Der Kampf ums kaspische Öl - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 11.09.02 10:55:32 von
neuester Beitrag 16.09.02 10:37:51 von
neuester Beitrag 16.09.02 10:37:51 von
Beiträge: 9
ID: 631.440
ID: 631.440
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 684
Gesamt: 684
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| vor 7 Minuten | 5773 | |
| heute 18:05 | 4380 | |
| vor 32 Minuten | 4002 | |
| heute 18:00 | 3089 | |
| vor 9 Minuten | 2381 | |
| vor 22 Minuten | 1929 | |
| vor 8 Minuten | 1839 | |
| vor 16 Minuten | 1463 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 17.674,38 | -0,44 | 191 | |||
| 2. | 2. | 147,77 | -1,44 | 98 | |||
| 3. | 7. | 6,6400 | -1,31 | 71 | |||
| 4. | 8. | 3,7750 | +0,94 | 67 | |||
| 5. | 5. | 0,1795 | -2,71 | 67 | |||
| 6. | 17. | 7,3000 | -0,07 | 47 | |||
| 7. | 4. | 2.395,40 | +0,67 | 42 | |||
| 8. | Neu! | 731,27 | -21,24 | 33 |
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-210272,00…
Der Kampf ums kaspische Öl
Pipelines, Bomben und Soldaten
Von Lutz C. Kleveman, Baku
Mit aller Macht wollen die Amerikaner ihre Abhängigkeit vom arabischen Öl drosseln und schieben dazu ein gefährliches Milliardenabenteuer an. Um an
die Ölreserven am kaspischen Meer heranzukommen unterstützen sie skrupellose Ölbosse und machthungrige Despoten. Eine Reportage-Serie über den
Kampf der Staaten und Konzerne um Pipeline-Routen und militärische Vorherrschaft.
Im "Finnegan`s" trifft sich, was man in Baku die "Ölmänner" nennt. Nicht die Bosse und Manager, die zieht es nach Feierabend eher ins
feine "Sunset Café" oder direkt heim in ihre Villen vor der Stadt. Das "Finnegan`s" in der Altstadt ist für die Jungs von den Bohrinseln. Die
sich, wenn sie Schichtpause an Land machen, nach einem Pub wie zuhause sehnen.
Hier wird ihnen geholfen: Aus den Boxen über dem Tresen kommt Rockmusik, man kann in Dollars bezahlen, und im Fernseher an der
Wand spielt Manchester United gegen Chelsea. Für ein paar Stunden können die Ölmänner den penetranten Petroleumgestank vergessen,
der Tag und Nacht die Hauptstadt der ex-sowjetischen Republik Aserbaidschan durchzieht.
"Ein wackeliger Flug war das - bin gespannt, wann die nächste Maschine ins Meer plumpst", sagt Thomas, als er an die Bar tritt. Der
Ölingenieur aus Westfalen arbeitet auf der Plattform Chirag, 80 Kilometer auf dem Kaspischen Meer gelegen, von wo ihn am Nachmittag
der Konzern-Helikopter von British Petroleum-Amoco in die Stadt gebracht hat. Ein schottischer Kollege klopft Thomas auf die Schulter und
schlägt eine Wette darauf vor, wessen Hubschrauber wohl als erster abstürzen werde. "Jeder setzt auf seinen eigenen Flug - dann hat man
wenigstens die Wette gewonnen, wenn es abwärts geht."
Trotz ihres schwarzen Humors ist die Stimmung der Ölmänner den gesamten Abend über ausgezeichnet. Nicht ohne Grund: Der Ölboom am
Kaspischen Meer, dem neuen Wilden Osten der Industrie des Schwarzen Goldes, hat seine kurze Flaute überwunden. Auf dem Grund des riesigen
Binnensees und an seinen Ufern bohren gleich mehrere transnationale Energiekonzerne nach den größten unerschlossenen Ölvorkommen der Welt
und bescheren ihren Arbeitern und Ingenieuren Spitzeneinkommen für viele Jahre.
Schätzungen über das verfügbare Volumen reichen von 50 bis 110 Milliarden Fass Erdöl und etwa sieben bis neun Billionen Kubikmeter Erdgas. Das
US-Energieministerium kalkuliert sogar mit 200 Milliarden Barrel Erdöl - nur Saudi Arabien besitzt mit nachgewiesenen 262 Milliarden Barrel mehr.
Erst im Sommer 2000 wurde vor der kasachischen Küste das Kashagan-Ölfeld entdeckt, das als eines der fünf größten der Welt gilt.
Der letzte Öl-Rausch in der Geschichte der Menschheit
Für westliche Ölfirmen, denen die verstaatlichten Produktionsstätten der Golfregion und das unsichere Russland wenig Chancen für Beteiligungen
bieten, ist der kaspische Boom ein Segen. Sie haben mit den zumeist ex-kommunistischen Potentaten der Region lukrative Verträge abgeschlossen
und 30 Milliarden Dollar in neue Förderanlagen gesteckt. Bis zum Jahr 2015 sind weitere Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar vorgesehen.
Zugleich hat aber der voraussichtlich letzte große Öl-Rausch in der Geschichte der Menschheit einen geopolitischen Kampf um den Kaukasus und
Zentralasien ausgelöst, wo seit dem Kollaps der Sowjetunion vor zehn Jahren ein Machtvakuum herrscht. Er gleicht dem "Great Game", der imperialen
Rivalität zwischen dem Britischen Weltreich und dem zaristischen Russland um das Herz der eurasischen Landmasse im 19. Jahrhundert, das der
britische Schriftsteller Rudyard Kipling einst so spannend beschrieb.
Nun ist ein neues "Großes Spiel" um die Territorien zwischen den Gebirgen des Kaukasus und des Pamir entbrannt
(siehe Karte). Mit dem Unterschied, dass nun die Amerikaner Gegenspieler der Russen sind. Außerdem mischen dieses Mal reiche Konzerne
und Regionalmächte kräftig mit - China, der Iran, die Türkei, Pakistan sowie Shell und BP.
Alle wollen die Kontrolle über die Energiereserven gewinnen, welche die Abhängigkeit vom Öl des mächtigen, arabisch dominierten
OPEC-Kartells aus der instabilen Golfregion mindern können. Zwar reichen die Ölreserven des kaspischen Meers entgegen ersten euphorischen
Erwartungen nicht an die Vorkommen des Persischen Golfs heran, die etwa 600 Milliarden Barrel, zwei Drittel der Vorräte der Erde, umfassen.
Mit einer Fördermenge von maximal sechs Millionen Barrel pro Tag könnte die kaspische Region einen Weltmarktanteil von lediglich fünf bis
acht Prozent erreichen, was ungefähr dem der Förderung aus dem Nordseegrund entspräche. Die Führerschaft des OPEC-Kartells wird also
unangefochten bleiben. Zudem gehen die außerhalb der Golfregion liegenden fossilen Reserven allmählich zur Neige. Bei der jährlich um fast
zwei Millionen Barrel steigenden Nachfrage nach Rohöl wird der Anteil der OPEC am Weltmarkt in den kommenden zwei Jahrzehnten weiter
wachsen.
Strategisches Ziel für Öl-Männer der Bush-Regierung
Aber gerade darin liegt die strategische Bedeutung der kaspischen Vorkommen. Denn um die Abhängigkeit vom arabischen Öl zu mildern, verfolgen die Regierungen der
Vereinigten Staaten die Politik, ihre "Energieversorgung zu diversifizieren", also Rohstoffquellen außerhalb der OPEC zu erschließen und zu sichern.
Die Kontrolle über das kaspische Erdöl ist eines der Schlüsselelemente dieser Strategie. "Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der eine Region so plötzlich strategisch
so wichtig geworden ist wie jetzt die kaspische Region", erklärte Dick Cheney, der damalige Chef des Petrologistik-Konzerns Halliburton, im Jahre 1998 in einer Rede vor
Öl-Industriellen in Washington.
Heute ist Cheney Vize-Präsident der Vereinigten Staaten und gilt als der einflussreichste Mann hinter George W. Bush, der selbst aus der texanischen Ölindustrie kommt.
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 und der amerikanische Feldzug in Afghanistan haben Zentralasien endgültig in den Brennpunkt der US-Außenpolitik gerückt.
Washington ist entschlossen, die geostrategischen Kräfteverhältnisse am Kaspischen Meer zu seinen Gunsten zu verändern.
Alle Spieler des neuen "Great Game" beschäftigt ein ernstes Problem: die Ölfelder der landumschlossenen kaspischen Region liegen Tausende Kilometer von
Hochseehäfen entfernt, von wo Tanker es zu den Märkten der industrialisierten Welt bringen könnten. Also müssen Pipelines gebaut werden. Und um deren Verlauf gibt es
im Kaukasus und in Zentralasien seit fast zehn Jahren Konflikte - und Kriege.
Russlands Regenten, nach Saudi-Arabien die zweitgrößten Erdölexporteure der Welt, sehen sich noch immer als Aufseher ihrer ehemaligen
kaukasischen und zentralasiatischen Kolonien. Trotz der Mitarbeit Präsident Vladimir Putins in der amerikanischen Anti-Terror-Koalition wollen
mächtige politische und wirtschaftliche Kreise in Moskau die USA auf Armlänge halten. Sie bestehen darauf, dass die Pipelines für das kaspische
Öl wie zu Sowjetzeiten über russisches Territorium nördlich des Kaukasus-Gebirges verlaufen, durch das kriegsgeschüttelte Tschetschenien zum
Schwarzmeer-Hafen Novorossijsk.
Die Vereinigten Staaten hingegen wollen den kostbaren Rohstoff russischem Zugriff entziehen, um die Unabhängigkeit der ehemaligen
Sowjetrepubliken von Moskau zu stärken. Eine südliche Route durch den von Mullahs regierten Iran, seit 20 Jahren Amerikas Erzfeind, kommt für
Washington ebenfalls nicht in Frage. Die Bush-Regierung, wie zuvor auch schon die Clinton-Administration, kämpft mit allen Mitteln für eine
Pipeline, die sowohl Russland als auch den Iran umgeht.
Seit Mitte der 1990er macht Washington daher Druck für ein gigantisches Pipeline-Projekt über 1750 Kilometer von der aserbaidschanischen
Hauptstadt Baku durch das Nachbarland Georgien zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Massiv unterstützt wird die kühne Idee von der
türkischen Regierung, die befürchtet, Tanker aus dem Schwarzen Meer könnten im engen Bosporus havarieren und Istanbul verseuchen. Mit 2,9
Milliarden Dollar Baukosten ist die Leitung allerdings extrem teuer und soll zudem durch politisch sehr instabile Gebiete verlaufen, zunächst wollte
darum kein Konzern das Risiko eingehen.
Doch beim Öl ist Politik mindestens so wichtig wie der Markt. Darum wird nun die Azerbaijan International Operating Company (AIOC), ein
internationales Konsortium aus einem Dutzend Ölkonzernen das Projekt in Angriff nehmen. An dessen Spitze steht die BP Amoco AG, mit
der Aserbaidschan Ende 1994 den sogenannten "Jahrhundert-Vertrag" zur Ausbeutung der kaspischen Ölquellen unterzeichnete. Und alle
Fäden für das kaspische Ölabenteuer laufen zusammen in der Villa Petrolea, der BP-Konzernzentrale in Baku, inmitten einer der
gespenstischsten Industrieödlandschaften der Erde.
Direkt am Ufer rosten hier hunderte Derricks, alte Ölfördertürme, inmitten riesiger Lachen aus schleimigem
Ölschlick und rosa glänzendem Wasser. Noch immer quälen sich einige Schwengel knirschend und rasselnd auf
und ab, wie nickende Esel aus Stahl, und saugen Rohöl aus dem Erdreich. So verseucht ist das Gelände, dass
auf mehreren Quadratkilometern nicht eine grüne Pflanze wächst, nicht ein einziger Grashalm.
Hier brach Ende des 19. Jahrhunderts der erste Ölboom Bakus los, als die Nobels und die Rothschilds in die
Stadt kamen und von hier aus der amerikanischen Standard Oil Company John Rockefellers das Weltmonopol streitig machten. Sie bauten die
erste Pipeline vom Kaspischen ans Schwarze Meer, mehr als die Hälfte allen Öls auf dem Weltmarkt kam vor 100 Jahren aus Baku. Aber auch
die russische Arbeiterbewegung hatte hier ihre Ursprünge, aufgestachelt von einem gewissen georgischen Agitator namens Josif Dschugaschwili,
der sich später Stalin nennen sollte. Nach der Oktoberrevolution 1917 vertrieb die Avantgarde des Proletariats die kapitalistischen Ölbarone und
verfeinerte deren Methoden, die Natur restlos zu verseuchen.
Auch die Villa Petrolea, von der aus BPAmoco heute die kaspischen Geschäfte leitet, war vor zehn Jahren noch ein Regierungsgebäude der
Kommunisten. Viele kleine Hämmer und Sicheln, liebevoll in Rot ausgemalt, prangen in der fein verzierten Stuckdecke der Eingangshalle. "Tja,
das ist die Ironie der Geschichte", lacht BP-Sprecherin Taman Bayatli, beim Empfang des Besuchers im dritten Stock des Gebäudes.
Hier arbeitet David Woodward, Vorsitzender von BPAmoco Aserbaidschan, nach Staatspräsident Heydar Alijew und dessen Sohn wohl der
mächtigste Mann in Baku. Er verwaltet rund 15 Milliarden Dollar, die der Ölkonzern in den kommenden Jahren vor der aserischen Küste
investieren will. So dominant ist BPAmocos wirtschaftliche Stellung in Aserbaidschan mittlerweile, dass kaum eine wichtige Entscheidung in
Sachen Öl ohne Woodwards Zustimmung fällt - und Öl ist in diesem Land fast alles. Ein BP-Sprecher hat es mal so ausgedrückt: "Wenn wir
aus Baku abzögen, würde das Land über Nacht zusammenbrechen."
Woodward, der großgewachsene BP-Veteran, in dessen Lebenslauf keine der klassischen Job-Stationen von Aberdeen bis Alaska fehlt, kommt
gleich zum Punkt: "Wir werden die Pipeline nach Ceyhan bauen, und wir werden sie mit Öl vollmachen. Sie wird rentabel sein, im Sommer geht
es los."
Nein, nicht der politische Druck aus Washington sei ausschlaggebend, die Entscheidung rein ökonomisch motiviert, beteuert Woodward. "Es
ist kein politisches Projekt. Wir sind keine wohltätige Organisation - wenn sich die Sache nicht rechnen würde, hätten wir Amerikanern und
Aseris gesagt: `Sorry, aber es geht nicht!`" Einmal fertig, soll die Röhre täglich bis zu eine Million Barrel Rohöl des Chirag-Felds transportieren.
Woodward räumt ein, dass eine Nord-Süd-Route durch den Iran kürzer, billiger und wahrscheinlich auch sicherer wäre als die Pipeline durch
das bürgerkriegsgeschüttelte Georgien. "Aber wir halten uns an amerikanische Sanktionen gegen den Iran, und außerdem will unser Gastgeber
Aserbaidschan nicht vom Iran abhängig sein - was wir respektieren müssen."
Die große Unbekannte Russland
Sogar der russische Widerstand gegen das Projekt wird offenbar geringer. Seit Jahren steht Moskau im Verdacht, absichtlich politisches Chaos und Bürgerkriege in
Aserbaidschan und im Transitland Georgien anzufachen, um Pipeline-Investoren abzuschrecken. Im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien Anfang der 1990er um
die Enklave Berg-Karabach, bei der Zehntausende starben und bis zu eine Million Aseris vertrieben wurden, unterstützte Moskau offen die Armenier.
Im vergangenen Oktober allerdings, auf dem Höhepunkt russisch-amerikanischer Detente im gemeinsamen "Krieg gegen den Terror", reiste
Woodward mit ein paar Kollegen nach Moskau und stellte das Baku-Ceyhan-Projekt erstmalig im dortigen Energieministerium vor. Noch ein
Jahr zuvor wäre dies undenkbar gewesen. "Der stellvertretende Minister war da und machte deutlich, dass russischen Firmen, die sich an
der Pipeline beteiligen wollen, keine Steine in den Weg gelegt würden."
So hat denn auch der russische Ölriese Lukoil, der als verlängerter Arm von Moskaus Außenpolitik betrachtet wird, Interesse signalisiert,
sich in das Projekt einzukaufen.
Ein hochrangiger russischer Diplomat in der Region dämpft allerdings zu hohe Erwartungen an Moskaus Kooperation: "Auch wenn Lukoil
sich an Baku-Ceyhan beteiligt, Russland ist und bleibt gegen Pipeline. Sie ist ein geopolitisches Projekt der Amerikaner, und wir werden
versuchen, es zu verhindern."
Der Weg zu US-Botschafter Ros Wilson in Baku, Washingtons wichtigstem Diplomaten in diesem Teil der Welt, führt durch eine
Metallschranke, die solange piept, bis man auch den letzten Kugelschreiber aus der Tasche gekramt hat. Woraufhin die
Sicherheitsbeamten, seit dem 11. September noch gewissenhafter als sonst, den Kugelschreiber in seine Einzelteile zerlegen - man kann ja nie wissen.
Botschafter Wilson, ein hochaufgeschossener, schlanker Mann aus Minnesota, hat seit dem Beginn des amerikanischen "Kriegs gegen den Terror" wohl ein paar mehr
Akten als sonst auf seinem Schreibtisch. Er scheint ganz froh zu sein, mal wieder über Öl, und nicht islamische Terroristen, reden zu können. Schon die ersten Sätze
verraten den geschliffenen Karriere-Diplomaten: "Wir sehen uns nicht in einem Großen Spiel mit Russland, schon gar nicht in einem Nullsummenspiel. Wir haben unsere
Interessen, die Russen haben ihre, aber sie müssen nicht unbedingt miteinander kollidieren." Das Gefühl einiger Russen, Amerika wolle sie aus der Region verdrängen, sei
grundlos.
Nach einigen Phrasen über Demokratie, Frieden und Kooperation, die so sorgsam getrimmt sind wie sein rötlicher Vollbart, wird Wilson deutlicher:
"Wir wollen sicherstellen, dass das kaspische Öl an die Märkte kommt." Die Aseris wüssten außerdem, dass nur die Pipeline nach Ceyhan das
Ticket zur wirklichen Unabhängigkeit sei. Schließlich sei der große Nachbar im Norden ein Hauptkonkurrent Aserbaidschans auf den Ölmärkten.
"Die Aseris versuchen natürlich, Amerika und Russland gegeneinander auszuspielen. Aber sie verstehen, dass nur die Vereinigten Staaten der
Garant für ihre Unabhängigkeit sind." Wie einen Beschluss verkündet Wilson dann: "Das Öl wird nie durch Russland gehen."
Der Kampf ums kaspische Öl
Pipelines, Bomben und Soldaten
Von Lutz C. Kleveman, Baku
Mit aller Macht wollen die Amerikaner ihre Abhängigkeit vom arabischen Öl drosseln und schieben dazu ein gefährliches Milliardenabenteuer an. Um an
die Ölreserven am kaspischen Meer heranzukommen unterstützen sie skrupellose Ölbosse und machthungrige Despoten. Eine Reportage-Serie über den
Kampf der Staaten und Konzerne um Pipeline-Routen und militärische Vorherrschaft.
Im "Finnegan`s" trifft sich, was man in Baku die "Ölmänner" nennt. Nicht die Bosse und Manager, die zieht es nach Feierabend eher ins
feine "Sunset Café" oder direkt heim in ihre Villen vor der Stadt. Das "Finnegan`s" in der Altstadt ist für die Jungs von den Bohrinseln. Die
sich, wenn sie Schichtpause an Land machen, nach einem Pub wie zuhause sehnen.
Hier wird ihnen geholfen: Aus den Boxen über dem Tresen kommt Rockmusik, man kann in Dollars bezahlen, und im Fernseher an der
Wand spielt Manchester United gegen Chelsea. Für ein paar Stunden können die Ölmänner den penetranten Petroleumgestank vergessen,
der Tag und Nacht die Hauptstadt der ex-sowjetischen Republik Aserbaidschan durchzieht.
"Ein wackeliger Flug war das - bin gespannt, wann die nächste Maschine ins Meer plumpst", sagt Thomas, als er an die Bar tritt. Der
Ölingenieur aus Westfalen arbeitet auf der Plattform Chirag, 80 Kilometer auf dem Kaspischen Meer gelegen, von wo ihn am Nachmittag
der Konzern-Helikopter von British Petroleum-Amoco in die Stadt gebracht hat. Ein schottischer Kollege klopft Thomas auf die Schulter und
schlägt eine Wette darauf vor, wessen Hubschrauber wohl als erster abstürzen werde. "Jeder setzt auf seinen eigenen Flug - dann hat man
wenigstens die Wette gewonnen, wenn es abwärts geht."
Trotz ihres schwarzen Humors ist die Stimmung der Ölmänner den gesamten Abend über ausgezeichnet. Nicht ohne Grund: Der Ölboom am
Kaspischen Meer, dem neuen Wilden Osten der Industrie des Schwarzen Goldes, hat seine kurze Flaute überwunden. Auf dem Grund des riesigen
Binnensees und an seinen Ufern bohren gleich mehrere transnationale Energiekonzerne nach den größten unerschlossenen Ölvorkommen der Welt
und bescheren ihren Arbeitern und Ingenieuren Spitzeneinkommen für viele Jahre.
Schätzungen über das verfügbare Volumen reichen von 50 bis 110 Milliarden Fass Erdöl und etwa sieben bis neun Billionen Kubikmeter Erdgas. Das
US-Energieministerium kalkuliert sogar mit 200 Milliarden Barrel Erdöl - nur Saudi Arabien besitzt mit nachgewiesenen 262 Milliarden Barrel mehr.
Erst im Sommer 2000 wurde vor der kasachischen Küste das Kashagan-Ölfeld entdeckt, das als eines der fünf größten der Welt gilt.
Der letzte Öl-Rausch in der Geschichte der Menschheit
Für westliche Ölfirmen, denen die verstaatlichten Produktionsstätten der Golfregion und das unsichere Russland wenig Chancen für Beteiligungen
bieten, ist der kaspische Boom ein Segen. Sie haben mit den zumeist ex-kommunistischen Potentaten der Region lukrative Verträge abgeschlossen
und 30 Milliarden Dollar in neue Förderanlagen gesteckt. Bis zum Jahr 2015 sind weitere Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar vorgesehen.
Zugleich hat aber der voraussichtlich letzte große Öl-Rausch in der Geschichte der Menschheit einen geopolitischen Kampf um den Kaukasus und
Zentralasien ausgelöst, wo seit dem Kollaps der Sowjetunion vor zehn Jahren ein Machtvakuum herrscht. Er gleicht dem "Great Game", der imperialen
Rivalität zwischen dem Britischen Weltreich und dem zaristischen Russland um das Herz der eurasischen Landmasse im 19. Jahrhundert, das der
britische Schriftsteller Rudyard Kipling einst so spannend beschrieb.
Nun ist ein neues "Großes Spiel" um die Territorien zwischen den Gebirgen des Kaukasus und des Pamir entbrannt
(siehe Karte). Mit dem Unterschied, dass nun die Amerikaner Gegenspieler der Russen sind. Außerdem mischen dieses Mal reiche Konzerne
und Regionalmächte kräftig mit - China, der Iran, die Türkei, Pakistan sowie Shell und BP.
Alle wollen die Kontrolle über die Energiereserven gewinnen, welche die Abhängigkeit vom Öl des mächtigen, arabisch dominierten
OPEC-Kartells aus der instabilen Golfregion mindern können. Zwar reichen die Ölreserven des kaspischen Meers entgegen ersten euphorischen
Erwartungen nicht an die Vorkommen des Persischen Golfs heran, die etwa 600 Milliarden Barrel, zwei Drittel der Vorräte der Erde, umfassen.
Mit einer Fördermenge von maximal sechs Millionen Barrel pro Tag könnte die kaspische Region einen Weltmarktanteil von lediglich fünf bis
acht Prozent erreichen, was ungefähr dem der Förderung aus dem Nordseegrund entspräche. Die Führerschaft des OPEC-Kartells wird also
unangefochten bleiben. Zudem gehen die außerhalb der Golfregion liegenden fossilen Reserven allmählich zur Neige. Bei der jährlich um fast
zwei Millionen Barrel steigenden Nachfrage nach Rohöl wird der Anteil der OPEC am Weltmarkt in den kommenden zwei Jahrzehnten weiter
wachsen.
Strategisches Ziel für Öl-Männer der Bush-Regierung
Aber gerade darin liegt die strategische Bedeutung der kaspischen Vorkommen. Denn um die Abhängigkeit vom arabischen Öl zu mildern, verfolgen die Regierungen der
Vereinigten Staaten die Politik, ihre "Energieversorgung zu diversifizieren", also Rohstoffquellen außerhalb der OPEC zu erschließen und zu sichern.
Die Kontrolle über das kaspische Erdöl ist eines der Schlüsselelemente dieser Strategie. "Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der eine Region so plötzlich strategisch
so wichtig geworden ist wie jetzt die kaspische Region", erklärte Dick Cheney, der damalige Chef des Petrologistik-Konzerns Halliburton, im Jahre 1998 in einer Rede vor
Öl-Industriellen in Washington.
Heute ist Cheney Vize-Präsident der Vereinigten Staaten und gilt als der einflussreichste Mann hinter George W. Bush, der selbst aus der texanischen Ölindustrie kommt.
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 und der amerikanische Feldzug in Afghanistan haben Zentralasien endgültig in den Brennpunkt der US-Außenpolitik gerückt.
Washington ist entschlossen, die geostrategischen Kräfteverhältnisse am Kaspischen Meer zu seinen Gunsten zu verändern.
Alle Spieler des neuen "Great Game" beschäftigt ein ernstes Problem: die Ölfelder der landumschlossenen kaspischen Region liegen Tausende Kilometer von
Hochseehäfen entfernt, von wo Tanker es zu den Märkten der industrialisierten Welt bringen könnten. Also müssen Pipelines gebaut werden. Und um deren Verlauf gibt es
im Kaukasus und in Zentralasien seit fast zehn Jahren Konflikte - und Kriege.
Russlands Regenten, nach Saudi-Arabien die zweitgrößten Erdölexporteure der Welt, sehen sich noch immer als Aufseher ihrer ehemaligen
kaukasischen und zentralasiatischen Kolonien. Trotz der Mitarbeit Präsident Vladimir Putins in der amerikanischen Anti-Terror-Koalition wollen
mächtige politische und wirtschaftliche Kreise in Moskau die USA auf Armlänge halten. Sie bestehen darauf, dass die Pipelines für das kaspische
Öl wie zu Sowjetzeiten über russisches Territorium nördlich des Kaukasus-Gebirges verlaufen, durch das kriegsgeschüttelte Tschetschenien zum
Schwarzmeer-Hafen Novorossijsk.
Die Vereinigten Staaten hingegen wollen den kostbaren Rohstoff russischem Zugriff entziehen, um die Unabhängigkeit der ehemaligen
Sowjetrepubliken von Moskau zu stärken. Eine südliche Route durch den von Mullahs regierten Iran, seit 20 Jahren Amerikas Erzfeind, kommt für
Washington ebenfalls nicht in Frage. Die Bush-Regierung, wie zuvor auch schon die Clinton-Administration, kämpft mit allen Mitteln für eine
Pipeline, die sowohl Russland als auch den Iran umgeht.
Seit Mitte der 1990er macht Washington daher Druck für ein gigantisches Pipeline-Projekt über 1750 Kilometer von der aserbaidschanischen
Hauptstadt Baku durch das Nachbarland Georgien zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Massiv unterstützt wird die kühne Idee von der
türkischen Regierung, die befürchtet, Tanker aus dem Schwarzen Meer könnten im engen Bosporus havarieren und Istanbul verseuchen. Mit 2,9
Milliarden Dollar Baukosten ist die Leitung allerdings extrem teuer und soll zudem durch politisch sehr instabile Gebiete verlaufen, zunächst wollte
darum kein Konzern das Risiko eingehen.
Doch beim Öl ist Politik mindestens so wichtig wie der Markt. Darum wird nun die Azerbaijan International Operating Company (AIOC), ein
internationales Konsortium aus einem Dutzend Ölkonzernen das Projekt in Angriff nehmen. An dessen Spitze steht die BP Amoco AG, mit
der Aserbaidschan Ende 1994 den sogenannten "Jahrhundert-Vertrag" zur Ausbeutung der kaspischen Ölquellen unterzeichnete. Und alle
Fäden für das kaspische Ölabenteuer laufen zusammen in der Villa Petrolea, der BP-Konzernzentrale in Baku, inmitten einer der
gespenstischsten Industrieödlandschaften der Erde.
Direkt am Ufer rosten hier hunderte Derricks, alte Ölfördertürme, inmitten riesiger Lachen aus schleimigem
Ölschlick und rosa glänzendem Wasser. Noch immer quälen sich einige Schwengel knirschend und rasselnd auf
und ab, wie nickende Esel aus Stahl, und saugen Rohöl aus dem Erdreich. So verseucht ist das Gelände, dass
auf mehreren Quadratkilometern nicht eine grüne Pflanze wächst, nicht ein einziger Grashalm.
Hier brach Ende des 19. Jahrhunderts der erste Ölboom Bakus los, als die Nobels und die Rothschilds in die
Stadt kamen und von hier aus der amerikanischen Standard Oil Company John Rockefellers das Weltmonopol streitig machten. Sie bauten die
erste Pipeline vom Kaspischen ans Schwarze Meer, mehr als die Hälfte allen Öls auf dem Weltmarkt kam vor 100 Jahren aus Baku. Aber auch
die russische Arbeiterbewegung hatte hier ihre Ursprünge, aufgestachelt von einem gewissen georgischen Agitator namens Josif Dschugaschwili,
der sich später Stalin nennen sollte. Nach der Oktoberrevolution 1917 vertrieb die Avantgarde des Proletariats die kapitalistischen Ölbarone und
verfeinerte deren Methoden, die Natur restlos zu verseuchen.
Auch die Villa Petrolea, von der aus BPAmoco heute die kaspischen Geschäfte leitet, war vor zehn Jahren noch ein Regierungsgebäude der
Kommunisten. Viele kleine Hämmer und Sicheln, liebevoll in Rot ausgemalt, prangen in der fein verzierten Stuckdecke der Eingangshalle. "Tja,
das ist die Ironie der Geschichte", lacht BP-Sprecherin Taman Bayatli, beim Empfang des Besuchers im dritten Stock des Gebäudes.
Hier arbeitet David Woodward, Vorsitzender von BPAmoco Aserbaidschan, nach Staatspräsident Heydar Alijew und dessen Sohn wohl der
mächtigste Mann in Baku. Er verwaltet rund 15 Milliarden Dollar, die der Ölkonzern in den kommenden Jahren vor der aserischen Küste
investieren will. So dominant ist BPAmocos wirtschaftliche Stellung in Aserbaidschan mittlerweile, dass kaum eine wichtige Entscheidung in
Sachen Öl ohne Woodwards Zustimmung fällt - und Öl ist in diesem Land fast alles. Ein BP-Sprecher hat es mal so ausgedrückt: "Wenn wir
aus Baku abzögen, würde das Land über Nacht zusammenbrechen."
Woodward, der großgewachsene BP-Veteran, in dessen Lebenslauf keine der klassischen Job-Stationen von Aberdeen bis Alaska fehlt, kommt
gleich zum Punkt: "Wir werden die Pipeline nach Ceyhan bauen, und wir werden sie mit Öl vollmachen. Sie wird rentabel sein, im Sommer geht
es los."
Nein, nicht der politische Druck aus Washington sei ausschlaggebend, die Entscheidung rein ökonomisch motiviert, beteuert Woodward. "Es
ist kein politisches Projekt. Wir sind keine wohltätige Organisation - wenn sich die Sache nicht rechnen würde, hätten wir Amerikanern und
Aseris gesagt: `Sorry, aber es geht nicht!`" Einmal fertig, soll die Röhre täglich bis zu eine Million Barrel Rohöl des Chirag-Felds transportieren.
Woodward räumt ein, dass eine Nord-Süd-Route durch den Iran kürzer, billiger und wahrscheinlich auch sicherer wäre als die Pipeline durch
das bürgerkriegsgeschüttelte Georgien. "Aber wir halten uns an amerikanische Sanktionen gegen den Iran, und außerdem will unser Gastgeber
Aserbaidschan nicht vom Iran abhängig sein - was wir respektieren müssen."
Die große Unbekannte Russland
Sogar der russische Widerstand gegen das Projekt wird offenbar geringer. Seit Jahren steht Moskau im Verdacht, absichtlich politisches Chaos und Bürgerkriege in
Aserbaidschan und im Transitland Georgien anzufachen, um Pipeline-Investoren abzuschrecken. Im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien Anfang der 1990er um
die Enklave Berg-Karabach, bei der Zehntausende starben und bis zu eine Million Aseris vertrieben wurden, unterstützte Moskau offen die Armenier.
Im vergangenen Oktober allerdings, auf dem Höhepunkt russisch-amerikanischer Detente im gemeinsamen "Krieg gegen den Terror", reiste
Woodward mit ein paar Kollegen nach Moskau und stellte das Baku-Ceyhan-Projekt erstmalig im dortigen Energieministerium vor. Noch ein
Jahr zuvor wäre dies undenkbar gewesen. "Der stellvertretende Minister war da und machte deutlich, dass russischen Firmen, die sich an
der Pipeline beteiligen wollen, keine Steine in den Weg gelegt würden."
So hat denn auch der russische Ölriese Lukoil, der als verlängerter Arm von Moskaus Außenpolitik betrachtet wird, Interesse signalisiert,
sich in das Projekt einzukaufen.
Ein hochrangiger russischer Diplomat in der Region dämpft allerdings zu hohe Erwartungen an Moskaus Kooperation: "Auch wenn Lukoil
sich an Baku-Ceyhan beteiligt, Russland ist und bleibt gegen Pipeline. Sie ist ein geopolitisches Projekt der Amerikaner, und wir werden
versuchen, es zu verhindern."
Der Weg zu US-Botschafter Ros Wilson in Baku, Washingtons wichtigstem Diplomaten in diesem Teil der Welt, führt durch eine
Metallschranke, die solange piept, bis man auch den letzten Kugelschreiber aus der Tasche gekramt hat. Woraufhin die
Sicherheitsbeamten, seit dem 11. September noch gewissenhafter als sonst, den Kugelschreiber in seine Einzelteile zerlegen - man kann ja nie wissen.
Botschafter Wilson, ein hochaufgeschossener, schlanker Mann aus Minnesota, hat seit dem Beginn des amerikanischen "Kriegs gegen den Terror" wohl ein paar mehr
Akten als sonst auf seinem Schreibtisch. Er scheint ganz froh zu sein, mal wieder über Öl, und nicht islamische Terroristen, reden zu können. Schon die ersten Sätze
verraten den geschliffenen Karriere-Diplomaten: "Wir sehen uns nicht in einem Großen Spiel mit Russland, schon gar nicht in einem Nullsummenspiel. Wir haben unsere
Interessen, die Russen haben ihre, aber sie müssen nicht unbedingt miteinander kollidieren." Das Gefühl einiger Russen, Amerika wolle sie aus der Region verdrängen, sei
grundlos.
Nach einigen Phrasen über Demokratie, Frieden und Kooperation, die so sorgsam getrimmt sind wie sein rötlicher Vollbart, wird Wilson deutlicher:
"Wir wollen sicherstellen, dass das kaspische Öl an die Märkte kommt." Die Aseris wüssten außerdem, dass nur die Pipeline nach Ceyhan das
Ticket zur wirklichen Unabhängigkeit sei. Schließlich sei der große Nachbar im Norden ein Hauptkonkurrent Aserbaidschans auf den Ölmärkten.
"Die Aseris versuchen natürlich, Amerika und Russland gegeneinander auszuspielen. Aber sie verstehen, dass nur die Vereinigten Staaten der
Garant für ihre Unabhängigkeit sind." Wie einen Beschluss verkündet Wilson dann: "Das Öl wird nie durch Russland gehen."
Das gleiche Spiel wie in Afghanistan. Die Amis machen immer so weiter.
Mahlzeit
Mahlzeit
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-210717,00…
Der Kampf ums kaspische Öl (2)
Wem gehört das Kaspische Meer?
Von Lutz C. Kleveman, Turkmenbaschi
Kampfjets fliegen Einsätze gegen Forschungsschiffe, Regierungen streiten über die Frage, ob ein Meer ein See sein kann, und die Anrainerstaaten sperren
ihre Häfen für die Schiffe der Nachbarn. Der Streit um die Claims am Grund des Kaspischen Meers treibt skurrile Blüten und birgt riskante Konflikte.
Pechschwarzer Qualm quillt aus den zwei Schornsteinen der "Professor Gül", als der Kapitän die Maschinen hochfahren lässt. Mit fast einer Woche
Verspätung startet der alte Dampfer aus dem Hafen von Baku, denn die Stadt hatte der persischen Bedeutung ihres Namens ("windige Stadt") alle
Ehre gemacht: Drei Tage lang fegte ein Sturm übers Meer und zwang alle Schiffe in den Hafen. Der rostige Pott, gut 150 Meter lang, nimmt eigentlich
nur Lkw und Bahnwaggons in seinem Bauch auf, aber mit knapp 50 Dollar ist man als ausländischer Passagier dabei. Dafür gibt es zwar nur einen
zerschlissenen Sessel, doch gegen eine nette, raschelnde Geste weist die dicke Babuschka auf dem Oberdeck dem Passagier auch eine Kabine zu.
Auf dem langen Gang ist es still, sehr still - für die Schiffspassage gibt es nur wenige Kunden.
Die Route von Baku bis in die turkmenische Hafenstadt Turkmenbaschi führt dicht an den meisten Bohrinseln der internationalen Petroleumkonzerne
vorbei, die entlang einer Kette von kaspischen Öl- und Gasfeldern liegen. Noch immer weiß niemand sicher, welchem Staat dieser Reichtum zusteht.
Bis heute haben sich die fünf kaspischen Anrainerstaaten - Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Iran und Aserbaidschan - nicht auf eine territoriale
Aufteilung des Gewässers einigen können. Aserbaidschan liegt gleichzeitig mit Turkmenistan und mit Iran in einem erbitterten Grenzstreit, der einmal
bereits fast in einen bewaffneten Konflikt umgeschlagen wäre.
Mitte Juli vergangenes Jahres brach ein Forschungsschiff von BP Amoco unter aserbaidschanischer Flagge von Baku aus
in den südlichen Teil des Kaspischen Meers auf, um Probebohrungen in einem vermuteten Ölfeld zu unternehmen. An Bord
waren vor allem Geologen und Ingenieure. Um die Mittagszeit des 23. Juli donnerten plötzlich zwei Kampfjets der
iranischen Luftwaffe über ihre Köpfe hinweg und kreisten zwei Stunden über dem Schiff. Dann tauchte ein iranisches Kanonenboot auf. Über
Funk forderte der Kapitän die Besatzung des BP-Schiffs auf, unverzüglich alle Bohrungen einzustellen und iranische Hoheitsgewässer zu
verlassen.
"Szenario für einen Dritten Weltkrieg"
Das Forschungsschiff drehte bei. "Unsere Leute waren weit mehr als hundert Seemeilen von der iranischen Küste entfernt", sagte BP-Sprecher
Steve Lawrence später. "Aber die Iraner waren bewaffnet, da war nichts zu machen." Die aserbaidschanische Regierung und amerikanische
Diplomaten protestierten heftig, und Washington lieferte der Küstenwache seines Verbündeten zwei neue Patrouillenboote. Das iranische
Außenministerium rechtfertigte das Eingreifen damit, dass sich das BP-Schiff in Gewässern befunden habe, die nach Teherans Auffassung dem
Iran gehören. "Wir mussten zu militärischen Mitteln greifen, alle unseren diplomatischen Noten zuvor haben die Aserbaidschaner doch einfach
ignoriert", sagte ein iranischer Regierungsbeamter. "Jetzt haben sie begriffen, dass es uns ernst ist."
Der Streit geht um eine an sich sehr simple Frage: Ist das Kaspische Meer ein Meer, oder ist es ein See? Dieses Thema würde
normalerweise höchstens Rechtsgelehrte beschäftigen - ginge es hierbei nicht um Milliarden Tonnen Öl. Wie sie aufgeteilt werden, das
hängt von der Definition des mit 386.400 Quadratkilometern Fläche größten Binnengewässers der Welt ab. Dabei verhält es sich genau
andersherum als gemeinhin angenommen: Betrachtet man das Kaspische Meer als Meer, dann würden die Anrainer lediglich einige
Seemeilen vor ihrer Küste kontrollieren. Die große Mitte des Meeres hingegen wäre internationales Gewässer, dessen Schifffahrtswege,
Fischschwärme und Bodenschätze von allen Beteiligten gemeinsam genutzt werden könnten. Sie müssten sich darauf einigen, wie die
Ölquellen ausgebeutet und die Profite geteilt werden.
Ist das Kaspische Meer hingegen ein See, wird der gesamte Grund unter den Anrainern aufgeteilt, wie ein Kuchen. Die meisten
Rechtsexperten legen die internationale Konvention des Seerechts so aus, dass das Kaspische Meer das ist, was der Name sagt: ein
Meer. Der Duden kennt allerdings neben der Bezeichnung "Kaspisches Meer, das" auch den Namen "Kaspisee, der", was darauf hinweist,
dass auch die Frage nach dem eigentlichen Namen des Gewässers strittig ist.
Eine vertrackte Situation, die das sonst eher nüchterne britische Magazin "Economist" mit einem "Szenario für einen Dritten Weltkrieg" verglich: Während die vier ehemals
sowjetischen Republiken den Grund des Meeres und die dort liegenden Bodenschätze in fünf ungleiche Sektoren unterteilen wollen, die dem Küstenanteil eines jeden
Landes entsprechen, besteht der Iran auf zwanzig Prozent der Fläche, vom Grund bis zur Wasseroberfläche. An der so entstehenden neuen Grenze auf dem Wasser
patrouillieren iranische Marineboote schon heute. Teheran beruft sich auf alte Verträge mit der Sowjetunion aus den Jahren 1921 und 1940, die festschrieben, dass beide
Länder das Gewässer unbegrenzt nutzen konnten. Dahinter steht der Verdacht der Mullah-Regierung, dass die Vereinigten Staaten die Arbeit amerikanischer Ölfirmen zum
Vorwand für eine militärische Präsenz nehmen könnten. Damit lägen Schiffe der US-Marine nicht mehr nur im Persischen Golf vor iranischen Küsten.
Als wäre dies nicht Konfliktstoff genug, sind sich auch Aserbaidschan und Turkmenistan über die Zuteilung der Ölvorkommen uneins. Ginge es nach den Turkmenen, würde
eine strikt vertikale Grenze durch das Meer gezogen und mindestens die Hälfte aller jetzt von Aserbaidschan beanspruchten Bodenschätze gehörten dem Nachbarstaat im
Osten.
Die "Professor Gül" passiert jedoch unbehelligt die Konfliktgrenze. Backbord tauchen vorne die verrottenden Bohrtürme der Sandinsel auf,
eine der größten Off-Shore-Produktionsstätten des staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzerns Socar. Von der Insel ragt sie ins offene
Meer: ein gigantisches Geflecht aus auf Holzpfählen gebauten Pipelines, Pumpstationen, Bohrtürmen und etwa zwölf Kilometern
Verbindungsstraßen. "Die Bauten sind sehr alt, man muss vorsichtig sein, wo man hintritt", warnte Generaldirektor Vagif Guseinow bei
einem Reporterbesuch Wochen zuvor. Vorsicht ist auf der Sandinsel tatsächlich angebracht, denn die Anlage aus dem Jahre 1952, damals
ein Juwel sowjetischer Ingenieurskunst, ist inzwischen hoffnungslos verrottet.
Pipelines und Ölreservoirs rosten vor sich hin, die windschiefen Bohrtürme aus Holz und Stahl erinnern an Bilder der ersten Ölquellen im
Pennsylvania des 19. Jahrhunderts. "Westliche Investoren haben sich bis jetzt noch nicht für die Sandinsel interessiert", kommentiert
Guseinow trocken. Auf 150.000 Tonnen im Jahr sei die Produktion gesunken, ein Bruchteil der einstigen Fördermenge. Dennoch arbeiteten
noch immer 1600 Menschen auf der Sandinsel. "Wir werden die Anlage nie dichtmachen, auch wenn alle Quellen erschöpft sind. Die
Menschen brauchen doch Arbeit."
Die größte Bohrinsel der Welt
Gegen Mitternacht, als die sich mühsam vorwärts kämpfende "Professor Gül" bereits auf hoher See ist, werden Wind und Wellen wieder mächtiger. Backbord liegt jetzt das
riesige Ölfeld Chirag. Die Blase, mit geschätzten fünf bis sieben Milliarden Barrel Inhalt, riss sich der BP-Konzern Mitte der neunziger Jahre unter den Nagel. Eine gewaltige
Flamme, gespeist aus abgefackeltem Gas, ist bereits seit zwei Stunden zu sehen, aus bestimmt mehr als 30 Seemeilen Entfernung. Rote Wolken zaubert das Feuer an
den Himmel und schillernde Kämme auf die Wellen bis vor den Schiffsbug - so muss in der Antike der Leuchtturm von Alexandria gewirkt haben.
Doch es ist nicht der einzige helle Schein auf dem Meer: Westlich von Chirag zittern in der Ferne die Lichter von Neft Dashlarin (Ölige Felsen), die größte off-shore
Bohrinsel der Welt. Anders als die kleinere Sandinsel, ist sie eine richtige Stadt auf Stelzen, von sowjetischen Ingenieure 1949 über dem Wasser errichtet. Mehr als
einhundert Kilometer Straßen verbinden zahllose Bohrtürme, für die Tausenden Arbeiter gibt es Wohnblocks, ein Kino und Bars. Als ein Wunderwerk sozialistischer
Ingenieurskunst galt Neft Dashlari damals weltweit, der Stolz eines Landes, das wenige Jahre zuvor den Marsch der Armeen Adolf Hitlers auf die kaspischen Ölquellen
gestoppt hatte. Heute, fünfzig Jahre später, verfallen die hoffnungslos veralteten Anlagen wie die der Sandinsel. Immer wieder kommen Arbeiter bei Unfällen ums Leben.
Einer, der die gesamten fünfziger Jahre auf den Öligen Felsen verbracht hat, ist Hokhsbat Yusifzadeh, heute mächtiger Vizepräsident von Socar, dem
staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzern. "Wir waren Pioniere damals, und das Öl floss in rauen Mengen - es war eine großartige Zeit", schwärmt
der heute 72-jährige Grandseigneur. "Vergessen Sie nicht, es arbeiteten auch viele Frauen auf Neft Dashlari, und die Abende waren lang auf dem
Meer." In den siebziger Jahren wurde Yusifzadeh Chefgeologe für die gesamte kaspische Region und entdeckte viele der Ölfelder, um die die
Anrainerstaaten und Konzerne heute rangeln.
Dass der Iran nun die Früchte seiner Arbeit ernten möchte, ärgert den Aserbaidschaner: "Gäbe es die mächtige Sowjetunion noch, würden sie nicht
wagen, unsere Ölfelder im Süden zu beanspruchen. Damals hat es die Iraner ja gar nicht gestört, wenn ich dort gebohrt habe."
Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, kommt die turkmenische Küste in Sicht. Plötzlich ist ein lautes Kettenrasseln zu hören - die
"Professor Gül" wirft Anker. "Wir werden hier gewiss noch bis morgen früh liegen müssen", sagt Bootsmaat Avaz gelassen. "So sind sie, die
Turkemenen. Ihr Präsident ist sauer auf unseren Präsidenten, weil Aserbaidschan alle guten Ölfelder abgegriffen hat, darum lassen sie uns nicht in
den Hafen."
Erst 23 Stunden später legt das Schiff endlich im Hafen von Turkmenbaschi an, und auf dem Kai tauchen mehrere uniformierte Männer auf, im Licht
der Scheinwerfern nur als gesichtslose Silhouetten mit Pistolen am Gürtel erkennbar - turkmenische Grenzpolizisten. Nach weiteren anderthalb
Stunden schließlich, nachdem die Beamten die Ladung peinlich genau inspiziert haben, darf der einzige Passagier aus Baku seinen Pass vorzeigen
und von Bord gehen.
Der Kampf ums kaspische Öl (2)
Wem gehört das Kaspische Meer?
Von Lutz C. Kleveman, Turkmenbaschi
Kampfjets fliegen Einsätze gegen Forschungsschiffe, Regierungen streiten über die Frage, ob ein Meer ein See sein kann, und die Anrainerstaaten sperren
ihre Häfen für die Schiffe der Nachbarn. Der Streit um die Claims am Grund des Kaspischen Meers treibt skurrile Blüten und birgt riskante Konflikte.
Pechschwarzer Qualm quillt aus den zwei Schornsteinen der "Professor Gül", als der Kapitän die Maschinen hochfahren lässt. Mit fast einer Woche
Verspätung startet der alte Dampfer aus dem Hafen von Baku, denn die Stadt hatte der persischen Bedeutung ihres Namens ("windige Stadt") alle
Ehre gemacht: Drei Tage lang fegte ein Sturm übers Meer und zwang alle Schiffe in den Hafen. Der rostige Pott, gut 150 Meter lang, nimmt eigentlich
nur Lkw und Bahnwaggons in seinem Bauch auf, aber mit knapp 50 Dollar ist man als ausländischer Passagier dabei. Dafür gibt es zwar nur einen
zerschlissenen Sessel, doch gegen eine nette, raschelnde Geste weist die dicke Babuschka auf dem Oberdeck dem Passagier auch eine Kabine zu.
Auf dem langen Gang ist es still, sehr still - für die Schiffspassage gibt es nur wenige Kunden.
Die Route von Baku bis in die turkmenische Hafenstadt Turkmenbaschi führt dicht an den meisten Bohrinseln der internationalen Petroleumkonzerne
vorbei, die entlang einer Kette von kaspischen Öl- und Gasfeldern liegen. Noch immer weiß niemand sicher, welchem Staat dieser Reichtum zusteht.
Bis heute haben sich die fünf kaspischen Anrainerstaaten - Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Iran und Aserbaidschan - nicht auf eine territoriale
Aufteilung des Gewässers einigen können. Aserbaidschan liegt gleichzeitig mit Turkmenistan und mit Iran in einem erbitterten Grenzstreit, der einmal
bereits fast in einen bewaffneten Konflikt umgeschlagen wäre.
Mitte Juli vergangenes Jahres brach ein Forschungsschiff von BP Amoco unter aserbaidschanischer Flagge von Baku aus
in den südlichen Teil des Kaspischen Meers auf, um Probebohrungen in einem vermuteten Ölfeld zu unternehmen. An Bord
waren vor allem Geologen und Ingenieure. Um die Mittagszeit des 23. Juli donnerten plötzlich zwei Kampfjets der
iranischen Luftwaffe über ihre Köpfe hinweg und kreisten zwei Stunden über dem Schiff. Dann tauchte ein iranisches Kanonenboot auf. Über
Funk forderte der Kapitän die Besatzung des BP-Schiffs auf, unverzüglich alle Bohrungen einzustellen und iranische Hoheitsgewässer zu
verlassen.
"Szenario für einen Dritten Weltkrieg"
Das Forschungsschiff drehte bei. "Unsere Leute waren weit mehr als hundert Seemeilen von der iranischen Küste entfernt", sagte BP-Sprecher
Steve Lawrence später. "Aber die Iraner waren bewaffnet, da war nichts zu machen." Die aserbaidschanische Regierung und amerikanische
Diplomaten protestierten heftig, und Washington lieferte der Küstenwache seines Verbündeten zwei neue Patrouillenboote. Das iranische
Außenministerium rechtfertigte das Eingreifen damit, dass sich das BP-Schiff in Gewässern befunden habe, die nach Teherans Auffassung dem
Iran gehören. "Wir mussten zu militärischen Mitteln greifen, alle unseren diplomatischen Noten zuvor haben die Aserbaidschaner doch einfach
ignoriert", sagte ein iranischer Regierungsbeamter. "Jetzt haben sie begriffen, dass es uns ernst ist."
Der Streit geht um eine an sich sehr simple Frage: Ist das Kaspische Meer ein Meer, oder ist es ein See? Dieses Thema würde
normalerweise höchstens Rechtsgelehrte beschäftigen - ginge es hierbei nicht um Milliarden Tonnen Öl. Wie sie aufgeteilt werden, das
hängt von der Definition des mit 386.400 Quadratkilometern Fläche größten Binnengewässers der Welt ab. Dabei verhält es sich genau
andersherum als gemeinhin angenommen: Betrachtet man das Kaspische Meer als Meer, dann würden die Anrainer lediglich einige
Seemeilen vor ihrer Küste kontrollieren. Die große Mitte des Meeres hingegen wäre internationales Gewässer, dessen Schifffahrtswege,
Fischschwärme und Bodenschätze von allen Beteiligten gemeinsam genutzt werden könnten. Sie müssten sich darauf einigen, wie die
Ölquellen ausgebeutet und die Profite geteilt werden.
Ist das Kaspische Meer hingegen ein See, wird der gesamte Grund unter den Anrainern aufgeteilt, wie ein Kuchen. Die meisten
Rechtsexperten legen die internationale Konvention des Seerechts so aus, dass das Kaspische Meer das ist, was der Name sagt: ein
Meer. Der Duden kennt allerdings neben der Bezeichnung "Kaspisches Meer, das" auch den Namen "Kaspisee, der", was darauf hinweist,
dass auch die Frage nach dem eigentlichen Namen des Gewässers strittig ist.
Eine vertrackte Situation, die das sonst eher nüchterne britische Magazin "Economist" mit einem "Szenario für einen Dritten Weltkrieg" verglich: Während die vier ehemals
sowjetischen Republiken den Grund des Meeres und die dort liegenden Bodenschätze in fünf ungleiche Sektoren unterteilen wollen, die dem Küstenanteil eines jeden
Landes entsprechen, besteht der Iran auf zwanzig Prozent der Fläche, vom Grund bis zur Wasseroberfläche. An der so entstehenden neuen Grenze auf dem Wasser
patrouillieren iranische Marineboote schon heute. Teheran beruft sich auf alte Verträge mit der Sowjetunion aus den Jahren 1921 und 1940, die festschrieben, dass beide
Länder das Gewässer unbegrenzt nutzen konnten. Dahinter steht der Verdacht der Mullah-Regierung, dass die Vereinigten Staaten die Arbeit amerikanischer Ölfirmen zum
Vorwand für eine militärische Präsenz nehmen könnten. Damit lägen Schiffe der US-Marine nicht mehr nur im Persischen Golf vor iranischen Küsten.
Als wäre dies nicht Konfliktstoff genug, sind sich auch Aserbaidschan und Turkmenistan über die Zuteilung der Ölvorkommen uneins. Ginge es nach den Turkmenen, würde
eine strikt vertikale Grenze durch das Meer gezogen und mindestens die Hälfte aller jetzt von Aserbaidschan beanspruchten Bodenschätze gehörten dem Nachbarstaat im
Osten.
Die "Professor Gül" passiert jedoch unbehelligt die Konfliktgrenze. Backbord tauchen vorne die verrottenden Bohrtürme der Sandinsel auf,
eine der größten Off-Shore-Produktionsstätten des staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzerns Socar. Von der Insel ragt sie ins offene
Meer: ein gigantisches Geflecht aus auf Holzpfählen gebauten Pipelines, Pumpstationen, Bohrtürmen und etwa zwölf Kilometern
Verbindungsstraßen. "Die Bauten sind sehr alt, man muss vorsichtig sein, wo man hintritt", warnte Generaldirektor Vagif Guseinow bei
einem Reporterbesuch Wochen zuvor. Vorsicht ist auf der Sandinsel tatsächlich angebracht, denn die Anlage aus dem Jahre 1952, damals
ein Juwel sowjetischer Ingenieurskunst, ist inzwischen hoffnungslos verrottet.
Pipelines und Ölreservoirs rosten vor sich hin, die windschiefen Bohrtürme aus Holz und Stahl erinnern an Bilder der ersten Ölquellen im
Pennsylvania des 19. Jahrhunderts. "Westliche Investoren haben sich bis jetzt noch nicht für die Sandinsel interessiert", kommentiert
Guseinow trocken. Auf 150.000 Tonnen im Jahr sei die Produktion gesunken, ein Bruchteil der einstigen Fördermenge. Dennoch arbeiteten
noch immer 1600 Menschen auf der Sandinsel. "Wir werden die Anlage nie dichtmachen, auch wenn alle Quellen erschöpft sind. Die
Menschen brauchen doch Arbeit."
Die größte Bohrinsel der Welt
Gegen Mitternacht, als die sich mühsam vorwärts kämpfende "Professor Gül" bereits auf hoher See ist, werden Wind und Wellen wieder mächtiger. Backbord liegt jetzt das
riesige Ölfeld Chirag. Die Blase, mit geschätzten fünf bis sieben Milliarden Barrel Inhalt, riss sich der BP-Konzern Mitte der neunziger Jahre unter den Nagel. Eine gewaltige
Flamme, gespeist aus abgefackeltem Gas, ist bereits seit zwei Stunden zu sehen, aus bestimmt mehr als 30 Seemeilen Entfernung. Rote Wolken zaubert das Feuer an
den Himmel und schillernde Kämme auf die Wellen bis vor den Schiffsbug - so muss in der Antike der Leuchtturm von Alexandria gewirkt haben.
Doch es ist nicht der einzige helle Schein auf dem Meer: Westlich von Chirag zittern in der Ferne die Lichter von Neft Dashlarin (Ölige Felsen), die größte off-shore
Bohrinsel der Welt. Anders als die kleinere Sandinsel, ist sie eine richtige Stadt auf Stelzen, von sowjetischen Ingenieure 1949 über dem Wasser errichtet. Mehr als
einhundert Kilometer Straßen verbinden zahllose Bohrtürme, für die Tausenden Arbeiter gibt es Wohnblocks, ein Kino und Bars. Als ein Wunderwerk sozialistischer
Ingenieurskunst galt Neft Dashlari damals weltweit, der Stolz eines Landes, das wenige Jahre zuvor den Marsch der Armeen Adolf Hitlers auf die kaspischen Ölquellen
gestoppt hatte. Heute, fünfzig Jahre später, verfallen die hoffnungslos veralteten Anlagen wie die der Sandinsel. Immer wieder kommen Arbeiter bei Unfällen ums Leben.
Einer, der die gesamten fünfziger Jahre auf den Öligen Felsen verbracht hat, ist Hokhsbat Yusifzadeh, heute mächtiger Vizepräsident von Socar, dem
staatlichen aserbaidschanischen Ölkonzern. "Wir waren Pioniere damals, und das Öl floss in rauen Mengen - es war eine großartige Zeit", schwärmt
der heute 72-jährige Grandseigneur. "Vergessen Sie nicht, es arbeiteten auch viele Frauen auf Neft Dashlari, und die Abende waren lang auf dem
Meer." In den siebziger Jahren wurde Yusifzadeh Chefgeologe für die gesamte kaspische Region und entdeckte viele der Ölfelder, um die die
Anrainerstaaten und Konzerne heute rangeln.
Dass der Iran nun die Früchte seiner Arbeit ernten möchte, ärgert den Aserbaidschaner: "Gäbe es die mächtige Sowjetunion noch, würden sie nicht
wagen, unsere Ölfelder im Süden zu beanspruchen. Damals hat es die Iraner ja gar nicht gestört, wenn ich dort gebohrt habe."
Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, kommt die turkmenische Küste in Sicht. Plötzlich ist ein lautes Kettenrasseln zu hören - die
"Professor Gül" wirft Anker. "Wir werden hier gewiss noch bis morgen früh liegen müssen", sagt Bootsmaat Avaz gelassen. "So sind sie, die
Turkemenen. Ihr Präsident ist sauer auf unseren Präsidenten, weil Aserbaidschan alle guten Ölfelder abgegriffen hat, darum lassen sie uns nicht in
den Hafen."
Erst 23 Stunden später legt das Schiff endlich im Hafen von Turkmenbaschi an, und auf dem Kai tauchen mehrere uniformierte Männer auf, im Licht
der Scheinwerfern nur als gesichtslose Silhouetten mit Pistolen am Gürtel erkennbar - turkmenische Grenzpolizisten. Nach weiteren anderthalb
Stunden schließlich, nachdem die Beamten die Ladung peinlich genau inspiziert haben, darf der einzige Passagier aus Baku seinen Pass vorzeigen
und von Bord gehen.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,211308,00.html
Der Kampf ums kaspische Öl (3)
Das neue Kuweit und sein kindlicher Diktator
Von Lutz C. Kleveman, Aschgabad
Ein bizarrer Despot und die Oligarchen aus Moskau halten Turkmenistan fest im Griff - zum Schaden für die westliche Öl-Industrie. Die Milliardengewinne
aus den zwei Billionen Kubikmeter fassenden Erdgasfeldern gehen an den Konzernen vorbei. Nun setzten Amerikas Strategen auf die Option Afghanistan.
Turkmenistan ist wahrscheinlich der einzige Ort der Welt, wo ein Taxi zum Flughafen teurer ist als der anschließende Flug. "Nein, mein Herr, das
ist ganz sicher kein Irrtum, das Ticket kostet 35 Manat", sagt die Dame am Verkaufsschalter der Turkmenistan Airways in Turkmenbaschi, der
einzigen Hafenstadt des Landes am Ostufer des Kaspischen Meer. 35 Manat, das sind umgerechnet etwas mehr als zwei Euro! Für einen Flug in
die Hauptstadt Aschgabad, immerhin 800 Kilometer entfernt.
Unter den Passagieren der Maschine, einer brandneuen Boeing 757, sind viele bunt bekleidete Marktfrauen, die Obst und Fische aus dem
Kaspischen Meer auf dem Bazaar in Aschgabad verkaufen. Am Abend werden sie mit dem letzten Flieger wieder heimkehren. Mit einem feinen
Netto-Gewinn, nach Abzug der Transportkosten.
"Ein Volk, ein Vaterland, ein Führer"
In Ländern, in denen derartiges möglich ist, sind meist sagenhafte Bodenschätze nicht weit. Tatsächlich wird Turkmenistan oft das neue Kuweit am
Kaspischen Meer genannt: Die seit zehn Jahren unabhängige ex-sowjetische Wüstenrepublik sitzt auf immensen Reichtümern. Die Gasvorkommen
allein werden auf zwei Billionen Kubikmeter geschätzt, die viertgrößten der Welt. Hinzu kommen noch weitgehend unerschlossene Ölfelder vor der
turkmenischen Küste, von denen bis heute niemand weiß, wie groß sie sind. Die Bodenschätze machen das Land zu einem der wertvollsten
Beutestücke im neuen Großen Spiel, dem Kampf der Großmächte und Konzerne um die Öl- und Gasfelder am Kaspischen Meer.
Deren Problem ist nur, dass Turkmenistan von einem, vorsichtig ausgedrückt, leicht realitätsfremden Mann beherrscht wird: Staatspräsident
Saparmurad Nijazow. Besser bekannt als Turkmenbaschi, der "Führer aller Turkmenen", wie sich Nijazow seit Jahren nur noch nennt. Der
ehemalige Chef der Kommunistischen Partei in Turkmenistan hat das Land seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einen gigantischen
Themenpark verwandelt, mit einem einzigen Thema: ihm selbst. An fast jeder Straßenecke in Aschgabad hängen Porträts des 60-Jährigen,
eines kleinen Mannes mit scheinbar weichem Gesicht. Der Staatsslogan "Halk, Watan, Turkmenbaschi" (was so viel bedeutet wie "Ein Volk,
ein Vaterland, ein Führer") schmückt alle öffentlichen Gebäude.
Dazu ist die Hauptstadt mit zahllosen Statuen des Diktators auf Lebenszeit übersät, von denen ein gutes Dutzend vergoldet sind. Die größte
unter ihnen steht 40 Meter hoch auf einem Triumphbogen im Kern der Stadt: mit fliegendem Mantel und weit ausgestreckten Armen blickt
Turkmenbaschi auf seine etwa fünf Millionen Untergebenen runter. Dabei rotiert der Herrscher langsam, damit sein güldenes Antlitz stets der
Sonne zugewandt bleibt. "Es ist ein Personenkult wie zu Stalins Zeiten", sagt ein hochrangiger westlicher Diplomat in Aschgabad. "In keiner
anderen ehemals kommunistischen Republik hat sich das sowjetische System so unreformiert erhalten."
Fast alle erwachsenen Menschen arbeiten noch immer für den Staat, um die grandiosen Ideen und Spielereien
des exzentrischen Chefs zu verwirklichen: Arbeiterbrigaden reißen ganze Wohngebiete der Hauptstadt ab und
ersetzen sie durch leer stehende Marmor-Prachtbauten, Palmenparks mit mythischen Statuen und Tausenden,
zum Teil gigantischen Springbrunnen. Sie sind Nijazows größte Obsession, und er besteht darauf, dass nur das beste Trinkwasser des
Wüstenlandes aus ihnen sprudelt (und verdunstet). "Es erinnert alles ein wenig an Kim Il Sung in Nordkorea", kommentiert der westliche
Diplomat. "Dabei ist der Mann kein brutaler Tyrann. Er ist nur wie ein Kind, und dazu noch ein ziemlich verrücktes."
Schweres Terrain für die Ölindustrie
Kein Mitglied des diplomatischen Corps, das nicht eine obskure Anekdote darüber auf Lager hätte, was Turkmenbaschi nun schon wieder
angestellt hat. "Neulich fragte er sich wohl in seinem Palast, ob das Volk ihn auch wirklich so liebe, wie seine Minister ihm versichern",
erzählt eine amerikanische Diplomatin. "Da hat er sich einen falschen schwarzen Bart angeklebt und ist ganz allein in die Außenbezirke gefahren, um einfache Menschen
auf der Straße nach ihrer Meinung zu fragen." Natürlich würde sich in Turkmenistan niemand trauen, seine wirklichen Ansichten zu politischen Themen öffentlich
kundzutun. "Schon gar nicht, wenn der Befrager im gepanzerten schwarzen Mercedes des Präsidenten angefahren kommt - und obendrein der Bart schief vom Kinn hängt."
So unterhaltsam die Launen des modernen turkmenischen Khans sein mögen, so schwer machen sie es für westliche Regierungen und Unternehmen, in dem
rohstoffreichen Land politisch und wirtschaftlich Einfluss zu gewinnen. Anders als in den übrigen Schlüsselstaaten am Kaspischen Meer wie Kasachstan und
Aserbaidschan, sind ausländische Investitionen in Turkmenistan, besonders im Öl- und Gassektor, nach wie vor sehr schwierig. Die Willkür des Präsidenten verhindert klare
legale Vorgaben ebenso wie einen effektiven Schutz vor korrupten Bürokraten. "So müssen sich die ersten Händler gefühlt haben, die im 19. Jahrhundert an den Hof des
Emirs von Bukhara gereist sind", stöhnt ein britischer Geschäftsmann. Auch er will nicht namentlich genannt werden, aus Angst vor negativen Folgen. "Die Turkmenen
könnten zum Beispiel unsere bestehenden Verträge einfach zerreißen und mich ausweisen."
Von den Schwierigkeiten seiner westlichen Gegenspieler im neuen Großen Spiel profitiert Turkmenistans ehemaliger kolonialer Hegemon: Russland.
Zwar besiegten russische Zarentruppen die letzten nomadischen Banditen Turkmenistans erst vor gut einhundert Jahren, in der blutigen Schlacht von
Geok-Tepe im Januar 1881, aber aus der folgenden Kontrolle und Abhängigkeit von Russland weiß sich das kleine Land auch nach dem Ende der
UdSSR nicht richtig zu befreien. Seinen wichtigsten Geldbringer, das Erdgas, muss Turkmenistan bis heute durch die alten Pipelines nach
Russland exportieren. Andere bestehen nicht, außer einer kleinen neuen Röhre nach Iran, die aber die Abhängigkeit von Moskau kaum mindert.
Schon mehrfach hat Gazprom, der russische Gasriese, den Turkmenen willkürlich den Hahn abgedreht und die Pipelines gesperrt.
Daher hatte die turkmenische Regierung Mitte der Neunziger den kühnen Plan, eine Pipeline unter dem Kaspischen Meer durch nach
Aserbaidschan zu legen, wo sie an eine Leitung in die Türkei angeschlossen würde. Das Projekt wurde enthusiastisch von der amerikanischen
Regierung unterstützt, die Turkmenistan wie alle 1992 unabhängig gewordenen und zudem rohstoffreichen Länder aus der Faust Moskaus zu
befreien sucht. Wie im Falle von Aserbaidschan sieht Washington in einer Ost-West-Pipeline, die Russland umgeht, das beste Mittel dafür.
Rückschlag für Shell, Gewinner sind Russlands Ölbosse
Der britisch-holländische Rohstoffgigant Shell stieg in das Projekt ein und fertigte Machbarkeitsstudien an. "Wir kamen zu dem Schluss, dass die
Pipeline technisch und kommerziell absolut Sinn machen würde", sagt Pius Cagienard, Generaldirektor von Shell in Turkmenistan. In seinem Büro,
zusammen mit den britischen, deutschen und französischen Botschaften in einem Luxushotel untergebracht, hängen viele Photos von dem Tag im Jahre 1999, an dem
Shell-Manager mit Nijazow Vorverträge unterschrieben.
Der Schweizer betrachtet sie heute mit Bitterkeit, denn aus der Transkaspischen Pipeline wurde nichts. "Das Projekt geriet in ein geopolitisches
Ringen zwischen den USA und Russland, und Moskau hatte leider den längeren Arm", erzählt Cagienard und sieht dabei sehr wie ein Verlierer aus.
"Die Russen haben so viel politischen Druck gemacht, da hat sich Präsident Nijazow nicht mehr getraut, sie vor den Kopf zu schlagen und mit uns
einen endgültigen Vertrag zu unterschreiben." Damit ging die Chance auf eine weitere Exportroute bis auf weiteres verloren, denn die Türkei hat
inzwischen Lieferverträge für Gas mit Iran und mit Russland abgeschlossen. Die russische Pipeline, Blue Stream genannt, wird ironischerweise unter
dem Schwarzen Meer hindurch in die Türkei führen.
Des einen Leid ist des anderen Freud: der vorläufige Gewinner im Kampf um das turkmenische Gas ist der russische Rohstoffkonzern Itera, der eng
mit dem Monopolisten Gazprom zusammenarbeitet. Iteras Boss Igor Makarow, einer der mächtigen Oligarchen in Moskau, wurde in Aschgabad
geboren und kann sich in seiner Geschäftsstrategie auf eine langjährige Freundschaft mit Staatspräsident Nijazow stützen. Vor wenigen Monaten
haben die beiden Männer vereinbart, dass Turkmenistan im kommenden Jahr 40 Milliarden Kubikmeter Gas nach Norden an Itera liefert.
Der Preis, spottbillige 43 Dollar pro tausend Kubikmeter, ist zur Hälfte in Naturalien zahlbar. "Das ist ein fairer Preis, alle sind zufrieden. Wir nutzen
die Pipeline-Situation nicht aus", beteuert Gozchmurad Nazdianow, Itera-Topmanager in Turkmenistan. So überzeugend verteidigt der elegante
Mittfünfziger heute die Interessen seiner russischen Firma, fast könnte man vergessen, dass er noch vor wenigen Jahren Turkmenbaschis Ölminister
war. Nazdianow einzustellen war ein weiterer schlauer Schachzug von Itera-Chef Makarow.
Die Afghanistan-Route - Alternative für Amerikas Öl-Strategen
An politischen Hindernissen allerdings sei die Transkaspische Pipeline nicht gescheitert, behauptet Nazdianow heute: "Die Russen haben gar keinen
Druck gemacht, Schuld am Scheitern des Projekts hatten nur die Aserbaidschaner." Die Regierung in Baku habe nämlich die Pipeline boykottiert,
wollte nicht ausreichend Gas durch das Land lassen, um sie rentabel zu machen. Massiven politischem Einfluss habe nur Washington auszuüben versucht. "Aber es hat
nicht gereicht, um die Aserbaidschaner zum Einlenken zu bringen. Also ist das Projekt gestorben." Für einen kurzen Moment ist Nazdianow anzumerken, dass ihm das als
ehemaligem Ölminister seines Landes leid tut. Aber dann besinnt er sich wieder darauf, in wessen Diensten er heute steht. "Für Itera ist das natürlich eine gute Nachricht."
Hoffnung auf eine zweite große Exportroute für turkmenisches Gas, fügt er dann hinzu, gebe es allerdings weiter: "Durch Afghanistan." Bereits Mitte
der Neunziger plante der amerikanischen Ölkonzern Unocal, zwei Pipelines für Gas und für Öl durch Afghanistan nach Pakistan zu bauen.
Nazdianow, damals noch Ölminister, reiste mehrfach mit Unocal-Managern nach Afghanistan, um die Taliban und die Nordallianz für das Projekt und
ein dafür nötiges Ende des Bürgerkriegs zu begeistern. Die Kämpfe aber gingen weiter, und Unocal stieg aus. Mit dem Ende der Taliban hat sich
nun der afghanische Pipeline-Korridor wieder geöffnet: Bei einem Staatsbesuch in Aschgabad Anfang März besprachen der neue afghanische
Präsident Hamid Karzai und Turkmenbaschi das Vorhaben bereits. Nazdianow glaubt: "Lange werden die Ölkonzerne nicht auf sich warten lassen.
Der Kampf ums kaspische Öl (3)
Das neue Kuweit und sein kindlicher Diktator
Von Lutz C. Kleveman, Aschgabad
Ein bizarrer Despot und die Oligarchen aus Moskau halten Turkmenistan fest im Griff - zum Schaden für die westliche Öl-Industrie. Die Milliardengewinne
aus den zwei Billionen Kubikmeter fassenden Erdgasfeldern gehen an den Konzernen vorbei. Nun setzten Amerikas Strategen auf die Option Afghanistan.
Turkmenistan ist wahrscheinlich der einzige Ort der Welt, wo ein Taxi zum Flughafen teurer ist als der anschließende Flug. "Nein, mein Herr, das
ist ganz sicher kein Irrtum, das Ticket kostet 35 Manat", sagt die Dame am Verkaufsschalter der Turkmenistan Airways in Turkmenbaschi, der
einzigen Hafenstadt des Landes am Ostufer des Kaspischen Meer. 35 Manat, das sind umgerechnet etwas mehr als zwei Euro! Für einen Flug in
die Hauptstadt Aschgabad, immerhin 800 Kilometer entfernt.
Unter den Passagieren der Maschine, einer brandneuen Boeing 757, sind viele bunt bekleidete Marktfrauen, die Obst und Fische aus dem
Kaspischen Meer auf dem Bazaar in Aschgabad verkaufen. Am Abend werden sie mit dem letzten Flieger wieder heimkehren. Mit einem feinen
Netto-Gewinn, nach Abzug der Transportkosten.
"Ein Volk, ein Vaterland, ein Führer"
In Ländern, in denen derartiges möglich ist, sind meist sagenhafte Bodenschätze nicht weit. Tatsächlich wird Turkmenistan oft das neue Kuweit am
Kaspischen Meer genannt: Die seit zehn Jahren unabhängige ex-sowjetische Wüstenrepublik sitzt auf immensen Reichtümern. Die Gasvorkommen
allein werden auf zwei Billionen Kubikmeter geschätzt, die viertgrößten der Welt. Hinzu kommen noch weitgehend unerschlossene Ölfelder vor der
turkmenischen Küste, von denen bis heute niemand weiß, wie groß sie sind. Die Bodenschätze machen das Land zu einem der wertvollsten
Beutestücke im neuen Großen Spiel, dem Kampf der Großmächte und Konzerne um die Öl- und Gasfelder am Kaspischen Meer.
Deren Problem ist nur, dass Turkmenistan von einem, vorsichtig ausgedrückt, leicht realitätsfremden Mann beherrscht wird: Staatspräsident
Saparmurad Nijazow. Besser bekannt als Turkmenbaschi, der "Führer aller Turkmenen", wie sich Nijazow seit Jahren nur noch nennt. Der
ehemalige Chef der Kommunistischen Partei in Turkmenistan hat das Land seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einen gigantischen
Themenpark verwandelt, mit einem einzigen Thema: ihm selbst. An fast jeder Straßenecke in Aschgabad hängen Porträts des 60-Jährigen,
eines kleinen Mannes mit scheinbar weichem Gesicht. Der Staatsslogan "Halk, Watan, Turkmenbaschi" (was so viel bedeutet wie "Ein Volk,
ein Vaterland, ein Führer") schmückt alle öffentlichen Gebäude.
Dazu ist die Hauptstadt mit zahllosen Statuen des Diktators auf Lebenszeit übersät, von denen ein gutes Dutzend vergoldet sind. Die größte
unter ihnen steht 40 Meter hoch auf einem Triumphbogen im Kern der Stadt: mit fliegendem Mantel und weit ausgestreckten Armen blickt
Turkmenbaschi auf seine etwa fünf Millionen Untergebenen runter. Dabei rotiert der Herrscher langsam, damit sein güldenes Antlitz stets der
Sonne zugewandt bleibt. "Es ist ein Personenkult wie zu Stalins Zeiten", sagt ein hochrangiger westlicher Diplomat in Aschgabad. "In keiner
anderen ehemals kommunistischen Republik hat sich das sowjetische System so unreformiert erhalten."
Fast alle erwachsenen Menschen arbeiten noch immer für den Staat, um die grandiosen Ideen und Spielereien
des exzentrischen Chefs zu verwirklichen: Arbeiterbrigaden reißen ganze Wohngebiete der Hauptstadt ab und
ersetzen sie durch leer stehende Marmor-Prachtbauten, Palmenparks mit mythischen Statuen und Tausenden,
zum Teil gigantischen Springbrunnen. Sie sind Nijazows größte Obsession, und er besteht darauf, dass nur das beste Trinkwasser des
Wüstenlandes aus ihnen sprudelt (und verdunstet). "Es erinnert alles ein wenig an Kim Il Sung in Nordkorea", kommentiert der westliche
Diplomat. "Dabei ist der Mann kein brutaler Tyrann. Er ist nur wie ein Kind, und dazu noch ein ziemlich verrücktes."
Schweres Terrain für die Ölindustrie
Kein Mitglied des diplomatischen Corps, das nicht eine obskure Anekdote darüber auf Lager hätte, was Turkmenbaschi nun schon wieder
angestellt hat. "Neulich fragte er sich wohl in seinem Palast, ob das Volk ihn auch wirklich so liebe, wie seine Minister ihm versichern",
erzählt eine amerikanische Diplomatin. "Da hat er sich einen falschen schwarzen Bart angeklebt und ist ganz allein in die Außenbezirke gefahren, um einfache Menschen
auf der Straße nach ihrer Meinung zu fragen." Natürlich würde sich in Turkmenistan niemand trauen, seine wirklichen Ansichten zu politischen Themen öffentlich
kundzutun. "Schon gar nicht, wenn der Befrager im gepanzerten schwarzen Mercedes des Präsidenten angefahren kommt - und obendrein der Bart schief vom Kinn hängt."
So unterhaltsam die Launen des modernen turkmenischen Khans sein mögen, so schwer machen sie es für westliche Regierungen und Unternehmen, in dem
rohstoffreichen Land politisch und wirtschaftlich Einfluss zu gewinnen. Anders als in den übrigen Schlüsselstaaten am Kaspischen Meer wie Kasachstan und
Aserbaidschan, sind ausländische Investitionen in Turkmenistan, besonders im Öl- und Gassektor, nach wie vor sehr schwierig. Die Willkür des Präsidenten verhindert klare
legale Vorgaben ebenso wie einen effektiven Schutz vor korrupten Bürokraten. "So müssen sich die ersten Händler gefühlt haben, die im 19. Jahrhundert an den Hof des
Emirs von Bukhara gereist sind", stöhnt ein britischer Geschäftsmann. Auch er will nicht namentlich genannt werden, aus Angst vor negativen Folgen. "Die Turkmenen
könnten zum Beispiel unsere bestehenden Verträge einfach zerreißen und mich ausweisen."
Von den Schwierigkeiten seiner westlichen Gegenspieler im neuen Großen Spiel profitiert Turkmenistans ehemaliger kolonialer Hegemon: Russland.
Zwar besiegten russische Zarentruppen die letzten nomadischen Banditen Turkmenistans erst vor gut einhundert Jahren, in der blutigen Schlacht von
Geok-Tepe im Januar 1881, aber aus der folgenden Kontrolle und Abhängigkeit von Russland weiß sich das kleine Land auch nach dem Ende der
UdSSR nicht richtig zu befreien. Seinen wichtigsten Geldbringer, das Erdgas, muss Turkmenistan bis heute durch die alten Pipelines nach
Russland exportieren. Andere bestehen nicht, außer einer kleinen neuen Röhre nach Iran, die aber die Abhängigkeit von Moskau kaum mindert.
Schon mehrfach hat Gazprom, der russische Gasriese, den Turkmenen willkürlich den Hahn abgedreht und die Pipelines gesperrt.
Daher hatte die turkmenische Regierung Mitte der Neunziger den kühnen Plan, eine Pipeline unter dem Kaspischen Meer durch nach
Aserbaidschan zu legen, wo sie an eine Leitung in die Türkei angeschlossen würde. Das Projekt wurde enthusiastisch von der amerikanischen
Regierung unterstützt, die Turkmenistan wie alle 1992 unabhängig gewordenen und zudem rohstoffreichen Länder aus der Faust Moskaus zu
befreien sucht. Wie im Falle von Aserbaidschan sieht Washington in einer Ost-West-Pipeline, die Russland umgeht, das beste Mittel dafür.
Rückschlag für Shell, Gewinner sind Russlands Ölbosse
Der britisch-holländische Rohstoffgigant Shell stieg in das Projekt ein und fertigte Machbarkeitsstudien an. "Wir kamen zu dem Schluss, dass die
Pipeline technisch und kommerziell absolut Sinn machen würde", sagt Pius Cagienard, Generaldirektor von Shell in Turkmenistan. In seinem Büro,
zusammen mit den britischen, deutschen und französischen Botschaften in einem Luxushotel untergebracht, hängen viele Photos von dem Tag im Jahre 1999, an dem
Shell-Manager mit Nijazow Vorverträge unterschrieben.
Der Schweizer betrachtet sie heute mit Bitterkeit, denn aus der Transkaspischen Pipeline wurde nichts. "Das Projekt geriet in ein geopolitisches
Ringen zwischen den USA und Russland, und Moskau hatte leider den längeren Arm", erzählt Cagienard und sieht dabei sehr wie ein Verlierer aus.
"Die Russen haben so viel politischen Druck gemacht, da hat sich Präsident Nijazow nicht mehr getraut, sie vor den Kopf zu schlagen und mit uns
einen endgültigen Vertrag zu unterschreiben." Damit ging die Chance auf eine weitere Exportroute bis auf weiteres verloren, denn die Türkei hat
inzwischen Lieferverträge für Gas mit Iran und mit Russland abgeschlossen. Die russische Pipeline, Blue Stream genannt, wird ironischerweise unter
dem Schwarzen Meer hindurch in die Türkei führen.
Des einen Leid ist des anderen Freud: der vorläufige Gewinner im Kampf um das turkmenische Gas ist der russische Rohstoffkonzern Itera, der eng
mit dem Monopolisten Gazprom zusammenarbeitet. Iteras Boss Igor Makarow, einer der mächtigen Oligarchen in Moskau, wurde in Aschgabad
geboren und kann sich in seiner Geschäftsstrategie auf eine langjährige Freundschaft mit Staatspräsident Nijazow stützen. Vor wenigen Monaten
haben die beiden Männer vereinbart, dass Turkmenistan im kommenden Jahr 40 Milliarden Kubikmeter Gas nach Norden an Itera liefert.
Der Preis, spottbillige 43 Dollar pro tausend Kubikmeter, ist zur Hälfte in Naturalien zahlbar. "Das ist ein fairer Preis, alle sind zufrieden. Wir nutzen
die Pipeline-Situation nicht aus", beteuert Gozchmurad Nazdianow, Itera-Topmanager in Turkmenistan. So überzeugend verteidigt der elegante
Mittfünfziger heute die Interessen seiner russischen Firma, fast könnte man vergessen, dass er noch vor wenigen Jahren Turkmenbaschis Ölminister
war. Nazdianow einzustellen war ein weiterer schlauer Schachzug von Itera-Chef Makarow.
Die Afghanistan-Route - Alternative für Amerikas Öl-Strategen
An politischen Hindernissen allerdings sei die Transkaspische Pipeline nicht gescheitert, behauptet Nazdianow heute: "Die Russen haben gar keinen
Druck gemacht, Schuld am Scheitern des Projekts hatten nur die Aserbaidschaner." Die Regierung in Baku habe nämlich die Pipeline boykottiert,
wollte nicht ausreichend Gas durch das Land lassen, um sie rentabel zu machen. Massiven politischem Einfluss habe nur Washington auszuüben versucht. "Aber es hat
nicht gereicht, um die Aserbaidschaner zum Einlenken zu bringen. Also ist das Projekt gestorben." Für einen kurzen Moment ist Nazdianow anzumerken, dass ihm das als
ehemaligem Ölminister seines Landes leid tut. Aber dann besinnt er sich wieder darauf, in wessen Diensten er heute steht. "Für Itera ist das natürlich eine gute Nachricht."
Hoffnung auf eine zweite große Exportroute für turkmenisches Gas, fügt er dann hinzu, gebe es allerdings weiter: "Durch Afghanistan." Bereits Mitte
der Neunziger plante der amerikanischen Ölkonzern Unocal, zwei Pipelines für Gas und für Öl durch Afghanistan nach Pakistan zu bauen.
Nazdianow, damals noch Ölminister, reiste mehrfach mit Unocal-Managern nach Afghanistan, um die Taliban und die Nordallianz für das Projekt und
ein dafür nötiges Ende des Bürgerkriegs zu begeistern. Die Kämpfe aber gingen weiter, und Unocal stieg aus. Mit dem Ende der Taliban hat sich
nun der afghanische Pipeline-Korridor wieder geöffnet: Bei einem Staatsbesuch in Aschgabad Anfang März besprachen der neue afghanische
Präsident Hamid Karzai und Turkmenbaschi das Vorhaben bereits. Nazdianow glaubt: "Lange werden die Ölkonzerne nicht auf sich warten lassen.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,211586,00.html
Der Kampf ums kaspische Öl (4)
Pipeline-Poker in der kasachischen Steppe
Von Lutz C. Kleveman, Atyrau
Die Entdeckung des zweitgrößten Ölfelds der Welt vor der Küste Kasachstans hat eine neue Runde im Großen Machtspiel um die kaspischen Öl-Reserven
eingeläutet. Das Mullah-Regime in Teheran hat gute Karten. Aber auch Chinas Kommunisten mischen mit.
Von fern erscheint sie wie eine Kircheninsel in der Lagune von Venedig. Doch als der Helikopter näher heran fliegt, entpuppt sich der
vermeintliche Dom als profaner Bohrturm, und die Kirche darunter als Ölplattform, so breit wie ein Fußballfeld. Wir befinden uns über dem
nördlichen Kaspischen Meer, 50 Kilometer vor der Küste Kasachstans, irgendwo im Westen liegt das russische Ufer.
"Sunkar" wird die Bohrinsel genannt, das ist Kasachisch für "Adler". Eigentlich ist sie nichts weiter als ein schwerfälliges Floß, das noch
vor wenigen Jahren durch das Niger-Delta schipperte. Dann wurde es an diesen Ort geschleppt, über viele Tausend Kilometer. Erst die
afrikanische Westküste hoch, dann durch das Mittelmeer, das Schwarze Meer, den Don aufwärts und schließlich die Wolga runter, bis ins
Kaspische Meer. Wer so etwas macht, will Geld verdienen. Viel Geld.
"Hier ist es damals passiert", sagt Neil Booth trocken. "Hier haben wir es gefunden, und es war groß." Es gehört zu Booths
Selbstverständnis als Brite, Erfolge zu untertreiben. Was der Manager des italienischen Ölkonzerns Agip so vorsichtig umschreibt, war der
größte Ölfund seit drei Jahrzehnten: das Kashagan-Feld. Im Juli 2000 stießen Geologen unter einem uralten Korallenatoll in 4500 Metern Tiefe auf eine gewaltige Ölblase.
Wie weit und wohin sie den Testbohrer auch bewegten, an Bord der Sunkar barsten beinahe die Ventile, weil das hochkonzentrierte Rohöl noch oben drückte. Schon nach
wenigen Tagen wurde allen Anwesenden klar: Seit dem sensationellen Fund in Alaskas Prudhoe Bay im Jahr 1970 wurde nicht mehr so viel Erdöl an einem Ort entdeckt.
"Wir waren alle völlig perplex", erinnert sich der 50-jährige Booth in seinem Büro im kasachischen Atyrau, einer bislang verschlafenen Kleinstadt
an der Nordküste des Kaspischen Meeres. Hier hat der Agip-Konzern, der das internationale Kashagan-Konsortium anführt, ein hastig aus
Wohncontainern zusammengebasteltes Hauptquartier bezogen. Es wimmelt von italienischen Ölmännern, an jeder zweiten Ecke stehen
Espresso-Maschinen.
"Keiner wollte es glauben, als die Resultate reinkamen. Es war doch eine `wild cat` gewesen." Eine wilde Katze, so nennt man in der Branche
eine Ölsuche an einem Ort, wo nie zuvor gebohrt worden war. Da das nordkaspische Meer in der Sowjetunion unter Naturschutz stand, gab es
dort keine Erfahrungen mit Off-shore-Bohrungen. Booth erläutert: "Das ist ein Glücksspiel, da stehen die Chancen auf einen Treffer bei eins zu
zwanzig, nicht mehr." Begeistert von ihrer Fortune, bohrten die Geologen 40 Kilometer vom ersten Treffer entfernt, um die Ausdehnung des
Ölfelds unter dem Meer bestimmen.
Das "neue Houston"
Der Coup gelang: Wieder sprudelte das schwarze Gold. "Die chemische Zusammensetzung des Öls aus beiden Funden ist sehr ähnlich",
berichtet Booth. "Das deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um ein und dieselbe Blase handelt." Mindestens 40 Kilometer Ausdehnung
hat das Feld, vielleicht noch mehr. Experten schätzen, dass in Kashagan 30 Milliarden Barrel Erdöl verborgen liegen. Damit wäre es das
zweitgrößte Ölfeld der Erde. Nur Ghawar in Saudi-Arabien ist mit 80 Milliarden Barrel noch größer, die Felder der Nordsee bergen noch insgesamt 17 Milliarden Barrel.
Die Entdeckung von Kashagan ist nicht nur für die beteiligten Ölkonzerne eine Verheißung. Der gigantische Ölfund hat die geopolitische Balance am Kaspischen Meer ins
Wanken gebracht und eine neue, gefährliche Runde im großen Ringen der Weltmächte um Rohstoffe und Pipelines eingeläutet. Kasachstan, noch vor einem Jahrzehnt eine
rückständige Sowjetrepublik, wird sich in naher Zukunft zum größten Erdölexporteur nach Saudi Arabien entwickeln. Jeden Tag bis zu fünf Millionen Barrel könnte das Land
schon im Jahr 2010 an den Rest der Welt verkaufen.
Dem internationalen Öl-Kartell Opec bereitet diese Aussicht Kopfschmerzen: Dass sich das Nicht-Mitglied an Preisabsprachen und Förderlimits halten wird, ist mehr als
unwahrscheinlich. Zusammen mit Russland, das der Opec ebenfalls nicht angehört, könnte Kasachstan so die Macht der saudischen Scheichs über Wohl und Wehe der
westlichen Industrieländer brechen. Für jede energiehungrige Gesellschaft, allen voran die USA, ist Kasachstan dadurch strategisch sehr wichtig geworden.
Für die bislang trostlose Plattenbaustadt Atyrau bringt das dramatische Veränderungen: Plötzlich sitzen in den Tupolews aus Moskau
smarte Geschäftsleute, die während des Flugs ihre Laptops traktieren. Rechts und links der frisch geteerten Hauptstraße stehen nun große
Schilder, die den Bau neuer Banken und Bürogebäude ankündigen. So gewaltig rollt der Ölboom über Atyrau her, dass das "Wall Street
Journal" schon das "neue Houston" ausrief. Den vielen Fischern am Ural-Fluss, der hier als geografische Grenze zwischen Europa und
Asien in das Kaspische Meer mündet, lässt der Hype um das neue Öl-Dorado bisher kalt. "Hauptsache, die Ölkonzerne vergiften nicht
unsere Fische", sagt einer von ihnen. Die Sorge ist nicht aus der Luft gegriffen: Die Bohrinsel über Kashagan liegt mitten im
nordkaspischen Naturschutzgebiet, in dem mehr als 200 bedrohte Tierarten, vor allem Vögel und der kaspische Seehund, leben.
Angst vor einer "toten Zone
"Wie konnte unsere Regierung dort den Schutzstatus aufheben und Bohrrechte erteilen?", schimpft Galina Chernowa, die zusammen mit
dreißig Mitstreitern den Kampf derer in Atyrau anführt, die dem Ölboom nicht trauen. Die energische Biologin fordert einen sofortigen
Bohrstopp: "Die Ölfirmen sagen uns, dass ihre Arbeit gar keinen Schaden anrichtet, aber das stimmt hinten und vorne nicht." Das Meer sei
im Norden mit zwei bis zehn Metern Wassertiefe zu flach, um sich von Verschmutzungen je wieder zu erholen. "Wir wollen nicht, dass die Konzerne mit dem Geld
davonrennen und uns hier in einer toten Zone zurücklassen."
Dave Preston, Umweltbeauftragter von Agip in Atyrau, wiegelt ab: "Wir tun alles, um möglichst sauber zu produzieren." Abwasser gelange nicht ins Meer, auch Müll werde
an Land entsorgt. Aber Preston fügt hinzu: "Dass es zu einem Blow-out kommt, wenn Öl unkontrolliert aus der Quelle schießt, das kann man natürlich nie ausschließen."
Weit ärgeres Kopfzerbrechen als der Umweltschutz bereitet Industrie und Politikern aber die Frage, wie das Öl zu den Märkten der industrialisierten Welt gebracht werden
kann. Im Poker um Pipelines sind die kaspischen Karten seit dem Kashagan-Fund völlig neu gemischt.
Der amerikanische Ölriese Chevron, der bereits seit 1993 in einem Joint Venture mit dem staatlichen Konzern Kazmunaigaz Öl aus dem
riesigen Tengiz-Feld an der kaspischen Ostküste fördert, hat trotz unfreundlicher Kommentare aus Washington bereits eine Pipeline für mehr als
zwei Milliarden Dollar durch den kriegsgeschüttelten Nordkaukasus zum russischen Schwarzmeerhafen Novorissijsk bauen lassen. Bis zu eine
Million Barrel pro Tag kann die Leitung fassen. Im vergangenen Oktober floss das erste Öl.
Zu Asiens Märkten über die "Achse des Bösen"
"Für den Anfang könnte unsere Pipeline die Kashagan-Produktion aufnehmen, aber eine zweite Leitung ist notwendig", sagt Boris
Scherdabajew, mächtiger Präsident vom Tengizchevroil genannten US-kasachischen Gemeinschaftsunternehmen, während er im Firmenjet bei
Lachs und Sekt über die weite Steppe Kasachstans fliegt. "Noch eine Pipeline durch Russland wird die kasachische Regierung aber nicht
zulassen, dann wäre sie zu abhängig von Moskau." Schon ist von einer zweiten Röhre entlang der Baku-Ceyhan-Pipeline durch den
Süd-Kaukasus die Rede. Dafür müsste das Kashagan-Öl allerdings zunächst umständlich mit Tankern quer über das Kaspische Meer geschifft
werden.
Alle ökonomischen Fakten sprechen daher für eine Süd-Route zum Persischen Golf. Durch zwei Länder könnte sie verlaufen: durch den Iran
oder Afghanistan.
Das Mullah-Regime in Teheran hat sein Territorium mehrfach als idealen Korridor angeboten und möchte sogar eine Pipeline entlang der kaspischen Ostküste mit
finanzieren. Kasachstans Präsident Nursultan Nazarbajew hat mehrfach seine Sympathie für das Projekt erklärt, sehr zum Ärger der US-Regierung von Präsident George
W. Bush, der den Iran mehrfach als Teil einer "Achse des Bösen" bezeichnet hat und die amerikanischen Wirtschaftssanktionen gegen das Land aufrecht erhält. Sie
verbieten es US-Konzernen, Öl durch Persien zu transportieren. Doch das letzte Wort darüber, welchen Weg das Kashagan-Öl nehmen wird, haben die Kasachen. "Wir
glauben, dass die Route durch den Iran am ökonomisch sinnvollsten wäre", sagt Sabr Yessimbekow, Pipeline-Chefplaner von Präsident Nazarbajew. "Das Öl muss nach
Asien, die Märkte Europas sind übersättigt." Das Büro des 38jährigen ehemaligen Diplomaten liegt in der neuen Hauptstadt Astana, die sich Nazarbajew in froher
Erwartung des Petrolreichtums für mehrere Milliarden Dollar in die nördliche Steppe bauen lässt.
An der Wand hängt eine Karte des Landes, in der alle Pipeline-Optionen eingezeichnet sind. Darunter ist auch eine mehr als 3000 Kilometer lange
Röhre nach China. "Die Chinesen sind ganz scharf auf das Kashagan-Öl", erzählt Yessimbekow mit einem Stirnrunzeln. "Sie sind sehr aggressiv,
versuchen mit allen Mitteln, nach Kasachstan einzudringen."
Der Pipeline-Chefplaner fährt fort: "Und deswegen ist es sehr gut, dass die USA ihre Truppen in Zentralasien stationieren - sie halten die Chinesen
draußen." Der Kasache grinst unverhohlen schadenfroh: "Wer glaubt denn überhaupt, dass es den Amerikanern in diesem sogenannten
Anti-Terror-Krieg um Osama Bin Laden geht? Es geht ihnen um uns, unser Öl wollen sie haben." Yessimbekow zögert einen Moment, dann fährt sein
Finger plötzlich auf der Landkarte nach Südosten: "Durch Afghanistan könnte man die Pipeline jetzt auch wieder legen. Vielleicht subventioniert die
Uno den Bau, das wäre doch was."
Der Kampf ums kaspische Öl (4)
Pipeline-Poker in der kasachischen Steppe
Von Lutz C. Kleveman, Atyrau
Die Entdeckung des zweitgrößten Ölfelds der Welt vor der Küste Kasachstans hat eine neue Runde im Großen Machtspiel um die kaspischen Öl-Reserven
eingeläutet. Das Mullah-Regime in Teheran hat gute Karten. Aber auch Chinas Kommunisten mischen mit.
Von fern erscheint sie wie eine Kircheninsel in der Lagune von Venedig. Doch als der Helikopter näher heran fliegt, entpuppt sich der
vermeintliche Dom als profaner Bohrturm, und die Kirche darunter als Ölplattform, so breit wie ein Fußballfeld. Wir befinden uns über dem
nördlichen Kaspischen Meer, 50 Kilometer vor der Küste Kasachstans, irgendwo im Westen liegt das russische Ufer.
"Sunkar" wird die Bohrinsel genannt, das ist Kasachisch für "Adler". Eigentlich ist sie nichts weiter als ein schwerfälliges Floß, das noch
vor wenigen Jahren durch das Niger-Delta schipperte. Dann wurde es an diesen Ort geschleppt, über viele Tausend Kilometer. Erst die
afrikanische Westküste hoch, dann durch das Mittelmeer, das Schwarze Meer, den Don aufwärts und schließlich die Wolga runter, bis ins
Kaspische Meer. Wer so etwas macht, will Geld verdienen. Viel Geld.
"Hier ist es damals passiert", sagt Neil Booth trocken. "Hier haben wir es gefunden, und es war groß." Es gehört zu Booths
Selbstverständnis als Brite, Erfolge zu untertreiben. Was der Manager des italienischen Ölkonzerns Agip so vorsichtig umschreibt, war der
größte Ölfund seit drei Jahrzehnten: das Kashagan-Feld. Im Juli 2000 stießen Geologen unter einem uralten Korallenatoll in 4500 Metern Tiefe auf eine gewaltige Ölblase.
Wie weit und wohin sie den Testbohrer auch bewegten, an Bord der Sunkar barsten beinahe die Ventile, weil das hochkonzentrierte Rohöl noch oben drückte. Schon nach
wenigen Tagen wurde allen Anwesenden klar: Seit dem sensationellen Fund in Alaskas Prudhoe Bay im Jahr 1970 wurde nicht mehr so viel Erdöl an einem Ort entdeckt.
"Wir waren alle völlig perplex", erinnert sich der 50-jährige Booth in seinem Büro im kasachischen Atyrau, einer bislang verschlafenen Kleinstadt
an der Nordküste des Kaspischen Meeres. Hier hat der Agip-Konzern, der das internationale Kashagan-Konsortium anführt, ein hastig aus
Wohncontainern zusammengebasteltes Hauptquartier bezogen. Es wimmelt von italienischen Ölmännern, an jeder zweiten Ecke stehen
Espresso-Maschinen.
"Keiner wollte es glauben, als die Resultate reinkamen. Es war doch eine `wild cat` gewesen." Eine wilde Katze, so nennt man in der Branche
eine Ölsuche an einem Ort, wo nie zuvor gebohrt worden war. Da das nordkaspische Meer in der Sowjetunion unter Naturschutz stand, gab es
dort keine Erfahrungen mit Off-shore-Bohrungen. Booth erläutert: "Das ist ein Glücksspiel, da stehen die Chancen auf einen Treffer bei eins zu
zwanzig, nicht mehr." Begeistert von ihrer Fortune, bohrten die Geologen 40 Kilometer vom ersten Treffer entfernt, um die Ausdehnung des
Ölfelds unter dem Meer bestimmen.
Das "neue Houston"
Der Coup gelang: Wieder sprudelte das schwarze Gold. "Die chemische Zusammensetzung des Öls aus beiden Funden ist sehr ähnlich",
berichtet Booth. "Das deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um ein und dieselbe Blase handelt." Mindestens 40 Kilometer Ausdehnung
hat das Feld, vielleicht noch mehr. Experten schätzen, dass in Kashagan 30 Milliarden Barrel Erdöl verborgen liegen. Damit wäre es das
zweitgrößte Ölfeld der Erde. Nur Ghawar in Saudi-Arabien ist mit 80 Milliarden Barrel noch größer, die Felder der Nordsee bergen noch insgesamt 17 Milliarden Barrel.
Die Entdeckung von Kashagan ist nicht nur für die beteiligten Ölkonzerne eine Verheißung. Der gigantische Ölfund hat die geopolitische Balance am Kaspischen Meer ins
Wanken gebracht und eine neue, gefährliche Runde im großen Ringen der Weltmächte um Rohstoffe und Pipelines eingeläutet. Kasachstan, noch vor einem Jahrzehnt eine
rückständige Sowjetrepublik, wird sich in naher Zukunft zum größten Erdölexporteur nach Saudi Arabien entwickeln. Jeden Tag bis zu fünf Millionen Barrel könnte das Land
schon im Jahr 2010 an den Rest der Welt verkaufen.
Dem internationalen Öl-Kartell Opec bereitet diese Aussicht Kopfschmerzen: Dass sich das Nicht-Mitglied an Preisabsprachen und Förderlimits halten wird, ist mehr als
unwahrscheinlich. Zusammen mit Russland, das der Opec ebenfalls nicht angehört, könnte Kasachstan so die Macht der saudischen Scheichs über Wohl und Wehe der
westlichen Industrieländer brechen. Für jede energiehungrige Gesellschaft, allen voran die USA, ist Kasachstan dadurch strategisch sehr wichtig geworden.
Für die bislang trostlose Plattenbaustadt Atyrau bringt das dramatische Veränderungen: Plötzlich sitzen in den Tupolews aus Moskau
smarte Geschäftsleute, die während des Flugs ihre Laptops traktieren. Rechts und links der frisch geteerten Hauptstraße stehen nun große
Schilder, die den Bau neuer Banken und Bürogebäude ankündigen. So gewaltig rollt der Ölboom über Atyrau her, dass das "Wall Street
Journal" schon das "neue Houston" ausrief. Den vielen Fischern am Ural-Fluss, der hier als geografische Grenze zwischen Europa und
Asien in das Kaspische Meer mündet, lässt der Hype um das neue Öl-Dorado bisher kalt. "Hauptsache, die Ölkonzerne vergiften nicht
unsere Fische", sagt einer von ihnen. Die Sorge ist nicht aus der Luft gegriffen: Die Bohrinsel über Kashagan liegt mitten im
nordkaspischen Naturschutzgebiet, in dem mehr als 200 bedrohte Tierarten, vor allem Vögel und der kaspische Seehund, leben.
Angst vor einer "toten Zone
"Wie konnte unsere Regierung dort den Schutzstatus aufheben und Bohrrechte erteilen?", schimpft Galina Chernowa, die zusammen mit
dreißig Mitstreitern den Kampf derer in Atyrau anführt, die dem Ölboom nicht trauen. Die energische Biologin fordert einen sofortigen
Bohrstopp: "Die Ölfirmen sagen uns, dass ihre Arbeit gar keinen Schaden anrichtet, aber das stimmt hinten und vorne nicht." Das Meer sei
im Norden mit zwei bis zehn Metern Wassertiefe zu flach, um sich von Verschmutzungen je wieder zu erholen. "Wir wollen nicht, dass die Konzerne mit dem Geld
davonrennen und uns hier in einer toten Zone zurücklassen."
Dave Preston, Umweltbeauftragter von Agip in Atyrau, wiegelt ab: "Wir tun alles, um möglichst sauber zu produzieren." Abwasser gelange nicht ins Meer, auch Müll werde
an Land entsorgt. Aber Preston fügt hinzu: "Dass es zu einem Blow-out kommt, wenn Öl unkontrolliert aus der Quelle schießt, das kann man natürlich nie ausschließen."
Weit ärgeres Kopfzerbrechen als der Umweltschutz bereitet Industrie und Politikern aber die Frage, wie das Öl zu den Märkten der industrialisierten Welt gebracht werden
kann. Im Poker um Pipelines sind die kaspischen Karten seit dem Kashagan-Fund völlig neu gemischt.
Der amerikanische Ölriese Chevron, der bereits seit 1993 in einem Joint Venture mit dem staatlichen Konzern Kazmunaigaz Öl aus dem
riesigen Tengiz-Feld an der kaspischen Ostküste fördert, hat trotz unfreundlicher Kommentare aus Washington bereits eine Pipeline für mehr als
zwei Milliarden Dollar durch den kriegsgeschüttelten Nordkaukasus zum russischen Schwarzmeerhafen Novorissijsk bauen lassen. Bis zu eine
Million Barrel pro Tag kann die Leitung fassen. Im vergangenen Oktober floss das erste Öl.
Zu Asiens Märkten über die "Achse des Bösen"
"Für den Anfang könnte unsere Pipeline die Kashagan-Produktion aufnehmen, aber eine zweite Leitung ist notwendig", sagt Boris
Scherdabajew, mächtiger Präsident vom Tengizchevroil genannten US-kasachischen Gemeinschaftsunternehmen, während er im Firmenjet bei
Lachs und Sekt über die weite Steppe Kasachstans fliegt. "Noch eine Pipeline durch Russland wird die kasachische Regierung aber nicht
zulassen, dann wäre sie zu abhängig von Moskau." Schon ist von einer zweiten Röhre entlang der Baku-Ceyhan-Pipeline durch den
Süd-Kaukasus die Rede. Dafür müsste das Kashagan-Öl allerdings zunächst umständlich mit Tankern quer über das Kaspische Meer geschifft
werden.
Alle ökonomischen Fakten sprechen daher für eine Süd-Route zum Persischen Golf. Durch zwei Länder könnte sie verlaufen: durch den Iran
oder Afghanistan.
Das Mullah-Regime in Teheran hat sein Territorium mehrfach als idealen Korridor angeboten und möchte sogar eine Pipeline entlang der kaspischen Ostküste mit
finanzieren. Kasachstans Präsident Nursultan Nazarbajew hat mehrfach seine Sympathie für das Projekt erklärt, sehr zum Ärger der US-Regierung von Präsident George
W. Bush, der den Iran mehrfach als Teil einer "Achse des Bösen" bezeichnet hat und die amerikanischen Wirtschaftssanktionen gegen das Land aufrecht erhält. Sie
verbieten es US-Konzernen, Öl durch Persien zu transportieren. Doch das letzte Wort darüber, welchen Weg das Kashagan-Öl nehmen wird, haben die Kasachen. "Wir
glauben, dass die Route durch den Iran am ökonomisch sinnvollsten wäre", sagt Sabr Yessimbekow, Pipeline-Chefplaner von Präsident Nazarbajew. "Das Öl muss nach
Asien, die Märkte Europas sind übersättigt." Das Büro des 38jährigen ehemaligen Diplomaten liegt in der neuen Hauptstadt Astana, die sich Nazarbajew in froher
Erwartung des Petrolreichtums für mehrere Milliarden Dollar in die nördliche Steppe bauen lässt.
An der Wand hängt eine Karte des Landes, in der alle Pipeline-Optionen eingezeichnet sind. Darunter ist auch eine mehr als 3000 Kilometer lange
Röhre nach China. "Die Chinesen sind ganz scharf auf das Kashagan-Öl", erzählt Yessimbekow mit einem Stirnrunzeln. "Sie sind sehr aggressiv,
versuchen mit allen Mitteln, nach Kasachstan einzudringen."
Der Pipeline-Chefplaner fährt fort: "Und deswegen ist es sehr gut, dass die USA ihre Truppen in Zentralasien stationieren - sie halten die Chinesen
draußen." Der Kasache grinst unverhohlen schadenfroh: "Wer glaubt denn überhaupt, dass es den Amerikanern in diesem sogenannten
Anti-Terror-Krieg um Osama Bin Laden geht? Es geht ihnen um uns, unser Öl wollen sie haben." Yessimbekow zögert einen Moment, dann fährt sein
Finger plötzlich auf der Landkarte nach Südosten: "Durch Afghanistan könnte man die Pipeline jetzt auch wieder legen. Vielleicht subventioniert die
Uno den Bau, das wäre doch was."
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,212468,00.html
Der Kampf ums kaspische Öl (5)
Pax Americana in Zentralasien
Von Lutz C. Kleveman, Bischkek
Der Aufbau neuer US-Militärbasen in den ex-sowjetischen Republiken Zentralasiens soll vorgeblich nur der Terrorbekämpfung dienen. Doch die Stützpunkte
werden offenkundig auf Dauer errichtet, Russen und Chinesen bekunden unverhohlen ihr Misstrauen: "Die Amerikaner sind wegen des Öls da".
Langsam rollen die zwei Humvee-Militärfahrzeuge in das Dorf, irgendwo in den Bergen Kirgisiens. Zu beiden Seiten der verschlammten
Fahrbahn stehen einige ärmliche Holzhäuser, alte Leute und Kinder am Straßenrand starren reglos auf die olivgrünen Geländewagen und
ihre Insassen. Bevor Staff Sergeant Chad Bickley aussteigt, schärft er seinen Männer noch einmal den Sinn der Patrouille ein: "Denkt dran,
Jungs, wir sind hier draußen, um Freunde zu gewinnen. Wir werden Hände schütteln, winken und Candies verteilen, okay?" "Yes, Sir!",
erwidern die Soldaten und greifen nach ihren schwarzen M-16 Gewehren.
Es gehört zu den eher surrealen Anblicken der neuen globalen Pax Americana, wie Bickley und sein Trupp in Kampfmonturen nun die
Herzen kirgisischer Dorfbewohner zu erobern suchen. Bickley nimmt seine schmale Reflex-Sonnenbrille ab und geht auf eine Gruppe älterer
Männer zu: "Hi, ich heiße Chad, von der U.S. Air Force. Ich wollte mal sehen, wie es euch hier so geht im Dorf." Ein Dolmetscher
übersetzt. Die Angesprochenen schweigen, ihre Gesichter undurchdringlich bis feindselig. Endlich lässt einer ausrichten: "Gut, danke."
Unterdessen kniet Captain Todd Schrader vor zwei kleinen Jungs nieder, schultert seine M-16 und bietet ihnen
einen Schluck aus einer Flasche Koolaid an. Die Kinder sind nicht interessiert. Nun zeigt der Air Force Captain
mit Hand, Spucke und Zunge, wie man Brausepulver zu sich nimmt. Er hält ihnen das Päckchen hin. Die
Kleinen regen sich nicht. "Sie sind noch etwas schüchtern", erläutert Bickley. "Sie haben ja noch nie amerikanische Soldaten gesehen."
Nur die vielen Flugzeuge der U.S. Air Force werden sie bemerkt haben, die seit Ende einigen Monaten Tag und Nacht auf dem fünf Kilometer
entfernten Manas-Flughafen der kirgisischen Hauptstadt Bishkek landen und wieder starten. Sie bringen Soldaten des 376th Air Expeditionary
Wing und Material für den neuesten Militärstützpunkt, den Washington in Zentralasien errichtet, angeblich als weiteres Bollwerk gegen den
Terrorismus.
Auf mehrere Jahre hat die U.S.-Regierung den bislang rein zivilen Flughafen von Kirgisien gemietet, der kleinsten der fünf zentralasiatischen
Republiken, die vor zehn Jahren aus dem Trümmerhaufen der UdSSR hervorgingen. Er ergänzt die amerikanischen Basen in Usbekistan und
Tadschikistan, die im Oktober 2001 eingerichtet wurden. Es sind die ersten US-Truppen mit Kampfauftrag, die seit dem Ende des Kalten Kriegs
auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion stationiert wurden - das neue Große Spiel um die Macht in Zentralasien ist in eine
entscheidende Phase getreten.
Das Ausmaß des amerikanischen Engagements ist verblüffend: Mit Baggern, Raupen und Kränen errichtet eine Pionier-Einheit einen neuen Hangar
für Kampfjets aller Art. Es wird gehämmert und geschraubt, Bauleiter brüllen Anweisungen, ein Betonmischer kippt seine graue Ladung in ein
ausgehobenes Fundament. Die Pioniere sind eigens von der Heimatkaserne im deutschen Ramstein eingeflogen, vor einem ihrer Zelte hängt eine
Fahne des 1. FC Kaiserslautern.
Hinter dem heruntergekommenen Terminal erstrecken sich auf 37 Hektar die Quartiere: In langen Reihen stehen mehr als 200 "Harvest Falcon" und
"Force Provider"-Zelte, in denen fast 3000 Soldaten wohnen können. Soldatentrupps, darunter auch Einheiten aus Frankreich und Spanien,
marschieren kreuz und quer über den Innenhof, ihre hellen Kampfstiefel knirschen dabei im Rollsplit.
Der Held von New York als Namensgeber für die Basis
Schon am Haupttor zur Basis wird der Besucher darauf eingestimmt, worum es bei dieser Mission geht. Aus einem Haufen Ziegenbockschädel ragt
ein Schild mit der Aufschrift: "Peter J. Ganci Base". Mit belegter Stimmer erläutert Air-Force-Captain Richard Essary den Namen: "Ganci war ein
Feuerwehrmann, der im Südturm des World Trade Center fast hundert Menschenleben gerettet hat, bevor er selbst zu Tode gekommen ist. Als er
die Geschichte dieses Heldens hörte, hat unser Kommandeur entschieden, dass Gott die Basis nach Ganci benennen würde." Allerdings sei es
besser, fügt Essary hinzu, den Kommandeur nicht auf die Geschichte anzusprechen. Er werde sonst wahrscheinlich weinen müssen.
Dabei wirkt Brigadegeneral Chris Kelly, ein drahtiger Mann mit kurzgeschorenem grauen Haar und stahlblauen Augen, eher wenig zimperlich: "Wir
bauen diese Basis auf, um von hier aus alle Taliban und al-Qaida in Afghanistan auszurotten. Bis diese Mission abgeschlossen ist, werden wir hier
bleiben." Kellys Stimme klingt kampfentschlossen, was die Totenkopf-Piratenfahne vor seinem Kommando-Zelt noch unterstreicht. "Wir streiten für
eine hehre Sache", fährt der General fort, "wir führen den Willen der Welt aus."
Dass er nach 28 Jahren Militärdienst auf ehemals sowjetischem Gebiet stehen würde, hätte der heute 50-Jährige früher "nicht fünf Minuten lang" für
möglich gehalten. Ärgerlich wird Kelly allerdings, wenn man ihn auf das Gerücht anspricht, demzufolge die amerikanischen Streitkräfte neben dem
Kampf gegen den Terrorismus noch andere strategische Ziele in Mittelasien verfolgten. "Es gibt nichts Heimliches an unserer Mission. Wir
kooperieren einfach mit Nationen, die unsere Vision davon, wie die Welt aussehen sollte, teilen." Kelly dreht an seinem klobigen blauen Ring, der
ihn als Absolvent der prestigereichen Air Force Academy in Colorado Springs auszeichnet: "Außerdem kooperieren wir bei der Operation `Enduring
Freedom` mit einer multinationalen Koalition. Die Kirgisen haben uns schließlich eingeladen. Also wo ist das Problem?"
Die US-Militärbasen schüren Unruhe
Das amerikanische Vorrücken in Zentralasien beunruhigt trotz aller offiziellen Bekenntnisse zur Anti-Terror-Allianz viele Mächtige in Russland und
China. In Moskau sind Generäle und Nationalisten alarmiert, die die ehemaligen Kolonien noch immer als ihren strategischen Hinterhof betrachten.
Viele fürchten, durch Präsident Wladimir Putins kooperative Politik gegenüber den USA nach dem 11. September könne Russland nur verlieren. Für Vize-Außenminister
Viktor Kalyushny ist die Sache klar: "Wir haben bislang aufrichtig an der Seite der Amerikaner gegen die Terroristen gekämpft, aber sie müssen wieder aus Mittelasien
abziehen, sobald sie Bin Laden gefasst haben."
Nur mit Mühe findet der ehemalige Ölindustrielle Kalyushny, den Putin als Sondergesandten für das Kaspische Meer ernannt hat,
diplomatische Worte über die U.S.-Truppen: "Hat man Gäste im Haus, freut man sich zweimal: wenn sie kommen - und wenn sie wieder
gehen." Den Hinweis darauf, dass die Amerikaner ja nicht die Gäste Russlands, sondern der unabhängigen zentralasiatischen Republiken
seien, wischt Kalyushny beiseite: "Kirgisien und Usbekistan sind Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und haben
Sicherheitsverträge mit uns geschlossen." Vorsichtshalber wiederholt er dann: "Gäste sollten wissen, dass es unhöflich ist, zu lange zu
bleiben."
"China wird umzingelt"
Auch in China, dem dritten großen Spieler im Ringen um Zentralasien, ist man über die Stationierung der U.S.-Truppen in Kirgisien nicht
glücklich. Immerhin sind es von der Manas Airbase in Kirgisien zur chinesischen Grenze keine 400 Kilometer, weit weniger als bis nach
Afghanistan. Zheng Chenghu, Manager des staatlichen chinesischen Ölkonzerns CNPC in Almaty (Kasachstan), ist überzeugt: "Die
Amerikaner sind wegen des kaspischen Öls hier."
Schlechte Nachrichten seien das für den CNPC-Konzern, der selbst zwei gigantische Öl-Pipelines vom Kaspischen Meer quer durch Kasachstan bis in die westliche
Region Xingjiang bauen will. "Nun werden die zentralasiatischen Staaten noch eher dazu neigen, mit amerikanischen Ölfirmen Verträge abzuschließen - und nicht mit uns."
Für Chenghu ist klar, dass sich der amerikanische Vormarsch gegen China richtet: "Die USA haben jetzt Truppen in Japan, in Taiwan, in Südkorea, in Pakistan und hier -
China wird umzingelt."
Für die Regierungen der zentralasiatischen Staaten indes ist das amerikanische Engagement der größte Glücksfall seit Ende des Kalten Kriegs.
Washingtons wirtschaftliche und vor allem militärische Hilfe für die Region hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, auf 400 Millionen Dollar. Den
Löwenanteil erhält mit 150 Millionen Usbekistan, das zugleich geschätzte 300 Millionen Dollar Miete für die U.S. Airbase in Qarshi erhält. Auch die
deutsche Bundeswehr hat einen Luftstützpunkt im südusbekischen Termez gepachtet.
Welche Summe Washington dem restlos verarmten Kirgisien für die Manas Airbase zahlt, halten beide Seiten geheim. Bekannt ist nur, dass die
Regierung für jeden Start und jede Landung eines amerikanischen Flugzeugs 7000 Dollar einstreicht - die höchste Airport Tax der Welt.
Kirgisiens Hauptstadt Bischkek könnte ein wenig Cash gut gebrauchen. Rund um eine riesige Statue Wladimir Lenins breiten sich tristgraue
sowjetische Betonbauten aus, nur wenige Geschäfte bringen Farbe ins Stadtbild. Dennoch möchte laut Umfragen die Mehrheit der kirgisischen
Bevölkerung die amerikanischen Soldaten nicht als Nachbarn haben.
Die Menschen wollen nicht, dass unser Land die gerade gewonnene Unabhängigkeit wieder einer Großmacht opfert", glaubt Fatima Gayazova,
Chefredakteurin eines lokalen Fernsehsenders. "Aber die Amerikaner werden bleiben, solange sie wollen. Ein unruhiges Afghanistan wird ihnen immer
als perfekter Vorwand dienen, um Zentralasien zu kontrollieren"
"Staff Sergeant Bickley und seine Männer haben derweil ihre Patrouille im Dorf neben der Manas Airbase beendet und steigen wieder in ihre
Humvee-Fahrzeuge. Die einzige ernste Gefahr, der sich die U.S.-Soldaten ausgesetzt sahen, waren Schlammklumpen, geworfen von zwei kirgisischen
Lausbuben. Das Feuer wurde mit Candies erwidert. "Die Menschen hier mögen uns", sagt Bickley. "Durch unsere Patrouillen geben wir ihnen
Sicherheit." Ein Dorfbewohner, der in einem unbeobachteten Augenblick mit meiner Dolmetscherin sprechen kann, sieht das anders: "Was müssen
die Amerikaner hier mit solch großen Gewehren rumlaufen? Wer weiß, was da passieren kann, wir sorgen uns um unsere Kinder." Als Bickley und
sein Trupp aus dem Dorf fahren, winken sie den Dorfbewohnern zu. Niemand winkt zurück. Aber eigentlich ist das Bickley auch egal.
Der Kampf ums kaspische Öl (5)
Pax Americana in Zentralasien
Von Lutz C. Kleveman, Bischkek
Der Aufbau neuer US-Militärbasen in den ex-sowjetischen Republiken Zentralasiens soll vorgeblich nur der Terrorbekämpfung dienen. Doch die Stützpunkte
werden offenkundig auf Dauer errichtet, Russen und Chinesen bekunden unverhohlen ihr Misstrauen: "Die Amerikaner sind wegen des Öls da".
Langsam rollen die zwei Humvee-Militärfahrzeuge in das Dorf, irgendwo in den Bergen Kirgisiens. Zu beiden Seiten der verschlammten
Fahrbahn stehen einige ärmliche Holzhäuser, alte Leute und Kinder am Straßenrand starren reglos auf die olivgrünen Geländewagen und
ihre Insassen. Bevor Staff Sergeant Chad Bickley aussteigt, schärft er seinen Männer noch einmal den Sinn der Patrouille ein: "Denkt dran,
Jungs, wir sind hier draußen, um Freunde zu gewinnen. Wir werden Hände schütteln, winken und Candies verteilen, okay?" "Yes, Sir!",
erwidern die Soldaten und greifen nach ihren schwarzen M-16 Gewehren.
Es gehört zu den eher surrealen Anblicken der neuen globalen Pax Americana, wie Bickley und sein Trupp in Kampfmonturen nun die
Herzen kirgisischer Dorfbewohner zu erobern suchen. Bickley nimmt seine schmale Reflex-Sonnenbrille ab und geht auf eine Gruppe älterer
Männer zu: "Hi, ich heiße Chad, von der U.S. Air Force. Ich wollte mal sehen, wie es euch hier so geht im Dorf." Ein Dolmetscher
übersetzt. Die Angesprochenen schweigen, ihre Gesichter undurchdringlich bis feindselig. Endlich lässt einer ausrichten: "Gut, danke."
Unterdessen kniet Captain Todd Schrader vor zwei kleinen Jungs nieder, schultert seine M-16 und bietet ihnen
einen Schluck aus einer Flasche Koolaid an. Die Kinder sind nicht interessiert. Nun zeigt der Air Force Captain
mit Hand, Spucke und Zunge, wie man Brausepulver zu sich nimmt. Er hält ihnen das Päckchen hin. Die
Kleinen regen sich nicht. "Sie sind noch etwas schüchtern", erläutert Bickley. "Sie haben ja noch nie amerikanische Soldaten gesehen."
Nur die vielen Flugzeuge der U.S. Air Force werden sie bemerkt haben, die seit Ende einigen Monaten Tag und Nacht auf dem fünf Kilometer
entfernten Manas-Flughafen der kirgisischen Hauptstadt Bishkek landen und wieder starten. Sie bringen Soldaten des 376th Air Expeditionary
Wing und Material für den neuesten Militärstützpunkt, den Washington in Zentralasien errichtet, angeblich als weiteres Bollwerk gegen den
Terrorismus.
Auf mehrere Jahre hat die U.S.-Regierung den bislang rein zivilen Flughafen von Kirgisien gemietet, der kleinsten der fünf zentralasiatischen
Republiken, die vor zehn Jahren aus dem Trümmerhaufen der UdSSR hervorgingen. Er ergänzt die amerikanischen Basen in Usbekistan und
Tadschikistan, die im Oktober 2001 eingerichtet wurden. Es sind die ersten US-Truppen mit Kampfauftrag, die seit dem Ende des Kalten Kriegs
auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion stationiert wurden - das neue Große Spiel um die Macht in Zentralasien ist in eine
entscheidende Phase getreten.
Das Ausmaß des amerikanischen Engagements ist verblüffend: Mit Baggern, Raupen und Kränen errichtet eine Pionier-Einheit einen neuen Hangar
für Kampfjets aller Art. Es wird gehämmert und geschraubt, Bauleiter brüllen Anweisungen, ein Betonmischer kippt seine graue Ladung in ein
ausgehobenes Fundament. Die Pioniere sind eigens von der Heimatkaserne im deutschen Ramstein eingeflogen, vor einem ihrer Zelte hängt eine
Fahne des 1. FC Kaiserslautern.
Hinter dem heruntergekommenen Terminal erstrecken sich auf 37 Hektar die Quartiere: In langen Reihen stehen mehr als 200 "Harvest Falcon" und
"Force Provider"-Zelte, in denen fast 3000 Soldaten wohnen können. Soldatentrupps, darunter auch Einheiten aus Frankreich und Spanien,
marschieren kreuz und quer über den Innenhof, ihre hellen Kampfstiefel knirschen dabei im Rollsplit.
Der Held von New York als Namensgeber für die Basis
Schon am Haupttor zur Basis wird der Besucher darauf eingestimmt, worum es bei dieser Mission geht. Aus einem Haufen Ziegenbockschädel ragt
ein Schild mit der Aufschrift: "Peter J. Ganci Base". Mit belegter Stimmer erläutert Air-Force-Captain Richard Essary den Namen: "Ganci war ein
Feuerwehrmann, der im Südturm des World Trade Center fast hundert Menschenleben gerettet hat, bevor er selbst zu Tode gekommen ist. Als er
die Geschichte dieses Heldens hörte, hat unser Kommandeur entschieden, dass Gott die Basis nach Ganci benennen würde." Allerdings sei es
besser, fügt Essary hinzu, den Kommandeur nicht auf die Geschichte anzusprechen. Er werde sonst wahrscheinlich weinen müssen.
Dabei wirkt Brigadegeneral Chris Kelly, ein drahtiger Mann mit kurzgeschorenem grauen Haar und stahlblauen Augen, eher wenig zimperlich: "Wir
bauen diese Basis auf, um von hier aus alle Taliban und al-Qaida in Afghanistan auszurotten. Bis diese Mission abgeschlossen ist, werden wir hier
bleiben." Kellys Stimme klingt kampfentschlossen, was die Totenkopf-Piratenfahne vor seinem Kommando-Zelt noch unterstreicht. "Wir streiten für
eine hehre Sache", fährt der General fort, "wir führen den Willen der Welt aus."
Dass er nach 28 Jahren Militärdienst auf ehemals sowjetischem Gebiet stehen würde, hätte der heute 50-Jährige früher "nicht fünf Minuten lang" für
möglich gehalten. Ärgerlich wird Kelly allerdings, wenn man ihn auf das Gerücht anspricht, demzufolge die amerikanischen Streitkräfte neben dem
Kampf gegen den Terrorismus noch andere strategische Ziele in Mittelasien verfolgten. "Es gibt nichts Heimliches an unserer Mission. Wir
kooperieren einfach mit Nationen, die unsere Vision davon, wie die Welt aussehen sollte, teilen." Kelly dreht an seinem klobigen blauen Ring, der
ihn als Absolvent der prestigereichen Air Force Academy in Colorado Springs auszeichnet: "Außerdem kooperieren wir bei der Operation `Enduring
Freedom` mit einer multinationalen Koalition. Die Kirgisen haben uns schließlich eingeladen. Also wo ist das Problem?"
Die US-Militärbasen schüren Unruhe
Das amerikanische Vorrücken in Zentralasien beunruhigt trotz aller offiziellen Bekenntnisse zur Anti-Terror-Allianz viele Mächtige in Russland und
China. In Moskau sind Generäle und Nationalisten alarmiert, die die ehemaligen Kolonien noch immer als ihren strategischen Hinterhof betrachten.
Viele fürchten, durch Präsident Wladimir Putins kooperative Politik gegenüber den USA nach dem 11. September könne Russland nur verlieren. Für Vize-Außenminister
Viktor Kalyushny ist die Sache klar: "Wir haben bislang aufrichtig an der Seite der Amerikaner gegen die Terroristen gekämpft, aber sie müssen wieder aus Mittelasien
abziehen, sobald sie Bin Laden gefasst haben."
Nur mit Mühe findet der ehemalige Ölindustrielle Kalyushny, den Putin als Sondergesandten für das Kaspische Meer ernannt hat,
diplomatische Worte über die U.S.-Truppen: "Hat man Gäste im Haus, freut man sich zweimal: wenn sie kommen - und wenn sie wieder
gehen." Den Hinweis darauf, dass die Amerikaner ja nicht die Gäste Russlands, sondern der unabhängigen zentralasiatischen Republiken
seien, wischt Kalyushny beiseite: "Kirgisien und Usbekistan sind Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und haben
Sicherheitsverträge mit uns geschlossen." Vorsichtshalber wiederholt er dann: "Gäste sollten wissen, dass es unhöflich ist, zu lange zu
bleiben."
"China wird umzingelt"
Auch in China, dem dritten großen Spieler im Ringen um Zentralasien, ist man über die Stationierung der U.S.-Truppen in Kirgisien nicht
glücklich. Immerhin sind es von der Manas Airbase in Kirgisien zur chinesischen Grenze keine 400 Kilometer, weit weniger als bis nach
Afghanistan. Zheng Chenghu, Manager des staatlichen chinesischen Ölkonzerns CNPC in Almaty (Kasachstan), ist überzeugt: "Die
Amerikaner sind wegen des kaspischen Öls hier."
Schlechte Nachrichten seien das für den CNPC-Konzern, der selbst zwei gigantische Öl-Pipelines vom Kaspischen Meer quer durch Kasachstan bis in die westliche
Region Xingjiang bauen will. "Nun werden die zentralasiatischen Staaten noch eher dazu neigen, mit amerikanischen Ölfirmen Verträge abzuschließen - und nicht mit uns."
Für Chenghu ist klar, dass sich der amerikanische Vormarsch gegen China richtet: "Die USA haben jetzt Truppen in Japan, in Taiwan, in Südkorea, in Pakistan und hier -
China wird umzingelt."
Für die Regierungen der zentralasiatischen Staaten indes ist das amerikanische Engagement der größte Glücksfall seit Ende des Kalten Kriegs.
Washingtons wirtschaftliche und vor allem militärische Hilfe für die Region hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt, auf 400 Millionen Dollar. Den
Löwenanteil erhält mit 150 Millionen Usbekistan, das zugleich geschätzte 300 Millionen Dollar Miete für die U.S. Airbase in Qarshi erhält. Auch die
deutsche Bundeswehr hat einen Luftstützpunkt im südusbekischen Termez gepachtet.
Welche Summe Washington dem restlos verarmten Kirgisien für die Manas Airbase zahlt, halten beide Seiten geheim. Bekannt ist nur, dass die
Regierung für jeden Start und jede Landung eines amerikanischen Flugzeugs 7000 Dollar einstreicht - die höchste Airport Tax der Welt.
Kirgisiens Hauptstadt Bischkek könnte ein wenig Cash gut gebrauchen. Rund um eine riesige Statue Wladimir Lenins breiten sich tristgraue
sowjetische Betonbauten aus, nur wenige Geschäfte bringen Farbe ins Stadtbild. Dennoch möchte laut Umfragen die Mehrheit der kirgisischen
Bevölkerung die amerikanischen Soldaten nicht als Nachbarn haben.
Die Menschen wollen nicht, dass unser Land die gerade gewonnene Unabhängigkeit wieder einer Großmacht opfert", glaubt Fatima Gayazova,
Chefredakteurin eines lokalen Fernsehsenders. "Aber die Amerikaner werden bleiben, solange sie wollen. Ein unruhiges Afghanistan wird ihnen immer
als perfekter Vorwand dienen, um Zentralasien zu kontrollieren"
"Staff Sergeant Bickley und seine Männer haben derweil ihre Patrouille im Dorf neben der Manas Airbase beendet und steigen wieder in ihre
Humvee-Fahrzeuge. Die einzige ernste Gefahr, der sich die U.S.-Soldaten ausgesetzt sahen, waren Schlammklumpen, geworfen von zwei kirgisischen
Lausbuben. Das Feuer wurde mit Candies erwidert. "Die Menschen hier mögen uns", sagt Bickley. "Durch unsere Patrouillen geben wir ihnen
Sicherheit." Ein Dorfbewohner, der in einem unbeobachteten Augenblick mit meiner Dolmetscherin sprechen kann, sieht das anders: "Was müssen
die Amerikaner hier mit solch großen Gewehren rumlaufen? Wer weiß, was da passieren kann, wir sorgen uns um unsere Kinder." Als Bickley und
sein Trupp aus dem Dorf fahren, winken sie den Dorfbewohnern zu. Niemand winkt zurück. Aber eigentlich ist das Bickley auch egal.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-212658,00…
Der Kampf ums kaspische Öl (6)
Konkurrenz von der Achse des Bösen
Von Lutz C. Kleveman, Teheran
Der Iran hat wirtschaftlich die besten Karten im Großen Spiel ums kaspische Öl, und das US-Embargo gegen Teheran spielt Frankreichs Ölkonzern Elf in die
Hände. Das Regime in Teheran will mit den Mitteln des Marktes gegen die Amerikaner antreten - und freundlicher Unterstützung aus Moskau.
Es ist einer der seltenen klaren Tage in Teheran. Den sonst unerträglichen Smog treibt ein sanfter Wind aus der Stadt und selbst die
Kiefern auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Botschaft sehen heute grüner aus als sonst.
Einst, im Jahr 1979, nach der Islamischen Revolution, hielten hier radikale Studenten 50 amerikanische Diplomaten und
Botschaftsangestellte fast 500 Tage lang in als Geiseln. Am Eingang hängt neben dem zerhackten amerikanischen Staatswappen noch
immer das unvermeidliche Schild: "Tod den USA!" Doch heute residiert das iranische Militär in den prachtvollen Gebäuden und gleich
nebenan steht das Hochhaus, aus dem der Motor der iranischen Wirtschaft gesteuert wird: Die Zentrale der National Iranian Oil Company
(NIOC).
"Heute nennen wir die Botschaft nur noch die amerikanische Spionagehöhle", sagt Kasaei Zadeh und kichert. Um sie zu sehen, muss er
ganz dicht ans Fenster treten, so tief liegt das ehemalige Hoheitsgebiet der USA unter seinem geräumigen Büros im achten Stock des
Hochhauses. Zadeh ist Planungsdirektor des staatlichen Ölkonzerns und damit nicht nur ein vornehmer, sondern auch sehr mächtiger
Mann in einem Land, das nach Saudi Arabien und Russland der drittgrößte Erdölexporteur der Welt ist. Mit nachgewiesenen 93 Milliarden
Barrel Rohöl verfügt der Iran über etwa zehn Prozent der Weltvorräte.
Die gute Laune des Direktors an diesem Tag hat einen handfesten Grund: Gerade ist er von Verhandlungen mit der kasachischen Regierung in Almaty heimgekehrt und
einen lukrativen Vertrag mitgebracht. "Wir haben einen sehr guten Deal vereinbart: Die Kasachen liefern uns per Schiff kaspisches Öl für unseren dicht besiedelten Norden,
und wir verkaufen für sie die gleiche Menge unseres Öls auf dem Weltmarkt über den Hafen im Süden."
Diese Praxis, Öltausch genannt, erspart dem Iran, wie bisher eigenes Öl aus den Fördergebieten in den Wüsten im Süden des Landes
kostspielig zu den Städten im Norden zu pumpen, wo ein Großteil der mehr als 70 Millionen Iraner lebt und pro Tag etwa 1.4 Millionen Barrel Öl
verbraucht. Im Gegenzug können die zentralasiatischen Länder kurzfristig für gutes Geld ihr Rohöl verkaufen und müssen nicht warten, bis
Pipelines aus der Region bis an irgendwelche Tiefseehäfen gebaut werden.
Die US-Sanktionen gegen Iran behindern die eigenen Ölkonzerne
Schon ab Ende diesen Jahres wollen die Iraner 100.000 Barrel pro Tag übernehmen. Im kaspischen Hafen Neka wurde dafür eigens ein neuer
Terminal errichtet, von einer neuen 32-Zoll-Pipeline nach Teheran sind 42 Kilometer bereits gelegt. Zusätzlich hat die NIOC zwei neue
Raffinerien im Norden der Hauptstadt gebaut, in denen in drei Jahren pro Tag bis zu 500.000 Barrel kasachisches Öl verarbeitet werden sollen.
Der Öltausch wurde offensichtlich seit Jahren vorbereitet.
Alle Beteiligten freuen sich, nur einer nicht: die Regierung der Vereinigten Staaten. In Washington sieht man mit Argwohn, wie der als
Mullah-Staat gebrandmarkte Iran seit dem Ende des Kalten Kriegs seine wirtschaftliche und politische Macht in das ehemals sowjetische
Zentralasien ausdehnt. Gestützt auf Jahrtausendealte Bindungen der persischen Kultur und Sprache, die bis nach Indien reichen, hat sich
Teheran zu einem der einflussreichsten Akteure im neuen Großen Spiel am Kaspischen Meer gemausert. Die USA werfen dem theokratischen
Regime vor, Massenvernichtungswaffen zu bauen und Terroristen im Nahen Osten zu unterstützen.
Als Strafe hat der amerikanische Kongress im Jahre 1995 Sanktionen gegen den Iran verhängt, die es amerikanischen Firmen verbieten, Geschäfte
mit dem Land zu machen. Auch europäischen Unternehmen, die im Iran aktiv sind, droht das Gesetz mit empfindlichen Strafen in den USA.
Seitdem hält das Embargo Ölkonzerne davon ab, eine Pipeline vom Kaspischen Meer zum Persischen Golf zu bauen. Die Iran-Route wäre, wie
selbst amerikanische Ölchefs einräumen, kürzer, billiger und sicherer als alle anderen geplanten Leitungen durch Russland, die Türkei und
Afghanistan. Statt dessen unterstützt Washington seit Jahren das Pipeline-Projekt von der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku über Georgien
bis zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Seit kurzem in Bau, wird diese Röhre sowohl Russland als auch den Iran umgehen.
"Die Baku-Ceyhan-Linie wird als Industrieruine enden"
Ölchef Zadeh ficht das nicht an. "Wir werden neben dem Öltauschen eine Konkurrenz-Pipeline anbieten, unser Netz ist ja schon voll ausgebaut",
sagt er selbstbewusst. Dabei zeigt der Perser auf eine große Wandkarte Irans, auf der bestehende Leitungen durch viele kleine Gummischläuche
gekennzeichnet sind. "Wir können das kaspische Öl weitaus billiger an den Markt bringen, die Baku-Ceyhan-Leitung wird als riesige Industrieruine
enden." Die Regierung Kasachstans, der ölreichsten zentralasiatischen Republik, hat bereits mehrfach reges Interesse an der Route durch den Iran
verkündet - zum Ärger Washingtons. Zadeh ist sich sicher: "Die Kasachen sind von den USA enttäuscht, sie suchen neue Freunde in der Region.
Das sind wir."
Europäische Firmen, die sich trotz Protesten und Drohungen aus Washington nicht an die U.S.-Sanktionen gebunden fühlen, nutzen die Abwesenheit amerikanischer
Konkurrenz auf dem iranischen Ölmarkt. Der französische TotalFinaElf fertigt derzeit eine Machbarkeitsstudie über eine Pipeline an, die entlang der kaspischen Ostküste
von Kasachstan über Turkmenistan durch den Iran verlaufen soll. "Wir unterstützen die Firma darin", sagt eine französischer Diplomat in Teheran. "Die Sanktionen der USA
akzeptieren wir nicht. Überhaupt lehnen wir die amerikanische Logik ab, dass der Iran isoliert werden muss."
Vielmehr versuche Frankreich, wie auch andere europäische Länder, Teheran wirtschaftlich einzubinden und so die liberalen Reformer um den seit
fünf Jahren regierenden Präsident Mohammad Chatami in ihrem erbitterten Machtkampf mit den konservativen Mullahs zu unterstützen. Zwar
weigern sich die Theokraten weiter beharrlich, das Land für ausländische Direktinvestitionen zu öffnen. Aber zumindest ist der Handel zwischen
Frankreich und dem Iran im vergangenen Jahr um die Hälfte gewachsen.
Sorge bereitet internationalen Beobachtern allerdings der eskalierende Streit zwischen dem Iran und seinem Nachbarn Aserbaidschan über Ölfelder
im südlichen Teil des Kaspischen Meers. Beide Länder beanspruchen die Vorkommen für sich, der Iran besteht auf zwanzig Prozent der Fläche.
Um diese Position durchzusetzen, zwangen im Juli vergangenen Jahres iranische Kanonenboote und Kampfjets ein aserbaidschanisches
Forschungsschiff von BPAmoco, Probebohrungen im Kaspischen Meer abzubrechen. Washington, mächtiger Verbündeter Aserbaidschans,
protestierte energisch aber ohne Erfolg.
Im Bündnis mit Russland gegen die amerikanische Dominanz
Auch russische Diplomaten versuchen, die iranische Regierung zu beschwichtigen und zu friedlichen Verhandlungen anzuhalten. "Das ist in
unserem Interesse, denn einen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Iran würden die USA sofort als Vorwand nehmen, Truppen in den Kaukasus zu
schicken", sagt Alexander Maryasow, russischer Botschafter in Teheran. Der großgewachsene, aristokratisch wirkende Diplomat ist Herr über eine
palastartige Gesandtschaft mit Kiefernpark mitten in der Stadt. Ein historischer Ort: hier verhandelten und übernachteten 1943 die Alliierten
Roosevelt, Churchill und Stalin auf ihrer ersten großen Kriegskonferenz. Maryasow macht aus seinem alten und neuen Feindbild keinen Hehl: "Jetzt
haben die Amerikaner ja schon Truppen in Zentralasien. Die glauben doch, sie seien mächtig genug, unilateral alles zu tun und zu lassen, was ihnen gefällt."
Wenn es darum geht, den langen Arm der Vereinigten Staaten aus der Kaspischen Region rauszuhalten, arbeiten der Iran und Russland eng
zusammen. Das amerikanische Treiben in der Region lässt beide Länder ihre Jahrhunderte währende Feindschaft vergessen. Seit sie zudem keine
gemeinsame Grenze mehr haben, sind die Beziehungen nahezu freundschaftlich geworden: Moskau liefert im großen Stil Waffen an den Iran und hilft
beim Bau seines ersten Atomkraftwerks. Amerikanische Proteste gegen die neue Allianz lassen beide Seiten kalt.
Auch der gemeinsame Widerstand gegen die von Washington unterstützte Baku-Ceyhan Pipeline schweißt die ungleichen Partner und Konkurrenten
auf dem Ölmarkt enger zusammen. "Wir sind gegen dieses Projekt, weil es politische Motive hat. Eine Pipeline-Route durch den Iran hingegen würde
Russland unterstützen", sagt Maryasow, fügt aber gleich hinzu: "Natürlich erst, wenn alle russischen Pipelines voll ausgelastet sind."
Wie auch die meisten westlichen Diplomaten in Teheran, hat der 54jährige nichts als Kopfschütteln übrig für US-Präsident George Bushs, der den Iran
in eine "Achse des Bösen" mit dem Irak und Nordkorea einordnet. "Diese Doppelmoral! Dahinter steckt die israelische Lobby in Washington. Die
Amerikaner haben in ihren Beziehungen zum Iran bis heute nichts dazugelernt. Sie sind engstirnig, sie schauen nicht genau hin, sie hören nicht zu."
Eine Einschätzung, die den meisten Iranern aus dem Herzen spricht. Entsetzt sehen sie, wie die Drohgebärden aus Washington den konservativen
Mullahs im Machtkampf mit den liberalen Reformern zuspielen. "Das amerikanische Feindbild ist doch das einzige, was das alte Regime noch an der
Macht hält", sagt Amir Loghmany, langjähriger Politikchef von "Hamshari", der größten Tageszeitung im Iran. "Damit bremsen die Mullahs immer
wieder die Reformen für mehr Freiheit bei uns." Den demokratischen Wandel seit der ersten Wahl Chatamis 1997 hält der promovierte
Politikwissenschaftler, der in den 1960ern in Würzburg und Frankfurt studiert hat, allerdings nicht mehr für umkehrbar. "Die jungen Menschen lassen
sich nicht mehr alles gefallen, und sie wenden sich vom Islam ab."
Tatsächlich sind die Kopftücher der jungen Frauen, die uns in den platanenbestandenen Straßen im vornehmen Norden Teherans begegnen, längst
weit aus der Stirn gerutscht und erlauben den Blick - undenkbar noch vor wenigen Jahren - auf viel schönes, langes Haar. Dazu schminken viele Mädchen ihre Gesichter,
und unter den schwarzen Tschador-Gewändern tragen sie modische Turnschuhe und Jeans. Im Park um den ehemaligen Sommerpalast des 1979 gestürzten Schahs Reza
Pahlavi halten junge Paare ungeniert Händchen und tauschen Zärtlichkeiten aus. Von der Welt des Ayatollah Khomeini hat sich die nach der Revolution geborene
Generation, die heute mehr als die Hälfte der iranischen Bevölkerung ausmacht, weit entfernt.
"Es liegt nur an Washington"
Wie der innenpolitische Kampf im Iran auch immer ausgehen mag: Auch bei einem endgültigen Sieg der Reformer wäre beileibe nicht gewiss, dass sich die Beziehungen
des Iran zu den USA normalisieren würden. "Es liegt nur an Washington, das Verhältnis zu uns zu verbessern", sagt Loghmany, während er aus einer Flasche Coca-Cola,
Produkt einer vor den Sanktionen gebauten Fabrik im Iran, trinkt. "Die Amerikaner müssten uns Respekt zeigen und uns gleichberechtigt behandeln." Schließlich sei der
Iran eine stolze Nation. Aus dem Ringen um die Macht am Kaspischen Meer jedenfalls ist der Iran als mächtiger Spieler nicht mehr wegzudenken, glaubt Loghmany. "Egal,
was die Amerikaner machen: Ohne uns ist in Zentralasien keine Rechnung zu machen."
Der Kampf ums kaspische Öl (6)
Konkurrenz von der Achse des Bösen
Von Lutz C. Kleveman, Teheran
Der Iran hat wirtschaftlich die besten Karten im Großen Spiel ums kaspische Öl, und das US-Embargo gegen Teheran spielt Frankreichs Ölkonzern Elf in die
Hände. Das Regime in Teheran will mit den Mitteln des Marktes gegen die Amerikaner antreten - und freundlicher Unterstützung aus Moskau.
Es ist einer der seltenen klaren Tage in Teheran. Den sonst unerträglichen Smog treibt ein sanfter Wind aus der Stadt und selbst die
Kiefern auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Botschaft sehen heute grüner aus als sonst.
Einst, im Jahr 1979, nach der Islamischen Revolution, hielten hier radikale Studenten 50 amerikanische Diplomaten und
Botschaftsangestellte fast 500 Tage lang in als Geiseln. Am Eingang hängt neben dem zerhackten amerikanischen Staatswappen noch
immer das unvermeidliche Schild: "Tod den USA!" Doch heute residiert das iranische Militär in den prachtvollen Gebäuden und gleich
nebenan steht das Hochhaus, aus dem der Motor der iranischen Wirtschaft gesteuert wird: Die Zentrale der National Iranian Oil Company
(NIOC).
"Heute nennen wir die Botschaft nur noch die amerikanische Spionagehöhle", sagt Kasaei Zadeh und kichert. Um sie zu sehen, muss er
ganz dicht ans Fenster treten, so tief liegt das ehemalige Hoheitsgebiet der USA unter seinem geräumigen Büros im achten Stock des
Hochhauses. Zadeh ist Planungsdirektor des staatlichen Ölkonzerns und damit nicht nur ein vornehmer, sondern auch sehr mächtiger
Mann in einem Land, das nach Saudi Arabien und Russland der drittgrößte Erdölexporteur der Welt ist. Mit nachgewiesenen 93 Milliarden
Barrel Rohöl verfügt der Iran über etwa zehn Prozent der Weltvorräte.
Die gute Laune des Direktors an diesem Tag hat einen handfesten Grund: Gerade ist er von Verhandlungen mit der kasachischen Regierung in Almaty heimgekehrt und
einen lukrativen Vertrag mitgebracht. "Wir haben einen sehr guten Deal vereinbart: Die Kasachen liefern uns per Schiff kaspisches Öl für unseren dicht besiedelten Norden,
und wir verkaufen für sie die gleiche Menge unseres Öls auf dem Weltmarkt über den Hafen im Süden."
Diese Praxis, Öltausch genannt, erspart dem Iran, wie bisher eigenes Öl aus den Fördergebieten in den Wüsten im Süden des Landes
kostspielig zu den Städten im Norden zu pumpen, wo ein Großteil der mehr als 70 Millionen Iraner lebt und pro Tag etwa 1.4 Millionen Barrel Öl
verbraucht. Im Gegenzug können die zentralasiatischen Länder kurzfristig für gutes Geld ihr Rohöl verkaufen und müssen nicht warten, bis
Pipelines aus der Region bis an irgendwelche Tiefseehäfen gebaut werden.
Die US-Sanktionen gegen Iran behindern die eigenen Ölkonzerne
Schon ab Ende diesen Jahres wollen die Iraner 100.000 Barrel pro Tag übernehmen. Im kaspischen Hafen Neka wurde dafür eigens ein neuer
Terminal errichtet, von einer neuen 32-Zoll-Pipeline nach Teheran sind 42 Kilometer bereits gelegt. Zusätzlich hat die NIOC zwei neue
Raffinerien im Norden der Hauptstadt gebaut, in denen in drei Jahren pro Tag bis zu 500.000 Barrel kasachisches Öl verarbeitet werden sollen.
Der Öltausch wurde offensichtlich seit Jahren vorbereitet.
Alle Beteiligten freuen sich, nur einer nicht: die Regierung der Vereinigten Staaten. In Washington sieht man mit Argwohn, wie der als
Mullah-Staat gebrandmarkte Iran seit dem Ende des Kalten Kriegs seine wirtschaftliche und politische Macht in das ehemals sowjetische
Zentralasien ausdehnt. Gestützt auf Jahrtausendealte Bindungen der persischen Kultur und Sprache, die bis nach Indien reichen, hat sich
Teheran zu einem der einflussreichsten Akteure im neuen Großen Spiel am Kaspischen Meer gemausert. Die USA werfen dem theokratischen
Regime vor, Massenvernichtungswaffen zu bauen und Terroristen im Nahen Osten zu unterstützen.
Als Strafe hat der amerikanische Kongress im Jahre 1995 Sanktionen gegen den Iran verhängt, die es amerikanischen Firmen verbieten, Geschäfte
mit dem Land zu machen. Auch europäischen Unternehmen, die im Iran aktiv sind, droht das Gesetz mit empfindlichen Strafen in den USA.
Seitdem hält das Embargo Ölkonzerne davon ab, eine Pipeline vom Kaspischen Meer zum Persischen Golf zu bauen. Die Iran-Route wäre, wie
selbst amerikanische Ölchefs einräumen, kürzer, billiger und sicherer als alle anderen geplanten Leitungen durch Russland, die Türkei und
Afghanistan. Statt dessen unterstützt Washington seit Jahren das Pipeline-Projekt von der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku über Georgien
bis zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan. Seit kurzem in Bau, wird diese Röhre sowohl Russland als auch den Iran umgehen.
"Die Baku-Ceyhan-Linie wird als Industrieruine enden"
Ölchef Zadeh ficht das nicht an. "Wir werden neben dem Öltauschen eine Konkurrenz-Pipeline anbieten, unser Netz ist ja schon voll ausgebaut",
sagt er selbstbewusst. Dabei zeigt der Perser auf eine große Wandkarte Irans, auf der bestehende Leitungen durch viele kleine Gummischläuche
gekennzeichnet sind. "Wir können das kaspische Öl weitaus billiger an den Markt bringen, die Baku-Ceyhan-Leitung wird als riesige Industrieruine
enden." Die Regierung Kasachstans, der ölreichsten zentralasiatischen Republik, hat bereits mehrfach reges Interesse an der Route durch den Iran
verkündet - zum Ärger Washingtons. Zadeh ist sich sicher: "Die Kasachen sind von den USA enttäuscht, sie suchen neue Freunde in der Region.
Das sind wir."
Europäische Firmen, die sich trotz Protesten und Drohungen aus Washington nicht an die U.S.-Sanktionen gebunden fühlen, nutzen die Abwesenheit amerikanischer
Konkurrenz auf dem iranischen Ölmarkt. Der französische TotalFinaElf fertigt derzeit eine Machbarkeitsstudie über eine Pipeline an, die entlang der kaspischen Ostküste
von Kasachstan über Turkmenistan durch den Iran verlaufen soll. "Wir unterstützen die Firma darin", sagt eine französischer Diplomat in Teheran. "Die Sanktionen der USA
akzeptieren wir nicht. Überhaupt lehnen wir die amerikanische Logik ab, dass der Iran isoliert werden muss."
Vielmehr versuche Frankreich, wie auch andere europäische Länder, Teheran wirtschaftlich einzubinden und so die liberalen Reformer um den seit
fünf Jahren regierenden Präsident Mohammad Chatami in ihrem erbitterten Machtkampf mit den konservativen Mullahs zu unterstützen. Zwar
weigern sich die Theokraten weiter beharrlich, das Land für ausländische Direktinvestitionen zu öffnen. Aber zumindest ist der Handel zwischen
Frankreich und dem Iran im vergangenen Jahr um die Hälfte gewachsen.
Sorge bereitet internationalen Beobachtern allerdings der eskalierende Streit zwischen dem Iran und seinem Nachbarn Aserbaidschan über Ölfelder
im südlichen Teil des Kaspischen Meers. Beide Länder beanspruchen die Vorkommen für sich, der Iran besteht auf zwanzig Prozent der Fläche.
Um diese Position durchzusetzen, zwangen im Juli vergangenen Jahres iranische Kanonenboote und Kampfjets ein aserbaidschanisches
Forschungsschiff von BPAmoco, Probebohrungen im Kaspischen Meer abzubrechen. Washington, mächtiger Verbündeter Aserbaidschans,
protestierte energisch aber ohne Erfolg.
Im Bündnis mit Russland gegen die amerikanische Dominanz
Auch russische Diplomaten versuchen, die iranische Regierung zu beschwichtigen und zu friedlichen Verhandlungen anzuhalten. "Das ist in
unserem Interesse, denn einen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Iran würden die USA sofort als Vorwand nehmen, Truppen in den Kaukasus zu
schicken", sagt Alexander Maryasow, russischer Botschafter in Teheran. Der großgewachsene, aristokratisch wirkende Diplomat ist Herr über eine
palastartige Gesandtschaft mit Kiefernpark mitten in der Stadt. Ein historischer Ort: hier verhandelten und übernachteten 1943 die Alliierten
Roosevelt, Churchill und Stalin auf ihrer ersten großen Kriegskonferenz. Maryasow macht aus seinem alten und neuen Feindbild keinen Hehl: "Jetzt
haben die Amerikaner ja schon Truppen in Zentralasien. Die glauben doch, sie seien mächtig genug, unilateral alles zu tun und zu lassen, was ihnen gefällt."
Wenn es darum geht, den langen Arm der Vereinigten Staaten aus der Kaspischen Region rauszuhalten, arbeiten der Iran und Russland eng
zusammen. Das amerikanische Treiben in der Region lässt beide Länder ihre Jahrhunderte währende Feindschaft vergessen. Seit sie zudem keine
gemeinsame Grenze mehr haben, sind die Beziehungen nahezu freundschaftlich geworden: Moskau liefert im großen Stil Waffen an den Iran und hilft
beim Bau seines ersten Atomkraftwerks. Amerikanische Proteste gegen die neue Allianz lassen beide Seiten kalt.
Auch der gemeinsame Widerstand gegen die von Washington unterstützte Baku-Ceyhan Pipeline schweißt die ungleichen Partner und Konkurrenten
auf dem Ölmarkt enger zusammen. "Wir sind gegen dieses Projekt, weil es politische Motive hat. Eine Pipeline-Route durch den Iran hingegen würde
Russland unterstützen", sagt Maryasow, fügt aber gleich hinzu: "Natürlich erst, wenn alle russischen Pipelines voll ausgelastet sind."
Wie auch die meisten westlichen Diplomaten in Teheran, hat der 54jährige nichts als Kopfschütteln übrig für US-Präsident George Bushs, der den Iran
in eine "Achse des Bösen" mit dem Irak und Nordkorea einordnet. "Diese Doppelmoral! Dahinter steckt die israelische Lobby in Washington. Die
Amerikaner haben in ihren Beziehungen zum Iran bis heute nichts dazugelernt. Sie sind engstirnig, sie schauen nicht genau hin, sie hören nicht zu."
Eine Einschätzung, die den meisten Iranern aus dem Herzen spricht. Entsetzt sehen sie, wie die Drohgebärden aus Washington den konservativen
Mullahs im Machtkampf mit den liberalen Reformern zuspielen. "Das amerikanische Feindbild ist doch das einzige, was das alte Regime noch an der
Macht hält", sagt Amir Loghmany, langjähriger Politikchef von "Hamshari", der größten Tageszeitung im Iran. "Damit bremsen die Mullahs immer
wieder die Reformen für mehr Freiheit bei uns." Den demokratischen Wandel seit der ersten Wahl Chatamis 1997 hält der promovierte
Politikwissenschaftler, der in den 1960ern in Würzburg und Frankfurt studiert hat, allerdings nicht mehr für umkehrbar. "Die jungen Menschen lassen
sich nicht mehr alles gefallen, und sie wenden sich vom Islam ab."
Tatsächlich sind die Kopftücher der jungen Frauen, die uns in den platanenbestandenen Straßen im vornehmen Norden Teherans begegnen, längst
weit aus der Stirn gerutscht und erlauben den Blick - undenkbar noch vor wenigen Jahren - auf viel schönes, langes Haar. Dazu schminken viele Mädchen ihre Gesichter,
und unter den schwarzen Tschador-Gewändern tragen sie modische Turnschuhe und Jeans. Im Park um den ehemaligen Sommerpalast des 1979 gestürzten Schahs Reza
Pahlavi halten junge Paare ungeniert Händchen und tauschen Zärtlichkeiten aus. Von der Welt des Ayatollah Khomeini hat sich die nach der Revolution geborene
Generation, die heute mehr als die Hälfte der iranischen Bevölkerung ausmacht, weit entfernt.
"Es liegt nur an Washington"
Wie der innenpolitische Kampf im Iran auch immer ausgehen mag: Auch bei einem endgültigen Sieg der Reformer wäre beileibe nicht gewiss, dass sich die Beziehungen
des Iran zu den USA normalisieren würden. "Es liegt nur an Washington, das Verhältnis zu uns zu verbessern", sagt Loghmany, während er aus einer Flasche Coca-Cola,
Produkt einer vor den Sanktionen gebauten Fabrik im Iran, trinkt. "Die Amerikaner müssten uns Respekt zeigen und uns gleichberechtigt behandeln." Schließlich sei der
Iran eine stolze Nation. Aus dem Ringen um die Macht am Kaspischen Meer jedenfalls ist der Iran als mächtiger Spieler nicht mehr wegzudenken, glaubt Loghmany. "Egal,
was die Amerikaner machen: Ohne uns ist in Zentralasien keine Rechnung zu machen."
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,213352,00.html
Der Kampf ums kaspische Öl (7)
Agentennest am Knotenpunkt
Von Lutz C. Kleveman, Herat
Nach dem Ende des Krieges wird die westafghanische Großstadt Herat die strategische Machtbasis an einer Pipeline-Trasse, für die Amerikas Öl-Industrie
schon seit zehn Jahren ficht. Und der legendäre Mudschaheddin-Fürst Ismail Khan steht zwischen allen Fronten.
Die Gespräche verstummen schon, da ist Khan noch kilometerweit entfernt. Nur die Motoren seines Konvois sind leise zu hören, als die Kolonne
sich über eine Sandpiste dem kleinen Kiefern-Park vor der Stadt nähert. Dennoch richten sich die ersten der gut 200 versammelten Mudschaheddin
auf, streichen ihre olivgrünen Kampfanzüge und ihre langen grauen Bärte glatt, umfassen ihre Gewehre mit beiden Händen und stehen stramm.
Hinter ihnen tummeln sich einige hundert Menschen, viele Graubärte mit Turbanen, aber auch Frauen in hellblauen Burqa-Gewändern und Kinder
sind darunter. Es ist Nawruz, der erste Tag des Neuen Jahres nach dem persischen Sonnenkalender, 1381 nach Geburt des Propheten
Mohammed.
Die Einwohner von Herat, der uralten und größten Stadt im Westen Afghanistans, verbringen den Tag traditionell beim Picknick im Freien - zum
ersten Mal wieder seit dem Sturz der Taliban-Herrscher, die alle Neujahrsbräuche als unislamisch verboten hatten. Grund genug für Ismail Khan,
den legendären Mudschaheddin-Warlord und neuen alten Herrscher von Herat, persönlich den kurz zuvor von Landminen geräumten Park wieder zu
eröffnen.
Khan, genannt der "Löwe von Herat" ist aus seinem Bergversteck zurückgekehrt und erneut zu einem der mächtigsten Regionalfürsten
Afghanistans aufgestiegen. Wie ein Monarch herrscht der 56jährige in dieser Westprovinz an der Grenze zum Iran und schert sich wenig um die
schwache Zentralregierung in Kabul - sehr zum Missfallen der US-Regierung, die in dem Tadschiken einen Verbündeten des Mullah-Regimes in
Teheran sehen. Das hat den Gotteskämpfer jahrelang unterstützt und ihm mehrfach Exil gewährt. Mit Khans Hilfe mische sich Teheran auch jetzt
wieder in die inneren Angelegenheiten seines östlichen Nachbarlands ein, um ein friedliches, geeintes Afghanistan zu verhindern, lautet der Vorwurf aus Washington.
Angeblich versorgen die Iraner Khans Guerilla-Armee noch immer mit Waffen und Geld.
Ein Motiv dafür gäbe es. Herat ist der strategische Knotenpunkt für die beiden Hauptstraßen in den Iran und nach Turkmenistan. Darum ist ein
erbitterter, wenngleich verborgen ausgetragener Kampf um die Vorherrschaft in der Stadt ausgebrochen. Er könnte entscheidend sein für den
Ausgang des neuen "Great Game" um die Macht in Zentralasien, denn direkt an Herat vorbei führt die Route zweier geplanter Pipelines für Gas
und Öl vom Kaspischen Meer zum Indischen Ozean. "Die Stadt wimmelt nur so von Agenten, so muss es in Casablanca in den frühen 1940ern
gewesen sein", sagt ein westlicher Diplomat. "Die Amerikaner verstärken ihre Präsenz mit jeder Woche und beobachten ganz genau, was die
Iraner hier anstellen."
Mit rasselndem Motor biegt der braune Toyota-Geländewagen des Khans in den Park ein, dicht gefolgt von drei roten Pickup-Trucks, auf denen
grimmig aussehende Kämpfer mit Kalaschnikows und Panzerfäusten hocken. Obwohl von kleinem Wuchs, strahlt der Khan in seinem hellen
Umhang unübersehbar Autorität aus. Mit dem langen schneeweißen Bart würde er jedes Kind des Abendlands an den Weihnachtsmann
erinnern, trüge er nicht den gescheckten Turban. Die versammelten Mudschaheddin verbeugen sich respektvoll. Dabei legt jeder die rechte
Hand auf seine Brust, zum Zeichen der Aufrichtigkeit und Treue. "Allahu akbar!", ruft die Menge dreimal.
Viele sind Weggefährten seit 1979, als der damalige Armeeoffizier Khan den Dschihad, den Glaubenskrieg,
gegen die sowjetischen Invasoren aufnahm. Während des Bürgerkriegs, der nach dem Abzug der sowjetischen
Truppen 1989 und dem Sturz des kommunistischen Regimes 1991 im Land tobte, verübten Khans Einheiten
weniger scheußliche Verbrechen als andere. Im Jahre 1995 überließ der Tadschike Herat den überlegenen paschtunischen Taliban-Truppen
fast kampflos und zog mit seinen Kämpfern in den Iran. Dort bildeten die Wächter der Revolution, der erzkonservative Teil der iranischen
Armee, viele der besten Partisanen Khans für den Kampf gegen die Taliban aus und versorgten sie mit Waffen und Geld. Außerdem
nahmen die persischen Nachbarn mehr als zwei Millionen afghanische Flüchtlinge auf, die die Vereinten Nationen jetzt in ihre Dörfer
zurückbringt.
"Die heimkehrenden Flüchtlinge werden die Verbindungen zum Iran noch verstärken, und unter ihnen werden viele iranische Agenten sein",
glaubt Jan Malekzade, politischer Berater der Uno-Mission in Herat und bestätigt jüngste Berichte über Waffenschmuggel aus dem Iran:
"Wir wissen von mehreren LKW, die mit brandneuen halbautomatischen Gewehren der Marke MP-5 beladen waren. Außerdem haben
Khans Soldaten neue Uniformen bekommen." Gerüchte kursierten, dass die persischen Mullahs Khan Geld schicken, mit dem er sich
weiter die Treue seiner Truppen erkaufen kann. "Ob Khan sie tatsächlich der Zentralregierung unterstellen wird, ist sehr unsicher. Tatsächlich baut er seine Armee noch
aus", berichtet Uno-Diplomat Malekzade. "Es hat schon wieder erste Kampfhandlungen mit Paschtunen an der Grenze zur Provinz Kandahar gegeben."
"Die Iraner führen nichts gutes im Schilde"
Viele Heratis sehen die politischen Spiele ihres Herrschers mit Sorge. Zwar gilt Herat, berühmt für seine timuridische Moschee und fünf riesige Minarette, seit jeher kulturell
als persische Stadt, aus der bedeutende Literaten und Künstler hervorgegangen sind. Die Einwohner sprechen wie Iraner Farsi und sehen iranisches Fernsehen. Auch im
Handel war Teheran der Region immer näher als das jenseits der Paropamisus-Berge liegende Kabul. Aber gleichzeitig misstraut man in Herat den Iranern, die auf
Afghanen seit jeher wie auf arme Vetter herabsehen. "Die Iraner führen nichts Gutes mit uns im Schilde", sagt eine afghanische Lehrerin in Herat. "Wir müssen uns gut mit
Kabul stellen, damit wir Geld von dort bekommen." Sie meint einen Teil der $4.5 Milliarden, die die internationalen Gemeinschaft Afghanistan für den Wiederaufbau
versprochen hat.
Aber auch das geheimdienstliche Treiben der Amerikaner betrachtet man in Herat mit Skepsis. Zwar sind keine uniformierten US-Militärs in der Stadt zu sehen, aber kaum
einer der vielen zivil gekleideten Amerikaner kann seine Anwesenheit glaubhaft erklären. Viele behaupten, obskuren humanitären Organisationen anzugehören. "Wenn man
Operation `Enduring Freedom` als humanitären Einsatz definiert, stimmt das sogar", frotzelt ein europäischer Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Ihr Quartier hat die CIA, wie
mittlerweile jedes Kind in Herat weiß, in einem ehemaligen Gästehaus Ismail Khans eingerichtet. Es liegt an einem Berghang - bezeichnenderweise direkt oberhalb der
Residenz des Emirs. Von dort aus können die Agenten über die gesamte Oasenstadt bis zur iranischen Grenze spähen.
So bleibt Afghanistan, wegen seiner strategisch zentralen Position in Asien seit der Invasion Alexanders des Großen umkämpft, noch immer Spielball fremder Mächte. Die
im Westen weit verbreitete Ansicht, ein 23 Jahre währender "Bürgerkrieg" habe Afghanistan zerstört, ist irreleitend.
Immer waren es die Nachbarländer und Supermächte, die - stets mit Hilfe lokaler Stellvertreter - den Konflikt nach ihren Interessen schufen
und schürten. So bildete der pakistanische Geheimdienst Interservice Intelligence (ISI) Mitte der 1990er die Taliban mit Hilfe Saudi Arabiens
aus und versorgte sie mit Waffen und Geld. Die USA billigten das Treiben ihrer Verbündeten stillschweigend.
Ein Grund dafür waren amerikanische Pipeline-Pläne. Im Oktober 1995 unterzeichneten Manager des US-Ölkonzern Unocal - mit Wissen
der US-Regierung - mit dem turkmenischen Diktator Nyazow ein Abkommen, um zwei Pipelines für Gas und Öl von Turkmenistan bis zur
Küste Pakistans zu bauen, quer durch einen afghanischen Korridor von Herat nach Khandahar. Unocals Versuche, die afghanischen
Bürgerkriegsparteien zu einem für das Projekt notwendigen Friedensschluss zu bewegen, scheiterten jedoch. Zwar waren die Taliban, deren
Schutzmacht Pakistan dringend Energieressourcen brauchte, von dem Projekt begeistert. Die Führer der Nordallianz wollten jedoch von
einem Waffenstillstand nichts wissen. Hinter dieser Ablehnung standen die Verbündeten der Nordallianz: Russland und der Iran. Der
Verdacht liegt nahe, dass sie so die Unocal-Pipeline verhindern wollten.
Moskau und Teheran haben ihre eigenen Pipeline-Pläne
Russlands Regenten haben bis heute kein Interesse daran, dass die Turkmenen eine Exportalternative zu den russischen Pipelines bekommen. Irans Ölbosse haben selbst
die Absicht, Gas nach Pakistan zu verkaufen. Mit Hilfe britischer Firmen plant Teheran, für drei Milliarden Dollar eine Pipeline vom Pars-Feld im Persischen Golf bis ins
pakistanische Karachi zu bauen. Eine eigene afghanische Röhre stünde in direkter Konkurrenz zu dem Projekt. So schamlos trugen die Nachbarländer ihre
Interessenskämpfe auf dem Rücken der Afghanen aus, dass Uno-Generalsekretär Kofi Annan 1998 warnte, Afghanistan verkomme zur "Bühne für eine neue Variante des
`Great Game`". Als im selben Jahr die USA erstmals Ausbildungslager der Al Qaida in Afghanistan angriffen, war Unocal aber gezwungen, die Pipeline-Pläne auf Eis zu
legen.
Nun, nach dem Einmarsch amerikanischer Anti-Terror-Streitkräfte in das Land, könnten Ölkonzerne das Vorhaben wieder hervorholen. Ismail Khan
wundert sich daher kaum, dass seine Stadt wie im 19. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt des "Great Game" zwischen Russen und Briten, in ein
geopolitisches Kreuzfeuer geraten ist: "Herat ist seit jeher eine sehr besondere Stadt, die eine Schlüsselposition zwischen Zentralasien und Pakistan
besitzt. Die Pläne für eine Pipeline durch die Gegend zeigen das - sie ist ein sehr aufregendes und wichtiges Projekt für uns." Von der Terrasse seiner
Residenz, wo der Warlord an diesem milden Abend Tee trinkt, kann er die geplante Trasse durch das Flusstal des Hari Rud überblicken.
Wirtschaftlich und politisch sei die Röhre wichtig für die Region, denn sie würde die Beziehungen zwischen Afghanistan und seinen Nachbarländern
Turkmenistan und Pakistan verbessern. "Wir werden, wenn es irgend geht, dieses Projekt ermöglichen."
Dass der Iran an dieser Route wenig Interesse haben kann, verschweigt Khan lieber. Überhaupt spielt er seine iranische Connection herunter: "Die
Iraner sind gute Nachbarn, mehr nicht." Schließlich bestehe eine 700 Kilometer lange gemeinsame Grenze, und der Iran sei ein guter Markt für
afghanische Produkte. Natürlich zähle auch die jüngste Vergangenheit: "Der Iran hat den Kampf der Mudschaheddin unterstützt, wie andere Länder
auch." Die Vorwürfe der USA, er habe noch in diesem Jahr Waffen von den Iranern erhalten, wischt Khan beiseite. "Wir hatten 23 Jahre Krieg - wir
haben genug Waffen hier und brauchen keine neuen." Niemand in Herat, so beteuert der "Emir", wolle dem Iran eine Rolle in afghanischen
Angelegenheiten geben. "Nach den Erfahrungen der Russen und der Pakistan mit uns müsste jeder Nachbar wissen, dass es sich nicht auszahlt,
sich bei uns einzumischen."
Die Frage, ob das auch für die amerikanischen Truppen gelte, beantwortet Khan vorsichtig: ",Ich sehe die Amerikaner nicht als Invasoren oder
Besatzer. Ich will sie nicht nach ihren Taten der Vergangenheit beurteilen. Zuletzt haben sie eine positive Rolle im Kampf gegen Taliban und Al-Qaida
gespielt." Sobald sie alle Terroristen besiegt hätten, betont Khan, müssten die US-Truppen Afghanistan wieder verlassen. "Bleiben sie gegen den
Willen der Afghanen, könnten sie schnell das gleiche Schicksal wie die Russen ereilen." Durch das Fenster im Raum sind zwei Männer zu sehen, die
auf dem Balkon des von der CIA-bezogenen Gästehauses stehen und Khan mit Ferngläsern beobachten.
Der Kampf ums kaspische Öl (7)
Agentennest am Knotenpunkt
Von Lutz C. Kleveman, Herat
Nach dem Ende des Krieges wird die westafghanische Großstadt Herat die strategische Machtbasis an einer Pipeline-Trasse, für die Amerikas Öl-Industrie
schon seit zehn Jahren ficht. Und der legendäre Mudschaheddin-Fürst Ismail Khan steht zwischen allen Fronten.
Die Gespräche verstummen schon, da ist Khan noch kilometerweit entfernt. Nur die Motoren seines Konvois sind leise zu hören, als die Kolonne
sich über eine Sandpiste dem kleinen Kiefern-Park vor der Stadt nähert. Dennoch richten sich die ersten der gut 200 versammelten Mudschaheddin
auf, streichen ihre olivgrünen Kampfanzüge und ihre langen grauen Bärte glatt, umfassen ihre Gewehre mit beiden Händen und stehen stramm.
Hinter ihnen tummeln sich einige hundert Menschen, viele Graubärte mit Turbanen, aber auch Frauen in hellblauen Burqa-Gewändern und Kinder
sind darunter. Es ist Nawruz, der erste Tag des Neuen Jahres nach dem persischen Sonnenkalender, 1381 nach Geburt des Propheten
Mohammed.
Die Einwohner von Herat, der uralten und größten Stadt im Westen Afghanistans, verbringen den Tag traditionell beim Picknick im Freien - zum
ersten Mal wieder seit dem Sturz der Taliban-Herrscher, die alle Neujahrsbräuche als unislamisch verboten hatten. Grund genug für Ismail Khan,
den legendären Mudschaheddin-Warlord und neuen alten Herrscher von Herat, persönlich den kurz zuvor von Landminen geräumten Park wieder zu
eröffnen.
Khan, genannt der "Löwe von Herat" ist aus seinem Bergversteck zurückgekehrt und erneut zu einem der mächtigsten Regionalfürsten
Afghanistans aufgestiegen. Wie ein Monarch herrscht der 56jährige in dieser Westprovinz an der Grenze zum Iran und schert sich wenig um die
schwache Zentralregierung in Kabul - sehr zum Missfallen der US-Regierung, die in dem Tadschiken einen Verbündeten des Mullah-Regimes in
Teheran sehen. Das hat den Gotteskämpfer jahrelang unterstützt und ihm mehrfach Exil gewährt. Mit Khans Hilfe mische sich Teheran auch jetzt
wieder in die inneren Angelegenheiten seines östlichen Nachbarlands ein, um ein friedliches, geeintes Afghanistan zu verhindern, lautet der Vorwurf aus Washington.
Angeblich versorgen die Iraner Khans Guerilla-Armee noch immer mit Waffen und Geld.
Ein Motiv dafür gäbe es. Herat ist der strategische Knotenpunkt für die beiden Hauptstraßen in den Iran und nach Turkmenistan. Darum ist ein
erbitterter, wenngleich verborgen ausgetragener Kampf um die Vorherrschaft in der Stadt ausgebrochen. Er könnte entscheidend sein für den
Ausgang des neuen "Great Game" um die Macht in Zentralasien, denn direkt an Herat vorbei führt die Route zweier geplanter Pipelines für Gas
und Öl vom Kaspischen Meer zum Indischen Ozean. "Die Stadt wimmelt nur so von Agenten, so muss es in Casablanca in den frühen 1940ern
gewesen sein", sagt ein westlicher Diplomat. "Die Amerikaner verstärken ihre Präsenz mit jeder Woche und beobachten ganz genau, was die
Iraner hier anstellen."
Mit rasselndem Motor biegt der braune Toyota-Geländewagen des Khans in den Park ein, dicht gefolgt von drei roten Pickup-Trucks, auf denen
grimmig aussehende Kämpfer mit Kalaschnikows und Panzerfäusten hocken. Obwohl von kleinem Wuchs, strahlt der Khan in seinem hellen
Umhang unübersehbar Autorität aus. Mit dem langen schneeweißen Bart würde er jedes Kind des Abendlands an den Weihnachtsmann
erinnern, trüge er nicht den gescheckten Turban. Die versammelten Mudschaheddin verbeugen sich respektvoll. Dabei legt jeder die rechte
Hand auf seine Brust, zum Zeichen der Aufrichtigkeit und Treue. "Allahu akbar!", ruft die Menge dreimal.
Viele sind Weggefährten seit 1979, als der damalige Armeeoffizier Khan den Dschihad, den Glaubenskrieg,
gegen die sowjetischen Invasoren aufnahm. Während des Bürgerkriegs, der nach dem Abzug der sowjetischen
Truppen 1989 und dem Sturz des kommunistischen Regimes 1991 im Land tobte, verübten Khans Einheiten
weniger scheußliche Verbrechen als andere. Im Jahre 1995 überließ der Tadschike Herat den überlegenen paschtunischen Taliban-Truppen
fast kampflos und zog mit seinen Kämpfern in den Iran. Dort bildeten die Wächter der Revolution, der erzkonservative Teil der iranischen
Armee, viele der besten Partisanen Khans für den Kampf gegen die Taliban aus und versorgten sie mit Waffen und Geld. Außerdem
nahmen die persischen Nachbarn mehr als zwei Millionen afghanische Flüchtlinge auf, die die Vereinten Nationen jetzt in ihre Dörfer
zurückbringt.
"Die heimkehrenden Flüchtlinge werden die Verbindungen zum Iran noch verstärken, und unter ihnen werden viele iranische Agenten sein",
glaubt Jan Malekzade, politischer Berater der Uno-Mission in Herat und bestätigt jüngste Berichte über Waffenschmuggel aus dem Iran:
"Wir wissen von mehreren LKW, die mit brandneuen halbautomatischen Gewehren der Marke MP-5 beladen waren. Außerdem haben
Khans Soldaten neue Uniformen bekommen." Gerüchte kursierten, dass die persischen Mullahs Khan Geld schicken, mit dem er sich
weiter die Treue seiner Truppen erkaufen kann. "Ob Khan sie tatsächlich der Zentralregierung unterstellen wird, ist sehr unsicher. Tatsächlich baut er seine Armee noch
aus", berichtet Uno-Diplomat Malekzade. "Es hat schon wieder erste Kampfhandlungen mit Paschtunen an der Grenze zur Provinz Kandahar gegeben."
"Die Iraner führen nichts gutes im Schilde"
Viele Heratis sehen die politischen Spiele ihres Herrschers mit Sorge. Zwar gilt Herat, berühmt für seine timuridische Moschee und fünf riesige Minarette, seit jeher kulturell
als persische Stadt, aus der bedeutende Literaten und Künstler hervorgegangen sind. Die Einwohner sprechen wie Iraner Farsi und sehen iranisches Fernsehen. Auch im
Handel war Teheran der Region immer näher als das jenseits der Paropamisus-Berge liegende Kabul. Aber gleichzeitig misstraut man in Herat den Iranern, die auf
Afghanen seit jeher wie auf arme Vetter herabsehen. "Die Iraner führen nichts Gutes mit uns im Schilde", sagt eine afghanische Lehrerin in Herat. "Wir müssen uns gut mit
Kabul stellen, damit wir Geld von dort bekommen." Sie meint einen Teil der $4.5 Milliarden, die die internationalen Gemeinschaft Afghanistan für den Wiederaufbau
versprochen hat.
Aber auch das geheimdienstliche Treiben der Amerikaner betrachtet man in Herat mit Skepsis. Zwar sind keine uniformierten US-Militärs in der Stadt zu sehen, aber kaum
einer der vielen zivil gekleideten Amerikaner kann seine Anwesenheit glaubhaft erklären. Viele behaupten, obskuren humanitären Organisationen anzugehören. "Wenn man
Operation `Enduring Freedom` als humanitären Einsatz definiert, stimmt das sogar", frotzelt ein europäischer Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Ihr Quartier hat die CIA, wie
mittlerweile jedes Kind in Herat weiß, in einem ehemaligen Gästehaus Ismail Khans eingerichtet. Es liegt an einem Berghang - bezeichnenderweise direkt oberhalb der
Residenz des Emirs. Von dort aus können die Agenten über die gesamte Oasenstadt bis zur iranischen Grenze spähen.
So bleibt Afghanistan, wegen seiner strategisch zentralen Position in Asien seit der Invasion Alexanders des Großen umkämpft, noch immer Spielball fremder Mächte. Die
im Westen weit verbreitete Ansicht, ein 23 Jahre währender "Bürgerkrieg" habe Afghanistan zerstört, ist irreleitend.
Immer waren es die Nachbarländer und Supermächte, die - stets mit Hilfe lokaler Stellvertreter - den Konflikt nach ihren Interessen schufen
und schürten. So bildete der pakistanische Geheimdienst Interservice Intelligence (ISI) Mitte der 1990er die Taliban mit Hilfe Saudi Arabiens
aus und versorgte sie mit Waffen und Geld. Die USA billigten das Treiben ihrer Verbündeten stillschweigend.
Ein Grund dafür waren amerikanische Pipeline-Pläne. Im Oktober 1995 unterzeichneten Manager des US-Ölkonzern Unocal - mit Wissen
der US-Regierung - mit dem turkmenischen Diktator Nyazow ein Abkommen, um zwei Pipelines für Gas und Öl von Turkmenistan bis zur
Küste Pakistans zu bauen, quer durch einen afghanischen Korridor von Herat nach Khandahar. Unocals Versuche, die afghanischen
Bürgerkriegsparteien zu einem für das Projekt notwendigen Friedensschluss zu bewegen, scheiterten jedoch. Zwar waren die Taliban, deren
Schutzmacht Pakistan dringend Energieressourcen brauchte, von dem Projekt begeistert. Die Führer der Nordallianz wollten jedoch von
einem Waffenstillstand nichts wissen. Hinter dieser Ablehnung standen die Verbündeten der Nordallianz: Russland und der Iran. Der
Verdacht liegt nahe, dass sie so die Unocal-Pipeline verhindern wollten.
Moskau und Teheran haben ihre eigenen Pipeline-Pläne
Russlands Regenten haben bis heute kein Interesse daran, dass die Turkmenen eine Exportalternative zu den russischen Pipelines bekommen. Irans Ölbosse haben selbst
die Absicht, Gas nach Pakistan zu verkaufen. Mit Hilfe britischer Firmen plant Teheran, für drei Milliarden Dollar eine Pipeline vom Pars-Feld im Persischen Golf bis ins
pakistanische Karachi zu bauen. Eine eigene afghanische Röhre stünde in direkter Konkurrenz zu dem Projekt. So schamlos trugen die Nachbarländer ihre
Interessenskämpfe auf dem Rücken der Afghanen aus, dass Uno-Generalsekretär Kofi Annan 1998 warnte, Afghanistan verkomme zur "Bühne für eine neue Variante des
`Great Game`". Als im selben Jahr die USA erstmals Ausbildungslager der Al Qaida in Afghanistan angriffen, war Unocal aber gezwungen, die Pipeline-Pläne auf Eis zu
legen.
Nun, nach dem Einmarsch amerikanischer Anti-Terror-Streitkräfte in das Land, könnten Ölkonzerne das Vorhaben wieder hervorholen. Ismail Khan
wundert sich daher kaum, dass seine Stadt wie im 19. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt des "Great Game" zwischen Russen und Briten, in ein
geopolitisches Kreuzfeuer geraten ist: "Herat ist seit jeher eine sehr besondere Stadt, die eine Schlüsselposition zwischen Zentralasien und Pakistan
besitzt. Die Pläne für eine Pipeline durch die Gegend zeigen das - sie ist ein sehr aufregendes und wichtiges Projekt für uns." Von der Terrasse seiner
Residenz, wo der Warlord an diesem milden Abend Tee trinkt, kann er die geplante Trasse durch das Flusstal des Hari Rud überblicken.
Wirtschaftlich und politisch sei die Röhre wichtig für die Region, denn sie würde die Beziehungen zwischen Afghanistan und seinen Nachbarländern
Turkmenistan und Pakistan verbessern. "Wir werden, wenn es irgend geht, dieses Projekt ermöglichen."
Dass der Iran an dieser Route wenig Interesse haben kann, verschweigt Khan lieber. Überhaupt spielt er seine iranische Connection herunter: "Die
Iraner sind gute Nachbarn, mehr nicht." Schließlich bestehe eine 700 Kilometer lange gemeinsame Grenze, und der Iran sei ein guter Markt für
afghanische Produkte. Natürlich zähle auch die jüngste Vergangenheit: "Der Iran hat den Kampf der Mudschaheddin unterstützt, wie andere Länder
auch." Die Vorwürfe der USA, er habe noch in diesem Jahr Waffen von den Iranern erhalten, wischt Khan beiseite. "Wir hatten 23 Jahre Krieg - wir
haben genug Waffen hier und brauchen keine neuen." Niemand in Herat, so beteuert der "Emir", wolle dem Iran eine Rolle in afghanischen
Angelegenheiten geben. "Nach den Erfahrungen der Russen und der Pakistan mit uns müsste jeder Nachbar wissen, dass es sich nicht auszahlt,
sich bei uns einzumischen."
Die Frage, ob das auch für die amerikanischen Truppen gelte, beantwortet Khan vorsichtig: ",Ich sehe die Amerikaner nicht als Invasoren oder
Besatzer. Ich will sie nicht nach ihren Taten der Vergangenheit beurteilen. Zuletzt haben sie eine positive Rolle im Kampf gegen Taliban und Al-Qaida
gespielt." Sobald sie alle Terroristen besiegt hätten, betont Khan, müssten die US-Truppen Afghanistan wieder verlassen. "Bleiben sie gegen den
Willen der Afghanen, könnten sie schnell das gleiche Schicksal wie die Russen ereilen." Durch das Fenster im Raum sind zwei Männer zu sehen, die
auf dem Balkon des von der CIA-bezogenen Gästehauses stehen und Khan mit Ferngläsern beobachten.
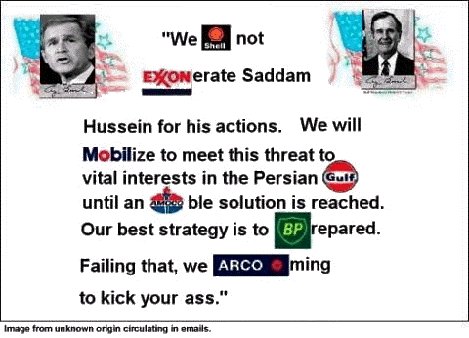
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 191 | ||
| 98 | ||
| 71 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 47 | ||
| 42 | ||
| 33 | ||
| 28 | ||
| 27 |
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 27 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 16 |





















