Katastrophe ... ? - welche Katastrophe ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 09.10.02 12:17:08 von
neuester Beitrag 20.01.06 20:57:33 von
neuester Beitrag 20.01.06 20:57:33 von
Beiträge: 1.264
ID: 643.906
ID: 643.906
Aufrufe heute: 0
Gesamt: 75.427
Gesamt: 75.427
Aktive User: 0
ISIN: XD0002747026 · WKN: CG3AB0 · Symbol: GLDUZ
2.328,89
USD
-2,10 %
-49,93 USD
Letzter Kurs 23.05.24 L&S Exchange
Neuigkeiten
| TitelBeiträge |
|---|
23.05.24 · wallstreetONLINE Redaktion |
00:15 Uhr · Swiss Resource Capital AG Anzeige |
23.05.24 · Redaktion dts |
Werte aus der Branche Rohstoffe
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 11.294,00 | +30,57 | |
| 0,7750 | +20,16 | |
| 0,5600 | +19,15 | |
| 0,7700 | +16,67 | |
| 2,7400 | +13,69 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 0,7500 | -9,09 | |
| 0,5800 | -9,38 | |
| 9,8300 | -9,73 | |
| 0,6548 | -11,57 | |
| 177,35 | -19,75 |
.
Ich weiß ja nicht, ob es Euch auch so geht:
Ich schmeiße gerade meinen PC an, rufe die einschlägigen Börsenseiten ab,
sehe den DAX in Richtung 2500 dümpeln und über Amerika baut sich wieder mal eine Sturmfront auf.
Alles bestens also ?
Als "Goldbug" habe ich doch meine Schäfchen im Trockenen, - was kann denn da schlimmstenfalls passieren ?
- Doch nichts wirklich Ernstes !?
Dann lehnen wir uns mal zurück und schauen mit kribbelnder Begeisterung der Achterbahn bei der Talfahrt zu ...
Ich blicke aus dem Fenster – hier in Hamburg strahlt gerade die Sonne –
unten vor dem Haus schiebt eine Mutter ihren Kinderwagen und nebenan scherzen die Monteure auf dem Baugerüst.
Katastrophe ? – Welche Katastrophe ?
Es ist so unwirklich, das Ganze ! Was sehe ich da auf meinem Bildschirm:
kleine Zahlenkolonnen, dünne Striche – und damit soll sich der Untergang des Abendlandes ankündigen ?
- Das ist doch alles nur ein Videogame !
– Mann, Junge, wach auf, - Du träumst !
Eigentlich hasse ich Untergangspropheten, denn sie instrumentalisieren meist
nur die Ängste der weniger abgebrühten Zeitgenossen für eigene Interessen.
Aber diesmal ... ?

25. November 1973 - Autofreie Autobahn bei Hannover:
Polizisten kontrollieren das erste Sonntags-Fahrverbot
in der Bundesrepublik.
Ich war noch ein Kind, damals 1973, als die Autobahnen aufgrund der Ölkrise am Sonntag gesperrt wurden.
Und das war vermutlich noch harmlos ...
Angst ? – Ich doch nicht ! ... ?
Konradi
Ich weiß ja nicht, ob es Euch auch so geht:
Ich schmeiße gerade meinen PC an, rufe die einschlägigen Börsenseiten ab,
sehe den DAX in Richtung 2500 dümpeln und über Amerika baut sich wieder mal eine Sturmfront auf.
Alles bestens also ?
Als "Goldbug" habe ich doch meine Schäfchen im Trockenen, - was kann denn da schlimmstenfalls passieren ?
- Doch nichts wirklich Ernstes !?
Dann lehnen wir uns mal zurück und schauen mit kribbelnder Begeisterung der Achterbahn bei der Talfahrt zu ...
Ich blicke aus dem Fenster – hier in Hamburg strahlt gerade die Sonne –
unten vor dem Haus schiebt eine Mutter ihren Kinderwagen und nebenan scherzen die Monteure auf dem Baugerüst.
Katastrophe ? – Welche Katastrophe ?
Es ist so unwirklich, das Ganze ! Was sehe ich da auf meinem Bildschirm:
kleine Zahlenkolonnen, dünne Striche – und damit soll sich der Untergang des Abendlandes ankündigen ?
- Das ist doch alles nur ein Videogame !
– Mann, Junge, wach auf, - Du träumst !
Eigentlich hasse ich Untergangspropheten, denn sie instrumentalisieren meist
nur die Ängste der weniger abgebrühten Zeitgenossen für eigene Interessen.
Aber diesmal ... ?

25. November 1973 - Autofreie Autobahn bei Hannover:
Polizisten kontrollieren das erste Sonntags-Fahrverbot
in der Bundesrepublik.
Ich war noch ein Kind, damals 1973, als die Autobahnen aufgrund der Ölkrise am Sonntag gesperrt wurden.
Und das war vermutlich noch harmlos ...
Angst ? – Ich doch nicht ! ... ?
Konradi
When Wells Go Dry
Energy: The rate of global oil production will start to fall in just a few years, says a controversial geologist. And alternative technologies aren’t ready yet
By Fred Guterl
NEWSWEEK
Arpil 15 issue — As Kenneth Deffeyes walks the five blocks from the Princeton University campus to his home, he veers sharply through a parking lot and then without warning takes a diagonal path across a side street. He doesn’t seem to be paying any particular attention to where his sneaker-clad feet are taking him. His hands are tucked firmly in his parka, his eyes are looking up at a cloudless blue sky and his mind is where it usually is: on the world’s supply of oil. In particular, Deffeyes is trying to explain why anybody should believe that the entire human enterprise of oil exploration—the search for reserves, the drilling of wells, the extraction of crude and all the attendant calculations of supply and demand—why this whole messy business should obey a simple but elegant piece of mathematics.
Energy: The rate of global oil production will start to fall in just a few years, says a controversial geologist. And alternative technologies aren’t ready yet
By Fred Guterl
NEWSWEEK
Arpil 15 issue — As Kenneth Deffeyes walks the five blocks from the Princeton University campus to his home, he veers sharply through a parking lot and then without warning takes a diagonal path across a side street. He doesn’t seem to be paying any particular attention to where his sneaker-clad feet are taking him. His hands are tucked firmly in his parka, his eyes are looking up at a cloudless blue sky and his mind is where it usually is: on the world’s supply of oil. In particular, Deffeyes is trying to explain why anybody should believe that the entire human enterprise of oil exploration—the search for reserves, the drilling of wells, the extraction of crude and all the attendant calculations of supply and demand—why this whole messy business should obey a simple but elegant piece of mathematics.
The World`s Last
Barrel of Oil
By Stephen Leeb
Editor, Personal Finance
Demand for energy is rising 4% a year. At that rate, we will pump our last barrel of
oil out of Mother Earth in 2029.
Some numbers are true but irrelevant. You just read one of them.
Yes, if we continue using oil at today’s growing rate, our original world supply will be half
gone by 2010—and all gone by about 2029. That’s extremely serious.
But oil will never actually run out. It will simply get more and more hideously expensive.
Already, the good, cheap stuff is long gone. In the ‘20s, farmers could take crude oil out
of some wells and put it straight into their tractors. As late as 1970, we could still pump all
the pretty-good oil we wanted at a cost of three or four dollars a barrel. No longer. Now
we’re into “needs some work” oil, and we sometimes have to go down four miles to get it.
That’s a mighty expensive straw!
So what does this mean to you? It means...
Your Life Is About to
Change—for the
Better
Unless you’re in really crummy shape, you’re going to live to see major shifts in your
lifestyle—and everyone else’s. For starters:
1. Over the next ten years, oil will easily surpass $150 a barrel. It has to. Why? Well, for
one example out of many, China will be importing as much oil as we do by 2012 or 2015.
And ten years after that, they’ll be using twice what we do.
Will that bother you? Not overly. You’re going to be one of the few who can still afford
it! That’s because you will have made pig-sized profits on oil and other energy issues by
tracking closely with the ever-changing advice in Personal Finance in the zigzag markets
of the “oughts” (from 2000 to 2009).
NOTE: You will not be able to simply buy and hold oil-related stocks. They are far too
cyclical. You must track carefully with good advice.
2. Your current car could wind up in a museum. After researchers develop another power
source, the government might even outlaw most vehicles that use gas or diesel. At the
least, they will pass oppressive laws making it inconvenient for you to drive around in
your antiquated, high-octane buggy.
3. Instead, you will be the proud owner of a pollution-free set of wheels that will take you
coast to coast on about $10 worth of fuel. You won’t miss your old Smogmobile.
4. The world’s remaining oil will be carefully transformed into actual, solid goods—which
should make the late Shah of Iran rest easy in his grave. (He always complained that oil is
far too valuable to burn up in cars.)
5. Meanwhile, back in the sandpiles of the Middle East, our Arab friends will be cashing in
their very large collection of petrodollars to build industrial plants and universities in order
to recycle their people into happy, productive citizens of a wider world instead of isolated
radicals who lash out at things foreign because they don’t understand them.
6. But the Arabs, Persians, Nigerians, Venezuelans, and other oil producers will be just
one part of a worldwide economic boom. Cheap energy will make the Industrial
Revolution look like a non-event.
7. You’ll be able to breathe again. The air in L.A. will make you think you’re in a
Colorado forest.
Naturally, you’re asking yourself at this point...
Barrel of Oil
By Stephen Leeb
Editor, Personal Finance
Demand for energy is rising 4% a year. At that rate, we will pump our last barrel of
oil out of Mother Earth in 2029.
Some numbers are true but irrelevant. You just read one of them.
Yes, if we continue using oil at today’s growing rate, our original world supply will be half
gone by 2010—and all gone by about 2029. That’s extremely serious.
But oil will never actually run out. It will simply get more and more hideously expensive.
Already, the good, cheap stuff is long gone. In the ‘20s, farmers could take crude oil out
of some wells and put it straight into their tractors. As late as 1970, we could still pump all
the pretty-good oil we wanted at a cost of three or four dollars a barrel. No longer. Now
we’re into “needs some work” oil, and we sometimes have to go down four miles to get it.
That’s a mighty expensive straw!
So what does this mean to you? It means...
Your Life Is About to
Change—for the
Better
Unless you’re in really crummy shape, you’re going to live to see major shifts in your
lifestyle—and everyone else’s. For starters:
1. Over the next ten years, oil will easily surpass $150 a barrel. It has to. Why? Well, for
one example out of many, China will be importing as much oil as we do by 2012 or 2015.
And ten years after that, they’ll be using twice what we do.
Will that bother you? Not overly. You’re going to be one of the few who can still afford
it! That’s because you will have made pig-sized profits on oil and other energy issues by
tracking closely with the ever-changing advice in Personal Finance in the zigzag markets
of the “oughts” (from 2000 to 2009).
NOTE: You will not be able to simply buy and hold oil-related stocks. They are far too
cyclical. You must track carefully with good advice.
2. Your current car could wind up in a museum. After researchers develop another power
source, the government might even outlaw most vehicles that use gas or diesel. At the
least, they will pass oppressive laws making it inconvenient for you to drive around in
your antiquated, high-octane buggy.
3. Instead, you will be the proud owner of a pollution-free set of wheels that will take you
coast to coast on about $10 worth of fuel. You won’t miss your old Smogmobile.
4. The world’s remaining oil will be carefully transformed into actual, solid goods—which
should make the late Shah of Iran rest easy in his grave. (He always complained that oil is
far too valuable to burn up in cars.)
5. Meanwhile, back in the sandpiles of the Middle East, our Arab friends will be cashing in
their very large collection of petrodollars to build industrial plants and universities in order
to recycle their people into happy, productive citizens of a wider world instead of isolated
radicals who lash out at things foreign because they don’t understand them.
6. But the Arabs, Persians, Nigerians, Venezuelans, and other oil producers will be just
one part of a worldwide economic boom. Cheap energy will make the Industrial
Revolution look like a non-event.
7. You’ll be able to breathe again. The air in L.A. will make you think you’re in a
Colorado forest.
Naturally, you’re asking yourself at this point...
Ich bin ziemlich baff, wie ABSOLUT AHNUNGSLOS selbst studierte VWLer bei diesem Thema sind. Die, mit denen ich gesprochen habe, glauben nicht im Traum an eine erste Krise oder meinen, dass ein 1929 mit den heutigen Mitteln und Instrumenten eigentlich auszuschliessen ist...
@Konradi
Schade eigentlich, daß Du politisch so daneben bist.
Übrigens: Wenn alte Menschen (ich) Angst haben, kann
man das vielleicht verstehen.
Aber junge Menschen ??
Du hast noch eine Menge Versuche (Chancen) frei.
Der gute Werner Otto war mindestens 5 x pleite, bevor er seinen Saftladen zum Laufen bekommen hat.
 ... Arrogant ?!
... Arrogant ?!
deempf
Schade eigentlich, daß Du politisch so daneben bist.

Übrigens: Wenn alte Menschen (ich) Angst haben, kann
man das vielleicht verstehen.
Aber junge Menschen ??
Du hast noch eine Menge Versuche (Chancen) frei.
Der gute Werner Otto war mindestens 5 x pleite, bevor er seinen Saftladen zum Laufen bekommen hat.
 ... Arrogant ?!
... Arrogant ?! deempf
@konradi
"Ich blicke aus dem Fenster – hier in Hamburg strahlt gerade die Sonne –
unten vor dem Haus schiebt eine Mutter ihren Kinderwagen und nebenan scherzen die Monteure auf dem Baugerüst.
Katastrophe ? – Welche Katastrophe ?
Es ist so unwirklich, das Ganze ! "
Dir mag es vielleicht unwirklich entscheiden (mir eigentlich auch), aber mitttlerweile bin ich zu der Erkenntnis gelangt, daß die Masse der Menschen eben gar nicht versteht, was momentan vor sich geht. Deine Monteure werden solange auf dem Gerüst scherzen, bis sie sich plötzlich vor dem Arbeitsamt sehen. Die Mütter werden lachend mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben, denn unsere ach so soziale Bundesregierung sorgt ja für sozialen Ausgleich und man kann sich über Kindergeld, Kitas und Spielstrassen freuen. Was wirklich vor sich geht, begreifen diese Menschen doch eh nicht. Sie werden es nie verstehen und wollen es insgeheim auch nicht verstehen. Ihre kleine Welt ist ja scheinbar in Ordnung und man freut sich über den nächsten Urlaub oder fängt an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen...im Grunde sind die Menschen wie eine Herde Gänse: Die schnattern auch fröhlich umher und wissen nicht, was ihnen am St. Martinstag bevorsteht.
"Angst ? – Ich doch nicht ! ... ?"
Pah, wer hat denn Angst? Ich bin sicher, daß wir mit dem Gold einen Schnitt machen werden, den man nur einmal in einer Generation realisieren kann. Wenn nicht, was haben wir denn zu verlieren? Das was alle verlieren werden, also was solls? Nimm es mit einem Lachen und einen blumigen Kommentar hin: Wir kommen aus dem Nichts und werden uns in Nichts auflösen....und einen Sinn für die ganze Zeit dazwischen: Gibt es nicht!
Also was haben wir zu verlieren?....Nichts, absolut nichts!
Gruß
Sovereign
"Ich blicke aus dem Fenster – hier in Hamburg strahlt gerade die Sonne –
unten vor dem Haus schiebt eine Mutter ihren Kinderwagen und nebenan scherzen die Monteure auf dem Baugerüst.
Katastrophe ? – Welche Katastrophe ?
Es ist so unwirklich, das Ganze ! "
Dir mag es vielleicht unwirklich entscheiden (mir eigentlich auch), aber mitttlerweile bin ich zu der Erkenntnis gelangt, daß die Masse der Menschen eben gar nicht versteht, was momentan vor sich geht. Deine Monteure werden solange auf dem Gerüst scherzen, bis sie sich plötzlich vor dem Arbeitsamt sehen. Die Mütter werden lachend mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben, denn unsere ach so soziale Bundesregierung sorgt ja für sozialen Ausgleich und man kann sich über Kindergeld, Kitas und Spielstrassen freuen. Was wirklich vor sich geht, begreifen diese Menschen doch eh nicht. Sie werden es nie verstehen und wollen es insgeheim auch nicht verstehen. Ihre kleine Welt ist ja scheinbar in Ordnung und man freut sich über den nächsten Urlaub oder fängt an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen...im Grunde sind die Menschen wie eine Herde Gänse: Die schnattern auch fröhlich umher und wissen nicht, was ihnen am St. Martinstag bevorsteht.

"Angst ? – Ich doch nicht ! ... ?"
Pah, wer hat denn Angst? Ich bin sicher, daß wir mit dem Gold einen Schnitt machen werden, den man nur einmal in einer Generation realisieren kann. Wenn nicht, was haben wir denn zu verlieren? Das was alle verlieren werden, also was solls? Nimm es mit einem Lachen und einen blumigen Kommentar hin: Wir kommen aus dem Nichts und werden uns in Nichts auflösen....und einen Sinn für die ganze Zeit dazwischen: Gibt es nicht!
Also was haben wir zu verlieren?....Nichts, absolut nichts!
Gruß
Sovereign
@Reikianer
"Ich bin ziemlich baff, wie ABSOLUT AHNUNGSLOS selbst studierte VWLer bei diesem Thema sind."
Was erwartest Du? Es entspricht der gängigen Lehrmeinung der VWL, daß durch den Einsatz geld- und zinspolitischer Instrumente der Notenbanken die Wirtschaft stabilisert werden kann. Ansonsten muß eben der alte Keynes herhalten, um fiskalpolitische Maßßnahmen und staatliche Interventionen zu begründen....Es gibt eine Fraktion (eine sehr kleine Fraktion) unter den VWL-Profs die anderer Meinung sind, und die die Gefahren der golbalen Zinsspirale aufzeigen. Trotzdem sind dies intellektuelle Outcasts, die keine größere Breitenwirkung erzielen.
@deempf
"Wenn alte Menschen (ich) Angst haben, kann
man das vielleicht verstehen."
Warum soll man das verstehen? Hast Du Angst? Vielleicht deshalb weil das Unausweichliche immer näher rückt, und man sich nicht mit der Idee des Nichts abfinden kann? Dann aber ab in die nächste Kirche mit Dir, und stimm ein paar "Dankelieder" an, wenn Dich das beruhigt.
"Ich bin ziemlich baff, wie ABSOLUT AHNUNGSLOS selbst studierte VWLer bei diesem Thema sind."
Was erwartest Du? Es entspricht der gängigen Lehrmeinung der VWL, daß durch den Einsatz geld- und zinspolitischer Instrumente der Notenbanken die Wirtschaft stabilisert werden kann. Ansonsten muß eben der alte Keynes herhalten, um fiskalpolitische Maßßnahmen und staatliche Interventionen zu begründen....Es gibt eine Fraktion (eine sehr kleine Fraktion) unter den VWL-Profs die anderer Meinung sind, und die die Gefahren der golbalen Zinsspirale aufzeigen. Trotzdem sind dies intellektuelle Outcasts, die keine größere Breitenwirkung erzielen.
@deempf
"Wenn alte Menschen (ich) Angst haben, kann
man das vielleicht verstehen."
Warum soll man das verstehen? Hast Du Angst? Vielleicht deshalb weil das Unausweichliche immer näher rückt, und man sich nicht mit der Idee des Nichts abfinden kann? Dann aber ab in die nächste Kirche mit Dir, und stimm ein paar "Dankelieder" an, wenn Dich das beruhigt.

@Sovereign: Kannst Du mir ein paar Namen dieser Fraktion nennen? In Princeton gab`s da jemanden, oder? Zwei der VWLer befinden sich noch im Studium, je früher man ihnen die Augen öffnet, desto besser. Danke!
Ich bin nur ein Werkzeug der Vorsehung.
Ist diese erfüllt,werde ich zerbrechen wie Glas.
Napoleon
Ist diese erfüllt,werde ich zerbrechen wie Glas.
Napoleon
@reikianer
Nicht so einfach hier konkrete Empfehlungen zu geben. Im Grunde muß man die Lehrmeinung der "Chikagoer Schule" der Monetaristen und insb. von Milton Friedman nur eng auslegen, und man erkennt die systemsprengenden Potentiale expansiver Kreditausweitungen.
Einer meiner Profs an der Uni Kiel: Manfred Willms ist ein Monetarist und ein erklärter Euro-Gegner. Sein Buch "Internationale Währungspolitik" ist in diesem Zusammenhang recht empfehlenswert (allerdings muß man ZWISCHEN den Zeilen dieses Standardlehrbuchs lesen).
Ansonsten habe ich an der Uni gehört: Wohltmann (100-iger Kenynesianer der nach Staatseingriffen schreit...nicht so meine Sache), Horst Siebert (ja, der Ex-Wirtschaftsweise und Freihandelsfanatiker...bekannt aus Funk und Fernsehen), Schatz (postuliert die Wettbewerbsfreiheit, ist jetzt bei einem Arbeitgeberverband soweit ich weiß ).
).
Alles in allem ne ausgewogene Mischung, wobei Kiel noch den Vorteil hat, mit dem Institut für Weltwirtschaft die wirtschaftswissenschaftliche Zentralbibiothek der Bundesrepublik vor Ort zu haben (und die Jungs sind seeehr gut sortiert....was habe ich da für Stunden mit Lesen verbracht, alles mit bestem Fördeblick...Mist, ich glaube ich sollte wieder das Studieren anfangen: War irgendwie auch lustig ).
).
Gruß
Sovereign
Nicht so einfach hier konkrete Empfehlungen zu geben. Im Grunde muß man die Lehrmeinung der "Chikagoer Schule" der Monetaristen und insb. von Milton Friedman nur eng auslegen, und man erkennt die systemsprengenden Potentiale expansiver Kreditausweitungen.
Einer meiner Profs an der Uni Kiel: Manfred Willms ist ein Monetarist und ein erklärter Euro-Gegner. Sein Buch "Internationale Währungspolitik" ist in diesem Zusammenhang recht empfehlenswert (allerdings muß man ZWISCHEN den Zeilen dieses Standardlehrbuchs lesen).
Ansonsten habe ich an der Uni gehört: Wohltmann (100-iger Kenynesianer der nach Staatseingriffen schreit...nicht so meine Sache), Horst Siebert (ja, der Ex-Wirtschaftsweise und Freihandelsfanatiker...bekannt aus Funk und Fernsehen), Schatz (postuliert die Wettbewerbsfreiheit, ist jetzt bei einem Arbeitgeberverband soweit ich weiß
 ).
).Alles in allem ne ausgewogene Mischung, wobei Kiel noch den Vorteil hat, mit dem Institut für Weltwirtschaft die wirtschaftswissenschaftliche Zentralbibiothek der Bundesrepublik vor Ort zu haben (und die Jungs sind seeehr gut sortiert....was habe ich da für Stunden mit Lesen verbracht, alles mit bestem Fördeblick...Mist, ich glaube ich sollte wieder das Studieren anfangen: War irgendwie auch lustig
 ).
).Gruß
Sovereign
@Sovereign
Ob ich Angst habe, weiß ich so nicht.
Hunde kann ich z.B. nicht ausstehen. Scheißviecher !!
Angst vor Hunden ?
Zumindest habe ich keine Angst, Geld zu verleren.
Und das ist bei Aktien (Goldminen) ganz hilfreich.
Studieren ist u.U. eine gute Idee oder eigentlich
mehr das Studentenleben !?
deempf
Ob ich Angst habe, weiß ich so nicht.
Hunde kann ich z.B. nicht ausstehen. Scheißviecher !!
Angst vor Hunden ?
Zumindest habe ich keine Angst, Geld zu verleren.
Und das ist bei Aktien (Goldminen) ganz hilfreich.
Studieren ist u.U. eine gute Idee oder eigentlich
mehr das Studentenleben !?

deempf

@sovereign:
Für die anbrechenden gemütlichen Leseabende empfehle
ich Dir zur Abrundung und/oder Auflockerung Deines umfangreichen Bildungskanons wärmstens die sarkastischen Aphorismen E.M.Cioran`s, eines rumänischen Philosophen, der in Paris lebte und schrieb, in deutscher Uebersetzung, in mehrere Bänden erschienen bei Suhrkamp, vorteilhaft etwa zwischen zwei Schlucken Single Malt, zu Gemüte zu führen,
worauf Dein frischer, jetzo bereits schier unübertreffbarer Sarkasmus, den viele, mich selbstredend eingeschlossen, abgöttisch bewundern, erst die schönsten, finalen Blüten hervortreiben wird.
Die stilistisch einwandfrei abgefassten, denkerischen Glanzlichter über das Elend des menschlichen Daseins vom leider allzu früh verstorbenen Hellsichtigen zähle ich
seit zwanzig Jahren zu meinen Trosttropfen, gerade heutzutage, wenn die weibische Wehleidigkeit über
das Ausbleiben der Goldpreisexplosion mir wieder einen bösen Streich spielen will.
Uebrigens:
Wäre ich der liebe Gott, würde ich (von Dir) sagen:
Dies ist mein Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen.
Gruss Dir und tapfer weiter vorangeschritten.
Rigel
Für die anbrechenden gemütlichen Leseabende empfehle
ich Dir zur Abrundung und/oder Auflockerung Deines umfangreichen Bildungskanons wärmstens die sarkastischen Aphorismen E.M.Cioran`s, eines rumänischen Philosophen, der in Paris lebte und schrieb, in deutscher Uebersetzung, in mehrere Bänden erschienen bei Suhrkamp, vorteilhaft etwa zwischen zwei Schlucken Single Malt, zu Gemüte zu führen,
worauf Dein frischer, jetzo bereits schier unübertreffbarer Sarkasmus, den viele, mich selbstredend eingeschlossen, abgöttisch bewundern, erst die schönsten, finalen Blüten hervortreiben wird.
Die stilistisch einwandfrei abgefassten, denkerischen Glanzlichter über das Elend des menschlichen Daseins vom leider allzu früh verstorbenen Hellsichtigen zähle ich
seit zwanzig Jahren zu meinen Trosttropfen, gerade heutzutage, wenn die weibische Wehleidigkeit über
das Ausbleiben der Goldpreisexplosion mir wieder einen bösen Streich spielen will.
Uebrigens:
Wäre ich der liebe Gott, würde ich (von Dir) sagen:
Dies ist mein Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen.
Gruss Dir und tapfer weiter vorangeschritten.
Rigel
@deempf
"Studieren ist u.U. eine gute Idee oder eigentlich
mehr das Studentenleben !?"
Ich bin da ambivalent: Sicher als Exstudent sind die Autos und die Anzüge besser und der Rotwein einige Preisklassen teurer, aber sonst? Irgendwie war das alles doch schon lustig...OK, man konnte keine Leute triezen, aber dafür konnte man Sommernachmittage am Strand verbringen, konnte unter der Woche spätabends die Clubs bevölkern, weil man öfter vor 10 Uhr sowieso nicht aufzustehen brauchte, und 2 1/2 Monate Semesterferien am Stück sind doch auch was...vielleicht sollten wir, wenn es uns das Gold erlaubt, just for fun ne Promotion nachschieben?
Gruß
Sovereign
"Studieren ist u.U. eine gute Idee oder eigentlich
mehr das Studentenleben !?"
Ich bin da ambivalent: Sicher als Exstudent sind die Autos und die Anzüge besser und der Rotwein einige Preisklassen teurer, aber sonst? Irgendwie war das alles doch schon lustig...OK, man konnte keine Leute triezen, aber dafür konnte man Sommernachmittage am Strand verbringen, konnte unter der Woche spätabends die Clubs bevölkern, weil man öfter vor 10 Uhr sowieso nicht aufzustehen brauchte, und 2 1/2 Monate Semesterferien am Stück sind doch auch was...vielleicht sollten wir, wenn es uns das Gold erlaubt, just for fun ne Promotion nachschieben?

Gruß
Sovereign
# 12
@Rigel
Bitte kein Lob: "Begraben will ich Cäsar, nicht ihn preisen."
Cioran ist in der Tat harter Tobak, habe mich noch nicht näher mit ihm auseinandergesetzt, werde es aber beizeiten tun. Momentan tendiere ich mehr zum Existentialismus französischer Prägung: Was aber nicht heißt, daß ich ganz in Schwarz gekleidet mit ner filterlosen Gaulloise im Mundwinkel herumlaufe
Ich habe gerade mit Sartres Hauptwerk "Das Sein und das Nichts" abgeschlossen: Teilweise ziemlich krudes Zeug, nichtsdestotrotz bahnbrechend und lese in loser Reihenfolge andere Werke von Sartre: Der Ekel, Geschlossene Gesellschaft, verschiedene Essays.
Camus und Merleau-Pointy erscheinen mir in darstellerischer Hinsicht einsteigerfreundlicher, auch wenn die Botschaft, die sie vermitteln nicht gerade einsteigerfreundlich ist.
Zudem gefallen mir die russischen Autoren: Dostojewski "Schuld und Sühne", Gontschrow "Oblomow", alles von Tolstoi. Mixe das alles mit ein paar französischen Romanciers wie Proust, Zola, Hugo, Flaubert, dazu eine Prise Kafka und Kierkegaard und dazu noch einen Hauch Symbolismus à la Mellvilles "Moby Dick" (es gibt dazu übrigens eine wunderbare neue deutsche Übersetzung) und das Ergebnis wird mir gefallen. Vielleicht als Ergänzung noch ein paar "kranke" Kurzgeschichten von Roald Dahl, etwas Hemingway, Joseph Conrad und Kipling...das alles gut schütteln und servieren mit Zitaten aus Dantes Göttlicher Komödie... Jup, das wär`s
Jup, das wär`s
Gruß
Sovereign
P.S.: Was hat das alles mit Gold zu tun? Nichts und doch wieder ne ganze Menge
@Rigel
Bitte kein Lob: "Begraben will ich Cäsar, nicht ihn preisen."

Cioran ist in der Tat harter Tobak, habe mich noch nicht näher mit ihm auseinandergesetzt, werde es aber beizeiten tun. Momentan tendiere ich mehr zum Existentialismus französischer Prägung: Was aber nicht heißt, daß ich ganz in Schwarz gekleidet mit ner filterlosen Gaulloise im Mundwinkel herumlaufe

Ich habe gerade mit Sartres Hauptwerk "Das Sein und das Nichts" abgeschlossen: Teilweise ziemlich krudes Zeug, nichtsdestotrotz bahnbrechend und lese in loser Reihenfolge andere Werke von Sartre: Der Ekel, Geschlossene Gesellschaft, verschiedene Essays.
Camus und Merleau-Pointy erscheinen mir in darstellerischer Hinsicht einsteigerfreundlicher, auch wenn die Botschaft, die sie vermitteln nicht gerade einsteigerfreundlich ist.

Zudem gefallen mir die russischen Autoren: Dostojewski "Schuld und Sühne", Gontschrow "Oblomow", alles von Tolstoi. Mixe das alles mit ein paar französischen Romanciers wie Proust, Zola, Hugo, Flaubert, dazu eine Prise Kafka und Kierkegaard und dazu noch einen Hauch Symbolismus à la Mellvilles "Moby Dick" (es gibt dazu übrigens eine wunderbare neue deutsche Übersetzung) und das Ergebnis wird mir gefallen. Vielleicht als Ergänzung noch ein paar "kranke" Kurzgeschichten von Roald Dahl, etwas Hemingway, Joseph Conrad und Kipling...das alles gut schütteln und servieren mit Zitaten aus Dantes Göttlicher Komödie...
 Jup, das wär`s
Jup, das wär`sGruß
Sovereign
P.S.: Was hat das alles mit Gold zu tun? Nichts und doch wieder ne ganze Menge

Roland Leuschel (09.10.2002)
Der ewige Optimist
Jetzt werden anscheinend in der internationalen Presse und bei vielen Experten langsam « die Messer gewetzt », um den Mythos Greenspan entsprechend schlachten zu können. Als Beispiel zitiere ich den Leitartikel von Martin Wolf in der Financial Times London « Greenspan goes on trial for complacency about bubbles ». Es gilt den Schuldigen zu finden, nicht für das Platzen der grössten Aktienblase der Geschichte, sondern dafür was danach kommt. Und alle die sich in den letzten Jahren ein wenig gesunden Menschenverstand bewahrt haben, sind davon überzeugt, dass die grösste Kapitalvernichtung aller Zeiten (seit Mârz 2000 wurden weltweit rund 12.000 Milliarden Dollar, d.h. etwas mehr als das Bruttosozialprodukt Amerikas von 2001 vernichtet) realwirtschaftliche Folgen haben wird.
Zwar gibt es immer noch Optimisten, die kein Abgleiten der Weltwirtschaft in eine zweite Rezession (Double Dip) vorhersagen. An der Spitze steht Alan Greenspan, der wörtlich erklärte : « Trotz der Auswirkungen des Wertverlusts von acht Billionen (= 8.000 Milliarden) Dollar am Aktienmarkt, des scharfen Rückgangs der Investitionen und natürlich der tragischen Ereignisse vom 11. September 2001 hat sich unsere Wirtschaft stabil gehalten. » Auch die Chefvolkswirtin, Gail Fosler, des Conference Board glaubt an eine starke Wiederbelebung und erwartet eine Zinsanhebung als nächsten Schritt der Fed. Sie sagt ein Wirtschaftswachstum von 4% im Jahre 2003 für die USA voraus.
Präsident Bush wirds schon richten, und er hat ja hinter sich eine überstarke Rüstungs- bzw. Öllobby, mit anderen Worten ein Krieg gegen den Irak scheint in dieser Logik immer wahrscheinlicher, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
Der Berater des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, Lawrence Kudlow, hat es auf den Punkt gebracht : "Den Markt mit Gewalt zurückerobern !" Er geht davon aus, der Krieg könnte den Dow Jones "um ein paar Tausend Punkte" nach oben bringen. Andere US-Ökonomen stimmen mit Kudlow überein, und nicht umsonst werden in den Medien die Ergebnisse einer US-Studie zitiert, wonach die Gesamtkosten einer Militäroperation rund 200 Milliarden Dollar betragen würden, das heisst rund 2% des Bruttosozialprodukts.
Der Präsident der Federal Reserve von Richmond, Alfred Broaddus, erklärte : "Die Folgen eines kurzen Krieges könnten sehr milde, wenn nicht sogar positiv sein. Nach dem ersten Golfkrieg Anfang der 90er Jahre hätten die Märkte von der militärischen Auseinandersetzung profitiert, weil die Unsicherheiten verschwunden seien." Und was geschieht, wenn der Krieg längere Zeit andauern sollte, und die arabische Welt ihre Ölproduktion reduziert ?, fragen sich zu Recht realistische Anleger.
In der letzten Ausgabe der Welt am Sonntag wurde ein Interview mit Heiko Thieme und mir veröffentlicht. Heiko Thieme sieht den Dow bei 12.000 und den Dax bei 5.000 bereits im Jahre 2004. Ich habe dagegen die Befürchtung geäussert, der Dow könnte binnen Jahresfrist auf einen "fairen" Kurs von 4.500 bis 5.000 Punkte fallen und den Dax in einer Übertreibung auf 2.000 bis 2.200 runterziehen, und die Ihnen längst bekannte Meinung wiederholt : Wir müssen mit einer 10- bis 12-jährigen Seitwärtsbewegung der Börse rechnen und unser Verhalten darauf einstellen, das heisst Kurserholungen, die durchaus kräftig ausfallen können (15 bis 20%), nützen, um mit Qualitätsaktien eine halbwegs einträgliche Performance zu erreichen (6 bis 8% pro Jahr).
Ein Beispiel gab ich in meiner Kolumne "Zinssenkung der Fed ante portas ?" am 2.7.02, in der ich eine Rallye von 10 bis 15% und im August das Ende derselben mit der Kolumne "Das brutale Ende der Kursrallye des Dow Jones an der Fall Street" ankündigte : In den Perioden des Tradings muss der Anleger die Börse wie eine kalte Dusche nach der Sauna ansehen, schnell rein, schnell wieder raus.
Meine in der WamS gemachten Prognosen mögen pessimistisch erscheinen, aber am letzten Wochenende veröffentlichte der Präsident der Elliott Wave International, für die Charttechniker ein alter Bekannter, der Dow werde erheblich die 5.000er Grenze unterschreiten, und er malte sogar das Schreckgespenst eines Dow Jones unter 1.000 an die Wand.
"By the time the washout is over, the Dow will be under 1.000."
Sie sehen mit meinen 4.500 bis 5.000 bin ich nach wie vor der "ewige Optimist", wie mich einmal in den 80er Jahren eine Zeitung betitelte. Das mögen Sie auch daran erkennen, dass ich zum Kauf einer Allianz unter 100, einer IBM unter 65, einer Daimler oder Siemens unter 40 geraten habe, während uns die Realität noch erheblich tiefere Kurse bescherte. Aus diesem Grunde empfehle ich nach wie vor mit mutigen Kauf- und Verkaufslimits zu arbeiten ; denn die Volatilität des Marktes ist inzwischen so gross wie seit 10 Jahren nicht mehr, und beim Dax wurde sogar die Spitze von 1998 erreicht.
Vergessen Sie nicht, während in den 90er Jahren bis zum Jahr 1996 der Dax eine Volatilität von 10 hatte, ist sie inzwischen 6 mal höher. Wenn Ihnen die Prognosen von Bob Prechter wirklich zu pessimistisch erscheinen, vergessen Sie bitte nicht, der Neue Markt gemessen am Nemax Allshare in Deutschland hat inzwischen mehr als 95% seines Wertes gegenüber dem Höchstpunkt vor zwei Jahren verloren, und die umsatzstärkste Börse der Welt, die Nasdaq, büsste rund 80% ein !
Auch die vorrübergehend wertmässig grösste Börse der Welt in Tokio hat mittlerweile über 80% an Wert verloren. Ich hätte es auch für kaum möglich gehalten, dass ein grundsolider Traditionswert der Verischerungsbranche, die Allianz Aktie, mehr als 80% ihres Kurswertes innerhalb von 2 Jahren verlieren kann. In der Periode nach dem Börsenkrach von 1929 waren Wertverluste von 80 bis 90% die Regel.
Wer ein Realist ist, sollte sich den Leitartikel von John Plender in der Financial Times vom 4.10. anschauen « Bubble , bubble, default trouble ». Darin erklärt der Autor, dass auch in Amerika und Grossbritannien eine « japanese style deflation » spürbar ist, und weist auf die Gefahren in unserem Pensionssystem hin. Wenn also die Pensionsverbindlichkeiten vergleichbar sind mit den Schulden des Unternehmens, dann hat sich mittlerweile durch die Kursverluste ein Riesenschuldenproblem aufgetan, das sich in einem Teufelskreis befindet, und selbst grosse, bekannte Gesellschaften in einen "highly leveraged hedge fund" verwandeln. Übrigens auch die renommierte Bank HSBC hat in ihrer letzten Studie auf eine mögliche Deflation in Deutschland hingewiesen : "The country may eventually face deflationary problems à la Japan." Und HSBC hat sich in letzter Zeit mit äusserst prägnanten und akkuraten Prognosen hervorgetan.
Bleiben Sie ruhig, und verändern Sie die Struktur Ihres Portefeuilles nicht. Seit Jahren empfehle ich 70% in Triple A Anleihen und Cash und 30% in Qualitätsaktien. Versuchen Sie weiterhin die Markterholungen mit den Ihnen bekannten Werten auszunutzen. Ich glaube, in diesem Oktober 2002 wird wieder eine Kursrallye starten, die eine Aktie wie Allianz auf 120 katapultieren könnte, nur vergessen Sie dabei nicht, Ihren Gewinn glattzustellen (von jetzt 80 auf 120 wären 50% !), auch wenn Ihnen Analysten glaubwürdig vorrechnen, dass der « faire Wert » dieser Aktie zwischen 150 und 180 Euro liegt.
Trösten Sie sich mit dem Spruch « An einem mitgenommenen Gewinn ist noch keiner gestorben ! », und holen Sie sich die Allianz-Aktie bei 80 wieder zurück.
Der ewige Optimist
Jetzt werden anscheinend in der internationalen Presse und bei vielen Experten langsam « die Messer gewetzt », um den Mythos Greenspan entsprechend schlachten zu können. Als Beispiel zitiere ich den Leitartikel von Martin Wolf in der Financial Times London « Greenspan goes on trial for complacency about bubbles ». Es gilt den Schuldigen zu finden, nicht für das Platzen der grössten Aktienblase der Geschichte, sondern dafür was danach kommt. Und alle die sich in den letzten Jahren ein wenig gesunden Menschenverstand bewahrt haben, sind davon überzeugt, dass die grösste Kapitalvernichtung aller Zeiten (seit Mârz 2000 wurden weltweit rund 12.000 Milliarden Dollar, d.h. etwas mehr als das Bruttosozialprodukt Amerikas von 2001 vernichtet) realwirtschaftliche Folgen haben wird.
Zwar gibt es immer noch Optimisten, die kein Abgleiten der Weltwirtschaft in eine zweite Rezession (Double Dip) vorhersagen. An der Spitze steht Alan Greenspan, der wörtlich erklärte : « Trotz der Auswirkungen des Wertverlusts von acht Billionen (= 8.000 Milliarden) Dollar am Aktienmarkt, des scharfen Rückgangs der Investitionen und natürlich der tragischen Ereignisse vom 11. September 2001 hat sich unsere Wirtschaft stabil gehalten. » Auch die Chefvolkswirtin, Gail Fosler, des Conference Board glaubt an eine starke Wiederbelebung und erwartet eine Zinsanhebung als nächsten Schritt der Fed. Sie sagt ein Wirtschaftswachstum von 4% im Jahre 2003 für die USA voraus.
Präsident Bush wirds schon richten, und er hat ja hinter sich eine überstarke Rüstungs- bzw. Öllobby, mit anderen Worten ein Krieg gegen den Irak scheint in dieser Logik immer wahrscheinlicher, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
Der Berater des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, Lawrence Kudlow, hat es auf den Punkt gebracht : "Den Markt mit Gewalt zurückerobern !" Er geht davon aus, der Krieg könnte den Dow Jones "um ein paar Tausend Punkte" nach oben bringen. Andere US-Ökonomen stimmen mit Kudlow überein, und nicht umsonst werden in den Medien die Ergebnisse einer US-Studie zitiert, wonach die Gesamtkosten einer Militäroperation rund 200 Milliarden Dollar betragen würden, das heisst rund 2% des Bruttosozialprodukts.
Der Präsident der Federal Reserve von Richmond, Alfred Broaddus, erklärte : "Die Folgen eines kurzen Krieges könnten sehr milde, wenn nicht sogar positiv sein. Nach dem ersten Golfkrieg Anfang der 90er Jahre hätten die Märkte von der militärischen Auseinandersetzung profitiert, weil die Unsicherheiten verschwunden seien." Und was geschieht, wenn der Krieg längere Zeit andauern sollte, und die arabische Welt ihre Ölproduktion reduziert ?, fragen sich zu Recht realistische Anleger.
In der letzten Ausgabe der Welt am Sonntag wurde ein Interview mit Heiko Thieme und mir veröffentlicht. Heiko Thieme sieht den Dow bei 12.000 und den Dax bei 5.000 bereits im Jahre 2004. Ich habe dagegen die Befürchtung geäussert, der Dow könnte binnen Jahresfrist auf einen "fairen" Kurs von 4.500 bis 5.000 Punkte fallen und den Dax in einer Übertreibung auf 2.000 bis 2.200 runterziehen, und die Ihnen längst bekannte Meinung wiederholt : Wir müssen mit einer 10- bis 12-jährigen Seitwärtsbewegung der Börse rechnen und unser Verhalten darauf einstellen, das heisst Kurserholungen, die durchaus kräftig ausfallen können (15 bis 20%), nützen, um mit Qualitätsaktien eine halbwegs einträgliche Performance zu erreichen (6 bis 8% pro Jahr).
Ein Beispiel gab ich in meiner Kolumne "Zinssenkung der Fed ante portas ?" am 2.7.02, in der ich eine Rallye von 10 bis 15% und im August das Ende derselben mit der Kolumne "Das brutale Ende der Kursrallye des Dow Jones an der Fall Street" ankündigte : In den Perioden des Tradings muss der Anleger die Börse wie eine kalte Dusche nach der Sauna ansehen, schnell rein, schnell wieder raus.
Meine in der WamS gemachten Prognosen mögen pessimistisch erscheinen, aber am letzten Wochenende veröffentlichte der Präsident der Elliott Wave International, für die Charttechniker ein alter Bekannter, der Dow werde erheblich die 5.000er Grenze unterschreiten, und er malte sogar das Schreckgespenst eines Dow Jones unter 1.000 an die Wand.
"By the time the washout is over, the Dow will be under 1.000."
Sie sehen mit meinen 4.500 bis 5.000 bin ich nach wie vor der "ewige Optimist", wie mich einmal in den 80er Jahren eine Zeitung betitelte. Das mögen Sie auch daran erkennen, dass ich zum Kauf einer Allianz unter 100, einer IBM unter 65, einer Daimler oder Siemens unter 40 geraten habe, während uns die Realität noch erheblich tiefere Kurse bescherte. Aus diesem Grunde empfehle ich nach wie vor mit mutigen Kauf- und Verkaufslimits zu arbeiten ; denn die Volatilität des Marktes ist inzwischen so gross wie seit 10 Jahren nicht mehr, und beim Dax wurde sogar die Spitze von 1998 erreicht.
Vergessen Sie nicht, während in den 90er Jahren bis zum Jahr 1996 der Dax eine Volatilität von 10 hatte, ist sie inzwischen 6 mal höher. Wenn Ihnen die Prognosen von Bob Prechter wirklich zu pessimistisch erscheinen, vergessen Sie bitte nicht, der Neue Markt gemessen am Nemax Allshare in Deutschland hat inzwischen mehr als 95% seines Wertes gegenüber dem Höchstpunkt vor zwei Jahren verloren, und die umsatzstärkste Börse der Welt, die Nasdaq, büsste rund 80% ein !
Auch die vorrübergehend wertmässig grösste Börse der Welt in Tokio hat mittlerweile über 80% an Wert verloren. Ich hätte es auch für kaum möglich gehalten, dass ein grundsolider Traditionswert der Verischerungsbranche, die Allianz Aktie, mehr als 80% ihres Kurswertes innerhalb von 2 Jahren verlieren kann. In der Periode nach dem Börsenkrach von 1929 waren Wertverluste von 80 bis 90% die Regel.
Wer ein Realist ist, sollte sich den Leitartikel von John Plender in der Financial Times vom 4.10. anschauen « Bubble , bubble, default trouble ». Darin erklärt der Autor, dass auch in Amerika und Grossbritannien eine « japanese style deflation » spürbar ist, und weist auf die Gefahren in unserem Pensionssystem hin. Wenn also die Pensionsverbindlichkeiten vergleichbar sind mit den Schulden des Unternehmens, dann hat sich mittlerweile durch die Kursverluste ein Riesenschuldenproblem aufgetan, das sich in einem Teufelskreis befindet, und selbst grosse, bekannte Gesellschaften in einen "highly leveraged hedge fund" verwandeln. Übrigens auch die renommierte Bank HSBC hat in ihrer letzten Studie auf eine mögliche Deflation in Deutschland hingewiesen : "The country may eventually face deflationary problems à la Japan." Und HSBC hat sich in letzter Zeit mit äusserst prägnanten und akkuraten Prognosen hervorgetan.
Bleiben Sie ruhig, und verändern Sie die Struktur Ihres Portefeuilles nicht. Seit Jahren empfehle ich 70% in Triple A Anleihen und Cash und 30% in Qualitätsaktien. Versuchen Sie weiterhin die Markterholungen mit den Ihnen bekannten Werten auszunutzen. Ich glaube, in diesem Oktober 2002 wird wieder eine Kursrallye starten, die eine Aktie wie Allianz auf 120 katapultieren könnte, nur vergessen Sie dabei nicht, Ihren Gewinn glattzustellen (von jetzt 80 auf 120 wären 50% !), auch wenn Ihnen Analysten glaubwürdig vorrechnen, dass der « faire Wert » dieser Aktie zwischen 150 und 180 Euro liegt.
Trösten Sie sich mit dem Spruch « An einem mitgenommenen Gewinn ist noch keiner gestorben ! », und holen Sie sich die Allianz-Aktie bei 80 wieder zurück.
@Konradi
Leuschel ... Den Typen kenne ich schon seit weit über 10 Jahren.
Eigentlich taugt der nur zum Kontraindikator oder wahrscheinlich noch nicht einmal das.
Heiko Thieme ... Siehe Leuschel, nur Thieme ist noch
penetranter und nerviger. Schrott pur.
Ich glaube,es hilft nichts: Du mußt Dir schon selber den
Kopf zerbrechen. Gute Tips wirst Du von niemandem gekommen.
deempf
Leuschel ... Den Typen kenne ich schon seit weit über 10 Jahren.
Eigentlich taugt der nur zum Kontraindikator oder wahrscheinlich noch nicht einmal das.
Heiko Thieme ... Siehe Leuschel, nur Thieme ist noch
penetranter und nerviger. Schrott pur.
Ich glaube,es hilft nichts: Du mußt Dir schon selber den
Kopf zerbrechen. Gute Tips wirst Du von niemandem gekommen.
deempf
Hallo,
hat jemand von euch etwas konkretere Vorstellungen was realwirtschaftlich auf uns zukommen wird?
Am Höhepunkt der Krise von 1929-1933 standen in den Städten ja die Leute Schlange vor den öffentlichen Suppenküchen.
Kommt es so weit? Oder noch viel schlimmer?
Bitte um Meinungen,
Grüße,
Waschbär
hat jemand von euch etwas konkretere Vorstellungen was realwirtschaftlich auf uns zukommen wird?
Am Höhepunkt der Krise von 1929-1933 standen in den Städten ja die Leute Schlange vor den öffentlichen Suppenküchen.
Kommt es so weit? Oder noch viel schlimmer?
Bitte um Meinungen,
Grüße,
Waschbär
#17, armer Kerl, es kommt schlimmer!! Die Leute werden den Waschbären den Pelz abziehen, damit sie etwas warmes zum anziehen haben. 
J2

J2
"standen in den Städten ja die Leute Schlange vor den öffentlichen Suppenküchen"
"Die Leute werden den Waschbären den Pelz abziehen, damit sie etwas warmes zum anziehen haben. "
Hm, da stellt sich doch die Frage, was man mit dem Rest vom Waschbären anfangen soll, und was in der Suppe drin ist? Schmecken die Biester überhaupt? Muß man die erst einen Tag in Buttermilch einlegen? Benötigt man Fleischzartmacher?
Und sehr wichtig: Welchen Wein kredenzt man zum Waschbären?
Gruß
Sovereign
"Die Leute werden den Waschbären den Pelz abziehen, damit sie etwas warmes zum anziehen haben. "
Hm, da stellt sich doch die Frage, was man mit dem Rest vom Waschbären anfangen soll, und was in der Suppe drin ist? Schmecken die Biester überhaupt? Muß man die erst einen Tag in Buttermilch einlegen? Benötigt man Fleischzartmacher?
Und sehr wichtig: Welchen Wein kredenzt man zum Waschbären?

Gruß
Sovereign
Sovereign Du bist einfach unschlagbar ! 





#20
Ist durchaus ernst gemeint. Ich schätze die Viecher müssen gut durchgebraten werden, am Ende enthalten sie gar Trichine!
Trichinella spiralis; parasitärer Fadenwurm mit 1,5...4 mm Länge und 0,04...0,06 mm Durchmesser. Die Entwicklung geschieht über Wirts- und Organwechsel, wobei der Parasit nie ins Freie gelangt. Man findet die Trichine in vielen Säugetieren, sie lebt unter anderem in Mensch, Haus- und Wildschwein, Hund, Katze, Fuchs, Marder, Bär, Maus und Ratte...
also Augen auf beim Fleischverzehr!
Ein Verwandter von mir war dieses Jahr in Peru und mag seitdem Meerschweinchen (ja er hat sie sogar zum Fressen gern ), ein Bekannter (ein passionierter Jäger) schwört auf in Sauer eingelegte Schwäne.....
), ein Bekannter (ein passionierter Jäger) schwört auf in Sauer eingelegte Schwäne.....
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll? Ich bevorzuge eigentlich eher eine Haustaube aus dem Römertopf, serviert mit Wacholdersoße, Kroketten, Rotkohl und Austernpilzen....dazu einen 95er Medoc und der Tag ist gerettet
Gruß
Sovereign
Ich für meinen Teil bevorzuge
Ist durchaus ernst gemeint. Ich schätze die Viecher müssen gut durchgebraten werden, am Ende enthalten sie gar Trichine!

Trichinella spiralis; parasitärer Fadenwurm mit 1,5...4 mm Länge und 0,04...0,06 mm Durchmesser. Die Entwicklung geschieht über Wirts- und Organwechsel, wobei der Parasit nie ins Freie gelangt. Man findet die Trichine in vielen Säugetieren, sie lebt unter anderem in Mensch, Haus- und Wildschwein, Hund, Katze, Fuchs, Marder, Bär, Maus und Ratte...
also Augen auf beim Fleischverzehr!

Ein Verwandter von mir war dieses Jahr in Peru und mag seitdem Meerschweinchen (ja er hat sie sogar zum Fressen gern
 ), ein Bekannter (ein passionierter Jäger) schwört auf in Sauer eingelegte Schwäne.....
), ein Bekannter (ein passionierter Jäger) schwört auf in Sauer eingelegte Schwäne.....Ich weiß nicht, was ich davon halten soll? Ich bevorzuge eigentlich eher eine Haustaube aus dem Römertopf, serviert mit Wacholdersoße, Kroketten, Rotkohl und Austernpilzen....dazu einen 95er Medoc und der Tag ist gerettet

Gruß
Sovereign
Ich für meinen Teil bevorzuge
das finde ich nun aber garnicht nett mit dem Hinweis auf parasitäre Fadenwürmer.
Schließlich ist gleich Mittag und so wie es riecht gibt es heute wieder Kohlroulade mit Karottengemüse.
Aus lauter Verzweiflung überleg ich mir jetzt schon mal kurz zum Drive-in von McDonalds zu fahren ...
 konradi
konradi
Schließlich ist gleich Mittag und so wie es riecht gibt es heute wieder Kohlroulade mit Karottengemüse.
Aus lauter Verzweiflung überleg ich mir jetzt schon mal kurz zum Drive-in von McDonalds zu fahren ...
 konradi
konradi
#22 Kohlroulade? Schauder! 
Ist die Baisse ausgebrochen oder was? Keine Filetspitzen? Keine Gambas? Am Ende gibt`s zum Nachtisch nichtmal eine Crème Brûlée? Wo soll das noch hinführen? Nachher erzählst Du mir noch, daß der Chablis nicht richtig temperiert ist! Der Untergang des Abendlands ist nah!
Und was die Fadenwürmer angeht: Immer schön mit Single Malt Cask Strength nachspülen....so eine Desinfektion von innen überleben die Viecher nicht.
Gruß
Sovereign

Ist die Baisse ausgebrochen oder was? Keine Filetspitzen? Keine Gambas? Am Ende gibt`s zum Nachtisch nichtmal eine Crème Brûlée? Wo soll das noch hinführen? Nachher erzählst Du mir noch, daß der Chablis nicht richtig temperiert ist! Der Untergang des Abendlands ist nah!

Und was die Fadenwürmer angeht: Immer schön mit Single Malt Cask Strength nachspülen....so eine Desinfektion von innen überleben die Viecher nicht.
Gruß
Sovereign
Sovereign, hör bloß auf, ich fang ich gleich an zu heulen ! 






Eigentlich viel zu schade für die Suppe diese Biester! Daher mein Vorschlag: Steckrüben- und Brotkrustensuppe für die mittellosen Börsenlemminge und Waschbärragout Winzerart für die Goldbugs...wird bestimmt lecker!

@ Souvereign
Souveräne Antwort...
Zu Fleisch dieser Art würde ich einen Riesling Spätlese Trocken empfehlen (muß aber leicht perlen!!)
Gegen Trichinen hilft eigentlich sehr gut durchbraten!!
Da brauchste aber gute Kaumuskulaturen... Sehr gut bei Diät; viel kauen verringert Hungergefühl erheblich
Interessant wird es, wenn die Mitbewohner im Fell als Beigabe kredenzt werden. Ich glaube die Schimpansen pflegen damit soziale Kontakte mit kulinarischer Hochkultur. Die weibliche Begleitung freuts bestimmt
Wohl bekommts
Souveräne Antwort...

Zu Fleisch dieser Art würde ich einen Riesling Spätlese Trocken empfehlen (muß aber leicht perlen!!)
Gegen Trichinen hilft eigentlich sehr gut durchbraten!!
Da brauchste aber gute Kaumuskulaturen... Sehr gut bei Diät; viel kauen verringert Hungergefühl erheblich

Interessant wird es, wenn die Mitbewohner im Fell als Beigabe kredenzt werden. Ich glaube die Schimpansen pflegen damit soziale Kontakte mit kulinarischer Hochkultur. Die weibliche Begleitung freuts bestimmt

Wohl bekommts
@Waschbär
Hier handelt es sich doch wohl eindeutig um Wild. Demnach dürfte der Geschmack ähnlich dem der Bisamratten sein, die im belgischen Ardennengebiet als regionale Spezialität auf der Speisekarte stehen. Diese sollen ja in etwa nach Rebhuhn schmecken (sehr ausgeprägter Wildgeschmack, daher vorher in Buttermilch einlegen)....hab ich mir zumindest sagen lassen.
In diesem Fall ist ein Riesling doch wohl eindeutig fehl am Platze! Wenn wir schon derartige Tierchen verspeisen wollen, dann sollte wenigstens der Wein uns einen Anschein von Kultur und Stil geben...was neben Messer und Gabel sowie einer Damasttischdecke würde uns sonst noch von den wilden Papuas trennen?... Daher plädiere ich ausdrücklich dafür, einen schweren Rotwein zum Einsatz zu bringen: Empfehlen würde ich in diesem Fall einen sortenreinen Syrah von der nördlichen Rhône (Hermitage bzw. Côte Rotie) oder alternativ einen großen Barolo bzw. Barbaresco.
Damit das gute Tier später im Magen bleibt, sollten wir als Digestif entweder einen alten Malt (Macallan wäre gut) oder einen guten Cognac reichen. Die abschließende Havanna geht dann auf meine Rechnung
Gruß
Sovereign
Hier handelt es sich doch wohl eindeutig um Wild. Demnach dürfte der Geschmack ähnlich dem der Bisamratten sein, die im belgischen Ardennengebiet als regionale Spezialität auf der Speisekarte stehen. Diese sollen ja in etwa nach Rebhuhn schmecken (sehr ausgeprägter Wildgeschmack, daher vorher in Buttermilch einlegen)....hab ich mir zumindest sagen lassen.
In diesem Fall ist ein Riesling doch wohl eindeutig fehl am Platze! Wenn wir schon derartige Tierchen verspeisen wollen, dann sollte wenigstens der Wein uns einen Anschein von Kultur und Stil geben...was neben Messer und Gabel sowie einer Damasttischdecke würde uns sonst noch von den wilden Papuas trennen?... Daher plädiere ich ausdrücklich dafür, einen schweren Rotwein zum Einsatz zu bringen: Empfehlen würde ich in diesem Fall einen sortenreinen Syrah von der nördlichen Rhône (Hermitage bzw. Côte Rotie) oder alternativ einen großen Barolo bzw. Barbaresco.
Damit das gute Tier später im Magen bleibt, sollten wir als Digestif entweder einen alten Malt (Macallan wäre gut) oder einen guten Cognac reichen. Die abschließende Havanna geht dann auf meine Rechnung

Gruß
Sovereign
@ Sovereign
Alles klar!!
Du stiftest den Wein, den Whisky und die Havanna! Ich treib schon mal ein paar von diesen Tierchen auf (Müssen mehrere sein, da man ja schließlich auch ein Gefühl der Sättigung verspüren will).
Ich versuch möglichst frisches Fleisch zu organisieren...
Minz, minz, minz... wo bist Du?
P.S.: Mein Großvater selig hat mir immer davon erzählt, daß er nicht wissen wolle, wieviele Hasen er auf diese Weise in den Restaurants während des 2.Weltkrieges serviert bekommen hat. Die haben übrigens nie nach "Wild" geschmeckt...
Grüße,
Waschbär
Alles klar!!
Du stiftest den Wein, den Whisky und die Havanna! Ich treib schon mal ein paar von diesen Tierchen auf (Müssen mehrere sein, da man ja schließlich auch ein Gefühl der Sättigung verspüren will).
Ich versuch möglichst frisches Fleisch zu organisieren...
Minz, minz, minz... wo bist Du?
P.S.: Mein Großvater selig hat mir immer davon erzählt, daß er nicht wissen wolle, wieviele Hasen er auf diese Weise in den Restaurants während des 2.Weltkrieges serviert bekommen hat. Die haben übrigens nie nach "Wild" geschmeckt...
Grüße,
Waschbär
@Waschbär
Wenn sie nicht nach Wild geschmeckt haben, dann waren es auch keine Hasen
Glaub mir, ich sitze an der Quelle und hab schon ne Menge Feldhasen serviert bekommen.
Wenn ich eine Skala des "Wildgeschmacks" aufstellen sollte (wobei ich mit dem stärksten Geschmack beginne), würde ich sagen:
Rebhuhn, Feldhase, Wildschwein, Wildente, Rotwild, Damwild, Elch, Fasan...(wobei der Fasan schon eher wie Hauskaninchen schmeckt)
Wenn anno dunnemals die Hasen so gar nicht nach Wild geschmeckt haben, können das auch Katzen gewesen sein Daher kauft der Kenner auch nie abgezogene Hasen oder Kaninchen ohne Kopf
Daher kauft der Kenner auch nie abgezogene Hasen oder Kaninchen ohne Kopf 
Gruß
Sovereign
P.S.: Bis vor 20 Jahren gab es auf dem Wochenmarkt sogenanntes "Wildgeflügel"...Was meinst Du wohl, was das ist?....Saatkrähen (kein Witz).
Schwäne waren übrigens vor 100 Jahren noch "Edelwild" und nur den adligen Herrn vorbehalten. Und den berühmten Bärenschinken kennst Du sicher auch?
Es ist schon erstaunlich, welche Viecher alle essbar sind...ich bekomme beim Schreiben langsam Hunger
Wenn sie nicht nach Wild geschmeckt haben, dann waren es auch keine Hasen

Glaub mir, ich sitze an der Quelle und hab schon ne Menge Feldhasen serviert bekommen.
Wenn ich eine Skala des "Wildgeschmacks" aufstellen sollte (wobei ich mit dem stärksten Geschmack beginne), würde ich sagen:
Rebhuhn, Feldhase, Wildschwein, Wildente, Rotwild, Damwild, Elch, Fasan...(wobei der Fasan schon eher wie Hauskaninchen schmeckt)
Wenn anno dunnemals die Hasen so gar nicht nach Wild geschmeckt haben, können das auch Katzen gewesen sein
 Daher kauft der Kenner auch nie abgezogene Hasen oder Kaninchen ohne Kopf
Daher kauft der Kenner auch nie abgezogene Hasen oder Kaninchen ohne Kopf 
Gruß
Sovereign
P.S.: Bis vor 20 Jahren gab es auf dem Wochenmarkt sogenanntes "Wildgeflügel"...Was meinst Du wohl, was das ist?....Saatkrähen (kein Witz).
Schwäne waren übrigens vor 100 Jahren noch "Edelwild" und nur den adligen Herrn vorbehalten. Und den berühmten Bärenschinken kennst Du sicher auch?
Es ist schon erstaunlich, welche Viecher alle essbar sind...ich bekomme beim Schreiben langsam Hunger

#28
@Waschbär
" Ich treib schon mal ein paar von diesen Tierchen auf."
Aber bitte keinen roadkill von der Landstraße. Wir wollen schließlich keinen Vagabundeneintopf kochen (Rezept: Alles in einen Topf werfen, was irgendwie essbar erscheint)
@Waschbär
" Ich treib schon mal ein paar von diesen Tierchen auf."
Aber bitte keinen roadkill von der Landstraße. Wir wollen schließlich keinen Vagabundeneintopf kochen (Rezept: Alles in einen Topf werfen, was irgendwie essbar erscheint)



Der @konradi ist ja sowas von undankbar. Welche Frau macht sich noch die Mühe Kohlrouladen zu kochen??????? Und dann noch meckern. Schäm Dich, ich ess die wirklich gern. Natürlich nicht jeden Tag.
Allerdings, wenn die von Aldidente aus der Truhe sind, na ja.
Ansonsten Gruss an die Hausfrau!
J2
Allerdings, wenn die von Aldidente aus der Truhe sind, na ja.
Ansonsten Gruss an die Hausfrau!
J2
@kon. ähh, kauf der mal was "Goldenes", dann gehts auch wieder vorwärts mit HUI und Pfui.
J2
J2
.
Na Ihr seid gut ...
– mein ganzes Erspartes steckt in abschmierenden Goldaktien, da bleibt kein Pfennig übrig für Waschbärragout nach Winzerart !
Apropos Waschbär:
Diese nachtaktiven Kleinbären sind Allesfresser. Sie ernähren sich u.a. von Schnecken, Muscheln, Insektenlarven, Würmern –
und bei passender Gelegenheit auch aus Mülltonnen !!
Ich habe da so meine Bedenken bezüglich der Schmackhaftigkeit Eures Vagabundeneintopfes.
Zudem müsst Ihr höllisch aufpassen, den Waschbären nicht mit einem Dachs zu verwechseln. Sie sehen sich nämlich recht ähnlich:

Und der Da(ch)x steht ja hier unter ganz besonderem Schutz, das dürfte ja wohl bekannt sein ?
- Hier noch mal eine kleine Hilfe für die Pirsch:

Waidmanns Heil -
Konradi
ach so:
und was sollen diese platt-bajuwarischen Anspielungen auf "Radi", - Jeffery ? - Hä ?
Ich bin gebürtiger Hamburger und kein Weißwurstdepp !
Ist das klar ?
Hanseatische Esskultur orientiert sich an den Vorlieben unseres allseits geschätzten Altbundeskanzlers Helmut Schmidt.
Der trifft sich ab und zu mal mit Heidi Kabel im "Old Commercial Room" an der "Englischen Planke" zu einem deftigen Labskaus.
Den gibt’s hier am Sonnabend - und morgen Scholle mit Speckkartoffeln !
- Noch Fragen ?
.
Na Ihr seid gut ...

– mein ganzes Erspartes steckt in abschmierenden Goldaktien, da bleibt kein Pfennig übrig für Waschbärragout nach Winzerart !
Apropos Waschbär:
Diese nachtaktiven Kleinbären sind Allesfresser. Sie ernähren sich u.a. von Schnecken, Muscheln, Insektenlarven, Würmern –
und bei passender Gelegenheit auch aus Mülltonnen !!
Ich habe da so meine Bedenken bezüglich der Schmackhaftigkeit Eures Vagabundeneintopfes.

Zudem müsst Ihr höllisch aufpassen, den Waschbären nicht mit einem Dachs zu verwechseln. Sie sehen sich nämlich recht ähnlich:

Und der Da(ch)x steht ja hier unter ganz besonderem Schutz, das dürfte ja wohl bekannt sein ?
- Hier noch mal eine kleine Hilfe für die Pirsch:

Waidmanns Heil -
Konradi

ach so:
und was sollen diese platt-bajuwarischen Anspielungen auf "Radi", - Jeffery ? - Hä ?
Ich bin gebürtiger Hamburger und kein Weißwurstdepp !
Ist das klar ?
Hanseatische Esskultur orientiert sich an den Vorlieben unseres allseits geschätzten Altbundeskanzlers Helmut Schmidt.
Der trifft sich ab und zu mal mit Heidi Kabel im "Old Commercial Room" an der "Englischen Planke" zu einem deftigen Labskaus.
Den gibt’s hier am Sonnabend - und morgen Scholle mit Speckkartoffeln !
- Noch Fragen ?
.
Labskaus, einmal gegessen, es könnte auch aus Mülltonnen sein. Also wirklich, alles was von letzter Woche noch übrig ist wird durchgedreht und heisst Labskaus. Sakra, da lob ich mir Kohlrouladen. Ährlich.
J2
J2
@konradi
Nun sind wir also beim Dachs...ich könnte dazu eine nette Geschichte vortragen, die 100%ig wahr ist (auch wenn sich das nicht so anhören mag).
Zunächst mal zur Dachsjagd:
Dachse
--------------------------------------------------------------------------------
Der Dachs ist ein Sohlengänger, gehört aber zur Familie der Marderartigen (Gattung Dachse). Dort nimmt der Dachs eine Sonderstellung ein. Er bewohnt dauerhaft tiefe, meist selbst gegrabene Erdbaue. Dachse sind vorwiegend nachtaktiv und zeigen eine heimliche, verborgene Lebensweise.
Nach dem Einstellen der Fuchsbau-Begasung hat sich der Dachs wieder stark verbreitet, ist in ganz Deutschland überall häufig, und seine Besätze sind weiter ansteigend. Jagdlich wird er nur wenig genutzt. Die Jagdstrecke in den meisten Revieren liegt weit unter dem Zuwachs. Der Dachs ist durch seine markante schwarz-weiße Gesichtszeichnung nicht zu verwechseln und ist in seiner Familie der größte Vertreter.
Erwachsene Dachsrüden werden zwölf bis 17 Kilogramm schwer, die Fähen sind etwa ein Drittel kleiner. Äußerlich lassen sich die Geschlechter aber nicht unterscheiden. Der Dachsschädel lässt sich im Vergleich mit anderen Raubwildschädeln an dem zehn bis 20 Millimeter hohen Knochenkamm unterscheiden.
Der Dachs besitzt bei uns praktisch keine Feinde, so dass es besonders in Niederwildrevieren wichtig ist, ihn zu bejagen. Als Allesfresser beeinträchtigt er erheblich den Niederwildbesatz, besonders die Bodenbrüter.
So jetzt meine Geschichte: Ein Bekannter von mir, der Jäger ist (der gleiche der die Schwäne futtert und sich nen Spaß daraus macht einmal im Jahr in Norwegen den Elchen nachzustellen), jagdt auch Dachse (ich hab ihn noch nicht gefragt, ob er mir ein solches Teil mal überlassen kann, damit er ausgestopft meinen Flur ziert ). Nun er jagdt sie nicht des Felles wegen (des Fleisches wegen schon gar nicht), aber rate mal, wozu sich so ein Dachs verwenden läßt?....Dachsfett ergibt ein wunderbares Stiefelfett! Also hat er einmal den Dachsspeck in seiner Küche abgekocht und das erhaltene Fett fein säuberlich in Marmaladengläser abgefüllt...
). Nun er jagdt sie nicht des Felles wegen (des Fleisches wegen schon gar nicht), aber rate mal, wozu sich so ein Dachs verwenden läßt?....Dachsfett ergibt ein wunderbares Stiefelfett! Also hat er einmal den Dachsspeck in seiner Küche abgekocht und das erhaltene Fett fein säuberlich in Marmaladengläser abgefüllt...  Nachdem seine Frau den benutzten neuen Kochtopf weggeworfen hat, und er erst mal furchtbar einen auf den Deckel bekommen hat, die Küche mit so einem Viehzeug zu versauen, ist er mittlerweile lieber auf industriell gefertigte Schuhcreme ausgewichen.
Nachdem seine Frau den benutzten neuen Kochtopf weggeworfen hat, und er erst mal furchtbar einen auf den Deckel bekommen hat, die Küche mit so einem Viehzeug zu versauen, ist er mittlerweile lieber auf industriell gefertigte Schuhcreme ausgewichen. 
Gruß
Sovereign
P.S.: Mit dem "Old Commercial Room" hast Du nen Volltreffer gelandet. Ich liebe dieses Restaurant! Nicht wegen des Labskaus, aber wegen der Weinkarte, die wirklich eine Offenbarung ist! Wenn jemand von Euch mal mit der Firmenkreditkarte in Hamburg ist, dann nichts wie hin und die Bordeauxschätze weggesoffen!
Nun sind wir also beim Dachs...ich könnte dazu eine nette Geschichte vortragen, die 100%ig wahr ist (auch wenn sich das nicht so anhören mag).
Zunächst mal zur Dachsjagd:
Dachse
--------------------------------------------------------------------------------
Der Dachs ist ein Sohlengänger, gehört aber zur Familie der Marderartigen (Gattung Dachse). Dort nimmt der Dachs eine Sonderstellung ein. Er bewohnt dauerhaft tiefe, meist selbst gegrabene Erdbaue. Dachse sind vorwiegend nachtaktiv und zeigen eine heimliche, verborgene Lebensweise.
Nach dem Einstellen der Fuchsbau-Begasung hat sich der Dachs wieder stark verbreitet, ist in ganz Deutschland überall häufig, und seine Besätze sind weiter ansteigend. Jagdlich wird er nur wenig genutzt. Die Jagdstrecke in den meisten Revieren liegt weit unter dem Zuwachs. Der Dachs ist durch seine markante schwarz-weiße Gesichtszeichnung nicht zu verwechseln und ist in seiner Familie der größte Vertreter.
Erwachsene Dachsrüden werden zwölf bis 17 Kilogramm schwer, die Fähen sind etwa ein Drittel kleiner. Äußerlich lassen sich die Geschlechter aber nicht unterscheiden. Der Dachsschädel lässt sich im Vergleich mit anderen Raubwildschädeln an dem zehn bis 20 Millimeter hohen Knochenkamm unterscheiden.
Der Dachs besitzt bei uns praktisch keine Feinde, so dass es besonders in Niederwildrevieren wichtig ist, ihn zu bejagen. Als Allesfresser beeinträchtigt er erheblich den Niederwildbesatz, besonders die Bodenbrüter.
So jetzt meine Geschichte: Ein Bekannter von mir, der Jäger ist (der gleiche der die Schwäne futtert und sich nen Spaß daraus macht einmal im Jahr in Norwegen den Elchen nachzustellen), jagdt auch Dachse (ich hab ihn noch nicht gefragt, ob er mir ein solches Teil mal überlassen kann, damit er ausgestopft meinen Flur ziert
 ). Nun er jagdt sie nicht des Felles wegen (des Fleisches wegen schon gar nicht), aber rate mal, wozu sich so ein Dachs verwenden läßt?....Dachsfett ergibt ein wunderbares Stiefelfett! Also hat er einmal den Dachsspeck in seiner Küche abgekocht und das erhaltene Fett fein säuberlich in Marmaladengläser abgefüllt...
). Nun er jagdt sie nicht des Felles wegen (des Fleisches wegen schon gar nicht), aber rate mal, wozu sich so ein Dachs verwenden läßt?....Dachsfett ergibt ein wunderbares Stiefelfett! Also hat er einmal den Dachsspeck in seiner Küche abgekocht und das erhaltene Fett fein säuberlich in Marmaladengläser abgefüllt...  Nachdem seine Frau den benutzten neuen Kochtopf weggeworfen hat, und er erst mal furchtbar einen auf den Deckel bekommen hat, die Küche mit so einem Viehzeug zu versauen, ist er mittlerweile lieber auf industriell gefertigte Schuhcreme ausgewichen.
Nachdem seine Frau den benutzten neuen Kochtopf weggeworfen hat, und er erst mal furchtbar einen auf den Deckel bekommen hat, die Küche mit so einem Viehzeug zu versauen, ist er mittlerweile lieber auf industriell gefertigte Schuhcreme ausgewichen. 
Gruß
Sovereign
P.S.: Mit dem "Old Commercial Room" hast Du nen Volltreffer gelandet. Ich liebe dieses Restaurant! Nicht wegen des Labskaus, aber wegen der Weinkarte, die wirklich eine Offenbarung ist! Wenn jemand von Euch mal mit der Firmenkreditkarte in Hamburg ist, dann nichts wie hin und die Bordeauxschätze weggesoffen!

@konradi
So, so, Du scheinst auf bodenständige Hausmannskost zu stehen: Kohlrouladen, Labskaus, Scholle mit Speck (also klassische Finkenwerder Art...ich bevorzuge bei den Plattfischen eindeutig die Seezunge ).
).
Was hast Du den sonst noch anzubieten? Als Schleswig-Holsteiner hätte ich noch im Arsenal: Schwarzsauer, Senfeier, Dithmarscher Mehlbühddel, Rote Grütze, Fliederbeersuppe und natürlich Grünkohl mit Schweinebacke (wer`s mag auch mit Schweinpfoten)
Gruß
Sovereign
So, so, Du scheinst auf bodenständige Hausmannskost zu stehen: Kohlrouladen, Labskaus, Scholle mit Speck (also klassische Finkenwerder Art...ich bevorzuge bei den Plattfischen eindeutig die Seezunge
 ).
).Was hast Du den sonst noch anzubieten? Als Schleswig-Holsteiner hätte ich noch im Arsenal: Schwarzsauer, Senfeier, Dithmarscher Mehlbühddel, Rote Grütze, Fliederbeersuppe und natürlich Grünkohl mit Schweinebacke (wer`s mag auch mit Schweinpfoten)
Gruß
Sovereign
Nachtrag:
Es naht ja wieder die Winterzeit, also gibt`s abends natürlich nen dampfenden Pott Büsumer Miesmuscheln! Lecker!
Es naht ja wieder die Winterzeit, also gibt`s abends natürlich nen dampfenden Pott Büsumer Miesmuscheln! Lecker!

@Soverein
@Konradi
Wenn ich Euch mal in Eurer hanseatisch norddeutschen
Lobhudelei stören darf:
Das norddeutsche Essen ist im Prinzip genauso ungeniessbar
wie das Wetter. Ausserdem mag ich keinen Fisch. (und keine Hunde !!)
Also: Steak, Italiener, Türke, Chinese ... das schmeckt.
deempf
@Konradi
Wenn ich Euch mal in Eurer hanseatisch norddeutschen
Lobhudelei stören darf:
Das norddeutsche Essen ist im Prinzip genauso ungeniessbar
wie das Wetter. Ausserdem mag ich keinen Fisch. (und keine Hunde !!)
Also: Steak, Italiener, Türke, Chinese ... das schmeckt.

deempf

@deempf
Du bist nun mal ein Banause. Hamburg ist nun mal die "englischte" Stadt Deutschlands, und dort ist die Küche ja auch verrufen (Was ich gar nicht verstehe: Ich liebe Plumpudding geradezu )
)
Oder opp platt: "Quietschers waard dat jümmers nich verstaan, wat een bannich feen Eeten utmaakt."
Du bist nun mal ein Banause. Hamburg ist nun mal die "englischte" Stadt Deutschlands, und dort ist die Küche ja auch verrufen (Was ich gar nicht verstehe: Ich liebe Plumpudding geradezu
 )
)Oder opp platt: "Quietschers waard dat jümmers nich verstaan, wat een bannich feen Eeten utmaakt."
@deempf
"Also: Steak, Italiener, Türke, Chinese ... das schmeckt."
Bist Du Dir der Doppeldeutigkeit dieser Zeile bewußt? Hast Du einen Kochkurs in Papua-Neuguinea besucht? Hast Du alle Mitmenschen zum Fressen gern?
"Also: Steak, Italiener, Türke, Chinese ... das schmeckt."
Bist Du Dir der Doppeldeutigkeit dieser Zeile bewußt? Hast Du einen Kochkurs in Papua-Neuguinea besucht? Hast Du alle Mitmenschen zum Fressen gern?

Grüsse aus dem Norden speziell nach HAMBURG. Werde am 19. Oktober dort sein. Noch jemand da ?
http://www.boersentag.de/home/mainframe.html
Gruss
niemandweiss
http://www.boersentag.de/home/mainframe.html
Gruss
niemandweiss
Freier Eintritt!!!!!!
Das waren noch Zeiten damals in Düsseldorf, als die Gemeinde sehnsüchtig für teueres Geld die Pfeife Thieme erwartet hat.
J2
Das waren noch Zeiten damals in Düsseldorf, als die Gemeinde sehnsüchtig für teueres Geld die Pfeife Thieme erwartet hat.
J2
@j2
Thieme war doch immer lustig! Der Kerl war eine einzige fleischgewordene Karrikatur. Ich wüßte gar nicht, wie man über ihn Witze machen sollte, er ist schließlich selbst ein einziger Witz.
Ansonsten interessiert mich dieser Börsentag sowieso nicht. Auf flache Empfehlungen irgendwelcher Dünnbrettbohrer kann ich verzichten, und die Fachvorträge sind mE wertlos.
Gruß
Sovereign
Thieme war doch immer lustig! Der Kerl war eine einzige fleischgewordene Karrikatur. Ich wüßte gar nicht, wie man über ihn Witze machen sollte, er ist schließlich selbst ein einziger Witz.

Ansonsten interessiert mich dieser Börsentag sowieso nicht. Auf flache Empfehlungen irgendwelcher Dünnbrettbohrer kann ich verzichten, und die Fachvorträge sind mE wertlos.
Gruß
Sovereign
hier noch mal das Programm für den Hamburger Börsentag 19.10.02
http://www.boersentag.de/home/mainframe/vortragsprogramm.htm…
http://www.boersentag.de/home/mainframe/vortragsprogramm.htm…
Ich hatte ja schon im Oktober 2001 eine Bärenmarktrally mit anschließendem Dax-Wert von 2500 vorhergesagt. Jetzt hätte ich eigentlich eine starke Aufwärtskorrektur erwartet. Diese wird m.E. jedoch inbesondere Aufgrund des heutigen Tages ausbleiben.
Kursbewegungen von 6% sind NICHT normal. Nach unten ging es nicht über 5% hinaus. Nach oben sind dei Ausschläge umso heftiger. Klassischer Bärenmarkt also.
Inzwischen ist der Dax auch nicht mehr überverkauft, sondern wieder neutral. Das Ende der Baisse wird erst dann kommen, wenn es min. 5 bis 10 Tage innerhalb von 3 bis 4 Monaten mit mehr als 5% Minus gegeben hat.
Die Baisse bleibt uns also über kurz oder eher lang erhalten.
Gruß
S.
Kursbewegungen von 6% sind NICHT normal. Nach unten ging es nicht über 5% hinaus. Nach oben sind dei Ausschläge umso heftiger. Klassischer Bärenmarkt also.
Inzwischen ist der Dax auch nicht mehr überverkauft, sondern wieder neutral. Das Ende der Baisse wird erst dann kommen, wenn es min. 5 bis 10 Tage innerhalb von 3 bis 4 Monaten mit mehr als 5% Minus gegeben hat.
Die Baisse bleibt uns also über kurz oder eher lang erhalten.
Gruß
S.
@sov. überlege Dir die Geschichte mit der Hamburger Veranstaltung noch mal.
1. Du könntest @niemandweiss treffen, was Dein Leben erheblich verändern könnte.
2. Es gibt unter Umständen bei freiem Eintritt leckere Häppchen, na das ist doch für einen Junggesellen nicht zu verachten.
Habe mich selbst schon lustig durchgefuttert bei der LBS (dankeschön)
Übrigens schleich doch einmal in Deinem Leben zu Aldi, der hat jetzt für eine Woche, je nach Vorrat, einen prima Spätburgunder aus Breisach für 2,99 €.
Prost.
J2
1. Du könntest @niemandweiss treffen, was Dein Leben erheblich verändern könnte.

2. Es gibt unter Umständen bei freiem Eintritt leckere Häppchen, na das ist doch für einen Junggesellen nicht zu verachten.
Habe mich selbst schon lustig durchgefuttert bei der LBS (dankeschön)
Übrigens schleich doch einmal in Deinem Leben zu Aldi, der hat jetzt für eine Woche, je nach Vorrat, einen prima Spätburgunder aus Breisach für 2,99 €.
Prost.
J2
ist souvereign eigentlich ein junger oder ein alter und reicher Junggeselle? 
 Mal abgesehen davon gibt es sicher noch mehr Jungesellschen auf dieser Veranstaltung
Mal abgesehen davon gibt es sicher noch mehr Jungesellschen auf dieser Veranstaltung 

 Mal abgesehen davon gibt es sicher noch mehr Jungesellschen auf dieser Veranstaltung
Mal abgesehen davon gibt es sicher noch mehr Jungesellschen auf dieser Veranstaltung 
@ jeffery
Labskaus - Zutaten für 4 Personen :
1,2 kg Kartoffeln
3 Zwiebeln
1/2 l Fleischbrühe
1 Dose (300 g) Corned Beef
1 Dose (300 g) Schweinefleisch
4 Gewürzgurken
Öl
Salz
Pfeffer
Muskat

Zugegeben, Sovereigns sortenreinen Syrah von der nördlichen Rhône passt nicht ganz dazu,
und die altrosafarbene Rührmasse wirkt ohne einen applizierten Rollmops ein wenig hilflos auf der Damasttischdecke...
Naja, wir essen´s ja auch nicht jeden Tag...
Danke übrigens für den Tipp mit dem Breisacher Spätburgunder von ALDI ! ( - Nord oder Süd ? )
- Angesicht der stagnierenden Lage auf den Goldmärkten werde ich diesen hochgeschätzten Dicounter mal aufsuchen.
Frage: Reichen 12 Flaschen oder wird es länger dauern mit der Baisse?
@ Sovereign
Dachsfett, ist – wie übrigens auch Murmeltierfett - im Alpenraum ein probates Mittel gegen Schorf und Rheuma. Zudem hilft gegen Kropf, wie es aus Peter Roseggers "Als ich noch ein Waldbauernbub war" zu entnehmen ist. Im Mittelalter waren diese Tierfettsalben der absolute Renner: Hirschtalg gegen Zipperlein und Gicht, Hundefett gegen schwärende Wunden. Vermengt mit pulverisierten Kräutern, Farben und Metallstäuben wurden auf den Märkten Mixturen feilgeboten die auch heute noch in abgelegenen Gegenden Niederbayerns als Naturheilmittel ihre Verwendung finden: zu Brei zerstampfte Frösche und Kröten, zerhackte Maulwurfsfüße, Schwänze von Ratten und Mäusen, Nasenhaare toter Fledermäuse – all diese Indigrenzien fanden ihre gläubigen Abnehmer. Kellerasseln schätzte man als harntreibend, - Lapislazuli half gegen Augenleiden. - Selbst vor dem Urin kalbender Kühe schreckten die fahrenden Ärzte, Olitäten- und Theriakhändler nicht zurück.
ach und bevor ich´s vergesse, Sovereign -
hier ist noch ein erprobtes Rezept für Dithmarscher Dickschädel:
MEHLBÜDDEL MIT ZWETSCHEN
Zutaten (für 4 Personen) :
90 g weiche Butter, 4 Eigelb, Salz, ¼ TL Kardamom, ¼ l Milch, 250 g Mehl, 4 Eiweiß, 50 g Rosinen, 750 g Zwetschen, 150 g Zucker, 1 Zimtstück, 1 Tasse Wasser
Butter und Eigelb cremig rühren. Salz, Kardamom und Milch zufügen, verrühren, Mehl daruntermischen. Eiweiß steif schlagen und mit den Rosinen unter den Teig heben.
Ein großes Tuch in eine Schüssel legen und mit etwas Mehl bestäuben, Teig daraufgeben. Das Tuch locker darüber zusammenbinden, so daß noch 2 Finger breit Luft ist.
In einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Einen Kochlöffelstil durch den Knoten des Teigbeutels ziehen und über den Topfrand legen. Teigbeutel hängend im siedenden Wasser etwa 2 Stunden köcheln lassen. Inzwischen Zwetschen waschen und entsteinen. Mit Wasser, Zucker und Zimt aufkochen. Zugedeckt etwa 5 Minuten schmoren; etwas abkühlen lassen. Mehlbeutel aud dem Topf nehmen, abtropfen und etwas ausdampfen lassen. In dicke Scheiben schneiden und zu den Zwetschen reichen.
Die Zubereitung dauert allerdings etwa 2 Stunden ...
Un dat Du ole Klookschieter nu ook noch Plattdüütsch snackken kunnst, hebb ick nu reinweg nich dacht !
Vundaag speelt uns Platt sien Rull nu ook bi de goldbugs !
Nee, wat is dat scheun !
Konradi
.
Labskaus - Zutaten für 4 Personen :
1,2 kg Kartoffeln
3 Zwiebeln
1/2 l Fleischbrühe
1 Dose (300 g) Corned Beef
1 Dose (300 g) Schweinefleisch
4 Gewürzgurken
Öl
Salz
Pfeffer
Muskat

Zugegeben, Sovereigns sortenreinen Syrah von der nördlichen Rhône passt nicht ganz dazu,
und die altrosafarbene Rührmasse wirkt ohne einen applizierten Rollmops ein wenig hilflos auf der Damasttischdecke...
Naja, wir essen´s ja auch nicht jeden Tag...

Danke übrigens für den Tipp mit dem Breisacher Spätburgunder von ALDI ! ( - Nord oder Süd ? )
- Angesicht der stagnierenden Lage auf den Goldmärkten werde ich diesen hochgeschätzten Dicounter mal aufsuchen.
Frage: Reichen 12 Flaschen oder wird es länger dauern mit der Baisse?
@ Sovereign
Dachsfett, ist – wie übrigens auch Murmeltierfett - im Alpenraum ein probates Mittel gegen Schorf und Rheuma. Zudem hilft gegen Kropf, wie es aus Peter Roseggers "Als ich noch ein Waldbauernbub war" zu entnehmen ist. Im Mittelalter waren diese Tierfettsalben der absolute Renner: Hirschtalg gegen Zipperlein und Gicht, Hundefett gegen schwärende Wunden. Vermengt mit pulverisierten Kräutern, Farben und Metallstäuben wurden auf den Märkten Mixturen feilgeboten die auch heute noch in abgelegenen Gegenden Niederbayerns als Naturheilmittel ihre Verwendung finden: zu Brei zerstampfte Frösche und Kröten, zerhackte Maulwurfsfüße, Schwänze von Ratten und Mäusen, Nasenhaare toter Fledermäuse – all diese Indigrenzien fanden ihre gläubigen Abnehmer. Kellerasseln schätzte man als harntreibend, - Lapislazuli half gegen Augenleiden. - Selbst vor dem Urin kalbender Kühe schreckten die fahrenden Ärzte, Olitäten- und Theriakhändler nicht zurück.
ach und bevor ich´s vergesse, Sovereign -
hier ist noch ein erprobtes Rezept für Dithmarscher Dickschädel:
MEHLBÜDDEL MIT ZWETSCHEN
Zutaten (für 4 Personen) :
90 g weiche Butter, 4 Eigelb, Salz, ¼ TL Kardamom, ¼ l Milch, 250 g Mehl, 4 Eiweiß, 50 g Rosinen, 750 g Zwetschen, 150 g Zucker, 1 Zimtstück, 1 Tasse Wasser
Butter und Eigelb cremig rühren. Salz, Kardamom und Milch zufügen, verrühren, Mehl daruntermischen. Eiweiß steif schlagen und mit den Rosinen unter den Teig heben.
Ein großes Tuch in eine Schüssel legen und mit etwas Mehl bestäuben, Teig daraufgeben. Das Tuch locker darüber zusammenbinden, so daß noch 2 Finger breit Luft ist.
In einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen. Einen Kochlöffelstil durch den Knoten des Teigbeutels ziehen und über den Topfrand legen. Teigbeutel hängend im siedenden Wasser etwa 2 Stunden köcheln lassen. Inzwischen Zwetschen waschen und entsteinen. Mit Wasser, Zucker und Zimt aufkochen. Zugedeckt etwa 5 Minuten schmoren; etwas abkühlen lassen. Mehlbeutel aud dem Topf nehmen, abtropfen und etwas ausdampfen lassen. In dicke Scheiben schneiden und zu den Zwetschen reichen.
Die Zubereitung dauert allerdings etwa 2 Stunden ...

Un dat Du ole Klookschieter nu ook noch Plattdüütsch snackken kunnst, hebb ick nu reinweg nich dacht !
Vundaag speelt uns Platt sien Rull nu ook bi de goldbugs !

Nee, wat is dat scheun !
Konradi

.
Trägt ein Ostfriese einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Nelke im Knopfloch, dann feiert er 20 Jahre unfallfreies Essen.
und,soll wahr sein.Hamburg ist die Fußmatte von Berlin.
Grüße Talvi
und,soll wahr sein.Hamburg ist die Fußmatte von Berlin.
Grüße Talvi

@ niemandweiss + jeffery
zum Börsentag in Hamburg: Ich war mal vor zwei Jahren da.
Zielgruppe: Tante Uschi und Onkel Herbert haben von Oma 10.000 Euro geerbt.
Häppchen gibt es kaum, (ich war allerdings nicht bei der LBS)
dafür kiloweise Hochglanzprospekte von Fidelity und DWS.
Andererseits: wir haben hier gerade einen echt "goldenen" Oktober und Hamburg ist immer ein Besuch wert.
Die Messe findet in den ehrwürdigen Räumen der alten Börse statt, die wiederum direkt mit dem Rathaus verbunden ist.
http://www.hamburg.de/StadtPol/Rathaus/welcome.htm
 konradi
konradi
zum Börsentag in Hamburg: Ich war mal vor zwei Jahren da.
Zielgruppe: Tante Uschi und Onkel Herbert haben von Oma 10.000 Euro geerbt.
Häppchen gibt es kaum, (ich war allerdings nicht bei der LBS)
dafür kiloweise Hochglanzprospekte von Fidelity und DWS.
Andererseits: wir haben hier gerade einen echt "goldenen" Oktober und Hamburg ist immer ein Besuch wert.
Die Messe findet in den ehrwürdigen Räumen der alten Börse statt, die wiederum direkt mit dem Rathaus verbunden ist.
http://www.hamburg.de/StadtPol/Rathaus/welcome.htm
 konradi
konradi
@konradi, Aldi-nord. Bin gestern schon mächtig herumgefahren um noch 30 Pülleken einzusammeln.
Wenn man sich bei Labskaus die Garnierungen wegdenkt, könnte es etwas sein, das schon mal gege....... Furchtbar.
@niemand. Sov. ist ein junger, der manchmal wie ein älterer schreibt. Reich .. wird er werden, wenn das mit Cambior usw. richtig funzt.
Allerdings ich denke er braucht eine Frau, die kochen, Bäume fällen, Fische fangen, Naturmedizin beherrscht usw. denn er will auf eine einsame Insel und hat zwei, sagen wir mal nicht ganz rechte Hände.
Hab ich jetzt nen neuen Feind aus Hamburg?
J2
Wenn man sich bei Labskaus die Garnierungen wegdenkt, könnte es etwas sein, das schon mal gege....... Furchtbar.
@niemand. Sov. ist ein junger, der manchmal wie ein älterer schreibt. Reich .. wird er werden, wenn das mit Cambior usw. richtig funzt.
Allerdings ich denke er braucht eine Frau, die kochen, Bäume fällen, Fische fangen, Naturmedizin beherrscht usw. denn er will auf eine einsame Insel und hat zwei, sagen wir mal nicht ganz rechte Hände.

Hab ich jetzt nen neuen Feind aus Hamburg?

J2
@ jeffery
- gleich 30 Pülleken ? – oha ! Das Foto mit dem Labskaus ist einfach schlecht arrangiert, - im Old Commercial Room ist es immer ein wenig schummrig, da sieht man dann nicht so genau , was da auf den Tellern serviert wird ! (zudem gibt es ja für alle Fälle noch die Bordeauxschätze ...)
Was Sovereign betrifft: Da hast Du eine feinsinnige Einschätzung angestellt. - Zur Ergänzung: seine Frau müsste auch noch ein Kochseminar bei Eckart Witzigmann belegt haben und fließend plattdüütsch und norwegisch sprechen.
- Zur Ergänzung: seine Frau müsste auch noch ein Kochseminar bei Eckart Witzigmann belegt haben und fließend plattdüütsch und norwegisch sprechen.
 konradi
konradi
- gleich 30 Pülleken ? – oha ! Das Foto mit dem Labskaus ist einfach schlecht arrangiert, - im Old Commercial Room ist es immer ein wenig schummrig, da sieht man dann nicht so genau , was da auf den Tellern serviert wird ! (zudem gibt es ja für alle Fälle noch die Bordeauxschätze ...)
Was Sovereign betrifft: Da hast Du eine feinsinnige Einschätzung angestellt.
 - Zur Ergänzung: seine Frau müsste auch noch ein Kochseminar bei Eckart Witzigmann belegt haben und fließend plattdüütsch und norwegisch sprechen.
- Zur Ergänzung: seine Frau müsste auch noch ein Kochseminar bei Eckart Witzigmann belegt haben und fließend plattdüütsch und norwegisch sprechen. konradi
konradi
Also, was mein Alter und meinen Familienstand betrifft:
Sollte ich mich an lokale Volksbräuche halten (was ich nicht tue), dann müßte ich im kommenden Frühjahr die Rathaustreppe fegen (daraus müßtet Ihr eigentlich entsprechende Rückschlüsse ziehen können).
"Ist sovereign eigentlich ein junger oder ein alter und reicher Junggeselle?" Allein ein junger Junggeselle, der zum alten Junggesellen wird, hat die Chance, zu Geld zu kommen (so er immer die Bankberater abwehrt)
Außerdem bin ich, so meine ich zumindest, keine gute Partie: Urlaub habe ich dieses Jahr noch keinen Tag genommen, wie`s aussieht werde ich auch Weihnachten durcharbeiten dürfen. Wenn ich abends nach Hause komme, habe ich im allgemeinem eine Scheißlaune. Addiert dazu meinen Hang zu zynischen und sarkastischen Bemerkungen, den Umstand, daß ich es mit Churchill halte (No Sports) und eine gewisse Misantrophie.
Zum Labskaus: Soweit ganz nett das Bild, aber: Die rote Beete sieht mir nicht hausgemacht aus! Außerdem erscheint mir das Spiegelei zu wabbelig: Ich bevorzuge sie von beiden Seiten gebraten!
Was "freien Eintritt" angeht: Wenn es keine schriftlichen Einladungen gibt (u.A.w.g.) dann kann man solche Sachen sowieso vergessen! Ein italienisches Buffet mit Chianti Classico werde ich dort wohl nicht serviert bekommen.
Ansonsten stimmt es natürlich: Ich futtere mich gerne und oft bei Veranstaltungen umsonst durch: Besonders weil sowas noch nicht als geldwerter Vorteil zu versteuern ist! Aber bei Veranstaltungen für jedermann gibt`s meistens nichts ordentliches.
Aber bei Veranstaltungen für jedermann gibt`s meistens nichts ordentliches.
@konradi, unseren "Plattdütschen":
Beim Mehlbüddel gibt es noch eine Verschärfung! Original reicht man dazu keine Zwetschen sondern geräucherten Speck! Hört sich gruselig an, oder?
Watt shall ick Die denn opp Platt sünst noch so vertelln? Mien Sippschaft weern toon meesten Deel jümmers Buurn wesst, doher mut ick wool oder övel een beeten Platt schnacken künn.
Gruß
Sovereign
P.S.: @talvi
"und,soll wahr sein.Hamburg ist die Fußmatte von Berlin." Pah, die Hamburger Pfeffersäcke haben schon am Bordeaux genippt, bevor die Berliner vom alten Fritz ihre ersten Kartoffeln zugeteilt bekamen. Berlin mag sich zwar Bundeshauptsatdt schimpfen, bleibt aber für den Hanseaten provinziell!
P.P.S.: Zum Aldi oder Lidl kriegen mich keine 10 Pferde! Kein Ambiente! Außerdem trinke ich aus Prinzip keinen deutschen Spätburgunder und einen Côte des Nuits werde ich beim Aldi wohl kaum finden
Sollte ich mich an lokale Volksbräuche halten (was ich nicht tue), dann müßte ich im kommenden Frühjahr die Rathaustreppe fegen (daraus müßtet Ihr eigentlich entsprechende Rückschlüsse ziehen können).
"Ist sovereign eigentlich ein junger oder ein alter und reicher Junggeselle?" Allein ein junger Junggeselle, der zum alten Junggesellen wird, hat die Chance, zu Geld zu kommen (so er immer die Bankberater abwehrt)

Außerdem bin ich, so meine ich zumindest, keine gute Partie: Urlaub habe ich dieses Jahr noch keinen Tag genommen, wie`s aussieht werde ich auch Weihnachten durcharbeiten dürfen. Wenn ich abends nach Hause komme, habe ich im allgemeinem eine Scheißlaune. Addiert dazu meinen Hang zu zynischen und sarkastischen Bemerkungen, den Umstand, daß ich es mit Churchill halte (No Sports) und eine gewisse Misantrophie.

Zum Labskaus: Soweit ganz nett das Bild, aber: Die rote Beete sieht mir nicht hausgemacht aus! Außerdem erscheint mir das Spiegelei zu wabbelig: Ich bevorzuge sie von beiden Seiten gebraten!
Was "freien Eintritt" angeht: Wenn es keine schriftlichen Einladungen gibt (u.A.w.g.) dann kann man solche Sachen sowieso vergessen! Ein italienisches Buffet mit Chianti Classico werde ich dort wohl nicht serviert bekommen.
Ansonsten stimmt es natürlich: Ich futtere mich gerne und oft bei Veranstaltungen umsonst durch: Besonders weil sowas noch nicht als geldwerter Vorteil zu versteuern ist!
 Aber bei Veranstaltungen für jedermann gibt`s meistens nichts ordentliches.
Aber bei Veranstaltungen für jedermann gibt`s meistens nichts ordentliches.@konradi, unseren "Plattdütschen":
Beim Mehlbüddel gibt es noch eine Verschärfung! Original reicht man dazu keine Zwetschen sondern geräucherten Speck! Hört sich gruselig an, oder?

Watt shall ick Die denn opp Platt sünst noch so vertelln? Mien Sippschaft weern toon meesten Deel jümmers Buurn wesst, doher mut ick wool oder övel een beeten Platt schnacken künn.

Gruß
Sovereign
P.S.: @talvi
"und,soll wahr sein.Hamburg ist die Fußmatte von Berlin." Pah, die Hamburger Pfeffersäcke haben schon am Bordeaux genippt, bevor die Berliner vom alten Fritz ihre ersten Kartoffeln zugeteilt bekamen. Berlin mag sich zwar Bundeshauptsatdt schimpfen, bleibt aber für den Hanseaten provinziell!

P.P.S.: Zum Aldi oder Lidl kriegen mich keine 10 Pferde! Kein Ambiente! Außerdem trinke ich aus Prinzip keinen deutschen Spätburgunder und einen Côte des Nuits werde ich beim Aldi wohl kaum finden

ich hab mal was aus dem "cabinda-thread" von"woernie"geklaut, weil es mir wichtig erscheint.
woernie - ich hoffe auf Dein Verstädnis
morgen leute,
nur kurz eine info die fuer den einen oder anderen vielleicht interessant ist im hinblick auf den verlauf der naechsten paar wochen.
das sogenannte `reballancing` der pensionsfonds in den staaten wird der mittelfristige schluessel zum weiteren verlauf sein. diese fonds sind per statuten gehalten einen bestimmten anteil ihres verwaltungsvermoegens in Renten und einen gewissen teil in aktien zu halten. durch die starken kursgewinne bei renten und vice versa verluste bei aktien muss irgendwann umgeschichtet werden. so war es auch im oktober 2001!
wann das ist? vermutlich jetzt...
---
- passen würde dazu auch eine mögliche Zinserhöhung - wie von der Chefvolkswirtin des "Conference Board" -
Gail Fosler, angedeutet wurde, denn damit würde die Umschichtung in die Aktienmärkte zusätzlich befeuert ...)
konradi
.
woernie - ich hoffe auf Dein Verstädnis

morgen leute,
nur kurz eine info die fuer den einen oder anderen vielleicht interessant ist im hinblick auf den verlauf der naechsten paar wochen.
das sogenannte `reballancing` der pensionsfonds in den staaten wird der mittelfristige schluessel zum weiteren verlauf sein. diese fonds sind per statuten gehalten einen bestimmten anteil ihres verwaltungsvermoegens in Renten und einen gewissen teil in aktien zu halten. durch die starken kursgewinne bei renten und vice versa verluste bei aktien muss irgendwann umgeschichtet werden. so war es auch im oktober 2001!
wann das ist? vermutlich jetzt...
---
- passen würde dazu auch eine mögliche Zinserhöhung - wie von der Chefvolkswirtin des "Conference Board" -
Gail Fosler, angedeutet wurde, denn damit würde die Umschichtung in die Aktienmärkte zusätzlich befeuert ...)
konradi
.
.
Ullrich Fichtner - DER SPIEGEL 42/2002 - 14. Oktober 2002
Die September-Lüge
Spinner? Aufklärer? Unbelehrbare? Verschwörungstheoretiker sehen die CIA, den Mossad oder andere Dienste in die Anschläge des 11. September verwickelt. Besonders deutschen Intellektuellen passen solche Theorien in die antiamerikanische Weltanschauung.
Trocken und heiß zog der 9. September über Toronto auf, Montag vor fünf Wochen, für Punkt 10 Uhr Ortszeit war Delmart "Mike" Vreelands Verhandlung bei Gericht angesetzt, aber Vreeland kam nicht, und so begann, im Wirrwarr der Geschichten, schon wieder eine neue. Tags darauf sagte Vreelands Anwalt Paul Slansky ins Telefon, unaufgeregt, wie vor Gericht, er fürchte, sein Mandant sei "zum Schweigen gebracht worden", also womöglich: tot, womöglich: ermordet.
Stimmt das, so wird die Suche nach den Tätern schwer werden, denn stimmen die Aussagen, die Vreeland bis zu seinem Verschwinden machte, dann hatte er Feinde ohne Zahl, darunter alle Geheimdienste der USA und Kanadas, die irakische Regierung und die russische, dazu diverse Drogenringe, ein paar amerikanische Mafia-Clans, und zusätzlich hatten sich die Polizeiapparate von mindestens vier US- Bundesstaaten gegen ihn verschworen.
Es ist der Stoff, aus dem Geschichten sind. Drehbücher. Romane. Nach Delmart Vreelands eigener Aussage, gegliedert in 64 Punkte, 15 A4-Seiten lang, beeidigt vor den kanadischen Behörden am 7. Oktober 2001, war er lange Jahre ein Geheimagent der U. S. Navy im Rang eines Leutnants, ein 007 im Dauereinsatz mit großer Legende.
Im Spätsommer 2000 will er, als Maulwurf in Moskau, brisante Papiere abgegraben haben, aus denen er ein Jahr später, einen Monat vor dem 11. September, gelernt haben will, dass sich bald ein großer schwarzer Tag in die Weltgeschichte einbrennen könnte. Er kritzelte Namen von Gebäuden auf einen Zettel, Pentagon, White House, dazu Pfeile, Buchstaben, Ausrufezeichen. Waren das die Notizen eines Mitwissers? Eines Kronzeugen gegen die offizielle Version? Oder doch nur Spielchen eines phantasiebegabten Ganoven?
Es ist der Stoff, aus dem Geschichten sind. Und Verschwörungstheorien: Wussten die US-Geheimdienste alles vorab? Ahnte das Weiße Haus, was auf Amerika zukommt? Bastelten sich die Vereinigten Staaten ein Motiv für den Clash of Civilizations, für den Krieg gegen den Islam? Was wird gespielt? Wem nützt es? Wer hat kein Alibi? Wo raucht ein Revolver?
So fragen sich seit einem Jahr die Wahrheitssucher, Hobby-Ermittler, Verschwörungstheoretiker in aller Welt, für sie ist Vreelands Fall nur einer von vielen, der die Zweifel nährt und die kritische Phantasie beflügelt. In Deutschland hat Mathias Bröckers ein Buch verfasst, das den Tag des Terrors als Komplott böser Mächte einschließlich des Weißen Hauses und der Bush-Familie erscheinen lässt. In Frankreich hat Thierry Meyssan mit "L`Effroyable Imposture" ("Der fürchterliche Betrug " ) einen Bestseller platziert, in dem behauptet wird, der Anschlag auf das Pentagon habe so nie stattgefunden.
Rund um den Globus finden sich die Amateure solcher Wahrheiten per Computer in Foren vernetzt und per Newsletter verbündet. Sie jagen ihre Schlüsselbegriffe in Sachen 11. September, all die vermeintlichen Indizien, Gerüchte, auch ihre Wahnideen durch die Suchmaschinen Google, Lycos, Yahoo, drehen ihre Spekulationen durch den Wolf des Internet, tauschen Spuren aus wie kostbare Briefmarken und arbeiten selbstgewiss an der "Wahrheit" hinter der offiziellen "Version".
Wortführer der "alternativen Ermittlung" sind Ex-Polizisten wie Michael Ruppert aus Kalifornien oder der Ökonom Michel Chossudovsky aus Kanada, man trifft sich online im "Guerrilla News Network" oder debattiert "what really happened" auf gleichnamigen Internet-Seiten. Immer gesellen sich namenlose Ex-Geheimdienstler hinzu, Ex-Feuerwehrleute, vorgebliche Versicherungsfachleute aus Mexiko und München, anonyme Ingenieure, die in den Nebel fragen, alles besser wissen, besser als die Polizei, als die Untersuchungsausschüsse, als die "Mainstream-Medien".
Für ihre großen Gegenthesen haben sie nicht einen einzigen Beweis. Aber sie sind sich ihrer Sache ganz sicher.
"Ich stelle nur Fragen", sagt Andreas von Bülow, 65, Ex-Staatssekretär, Ex-Minister, 25 Jahre war er Abgeordneter der SPD im Bundestag, "ich würde mich nie aufschwingen zu sagen, wer es war."
Goldener Oktober, draußen Bonn-Bad-Godesberg, vor den Fenstern des Hotels "Dreesen" geht der Rhein, darüber ein Himmel, so klar, wie der am 11. September. Viele Interviews hat Bülow im ablaufenden Jahr gegeben, hat sich ins Fernsehen gesetzt, an Radiomikrofone, hat in "Konkret" und "Tagesspiegel" über die "wahren Hintergründe" des 11. September geredet, hat die "amtliche Verschwörungstheorie" hinterfragt, bezweifelt, abgetan. Jedes Mal klang er dabei wie einer, der mehr weiß, als er verrät. Der einen Trumpf hat, der erst noch kommt.
"Die offizielle Version ist eine Lüge aus Tausendundeiner Nacht, das ist klar", sagt Andreas von Bülow, als wären die Drahtzieher der Qaida nicht identifiziert und festgenommen worden, als ginge mittlerweile die arabische Welt nicht selbst davon aus, dass am 11. September Bin Laden aktiv wurde im geschundenen Namen Allahs. Nein, mit Bin Laden sei eine "Fehlspur" gelegt worden, "breit wie von einer trampelnden Elefantenherde. Gegen den gleichgerichteten Strom der Medienberichterstattung kommt man jetzt natürlich nicht mehr an". Bülow ist mit dem Fahrrad zum Treffen gekommen, es gefällt ihm, gefragt zu sein, er wirkt wie ein zu junger Pensionär.
Er sagt, egal, wer auch immer dahinter stecke, in Wahrheit gehe es darum, die globale Tagesordnung der nächsten 50 Jahre festzuklopfen, um den Zugriff der einzig übrig gebliebenen Supermacht auf Öl, Gas und andere Bodenschätze sicherzustellen. Deshalb werde der islamische Terrorismus und jetzt der ölreiche Irak ohne hinreichenden Beweis zur globalen Bedrohung "hochgefälscht, und ich", sagt Bülow, "tue, was in meinen Kräften steht, um gegen dieses Hochkitzeln einer neuen Feindschaft mit dem Islam Front zu machen".
Aber was geschah am 11. September? Wer war es? "Das fragen mich viele", sagt Bülow. Dann greift er wahllos in die Kiste mit den üblichen Verdächtigen. CIA, sagt er, als wäre das Kürzel allein schon ein Skandal. Mossad, sagt er, echauffiert. Mafia. Machtzirkel. Finanzelite. Imperium USA. Andreas von Bülow sitzt im Bonner Hotel "Dreesen" vor einem Salat von Tafelspitz, hat keinen Trumpf mehr und sagt ernst: "Ich verlange eine Untersuchung."
Als hätte es nie eine gegeben. Ende September erstattete in Washington ein Team von Ermittlern Bericht über Wissen und Vorwissen der US-Geheimdienste in Sachen 11. September. 24 Polizisten, Juristen, Innenrevisoren hatten daran ein Jahr lang gearbeitet, im Auftrag des Kongresses, ein Jahr lang hatten sie Menschen und Dokumente befragt, Aktentürme bewegt, Datenbanken, und sie kamen, angeführt von Eleanor Hill, einer Top-Anwältin aus Washington, zweifelsfrei zu dem Schluss, dass die Geheimdienste fürchterlich versagt hatten.
CIA, FBI, all die anderen, laut Bericht hatten sie deutlich vor dem 11. September alle Elemente der heraufziehenden Katastrophe zusammen. Es gab, verstreut in den Apparaten, das Wissen über Terrorplots mit Zivilflugzeugen; man hatte gehört, in fehlgehenden Memos, von einer auffälligen Präsenz junger Araber an US-Flugschulen; man war, ahnungslos, dem Terrorpiloten Hani Hanjour schon fast auf den Fersen; man konnte rechnen, diffus, mit Gefahren für Wolkenkratzer; und alle Beteiligten kannten, seit Jahren, Osama Bin Laden, seine Helfer, seinen Terrorapparat, seine Kriegserklärungen - nur: Am Ende sahen sie alle das Muster nicht, nicht den Wald vor Bäumen. Am Ende konnten sie nur, nach dem Schlag, der Welt sehr schnell mitteilen, wer mutmaßlich das Massaker angerichtet hatte.
So viel immerhin fanden die zwei Dutzend Ermittler, dass die Geheimdienste der USA unfähig sind. Sie fanden Strukturfehler, Missgunst, Inkompetenz. Sie ermittelten Eitelkeiten, Korpsgeist, Engstirnigkeit. Eine Verschwörung fanden sie nicht. Nicht in den Papieren von 14 US-Behörden, darunter alle Geheimdienste des Landes. Nicht in 400 000 Blatt Akten, die sie sichteten seit April 2002 in Tag- und Nachtarbeit. Nicht in 66 000 Blatt Gesprächsnotizen, Telefonlisten, Memos, E-Mails, die sie ihrem Bericht als Anhang beigaben. Nicht in 400 Interviews, die sie führten mit allen Geheimdienstlern, die mit dem 11. September irgendetwas zu tun hatten.
Doch die Freunde der Verschwörungen sind nimmersatt im Zweifeln und Fragen und Stochern. Zum Beispiel das Pentagon: Flog denn wirklich eine Boeing in die Südwest-Fassade, American Airlines 77, am Steuerhorn der Terrorist Hani Hanjour? Wieso existieren keine Fotos, keine Videos vom Einschlag, noch nicht einmal große Trümmer der Maschine, überhaupt keine begreifbaren, sichtbaren Beweise dafür, dass ein Flugzeug ins Gebäude krachte?
Dutzende Internet-Seiten widmen sich allein diesem "Pentagon-Mysterium", der "Pentbomb". Auch Thierry Meyssans Buch zitiert Experten herbei, die behaupten, dass die Explosion anders hätte aussehen müssen; dass sie ganz andere Spuren hätte hinterlassen müssen; dass ein ungeübter Pilot die Aktion nicht habe ausführen können; dass alles viel eher, zum Beispiel, für eine Autobombe spreche oder für eine Rakete; dass, gut möglich, gar kein Terrorakt stattfand. So fragen sich die Wahrheitssucher Stück für Stück fort aus der Realität.
Hinweise, die gegen die eigene Mundzu-Mund-Ermittlung sprechen, landen im Schubfach Propagandalüge. So ignorieren die Verschwörungstheoretiker die Existenz all derjenigen, die am Tag der Ereignisse die große Boeing kommen und im Pentagon explodieren sahen, sie nehmen keine Notiz von Dutzenden Augenzeugen, die den Hergang detailreich beschrieben in Gesprächen mit Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen.
Die Netzwerker, sie ahnen nichts von der Höllenkraft der Physik, die ein Flugzeug mit Leichtigkeit in Fetzen und Klumpen zerlegt. Manche übersehen gar, dass in den Tagen danach 125 Menschen beerdigt wurden, die Opfer aus dem Gebäude. Und dass 59 Menschenleben ausgelöscht waren, die Passagiere und Crew der entführten Boeing 757, American Airlines 77.
Sie wollen es nicht wissen. Sie wollen an Legenden stricken. Wichtig sein im Cyberspace. Punkte sammeln im größten Computerspiel aller Zeiten, im verzwicktesten Rätselraten seit der Ermordung John F. Kennedys. Seit Pearl Harbor. Dabei bauen sie sich ihr eigenes Googlegate.
Widersprüche lösen sich auf in einem System endloser Querverweise, in dem alles mit allem zusammenhängt und in dem entweder alles stimmen muss - oder gar nichts stimmen kann. Unmöglich etwa, im Detail gegen eine These wie diese zu argumentieren: dass die "geopolitischen Schachmeister" im Weißen Haus und im Pentagon "zwei Türme" geopfert hätten, um auf lange Sicht besser dazustehen im Kampf um die "globale Vorherrschaft".
So etwas glaubt man - oder man lässt es lieber. Geschrieben hat es Mathias Bröckers in seinem Buch über die "Verschwörungen" des 11. September, das sich in den ersten drei Tagen nach Erscheinen im September 5000-mal verkauft hat und im ersten Monat auf dem Markt mehrere Auflagen erlebte. Bröckers, 48, er nennt sich einen "Konspirologen", hat einen Bestseller des Unbehagens verfasst. Er trinkt Milchkaffee im West-Berliner Café "Einstein", er ist aufgeräumter Stimmung, er raucht kurze Zigaretten ohne Filter. Er sagt, die Sonnenbrille auf die Stirn geschoben: "Es geht doch hier nicht darum, Herrn Bush irgendwie dumm anzupissen", und das sagt er, als müsste "Herr Bush" ihn, Bröckers, kennen. Oder fürchten.
Er jedenfalls wusste gleich, als American Airlines 11 eben in den Nordturm eingeschlagen war, dass an der ganzen Sache etwas zum Himmel stank. Stinken musste. Es war so ein Gefühl. Und als im Fernsehen bald der Name Bin Laden fiel, "urplötzlich", wusste Bröckers, was läuft. "Da habe ich angefangen, ein paar Fragen zu stellen." Nach der Verschwörung. Von oben.
Bröckers, langjähriger Journalist, als Autor bislang mit einem Werk über Hanf in Erscheinung getreten, begann die Arbeit an einem "konspirologischen Tagebuch", das heißt, er verbrachte Tage und Nächte am Computer, schürfte nach Verschwörungsstoff im Ozean des Internet und verquirlte seine Fundstücke zu Kommentaren für die "taz" und den Online-Dienst "telepolis".
Die Leser waren begeistert. Viele Menschen stellten sich Fragen in jenen Tagen. Viele hatten und haben, bis heute, so ein Gefühl. Wie Bröckers. Wie Bülow. Dass etwas faul sein müsse, weil doch in Sachen USA immer irgendetwas faul ist. Weil doch seit 40, 50 Jahren schon das alte Lied gesungen wird in immer neuen Strophen, bei Tisch, beim Bier, auf Partys: Pearl Harbor. Watergate. Vietnam. Irangate. Öl. Und jetzt also: Pentagate?
"Ich stelle nur Fragen", sagt Bröckers. Zum Beispiel: Warum blieb Bush so "merkwürdig ungerührt", als er die Nachricht aus New York bei seinem Auftritt in der Schule hörte? "Vielleicht weil die ,Schurken` den verabredeten Zeitpunkt eingehalten hatten?" Und organisiert Bush seine Regierung nicht wie einen Geheimbund?
So fragt sich Bröckers 360 Seiten lang über den eigenen Amerika-Komplex aus und bebildert wie nebenbei den tiefen Argwohn vieler deutscher Linker und Intellektueller gegen die Übermacht USA. Bröckers` Buch dokumentiert die Denkart eines deutschen Milieus, das sich zwischen Woodstock und "Brainwashington" politisierte, knapp zu jung für 1968, viel zu alt für 1989, aber unerschütterlich im Glauben an die Macht der eigenen Weltsicht, der sich die Wirklichkeit zu fügen hat, nicht umgekehrt.
Die Aktivisten dieser Weltanschauung begreifen die Attentate des 11. September nicht als Anschlag aufs eigene Denken, sondern machen daraus ein Komplott all der machtbesessenen Täuscher, denen sie schon zu Schulzeiten nicht über den Weg trauten. Dabei will es den Zweiflern heute plausibler vorkommen, dass der gesamte Regierungsapparat der USA, das Militär, die staatlichen zivilen Institutionen von Luftüberwachung bis Feuerwehr in einen gemeinschaftlichen Massenmord verstrickt sind, als dass die USA attackiert wurden von einer islamistischen Terroristenbande. Was für manchen Rechten die "Auschwitz-Lüge" ist, könnte für manchen Linken die "September-Lüge" werden. Eine verdrängte Wahrheit, um die Weltanschauung nicht verändern zu müssen.
Die "alternativen Aufklärer" - in Deutschland Bröckers, Bülow und Co., in Frankreich Meyssan und die Seinen, in Amerika die Rupperts und Chossudovskys -, im Fieber des Bestätigungswahns alter Weltbilder behindern sie die Wahrheitsfindung mehr, als dass sie sie beförderten. Sie vergeuden ihre Energie in den Maschen des World Wide Web, statt im konkreten Hier und Jetzt fehlende Fakten auszuforschen.
So ist etwa noch lange nicht befriedigend geklärt, wie am 11. September die Luftraumüberwachung arbeitete, das heißt: nicht arbeitete, wann sich die Kampfjets der Air Force an jenem Tag wo genau befanden, warum die US-Hauptstadt Washington mit all ihren symbolischen Monumenten einem Angriff derart schutzlos ausgeliefert war.
Es sind Fragen offen nach den Flugschreibern, allen Flugschreibern, besonders aber jenen der American Airlines 77, die ins Pentagon jagte, und denen der United Airlines 93, die in Pennsylvania niederging. Es gilt, grundsätzlich, das Gebaren der US-Geheimdienste zu durchleuchten, denen gefährliche Nähe zu den Taliban, zu islamischen Terrorgruppen, selbst zu Bin Laden und der Qaida nachgesagt werden.
Es gibt, auch ohne den Glauben an die Weltverschwörung, genug Fragen, genug Stoff, aus dem reale, beunruhigende Geschichten gemacht sind. Aber die irrealen gedeihen besser. Sie wuchern wie Urwald, weil jeder mitreden darf, der einen Computer hat und eine Telefonbuchse.
Es war, in Wirklichkeit, der Mossad.
Es war die CIA.
Es war Gottes Strafe.
Es war der Satan selbst.
14 ist die Quersumme von 09/11/2001, folglich waren es die Illuminaten.
Die USA werden von einer geheimen Parallelregierung geführt, die sich in unterirdischen Bunkern versteckt hält.
Man kann den neuen 20-Dollar-Schein so falten, dass "OSAMA" zu lesen ist.
So will sich alles auflösen in Interpretationen, Gerüchte, Hirngespinste. Die Fakten werden zu Splittern in einem Kaleidoskop, das je nach Drehung neue Bilder gaukelt.
Aber die Wirklichkeit ist schwerer zu fassen. Sie findet nicht im Internet statt, wo die Weltverschwörung immer nur zwei Mausklicks entfernt liegt. Und wo die Antwort auf alle Fragen Google heißt.
Ullrich Fichtner - DER SPIEGEL 42/2002 - 14. Oktober 2002
Die September-Lüge
Spinner? Aufklärer? Unbelehrbare? Verschwörungstheoretiker sehen die CIA, den Mossad oder andere Dienste in die Anschläge des 11. September verwickelt. Besonders deutschen Intellektuellen passen solche Theorien in die antiamerikanische Weltanschauung.
Trocken und heiß zog der 9. September über Toronto auf, Montag vor fünf Wochen, für Punkt 10 Uhr Ortszeit war Delmart "Mike" Vreelands Verhandlung bei Gericht angesetzt, aber Vreeland kam nicht, und so begann, im Wirrwarr der Geschichten, schon wieder eine neue. Tags darauf sagte Vreelands Anwalt Paul Slansky ins Telefon, unaufgeregt, wie vor Gericht, er fürchte, sein Mandant sei "zum Schweigen gebracht worden", also womöglich: tot, womöglich: ermordet.
Stimmt das, so wird die Suche nach den Tätern schwer werden, denn stimmen die Aussagen, die Vreeland bis zu seinem Verschwinden machte, dann hatte er Feinde ohne Zahl, darunter alle Geheimdienste der USA und Kanadas, die irakische Regierung und die russische, dazu diverse Drogenringe, ein paar amerikanische Mafia-Clans, und zusätzlich hatten sich die Polizeiapparate von mindestens vier US- Bundesstaaten gegen ihn verschworen.
Es ist der Stoff, aus dem Geschichten sind. Drehbücher. Romane. Nach Delmart Vreelands eigener Aussage, gegliedert in 64 Punkte, 15 A4-Seiten lang, beeidigt vor den kanadischen Behörden am 7. Oktober 2001, war er lange Jahre ein Geheimagent der U. S. Navy im Rang eines Leutnants, ein 007 im Dauereinsatz mit großer Legende.
Im Spätsommer 2000 will er, als Maulwurf in Moskau, brisante Papiere abgegraben haben, aus denen er ein Jahr später, einen Monat vor dem 11. September, gelernt haben will, dass sich bald ein großer schwarzer Tag in die Weltgeschichte einbrennen könnte. Er kritzelte Namen von Gebäuden auf einen Zettel, Pentagon, White House, dazu Pfeile, Buchstaben, Ausrufezeichen. Waren das die Notizen eines Mitwissers? Eines Kronzeugen gegen die offizielle Version? Oder doch nur Spielchen eines phantasiebegabten Ganoven?
Es ist der Stoff, aus dem Geschichten sind. Und Verschwörungstheorien: Wussten die US-Geheimdienste alles vorab? Ahnte das Weiße Haus, was auf Amerika zukommt? Bastelten sich die Vereinigten Staaten ein Motiv für den Clash of Civilizations, für den Krieg gegen den Islam? Was wird gespielt? Wem nützt es? Wer hat kein Alibi? Wo raucht ein Revolver?
So fragen sich seit einem Jahr die Wahrheitssucher, Hobby-Ermittler, Verschwörungstheoretiker in aller Welt, für sie ist Vreelands Fall nur einer von vielen, der die Zweifel nährt und die kritische Phantasie beflügelt. In Deutschland hat Mathias Bröckers ein Buch verfasst, das den Tag des Terrors als Komplott böser Mächte einschließlich des Weißen Hauses und der Bush-Familie erscheinen lässt. In Frankreich hat Thierry Meyssan mit "L`Effroyable Imposture" ("Der fürchterliche Betrug " ) einen Bestseller platziert, in dem behauptet wird, der Anschlag auf das Pentagon habe so nie stattgefunden.
Rund um den Globus finden sich die Amateure solcher Wahrheiten per Computer in Foren vernetzt und per Newsletter verbündet. Sie jagen ihre Schlüsselbegriffe in Sachen 11. September, all die vermeintlichen Indizien, Gerüchte, auch ihre Wahnideen durch die Suchmaschinen Google, Lycos, Yahoo, drehen ihre Spekulationen durch den Wolf des Internet, tauschen Spuren aus wie kostbare Briefmarken und arbeiten selbstgewiss an der "Wahrheit" hinter der offiziellen "Version".
Wortführer der "alternativen Ermittlung" sind Ex-Polizisten wie Michael Ruppert aus Kalifornien oder der Ökonom Michel Chossudovsky aus Kanada, man trifft sich online im "Guerrilla News Network" oder debattiert "what really happened" auf gleichnamigen Internet-Seiten. Immer gesellen sich namenlose Ex-Geheimdienstler hinzu, Ex-Feuerwehrleute, vorgebliche Versicherungsfachleute aus Mexiko und München, anonyme Ingenieure, die in den Nebel fragen, alles besser wissen, besser als die Polizei, als die Untersuchungsausschüsse, als die "Mainstream-Medien".
Für ihre großen Gegenthesen haben sie nicht einen einzigen Beweis. Aber sie sind sich ihrer Sache ganz sicher.
"Ich stelle nur Fragen", sagt Andreas von Bülow, 65, Ex-Staatssekretär, Ex-Minister, 25 Jahre war er Abgeordneter der SPD im Bundestag, "ich würde mich nie aufschwingen zu sagen, wer es war."
Goldener Oktober, draußen Bonn-Bad-Godesberg, vor den Fenstern des Hotels "Dreesen" geht der Rhein, darüber ein Himmel, so klar, wie der am 11. September. Viele Interviews hat Bülow im ablaufenden Jahr gegeben, hat sich ins Fernsehen gesetzt, an Radiomikrofone, hat in "Konkret" und "Tagesspiegel" über die "wahren Hintergründe" des 11. September geredet, hat die "amtliche Verschwörungstheorie" hinterfragt, bezweifelt, abgetan. Jedes Mal klang er dabei wie einer, der mehr weiß, als er verrät. Der einen Trumpf hat, der erst noch kommt.
"Die offizielle Version ist eine Lüge aus Tausendundeiner Nacht, das ist klar", sagt Andreas von Bülow, als wären die Drahtzieher der Qaida nicht identifiziert und festgenommen worden, als ginge mittlerweile die arabische Welt nicht selbst davon aus, dass am 11. September Bin Laden aktiv wurde im geschundenen Namen Allahs. Nein, mit Bin Laden sei eine "Fehlspur" gelegt worden, "breit wie von einer trampelnden Elefantenherde. Gegen den gleichgerichteten Strom der Medienberichterstattung kommt man jetzt natürlich nicht mehr an". Bülow ist mit dem Fahrrad zum Treffen gekommen, es gefällt ihm, gefragt zu sein, er wirkt wie ein zu junger Pensionär.
Er sagt, egal, wer auch immer dahinter stecke, in Wahrheit gehe es darum, die globale Tagesordnung der nächsten 50 Jahre festzuklopfen, um den Zugriff der einzig übrig gebliebenen Supermacht auf Öl, Gas und andere Bodenschätze sicherzustellen. Deshalb werde der islamische Terrorismus und jetzt der ölreiche Irak ohne hinreichenden Beweis zur globalen Bedrohung "hochgefälscht, und ich", sagt Bülow, "tue, was in meinen Kräften steht, um gegen dieses Hochkitzeln einer neuen Feindschaft mit dem Islam Front zu machen".
Aber was geschah am 11. September? Wer war es? "Das fragen mich viele", sagt Bülow. Dann greift er wahllos in die Kiste mit den üblichen Verdächtigen. CIA, sagt er, als wäre das Kürzel allein schon ein Skandal. Mossad, sagt er, echauffiert. Mafia. Machtzirkel. Finanzelite. Imperium USA. Andreas von Bülow sitzt im Bonner Hotel "Dreesen" vor einem Salat von Tafelspitz, hat keinen Trumpf mehr und sagt ernst: "Ich verlange eine Untersuchung."
Als hätte es nie eine gegeben. Ende September erstattete in Washington ein Team von Ermittlern Bericht über Wissen und Vorwissen der US-Geheimdienste in Sachen 11. September. 24 Polizisten, Juristen, Innenrevisoren hatten daran ein Jahr lang gearbeitet, im Auftrag des Kongresses, ein Jahr lang hatten sie Menschen und Dokumente befragt, Aktentürme bewegt, Datenbanken, und sie kamen, angeführt von Eleanor Hill, einer Top-Anwältin aus Washington, zweifelsfrei zu dem Schluss, dass die Geheimdienste fürchterlich versagt hatten.
CIA, FBI, all die anderen, laut Bericht hatten sie deutlich vor dem 11. September alle Elemente der heraufziehenden Katastrophe zusammen. Es gab, verstreut in den Apparaten, das Wissen über Terrorplots mit Zivilflugzeugen; man hatte gehört, in fehlgehenden Memos, von einer auffälligen Präsenz junger Araber an US-Flugschulen; man war, ahnungslos, dem Terrorpiloten Hani Hanjour schon fast auf den Fersen; man konnte rechnen, diffus, mit Gefahren für Wolkenkratzer; und alle Beteiligten kannten, seit Jahren, Osama Bin Laden, seine Helfer, seinen Terrorapparat, seine Kriegserklärungen - nur: Am Ende sahen sie alle das Muster nicht, nicht den Wald vor Bäumen. Am Ende konnten sie nur, nach dem Schlag, der Welt sehr schnell mitteilen, wer mutmaßlich das Massaker angerichtet hatte.
So viel immerhin fanden die zwei Dutzend Ermittler, dass die Geheimdienste der USA unfähig sind. Sie fanden Strukturfehler, Missgunst, Inkompetenz. Sie ermittelten Eitelkeiten, Korpsgeist, Engstirnigkeit. Eine Verschwörung fanden sie nicht. Nicht in den Papieren von 14 US-Behörden, darunter alle Geheimdienste des Landes. Nicht in 400 000 Blatt Akten, die sie sichteten seit April 2002 in Tag- und Nachtarbeit. Nicht in 66 000 Blatt Gesprächsnotizen, Telefonlisten, Memos, E-Mails, die sie ihrem Bericht als Anhang beigaben. Nicht in 400 Interviews, die sie führten mit allen Geheimdienstlern, die mit dem 11. September irgendetwas zu tun hatten.
Doch die Freunde der Verschwörungen sind nimmersatt im Zweifeln und Fragen und Stochern. Zum Beispiel das Pentagon: Flog denn wirklich eine Boeing in die Südwest-Fassade, American Airlines 77, am Steuerhorn der Terrorist Hani Hanjour? Wieso existieren keine Fotos, keine Videos vom Einschlag, noch nicht einmal große Trümmer der Maschine, überhaupt keine begreifbaren, sichtbaren Beweise dafür, dass ein Flugzeug ins Gebäude krachte?
Dutzende Internet-Seiten widmen sich allein diesem "Pentagon-Mysterium", der "Pentbomb". Auch Thierry Meyssans Buch zitiert Experten herbei, die behaupten, dass die Explosion anders hätte aussehen müssen; dass sie ganz andere Spuren hätte hinterlassen müssen; dass ein ungeübter Pilot die Aktion nicht habe ausführen können; dass alles viel eher, zum Beispiel, für eine Autobombe spreche oder für eine Rakete; dass, gut möglich, gar kein Terrorakt stattfand. So fragen sich die Wahrheitssucher Stück für Stück fort aus der Realität.
Hinweise, die gegen die eigene Mundzu-Mund-Ermittlung sprechen, landen im Schubfach Propagandalüge. So ignorieren die Verschwörungstheoretiker die Existenz all derjenigen, die am Tag der Ereignisse die große Boeing kommen und im Pentagon explodieren sahen, sie nehmen keine Notiz von Dutzenden Augenzeugen, die den Hergang detailreich beschrieben in Gesprächen mit Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen.
Die Netzwerker, sie ahnen nichts von der Höllenkraft der Physik, die ein Flugzeug mit Leichtigkeit in Fetzen und Klumpen zerlegt. Manche übersehen gar, dass in den Tagen danach 125 Menschen beerdigt wurden, die Opfer aus dem Gebäude. Und dass 59 Menschenleben ausgelöscht waren, die Passagiere und Crew der entführten Boeing 757, American Airlines 77.
Sie wollen es nicht wissen. Sie wollen an Legenden stricken. Wichtig sein im Cyberspace. Punkte sammeln im größten Computerspiel aller Zeiten, im verzwicktesten Rätselraten seit der Ermordung John F. Kennedys. Seit Pearl Harbor. Dabei bauen sie sich ihr eigenes Googlegate.
Widersprüche lösen sich auf in einem System endloser Querverweise, in dem alles mit allem zusammenhängt und in dem entweder alles stimmen muss - oder gar nichts stimmen kann. Unmöglich etwa, im Detail gegen eine These wie diese zu argumentieren: dass die "geopolitischen Schachmeister" im Weißen Haus und im Pentagon "zwei Türme" geopfert hätten, um auf lange Sicht besser dazustehen im Kampf um die "globale Vorherrschaft".
So etwas glaubt man - oder man lässt es lieber. Geschrieben hat es Mathias Bröckers in seinem Buch über die "Verschwörungen" des 11. September, das sich in den ersten drei Tagen nach Erscheinen im September 5000-mal verkauft hat und im ersten Monat auf dem Markt mehrere Auflagen erlebte. Bröckers, 48, er nennt sich einen "Konspirologen", hat einen Bestseller des Unbehagens verfasst. Er trinkt Milchkaffee im West-Berliner Café "Einstein", er ist aufgeräumter Stimmung, er raucht kurze Zigaretten ohne Filter. Er sagt, die Sonnenbrille auf die Stirn geschoben: "Es geht doch hier nicht darum, Herrn Bush irgendwie dumm anzupissen", und das sagt er, als müsste "Herr Bush" ihn, Bröckers, kennen. Oder fürchten.
Er jedenfalls wusste gleich, als American Airlines 11 eben in den Nordturm eingeschlagen war, dass an der ganzen Sache etwas zum Himmel stank. Stinken musste. Es war so ein Gefühl. Und als im Fernsehen bald der Name Bin Laden fiel, "urplötzlich", wusste Bröckers, was läuft. "Da habe ich angefangen, ein paar Fragen zu stellen." Nach der Verschwörung. Von oben.
Bröckers, langjähriger Journalist, als Autor bislang mit einem Werk über Hanf in Erscheinung getreten, begann die Arbeit an einem "konspirologischen Tagebuch", das heißt, er verbrachte Tage und Nächte am Computer, schürfte nach Verschwörungsstoff im Ozean des Internet und verquirlte seine Fundstücke zu Kommentaren für die "taz" und den Online-Dienst "telepolis".
Die Leser waren begeistert. Viele Menschen stellten sich Fragen in jenen Tagen. Viele hatten und haben, bis heute, so ein Gefühl. Wie Bröckers. Wie Bülow. Dass etwas faul sein müsse, weil doch in Sachen USA immer irgendetwas faul ist. Weil doch seit 40, 50 Jahren schon das alte Lied gesungen wird in immer neuen Strophen, bei Tisch, beim Bier, auf Partys: Pearl Harbor. Watergate. Vietnam. Irangate. Öl. Und jetzt also: Pentagate?
"Ich stelle nur Fragen", sagt Bröckers. Zum Beispiel: Warum blieb Bush so "merkwürdig ungerührt", als er die Nachricht aus New York bei seinem Auftritt in der Schule hörte? "Vielleicht weil die ,Schurken` den verabredeten Zeitpunkt eingehalten hatten?" Und organisiert Bush seine Regierung nicht wie einen Geheimbund?
So fragt sich Bröckers 360 Seiten lang über den eigenen Amerika-Komplex aus und bebildert wie nebenbei den tiefen Argwohn vieler deutscher Linker und Intellektueller gegen die Übermacht USA. Bröckers` Buch dokumentiert die Denkart eines deutschen Milieus, das sich zwischen Woodstock und "Brainwashington" politisierte, knapp zu jung für 1968, viel zu alt für 1989, aber unerschütterlich im Glauben an die Macht der eigenen Weltsicht, der sich die Wirklichkeit zu fügen hat, nicht umgekehrt.
Die Aktivisten dieser Weltanschauung begreifen die Attentate des 11. September nicht als Anschlag aufs eigene Denken, sondern machen daraus ein Komplott all der machtbesessenen Täuscher, denen sie schon zu Schulzeiten nicht über den Weg trauten. Dabei will es den Zweiflern heute plausibler vorkommen, dass der gesamte Regierungsapparat der USA, das Militär, die staatlichen zivilen Institutionen von Luftüberwachung bis Feuerwehr in einen gemeinschaftlichen Massenmord verstrickt sind, als dass die USA attackiert wurden von einer islamistischen Terroristenbande. Was für manchen Rechten die "Auschwitz-Lüge" ist, könnte für manchen Linken die "September-Lüge" werden. Eine verdrängte Wahrheit, um die Weltanschauung nicht verändern zu müssen.
Die "alternativen Aufklärer" - in Deutschland Bröckers, Bülow und Co., in Frankreich Meyssan und die Seinen, in Amerika die Rupperts und Chossudovskys -, im Fieber des Bestätigungswahns alter Weltbilder behindern sie die Wahrheitsfindung mehr, als dass sie sie beförderten. Sie vergeuden ihre Energie in den Maschen des World Wide Web, statt im konkreten Hier und Jetzt fehlende Fakten auszuforschen.
So ist etwa noch lange nicht befriedigend geklärt, wie am 11. September die Luftraumüberwachung arbeitete, das heißt: nicht arbeitete, wann sich die Kampfjets der Air Force an jenem Tag wo genau befanden, warum die US-Hauptstadt Washington mit all ihren symbolischen Monumenten einem Angriff derart schutzlos ausgeliefert war.
Es sind Fragen offen nach den Flugschreibern, allen Flugschreibern, besonders aber jenen der American Airlines 77, die ins Pentagon jagte, und denen der United Airlines 93, die in Pennsylvania niederging. Es gilt, grundsätzlich, das Gebaren der US-Geheimdienste zu durchleuchten, denen gefährliche Nähe zu den Taliban, zu islamischen Terrorgruppen, selbst zu Bin Laden und der Qaida nachgesagt werden.
Es gibt, auch ohne den Glauben an die Weltverschwörung, genug Fragen, genug Stoff, aus dem reale, beunruhigende Geschichten gemacht sind. Aber die irrealen gedeihen besser. Sie wuchern wie Urwald, weil jeder mitreden darf, der einen Computer hat und eine Telefonbuchse.
Es war, in Wirklichkeit, der Mossad.
Es war die CIA.
Es war Gottes Strafe.
Es war der Satan selbst.
14 ist die Quersumme von 09/11/2001, folglich waren es die Illuminaten.
Die USA werden von einer geheimen Parallelregierung geführt, die sich in unterirdischen Bunkern versteckt hält.
Man kann den neuen 20-Dollar-Schein so falten, dass "OSAMA" zu lesen ist.
So will sich alles auflösen in Interpretationen, Gerüchte, Hirngespinste. Die Fakten werden zu Splittern in einem Kaleidoskop, das je nach Drehung neue Bilder gaukelt.
Aber die Wirklichkeit ist schwerer zu fassen. Sie findet nicht im Internet statt, wo die Weltverschwörung immer nur zwei Mausklicks entfernt liegt. Und wo die Antwort auf alle Fragen Google heißt.

Ich stehe den Elliotfreaks ja skeptisch gegenüber. Vielleicht bin ich ja nur zu blöde die Wellen richtig abzuzählen, aber irgendwie erinnert mich das Ganze an Horoskop und Kaffeesatz.
Andererseits: wenn man sich bei Uwe Warmbein und Jürgen Küßner umschaut beschleicht einem das Gefühl "da ist wohl was dran ..."
Eine Erklärung liefert die Spieltheorie. - Bezüglich der Goldpreisentwicklung hat "seher 33" im derzeit heißdiskussierten "ribaldcorellothread" die augenblickliche Stagnation wohl auf den Punkt gebracht:
Die Anfälligkeit dieser intelligenten Handelssysteme liegt darin,
das sie das Wahrscheinlichste (also hier Kursrückgang ab 326/328 $ )
annehmen und die Trades danach ausrichten.
(...)
Angenommen, wir stoßen in die Zone 226/228 $ wiedereinmal
vor, alle gehen short, der Kurs geht langsam zurück, noch
mehr gehen short (ist ja absolut sicher!!), alle Techniker
fühlen sich bestärkt und brabbeln was von Doppeltop, Unter-
schreiten von wichtigen Unterstützungslinien, Vollendung der
Nackenlinie, Elliot-wave theorien, Abschwung unter 280$
Blabla ...
(...)
Letzte Woche bekamen zwei Ökonomen den Nobelpreis für ihre verhaltensorientierte Grundlagenforschung:
Daniel Kahnemann und Vernon Smith. Die "ZEIT" hat zu deren Forschung einen interessanten Artikel veröffentlicht:
***
Die Revolution hat begonnen
Auf Wiedersehen, Homo oeconomicus: Lange glaubte die Wirtschaftswissenschaft, dass der Mensch sich rational verhält.
Doch jetzt sehen die Forscher, wie wir wirklich entscheiden - und ziehen ihre Theorie in Zweifel
von Uwe Jean Heuser
In der Wissenschaft dauern Revolutionen ein Leben lang. Vor fast einem halben Jahrhundert begann der deutsche Mathematiker und Ökonom Reinhard Selten, die Spieltheorie zu erforschen. Sie kann Situationen erhellen, in denen Menschen sich durch ihre Entscheidungen gegenseitig beeinflussen - Brettspiele genauso wie den Wettbewerb auf einzelnen Märkten. Selten war erfolgreich: Ohne seine Ideen könnten Wirtschaftswissenschaftler einige dieser kniffligen Probleme heute noch nicht verstehen.
Das reichte dem jungen Forscher aber nicht. Tatsächlich führte er ein Doppelleben. In seinem Büro entwickelte er weiter die eleganten Modelle - samt und sonders gehen sie vom rationalen Entscheider aus, der alle verfügbaren Informationen trefflich nutzt und auf diese Weise das Beste für sich herausholt. Doch immer öfter ging Reinhard Selten hinunter ins Labor und rüttelte am Fundament seiner Wissenschaft. Dort testete er, wie die Menschen sich wirklich verhalten. Studenten und andere Probanden spielten die Theorien durch und demonstrierten ein ums andere Mal, dass Menschen nicht so sind, wie Ökonomen sie über Jahrhunderte gern haben wollten. Anders als der Homo oeconomicus, jenes Extrembild des rationalen Menschen, konnten und wollten die Mitspieler ihren Eigennutz nicht maximieren. Teils schätzten sie die Situationen falsch ein und machten unbewusst Fehler; teils nahmen sie Verluste bewusst in Kauf, um andere zu Fairness und Zusammenarbeit zu erziehen - und das alles nicht bloß zufällig, sondern mit vorhersagbaren Wirkungen auf das Ergebnis des Mit- und Gegeneinanders. Fortan diente Selten die Theorie nicht mehr als eine akzeptable Vereinfachung der Wirklichkeit, sondern als Elle, an der sich die Abweichungen der Menschen vom Ideal messen lassen.
Die Revolution hatte begonnen. Doch kaum jemand wollte sie wahrhaben. Selbst als Selten im Oktober 1994 als erster Deutscher den Nobelpreis für Ökonomie gewann, galt alle Aufmerksamkeit seinen Taten für die Spieltheorie. Im Trubel ging unter, dass dieser freundliche Mann längst zu den verwegensten und beharrlichsten Kritikern seiner Zunft gehörte.
Am Mittwoch vergangener Woche kam der Durchbruch. Zwei andere Pioniere der verhaltensorientierten Ökonomie erhielten den Nobelpreis: der aus Israel stammende Psychologe Daniel Kahneman und der amerikanische Experimental- forscher Vernon Smith. Es wurde höchste Zeit. In Labors und Befragungsräumen, Seminarzimmern und Lehrstuben nimmt längst eine ganze Forschergeneration das Menschenbild der Ökonomen auseinander.
"Seit drei, vier Jahren schießt die Entwicklung exponentiell in die Höhe. Heute werden Verhaltensökonomen überall gesucht", sagt der Züricher Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr, selbst ein Vorreiter der Revolution.
[/b]Kein Wunder, erklären sie doch Phänomene, die ihre klassischen Kollegen nur als Verirrungen abtun konnten. So wird die besondere Furcht der Menschen belegt, ins Hintertreffen zu geraten. Sie ist ein Grund, warum Bankmanager auf Teufel komm raus riskante Kredite vergeben, wenn ein Konkurrent es vormacht.[/b]
Im Abschwung, so wie jetzt, wird die Krise dann umso schwerer, weil alle Banken unter enormen Ausfällen leiden.
Rationale Menschen hätten auch kaum New-Economy-Aktien gekauft, als ihr Kurs zehn mal höher war als ihre mögliche Ertragskraft. Anders sieht das bei Anlegern aus, die von der Angst gelenkt werden, den Zug zum Reichtum zu verpassen.
Selbst vermeintlich einfachen Ansprüchen an sein Verhalten mag der Mensch nicht genügen. Nur ein Beispiel: Angenommen ein Autokäufer zieht im direkten Vergleich den VW Golf einem Opel Astra vor; er findet den Opel im zweiten Vergleich jedoch besser als den Ford Focus. Dann müsste er schließlich im dritten Vergleich den VW besser finden als den Ford. Tut er vielfach aber nicht - und verletzt eine grundlegende Annahme der Ökonomie.
Wo immer die Verhaltensforscher ihre Neugier hinwenden, finden sie Widersprüche zur Theorie und säen Zweifel:
Wenn die Menschen nun partout nicht so rational sind, wie die Ökonomie annahm - können sie dann wirklich von freien Märkten profitieren? Legen sie dann ihr Geld fürs Alter am besten selbst an, oder sollte der Staat auf sie aufpassen? Und umgekehrt: Muss der Staat wirklich immer neue Ökologie-Gesetze erlassen, wenn seine Bürger gar nicht so egoistisch sind wie angenommen und in einer Welt ohne tausend Vorschriften die Umwelt selbst schützen würden?
Die Fragen sind offen, aber eines ist beschlossene Sache: Mit dem Menschenbild verändern die Ökonomen auch die Weltsicht ihres Faches.
Seit Adam Smith ist der rationale Entscheider die Grundlage wirtschaftlichen Denkens. Das allgemeine Credo, wenn es überhaupt zur Sprache kam, lautete so: Zwar hat der Mensch moralische Anwandlungen, zwar begeht er mitunter auch Entscheidungsfehler - aber dass einzelne Marktteilnehmer zufällig vom Ideal abweichen, ändert nichts am Marktergebnis.
Selbst John Maynard Keynes hätte das unterschrieben, obwohl er doch mit der Konjunkturtheorie der Klassiker brach. Volkswirtschaften könnten in die Depression abdriften, wenn der Staat im Abschwung nicht mehr Geld ausgebe, behauptete der britische Ökonom in den dreißiger Jahren - weil jeder Bürger in der Wirtschaftskrise bereits für sich das Beste tut und Geld hortet, statt etwas zu kaufen.
Erst der spätere amerikanische Nobelpreisträger Herbert Simon hinterfragte ab 1950 die offenen und im Theoriegebäude versteckten Annahmen der Kollegen. Die Ökonomie erwartet vom Menschen, dass er nicht nur alle Handlungsalternativen überblickt, sondern auch weiß, welche Folgen mit welcher Wahrscheinlichkeit eintreten, wenn er eine Option wählt. Selbst wenn ihm hundert Alternativen offen stehen, kann er sie alle einordnen. Beobachtungen in Unternehmen und sein gesunder Menschenverstand sagten Simon aber etwas anderes. Er entwickelte ein Gegenkonzept.
In Simons Welt der "begrenzten Rationalität" können sich die Menschen mit ihrer beschränkten Auffassungsgabe immer nur um einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit kümmern, und ihr Verstand kann bloß ein Bedürfnis auf einmal verarbeiten. Sie suchen sich ein paar vielversprechende Alternativen, wägen kurz ab und treffen ihre Wahl.
Maximiert wird nichts. Simons Menschenmodell lässt zu, dass der Einzelne mit der Zeit höchst widersprüchliche Entscheidungen fällt.
Simons Kritik war visionär. Und sie war es auch, die den jungen Reinhard Selten ins Labor trieb. Dennoch bewegte sich die Ökonomie erst einmal in die entgegengesetzte Richtung. In immer feineren Modellen verlangten die Theoretiker immer neue Kunststücke von ihrem Homo oeconomicus. Die neoliberalen Ökonomen um Milton Friedman in Chicago verordneten ihm, dass er Investitionsentscheidungen trifft, die sein ganzes Leben umspannen.
Schließlich brachte Chicago-Boy Robert Lucas im Jahr 1979 die Theorie der rationalen Erwartungen ins Spiel.
Das Postulat: Menschen entscheiden nicht bloß rational, sondern bilden auch ihre Erwartung über volkswirtschaftliche Größen wie Inflation ohne Fehl und Tadel. Um dem Modell zu genügen, müssten sie alle verfügbaren Informationen gemäß dem richtigen Modell der Volkswirtschaft verarbeiten und im Durchschnitt den richtigen Zukunftswert treffen - die Theorie war in sich bestechend und schob keynesianische Ansätze beiseite, doch der heroischen Annahme können im wirklichen Leben nicht einmal studierte Volkswirte entsprechen.
Die Rationalitätsbewegung erreichte ihren Höhepunkt. Für ihre Protagonisten hagelte es Nobelpreise. Theoretiker aus Chicago und geistesverwandten Orten wandten ihre eleganten Formelwerke auf politische Fragen und private Entscheidungen wie die Wahl des Heiratspartners an.
Der Homo oeconomicus auf dem Gipfel - doch die Gegenbewegung nahm Tempo auf. Daniel Kahneman belegte gemeinsam mit seinem 1996 verstorbenen Kollegen Amos Tversky unentwegt neu, wie weit die herrschende Theorie von der Realität entfernt war. Der Mensch, den sie aus ihrer Forschung kannten, handelte so ganz anders als jenes Wesen aus den Büchern der Ökonomen. Seine Entscheidungen beruhen nicht auf komplizierten Rechnungen, sondern auf Daumenregeln. So misst er neuen Informationen eine besonders hohe Aufmerksamkeit zu - und bewertet sie regelmäßig über. Mit dieser menschlichen Gewohnheit erklärt die "Theorie der nervösen Frösche", warum etwa der Dollarkurs ungleich stärker schwankt als die wirtschaftlichen Aussichten in Europa und Amerika: Jede kleine Neuigkeit verursacht überdimensionale Ausschläge.
Ein anderes Beispiel: Meistens hält der Mensch solche Ereignisse für wahrscheinlich, die in seiner Vorstellungswelt eine große Rolle spielen - Arbeitslose zum Beispiel erwarten für das Land eine höhere Arbeitslosigkeit als andere Bürger. Und wer sich an der Börse verzockt hat, sieht für die Zukunft des Aktienmarktes besonders schwarz. Das ist alles verständlich, widerspricht aber dem Ideal.
Kahneman und Co. zeigten, wie sich der Mensch seine komplizierte Umwelt handhabbar macht - und darüber die Gesetze der Ökonomen in den Wind schlägt. Immerzu sucht er nach Ankern für sein Denken. Wenn der Laden um die Ecke einen Preisnachlass aufhebt, ärgert uns das weniger, als wenn er den regulären Preis erhöht. Warum? Weil wir uns einen Anhaltspunkt für die Bewertung diktieren lassen - in dem Fall den "regulären" Preis. Der Homo oeconomicus würde das nie tun.
Nur selten bewertet der reale Mensch seine Optionen nach objektiven Kriterien wie Produktionskosten oder Marktlage. Wichtiger ist ihm der Vergleich zu dem, was er bisher hatte oder als seinen Anspruch betrachtete - und zum Besitz anderer. Eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent freut uns, bis wir hören müssen, dass der lächelnde Kollege im Nebenbüro gerade zehn Prozent mehr bekommen hat. Dem Homo oeconomicus wäre das egal.
Andere Ungläubige wiesen in Experimenten nach: Auch in Wirtschaftsdingen handelt der Mensch nicht rein egoistisch. Wenn ein Kaufhaus im Unwetter den Preis für Regenschirme erhöht, wie es dem Gesetz von Angebot und Nachfrage entspricht, finden das die meisten unfair. Um eine solche Firma zu bestrafen, nehmen sie längere Fahrtwege oder schlechtere Qualität in Kauf. Andere Konsumenten meiden Produkte eines Konzerns, der Rassen diskriminiert, obwohl sie sich selbst davon keinen Vorteil versprechen.
Nichts von all dem passt zum gängigen Modell.
Vernon Smith, der sich nun mit Kahneman den Nobelpreis teilt, spielte im Labor durch, wie ganze Märkte kippen können, weil die Akteure den falschen Anreizen erliegen. In diese Kategorie fällt der "Fluch des Gewinners": Auktionen, bei denen das höchste Gebot gewinnt, enden regelmäßig im wirtschaftlichen Desaster. Einige Bieter schätzen den Ertrag richtig ein, andere zu niedrig und wieder andere zu hoch. Es gewinnt aber derjenige, der den Ertrag - eines versteigerten Bohrrechts oder einer Sendelizenz beispielsweise - überschätzt. Sein Verlust ist programmiert.
Mit der Flut an Widersprüchen kommt die Erkenntnis: Die Kritik am ökonomischen Menschenbild verschwindet nicht wieder. Die Verhaltensmuster sind so tief eingewoben, dass die Verbraucher, Anleger oder Manager ihnen nicht entkommen können - wenn sie es überhaupt wollen. Mag sein, erklärt Daniel Kahneman, dass sie aus einem Fehler lernen. Doch die nächste Situation sehe immer ein wenig anders aus als die vorherige, und schon weiche man wieder vom Gebot der Rationalität ab.
Anleger hätten es von früheren Börsenkrächen wissen sollen: Die Aktienblase musste platzen. Und doch war alles irgendwie neu, das Internet und die New Economy, der inflationsfreie Aufschwung in Amerika und die Sicherheit verheißenden Investmentfonds.
Gerade im Umgang mit Geld lauern so viele Gedankenfallen, dass ein eigener Forschungszweig namens Behavioral Finance das Verhalten auf den Finanzmärkten untersucht.
Vorhersagbar verkaufen Anleger ihre Aktien zu spät, wenn der Kurs schnell fällt. Systematisch schätzen sie ihre eigene Prognosefähigkeit zu hoch ein und reden Abweichungen im Nachhinein schön, was die Experten als "Das wussten wir schon immer"-Effekt bezeichnen.
Wie sich der Einzelne verhält, schlägt sich oft im Marktergebnis nieder - und hebelt spätestens dann die klassische Theorie aus. Denn "die Rationalen rechnen mit den Irrationalen", erklärt Ernst Fehr. Sie treiben im Boom die Preise weiter hoch und versuchen, kurz vor der Horde auszusteigen. In der Baisse geht das Spiel genau umgekehrt.
Das Auf und Ab der Finanzmärkte - und somit auch der Konjunktur - lässt sich besser erklären, wenn man die Wahrnehmung und Wünsche der Menschen für bare Münze nimmt, statt sie wegzudefinieren. Aber lässt es sich auch durch Bewusstseinswandel oder clevere Staatseingriffe verändern?
Die Revolutionäre stehen am Anfang. Das alte Menschenmodell haben sie demontiert, vom neuen halten sie aber nur Einzelteile in Händen. Daniel Kahneman findet immer neue Differenzierungen in unserem Verhalten. Zum Beispiel unterscheidet er zwischen dem Nutzen, den wir vor einem Kauf erwarten, beim Konsum erleben und später erinnern. Vielfach sind die drei Phasen alles andere als identisch. Und der Verbraucher trifft eine Wahl, die ihn später ärgert.
Als er begann, hoffte Reinhard Selten noch, das Entscheidungsverhalten lasse sich in ein paar Prinzipien zusammenfassen. Heute, viele Experimente später, meint er, dass uns Hunderte von Regeln unter all den verschiedenen Umständen leiten. Seine These: "Entscheidungen werden nicht gemacht, sie quellen auf." Rationales Abwägen ist demnach nur einer von mehreren Beratern. Manchmal schlägt dieser Berater eine Entscheidung vor, manchmal weist er lediglich auf die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen hin. Die Entscheidung selbst fällt dann unterbewusst - manchmal gibt die Ratio den Ausschlag, aber manchmal eben nicht, auch wenn wir unsere Wahl später als rational beschreiben.
Anders als der Homo oeconomicus ist der Homo sapiens schwer zu fassen. Die Ökonomen streiten darüber, wie weit die Revolution geht. Nicht weit, meint Joe Stiglitz, Nobelpreisträger von 2001: "Die Verhaltensökonomie reißt ein paar bleibende Löcher. Nur wenige Irrationalitäten sind wirklich von Bedeutung, der Rest ist unwichtig." Der New Yorker Professor glaubt, dass die Menschen auch in ihrem wirtschaftlichen Verhalten dazulernen, und wenn künftig ein neues Modell die Ökonomie verändere, so sagt er, dann eines über das Lernen.
Auf alle Fälle verlieren die Ökonomen das eine Modell, welches sie bedenkenlos auf alle Fragen anwenden können.
Wie Naturwissenschaftler wollten sie im vergangenen Jahrhundert allgemeine Gesetze aufstellen, doch während der Newtonsche Apfel immer wieder vom Baum zur Erde fällt, ändern sich die Stimmungen der Menschen. Deshalb rücken die Verhaltensforscher die Ökonomie jetzt wieder ein Stück in Richtung Geisteswissenschaften: Für verschiedenste Situationen muss die alte Weisheit neu überprüft werden. Die dismal science, die trostlose Wissenschaft, wie die Angelsachsen sie getauft haben, wird offener, überraschender - und vielleicht für normale Menschen zugänglicher.
Rückt sie deswegen ideologisch nach links und liefert dem Staat neue Gründe einzugreifen?
Vergangenes Jahr druckte die liberal-konservative Neue Zürcher Zeitung eine Serie über Verhaltensökonomie. Mit Ungeduld und Willensschwäche würden sich Verbraucher und Sparer selbst schaden, stand da unter anderem. Die Beiträge weckten manchen Zweifel an freien Märkten. (!!! )
)
Am Ende wurde es dem verantwortlichen Redakteur zu bunt, und er schrieb, die Beobachtung von unvernünftigem Verhalten könne "dazu verführen, die Menschen zu ihrem ,Glück` zwingen zu wollen".
Aber so einfach ist die Revolution gar nicht einzuordnen. "Die Verhaltensökonomie begründet nicht die Forderung nach mehr Staat", sagt Joe Stiglitz. "Wenn die Regierung lernen kann - warum dann nicht die Menschen selbst?" So gesehen, ist die Revolution der Ökonomen auch eine Herausforderung an alle Laien.
Andererseits: wenn man sich bei Uwe Warmbein und Jürgen Küßner umschaut beschleicht einem das Gefühl "da ist wohl was dran ..."
Eine Erklärung liefert die Spieltheorie. - Bezüglich der Goldpreisentwicklung hat "seher 33" im derzeit heißdiskussierten "ribaldcorellothread" die augenblickliche Stagnation wohl auf den Punkt gebracht:
Die Anfälligkeit dieser intelligenten Handelssysteme liegt darin,
das sie das Wahrscheinlichste (also hier Kursrückgang ab 326/328 $ )
annehmen und die Trades danach ausrichten.
(...)
Angenommen, wir stoßen in die Zone 226/228 $ wiedereinmal
vor, alle gehen short, der Kurs geht langsam zurück, noch
mehr gehen short (ist ja absolut sicher!!), alle Techniker
fühlen sich bestärkt und brabbeln was von Doppeltop, Unter-
schreiten von wichtigen Unterstützungslinien, Vollendung der
Nackenlinie, Elliot-wave theorien, Abschwung unter 280$
Blabla ...
(...)
Letzte Woche bekamen zwei Ökonomen den Nobelpreis für ihre verhaltensorientierte Grundlagenforschung:
Daniel Kahnemann und Vernon Smith. Die "ZEIT" hat zu deren Forschung einen interessanten Artikel veröffentlicht:
***
Die Revolution hat begonnen
Auf Wiedersehen, Homo oeconomicus: Lange glaubte die Wirtschaftswissenschaft, dass der Mensch sich rational verhält.
Doch jetzt sehen die Forscher, wie wir wirklich entscheiden - und ziehen ihre Theorie in Zweifel
von Uwe Jean Heuser
In der Wissenschaft dauern Revolutionen ein Leben lang. Vor fast einem halben Jahrhundert begann der deutsche Mathematiker und Ökonom Reinhard Selten, die Spieltheorie zu erforschen. Sie kann Situationen erhellen, in denen Menschen sich durch ihre Entscheidungen gegenseitig beeinflussen - Brettspiele genauso wie den Wettbewerb auf einzelnen Märkten. Selten war erfolgreich: Ohne seine Ideen könnten Wirtschaftswissenschaftler einige dieser kniffligen Probleme heute noch nicht verstehen.
Das reichte dem jungen Forscher aber nicht. Tatsächlich führte er ein Doppelleben. In seinem Büro entwickelte er weiter die eleganten Modelle - samt und sonders gehen sie vom rationalen Entscheider aus, der alle verfügbaren Informationen trefflich nutzt und auf diese Weise das Beste für sich herausholt. Doch immer öfter ging Reinhard Selten hinunter ins Labor und rüttelte am Fundament seiner Wissenschaft. Dort testete er, wie die Menschen sich wirklich verhalten. Studenten und andere Probanden spielten die Theorien durch und demonstrierten ein ums andere Mal, dass Menschen nicht so sind, wie Ökonomen sie über Jahrhunderte gern haben wollten. Anders als der Homo oeconomicus, jenes Extrembild des rationalen Menschen, konnten und wollten die Mitspieler ihren Eigennutz nicht maximieren. Teils schätzten sie die Situationen falsch ein und machten unbewusst Fehler; teils nahmen sie Verluste bewusst in Kauf, um andere zu Fairness und Zusammenarbeit zu erziehen - und das alles nicht bloß zufällig, sondern mit vorhersagbaren Wirkungen auf das Ergebnis des Mit- und Gegeneinanders. Fortan diente Selten die Theorie nicht mehr als eine akzeptable Vereinfachung der Wirklichkeit, sondern als Elle, an der sich die Abweichungen der Menschen vom Ideal messen lassen.
Die Revolution hatte begonnen. Doch kaum jemand wollte sie wahrhaben. Selbst als Selten im Oktober 1994 als erster Deutscher den Nobelpreis für Ökonomie gewann, galt alle Aufmerksamkeit seinen Taten für die Spieltheorie. Im Trubel ging unter, dass dieser freundliche Mann längst zu den verwegensten und beharrlichsten Kritikern seiner Zunft gehörte.
Am Mittwoch vergangener Woche kam der Durchbruch. Zwei andere Pioniere der verhaltensorientierten Ökonomie erhielten den Nobelpreis: der aus Israel stammende Psychologe Daniel Kahneman und der amerikanische Experimental- forscher Vernon Smith. Es wurde höchste Zeit. In Labors und Befragungsräumen, Seminarzimmern und Lehrstuben nimmt längst eine ganze Forschergeneration das Menschenbild der Ökonomen auseinander.
"Seit drei, vier Jahren schießt die Entwicklung exponentiell in die Höhe. Heute werden Verhaltensökonomen überall gesucht", sagt der Züricher Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr, selbst ein Vorreiter der Revolution.
[/b]Kein Wunder, erklären sie doch Phänomene, die ihre klassischen Kollegen nur als Verirrungen abtun konnten. So wird die besondere Furcht der Menschen belegt, ins Hintertreffen zu geraten. Sie ist ein Grund, warum Bankmanager auf Teufel komm raus riskante Kredite vergeben, wenn ein Konkurrent es vormacht.[/b]
Im Abschwung, so wie jetzt, wird die Krise dann umso schwerer, weil alle Banken unter enormen Ausfällen leiden.
Rationale Menschen hätten auch kaum New-Economy-Aktien gekauft, als ihr Kurs zehn mal höher war als ihre mögliche Ertragskraft. Anders sieht das bei Anlegern aus, die von der Angst gelenkt werden, den Zug zum Reichtum zu verpassen.
Selbst vermeintlich einfachen Ansprüchen an sein Verhalten mag der Mensch nicht genügen. Nur ein Beispiel: Angenommen ein Autokäufer zieht im direkten Vergleich den VW Golf einem Opel Astra vor; er findet den Opel im zweiten Vergleich jedoch besser als den Ford Focus. Dann müsste er schließlich im dritten Vergleich den VW besser finden als den Ford. Tut er vielfach aber nicht - und verletzt eine grundlegende Annahme der Ökonomie.
Wo immer die Verhaltensforscher ihre Neugier hinwenden, finden sie Widersprüche zur Theorie und säen Zweifel:
Wenn die Menschen nun partout nicht so rational sind, wie die Ökonomie annahm - können sie dann wirklich von freien Märkten profitieren? Legen sie dann ihr Geld fürs Alter am besten selbst an, oder sollte der Staat auf sie aufpassen? Und umgekehrt: Muss der Staat wirklich immer neue Ökologie-Gesetze erlassen, wenn seine Bürger gar nicht so egoistisch sind wie angenommen und in einer Welt ohne tausend Vorschriften die Umwelt selbst schützen würden?
Die Fragen sind offen, aber eines ist beschlossene Sache: Mit dem Menschenbild verändern die Ökonomen auch die Weltsicht ihres Faches.
Seit Adam Smith ist der rationale Entscheider die Grundlage wirtschaftlichen Denkens. Das allgemeine Credo, wenn es überhaupt zur Sprache kam, lautete so: Zwar hat der Mensch moralische Anwandlungen, zwar begeht er mitunter auch Entscheidungsfehler - aber dass einzelne Marktteilnehmer zufällig vom Ideal abweichen, ändert nichts am Marktergebnis.
Selbst John Maynard Keynes hätte das unterschrieben, obwohl er doch mit der Konjunkturtheorie der Klassiker brach. Volkswirtschaften könnten in die Depression abdriften, wenn der Staat im Abschwung nicht mehr Geld ausgebe, behauptete der britische Ökonom in den dreißiger Jahren - weil jeder Bürger in der Wirtschaftskrise bereits für sich das Beste tut und Geld hortet, statt etwas zu kaufen.
Erst der spätere amerikanische Nobelpreisträger Herbert Simon hinterfragte ab 1950 die offenen und im Theoriegebäude versteckten Annahmen der Kollegen. Die Ökonomie erwartet vom Menschen, dass er nicht nur alle Handlungsalternativen überblickt, sondern auch weiß, welche Folgen mit welcher Wahrscheinlichkeit eintreten, wenn er eine Option wählt. Selbst wenn ihm hundert Alternativen offen stehen, kann er sie alle einordnen. Beobachtungen in Unternehmen und sein gesunder Menschenverstand sagten Simon aber etwas anderes. Er entwickelte ein Gegenkonzept.
In Simons Welt der "begrenzten Rationalität" können sich die Menschen mit ihrer beschränkten Auffassungsgabe immer nur um einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit kümmern, und ihr Verstand kann bloß ein Bedürfnis auf einmal verarbeiten. Sie suchen sich ein paar vielversprechende Alternativen, wägen kurz ab und treffen ihre Wahl.
Maximiert wird nichts. Simons Menschenmodell lässt zu, dass der Einzelne mit der Zeit höchst widersprüchliche Entscheidungen fällt.
Simons Kritik war visionär. Und sie war es auch, die den jungen Reinhard Selten ins Labor trieb. Dennoch bewegte sich die Ökonomie erst einmal in die entgegengesetzte Richtung. In immer feineren Modellen verlangten die Theoretiker immer neue Kunststücke von ihrem Homo oeconomicus. Die neoliberalen Ökonomen um Milton Friedman in Chicago verordneten ihm, dass er Investitionsentscheidungen trifft, die sein ganzes Leben umspannen.
Schließlich brachte Chicago-Boy Robert Lucas im Jahr 1979 die Theorie der rationalen Erwartungen ins Spiel.
Das Postulat: Menschen entscheiden nicht bloß rational, sondern bilden auch ihre Erwartung über volkswirtschaftliche Größen wie Inflation ohne Fehl und Tadel. Um dem Modell zu genügen, müssten sie alle verfügbaren Informationen gemäß dem richtigen Modell der Volkswirtschaft verarbeiten und im Durchschnitt den richtigen Zukunftswert treffen - die Theorie war in sich bestechend und schob keynesianische Ansätze beiseite, doch der heroischen Annahme können im wirklichen Leben nicht einmal studierte Volkswirte entsprechen.
Die Rationalitätsbewegung erreichte ihren Höhepunkt. Für ihre Protagonisten hagelte es Nobelpreise. Theoretiker aus Chicago und geistesverwandten Orten wandten ihre eleganten Formelwerke auf politische Fragen und private Entscheidungen wie die Wahl des Heiratspartners an.
Der Homo oeconomicus auf dem Gipfel - doch die Gegenbewegung nahm Tempo auf. Daniel Kahneman belegte gemeinsam mit seinem 1996 verstorbenen Kollegen Amos Tversky unentwegt neu, wie weit die herrschende Theorie von der Realität entfernt war. Der Mensch, den sie aus ihrer Forschung kannten, handelte so ganz anders als jenes Wesen aus den Büchern der Ökonomen. Seine Entscheidungen beruhen nicht auf komplizierten Rechnungen, sondern auf Daumenregeln. So misst er neuen Informationen eine besonders hohe Aufmerksamkeit zu - und bewertet sie regelmäßig über. Mit dieser menschlichen Gewohnheit erklärt die "Theorie der nervösen Frösche", warum etwa der Dollarkurs ungleich stärker schwankt als die wirtschaftlichen Aussichten in Europa und Amerika: Jede kleine Neuigkeit verursacht überdimensionale Ausschläge.
Ein anderes Beispiel: Meistens hält der Mensch solche Ereignisse für wahrscheinlich, die in seiner Vorstellungswelt eine große Rolle spielen - Arbeitslose zum Beispiel erwarten für das Land eine höhere Arbeitslosigkeit als andere Bürger. Und wer sich an der Börse verzockt hat, sieht für die Zukunft des Aktienmarktes besonders schwarz. Das ist alles verständlich, widerspricht aber dem Ideal.
Kahneman und Co. zeigten, wie sich der Mensch seine komplizierte Umwelt handhabbar macht - und darüber die Gesetze der Ökonomen in den Wind schlägt. Immerzu sucht er nach Ankern für sein Denken. Wenn der Laden um die Ecke einen Preisnachlass aufhebt, ärgert uns das weniger, als wenn er den regulären Preis erhöht. Warum? Weil wir uns einen Anhaltspunkt für die Bewertung diktieren lassen - in dem Fall den "regulären" Preis. Der Homo oeconomicus würde das nie tun.
Nur selten bewertet der reale Mensch seine Optionen nach objektiven Kriterien wie Produktionskosten oder Marktlage. Wichtiger ist ihm der Vergleich zu dem, was er bisher hatte oder als seinen Anspruch betrachtete - und zum Besitz anderer. Eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent freut uns, bis wir hören müssen, dass der lächelnde Kollege im Nebenbüro gerade zehn Prozent mehr bekommen hat. Dem Homo oeconomicus wäre das egal.
Andere Ungläubige wiesen in Experimenten nach: Auch in Wirtschaftsdingen handelt der Mensch nicht rein egoistisch. Wenn ein Kaufhaus im Unwetter den Preis für Regenschirme erhöht, wie es dem Gesetz von Angebot und Nachfrage entspricht, finden das die meisten unfair. Um eine solche Firma zu bestrafen, nehmen sie längere Fahrtwege oder schlechtere Qualität in Kauf. Andere Konsumenten meiden Produkte eines Konzerns, der Rassen diskriminiert, obwohl sie sich selbst davon keinen Vorteil versprechen.
Nichts von all dem passt zum gängigen Modell.
Vernon Smith, der sich nun mit Kahneman den Nobelpreis teilt, spielte im Labor durch, wie ganze Märkte kippen können, weil die Akteure den falschen Anreizen erliegen. In diese Kategorie fällt der "Fluch des Gewinners": Auktionen, bei denen das höchste Gebot gewinnt, enden regelmäßig im wirtschaftlichen Desaster. Einige Bieter schätzen den Ertrag richtig ein, andere zu niedrig und wieder andere zu hoch. Es gewinnt aber derjenige, der den Ertrag - eines versteigerten Bohrrechts oder einer Sendelizenz beispielsweise - überschätzt. Sein Verlust ist programmiert.
Mit der Flut an Widersprüchen kommt die Erkenntnis: Die Kritik am ökonomischen Menschenbild verschwindet nicht wieder. Die Verhaltensmuster sind so tief eingewoben, dass die Verbraucher, Anleger oder Manager ihnen nicht entkommen können - wenn sie es überhaupt wollen. Mag sein, erklärt Daniel Kahneman, dass sie aus einem Fehler lernen. Doch die nächste Situation sehe immer ein wenig anders aus als die vorherige, und schon weiche man wieder vom Gebot der Rationalität ab.
Anleger hätten es von früheren Börsenkrächen wissen sollen: Die Aktienblase musste platzen. Und doch war alles irgendwie neu, das Internet und die New Economy, der inflationsfreie Aufschwung in Amerika und die Sicherheit verheißenden Investmentfonds.
Gerade im Umgang mit Geld lauern so viele Gedankenfallen, dass ein eigener Forschungszweig namens Behavioral Finance das Verhalten auf den Finanzmärkten untersucht.
Vorhersagbar verkaufen Anleger ihre Aktien zu spät, wenn der Kurs schnell fällt. Systematisch schätzen sie ihre eigene Prognosefähigkeit zu hoch ein und reden Abweichungen im Nachhinein schön, was die Experten als "Das wussten wir schon immer"-Effekt bezeichnen.
Wie sich der Einzelne verhält, schlägt sich oft im Marktergebnis nieder - und hebelt spätestens dann die klassische Theorie aus. Denn "die Rationalen rechnen mit den Irrationalen", erklärt Ernst Fehr. Sie treiben im Boom die Preise weiter hoch und versuchen, kurz vor der Horde auszusteigen. In der Baisse geht das Spiel genau umgekehrt.
Das Auf und Ab der Finanzmärkte - und somit auch der Konjunktur - lässt sich besser erklären, wenn man die Wahrnehmung und Wünsche der Menschen für bare Münze nimmt, statt sie wegzudefinieren. Aber lässt es sich auch durch Bewusstseinswandel oder clevere Staatseingriffe verändern?
Die Revolutionäre stehen am Anfang. Das alte Menschenmodell haben sie demontiert, vom neuen halten sie aber nur Einzelteile in Händen. Daniel Kahneman findet immer neue Differenzierungen in unserem Verhalten. Zum Beispiel unterscheidet er zwischen dem Nutzen, den wir vor einem Kauf erwarten, beim Konsum erleben und später erinnern. Vielfach sind die drei Phasen alles andere als identisch. Und der Verbraucher trifft eine Wahl, die ihn später ärgert.
Als er begann, hoffte Reinhard Selten noch, das Entscheidungsverhalten lasse sich in ein paar Prinzipien zusammenfassen. Heute, viele Experimente später, meint er, dass uns Hunderte von Regeln unter all den verschiedenen Umständen leiten. Seine These: "Entscheidungen werden nicht gemacht, sie quellen auf." Rationales Abwägen ist demnach nur einer von mehreren Beratern. Manchmal schlägt dieser Berater eine Entscheidung vor, manchmal weist er lediglich auf die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen hin. Die Entscheidung selbst fällt dann unterbewusst - manchmal gibt die Ratio den Ausschlag, aber manchmal eben nicht, auch wenn wir unsere Wahl später als rational beschreiben.
Anders als der Homo oeconomicus ist der Homo sapiens schwer zu fassen. Die Ökonomen streiten darüber, wie weit die Revolution geht. Nicht weit, meint Joe Stiglitz, Nobelpreisträger von 2001: "Die Verhaltensökonomie reißt ein paar bleibende Löcher. Nur wenige Irrationalitäten sind wirklich von Bedeutung, der Rest ist unwichtig." Der New Yorker Professor glaubt, dass die Menschen auch in ihrem wirtschaftlichen Verhalten dazulernen, und wenn künftig ein neues Modell die Ökonomie verändere, so sagt er, dann eines über das Lernen.
Auf alle Fälle verlieren die Ökonomen das eine Modell, welches sie bedenkenlos auf alle Fragen anwenden können.
Wie Naturwissenschaftler wollten sie im vergangenen Jahrhundert allgemeine Gesetze aufstellen, doch während der Newtonsche Apfel immer wieder vom Baum zur Erde fällt, ändern sich die Stimmungen der Menschen. Deshalb rücken die Verhaltensforscher die Ökonomie jetzt wieder ein Stück in Richtung Geisteswissenschaften: Für verschiedenste Situationen muss die alte Weisheit neu überprüft werden. Die dismal science, die trostlose Wissenschaft, wie die Angelsachsen sie getauft haben, wird offener, überraschender - und vielleicht für normale Menschen zugänglicher.
Rückt sie deswegen ideologisch nach links und liefert dem Staat neue Gründe einzugreifen?
Vergangenes Jahr druckte die liberal-konservative Neue Zürcher Zeitung eine Serie über Verhaltensökonomie. Mit Ungeduld und Willensschwäche würden sich Verbraucher und Sparer selbst schaden, stand da unter anderem. Die Beiträge weckten manchen Zweifel an freien Märkten. (!!!
 )
)Am Ende wurde es dem verantwortlichen Redakteur zu bunt, und er schrieb, die Beobachtung von unvernünftigem Verhalten könne "dazu verführen, die Menschen zu ihrem ,Glück` zwingen zu wollen".
Aber so einfach ist die Revolution gar nicht einzuordnen. "Die Verhaltensökonomie begründet nicht die Forderung nach mehr Staat", sagt Joe Stiglitz. "Wenn die Regierung lernen kann - warum dann nicht die Menschen selbst?" So gesehen, ist die Revolution der Ökonomen auch eine Herausforderung an alle Laien.
ich sehe gerade: Uwe Warmbein hat gestern ein
update veröffentlicht (www.stockmove.de)
Für alle Verzweielten hier hält er den immer noch
beeindruckenden DOW-Gold-Ratio-chart bereit:

update veröffentlicht (www.stockmove.de)
Für alle Verzweielten hier hält er den immer noch
beeindruckenden DOW-Gold-Ratio-chart bereit:

Muß man UWE WARNBEIN kennen ??????????????
Wenn ja, warum ??
Wenn ja, warum ??
Thema: Das Goldboard von wallstreet-online spiegelt massenpsy. Verhalten
#1 Das massenpsychologische Verhalten kann man vortrefflich im Goldboard von wallstreet-online beobachten. Dort werden Texte hereinkopiert, dass die Schwarte kracht.
Ja,wer sowas schreibt,den muß man kennen und lieben!!
Granitbiss, was muß man denn gelesen haben,um in diesem Geschäft zuüberleben.
Grüße Talvi
#1 Das massenpsychologische Verhalten kann man vortrefflich im Goldboard von wallstreet-online beobachten. Dort werden Texte hereinkopiert, dass die Schwarte kracht.
Ja,wer sowas schreibt,den muß man kennen und lieben!!

Granitbiss, was muß man denn gelesen haben,um in diesem Geschäft zuüberleben.
Grüße Talvi
@ talvi
... gestattet sei der Hinweis, das der "reinkopierte" chart auch nur von sharelynx geklaut wurde ...
... gestattet sei der Hinweis, das der "reinkopierte" chart auch nur von sharelynx geklaut wurde ...

FAZ 22.10.2002
"D" wie Deflation
Von Benedikt Fehr
Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Wirtschaftspolitik die Inflation als einen ihrer Hauptfeinde betrachtet. Doch mehren sich die Stimmen, die warnen, dass derzeit Deflation die größere Gefahr sei. Zwar hat der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Wim Duisenberg, unlängst betont, die Bank sehe dafür im Euro-Raum momentan keine Anzeichen. Doch zeigt dieser Hinweis, dass das Thema inzwischen nicht nur Bankenvolkswirte, sondern auch die Notenbanken beschäftigt.
Von Deflation wird gesprochen, wenn das Preisniveau dauerhaft sinkt und Konsumenten wie Unternehmer weitere Preisrückgänge erwarten. Die Folgen sind fatal, wie sich in Japan zeigt. Dort hat die Deflation die Wirtschaft seit einigen Jahren im Griff. Weil sich Japans Verbraucher in Erwartung sinkender Preise mit Anschaffungen zurückhalten, ist die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale aus sinkender Nachfrage, steigender Arbeitslosigkeit und abnehmenden Einkommen geraten. Zudem erhöht Deflation die Last von Schulden. Das hemmt die Investitionsbereitschaft und hat Japans Banken durch Forderungsausfälle in die Krise gestürzt.
Geldmenge nimmt weiter zu
Auf den ersten Blick spricht wenig dafür, dass Amerika oder der Euro-Raum in einen ähnlichen Strudel geraten könnten. Zwar ist Anfang 2000 die Super-Aktienhausse geplatzt. Doch hat vor allem die amerikanische Geldpolitik rasch mit einer starken Senkung der Leitzinsen reagiert. Die dem Börsenkrach folgende Rezession fiel deshalb milde aus, bald begann die Wirtschaft wieder zu wachsen.
Gegen eine deflationäre Entwicklung spricht zudem, dass die Geldmenge sowohl in Amerika als auch im Euro-Raum kräftig zunimmt. Manche Fachleute befürchten deshalb, dass die reichliche und billige Liquidität einem inflationären Preisauftrieb Vorschub leisten könnte. Eine Bestätigung findet diese Sichtweise darin, dass sich die Euro-Inflationsrate hartnäckig oberhalb der von der EZB gesetzten Obergrenze von zwei Prozent hält.
Abbau von Überkapazitäten
Die Warner vor einer Deflation argumentieren demgegenüber so: Weil viele Unternehmen in der Aktienhausse Überkapazitäten aufgebaut haben, halten sie sich jetzt mit Investitionen zurück und reduzieren ihre Kosten durch Abbau von Arbeitsplätzen. Zudem liefern sie sich einen deflationären Preiswettbewerb, den billige Importe aus den Schwellenländern noch verschärfen.
Folge dieses Existenzkampfes ist eine Pleitewelle, die die Banken in Bedrängnis bringt und ihre Bereitschaft zur Kreditvergabe beeinträchtigt. Den privaten Verbrauch schließlich dämpfen die Vermögenseinbußen aufgrund der Aktienbaisse, vor allem aber die steigende Arbeitslosigkeit.
Inflation der Häuserpreise
Diesen dämpfenden Effekten steht freilich gegenüber, dass die reichliche und billige Liquidität in Amerika und Großbritannien - aber auch in einigen südeuropäischen Ländern - eine Immobilienhausse ausgelöst hat. Diese "Inflation der Häuserpreise" stützt den Konsum; denn sie läßt viele Eigenheimbesitzer sich reicher fühlen. Doch ist es für Pessimisten nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Blase platzt. Dann wären ungezählte Haushalte überschuldet, drohte auch von daher Deflation.
Um dem Abgleiten in eine Abwärtsspirale vorzubeugen, empfehlen diejenigen, die Deflation befürchten, die Konjunktur durch niedrigere Leitzinsen und zusätzliche Staatsausgaben zu stimulieren. Ihrer Meinung nach könnte auch die erlahmende deutsche Konjunktur etwas Stimulanz gut gebrauchen. Sie verweisen zudem darauf, dass die Inflation in Deutschland nur noch ein Prozent beträgt. Der Realzins ist deshalb vergleichsweise hoch.
Fesseln der Geld- und Fiskalpolitik
Den "Deflationisten" zufolge haben sich allerdings Geld- und Fiskalpolitik des Euro-Raums in den Fesseln überzogener Vorgaben verfangen: die Geldpolitik durch das Ziel, die Inflationsrate unter zwei Prozent zu drücken; die Fiskalpolitik durch die Defizitregeln des Stabilitätspaktes. Darüber kann man streiten. Eine Gefahr liegt aber darin, dass sich Geld- und Fiskalpolitik über wechselseitige Vorwürfe blockieren.
So sieht die EZB die Wachstumsschwäche vor allem darin begründet, dass die Politik Strukturreformen verschleppt und die großen Wirtschaftsnationen Deutschland und Frankreich mit der Sanierung ihrer Staatshaushalte säumig sind. Demgegenüber werfen Politiker der EZB vor, ihre Wachstumsprognosen seien zu optimistisch gewesen. Deshalb solle sie schleunigst, bevor die Abwärtsspirale an Fahrt gewinne, durch niedrigere Leitzinsen günstigere Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum schaffen.
Saubere Diagnose schwierig
Wägt man die volkswirtschaftlichen Schäden ab, die von einer Deflation im Vergleich zu einer etwas stärkeren Inflation ausgehen können, stellt die Deflation das größere Risiko dar. Eine saubere Diagnose allerdings, ob im Euro-Raum tatsächlich eine Deflation bevorsteht, bleibt - wie die Auseinandersetzung der Ökonomen zeigt - schwierig. Der Interpretationsspielraum ist groß und die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass "Deflation" behauptet wird, um einen Kurs geldpolitischer Striktheit und finanzpolitischer Disziplin aufzuweichen und andere Gründe der Wachstumsschwäche, wie Angst vor strukturellen Reformen, zu verdecken.
Solange die Datenlage nicht eindeutig ist, sind daher Empfehlungen an die Geld- und Fiskalpolitik mit Vorsicht zu betrachten. Stellt sich heraus, dass die Anzeichen für eine Deflation deutlicher werden, müsste die EZB die Zügel eher lockern. Wunderdinge sind aber auch dann nicht von der Geldpolitik zu erwarten. Ihre Wirkung ist begrenzt, wenn das Zinsniveau niedrig ist. Auch das lehrt ein Blick nach Japan, wo sich die Deflation weder durch Geld- noch durch Fiskalpolitik stoppen lässt. Dort liegt der Leitzins bei null Prozent, Konjunkturprogramme haben die Staatsverschuldung auf desaströse 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufgebläht.
Überfällige Reformen
Der Schlüssel zum Wachstum liegt - nicht nur in Japan - darin, die strukturellen Schwächen der Volkswirtschaft anzugehen. Auch in Deutschland sind entsprechende Reformen überfällig. Sie nur schaffen das Vertrauen, das nötig ist, damit Unternehmer und Verbraucher der Zukunft mit Zuversicht entgegenblicken. Das Programm der neuen Bundesregierung gibt diesbezüglich keinen Anlaß zur Hoffnung.
"D" wie Deflation
Von Benedikt Fehr
Seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Wirtschaftspolitik die Inflation als einen ihrer Hauptfeinde betrachtet. Doch mehren sich die Stimmen, die warnen, dass derzeit Deflation die größere Gefahr sei. Zwar hat der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Wim Duisenberg, unlängst betont, die Bank sehe dafür im Euro-Raum momentan keine Anzeichen. Doch zeigt dieser Hinweis, dass das Thema inzwischen nicht nur Bankenvolkswirte, sondern auch die Notenbanken beschäftigt.
Von Deflation wird gesprochen, wenn das Preisniveau dauerhaft sinkt und Konsumenten wie Unternehmer weitere Preisrückgänge erwarten. Die Folgen sind fatal, wie sich in Japan zeigt. Dort hat die Deflation die Wirtschaft seit einigen Jahren im Griff. Weil sich Japans Verbraucher in Erwartung sinkender Preise mit Anschaffungen zurückhalten, ist die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale aus sinkender Nachfrage, steigender Arbeitslosigkeit und abnehmenden Einkommen geraten. Zudem erhöht Deflation die Last von Schulden. Das hemmt die Investitionsbereitschaft und hat Japans Banken durch Forderungsausfälle in die Krise gestürzt.
Geldmenge nimmt weiter zu
Auf den ersten Blick spricht wenig dafür, dass Amerika oder der Euro-Raum in einen ähnlichen Strudel geraten könnten. Zwar ist Anfang 2000 die Super-Aktienhausse geplatzt. Doch hat vor allem die amerikanische Geldpolitik rasch mit einer starken Senkung der Leitzinsen reagiert. Die dem Börsenkrach folgende Rezession fiel deshalb milde aus, bald begann die Wirtschaft wieder zu wachsen.
Gegen eine deflationäre Entwicklung spricht zudem, dass die Geldmenge sowohl in Amerika als auch im Euro-Raum kräftig zunimmt. Manche Fachleute befürchten deshalb, dass die reichliche und billige Liquidität einem inflationären Preisauftrieb Vorschub leisten könnte. Eine Bestätigung findet diese Sichtweise darin, dass sich die Euro-Inflationsrate hartnäckig oberhalb der von der EZB gesetzten Obergrenze von zwei Prozent hält.
Abbau von Überkapazitäten
Die Warner vor einer Deflation argumentieren demgegenüber so: Weil viele Unternehmen in der Aktienhausse Überkapazitäten aufgebaut haben, halten sie sich jetzt mit Investitionen zurück und reduzieren ihre Kosten durch Abbau von Arbeitsplätzen. Zudem liefern sie sich einen deflationären Preiswettbewerb, den billige Importe aus den Schwellenländern noch verschärfen.
Folge dieses Existenzkampfes ist eine Pleitewelle, die die Banken in Bedrängnis bringt und ihre Bereitschaft zur Kreditvergabe beeinträchtigt. Den privaten Verbrauch schließlich dämpfen die Vermögenseinbußen aufgrund der Aktienbaisse, vor allem aber die steigende Arbeitslosigkeit.
Inflation der Häuserpreise
Diesen dämpfenden Effekten steht freilich gegenüber, dass die reichliche und billige Liquidität in Amerika und Großbritannien - aber auch in einigen südeuropäischen Ländern - eine Immobilienhausse ausgelöst hat. Diese "Inflation der Häuserpreise" stützt den Konsum; denn sie läßt viele Eigenheimbesitzer sich reicher fühlen. Doch ist es für Pessimisten nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Blase platzt. Dann wären ungezählte Haushalte überschuldet, drohte auch von daher Deflation.
Um dem Abgleiten in eine Abwärtsspirale vorzubeugen, empfehlen diejenigen, die Deflation befürchten, die Konjunktur durch niedrigere Leitzinsen und zusätzliche Staatsausgaben zu stimulieren. Ihrer Meinung nach könnte auch die erlahmende deutsche Konjunktur etwas Stimulanz gut gebrauchen. Sie verweisen zudem darauf, dass die Inflation in Deutschland nur noch ein Prozent beträgt. Der Realzins ist deshalb vergleichsweise hoch.
Fesseln der Geld- und Fiskalpolitik
Den "Deflationisten" zufolge haben sich allerdings Geld- und Fiskalpolitik des Euro-Raums in den Fesseln überzogener Vorgaben verfangen: die Geldpolitik durch das Ziel, die Inflationsrate unter zwei Prozent zu drücken; die Fiskalpolitik durch die Defizitregeln des Stabilitätspaktes. Darüber kann man streiten. Eine Gefahr liegt aber darin, dass sich Geld- und Fiskalpolitik über wechselseitige Vorwürfe blockieren.
So sieht die EZB die Wachstumsschwäche vor allem darin begründet, dass die Politik Strukturreformen verschleppt und die großen Wirtschaftsnationen Deutschland und Frankreich mit der Sanierung ihrer Staatshaushalte säumig sind. Demgegenüber werfen Politiker der EZB vor, ihre Wachstumsprognosen seien zu optimistisch gewesen. Deshalb solle sie schleunigst, bevor die Abwärtsspirale an Fahrt gewinne, durch niedrigere Leitzinsen günstigere Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum schaffen.
Saubere Diagnose schwierig
Wägt man die volkswirtschaftlichen Schäden ab, die von einer Deflation im Vergleich zu einer etwas stärkeren Inflation ausgehen können, stellt die Deflation das größere Risiko dar. Eine saubere Diagnose allerdings, ob im Euro-Raum tatsächlich eine Deflation bevorsteht, bleibt - wie die Auseinandersetzung der Ökonomen zeigt - schwierig. Der Interpretationsspielraum ist groß und die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass "Deflation" behauptet wird, um einen Kurs geldpolitischer Striktheit und finanzpolitischer Disziplin aufzuweichen und andere Gründe der Wachstumsschwäche, wie Angst vor strukturellen Reformen, zu verdecken.
Solange die Datenlage nicht eindeutig ist, sind daher Empfehlungen an die Geld- und Fiskalpolitik mit Vorsicht zu betrachten. Stellt sich heraus, dass die Anzeichen für eine Deflation deutlicher werden, müsste die EZB die Zügel eher lockern. Wunderdinge sind aber auch dann nicht von der Geldpolitik zu erwarten. Ihre Wirkung ist begrenzt, wenn das Zinsniveau niedrig ist. Auch das lehrt ein Blick nach Japan, wo sich die Deflation weder durch Geld- noch durch Fiskalpolitik stoppen lässt. Dort liegt der Leitzins bei null Prozent, Konjunkturprogramme haben die Staatsverschuldung auf desaströse 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufgebläht.
Überfällige Reformen
Der Schlüssel zum Wachstum liegt - nicht nur in Japan - darin, die strukturellen Schwächen der Volkswirtschaft anzugehen. Auch in Deutschland sind entsprechende Reformen überfällig. Sie nur schaffen das Vertrauen, das nötig ist, damit Unternehmer und Verbraucher der Zukunft mit Zuversicht entgegenblicken. Das Programm der neuen Bundesregierung gibt diesbezüglich keinen Anlaß zur Hoffnung.
hier wieder neuer Stoff für unsere Globalstrategen und Verschwörungstheoretiker 
SPIEGEL 25.10.2002
Worum es Bush im Irak wirklich geht
Von Matthias Streitz
Nach einem Krieg gegen Saddam beginnt das Gezerre globaler Konzerne um die irakischen Ressourcen - fürchten viele Kommentatoren derzeit. Und im Kielwasser der US-Marines hätten amerikanische Ölmultis dabei die beste Ausgangsposition. Doch George W. Bush hat im Irak eine viel wichtigere Mission.
Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters konnte Sharif Ali Ben al-Hussein schon mal ein bisschen Machthaber spielen. In extenso disputierte er über Erdölförderung im Irak, über Millionen von Barrel und Milliarden Dollar Erlöse. Und nicht ganz nebenbei versuchte der Sprecher der Oppositionsgruppe Irakischer Nationalkongress (INC) und Cousin des letzten irakischen Königs, den größten Mineralölkonzernen Frankreichs und Russlands ein wenig Angst einzujagen.
Wenn Saddam Hussein aus seinen Palästen verjagt sei, tönte der in England lebende Exilant - dann würden die Karten im Spiel ums irakische Öl neu gemischt. Amerikas Energiekonzerne kämen zu ihrem Recht, sie dürften bisher versperrte Ölfelder entwickeln und bewirtschaften.
Feldverweis für die Saddam-Begleiter?
Ganz anders sei das bei russischen und französischen Multis, bei Lukoil aus Moskau und bei TotalFinaElf aus Paris. Beide haben seit dem letzten Golfkrieg Verträge oder Vorverträge für die Ölförderung im Irak geschlossen.
Das seien suspekte Deals mit einem Tyrannen, ärgerte sich al-Hussein. Nach einem Sturz Saddams müsse man sie womöglich widerrufen, den Europäern einen Platzverweis erteilen. Eine Drohung, die anscheinend viel Gewicht hat. Denn der INC, von den USA protegiert, könnte die nächste Regierung in Bagdad stellen.
Nach dem heißen Krieg gegen Saddam, fürchten Kommentatoren nicht nur wegen der Posen des INC, wird im Irak ein kalter folgen: Ein Kampf der US-Ölfirmen gegen die europäischen, ExxonMobil und ChevronTexaco gegen TotalFina und die Russen. Ein von den nationalen Regierungen unterstütztes Ringen um Förderrechte in jenem Land, in dem die zweitgrößten Öl-Reserven der Welt lagern. Selbst der stets seriöse Nachrichtendienst Bloomberg spekulierte, Washington könnte im Nachkriegsirak seine militärische Macht direkt in ökonomische ummünzen - und nichtamerikanische Energiekonzerne auf Grund früherer Kontakte zu Saddam aussperren.
Riskantes Spiel und Träume von Größe
Tatsächlich können Chevron, Exxon und andere US-Ölfirmen im Irak nur gewinnen, europäische haben anscheinend viel zu verlieren. Für die Amerikaner wurde der frühere Alliierte Irak zur Tabuzone, als Saddam 1990 Kuwait überrannte. Manche Europäer dagegen ließen sich nicht abschrecken - und hofierten den Despoten von Bagdad viele Jahre lang.
So strebt TotalFina-Chef Thierry Desmarest, der auch den Iran allen US-Drohungen zum Trotz umwirbt, nach irakischem Öl, um seine ambitionierten Träume zu verwirklichen. Der Branchenvierte Total soll es endlich mit dem Spitzentrio Exxon, BP und Shell aufnehmen können. Dazu braucht Desmarest überproportionales Wachstum, dafür geht er Risiken ein. So vereinbarte Total in den neunziger Jahren zwei Vorverträge, um die Ölfelder von Madschnun und Nahr Umar zu erschließen, aus denen irgendwann über eine Million Barrel Öl pro Tag sprudeln könnte.
Öliger Dank für den Freundschaftsdienst
Anderen, den russischen Konzernen, half die traditionelle Nähe der Moskauer Regierung zum Hussein-Regime. Vor dem Golfkrieg 1991 war es der sowjetische Außenminister Primakow, der zur letzten, vergeblichen Vermittlungsvisite nach Bagdad eilte. Im Frieden konnte sich der immer noch teilstaatliche Lukoil-Konzern, der auch anderswo offensiv ins Ausland drängt, als Führer eines Konsortiums Förderrechte in West Kurna sichern. Dieser Vertrag, der Lukoil insgesamt 20 Milliarden Dollar einbringen könnte, ist sogar schon unterzeichnet, Lukoil hat Milliarden investiert. Verlorenes Geld, wenn der INC zur Macht käme und seine Drohungen wahr machte.
Aber will und wird die US-Regierung nicht nur Saddam aus dem Irak vertreiben, sondern auch die Firmen von seinen Ölfeldern? Dass Präsident George W. Bush, sein Vize Dick Cheney, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice allesamt aus der Welt der Öltanker und -türme stammen, verleiht solchen Thesen eine gewisse Plausibilität. So plump nationalistisch im Sinne der eigenen Industrie, wie die Verschwörungstheoretiker glauben, werden die Amerikaner aber schwerlich agieren, und notfalls werden sie Heißsporne beim INC zu bremsen wissen.
Saddam gibt, Saddam nimmt
Dafür sorgt schon die Diplomatie: Für einen Einsatz gegen Saddam braucht Amerika die Stimmen Frankreichs und Russlands im Sicherheitsrat. Und so soll die Bush-Regierung Paris und Moskau bereits garantiert haben, die Interessen europäischer Konzerne im Irak zu wahren. Russlands Präsident Wladimir Putin sicherte Lukoil-Boss Wagit Alekperow gar persönlich zu, die russischen Förderrechte würden nicht angetastet. Die französische Regierung interveniert zwar nicht offen für Total, wirkt aber zweifelsohne im Verborgenen. Es ist auch schwer vorstellbar, wie Saddams Nachfolger einen Bruch gültiger Verträge juristisch rechtfertigen sollten, ohne neue Investoren zu verschrecken. Allenfalls wird man ein wenig an den Konditionen feilen.
Die These vom gravierenden Interessenkonflikt zwischen amerikanischen und europäischen Ölfirmen funktioniert aus einem zweiten Grund nicht. Denn die Konzessionen, die Total, Lukoil und andere wie die italienische Eni mit Saddam ausgehandelt haben, sind weit weniger wert, als es den Anschein hat. Bei der Ausübung ihrer Rechte nämlich steht ihnen just der im Weg, der sie gewährt hat: Saddam Hussein.
Despoten fallen, Ingenieure bleiben
Denn solange die Sanktionen der Uno gelten, können die Europäer keine einzige moderne Förderanlage aufbauen, keinen Liter Öl legal und Profit bringend exportieren. Ein schneller Sturz Saddams, nach dem eine prowestliche Klientelregierung die Ölhähne öffnen könnte, wäre daher nicht nur für die amerikanischen Konzerne das Idealszenario - sondern auch für die europäischen. Dies gilt insbesondere für den wahrscheinlichen Fall, dass ihre vereinbarten Rechte weit gehend bestehen bleiben.
Lukoil und Total hoffen offenbar, dass niemand ihr doppeltes Spiel enttarnt - und dass sich die Geschichte wiederholt. Die Regierung in Bagdad mag wechseln, das mittlere Management bleibt größtenteils das alte. Vielleicht erinnern sich irakische Öl-Ingenieure in der Ära nach Saddam, dass Franzosen und Russen schon lange um ihre Freundschaft gebuhlt haben. Das könnte den Europäern einen kleinen Startvorteil geben, sobald die ersten Amerikaner eintreffen.
Multikulti der Multis und Zwist in der Opec
Die US-Regierung wiederum wird sich natürlich insgeheim bemühen, nationalen Unternehmen kleinere Aufträge zuzuschanzen. Tatsächlich aber bietet der Irak, in dem elf Prozent der bekannten Erdöl-Reserven der Welt lagern, genug Raum für eine Fülle von Konzernen. Warum also Alliierte mit nationaler Klientelpolitik brüskieren? Auch zeigt die Praxis der Öl-Förderung, etwa in den zentralasiatischen Republiken, dass riesige Ölfelder ohnehin meist von multinationalen Konsortien erschlossen werden, nicht von Einzelunternehmen.
Die wichtigere, energiepolitische Mission der Bush-Regierung dürfte denn auch andere sein: Stürzt Saddam, ohne dass die ganze Region ins Chaos versinkt - dann wäre die Gefahr gebannt, dass Bagdad den weltgrößten Erdöllieferanten Saudi-Arabien womöglich mit Massenvernichtungswaffen überfallen und den Westen mit Hochpreisen für Öl erpressen kann. Irakisches Öl könnte wieder auf den Weltmarkt strömen, die Saudis würden nicht wie bisher an den wichtigsten Preis-Hebeln der Opec sitzen. George Bush junior hätte eine neue "Balance of Power" installiert, mit Amerika als Schiedsmann. Da würde es kaum stören, wenn Russen und Franzosen ein wenig daran mitverdienen.

SPIEGEL 25.10.2002
Worum es Bush im Irak wirklich geht
Von Matthias Streitz
Nach einem Krieg gegen Saddam beginnt das Gezerre globaler Konzerne um die irakischen Ressourcen - fürchten viele Kommentatoren derzeit. Und im Kielwasser der US-Marines hätten amerikanische Ölmultis dabei die beste Ausgangsposition. Doch George W. Bush hat im Irak eine viel wichtigere Mission.
Im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters konnte Sharif Ali Ben al-Hussein schon mal ein bisschen Machthaber spielen. In extenso disputierte er über Erdölförderung im Irak, über Millionen von Barrel und Milliarden Dollar Erlöse. Und nicht ganz nebenbei versuchte der Sprecher der Oppositionsgruppe Irakischer Nationalkongress (INC) und Cousin des letzten irakischen Königs, den größten Mineralölkonzernen Frankreichs und Russlands ein wenig Angst einzujagen.
Wenn Saddam Hussein aus seinen Palästen verjagt sei, tönte der in England lebende Exilant - dann würden die Karten im Spiel ums irakische Öl neu gemischt. Amerikas Energiekonzerne kämen zu ihrem Recht, sie dürften bisher versperrte Ölfelder entwickeln und bewirtschaften.
Feldverweis für die Saddam-Begleiter?
Ganz anders sei das bei russischen und französischen Multis, bei Lukoil aus Moskau und bei TotalFinaElf aus Paris. Beide haben seit dem letzten Golfkrieg Verträge oder Vorverträge für die Ölförderung im Irak geschlossen.
Das seien suspekte Deals mit einem Tyrannen, ärgerte sich al-Hussein. Nach einem Sturz Saddams müsse man sie womöglich widerrufen, den Europäern einen Platzverweis erteilen. Eine Drohung, die anscheinend viel Gewicht hat. Denn der INC, von den USA protegiert, könnte die nächste Regierung in Bagdad stellen.
Nach dem heißen Krieg gegen Saddam, fürchten Kommentatoren nicht nur wegen der Posen des INC, wird im Irak ein kalter folgen: Ein Kampf der US-Ölfirmen gegen die europäischen, ExxonMobil und ChevronTexaco gegen TotalFina und die Russen. Ein von den nationalen Regierungen unterstütztes Ringen um Förderrechte in jenem Land, in dem die zweitgrößten Öl-Reserven der Welt lagern. Selbst der stets seriöse Nachrichtendienst Bloomberg spekulierte, Washington könnte im Nachkriegsirak seine militärische Macht direkt in ökonomische ummünzen - und nichtamerikanische Energiekonzerne auf Grund früherer Kontakte zu Saddam aussperren.
Riskantes Spiel und Träume von Größe
Tatsächlich können Chevron, Exxon und andere US-Ölfirmen im Irak nur gewinnen, europäische haben anscheinend viel zu verlieren. Für die Amerikaner wurde der frühere Alliierte Irak zur Tabuzone, als Saddam 1990 Kuwait überrannte. Manche Europäer dagegen ließen sich nicht abschrecken - und hofierten den Despoten von Bagdad viele Jahre lang.
So strebt TotalFina-Chef Thierry Desmarest, der auch den Iran allen US-Drohungen zum Trotz umwirbt, nach irakischem Öl, um seine ambitionierten Träume zu verwirklichen. Der Branchenvierte Total soll es endlich mit dem Spitzentrio Exxon, BP und Shell aufnehmen können. Dazu braucht Desmarest überproportionales Wachstum, dafür geht er Risiken ein. So vereinbarte Total in den neunziger Jahren zwei Vorverträge, um die Ölfelder von Madschnun und Nahr Umar zu erschließen, aus denen irgendwann über eine Million Barrel Öl pro Tag sprudeln könnte.
Öliger Dank für den Freundschaftsdienst
Anderen, den russischen Konzernen, half die traditionelle Nähe der Moskauer Regierung zum Hussein-Regime. Vor dem Golfkrieg 1991 war es der sowjetische Außenminister Primakow, der zur letzten, vergeblichen Vermittlungsvisite nach Bagdad eilte. Im Frieden konnte sich der immer noch teilstaatliche Lukoil-Konzern, der auch anderswo offensiv ins Ausland drängt, als Führer eines Konsortiums Förderrechte in West Kurna sichern. Dieser Vertrag, der Lukoil insgesamt 20 Milliarden Dollar einbringen könnte, ist sogar schon unterzeichnet, Lukoil hat Milliarden investiert. Verlorenes Geld, wenn der INC zur Macht käme und seine Drohungen wahr machte.
Aber will und wird die US-Regierung nicht nur Saddam aus dem Irak vertreiben, sondern auch die Firmen von seinen Ölfeldern? Dass Präsident George W. Bush, sein Vize Dick Cheney, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice allesamt aus der Welt der Öltanker und -türme stammen, verleiht solchen Thesen eine gewisse Plausibilität. So plump nationalistisch im Sinne der eigenen Industrie, wie die Verschwörungstheoretiker glauben, werden die Amerikaner aber schwerlich agieren, und notfalls werden sie Heißsporne beim INC zu bremsen wissen.
Saddam gibt, Saddam nimmt
Dafür sorgt schon die Diplomatie: Für einen Einsatz gegen Saddam braucht Amerika die Stimmen Frankreichs und Russlands im Sicherheitsrat. Und so soll die Bush-Regierung Paris und Moskau bereits garantiert haben, die Interessen europäischer Konzerne im Irak zu wahren. Russlands Präsident Wladimir Putin sicherte Lukoil-Boss Wagit Alekperow gar persönlich zu, die russischen Förderrechte würden nicht angetastet. Die französische Regierung interveniert zwar nicht offen für Total, wirkt aber zweifelsohne im Verborgenen. Es ist auch schwer vorstellbar, wie Saddams Nachfolger einen Bruch gültiger Verträge juristisch rechtfertigen sollten, ohne neue Investoren zu verschrecken. Allenfalls wird man ein wenig an den Konditionen feilen.
Die These vom gravierenden Interessenkonflikt zwischen amerikanischen und europäischen Ölfirmen funktioniert aus einem zweiten Grund nicht. Denn die Konzessionen, die Total, Lukoil und andere wie die italienische Eni mit Saddam ausgehandelt haben, sind weit weniger wert, als es den Anschein hat. Bei der Ausübung ihrer Rechte nämlich steht ihnen just der im Weg, der sie gewährt hat: Saddam Hussein.
Despoten fallen, Ingenieure bleiben
Denn solange die Sanktionen der Uno gelten, können die Europäer keine einzige moderne Förderanlage aufbauen, keinen Liter Öl legal und Profit bringend exportieren. Ein schneller Sturz Saddams, nach dem eine prowestliche Klientelregierung die Ölhähne öffnen könnte, wäre daher nicht nur für die amerikanischen Konzerne das Idealszenario - sondern auch für die europäischen. Dies gilt insbesondere für den wahrscheinlichen Fall, dass ihre vereinbarten Rechte weit gehend bestehen bleiben.
Lukoil und Total hoffen offenbar, dass niemand ihr doppeltes Spiel enttarnt - und dass sich die Geschichte wiederholt. Die Regierung in Bagdad mag wechseln, das mittlere Management bleibt größtenteils das alte. Vielleicht erinnern sich irakische Öl-Ingenieure in der Ära nach Saddam, dass Franzosen und Russen schon lange um ihre Freundschaft gebuhlt haben. Das könnte den Europäern einen kleinen Startvorteil geben, sobald die ersten Amerikaner eintreffen.
Multikulti der Multis und Zwist in der Opec
Die US-Regierung wiederum wird sich natürlich insgeheim bemühen, nationalen Unternehmen kleinere Aufträge zuzuschanzen. Tatsächlich aber bietet der Irak, in dem elf Prozent der bekannten Erdöl-Reserven der Welt lagern, genug Raum für eine Fülle von Konzernen. Warum also Alliierte mit nationaler Klientelpolitik brüskieren? Auch zeigt die Praxis der Öl-Förderung, etwa in den zentralasiatischen Republiken, dass riesige Ölfelder ohnehin meist von multinationalen Konsortien erschlossen werden, nicht von Einzelunternehmen.
Die wichtigere, energiepolitische Mission der Bush-Regierung dürfte denn auch andere sein: Stürzt Saddam, ohne dass die ganze Region ins Chaos versinkt - dann wäre die Gefahr gebannt, dass Bagdad den weltgrößten Erdöllieferanten Saudi-Arabien womöglich mit Massenvernichtungswaffen überfallen und den Westen mit Hochpreisen für Öl erpressen kann. Irakisches Öl könnte wieder auf den Weltmarkt strömen, die Saudis würden nicht wie bisher an den wichtigsten Preis-Hebeln der Opec sitzen. George Bush junior hätte eine neue "Balance of Power" installiert, mit Amerika als Schiedsmann. Da würde es kaum stören, wenn Russen und Franzosen ein wenig daran mitverdienen.
Die Welt 26.10.2002
Kolumne von Marc Faber: Wer bietet weniger?
Seit meinem Start an der Wall Street im Jahr 1970, hat mich die technische Analyse von Märkten und einzelnen Aktien immer wieder fasziniert. Persönlich würde ich nie eine Aktie kaufen oder in einen Markt einsteigen, der technisch schlecht aussieht. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass man der technischen Analyse nicht hundertprozentig trauen sollte. Schließlich beruht sie allein auf der Kursbildung der Vergangenheit, und jeder Trend kann sich jederzeit völlig unerwartet ändern. Nachdem es sich aber gezeigt hat, dass die Prognosen von fundamental orientierten Anlagestrategen und Finanzanalysten keineswegs zuverlässiger sind als die Bell-Signale meiner vier Rottweiler Hunde, wenn man ihnen mit einer Finanzzeitung winkt, lohnt sich ein Blick auf die Meinung von Börsentechnikern zu den US-Märkten allemal.
Eindeutig am negativsten sind dabei die Prognosen von Robert Prechter, der seine Analysen auf die so genannten Elliott-Wellen stützt. Er zeichnet ein wahres Horrorszenario, in dem der gegenwärtige Bärenmarkt den Dow Jones noch auf weniger als 1000 Punkte sinken lassen wird. Etwas weniger schrecklich sind die Perspektiven der Techniker, die argumentieren, dass in der Vergangenheit jede Finanz- oder Anlageblase die vorhergehende Hausse komplett wieder zurückgegeben hat. Nach ihrer Ansicht würden damit der Dow Jones und der S & P-500 auf das Niveau von 1990 zurückfallen. Konkret bedeutet dies für den Dow ein Kursziel von rund 2500 Punkten und für den S & P-500 ein Niveau von rund 300 Zählern.
Wiederum andere berechnen zwar kein Kursziel, sie gehen aber davon aus, dass im 20. Jahrhundert die Baisse-Phasen im Schnitt jeweils fünf Jahre der Kursgewinne, die zum endgültigen Hoch geführt haben, zunichte gemacht haben.
Wenn also der gegenwärtige Bärenmarkt eine durchschnittliche Baisse wäre, dann würden wir auf das Niveau vom Jahre 1995 zurückfallen, nachdem die Börsen ihr Hoch im Jahre 2000 erreicht haben. Für den Dow würde das einen weiteren Verlust von rund 3000 Punkten bedeuten und der S & P-500 würde demnach auf knapp 500 Punkte zurückfallen.
Solche Statistiken verbergen allerdings die durchaus vorhandenen Schwankungen. So sind die Kurse in der Baisse von 1929 bis 1932 auf das Niveau von 1914 gesunken - es wurden also 15 Jahre frühere Kapitalgewinne vernichtet.
Im Bärenmarkt 1973/74 sind die amerikanischen Börsen auf den Stand von 1965 eingebrochen, und im Fall von Japan steht der Nikkei heute - zwölf Jahre nach seinem Höchststand - auf dem Niveau des Jahres 1983! Und nachdem die Hausse zwischen 1982 und 2000 in den USA weit über dem Durchschnitt früherer Boom-Perioden lag, spricht eigentlich vieles dafür, dass nun auch die Baisse besonders kräftig ausfällt.
Dabei ist es wie im Fall von Japan durchaus möglich, dass sich der Kursverfall über Jahre hinauszögert, weil die amerikanische Notenbank die Börse mit allen geldpolitischen Mitteln zu stützen versucht.
Ebenfalls ist es denkbar, dass die Baisse auch über eine Dollar-Abwertung etwas gelindert werden könnte.
Wie gesagt, ich würde eine Anlageentscheidung nie allein auf Basis markttechnischer Analysen treffen. Aber die Flut düsterer Prognosen sollte doch zur Vorsicht bei US-Aktien führen - auch wenn innerhalb von Bärenmärkten immer wieder kurzfristige Haussen stattfinden können.
Der Fondsmanager und Publizist Marc Faber ist als Skeptiker unter den Börsianern bekannt.
Kolumne von Marc Faber: Wer bietet weniger?
Seit meinem Start an der Wall Street im Jahr 1970, hat mich die technische Analyse von Märkten und einzelnen Aktien immer wieder fasziniert. Persönlich würde ich nie eine Aktie kaufen oder in einen Markt einsteigen, der technisch schlecht aussieht. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass man der technischen Analyse nicht hundertprozentig trauen sollte. Schließlich beruht sie allein auf der Kursbildung der Vergangenheit, und jeder Trend kann sich jederzeit völlig unerwartet ändern. Nachdem es sich aber gezeigt hat, dass die Prognosen von fundamental orientierten Anlagestrategen und Finanzanalysten keineswegs zuverlässiger sind als die Bell-Signale meiner vier Rottweiler Hunde, wenn man ihnen mit einer Finanzzeitung winkt, lohnt sich ein Blick auf die Meinung von Börsentechnikern zu den US-Märkten allemal.
Eindeutig am negativsten sind dabei die Prognosen von Robert Prechter, der seine Analysen auf die so genannten Elliott-Wellen stützt. Er zeichnet ein wahres Horrorszenario, in dem der gegenwärtige Bärenmarkt den Dow Jones noch auf weniger als 1000 Punkte sinken lassen wird. Etwas weniger schrecklich sind die Perspektiven der Techniker, die argumentieren, dass in der Vergangenheit jede Finanz- oder Anlageblase die vorhergehende Hausse komplett wieder zurückgegeben hat. Nach ihrer Ansicht würden damit der Dow Jones und der S & P-500 auf das Niveau von 1990 zurückfallen. Konkret bedeutet dies für den Dow ein Kursziel von rund 2500 Punkten und für den S & P-500 ein Niveau von rund 300 Zählern.
Wiederum andere berechnen zwar kein Kursziel, sie gehen aber davon aus, dass im 20. Jahrhundert die Baisse-Phasen im Schnitt jeweils fünf Jahre der Kursgewinne, die zum endgültigen Hoch geführt haben, zunichte gemacht haben.
Wenn also der gegenwärtige Bärenmarkt eine durchschnittliche Baisse wäre, dann würden wir auf das Niveau vom Jahre 1995 zurückfallen, nachdem die Börsen ihr Hoch im Jahre 2000 erreicht haben. Für den Dow würde das einen weiteren Verlust von rund 3000 Punkten bedeuten und der S & P-500 würde demnach auf knapp 500 Punkte zurückfallen.
Solche Statistiken verbergen allerdings die durchaus vorhandenen Schwankungen. So sind die Kurse in der Baisse von 1929 bis 1932 auf das Niveau von 1914 gesunken - es wurden also 15 Jahre frühere Kapitalgewinne vernichtet.
Im Bärenmarkt 1973/74 sind die amerikanischen Börsen auf den Stand von 1965 eingebrochen, und im Fall von Japan steht der Nikkei heute - zwölf Jahre nach seinem Höchststand - auf dem Niveau des Jahres 1983! Und nachdem die Hausse zwischen 1982 und 2000 in den USA weit über dem Durchschnitt früherer Boom-Perioden lag, spricht eigentlich vieles dafür, dass nun auch die Baisse besonders kräftig ausfällt.
Dabei ist es wie im Fall von Japan durchaus möglich, dass sich der Kursverfall über Jahre hinauszögert, weil die amerikanische Notenbank die Börse mit allen geldpolitischen Mitteln zu stützen versucht.
Ebenfalls ist es denkbar, dass die Baisse auch über eine Dollar-Abwertung etwas gelindert werden könnte.
Wie gesagt, ich würde eine Anlageentscheidung nie allein auf Basis markttechnischer Analysen treffen. Aber die Flut düsterer Prognosen sollte doch zur Vorsicht bei US-Aktien führen - auch wenn innerhalb von Bärenmärkten immer wieder kurzfristige Haussen stattfinden können.
Der Fondsmanager und Publizist Marc Faber ist als Skeptiker unter den Börsianern bekannt.
.
Robert von Heusinger :
Langfristig sind wir alle tot
Der Börsenkrach entlarvt die Parole von der Überlegenheit der Aktie - wenn man sie nur lang genug halte, schlage sie jede Anlageform. Jetzt zeigt sich: Selbst 40 Jahre reichen nicht
Aktien steigen immer, zumindest auf lange Sicht. Das hört sich in diesen Tagen an wie blanker Hohn, stimmt aber. Beweise? Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Dax verdoppelt; der Dow Jones, der älteste Aktienindex der Welt, notiert heute fast 3000-mal höher als bei seiner erstmaligen Berechnung im Jahr 1896. Und selbst das Sorgenkind, der japanische Nikkei, bringt es im Vergleich zu Oktober 1972 noch auf ein Kursplus von 100 Prozent.
Allerdings kann man mit Statistiken bekanntlich alles beweisen. Wer im März 2000 Geld in den Dax steckte, muss heute fast 70 Prozent Kursverlust verkraften. Wer 1989 in den Nikkei investierte, besitzt nur noch ein Fünftel der damaligen Summe, vom Wertverlust durch Inflation ganz zu schweigen. Und wer den Nikkei vor 20 Jahren kaufte, hat nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Rendite: null Komma null.
Nun mag man einwenden, diese Zeiträume seien noch zu kurz, auf wirklich lange Sicht schneide am Ende doch die Aktie am besten ab. Doch die einschlägigen Vergleiche, mit denen die Überlegenheit der Aktie bewiesen werden soll, sind perfide: Heute gibt es im Dow Jones nur noch ein Unternehmen, General Electric, das bereits vor 106 Jahren zu den damals größten Firmen Amerikas zählte, die den Index bildeten. Die anderen sind Pleite gegangen, wurden aufgekauft oder sind einfach zu unbedeutend geworden, als dass sie noch die erste Aktiengarde bildeten. Hat je jemand berechnet, wie der Renditevergleich ausgegangen wäre, hätte man noch die zwölf Dow-Gründungsmitglieder im Depot? Vielleicht. Nur hat das nie jemanden interessiert. Schon gar nicht die Apologeten der Aktie: die Banken und Fondsgesellschaften. Sie haben es mit ihrem Trommelfeuer der Renditevergleiche geschafft, die Deutschen mitzureißen.
12,9 Millionen Aktionäre und Fondsbesitzer zählte das Deutsche Aktieninstitut Ende 2001 - eine Verdopplung binnen vier Jahren. Und, noch schlimmer, die Marketingexperten haben es geschafft, dass die Deutschen ihre gesetzliche Rentenversicherung verfluchten.
Die Verheißung zweistelliger Aktienrenditen, wie sie am Ende der neunziger Jahre gang und gäbe war, hat "den kritischen Keil zwischen die Altersgruppen getrieben, die Solidarität der Jungen mit den Alten geschwächt". So formulierte es der heutige Bundesbankvorstand Hans-Helmut Kotz auf dem Höhepunkt der Hausse, im Frühjahr 2000. Die Jungen, Dynamischen und Erfolgreichen sahen sich im Alter auf der Verliererstraße. Jeden Monat bis zu 20 Prozent ihres Einkommens in die Rentenversicherung einzahlen, in der Gewissheit damit nicht annähernd eine zweistellige Rendite erzielen zu können und später auf Hunderttausende Euro verzichten zu müssen.
Doch selbst jetzt, im Aktien-Crash, scheint der Glaube an die Unschlagbarkeit der privaten Altersvorsorge mit Aktien noch ungebrochen. Noch. Aber es gibt Hoffnung, dass bald wieder Vernunft einkehrt. Und das nicht nur, weil immer mehr der einst Jungen und Erfolgreichen inzwischen zu dynamischen Arbeitslosen geworden sind, die in einem privaten Vorsorgesystem gar nichts mehr hätten, was sie einzahlen könnten, von den Traumrenditen ganz zu schweigen.
Inzwischen ist auch die letzte Bastion der Aktienwerber gefallen. Mit Fondssparplänen, so versprachen die Anlagegesellschaften, könne man gar nicht schief liegen. Denn dabei zahlt man jeden Monat die gleiche Summe ein, ganz gleich ob sich die Börse im Höhenrausch befindet oder auf Tauchstation. So erwirbt man bei tiefen Kursen viele Anteile und bei hohen Kursen wenige. Klassisches antizyklisches Verhalten. Doch jetzt hat die Interessenvertretung der Fondsgesellschaften, der Bundesverband der Investmentgesellschaften (BVI), errechnet: Selbst die Fondssparpläne haben zu viel versprochen. Wer in den vergangenen zehn Jahren jeden Monat 100 Euro in deutsche Aktienfonds investierte, hätte das Geld gleich in den Sparstrumpf stecken können. Das klügste Produkt der Aktienanlage, der Fondssparplan, ist desavouiert. Wer Monat für Monat mit 100 Euro ein Stückchen Dax kaufte, hatte Ende September die traurige Summe von 10 736,50 Euro in der Hand, eingezahlt aber hat man über die Jahre 12 000 Euro. Und das, obwohl sich der Dax in den zehn Jahren immerhin noch verdoppelt hat.
Da wird es wenig helfen, 10 Jahre als die kurze Frist zu deklarieren und auf Sparpläne zu verweisen, die 35 Jahre gelaufen sind. Denn hier beträgt die Rendite nur knapp über fünf Prozent. Ein kümmerliches Ergebnis für all jene, die an zweistellige Zuwächse geglaubt haben. Willkommen in der Realität.
Es ist richtig, dass der BVI in die Offensive geht und die Schmach thematisiert. Nur mit der ungeschminkten Wahrheit lernt das Volk der Neuaktionäre, was Langfristigkeit wirklich bedeutet: In the long run, we are all dead, meinte schon der britische Ökonom John Maynard Keynes, langfristig sind wir alle tot.
Keynes zielte während der großen Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zwar nicht auf die Marketingmaschinen der Fondsindustrie, er hatte die Anhänger unregulierter Märkte im Sinn. Ihnen hielt er vor, dass es Unternehmen und Arbeitslosen nichts bringt, wenn sie warten, bis die unsichtbare Hand des Marktes irgendwann Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht schaukelt. Weder Unternehmen noch Arbeitnehmer hätten die Zeit, auf den erhofften Idealzustand der Wirtschaft zu warten.
Wie lange können Menschen hungern? Einen Monat, vielleicht. Und wenn sie bis dahin keinen neuen Job gefunden haben? Analog stellt sich die Frage: Was bringt es dem Anleger, dass Aktien langfristig immer die beste Geldanlage sind? Er braucht sein Geld in 20 oder 30 Jahren, aber die Statistik versteht unter langfristig vielleicht 40 oder gar 70 Jahre.
Ein Arbeitsleben ist zu kurz
Wie lange ist langfristig? Verlässliche Daten über die Entwicklung von Aktienkursen gibt es seit knapp 150 Jahren. Das ist zu kurz, um eine ehrliche Antwort auf die Frage zu finden, ab wann Aktien immer besser als alle anderen Anlagekategorien sind. Nur eines steht fest: 40 Jahre sind nicht lange genug. Viel länger arbeitet aber kaum ein Mensch in den westlichen Industrieländern.
Einer, der es genau wissen wollte, ist der amerikanische Wirtschaftsforscher Gary Burtless. Er glaubte nicht an die pannensichere Gewinnmaschine Aktienmarkt. Burtless hat für 90 Zeiträume nachgerechnet, welche Rente ein US-Bürger im Ruhestand bezogen hätte, wenn dieser 40 Jahre lang jeweils sechs Prozent seines Einkommens Monat für Monat in amerikanische Standardaktien investiert hätte. Im ersten Zeitraum hätte dieser Sparer 1871 zu arbeiten begonnen und wäre 1911 in Rente gegangen. Die am Aktienmarkt angesparte Summe hätte er beim Eintritt in den Ruhestand verrentet, also in Anleihen umgeschichtet, und dann als monatliche Summe bis zum 80. Lebensjahr aufgebraucht.
Burtless hat seine Untersuchung so realitätsnah wie möglich angelegt. Er hat Stundenlöhne, Zinssätze von Staatsanleihen, Inflation, Dividenden und Kursschwankungen berücksichtigt. Sein Ergebnis spricht sogar für die Aktienanlage, allerdings nur im Durchschnitt. Mit keiner anderen Anlage wurde über alle Jahrgänge hinweg eine höhere Rente erwirtschaftet. 7 Prozent pro Jahr brachten amerikanische Aktien im vergangenen Jahrhundert, Anleihen dagegen nur 1,6 Prozent. Im Durchschnitt der 90 berechneten Zeiträume konnte man mit 52 Prozent des letzten Lohnes den Ruhestand genießen. Das lässt sich sehen. Am besten hatte es der Jahrgang, der Ende 1999 aus dem Berufsleben ausschied. Diese Aktiensparer hätten 110 Prozent des letzten Gehaltes als monatliche Rente bekommen.
Wer dagegen 1921 das letzte Mal arbeiten gegangen wäre, hätte nur 20 Prozent des letzten Einkommens ausbezahlt bekommen. Ruheständler des Jahres 1969 hätten so viel Rente bezogen, wie sie zuletzt verdienten, sechs Jahrgänge später wäre es weniger als die Hälfte gewesen. Ist es sinnvoll oder gerecht, dass die Altersversorgung derart von den Launen des Aktienmarktes abhängig ist? Und was passiert, wenn Burtless` hypothetische Menschen älter als 80 Jahre werden? Dann haben sie ihr Vermögen aufgebraucht.
Auf all diese Fragen hat die gesetzliche Rente eine einfache Antwort: Die Jungen zahlen für die Alten. Zwar steht auch hier nicht fest, wie viel sie zahlen, und kein Rentner besitzt eine Garantie, dass er das herausbekommt, was er eingezahlt hat. Dafür weiß jeder Sozialversicherte, dass er genug zum Leben haben wird; dass seine Frau und die Kinder unterstützt werden, wenn er noch im Arbeitsleben stirbt; dass er 100 Jahre und älter werden kann und trotzdem noch Rente bezieht. Die Kritiker wenden ein, dass die staatliche Rente spätestens in 25 Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, nicht mehr finanzierbar ist. Das ist aber noch kein Argument für eine ausschließlich private Vorsorge.
Vernünftiger und realistischer sind Kompromisse: Die Alten müssen länger arbeiten, die Jungen mehr zahlen, und der Staat verschuldet sich für eine gewisse Periode stärker. Das spricht nicht gegen den behutsamen Einstieg in die private Altersversorgung, nicht gegen ein Mischsystem mit einem starken gesetzlichen Anteil und einem kleinen privaten. Immerhin gibt es die berechtigte Vermutung, dass die demografische Schieflage in Deutschland extremer ist als in anderen Industrieländern.
Genauso kann niemand raten, von Aktien ganz die Finger zu lassen. Schon zur Risikostreuung gehören sie in jedes Portfolio. Aktien schützen vor den Folgen einer Hyperinflation, die, rein statistisch betrachtet, eineinhalb Mal in 100 Jahren Sparvermögen wie Festgeld oder Anleihen vernichtet. Und Aktien sind das einzige Vehikel, um an der Gewinnentwicklung einer Volkswirtschaft zu partizipieren. Alles gute Gründe für die schwankungsanfällige und daher risikoreiche Anlageform. Aber kein Freibrief, alles auf diese Anlageform zu setzen - schon gar nicht das Geld, das den Lebensabend absichern soll.
Robert von Heusinger :
Langfristig sind wir alle tot
Der Börsenkrach entlarvt die Parole von der Überlegenheit der Aktie - wenn man sie nur lang genug halte, schlage sie jede Anlageform. Jetzt zeigt sich: Selbst 40 Jahre reichen nicht
Aktien steigen immer, zumindest auf lange Sicht. Das hört sich in diesen Tagen an wie blanker Hohn, stimmt aber. Beweise? Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Dax verdoppelt; der Dow Jones, der älteste Aktienindex der Welt, notiert heute fast 3000-mal höher als bei seiner erstmaligen Berechnung im Jahr 1896. Und selbst das Sorgenkind, der japanische Nikkei, bringt es im Vergleich zu Oktober 1972 noch auf ein Kursplus von 100 Prozent.
Allerdings kann man mit Statistiken bekanntlich alles beweisen. Wer im März 2000 Geld in den Dax steckte, muss heute fast 70 Prozent Kursverlust verkraften. Wer 1989 in den Nikkei investierte, besitzt nur noch ein Fünftel der damaligen Summe, vom Wertverlust durch Inflation ganz zu schweigen. Und wer den Nikkei vor 20 Jahren kaufte, hat nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Rendite: null Komma null.
Nun mag man einwenden, diese Zeiträume seien noch zu kurz, auf wirklich lange Sicht schneide am Ende doch die Aktie am besten ab. Doch die einschlägigen Vergleiche, mit denen die Überlegenheit der Aktie bewiesen werden soll, sind perfide: Heute gibt es im Dow Jones nur noch ein Unternehmen, General Electric, das bereits vor 106 Jahren zu den damals größten Firmen Amerikas zählte, die den Index bildeten. Die anderen sind Pleite gegangen, wurden aufgekauft oder sind einfach zu unbedeutend geworden, als dass sie noch die erste Aktiengarde bildeten. Hat je jemand berechnet, wie der Renditevergleich ausgegangen wäre, hätte man noch die zwölf Dow-Gründungsmitglieder im Depot? Vielleicht. Nur hat das nie jemanden interessiert. Schon gar nicht die Apologeten der Aktie: die Banken und Fondsgesellschaften. Sie haben es mit ihrem Trommelfeuer der Renditevergleiche geschafft, die Deutschen mitzureißen.
12,9 Millionen Aktionäre und Fondsbesitzer zählte das Deutsche Aktieninstitut Ende 2001 - eine Verdopplung binnen vier Jahren. Und, noch schlimmer, die Marketingexperten haben es geschafft, dass die Deutschen ihre gesetzliche Rentenversicherung verfluchten.
Die Verheißung zweistelliger Aktienrenditen, wie sie am Ende der neunziger Jahre gang und gäbe war, hat "den kritischen Keil zwischen die Altersgruppen getrieben, die Solidarität der Jungen mit den Alten geschwächt". So formulierte es der heutige Bundesbankvorstand Hans-Helmut Kotz auf dem Höhepunkt der Hausse, im Frühjahr 2000. Die Jungen, Dynamischen und Erfolgreichen sahen sich im Alter auf der Verliererstraße. Jeden Monat bis zu 20 Prozent ihres Einkommens in die Rentenversicherung einzahlen, in der Gewissheit damit nicht annähernd eine zweistellige Rendite erzielen zu können und später auf Hunderttausende Euro verzichten zu müssen.
Doch selbst jetzt, im Aktien-Crash, scheint der Glaube an die Unschlagbarkeit der privaten Altersvorsorge mit Aktien noch ungebrochen. Noch. Aber es gibt Hoffnung, dass bald wieder Vernunft einkehrt. Und das nicht nur, weil immer mehr der einst Jungen und Erfolgreichen inzwischen zu dynamischen Arbeitslosen geworden sind, die in einem privaten Vorsorgesystem gar nichts mehr hätten, was sie einzahlen könnten, von den Traumrenditen ganz zu schweigen.
Inzwischen ist auch die letzte Bastion der Aktienwerber gefallen. Mit Fondssparplänen, so versprachen die Anlagegesellschaften, könne man gar nicht schief liegen. Denn dabei zahlt man jeden Monat die gleiche Summe ein, ganz gleich ob sich die Börse im Höhenrausch befindet oder auf Tauchstation. So erwirbt man bei tiefen Kursen viele Anteile und bei hohen Kursen wenige. Klassisches antizyklisches Verhalten. Doch jetzt hat die Interessenvertretung der Fondsgesellschaften, der Bundesverband der Investmentgesellschaften (BVI), errechnet: Selbst die Fondssparpläne haben zu viel versprochen. Wer in den vergangenen zehn Jahren jeden Monat 100 Euro in deutsche Aktienfonds investierte, hätte das Geld gleich in den Sparstrumpf stecken können. Das klügste Produkt der Aktienanlage, der Fondssparplan, ist desavouiert. Wer Monat für Monat mit 100 Euro ein Stückchen Dax kaufte, hatte Ende September die traurige Summe von 10 736,50 Euro in der Hand, eingezahlt aber hat man über die Jahre 12 000 Euro. Und das, obwohl sich der Dax in den zehn Jahren immerhin noch verdoppelt hat.
Da wird es wenig helfen, 10 Jahre als die kurze Frist zu deklarieren und auf Sparpläne zu verweisen, die 35 Jahre gelaufen sind. Denn hier beträgt die Rendite nur knapp über fünf Prozent. Ein kümmerliches Ergebnis für all jene, die an zweistellige Zuwächse geglaubt haben. Willkommen in der Realität.
Es ist richtig, dass der BVI in die Offensive geht und die Schmach thematisiert. Nur mit der ungeschminkten Wahrheit lernt das Volk der Neuaktionäre, was Langfristigkeit wirklich bedeutet: In the long run, we are all dead, meinte schon der britische Ökonom John Maynard Keynes, langfristig sind wir alle tot.
Keynes zielte während der großen Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zwar nicht auf die Marketingmaschinen der Fondsindustrie, er hatte die Anhänger unregulierter Märkte im Sinn. Ihnen hielt er vor, dass es Unternehmen und Arbeitslosen nichts bringt, wenn sie warten, bis die unsichtbare Hand des Marktes irgendwann Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht schaukelt. Weder Unternehmen noch Arbeitnehmer hätten die Zeit, auf den erhofften Idealzustand der Wirtschaft zu warten.
Wie lange können Menschen hungern? Einen Monat, vielleicht. Und wenn sie bis dahin keinen neuen Job gefunden haben? Analog stellt sich die Frage: Was bringt es dem Anleger, dass Aktien langfristig immer die beste Geldanlage sind? Er braucht sein Geld in 20 oder 30 Jahren, aber die Statistik versteht unter langfristig vielleicht 40 oder gar 70 Jahre.
Ein Arbeitsleben ist zu kurz
Wie lange ist langfristig? Verlässliche Daten über die Entwicklung von Aktienkursen gibt es seit knapp 150 Jahren. Das ist zu kurz, um eine ehrliche Antwort auf die Frage zu finden, ab wann Aktien immer besser als alle anderen Anlagekategorien sind. Nur eines steht fest: 40 Jahre sind nicht lange genug. Viel länger arbeitet aber kaum ein Mensch in den westlichen Industrieländern.
Einer, der es genau wissen wollte, ist der amerikanische Wirtschaftsforscher Gary Burtless. Er glaubte nicht an die pannensichere Gewinnmaschine Aktienmarkt. Burtless hat für 90 Zeiträume nachgerechnet, welche Rente ein US-Bürger im Ruhestand bezogen hätte, wenn dieser 40 Jahre lang jeweils sechs Prozent seines Einkommens Monat für Monat in amerikanische Standardaktien investiert hätte. Im ersten Zeitraum hätte dieser Sparer 1871 zu arbeiten begonnen und wäre 1911 in Rente gegangen. Die am Aktienmarkt angesparte Summe hätte er beim Eintritt in den Ruhestand verrentet, also in Anleihen umgeschichtet, und dann als monatliche Summe bis zum 80. Lebensjahr aufgebraucht.
Burtless hat seine Untersuchung so realitätsnah wie möglich angelegt. Er hat Stundenlöhne, Zinssätze von Staatsanleihen, Inflation, Dividenden und Kursschwankungen berücksichtigt. Sein Ergebnis spricht sogar für die Aktienanlage, allerdings nur im Durchschnitt. Mit keiner anderen Anlage wurde über alle Jahrgänge hinweg eine höhere Rente erwirtschaftet. 7 Prozent pro Jahr brachten amerikanische Aktien im vergangenen Jahrhundert, Anleihen dagegen nur 1,6 Prozent. Im Durchschnitt der 90 berechneten Zeiträume konnte man mit 52 Prozent des letzten Lohnes den Ruhestand genießen. Das lässt sich sehen. Am besten hatte es der Jahrgang, der Ende 1999 aus dem Berufsleben ausschied. Diese Aktiensparer hätten 110 Prozent des letzten Gehaltes als monatliche Rente bekommen.
Wer dagegen 1921 das letzte Mal arbeiten gegangen wäre, hätte nur 20 Prozent des letzten Einkommens ausbezahlt bekommen. Ruheständler des Jahres 1969 hätten so viel Rente bezogen, wie sie zuletzt verdienten, sechs Jahrgänge später wäre es weniger als die Hälfte gewesen. Ist es sinnvoll oder gerecht, dass die Altersversorgung derart von den Launen des Aktienmarktes abhängig ist? Und was passiert, wenn Burtless` hypothetische Menschen älter als 80 Jahre werden? Dann haben sie ihr Vermögen aufgebraucht.
Auf all diese Fragen hat die gesetzliche Rente eine einfache Antwort: Die Jungen zahlen für die Alten. Zwar steht auch hier nicht fest, wie viel sie zahlen, und kein Rentner besitzt eine Garantie, dass er das herausbekommt, was er eingezahlt hat. Dafür weiß jeder Sozialversicherte, dass er genug zum Leben haben wird; dass seine Frau und die Kinder unterstützt werden, wenn er noch im Arbeitsleben stirbt; dass er 100 Jahre und älter werden kann und trotzdem noch Rente bezieht. Die Kritiker wenden ein, dass die staatliche Rente spätestens in 25 Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, nicht mehr finanzierbar ist. Das ist aber noch kein Argument für eine ausschließlich private Vorsorge.
Vernünftiger und realistischer sind Kompromisse: Die Alten müssen länger arbeiten, die Jungen mehr zahlen, und der Staat verschuldet sich für eine gewisse Periode stärker. Das spricht nicht gegen den behutsamen Einstieg in die private Altersversorgung, nicht gegen ein Mischsystem mit einem starken gesetzlichen Anteil und einem kleinen privaten. Immerhin gibt es die berechtigte Vermutung, dass die demografische Schieflage in Deutschland extremer ist als in anderen Industrieländern.
Genauso kann niemand raten, von Aktien ganz die Finger zu lassen. Schon zur Risikostreuung gehören sie in jedes Portfolio. Aktien schützen vor den Folgen einer Hyperinflation, die, rein statistisch betrachtet, eineinhalb Mal in 100 Jahren Sparvermögen wie Festgeld oder Anleihen vernichtet. Und Aktien sind das einzige Vehikel, um an der Gewinnentwicklung einer Volkswirtschaft zu partizipieren. Alles gute Gründe für die schwankungsanfällige und daher risikoreiche Anlageform. Aber kein Freibrief, alles auf diese Anlageform zu setzen - schon gar nicht das Geld, das den Lebensabend absichern soll.
Wenn der Immobilienmarkt umkippt
US-Wirtschaft.
Platzt die Immobilienblase, geraten auch das US-Bankensystem, die Konsumausgaben und der Derivatmarkt außer Kontrolle. Um diese Realität zu vertuschen, hilft der US-Administration auch kein Irakkrieg.
Es kracht im Gebälk
Die Dinosaurier des Hypothekenmarktes
Der Jahrhundert-Crash an den Aktienmärkten hat allein in den USA bereits mehr als acht Billionen Dollar an Geldvermögen vernichtet. Durch die Halbierung des Gesamtwertes des amerikanischen Aktienmarktes sind nicht nur die Ersparnisse der Privathaushalte implodiert, sondern aufgrund der dort viel weiter vorangeschrittenen Hinwendung zu privater Altersvorsorge gleichzeitig auch die Rentenansprüche von Millionen Amerikanern. Wenn es bis jetzt noch keine Rentenunruhen in New York, Chicago oder Los Angeles gegeben hat, so mag das aus finanzieller Sicht an zwei Gründen liegen. Zum einen scheint das Propagandamärchen von der "fundamental gesunden Wirtschaft" immer noch den einen oder anderen hoffen zu lassen, der Aufschwung stehe unmittelbar bevor und dann könnten die Aktienkurse rasch zu den alten Ständen zurückkehren. Zum anderen hat die Massenflucht aus den Aktienmärkten in den vergangenen zwei Jahren zur nochmaligen Inflationierung einer weiteren Blase beigetragen: der Blase des amerikanischen Immobilienmarktes. Beispielsweise sind die Immobilienpreise in Boston in vier Jahren um 89 Prozent angestiegen, ebenso im New Yorker Vorort Long Island.Mit der Immobilienblase aufs engste verknüpft ist die gewaltige Schuldenpyramide der Hypothekenkredite, zu deren Wachstum die Federal Reserve mit elf Zinssenkungen im Jahre 2001 maßgeblich beigetragen hat. Die Hypothekenzinsen sind im September auf den tiefsten Stand seit 40 Jahren gefallen. Aber was passiert, wenn auch diese Blase platzt? Die Folgen sowohl für die Hausbesitzer wie für das gesamte Finanzsystem wären in jedem Fall katastrophal. Nicht nur würden die Privathaushalte eine zweite Vermögensimplosion erleben. Mindestens ebenso wichtig ist der Umstand, daß die stark steigenden Häuserpreise in den vergangenen Jahren die private Schuldenspirale und damit die von kreditfinanziertem Konsum abhängige US-Wirtschaft am Laufen gehalten haben. Mehr als zwei Drittel aller amerikanischen Privathaushalte haben einen Hypothekenkredit aufgenommen. Weil die Häuserpreise steigen und die Zinsraten fallen, werden zur Zeit scharenweise Hypothekenkredite umgeschuldet. Bei diesen Umschuldungen, den sogenannten "Refis", gewähren die Banken den Privathaushalten sowohl ein höheres Kreditvolumen als auch niedrigere Zinsraten. Der zusätzliche Kredit wird dabei häufig in bar ausgezahlt und steht für Konsumausgaben zur Verfügung. Dieser "Refi-Boom" ist vermutlich der letzte Faden, der die amerikanische Wirtschaft noch vor dem endgültigen Fall in den Abgrund bewahrt. Aber mit jedem weiteren Tag wird auf diese Weise der amerikanische Schuldenberg ausgeweitet, und jeder Zinsanstieg könnte eine Lawine von privaten Zahlungsunfähigkeiten auslösen. Und wenn die Häuserpreise erst einmal ins Rutschen kommen, dann droht eine Kettenreaktion. Weil die Sicherheiten für die Hypothekenkredite an Wert verlieren, werden die Banken, genau umgekehrt zum gegenwärtigen "Refi"-Treiben, einen sofortigen Barausgleich verlangen. Den Rest kann man sich ausmalen: private Bankrotte, Zwangsversteigerungen von Wohnungen, und dadurch angetrieben ein noch schnellerer Fall der Immobilienpreise. Zugleich ein explosiver Anstieg fauler Kredite im Bankensystem. Es kracht im Gebälk
Etwas sehr Ungewöhnliches geschah Mitte Oktober an den US-Finanzmärkten. Ohne erkennbaren Grund stiegen die Hypothekenzinsen plötzlich deutlich an. Innerhalb einer Woche kletterte die Zinsrate für 30jährige Hypothekenkredite von 6,02% auf 6,23% an, bei 15jährigen von 5,45% auf 5,63%. Nach dem Lehrbuch spiegelt ein solcher Anstieg die Erwartungen an den Märkten wieder, das allgemeine Zinsniveau werde bald steigen, weil es der Wirtschaft zu gut gehe oder weil die Zentralbank eine Inflation zu bekämpfen habe. Die Nachrichtenlage ließ von alledem nichts erkennen: Die Umsätze, Gewinne und Investitionen der Unternehmen gehen weiter zurück, und die Finanzmedien beschwören die Gefahr einer Deflation. Aber da gab es vielleicht einen ganz anderen Zusammenhang. So hatte sich auf den Derivatmärkten gerade ein mittelschwerer Unfall ereignet. Ein Unfall, der, wie der Kolumnist der New Yorker Post John Crudele am 22.Oktober schrieb, "die Zerbrechlichkeit des nationalen Finanzsystems aufzeigt". Und zwar war das Finanzunternehmen Beacon Hill Asset Management in eine Schieflage geraten. Gerüchte kursierten, Beacon Hill sei zu Notverkäufen von Anleihen gezwungen, wodurch dann die Preise langfristiger Schuldenpapiere fallen und ihre Zinsraten entsprechend steigen. Bereits am 18.Oktober hatte Beacon Hill seinen Investoren in einem Brief mitgeteilt, man müsse den hauseigenen Spekulationsfonds Bristol Fund liquidieren, weil dieser mit fehlgeschlagenen Finanzwetten bereits 54% der Kundengelder verbrannt habe. Bei diesen Wetten hatte es sich um komplizierte Anleihegeschäfte gehandelt, die Hypothekenkredite als Absicherung verwendeten. Besonders "beängstigend" an der Beacon-Hill-Geschichte, so Crudele, ist die Tatsache, daß bereits die Probleme eines einzigen mittelgroßen Fonds den gesamten amerikanischen Immobilienmarkt durcheinander wirbeln können. Die Dinosaurier des Hypothekenmarktes
In den vergangenen Monaten hat sich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mehrfach sehr besorgt über die beiden wichtigsten Finanzinstitutionen des amerikanischen Immobilienmarktes geäußert: die halbstaatlichen Hypothekenfinanzierer "Fannie Mae" (Federal National Mortgage Association) und "Freddie Mac" (Federal Home Loan Mortgage Association). Vom US-Kongreß ins Leben gerufen, um den Wohnungsbau zu fördern, haben beide offiziell den Status eines "regierungsunterstützten Unternehmens". Für den Fall einer Schieflage genießen sie zwar keine formelle Regierungsgarantie, aber es wird allgemein angenommen, daß beide Institutionen aufgrund ihres Status und ihrer Größe im Ernstfall von der Regierung gerettet würden. Das Schuldenkarussell des amerikanischen Immobilienmarktes funktioniert folgendermaßen: Zunächst nehmen die Privathaushalte bei ihren Banken Hypothekenkredite auf. Diese werden sodann von den Banken an Fannie Mae und Freddie Mac weiterverkauft. Das Geld dafür holen sich letztere auf den internationalen Anleihemärkten, wo sie sich dank der impliziten Staatsgarantie bei günstigen Konditionen verschulden können. Private Hypothekenschulden werden so in halbstaatliche Anleiheschulden verwandelt. Allein Freddie Mac wirft auf diese Weise jedes Jahr rund 100 Milliarden Dollar an neuen Anleihen auf den Markt. Die Jahresrate der Neuverschuldung mit Hypothekenkrediten ist im zweiten Quartal 2002 auf den Allzeitrekord von 596 Milliarden Dollar hochgeschnellt, drei Mal so viel wie der in den Jahren 1990 bis 1997 übliche Wert von rund 200 Milliarden Dollar. Der Gesamtwert der ausstehenden Hypothekenkredite beläuft sich inzwischen auf 6300 Milliarden Dollar. Am Jahresende 2001 wies Fannie Mae finanzielle Verbindlichkeiten im Volumen von 1560 Milliarden Dollar auf. Bei Freddie Mac waren es 1140 Milliarden Dollar. Nicht eingerechnet sind hier die Derivatkontrakte, welche die beiden Hypothekengiganten eingegangen sind, um sich gegen fallende Hypothekenzinsen und steigende Anleihezinsen abzusichern. Im August mußte Fannie bereits ein milliardenschweres "Problem" bei seinen Finanzverbindlichkeiten einräumen, das große Ähnlichkeit zu dem "Problem" aufweist, dem Beacon Hill Asset Management zum Opfer gefallen ist. Die "extrem zerbrechliche Lage" auf dem amerikanischen Wohnungsmarkt und die potentiell explosiven Folgen für das Bankensystem sind nun zur größten Bedrohung des weltweiten Finanzsystems geworden, bemerkte ein Londoner Finanzinsider am 23.Oktober. Zwar sei man in den USA bemüht, bis zu den Wahlen am 5.November die Fassade der Stabilität aufrechtzuerhalten. Aber "wenn der Immobilienmarkt platzt", dann gerät alles außer Kontrolle: das Bankensystem, die Konsumausgaben, der Derivatmarkt. Irak hin oder her, "Bush hätte keine andere Wahl, als sich diesem Problem zu stellen".
von Lothar Komp
US-Wirtschaft.
Platzt die Immobilienblase, geraten auch das US-Bankensystem, die Konsumausgaben und der Derivatmarkt außer Kontrolle. Um diese Realität zu vertuschen, hilft der US-Administration auch kein Irakkrieg.
Es kracht im Gebälk
Die Dinosaurier des Hypothekenmarktes
Der Jahrhundert-Crash an den Aktienmärkten hat allein in den USA bereits mehr als acht Billionen Dollar an Geldvermögen vernichtet. Durch die Halbierung des Gesamtwertes des amerikanischen Aktienmarktes sind nicht nur die Ersparnisse der Privathaushalte implodiert, sondern aufgrund der dort viel weiter vorangeschrittenen Hinwendung zu privater Altersvorsorge gleichzeitig auch die Rentenansprüche von Millionen Amerikanern. Wenn es bis jetzt noch keine Rentenunruhen in New York, Chicago oder Los Angeles gegeben hat, so mag das aus finanzieller Sicht an zwei Gründen liegen. Zum einen scheint das Propagandamärchen von der "fundamental gesunden Wirtschaft" immer noch den einen oder anderen hoffen zu lassen, der Aufschwung stehe unmittelbar bevor und dann könnten die Aktienkurse rasch zu den alten Ständen zurückkehren. Zum anderen hat die Massenflucht aus den Aktienmärkten in den vergangenen zwei Jahren zur nochmaligen Inflationierung einer weiteren Blase beigetragen: der Blase des amerikanischen Immobilienmarktes. Beispielsweise sind die Immobilienpreise in Boston in vier Jahren um 89 Prozent angestiegen, ebenso im New Yorker Vorort Long Island.Mit der Immobilienblase aufs engste verknüpft ist die gewaltige Schuldenpyramide der Hypothekenkredite, zu deren Wachstum die Federal Reserve mit elf Zinssenkungen im Jahre 2001 maßgeblich beigetragen hat. Die Hypothekenzinsen sind im September auf den tiefsten Stand seit 40 Jahren gefallen. Aber was passiert, wenn auch diese Blase platzt? Die Folgen sowohl für die Hausbesitzer wie für das gesamte Finanzsystem wären in jedem Fall katastrophal. Nicht nur würden die Privathaushalte eine zweite Vermögensimplosion erleben. Mindestens ebenso wichtig ist der Umstand, daß die stark steigenden Häuserpreise in den vergangenen Jahren die private Schuldenspirale und damit die von kreditfinanziertem Konsum abhängige US-Wirtschaft am Laufen gehalten haben. Mehr als zwei Drittel aller amerikanischen Privathaushalte haben einen Hypothekenkredit aufgenommen. Weil die Häuserpreise steigen und die Zinsraten fallen, werden zur Zeit scharenweise Hypothekenkredite umgeschuldet. Bei diesen Umschuldungen, den sogenannten "Refis", gewähren die Banken den Privathaushalten sowohl ein höheres Kreditvolumen als auch niedrigere Zinsraten. Der zusätzliche Kredit wird dabei häufig in bar ausgezahlt und steht für Konsumausgaben zur Verfügung. Dieser "Refi-Boom" ist vermutlich der letzte Faden, der die amerikanische Wirtschaft noch vor dem endgültigen Fall in den Abgrund bewahrt. Aber mit jedem weiteren Tag wird auf diese Weise der amerikanische Schuldenberg ausgeweitet, und jeder Zinsanstieg könnte eine Lawine von privaten Zahlungsunfähigkeiten auslösen. Und wenn die Häuserpreise erst einmal ins Rutschen kommen, dann droht eine Kettenreaktion. Weil die Sicherheiten für die Hypothekenkredite an Wert verlieren, werden die Banken, genau umgekehrt zum gegenwärtigen "Refi"-Treiben, einen sofortigen Barausgleich verlangen. Den Rest kann man sich ausmalen: private Bankrotte, Zwangsversteigerungen von Wohnungen, und dadurch angetrieben ein noch schnellerer Fall der Immobilienpreise. Zugleich ein explosiver Anstieg fauler Kredite im Bankensystem. Es kracht im Gebälk
Etwas sehr Ungewöhnliches geschah Mitte Oktober an den US-Finanzmärkten. Ohne erkennbaren Grund stiegen die Hypothekenzinsen plötzlich deutlich an. Innerhalb einer Woche kletterte die Zinsrate für 30jährige Hypothekenkredite von 6,02% auf 6,23% an, bei 15jährigen von 5,45% auf 5,63%. Nach dem Lehrbuch spiegelt ein solcher Anstieg die Erwartungen an den Märkten wieder, das allgemeine Zinsniveau werde bald steigen, weil es der Wirtschaft zu gut gehe oder weil die Zentralbank eine Inflation zu bekämpfen habe. Die Nachrichtenlage ließ von alledem nichts erkennen: Die Umsätze, Gewinne und Investitionen der Unternehmen gehen weiter zurück, und die Finanzmedien beschwören die Gefahr einer Deflation. Aber da gab es vielleicht einen ganz anderen Zusammenhang. So hatte sich auf den Derivatmärkten gerade ein mittelschwerer Unfall ereignet. Ein Unfall, der, wie der Kolumnist der New Yorker Post John Crudele am 22.Oktober schrieb, "die Zerbrechlichkeit des nationalen Finanzsystems aufzeigt". Und zwar war das Finanzunternehmen Beacon Hill Asset Management in eine Schieflage geraten. Gerüchte kursierten, Beacon Hill sei zu Notverkäufen von Anleihen gezwungen, wodurch dann die Preise langfristiger Schuldenpapiere fallen und ihre Zinsraten entsprechend steigen. Bereits am 18.Oktober hatte Beacon Hill seinen Investoren in einem Brief mitgeteilt, man müsse den hauseigenen Spekulationsfonds Bristol Fund liquidieren, weil dieser mit fehlgeschlagenen Finanzwetten bereits 54% der Kundengelder verbrannt habe. Bei diesen Wetten hatte es sich um komplizierte Anleihegeschäfte gehandelt, die Hypothekenkredite als Absicherung verwendeten. Besonders "beängstigend" an der Beacon-Hill-Geschichte, so Crudele, ist die Tatsache, daß bereits die Probleme eines einzigen mittelgroßen Fonds den gesamten amerikanischen Immobilienmarkt durcheinander wirbeln können. Die Dinosaurier des Hypothekenmarktes
In den vergangenen Monaten hat sich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) mehrfach sehr besorgt über die beiden wichtigsten Finanzinstitutionen des amerikanischen Immobilienmarktes geäußert: die halbstaatlichen Hypothekenfinanzierer "Fannie Mae" (Federal National Mortgage Association) und "Freddie Mac" (Federal Home Loan Mortgage Association). Vom US-Kongreß ins Leben gerufen, um den Wohnungsbau zu fördern, haben beide offiziell den Status eines "regierungsunterstützten Unternehmens". Für den Fall einer Schieflage genießen sie zwar keine formelle Regierungsgarantie, aber es wird allgemein angenommen, daß beide Institutionen aufgrund ihres Status und ihrer Größe im Ernstfall von der Regierung gerettet würden. Das Schuldenkarussell des amerikanischen Immobilienmarktes funktioniert folgendermaßen: Zunächst nehmen die Privathaushalte bei ihren Banken Hypothekenkredite auf. Diese werden sodann von den Banken an Fannie Mae und Freddie Mac weiterverkauft. Das Geld dafür holen sich letztere auf den internationalen Anleihemärkten, wo sie sich dank der impliziten Staatsgarantie bei günstigen Konditionen verschulden können. Private Hypothekenschulden werden so in halbstaatliche Anleiheschulden verwandelt. Allein Freddie Mac wirft auf diese Weise jedes Jahr rund 100 Milliarden Dollar an neuen Anleihen auf den Markt. Die Jahresrate der Neuverschuldung mit Hypothekenkrediten ist im zweiten Quartal 2002 auf den Allzeitrekord von 596 Milliarden Dollar hochgeschnellt, drei Mal so viel wie der in den Jahren 1990 bis 1997 übliche Wert von rund 200 Milliarden Dollar. Der Gesamtwert der ausstehenden Hypothekenkredite beläuft sich inzwischen auf 6300 Milliarden Dollar. Am Jahresende 2001 wies Fannie Mae finanzielle Verbindlichkeiten im Volumen von 1560 Milliarden Dollar auf. Bei Freddie Mac waren es 1140 Milliarden Dollar. Nicht eingerechnet sind hier die Derivatkontrakte, welche die beiden Hypothekengiganten eingegangen sind, um sich gegen fallende Hypothekenzinsen und steigende Anleihezinsen abzusichern. Im August mußte Fannie bereits ein milliardenschweres "Problem" bei seinen Finanzverbindlichkeiten einräumen, das große Ähnlichkeit zu dem "Problem" aufweist, dem Beacon Hill Asset Management zum Opfer gefallen ist. Die "extrem zerbrechliche Lage" auf dem amerikanischen Wohnungsmarkt und die potentiell explosiven Folgen für das Bankensystem sind nun zur größten Bedrohung des weltweiten Finanzsystems geworden, bemerkte ein Londoner Finanzinsider am 23.Oktober. Zwar sei man in den USA bemüht, bis zu den Wahlen am 5.November die Fassade der Stabilität aufrechtzuerhalten. Aber "wenn der Immobilienmarkt platzt", dann gerät alles außer Kontrolle: das Bankensystem, die Konsumausgaben, der Derivatmarkt. Irak hin oder her, "Bush hätte keine andere Wahl, als sich diesem Problem zu stellen".
von Lothar Komp
DIE ZEIT 45/2002
Wir alle - finanzielle Analphabeten

von Marc Brost und Marcus Rohwetter
Ersparnisse weg, Versicherungen unsicher, Rente gefährdet: In der Krise merken die Menschen, dass sie von Geld nichts verstehen. Und dass niemand ihnen hilft
Acht von zehn Deutschen rechnen immer noch in Mark statt in Euro. Sieben von zehn verstehen das gesetzliche Rentensystem nicht. Die meisten zahlen zu viel für ihre privaten Versicherungen.
Und Sie? Glauben Sie wirklich, sich mit Geld auszukennen?
Wenn die Lebensversicherer demnächst wieder Post verschicken, lesen es Millionen Kunden schwarz auf weiß: Es gibt einen Unterschied zwischen Garantiezins und Gewinnbeteiligung. Wer aber weiß, dass eine gekürzte Gewinnbeteiligung gleich mehrere zehntausend Euro ausmachen kann?
Wenn elf Millionen deutsche Aktionäre in diesen Tagen ihr Depot kontrollieren, sehen sie vor allem eines: rot. Kaum eine Aktie, die nicht abgestürzt ist, kaum ein Investmentfonds, der noch Gewinn abwirft. Binnen 18 Monaten wurden in Deutschland fast 600 Milliarden Euro Aktienkapital vernichtet. Verführt hat die Anleger der Werbespruch der Investmentgesellschaften, man müsse nur monatlich Fondsanteile kaufen, dann würden über die Jahre hinweg selbst schwere Kursschwankungen ausgeglichen. Ein teurer Irrtum. Verstehen wir tatsächlich, wie die Börse funktioniert?
Dabei ist Geld doch nur Papier, und es zusammenzuhalten gar nicht so schwer. Dachten wir. "Es gibt keine finanzielle Allgemeinbildung", sagt Jürgen Steiner, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Passau. "Nur Einbildung."
So ergeht es uns wie Analphabeten auf dem Bahnhof. Solange es Lautsprecherdurchsagen gibt und Schaffner uns den Weg weisen, finden wir den richtigen Zug - selbst wenn wir die Schilder nicht lesen können. Was aber, wenn die Lautsprecheranlage ausfällt? Wenn uns der Schaffner zum falschen Gleis schickt?
Erst in der Krise merken wir, wie abhängig wir von anderen sind. Dass wir uns selbst nicht helfen können. Weil wir Analphabeten sind: finanzielle Analphabeten.
Wer den richtigen Zug nicht gefunden hat, landet bei Menschen wie Wolfgang Römer. Der 66-Jährige war früher Richter am Bundesgerichtshof, heute ist er so etwas wie der offizielle Beschwerdeonkel der Versicherungskunden. Ombudsmann nennt sich Römer, und jeder, der mit einer Versicherung streitet, kann sich an ihn wenden. Bis zu tausend Leute im Monat schreiben oder rufen in seinem Berliner Büro an. Manchmal hat sie ihr Versicherungsvertreter falsch beraten, manchmal sträubt sich einfach nur der Sachbearbeiter in der Zentrale, ihnen zu helfen. Im Grunde aber haben die frustrierten Kunden alle das gleiche Problem: Sie durchschauen ihre Versicherung nicht. "Eine Versicherung", sagt Römer, "übersteigt den Verständnishorizont jedes Durchschnittsmenschen."
Das allein ist schlimm genug. Schlimmer ist, dass es den Menschen bei allen anderen Finanzprodukten genauso geht. Weil inzwischen niemand mehr durchblickt: Turbo-Bull-Zertifikate, Click-Optionen, Schatzbriefe Typ A oder B, Dynamik-Garant-Fonds und unzählige Varianten der Riester-Rente - wer kennt da noch die Details?
Dabei sollten wir alle den Durchblick haben. Unbedingt. Da die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht, muss jeder privat vorsorgen. Was in Deutschland lange Zeit nur Gedankenspiele waren, wird jetzt bittere Realität: Die staatlichen Rentenreserven sind so niedrig wie nie, die Regierung erhöht die Rentenbeiträge, die Opposition ruft "Wahlbetrug!", und die meisten Bürger verstehen nur, dass sie heute mehr zahlen und künftig weniger haben werden. Wer kann schon in einem Satz erklären, was die Beitragsbemessungsgrenze ist? Die Probleme fangen gerade erst an.
Vielen Menschen fehlen die Voraussetzungen, um Geld auch nur ansatzweise zu verstehen. Vor Einführung des Euro tourte ein Student mit dem Infomobil der EU-Kommission durchs Land, um die Deutschen über die neue Währung zu informieren. "Es war schon schwierig, ihnen die Faustregel zu erklären, dass ein Euro etwa zwei Mark sind", sagt er.
Mit Zahlen, sagt Gerhard Rupprecht, hätten viele Anleger und Verbraucher nichts am Hut. Der Mann muss es wissen: Rupprecht ist Mathematiker - und Vorstandschef der Allianz Lebensversicherung. Mehr als neun Millionen Policen verantwortet der 53-Jährige, so viel wie kein anderer in Deutschland. "Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, wie eine Lebensversicherung funktioniert", sagt er. "Ein gewisses Verständnis für Zins und Zinseszins reicht schon aus." Aber wer hat das tatsächlich? "Es gibt Abiturienten, die können nicht mal Prozentrechnen", sagt Rupprecht.
Wie viel Prozent muss eine Aktie zulegen, um 50 Prozent Verlust wieder auszugleichen? 50? Falsch! Es sind 100.
Wir leben in einer Welt, die in vielen Bereichen ziemlich kompliziert geworden ist - und dennoch scheitern die Verbraucher fast ausschließlich in der Disziplin Geld. Beispiel Autokauf: Die technischen Details von Achtzylinder und Fünfganggetriebe verstehen die wenigsten. Dennoch treffen sie meistens die richtige Wahl. Ein Ehepaar mit zwei Kindern und Hund schafft sich einen Kombi an und kein Sportcoupé. "Ein Auto kauft man eben nur für die nächsten vier oder fünf Jahre", sagt Jan Evers von der Hamburger Finanzforschung Evers & Jung, "eine Lebensversicherung dagegen rechnet sich erst nach 30 Jahren". Und wer kann diesen Zeitraum schon überblicken?
Weil Geld ein Tabuthema ist, können wir uns auch nicht gegenseitig helfen. Über Geld spricht man nicht einmal in der Familie. Nur die wenigsten wissen, was ihre Eltern genau verdienen. Oder wie diese ihr Vermögen aufgebaut und angelegt haben. Und anders als ein Auto ist der Umgang mit Geld auch kein Lifestyle-Thema, über das man auf Partys plaudert - es sei denn, man kokettiert mit Börsenverlusten. Ein Bausparvertrag passt eben nicht zu Canapés.
Im Idealfall müsste jeder Haushalt seine Finanzen genauso organisieren, wie das ein Unternehmen macht: mit einer Übersicht aller Einnahmen und Ausgaben und dem genauen Vermögensstand. Volker Looman weiß, dass die Realität anders aussieht. Viele seiner Kunden, erzählt der freie Finanzanalytiker aus Reutlingen, haben den Überblick über ihre Finanzen längst verloren. Und das wird zum Problem. "Bei der Geldanlage ist die ehrliche Selbsteinschätzung das Allerwichtigste", sagt Looman. Bloß: Wenn man nicht weiß, was man hat, weiß man auch nicht, was man braucht.
Falsche Freunde.
Finanzielle Analphabeten brauchen Schaffner, die ihnen im Durcheinander des Bahnhofs den Weg weisen. Doch guter Rat ist Glückssache. Die meisten Finanzberater arbeiteten mit Standardkonzepten, haben die Forscher von Cap Gemini Ernst & Young ermittelt. Meist versuchten sie alles, um den Kunden andere als die von ihnen gewünschten Produkte zu verkaufen, heißt es in der Studie. Im Klartext: Man setzt uns alle in den gleichen Zug - und für viele ist es der falsche. "Die Anleger sind nicht wirklich aufgeklärt", sagt der Passauer Wirtschaftsprofessor Steiner. "Deshalb kann man sie auch so leicht über den Tisch ziehen."
Wie die Zahl der Finanzprodukte ist auch die Zahl der Verkäufer rasant gestiegen. 450 000 Versicherungsvertreter, weit mehr als 100 000 Berater bei Banken, Sparkassen und Finanzvertrieben wie MLP, AWD und DVAG - sie alle buhlen in Deutschland um Kunden, und sie alle wollen nur unser Bestes: unser Geld. "Das ist der Grundkonflikt", sagt Marco Habschick von der Finanzforschung Evers & Jung. "Man lässt jemanden für sich arbeiten, der von jemand anders bezahlt wird" - nämlich von der Bank oder Versicherung.
Natürlich gibt es auch gute Berater und individuelle Lösungen. Verhängnisvoll ist nur: Wenn die Sparer merken, dass die Beratung schlecht war, ist es meist zu spät. Weil der empfohlene Aktienfonds um 90 Prozent abgestürzt ist. Oder weil bei Auszahlung der Lebensversicherung bereits 30 Jahre vergangen sind.
Allerdings sind wir finanziellen Analphabeten an einer mangelhaften Beratung nicht schuldlos. Genau wie Leute, die nicht lesen können, geben wir unsere Schwäche ungern zu. "Die meisten Menschen fragen vor dem Vertragsabschluss nicht richtig nach", sagt Wolfgang Römer, der Ombudsmann für Versicherungen. "Fragen die Kunden aber doch, ist es so kompliziert, dass sie es nicht verstehen und dann nicht wagen, noch einmal nachzufragen. Oder der Vertreter erklärt es falsch, weil er es selber nicht weiß."
Selbst wer seine Schwäche eingesteht, kann den falschen Weg gezeigt bekommen. Denn finanzielle Analphabeten gibt es auch dort, wo man sie nicht vermutet: zum Beispiel in Banken. Wenige Wochen vor der Euro-Umstellung rief der Filialleiter einer süddeutschen Sparkasse einen ihm bekannten Finanzexperten an und bat ihn, seinen Mitarbeitern etwas zur Umrechnung zu erzählen. "Als ich hereinkam, saßen die alle hoffnungsvoll am Tisch mit aufgeklappten Notizblöcken", erinnert sich der Referent. "Die wollten tatsächlich wissen, ob die Menschen nach der Umstellung mehr oder weniger Geld haben. Ein Teil konnte nicht einmal den Dreisatz rechnen."
Finanzgurus wie Bodo Schäfer verdienen mit der Unwissenheit der Anleger viel Geld. Der Buchautor verheißt den Weg zur finanziellen Freiheit, verspricht Wohlstand ohne Stress und kennt Die Gesetze der Gewinner. Schäfer schaffte es damit bis in die Spitze der Bestsellerlisten. Endlich mehr verdienen, heißt sein neuestes Buch, doch der Guru, behauptet ein Konkurrenzverlag, soll in einem Kapitel kräftig abgeschrieben haben. Auch so verdient man mehr. Schäfer bestreitet die Vorwürfe.
Profiteure des Unglücks.
Unfähig, unsere Fehler einzusehen, suchen wir die Schuld am liebsten bei anderen. Zum Beispiel bei Managern, die Bilanzen schönen und mit windigen Zahlen tricksen. Als ob wir die Zahlen verstanden hätten, wenn sie korrekt gewesen wären. Jetzt sollen uns die Gerichte zurückgeben, was uns die Börse nahm - und dabei riskieren wir noch mehr Geld. Wer ein 50 000-Euro-Verfahren in allen Instanzen verliert, muss mit Kosten von mehr als 25 000 Euro rechnen.
Enttäuschte Kleinaktionäre sind für Anwälte eine lukrative Klientel. Die hierzulande noch junge Gruppe der Anlegeranwälte zeichnet sich vor allem durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit aus. Einen Namen hat sich die Kanzlei Rotter aus Grünwald oder Tilp & Kälberer aus Kirchentellinsfurt bei Tübingen gemacht. Kaum ein Unternehmen, das noch nicht auf Schadenersatz verklagt worden ist: Der Filmrechtehändler EM.TV, andere Neue-Markt-Firmen wie Metabox oder Infomatec, aber auch Dax-Schwergewichte wie die Deutsche Telekom. Ende vergangener Woche verklagte Rotter - laut Eigenwerbung die "Kanzlei für Wertpapieranleger" - im Namen von 150 Anlegern den ehemaligen Comroad-Chef Bodo Schnabel wegen Bilanzfälschung.
Auch die Juristen der Anlegerschutzvereine gehen gern an die Öffentlichkeit. Der wohl prominenteste unter ihnen ist Klaus Nieding, Rechtsanwalt aus Frankfurt, Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Präsident des Deutschen Anlegerschutzbundes (DASB). In seiner Pressemitteilung vom 27. Juni 2002 verweist "der renommierte Anlegervertreter" (Selbstauskunft) auf angeblich steigende Erfolgschancen seiner zahlreichen Prozesse gegen eine Schweizer Privatbank: "Millionenklagen gegen Julius Bär offenbar gerechtfertigt" - dabei hatte das Gericht den Parteien bloß nahe gelegt, einen Vergleich zu schließen.
Die Hoffnung vieler Anleger, Gerichte würden ihnen zurückgeben, was ihnen die Börse nahm, wird oft enttäuscht. Beispiel Infomatec: 50 Euro kostete die Aktie der Softwarefirma zu Spitzenzeiten am Neuen Markt, heute sind es 5 Cent - Kursverlust 99,9 Prozent. Weil die beiden Vorstände Aufträge nur vorgetäuscht haben sollen, sprach das Landgericht Augsburg im vergangenen Sommer einem Anleger knapp 100 000 Mark Schadenersatz zu. Die Entscheidung, von der Kanzlei Rotter erstritten und prompt als "Meilenstein im über hundertjährigen deutschen Aktienrecht" bezeichnet, war zwar tatsächlich neu - nie zuvor konnte ein Aktionär die Führungsriege eines Unternehmens persönlich haftbar machen. Aber vor wenigen Wochen kippte das Oberlandesgericht München das Urteil; nun muss der Bundesgerichtshof entscheiden.
Amerikas Albtraum.
Finanzielle Analphabeten gibt es überall. Weil Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten nicht ausreichend vorsorgen, können sie ihren Lebensstandard nicht halten, wenn sie in Rente gehen. Aber: In den USA wird dieses Problem wenigstens öffentlich diskutiert. Bereits Ende der neunziger Jahre warnte der damalige Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, Arthur Levitt, die finanzielle Bildung zu vernachlässigen. Diese Ignoranz könne noch "sehr gefährlich" werden. Und in diesem Mai bestätigte das National Summit on Economic and Financial Literacy - das landesweit erste Gipfeltreffen zu diesem Thema - die böse Ahnung: Die amerikanische Durchschnittsfamilie hat 8000 Dollar Konsumschulden; 14 Prozent des verfügbaren Einkommens gehen allein für Zinsen drauf. Jeder zehnte Student mit eigener Kreditkarte steht mit mehr als 7000 Dollar in der Kreide.
Nichtkommerzielle Organisationen wie Financial Literacy 2010 (FL 2010)wollen vor allem die Lehrer an den Schulen finanziell weiterbilden. Mehr als 40 000 von ihnen hat FL 2010mit Unterrichtsmaterial versorgt, rund 9000 Lehrer besuchen Seminare über die Grundlagen des Sparens und die Präsentation von Finanzthemen im Unterricht. So wollen sie ändern, dass 78 Prozent der Amerikaner zwar die Namen von TV-Serienfiguren kennen, aber nur 12 Prozent den Unterschied zwischen einem Investmentfonds mit und ohne Ausgabeaufschlag. Es ist ein Langzeitprojekt. "Das dauert eine Generation", sagt Lewis Mandell, Professor an der University at Buffalo School of Management, bis sich neue Lehrmethoden im Schülerverhalten widerspiegeln.
Und die Arbeit ist mühsam. In Multiple-Choice-Tests bittet Mandell die Schüler amerikanischer Highschools regelmäßig, die richtigen Antworten anzukreuzen: Welche Probleme bringt Inflation mit sich? Welche Versicherung hilft bei einem Autounfall? Das Ergebnis der diesjährigen Umfrage: "From bad to worse" - die Schüler werden immer dümmer. Im Durchschnitt wussten sie gerade mal auf jede zweite Frage die korrekte Antwort.
Das Fatale: Selbst in einem Land mit vorwiegend privater Altersvorsorge interessiert sich kaum jemand für den richtigen Umgang mit Geld. Der Anteil der US-Schüler, die Kurse in persönlicher Finanzplanung belegen, sinkt.
Vielleicht hilft da ja die Wirtschaftskrise. "Die Menschen werden gezwungen, mit weniger Geld mehr zu erreichen", sagt Lewis Mandell. Rezession macht klug.
Deutsches Dilemma.
In Deutschland gibt es zur Hoffnung keinen Grund: Finanzielle Allgemeinbildung ist kein Thema, niemand fühlt sich zuständig.
Der Staat? Verpflichtet seine Bürger zur privaten Altersvorsorge, kümmert sich aber nicht um die Information. "In unseren Prospekten müssen wir den Menschen erst einmal ausführlich erklären, was sich in der gesetzlichen Rentenversicherung künftig ändert", sagt Allianz-Leben-Chef Rupprecht. "Die Politik vernachlässigt ihre Aufgaben."
Die Schulen? Sind weit davon entfernt, "allen Schülern eine ökonomische Grundbildung als Teil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung zu vermitteln", kritisiert Reinhold Weiß vom Institut der deutschen Wirtschaft. Dabei gibt der Staat jedes Jahr rund 40 Milliarden Euro für Bildung aus: zum Beispiel für Biologiebücher, Landkarten und die Gehälter von Kunstlehrern. Nur für den Umgang mit Geld ist kein Geld da.
Zwar stellen in den kommenden Jahren fast alle Bundesländer ihre Lehrpläne um. An Hamburgs Gymnasien etwa wird von 2003 an in den Klassen 8 bis 10 das neue Fach Politik/Gesellschaft/Wirtschaft zur Pflicht. Aber das ist bloß ein kleiner Fortschritt. "Integrierte Fächer sind nur die zweitbeste Lösung", sagt Ulrike Lexis von der Bertelsmann Stiftung. An dem neuen Fach hat Wirtschaft eben nur einen Anteil von einem Drittel. Und wie groß daran dann der Anteil der finanziellen Bildung sein könnte, ist offen. "Ohne die private Lebenssituation mit einzubeziehen - etwa als Konsument oder Steuerzahler -, wäre das eine blutleere Veranstaltung", kritisiert Hans Kaminski, Professor am Institut für ökonomische Bildung der Universität Oldenburg.
Können ein paar Schulstunden im Halbjahr einem Jugendlichen tatsächlich helfen, seine Finanzen irgendwann optimal zu regeln? Bewahren sie ihn davor, sich später von Beratern und falschen Freunden ausnehmen zu lassen? Schützen sie ihn vor einem Alter in Armut?
Wichtig ist: dass wir uns eingestehen, finanzielle Analphabeten zu sein. Dass wir Hilfe brauchen, um uns irgendwann selbst helfen zu können. Finanzielles Grundwissen ist das Minimum, damit wäre schon viel erreicht. Nie einen Fehler zu machen bleibt eine Illusion. Wenn es um Geld geht, scheitern selbst Profis.
Die Ego-Falle.
Natürlich gibt es Menschen, die das staatliche Rentensystem verstehen. Die einen exakten Überblick über ihre Finanzlage haben. Und die sehr gut wissen, dass ihr Bankberater vor allem die Interessen seines Arbeitgebers im Blick hat. Auch sie können irren.
"Wissen allein schützt nicht", sagt der Züricher Wirtschaftswissenschaftler Ernst Fehr. Auch ein Alkoholiker weiß im Grunde, dass Alkohol nicht gut für ihn ist - und trinkt dennoch. Weil Ungeduld oder Willensschwäche unser Handeln beeinflussen. "Selbst wenn die Menschen die besten Mittel kennen, sind sie manchmal nicht in der Lage, diese Mittel auch anzuwenden", sagt Fehr. Zwei Drittel der US-Bürger glauben, dass sie fürs Alter zu wenig vorsorgen, heißt es zum Beispiel in einer Studie der Investmentbank UBS Warburg. Mehr als ein Drittel will daher mehr sparen. Fragt man jedoch einige Monate später nach, haben die wenigsten mehr Geld auf die Seite gelegt.
In Experimenten und Simulationen erforschen Ökonomen wie Fehr seit langem, warum sich sogar gebildete Menschen im Wirtschaftsleben kurzfristig anders verhalten, als es ihren langfristigen Interessen entspricht. Das hat mehrere Gründe: Wir alle sind zu sehr von uns überzeugt - overconfidence nennen das die Wissenschaftler.
70 Prozent der Autofahrer sagen von sich, dass sie überdurchschnittlich gut fahren. 90 Prozent der Fondsmanager behaupten, dass sie den Vergleichsindex schlagen. Kaum einem gelingt es wirklich. Weil wir glauben, dass wir besser sind als andere, halten wir zum Beispiel an unserer Investmentstrategie fest - obwohl längst nichts mehr für dieses Investment spricht.
Doch zu lernen fällt uns schwer. Manchen Fehler mögen wir begreifen, aber wenn die Ausgangslage beim nächsten Mal nur ein wenig anders aussieht, erkennen wir das Muster nicht mehr wieder. Und handeln erneut entgegen dem eigenen Interesse.
Als der amerikanische Aktienindex Dow Jones noch kletterte und nahezu jeder Aktien und Fondsanteile kaufte, befragte ein Forscherteam private Fondsbesitzer. Was würden Sie tun, wenn der Dow Jones bei 8000 Punkten steht und plötzlich um fünf Prozent fällt? Jeder Siebte gab an, keine neuen Fondsanteile zu kaufen. Zweite Frage: Was würden Sie tun, wenn der Index um 400 Punkte fällt? Da wollten fast doppelt so viele aufhören zu investieren - obwohl der Absturz des Dow identisch war. Gleiche Situation, ganz anderes Verhalten.
Rationaler Umgang mit Geld ist eine Seltenheit.
Deshalb wiederholen sich am Aktienmarkt seit Jahrhunderten die Übertreibungen, Fehleinschätzungen und Exzesse. Deshalb spekulierten die Niederländer 1637 mit Tulpenzwiebeln, bis diese so viel kosteten wie ein Einfamilienhaus. Deshalb konnte ein findiger Brite Anfang des 18. Jahrhunderts Tausende Menschen dazu bringen, sich an seiner wirren Idee finanziell zu beteiligen - der "Gesellschaft zur Durchführung eines überaus nützlichen Unternehmens, das aber noch niemand kennt". Und deshalb stürzten sich viele Tausende Kleinaktionäre noch im Jahr 2000 ins Abenteuer Neuer Markt, obwohl bereits damals das Bundeskriminalamt vor "Straftaten im Umfeld des Kapitalanlagebetruges" warnte.
"Finanzgenie ist man nur bis zum Bankrott", spottet der amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith. "Es ist eine trügerische Vorstellung, Geld und Intelligenz müssten miteinander einhergehen."
Wir alle - finanzielle Analphabeten

von Marc Brost und Marcus Rohwetter
Ersparnisse weg, Versicherungen unsicher, Rente gefährdet: In der Krise merken die Menschen, dass sie von Geld nichts verstehen. Und dass niemand ihnen hilft
Acht von zehn Deutschen rechnen immer noch in Mark statt in Euro. Sieben von zehn verstehen das gesetzliche Rentensystem nicht. Die meisten zahlen zu viel für ihre privaten Versicherungen.
Und Sie? Glauben Sie wirklich, sich mit Geld auszukennen?
Wenn die Lebensversicherer demnächst wieder Post verschicken, lesen es Millionen Kunden schwarz auf weiß: Es gibt einen Unterschied zwischen Garantiezins und Gewinnbeteiligung. Wer aber weiß, dass eine gekürzte Gewinnbeteiligung gleich mehrere zehntausend Euro ausmachen kann?
Wenn elf Millionen deutsche Aktionäre in diesen Tagen ihr Depot kontrollieren, sehen sie vor allem eines: rot. Kaum eine Aktie, die nicht abgestürzt ist, kaum ein Investmentfonds, der noch Gewinn abwirft. Binnen 18 Monaten wurden in Deutschland fast 600 Milliarden Euro Aktienkapital vernichtet. Verführt hat die Anleger der Werbespruch der Investmentgesellschaften, man müsse nur monatlich Fondsanteile kaufen, dann würden über die Jahre hinweg selbst schwere Kursschwankungen ausgeglichen. Ein teurer Irrtum. Verstehen wir tatsächlich, wie die Börse funktioniert?
Dabei ist Geld doch nur Papier, und es zusammenzuhalten gar nicht so schwer. Dachten wir. "Es gibt keine finanzielle Allgemeinbildung", sagt Jürgen Steiner, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Passau. "Nur Einbildung."
So ergeht es uns wie Analphabeten auf dem Bahnhof. Solange es Lautsprecherdurchsagen gibt und Schaffner uns den Weg weisen, finden wir den richtigen Zug - selbst wenn wir die Schilder nicht lesen können. Was aber, wenn die Lautsprecheranlage ausfällt? Wenn uns der Schaffner zum falschen Gleis schickt?
Erst in der Krise merken wir, wie abhängig wir von anderen sind. Dass wir uns selbst nicht helfen können. Weil wir Analphabeten sind: finanzielle Analphabeten.
Wer den richtigen Zug nicht gefunden hat, landet bei Menschen wie Wolfgang Römer. Der 66-Jährige war früher Richter am Bundesgerichtshof, heute ist er so etwas wie der offizielle Beschwerdeonkel der Versicherungskunden. Ombudsmann nennt sich Römer, und jeder, der mit einer Versicherung streitet, kann sich an ihn wenden. Bis zu tausend Leute im Monat schreiben oder rufen in seinem Berliner Büro an. Manchmal hat sie ihr Versicherungsvertreter falsch beraten, manchmal sträubt sich einfach nur der Sachbearbeiter in der Zentrale, ihnen zu helfen. Im Grunde aber haben die frustrierten Kunden alle das gleiche Problem: Sie durchschauen ihre Versicherung nicht. "Eine Versicherung", sagt Römer, "übersteigt den Verständnishorizont jedes Durchschnittsmenschen."
Das allein ist schlimm genug. Schlimmer ist, dass es den Menschen bei allen anderen Finanzprodukten genauso geht. Weil inzwischen niemand mehr durchblickt: Turbo-Bull-Zertifikate, Click-Optionen, Schatzbriefe Typ A oder B, Dynamik-Garant-Fonds und unzählige Varianten der Riester-Rente - wer kennt da noch die Details?
Dabei sollten wir alle den Durchblick haben. Unbedingt. Da die gesetzliche Rente nicht mehr ausreicht, muss jeder privat vorsorgen. Was in Deutschland lange Zeit nur Gedankenspiele waren, wird jetzt bittere Realität: Die staatlichen Rentenreserven sind so niedrig wie nie, die Regierung erhöht die Rentenbeiträge, die Opposition ruft "Wahlbetrug!", und die meisten Bürger verstehen nur, dass sie heute mehr zahlen und künftig weniger haben werden. Wer kann schon in einem Satz erklären, was die Beitragsbemessungsgrenze ist? Die Probleme fangen gerade erst an.
Vielen Menschen fehlen die Voraussetzungen, um Geld auch nur ansatzweise zu verstehen. Vor Einführung des Euro tourte ein Student mit dem Infomobil der EU-Kommission durchs Land, um die Deutschen über die neue Währung zu informieren. "Es war schon schwierig, ihnen die Faustregel zu erklären, dass ein Euro etwa zwei Mark sind", sagt er.
Mit Zahlen, sagt Gerhard Rupprecht, hätten viele Anleger und Verbraucher nichts am Hut. Der Mann muss es wissen: Rupprecht ist Mathematiker - und Vorstandschef der Allianz Lebensversicherung. Mehr als neun Millionen Policen verantwortet der 53-Jährige, so viel wie kein anderer in Deutschland. "Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, wie eine Lebensversicherung funktioniert", sagt er. "Ein gewisses Verständnis für Zins und Zinseszins reicht schon aus." Aber wer hat das tatsächlich? "Es gibt Abiturienten, die können nicht mal Prozentrechnen", sagt Rupprecht.
Wie viel Prozent muss eine Aktie zulegen, um 50 Prozent Verlust wieder auszugleichen? 50? Falsch! Es sind 100.
Wir leben in einer Welt, die in vielen Bereichen ziemlich kompliziert geworden ist - und dennoch scheitern die Verbraucher fast ausschließlich in der Disziplin Geld. Beispiel Autokauf: Die technischen Details von Achtzylinder und Fünfganggetriebe verstehen die wenigsten. Dennoch treffen sie meistens die richtige Wahl. Ein Ehepaar mit zwei Kindern und Hund schafft sich einen Kombi an und kein Sportcoupé. "Ein Auto kauft man eben nur für die nächsten vier oder fünf Jahre", sagt Jan Evers von der Hamburger Finanzforschung Evers & Jung, "eine Lebensversicherung dagegen rechnet sich erst nach 30 Jahren". Und wer kann diesen Zeitraum schon überblicken?
Weil Geld ein Tabuthema ist, können wir uns auch nicht gegenseitig helfen. Über Geld spricht man nicht einmal in der Familie. Nur die wenigsten wissen, was ihre Eltern genau verdienen. Oder wie diese ihr Vermögen aufgebaut und angelegt haben. Und anders als ein Auto ist der Umgang mit Geld auch kein Lifestyle-Thema, über das man auf Partys plaudert - es sei denn, man kokettiert mit Börsenverlusten. Ein Bausparvertrag passt eben nicht zu Canapés.
Im Idealfall müsste jeder Haushalt seine Finanzen genauso organisieren, wie das ein Unternehmen macht: mit einer Übersicht aller Einnahmen und Ausgaben und dem genauen Vermögensstand. Volker Looman weiß, dass die Realität anders aussieht. Viele seiner Kunden, erzählt der freie Finanzanalytiker aus Reutlingen, haben den Überblick über ihre Finanzen längst verloren. Und das wird zum Problem. "Bei der Geldanlage ist die ehrliche Selbsteinschätzung das Allerwichtigste", sagt Looman. Bloß: Wenn man nicht weiß, was man hat, weiß man auch nicht, was man braucht.
Falsche Freunde.
Finanzielle Analphabeten brauchen Schaffner, die ihnen im Durcheinander des Bahnhofs den Weg weisen. Doch guter Rat ist Glückssache. Die meisten Finanzberater arbeiteten mit Standardkonzepten, haben die Forscher von Cap Gemini Ernst & Young ermittelt. Meist versuchten sie alles, um den Kunden andere als die von ihnen gewünschten Produkte zu verkaufen, heißt es in der Studie. Im Klartext: Man setzt uns alle in den gleichen Zug - und für viele ist es der falsche. "Die Anleger sind nicht wirklich aufgeklärt", sagt der Passauer Wirtschaftsprofessor Steiner. "Deshalb kann man sie auch so leicht über den Tisch ziehen."
Wie die Zahl der Finanzprodukte ist auch die Zahl der Verkäufer rasant gestiegen. 450 000 Versicherungsvertreter, weit mehr als 100 000 Berater bei Banken, Sparkassen und Finanzvertrieben wie MLP, AWD und DVAG - sie alle buhlen in Deutschland um Kunden, und sie alle wollen nur unser Bestes: unser Geld. "Das ist der Grundkonflikt", sagt Marco Habschick von der Finanzforschung Evers & Jung. "Man lässt jemanden für sich arbeiten, der von jemand anders bezahlt wird" - nämlich von der Bank oder Versicherung.
Natürlich gibt es auch gute Berater und individuelle Lösungen. Verhängnisvoll ist nur: Wenn die Sparer merken, dass die Beratung schlecht war, ist es meist zu spät. Weil der empfohlene Aktienfonds um 90 Prozent abgestürzt ist. Oder weil bei Auszahlung der Lebensversicherung bereits 30 Jahre vergangen sind.
Allerdings sind wir finanziellen Analphabeten an einer mangelhaften Beratung nicht schuldlos. Genau wie Leute, die nicht lesen können, geben wir unsere Schwäche ungern zu. "Die meisten Menschen fragen vor dem Vertragsabschluss nicht richtig nach", sagt Wolfgang Römer, der Ombudsmann für Versicherungen. "Fragen die Kunden aber doch, ist es so kompliziert, dass sie es nicht verstehen und dann nicht wagen, noch einmal nachzufragen. Oder der Vertreter erklärt es falsch, weil er es selber nicht weiß."
Selbst wer seine Schwäche eingesteht, kann den falschen Weg gezeigt bekommen. Denn finanzielle Analphabeten gibt es auch dort, wo man sie nicht vermutet: zum Beispiel in Banken. Wenige Wochen vor der Euro-Umstellung rief der Filialleiter einer süddeutschen Sparkasse einen ihm bekannten Finanzexperten an und bat ihn, seinen Mitarbeitern etwas zur Umrechnung zu erzählen. "Als ich hereinkam, saßen die alle hoffnungsvoll am Tisch mit aufgeklappten Notizblöcken", erinnert sich der Referent. "Die wollten tatsächlich wissen, ob die Menschen nach der Umstellung mehr oder weniger Geld haben. Ein Teil konnte nicht einmal den Dreisatz rechnen."
Finanzgurus wie Bodo Schäfer verdienen mit der Unwissenheit der Anleger viel Geld. Der Buchautor verheißt den Weg zur finanziellen Freiheit, verspricht Wohlstand ohne Stress und kennt Die Gesetze der Gewinner. Schäfer schaffte es damit bis in die Spitze der Bestsellerlisten. Endlich mehr verdienen, heißt sein neuestes Buch, doch der Guru, behauptet ein Konkurrenzverlag, soll in einem Kapitel kräftig abgeschrieben haben. Auch so verdient man mehr. Schäfer bestreitet die Vorwürfe.
Profiteure des Unglücks.
Unfähig, unsere Fehler einzusehen, suchen wir die Schuld am liebsten bei anderen. Zum Beispiel bei Managern, die Bilanzen schönen und mit windigen Zahlen tricksen. Als ob wir die Zahlen verstanden hätten, wenn sie korrekt gewesen wären. Jetzt sollen uns die Gerichte zurückgeben, was uns die Börse nahm - und dabei riskieren wir noch mehr Geld. Wer ein 50 000-Euro-Verfahren in allen Instanzen verliert, muss mit Kosten von mehr als 25 000 Euro rechnen.
Enttäuschte Kleinaktionäre sind für Anwälte eine lukrative Klientel. Die hierzulande noch junge Gruppe der Anlegeranwälte zeichnet sich vor allem durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit aus. Einen Namen hat sich die Kanzlei Rotter aus Grünwald oder Tilp & Kälberer aus Kirchentellinsfurt bei Tübingen gemacht. Kaum ein Unternehmen, das noch nicht auf Schadenersatz verklagt worden ist: Der Filmrechtehändler EM.TV, andere Neue-Markt-Firmen wie Metabox oder Infomatec, aber auch Dax-Schwergewichte wie die Deutsche Telekom. Ende vergangener Woche verklagte Rotter - laut Eigenwerbung die "Kanzlei für Wertpapieranleger" - im Namen von 150 Anlegern den ehemaligen Comroad-Chef Bodo Schnabel wegen Bilanzfälschung.
Auch die Juristen der Anlegerschutzvereine gehen gern an die Öffentlichkeit. Der wohl prominenteste unter ihnen ist Klaus Nieding, Rechtsanwalt aus Frankfurt, Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Präsident des Deutschen Anlegerschutzbundes (DASB). In seiner Pressemitteilung vom 27. Juni 2002 verweist "der renommierte Anlegervertreter" (Selbstauskunft) auf angeblich steigende Erfolgschancen seiner zahlreichen Prozesse gegen eine Schweizer Privatbank: "Millionenklagen gegen Julius Bär offenbar gerechtfertigt" - dabei hatte das Gericht den Parteien bloß nahe gelegt, einen Vergleich zu schließen.
Die Hoffnung vieler Anleger, Gerichte würden ihnen zurückgeben, was ihnen die Börse nahm, wird oft enttäuscht. Beispiel Infomatec: 50 Euro kostete die Aktie der Softwarefirma zu Spitzenzeiten am Neuen Markt, heute sind es 5 Cent - Kursverlust 99,9 Prozent. Weil die beiden Vorstände Aufträge nur vorgetäuscht haben sollen, sprach das Landgericht Augsburg im vergangenen Sommer einem Anleger knapp 100 000 Mark Schadenersatz zu. Die Entscheidung, von der Kanzlei Rotter erstritten und prompt als "Meilenstein im über hundertjährigen deutschen Aktienrecht" bezeichnet, war zwar tatsächlich neu - nie zuvor konnte ein Aktionär die Führungsriege eines Unternehmens persönlich haftbar machen. Aber vor wenigen Wochen kippte das Oberlandesgericht München das Urteil; nun muss der Bundesgerichtshof entscheiden.
Amerikas Albtraum.
Finanzielle Analphabeten gibt es überall. Weil Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten nicht ausreichend vorsorgen, können sie ihren Lebensstandard nicht halten, wenn sie in Rente gehen. Aber: In den USA wird dieses Problem wenigstens öffentlich diskutiert. Bereits Ende der neunziger Jahre warnte der damalige Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, Arthur Levitt, die finanzielle Bildung zu vernachlässigen. Diese Ignoranz könne noch "sehr gefährlich" werden. Und in diesem Mai bestätigte das National Summit on Economic and Financial Literacy - das landesweit erste Gipfeltreffen zu diesem Thema - die böse Ahnung: Die amerikanische Durchschnittsfamilie hat 8000 Dollar Konsumschulden; 14 Prozent des verfügbaren Einkommens gehen allein für Zinsen drauf. Jeder zehnte Student mit eigener Kreditkarte steht mit mehr als 7000 Dollar in der Kreide.
Nichtkommerzielle Organisationen wie Financial Literacy 2010 (FL 2010)wollen vor allem die Lehrer an den Schulen finanziell weiterbilden. Mehr als 40 000 von ihnen hat FL 2010mit Unterrichtsmaterial versorgt, rund 9000 Lehrer besuchen Seminare über die Grundlagen des Sparens und die Präsentation von Finanzthemen im Unterricht. So wollen sie ändern, dass 78 Prozent der Amerikaner zwar die Namen von TV-Serienfiguren kennen, aber nur 12 Prozent den Unterschied zwischen einem Investmentfonds mit und ohne Ausgabeaufschlag. Es ist ein Langzeitprojekt. "Das dauert eine Generation", sagt Lewis Mandell, Professor an der University at Buffalo School of Management, bis sich neue Lehrmethoden im Schülerverhalten widerspiegeln.
Und die Arbeit ist mühsam. In Multiple-Choice-Tests bittet Mandell die Schüler amerikanischer Highschools regelmäßig, die richtigen Antworten anzukreuzen: Welche Probleme bringt Inflation mit sich? Welche Versicherung hilft bei einem Autounfall? Das Ergebnis der diesjährigen Umfrage: "From bad to worse" - die Schüler werden immer dümmer. Im Durchschnitt wussten sie gerade mal auf jede zweite Frage die korrekte Antwort.
Das Fatale: Selbst in einem Land mit vorwiegend privater Altersvorsorge interessiert sich kaum jemand für den richtigen Umgang mit Geld. Der Anteil der US-Schüler, die Kurse in persönlicher Finanzplanung belegen, sinkt.
Vielleicht hilft da ja die Wirtschaftskrise. "Die Menschen werden gezwungen, mit weniger Geld mehr zu erreichen", sagt Lewis Mandell. Rezession macht klug.
Deutsches Dilemma.
In Deutschland gibt es zur Hoffnung keinen Grund: Finanzielle Allgemeinbildung ist kein Thema, niemand fühlt sich zuständig.
Der Staat? Verpflichtet seine Bürger zur privaten Altersvorsorge, kümmert sich aber nicht um die Information. "In unseren Prospekten müssen wir den Menschen erst einmal ausführlich erklären, was sich in der gesetzlichen Rentenversicherung künftig ändert", sagt Allianz-Leben-Chef Rupprecht. "Die Politik vernachlässigt ihre Aufgaben."
Die Schulen? Sind weit davon entfernt, "allen Schülern eine ökonomische Grundbildung als Teil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung zu vermitteln", kritisiert Reinhold Weiß vom Institut der deutschen Wirtschaft. Dabei gibt der Staat jedes Jahr rund 40 Milliarden Euro für Bildung aus: zum Beispiel für Biologiebücher, Landkarten und die Gehälter von Kunstlehrern. Nur für den Umgang mit Geld ist kein Geld da.
Zwar stellen in den kommenden Jahren fast alle Bundesländer ihre Lehrpläne um. An Hamburgs Gymnasien etwa wird von 2003 an in den Klassen 8 bis 10 das neue Fach Politik/Gesellschaft/Wirtschaft zur Pflicht. Aber das ist bloß ein kleiner Fortschritt. "Integrierte Fächer sind nur die zweitbeste Lösung", sagt Ulrike Lexis von der Bertelsmann Stiftung. An dem neuen Fach hat Wirtschaft eben nur einen Anteil von einem Drittel. Und wie groß daran dann der Anteil der finanziellen Bildung sein könnte, ist offen. "Ohne die private Lebenssituation mit einzubeziehen - etwa als Konsument oder Steuerzahler -, wäre das eine blutleere Veranstaltung", kritisiert Hans Kaminski, Professor am Institut für ökonomische Bildung der Universität Oldenburg.
Können ein paar Schulstunden im Halbjahr einem Jugendlichen tatsächlich helfen, seine Finanzen irgendwann optimal zu regeln? Bewahren sie ihn davor, sich später von Beratern und falschen Freunden ausnehmen zu lassen? Schützen sie ihn vor einem Alter in Armut?
Wichtig ist: dass wir uns eingestehen, finanzielle Analphabeten zu sein. Dass wir Hilfe brauchen, um uns irgendwann selbst helfen zu können. Finanzielles Grundwissen ist das Minimum, damit wäre schon viel erreicht. Nie einen Fehler zu machen bleibt eine Illusion. Wenn es um Geld geht, scheitern selbst Profis.
Die Ego-Falle.
Natürlich gibt es Menschen, die das staatliche Rentensystem verstehen. Die einen exakten Überblick über ihre Finanzlage haben. Und die sehr gut wissen, dass ihr Bankberater vor allem die Interessen seines Arbeitgebers im Blick hat. Auch sie können irren.
"Wissen allein schützt nicht", sagt der Züricher Wirtschaftswissenschaftler Ernst Fehr. Auch ein Alkoholiker weiß im Grunde, dass Alkohol nicht gut für ihn ist - und trinkt dennoch. Weil Ungeduld oder Willensschwäche unser Handeln beeinflussen. "Selbst wenn die Menschen die besten Mittel kennen, sind sie manchmal nicht in der Lage, diese Mittel auch anzuwenden", sagt Fehr. Zwei Drittel der US-Bürger glauben, dass sie fürs Alter zu wenig vorsorgen, heißt es zum Beispiel in einer Studie der Investmentbank UBS Warburg. Mehr als ein Drittel will daher mehr sparen. Fragt man jedoch einige Monate später nach, haben die wenigsten mehr Geld auf die Seite gelegt.
In Experimenten und Simulationen erforschen Ökonomen wie Fehr seit langem, warum sich sogar gebildete Menschen im Wirtschaftsleben kurzfristig anders verhalten, als es ihren langfristigen Interessen entspricht. Das hat mehrere Gründe: Wir alle sind zu sehr von uns überzeugt - overconfidence nennen das die Wissenschaftler.
70 Prozent der Autofahrer sagen von sich, dass sie überdurchschnittlich gut fahren. 90 Prozent der Fondsmanager behaupten, dass sie den Vergleichsindex schlagen. Kaum einem gelingt es wirklich. Weil wir glauben, dass wir besser sind als andere, halten wir zum Beispiel an unserer Investmentstrategie fest - obwohl längst nichts mehr für dieses Investment spricht.
Doch zu lernen fällt uns schwer. Manchen Fehler mögen wir begreifen, aber wenn die Ausgangslage beim nächsten Mal nur ein wenig anders aussieht, erkennen wir das Muster nicht mehr wieder. Und handeln erneut entgegen dem eigenen Interesse.
Als der amerikanische Aktienindex Dow Jones noch kletterte und nahezu jeder Aktien und Fondsanteile kaufte, befragte ein Forscherteam private Fondsbesitzer. Was würden Sie tun, wenn der Dow Jones bei 8000 Punkten steht und plötzlich um fünf Prozent fällt? Jeder Siebte gab an, keine neuen Fondsanteile zu kaufen. Zweite Frage: Was würden Sie tun, wenn der Index um 400 Punkte fällt? Da wollten fast doppelt so viele aufhören zu investieren - obwohl der Absturz des Dow identisch war. Gleiche Situation, ganz anderes Verhalten.
Rationaler Umgang mit Geld ist eine Seltenheit.
Deshalb wiederholen sich am Aktienmarkt seit Jahrhunderten die Übertreibungen, Fehleinschätzungen und Exzesse. Deshalb spekulierten die Niederländer 1637 mit Tulpenzwiebeln, bis diese so viel kosteten wie ein Einfamilienhaus. Deshalb konnte ein findiger Brite Anfang des 18. Jahrhunderts Tausende Menschen dazu bringen, sich an seiner wirren Idee finanziell zu beteiligen - der "Gesellschaft zur Durchführung eines überaus nützlichen Unternehmens, das aber noch niemand kennt". Und deshalb stürzten sich viele Tausende Kleinaktionäre noch im Jahr 2000 ins Abenteuer Neuer Markt, obwohl bereits damals das Bundeskriminalamt vor "Straftaten im Umfeld des Kapitalanlagebetruges" warnte.
"Finanzgenie ist man nur bis zum Bankrott", spottet der amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith. "Es ist eine trügerische Vorstellung, Geld und Intelligenz müssten miteinander einhergehen."
.
dann wollen wir mal wieder "reinkopieren bis die Schwarte kracht ..." - ist alle nur Werbung für Sie, verehrter Herr Warmbein ...


.
dann wollen wir mal wieder "reinkopieren bis die Schwarte kracht ..." - ist alle nur Werbung für Sie, verehrter Herr Warmbein ...



.
"kiss of goodbye" hört sich für den Dow und Dax ja toll an...Charttechnik fängt an, mir Spaß zu machen (zumindest die Begrifflichkeit)...allerdings wäre ein "kiss of death" noch besser 

tja, Sovereign, allein die "Begrifflichkeit" reicht nicht ganz ...  -
-
Frank Bulthaupt :
In der Krise auf Neuschnee achten
Es sind nicht die harten Fakten, welche die Börsen auf Talfahrt schickten, sondern die Bilder zurückliegender Crashs. Diese Bilder prägen die Vermutungen eines Investors über das Verhalten der anderen Investoren. Der Aktienmarkt 2002 zeigt: 1929 lebt.
Am 22. Oktober 1929 titelte die New York Times: "Irving Fisher hält Aktienkurse für niedrig." Zwei Tage später kam es zum Crash. Innerhalb von drei Wochen fielen die Kurse um 50 Prozent...
Abgesehen davon, dass neue Untersuchungen die Analyse des damals berühmtesten amerikanischen Ökonomen bestätigen: Das Bild "Crash 1929" war in diesem Jahr wieder allgegenwärtig. Vergleiche wurden angestellt. Es ist alles schon mal da gewesen.
Entsprechend zu Kurt Tucholsky: "Es gibt keinen Neuschnee. Wenn Du aufwärts gehst und dich hochaufatmend umsiehst, ... dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir dagewesen ... Und immer sind da Spuren, und immer ist einer dagewesen .... Und es gibt keinen Neuschnee."
Es gibt keinen Neuschnee? Ist die Börsenentwicklung nur eine Kopie ihrer eigenen Vergangenheit? In den USA hatte der Aktienmarkt von Mitte 1921 bis Herbst 1929 eine nahezu permanente Aufwärtsbewegung gezeigt. Nach einem enormem Wirtschaftswachstum von 10 Prozent bzw. 5 Prozent in den Jahren 1927 und 1928 kam es 1929 zur Abkühlung (-0,9 Prozent).
Hinzu kamen unter anderem eine Labilität des Bankwesens aufgrund leichtfertiger Kreditvergabe, die auf Dauer ungelöste Finanzierungsfrage der Leistungsbilanzdefizite einiger europäischer (!) Länder, und schließlich eine Zunahme dubioser Managementmethoden. Aber unabhängig von den Gründen: Das Bild vom Crash 1929 wirkte über Generationen weiter.
Fast 60 Jahre später, am 19. Oktober 1987, fiel der Dow Jones um 22,6 Prozent allein an einem Tag. Dies entsprach der Gesamtsumme von 480 Milliarden Dollar, mehr als dem Sozialprodukt Kanadas.
Was war passiert? Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen waren im Umfeld eines ordentlichen Wirtschaftswachstums auf über 10 Prozent angestiegen. Weitere Zinssteigerungen wurden erwartet. Als wirtschaftspolitische Unsicherheiten (hinsichtlich des Fortbestandes des so genannten Louvre-Akkords, der die Stabilisierung des Wechselkurses zum Ziel hatte) hinzukamen, setzte die Verkaufswelle ein.
Der Finanzmarktforscher Robert Shiller versuchte seinerzeit anhand von Umfragen Charakteristika des damaligen Investorenverhaltens herauszufiltern. Sein Ergebnis: 85 Prozent der institutionellen Investoren waren sich vor dem Crash einig, dass der Markt überbewertet war, folgten aber der Philosophie "the trend is your friend" oder der "good feeling" Prognosemethode.
Als die Kurse dann abrutschten und eine Korrektur einsetzte, orientierten sie sich nicht an aktuellen fundamentalen Daten, sondern an einem ihren Großeltern bekannten - singulären - Phänomen. Genauer: Sie vermuteten, dass sich andere Anleger am Crash von 1929 orientieren. Der Kursrutsch war nicht aufzuhalten.
Ist die Krise da, ist der Pessimismus nicht weit. Oder mit Goethe: Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht, stellt er sich gleich das Ende vor. Die Erwartung wurde zu einer sich selbst erfüllenden Prognose.
Aktienmärkte 2002: 1929 lebt
Und heute? Nach der Korrektur der Überbewertungsphase des Jahres 2000 sind die Börsen auf Talfahrt. Welche Bilder treiben jetzt die Märkte rund um den Atlantik? Kaum haltbare Vergleiche mit historischen KGV, Angst vor japanischen Verhältnissen, obgleich bekannt ist, dass das amerikanische wie auch das europäische Bankensystem nicht mit dem japanischen vergleichbar ist, Deflationsängste (zum Vergleich: Die jährlichen Inflationsraten zwischen 1925 und 1929, den so genannten Goldenen Zwanzigern, variierten zwischen 1,1 und –1,7 Prozent) und ein weiteres Bild: wie bereits 1987 der Crash des Jahres 1929. Wieder findet man Gründe für Übertreibungen, und die daraus resultierende Krise wird erneut zur Plazenta des Pessimismus.
Übertragung gerechtfertigt?
Gewiss drohen Risiken, konjunkturelle wie auch geopolitische. Der Konjunkturmotor im Euro-Raum stottert. Einige Parallelen zum Börsenumfeld 1929 sind erkennbar. Ist damit die Analyse abgeschlossen und eine Übertragung auf 2002 gerechtfertigt?
Blicken wir auf die harten Fakten, auf konjunkturelle und auf strukturelle Entwicklungen: Noch vor einem Jahr hatten die Wirtschaftsforscher für 2002 durchschnittlich 1,2 Prozent Wirtschaftswachstum für die USA prognostiziert (siehe Consensus Forecasts Oktober 2001). Aller Voraussicht wird sich ein reales Wachstum von etwa 2,4 Prozent ergeben. Die aktuellen Einschätzungen für 2003 variieren zwischen 2,4 und 3,7 Prozent.
Die Gewinne der Kapitalgesellschaften in den USA stiegen in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die gleiche Größenordnung ist angesichts der günstigen Kostenentwicklung für die zweite Jahreshälfte zu erwarten. Der Ausblick für 2003 liegt leicht darunter. Die Zinssätze liegen am langen Ende bei 4 Prozent in den USA und bei 4,5 Prozent in Deutschland.
Märkte sind robuster geworden
Auch das strukturelle Umfeld hat sich grundlegend geändert: Die Korrelation der Aktienmärkte zwischen USA und den europäischen Börsen hat sich seit 1929 massiv verschoben. Durch die zunehmende Integration wurden die Märkte insgesamt robuster gegenüber nationalen Schocks, dazu gehören auch Bilanzfälschungen einzelner Unternehmen.
Weiter haben einschneidende technologische Entwicklungen dazu beigetragen, dass Investoren einen umfassenderen und schnelleren Zugriff auf Informationen haben, bessere Kommunikations- und Transaktionswege zur Verfügung stehen sowie erhöhte Vertragssicherheiten vorhanden sind. Diese Entwicklung hat den Informationsstand der Marktakteure verbessert, Unsicherheiten abgebaut und Risikoprämien gesenkt.
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Krise wie 1929? Es liegt überall Neuschnee!
Frank Bulthaupt, verbindet Praxis und Forschung im Kapitalmarkt-Research. Nach seinem Mathematikstudium promovierte er über Geldpolitik und habilitierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel. Mit der Erlangung der Venia Legendi für die gesamte Volkwirtschaftslehre wechselte der Top-Ökonom zur Dresdner Bank/Allianz Group.
Modellierungen von Weltkapitalmärkten und Volkswirtschaften, Bewertung des Ist-Zustandes an den Börsen, der Blick nach vorne und die Forschungsfront – das sind die Themen von Frank Bulthaupt. Der 44-jährige lebt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen in der Nähe Frankfurts.
Quelle: manager-magazin 31.10.2002
 -
-Frank Bulthaupt :
In der Krise auf Neuschnee achten
Es sind nicht die harten Fakten, welche die Börsen auf Talfahrt schickten, sondern die Bilder zurückliegender Crashs. Diese Bilder prägen die Vermutungen eines Investors über das Verhalten der anderen Investoren. Der Aktienmarkt 2002 zeigt: 1929 lebt.
Am 22. Oktober 1929 titelte die New York Times: "Irving Fisher hält Aktienkurse für niedrig." Zwei Tage später kam es zum Crash. Innerhalb von drei Wochen fielen die Kurse um 50 Prozent...
Abgesehen davon, dass neue Untersuchungen die Analyse des damals berühmtesten amerikanischen Ökonomen bestätigen: Das Bild "Crash 1929" war in diesem Jahr wieder allgegenwärtig. Vergleiche wurden angestellt. Es ist alles schon mal da gewesen.
Entsprechend zu Kurt Tucholsky: "Es gibt keinen Neuschnee. Wenn Du aufwärts gehst und dich hochaufatmend umsiehst, ... dann entdeckst du immer Spuren im Schnee. Es ist schon einer vor dir dagewesen ... Und immer sind da Spuren, und immer ist einer dagewesen .... Und es gibt keinen Neuschnee."
Es gibt keinen Neuschnee? Ist die Börsenentwicklung nur eine Kopie ihrer eigenen Vergangenheit? In den USA hatte der Aktienmarkt von Mitte 1921 bis Herbst 1929 eine nahezu permanente Aufwärtsbewegung gezeigt. Nach einem enormem Wirtschaftswachstum von 10 Prozent bzw. 5 Prozent in den Jahren 1927 und 1928 kam es 1929 zur Abkühlung (-0,9 Prozent).
Hinzu kamen unter anderem eine Labilität des Bankwesens aufgrund leichtfertiger Kreditvergabe, die auf Dauer ungelöste Finanzierungsfrage der Leistungsbilanzdefizite einiger europäischer (!) Länder, und schließlich eine Zunahme dubioser Managementmethoden. Aber unabhängig von den Gründen: Das Bild vom Crash 1929 wirkte über Generationen weiter.
Fast 60 Jahre später, am 19. Oktober 1987, fiel der Dow Jones um 22,6 Prozent allein an einem Tag. Dies entsprach der Gesamtsumme von 480 Milliarden Dollar, mehr als dem Sozialprodukt Kanadas.
Was war passiert? Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen waren im Umfeld eines ordentlichen Wirtschaftswachstums auf über 10 Prozent angestiegen. Weitere Zinssteigerungen wurden erwartet. Als wirtschaftspolitische Unsicherheiten (hinsichtlich des Fortbestandes des so genannten Louvre-Akkords, der die Stabilisierung des Wechselkurses zum Ziel hatte) hinzukamen, setzte die Verkaufswelle ein.
Der Finanzmarktforscher Robert Shiller versuchte seinerzeit anhand von Umfragen Charakteristika des damaligen Investorenverhaltens herauszufiltern. Sein Ergebnis: 85 Prozent der institutionellen Investoren waren sich vor dem Crash einig, dass der Markt überbewertet war, folgten aber der Philosophie "the trend is your friend" oder der "good feeling" Prognosemethode.
Als die Kurse dann abrutschten und eine Korrektur einsetzte, orientierten sie sich nicht an aktuellen fundamentalen Daten, sondern an einem ihren Großeltern bekannten - singulären - Phänomen. Genauer: Sie vermuteten, dass sich andere Anleger am Crash von 1929 orientieren. Der Kursrutsch war nicht aufzuhalten.
Ist die Krise da, ist der Pessimismus nicht weit. Oder mit Goethe: Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht, stellt er sich gleich das Ende vor. Die Erwartung wurde zu einer sich selbst erfüllenden Prognose.
Aktienmärkte 2002: 1929 lebt
Und heute? Nach der Korrektur der Überbewertungsphase des Jahres 2000 sind die Börsen auf Talfahrt. Welche Bilder treiben jetzt die Märkte rund um den Atlantik? Kaum haltbare Vergleiche mit historischen KGV, Angst vor japanischen Verhältnissen, obgleich bekannt ist, dass das amerikanische wie auch das europäische Bankensystem nicht mit dem japanischen vergleichbar ist, Deflationsängste (zum Vergleich: Die jährlichen Inflationsraten zwischen 1925 und 1929, den so genannten Goldenen Zwanzigern, variierten zwischen 1,1 und –1,7 Prozent) und ein weiteres Bild: wie bereits 1987 der Crash des Jahres 1929. Wieder findet man Gründe für Übertreibungen, und die daraus resultierende Krise wird erneut zur Plazenta des Pessimismus.
Übertragung gerechtfertigt?
Gewiss drohen Risiken, konjunkturelle wie auch geopolitische. Der Konjunkturmotor im Euro-Raum stottert. Einige Parallelen zum Börsenumfeld 1929 sind erkennbar. Ist damit die Analyse abgeschlossen und eine Übertragung auf 2002 gerechtfertigt?
Blicken wir auf die harten Fakten, auf konjunkturelle und auf strukturelle Entwicklungen: Noch vor einem Jahr hatten die Wirtschaftsforscher für 2002 durchschnittlich 1,2 Prozent Wirtschaftswachstum für die USA prognostiziert (siehe Consensus Forecasts Oktober 2001). Aller Voraussicht wird sich ein reales Wachstum von etwa 2,4 Prozent ergeben. Die aktuellen Einschätzungen für 2003 variieren zwischen 2,4 und 3,7 Prozent.
Die Gewinne der Kapitalgesellschaften in den USA stiegen in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die gleiche Größenordnung ist angesichts der günstigen Kostenentwicklung für die zweite Jahreshälfte zu erwarten. Der Ausblick für 2003 liegt leicht darunter. Die Zinssätze liegen am langen Ende bei 4 Prozent in den USA und bei 4,5 Prozent in Deutschland.
Märkte sind robuster geworden
Auch das strukturelle Umfeld hat sich grundlegend geändert: Die Korrelation der Aktienmärkte zwischen USA und den europäischen Börsen hat sich seit 1929 massiv verschoben. Durch die zunehmende Integration wurden die Märkte insgesamt robuster gegenüber nationalen Schocks, dazu gehören auch Bilanzfälschungen einzelner Unternehmen.
Weiter haben einschneidende technologische Entwicklungen dazu beigetragen, dass Investoren einen umfassenderen und schnelleren Zugriff auf Informationen haben, bessere Kommunikations- und Transaktionswege zur Verfügung stehen sowie erhöhte Vertragssicherheiten vorhanden sind. Diese Entwicklung hat den Informationsstand der Marktakteure verbessert, Unsicherheiten abgebaut und Risikoprämien gesenkt.
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Krise wie 1929? Es liegt überall Neuschnee!
Frank Bulthaupt, verbindet Praxis und Forschung im Kapitalmarkt-Research. Nach seinem Mathematikstudium promovierte er über Geldpolitik und habilitierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel. Mit der Erlangung der Venia Legendi für die gesamte Volkwirtschaftslehre wechselte der Top-Ökonom zur Dresdner Bank/Allianz Group.
Modellierungen von Weltkapitalmärkten und Volkswirtschaften, Bewertung des Ist-Zustandes an den Börsen, der Blick nach vorne und die Forschungsfront – das sind die Themen von Frank Bulthaupt. Der 44-jährige lebt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen in der Nähe Frankfurts.
Quelle: manager-magazin 31.10.2002
Donnerstag, 31. Oktober 2002
1,4 Billionen Dollar durch Hypotheken-Refinanzierungen
von unserem Korrespondenten Bill Bonner
So viel Geld! Wohin fließt das alles?
Ich meine damit die 1,4 Billionen Dollar, die die Konsumenten alleine durch Refinanzierungen bestehender Hypotheken aus ihren Häusern ziehen konnten. Wenn das keinen Boom begründen kann – was sonst?
Gute Frage.
"Wenn Refinanzierungen zu einem Boom führen sollen", so Martin Bukold von Northern Trust, "warum haben wir dann noch keinen gesehen?" Stattdessen melden die Kaufhaus-Ketten zurückgehende Umsätze, und man kann in den USA in eine Shopping Mall gehen, ohne einen einzigen Käufer zu treffen.
Die Halbleiter-Aktien sind seit dem 9. Oktober um 40 % gestiegen, aber fast alle News aus dem Sektor bleiben schlecht.
Den anderen Industrien geht es nicht viel besser. Die Autoverkäufe sind rückläufig, und Experten warnen vor einer Überschätzung des kommenden Weihnachtsgeschäftes.
Alan Greenspan könnte sich nächste Woche für eine weiteren Zinssenkung entscheiden. Mehr dazu weiter unten. Und die Hypothekenbanken könnten neue, clevere Wege finden, mit denen sie ihre Kunden zu einer Erhöhung der Hypothekendarlehen veranlassen könnten – was diese armen Kunden mehr in Richtung Insolvenz stoßen würde. Aber wenn selbst 1,4 Billionen Dollar aus Refinanzierungen dieses Jahr keinen Boom ausgelöst haben – warum sollte es dann eine Milliarde im nächsten Jahr tun?
_________________________________
Donnerstag, 31. Oktober 2002
S&P 500: KGV 17 – oder 47?
von unserem Korrespondenten Eric Fry in New York
Die Konsumenten sind Menschen, keine Frage ... es fließt kein Eis durch ihre Adern, und – entgegen anderslautenden Legenden – werden sie eventuell irgendwann aufhören, Geld auszugeben, das nicht ihnen gehört. Haben Sie die jüngsten Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen mitbekommen? Der entsprechende Index fiel im Oktober sehr deutlich. Unmittelbar nach der Veröffentlichung fielen die Aktien, und die Anleihen stiegen.
Die Aussicht auf eine weiter schwächelnde Wirtschaft verstärkt die Hoffnung auf weiteren Zinssenkungen – deshalb stiegen die Kurse der Anleihen, was wiederum bedeutet, dass die Renditen zurückgingen. Die Rendite der 10jährigen amerikanischen T-Bonds fiel wieder unter die Marke von 4 %. Plötzlich steht die gefürchtete Deflation wieder vor der Tür.
Das Verbrauchervertrauen ist jetzt fünf Monate in Folge gefallen, auf ein neues 9-Jahres-Tief. Offensichtlich ist das Vertrauen der amerikanischen Konsumenten erheblich erschüttert. Der Sub-Index für die Einschätzung der aktuellen Lage fiel von 88,5 Zählern im September auf nur noch 77,5 Punkte im Oktober. Der Sub-Index für die Erwartungen der Verbraucher fiel von 97,2 auf 80,7. Trotzdem sind die Aktien zuvor den ganzen Oktober gestiegen ... aber sollte der Aktienmarkt nicht die "zukünftigen Erwartungen" wiederspiegeln? Irgendwas läuft da doch schief. Ich persönlich glaube, dass das der Aktienmarkt ist.
Die Aussicht, dass die amerikanischen Konsumenten weniger konsumieren und mehr sparen könnten, ist eine Horror-Vorstellung für jeden amerikanischen Investor. Natürlich, es wäre klug, Geld zu sparen – aber Sparen hilft der Wirtschaft nicht, zu wachsen! Das ist zumindest eine Sichtweise, die derzeit relativ populär ist. Ich sage nicht, dass ich sie teile. Nach dieser Sichtweise stellt sich die Frage: Wenn die Konsumenten nicht weiter konsumieren, wer soll es denn sonst tun? Und woher sollen dann die Unternehmensgewinne kommen?
Hier ist eine andere Frage: Sind die Unternehmensgewinne niedriger, als die meisten glauben? Die Analysten von Standard & Poor`s sagen: "Ja ... deutlich niedriger." Der Grund ist einfach: Die meisten Gesellschaften berücksichtigen bei der Berechnung ihres ausgewiesenen Gewinns gewisse versteckte Kosten wie notwendige Zahlungen für die eigenen Pensionsfonds und Aktienoptionspläne NICHT.
Ich habe Sie schon diesen Montag darauf hingewiesen, dass besonders die Verpflichtungen für die Unternehmens-Pensionsfonds immer mehr zu einer tickenden Zeitbombe für die Investoren werden. Sie sind besonders gefährlich, da sie versteckt ticken. Aber auch die Aktienoptionspläne fürs Top-Management können ein sehr großer versteckter Kostenblock sein. Um welche Dimensionen handelt es sich? Die "Kern-Gewinne", die Standard & Poor`s gerade für die Gesellschaften des S&P 500 veröffentlicht hat, lassen ungefähr die Dimensionen erahnen, um die es hier geht.
Wenn man die Ausgaben für die unternehmenseigenen Pensionsfonds, die Kosten für die Aktienoptionspläne und weitere versteckte Kostenblöcke berücksichtigt, dann kommt man laut Standard & Poor`s auf einen Kern-Gewinn für alle im S&P 500 enthaltenen Werte von 18,48 Dollar pro Aktie (für den 12-Monats-Zeitraum bis 30.6.2002). Das bleibt deutlich unter den von den Unternehmen genannten Gewinnen von 26,74 Dollar.
"Diese große Differenz kommt hauptsächlich wegen den Ausgaben für die Aktienoptionspläne und für die Pensionsfonds", so Comstock Partners. "S&P hat berechnet, dass die Aktienoptionspläne für 5,21 Dollar der Differenz verantwortlich sind, die nicht berücksichtigten Ausgaben für die Pensionsfonds machen 6,54 Dollar aus."
Mit anderen Worten: Die schönen ausgewiesenen Gewinne der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen schmelzen wie Schnee in der Sonne, wenn man genau hinschaut. "Die offiziell veröffentlichten Zahlen zeigen leider nur einen Teil der Wahrheit, und vernachlässigen den anderen Teil", so der Finanz-Autor Fred Schwed, der dies seit 60 Jahren beobachtet hat.
Dennoch schwören die meisten Wall Street-Analysten weiterhin auf ihre Schätzungen des "operativen Gewinnes" – die für die im S&P 500 insgesamt enthaltenen Gesellschaften auf eine Summe von mehr als 50 Dollar pro Aktie für 2003 kommen. Basierend auf diesen "Schätzungen" kommt der S&P 500 tatsächlich auf ein KGV `03 von "nur" 17. Diese Bewertung ist zwar im historischen Vergleich immer noch nicht billig, aber sie klingt erheblich besser als das KGV von 47, das sich errechnen würde, wenn man nur die Kern-Gewinne berücksichtigen würde.
Unglücklicherweise (für die Investoren) spiegeln die Kern-Gewinne die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung des zugrunde liegenden Unternehmens erheblich besser wieder als die sogenannten "operativen Gewinne". Lassen Sie sich von dem gut klingenden Namen nicht täuschen! Aus diesem Grund könnten viele Leute, die glauben, dass der Markt jetzt einen Boden gefunden hat, noch enttäuscht werden.
Die Chancen für einen neuen Bullenmarkt sind bei einem KGV von 17 gering. Ein Bullenmarkt, der bei einem KGV von 33 startet (dieser Wert errechnet sich, wenn man die von den Unternehmen angegebenen Gewinne als Basis nimmt) ist noch unwahrscheinlicher. Aber die Aussichten für einen neuen Bullenmarkt sind bei einem KGV von 47 einfach nur lächerlich ... aber natürlich können die Götter des Marktes das anders sehen
(investorverlag
1,4 Billionen Dollar durch Hypotheken-Refinanzierungen
von unserem Korrespondenten Bill Bonner
So viel Geld! Wohin fließt das alles?
Ich meine damit die 1,4 Billionen Dollar, die die Konsumenten alleine durch Refinanzierungen bestehender Hypotheken aus ihren Häusern ziehen konnten. Wenn das keinen Boom begründen kann – was sonst?
Gute Frage.
"Wenn Refinanzierungen zu einem Boom führen sollen", so Martin Bukold von Northern Trust, "warum haben wir dann noch keinen gesehen?" Stattdessen melden die Kaufhaus-Ketten zurückgehende Umsätze, und man kann in den USA in eine Shopping Mall gehen, ohne einen einzigen Käufer zu treffen.
Die Halbleiter-Aktien sind seit dem 9. Oktober um 40 % gestiegen, aber fast alle News aus dem Sektor bleiben schlecht.
Den anderen Industrien geht es nicht viel besser. Die Autoverkäufe sind rückläufig, und Experten warnen vor einer Überschätzung des kommenden Weihnachtsgeschäftes.
Alan Greenspan könnte sich nächste Woche für eine weiteren Zinssenkung entscheiden. Mehr dazu weiter unten. Und die Hypothekenbanken könnten neue, clevere Wege finden, mit denen sie ihre Kunden zu einer Erhöhung der Hypothekendarlehen veranlassen könnten – was diese armen Kunden mehr in Richtung Insolvenz stoßen würde. Aber wenn selbst 1,4 Billionen Dollar aus Refinanzierungen dieses Jahr keinen Boom ausgelöst haben – warum sollte es dann eine Milliarde im nächsten Jahr tun?
_________________________________
Donnerstag, 31. Oktober 2002
S&P 500: KGV 17 – oder 47?
von unserem Korrespondenten Eric Fry in New York
Die Konsumenten sind Menschen, keine Frage ... es fließt kein Eis durch ihre Adern, und – entgegen anderslautenden Legenden – werden sie eventuell irgendwann aufhören, Geld auszugeben, das nicht ihnen gehört. Haben Sie die jüngsten Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen mitbekommen? Der entsprechende Index fiel im Oktober sehr deutlich. Unmittelbar nach der Veröffentlichung fielen die Aktien, und die Anleihen stiegen.
Die Aussicht auf eine weiter schwächelnde Wirtschaft verstärkt die Hoffnung auf weiteren Zinssenkungen – deshalb stiegen die Kurse der Anleihen, was wiederum bedeutet, dass die Renditen zurückgingen. Die Rendite der 10jährigen amerikanischen T-Bonds fiel wieder unter die Marke von 4 %. Plötzlich steht die gefürchtete Deflation wieder vor der Tür.
Das Verbrauchervertrauen ist jetzt fünf Monate in Folge gefallen, auf ein neues 9-Jahres-Tief. Offensichtlich ist das Vertrauen der amerikanischen Konsumenten erheblich erschüttert. Der Sub-Index für die Einschätzung der aktuellen Lage fiel von 88,5 Zählern im September auf nur noch 77,5 Punkte im Oktober. Der Sub-Index für die Erwartungen der Verbraucher fiel von 97,2 auf 80,7. Trotzdem sind die Aktien zuvor den ganzen Oktober gestiegen ... aber sollte der Aktienmarkt nicht die "zukünftigen Erwartungen" wiederspiegeln? Irgendwas läuft da doch schief. Ich persönlich glaube, dass das der Aktienmarkt ist.
Die Aussicht, dass die amerikanischen Konsumenten weniger konsumieren und mehr sparen könnten, ist eine Horror-Vorstellung für jeden amerikanischen Investor. Natürlich, es wäre klug, Geld zu sparen – aber Sparen hilft der Wirtschaft nicht, zu wachsen! Das ist zumindest eine Sichtweise, die derzeit relativ populär ist. Ich sage nicht, dass ich sie teile. Nach dieser Sichtweise stellt sich die Frage: Wenn die Konsumenten nicht weiter konsumieren, wer soll es denn sonst tun? Und woher sollen dann die Unternehmensgewinne kommen?
Hier ist eine andere Frage: Sind die Unternehmensgewinne niedriger, als die meisten glauben? Die Analysten von Standard & Poor`s sagen: "Ja ... deutlich niedriger." Der Grund ist einfach: Die meisten Gesellschaften berücksichtigen bei der Berechnung ihres ausgewiesenen Gewinns gewisse versteckte Kosten wie notwendige Zahlungen für die eigenen Pensionsfonds und Aktienoptionspläne NICHT.
Ich habe Sie schon diesen Montag darauf hingewiesen, dass besonders die Verpflichtungen für die Unternehmens-Pensionsfonds immer mehr zu einer tickenden Zeitbombe für die Investoren werden. Sie sind besonders gefährlich, da sie versteckt ticken. Aber auch die Aktienoptionspläne fürs Top-Management können ein sehr großer versteckter Kostenblock sein. Um welche Dimensionen handelt es sich? Die "Kern-Gewinne", die Standard & Poor`s gerade für die Gesellschaften des S&P 500 veröffentlicht hat, lassen ungefähr die Dimensionen erahnen, um die es hier geht.
Wenn man die Ausgaben für die unternehmenseigenen Pensionsfonds, die Kosten für die Aktienoptionspläne und weitere versteckte Kostenblöcke berücksichtigt, dann kommt man laut Standard & Poor`s auf einen Kern-Gewinn für alle im S&P 500 enthaltenen Werte von 18,48 Dollar pro Aktie (für den 12-Monats-Zeitraum bis 30.6.2002). Das bleibt deutlich unter den von den Unternehmen genannten Gewinnen von 26,74 Dollar.
"Diese große Differenz kommt hauptsächlich wegen den Ausgaben für die Aktienoptionspläne und für die Pensionsfonds", so Comstock Partners. "S&P hat berechnet, dass die Aktienoptionspläne für 5,21 Dollar der Differenz verantwortlich sind, die nicht berücksichtigten Ausgaben für die Pensionsfonds machen 6,54 Dollar aus."
Mit anderen Worten: Die schönen ausgewiesenen Gewinne der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen schmelzen wie Schnee in der Sonne, wenn man genau hinschaut. "Die offiziell veröffentlichten Zahlen zeigen leider nur einen Teil der Wahrheit, und vernachlässigen den anderen Teil", so der Finanz-Autor Fred Schwed, der dies seit 60 Jahren beobachtet hat.
Dennoch schwören die meisten Wall Street-Analysten weiterhin auf ihre Schätzungen des "operativen Gewinnes" – die für die im S&P 500 insgesamt enthaltenen Gesellschaften auf eine Summe von mehr als 50 Dollar pro Aktie für 2003 kommen. Basierend auf diesen "Schätzungen" kommt der S&P 500 tatsächlich auf ein KGV `03 von "nur" 17. Diese Bewertung ist zwar im historischen Vergleich immer noch nicht billig, aber sie klingt erheblich besser als das KGV von 47, das sich errechnen würde, wenn man nur die Kern-Gewinne berücksichtigen würde.
Unglücklicherweise (für die Investoren) spiegeln die Kern-Gewinne die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung des zugrunde liegenden Unternehmens erheblich besser wieder als die sogenannten "operativen Gewinne". Lassen Sie sich von dem gut klingenden Namen nicht täuschen! Aus diesem Grund könnten viele Leute, die glauben, dass der Markt jetzt einen Boden gefunden hat, noch enttäuscht werden.
Die Chancen für einen neuen Bullenmarkt sind bei einem KGV von 17 gering. Ein Bullenmarkt, der bei einem KGV von 33 startet (dieser Wert errechnet sich, wenn man die von den Unternehmen angegebenen Gewinne als Basis nimmt) ist noch unwahrscheinlicher. Aber die Aussichten für einen neuen Bullenmarkt sind bei einem KGV von 47 einfach nur lächerlich ... aber natürlich können die Götter des Marktes das anders sehen
(investorverlag
.
nur mal so - zur Orientierung
"Alle 30 Dax-Unternehmen zusammen sind an der Börse inzwischen weniger wert
als nur die beiden US-Konzerne Pfizer und Exxon Mobil zusammen."
(Kai Peter Rath -Wirtschaftswoche)
nur mal so - zur Orientierung

"Alle 30 Dax-Unternehmen zusammen sind an der Börse inzwischen weniger wert
als nur die beiden US-Konzerne Pfizer und Exxon Mobil zusammen."
(Kai Peter Rath -Wirtschaftswoche)
sag mal, Freund waschbär willst Du mich hier auf die Schippe nehmen -  -, oder meinst Du es ernst
-, oder meinst Du es ernst
mit Deinem Link ?
Darauf habe ich gerade noch gewartet. Die
"Neue Solidarität" ist ein LaRouche-Forum und welche Leute sich dahinter verbergen kannst Du
in meinem Thread: CIA - MOSSAD - Harmagedon - LaRouche und Indymedia nachlesen !
Paß ein bißchen auf, mein Lieber !
Konradi
 -, oder meinst Du es ernst
-, oder meinst Du es ernstmit Deinem Link ?
Darauf habe ich gerade noch gewartet. Die
"Neue Solidarität" ist ein LaRouche-Forum und welche Leute sich dahinter verbergen kannst Du
in meinem Thread: CIA - MOSSAD - Harmagedon - LaRouche und Indymedia nachlesen !
Paß ein bißchen auf, mein Lieber !

Konradi
Sorry Konradi,
LaRouche kannte ich bis dato nur vom Hörensagen!
Daß die "Neue Solidarität" damit zusammenhängt ist mir erst seit heute bekannt. Ich war selbst (abgesehen von heute) noch nie auf diesem Forum.
Ein Grund warum ich versuche immer die Quelle einer Info mitzuliefern,...Danke für den Hinweis
LaRouche kannte ich bis dato nur vom Hörensagen!
Daß die "Neue Solidarität" damit zusammenhängt ist mir erst seit heute bekannt. Ich war selbst (abgesehen von heute) noch nie auf diesem Forum.
Ein Grund warum ich versuche immer die Quelle einer Info mitzuliefern,...Danke für den Hinweis
Niquet ist ja nicht sonderlich beliebt bei den goldbugs, nicht wahr jeffery ? -  - aber hier kann man ihm
- aber hier kann man ihm
ja mal zustimmen:
Dr. Bernd Niquet (November 2002)
Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen
Endlich gibt es Entwarnung für unsere geschundenen Anlegerseelen! Natürlich haben wir alle ein bisschen übertrieben, ein wenig überspekuliert in den goldenen Jahren vor der Jahrtausendwende, doch im Endeffekt sind wir gar nicht die Schuldigen der gegenwärtigen Malaise! Denn überall – und natürlich auch auf dieser Internetseite – wird uns gegenwärtig von prominenter Seite die Lektion übermittelt, der wahre Schuldige der gegenwärtigen Börsenkrise säße in den USA und hieße Alan Greenspan. Nur durch seine „unverantwortliche Geldpolitik“, so die Auguren, hat es nämlich die Spekulationsblase gegeben, an deren Platzen wir derzeit alle so zu knabbern haben.
„Juchhu!“ können wir nun alle laut herausschreien. Die Entwarnung ist da! „Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen.“
Doch wie kommt man eigentlich auf eine derartige These? Finden wir hier eine völlig neuartige ökonomische Theorie? Gar eine neue Form des Antiamerikanismus? Oder etwa noch viel Schlimmeres? Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen. Haben wir das nicht schon einmal ganz woanders gehört?
Vor der theoretischen Debatte sollten wir auf jeden Fall erst einmal ausgiebig jubeln:
Haben wir uns nicht vielleicht alle fürchterlich dämlich verhalten, uns von den Gegebenheiten, den Bankanalysten und Medien in so schlimmer Weise missbrauchen zu lassen? Aber Nein: Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen.
Sind wir nicht alle kollektiv in die Falle getappt, die uns unsere Gier des schnellen Reichwerdens selbst gestellt hat? Aber nein: Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen.
Unter ökonomischen Laien, die niemals eine Universität besucht haben, sowie im Kreise derjenigen, die solche Grenzfächer wie „Betriebswirtschaftslehre“ studiert haben, kursiert eine Theorie, die etwa folgendermaßen lautet:
Ist viel Geld auf der Suche nach wenig Gütern, dann gibt es Inflation – entweder in den Finanzmärkten oder in der Realwirtschaft. Ist hingegen wenig Geld auf der Suche nach vielen Gütern, dann beobachten wir das umgekehrte Phänomen, nämlich sinkende Preise in mindestens einem der beiden Bereiche.
Diese "Theorie" Theorie zu nennen, ist nun bereits ein unverdientes Kompliment. Denn hier wird nur die Quantitätsgleichung (nach der alle Umsätze in einer Volkswirtschaft stets der Geldmenge multipliziert mit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes), die eine immer geltende Identität darstellt, durch Konstantsetzung der Umlaufsgeschwindigkeit zur Schmalspur-"Theorie" umfunktioniert. Auf unser normales Leben übertragen, bedeutet diese "Theorie" in etwa das Gleiche, als wenn ich sagen würde: Da morgens stets die Sonne aufgeht, ist auf der ganzen Welt immer Vormittag.
Ich weiß, dass diese Ausführungen arrogant klingen. Doch die Wahrheit tut manchmal fürchterlich weh. Und so müssen sich denn auch die Kritiker von Alan Greenspan einmal im Ernst fragen, ob sie mit ihrer schönen "Theorie", die tatsächlich nur einen kleinen Teil der Wirtschaftswirklichkeit abbildet – nämlich den "Vormittag" – tatsächlich die Weltgeschichte richten wollen.
Der ökonomische Mittag, Nachmittag, Abend, wie auch die ökonomische Nacht, sehen nämlich völlig anders aus. Um es in der gebotenen Kürze ganz einfach auszudrücken: Durch eine expansive Geldpolitik kann man zwar in Not geratene Marktteilnehmer – im Rahmen von neuen Notenbankkrediten – vor der Pleite schützen, doch mit einer expansiven Geldpolitik kann man niemals eine Hausse initiieren. Denn die Geldpolitik wirkt in den Finanzmärkten ebenso wie in der Realwirtschaft stets nur wie ein Faden, an dem man zwar ziehen, mit dem man jedoch nichts und niemanden anschieben kann. Alan Greenspan hätte die Börsenkrise also immens verschlimmern können, eine Urheberschaft ist ihm jedoch nur von den Anhängern der Flat-Earth-Society nachzuweisen.
Doch was rege ich mich eigentlich auf? Vielleicht sollte ich mich daher lieber an die Weisheit des größten Geldtheoretiker der Neuzeit, John Maynard Keynes, halten und mit den Wölfen heulen. Denn "konventionelle Weisheit rät uns", so Keynes, "dass es besser für den Ruf ist, konventionell zu versagen, als unkonventionell erfolgreich zu sein." Also: Auch ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen. Und schon sind auch meine eigenen Verluste gleichsam in der selben Art und Weise wie diejenigen der Fondsmanager plötzlich "sozialisiert". Zumindest mental. Aber das ist doch immerhin schon etwas.
 - aber hier kann man ihm
- aber hier kann man ihmja mal zustimmen:
Dr. Bernd Niquet (November 2002)
Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen
Endlich gibt es Entwarnung für unsere geschundenen Anlegerseelen! Natürlich haben wir alle ein bisschen übertrieben, ein wenig überspekuliert in den goldenen Jahren vor der Jahrtausendwende, doch im Endeffekt sind wir gar nicht die Schuldigen der gegenwärtigen Malaise! Denn überall – und natürlich auch auf dieser Internetseite – wird uns gegenwärtig von prominenter Seite die Lektion übermittelt, der wahre Schuldige der gegenwärtigen Börsenkrise säße in den USA und hieße Alan Greenspan. Nur durch seine „unverantwortliche Geldpolitik“, so die Auguren, hat es nämlich die Spekulationsblase gegeben, an deren Platzen wir derzeit alle so zu knabbern haben.
„Juchhu!“ können wir nun alle laut herausschreien. Die Entwarnung ist da! „Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen.“
Doch wie kommt man eigentlich auf eine derartige These? Finden wir hier eine völlig neuartige ökonomische Theorie? Gar eine neue Form des Antiamerikanismus? Oder etwa noch viel Schlimmeres? Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen. Haben wir das nicht schon einmal ganz woanders gehört?
Vor der theoretischen Debatte sollten wir auf jeden Fall erst einmal ausgiebig jubeln:
Haben wir uns nicht vielleicht alle fürchterlich dämlich verhalten, uns von den Gegebenheiten, den Bankanalysten und Medien in so schlimmer Weise missbrauchen zu lassen? Aber Nein: Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen.
Sind wir nicht alle kollektiv in die Falle getappt, die uns unsere Gier des schnellen Reichwerdens selbst gestellt hat? Aber nein: Ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen.
Unter ökonomischen Laien, die niemals eine Universität besucht haben, sowie im Kreise derjenigen, die solche Grenzfächer wie „Betriebswirtschaftslehre“ studiert haben, kursiert eine Theorie, die etwa folgendermaßen lautet:
Ist viel Geld auf der Suche nach wenig Gütern, dann gibt es Inflation – entweder in den Finanzmärkten oder in der Realwirtschaft. Ist hingegen wenig Geld auf der Suche nach vielen Gütern, dann beobachten wir das umgekehrte Phänomen, nämlich sinkende Preise in mindestens einem der beiden Bereiche.
Diese "Theorie" Theorie zu nennen, ist nun bereits ein unverdientes Kompliment. Denn hier wird nur die Quantitätsgleichung (nach der alle Umsätze in einer Volkswirtschaft stets der Geldmenge multipliziert mit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes), die eine immer geltende Identität darstellt, durch Konstantsetzung der Umlaufsgeschwindigkeit zur Schmalspur-"Theorie" umfunktioniert. Auf unser normales Leben übertragen, bedeutet diese "Theorie" in etwa das Gleiche, als wenn ich sagen würde: Da morgens stets die Sonne aufgeht, ist auf der ganzen Welt immer Vormittag.
Ich weiß, dass diese Ausführungen arrogant klingen. Doch die Wahrheit tut manchmal fürchterlich weh. Und so müssen sich denn auch die Kritiker von Alan Greenspan einmal im Ernst fragen, ob sie mit ihrer schönen "Theorie", die tatsächlich nur einen kleinen Teil der Wirtschaftswirklichkeit abbildet – nämlich den "Vormittag" – tatsächlich die Weltgeschichte richten wollen.
Der ökonomische Mittag, Nachmittag, Abend, wie auch die ökonomische Nacht, sehen nämlich völlig anders aus. Um es in der gebotenen Kürze ganz einfach auszudrücken: Durch eine expansive Geldpolitik kann man zwar in Not geratene Marktteilnehmer – im Rahmen von neuen Notenbankkrediten – vor der Pleite schützen, doch mit einer expansiven Geldpolitik kann man niemals eine Hausse initiieren. Denn die Geldpolitik wirkt in den Finanzmärkten ebenso wie in der Realwirtschaft stets nur wie ein Faden, an dem man zwar ziehen, mit dem man jedoch nichts und niemanden anschieben kann. Alan Greenspan hätte die Börsenkrise also immens verschlimmern können, eine Urheberschaft ist ihm jedoch nur von den Anhängern der Flat-Earth-Society nachzuweisen.
Doch was rege ich mich eigentlich auf? Vielleicht sollte ich mich daher lieber an die Weisheit des größten Geldtheoretiker der Neuzeit, John Maynard Keynes, halten und mit den Wölfen heulen. Denn "konventionelle Weisheit rät uns", so Keynes, "dass es besser für den Ruf ist, konventionell zu versagen, als unkonventionell erfolgreich zu sein." Also: Auch ich bin´s nicht, Alan Greenspan ist es gewesen. Und schon sind auch meine eigenen Verluste gleichsam in der selben Art und Weise wie diejenigen der Fondsmanager plötzlich "sozialisiert". Zumindest mental. Aber das ist doch immerhin schon etwas.
@konradi, habe anfangs seine Kolumne gern gelesen, schreibt ja ganz unterhaltsam, bis er anfing seine Meinung so schnell zu ändern, wie der Wetterhahn auf dem Kirchturm die Richtung, da war er bei mir unten durch. Und dann noch der Titel von seinem Buch.
Liest sich so als hätte er auch Geld verloren. Ich gottseindank (noch?!) nicht.
J2
Liest sich so als hätte er auch Geld verloren. Ich gottseindank (noch?!) nicht.

J2
.
Ferdinand Lips:
Freiheit verliert man in kleinen Dosen
Initiative zur Wiedereinführung der Golddeckung in der Schweiz
Die Resultate der jüngsten Volksabstimmung in der Schweiz über den Verkauf des Goldes der Nationalbank sind anders herausgekommen, als von der Regierung gewünscht. Das Volk will den Erlös aus Goldverkäufen weder für die Altersversorgung noch für eine dubiose Solidaritätsstiftung verwenden. Jetzt muss neu überlegt werden, was mit dem Gold geschehen soll. Unter dem Aspekt des Gemeinwohls und der umsichtigen Staatslenkung wären zwei Schritte nötig: Die Nationalbank müsste die Goldverkäufe sofort einstellen, und dann sollte die frühere Golddeckung des Frankens wieder eingeführt werden. Dies muss wohl mit einer Volksinitiative zur Debatte gebracht werden.
Eine unabhängige, stabile Währung ist in Zeiten von Krisen, Finanzkollapsen und Kriegen ein Schutz für Staat und Bevölkerung vor der «Arglist der Zeit», wie der Bundesbrief von 1291 so zeitlos formulierte. Ein Zusammenbruch des unstabilen Papiergeldsystems und die Kriegskosten, welche unweigerlich mit Inflation «bezahlt» werden, könnten unerwartet rasch zu einer grossen Krise und breiter Verarmung führen.
Wie kam es zur Abschaffung der Golddeckung?
Als Folge des Beitrittes der Schweiz zum Internationalen Währungsfonds (IWF) 1992 war die Schweiz gezwungen, die in der alten Verfassung verankerte Golddeckung des Schweizerfrankens (bis dahin zu 40%) aufzugeben. Die Verfassungsänderung wurde in der ominösen neuen Bundesverfassung versteckt und trat per 1.1.2000 in Kraft. Auch die untergeordneten Gesetze und Verordnungen wurden geändert. Eine breite Diskussion über die Vor- und Nachteile der Abschaffung der Golddeckung fand nicht statt, und ich bezweifle, dass viele die Tragweite der damaligen Entscheidung wirklich ermessen konnten.
Gestützt auf diese Entwicklung begann die Schweizerische Nationalbank (SNB) 1300 Tonnen Gold, die angeblich nicht mehr als Währungsreserve benötigt wurden, zu verkaufen (bisher 600 Tonnen). Der Erlös soll verteilt werden. Die bisherigen zwei Vorschläge hat das Volk vor zwei Wochen abgelehnt.
Vorteile der Wiedereinführung der Golddeckung
Die Schweiz ist jetzt im IWF-System eingebunden. Die Schäden für das Land sind zwar noch nicht offensichtlich, aber der IWF hat in anderen Ländern eine Verwüstungsschneise in die Volkswirtschaften gehauen, wie die B-52-Bomber auf den Kriegsschauplätzen. Auf jeden Fall ist die Schweiz nicht frei, ihre Währungs- und Finanzpolitik unter Gemeinwohlaspekten selbst zu gestalten. Bei der Wiedereinführung der Golddeckung und damit dem Austritt aus dem IWF hätten wir wieder eine Währung, die international respektiert und uns Schutz und Sicherheit vor inflationären Krisen und anderen grossen Schockwellen der Weltwirtschaft bieten würde. Wir hätten wieder das vertrauenswürdigste Geld der Welt. Nichts wäre positiver für die Schweiz, ihre Bürgerinnen und Bürger und den Bankenplatz als eine solche Entwicklung.
Das Gold soll also nicht verkauft werden, sondern der Schweizerfranken soll wieder wie unter dem früheren Recht zu 40% mit Gold gedeckt sein. Damals konnte jedermann sicher sein, dass für jeden Franken mindestens 40 Rappen in purem Gold bei der Nationalbank lagerten. Da die SNB das Gold bis 1998 nur zu Fr. 4575.- pro Kilogramm in der Bilanz einsetzte, während der Goldpreis zwischen Fr. 10000.- und Fr. 15000.- pro Kilogramm schwankte, war mehr als genügend Golddeckung für jeden Franken Notenumlauf vorhanden. Dies machte unsere Währung zur besten Währung der Welt und unsere Nationalbank zu einer respektierten Grösse. Zweifellos hat der Bankenplatz Schweiz enorm von dieser Situation profitiert. Dies war auch mit Personen wie dem damaligen Präsidenten Dr. Fritz Leutwiler verbunden.
Eiserne Reserve gegen Papier tauschen?
Gold ist übrigens in den letzten 12 Monaten von rund 275 Dollar pro Unze (33 g) auf 320 Dollar pro Unze gestiegen (etwa +18%). In dieser Zeit brachen die Börsen ein, und Weltkonzerne kollabierten (Enron, Swissair). Viele andere - auch schweizerische Gesellschaften - stehen am Abgrund. Die Weltlage ist ernst, und die nächsten Jahre werden nicht heiter sein. Darum wäre es schon für einen gewöhnlichen Kaufmann nicht klug, jetzt Gold zu verkaufen, das überall als materialisierte Krisensicherheit und Wertbeständigkeit betrachtet wird. Wenn es heftig kracht, z. B. eine Grossbank kollabiert, dann passiert das nicht isoliert, dann taumelt wirtschaftlich die ganze Welt, und den Papierwährungen geht gleichzeitig die Luft aus. Als «Lender of Last Resort» (Zentralbank als letzter Retter des Bankensystems) werden dann Papiergeld-Reserven in Dollars, Euros und Yen der SNB nicht viel weiterhelfen. Dann werden sie auf das Gold zurückgreifen müssen - wenn sie es noch haben.
Verkäufe stoppen
Am Donnerstag nach der Abstimmung gab die Schweizerische Nationalbank SNB bekannt, sie werde in den nächsten 12 Monaten weitere 283 Tonnen Gold verkaufen. Sie will damit rechtzeitig die 1300 Tonnen loswerden, die sie über eine Periode von 4 Jahren verkaufen will. In Anbetracht des Abstimmungsresultates und der veränderten Situation am Goldmarkt müsste die Nationalbank eigentlich die Verkäufe stoppen und die Situation neu überdenken. Was macht die SNB, wenn der Goldpreis in ein paar Jahren viel höher ist und sie den Goldschatz zu billig verkauft hat? Die Bank von England kommt deswegen schon jetzt unter Druck, weil das Land durch seine Goldauktionen bisher etwa 500 Mio. Pfund verloren hat. Ich habe in meinem Buch «Gold Wars» zeitgeschichtlich im Detail beschrieben, wie es zu diesem Ausverkauf gekommen ist. Alles in allem handelt es sich um einen Betrug und Verrat am Schweizer Volk, um einen erstklassigen Skandal.
SNB hat schon 40% durch Goldverkäufe verloren
Es ist tragisch. Denn wir erleben hier den Niedergang einer Nation, die einstmals als «Festung Schweiz» betrachtet wurde. Solche Entwicklungen kommen jedoch nicht über Nacht, sondern passieren Schritt um Schritt. «Die Freiheit verliert man heute in kleinen Dosen», schrieb mir neulich ein amerikanischer Freund, der die Entwicklung beobachtet.
In den letzten zwei Jahren hat die SNB fast unbemerkt 603 Tonnen Gold verkauft. Den Erlös der Verkäufe steckt die SNB in Dollars, Euros, Yen oder was immer ihr gerade recht erscheint, z. B. langfristige Anleihen. Die Nationalbank hat dabei, konservativ geschätzt, etwa 500 Mio. Dollar verloren, weil der Goldpreis in dieser Zeit etwa 20% gestiegen ist. Sie hat zusätzlich schwer Volksvermögen verloren, weil diese Dollars in ihrer Truhe dieses Jahr von rund Fr. 1.80 auf jetzt etwa Fr. 1.45 abgesackt sind. Der knapp 20%ige Wertverlust ist die Quittung, weil die Welt merkt, dass das amerikanische Wirtschaftswunder der 90er Jahre gar nicht stattgefunden hat.
Mit der Politik des festen Dollars während der Ära Clinton/Rubin (Robert E. Rubin war damals Finanzminister der USA) mit einer Rekord-Geld-und-Kreditschöpfung und mit Bilanzschönung und Bilanztäuschertricks fabrizierte man die grösste Börsenmanie der Weltgeschichte. Auf diese Weise saugte die US-Finanzwirtschaft Jahr für Jahr den Grossteil der Ersparnisse der übrigen Welt nach den US-Finanzmärkten ab, wo sie nötig waren, um die Defizite zu decken. Jetzt wo die Wahrheit ans Licht kommt, fliehen viele aus dem Dollar und gehen ins Gold. Trotzdem verkauft die SNB weiter Gold. Wer kann das verstehen? Ist sie etwa fremdbestimmt? Auf wen hören unsere Regierung und die Finanzspitzen? Sind sie bloss gutgläubig naiv oder gar Teil des Problems?
SNB am Führungsfaden von New York?
Meiner Meinung nach ist die einstmals starke, stolze und unabhängige SNB eine «Offshore-Filiale» der US-Notenbank (FED) geworden und rapportiert direkt an Sir Alan Greenspan und seine Boys in New York. Der Schweizerfranken, die letzte Bastion einer «relativ» starken Währung, ist zerstört worden, und zum ersten Mal in ihrer Geschichte schwimmt jetzt die ganze Welt auf einem Meer von Papiergeld. Das kann nicht gutgehen. Aber wir können es wieder ändern, sofern wir wollen.
Während die SNB tagtäglich unser Gold verkauft, denken ostasiatische Zentralbanken viel weitsichtiger und kaufen Gold zu den jetzigen nach wie vor tiefen Marktpreisen. Sie tauschen somit ihr Papiergeld gegen Gold zum Preis von Fr. 15000.- pro Kilogramm, um eine Notreserve zu haben, wenn die Märkte krachen. Sind die Ostasiaten schlauer, und warum tun sie das? Die Geschichte hat schon immer gezeigt, dass Länder, die Gold verkaufen, wirtschaftlich und politisch an Bedeutung verlieren. Darum geht es. Hier läuft eindeutig und auf bedenkliche Art und Weise der finanzpolitische Teil des Ausverkaufs des Modells Schweiz.
Nicht viele verstehen die Bedeutung der Golddeckung oder gar des Goldstandards heute, aber wenn jetzt nicht Einhalt geboten wird, wird die Schweiz eines Tages in der Krise aufwachen, nackt dastehen, ausgeliefert sein und ihren Riesenfehler einsehen. Die enorme Konsequenz dieses sinnlosen Ausverkaufs wird sein, dass unser Land dabei seine Unabhängigkeit und finanzielle Stärke verliert. Unze um Unze werden unsere Freiheit und die Sicherheit verkauft. Es wäre besser, jetzt darüber nachzudenken. Jetzt haben wir nämlich noch Spielraum.
Zwei Prognosen
Erstens: Die Schweizer Goldverkäufe werden sicher den New Yorker Banken helfen, noch etwas länger zu überleben. Es wird ihnen helfen, den Goldmarkt weiter zu manipulieren. Aber die Zeit des Goldes wird kommen. Und wenn die SNB die Verkäufe nicht stoppt, wird die Schweiz eines Tages ihr Gold zurückkaufen müssen, jedoch zu viel höheren Preisen, aber womit?
Zweitens: Der Bankenplatz Schweiz wird immer mehr seinen Status als sicheren Hafen in Krisenzeiten verlieren. Damit geht für die Schweizer Wirtschaft enorm viel verloren. Eines aber ist ganz sicher: Die Schweiz wird ihre Unabhängigkeit und ihre finanzielle Stärke und Prosperität für immer verlieren. Dies ist in der Tat ein sehr trauriger Ausblick.
Warum man dagegen sein kann?
Noch ein Wort zu denjenigen, die diesen Vorschlag ablehnen werden. Die Kantone schielen auf das viele Geld der SNB. Von deren Gewinn stehen ihnen nach der Verfassung zwei Drittel zu. Das Schielen ist verständlich, denn die Kantone sind in Geldnot. Sie liessen sich - wie der Bund und viele andere Staaten - zum Schuldenmachen, zur Defizitwirtschaft verleiten. Sie gaben Geld aus, das sie nicht hatten, Geld, das künftige Generationen erst in Form von Steuern bezahlen sollen. (Ich schäme mich, der Jugend dieses Erbe zu hinterlassen). Jetzt drücken Schuldenberge und Zinslast. Früher konnten Politiker mit dem Verteilen von geborgtem Geld punkten und ihre Klientel zufriedenstellen. Aber jetzt, wo der Tag der Wahrheit näherkommt, haben sie natürlich viel Musikgehör, wenn ihnen jemand Geld verspricht, das wie Manna vom Himmel der SNB kommen soll.
Dieses Denken ist ebenso kurzfristig wie die frühere Schuldenwirtschaft.
Selbst wenn man das Gold zum Abbau der Schulden von Bund und Kantonen einsetzen würde, wäre die Währung nachher trotzdem ein Spielball, und von den 200 Milliarden Franken Schulden (Bund und Kantone!) könnte auch nur ein geringer Teil zurückgezahlt werden.
Heute hilft nur eines. Man muss den Fakten in die Augen sehen und solide und langfristig wirtschaften. Staat und Private, die auf zu grossem Fuss leben, müssen sich einschränken, auch wenn diejenigen murren werden, die von guten Staatsgehältern leben, aber nichts zur Res publica beitragen, sondern sie zersetzen, wie zum Beispiel viele der sogenannten Kulturschaffenden.
Golddeckung wieder einführen, IWF auflösen, ehrliche Lösungen
Wir müssen zurück zu ehrlichem Geld und sauberen Lösungen. Vorerst soll Druck gemacht werden auf die Nationalbank, die Goldverkäufe zumindest für eine Denkpause zu stoppen. Diese Denkpause muss genutzt werden, die Golddeckung und den Austritt aus dem IWF im Lichte der heutigen Weltlage und der Erfahrungen der Geschichte zu prüfen. In den USA gibt es immer wieder Vorstösse von namhaften Finanz- und Bankexperten, den IWF aufzulösen, ich bin damit nicht alleine.
Bei uns ist die Volksinitiative das ehrlichste Mittel, die Diskussion in der Breite zu führen. Auch wenn es eine Weile dauert, so ist es für viele eine Chance, zur Besinnung zu kommen. Unabhängig fährt die Schweiz besser denn als Teil des internationalen Papiergeld-Manipulations-Kartells. Als ehemaligem Bankier ist es mir und vielen meiner Kollegen, die im Laufe ihrer Karriere nicht zynisch geworden sind und die gleich denken wie ich, nicht egal - keinem von uns -, dass so viele ehrliche Menschen, die nichts ahnen, durch mangelnde Voraussicht der Regierenden schon bald um ihre Ersparnisse und Renten gebracht werden. Hoffen wir, dass es genug weitsichtig denkende Menschen gibt, die mit mir der Meinung sind, dass die Nationalbank ein grausames Spiel betreibt, das besser gestoppt wird, bevor es zu spät ist.
Gold ist Geld, und alles andere ist Kredit.
Ferdinand Lips, 1931 in der Schweiz geboren, ist eine angesehene und respektierte Persönlichkeit im Bereich Gold und Goldhandel. Lips war Mitgründer der Rothschild-Bank in Zürich. 1987 eröffnete er, ebenfalls in Zürich, mit der Bank Lips AG seine eigene Bank. 1998 zog er sich aus dem Bankgeschäft zurück. Heute sitzt er im Vorstand verschiedener Firmen, darunter afrikanische Goldminenfirmen. Ausserdem verwaltet er die «Foundation for the Advancement of Monetary Education» (FAME) in New York. Dort wurde auch sein aktuelles Buch herausgegeben: Gold Wars, The Battle Against Sound Money As Seen From A Swiss Perspective (Foundation for the Advancement of Monetary Education, 2001, 304 Seiten, ISBN 0-9710380-0-7), in dem Lips entschieden für die Wiedereinführung des Goldstandards eintritt.
.
Ferdinand Lips:
Freiheit verliert man in kleinen Dosen
Initiative zur Wiedereinführung der Golddeckung in der Schweiz
Die Resultate der jüngsten Volksabstimmung in der Schweiz über den Verkauf des Goldes der Nationalbank sind anders herausgekommen, als von der Regierung gewünscht. Das Volk will den Erlös aus Goldverkäufen weder für die Altersversorgung noch für eine dubiose Solidaritätsstiftung verwenden. Jetzt muss neu überlegt werden, was mit dem Gold geschehen soll. Unter dem Aspekt des Gemeinwohls und der umsichtigen Staatslenkung wären zwei Schritte nötig: Die Nationalbank müsste die Goldverkäufe sofort einstellen, und dann sollte die frühere Golddeckung des Frankens wieder eingeführt werden. Dies muss wohl mit einer Volksinitiative zur Debatte gebracht werden.
Eine unabhängige, stabile Währung ist in Zeiten von Krisen, Finanzkollapsen und Kriegen ein Schutz für Staat und Bevölkerung vor der «Arglist der Zeit», wie der Bundesbrief von 1291 so zeitlos formulierte. Ein Zusammenbruch des unstabilen Papiergeldsystems und die Kriegskosten, welche unweigerlich mit Inflation «bezahlt» werden, könnten unerwartet rasch zu einer grossen Krise und breiter Verarmung führen.
Wie kam es zur Abschaffung der Golddeckung?
Als Folge des Beitrittes der Schweiz zum Internationalen Währungsfonds (IWF) 1992 war die Schweiz gezwungen, die in der alten Verfassung verankerte Golddeckung des Schweizerfrankens (bis dahin zu 40%) aufzugeben. Die Verfassungsänderung wurde in der ominösen neuen Bundesverfassung versteckt und trat per 1.1.2000 in Kraft. Auch die untergeordneten Gesetze und Verordnungen wurden geändert. Eine breite Diskussion über die Vor- und Nachteile der Abschaffung der Golddeckung fand nicht statt, und ich bezweifle, dass viele die Tragweite der damaligen Entscheidung wirklich ermessen konnten.
Gestützt auf diese Entwicklung begann die Schweizerische Nationalbank (SNB) 1300 Tonnen Gold, die angeblich nicht mehr als Währungsreserve benötigt wurden, zu verkaufen (bisher 600 Tonnen). Der Erlös soll verteilt werden. Die bisherigen zwei Vorschläge hat das Volk vor zwei Wochen abgelehnt.
Vorteile der Wiedereinführung der Golddeckung
Die Schweiz ist jetzt im IWF-System eingebunden. Die Schäden für das Land sind zwar noch nicht offensichtlich, aber der IWF hat in anderen Ländern eine Verwüstungsschneise in die Volkswirtschaften gehauen, wie die B-52-Bomber auf den Kriegsschauplätzen. Auf jeden Fall ist die Schweiz nicht frei, ihre Währungs- und Finanzpolitik unter Gemeinwohlaspekten selbst zu gestalten. Bei der Wiedereinführung der Golddeckung und damit dem Austritt aus dem IWF hätten wir wieder eine Währung, die international respektiert und uns Schutz und Sicherheit vor inflationären Krisen und anderen grossen Schockwellen der Weltwirtschaft bieten würde. Wir hätten wieder das vertrauenswürdigste Geld der Welt. Nichts wäre positiver für die Schweiz, ihre Bürgerinnen und Bürger und den Bankenplatz als eine solche Entwicklung.
Das Gold soll also nicht verkauft werden, sondern der Schweizerfranken soll wieder wie unter dem früheren Recht zu 40% mit Gold gedeckt sein. Damals konnte jedermann sicher sein, dass für jeden Franken mindestens 40 Rappen in purem Gold bei der Nationalbank lagerten. Da die SNB das Gold bis 1998 nur zu Fr. 4575.- pro Kilogramm in der Bilanz einsetzte, während der Goldpreis zwischen Fr. 10000.- und Fr. 15000.- pro Kilogramm schwankte, war mehr als genügend Golddeckung für jeden Franken Notenumlauf vorhanden. Dies machte unsere Währung zur besten Währung der Welt und unsere Nationalbank zu einer respektierten Grösse. Zweifellos hat der Bankenplatz Schweiz enorm von dieser Situation profitiert. Dies war auch mit Personen wie dem damaligen Präsidenten Dr. Fritz Leutwiler verbunden.
Eiserne Reserve gegen Papier tauschen?
Gold ist übrigens in den letzten 12 Monaten von rund 275 Dollar pro Unze (33 g) auf 320 Dollar pro Unze gestiegen (etwa +18%). In dieser Zeit brachen die Börsen ein, und Weltkonzerne kollabierten (Enron, Swissair). Viele andere - auch schweizerische Gesellschaften - stehen am Abgrund. Die Weltlage ist ernst, und die nächsten Jahre werden nicht heiter sein. Darum wäre es schon für einen gewöhnlichen Kaufmann nicht klug, jetzt Gold zu verkaufen, das überall als materialisierte Krisensicherheit und Wertbeständigkeit betrachtet wird. Wenn es heftig kracht, z. B. eine Grossbank kollabiert, dann passiert das nicht isoliert, dann taumelt wirtschaftlich die ganze Welt, und den Papierwährungen geht gleichzeitig die Luft aus. Als «Lender of Last Resort» (Zentralbank als letzter Retter des Bankensystems) werden dann Papiergeld-Reserven in Dollars, Euros und Yen der SNB nicht viel weiterhelfen. Dann werden sie auf das Gold zurückgreifen müssen - wenn sie es noch haben.
Verkäufe stoppen
Am Donnerstag nach der Abstimmung gab die Schweizerische Nationalbank SNB bekannt, sie werde in den nächsten 12 Monaten weitere 283 Tonnen Gold verkaufen. Sie will damit rechtzeitig die 1300 Tonnen loswerden, die sie über eine Periode von 4 Jahren verkaufen will. In Anbetracht des Abstimmungsresultates und der veränderten Situation am Goldmarkt müsste die Nationalbank eigentlich die Verkäufe stoppen und die Situation neu überdenken. Was macht die SNB, wenn der Goldpreis in ein paar Jahren viel höher ist und sie den Goldschatz zu billig verkauft hat? Die Bank von England kommt deswegen schon jetzt unter Druck, weil das Land durch seine Goldauktionen bisher etwa 500 Mio. Pfund verloren hat. Ich habe in meinem Buch «Gold Wars» zeitgeschichtlich im Detail beschrieben, wie es zu diesem Ausverkauf gekommen ist. Alles in allem handelt es sich um einen Betrug und Verrat am Schweizer Volk, um einen erstklassigen Skandal.
SNB hat schon 40% durch Goldverkäufe verloren
Es ist tragisch. Denn wir erleben hier den Niedergang einer Nation, die einstmals als «Festung Schweiz» betrachtet wurde. Solche Entwicklungen kommen jedoch nicht über Nacht, sondern passieren Schritt um Schritt. «Die Freiheit verliert man heute in kleinen Dosen», schrieb mir neulich ein amerikanischer Freund, der die Entwicklung beobachtet.
In den letzten zwei Jahren hat die SNB fast unbemerkt 603 Tonnen Gold verkauft. Den Erlös der Verkäufe steckt die SNB in Dollars, Euros, Yen oder was immer ihr gerade recht erscheint, z. B. langfristige Anleihen. Die Nationalbank hat dabei, konservativ geschätzt, etwa 500 Mio. Dollar verloren, weil der Goldpreis in dieser Zeit etwa 20% gestiegen ist. Sie hat zusätzlich schwer Volksvermögen verloren, weil diese Dollars in ihrer Truhe dieses Jahr von rund Fr. 1.80 auf jetzt etwa Fr. 1.45 abgesackt sind. Der knapp 20%ige Wertverlust ist die Quittung, weil die Welt merkt, dass das amerikanische Wirtschaftswunder der 90er Jahre gar nicht stattgefunden hat.
Mit der Politik des festen Dollars während der Ära Clinton/Rubin (Robert E. Rubin war damals Finanzminister der USA) mit einer Rekord-Geld-und-Kreditschöpfung und mit Bilanzschönung und Bilanztäuschertricks fabrizierte man die grösste Börsenmanie der Weltgeschichte. Auf diese Weise saugte die US-Finanzwirtschaft Jahr für Jahr den Grossteil der Ersparnisse der übrigen Welt nach den US-Finanzmärkten ab, wo sie nötig waren, um die Defizite zu decken. Jetzt wo die Wahrheit ans Licht kommt, fliehen viele aus dem Dollar und gehen ins Gold. Trotzdem verkauft die SNB weiter Gold. Wer kann das verstehen? Ist sie etwa fremdbestimmt? Auf wen hören unsere Regierung und die Finanzspitzen? Sind sie bloss gutgläubig naiv oder gar Teil des Problems?
SNB am Führungsfaden von New York?
Meiner Meinung nach ist die einstmals starke, stolze und unabhängige SNB eine «Offshore-Filiale» der US-Notenbank (FED) geworden und rapportiert direkt an Sir Alan Greenspan und seine Boys in New York. Der Schweizerfranken, die letzte Bastion einer «relativ» starken Währung, ist zerstört worden, und zum ersten Mal in ihrer Geschichte schwimmt jetzt die ganze Welt auf einem Meer von Papiergeld. Das kann nicht gutgehen. Aber wir können es wieder ändern, sofern wir wollen.
Während die SNB tagtäglich unser Gold verkauft, denken ostasiatische Zentralbanken viel weitsichtiger und kaufen Gold zu den jetzigen nach wie vor tiefen Marktpreisen. Sie tauschen somit ihr Papiergeld gegen Gold zum Preis von Fr. 15000.- pro Kilogramm, um eine Notreserve zu haben, wenn die Märkte krachen. Sind die Ostasiaten schlauer, und warum tun sie das? Die Geschichte hat schon immer gezeigt, dass Länder, die Gold verkaufen, wirtschaftlich und politisch an Bedeutung verlieren. Darum geht es. Hier läuft eindeutig und auf bedenkliche Art und Weise der finanzpolitische Teil des Ausverkaufs des Modells Schweiz.
Nicht viele verstehen die Bedeutung der Golddeckung oder gar des Goldstandards heute, aber wenn jetzt nicht Einhalt geboten wird, wird die Schweiz eines Tages in der Krise aufwachen, nackt dastehen, ausgeliefert sein und ihren Riesenfehler einsehen. Die enorme Konsequenz dieses sinnlosen Ausverkaufs wird sein, dass unser Land dabei seine Unabhängigkeit und finanzielle Stärke verliert. Unze um Unze werden unsere Freiheit und die Sicherheit verkauft. Es wäre besser, jetzt darüber nachzudenken. Jetzt haben wir nämlich noch Spielraum.
Zwei Prognosen
Erstens: Die Schweizer Goldverkäufe werden sicher den New Yorker Banken helfen, noch etwas länger zu überleben. Es wird ihnen helfen, den Goldmarkt weiter zu manipulieren. Aber die Zeit des Goldes wird kommen. Und wenn die SNB die Verkäufe nicht stoppt, wird die Schweiz eines Tages ihr Gold zurückkaufen müssen, jedoch zu viel höheren Preisen, aber womit?
Zweitens: Der Bankenplatz Schweiz wird immer mehr seinen Status als sicheren Hafen in Krisenzeiten verlieren. Damit geht für die Schweizer Wirtschaft enorm viel verloren. Eines aber ist ganz sicher: Die Schweiz wird ihre Unabhängigkeit und ihre finanzielle Stärke und Prosperität für immer verlieren. Dies ist in der Tat ein sehr trauriger Ausblick.
Warum man dagegen sein kann?
Noch ein Wort zu denjenigen, die diesen Vorschlag ablehnen werden. Die Kantone schielen auf das viele Geld der SNB. Von deren Gewinn stehen ihnen nach der Verfassung zwei Drittel zu. Das Schielen ist verständlich, denn die Kantone sind in Geldnot. Sie liessen sich - wie der Bund und viele andere Staaten - zum Schuldenmachen, zur Defizitwirtschaft verleiten. Sie gaben Geld aus, das sie nicht hatten, Geld, das künftige Generationen erst in Form von Steuern bezahlen sollen. (Ich schäme mich, der Jugend dieses Erbe zu hinterlassen). Jetzt drücken Schuldenberge und Zinslast. Früher konnten Politiker mit dem Verteilen von geborgtem Geld punkten und ihre Klientel zufriedenstellen. Aber jetzt, wo der Tag der Wahrheit näherkommt, haben sie natürlich viel Musikgehör, wenn ihnen jemand Geld verspricht, das wie Manna vom Himmel der SNB kommen soll.
Dieses Denken ist ebenso kurzfristig wie die frühere Schuldenwirtschaft.
Selbst wenn man das Gold zum Abbau der Schulden von Bund und Kantonen einsetzen würde, wäre die Währung nachher trotzdem ein Spielball, und von den 200 Milliarden Franken Schulden (Bund und Kantone!) könnte auch nur ein geringer Teil zurückgezahlt werden.
Heute hilft nur eines. Man muss den Fakten in die Augen sehen und solide und langfristig wirtschaften. Staat und Private, die auf zu grossem Fuss leben, müssen sich einschränken, auch wenn diejenigen murren werden, die von guten Staatsgehältern leben, aber nichts zur Res publica beitragen, sondern sie zersetzen, wie zum Beispiel viele der sogenannten Kulturschaffenden.
Golddeckung wieder einführen, IWF auflösen, ehrliche Lösungen
Wir müssen zurück zu ehrlichem Geld und sauberen Lösungen. Vorerst soll Druck gemacht werden auf die Nationalbank, die Goldverkäufe zumindest für eine Denkpause zu stoppen. Diese Denkpause muss genutzt werden, die Golddeckung und den Austritt aus dem IWF im Lichte der heutigen Weltlage und der Erfahrungen der Geschichte zu prüfen. In den USA gibt es immer wieder Vorstösse von namhaften Finanz- und Bankexperten, den IWF aufzulösen, ich bin damit nicht alleine.
Bei uns ist die Volksinitiative das ehrlichste Mittel, die Diskussion in der Breite zu führen. Auch wenn es eine Weile dauert, so ist es für viele eine Chance, zur Besinnung zu kommen. Unabhängig fährt die Schweiz besser denn als Teil des internationalen Papiergeld-Manipulations-Kartells. Als ehemaligem Bankier ist es mir und vielen meiner Kollegen, die im Laufe ihrer Karriere nicht zynisch geworden sind und die gleich denken wie ich, nicht egal - keinem von uns -, dass so viele ehrliche Menschen, die nichts ahnen, durch mangelnde Voraussicht der Regierenden schon bald um ihre Ersparnisse und Renten gebracht werden. Hoffen wir, dass es genug weitsichtig denkende Menschen gibt, die mit mir der Meinung sind, dass die Nationalbank ein grausames Spiel betreibt, das besser gestoppt wird, bevor es zu spät ist.
Gold ist Geld, und alles andere ist Kredit.
Ferdinand Lips, 1931 in der Schweiz geboren, ist eine angesehene und respektierte Persönlichkeit im Bereich Gold und Goldhandel. Lips war Mitgründer der Rothschild-Bank in Zürich. 1987 eröffnete er, ebenfalls in Zürich, mit der Bank Lips AG seine eigene Bank. 1998 zog er sich aus dem Bankgeschäft zurück. Heute sitzt er im Vorstand verschiedener Firmen, darunter afrikanische Goldminenfirmen. Ausserdem verwaltet er die «Foundation for the Advancement of Monetary Education» (FAME) in New York. Dort wurde auch sein aktuelles Buch herausgegeben: Gold Wars, The Battle Against Sound Money As Seen From A Swiss Perspective (Foundation for the Advancement of Monetary Education, 2001, 304 Seiten, ISBN 0-9710380-0-7), in dem Lips entschieden für die Wiedereinführung des Goldstandards eintritt.
.
.
Paul Krugman :
Der amerikanische Albtraum
Nachdruck aus dem "New York Times Magazine" vom 20. Oktober 2002
Aus dem Amerikanischen von Sandra Pfister
Als ich ein Teenager war und auf Long Island nahe New York lebte, machte ich oft Ausflüge zu den Villen an der Nordküste. Diese Villen waren Monumente eines vergangenen Zeitalters, in der sich die Reichen ganze Armeen von Sklaven leisten konnten. Die brauchte man auch, um Häuser von der Größe europäischer Paläste zu unterhalten. Als ich diese Häuser sah, war diese Ära, die wir heute das Goldene Zeitalter nennen, längst Vergangenheit. Kaum eine der Villen auf Long Island war noch in Privatbesitz. Entweder waren sie zu Museen umfunktioniert worden, oder sie wurden als Kindergärten oder Privatschulen genutzt.
Denn das Amerika der fünfziger und sechziger Jahre, in dem ich aufwuchs, war eine Mittelklassegesellschaft. Die großen Einkommens- und Wohlstandsunterschiede des Goldenen Zeitalters waren verschwunden. Natürlich lebte so mancher reiche Geschäftsmann oder Erbe weit besser als der durchschnittliche Amerikaner. Aber sie waren auf eine andere Weise reich als die Räuberbarone, die sich um die Jahrhundertwende riesige Villen hatten bauen lassen, und sie waren nicht so zahlreich. Die Tage, in denen Plutokraten eine wichtige Rolle in der amerikanischen Gesellschaft gespielt hatten, politisch wie ökonomisch, schienen passé.
Die tägliche Erfahrung vermittelte uns den Eindruck, in einer einigermaßen gleichen Gesellschaft zu leben. Die wirtschaftlichen Disparitäten waren nicht besonders ausgeprägt. Berufstätige mit höherer Ausbildung - Manager der mittleren Ebene, Lehrer, sogar Anwälte - behaupteten oft, weniger zu verdienen als gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. Wer als wohlhabend galt, ließ sich einmal pro Woche eine Putzfrau kommen und verbrachte den Sommerurlaub in Europa. Aber auch diese Wohlhabenden schickten ihre Kinder in öffentliche Schulen und fuhren im eigenen Auto zur Arbeit so wie jeder andere auch.
Doch das ist lange her. Heute leben wir wieder in einem Goldenen Zeitalter - ähnlich extravagant wie das Original. Villen und Paläste erleben ihr Comeback. 1999 porträtierte das New York Times Magazine den Architekten Thierry Despont, die "Eminenz des Exzesses", der darauf spezialisiert ist, Häuser für die Superreichen zu gestalten. Seine Kreationen entstehen gewöhnlich auf einer Fläche von 2000 bis 6000 Quadratmetern; Häuser am oberen Ende dieser Skala sind kaum kleiner als das Weiße Haus. Natürlich sind auch die Armeen von Bediensteten zurückgekehrt. Ebenso die Yachten.
Nur wenigen Leuten ist bewusst, wie sehr sich in diesem Land die Kluft zwischen den sehr Reichen und dem Rest innerhalb relativ kurzer Zeit verbreitert hat. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, setzt sich unweigerlich dem Verdacht aus, "Klassenkampf" oder eine "Politik des Neides" zu betreiben. Und nur wenige Leute sind tatsächlich willens, über die weitgehenden Auswirkungen dieser sich immer weiter öffnenden Schere zu sprechen - ökonomische, soziale und politische Auswirkungen.
Doch was in den USA heute geschieht, kann nur verstehen, wer das Ausmaß, die Ursachen und Konsequenzen der zunehmenden Ungleichheit in den letzten drei Jahrzehnten begreift. Wer begreifen will, wieso es in Amerika trotz allen ökonomischen Erfolgs mehr Armut gibt als in jeder anderen großen Industrienation, der muss sich die Einkommenskonzentration an der Spitze ansehen.
I. Das neue Goldene Zeitalter
Das Durcheinander beim Ausscheiden von Jack Welch als Chef des US-Konzerns General Electric hatte einen positiven Nebeneffekt: Es gab Einblick in die Sozialleistungen, die die Wirtschaftselite einstreicht und die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleiben. Wie sich herausstellte, wurde Welch die lebenslange Nutzung eines Apartments in Manhattan (inklusive Essen, Wein und Wäsche) gewährt, ebenso die Nutzung von Firmenjets und einige andere geldwerte Vorteile im Wert von mindestens zwei Millionen Dollar pro Jahr. Diese Abfindung veranschaulicht, wie sehr Firmenlenker mittlerweile erwarten, ähnlich königlichen Hoheiten des Ancien Régime behandelt zu werden. Finanziell dürften diese Sonderleistungen Welch wenig bedeutet haben. Im Jahr 2000, seinem letzten kompletten Dienstjahr bei General Electric, bezog er ein Einkommen von 123 Millionen Dollar.
Man mag einwenden, es sei nichts Neues, dass die Chefs amerikanischer Konzerne eine Menge Geld kassieren. Aber es ist neu. Zwar waren sie im Vergleich zum durchschnittlichen Arbeiter immer schon gut bezahlt, doch was ein Manager vor 30 Jahren verdiente und was er heute verdient, ist nicht zu vergleichen.
In den vergangenen drei Jahrzehnten sind die Gehälter der meisten US-Bürger nur moderat gestiegen: Das durchschnittliche jährliche Einkommen wuchs inflationsbereinigt von 32 522 Dollar im Jahr 1970 auf 35 864 Dollar 1999. Zehn Prozent in 29 Jahren - ein Fortschritt, wenn auch ein bescheidener. Glaubt man dem Fortune Magazine, stiegen in derselben Zeit die Jahresgehälter der Firmenchefs der 100 größten US-Unternehmen aber von 1,3 Millionen Dollar - dem 39fachen des Gehaltes eines durchschnittlichen Arbeiters - auf 37,5 Millionen Dollar, dem mehr als 1000fachen Lohn eines normalen Arbeitnehmers.
Diese Explosion der Vorstandsgehälter in den vergangenen 30 Jahren ist an sich schon erstaunlich. Aber sie deutet nur auf einen größeren Zusammenhang hin: die erneute Konzentration von Einkommen und Wohlstand in den USA.
Offizielle Erhebungen belegen, dass ein wachsender Einkommensanteil an die oberen 20 Prozent der Familien fließt, und innerhalb dieser Schicht besonders an die obersten fünf Prozent, während die Familien in der Mitte immer weniger abbekommen. Dies sind die Fakten. Trotzdem beschäftigt sich eine ganze, gut finanzierte Industrie damit, sie zu leugnen. Konservative Denkfabriken produzieren reihenweise Studien, die diese Daten, die Methoden ihrer Erhebung und die Motive jener Statistiker diskreditieren sollen, die doch nur das Offensichtliche berichten. Vor vier Jahre hielt Alan Greenspan - wer konnte diesen Mann ernsthaft für objektiv halten? - eine Rede bei der Konferenz der US-Notenbank in Jackson Hole. Die Rede war ein einziger Versuch, die reale Zunahme von Ungleichheit in Amerika abzustreiten.
Tatsächlich jedoch haben Studien, die sich seriös um das Aufspüren hoher Einkommen bemühen, zu erschreckenden Ergebnisse geführt. Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des unabhängigen Haushaltsamts des amerikanischen Kongresses hat beispielsweise Daten zur Einkommensteuer und andere Quellen herangezogen, um die bisherigen Schätzungen zu verbessern. Dabei stellte sich heraus, dass zwischen 1979 und 1997 die Nettoeinkommen des obersten Prozents der Bestverdienenden um 157 Prozent stiegen - gegenüber zehn Prozent bei den durchschnittlichen Einkommen. Noch aufrüttelnder sind die Ergebnisse einer Studie von Thomas Piketty und Emmanuel Saez vom französischen Forschungsinstitut Cepremap. Piketty und Saez nutzten Daten aus der Erhebung der Einkommensteuer, um die Einkommen von Wohlhabenden, Reichen und sehr Reichen bis zurück ins Jahr 1913 zu schätzen.
Aus diesen Berechnungen kann man einiges lernen. Zunächst, dass das Amerika meiner Jugend weniger als normaler Zustand unserer Gesellschaft gelten sollte, sondern eher als Interregnum zwischen zwei Goldenen Zeitaltern. In der amerikanischen Gesellschaft vor 1930 kontrollierten wenige Superreiche einen Großteil des Wohlstandes. Eine Mittelklassegesellschaft wurden wir erst, nachdem sich die Einkommenskonzentration während des New Deal von Präsident Franklin D. Roosevelt und besonders während des Zweiten Weltkriegs auflöste. Die Wirtschaftshistoriker Claudia Goldin und Robert Margo haben die Verengung der Einkommenskluft während dieser Jahre "Great Compression", Große Kompression, getauft. Bis in die siebziger Jahre blieben die Einkommen relativ gleichmäßig verteilt: Der rapide Anstieg der Einkommen der ersten Nachkriegsgeneration verteilte sich gleichmäßig auf die Gesamtbevölkerung.
Seit den siebziger Jahren klaffen die Einkommen allerdings zunehmend auseinander. Und die großen Gewinner sind die Superreichen. Ein häufig gebrauchter Trick, um die wachsende Ungleichheit herunterzuspielen, ist der Rückgriff auf relativ grobe statistische Aufschlüsselungen. Ein konservativer Kommentator wird zwar zum Beispiel einräumen, dass tatsächlich die obersten zehn Prozent der Steuerzahler einen immer höheren Anteil am nationalen Einkommen abbekommen. Aber dann kann er gelassen darauf verweisen, dass bereits ein Einkommen von 81 000 Dollar aufwärts zu diesen zehn Prozent zählt. Demnach reden wir nur von Einkommensverschiebungen innerhalb der Mittelschicht, oder?
Falsch. Die oberen zehn Prozent umfassen zwar tatsächlich eine Menge Leute, die wir der Mittelklasse zuordnen würden. Sie aber waren nicht die großen Gewinner. In Wahrheit profitierte das oberste eine Prozent der bestverdienenden zehn Prozent vom Einkommenszuwachs mehr als die folgenden neun Prozent der Steuerzahler. 1998 verdienten alle, die unter dieses eine Prozent fielen, jeweils mehr als 230 000 Dollar. Andererseits wanderten 60 Prozent der Zuwächse dieses einen Prozents in die Taschen von 0,1 Prozent, nämlich derjenigen, die über ein Einkommen von über 790 000 Dollar verfügten. Und fast die Hälfte dieser Steigerungen wiederum floss 13 000 Steuerzahlern zu, den obersten 0,01 Prozent, die über ein Einkommen von mindestens 3,6 Millionen Dollar, im Durchschnitt aber über Einnahmen von 17 Millionen Dollar verfügten.
Diese Schätzungen stammen aus dem Jahr 1998. Hat sich der Trend seitdem umgekehrt? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Alles weist darauf hin, dass die Einkommen an der Spitze im Jahr 2000 weiter nach oben schnellten. Seither fielen die hohen Einkommen wegen der fallenden Aktienkurse vermutlich etwas niedriger aus. Aber bereits für das Jahr 2001 weisen Erhebungen ein wieder wachsendes Auseinanderklaffen der Einkommen aus, was vor allem mit den Auswirkungen der Rezession auf die Geringverdiener zusammenhängt. Am Ende der derzeitigen Konjunkturschwäche werden wir uns mit ziemlicher Sicherheit in einer Gesellschaft wiederfinden, in der die Ungleichheit größer ist als in den späten Neunzigern.
Es ist also keineswegs übertrieben, von einem zweiten Goldenen Zeitalter zu sprechen. Als die Mittelklasse in Amerika an Boden gewann, war die Klasse der Villenbauer und Yachtbesitzer weitgehend verschwunden. 1970 besaßen 0,01 Prozent der Steuerzahler 0,7 Prozent des Gesamteinkommens - sie verdienten also "nur" 70-mal so viel wie der Durchschnitt, nicht genug, um eine Riesenresidenz zu kaufen oder zu unterhalten. 1998 hingegen flossen mehr als drei Prozent des Gesamteinkommens den oberen 0,01 Prozent zu. Das bedeutet, dass die 13 000 reichsten Familien in Amerika über fast ebenso viel Geld verfügten wie die 20 Millionen ärmsten Haushalte; die Einkommen dieser 13 000 Familien waren etwa 300-mal so hoch wie die der durchschnittlichen Familien. Und dieser Wandel ist längst noch nicht abgeschlossen.
II. Rücknahme des New Deal
Mitte der Neunziger, als die Ökonomen eine Veränderung der Einkommensverteilung in Amerika ausmachten, formulierten sie drei Haupthypothesen über ihre Ursachen.
Die Globalisierungsthese verknüpfte die sich verändernde Einkommensverteilung mit dem Wachstum des Welthandels, besonders mit dem zunehmenden Import verarbeiteter Güter aus der so genannten Dritten Welt. Diese These besagt, dass Arbeiter - Leute, die in meiner Jugend oft ebenso viel verdienten wie Manager der mittleren Ebene mit College-Abschluss - gegenüber den billigen Arbeitskräften aus Asien nicht konkurrenzfähig waren. Folglich stagnierten die Löhne normaler Leute oder sanken sogar, während ein größerer Anteil des nationalen Einkommens an die besser Ausgebildeten ging.
Eine zweite Hypothese sah den Grund für die wachsende Ungleichheit nicht im Außenhandel, sondern in den Innovationen im Inland. Der ständige Fortschritt in der Informationstechnologie hatte demnach die Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften stimuliert. Die Einkommen verteilten sich also zunehmend nach Hirn statt nach Muskeln.
Die "Superstar"-Hypothese des Chicagoer Ökonomen Sherwin Rosen variierte die These vom technologischen Fortschritt. Rosen argumentierte, moderne Kommunikationstechnologien machten den Wettbewerb häufig zu einem Wettkampf, bei dem der Gewinner reich belohnt werde, während die Unterlegenen weit weniger bekämen. Als klassisches Beispiel dient die Unterhaltungsbranche. Rosen führte an, dass früher Hunderte von Komödianten ihr bescheidenes Auskommen durch Live Shows verdienen konnten. In den Zeiten des Fernsehens sind die meisten verschwunden, übrig geblieben sind ein paar TV-Superstars.
Die Verfechtern dieser drei Hypothesen trugen erbitterte Kämpfe aus. In den vergangenen Jahren haben jedoch viele Ökonomen ein Gespür dafür entwickelt, dass keiner dieser Erklärungsansätze trägt.
Die Globalisierung kann zwar die sinkenden Arbeitergehälter teilweise erklären, kaum aber den 2500-prozentigen Anstieg der Vorstandsgehälter. Technologischer Fortschritt mag erklären, warum die Top-Gehälter mit zunehmendem Bildungsgrad gestiegen sind. Aber es ist schwer, dies mit der wachsenden Ungleichheit unter den College-Absolventen in Einklang zu bringen. Die Superstar-Theorie ist auf den Star-Talkmaster Jay Leno anwendbar, erklärt aber nicht, wieso Tausende von Leuten ungeheuer reich wurden, ohne zum Fernsehen zu gehen.
Auch die Große Kompression - die substanziell sinkende Ungleichheit während des New Deal und des Zweiten Weltkriegs - ist mithilfe der gängigen Theorien schwer zu verstehen. Während des Kriegs ließ Roosevelt die Lohnentwicklung staatlich kontrollieren, um Einkommensunterschiede auszugleichen. Aber wäre die Mittelklassegesellschaft nur ein Kunstprodukt des Krieges gewesen, hätte sie dann weitere 30 Jahre lang Bestand gehabt?
Manche Ökonomen nehmen mittlerweile eine These ernst, die sie noch vor einer Weile für verrückt gehalten hätten. Diese These betont die Rolle sozialer Normen, die der Ungleichheit Schranken setzt. Der New Deal hatte demnach einen viel tieferen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft, als ihm selbst glühende Bewunderer jemals zugestanden hätten. Er setzte Normen relativer Gleichheit, die die kommenden 30 Jahre überdauerten.
Diese Normen wurden seit den siebziger Jahren ausgehöhlt.
Ein Beleg dafür ist die Entlohnung von Führungskräften. In den sechziger Jahren verhielten sich die großen amerikanischen Unternehmen eher wie sozialistische Republiken und nicht wie kapitalistische Halsabschneider, und die Firmenchefs verhielten sich eher wie auf das öffentliche Wohl bedachte Bürokraten und nicht wie Industriekapitäne.
35 Jahre später schreibt das Magazin Fortune: "Überall in Amerika kassierten die Führungskräfte in Aktien ab, während ihre Unternehmen vor die Hunde gingen."
Lässt man die aktuellen Vergehen beiseite und fragt, wie die relativ bescheidenen Gehälter der Top-Angestellten von vor 30 Jahren zu gigantischen Entlohnungspaketen anwuchsen, stößt man auf zwei Erklärungsstränge.
Der optimistischere stellt eine Analogie her zwischen der Explosion der Gehälter von Konzernchefs und der Explosion der Gehälter von Baseball-Spielern. Sie besagt, dass hoch bezahlte Chefs ihr Geld wert sind, weil sie einfach die richtigen Männer für diesen Job sind. Die pessimistischere Sicht - die ich plausibler finde - besagt, dass die Jagd nach Talenten eine untergeordnete Rolle spielt. Denn schließlich gingen die voll gepackten Lohntüten oft genug an Leute, deren Leistung bestenfalls mittelmäßig war. In Wirklichkeit werden viele so gut bezahlt, weil sie es sind, die die Mitglieder des Aufsichtsrats ernennen - und der wiederum legt ihre Kompensation fest. Es ist also nicht die unsichtbare Hand des Marktes, die zu den monumentalen Bezügen führt. Es ist der unsichtbare Handschlag in den Hinterzimmern der Unternehmenszentralen.
Vor 30 Jahren wurden Vorstände weniger großzügig bedacht, weil die Angst vor einem öffentlichen Aufschrei die höheren Gehälter unter Kontrolle hielt. Heute empört sich niemand mehr. Insofern spiegelt die Explosion der Gehälter von Führungskräften eher einen sozialen Wandel wider als die rein ökonomischen Kräfte von Angebot und Nachfrage.
Wie aber konnte sich die Unternehmenskultur so verändern?
Ein Grund ist die gewandelte Struktur der Finanzmärkte. In seinem Buch Auf der Suche nach dem Unternehmensretter argumentiert Rakesh Khurana von der Harvard Business School, in den achtziger und neunziger Jahren sei der Kapitalismus der Manager durch den Kapitalismus der Investoren ersetzt worden. Institutionelle Investoren ließen die Konzernchefs nicht länger selbst ihre Nachfolger aus der Mitte der Firma heraus bestimmen. Sie wollten heroische Führergestalten, oft von außerhalb, und waren bereit, immense Summen dafür zu bezahlen. Khurana brachte dies im Untertitel seines Buches auf den Punkt: Die irrationale Suche nach charismatischen Vorstandschefs.
Moderne Management-Theoretiker hingegen glauben nicht, dass dies so irrational war. Seit den achtziger Jahren wurde die Bedeutung von leadership, von persönlicher, charismatischer Führung, zunehmend betont. Als Lee Iacocca von Chrysler in den frühen Achtzigern eine Berühmtheit wurde, war er eine Besonderheit. Khurana berichtet, dass die Business Week 1980 lediglich einen Vorstandschef auf dem Titelblatt hatte. 1999 waren es bereits 19. Und als es für einen Konzernlenker erst einmal als normal oder sogar notwendig galt, berühmt zu sein, wurde es auch leichter, ihn reich zu machen.
III. Der Preis der Ungleichheit
Auch die Ökonomen trugen dazu bei, dass Gehälter in vorher undenkbarer Höhe möglich wurden. In den achtziger und neunziger Jahren behauptete eine Flut von akademischen Abhandlungen, dass die Filmfigur Gordon Gekko aus Oliver Stones Wallstreet Recht hatte: Gier ist gut. Wer Führungskräfte zur Spitzenleistung treiben wolle, müsse ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringen, argumentierten diese Studien. Und das sollte durch die großzügige Gewährung von Aktien oder Aktienoptionen geschehen.
Piketty und Saez schlagen vor, die Entwicklung der Gehälter in den Führungsetagen in einem breiteren Kontext zu sehen. Löhne und Gehälter sind von sozialen Normen bestimmt - weit mehr, als die Ökonomen und Verfechter des freien Marktes sich vorstellen mögen. In den dreißiger und vierziger Jahren wurden neue Gleichheitsnormen etabliert, vor allem auf politischem Wege. In den Achtzigern und Neunzigern wurden diese Normen demontiert und durch einen Ethos des anything goes ersetzt. Die Folge war die Explosion der Spitzeneinkommen.
Trotz allem: Amerika ist noch immer das reichste der großen Länder dieser Welt, mit einem realen Bruttoinlandsprodukt (BIP), das 20 Prozent höher ist als etwa das von Kanada. Aber: Die Lebenserwartung in den USA ist um einiges niedriger als in Kanada, Japan und jedem größeren Land Westeuropas. Im Durchschnitt haben wir Amerikaner eine Lebenserwartung, die etwas unter der der Griechen liegt. Dabei war es ein amerikanischer Glaubenssatz, dass die Flut alle Boote steigen lässt - dass also alle vom zunehmenden Wohlstand profitieren. Hat unser wachsender nationaler Reichtum sich etwa nicht in einem hohen Lebensstandard für alle Amerikaner niedergeschlagen?
Die Antwort ist: Nein. Amerika hat zwar ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als alle übrigen großen Industrieländer, das aber vor allem weil die Reichen viel reicher sind als anderswo. Wir Amerikaner sind stolz auf unserer rekordverdächtiges Wirtschaftswachstum. Nur: In den letzten Jahrzehnten kam nur wenig von diesem Wachstum bei normalen Familien an. Das durchschnittliche Familieneinkommen ist nur um 0,5 Prozent jährlich gestiegen.
Darüber hinaus spiegeln die Einkommensstatistiken die zunehmenden Risiken der Arbeitswelt für normale Arbeiter kaum wider. Als der Autokonzern General Motors noch als Generous Motors bekannt war, konnten sich die meisten Mitarbeiter ihres Jobs ziemlich sicher sein. Sie wussten, die Firma würde sie nur im Extremfall feuern. Viele hatten Verträge, die ihnen eine Krankenversicherung garantierten, selbst bei einer Entlassung. Ihre Pensionen hingen nicht vom Aktienmarkt ab. Mittlerweile sind Massenentlassungen auch bei etablierten Unternehmen üblich. Und Millionen von Leuten mussten erleben, dass ein betrieblicher Pensionsplan keineswegs eine komfortable Rente garantiert.
Manche Leute mögen dem entgegnen, dass das System der USA bei aller Ungleichheit auch für höhere Einkommen sorge. Dass also nicht nur unsere Reichen reicher sind als anderswo, sondern dass es auch der typischen amerikanischen Durchschnittsfamilie besser gehe als den Menschen in anderen Ländern, ja sogar unseren Armen.
Doch das ist nicht wahr. Man sieht das am Beispiel von Schweden, der großen bête noire der Konservativen. Die Lebenserwartung in Schweden liegt um drei Jahre höher als in den USA. Die Kindersterblichkeit ist halb so hoch und Analphabetentum weit weniger verbreitet als in Amerika.
Zwar weist Schweden ein geringeres Durchschnittseinkommen auf als die USA, aber das liegt vor allem daran, dass unsere Reichen so viel reicher sind. Einer normalen schwedischen Familie hingegen geht es besser als der entsprechenden amerikanischen Familie: Die Einkommen sind höher, und die höhere Steuerlast wird durch die öffentliche Gesundheitsvorsorge und die besseren öffentlichen Dienstleistungen wieder wettgemacht. Und selbst schwedische Familien, die zu den 10 Prozent der Ärmsten gehören, verfügen über ein 60 Prozent höheres Einkommen als vergleichbare amerikanische Familien. Mitte der Neunziger lebten nur 6 Prozent aller Schweden von weniger als 11 Dollar pro Tag. In den USA waren es 14 Prozent.
Der Vergleich zeigt: Selbst wenn man die große Ungleichheit in den USA als den Preis ansieht, den wir für unsere große Wirtschaftskraft bezahlen, ist nicht klar, dass das Ergebnis diesen Preis wert ist. Denn die Ungleichheit in den USA hat ein Niveau erreicht, das kontraproduktiv ist.
Zum Beispiel die außergewöhnlich hohen Gehältern der heutigen Top-Manager. Sind sie gut für die Wirtschaft?
Nach dem Platzen der Spekulationsblase zeigt sich, dass wir alle für diese dicken Lohnpakete aufkommen mussten. Wahrscheinlich haben die Aktionäre und die Gesellschaft insgesamt einen Preis bezahlt, der die Geldmenge, die an die Manager gezahlt wurde, bei weitem übertraf.
Ökonomen, die sich mit Wirtschaftskriminalität beschäftigen, versichern, Verbrechen sei ineffizient - in dem Sinne, dass ein Verbrechen die Wirtschaft mehr kostet als das Gestohlene. Verbrechen leiten Energie und Ressourcen weg von dem, was nützlich ist: Kriminelle verwenden ihre Zeit eher aufs Stehlen als aufs Produzieren, potenzielle Opfer aufs Schützen ihres Eigentums. Das gilt auch für Wirtschaftskriminalität. Manager, die ihre Tage damit verbringen, das Geld ihrer Aktionäre in die eigenen Taschen zu leiten, haben keine Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben (denken Sie an Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia ...).
Das Hauptargument für ein System, in dem einige Leute sehr reich werden, war immer: Die Aussicht auf Reichtum ist ein Leistungsanreiz. Nur: Für welche Leistung? Je mehr bekannt wird, was in amerikanischen Firmen vor sich ging, desto unklarer wird, ob diese Anreize die Manager dazu gebracht haben, in unser aller Interesse zu arbeiten.
IV. Ungleichheit und Politik
Im September debattierte der Senat über den Vorschlag, US-Bürger, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, um in den USA keine Steuern zahlen zu müssen, mit einer einmaligen Steuer auf Kapitalgewinne zu belegen. Senator Phil Gramm wetterte dagegen: Dieser Vorschlag stamme "direkt aus Nazideutschland". Ziemlich heftig, aber nicht heftiger als die Metapher, die Daniel Mitchell von der Heritage Foundation in einem Beitrag in der Washington Times benutzte, um eine Gesetzesvorlage zu charakterisieren, die Unternehmen daran hindern sollte, ihren Firmensitz aus Steuergründen zu verlegen. Er verglich dieses Vorhaben mit dem infamen Erlass des Verfassungsgerichts von 1857, der den Bundesstaaten im Norden vorschrieb, geflohene Sklaven in die Südstaaten zurückzubringen.
Solche Äußerungen sind Indikatoren großer Veränderungen in der amerikanischen Politik. Zum einen sind unsere Politiker immer weniger geneigt, sich auch nur den Anschein von Mäßigung zu geben. Zum anderen neigen sie immer stärker dazu, die Interessen der Wohlhabenden zu bedienen. Und ich meine wirklich die Wohlhabenden, nicht nur die, denen es finanziell gut geht. Nur wer mindestens über ein Nettovermögen von mehreren Millionen Dollar verfügt, könnte es für nötig befinden, ein Steuerflüchtling zu werden.
Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Politiker auf die sich öffnende Einkommensschere reagieren, indem sie vorschlagen, den Reichen Geld aus der Tasche zu ziehen. Vermutlich hätte das Wählerstimmen gebracht. Stattdessen nutzt die Wirtschaftspolitik vor allem den Wohlhabenden. Die wichtigsten Steuererleichterungen der vergangenen 25 Jahre, unter Reagan in den Achtzigern und jetzt unter Bush, hatten alle eine Schieflage: Sie begünstigen die ohnehin schon ziemlich Reichen.
Das stärkste Beispiel dafür, wie die Politik zunehmend die Wohlhabenden begünstigt, ist das Ansinnen, die Erbschaftsteuer abzuschaffen. Diese Steuer trifft überwiegend die Reichen. 1999 wurden nur zwei Prozent aller Erbschaften überhaupt besteuert, und die Hälfte des Steueraufkommen stammte von 3300 Haushalten - also von nur 0,16 Prozent aller amerikanischen Haushalte, deren Besitz aber durchschnittlich 20 Millionen Dollar wert war. Die 467 Erben, deren Besitz 20 Millionen Dollar überstieg, zahlten ein Viertel der Steuer.
Eigentlich wäre zu erwarten, dass eine Steuer, die so wenige Leute trifft, aber so große Erträge bringt, politisch sehr populär ist. Zudem könnte diese Steuer demokratische Werte fördern, weil sie die Möglichkeit der Reichen einschränkt, Dynastien zu formen. Woher also der Druck, sie aufzuheben, und warum war diese Steuererleichterung das Herzstück der Steuerreform George W. Bushs?
Die Antwort fällt leicht, wenn man sieht, wem die Abschaffung der Steuer zugute kommt. Zwar würden nur wenige von einer Aufhebung der Erbschaftsteuer profitieren. Aber diese wenigen haben eine Menge Geld, und beruflich kontrollieren sie meist noch mehr. Genau diese Sorte Mensch zieht die Aufmerksamkeit von Politikern auf sich, die auf der Suche nach Wahlkampfspenden sind.
Aber auch ein breiteres Publikum wurde davon überzeugt, dass die Erbschaftsteuer eine schlechte Sache sei. Wer so denkt, ist meist überzeugt, dass kleine Unternehmen und Familien die Hauptlast der Steuer tragen - was schlicht nicht stimmt. Diese falschen Vorstellungen aber wurden gezielt gefördert - etwa durch die Heritage Foundation. Die wiederum wurde von reichen Familien gegründet.
Konservative Anschauungen, die gegen Steuern für Reiche kämpfen, sind nicht zufällig so verbreitet. Geld kann nicht nur direkten Einfluss kaufen, sondern man kann es auch verwenden, um die öffentliche Wahrnehmung zu verändern. Die liberale Gruppierung People for the American Way veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel Eine Bewegung kaufen. Darin berichtet sie, wie konservative Stiftungen, Denkfabriken und Medien große Summen zur Verfügung stellen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.
V. Plutokratie?
Weil die Reichen immer reicher werden, könnten sie sich außer Gütern und Dienstleistungen auch eine Menge anderer Sachen kaufen. Mit Geld lässt sich Einfluss auf die Politik erwerben, selbst Unterstützung aus intellektuellen Kreisen, wenn man es geschickt anstellt. Wachsende Einkommensunterschiede in den USA haben also nicht etwa dazu geführt, dass die Linken aufschreien und den Reichen ans Leder wollen. Stattdessen entstand eine Bewegung, die den Wohlhabenden mehr von ihren Erträgen belassen und ihnen das Weitervererben ihres Reichtums erleichtern will.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sich selbst verstärkenden Prozesses. Während sich die Kluft zwischen Reichen und Armen weitet, kümmert sich die Wirtschaftspolitik zunehmend um die Interessen der Elite. Gleichzeitig bleibt für öffentliche Dienstleistungen, vor allem für Schulen, kaum noch Geld bleibt.
1924 erstrahlten die Villen an der Nordküste von Long Island noch in ihrem vollen Glanz, ebenso wie die politische Macht der Klasse, die sie besaß. Als der Gouverneur von New York, Al Smith, vorschlug, öffentliche Parks anzulegen, erntete er bitteren Protest. Ein Villenbesitzer, der "Zuckersultan" Horace Havemeyer, entwarf ein abschreckendes Szenario: Die Nordküste würde von "Gesindel aus der Stadt überrannt". - "Gesindel?", antwortete Smith, "Sie reden von mir." Letztlich bekamen die New Yorker ihre Parks, aber um ein Haar hätten die Interessen einiger hundert reicher Familien die Bedürfnisse der Mittelklasse von New York City ausgestochen.
Diese Zeiten sind vorbei. Wirklich? Die Einkommensunterschiede sind wieder so groß wie in den zwanziger Jahren. Ererbter Wohlstand spielt noch keine bedeutende Rolle, aber mit der Zeit - und der Aufhebung der Erbschaftsteuer - züchten wir uns eine Elite der Erben, die sich vom normalen Amerikaner so weit entfernt haben wird wie der alte Horace Havemeyer. Und die neue Elite wird - wie die alte - enorme politische Macht haben.
Kevin Philipps schließt sein Buch Wohlstand und Demokratie mit einer Warnung: "Wenn wir die Demokratie nicht erneuern und die Politik wieder zum Leben erwecken, wird der Wohlstand ein neues, weniger demokratisches Regime zementieren - eine Plutokratie." Eine extreme Einschätzung. Aber wir leben in extremen Zeiten.
Bin ich zu pessimistisch? Selbst meine liberalen Freunde sagen mir, ich solle mir keine Sorgen machen, unser System sei elastisch, die Mittelachse werde halten. Ich hoffe, dass sie Recht haben. Unser Optimismus, dass unsere Nation am Ende letztlich doch immer ihren Weg findet, rührt aus der Vergangenheit her - einer Vergangenheit, in der Amerika eine Mittelklassegesellschaft war. Aber damals war das Land noch ein anderes.
siehe auch: http://www.pkarchive.org
Paul Krugman wurde 1953 in Long Island, New York, geboren. An der Yale University erhielt er 1974 seinen B.A. und bereits im Alter von 24 schloß er seine Promotion am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ab. Bereits im selben Jahr erhielt er seine erste Professur an der Yale University. Zwischen 1980 und 2000 war Krugman zunächst Associate Professor, schließlich Ford International Professor of Economics am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. In den Jahren zwischen 1994 und 1996 lehrte Krugman an der Stanford University. Seit kurzem ist er an der Princeton University tätig. Daneben hält er sich immer wieder zu Forschungszwecken am National Bureau of Economic Research (NBER) auf.
In den Jahren 1982 und 1983 war er Mitglied des U.S. Council of Economic Advisors (entsprechend dem deutschen Sachverständigenrat) unter Präsident Ronald Reagan. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit schreibt er als Kolumnist für zahlreiche Zeitungen, u.a. New York Times, Slate und Fortune. Dabei ist Krugman bekannt für seine Fähigkeit, komplexe ökonomische Sachverhalte mit seinem einfachen und klaren Stil einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen, wobei er auch immer das Gespräch zu Nicht-Ökonomen sucht.
Seine Arbeit wurde u.a. 1991 durch die Verleihung der John Bates Clark-Medaille für den besten Nachwuchswissenschaftler unter 40 Jahren gewürdigt. Im Jahr 1998 erhielt Krugman die Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin. In jüngster Zeit wurden drei seiner Bücher ins Deutsche übersetzt: "Der Mythos vom globalen Wirtschaftskrieg" (1999), "Die Grosse Rezession" (1999) und "Schmalspur-Ökonomie" (2000), alle erschienen beim Campus Verlag, Frankfurt/New York.
Im Mikroökonomischen Bereich zählt Krugman zum Mitbegründer der so genannten "New Trade Theory", die Erkenntnisse der Industrieökonomik auf Fragestellungen des Internationalen Handels anwendet. Dabei wird beispielsweise erklärt, wie die selben Güter von einem Land gleichzeitig exportiert und importiert werden können, welche Auswirkungen Marktmacht und unvollständiger Wettbewerb auf den internationalen Handel haben und warum Länder mit gleicher Ressourcenausstattung und Industriestruktur miteinander Handel betreiben. Ebenso herausragend sind seine Arbeiten auf dem Gebiet der Makroökonomik, wo Krugman wesentliche Beiträge zur Theorie von Währungskrisen und Wechselkurssschwankungen leistete. Beispielsweise analysierte er, wie eine historisch stabile Währung plötzlich starke Schwankungen erfährt und somit eine Zahlungsbilanzkrise verursacht.
Paul Krugman :
Der amerikanische Albtraum
Nachdruck aus dem "New York Times Magazine" vom 20. Oktober 2002
Aus dem Amerikanischen von Sandra Pfister
Als ich ein Teenager war und auf Long Island nahe New York lebte, machte ich oft Ausflüge zu den Villen an der Nordküste. Diese Villen waren Monumente eines vergangenen Zeitalters, in der sich die Reichen ganze Armeen von Sklaven leisten konnten. Die brauchte man auch, um Häuser von der Größe europäischer Paläste zu unterhalten. Als ich diese Häuser sah, war diese Ära, die wir heute das Goldene Zeitalter nennen, längst Vergangenheit. Kaum eine der Villen auf Long Island war noch in Privatbesitz. Entweder waren sie zu Museen umfunktioniert worden, oder sie wurden als Kindergärten oder Privatschulen genutzt.
Denn das Amerika der fünfziger und sechziger Jahre, in dem ich aufwuchs, war eine Mittelklassegesellschaft. Die großen Einkommens- und Wohlstandsunterschiede des Goldenen Zeitalters waren verschwunden. Natürlich lebte so mancher reiche Geschäftsmann oder Erbe weit besser als der durchschnittliche Amerikaner. Aber sie waren auf eine andere Weise reich als die Räuberbarone, die sich um die Jahrhundertwende riesige Villen hatten bauen lassen, und sie waren nicht so zahlreich. Die Tage, in denen Plutokraten eine wichtige Rolle in der amerikanischen Gesellschaft gespielt hatten, politisch wie ökonomisch, schienen passé.
Die tägliche Erfahrung vermittelte uns den Eindruck, in einer einigermaßen gleichen Gesellschaft zu leben. Die wirtschaftlichen Disparitäten waren nicht besonders ausgeprägt. Berufstätige mit höherer Ausbildung - Manager der mittleren Ebene, Lehrer, sogar Anwälte - behaupteten oft, weniger zu verdienen als gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. Wer als wohlhabend galt, ließ sich einmal pro Woche eine Putzfrau kommen und verbrachte den Sommerurlaub in Europa. Aber auch diese Wohlhabenden schickten ihre Kinder in öffentliche Schulen und fuhren im eigenen Auto zur Arbeit so wie jeder andere auch.
Doch das ist lange her. Heute leben wir wieder in einem Goldenen Zeitalter - ähnlich extravagant wie das Original. Villen und Paläste erleben ihr Comeback. 1999 porträtierte das New York Times Magazine den Architekten Thierry Despont, die "Eminenz des Exzesses", der darauf spezialisiert ist, Häuser für die Superreichen zu gestalten. Seine Kreationen entstehen gewöhnlich auf einer Fläche von 2000 bis 6000 Quadratmetern; Häuser am oberen Ende dieser Skala sind kaum kleiner als das Weiße Haus. Natürlich sind auch die Armeen von Bediensteten zurückgekehrt. Ebenso die Yachten.
Nur wenigen Leuten ist bewusst, wie sehr sich in diesem Land die Kluft zwischen den sehr Reichen und dem Rest innerhalb relativ kurzer Zeit verbreitert hat. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, setzt sich unweigerlich dem Verdacht aus, "Klassenkampf" oder eine "Politik des Neides" zu betreiben. Und nur wenige Leute sind tatsächlich willens, über die weitgehenden Auswirkungen dieser sich immer weiter öffnenden Schere zu sprechen - ökonomische, soziale und politische Auswirkungen.
Doch was in den USA heute geschieht, kann nur verstehen, wer das Ausmaß, die Ursachen und Konsequenzen der zunehmenden Ungleichheit in den letzten drei Jahrzehnten begreift. Wer begreifen will, wieso es in Amerika trotz allen ökonomischen Erfolgs mehr Armut gibt als in jeder anderen großen Industrienation, der muss sich die Einkommenskonzentration an der Spitze ansehen.
I. Das neue Goldene Zeitalter
Das Durcheinander beim Ausscheiden von Jack Welch als Chef des US-Konzerns General Electric hatte einen positiven Nebeneffekt: Es gab Einblick in die Sozialleistungen, die die Wirtschaftselite einstreicht und die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleiben. Wie sich herausstellte, wurde Welch die lebenslange Nutzung eines Apartments in Manhattan (inklusive Essen, Wein und Wäsche) gewährt, ebenso die Nutzung von Firmenjets und einige andere geldwerte Vorteile im Wert von mindestens zwei Millionen Dollar pro Jahr. Diese Abfindung veranschaulicht, wie sehr Firmenlenker mittlerweile erwarten, ähnlich königlichen Hoheiten des Ancien Régime behandelt zu werden. Finanziell dürften diese Sonderleistungen Welch wenig bedeutet haben. Im Jahr 2000, seinem letzten kompletten Dienstjahr bei General Electric, bezog er ein Einkommen von 123 Millionen Dollar.
Man mag einwenden, es sei nichts Neues, dass die Chefs amerikanischer Konzerne eine Menge Geld kassieren. Aber es ist neu. Zwar waren sie im Vergleich zum durchschnittlichen Arbeiter immer schon gut bezahlt, doch was ein Manager vor 30 Jahren verdiente und was er heute verdient, ist nicht zu vergleichen.
In den vergangenen drei Jahrzehnten sind die Gehälter der meisten US-Bürger nur moderat gestiegen: Das durchschnittliche jährliche Einkommen wuchs inflationsbereinigt von 32 522 Dollar im Jahr 1970 auf 35 864 Dollar 1999. Zehn Prozent in 29 Jahren - ein Fortschritt, wenn auch ein bescheidener. Glaubt man dem Fortune Magazine, stiegen in derselben Zeit die Jahresgehälter der Firmenchefs der 100 größten US-Unternehmen aber von 1,3 Millionen Dollar - dem 39fachen des Gehaltes eines durchschnittlichen Arbeiters - auf 37,5 Millionen Dollar, dem mehr als 1000fachen Lohn eines normalen Arbeitnehmers.
Diese Explosion der Vorstandsgehälter in den vergangenen 30 Jahren ist an sich schon erstaunlich. Aber sie deutet nur auf einen größeren Zusammenhang hin: die erneute Konzentration von Einkommen und Wohlstand in den USA.
Offizielle Erhebungen belegen, dass ein wachsender Einkommensanteil an die oberen 20 Prozent der Familien fließt, und innerhalb dieser Schicht besonders an die obersten fünf Prozent, während die Familien in der Mitte immer weniger abbekommen. Dies sind die Fakten. Trotzdem beschäftigt sich eine ganze, gut finanzierte Industrie damit, sie zu leugnen. Konservative Denkfabriken produzieren reihenweise Studien, die diese Daten, die Methoden ihrer Erhebung und die Motive jener Statistiker diskreditieren sollen, die doch nur das Offensichtliche berichten. Vor vier Jahre hielt Alan Greenspan - wer konnte diesen Mann ernsthaft für objektiv halten? - eine Rede bei der Konferenz der US-Notenbank in Jackson Hole. Die Rede war ein einziger Versuch, die reale Zunahme von Ungleichheit in Amerika abzustreiten.
Tatsächlich jedoch haben Studien, die sich seriös um das Aufspüren hoher Einkommen bemühen, zu erschreckenden Ergebnisse geführt. Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung des unabhängigen Haushaltsamts des amerikanischen Kongresses hat beispielsweise Daten zur Einkommensteuer und andere Quellen herangezogen, um die bisherigen Schätzungen zu verbessern. Dabei stellte sich heraus, dass zwischen 1979 und 1997 die Nettoeinkommen des obersten Prozents der Bestverdienenden um 157 Prozent stiegen - gegenüber zehn Prozent bei den durchschnittlichen Einkommen. Noch aufrüttelnder sind die Ergebnisse einer Studie von Thomas Piketty und Emmanuel Saez vom französischen Forschungsinstitut Cepremap. Piketty und Saez nutzten Daten aus der Erhebung der Einkommensteuer, um die Einkommen von Wohlhabenden, Reichen und sehr Reichen bis zurück ins Jahr 1913 zu schätzen.
Aus diesen Berechnungen kann man einiges lernen. Zunächst, dass das Amerika meiner Jugend weniger als normaler Zustand unserer Gesellschaft gelten sollte, sondern eher als Interregnum zwischen zwei Goldenen Zeitaltern. In der amerikanischen Gesellschaft vor 1930 kontrollierten wenige Superreiche einen Großteil des Wohlstandes. Eine Mittelklassegesellschaft wurden wir erst, nachdem sich die Einkommenskonzentration während des New Deal von Präsident Franklin D. Roosevelt und besonders während des Zweiten Weltkriegs auflöste. Die Wirtschaftshistoriker Claudia Goldin und Robert Margo haben die Verengung der Einkommenskluft während dieser Jahre "Great Compression", Große Kompression, getauft. Bis in die siebziger Jahre blieben die Einkommen relativ gleichmäßig verteilt: Der rapide Anstieg der Einkommen der ersten Nachkriegsgeneration verteilte sich gleichmäßig auf die Gesamtbevölkerung.
Seit den siebziger Jahren klaffen die Einkommen allerdings zunehmend auseinander. Und die großen Gewinner sind die Superreichen. Ein häufig gebrauchter Trick, um die wachsende Ungleichheit herunterzuspielen, ist der Rückgriff auf relativ grobe statistische Aufschlüsselungen. Ein konservativer Kommentator wird zwar zum Beispiel einräumen, dass tatsächlich die obersten zehn Prozent der Steuerzahler einen immer höheren Anteil am nationalen Einkommen abbekommen. Aber dann kann er gelassen darauf verweisen, dass bereits ein Einkommen von 81 000 Dollar aufwärts zu diesen zehn Prozent zählt. Demnach reden wir nur von Einkommensverschiebungen innerhalb der Mittelschicht, oder?
Falsch. Die oberen zehn Prozent umfassen zwar tatsächlich eine Menge Leute, die wir der Mittelklasse zuordnen würden. Sie aber waren nicht die großen Gewinner. In Wahrheit profitierte das oberste eine Prozent der bestverdienenden zehn Prozent vom Einkommenszuwachs mehr als die folgenden neun Prozent der Steuerzahler. 1998 verdienten alle, die unter dieses eine Prozent fielen, jeweils mehr als 230 000 Dollar. Andererseits wanderten 60 Prozent der Zuwächse dieses einen Prozents in die Taschen von 0,1 Prozent, nämlich derjenigen, die über ein Einkommen von über 790 000 Dollar verfügten. Und fast die Hälfte dieser Steigerungen wiederum floss 13 000 Steuerzahlern zu, den obersten 0,01 Prozent, die über ein Einkommen von mindestens 3,6 Millionen Dollar, im Durchschnitt aber über Einnahmen von 17 Millionen Dollar verfügten.
Diese Schätzungen stammen aus dem Jahr 1998. Hat sich der Trend seitdem umgekehrt? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Alles weist darauf hin, dass die Einkommen an der Spitze im Jahr 2000 weiter nach oben schnellten. Seither fielen die hohen Einkommen wegen der fallenden Aktienkurse vermutlich etwas niedriger aus. Aber bereits für das Jahr 2001 weisen Erhebungen ein wieder wachsendes Auseinanderklaffen der Einkommen aus, was vor allem mit den Auswirkungen der Rezession auf die Geringverdiener zusammenhängt. Am Ende der derzeitigen Konjunkturschwäche werden wir uns mit ziemlicher Sicherheit in einer Gesellschaft wiederfinden, in der die Ungleichheit größer ist als in den späten Neunzigern.
Es ist also keineswegs übertrieben, von einem zweiten Goldenen Zeitalter zu sprechen. Als die Mittelklasse in Amerika an Boden gewann, war die Klasse der Villenbauer und Yachtbesitzer weitgehend verschwunden. 1970 besaßen 0,01 Prozent der Steuerzahler 0,7 Prozent des Gesamteinkommens - sie verdienten also "nur" 70-mal so viel wie der Durchschnitt, nicht genug, um eine Riesenresidenz zu kaufen oder zu unterhalten. 1998 hingegen flossen mehr als drei Prozent des Gesamteinkommens den oberen 0,01 Prozent zu. Das bedeutet, dass die 13 000 reichsten Familien in Amerika über fast ebenso viel Geld verfügten wie die 20 Millionen ärmsten Haushalte; die Einkommen dieser 13 000 Familien waren etwa 300-mal so hoch wie die der durchschnittlichen Familien. Und dieser Wandel ist längst noch nicht abgeschlossen.
II. Rücknahme des New Deal
Mitte der Neunziger, als die Ökonomen eine Veränderung der Einkommensverteilung in Amerika ausmachten, formulierten sie drei Haupthypothesen über ihre Ursachen.
Die Globalisierungsthese verknüpfte die sich verändernde Einkommensverteilung mit dem Wachstum des Welthandels, besonders mit dem zunehmenden Import verarbeiteter Güter aus der so genannten Dritten Welt. Diese These besagt, dass Arbeiter - Leute, die in meiner Jugend oft ebenso viel verdienten wie Manager der mittleren Ebene mit College-Abschluss - gegenüber den billigen Arbeitskräften aus Asien nicht konkurrenzfähig waren. Folglich stagnierten die Löhne normaler Leute oder sanken sogar, während ein größerer Anteil des nationalen Einkommens an die besser Ausgebildeten ging.
Eine zweite Hypothese sah den Grund für die wachsende Ungleichheit nicht im Außenhandel, sondern in den Innovationen im Inland. Der ständige Fortschritt in der Informationstechnologie hatte demnach die Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften stimuliert. Die Einkommen verteilten sich also zunehmend nach Hirn statt nach Muskeln.
Die "Superstar"-Hypothese des Chicagoer Ökonomen Sherwin Rosen variierte die These vom technologischen Fortschritt. Rosen argumentierte, moderne Kommunikationstechnologien machten den Wettbewerb häufig zu einem Wettkampf, bei dem der Gewinner reich belohnt werde, während die Unterlegenen weit weniger bekämen. Als klassisches Beispiel dient die Unterhaltungsbranche. Rosen führte an, dass früher Hunderte von Komödianten ihr bescheidenes Auskommen durch Live Shows verdienen konnten. In den Zeiten des Fernsehens sind die meisten verschwunden, übrig geblieben sind ein paar TV-Superstars.
Die Verfechtern dieser drei Hypothesen trugen erbitterte Kämpfe aus. In den vergangenen Jahren haben jedoch viele Ökonomen ein Gespür dafür entwickelt, dass keiner dieser Erklärungsansätze trägt.
Die Globalisierung kann zwar die sinkenden Arbeitergehälter teilweise erklären, kaum aber den 2500-prozentigen Anstieg der Vorstandsgehälter. Technologischer Fortschritt mag erklären, warum die Top-Gehälter mit zunehmendem Bildungsgrad gestiegen sind. Aber es ist schwer, dies mit der wachsenden Ungleichheit unter den College-Absolventen in Einklang zu bringen. Die Superstar-Theorie ist auf den Star-Talkmaster Jay Leno anwendbar, erklärt aber nicht, wieso Tausende von Leuten ungeheuer reich wurden, ohne zum Fernsehen zu gehen.
Auch die Große Kompression - die substanziell sinkende Ungleichheit während des New Deal und des Zweiten Weltkriegs - ist mithilfe der gängigen Theorien schwer zu verstehen. Während des Kriegs ließ Roosevelt die Lohnentwicklung staatlich kontrollieren, um Einkommensunterschiede auszugleichen. Aber wäre die Mittelklassegesellschaft nur ein Kunstprodukt des Krieges gewesen, hätte sie dann weitere 30 Jahre lang Bestand gehabt?
Manche Ökonomen nehmen mittlerweile eine These ernst, die sie noch vor einer Weile für verrückt gehalten hätten. Diese These betont die Rolle sozialer Normen, die der Ungleichheit Schranken setzt. Der New Deal hatte demnach einen viel tieferen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft, als ihm selbst glühende Bewunderer jemals zugestanden hätten. Er setzte Normen relativer Gleichheit, die die kommenden 30 Jahre überdauerten.
Diese Normen wurden seit den siebziger Jahren ausgehöhlt.
Ein Beleg dafür ist die Entlohnung von Führungskräften. In den sechziger Jahren verhielten sich die großen amerikanischen Unternehmen eher wie sozialistische Republiken und nicht wie kapitalistische Halsabschneider, und die Firmenchefs verhielten sich eher wie auf das öffentliche Wohl bedachte Bürokraten und nicht wie Industriekapitäne.
35 Jahre später schreibt das Magazin Fortune: "Überall in Amerika kassierten die Führungskräfte in Aktien ab, während ihre Unternehmen vor die Hunde gingen."
Lässt man die aktuellen Vergehen beiseite und fragt, wie die relativ bescheidenen Gehälter der Top-Angestellten von vor 30 Jahren zu gigantischen Entlohnungspaketen anwuchsen, stößt man auf zwei Erklärungsstränge.
Der optimistischere stellt eine Analogie her zwischen der Explosion der Gehälter von Konzernchefs und der Explosion der Gehälter von Baseball-Spielern. Sie besagt, dass hoch bezahlte Chefs ihr Geld wert sind, weil sie einfach die richtigen Männer für diesen Job sind. Die pessimistischere Sicht - die ich plausibler finde - besagt, dass die Jagd nach Talenten eine untergeordnete Rolle spielt. Denn schließlich gingen die voll gepackten Lohntüten oft genug an Leute, deren Leistung bestenfalls mittelmäßig war. In Wirklichkeit werden viele so gut bezahlt, weil sie es sind, die die Mitglieder des Aufsichtsrats ernennen - und der wiederum legt ihre Kompensation fest. Es ist also nicht die unsichtbare Hand des Marktes, die zu den monumentalen Bezügen führt. Es ist der unsichtbare Handschlag in den Hinterzimmern der Unternehmenszentralen.
Vor 30 Jahren wurden Vorstände weniger großzügig bedacht, weil die Angst vor einem öffentlichen Aufschrei die höheren Gehälter unter Kontrolle hielt. Heute empört sich niemand mehr. Insofern spiegelt die Explosion der Gehälter von Führungskräften eher einen sozialen Wandel wider als die rein ökonomischen Kräfte von Angebot und Nachfrage.
Wie aber konnte sich die Unternehmenskultur so verändern?
Ein Grund ist die gewandelte Struktur der Finanzmärkte. In seinem Buch Auf der Suche nach dem Unternehmensretter argumentiert Rakesh Khurana von der Harvard Business School, in den achtziger und neunziger Jahren sei der Kapitalismus der Manager durch den Kapitalismus der Investoren ersetzt worden. Institutionelle Investoren ließen die Konzernchefs nicht länger selbst ihre Nachfolger aus der Mitte der Firma heraus bestimmen. Sie wollten heroische Führergestalten, oft von außerhalb, und waren bereit, immense Summen dafür zu bezahlen. Khurana brachte dies im Untertitel seines Buches auf den Punkt: Die irrationale Suche nach charismatischen Vorstandschefs.
Moderne Management-Theoretiker hingegen glauben nicht, dass dies so irrational war. Seit den achtziger Jahren wurde die Bedeutung von leadership, von persönlicher, charismatischer Führung, zunehmend betont. Als Lee Iacocca von Chrysler in den frühen Achtzigern eine Berühmtheit wurde, war er eine Besonderheit. Khurana berichtet, dass die Business Week 1980 lediglich einen Vorstandschef auf dem Titelblatt hatte. 1999 waren es bereits 19. Und als es für einen Konzernlenker erst einmal als normal oder sogar notwendig galt, berühmt zu sein, wurde es auch leichter, ihn reich zu machen.
III. Der Preis der Ungleichheit
Auch die Ökonomen trugen dazu bei, dass Gehälter in vorher undenkbarer Höhe möglich wurden. In den achtziger und neunziger Jahren behauptete eine Flut von akademischen Abhandlungen, dass die Filmfigur Gordon Gekko aus Oliver Stones Wallstreet Recht hatte: Gier ist gut. Wer Führungskräfte zur Spitzenleistung treiben wolle, müsse ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringen, argumentierten diese Studien. Und das sollte durch die großzügige Gewährung von Aktien oder Aktienoptionen geschehen.
Piketty und Saez schlagen vor, die Entwicklung der Gehälter in den Führungsetagen in einem breiteren Kontext zu sehen. Löhne und Gehälter sind von sozialen Normen bestimmt - weit mehr, als die Ökonomen und Verfechter des freien Marktes sich vorstellen mögen. In den dreißiger und vierziger Jahren wurden neue Gleichheitsnormen etabliert, vor allem auf politischem Wege. In den Achtzigern und Neunzigern wurden diese Normen demontiert und durch einen Ethos des anything goes ersetzt. Die Folge war die Explosion der Spitzeneinkommen.
Trotz allem: Amerika ist noch immer das reichste der großen Länder dieser Welt, mit einem realen Bruttoinlandsprodukt (BIP), das 20 Prozent höher ist als etwa das von Kanada. Aber: Die Lebenserwartung in den USA ist um einiges niedriger als in Kanada, Japan und jedem größeren Land Westeuropas. Im Durchschnitt haben wir Amerikaner eine Lebenserwartung, die etwas unter der der Griechen liegt. Dabei war es ein amerikanischer Glaubenssatz, dass die Flut alle Boote steigen lässt - dass also alle vom zunehmenden Wohlstand profitieren. Hat unser wachsender nationaler Reichtum sich etwa nicht in einem hohen Lebensstandard für alle Amerikaner niedergeschlagen?
Die Antwort ist: Nein. Amerika hat zwar ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als alle übrigen großen Industrieländer, das aber vor allem weil die Reichen viel reicher sind als anderswo. Wir Amerikaner sind stolz auf unserer rekordverdächtiges Wirtschaftswachstum. Nur: In den letzten Jahrzehnten kam nur wenig von diesem Wachstum bei normalen Familien an. Das durchschnittliche Familieneinkommen ist nur um 0,5 Prozent jährlich gestiegen.
Darüber hinaus spiegeln die Einkommensstatistiken die zunehmenden Risiken der Arbeitswelt für normale Arbeiter kaum wider. Als der Autokonzern General Motors noch als Generous Motors bekannt war, konnten sich die meisten Mitarbeiter ihres Jobs ziemlich sicher sein. Sie wussten, die Firma würde sie nur im Extremfall feuern. Viele hatten Verträge, die ihnen eine Krankenversicherung garantierten, selbst bei einer Entlassung. Ihre Pensionen hingen nicht vom Aktienmarkt ab. Mittlerweile sind Massenentlassungen auch bei etablierten Unternehmen üblich. Und Millionen von Leuten mussten erleben, dass ein betrieblicher Pensionsplan keineswegs eine komfortable Rente garantiert.
Manche Leute mögen dem entgegnen, dass das System der USA bei aller Ungleichheit auch für höhere Einkommen sorge. Dass also nicht nur unsere Reichen reicher sind als anderswo, sondern dass es auch der typischen amerikanischen Durchschnittsfamilie besser gehe als den Menschen in anderen Ländern, ja sogar unseren Armen.
Doch das ist nicht wahr. Man sieht das am Beispiel von Schweden, der großen bête noire der Konservativen. Die Lebenserwartung in Schweden liegt um drei Jahre höher als in den USA. Die Kindersterblichkeit ist halb so hoch und Analphabetentum weit weniger verbreitet als in Amerika.
Zwar weist Schweden ein geringeres Durchschnittseinkommen auf als die USA, aber das liegt vor allem daran, dass unsere Reichen so viel reicher sind. Einer normalen schwedischen Familie hingegen geht es besser als der entsprechenden amerikanischen Familie: Die Einkommen sind höher, und die höhere Steuerlast wird durch die öffentliche Gesundheitsvorsorge und die besseren öffentlichen Dienstleistungen wieder wettgemacht. Und selbst schwedische Familien, die zu den 10 Prozent der Ärmsten gehören, verfügen über ein 60 Prozent höheres Einkommen als vergleichbare amerikanische Familien. Mitte der Neunziger lebten nur 6 Prozent aller Schweden von weniger als 11 Dollar pro Tag. In den USA waren es 14 Prozent.
Der Vergleich zeigt: Selbst wenn man die große Ungleichheit in den USA als den Preis ansieht, den wir für unsere große Wirtschaftskraft bezahlen, ist nicht klar, dass das Ergebnis diesen Preis wert ist. Denn die Ungleichheit in den USA hat ein Niveau erreicht, das kontraproduktiv ist.
Zum Beispiel die außergewöhnlich hohen Gehältern der heutigen Top-Manager. Sind sie gut für die Wirtschaft?
Nach dem Platzen der Spekulationsblase zeigt sich, dass wir alle für diese dicken Lohnpakete aufkommen mussten. Wahrscheinlich haben die Aktionäre und die Gesellschaft insgesamt einen Preis bezahlt, der die Geldmenge, die an die Manager gezahlt wurde, bei weitem übertraf.
Ökonomen, die sich mit Wirtschaftskriminalität beschäftigen, versichern, Verbrechen sei ineffizient - in dem Sinne, dass ein Verbrechen die Wirtschaft mehr kostet als das Gestohlene. Verbrechen leiten Energie und Ressourcen weg von dem, was nützlich ist: Kriminelle verwenden ihre Zeit eher aufs Stehlen als aufs Produzieren, potenzielle Opfer aufs Schützen ihres Eigentums. Das gilt auch für Wirtschaftskriminalität. Manager, die ihre Tage damit verbringen, das Geld ihrer Aktionäre in die eigenen Taschen zu leiten, haben keine Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben (denken Sie an Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia ...).
Das Hauptargument für ein System, in dem einige Leute sehr reich werden, war immer: Die Aussicht auf Reichtum ist ein Leistungsanreiz. Nur: Für welche Leistung? Je mehr bekannt wird, was in amerikanischen Firmen vor sich ging, desto unklarer wird, ob diese Anreize die Manager dazu gebracht haben, in unser aller Interesse zu arbeiten.
IV. Ungleichheit und Politik
Im September debattierte der Senat über den Vorschlag, US-Bürger, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen, um in den USA keine Steuern zahlen zu müssen, mit einer einmaligen Steuer auf Kapitalgewinne zu belegen. Senator Phil Gramm wetterte dagegen: Dieser Vorschlag stamme "direkt aus Nazideutschland". Ziemlich heftig, aber nicht heftiger als die Metapher, die Daniel Mitchell von der Heritage Foundation in einem Beitrag in der Washington Times benutzte, um eine Gesetzesvorlage zu charakterisieren, die Unternehmen daran hindern sollte, ihren Firmensitz aus Steuergründen zu verlegen. Er verglich dieses Vorhaben mit dem infamen Erlass des Verfassungsgerichts von 1857, der den Bundesstaaten im Norden vorschrieb, geflohene Sklaven in die Südstaaten zurückzubringen.
Solche Äußerungen sind Indikatoren großer Veränderungen in der amerikanischen Politik. Zum einen sind unsere Politiker immer weniger geneigt, sich auch nur den Anschein von Mäßigung zu geben. Zum anderen neigen sie immer stärker dazu, die Interessen der Wohlhabenden zu bedienen. Und ich meine wirklich die Wohlhabenden, nicht nur die, denen es finanziell gut geht. Nur wer mindestens über ein Nettovermögen von mehreren Millionen Dollar verfügt, könnte es für nötig befinden, ein Steuerflüchtling zu werden.
Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Politiker auf die sich öffnende Einkommensschere reagieren, indem sie vorschlagen, den Reichen Geld aus der Tasche zu ziehen. Vermutlich hätte das Wählerstimmen gebracht. Stattdessen nutzt die Wirtschaftspolitik vor allem den Wohlhabenden. Die wichtigsten Steuererleichterungen der vergangenen 25 Jahre, unter Reagan in den Achtzigern und jetzt unter Bush, hatten alle eine Schieflage: Sie begünstigen die ohnehin schon ziemlich Reichen.
Das stärkste Beispiel dafür, wie die Politik zunehmend die Wohlhabenden begünstigt, ist das Ansinnen, die Erbschaftsteuer abzuschaffen. Diese Steuer trifft überwiegend die Reichen. 1999 wurden nur zwei Prozent aller Erbschaften überhaupt besteuert, und die Hälfte des Steueraufkommen stammte von 3300 Haushalten - also von nur 0,16 Prozent aller amerikanischen Haushalte, deren Besitz aber durchschnittlich 20 Millionen Dollar wert war. Die 467 Erben, deren Besitz 20 Millionen Dollar überstieg, zahlten ein Viertel der Steuer.
Eigentlich wäre zu erwarten, dass eine Steuer, die so wenige Leute trifft, aber so große Erträge bringt, politisch sehr populär ist. Zudem könnte diese Steuer demokratische Werte fördern, weil sie die Möglichkeit der Reichen einschränkt, Dynastien zu formen. Woher also der Druck, sie aufzuheben, und warum war diese Steuererleichterung das Herzstück der Steuerreform George W. Bushs?
Die Antwort fällt leicht, wenn man sieht, wem die Abschaffung der Steuer zugute kommt. Zwar würden nur wenige von einer Aufhebung der Erbschaftsteuer profitieren. Aber diese wenigen haben eine Menge Geld, und beruflich kontrollieren sie meist noch mehr. Genau diese Sorte Mensch zieht die Aufmerksamkeit von Politikern auf sich, die auf der Suche nach Wahlkampfspenden sind.
Aber auch ein breiteres Publikum wurde davon überzeugt, dass die Erbschaftsteuer eine schlechte Sache sei. Wer so denkt, ist meist überzeugt, dass kleine Unternehmen und Familien die Hauptlast der Steuer tragen - was schlicht nicht stimmt. Diese falschen Vorstellungen aber wurden gezielt gefördert - etwa durch die Heritage Foundation. Die wiederum wurde von reichen Familien gegründet.
Konservative Anschauungen, die gegen Steuern für Reiche kämpfen, sind nicht zufällig so verbreitet. Geld kann nicht nur direkten Einfluss kaufen, sondern man kann es auch verwenden, um die öffentliche Wahrnehmung zu verändern. Die liberale Gruppierung People for the American Way veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel Eine Bewegung kaufen. Darin berichtet sie, wie konservative Stiftungen, Denkfabriken und Medien große Summen zur Verfügung stellen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.
V. Plutokratie?
Weil die Reichen immer reicher werden, könnten sie sich außer Gütern und Dienstleistungen auch eine Menge anderer Sachen kaufen. Mit Geld lässt sich Einfluss auf die Politik erwerben, selbst Unterstützung aus intellektuellen Kreisen, wenn man es geschickt anstellt. Wachsende Einkommensunterschiede in den USA haben also nicht etwa dazu geführt, dass die Linken aufschreien und den Reichen ans Leder wollen. Stattdessen entstand eine Bewegung, die den Wohlhabenden mehr von ihren Erträgen belassen und ihnen das Weitervererben ihres Reichtums erleichtern will.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sich selbst verstärkenden Prozesses. Während sich die Kluft zwischen Reichen und Armen weitet, kümmert sich die Wirtschaftspolitik zunehmend um die Interessen der Elite. Gleichzeitig bleibt für öffentliche Dienstleistungen, vor allem für Schulen, kaum noch Geld bleibt.
1924 erstrahlten die Villen an der Nordküste von Long Island noch in ihrem vollen Glanz, ebenso wie die politische Macht der Klasse, die sie besaß. Als der Gouverneur von New York, Al Smith, vorschlug, öffentliche Parks anzulegen, erntete er bitteren Protest. Ein Villenbesitzer, der "Zuckersultan" Horace Havemeyer, entwarf ein abschreckendes Szenario: Die Nordküste würde von "Gesindel aus der Stadt überrannt". - "Gesindel?", antwortete Smith, "Sie reden von mir." Letztlich bekamen die New Yorker ihre Parks, aber um ein Haar hätten die Interessen einiger hundert reicher Familien die Bedürfnisse der Mittelklasse von New York City ausgestochen.
Diese Zeiten sind vorbei. Wirklich? Die Einkommensunterschiede sind wieder so groß wie in den zwanziger Jahren. Ererbter Wohlstand spielt noch keine bedeutende Rolle, aber mit der Zeit - und der Aufhebung der Erbschaftsteuer - züchten wir uns eine Elite der Erben, die sich vom normalen Amerikaner so weit entfernt haben wird wie der alte Horace Havemeyer. Und die neue Elite wird - wie die alte - enorme politische Macht haben.
Kevin Philipps schließt sein Buch Wohlstand und Demokratie mit einer Warnung: "Wenn wir die Demokratie nicht erneuern und die Politik wieder zum Leben erwecken, wird der Wohlstand ein neues, weniger demokratisches Regime zementieren - eine Plutokratie." Eine extreme Einschätzung. Aber wir leben in extremen Zeiten.
Bin ich zu pessimistisch? Selbst meine liberalen Freunde sagen mir, ich solle mir keine Sorgen machen, unser System sei elastisch, die Mittelachse werde halten. Ich hoffe, dass sie Recht haben. Unser Optimismus, dass unsere Nation am Ende letztlich doch immer ihren Weg findet, rührt aus der Vergangenheit her - einer Vergangenheit, in der Amerika eine Mittelklassegesellschaft war. Aber damals war das Land noch ein anderes.
siehe auch: http://www.pkarchive.org
Paul Krugman wurde 1953 in Long Island, New York, geboren. An der Yale University erhielt er 1974 seinen B.A. und bereits im Alter von 24 schloß er seine Promotion am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ab. Bereits im selben Jahr erhielt er seine erste Professur an der Yale University. Zwischen 1980 und 2000 war Krugman zunächst Associate Professor, schließlich Ford International Professor of Economics am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. In den Jahren zwischen 1994 und 1996 lehrte Krugman an der Stanford University. Seit kurzem ist er an der Princeton University tätig. Daneben hält er sich immer wieder zu Forschungszwecken am National Bureau of Economic Research (NBER) auf.
In den Jahren 1982 und 1983 war er Mitglied des U.S. Council of Economic Advisors (entsprechend dem deutschen Sachverständigenrat) unter Präsident Ronald Reagan. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit schreibt er als Kolumnist für zahlreiche Zeitungen, u.a. New York Times, Slate und Fortune. Dabei ist Krugman bekannt für seine Fähigkeit, komplexe ökonomische Sachverhalte mit seinem einfachen und klaren Stil einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen, wobei er auch immer das Gespräch zu Nicht-Ökonomen sucht.
Seine Arbeit wurde u.a. 1991 durch die Verleihung der John Bates Clark-Medaille für den besten Nachwuchswissenschaftler unter 40 Jahren gewürdigt. Im Jahr 1998 erhielt Krugman die Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin. In jüngster Zeit wurden drei seiner Bücher ins Deutsche übersetzt: "Der Mythos vom globalen Wirtschaftskrieg" (1999), "Die Grosse Rezession" (1999) und "Schmalspur-Ökonomie" (2000), alle erschienen beim Campus Verlag, Frankfurt/New York.
Im Mikroökonomischen Bereich zählt Krugman zum Mitbegründer der so genannten "New Trade Theory", die Erkenntnisse der Industrieökonomik auf Fragestellungen des Internationalen Handels anwendet. Dabei wird beispielsweise erklärt, wie die selben Güter von einem Land gleichzeitig exportiert und importiert werden können, welche Auswirkungen Marktmacht und unvollständiger Wettbewerb auf den internationalen Handel haben und warum Länder mit gleicher Ressourcenausstattung und Industriestruktur miteinander Handel betreiben. Ebenso herausragend sind seine Arbeiten auf dem Gebiet der Makroökonomik, wo Krugman wesentliche Beiträge zur Theorie von Währungskrisen und Wechselkurssschwankungen leistete. Beispielsweise analysierte er, wie eine historisch stabile Währung plötzlich starke Schwankungen erfährt und somit eine Zahlungsbilanzkrise verursacht.
.

STEFAN AUST ZUM TOD VON RUDOLF AUGSTEIN
(11. November 2002)
"Der hier liegt, starb zu früh", das sollte auf seinem Grabstein stehen. Oder: "Er hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan." Aber: "Von mir aus bedarf es überhaupt keines Steines. Mir würde genügen, wenn einige Leute den Gedanken hegten, der SPIEGEL sei diesem Lande mehr nützlich als schädlich gewesen und sei es noch."
Jetzt ist er tot. Rudolf Augstein starb am Morgen des 7. November. Zwei Tage zuvor, am 5., war er 79 geworden. "Remember, remember the 5th of November", das hatte er immer wieder gesagt, zum Guy-Fawkes-Day. Im Jahre 1605 wollte dieser englische Katholik mit 36 Fass Schießpulver das House of Lords in die Luft sprengen. Der Plan flog auf, und Guy Fawkes sowie sieben weitere Verschwörer wurden hingerichtet.
So weit wollte die Staatsmacht im Fall Rudolf Augstein denn doch nicht gehen. Aber immerhin 103 Tage Gefängnis hatte im Oktober 1962 die vorübergehend kurzgeschlossene zweite und dritte Gewalt des Adenauer-Staates zu bieten. Genau 40 Jahre ist das her - und die SPIEGEL-Affäre ging ein in die Geschichte der Bundesrepublik.
Rudolf Augstein wurde zum Symbol für journalistischen Widerstand gegen die aus dem demokratischen Ruder laufende Staatsmacht. Er wurde ein Held wider Willen. Als er mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille geehrt werden sollte, lehnte er das ab: "Mir schien ein Missverständnis vorzuliegen. Nur weil auch ich, wie Ossietzky, wegen unterstellten Landesverrats im Gefängnis gesessen hatte, durfte ich mich doch nicht diesem von den Nazis im KZ auf den Tod misshandelten Friedensnobelpreisträger des Jahres 1935 an die Seite stellen."
Die Presse als vierte Gewalt? Gern erzählte Augstein die Geschichte vom ungarischen Schuster, der einst in einem kleinen Dorf sein Einmonatsblättchen redigierte und glücklich vor sich hin murmelte: "Was wird der Zar sich am Montag ärgern!"
Und doch freute er sich jeden Samstag nach Druck des SPIEGEL darauf, "wo der Torpedo am Montag einschlagen würde".
Rudolf Augstein wollte Öffentlichkeit herstellen, nicht mehr, aber auch nicht weniger: "Ich gebe mich der Hoffnung hin, wir hätten dazu mehr beigetragen als viele andere." "Sturmgeschütz der Demokratie" hatte er in jungen Jahren den SPIEGEL genannt. Das Zitat aber, das seither dem Nachrichten-Magazin als Etikett anhängt, war durchaus ironisch gemeint und lautet in der Fassung von 1963: "In der Ära Adenauer waren wir das Sturmgeschütz der Demokratie, mit verengten Sehschlitzen. Im ärgsten Kampfgetümmel, wo man uns manche Hafthohlladung appliziert hatte, erreichten wir nicht entfernt die Wirkung wie in dem Moment, da man uns wie mit einem Netz auf den Trockenboden schleppte und die Armierung zu demontieren gedachte."
Und später, als 70-Jähriger, fügte er hinzu: "Sturmgeschütze sind nur in Zeiten angebracht, wo es etwas zu stürmen gibt." Auf das erstaunte "Wie bitte?" junger SPIEGEL-Redakteure antwortete er: "Das Land ist im Kern gesund", um gleich danach die Position zu wechseln: "Wenn ich sage, Deutschland ist ein kerngesundes Land, dürfen Sie die Ironie, die mitschwingt, da das Zitat schließlich von Heine stammt, nicht außer Acht lassen."
Das war seine Dialektik. Er ließ sich nie auf etwas festnageln, was man in den neunziger Jahren als Political Correctness zu bezeichnen begann: "Wenn ich meiner Sache sicher bin, ist mir egal, was andere Leute dazu sagen und schreiben."
Er war unabhängig und kritisch, vor allem gegen die Regierenden aller Couleur, zuweilen auch unberechenbar, aber nie zu instrumentalisieren. Den Journalismus vor den geschäftlichen Erfolg zu setzen - der kommt dann schon von selbst - ist ihm stets wichtig gewesen. Und er wusste, dass der SPIEGEL sich verändern musste. Als 1955 ein farbiger Titel erschien, schrieb der Herausgeber einen fiktiven Leserbrief an sich selbst: "Muss jetzt auch der SPIEGEL dem illustrierten Zeitgeist Tribut zollen? Sind Sie unter die Schönfärber gegangen? Wie konnten Sie das zulassen? Sind Sie, Herr Augstein, überhaupt noch da?"
Er war da und blieb - bis zum letzten Tag. Er blieb die Seele des "Unternehmens Aufklärung", das der SPIEGEL war und ist, und er war keiner, der das Magazin als politisches Kampfinstrument begriff. "Der Journalist", schrieb er, "hat nicht das Mandat, Wahlen zu gewinnen und Parteien zu promovieren. Er gerät auf die Verliererstraße, wenn er versucht, Kanzler und Minister zu machen, Große oder Kleine Koalitionen zu begünstigen, kurz, wenn er der Versuchung erliegt, Politik treiben zu wollen. Unternimmt er es dagegen, Erkenntnissen zum Durchbruch zu verhelfen und zu sagen, was ist, dann ist er mächtig." Das war keine falsche Bescheidenheit, sondern Einsicht in die wirkliche Wirksamkeit der Presse: "Richtig informieren heißt auch schon verändern." Und: "Wenn Einfluss auf die Geister Macht ist, dann hat der Journalist auch Macht." Die aber hielt er für "ziemlich begrenzt".
Er selbst fühlte sich als Gefangener seines Systems, "das mich zwingt, das Handwerk über die Politik und über die Meinung zu stellen". Wobei er schon 1953, als er vor Sensationsjournalismus und einer Auflage um jeden Preis warnte, die Gefahr sah, dass der SPIEGEL "das Wichtige zu Gunsten des Interessanten vernachlässigt. Dass er nicht die Wirklichkeiten, sondern die Raritäten der Wirklichkeit spiegelt".
Natürlich sollte das Heft - wie es Rudolf Augstein 1993 noch einmal ausdrücklich festhielt - auch ein bisschen L`art pour l`art vermitteln und den Käufern Spaß machen: "Wir müssen den Lesern gute Geschichten liefern. Lesbar und informativ müssen sie sein, und vergnüglich dürfen sie auch sein."
Als eine der vornehmsten Aufgaben empfand er, den tierischen Ernst und die politische Wichtigtuerei bloßzulegen. "Dass die Journalisten dabei ihr Tun nicht überschätzen und ein brauchbares Maß an Selbstironie nicht unterschätzen sollten, versteht sich von selbst."
Aber er hatte auch durchaus Spaß daran, andere zu ärgern. Wenn es Tatsachen und Text erlaubten, kannte er keine Kameraden, keine alten und keine neuen. Dann hatte er zum Beispiel diebische Freude am Komplettverriss des großen G. G. durch den nicht minder großen M. R.-R. Auf dem weiten Feld seiner Jagdleidenschaft lagen viele Opfer - Feinde und Freunde. "In der Politik", erkannte er, "sind es oft die schlimmsten Feinde, die sich duzen. Ich habe mich mit vielen Politikern geduzt, doch als Journalist habe ich wenig Rücksicht darauf genommen. Ein Journalist kann keine permanenten Freundschaften haben."
Am Ende sind sie doch alle wiedergekommen. Franz Josef Strauß, der Augstein ins Gefängnis brachte, darüber als Minister stürzte und dennoch zurück an die Macht gelangte. Seine Memoiren musste posthum natürlich der SPIEGEL drucken. Da war Augstein Profi - und immerhin hatte er ja ein gut Teil der politischen und wirtschaftlichen Karriere des Blattes dem durchgeknallten Verfolgungseifer seines Lieblingsfeindes zu verdanken. Und mit Konrad Adenauer, der ihn in den frühen Jahren der Bonner Republik mehrmals als Unglück für Volk und Vaterland gegeißelt hatte, rauchte er noch kurz vor dessen Tod 1967 während eines langen Dialogs "die Friedenspfeife".
Leistungen erkannte er an - wie im Falle Helmut Kohls, der ihm ansonsten eher Fremdgefühle einflößte. Obschon der SPIEGEL den jahrelang und vergeblich aus dem Amt zu schreiben versucht hatte, belobigte ihn Augstein zur gelungenen Wiedervereinigung - und nicht nur zur Freude seiner damaligen Redaktion - mit einem herzhaften "Glückwunsch, Kanzler!" Um ihn gleich darauf wieder heftig zu kritisieren. Je nach Lage eben.
Von ihm hart attackierte Politiker bekamen immer wieder eine Chance zur Besserung - bis er sie erneut scharf ins Visier nahm. Er war ein unabhängiger Geist, der nie erwartete, dass der SPIEGEL ihm immer folgte, dass das Blatt immer auf seiner Linie lag: "Rein rechtlich bestimmt der Herausgeber die geistige Richtung des Blattes. Dies war natürlich immer Makulatur. Ich bin doch keine Verhinderungsmaschine. Aber der Herausgeber muss sich nicht allem anpassen, was in dem Blatt, das er herausgibt, gedruckt wird. Ich schreibe, was ich denke, weil das die einzige Richtlinienkompetenz ist, die mir verblieben ist. Und nach der muss sich niemand richten."
Ob dies tatsächlich seine ganze Macht sei, erkundigten sich irritiert einige seiner Jungredakteure, und Augstein bekräftigte: "Alle diese Hebel, die man theoretisch hat, nutzen sich so schnell ab. Wenn ich meine Befugnisse ausschöpfen würde, das wäre verheerend."
Rudolf Augstein hat von seiner Richtlinienkompetenz sparsam Gebrauch gemacht, zumindest in den letzten Jahren. Er hat sein publizistisches Kind laufen lassen, es wohlwollend und kritisch begleitet. Er wollte, hat er gesagt, kein Denkmal sein, aber wohl gewusst, dass er das sowieso ist.
Die Frage, ob er sich für unentbehrlich halte, beschied er auf die für ihn typische Weise: "Unentbehrlich ist niemand. Aber es ist ein Unterschied, ob ich tot bin oder als Lebender nichts für den Laden tue."
Er hat durchgehalten, bis zum letzten Atemzug. Einer, dessen Lebensaufgabe identisch war mit seiner Person. Rudolf Augstein war der SPIEGEL, der SPIEGEL war Rudolf Augstein - und so bleibt es.
"Wird es nach Ihnen noch einen Herausgeber geben?", fragten ihn Mitarbeiter, als er 70 wurde, und er antwortete: "Das ist nicht zwingend für die Zukunft."
Nein, es ist nicht zwingend. Denn Rudolf Augstein wird bleiben, solange es den SPIEGEL gibt.
Nach ihm kann und wird es keinen Herausgeber geben, der diesen Titel verdient. Die Schuhe sind zu groß. Sie sich anzuziehen wäre eine Anmaßung. So wird der Gründer und Herausgeber des SPIEGEL, Rudolf Augstein, auch weiterhin die Richtlinien vorgeben. Tot und doch lebendig.

STEFAN AUST ZUM TOD VON RUDOLF AUGSTEIN
(11. November 2002)
"Der hier liegt, starb zu früh", das sollte auf seinem Grabstein stehen. Oder: "Er hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan." Aber: "Von mir aus bedarf es überhaupt keines Steines. Mir würde genügen, wenn einige Leute den Gedanken hegten, der SPIEGEL sei diesem Lande mehr nützlich als schädlich gewesen und sei es noch."
Jetzt ist er tot. Rudolf Augstein starb am Morgen des 7. November. Zwei Tage zuvor, am 5., war er 79 geworden. "Remember, remember the 5th of November", das hatte er immer wieder gesagt, zum Guy-Fawkes-Day. Im Jahre 1605 wollte dieser englische Katholik mit 36 Fass Schießpulver das House of Lords in die Luft sprengen. Der Plan flog auf, und Guy Fawkes sowie sieben weitere Verschwörer wurden hingerichtet.
So weit wollte die Staatsmacht im Fall Rudolf Augstein denn doch nicht gehen. Aber immerhin 103 Tage Gefängnis hatte im Oktober 1962 die vorübergehend kurzgeschlossene zweite und dritte Gewalt des Adenauer-Staates zu bieten. Genau 40 Jahre ist das her - und die SPIEGEL-Affäre ging ein in die Geschichte der Bundesrepublik.
Rudolf Augstein wurde zum Symbol für journalistischen Widerstand gegen die aus dem demokratischen Ruder laufende Staatsmacht. Er wurde ein Held wider Willen. Als er mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille geehrt werden sollte, lehnte er das ab: "Mir schien ein Missverständnis vorzuliegen. Nur weil auch ich, wie Ossietzky, wegen unterstellten Landesverrats im Gefängnis gesessen hatte, durfte ich mich doch nicht diesem von den Nazis im KZ auf den Tod misshandelten Friedensnobelpreisträger des Jahres 1935 an die Seite stellen."
Die Presse als vierte Gewalt? Gern erzählte Augstein die Geschichte vom ungarischen Schuster, der einst in einem kleinen Dorf sein Einmonatsblättchen redigierte und glücklich vor sich hin murmelte: "Was wird der Zar sich am Montag ärgern!"
Und doch freute er sich jeden Samstag nach Druck des SPIEGEL darauf, "wo der Torpedo am Montag einschlagen würde".
Rudolf Augstein wollte Öffentlichkeit herstellen, nicht mehr, aber auch nicht weniger: "Ich gebe mich der Hoffnung hin, wir hätten dazu mehr beigetragen als viele andere." "Sturmgeschütz der Demokratie" hatte er in jungen Jahren den SPIEGEL genannt. Das Zitat aber, das seither dem Nachrichten-Magazin als Etikett anhängt, war durchaus ironisch gemeint und lautet in der Fassung von 1963: "In der Ära Adenauer waren wir das Sturmgeschütz der Demokratie, mit verengten Sehschlitzen. Im ärgsten Kampfgetümmel, wo man uns manche Hafthohlladung appliziert hatte, erreichten wir nicht entfernt die Wirkung wie in dem Moment, da man uns wie mit einem Netz auf den Trockenboden schleppte und die Armierung zu demontieren gedachte."
Und später, als 70-Jähriger, fügte er hinzu: "Sturmgeschütze sind nur in Zeiten angebracht, wo es etwas zu stürmen gibt." Auf das erstaunte "Wie bitte?" junger SPIEGEL-Redakteure antwortete er: "Das Land ist im Kern gesund", um gleich danach die Position zu wechseln: "Wenn ich sage, Deutschland ist ein kerngesundes Land, dürfen Sie die Ironie, die mitschwingt, da das Zitat schließlich von Heine stammt, nicht außer Acht lassen."
Das war seine Dialektik. Er ließ sich nie auf etwas festnageln, was man in den neunziger Jahren als Political Correctness zu bezeichnen begann: "Wenn ich meiner Sache sicher bin, ist mir egal, was andere Leute dazu sagen und schreiben."
Er war unabhängig und kritisch, vor allem gegen die Regierenden aller Couleur, zuweilen auch unberechenbar, aber nie zu instrumentalisieren. Den Journalismus vor den geschäftlichen Erfolg zu setzen - der kommt dann schon von selbst - ist ihm stets wichtig gewesen. Und er wusste, dass der SPIEGEL sich verändern musste. Als 1955 ein farbiger Titel erschien, schrieb der Herausgeber einen fiktiven Leserbrief an sich selbst: "Muss jetzt auch der SPIEGEL dem illustrierten Zeitgeist Tribut zollen? Sind Sie unter die Schönfärber gegangen? Wie konnten Sie das zulassen? Sind Sie, Herr Augstein, überhaupt noch da?"
Er war da und blieb - bis zum letzten Tag. Er blieb die Seele des "Unternehmens Aufklärung", das der SPIEGEL war und ist, und er war keiner, der das Magazin als politisches Kampfinstrument begriff. "Der Journalist", schrieb er, "hat nicht das Mandat, Wahlen zu gewinnen und Parteien zu promovieren. Er gerät auf die Verliererstraße, wenn er versucht, Kanzler und Minister zu machen, Große oder Kleine Koalitionen zu begünstigen, kurz, wenn er der Versuchung erliegt, Politik treiben zu wollen. Unternimmt er es dagegen, Erkenntnissen zum Durchbruch zu verhelfen und zu sagen, was ist, dann ist er mächtig." Das war keine falsche Bescheidenheit, sondern Einsicht in die wirkliche Wirksamkeit der Presse: "Richtig informieren heißt auch schon verändern." Und: "Wenn Einfluss auf die Geister Macht ist, dann hat der Journalist auch Macht." Die aber hielt er für "ziemlich begrenzt".
Er selbst fühlte sich als Gefangener seines Systems, "das mich zwingt, das Handwerk über die Politik und über die Meinung zu stellen". Wobei er schon 1953, als er vor Sensationsjournalismus und einer Auflage um jeden Preis warnte, die Gefahr sah, dass der SPIEGEL "das Wichtige zu Gunsten des Interessanten vernachlässigt. Dass er nicht die Wirklichkeiten, sondern die Raritäten der Wirklichkeit spiegelt".
Natürlich sollte das Heft - wie es Rudolf Augstein 1993 noch einmal ausdrücklich festhielt - auch ein bisschen L`art pour l`art vermitteln und den Käufern Spaß machen: "Wir müssen den Lesern gute Geschichten liefern. Lesbar und informativ müssen sie sein, und vergnüglich dürfen sie auch sein."
Als eine der vornehmsten Aufgaben empfand er, den tierischen Ernst und die politische Wichtigtuerei bloßzulegen. "Dass die Journalisten dabei ihr Tun nicht überschätzen und ein brauchbares Maß an Selbstironie nicht unterschätzen sollten, versteht sich von selbst."
Aber er hatte auch durchaus Spaß daran, andere zu ärgern. Wenn es Tatsachen und Text erlaubten, kannte er keine Kameraden, keine alten und keine neuen. Dann hatte er zum Beispiel diebische Freude am Komplettverriss des großen G. G. durch den nicht minder großen M. R.-R. Auf dem weiten Feld seiner Jagdleidenschaft lagen viele Opfer - Feinde und Freunde. "In der Politik", erkannte er, "sind es oft die schlimmsten Feinde, die sich duzen. Ich habe mich mit vielen Politikern geduzt, doch als Journalist habe ich wenig Rücksicht darauf genommen. Ein Journalist kann keine permanenten Freundschaften haben."
Am Ende sind sie doch alle wiedergekommen. Franz Josef Strauß, der Augstein ins Gefängnis brachte, darüber als Minister stürzte und dennoch zurück an die Macht gelangte. Seine Memoiren musste posthum natürlich der SPIEGEL drucken. Da war Augstein Profi - und immerhin hatte er ja ein gut Teil der politischen und wirtschaftlichen Karriere des Blattes dem durchgeknallten Verfolgungseifer seines Lieblingsfeindes zu verdanken. Und mit Konrad Adenauer, der ihn in den frühen Jahren der Bonner Republik mehrmals als Unglück für Volk und Vaterland gegeißelt hatte, rauchte er noch kurz vor dessen Tod 1967 während eines langen Dialogs "die Friedenspfeife".
Leistungen erkannte er an - wie im Falle Helmut Kohls, der ihm ansonsten eher Fremdgefühle einflößte. Obschon der SPIEGEL den jahrelang und vergeblich aus dem Amt zu schreiben versucht hatte, belobigte ihn Augstein zur gelungenen Wiedervereinigung - und nicht nur zur Freude seiner damaligen Redaktion - mit einem herzhaften "Glückwunsch, Kanzler!" Um ihn gleich darauf wieder heftig zu kritisieren. Je nach Lage eben.
Von ihm hart attackierte Politiker bekamen immer wieder eine Chance zur Besserung - bis er sie erneut scharf ins Visier nahm. Er war ein unabhängiger Geist, der nie erwartete, dass der SPIEGEL ihm immer folgte, dass das Blatt immer auf seiner Linie lag: "Rein rechtlich bestimmt der Herausgeber die geistige Richtung des Blattes. Dies war natürlich immer Makulatur. Ich bin doch keine Verhinderungsmaschine. Aber der Herausgeber muss sich nicht allem anpassen, was in dem Blatt, das er herausgibt, gedruckt wird. Ich schreibe, was ich denke, weil das die einzige Richtlinienkompetenz ist, die mir verblieben ist. Und nach der muss sich niemand richten."
Ob dies tatsächlich seine ganze Macht sei, erkundigten sich irritiert einige seiner Jungredakteure, und Augstein bekräftigte: "Alle diese Hebel, die man theoretisch hat, nutzen sich so schnell ab. Wenn ich meine Befugnisse ausschöpfen würde, das wäre verheerend."
Rudolf Augstein hat von seiner Richtlinienkompetenz sparsam Gebrauch gemacht, zumindest in den letzten Jahren. Er hat sein publizistisches Kind laufen lassen, es wohlwollend und kritisch begleitet. Er wollte, hat er gesagt, kein Denkmal sein, aber wohl gewusst, dass er das sowieso ist.
Die Frage, ob er sich für unentbehrlich halte, beschied er auf die für ihn typische Weise: "Unentbehrlich ist niemand. Aber es ist ein Unterschied, ob ich tot bin oder als Lebender nichts für den Laden tue."
Er hat durchgehalten, bis zum letzten Atemzug. Einer, dessen Lebensaufgabe identisch war mit seiner Person. Rudolf Augstein war der SPIEGEL, der SPIEGEL war Rudolf Augstein - und so bleibt es.
"Wird es nach Ihnen noch einen Herausgeber geben?", fragten ihn Mitarbeiter, als er 70 wurde, und er antwortete: "Das ist nicht zwingend für die Zukunft."
Nein, es ist nicht zwingend. Denn Rudolf Augstein wird bleiben, solange es den SPIEGEL gibt.
Nach ihm kann und wird es keinen Herausgeber geben, der diesen Titel verdient. Die Schuhe sind zu groß. Sie sich anzuziehen wäre eine Anmaßung. So wird der Gründer und Herausgeber des SPIEGEL, Rudolf Augstein, auch weiterhin die Richtlinien vorgeben. Tot und doch lebendig.
.
Götz Aly :
Was geschah mit den Besitztümern der ermordeten Juden Europas?
Zur Ökonomie der Nazis
Landläufig stellt man sich den „Arisierungsgewinnler“ als beziehungsreichen Selbstständigen oder Konzernmanager vor, auch als korrupten kleineren oder größeren Nazifunktionär, manchmal als Kollaborateur, der sich seine schmutzigen Dienste für die Besatzungsmacht aus „entjudetem“ Eigentum honorieren ließ. Nur schwach wird im öffentlichen Bewusstsein gehalten, dass 1942/43 in Hamburg allein aus Holland 45 Schiffsladungen mit insgesamt 27227 Tonnen „Judengut“ gelöscht wurden – gedacht als unbürokratische Aufmunterung für die von Bombenangriffen extrem schwer getroffene Stadt. Bei den regelmäßigen Volksauktionen im Hafen ersteigerten sich mehr als 100000 Hamburger einzelne Stücke aus dem Geraubten – genauer gesagt: hauptsächlich Hamburgerinnen, die Männer standen an der Front. Eine Augenzeugin berichtete: „Die einfachen Hausfrauen auf der Veddel trugen plötzlich Pelzmäntel, handelten mit Kaffee und Schmuck, hatten alte Möbel und Teppiche aus dem Hafen, aus Holland, aus Frankreich…“ Mitten im Krieg.
Doch führt jede Darstellung, die sich allein auf die genannten, sehr unterschiedlichen Kreise von Profiteuren konzentriert, in die Irre. Sie verfehlt den Kern der Sache, wenn versucht werden soll, die Frage zu beantworten, wo das Eigentum der expropriierten und zum großen Teil ermordeten Juden Europas geblieben ist. Sie lässt sich nur dann klären, wenn immer wieder die Finanzverwaltungen und Nationalbanken in Deutschland, in den verbündeten und besetzten Ländern in den Blick genommen werden.
Zwei Tage nach dem Pogrom vom 9. November 1938 verfügte Hermann Göring die Zahlung von einer Milliarde Reichsmark als „Sühneleistung der deutschen Juden“. Mit seiner Durchführungsverordnung gestaltete das Reichsfinanzministerium die „Sühneleistung“ zu einer Vermögensabgabe von 20 Prozent aus. Jeder Betroffene musste die fällige Geldsumme in vier Teilbeträgen an das zuständige Finanzamt entrichten, und zwar „ohne besondere Aufforderung“ am 15. Dezember 1938, am 15. Februar, 15. Mai und 15. August 1939.
Insgesamt trieb der Fiskus auf diesem Weg 1,2 Milliarden Reichsmark bei und verbuchte sie unter dem Haushaltstitel „Sonstige Einnahmen“. Die regulären Reichseinnahmen beliefen sich im Haushaltsjahr 1938/39 auf etwa 20 Milliarden Reichsmark. Die Judenkontribution erhöhte sie also um sechs Prozent. Wenn man sich für einen Moment vorstellt, der Bundesfinanzminister könnte heute ohne Steuererhöhungen über plötzliche Mehreinnahmen von sechs Prozent verfügen – das wären 15 Milliarden Euro –, dann offenbart sich sofort, wie entspannend die Zusatzeinnahme von 1,2 Milliarden Reichsmark auf den Durchschnittsarier gewirkt haben muss.
Am 23. November 1938 erörterten die Vorstände der fünf Berliner Großbanken – neben den drei heute noch aktiven Bankhäusern Dresdner, Commerz- und Deutsche Bank die Reichskreditgesellschaft und die Berliner Handelsgesellschaft – im Reichswirtschaftsministerium „die sich durch die Judengesetzgebung ergebende Situation“ und erfuhren dort von dem Beschluss einer „Überführung des gesamten Grundstücks- und Effekten-Vermögens aus jüdischem Besitz in zunächst staatliche und später vielleicht private Hände“. In Aussicht standen weitere sechs Milliarden Reichsmark, also eine Verstetigung der Zusatzeinnahmen für die nächsten Jahre. Die deutschen Banken gewährten Juden keine Darlehen mehr, weil sie infolge der politischen Diskriminierung zu – kredittechnisch gesprochen – „schlechten Risiken“ geworden waren. Um die Zwangsabgabe zu bezahlen, mussten die Tributpflichtigen daher Wertpapiere, Schmuck und Grundstücke veräußern.
Das machte die Bankiers nervös, da sie „überstürzte und unsachkundige Verkäufe“ von Aktien und damit die Gefahr einer „Déroute am Effektenmarkt“ befürchteten. Schließlich ging es um den für damalige Begriffe „ungeheuren Effektenblock“ von 1,5 Milliarden Reichsmark. Sie wollten, dass die Aktienpakete „langsam und unter entsprechender Marktpflege“ verkauft würden, mit der Einschränkung allerdings, „dass ein Kursrisiko irgendwelcher Art den Banken nicht aufgebürdet werden“ dürfe. Zur technischen Durchführung erklärten sie: „Wir schlagen vor, die so anfallenden Effekten zur Vermeidung unnötiger Arbeit bei den Hinterlegungsstellen, bei denen sie zur Zeit deponiert sind, zu Gunsten des Reichsfinanzministeriums zu sperren und sie dann je nach Lage des Kapitalmarktes sachlich und pfleglich zu Gunsten der Reichsfinanzverwaltung zu veräußern.“ Aber der Hitler-Staat war pleite. Das Reichsbankdirektorium warnte längst schon vor dem „unbegrenzten Anschwellen der Staatsausgaben“, das „trotz ungeheuerer Anspannung der Steuerschraube die Staatsfinanzen an den Rand des Zusammenbruchs“ führe. In dieser Situation erboten sich die Banken, „der Reichsfinanzverwaltung auf die abzuliefernden Effekten [der Juden, d. A.] einen angemessenen Kassenvorschuss zu gewähren, über dessen Bedingungen eine Verständigung wohl unschwer erfolgen könnte“. So wurde verfahren.
Die Spitzen der deutschen Großbanken betätigten sich in diesem Fall nicht als Räuber, wohl aber als Raubgehilfen, als konstruktive Mitorganisatoren, die das effektivste Enteignungsverfahren gewährleisteten. Ferner machten sie sich zu Hehlern. Sie verwandelten das Geraubte in bares Geld. Für den Vertrauensbruch und Kundenverrat berechnete zum Beispiel die Deutsche Bank ein halbes Prozent Verkaufsprovision zuzüglich der Umschreibungsspesen zulasten ihrer jüdischen Kunden. Auch belebte der weitere Handel mit den vorübergehend verstaatlichten Wertpapieren das Geschäft und eröffnete die Möglichkeit des eigenen, privilegierten Zugriffs. In der Hauptsache jedoch floss der Erlös in die deutsche Staatskasse und minderte die Lasten für die Allgemeinheit. Dasselbe galt selbstverständlich auch für Lebensversicherungen, die zum vertraglich festgelegten Rückkaufwert an den Reichsfiskus ausbezahlt wurden.
Will man darüber hinaus die Enteignung der Juden in den von Deutschland besetzten und abhängigen Ländern begreifen, dann erfordert das einen kurzen Blick auf die Technik der Kriegsfinanzierung. Der Erste Weltkrieg wurde in Deutschland zu 84 Prozent über Anleihen finanziert, nur zu 16 Prozent aus Steuern und Abgaben. Für den mehr als viermal so teuren Zweiten Weltkrieg galt von Anfang an die „goldene Deckungsquote“ von 50 Prozent Staatseinnahmen und 50 Prozent Verschuldung. So sollte gleich jede Erinnerung an die Kriegsinflation von 1914 bis 1918, die immerhin 100 Prozent ausgemacht hatte, und an die Hyperinflation von 1923 vermieden werden. Diese Vorgabe konnte die deutsche Finanzverwaltung bis einschließlich 1944 einigermaßen durchhalten. Nur wie? Etwa die Hälfte der regulären Staatseinnahmen hatten die besetzten und abhängigen Länder aufzubringen. Ihnen wurden ungeheuerliche Kontributionen und weit überhöhte Besatzungskostenzahlungen, Kredite und selbst Kriegsanleihen aufgebürdet. Man rechnet mit insgesamt etwa 100 bis 120 Milliarden Reichsmark.
Jüdische Vermögen verwandeln sich in Soldatensold
Prinzipiell sollte sich der Krieg nach dem Willen der deutschen Führung weitgehend aus den besetzten Ländern finanzieren. Daher bezogen deutsche Soldaten ihren Sold stets in der jeweiligen Landeswährung und sollten ihn dort möglichst verausgaben. Auf dieselbe Art wurden alle Dienstleistungen, Rohstoff-, Material- und Lebensmittellieferungen für die deutsche Wehrmacht und für die Ausfuhr ins Reich bezahlt. Das verlagerte den für einen Krieg typischen Inflationsdruck aus Deutschland ins europäische Ausland. Nun konnten die deutschen Besatzungsverwaltungen und Kollaborationsregierungen zwar eine mäßige Geldentwertung in Kauf nehmen, nicht jedoch eine galoppierende. Sie würde, das war allen Verantwortlichen klar, sofort jede okkupatorische Ordnung untergraben und die geregelte Ausplünderung der unterworfenen Länder verunmöglichen. An dieser Stelle der Kriegsfinanzpolitik kamen – unter äußerster Geheimhaltung – die Vermögen der europäischen Juden ins Spiel.
Nehmen wir als erstes Beispiel das Militärverwaltungsgebiet Serbien. Hier hatten die Deutschen bereits Anfang Mai 1942 alle Juden ermordet, derer sie habhaft geworden waren; hier stellte sich die Frage nach der vollständigen Verwertung ihrer materiellen Hinterlassenschaft früh. Natürlich hatten sich an den herrenlos gewordenen Werten bereits eine Vielzahl von Interessenten bereichert, insbesondere Volksdeutsche im Westbanat. Aber das Vermögen der Belgrader Juden war noch zu mehr als 80 Prozent unberührt geblieben. Nach einigen Diskussionen verfügte Göring am 25. Juni 1942, „das jüdische Vermögen in Serbien“ sei „zu Gunsten Serbiens einzuziehen“. Damit beabsichtigte er – so wörtlich – „eine finanzielle Hilfe für den durch die Last der Besatzungskosten ohnehin stark beanspruchten serbischen Staatshaushalt zu ermöglichen“. Die serbische Kollaborationsregierung erließ das entsprechende Gesetz.
Im Sommer 1942 betrugen die monatlichen Besatzungskosten 500 Millionen Dinar; das Gesamtvermögen der serbischen Juden schätzte man auf drei bis vier Milliarden Dinar. Zum Zeitpunkt der Berliner Entscheidung reichte diese Summe also aus, um die Besatzungskosten für ein gutes halbes Jahr zu decken beziehungsweise dafür, über einen längeren Zeitraum den Inflationsdruck auf die serbische Währung zu mindern. Praktisch lenkte die deutsche Besatzungsverwaltung auf Anordnung der Reichsregierung die Erträge aus der Verwertung des jüdischen Gesamtvermögens zuerst in die serbische Staatskasse und von dort – gemischt mit dem Geldstrom, der sich hauptsächlich aus der Notenpresse speiste – in den Besatzungskostenhaushalt.
Am 19. März 1944 besetzten die Deutschen das bis dahin verbündete Ungarn. Im April enteigneten ungarische Behörden die 700000 Juden des Landes komplett, 430000 von ihnen wurden im Mai und Juni in großer Eile nach Auschwitz deportiert. Die Besatzungskosten, die die Deutschen zunächst verlangten, lagen bei 75 Prozent des durch die ungarische Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion schon stark aufgeblähten Staatshaushalts. Am 31. Mai 1944 erklärte der zuständige Beamte im Reichswirtschaftsministerium auf einer Sitzung des „Ungarn-Ausschusses“ zur Frage der Besatzungslasten: „Die ungarische Judengesetzgebung ist inzwischen weiter vervollständigt worden. Die ungarische Regierung rechnet damit, dass die großen finanziellen Anstrengungen, die im Rahmen der gemeinsamen Kriegsführung notwendig werden, weitgehend aus dem Judenvermögen bestritten werden können. Die Vermögen sollen mindestens ein Drittel des Nationalvermögens betragen.“
Der für die Enteignung zuständige ungarische Beamte – es handelte sich um den Verwaltungschef des Branntweinmonopols – teilte zum selben Zeitpunkt mit, „dass die beschlagnahmten Judenvermögen zur Deckung der Kriegskosten und zur Wiedergutmachung der durch Bombenangriffe verursachten Schäden verwendet werden“. Die Neue Zürcher Zeitung analysierte am 3. August 1944 die Lage in Ungarn: „Bei der Arisierung jüdischer Unternehmen ist der behördlich festgesetzte Kaufpreis sofort in bar zu bezahlen, was zeigt, dass die Aktion wie seinerzeit in Deutschland eine gewisse fiskalische Bedeutung (Erleichterung der Kriegsfinanzierung) besitzt.“ Die Sachwerte und Depositen wurden wie überall von Ungarn für Ungarn verwertet – in Geld verwandelt, floss der Erlös dann zu einem erheblichen Teil in die deutsche Kriegskasse.
Die Plünderung der Juden von Saloniki im Jahre 1943
Nehmen wir als letztes Beispiel den Spezialfall Griechenland. Hier herrschte im Herbst 1942 eine extrem schnell voranschreitende Entwertung des Geldes. In dieser Situation ernannte Hitler im Oktober einen Sonderbeauftragten, dem sofort der Judenreferent des Auswärtigen Amtes zur Seite gestellt wurde. Er hieß Eberhard von Thadden und beteiligte sich bis zum Februar 1943 an den Vorbereitungen zur Deportation der nordgriechischen Juden, das waren fast ausschließlich die mehr als 50000 jüdischen Bürger von Saloniki. In seinen Reisekostenabrechnungen gab von Thadden als Grund seiner Athen-Flüge an: „Sonderauftrag des Führers betr. Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Griechenland“.
Dort hatte sich neben der Drachme bereits eine zweite Währung etabliert – das Gold. Daher brauchten es auch die Deutschen. Ihre Goldforderungen an die jüdische Kultusgemeinde und an wohlhabende Einzelpersonen setzten sofort mit der „Aktion zur Stabilisierung der griechischen Währung“ ein. Aus den Berichten der Überlebenden ist bekannt, wie der Wehrmachtsbefehlshaber von Saloniki, Max Merten, die verängstigten und gedemütigten Juden mit falschen Versprechen immer wieder zu Zahlungen zwang und höhnisch brüllte: „Goldbarren sind der Tarif“. Einige Tage vor der Deportation nach Auschwitz im März 1943 wurden die Opfer in ein kleines Warteghetto in der Nähe des Bahnhofs von Saloniki ge-bracht: „Dort mußten sie alles abgeben, Schmuck und alle goldenen Gegenstände.“
Mithilfe von Spitzeln und Folter zwangen Mitarbeiter Eichmanns die Wehrlosen, die Verstecke ihres Schmuckes und Goldes preiszugeben. So „füllte sich die Schatzkammer der Vélissarioustraße mit allen Kostbarkeiten Ali Babas“, wie es bei Michael Molho, dem griechisch-jüdischen Chronisten der Tragödie heißt: „Auf den Tischen lagen wohlgeordnet und in verschiedenen Haufen Ringe mit Diamanten und Edelsteinen aller Nuancen und Größen, Broschen, Medaillons, Armreifen, Goldketten, Trauringe, Uhren in jeder Form, Münzen, geordnet nach Bildern und Jahreszahlen, amerikanische und kanadische Dollars, Pfund Sterling, Schweizer Franken etc. Auf der Erde häuften sich an: Vasen, chinesische Porzellangefäße, seltene Objekte, enorme Stapel von Teppichen. Es war, auf diesem Raum relativ zusammengepfercht, ein Überfluss an Reichtümern, den selbst die überschwengliche Phantasie eines Alexandre Dumas nicht sich hätte spiegeln lassen in den Augen seines Monte Christo.“ Allein an Gold erbeuteten die Deutschen in Saloniki nach verlässlichen Feststellungen aus dem Jahr 1946 „die eindrucksvolle Menge von über 12 t. Feingold“. Zu diesem Zweck wurden selbst noch die Gräber auf dem in Bauland umgewandelten uralten jüdischen Friedhof von Thessaloniki nach Gold durchwühlt.
Das geraubten Gold setzten die Deutschen ausgesprochen effizient ein. Sie verwandten es mit Wissen der griechischen Finanzverwaltung und mithilfe griechischer Vertrauensmakler zu Stützungskäufen an der Börse. Kaum ging es im Juli/August 1943 zur Neige, stieg die Inflation wieder steil an. Daher flogen die Deutschen im letzten Jahr der Besatzung acht Tonnen Gold zur weiteren Währungsstabilisierung nach Griechenland ein. Auch dieses Gold war geraubt – von überall in Europa, nicht allein von Juden, aber auch. Doch zeigt der Transport nach Griechenland, wie wichtig dieses Mittel war, um die täglichen Kriegskosten zu bezahlen. „Als Vorteil der Goldverkäufe“, so resümierte Hitlers Sonderbeauftragter für Griechenland, „steht die technische Entlastung der Notenpresse fest, da mittels Gold erhebliche Mengen Banknoten bar für den Wehrmachtsbedarf herausgeholt wurden.“
Im Oktober 1942 mussten die rumänischen Juden Gold, Silber, Schmuck und Wertsachen an die Staatskasse des Landes abliefern, um die Währung zu stabilisieren. Offensichtlich konnten damit nur zwei, drei Monate überbrückt werden. Daher schlossen die beiden Außenminister Ribbentrop und Antonescu am 11. Januar 1943 im Führerhauptquartier ein Geheimabkommen über die Lieferung von 30 Tonnen Gold aus den Beutetresoren der Reichsbank an die Rumänische Nationalbank, um so die rumänische Währung „für die im deutschen Interesse erfolgende zusätzliche Notenausgabe“ zu stabilisieren. In der Slowakei stabilisierte die Nationalbank die Währung durch den Verkauf von geraubten Edelsteinen. Woher die gekommen sein werden, liegt nahe.
Das große Schweigen der Banken und der Finanzminister
Der Verkauf von Gold, Sachwerten, Immobilien, Wertpapieren und Pretiosen erlaubte eine gewisse währungspolitische Stabilisierung in einem Krieg, der aus deutscher Sicht stets im nächsten halben Jahr gewonnen werden sollte.
Der übergroße Teil des Vermögens der enteigneten und ermordeten Juden Europas verschwand eben nicht in den Kellern schweizerischer oder deutscher Banken. Wo aber dann? NS-Deutschland verhängte im Zweiten Weltkrieg eine beispiellose Kriegslasten- und Schuldenunion über Europa. Als fester Posten auf der Habenseite wurden darin die Vermögen der enteigneten Juden Europas verbucht, in Ungarn deckten sie die Besatzungskosten wohl zu 100 Prozent, in anderen Ländern nur zu fünf, zehn oder 20 Prozent – in jedem Fall dämpfte die Arisierung die Spitzenlasten, sie bremste die Inflation.
Aus dem Besatzungskostenetat erhielten die deutschen Soldaten ihren Sold in der jeweiligen Landeswährung. Sie durften dieses Geld nicht mit nach Hause nehmen, sondern mussten und wollten es auf den jeweils einheimischen Märkten ausgeben. Sie bezahlten davon Lebensmittel, mit denen sie die Abermillionen Feldpostpäckchen für ihre Familien füllten, Schuhe, Seidenschals und Schmuck, die sie ihren Freundinnen und Frauen schickten; sie bezahlten davon Tabak, Schnaps oder den Besuch im Bordell. Mit anderen Teilen der Besatzungskosten wurden Rechnungen für die tägliche Truppenversorgung beglichen, für Kleidung, Transporte, Quartiere und Lazarettaufenthalte deutscher Soldaten oder die Bunker des Atlantikwalls. Alle diese Leistungen wurden mit Mitteln bezahlt, die einen zeitlich und örtlich unterschiedlichen, durch die Vermischung mit anderen Geldströmen anonymisierten Anteil der zu Geld verflüssigten Vermögenswerte der Juden Europas enthielten.
[b9Nach dem Krieg verschwiegen die beteiligten Beamten der Nationalbanken und Finanzministerien in sämtlichen europäischen Ländern ihre Kenntnisse über die Metamorphose der enteigneten Werte. Die überlebenden Opfer und ihre Anwälte durchschauten das System nicht. Daher findet sich in den Verfahren, die ausländische Antragsteller vor deutschen Wiedergutmachungsgerichten anstrengten, immer wieder dasselbe abweisende Argument: Nicht etwa die deutsche Besatzungsmacht, sondern die jeweilige nationale Regierung oder Verwaltung der besetzten oder verbündeten Länder habe die Juden enteignet. Das Vermögen sei daher nicht außer Landes, insbesondere nicht nach Deutschland gebracht worden. Folglich erging regelmäßig und in abertausend Fällen ein ablehnender Beschluss, begründet mit der angeblichen Unzuständigkeit deutscher Gerichte. Ebenso verstellte der einseitige Blick auf Banken, Konzerne und individuelle Profiteure den Blick.[/b]
Tatsächlich verhielt es sich so, wie der Vertreter des Auswärtigen Amtes in Belgrad im Sommer 1942 die staatlich organisierte Form der Geldwäsche beschrieb: „Das Vermögen der Juden in Serbien ist zu Gunsten Serbiens einzuziehen, weil eine Einziehung zu Gunsten des Reiches der Haager Landkriegsordnung wiedersprechen würde. Der Erlös kommt aber mittelbar uns zugute…“ Gemeint waren alle Deutschen. Sie profitierten in einer unaufdringlichen, schwer erkennbaren Form vom Mord an den europäischen Juden. Politisch gesehen, minderten die Enteignungsakte die Lasten des Krieges für jeden von ihnen. Das hob die Stimmung in Deutschland und stärkte das Massenvertrauen in die Staatsführung.
Das jüdische Eigentum in Europa wurde zugunsten fast aller Deutschen sozialisiert. Am Ende hatte jeder Wehrmachtsoldat einen Bruchteil davon in seinem Geldbeutel, jede deutsche Familie Speisen auf ihrem Teller, Kleidungsstücke im Schrank, die zu einem gewissen Teil davon bezahlt worden waren.
Der Zeithistoriker Götz Aly veröffentliche jüngst gemeinsam mit Christian Gerlach „Das letzte Kapitel. Der Mord an den ungarischen Juden“ (DVA 2002). Sein Beitrag ist die Rede zum Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938, gehalten in der Frankfurter Paulskirche
Götz Aly :
Was geschah mit den Besitztümern der ermordeten Juden Europas?
Zur Ökonomie der Nazis
Landläufig stellt man sich den „Arisierungsgewinnler“ als beziehungsreichen Selbstständigen oder Konzernmanager vor, auch als korrupten kleineren oder größeren Nazifunktionär, manchmal als Kollaborateur, der sich seine schmutzigen Dienste für die Besatzungsmacht aus „entjudetem“ Eigentum honorieren ließ. Nur schwach wird im öffentlichen Bewusstsein gehalten, dass 1942/43 in Hamburg allein aus Holland 45 Schiffsladungen mit insgesamt 27227 Tonnen „Judengut“ gelöscht wurden – gedacht als unbürokratische Aufmunterung für die von Bombenangriffen extrem schwer getroffene Stadt. Bei den regelmäßigen Volksauktionen im Hafen ersteigerten sich mehr als 100000 Hamburger einzelne Stücke aus dem Geraubten – genauer gesagt: hauptsächlich Hamburgerinnen, die Männer standen an der Front. Eine Augenzeugin berichtete: „Die einfachen Hausfrauen auf der Veddel trugen plötzlich Pelzmäntel, handelten mit Kaffee und Schmuck, hatten alte Möbel und Teppiche aus dem Hafen, aus Holland, aus Frankreich…“ Mitten im Krieg.
Doch führt jede Darstellung, die sich allein auf die genannten, sehr unterschiedlichen Kreise von Profiteuren konzentriert, in die Irre. Sie verfehlt den Kern der Sache, wenn versucht werden soll, die Frage zu beantworten, wo das Eigentum der expropriierten und zum großen Teil ermordeten Juden Europas geblieben ist. Sie lässt sich nur dann klären, wenn immer wieder die Finanzverwaltungen und Nationalbanken in Deutschland, in den verbündeten und besetzten Ländern in den Blick genommen werden.
Zwei Tage nach dem Pogrom vom 9. November 1938 verfügte Hermann Göring die Zahlung von einer Milliarde Reichsmark als „Sühneleistung der deutschen Juden“. Mit seiner Durchführungsverordnung gestaltete das Reichsfinanzministerium die „Sühneleistung“ zu einer Vermögensabgabe von 20 Prozent aus. Jeder Betroffene musste die fällige Geldsumme in vier Teilbeträgen an das zuständige Finanzamt entrichten, und zwar „ohne besondere Aufforderung“ am 15. Dezember 1938, am 15. Februar, 15. Mai und 15. August 1939.
Insgesamt trieb der Fiskus auf diesem Weg 1,2 Milliarden Reichsmark bei und verbuchte sie unter dem Haushaltstitel „Sonstige Einnahmen“. Die regulären Reichseinnahmen beliefen sich im Haushaltsjahr 1938/39 auf etwa 20 Milliarden Reichsmark. Die Judenkontribution erhöhte sie also um sechs Prozent. Wenn man sich für einen Moment vorstellt, der Bundesfinanzminister könnte heute ohne Steuererhöhungen über plötzliche Mehreinnahmen von sechs Prozent verfügen – das wären 15 Milliarden Euro –, dann offenbart sich sofort, wie entspannend die Zusatzeinnahme von 1,2 Milliarden Reichsmark auf den Durchschnittsarier gewirkt haben muss.
Am 23. November 1938 erörterten die Vorstände der fünf Berliner Großbanken – neben den drei heute noch aktiven Bankhäusern Dresdner, Commerz- und Deutsche Bank die Reichskreditgesellschaft und die Berliner Handelsgesellschaft – im Reichswirtschaftsministerium „die sich durch die Judengesetzgebung ergebende Situation“ und erfuhren dort von dem Beschluss einer „Überführung des gesamten Grundstücks- und Effekten-Vermögens aus jüdischem Besitz in zunächst staatliche und später vielleicht private Hände“. In Aussicht standen weitere sechs Milliarden Reichsmark, also eine Verstetigung der Zusatzeinnahmen für die nächsten Jahre. Die deutschen Banken gewährten Juden keine Darlehen mehr, weil sie infolge der politischen Diskriminierung zu – kredittechnisch gesprochen – „schlechten Risiken“ geworden waren. Um die Zwangsabgabe zu bezahlen, mussten die Tributpflichtigen daher Wertpapiere, Schmuck und Grundstücke veräußern.
Das machte die Bankiers nervös, da sie „überstürzte und unsachkundige Verkäufe“ von Aktien und damit die Gefahr einer „Déroute am Effektenmarkt“ befürchteten. Schließlich ging es um den für damalige Begriffe „ungeheuren Effektenblock“ von 1,5 Milliarden Reichsmark. Sie wollten, dass die Aktienpakete „langsam und unter entsprechender Marktpflege“ verkauft würden, mit der Einschränkung allerdings, „dass ein Kursrisiko irgendwelcher Art den Banken nicht aufgebürdet werden“ dürfe. Zur technischen Durchführung erklärten sie: „Wir schlagen vor, die so anfallenden Effekten zur Vermeidung unnötiger Arbeit bei den Hinterlegungsstellen, bei denen sie zur Zeit deponiert sind, zu Gunsten des Reichsfinanzministeriums zu sperren und sie dann je nach Lage des Kapitalmarktes sachlich und pfleglich zu Gunsten der Reichsfinanzverwaltung zu veräußern.“ Aber der Hitler-Staat war pleite. Das Reichsbankdirektorium warnte längst schon vor dem „unbegrenzten Anschwellen der Staatsausgaben“, das „trotz ungeheuerer Anspannung der Steuerschraube die Staatsfinanzen an den Rand des Zusammenbruchs“ führe. In dieser Situation erboten sich die Banken, „der Reichsfinanzverwaltung auf die abzuliefernden Effekten [der Juden, d. A.] einen angemessenen Kassenvorschuss zu gewähren, über dessen Bedingungen eine Verständigung wohl unschwer erfolgen könnte“. So wurde verfahren.
Die Spitzen der deutschen Großbanken betätigten sich in diesem Fall nicht als Räuber, wohl aber als Raubgehilfen, als konstruktive Mitorganisatoren, die das effektivste Enteignungsverfahren gewährleisteten. Ferner machten sie sich zu Hehlern. Sie verwandelten das Geraubte in bares Geld. Für den Vertrauensbruch und Kundenverrat berechnete zum Beispiel die Deutsche Bank ein halbes Prozent Verkaufsprovision zuzüglich der Umschreibungsspesen zulasten ihrer jüdischen Kunden. Auch belebte der weitere Handel mit den vorübergehend verstaatlichten Wertpapieren das Geschäft und eröffnete die Möglichkeit des eigenen, privilegierten Zugriffs. In der Hauptsache jedoch floss der Erlös in die deutsche Staatskasse und minderte die Lasten für die Allgemeinheit. Dasselbe galt selbstverständlich auch für Lebensversicherungen, die zum vertraglich festgelegten Rückkaufwert an den Reichsfiskus ausbezahlt wurden.
Will man darüber hinaus die Enteignung der Juden in den von Deutschland besetzten und abhängigen Ländern begreifen, dann erfordert das einen kurzen Blick auf die Technik der Kriegsfinanzierung. Der Erste Weltkrieg wurde in Deutschland zu 84 Prozent über Anleihen finanziert, nur zu 16 Prozent aus Steuern und Abgaben. Für den mehr als viermal so teuren Zweiten Weltkrieg galt von Anfang an die „goldene Deckungsquote“ von 50 Prozent Staatseinnahmen und 50 Prozent Verschuldung. So sollte gleich jede Erinnerung an die Kriegsinflation von 1914 bis 1918, die immerhin 100 Prozent ausgemacht hatte, und an die Hyperinflation von 1923 vermieden werden. Diese Vorgabe konnte die deutsche Finanzverwaltung bis einschließlich 1944 einigermaßen durchhalten. Nur wie? Etwa die Hälfte der regulären Staatseinnahmen hatten die besetzten und abhängigen Länder aufzubringen. Ihnen wurden ungeheuerliche Kontributionen und weit überhöhte Besatzungskostenzahlungen, Kredite und selbst Kriegsanleihen aufgebürdet. Man rechnet mit insgesamt etwa 100 bis 120 Milliarden Reichsmark.
Jüdische Vermögen verwandeln sich in Soldatensold
Prinzipiell sollte sich der Krieg nach dem Willen der deutschen Führung weitgehend aus den besetzten Ländern finanzieren. Daher bezogen deutsche Soldaten ihren Sold stets in der jeweiligen Landeswährung und sollten ihn dort möglichst verausgaben. Auf dieselbe Art wurden alle Dienstleistungen, Rohstoff-, Material- und Lebensmittellieferungen für die deutsche Wehrmacht und für die Ausfuhr ins Reich bezahlt. Das verlagerte den für einen Krieg typischen Inflationsdruck aus Deutschland ins europäische Ausland. Nun konnten die deutschen Besatzungsverwaltungen und Kollaborationsregierungen zwar eine mäßige Geldentwertung in Kauf nehmen, nicht jedoch eine galoppierende. Sie würde, das war allen Verantwortlichen klar, sofort jede okkupatorische Ordnung untergraben und die geregelte Ausplünderung der unterworfenen Länder verunmöglichen. An dieser Stelle der Kriegsfinanzpolitik kamen – unter äußerster Geheimhaltung – die Vermögen der europäischen Juden ins Spiel.
Nehmen wir als erstes Beispiel das Militärverwaltungsgebiet Serbien. Hier hatten die Deutschen bereits Anfang Mai 1942 alle Juden ermordet, derer sie habhaft geworden waren; hier stellte sich die Frage nach der vollständigen Verwertung ihrer materiellen Hinterlassenschaft früh. Natürlich hatten sich an den herrenlos gewordenen Werten bereits eine Vielzahl von Interessenten bereichert, insbesondere Volksdeutsche im Westbanat. Aber das Vermögen der Belgrader Juden war noch zu mehr als 80 Prozent unberührt geblieben. Nach einigen Diskussionen verfügte Göring am 25. Juni 1942, „das jüdische Vermögen in Serbien“ sei „zu Gunsten Serbiens einzuziehen“. Damit beabsichtigte er – so wörtlich – „eine finanzielle Hilfe für den durch die Last der Besatzungskosten ohnehin stark beanspruchten serbischen Staatshaushalt zu ermöglichen“. Die serbische Kollaborationsregierung erließ das entsprechende Gesetz.
Im Sommer 1942 betrugen die monatlichen Besatzungskosten 500 Millionen Dinar; das Gesamtvermögen der serbischen Juden schätzte man auf drei bis vier Milliarden Dinar. Zum Zeitpunkt der Berliner Entscheidung reichte diese Summe also aus, um die Besatzungskosten für ein gutes halbes Jahr zu decken beziehungsweise dafür, über einen längeren Zeitraum den Inflationsdruck auf die serbische Währung zu mindern. Praktisch lenkte die deutsche Besatzungsverwaltung auf Anordnung der Reichsregierung die Erträge aus der Verwertung des jüdischen Gesamtvermögens zuerst in die serbische Staatskasse und von dort – gemischt mit dem Geldstrom, der sich hauptsächlich aus der Notenpresse speiste – in den Besatzungskostenhaushalt.
Am 19. März 1944 besetzten die Deutschen das bis dahin verbündete Ungarn. Im April enteigneten ungarische Behörden die 700000 Juden des Landes komplett, 430000 von ihnen wurden im Mai und Juni in großer Eile nach Auschwitz deportiert. Die Besatzungskosten, die die Deutschen zunächst verlangten, lagen bei 75 Prozent des durch die ungarische Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion schon stark aufgeblähten Staatshaushalts. Am 31. Mai 1944 erklärte der zuständige Beamte im Reichswirtschaftsministerium auf einer Sitzung des „Ungarn-Ausschusses“ zur Frage der Besatzungslasten: „Die ungarische Judengesetzgebung ist inzwischen weiter vervollständigt worden. Die ungarische Regierung rechnet damit, dass die großen finanziellen Anstrengungen, die im Rahmen der gemeinsamen Kriegsführung notwendig werden, weitgehend aus dem Judenvermögen bestritten werden können. Die Vermögen sollen mindestens ein Drittel des Nationalvermögens betragen.“
Der für die Enteignung zuständige ungarische Beamte – es handelte sich um den Verwaltungschef des Branntweinmonopols – teilte zum selben Zeitpunkt mit, „dass die beschlagnahmten Judenvermögen zur Deckung der Kriegskosten und zur Wiedergutmachung der durch Bombenangriffe verursachten Schäden verwendet werden“. Die Neue Zürcher Zeitung analysierte am 3. August 1944 die Lage in Ungarn: „Bei der Arisierung jüdischer Unternehmen ist der behördlich festgesetzte Kaufpreis sofort in bar zu bezahlen, was zeigt, dass die Aktion wie seinerzeit in Deutschland eine gewisse fiskalische Bedeutung (Erleichterung der Kriegsfinanzierung) besitzt.“ Die Sachwerte und Depositen wurden wie überall von Ungarn für Ungarn verwertet – in Geld verwandelt, floss der Erlös dann zu einem erheblichen Teil in die deutsche Kriegskasse.
Die Plünderung der Juden von Saloniki im Jahre 1943
Nehmen wir als letztes Beispiel den Spezialfall Griechenland. Hier herrschte im Herbst 1942 eine extrem schnell voranschreitende Entwertung des Geldes. In dieser Situation ernannte Hitler im Oktober einen Sonderbeauftragten, dem sofort der Judenreferent des Auswärtigen Amtes zur Seite gestellt wurde. Er hieß Eberhard von Thadden und beteiligte sich bis zum Februar 1943 an den Vorbereitungen zur Deportation der nordgriechischen Juden, das waren fast ausschließlich die mehr als 50000 jüdischen Bürger von Saloniki. In seinen Reisekostenabrechnungen gab von Thadden als Grund seiner Athen-Flüge an: „Sonderauftrag des Führers betr. Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Griechenland“.
Dort hatte sich neben der Drachme bereits eine zweite Währung etabliert – das Gold. Daher brauchten es auch die Deutschen. Ihre Goldforderungen an die jüdische Kultusgemeinde und an wohlhabende Einzelpersonen setzten sofort mit der „Aktion zur Stabilisierung der griechischen Währung“ ein. Aus den Berichten der Überlebenden ist bekannt, wie der Wehrmachtsbefehlshaber von Saloniki, Max Merten, die verängstigten und gedemütigten Juden mit falschen Versprechen immer wieder zu Zahlungen zwang und höhnisch brüllte: „Goldbarren sind der Tarif“. Einige Tage vor der Deportation nach Auschwitz im März 1943 wurden die Opfer in ein kleines Warteghetto in der Nähe des Bahnhofs von Saloniki ge-bracht: „Dort mußten sie alles abgeben, Schmuck und alle goldenen Gegenstände.“
Mithilfe von Spitzeln und Folter zwangen Mitarbeiter Eichmanns die Wehrlosen, die Verstecke ihres Schmuckes und Goldes preiszugeben. So „füllte sich die Schatzkammer der Vélissarioustraße mit allen Kostbarkeiten Ali Babas“, wie es bei Michael Molho, dem griechisch-jüdischen Chronisten der Tragödie heißt: „Auf den Tischen lagen wohlgeordnet und in verschiedenen Haufen Ringe mit Diamanten und Edelsteinen aller Nuancen und Größen, Broschen, Medaillons, Armreifen, Goldketten, Trauringe, Uhren in jeder Form, Münzen, geordnet nach Bildern und Jahreszahlen, amerikanische und kanadische Dollars, Pfund Sterling, Schweizer Franken etc. Auf der Erde häuften sich an: Vasen, chinesische Porzellangefäße, seltene Objekte, enorme Stapel von Teppichen. Es war, auf diesem Raum relativ zusammengepfercht, ein Überfluss an Reichtümern, den selbst die überschwengliche Phantasie eines Alexandre Dumas nicht sich hätte spiegeln lassen in den Augen seines Monte Christo.“ Allein an Gold erbeuteten die Deutschen in Saloniki nach verlässlichen Feststellungen aus dem Jahr 1946 „die eindrucksvolle Menge von über 12 t. Feingold“. Zu diesem Zweck wurden selbst noch die Gräber auf dem in Bauland umgewandelten uralten jüdischen Friedhof von Thessaloniki nach Gold durchwühlt.
Das geraubten Gold setzten die Deutschen ausgesprochen effizient ein. Sie verwandten es mit Wissen der griechischen Finanzverwaltung und mithilfe griechischer Vertrauensmakler zu Stützungskäufen an der Börse. Kaum ging es im Juli/August 1943 zur Neige, stieg die Inflation wieder steil an. Daher flogen die Deutschen im letzten Jahr der Besatzung acht Tonnen Gold zur weiteren Währungsstabilisierung nach Griechenland ein. Auch dieses Gold war geraubt – von überall in Europa, nicht allein von Juden, aber auch. Doch zeigt der Transport nach Griechenland, wie wichtig dieses Mittel war, um die täglichen Kriegskosten zu bezahlen. „Als Vorteil der Goldverkäufe“, so resümierte Hitlers Sonderbeauftragter für Griechenland, „steht die technische Entlastung der Notenpresse fest, da mittels Gold erhebliche Mengen Banknoten bar für den Wehrmachtsbedarf herausgeholt wurden.“
Im Oktober 1942 mussten die rumänischen Juden Gold, Silber, Schmuck und Wertsachen an die Staatskasse des Landes abliefern, um die Währung zu stabilisieren. Offensichtlich konnten damit nur zwei, drei Monate überbrückt werden. Daher schlossen die beiden Außenminister Ribbentrop und Antonescu am 11. Januar 1943 im Führerhauptquartier ein Geheimabkommen über die Lieferung von 30 Tonnen Gold aus den Beutetresoren der Reichsbank an die Rumänische Nationalbank, um so die rumänische Währung „für die im deutschen Interesse erfolgende zusätzliche Notenausgabe“ zu stabilisieren. In der Slowakei stabilisierte die Nationalbank die Währung durch den Verkauf von geraubten Edelsteinen. Woher die gekommen sein werden, liegt nahe.
Das große Schweigen der Banken und der Finanzminister
Der Verkauf von Gold, Sachwerten, Immobilien, Wertpapieren und Pretiosen erlaubte eine gewisse währungspolitische Stabilisierung in einem Krieg, der aus deutscher Sicht stets im nächsten halben Jahr gewonnen werden sollte.
Der übergroße Teil des Vermögens der enteigneten und ermordeten Juden Europas verschwand eben nicht in den Kellern schweizerischer oder deutscher Banken. Wo aber dann? NS-Deutschland verhängte im Zweiten Weltkrieg eine beispiellose Kriegslasten- und Schuldenunion über Europa. Als fester Posten auf der Habenseite wurden darin die Vermögen der enteigneten Juden Europas verbucht, in Ungarn deckten sie die Besatzungskosten wohl zu 100 Prozent, in anderen Ländern nur zu fünf, zehn oder 20 Prozent – in jedem Fall dämpfte die Arisierung die Spitzenlasten, sie bremste die Inflation.
Aus dem Besatzungskostenetat erhielten die deutschen Soldaten ihren Sold in der jeweiligen Landeswährung. Sie durften dieses Geld nicht mit nach Hause nehmen, sondern mussten und wollten es auf den jeweils einheimischen Märkten ausgeben. Sie bezahlten davon Lebensmittel, mit denen sie die Abermillionen Feldpostpäckchen für ihre Familien füllten, Schuhe, Seidenschals und Schmuck, die sie ihren Freundinnen und Frauen schickten; sie bezahlten davon Tabak, Schnaps oder den Besuch im Bordell. Mit anderen Teilen der Besatzungskosten wurden Rechnungen für die tägliche Truppenversorgung beglichen, für Kleidung, Transporte, Quartiere und Lazarettaufenthalte deutscher Soldaten oder die Bunker des Atlantikwalls. Alle diese Leistungen wurden mit Mitteln bezahlt, die einen zeitlich und örtlich unterschiedlichen, durch die Vermischung mit anderen Geldströmen anonymisierten Anteil der zu Geld verflüssigten Vermögenswerte der Juden Europas enthielten.
[b9Nach dem Krieg verschwiegen die beteiligten Beamten der Nationalbanken und Finanzministerien in sämtlichen europäischen Ländern ihre Kenntnisse über die Metamorphose der enteigneten Werte. Die überlebenden Opfer und ihre Anwälte durchschauten das System nicht. Daher findet sich in den Verfahren, die ausländische Antragsteller vor deutschen Wiedergutmachungsgerichten anstrengten, immer wieder dasselbe abweisende Argument: Nicht etwa die deutsche Besatzungsmacht, sondern die jeweilige nationale Regierung oder Verwaltung der besetzten oder verbündeten Länder habe die Juden enteignet. Das Vermögen sei daher nicht außer Landes, insbesondere nicht nach Deutschland gebracht worden. Folglich erging regelmäßig und in abertausend Fällen ein ablehnender Beschluss, begründet mit der angeblichen Unzuständigkeit deutscher Gerichte. Ebenso verstellte der einseitige Blick auf Banken, Konzerne und individuelle Profiteure den Blick.[/b]
Tatsächlich verhielt es sich so, wie der Vertreter des Auswärtigen Amtes in Belgrad im Sommer 1942 die staatlich organisierte Form der Geldwäsche beschrieb: „Das Vermögen der Juden in Serbien ist zu Gunsten Serbiens einzuziehen, weil eine Einziehung zu Gunsten des Reiches der Haager Landkriegsordnung wiedersprechen würde. Der Erlös kommt aber mittelbar uns zugute…“ Gemeint waren alle Deutschen. Sie profitierten in einer unaufdringlichen, schwer erkennbaren Form vom Mord an den europäischen Juden. Politisch gesehen, minderten die Enteignungsakte die Lasten des Krieges für jeden von ihnen. Das hob die Stimmung in Deutschland und stärkte das Massenvertrauen in die Staatsführung.
Das jüdische Eigentum in Europa wurde zugunsten fast aller Deutschen sozialisiert. Am Ende hatte jeder Wehrmachtsoldat einen Bruchteil davon in seinem Geldbeutel, jede deutsche Familie Speisen auf ihrem Teller, Kleidungsstücke im Schrank, die zu einem gewissen Teil davon bezahlt worden waren.
Der Zeithistoriker Götz Aly veröffentliche jüngst gemeinsam mit Christian Gerlach „Das letzte Kapitel. Der Mord an den ungarischen Juden“ (DVA 2002). Sein Beitrag ist die Rede zum Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938, gehalten in der Frankfurter Paulskirche
.
Analysten sehen deutsche Börse immer pessimistischer
Von Felix Hüfner
In den Vereinigten Staaten ergibt sich ein entgegengesetztes Bild zu Deutschland
Finanzanalysten schöpfen neuen Mut für die Konjunkturentwicklung in den USA durch die Zinssenkungen der Notenbank und den Wahlerfolg der Republikaner. Für den Euroraum und insbesondere für Deutschland weitet sich der Pessimismus hingegen immer mehr aus. Dies ist das Kernergebnis des aktuellen Finanzmarkttests des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Das Wirtschaftsforschungsinstitut befragte im November 312 Analysten und institutionelle Anleger aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen nach ihren Erwartungen bezüglich der Entwicklung auf den Finanzmärkten. Aus den Ergebnissen der Befragung lassen sich Prognosen für die mittelfristige Entwicklung an den internationalen Börsen ableiten.
Im Euroraum zeigt sich im November ein differenziertes Bild: Die Konjunkturerwartungen für Deutschland brechen deutlich stärker ein als diejenigen des Euroraums insgesamt. Mit per Saldo vier Prozent überwiegen die Optimisten für die deutsche Wirtschaft nur noch knapp die Pessimisten. Negative Werte sind in der Vergangenheit regelmäßig mit einem Rückgang der Industrieproduktion einhergegangen - insofern hat sich die Rezessionsgefahr erhöht.
Zwei Gründe werden auf den Finanzmärkten für das schlechtere Abschneiden Deutschlands angeführt. Zum einen muss sich die EZB notwendigerweise auf die Entwicklungen im gesamten Euroraum konzentrieren. Da Deutschland derzeit die niedrigste Inflationsrate aufweist, sind die Realzinsen hier am höchsten, und entsprechend wirkt die Geldpolitik etwas restriktiver. Als zweiter Belastungsfaktor für die deutschen Konjunkturaussichten wird vermehrt die Unsicherheit über den zukünftigen Kurs der deutschen Wirtschaftspolitik angesehen.
Positiv hingegen wirkt die Erwartung einer sinkenden Inflationsrate im Euroraum. Dies könnte die EZB veranlassen, die Kurzfristzinsen bald zu senken, wie dies von den Finanzanalysten schon seit längerem prognostiziert wird. Derzeit sehen sie bis Februar eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.
Bis Februar sehen die befragten Experten ein Niveau von rund 3350 Punkten für den Dax. Für den Euro-Stoxx-50 lässt sich aus den Einschätzungen ein Kursziel von 2650 Punkten ableiten.
In den Vereinigten Staaten ergibt sich ein entgegengesetztes Bild zu Deutschland: Zum einen hat die Federal Reserve Bank zum wiederholten Male die Zinsen gesenkt, und zum anderen ist der jüngste Wahlerfolg der Republikaner in Erwartung möglicher weiterer Steuersenkungen auf den Finanzmärkten sehr begrüßt worden.
Eine getrennte Auswertung der Antworten vor und nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank zeigt, dass die befragten Experten mit deutlichen Effekten der Geldpolitik auf die Konjunkturlage rechnen. So stieg der Saldo von Optimisten und Pessimisten bezüglich der Konjunkturentwicklung in den nächsten sechs Monaten von 29 auf 39 Punkte. Auch die Aktieneinschätzungen haben sich deutlich verbessert.
Die Experten rechnen nun damit, dass der Dow-Jones-Index bis Februar auf knapp über 9000 Punkte steigen wird.
Für den Devisenmarkt wird erstmals seit langer Zeit prognostiziert, dass der Euro sich oberhalb der Parität zum US-Dollar behaupten kann. Analysten zufolge spielt hierfür die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa derzeit eine wichtige Rolle: Anleger schichten demnach ihre Anlagen in den Euroraum um und profitieren dort von höheren Zinsen am kurzen Ende.
Gemäss dieser Logik müsste der japanische Yen aufgrund der Null-Zins-Politik der Bank von Japan eigentlich seit langer Zeit abwerten. Dies ist freilich nicht der Fall: Obwohl von der Regierung eigentlich ein schwacher Yen präferiert wird, um die Deflation zu bekämpfen, hält sich die japanische Währung sehr stabil sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem US-Dollar.
Analysten sehen deutsche Börse immer pessimistischer
Von Felix Hüfner
In den Vereinigten Staaten ergibt sich ein entgegengesetztes Bild zu Deutschland
Finanzanalysten schöpfen neuen Mut für die Konjunkturentwicklung in den USA durch die Zinssenkungen der Notenbank und den Wahlerfolg der Republikaner. Für den Euroraum und insbesondere für Deutschland weitet sich der Pessimismus hingegen immer mehr aus. Dies ist das Kernergebnis des aktuellen Finanzmarkttests des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Das Wirtschaftsforschungsinstitut befragte im November 312 Analysten und institutionelle Anleger aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen nach ihren Erwartungen bezüglich der Entwicklung auf den Finanzmärkten. Aus den Ergebnissen der Befragung lassen sich Prognosen für die mittelfristige Entwicklung an den internationalen Börsen ableiten.
Im Euroraum zeigt sich im November ein differenziertes Bild: Die Konjunkturerwartungen für Deutschland brechen deutlich stärker ein als diejenigen des Euroraums insgesamt. Mit per Saldo vier Prozent überwiegen die Optimisten für die deutsche Wirtschaft nur noch knapp die Pessimisten. Negative Werte sind in der Vergangenheit regelmäßig mit einem Rückgang der Industrieproduktion einhergegangen - insofern hat sich die Rezessionsgefahr erhöht.
Zwei Gründe werden auf den Finanzmärkten für das schlechtere Abschneiden Deutschlands angeführt. Zum einen muss sich die EZB notwendigerweise auf die Entwicklungen im gesamten Euroraum konzentrieren. Da Deutschland derzeit die niedrigste Inflationsrate aufweist, sind die Realzinsen hier am höchsten, und entsprechend wirkt die Geldpolitik etwas restriktiver. Als zweiter Belastungsfaktor für die deutschen Konjunkturaussichten wird vermehrt die Unsicherheit über den zukünftigen Kurs der deutschen Wirtschaftspolitik angesehen.
Positiv hingegen wirkt die Erwartung einer sinkenden Inflationsrate im Euroraum. Dies könnte die EZB veranlassen, die Kurzfristzinsen bald zu senken, wie dies von den Finanzanalysten schon seit längerem prognostiziert wird. Derzeit sehen sie bis Februar eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.
Bis Februar sehen die befragten Experten ein Niveau von rund 3350 Punkten für den Dax. Für den Euro-Stoxx-50 lässt sich aus den Einschätzungen ein Kursziel von 2650 Punkten ableiten.
In den Vereinigten Staaten ergibt sich ein entgegengesetztes Bild zu Deutschland: Zum einen hat die Federal Reserve Bank zum wiederholten Male die Zinsen gesenkt, und zum anderen ist der jüngste Wahlerfolg der Republikaner in Erwartung möglicher weiterer Steuersenkungen auf den Finanzmärkten sehr begrüßt worden.
Eine getrennte Auswertung der Antworten vor und nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank zeigt, dass die befragten Experten mit deutlichen Effekten der Geldpolitik auf die Konjunkturlage rechnen. So stieg der Saldo von Optimisten und Pessimisten bezüglich der Konjunkturentwicklung in den nächsten sechs Monaten von 29 auf 39 Punkte. Auch die Aktieneinschätzungen haben sich deutlich verbessert.
Die Experten rechnen nun damit, dass der Dow-Jones-Index bis Februar auf knapp über 9000 Punkte steigen wird.
Für den Devisenmarkt wird erstmals seit langer Zeit prognostiziert, dass der Euro sich oberhalb der Parität zum US-Dollar behaupten kann. Analysten zufolge spielt hierfür die Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa derzeit eine wichtige Rolle: Anleger schichten demnach ihre Anlagen in den Euroraum um und profitieren dort von höheren Zinsen am kurzen Ende.
Gemäss dieser Logik müsste der japanische Yen aufgrund der Null-Zins-Politik der Bank von Japan eigentlich seit langer Zeit abwerten. Dies ist freilich nicht der Fall: Obwohl von der Regierung eigentlich ein schwacher Yen präferiert wird, um die Deflation zu bekämpfen, hält sich die japanische Währung sehr stabil sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem US-Dollar.
.
Fredmund Malik :
Was hierzulande unerwähnt bleibt
Politiker, Manager und Experten aller Fachrichtungen nörgeln fast täglich über den miserablen Zustand der Republik. Aber von Deutschland so zu reden, als wäre es das Armenhaus Europas, ist falsch
Politiker aller Parteien, Manager aller Branchen und Experten aller Fachrichtungen sind fast täglich, sicher sonntäglich, versammelt, um in Talkshows aller Varianten über Deutschland zu jammern. Deutschland als Schlusslicht Europas, hoffnungslos abgeschlagen und abgewirtschaftet.
Ein paar Fragen aber bleiben ausgeklammert – warum, ist rätselhaft. Werden sie mitberücksichtigt, ist der Leistungsausweis Deutschlands hervorragend, jedenfalls viel besser, als er diskutiert wird. Unbestritten bleiben noch immer große Hausaufgaben zu erledigen, aber in welchem Land wäre das nicht so?
Arbeitslosigkeit
Ein zentrales Thema und ein Kernargument für die Schwäche Deutschlands sind die rund vier Millionen Arbeitslosen - für jeden Betroffenen tragisch. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit ein schwaches Argument. Warum?
Die Statistik der Arbeitslosigkeit ist bekanntlich ein Minenfeld. Wenn man die höchsten Ziffern nimmt, hat Deutschland - West und Ost zusammengezählt - 4,42 Millionen Arbeitslose. Hier sind 1,03 Millionen ABM-Personen eingerechnet.
1,738 Millionen Arbeitslose sind in den ostdeutschen Bundesländern zu verzeichnen. Sie können weder der Politik noch der Wirtschaft angelastet werden. Sie sind Folge von 50 Jahren DDR-Kommunismus. Kein Land der Welt könnte mit diesen Problemen besser fertig werden als Deutschland. Obwohl die Fortschritte groß sind, reichen auch zehn Jahre und Milliarden nicht aus, um sie zu lösen.
Es bleiben 2,67 Millionen Arbeitslose im Westen. Von diesen dürften rund eine Million (wahrscheinlich sind es mehr) nicht arbeiten können oder nicht wollen. Wie hoch die Quoten in den beiden Kategorien sind, ist schwer zu bestimmen. Es ist - Klardenkende haben es immer gesagt - schlichtweg eine Illusion zu glauben, dass man alte Berufe in nennenswertem Umfang in neue Berufe umschulen kann.
Die wenigen Fälle, wo das gelang, geben nicht Hoffnung, sondern sind ein Beweis für die These. Das ist der Preis für den technischen Fortschritt und für die Umgestaltung der Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft. Und dass die deutschen Sozialgesetze, so wie in jedem Land, auch ausgenützt werden können von jenen, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie könnten, ist kein Geheimnis.
Es bleibt also die echte Arbeitslosigkeit. Sie beträgt rund 1,7 Millionen. Es sind Menschen, die sowohl arbeiten können als auch wollen - und dennoch keinen Arbeitsplatz bekommen. Das sind rund 4,5 Prozent.
Das ist kein Grund zu jubeln, aber damit ist Deutschland keineswegs das Schlusslicht Europas, sondern gehört zu den Ländern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Auch im geschichtlichen Vergleich ist das eine gute Quote, denn im Gegensatz zu früher suchen viel mehr Frauen nach Arbeit. Wäre das nicht so, hätte Deutschland einen veritablen Arbeitskräftemangel.
Beschäftigungsquote
Um ein Gesamtbild zu bekommen, darf aber nicht nur gefragt werden, wie viele Personen arbeitslos sind, sondern es muss auch gefragt werden, wie viele beschäftigt sind. Die Beschäftigungsquote liegt in Deutschland 2002 bei geschätzten 69,4 Prozent; im Jahr 2001 waren es 68,6 Prozent. Sie ist seit 1995 jedes Jahr gestiegen. Der Durchschnitt der EU liegt 65,0 Prozent. Deutschland liegt damit zwar nicht an der Spitze, aber gut im Mittelfeld. Frankreich, Spanien und Italien sind deutlich schlechter.
Damit plädiere ich nicht für politische Untätigkeit, sondern dafür, die Proportionen richtig zu sehen. Und jene, die das Arbeitslosigkeitsargument ständig strapazieren, sollten die Zahlen etwas genauer studieren.
Schwarzarbeit
Nach Schätzung von Fachleuten wird mit Schwarzarbeit rund 15 Prozent des deutschen Sozialproduktes erwirtschaftet. Zählt man diese Wirtschaftsleistung zur offiziellen hinzu, steht Deutschland hervorragend da. Der Finanzminister mag sich ärgern. Dennoch ist diese Wirtschaftsleistung erbracht und real. Sie gehört mit zur Wohlstandsbeurteilung.
Wiedervereinigung
Kein anderes Land der Welt hat ein ähnliches Problem wie die deutsche Wiedervereinigung zu lösen gehabt. Die meisten anderen Länder wären massivst überfordert gewesen. Keine Wirtschaft der Welt musste die Leistung erbringen, um so etwas zu bewältigen.
Europa
Deutschland hat maßgeblich die europäische Integration bezahlt. Über große Strecken hat Deutschland genauso viel bezahlt, wie alle anderen Nettozahlerländer zusammen. Ob diese Zahlungen Investitionen oder Kosten sind, kann lange diskutiert werden. Der Return ist schwer messbar. Die Leistung wurde jedenfalls erbracht.
Wachstum und Größe
Deutschland, wird gesagt, sei wachstumsbezogen das Schlusslicht Europas. Kann sein, aber auch die Wachstumsstatistik ist ein Minenfeld. Wie auch immer man misst, ist Deutschland die drittgrößte Wirtschaft der Welt, und, wie der Economist schreibt, eine der fortgeschrittensten der Welt. Die beiden nächsten europäischen Ökonomien - England und Frankreich - sind um rund ein Drittel kleiner – jedenfalls von Deutschland aus gerechnet. Nach Berechnungen der Länder selbst sind sie um die Hälfte größer.
Die Menschen leben nicht von den Wachstumsraten, sondern vom absoluten Sozialprodukt. In der 2002-Ausgabe der Economist World Figures rangiert Deutschland mit seinem Lebensstandard auf dem elften Rang. Das könnte besser sein. Aber die anderen großen europäischen Staaten liegen deutlich dahinter. Wenn man die eher exotischen Spitzenreiter, wie Luxemburg, die Bermudas, Island und Singapur herausnimmt, dann rangiert Deutschland auf Platz sieben. Diese Position ist kein Grund zur Trauer.
Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass die ostdeutschen Bundesländer die Gesamtzahlen statistisch deutlich nach unten ziehen. Der Leistungsausweis wäre ohne Ostdeutschland massiv höher. Es gibt Meinungen von Ökonomen, wonach das bald anders werden soll und der Osten Deutschlands stärker wachsen wird als bisher und sogar stärker als der Westen. Damit würde die Gesamtleistung entsprechend besser.
Noch einmal - für jene, die unermüdlich den Zeigefinger heben: es sind Hausaufgaben zu machen und sie sind groß; und die nächsten Jahre werden schwierig sein. Aber von Deutschland so zu reden, als wäre es das Armenhaus Europas, ist falsch. Aus falscher Diagnose folgt selten eine richtige Therapie.
Quelle: manager-magazin 15.11.2002
Fredmund Malik :
Was hierzulande unerwähnt bleibt
Politiker, Manager und Experten aller Fachrichtungen nörgeln fast täglich über den miserablen Zustand der Republik. Aber von Deutschland so zu reden, als wäre es das Armenhaus Europas, ist falsch
Politiker aller Parteien, Manager aller Branchen und Experten aller Fachrichtungen sind fast täglich, sicher sonntäglich, versammelt, um in Talkshows aller Varianten über Deutschland zu jammern. Deutschland als Schlusslicht Europas, hoffnungslos abgeschlagen und abgewirtschaftet.
Ein paar Fragen aber bleiben ausgeklammert – warum, ist rätselhaft. Werden sie mitberücksichtigt, ist der Leistungsausweis Deutschlands hervorragend, jedenfalls viel besser, als er diskutiert wird. Unbestritten bleiben noch immer große Hausaufgaben zu erledigen, aber in welchem Land wäre das nicht so?
Arbeitslosigkeit
Ein zentrales Thema und ein Kernargument für die Schwäche Deutschlands sind die rund vier Millionen Arbeitslosen - für jeden Betroffenen tragisch. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit ein schwaches Argument. Warum?
Die Statistik der Arbeitslosigkeit ist bekanntlich ein Minenfeld. Wenn man die höchsten Ziffern nimmt, hat Deutschland - West und Ost zusammengezählt - 4,42 Millionen Arbeitslose. Hier sind 1,03 Millionen ABM-Personen eingerechnet.
1,738 Millionen Arbeitslose sind in den ostdeutschen Bundesländern zu verzeichnen. Sie können weder der Politik noch der Wirtschaft angelastet werden. Sie sind Folge von 50 Jahren DDR-Kommunismus. Kein Land der Welt könnte mit diesen Problemen besser fertig werden als Deutschland. Obwohl die Fortschritte groß sind, reichen auch zehn Jahre und Milliarden nicht aus, um sie zu lösen.
Es bleiben 2,67 Millionen Arbeitslose im Westen. Von diesen dürften rund eine Million (wahrscheinlich sind es mehr) nicht arbeiten können oder nicht wollen. Wie hoch die Quoten in den beiden Kategorien sind, ist schwer zu bestimmen. Es ist - Klardenkende haben es immer gesagt - schlichtweg eine Illusion zu glauben, dass man alte Berufe in nennenswertem Umfang in neue Berufe umschulen kann.
Die wenigen Fälle, wo das gelang, geben nicht Hoffnung, sondern sind ein Beweis für die These. Das ist der Preis für den technischen Fortschritt und für die Umgestaltung der Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft. Und dass die deutschen Sozialgesetze, so wie in jedem Land, auch ausgenützt werden können von jenen, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie könnten, ist kein Geheimnis.
Es bleibt also die echte Arbeitslosigkeit. Sie beträgt rund 1,7 Millionen. Es sind Menschen, die sowohl arbeiten können als auch wollen - und dennoch keinen Arbeitsplatz bekommen. Das sind rund 4,5 Prozent.
Das ist kein Grund zu jubeln, aber damit ist Deutschland keineswegs das Schlusslicht Europas, sondern gehört zu den Ländern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Auch im geschichtlichen Vergleich ist das eine gute Quote, denn im Gegensatz zu früher suchen viel mehr Frauen nach Arbeit. Wäre das nicht so, hätte Deutschland einen veritablen Arbeitskräftemangel.
Beschäftigungsquote
Um ein Gesamtbild zu bekommen, darf aber nicht nur gefragt werden, wie viele Personen arbeitslos sind, sondern es muss auch gefragt werden, wie viele beschäftigt sind. Die Beschäftigungsquote liegt in Deutschland 2002 bei geschätzten 69,4 Prozent; im Jahr 2001 waren es 68,6 Prozent. Sie ist seit 1995 jedes Jahr gestiegen. Der Durchschnitt der EU liegt 65,0 Prozent. Deutschland liegt damit zwar nicht an der Spitze, aber gut im Mittelfeld. Frankreich, Spanien und Italien sind deutlich schlechter.
Damit plädiere ich nicht für politische Untätigkeit, sondern dafür, die Proportionen richtig zu sehen. Und jene, die das Arbeitslosigkeitsargument ständig strapazieren, sollten die Zahlen etwas genauer studieren.
Schwarzarbeit
Nach Schätzung von Fachleuten wird mit Schwarzarbeit rund 15 Prozent des deutschen Sozialproduktes erwirtschaftet. Zählt man diese Wirtschaftsleistung zur offiziellen hinzu, steht Deutschland hervorragend da. Der Finanzminister mag sich ärgern. Dennoch ist diese Wirtschaftsleistung erbracht und real. Sie gehört mit zur Wohlstandsbeurteilung.
Wiedervereinigung
Kein anderes Land der Welt hat ein ähnliches Problem wie die deutsche Wiedervereinigung zu lösen gehabt. Die meisten anderen Länder wären massivst überfordert gewesen. Keine Wirtschaft der Welt musste die Leistung erbringen, um so etwas zu bewältigen.
Europa
Deutschland hat maßgeblich die europäische Integration bezahlt. Über große Strecken hat Deutschland genauso viel bezahlt, wie alle anderen Nettozahlerländer zusammen. Ob diese Zahlungen Investitionen oder Kosten sind, kann lange diskutiert werden. Der Return ist schwer messbar. Die Leistung wurde jedenfalls erbracht.
Wachstum und Größe
Deutschland, wird gesagt, sei wachstumsbezogen das Schlusslicht Europas. Kann sein, aber auch die Wachstumsstatistik ist ein Minenfeld. Wie auch immer man misst, ist Deutschland die drittgrößte Wirtschaft der Welt, und, wie der Economist schreibt, eine der fortgeschrittensten der Welt. Die beiden nächsten europäischen Ökonomien - England und Frankreich - sind um rund ein Drittel kleiner – jedenfalls von Deutschland aus gerechnet. Nach Berechnungen der Länder selbst sind sie um die Hälfte größer.
Die Menschen leben nicht von den Wachstumsraten, sondern vom absoluten Sozialprodukt. In der 2002-Ausgabe der Economist World Figures rangiert Deutschland mit seinem Lebensstandard auf dem elften Rang. Das könnte besser sein. Aber die anderen großen europäischen Staaten liegen deutlich dahinter. Wenn man die eher exotischen Spitzenreiter, wie Luxemburg, die Bermudas, Island und Singapur herausnimmt, dann rangiert Deutschland auf Platz sieben. Diese Position ist kein Grund zur Trauer.
Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass die ostdeutschen Bundesländer die Gesamtzahlen statistisch deutlich nach unten ziehen. Der Leistungsausweis wäre ohne Ostdeutschland massiv höher. Es gibt Meinungen von Ökonomen, wonach das bald anders werden soll und der Osten Deutschlands stärker wachsen wird als bisher und sogar stärker als der Westen. Damit würde die Gesamtleistung entsprechend besser.
Noch einmal - für jene, die unermüdlich den Zeigefinger heben: es sind Hausaufgaben zu machen und sie sind groß; und die nächsten Jahre werden schwierig sein. Aber von Deutschland so zu reden, als wäre es das Armenhaus Europas, ist falsch. Aus falscher Diagnose folgt selten eine richtige Therapie.
Quelle: manager-magazin 15.11.2002
.
zum Hoax : "HOW, WHY AND WHEN TO DESTROY THE UNITED STATES" :
http://antivirus.about.com/library/hoaxes/bljazeera.htm
SPIEGEL ONLINE - 15. November 2002
Geheime FBI-Warnung ängstigt US-Bürger
Ein FBI-Bericht hat die amerikanische Bevölkerung alarmiert. Mit drastischen Worten wird darin vor neuen Anschlägen der al-Qaida gewarnt. Was die Öffentlichkeit besonders beunruhigt: Der Bericht sollte geheim gehalten werden.
Washington - "Spektakuläre Anschläge" seien geplant, schreibt das FBI in einem Bericht, der an mehrere Außenstellen im ganzen Land verschickt wurde. Auf den abgehörten Kanälen der Terroristen sei der Informationsaustausch in letzter Zeit stark angestiegen, meldet der Geheimdienst. "Verschiedene Quellen weisen darauf hin, dass al-Qaida ihre Ziele nach folgenden Kriterien aussuchen wird: Hoher symbolischer Wert, eine hohe Anzahl von Opfern sowie schwerer Schaden für die amerikanische Wirtschaft", heißt es in dem Bericht. Vor allem auf Flughäfen, Ölraffinerien, Atomkraftwerke und nationale Monumente richten die Behörden jetzt ihre Aufmerksamkeit. Genauere Informationen über den Zeitpunkt und die Art eines möglichen Anschlags liefert der Bericht jedoch nicht.
Besondere Brisanz aber erhielt der Artikel durch die Tatsache, dass er eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Erst nachdem die "New York Times" am Donnerstag darüber berichtete, stellte das FBI ihn auf seiner Webseite der Bevölkerung zur Verfügung. Auffällig ist zudem die drastische Wortwahl, mit der vor Anschlägen gewarnt wird. Das Weiße Haus ließ sofort verkünden, man werde zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um der Gefahr zu begegnen. In San Francisco, Houston, Chicago und Washington wurden die Krankenhäuser in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Erst wenige Tage zuvor hatte die Belegschaft in einem Krankenhaus in San Francisco in einer Katastrophenübung einen Anschlag mit einer atomar verseuchten, so genannten schmutzigen Bombe, simuliert.
Zeitgleich mit der "New York Times" berichtete außerdem eine Zeitung aus Detroit von einer bislang geheimgehaltene Festnahme eines Mannes in North Carolina. Der 36-jährige Abdel-Illah Elmardoudi wird angeklagt, Anführer einer Terror-Zelle von Schläfern gewesen sein, und Angriffe in den USA geplant zu haben. Bereits am 5. November war der Mann verhaftet worden, "aus Sicherheitsgründen" wurde die Festnahme jedoch nicht öffentlich gemacht, erklärten schließlich staatliche Stellen in Detroit.
Die Behörden wollen diese Entwicklungen jedoch nicht überinterpretiert wissen. Der Direktor der Heimatschutzbehörde Tom Ridge erklärte übereinstimmend mit FBI-Chef Robert Mueller, die Nation sei seit dem 11. September 2001 sehr viel besser auf Anschläge vorbereitet. Die Geheimdienste verfügten jetzt über detailliertere Informationen, um Terrorattacken frühzeitig zu verhindern, erklärte Ridge.
Die offizielle Terror-Gefahrenstufe bleibt unterdessen auf "Gelb" und damit genau in der Mitte eines fünfstufigen Alarmsystems, das nach den Anschlägen vom 11. September eingerichtet wurde. Nur für die Zeit um den Jahrestag der Anschläge hatten die Behörden die Gefahrenstufe kurzfristig auf "Orange" geändert.
Die Welt –16.11.2002
Hildegard Stausberg
Argentiniens Verweigerung ist ein gefährlicher Dammbruch
Es gibt Dammbrüche, die sind irreparabel. Bisher galt in der internationalen Finanzwelt als ausgemacht, dass das Nichtbedienen von Verbindlichkeiten gegenüber den multilateralen Finanzorganisationen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) als solcher anzusehen sei. Dies erklärt, warum alle Staaten versuchen, bis zuletzt wenigstens diesen gegenüber keine Zahlungsausfälle zu provozieren.
ahrelanges Missmanagement
Nun hat das ehedem steinreiche Argentinien, in die Knie gezwungen durch jahrzehntelanges Missmanagement seiner Regierungskasten, diesen Rubikon überschritten: Ein am Donnerstag fälliger Kredit der Weltbank über 805 Millionen Dollar wurde nicht zurückbezahlt. Aber Argentinien hielt sich ein Hintertürchen offen und überwies Zinsen in Höhe von 80 Millionen Dollar. Es ist müßig zu spekulieren, ob die 9,8 Milliarden Dollar Währungsreserven ausgereicht hätten, um den Weltbankkredit doch noch zu bedienen. Tatsache ist, dass Buenos Aires dies nicht getan hat - Sanktionen müssten jetzt eigentlich sofort folgen.
Die Reaktion der Weltbank ist eindeutig: Sie kündigte an, Argentinien, das der Bank insgesamt stolze 8,7 Milliarden Dollar schuldet, ab sofort keine neuen Kredite zu gewähren, für die Auszahlung bereits gewährter Kredite gilt aber noch eine Schonfrist bis 15. Dezember.
Alles hängt jetzt davon ab, ob und wie der IWF endlich mit dem Land zu einer Übereinkunft findet. Fürs Erste hat er Buenos Aires - wieder einmal - eine Atempause gewährt und eine am 22. November fällige Rückzahlung verlängert. Das gibt dem Präsidenten Eduardo Duhalde Zeit, um für ein IWF-Abkommen die Unterstützung wichtiger Provinzfürsten einzuholen: Er selbst hat als Übergangspräsident dazu alleine nicht die Macht. Damit ist man beim eigentlichen Kern des argentinischen Problems: Ein Land mit solch gigantischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat eine gefährlich schwache Exekutive.
Für die kommenden Wochen lässt dies wenig Gutes hoffen. Denn es ist zwar richtig, dass der Fonds Argentinien entgegen kommen muss, aber gleichzeitig muss er sich davor hüten, von Buenos Aires durch geschicktes Taktieren auf dem internationalen Parkett als zahnloser Tiger hilflos vorgeführt zu werden. Diese Gefahr besteht -und sie würde dem Ansehen des IWF dauerhaft schaden.
Das, was Buenos Aires durch seine fehlende Zahlungsbereitschaft jetzt losgetreten hat, ist deshalb auch viel mehr als ein rein argentinischer Theaterdonner, es ist ein gefährliches Wetterleuchten und zeigt die echten Probleme, die der IWF hat. Sie alle kreisen um die Schlüsselfrage, wie er sich gegenüber schwerverschuldeten Ländern in diesen Zeiten wachsender Risikoaversion auf den internationalen Finanzmärkten verhalten soll - eine Problematik die besonders im Zusammenhang mit Brasilien in den nächsten Monaten immer drängender werden wird.
Dabei steht eines fest: Trotz fast erdrückender Schuldenlast sind die politischen Rahmenbedingungen anders. Das Land hatte und hat eine politische Führung. Auch deshalb fiel es dem IWF leichter, einen Mega-Kredit in Höhe von 30 Milliarden Dollar in Aussicht zu stellen, dessen Auszahlung jetzt zur Verhandlung ansteht.
Flucht in die Isolation
Für Argentinien wiederum werden die nächsten Wochen entscheiden, ob der letzte Vorhang fällt. Wenn die Zahlungsunfähigkeit gegenüber den multilateralen Gläubigern wirklich vollzogen würde, stünde das Land völlig allein und wäre von allen internationalen Kreditströmen abgeschnitten. Das würde auch für die Verhandlungen der argentinischen Staatsschulden gegenüber privaten Gläubigern in Höhe von mindestens 50 Milliarden Dollar nichts Gutes bedeuten: eine Regelung würde dann unmöglich. Die Mehrheit der Argentinier scheint dies übrigens nicht so zu sehen: Meinungsumfragen beweisen eine hohe Zustimmung für Duhaldes Zündeln mit dem finanziellen Isolationismus.
zum Hoax : "HOW, WHY AND WHEN TO DESTROY THE UNITED STATES" :
http://antivirus.about.com/library/hoaxes/bljazeera.htm
SPIEGEL ONLINE - 15. November 2002
Geheime FBI-Warnung ängstigt US-Bürger
Ein FBI-Bericht hat die amerikanische Bevölkerung alarmiert. Mit drastischen Worten wird darin vor neuen Anschlägen der al-Qaida gewarnt. Was die Öffentlichkeit besonders beunruhigt: Der Bericht sollte geheim gehalten werden.
Washington - "Spektakuläre Anschläge" seien geplant, schreibt das FBI in einem Bericht, der an mehrere Außenstellen im ganzen Land verschickt wurde. Auf den abgehörten Kanälen der Terroristen sei der Informationsaustausch in letzter Zeit stark angestiegen, meldet der Geheimdienst. "Verschiedene Quellen weisen darauf hin, dass al-Qaida ihre Ziele nach folgenden Kriterien aussuchen wird: Hoher symbolischer Wert, eine hohe Anzahl von Opfern sowie schwerer Schaden für die amerikanische Wirtschaft", heißt es in dem Bericht. Vor allem auf Flughäfen, Ölraffinerien, Atomkraftwerke und nationale Monumente richten die Behörden jetzt ihre Aufmerksamkeit. Genauere Informationen über den Zeitpunkt und die Art eines möglichen Anschlags liefert der Bericht jedoch nicht.
Besondere Brisanz aber erhielt der Artikel durch die Tatsache, dass er eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Erst nachdem die "New York Times" am Donnerstag darüber berichtete, stellte das FBI ihn auf seiner Webseite der Bevölkerung zur Verfügung. Auffällig ist zudem die drastische Wortwahl, mit der vor Anschlägen gewarnt wird. Das Weiße Haus ließ sofort verkünden, man werde zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um der Gefahr zu begegnen. In San Francisco, Houston, Chicago und Washington wurden die Krankenhäuser in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Erst wenige Tage zuvor hatte die Belegschaft in einem Krankenhaus in San Francisco in einer Katastrophenübung einen Anschlag mit einer atomar verseuchten, so genannten schmutzigen Bombe, simuliert.
Zeitgleich mit der "New York Times" berichtete außerdem eine Zeitung aus Detroit von einer bislang geheimgehaltene Festnahme eines Mannes in North Carolina. Der 36-jährige Abdel-Illah Elmardoudi wird angeklagt, Anführer einer Terror-Zelle von Schläfern gewesen sein, und Angriffe in den USA geplant zu haben. Bereits am 5. November war der Mann verhaftet worden, "aus Sicherheitsgründen" wurde die Festnahme jedoch nicht öffentlich gemacht, erklärten schließlich staatliche Stellen in Detroit.
Die Behörden wollen diese Entwicklungen jedoch nicht überinterpretiert wissen. Der Direktor der Heimatschutzbehörde Tom Ridge erklärte übereinstimmend mit FBI-Chef Robert Mueller, die Nation sei seit dem 11. September 2001 sehr viel besser auf Anschläge vorbereitet. Die Geheimdienste verfügten jetzt über detailliertere Informationen, um Terrorattacken frühzeitig zu verhindern, erklärte Ridge.
Die offizielle Terror-Gefahrenstufe bleibt unterdessen auf "Gelb" und damit genau in der Mitte eines fünfstufigen Alarmsystems, das nach den Anschlägen vom 11. September eingerichtet wurde. Nur für die Zeit um den Jahrestag der Anschläge hatten die Behörden die Gefahrenstufe kurzfristig auf "Orange" geändert.
Die Welt –16.11.2002
Hildegard Stausberg
Argentiniens Verweigerung ist ein gefährlicher Dammbruch
Es gibt Dammbrüche, die sind irreparabel. Bisher galt in der internationalen Finanzwelt als ausgemacht, dass das Nichtbedienen von Verbindlichkeiten gegenüber den multilateralen Finanzorganisationen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) als solcher anzusehen sei. Dies erklärt, warum alle Staaten versuchen, bis zuletzt wenigstens diesen gegenüber keine Zahlungsausfälle zu provozieren.
ahrelanges Missmanagement
Nun hat das ehedem steinreiche Argentinien, in die Knie gezwungen durch jahrzehntelanges Missmanagement seiner Regierungskasten, diesen Rubikon überschritten: Ein am Donnerstag fälliger Kredit der Weltbank über 805 Millionen Dollar wurde nicht zurückbezahlt. Aber Argentinien hielt sich ein Hintertürchen offen und überwies Zinsen in Höhe von 80 Millionen Dollar. Es ist müßig zu spekulieren, ob die 9,8 Milliarden Dollar Währungsreserven ausgereicht hätten, um den Weltbankkredit doch noch zu bedienen. Tatsache ist, dass Buenos Aires dies nicht getan hat - Sanktionen müssten jetzt eigentlich sofort folgen.
Die Reaktion der Weltbank ist eindeutig: Sie kündigte an, Argentinien, das der Bank insgesamt stolze 8,7 Milliarden Dollar schuldet, ab sofort keine neuen Kredite zu gewähren, für die Auszahlung bereits gewährter Kredite gilt aber noch eine Schonfrist bis 15. Dezember.
Alles hängt jetzt davon ab, ob und wie der IWF endlich mit dem Land zu einer Übereinkunft findet. Fürs Erste hat er Buenos Aires - wieder einmal - eine Atempause gewährt und eine am 22. November fällige Rückzahlung verlängert. Das gibt dem Präsidenten Eduardo Duhalde Zeit, um für ein IWF-Abkommen die Unterstützung wichtiger Provinzfürsten einzuholen: Er selbst hat als Übergangspräsident dazu alleine nicht die Macht. Damit ist man beim eigentlichen Kern des argentinischen Problems: Ein Land mit solch gigantischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat eine gefährlich schwache Exekutive.
Für die kommenden Wochen lässt dies wenig Gutes hoffen. Denn es ist zwar richtig, dass der Fonds Argentinien entgegen kommen muss, aber gleichzeitig muss er sich davor hüten, von Buenos Aires durch geschicktes Taktieren auf dem internationalen Parkett als zahnloser Tiger hilflos vorgeführt zu werden. Diese Gefahr besteht -und sie würde dem Ansehen des IWF dauerhaft schaden.
Das, was Buenos Aires durch seine fehlende Zahlungsbereitschaft jetzt losgetreten hat, ist deshalb auch viel mehr als ein rein argentinischer Theaterdonner, es ist ein gefährliches Wetterleuchten und zeigt die echten Probleme, die der IWF hat. Sie alle kreisen um die Schlüsselfrage, wie er sich gegenüber schwerverschuldeten Ländern in diesen Zeiten wachsender Risikoaversion auf den internationalen Finanzmärkten verhalten soll - eine Problematik die besonders im Zusammenhang mit Brasilien in den nächsten Monaten immer drängender werden wird.
Dabei steht eines fest: Trotz fast erdrückender Schuldenlast sind die politischen Rahmenbedingungen anders. Das Land hatte und hat eine politische Führung. Auch deshalb fiel es dem IWF leichter, einen Mega-Kredit in Höhe von 30 Milliarden Dollar in Aussicht zu stellen, dessen Auszahlung jetzt zur Verhandlung ansteht.
Flucht in die Isolation
Für Argentinien wiederum werden die nächsten Wochen entscheiden, ob der letzte Vorhang fällt. Wenn die Zahlungsunfähigkeit gegenüber den multilateralen Gläubigern wirklich vollzogen würde, stünde das Land völlig allein und wäre von allen internationalen Kreditströmen abgeschnitten. Das würde auch für die Verhandlungen der argentinischen Staatsschulden gegenüber privaten Gläubigern in Höhe von mindestens 50 Milliarden Dollar nichts Gutes bedeuten: eine Regelung würde dann unmöglich. Die Mehrheit der Argentinier scheint dies übrigens nicht so zu sehen: Meinungsumfragen beweisen eine hohe Zustimmung für Duhaldes Zündeln mit dem finanziellen Isolationismus.
.
Marc Faber:
Gold - das schlechte Geschäft der Notenbanken
Während am Ende der siebziger Jahren Anleger rund um die Welt Tag und Nacht Gold kauften oder verkauften und, mit Ausnahme von Minenaktien und Ölwerten, an Aktien und Obligationen kaum Interesse bekundeten, kehren in den letzten Jahren die Investoren Rohstoffen und Edelmetallen praktisch den Rücken.
Die allgemeine Meinung war, dass Gold als Anlageobjekt völlig uninteressant sei und dass der amerikanische Dollar, Gold als sicherer Hafen und Ankerwährung in der Welt ersetzt hätte. Man argumentierte, dass in einem Umfeld geringer Inflation der Kauf von Aktien und Obligationen wesentlich höhere Gewinne mit sich bringen würde als Anlagen in Rohstoffe, die ohnehin an einem Überangebot litten.
Zudem vertraten führende Strategen die Meinung, dass die regelmäßigen Goldverkäufe der westlichen Zentralbanken den Goldpreis wesentlich tiefer drücken würden und Gold rein volkswirtschaftlich gesehen, weder einen Wert noch eine Bedeutung hätte.
Als konträrer Anleger hat mich natürlich die negative Haltung der Investoren gegenüber Gold und ihre positive, ja euphorische Einstellung gegenüber Technologieaktien schon erstaunt und dies aus einer Reihe von Überlegungen.
Einmal habe ich mich immer wieder gefragt, ob die Notenbankpräsidenten völlig geschäftsuntüchtig sind, nachdem sie am Anfang der achtziger Jahren ihre Goldbestände bei einem Preis von stolzen 600 Dollar pro Unze hätten veräußern können und die Erlöse in amerikanischen Staatsobligationen, die damals um 15 Prozent Rendite abwarfen oder im Geldmarkt, der knapp unter 20 Prozent bot, hätten reinvestieren können.
Weshalb haben die Notenbanken rund 20 Jahren gewartet, um ihre Goldreserven zu einem Preis von weniger als 300 Dollar zu verkaufen und den Erlös in Obligationen oder im Geldmarkt zu investieren, der aber jetzt nur noch rund fünf Prozent Rendite abwirft. Ich nehme jedoch an, dass auch die Zentralbanken die äußerst profitable Anlagepolitik verfolgen und zu Tiefpreise kaufen sowie bei hohen Preisen wieder abstoßen.
Weiterhin hätte ein Anleger im Jahre 1980, als der Goldpreis kurz über 850 Dollar stieg, mit dem Verkauf einer einzigen Unze Gold einen Dow Jones Industrial Average, der damals um rund 800 Punkte lag, kaufen können. Im Jahre 2000 hätte aber ein Anleger ganze 45 Unzen Gold bezahlen müssen, um einen Dow Jones, der damals bei über 12.000 lag zu erwerben.
Mit anderen Worten im Jahre 1980 war Gold "teuer" und der Dow - oder ganz allgemein die meisten Aktien - "spotbillig", während in den letzten Jahren der Dow "teuer" wurde und Gold "spottbillig". Tatsächlich werden heute im Zeitalters des Kapitalismus, das jetzt etwa 150 Jahre alt ist, Gold und ebenfalls andere Rohstoffen wie Silber, Nickel, Kupfer, Kaffee, Getreide, Baumwolle, Gummi, und so weiter, tiefer im Vergleich zu den Kursen von Aktien bewertet als irgendwann zuvor.
Was mich dabei frappiert ist, dass die Notenbank und das Schatzamt in den USA bei diesen tiefen Rohstoffpreisen Gold verkaufen oder ausleihen, um den Goldpreis unter Druck zu halten und mit ihrem "Plungeteam" gleichzeitig bei relativ hohen Aktienpreisen, die Börse mit wiederholten Stützungskäufen künstlich hoch zu halten versuchen.
Weshalb verkaufte das amerikanische Schatzamt sein Gold nicht im Jahre 1980 und investierte damals in Aktien zu einer Zeit als der Dow Jones unter 1000 Punkten lag?
Die Welt 16.11.2002
Marc Faber:
Gold - das schlechte Geschäft der Notenbanken
Während am Ende der siebziger Jahren Anleger rund um die Welt Tag und Nacht Gold kauften oder verkauften und, mit Ausnahme von Minenaktien und Ölwerten, an Aktien und Obligationen kaum Interesse bekundeten, kehren in den letzten Jahren die Investoren Rohstoffen und Edelmetallen praktisch den Rücken.
Die allgemeine Meinung war, dass Gold als Anlageobjekt völlig uninteressant sei und dass der amerikanische Dollar, Gold als sicherer Hafen und Ankerwährung in der Welt ersetzt hätte. Man argumentierte, dass in einem Umfeld geringer Inflation der Kauf von Aktien und Obligationen wesentlich höhere Gewinne mit sich bringen würde als Anlagen in Rohstoffe, die ohnehin an einem Überangebot litten.
Zudem vertraten führende Strategen die Meinung, dass die regelmäßigen Goldverkäufe der westlichen Zentralbanken den Goldpreis wesentlich tiefer drücken würden und Gold rein volkswirtschaftlich gesehen, weder einen Wert noch eine Bedeutung hätte.
Als konträrer Anleger hat mich natürlich die negative Haltung der Investoren gegenüber Gold und ihre positive, ja euphorische Einstellung gegenüber Technologieaktien schon erstaunt und dies aus einer Reihe von Überlegungen.
Einmal habe ich mich immer wieder gefragt, ob die Notenbankpräsidenten völlig geschäftsuntüchtig sind, nachdem sie am Anfang der achtziger Jahren ihre Goldbestände bei einem Preis von stolzen 600 Dollar pro Unze hätten veräußern können und die Erlöse in amerikanischen Staatsobligationen, die damals um 15 Prozent Rendite abwarfen oder im Geldmarkt, der knapp unter 20 Prozent bot, hätten reinvestieren können.
Weshalb haben die Notenbanken rund 20 Jahren gewartet, um ihre Goldreserven zu einem Preis von weniger als 300 Dollar zu verkaufen und den Erlös in Obligationen oder im Geldmarkt zu investieren, der aber jetzt nur noch rund fünf Prozent Rendite abwirft. Ich nehme jedoch an, dass auch die Zentralbanken die äußerst profitable Anlagepolitik verfolgen und zu Tiefpreise kaufen sowie bei hohen Preisen wieder abstoßen.
Weiterhin hätte ein Anleger im Jahre 1980, als der Goldpreis kurz über 850 Dollar stieg, mit dem Verkauf einer einzigen Unze Gold einen Dow Jones Industrial Average, der damals um rund 800 Punkte lag, kaufen können. Im Jahre 2000 hätte aber ein Anleger ganze 45 Unzen Gold bezahlen müssen, um einen Dow Jones, der damals bei über 12.000 lag zu erwerben.
Mit anderen Worten im Jahre 1980 war Gold "teuer" und der Dow - oder ganz allgemein die meisten Aktien - "spotbillig", während in den letzten Jahren der Dow "teuer" wurde und Gold "spottbillig". Tatsächlich werden heute im Zeitalters des Kapitalismus, das jetzt etwa 150 Jahre alt ist, Gold und ebenfalls andere Rohstoffen wie Silber, Nickel, Kupfer, Kaffee, Getreide, Baumwolle, Gummi, und so weiter, tiefer im Vergleich zu den Kursen von Aktien bewertet als irgendwann zuvor.
Was mich dabei frappiert ist, dass die Notenbank und das Schatzamt in den USA bei diesen tiefen Rohstoffpreisen Gold verkaufen oder ausleihen, um den Goldpreis unter Druck zu halten und mit ihrem "Plungeteam" gleichzeitig bei relativ hohen Aktienpreisen, die Börse mit wiederholten Stützungskäufen künstlich hoch zu halten versuchen.
Weshalb verkaufte das amerikanische Schatzamt sein Gold nicht im Jahre 1980 und investierte damals in Aktien zu einer Zeit als der Dow Jones unter 1000 Punkten lag?
Die Welt 16.11.2002
.
wenn es denn noch eines Beweises bedarf :
Aktientipp gegen Platz im Kindergarten
Wie der New Yorker Staranalyst Jack Grubman seine Zwillinge exklusiv unterbrachte.
New Yorks Generalstaatsanwalt Eliot Spitzer lässt nicht locker. Hartnäckig ist er den dunklen Machenschaften im Bankengewerbe an der Wall Street auf der Spur. Was der Chefankläger jetzt zu Tage befördert hat, ist eine bizarre Geschichte über die Raffgier und Unverfrorenheit von Bankern, die offensichtlich in den Zeiten des Börsenbooms jedes Gefühl für Anstand verloren hatten.
Es geht um den ehemaligen Staranalysten der Citigroup, Jack Grubman.Um für seine Zwillinge einen Platz im exklusiven New Yorker Kindergarten „Y“ zu ergattern, hatte Grubman entgegen seiner Überzeugung die Aktien des Telefonriesen AT&T hochgejubelt. Der Hintergrund: Der Analyst wollte dadurch seinem Chef, Citigroup-Boss Sanford Weill, einen Gefallen tun, damit der sich um eine Aufnahme der Grubman-Sprösslinge in dem Kindergarten bemüht.
Ein Krippenplatz kostet immerhin bis zu 14 400 Dollar pro Jahr. Doch das ist Kleingeld für die New Yorker Eliten. Das größte Problem ist, dass sich um die 65 Plätze pro Jahr hunderte Eltern bewerben. Und man braucht schon gute Verbindungen, um sein Kind in dem Haus an der 92sten Straße in Manhattan unterzubringen.
Für Weill hatte die Aktienempfehlung seines Analysten wiederum eine ganz persönliche Bedeutung: Der Citigroup-Chef wollte sich der Unterstützung des AT&T-Chefs Michael Armstrong im Citibank-Aufsichtsrat für seinen Machtkampf gegen den damaligen Konkurrenten in der Firmenspitze, John Reed, versichern. Und so tat einer dem anderen offenbar einen Gefallen.
Grubman jubelte die AT&T-Aktie hoch. Armstrong war zufrieden. Weill hatte allen Grund, sich für Grubman und seine Kinder einzusetzen. Die Beteiligten streiten freilich einen direkten Zusammenhang zwischen Kindergarten-Platz, Aktientipp und Aufsichtsrats-Machtkampf ab.
Doch die Indizien scheinen ziemlich gegen Grubman, Weill & Co zu sprechen. Generalstaatsanwalt Spitzer hat im internen E-Mail-Verkehr der Bank handfeste Hinweise für den Deal gefunden.
„Wie ich letzte Woche schon andeutete, sind wir gerade mitten in diesem lächerlichen, aber notwendigen Bewerbungsprozess für die Kindergartenplätze in Manhattan... Wenn Sie irgendetwas tun könnten, wären wir sehr dankbar. Und, wie gesagt, ich halte Sie in Sachen AT&T auf dem Laufenden. Es sieht gut aus“, schrieb Grubman im November 1999 an seinen Chef Weill.
Eine Spende in Höhe von einer Million Dollar an den Kindergarten durch die Bank sicherte dann offenbar auch die begehrten Plätze für die Grubman-Zwillinge. Zu dieser Zeit hatte Weill seinen Staranalysten auch beauftragt, einen „frischen Blick“ auf die AT&T-Aktie zu werfen. Grubman parierte.
Im November 1999 gab er für das Papier eine Kaufempfehlung ab, obwohl er die Aktie kurz vorher nur mit „halten“ bewertet hatte. Im Februar 2000, nachdem für die Banker alles glatt über die Bühne gegangen war, wurde die Aktie wieder heruntergestuft.
An der Wall Street wird über die Geschichte viel gelacht. Nur: Von den Anlegern, die auf Grubmans Rat vertrauten, ist nicht die Rede. „Das ganze macht deutlich, was eigentlich hinter den hochgepriesenen Aktien-Analysen steckt“, kommentiert ein Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft die Grubman-Story.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 20.11.2002
wenn es denn noch eines Beweises bedarf :

Aktientipp gegen Platz im Kindergarten
Wie der New Yorker Staranalyst Jack Grubman seine Zwillinge exklusiv unterbrachte.
New Yorks Generalstaatsanwalt Eliot Spitzer lässt nicht locker. Hartnäckig ist er den dunklen Machenschaften im Bankengewerbe an der Wall Street auf der Spur. Was der Chefankläger jetzt zu Tage befördert hat, ist eine bizarre Geschichte über die Raffgier und Unverfrorenheit von Bankern, die offensichtlich in den Zeiten des Börsenbooms jedes Gefühl für Anstand verloren hatten.
Es geht um den ehemaligen Staranalysten der Citigroup, Jack Grubman.Um für seine Zwillinge einen Platz im exklusiven New Yorker Kindergarten „Y“ zu ergattern, hatte Grubman entgegen seiner Überzeugung die Aktien des Telefonriesen AT&T hochgejubelt. Der Hintergrund: Der Analyst wollte dadurch seinem Chef, Citigroup-Boss Sanford Weill, einen Gefallen tun, damit der sich um eine Aufnahme der Grubman-Sprösslinge in dem Kindergarten bemüht.
Ein Krippenplatz kostet immerhin bis zu 14 400 Dollar pro Jahr. Doch das ist Kleingeld für die New Yorker Eliten. Das größte Problem ist, dass sich um die 65 Plätze pro Jahr hunderte Eltern bewerben. Und man braucht schon gute Verbindungen, um sein Kind in dem Haus an der 92sten Straße in Manhattan unterzubringen.
Für Weill hatte die Aktienempfehlung seines Analysten wiederum eine ganz persönliche Bedeutung: Der Citigroup-Chef wollte sich der Unterstützung des AT&T-Chefs Michael Armstrong im Citibank-Aufsichtsrat für seinen Machtkampf gegen den damaligen Konkurrenten in der Firmenspitze, John Reed, versichern. Und so tat einer dem anderen offenbar einen Gefallen.
Grubman jubelte die AT&T-Aktie hoch. Armstrong war zufrieden. Weill hatte allen Grund, sich für Grubman und seine Kinder einzusetzen. Die Beteiligten streiten freilich einen direkten Zusammenhang zwischen Kindergarten-Platz, Aktientipp und Aufsichtsrats-Machtkampf ab.
Doch die Indizien scheinen ziemlich gegen Grubman, Weill & Co zu sprechen. Generalstaatsanwalt Spitzer hat im internen E-Mail-Verkehr der Bank handfeste Hinweise für den Deal gefunden.
„Wie ich letzte Woche schon andeutete, sind wir gerade mitten in diesem lächerlichen, aber notwendigen Bewerbungsprozess für die Kindergartenplätze in Manhattan... Wenn Sie irgendetwas tun könnten, wären wir sehr dankbar. Und, wie gesagt, ich halte Sie in Sachen AT&T auf dem Laufenden. Es sieht gut aus“, schrieb Grubman im November 1999 an seinen Chef Weill.
Eine Spende in Höhe von einer Million Dollar an den Kindergarten durch die Bank sicherte dann offenbar auch die begehrten Plätze für die Grubman-Zwillinge. Zu dieser Zeit hatte Weill seinen Staranalysten auch beauftragt, einen „frischen Blick“ auf die AT&T-Aktie zu werfen. Grubman parierte.
Im November 1999 gab er für das Papier eine Kaufempfehlung ab, obwohl er die Aktie kurz vorher nur mit „halten“ bewertet hatte. Im Februar 2000, nachdem für die Banker alles glatt über die Bühne gegangen war, wurde die Aktie wieder heruntergestuft.
An der Wall Street wird über die Geschichte viel gelacht. Nur: Von den Anlegern, die auf Grubmans Rat vertrauten, ist nicht die Rede. „Das ganze macht deutlich, was eigentlich hinter den hochgepriesenen Aktien-Analysen steckt“, kommentiert ein Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft die Grubman-Story.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 20.11.2002
nur sieht es bei uns nicht anders aus ...
Nach Ansicht führender Ermittler grassiert in Deutschland die Bestechung. Zur Abschreckung wollen sie Strafen durchsetzen, die bis zur Auflösung von Unternehmen reichen.
"Das Phänomen ist in Deutschland jahrzehntelang unterschätzt und seine Verfolgung sträflich vernachlässigt worden", sagte der Frankfurter Oberstaatsanwalt und Korruptionsermittler Wolfgang Schaupensteiner auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA). Ein schockierender Beleg ist seiner Ansicht nach die Zahl der strafrechtlich verfolgten Korruptionsfälle.
Diese sei von 58 im Jahr 1994 auf 1243 im Jahr 2000 gestiegen. Nach wie vor - so befürchtet der Korruptionsexperte - sei damit zu rechnen, dass 95 von 100 Korruptionsvergehen unentdeckt bleiben.
Die Bestechungssummen würden bei der Abrechnung von Leistungen zu Aufschlägen von bis zu 600 Prozent führen, so der Oberstaatsanwalt. Nur damit seien die oft beobachteten Kostensteigerungen bei öffentlichen Bauvorhaben zu erklären. Den Staatanwalt ärgert dabei besonders, dass jeder Bürger Opfer von Korruption ist: Höhere Steuern, Müll- oder Kindergartengebühren kommen laut Schaupensteiner nicht selten deshalb zustande, weil Unternehmen mit Schmiergeld arbeiten, um sich lukrative Staatsaufträge zu sichern.
Allein bei öffentlichen Bauvorhaben entstehe durch Korruption pro Jahr ein Schaden von schätzungsweise fünf Milliarden (!!!) Euro.
Schaupensteiner fordert deshalb ein eigenständiges Strafrecht gegen bestechende Unternehmen, dessen Sanktionen bis zur Auflösung der Firma reichen sollten. Zwingend notwendig sei zudem immer noch die Einführung einer bundesweiten "schwarzen Liste", mit deren Hilfe korrupte Unternehmen von weiteren Aufträgen ausgeschlossen werden könnten. Nach Einschätzung der Bielefelder Strafrechtlerin Britta Bannenberg fehlt es der Politik am Willen, gegen ihresgleichen ermitteln zu lassen. Wenn es um strukturelle Korruption gehe, bewege man sich automatisch in gesellschaftlich höheren Regionen und müsse gegen Beschuldigte in Machtpositionen vorgehen. In diesen Fällen nehme dann auch regelmäßig die Politik Einfluss auf Ermittlungen und öffentliche Diskussion. Es bestehe die Gefahr einer starken Verfilzung von Politik und Organisierter Kriminalität.
Außerdem sind die deutschen Strafverfolgungsbehörden nach Meinung von Bannenberg für den Kampf gegen die Korruption noch zu schlecht aufgestellt: Zahlreiche Ermittlungsverfahren, die deutliche Hinweise auf korrupte Netze und Organisierte Kriminalität enthielten, würden eingestellt, weil überlastete Staatsanwälte "die Akten vom Tisch hauen" müssten.
Quelle: SPIEGEL 20.11.2001
Nach Ansicht führender Ermittler grassiert in Deutschland die Bestechung. Zur Abschreckung wollen sie Strafen durchsetzen, die bis zur Auflösung von Unternehmen reichen.
"Das Phänomen ist in Deutschland jahrzehntelang unterschätzt und seine Verfolgung sträflich vernachlässigt worden", sagte der Frankfurter Oberstaatsanwalt und Korruptionsermittler Wolfgang Schaupensteiner auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA). Ein schockierender Beleg ist seiner Ansicht nach die Zahl der strafrechtlich verfolgten Korruptionsfälle.
Diese sei von 58 im Jahr 1994 auf 1243 im Jahr 2000 gestiegen. Nach wie vor - so befürchtet der Korruptionsexperte - sei damit zu rechnen, dass 95 von 100 Korruptionsvergehen unentdeckt bleiben.
Die Bestechungssummen würden bei der Abrechnung von Leistungen zu Aufschlägen von bis zu 600 Prozent führen, so der Oberstaatsanwalt. Nur damit seien die oft beobachteten Kostensteigerungen bei öffentlichen Bauvorhaben zu erklären. Den Staatanwalt ärgert dabei besonders, dass jeder Bürger Opfer von Korruption ist: Höhere Steuern, Müll- oder Kindergartengebühren kommen laut Schaupensteiner nicht selten deshalb zustande, weil Unternehmen mit Schmiergeld arbeiten, um sich lukrative Staatsaufträge zu sichern.
Allein bei öffentlichen Bauvorhaben entstehe durch Korruption pro Jahr ein Schaden von schätzungsweise fünf Milliarden (!!!) Euro.
Schaupensteiner fordert deshalb ein eigenständiges Strafrecht gegen bestechende Unternehmen, dessen Sanktionen bis zur Auflösung der Firma reichen sollten. Zwingend notwendig sei zudem immer noch die Einführung einer bundesweiten "schwarzen Liste", mit deren Hilfe korrupte Unternehmen von weiteren Aufträgen ausgeschlossen werden könnten. Nach Einschätzung der Bielefelder Strafrechtlerin Britta Bannenberg fehlt es der Politik am Willen, gegen ihresgleichen ermitteln zu lassen. Wenn es um strukturelle Korruption gehe, bewege man sich automatisch in gesellschaftlich höheren Regionen und müsse gegen Beschuldigte in Machtpositionen vorgehen. In diesen Fällen nehme dann auch regelmäßig die Politik Einfluss auf Ermittlungen und öffentliche Diskussion. Es bestehe die Gefahr einer starken Verfilzung von Politik und Organisierter Kriminalität.
Außerdem sind die deutschen Strafverfolgungsbehörden nach Meinung von Bannenberg für den Kampf gegen die Korruption noch zu schlecht aufgestellt: Zahlreiche Ermittlungsverfahren, die deutliche Hinweise auf korrupte Netze und Organisierte Kriminalität enthielten, würden eingestellt, weil überlastete Staatsanwälte "die Akten vom Tisch hauen" müssten.
Quelle: SPIEGEL 20.11.2001
50 Jahre DDR-Kommunismus....
Ich dachte der 40. Geburtstach war der letzte ...Oder war Hitler schon DDR-Kommunist...
@konradi
Was willst Du hier mit den tollen Artikeln und den fettgedruckten Stellen bezwecken??

Ich dachte der 40. Geburtstach war der letzte ...Oder war Hitler schon DDR-Kommunist...
@konradi
Was willst Du hier mit den tollen Artikeln und den fettgedruckten Stellen bezwecken??

@ schuh
ich vertreib mir die Langeweile - was sonst ?
ich vertreib mir die Langeweile - was sonst ?
Eigentlich hatte ich irgendwann mal vor, mich mit ner eigenen company selbstständig zu machen, aber angesichts unserer tollen bundesdeutschen Rahmenbedingungen arbeite ich lieber weiter auf Karte...
Was bringts denn heute noch Unternehmer zu sein? Dauerärger mit dem Betriebsrat, behördliche Hindernisse, grüne Ökotrottel, die einen mit Auflagen zuschmeißen und wenn man Glück hat und Geld macht, wird`s sozialisiert.
Allerdings ist der Konkurs den man im Umkehrschluß hinlegt, wenn man Pech hat, dann wieder Privatsache....einen Ehrenverlust für Bankrotteure wie früher gibt`s allerdings auch nicht mehr: Früher haben sich Bankrotteure oder pleitegegangene Zocker erschossen, heute haben die ein großes Maul und gehen in ne Talkshow.
Was bringts denn heute noch Unternehmer zu sein? Dauerärger mit dem Betriebsrat, behördliche Hindernisse, grüne Ökotrottel, die einen mit Auflagen zuschmeißen und wenn man Glück hat und Geld macht, wird`s sozialisiert.
Allerdings ist der Konkurs den man im Umkehrschluß hinlegt, wenn man Pech hat, dann wieder Privatsache....einen Ehrenverlust für Bankrotteure wie früher gibt`s allerdings auch nicht mehr: Früher haben sich Bankrotteure oder pleitegegangene Zocker erschossen, heute haben die ein großes Maul und gehen in ne Talkshow.

.
@ sovereign
also wenn ich Dich mal so ganz vorsichtig einschätzen darf, dann könntest Du
Dein Lebensglück vielleicht auch als Bergbauer finden
Wie das gehen könnte zeigt der folgende Bericht:
Sepp Holzer´s Nichtstuerlandwirtschaft

Ein österreichischer Bergbauer zeigt, was machbar ist, wenn man die Dinge so nimmt, wie sie sind:
Auf extremen Höhen wachsen Früchte, es gedeiht, was unter scheinbar besseren Bedingungen verdirbt.
Alles, was es dazu braucht: Konsequenz.
Der Salzburger Bergbauer Josef „Sepp“ Holzer pflanzt Apfelbäume, Kiwis und Weinstöcke an. In Höhen von 1300 bis 1500 Meter. Nach der reinen Schul-Biologie ist das eigentlich nicht möglich. Dort, wo der Bergbauer wohnt und arbeitet, wird es im Winter bis zu minus 30 Grad kalt. Keine Gegend für die Zucht wärmeliebender Obstsorten oder exotischer Früchte.
Aber Sepp Holzer tat es trotzdem, und es funktioniert.
Und Sepp Holzer weiß, warum.
Die Pflanzen in den Baumschulen und im Flachland sind sehr verwöhnt. Sie bekommen ein Überangebot an Nährstoffen und Wasser. Dieses Überangebot lässt sie zu schnell zu groß werden. Wenn es dann trockener oder kälter, nährstoffärmer oder enger wird, gehen diese Pflanzen schnell ein. Die Baumschulen warfen deshalb tausende von Obstbäumen weg, die nicht rechtzeitig zur Saison verkauft wurden. Die Abfallbäume hatten meist nicht einmal mehr Erdballen und lagen scheinbar tot herum. Sepp Holzer kaufte den Baumschulen die Bäume für winzige Beträge ab. Sie hatten bereits die Blätter verloren, die Spitzen der Äste waren dürr. Er sagt: „Das ist ganz natürlich. Wenn die Pflanze keine Nährstoffe und kein Wasser, keinen Schatten und keine Nachbarn mehr spürt, reduziert sie sich auf das absolute Minimum. Dafür muss sie alle Blätter und Früchte abwerfen.“
Anstatt nun die halb verhungerten Pflanzen in nährstoffreiche Humusoasen zu setzen oder gar stark zu wässern, steckte Holzer sie wiederum auf dürres Land. Holzer: „Für die Pflanze wäre es ein Schock, sofort so viel Wasser und Nährstoffe zu bekommen. Sie ist jetzt misstrauisch gegenüber solchen Gaben und wird erst wieder austreiben, wenn sie sich sicher fühlt.“
Holzer legte auf seinem Berg Terrassen an, in denen Kies und Steine im Boden blieben. Insgesamt 14000 Obstbäume setzte er in den unvorbereiteten Boden. Die örtlichen Bauernverbände lachten ihn aus, man entzog ihm sogar steuerlich den Bergbauernstatus, da er nun ein Gartenbaubetrieb sei. Die Folge war, dass er eine drastisch höhere Grundsteuer zahlen musste.
Kein Wunder, denn was Sepp Holzer macht, widerspricht allen Regeln der Landwirtschaft. Er steckt die Obstbäume ohne jede Humuszugabe einfach in den trockenen Boden. „Die Natur“, sagt Holzer, „weiß selbst am besten, wie es richtig geht.“ Holzer schneidet die Bäume auch nicht zurück: Nach seiner Ansicht schwächt das den Baum zusätzlich, weil er die dabei entstehenden Wunden verschließen muss.
Nachdem im Frühsommer, einer nach geltender Meinung völlig ungünstigen Pflanzzeit, die Bäume gesetzt wurden, kamen im Herbst die ersten hämischen Besucher: Die meisten Bäume sahen immer noch kahl aus und trugen keine Früchte. Die Schadenfreude sollte noch lange währen: Der Winter kam, und nun erfroren auch noch die Spitzen seiner Bäume. Holzers Erklärung: „Der Baum zieht seine Säfte zum Überleben in der Wurzel zusammen. Unter diesen Säften ist auch sein Frostschutz. Da sich die Bäume aber in der freien Wildbahn befanden, waren sie im Winter natürlich begehrte Delikatessen für Hasen und Rehe.“ Oder doch nicht? Die gefrorenen Spitzen nämlich wurden vom Wild nicht angerührt, das sich lieber an gesunden Bäumen labte.
Doch das schien ihnen nicht viel geholfen zu haben. Als im Frühjahr der Schnee schmolz und man die neu gesetzten Bäume mit den gesunden alten vergleichen konnte, hatten sie bis Mai immer noch keine Triebe angesetzt. „Kein Wunder“, sagt Holzer, „da die Spitzen abgefroren sind, muss der Baum erst von ganz unten aus dem Stamm heraus neue Triebe bilden. Das dauert lange.“
Der Sommer kam, und während es überall blühte und sich die ersten Früchte bildeten, sah es um Holzers Bäume traurig aus. Doch mitten im Juli, während anderswo bereits die Kirschen geerntet wurden, begannen Holzers Bäume auf einmal zu blühen: ein Fest für die Bienen.
Aber die Blüten lagen natürlich nicht in Erntehöhe, da die Bäume nie beschnitten wurden. Was für die Natur und für die romantischen Spaziergänger ein Erlebnis war, nämlich eine dichte Ansammlung von Obstbäumen, war unter Erntegesichtspunkten völlig unwirtschaftlich, da man weder mit kleinen Traktoren noch mit Erntemaschinen durch dieses Durcheinander fahren konnte.
Aber immerhin: Obst gab es genug. 14000 Obstbäume, das sind selbst bei einer winzigen Menge von zwei Kilo Obst pro Baum trotzdem noch 28000 Kilo Obst.
Der Sommer verging, August und September ebenfalls. Der Oktober hatte begonnen. Die Erntezeit der von Holzer gepflanzten Obstsorten Kirsche, Birne, Apfel, Johannisbeere war überall längst vorbei. Allenfalls einige verspätete Zwetschgen hielten sich noch an schattigen Nordseiten hinter Stallgebäuden.
Von Holzer lässt sich einiges lernen. Etwa, nicht von seinen Überzeugungen abzurücken
Am 8. Oktober fuhr ich mit dem Philosophen Walter Seitter zu Sepp Holzer hinauf. Wir fanden überall reife Johannisbeeren, Kirschen, darunter kleine, wohlschmeckende Schwarzkirschen, aber auch Äpfel und Birnen in großen Mengen. Die Zwetschgen aber waren noch nicht reif. Sepp Holzer hatte Frischobst produziert in einer Zeit, in der es eigentlich kein heimisches Frischobst mehr gab. Seine Bäume waren zwar schwieriger zu ernten, aber sie trugen in einer Zeit, in der die Preise bereits anstiegen. Das Echo ließ nicht lange auf sich warten: Mittlerweile möchten zahlreiche Gartenliebhaber Bäume von Holzer bei sich einsetzen. Und er verkauft sie zu guten Preisen.
Was wir aus dieser Erfolgsgeschichte – so darf man sie wohl nennen – lernen, sind mehrere Künste:
- die Kunst, geltenden Meinungen und Lehren zu misstrauen
- die Kunst, etwas Unvernünftiges und möglicherweise Vergebliches zu tun
- die Kunst, alle Rückschläge und Misserfolge nicht wegzureden, sondern zu akzeptieren und zu erklären
- die Kunst, zu warten.
Mich beeindrucken dabei besonders seine Experimente mit Samen. Sie widersprechen allem, was ich selbst auf den Spuren von John Seymour und Rudolf Steiner beim biologischen Gärtnern auf dem Bauernhof meines Vaters im niederbayerischen Rottal lernte und erprobte. Unser von zwei Bächen durchschnittener Grund war noch nie künstlich gedüngt worden. Es handelte sich also um relativ nährstoffarme Böden. Anfang der achtziger Jahre herrschten in der biologisch-dynamischen, manche sagen auch biologisch-organischen Landwirtschaft eine Reihe von Lehrmeinungen. Im Mittelpunkt stand dabei die Aktivierung des Bodenlebens. Die fleißigen Regenwürmer, die sich von Mikroben ernährten, sollten durch Kompost und Rindenmulch motiviert werden, die Erde locker zu halten. Bei neu gepflanzten Bäumen sorgte der Mulch dafür, dass die Wühlmäuse fern blieben und es um die junge Pflanze herum feucht blieb.
Als biologischer Landwirt ist man also ständig mit allerlei Mulchmischungen unterwegs, denen man am besten noch ganz anthroposophisch Urgesteinsmehl zusetzt. Bestimmte Tierarten erfuhren durch die biologische Landwirtschaft einen regelrechten Boom: Neben den Regenwürmern, die diese Unmengen von Nahrung gar nicht verdauen konnten, waren das die Schnecken.
Verkürzt gesagt, bedeutete die Lehrmeinung der biologischen Landwirtschaft das Gleiche wie die der Betriebswirtschaftslehre: Durch fleißige Arbeit (Mulchen) und die Zugabe von Kapital (Mulch) entsteht Mehrwert (Nährstoffe).
Die so bemutterten Pflanzen empfanden das jedoch anders. Mitten im Juni oder im September gingen sie ein. Obstbäume trugen nicht. Schnecken fraßen den Salat. Kartoffeln verfaulten im Feld. Auch die genaue Kenntnis der Mondphase und des Hundertjährigen Kalenders, das Ansetzen von Brennnesselsud und selbst der Feldzug gegen die Schnecken brachte keine Besserung. Ich lernte auf dem Bauernhof meines Vaters, dass auch so etwas scheinbar Einfaches wie Landwirtschaft schief gehen kann. Sepp Holzer nun, der Agrar-Rebell, wie er in Österreich genannt wurde, verfolgte eine völlig andere Strategie bei der Erziehung von Pflanzen. Holzer ließ seinen Samen freien Lauf. Anstatt sie in sorgfältig bereitete Humus-Whirlpools zu legen und ihnen Gesteinsmehldiäten zu verpassen, legte er die Samen einfach nackt unter kleine Steine. Holzer: „Der Stein gibt dem Samen alles, was er braucht: Schutz vor Kälte, Sonneneinstrahlung und Hitze, gespeicherte Feuchtigkeit und Wärme sowie Nährstoffe.“
Bedürfnisse folgen Bedingungen – auch auf der Alm
Da im Samen der Wille zu keimen angelegt ist, wird er dann keimen, wenn er die Bedingungen für optimal hält. Der Same, so Holzer, ist schlauer als wir. Es gibt Weizenkörner in Pharaonengräbern, die erst nach 4000 Jahren Lust zum Keimen bekamen, als nämlich Luftfeuchtigkeit, Licht und Sauerstoff in die versiegelten Räume eindrangen. In den Gärten des Sepp Holzer kann man Geröllhalden beobachten, die von riesigen Kürbis- und Zucchinipflanzen überwuchert sind. In den Kiesbetten wachsen Salat, Rote Bete und Rauke, Getreide und Spinat. Um nun den Entfaltungswillen des Samens nicht zu behindern, soll nach Holzer alles vermieden werden, was den Samen in die Irre führt. Wieder eine Lehrmeinung: Wir haben gelernt, frostempfindliche Pflanzen zunächst in Setzkästen oder gar im Gewächshaus anzuziehen, bevor man sie im Freiland aussetzt.
„Völlig falsch“, sagt Sepp Holzer. Eine schlaue Pflanze wird nämlich gar keine Triebe oder Blüten bilden, wenn sie das Gefühl hat, dass es dafür noch zu kalt ist. Und wenn ihr die Triebe erfrieren, wird sie später anderswo neue bilden. Wie aber soll der Same je sein Wissen über das Leben erproben, wenn er durch wohlmeinende Gartenliebhaberinnen mit Nährstoff und Regenwasser verdorben wird? Wie soll eine Pflanze, die täglich gegossen wird, sich in einer Welt zurechtfinden, in der es einmal sechs Wochen nicht regnet? Wie soll sich eine Pflanze gegen Schädlinge wehren, die von Anfang an von ihr fern gehalten werden? Je mehr wir über Holzers Samenphilosophie nachdenken, desto mehr erscheint es uns logisch, Pflanzen die Chance zu geben, sich an ihre Umgebung anzupassen. Wenn dann einer Pflanze die Umgebung partout nicht gefällt, was in einem deutschen Vorstadtgarten nicht gerade selten vorkommt, wird sie trotz aller Liebesgaben eingehen.
Die Samen unter den Steinen lernen, ihre Bedürfnisse den Bedingungen anzupassen. Sie kommen mit den Nährstoffen aus, die Tau und Regen vom Stein abwaschen. Sie nehmen sich einen Teil der Wärme, die der Stein tagsüber durch das Sonnenlicht aufnimmt. Sie saugen an der Feuchtigkeit, die sich in der ewigen Dunkelheit unter dem Stein erhält. Probieren Sie es doch mal: Säen Sie im November ein paar hundert Samen unter Steinen irgendwo in der Natur oder im Garten. Warum im November? Weil dann der Same gleich den Winter kennen lernen kann.
Holzer hat für seine Methode der sich selbst überlassenen Pflanzen den Begriff der „Nichtstuerlandwirtschaft“ geprägt. Während also unsere Familie in Niederbayern den ganzen Frühling und Sommer fleißig eggte und grub, säte und düngte, beschnitt und umzäunte, hätten wir laut Holzer auch gleich das tun sollen, was Vater und ich ohnehin am liebsten taten: bei einem Kasten Weißbier auf der Bank vorm Haus sitzen und dummes Zeug reden.
(brand eins / Alexander Dill)
mehr von Holzer : http://www.sbg.at/oberegger-anita/holzer1.html
- mit bodenständigen Grüßen Konradi
@ sovereign
also wenn ich Dich mal so ganz vorsichtig einschätzen darf, dann könntest Du
Dein Lebensglück vielleicht auch als Bergbauer finden

Wie das gehen könnte zeigt der folgende Bericht:
Sepp Holzer´s Nichtstuerlandwirtschaft

Ein österreichischer Bergbauer zeigt, was machbar ist, wenn man die Dinge so nimmt, wie sie sind:
Auf extremen Höhen wachsen Früchte, es gedeiht, was unter scheinbar besseren Bedingungen verdirbt.
Alles, was es dazu braucht: Konsequenz.
Der Salzburger Bergbauer Josef „Sepp“ Holzer pflanzt Apfelbäume, Kiwis und Weinstöcke an. In Höhen von 1300 bis 1500 Meter. Nach der reinen Schul-Biologie ist das eigentlich nicht möglich. Dort, wo der Bergbauer wohnt und arbeitet, wird es im Winter bis zu minus 30 Grad kalt. Keine Gegend für die Zucht wärmeliebender Obstsorten oder exotischer Früchte.
Aber Sepp Holzer tat es trotzdem, und es funktioniert.
Und Sepp Holzer weiß, warum.
Die Pflanzen in den Baumschulen und im Flachland sind sehr verwöhnt. Sie bekommen ein Überangebot an Nährstoffen und Wasser. Dieses Überangebot lässt sie zu schnell zu groß werden. Wenn es dann trockener oder kälter, nährstoffärmer oder enger wird, gehen diese Pflanzen schnell ein. Die Baumschulen warfen deshalb tausende von Obstbäumen weg, die nicht rechtzeitig zur Saison verkauft wurden. Die Abfallbäume hatten meist nicht einmal mehr Erdballen und lagen scheinbar tot herum. Sepp Holzer kaufte den Baumschulen die Bäume für winzige Beträge ab. Sie hatten bereits die Blätter verloren, die Spitzen der Äste waren dürr. Er sagt: „Das ist ganz natürlich. Wenn die Pflanze keine Nährstoffe und kein Wasser, keinen Schatten und keine Nachbarn mehr spürt, reduziert sie sich auf das absolute Minimum. Dafür muss sie alle Blätter und Früchte abwerfen.“
Anstatt nun die halb verhungerten Pflanzen in nährstoffreiche Humusoasen zu setzen oder gar stark zu wässern, steckte Holzer sie wiederum auf dürres Land. Holzer: „Für die Pflanze wäre es ein Schock, sofort so viel Wasser und Nährstoffe zu bekommen. Sie ist jetzt misstrauisch gegenüber solchen Gaben und wird erst wieder austreiben, wenn sie sich sicher fühlt.“
Holzer legte auf seinem Berg Terrassen an, in denen Kies und Steine im Boden blieben. Insgesamt 14000 Obstbäume setzte er in den unvorbereiteten Boden. Die örtlichen Bauernverbände lachten ihn aus, man entzog ihm sogar steuerlich den Bergbauernstatus, da er nun ein Gartenbaubetrieb sei. Die Folge war, dass er eine drastisch höhere Grundsteuer zahlen musste.
Kein Wunder, denn was Sepp Holzer macht, widerspricht allen Regeln der Landwirtschaft. Er steckt die Obstbäume ohne jede Humuszugabe einfach in den trockenen Boden. „Die Natur“, sagt Holzer, „weiß selbst am besten, wie es richtig geht.“ Holzer schneidet die Bäume auch nicht zurück: Nach seiner Ansicht schwächt das den Baum zusätzlich, weil er die dabei entstehenden Wunden verschließen muss.
Nachdem im Frühsommer, einer nach geltender Meinung völlig ungünstigen Pflanzzeit, die Bäume gesetzt wurden, kamen im Herbst die ersten hämischen Besucher: Die meisten Bäume sahen immer noch kahl aus und trugen keine Früchte. Die Schadenfreude sollte noch lange währen: Der Winter kam, und nun erfroren auch noch die Spitzen seiner Bäume. Holzers Erklärung: „Der Baum zieht seine Säfte zum Überleben in der Wurzel zusammen. Unter diesen Säften ist auch sein Frostschutz. Da sich die Bäume aber in der freien Wildbahn befanden, waren sie im Winter natürlich begehrte Delikatessen für Hasen und Rehe.“ Oder doch nicht? Die gefrorenen Spitzen nämlich wurden vom Wild nicht angerührt, das sich lieber an gesunden Bäumen labte.
Doch das schien ihnen nicht viel geholfen zu haben. Als im Frühjahr der Schnee schmolz und man die neu gesetzten Bäume mit den gesunden alten vergleichen konnte, hatten sie bis Mai immer noch keine Triebe angesetzt. „Kein Wunder“, sagt Holzer, „da die Spitzen abgefroren sind, muss der Baum erst von ganz unten aus dem Stamm heraus neue Triebe bilden. Das dauert lange.“
Der Sommer kam, und während es überall blühte und sich die ersten Früchte bildeten, sah es um Holzers Bäume traurig aus. Doch mitten im Juli, während anderswo bereits die Kirschen geerntet wurden, begannen Holzers Bäume auf einmal zu blühen: ein Fest für die Bienen.
Aber die Blüten lagen natürlich nicht in Erntehöhe, da die Bäume nie beschnitten wurden. Was für die Natur und für die romantischen Spaziergänger ein Erlebnis war, nämlich eine dichte Ansammlung von Obstbäumen, war unter Erntegesichtspunkten völlig unwirtschaftlich, da man weder mit kleinen Traktoren noch mit Erntemaschinen durch dieses Durcheinander fahren konnte.
Aber immerhin: Obst gab es genug. 14000 Obstbäume, das sind selbst bei einer winzigen Menge von zwei Kilo Obst pro Baum trotzdem noch 28000 Kilo Obst.
Der Sommer verging, August und September ebenfalls. Der Oktober hatte begonnen. Die Erntezeit der von Holzer gepflanzten Obstsorten Kirsche, Birne, Apfel, Johannisbeere war überall längst vorbei. Allenfalls einige verspätete Zwetschgen hielten sich noch an schattigen Nordseiten hinter Stallgebäuden.
Von Holzer lässt sich einiges lernen. Etwa, nicht von seinen Überzeugungen abzurücken
Am 8. Oktober fuhr ich mit dem Philosophen Walter Seitter zu Sepp Holzer hinauf. Wir fanden überall reife Johannisbeeren, Kirschen, darunter kleine, wohlschmeckende Schwarzkirschen, aber auch Äpfel und Birnen in großen Mengen. Die Zwetschgen aber waren noch nicht reif. Sepp Holzer hatte Frischobst produziert in einer Zeit, in der es eigentlich kein heimisches Frischobst mehr gab. Seine Bäume waren zwar schwieriger zu ernten, aber sie trugen in einer Zeit, in der die Preise bereits anstiegen. Das Echo ließ nicht lange auf sich warten: Mittlerweile möchten zahlreiche Gartenliebhaber Bäume von Holzer bei sich einsetzen. Und er verkauft sie zu guten Preisen.
Was wir aus dieser Erfolgsgeschichte – so darf man sie wohl nennen – lernen, sind mehrere Künste:
- die Kunst, geltenden Meinungen und Lehren zu misstrauen
- die Kunst, etwas Unvernünftiges und möglicherweise Vergebliches zu tun
- die Kunst, alle Rückschläge und Misserfolge nicht wegzureden, sondern zu akzeptieren und zu erklären
- die Kunst, zu warten.
Mich beeindrucken dabei besonders seine Experimente mit Samen. Sie widersprechen allem, was ich selbst auf den Spuren von John Seymour und Rudolf Steiner beim biologischen Gärtnern auf dem Bauernhof meines Vaters im niederbayerischen Rottal lernte und erprobte. Unser von zwei Bächen durchschnittener Grund war noch nie künstlich gedüngt worden. Es handelte sich also um relativ nährstoffarme Böden. Anfang der achtziger Jahre herrschten in der biologisch-dynamischen, manche sagen auch biologisch-organischen Landwirtschaft eine Reihe von Lehrmeinungen. Im Mittelpunkt stand dabei die Aktivierung des Bodenlebens. Die fleißigen Regenwürmer, die sich von Mikroben ernährten, sollten durch Kompost und Rindenmulch motiviert werden, die Erde locker zu halten. Bei neu gepflanzten Bäumen sorgte der Mulch dafür, dass die Wühlmäuse fern blieben und es um die junge Pflanze herum feucht blieb.
Als biologischer Landwirt ist man also ständig mit allerlei Mulchmischungen unterwegs, denen man am besten noch ganz anthroposophisch Urgesteinsmehl zusetzt. Bestimmte Tierarten erfuhren durch die biologische Landwirtschaft einen regelrechten Boom: Neben den Regenwürmern, die diese Unmengen von Nahrung gar nicht verdauen konnten, waren das die Schnecken.
Verkürzt gesagt, bedeutete die Lehrmeinung der biologischen Landwirtschaft das Gleiche wie die der Betriebswirtschaftslehre: Durch fleißige Arbeit (Mulchen) und die Zugabe von Kapital (Mulch) entsteht Mehrwert (Nährstoffe).
Die so bemutterten Pflanzen empfanden das jedoch anders. Mitten im Juni oder im September gingen sie ein. Obstbäume trugen nicht. Schnecken fraßen den Salat. Kartoffeln verfaulten im Feld. Auch die genaue Kenntnis der Mondphase und des Hundertjährigen Kalenders, das Ansetzen von Brennnesselsud und selbst der Feldzug gegen die Schnecken brachte keine Besserung. Ich lernte auf dem Bauernhof meines Vaters, dass auch so etwas scheinbar Einfaches wie Landwirtschaft schief gehen kann. Sepp Holzer nun, der Agrar-Rebell, wie er in Österreich genannt wurde, verfolgte eine völlig andere Strategie bei der Erziehung von Pflanzen. Holzer ließ seinen Samen freien Lauf. Anstatt sie in sorgfältig bereitete Humus-Whirlpools zu legen und ihnen Gesteinsmehldiäten zu verpassen, legte er die Samen einfach nackt unter kleine Steine. Holzer: „Der Stein gibt dem Samen alles, was er braucht: Schutz vor Kälte, Sonneneinstrahlung und Hitze, gespeicherte Feuchtigkeit und Wärme sowie Nährstoffe.“
Bedürfnisse folgen Bedingungen – auch auf der Alm
Da im Samen der Wille zu keimen angelegt ist, wird er dann keimen, wenn er die Bedingungen für optimal hält. Der Same, so Holzer, ist schlauer als wir. Es gibt Weizenkörner in Pharaonengräbern, die erst nach 4000 Jahren Lust zum Keimen bekamen, als nämlich Luftfeuchtigkeit, Licht und Sauerstoff in die versiegelten Räume eindrangen. In den Gärten des Sepp Holzer kann man Geröllhalden beobachten, die von riesigen Kürbis- und Zucchinipflanzen überwuchert sind. In den Kiesbetten wachsen Salat, Rote Bete und Rauke, Getreide und Spinat. Um nun den Entfaltungswillen des Samens nicht zu behindern, soll nach Holzer alles vermieden werden, was den Samen in die Irre führt. Wieder eine Lehrmeinung: Wir haben gelernt, frostempfindliche Pflanzen zunächst in Setzkästen oder gar im Gewächshaus anzuziehen, bevor man sie im Freiland aussetzt.
„Völlig falsch“, sagt Sepp Holzer. Eine schlaue Pflanze wird nämlich gar keine Triebe oder Blüten bilden, wenn sie das Gefühl hat, dass es dafür noch zu kalt ist. Und wenn ihr die Triebe erfrieren, wird sie später anderswo neue bilden. Wie aber soll der Same je sein Wissen über das Leben erproben, wenn er durch wohlmeinende Gartenliebhaberinnen mit Nährstoff und Regenwasser verdorben wird? Wie soll eine Pflanze, die täglich gegossen wird, sich in einer Welt zurechtfinden, in der es einmal sechs Wochen nicht regnet? Wie soll sich eine Pflanze gegen Schädlinge wehren, die von Anfang an von ihr fern gehalten werden? Je mehr wir über Holzers Samenphilosophie nachdenken, desto mehr erscheint es uns logisch, Pflanzen die Chance zu geben, sich an ihre Umgebung anzupassen. Wenn dann einer Pflanze die Umgebung partout nicht gefällt, was in einem deutschen Vorstadtgarten nicht gerade selten vorkommt, wird sie trotz aller Liebesgaben eingehen.
Die Samen unter den Steinen lernen, ihre Bedürfnisse den Bedingungen anzupassen. Sie kommen mit den Nährstoffen aus, die Tau und Regen vom Stein abwaschen. Sie nehmen sich einen Teil der Wärme, die der Stein tagsüber durch das Sonnenlicht aufnimmt. Sie saugen an der Feuchtigkeit, die sich in der ewigen Dunkelheit unter dem Stein erhält. Probieren Sie es doch mal: Säen Sie im November ein paar hundert Samen unter Steinen irgendwo in der Natur oder im Garten. Warum im November? Weil dann der Same gleich den Winter kennen lernen kann.
Holzer hat für seine Methode der sich selbst überlassenen Pflanzen den Begriff der „Nichtstuerlandwirtschaft“ geprägt. Während also unsere Familie in Niederbayern den ganzen Frühling und Sommer fleißig eggte und grub, säte und düngte, beschnitt und umzäunte, hätten wir laut Holzer auch gleich das tun sollen, was Vater und ich ohnehin am liebsten taten: bei einem Kasten Weißbier auf der Bank vorm Haus sitzen und dummes Zeug reden.
(brand eins / Alexander Dill)
mehr von Holzer : http://www.sbg.at/oberegger-anita/holzer1.html
- mit bodenständigen Grüßen Konradi

@konradi
Ich habs schonmal gesagt: Ich hab ne Menge Landwirte im weiteren Familienkreis und eines ist sicher: Ich bin nunmal kein Bauer!
Was soll ich machen? Ich bin handwerklich unbedarft, kein Freund körperlicher Arbeit und meine akademische Profession beschränkt sich auf Synergien, Effizienzen, Cost Cutting usw. usw.
Jeder kann nur das machen, wofür er geeignet ist und ich bin eben ein oller Schreibtischtäter...nicht mehr und nicht weniger.
Gruß
Sovereign
Ich habs schonmal gesagt: Ich hab ne Menge Landwirte im weiteren Familienkreis und eines ist sicher: Ich bin nunmal kein Bauer!

Was soll ich machen? Ich bin handwerklich unbedarft, kein Freund körperlicher Arbeit und meine akademische Profession beschränkt sich auf Synergien, Effizienzen, Cost Cutting usw. usw.
Jeder kann nur das machen, wofür er geeignet ist und ich bin eben ein oller Schreibtischtäter...nicht mehr und nicht weniger.
Gruß
Sovereign
na gut, mein Lieber, Bescheidenheit ist eine Zier ... 
- aber zwischen den Zeilen kann man ja vielleicht auch etwas entdecken, schließlich entstammt der Artikel einem Magazin für Unternehmensmanagement ...
Gruß Konradi

- aber zwischen den Zeilen kann man ja vielleicht auch etwas entdecken, schließlich entstammt der Artikel einem Magazin für Unternehmensmanagement ...
Gruß Konradi

.
Roland Leuschel plädiert für physisches Gold:
Ist das Ende der zweiten Kursrallye im aktuellen Bärenmarkt (2000 – 2012) eingeläutet ?
« Versuchen Sie weiterhin die Markterholungen mit den ihn bekannten Werten auszunutzen. Ich glaube in diesem Oktober 2002 wird wieder eine Kursrallye starten, die eine Aktie wie Allianz auf 120 katapultieren könnte, nur vergessen Sie dabei nicht, Ihren Gewinn glattzustellen (von jetzt 80 auf 120 wären es 50%). », so endete meine letzte Kolumne vom 9. Oktober.
Nun ich hoffe, Sie haben Ihre Gewinne « glattgestellt » ; denn die Allianz fiel sogar unter 80 und stieg auf 125. Auch andere Empfehlungen (wie IBM von 55 auf 80) konnten rund 50% zulegen. Auch das Ende der ersten Rallye kündigte ich Ende August in meiner Kolumne « Das brutale Ende der Kursrallye des Down Jones an der Fall Street » rechtzeitig an und meine Erfahrungen aus den 70er Jahren : In den Perioden des Tradings muss der Anleger die Börse wie eine kalte Dusche nach der Sauna ansehen : Schnell rein und schnell wieder raus !
Es gibt mehrere Gründe, die für ein Ende der derzeitigen Kursrallye plädieren, und gute Argumente, warum mittelfristig (3 bis 6 Monate) neue Tiefststände an den Börsen erreicht werden können. Vielleicht steht uns sogar eine « finale Ausverkaufsorgie » bevor. Dann können Sie wieder in aller Ruhe Ihre Value Stocks für die nächste Rallye, und die kommt bestimmt, einkaufen, denn der Bärenmarkt dauert noch ungefähr 10 Jahre.
Es braucht halt seine Zeit, bis die fundamentalen Ungleichgewichte abgebaut sind und die Normalität an die Börsen zurückkehrt (unter Anlegerforum.at können Sie meinen ausführlichen Vortrag beim Salzburger Anlegerforum vom 9.11.2002 abrufen).
Warum also kurzfristig Kasse machen, obwohl Berufsoptimisten, die zu erwartende Korrektur als grosse Chance ansehen : « Die Zeit zum Aktienkauf ist aus historischer Sicht gekommen. Auch die niedrigen Zinsen und das politische Umfeld sprechen dafür. », Artikel von Heiko Thieme in der FAZ vom 11.11. unter dem Titel « Grünes Licht für Aktien ».
Was das politische Umfeld anbetrifft, dürfte dieses Argument eher ein Karnevalsscherz zum 11.11. sein. Schon ein paar Tage später schrieb dieselbe FAZ auf der ersten Seite in einer Kolumne : « Wäre Deutschland ein Unternehmen und die Regierung der Vorstand, dann hätte die Staatsanwaltschaft gute Gründe, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung einzuleiten.
» Dem wäre nichts hinzuzufügen. Doch der ehemalige Finanzminister und Vorgänger von Hans Eichel, Oskar Lafontaine, schrieb am 17.11. in der Bild Zeitung : « Es ist als wäre Heinrich Brüning wieder auferstanden, jener Reichskanzler, der mit seiner Sparpolitik Massenarbeitslosigkeit verursachte und Hitler den Weg bereitete. »
In der Tat ist das die einzige Befürchtung, die ich auch hege ; denn mit Wirtschaftsrezessionen wird man immer fertig, sie gehören zur Natur der Wirschaftsentwicklung, und wir haben zum Beispiel in Belgien im Jahre 2001 die 34. Rezession seit der Schlacht von Waterloo gehabt, und das Land existiert immer noch. Wovor wir uns allerdings fürchten müssen, wäre eine Weltwirtschaftskrise II, Massenarbeitslosigkeit und konsequenterweise politischen Veränderungen. Vergessen wir nicht, dass im letzten Jahrhundert in zwei Ländern für mehrere Jahre der Aktienbesitz sogar verboten war – Sowjetunion und Deutschland. Es gibt auch Aktienexperten mit ausgezeichnetem Ruf, die auf Grund fundamentaler und charttechnischer Analyse noch erheblich tiefere Kurse in diesem Bärenmarkt sehen. So zeichnete der bekannte schweizerische Experte Felix Zulauf auf dem bereits erwähnten, gut besuchten 4. Salzburger Forum eine Situation, wonach der Standard & Poor`s 500 charttechnisch in die Gegend von 220 (heutiger Stand rund 900) fallen könnte, glaubt aber, dass bei 300 die Baisse ausgestanden sei.
Wir riskieren eine Weltwirtschaftskrise II, und es braucht nur die Immobilienblase in den USA oder Grossbritannien zu platzen, dann kann die letzte Stütze der Weltkonjunktur, der Konsum in USA, einbrechen, und der Staat hat bereits sein Pulver verschossen.
Die Notenbank ist sowieso nur noch Zuschauer, wie uns die japanische Entwicklung seit Jahren lehrt. Der Wirtschafts-Nobelpreisträger, Joseph E. Stiglitz, schreibt messerscharf dazu : « Wie mit einem Zauberstab hat es die amerikanische Regierung fertiggebracht, den in 10 Jahren kumulierten Haushaltsüberschuss von 3.000 Milliarden Dollar in ein titanisches Defizit von 2.000 Milliarden in einigen Monaten zu transformieren… Indem sie sich in ein riesiges Steuererleichterungsprogramm lanciert hat, hat die Regierung ähnliche betrügerische Buchhaltungsmethoden angewandt wie Enron… Europa wird Amerika in die Rezession folgen und so den amerikanischen Abschwung verstärken und eine Weltkrise auslösen. » - Trends Tendances 17. Oktober 2002.
Fazit : Erhöhen Sie wieder Ihre Cash-Position und berücksichtigen Sie dabei die Aufteilung 75% in Euro und 25% in Dollar. Aktien-Engagements sollten auf die Untergrenze von 30% limitiert bleiben.
Vergessen Sie auch nicht ein paar Goldbarren in Ihr Portefeuille zu legen. Irgendwann können die Notenbanken kein Gold mehr verkaufen, da sie keine Bestände mehr haben (ein schlimmes Beispiel in der langen Geschichte der Verschleuderung von « Volksvermögen »). Dann könnte die zweitgrösste Wirtschaftsmacht der Welt, China, ein Anlageproblem für ihre Reserven haben : Japanische Yen mögen sie nicht, der amerikanische Dollar könnte einbrechen, und der Euro ist nur eine Art Lückenbüsser, Gold dagegen können die Chinesen physisch in ihr Reich repatriieren. Dann, und ich hoffe es wird nie der Fall sein, werden in ein paar Jahren zwei Dinge bei 4.500 stehen : der Dow Jones und die Feinunze Gold.
Roland Leuschel 21.11.2002
Roland Leuschel plädiert für physisches Gold:
Ist das Ende der zweiten Kursrallye im aktuellen Bärenmarkt (2000 – 2012) eingeläutet ?
« Versuchen Sie weiterhin die Markterholungen mit den ihn bekannten Werten auszunutzen. Ich glaube in diesem Oktober 2002 wird wieder eine Kursrallye starten, die eine Aktie wie Allianz auf 120 katapultieren könnte, nur vergessen Sie dabei nicht, Ihren Gewinn glattzustellen (von jetzt 80 auf 120 wären es 50%). », so endete meine letzte Kolumne vom 9. Oktober.
Nun ich hoffe, Sie haben Ihre Gewinne « glattgestellt » ; denn die Allianz fiel sogar unter 80 und stieg auf 125. Auch andere Empfehlungen (wie IBM von 55 auf 80) konnten rund 50% zulegen. Auch das Ende der ersten Rallye kündigte ich Ende August in meiner Kolumne « Das brutale Ende der Kursrallye des Down Jones an der Fall Street » rechtzeitig an und meine Erfahrungen aus den 70er Jahren : In den Perioden des Tradings muss der Anleger die Börse wie eine kalte Dusche nach der Sauna ansehen : Schnell rein und schnell wieder raus !
Es gibt mehrere Gründe, die für ein Ende der derzeitigen Kursrallye plädieren, und gute Argumente, warum mittelfristig (3 bis 6 Monate) neue Tiefststände an den Börsen erreicht werden können. Vielleicht steht uns sogar eine « finale Ausverkaufsorgie » bevor. Dann können Sie wieder in aller Ruhe Ihre Value Stocks für die nächste Rallye, und die kommt bestimmt, einkaufen, denn der Bärenmarkt dauert noch ungefähr 10 Jahre.
Es braucht halt seine Zeit, bis die fundamentalen Ungleichgewichte abgebaut sind und die Normalität an die Börsen zurückkehrt (unter Anlegerforum.at können Sie meinen ausführlichen Vortrag beim Salzburger Anlegerforum vom 9.11.2002 abrufen).
Warum also kurzfristig Kasse machen, obwohl Berufsoptimisten, die zu erwartende Korrektur als grosse Chance ansehen : « Die Zeit zum Aktienkauf ist aus historischer Sicht gekommen. Auch die niedrigen Zinsen und das politische Umfeld sprechen dafür. », Artikel von Heiko Thieme in der FAZ vom 11.11. unter dem Titel « Grünes Licht für Aktien ».
Was das politische Umfeld anbetrifft, dürfte dieses Argument eher ein Karnevalsscherz zum 11.11. sein. Schon ein paar Tage später schrieb dieselbe FAZ auf der ersten Seite in einer Kolumne : « Wäre Deutschland ein Unternehmen und die Regierung der Vorstand, dann hätte die Staatsanwaltschaft gute Gründe, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung einzuleiten.
» Dem wäre nichts hinzuzufügen. Doch der ehemalige Finanzminister und Vorgänger von Hans Eichel, Oskar Lafontaine, schrieb am 17.11. in der Bild Zeitung : « Es ist als wäre Heinrich Brüning wieder auferstanden, jener Reichskanzler, der mit seiner Sparpolitik Massenarbeitslosigkeit verursachte und Hitler den Weg bereitete. »
In der Tat ist das die einzige Befürchtung, die ich auch hege ; denn mit Wirtschaftsrezessionen wird man immer fertig, sie gehören zur Natur der Wirschaftsentwicklung, und wir haben zum Beispiel in Belgien im Jahre 2001 die 34. Rezession seit der Schlacht von Waterloo gehabt, und das Land existiert immer noch. Wovor wir uns allerdings fürchten müssen, wäre eine Weltwirtschaftskrise II, Massenarbeitslosigkeit und konsequenterweise politischen Veränderungen. Vergessen wir nicht, dass im letzten Jahrhundert in zwei Ländern für mehrere Jahre der Aktienbesitz sogar verboten war – Sowjetunion und Deutschland. Es gibt auch Aktienexperten mit ausgezeichnetem Ruf, die auf Grund fundamentaler und charttechnischer Analyse noch erheblich tiefere Kurse in diesem Bärenmarkt sehen. So zeichnete der bekannte schweizerische Experte Felix Zulauf auf dem bereits erwähnten, gut besuchten 4. Salzburger Forum eine Situation, wonach der Standard & Poor`s 500 charttechnisch in die Gegend von 220 (heutiger Stand rund 900) fallen könnte, glaubt aber, dass bei 300 die Baisse ausgestanden sei.
Wir riskieren eine Weltwirtschaftskrise II, und es braucht nur die Immobilienblase in den USA oder Grossbritannien zu platzen, dann kann die letzte Stütze der Weltkonjunktur, der Konsum in USA, einbrechen, und der Staat hat bereits sein Pulver verschossen.
Die Notenbank ist sowieso nur noch Zuschauer, wie uns die japanische Entwicklung seit Jahren lehrt. Der Wirtschafts-Nobelpreisträger, Joseph E. Stiglitz, schreibt messerscharf dazu : « Wie mit einem Zauberstab hat es die amerikanische Regierung fertiggebracht, den in 10 Jahren kumulierten Haushaltsüberschuss von 3.000 Milliarden Dollar in ein titanisches Defizit von 2.000 Milliarden in einigen Monaten zu transformieren… Indem sie sich in ein riesiges Steuererleichterungsprogramm lanciert hat, hat die Regierung ähnliche betrügerische Buchhaltungsmethoden angewandt wie Enron… Europa wird Amerika in die Rezession folgen und so den amerikanischen Abschwung verstärken und eine Weltkrise auslösen. » - Trends Tendances 17. Oktober 2002.
Fazit : Erhöhen Sie wieder Ihre Cash-Position und berücksichtigen Sie dabei die Aufteilung 75% in Euro und 25% in Dollar. Aktien-Engagements sollten auf die Untergrenze von 30% limitiert bleiben.
Vergessen Sie auch nicht ein paar Goldbarren in Ihr Portefeuille zu legen. Irgendwann können die Notenbanken kein Gold mehr verkaufen, da sie keine Bestände mehr haben (ein schlimmes Beispiel in der langen Geschichte der Verschleuderung von « Volksvermögen »). Dann könnte die zweitgrösste Wirtschaftsmacht der Welt, China, ein Anlageproblem für ihre Reserven haben : Japanische Yen mögen sie nicht, der amerikanische Dollar könnte einbrechen, und der Euro ist nur eine Art Lückenbüsser, Gold dagegen können die Chinesen physisch in ihr Reich repatriieren. Dann, und ich hoffe es wird nie der Fall sein, werden in ein paar Jahren zwei Dinge bei 4.500 stehen : der Dow Jones und die Feinunze Gold.
Roland Leuschel 21.11.2002
zu #95 ein Link:
http://www.busrep.co.za/html/busrep/br_frame_decider.php?cli…
mit Dank an Thaiguru, der gerade darauf hingewiesen hatte
http://www.busrep.co.za/html/busrep/br_frame_decider.php?cli…
mit Dank an Thaiguru, der gerade darauf hingewiesen hatte
.
Udo Rettberg, Handelsblatt :
Goldbranche drängt auf schonende Platzierung der Notenbankbestände
Gold ist als Kapitalanlage umstritten wie kaum eine andere Investmentklasse. Das Trauma an den Aktienmärkten hat Gold zwar bei privaten Anlegern wieder stärker ins Bewusstsein gerückt – institutionelle Anleger können sich mit Gold jedoch noch nicht so recht anfreunden.
Der World Gold Council (WGC), die Interessenvertretung der Goldminen, will dies ändern. Dass der Goldpreis in den vergangenen Tagen von 311 wieder auf zeitweise 318 $ je Feinunze in die Höhe geschossen ist, wird auch dem inzwischen leicht zunehmenden Interesse institutioneller Großanleger vor allem in den USA zugeschrieben. „Für Gold interessieren sich immer mehr institutionelle Anleger“, sagte Simon Village vom World Gold Council auf einer Pressekonferenz in Frankfurt.
Die im Jahr 1987 gegründete Branchenvereinigung der Goldminenindustrie glaubt, mit der Ernennung von James E. Burton zum Vorstandschef des WGC „einen großen Coup gelandet zu haben“. Der ehemalige Chef des California Public Employees Retirement System (Calpers) soll Gold bei institutionellen Anlegern in aller Welt stärker ins Gespräch bringen. „In jedem Depot sollte Gold einen Anteil von rund 5 % ausmachen“, sagt Village.
Bei US-Institutionen stößt der WGC mit seinem Ansinnen bereits auf Gehör. „Weitsichtige Großfinanziers wie Warren Buffet und George Soros sind bereits seit geraumer Zeit in Edelmetallen engagiert“, sagt der Münchener Vermögensverwalter Jens Ehrhardt. „Wir haben in den vergangenen Wochen ein zunehmendes Interesse internationaler Großanleger an Gold und anderen Edelmetallen festgestellt“, bestätigt Wolfgang Wrzesniok-Rossbach von Dresdner Kleinwort Wasserstein. „Wir glauben, dass es in Europa noch eine gewisse Zeit dauern wird, bis sich die Institutionellen stärker an die Kapitalanlage Gold heranwagen werden“, prognostiziert Marion Waidlein von der DZ Bank AG.
Die Pläne des WGC zielen darauf, die in den nächsten Jahren zum Verkauf stehenden Goldbestände internationaler Notenbanken marktschonend bei institutionellen Anlegern zu platzieren. Das Interesse deutscher Großanleger an einer solchen Lösung sei derzeit gering, sagt Andreas Fink vom Bundesverband Deutscher Investment. Hierzulande sei Gold bei nur wenigen Anlegern als Depotbeimischung gefragt. Für deutsche Investmentfonds sei ein Investment in physischem Gold auf Grund der restriktiven Anlagevorschriften nicht möglich. „Wir würden eine Veränderung des Regelwerks sehr begrüßen“, sagt Jens Ehrhardt in seiner Eigenschaft als Fondsmanager.
„Burton will nicht nur das Interesse an physischem Gold, sondern vor allem auch an Goldaktien wecken“, sagt Norbert Faller, Senior Fund Manager von Union Investment. Zahlreiche Goldminen hätten ihre Hausaufgaben in den vergangenen Jahren sehr gut gemacht, schlanke Strukturen erreicht und die Produktionskosten deutlich gesenkt. Daher seien zahlreiche Goldaktien heute durchaus interessante Investments.
Faller glaubt, dass die vierzehn Notenbanken das im Jahr 1999 abgeschlossene Washingtoner Goldabkommen über das Jahr 2004 hinaus verlängern werden. Das Abkommen sieht den kontrollierten Verkauf bestimmter Goldmengen aus den Beständen dieser Notenbanken vor. Bundesbank-Chef Ernst Welteke hatte in den vergangenen Monaten zwar die Diskussion über einen möglichen Verkauf eines Teils der Bundesbank-Goldbestände angestoßen, doch glauben Experten zuletzt eine Kehrtwende in der Haltung der Bundesbank erkannt zu haben. Der Goldschatz der Deutschen Bundesbank wecke bei den Politikern in Berlin zwar gewisse Begehrlichkeiten, sagt Faller. „Wegen der jüngst kritischen Stimmen von Bundesbank-Sprechern zur Politik der Regierung Schröder ist indes zu erwarten, dass sich die Bundesbank mit Händen und Füßen gegen einen Verkauf der Goldbestände wehren dürfte“, prophezeit Faller.
Udo Rettberg, Handelsblatt :
Goldbranche drängt auf schonende Platzierung der Notenbankbestände
Gold ist als Kapitalanlage umstritten wie kaum eine andere Investmentklasse. Das Trauma an den Aktienmärkten hat Gold zwar bei privaten Anlegern wieder stärker ins Bewusstsein gerückt – institutionelle Anleger können sich mit Gold jedoch noch nicht so recht anfreunden.
Der World Gold Council (WGC), die Interessenvertretung der Goldminen, will dies ändern. Dass der Goldpreis in den vergangenen Tagen von 311 wieder auf zeitweise 318 $ je Feinunze in die Höhe geschossen ist, wird auch dem inzwischen leicht zunehmenden Interesse institutioneller Großanleger vor allem in den USA zugeschrieben. „Für Gold interessieren sich immer mehr institutionelle Anleger“, sagte Simon Village vom World Gold Council auf einer Pressekonferenz in Frankfurt.
Die im Jahr 1987 gegründete Branchenvereinigung der Goldminenindustrie glaubt, mit der Ernennung von James E. Burton zum Vorstandschef des WGC „einen großen Coup gelandet zu haben“. Der ehemalige Chef des California Public Employees Retirement System (Calpers) soll Gold bei institutionellen Anlegern in aller Welt stärker ins Gespräch bringen. „In jedem Depot sollte Gold einen Anteil von rund 5 % ausmachen“, sagt Village.
Bei US-Institutionen stößt der WGC mit seinem Ansinnen bereits auf Gehör. „Weitsichtige Großfinanziers wie Warren Buffet und George Soros sind bereits seit geraumer Zeit in Edelmetallen engagiert“, sagt der Münchener Vermögensverwalter Jens Ehrhardt. „Wir haben in den vergangenen Wochen ein zunehmendes Interesse internationaler Großanleger an Gold und anderen Edelmetallen festgestellt“, bestätigt Wolfgang Wrzesniok-Rossbach von Dresdner Kleinwort Wasserstein. „Wir glauben, dass es in Europa noch eine gewisse Zeit dauern wird, bis sich die Institutionellen stärker an die Kapitalanlage Gold heranwagen werden“, prognostiziert Marion Waidlein von der DZ Bank AG.
Die Pläne des WGC zielen darauf, die in den nächsten Jahren zum Verkauf stehenden Goldbestände internationaler Notenbanken marktschonend bei institutionellen Anlegern zu platzieren. Das Interesse deutscher Großanleger an einer solchen Lösung sei derzeit gering, sagt Andreas Fink vom Bundesverband Deutscher Investment. Hierzulande sei Gold bei nur wenigen Anlegern als Depotbeimischung gefragt. Für deutsche Investmentfonds sei ein Investment in physischem Gold auf Grund der restriktiven Anlagevorschriften nicht möglich. „Wir würden eine Veränderung des Regelwerks sehr begrüßen“, sagt Jens Ehrhardt in seiner Eigenschaft als Fondsmanager.
„Burton will nicht nur das Interesse an physischem Gold, sondern vor allem auch an Goldaktien wecken“, sagt Norbert Faller, Senior Fund Manager von Union Investment. Zahlreiche Goldminen hätten ihre Hausaufgaben in den vergangenen Jahren sehr gut gemacht, schlanke Strukturen erreicht und die Produktionskosten deutlich gesenkt. Daher seien zahlreiche Goldaktien heute durchaus interessante Investments.
Faller glaubt, dass die vierzehn Notenbanken das im Jahr 1999 abgeschlossene Washingtoner Goldabkommen über das Jahr 2004 hinaus verlängern werden. Das Abkommen sieht den kontrollierten Verkauf bestimmter Goldmengen aus den Beständen dieser Notenbanken vor. Bundesbank-Chef Ernst Welteke hatte in den vergangenen Monaten zwar die Diskussion über einen möglichen Verkauf eines Teils der Bundesbank-Goldbestände angestoßen, doch glauben Experten zuletzt eine Kehrtwende in der Haltung der Bundesbank erkannt zu haben. Der Goldschatz der Deutschen Bundesbank wecke bei den Politikern in Berlin zwar gewisse Begehrlichkeiten, sagt Faller. „Wegen der jüngst kritischen Stimmen von Bundesbank-Sprechern zur Politik der Regierung Schröder ist indes zu erwarten, dass sich die Bundesbank mit Händen und Füßen gegen einen Verkauf der Goldbestände wehren dürfte“, prophezeit Faller.
Um die Börsen zu begreifen ist es vermutlich besser
nicht Volkswirtschaft studiert zu haben -
hier die neueste Verschwörungstheorie :
:
Wall-Street-Ausblick
Die Lemminge und der fahrende Zug
Von Carsten Volkery, New York
Die Rallye an der Wall Street geht in die achte Woche. Die meisten Beobachter glauben inzwischen, dass sie bis Silvester anhalten wird, weil Fondsmanager feige sind.
Sie mögen Herrscher über Milliarden sein. Doch Fondsmanager sind auch nur Menschen, die Angst um ihren Job haben. Diese Angst, sagen Börsianer, ist einer der Gründe, warum die Kurse an der Wall Street wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter steigen werden.
Vergangene Woche legte der Dow Jones nach einer zweiwöchigen Durststrecke mal wieder satte 2,6 Prozent zu. Der Nasdaq Composite gewann sogar vier Prozent.
Die Rallye wird nicht von Kleinanlegern getrieben (die sind weiterhin misstrauisch), sondern von den institutionellen Anlegern. Kurz vor Jahresende will kein Fondsmanager den fahrenden Zug verpassen. Die Herdenmentalität an der Wall Street erlaubt es den hochbezahlten Finanzjoungleuren, Geld zu verlieren, wenn alle Geld verlieren. Es gilt aber als Kündigungsgrund, wenn das eigene Portfolio hinter den Leit-Indizes zurückbleibt.
Da am Jahresende Bilanz gezogen wird, beeilen sich die Manager, ihre Fonds in der verbleibenden Zeit noch aufzupolieren. Am liebsten kaufen sie logischerweise Aktien mit hohem Wachstumspotenzial. Und was gibt es da Besseres als die Penny Stocks von der Nasdaq?
Seit dem Tief am 9. Oktober hat der Nasdaq Composite 32 Prozent zugelegt, der Internet-Sektor sogar 40 Prozent. Das erscheint kaum gerechtfertigt, schließlich werden die Wachstumserwartungen fürs kommende Jahr ständig reduziert, und auch die Unternehmensinvestitionen zeigen keine Zeichen der Besserung. Die Wende in der besonders hart getroffenen Tech-Branche ist erst für Ende 2003 angesagt.
Doch die Rallye nährt sich im Moment selbst. Durch ihre schlichte Langlebigkeit zwingt sie die Fondsmanager zum Kaufen. Diese Woche wird sich die Aufwärtsspirale wohl weiterdrehen - wenn auch mit einem deutlich reduzierten Personal. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving zu, am Freitag schließt sie bereits früher. Viele Börsianer werden ein langes Wochenende genießen.
Thanksgiving ist der offizielle Beginn der Vorweihnachtszeit und damit der Startschuss zum alljährlichen Shopping-Wahnsinn. Die Ökonomen sind gespannt auf die ersten Berichte aus den Malls. Sie erwarten eine mittelprächtige Saison - etwa drei Prozent mehr Umsatz als vergangenes Jahr.
Traditionell ist die Weihnachtssaison auch gut für Aktien. In 41 der vergangenen 50 Jahre sind die Kurse am Tag vor und nach Thanksgiving gestiegen. Der Dezember ist im historischen Durchschnitt der zweitbeste Aktienmonat.
Unterstützend hinzu kommt diese Woche ein ganzer Schwung von voraussichtlich annehmbaren Konjunkturdaten. Am Dienstagmorgen soll das Wirtschaftswachstum des dritten Quartals von 3,1 auf 3,7 Prozent nach oben revidiert werden. Das dürfte der Börse einen Schub geben - auch wenn die Prognose für das laufende Quartal weiterhin bei einem Prozent liegt.
Nicht zuletzt dank der Aktienrallye schauen die Amerikaner wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft, wie beide Indizes des Verbrauchervertrauens diese Woche wohl zeigen werden. Ihren neu gewonnenen Optimismus können sie in den nächsten Wochen an den Kaufhauskassen unter Beweis stellen.
Am Mittwoch werden zwei wichtige Indikatoren für das Verhalten von Unternehmen bekannt gegeben: die Auftragseingänge für langlebige Güter (Oktober) und der Chicago-Einkaufsmanager-Index. Ökonomen erwarten in beiden Fällen einen leichten Anstieg - und die Börse wird dementsprechend positiv reagieren.
Doch der Anstieg der beiden Indikatoren kann nicht über den Mangel an Unternehmensinvestitionen hinweg täuschen: Die Auftragseingänge-Zahl ist sehr volatil, und der Oktoberwert könnte sich am Ende als Ausreißer im bestehenden Abwärtstrend entpuppen. Im August und September waren die Auftragseingänge jeweils eingebrochen. Auch der Einkaufsmanager-Index bleibt wohl weiter unter der 50-Prozent-Marke - und signalisiert damit eine Schrumpfung der Produktion.
Doch solche Sorgen werden die Fondsmanager von ihrem Silvesterrausch wohl vorerst nicht abbringen. Sie kaufen, obwohl gerade viele Tech-Aktien immer noch überteuert sind. Der Kater allerdings könnte sehr bald nach Silvester einsetzen - so wie letztes Mal. Nach den Terroranschlägen vom 11. September kam zunächst die große Befreiungsrallye. Im Januar dann begann der Absturz.
nicht Volkswirtschaft studiert zu haben -
hier die neueste Verschwörungstheorie
 :
:Wall-Street-Ausblick
Die Lemminge und der fahrende Zug
Von Carsten Volkery, New York
Die Rallye an der Wall Street geht in die achte Woche. Die meisten Beobachter glauben inzwischen, dass sie bis Silvester anhalten wird, weil Fondsmanager feige sind.
Sie mögen Herrscher über Milliarden sein. Doch Fondsmanager sind auch nur Menschen, die Angst um ihren Job haben. Diese Angst, sagen Börsianer, ist einer der Gründe, warum die Kurse an der Wall Street wahrscheinlich in den nächsten Wochen weiter steigen werden.
Vergangene Woche legte der Dow Jones nach einer zweiwöchigen Durststrecke mal wieder satte 2,6 Prozent zu. Der Nasdaq Composite gewann sogar vier Prozent.
Die Rallye wird nicht von Kleinanlegern getrieben (die sind weiterhin misstrauisch), sondern von den institutionellen Anlegern. Kurz vor Jahresende will kein Fondsmanager den fahrenden Zug verpassen. Die Herdenmentalität an der Wall Street erlaubt es den hochbezahlten Finanzjoungleuren, Geld zu verlieren, wenn alle Geld verlieren. Es gilt aber als Kündigungsgrund, wenn das eigene Portfolio hinter den Leit-Indizes zurückbleibt.
Da am Jahresende Bilanz gezogen wird, beeilen sich die Manager, ihre Fonds in der verbleibenden Zeit noch aufzupolieren. Am liebsten kaufen sie logischerweise Aktien mit hohem Wachstumspotenzial. Und was gibt es da Besseres als die Penny Stocks von der Nasdaq?
Seit dem Tief am 9. Oktober hat der Nasdaq Composite 32 Prozent zugelegt, der Internet-Sektor sogar 40 Prozent. Das erscheint kaum gerechtfertigt, schließlich werden die Wachstumserwartungen fürs kommende Jahr ständig reduziert, und auch die Unternehmensinvestitionen zeigen keine Zeichen der Besserung. Die Wende in der besonders hart getroffenen Tech-Branche ist erst für Ende 2003 angesagt.
Doch die Rallye nährt sich im Moment selbst. Durch ihre schlichte Langlebigkeit zwingt sie die Fondsmanager zum Kaufen. Diese Woche wird sich die Aufwärtsspirale wohl weiterdrehen - wenn auch mit einem deutlich reduzierten Personal. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving zu, am Freitag schließt sie bereits früher. Viele Börsianer werden ein langes Wochenende genießen.
Thanksgiving ist der offizielle Beginn der Vorweihnachtszeit und damit der Startschuss zum alljährlichen Shopping-Wahnsinn. Die Ökonomen sind gespannt auf die ersten Berichte aus den Malls. Sie erwarten eine mittelprächtige Saison - etwa drei Prozent mehr Umsatz als vergangenes Jahr.
Traditionell ist die Weihnachtssaison auch gut für Aktien. In 41 der vergangenen 50 Jahre sind die Kurse am Tag vor und nach Thanksgiving gestiegen. Der Dezember ist im historischen Durchschnitt der zweitbeste Aktienmonat.
Unterstützend hinzu kommt diese Woche ein ganzer Schwung von voraussichtlich annehmbaren Konjunkturdaten. Am Dienstagmorgen soll das Wirtschaftswachstum des dritten Quartals von 3,1 auf 3,7 Prozent nach oben revidiert werden. Das dürfte der Börse einen Schub geben - auch wenn die Prognose für das laufende Quartal weiterhin bei einem Prozent liegt.
Nicht zuletzt dank der Aktienrallye schauen die Amerikaner wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft, wie beide Indizes des Verbrauchervertrauens diese Woche wohl zeigen werden. Ihren neu gewonnenen Optimismus können sie in den nächsten Wochen an den Kaufhauskassen unter Beweis stellen.
Am Mittwoch werden zwei wichtige Indikatoren für das Verhalten von Unternehmen bekannt gegeben: die Auftragseingänge für langlebige Güter (Oktober) und der Chicago-Einkaufsmanager-Index. Ökonomen erwarten in beiden Fällen einen leichten Anstieg - und die Börse wird dementsprechend positiv reagieren.
Doch der Anstieg der beiden Indikatoren kann nicht über den Mangel an Unternehmensinvestitionen hinweg täuschen: Die Auftragseingänge-Zahl ist sehr volatil, und der Oktoberwert könnte sich am Ende als Ausreißer im bestehenden Abwärtstrend entpuppen. Im August und September waren die Auftragseingänge jeweils eingebrochen. Auch der Einkaufsmanager-Index bleibt wohl weiter unter der 50-Prozent-Marke - und signalisiert damit eine Schrumpfung der Produktion.
Doch solche Sorgen werden die Fondsmanager von ihrem Silvesterrausch wohl vorerst nicht abbringen. Sie kaufen, obwohl gerade viele Tech-Aktien immer noch überteuert sind. Der Kater allerdings könnte sehr bald nach Silvester einsetzen - so wie letztes Mal. Nach den Terroranschlägen vom 11. September kam zunächst die große Befreiungsrallye. Im Januar dann begann der Absturz.
@konradi
Wo soll denn hier die Verschwörung sein ? Der Artikel ist sehr gut, trifft den Kern der Sache. Das beschriebene Szenario wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit eintreten, so nicht unvorhergesehene Dinge geschehen.
Quelle ?
CU Jodie
Wer Gold hat, hat immer Geld.
Wo soll denn hier die Verschwörung sein ? Der Artikel ist sehr gut, trifft den Kern der Sache. Das beschriebene Szenario wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit eintreten, so nicht unvorhergesehene Dinge geschehen.
Quelle ?
CU Jodie
Wer Gold hat, hat immer Geld.
konradi:
Interessanter Thread.
Zu #82 :
Der Verlust des vernichteten Human-Kapitals, das in den
Köpfen der Juden lagerte, war letztendlich größer, als
die Einziehung der physischen Vermögenswerte für einen
spätestens mit Kriegseintritt der USA verlorenen Krieg.
Die Vernichtung/Vertreibung der Juden hat Deutschland
die Führung in den Naturwissenschaften, in den Geistes-
wissenschaften und im Venture-Capital gekostet,
von den menschlichen Verlusten und der bis heute reichenden
moralischen Auswirkungen ganz zu schweigen.
Auch hier müßte man sagen: Humankapital schlägt Gold -
unser Pech, daß die Nazis zu dumm waren, das zu begreiffen.
mfg
thefarmer
Interessanter Thread.
Zu #82 :
Der Verlust des vernichteten Human-Kapitals, das in den
Köpfen der Juden lagerte, war letztendlich größer, als
die Einziehung der physischen Vermögenswerte für einen
spätestens mit Kriegseintritt der USA verlorenen Krieg.
Die Vernichtung/Vertreibung der Juden hat Deutschland
die Führung in den Naturwissenschaften, in den Geistes-
wissenschaften und im Venture-Capital gekostet,
von den menschlichen Verlusten und der bis heute reichenden
moralischen Auswirkungen ganz zu schweigen.
Auch hier müßte man sagen: Humankapital schlägt Gold -
unser Pech, daß die Nazis zu dumm waren, das zu begreiffen.
mfg
thefarmer
SPIEGEL ONLINE - 26. November 2002
US-Wirtschaft brummt wieder
Trotz Krisengerede und der verbreiteten Angst vor einem Feldzug gegen den Irak arbeitet die US-Wirtschaft wieder auf vollen Touren. Das Wachstum im dritten Quartal überraschte die gesamte Expertenriege.
Die am Dienstag in Washington veröffentlichte Wachstumsrate lag mit vier Prozent sowohl über der ersten Schätzung des Handelsministeriums vor einem Monat in Höhe von 3,1 Prozent als auch über den Erwartungen von Analysten, die mit 3,8 Prozent gerechnet hatten. Im zweiten Quartal hatte die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) noch bei 1,3 Prozent gelegen.
Die kräftige Aufwärtsrevision der Wachstumsdaten begründete das Handelsministerium unter anderem mit einem unerwartet starken Lageraufbau und höher als zunächst angenommenen Staatsausgaben. Die Unternehmen füllten ihre Lager im dritten Quartal netto um Waren im Wert von 15,5 Milliarden Dollar auf, nach einem Zuwachs von lediglich 4,9 Milliarden Dollar im Vorquartal. Der Lageraufbau trug damit knapp einen halben Prozentpunkt zum Wirtschaftswachstum bei. Die Staatsausgaben legten um 3,1 Prozent zu nach einer ersten Schätzung von 1,8 Prozent und einem Plus von 1,4 Prozent in den drei Monaten zuvor.
Stärkster Wachstumsmotor jedoch waren erneut die Konsumausgaben, die um 4,1 Prozent zulegten nach einem Zuwachs von lediglich 1,8 Prozent im Vorquartal. Vor allem die Auto-Nachfrage zog stark an, was auf die zahlreichen Nullzins-Finanzierungsangebote der Autohersteller in den USA zurückzuführen war. "Das sind ziemlich starke Daten", sagte Todd Finkelstein von Boston Advisors.
Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich das Vertrauen der US-Verbraucher in die Wirtschaftsentwicklung ihres Landes im November überraschend deutlich verbessert hatte. Als Grund dafür wurde vor allem die Entspannung am Arbeits- und Aktienmarkt sowie die kräftige Leitzinssenkung der US-Notenbank eine Woche zuvor genannt. Der Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan war auf 85,0 von endgültig 80,6 Punkten im Oktober gestiegen. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 82,3 Punkte vorausgesagt.
Einige Marktteilnehmer warnten indes, der neuerliche Rückgang der Investitionsausgaben der US-Firmen um 0,7 Prozent verheiße nichts Gutes für die weitere Konjunkturentwicklung. Zudem hätten bereits im Oktober die Angebote der Autohersteller die Nachfrage nicht mehr so stark angekurbelt wie in den Vormonaten. Auch Finkelstein betonte: "Es gibt klare Anzeichen dafür, dass das laufende Quartal deutlich schwächer sein wird als das dritte."
Experten gehen davon aus, dass die US-Konjunktur erst bei einer spürbaren Erholung der Investitionsausgaben wieder an Fahrt gewinnen kann. Die Kurse der US-Staatsanleihen zogen nach den Daten etwas an, die US-Börsen eröffneten im Minus. Der Euro reagierte kaum und pendelte weiter knapp über 0,99 Dollar.
US-Wirtschaft brummt wieder
Trotz Krisengerede und der verbreiteten Angst vor einem Feldzug gegen den Irak arbeitet die US-Wirtschaft wieder auf vollen Touren. Das Wachstum im dritten Quartal überraschte die gesamte Expertenriege.
Die am Dienstag in Washington veröffentlichte Wachstumsrate lag mit vier Prozent sowohl über der ersten Schätzung des Handelsministeriums vor einem Monat in Höhe von 3,1 Prozent als auch über den Erwartungen von Analysten, die mit 3,8 Prozent gerechnet hatten. Im zweiten Quartal hatte die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) noch bei 1,3 Prozent gelegen.
Die kräftige Aufwärtsrevision der Wachstumsdaten begründete das Handelsministerium unter anderem mit einem unerwartet starken Lageraufbau und höher als zunächst angenommenen Staatsausgaben. Die Unternehmen füllten ihre Lager im dritten Quartal netto um Waren im Wert von 15,5 Milliarden Dollar auf, nach einem Zuwachs von lediglich 4,9 Milliarden Dollar im Vorquartal. Der Lageraufbau trug damit knapp einen halben Prozentpunkt zum Wirtschaftswachstum bei. Die Staatsausgaben legten um 3,1 Prozent zu nach einer ersten Schätzung von 1,8 Prozent und einem Plus von 1,4 Prozent in den drei Monaten zuvor.
Stärkster Wachstumsmotor jedoch waren erneut die Konsumausgaben, die um 4,1 Prozent zulegten nach einem Zuwachs von lediglich 1,8 Prozent im Vorquartal. Vor allem die Auto-Nachfrage zog stark an, was auf die zahlreichen Nullzins-Finanzierungsangebote der Autohersteller in den USA zurückzuführen war. "Das sind ziemlich starke Daten", sagte Todd Finkelstein von Boston Advisors.
Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich das Vertrauen der US-Verbraucher in die Wirtschaftsentwicklung ihres Landes im November überraschend deutlich verbessert hatte. Als Grund dafür wurde vor allem die Entspannung am Arbeits- und Aktienmarkt sowie die kräftige Leitzinssenkung der US-Notenbank eine Woche zuvor genannt. Der Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan war auf 85,0 von endgültig 80,6 Punkten im Oktober gestiegen. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 82,3 Punkte vorausgesagt.
Einige Marktteilnehmer warnten indes, der neuerliche Rückgang der Investitionsausgaben der US-Firmen um 0,7 Prozent verheiße nichts Gutes für die weitere Konjunkturentwicklung. Zudem hätten bereits im Oktober die Angebote der Autohersteller die Nachfrage nicht mehr so stark angekurbelt wie in den Vormonaten. Auch Finkelstein betonte: "Es gibt klare Anzeichen dafür, dass das laufende Quartal deutlich schwächer sein wird als das dritte."
Experten gehen davon aus, dass die US-Konjunktur erst bei einer spürbaren Erholung der Investitionsausgaben wieder an Fahrt gewinnen kann. Die Kurse der US-Staatsanleihen zogen nach den Daten etwas an, die US-Börsen eröffneten im Minus. Der Euro reagierte kaum und pendelte weiter knapp über 0,99 Dollar.
Süddeutsche Zeitung 26.11.2002
Geschäftsklima-Index
Ifo: Wirtschaft hat das Schlimmste überstanden
Zwar sind die Unternehmen so pessimistisch wie noch nie in diesem Jahr, dennoch sieht das Ifo-Institut auch Licht am Ende des Tunnels.
Nach einem weiteren Stimmungstief im November hat die deutsche Wirtschaft laut Ifo-Institut das Schlimmste überstanden. Im Westen sei eine Stabilisierung der Konjunktur zu erkennen, sagte Ifo-Chef Hans-Werner Sinn.
Sorgen bereite aber weiterhin der wachsende Pessimismus der Unternehmen für die kommenden Monate. Der Geschäftsklimaindex für Westdeutschland gab von 87,7 auf 87,3 nach. Dies ist der zweitschlechteste Wert in diesem Jahr. Experten hatten jedoch einen stärkeren Rückgang erwartet.
Wie Ifo-Chef Sinn erläuterte, kamen im November ungünstigere Meldungen aus der Baubranche, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Großhandel. Im Einzelhandel habe sich die Stimmung dagegen deutlich gebessert.
Das insgesamt trübere Klima in der Wirtschaft ist laut Sinn ausschließlich auf den Pessimismus für die kommenden sechs Monate zurückzuführen. Der Index der Geschäftserwartungen stürzte um 2,1 Punkte auf 95,8 Punkte ab. Damit schätzten die Unternehmen ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate so düster ein wie noch nie in diesem Jahr.
„Ein gutes Zeichen“
Für Lichtblicke sorgte nach Sinns Angaben die Bewertung der aktuellen Lage. Die befragten Firmen schätzten ihre momentane Situation zum dritten Mal in Folge besser ein als im Vormonat. Der Index der Geschäftslage kletterte von 77,9 auf 79,1 Punkte. Die Verbesserung sei noch deutlicher ausgefallen als erwartet, sagte der Instituts-Chef. „Das ist ein gutes Zeichen.“ Besonders im verarbeitenden Gewerbe habe sich die Lage aufgehellt.
Sinn sagte weiter, die Verbesserung beim Lage-Index zeige, dass die deutsche Wirtschaft in einem besseren Zustand sei als viele annähmen. Es zeichne sich aber noch keine Erholung bei den Investitionen ab. Der Ifo-Chef bemängelte, die rot-grüne Bundesregierung habe mit den geplanten Steuererhöhungen zu den falschen Maßnahmen gegriffen. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kritisierte Sinn erneut als zu restriktiv.
Schlechtere Stimmung im Osten
In den neuen Bundesländern trübte sich die Stimmung stärker ein als im Westen. „Anzeichen für einen Aufschwung gibt es noch immer nicht“, sagte Sinn. Der Geschäftsklimaindex sackte um 2,8 auf 97,8 Punkte. Die Stimmung ist damit auf einem neuen Tiefpunkt.
Im Gegensatz zu den alten Ländern sank im Osten auch der Index der Geschäftslage — von 115,2 auf 112,7 Punkte. Zudem zeigten sich die ostdeutschen Unternehmen im November so pessimistisch wie nie in diesem Jahr: Der Index der Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr schrumpfte um drei Punkte auf 78,4 Punkte.
Geschäftsklima-Index
Ifo: Wirtschaft hat das Schlimmste überstanden
Zwar sind die Unternehmen so pessimistisch wie noch nie in diesem Jahr, dennoch sieht das Ifo-Institut auch Licht am Ende des Tunnels.
Nach einem weiteren Stimmungstief im November hat die deutsche Wirtschaft laut Ifo-Institut das Schlimmste überstanden. Im Westen sei eine Stabilisierung der Konjunktur zu erkennen, sagte Ifo-Chef Hans-Werner Sinn.
Sorgen bereite aber weiterhin der wachsende Pessimismus der Unternehmen für die kommenden Monate. Der Geschäftsklimaindex für Westdeutschland gab von 87,7 auf 87,3 nach. Dies ist der zweitschlechteste Wert in diesem Jahr. Experten hatten jedoch einen stärkeren Rückgang erwartet.
Wie Ifo-Chef Sinn erläuterte, kamen im November ungünstigere Meldungen aus der Baubranche, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Großhandel. Im Einzelhandel habe sich die Stimmung dagegen deutlich gebessert.
Das insgesamt trübere Klima in der Wirtschaft ist laut Sinn ausschließlich auf den Pessimismus für die kommenden sechs Monate zurückzuführen. Der Index der Geschäftserwartungen stürzte um 2,1 Punkte auf 95,8 Punkte ab. Damit schätzten die Unternehmen ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate so düster ein wie noch nie in diesem Jahr.
„Ein gutes Zeichen“
Für Lichtblicke sorgte nach Sinns Angaben die Bewertung der aktuellen Lage. Die befragten Firmen schätzten ihre momentane Situation zum dritten Mal in Folge besser ein als im Vormonat. Der Index der Geschäftslage kletterte von 77,9 auf 79,1 Punkte. Die Verbesserung sei noch deutlicher ausgefallen als erwartet, sagte der Instituts-Chef. „Das ist ein gutes Zeichen.“ Besonders im verarbeitenden Gewerbe habe sich die Lage aufgehellt.
Sinn sagte weiter, die Verbesserung beim Lage-Index zeige, dass die deutsche Wirtschaft in einem besseren Zustand sei als viele annähmen. Es zeichne sich aber noch keine Erholung bei den Investitionen ab. Der Ifo-Chef bemängelte, die rot-grüne Bundesregierung habe mit den geplanten Steuererhöhungen zu den falschen Maßnahmen gegriffen. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank kritisierte Sinn erneut als zu restriktiv.
Schlechtere Stimmung im Osten
In den neuen Bundesländern trübte sich die Stimmung stärker ein als im Westen. „Anzeichen für einen Aufschwung gibt es noch immer nicht“, sagte Sinn. Der Geschäftsklimaindex sackte um 2,8 auf 97,8 Punkte. Die Stimmung ist damit auf einem neuen Tiefpunkt.
Im Gegensatz zu den alten Ländern sank im Osten auch der Index der Geschäftslage — von 115,2 auf 112,7 Punkte. Zudem zeigten sich die ostdeutschen Unternehmen im November so pessimistisch wie nie in diesem Jahr: Der Index der Geschäftserwartungen für das kommende halbe Jahr schrumpfte um drei Punkte auf 78,4 Punkte.
Lars Halter / Handelsblatt 26.11.2002
Danke für alles was wir haben...
Dafür danken, dass sich Millionen von Anlegern von gierigen CEOs, blinden Kontrolleuren und falschen Analysten an der Nase herumführen lassen und ein Vermögen verloren haben? Sicher nicht – aber drehen wir den Spieß einmal um.
Seit sieben Wochen klettern die US-Märkte eifrig, auf dem New Yorker Parkett hat die Stimmung gedreht. Zahlen gefällig? Der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 haben seit den Tiefständen von Anfang Oktober um fast 20 % zugelegt, die gebeutelte Hightech-Börse Nasdaq hat sich um 31 % verbessert. Und auch der Blick über den zeitlichen Tellerrand sieht nicht allzu schlecht aus: Der Dow hat sich in den vergangenen drei Jahren um 2,7 % verbessert, auf Sicht von fünf Jahren um 11 % und seit 1992 sogar um 14,6 %. Damit fällt die langfristige Bilanz deutlich besser aus als die anderer Märkte. Japan schließt seit zwölf Jahren mit roten Zahlen, und der Dax liegt 20 % unter dem Stand von vor 5 Jahren.
Auch andere Statistiken zeigen den Amerikanern zum Fest, dass man doch noch wer ist. Das gemeinsame Einkommen von Jane und John Doe, wie das Ehepaar Normalverbraucher in Amerika heißt, beträgt mehr als 40 000 $ im Jahr – das ist nach Informationen der Weltbank viermal soviel wie im globalen Durchschnitt.
Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 74 Jahren tanzt der Amerikaner 15 Jahre länger auf dem Gesicht der Erde als der durchschnittliche Weltenbürger. Das Wirtschaftsinstitut World Markets Research Center will herausgefunden haben, dass die USA in der Liste der lebenswerten Länder auf Rang 17 steht, und die Experten vom Börsendienst CBS Marketwatch wissen sogar: „Wir haben die beste Gesundheitsvorsorge, die besten Krankenhäuser und unser Bildungswesen ist das beste der Welt.“
Hört, hört! Und Amerikaner sind glücklicher und lächeln mehr als der Rest der Welt, sie sind größer und schöner, schlafen besser, tanzen besser Tango, haben buntere Farben, strammere Waden, schnellere Autos, sind der Nabel der Welt, das Zentrum aller Kultur, Herz und Mutter der Menschheit und sie Seele des Universums... vielleicht könnten die selbstverliebten Kritiker an dieser Stelle mal einen Gang zurückschalten.
Sicher, die USA sind die dominierende Weltmacht. Doch sollte die politische und wirtschaftliche Bedeutung auch vor dem Freudenfest Thanksgiving nicht den Blick für die Wahrheit verstellen, die nicht unbedingt und in jedem Detail der Bilderbuchwelt der CBS-Experten entspricht. „Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Amerika, um unsere Universitäten zu besuchen“, schreibt einer. Das ist richtig, hat aber nichts mit einem guten Bildungswesen per se zu tun. Die USA unterstützt eine Elite. Die Absolventen von Harvard, Yale und MIT gehören zu den smartesten Köpfen der Welt. Doch kommen auf jeden Studenten der noblen Ivy League Tausende von Kids, denen für eine angemessene Ausbildung das Geld fehlt.
Weiter sehen die CBS-Schreiber die Amerikaner an der Spitze der Altruismus-Charts. „In Sachen Wohlfahrt sind wir ganz vorne dabei“, lobt man. Tatsächlich spendet nach einem Bericht der Washingtoner Forschungsgruppe Independent Sector fast jeder zweite Amerikaner Zeit oder Geld an wohltätige Organisationen, doch sollte man sich nicht allzu schnell den Heiligenschein aufsetzen. Wer als Papa das Baseball-Team des Nachwuchses coacht oder als Mutti Nachhilfestunden gibt, tut zwar etwas Gutes. Doch macht man vor allem international nicht wett, was man anderen Ländern nimmt. In der Dritten Welt sind die USA an wirtschaftlich lukrativen Projekten mehr interessiert als am Aufbau von Schulen und Krankenhäusern.
Und in Sachen Umweltschutz, einem Thema das mehr und mehr zur zentralen Frage einer sozialen und zukunftsorientierten Politik wird, sind die USA gemessen an ihrer Größe und monetären Macht nicht mehr als ein Entwicklungsland. In New York hat man vor einem halben Jahr das Recycling von Glas und Dosen per Gesetz gestoppt, dem Daimler-Chrysler-Chef Dieter Zetsche weht ein rauer Wind ins Gesicht, wenn er beim Innovationsforum nur das Wort „Diesel“ ausspricht. Dem Amerikaner gefällt sein SUV, es darf auch gern ein „Hummer“ sein mit 120-Liter-Tank und einem Verbrauch von 24 Litern auf 100 Kilometer.
Thanksgiving? – Klar, danke für alles was wir haben und vor allem dafür, dass wir uns nicht mit einem ökologischen oder sozialen Gewissen rumschlagen müssen. Allen Ernstes mahnt der CBS-Schreiber kurz vor dem Fest, dass es in den nächsten Jahrzehnten mit Blick auf die weitere Bevölkerungsexplosion vor allem auf das Vertrauen der Völker untereinander ankomme, und dass auch damit die Amerikaner gesegnet seien. „Völkerübergreifendes Vertrauen hat Amerikaner und Indianer im 17. Jahrhundert an einen Tisch gebracht“, schreibt er. Wie weit die Indianer von den Verhandlungen mit den Besatzern profitiert haben ist bekannt.
Dennoch sieht man auch in Zukunft Handlungsbedarf. „Wir müssen mehr tun als Brot brechen“, so CBS. Bis zum Jahre 2050 rechnet die Weltbank mit einem Bruttosozialprodukt von weltweit 140 Bill. Dollar – das ist fünfmal mehr als heute. Die USA will ihren Anteil halten und man hat den Trend erkannt. „Grundbedürfnisse erkennen“, will der CBS-Autor, zum Beispiel den gigantischen Energiebedarf, den bis zu 10 Milliarden Menschen haben werden. Wie will man den decken? Die USA blockiert seit Jahren umweltfreundliche Technologien, stattdessen will man in Naturschutzgebieten in Alaska nach Öl bohren. „Danke“, sagt Präsident Bush wohl am Feiertag. „Danke, dass wir zunächst einmal genügend Öl haben.“
Es wäre schön, wenn „Thanks“ auch nur ein kleines bisschen mit „think“ zu tun hätte, und wenn mancher über dem Truthahn zum Nachdenken käme. Wenn sich CBS-Kommentatoren, Politiker und andere Lenker in den USA ernsthaft und langfristig mit globalen Problemen und Strategien auseinandersetzen würden, anstatt sich am Donnerstag für den Status Quo zu bedanken. Aber das ist natürlich viel einfacher. Happy Thanksgiving.
Danke für alles was wir haben...
Dafür danken, dass sich Millionen von Anlegern von gierigen CEOs, blinden Kontrolleuren und falschen Analysten an der Nase herumführen lassen und ein Vermögen verloren haben? Sicher nicht – aber drehen wir den Spieß einmal um.
Seit sieben Wochen klettern die US-Märkte eifrig, auf dem New Yorker Parkett hat die Stimmung gedreht. Zahlen gefällig? Der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 haben seit den Tiefständen von Anfang Oktober um fast 20 % zugelegt, die gebeutelte Hightech-Börse Nasdaq hat sich um 31 % verbessert. Und auch der Blick über den zeitlichen Tellerrand sieht nicht allzu schlecht aus: Der Dow hat sich in den vergangenen drei Jahren um 2,7 % verbessert, auf Sicht von fünf Jahren um 11 % und seit 1992 sogar um 14,6 %. Damit fällt die langfristige Bilanz deutlich besser aus als die anderer Märkte. Japan schließt seit zwölf Jahren mit roten Zahlen, und der Dax liegt 20 % unter dem Stand von vor 5 Jahren.
Auch andere Statistiken zeigen den Amerikanern zum Fest, dass man doch noch wer ist. Das gemeinsame Einkommen von Jane und John Doe, wie das Ehepaar Normalverbraucher in Amerika heißt, beträgt mehr als 40 000 $ im Jahr – das ist nach Informationen der Weltbank viermal soviel wie im globalen Durchschnitt.
Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 74 Jahren tanzt der Amerikaner 15 Jahre länger auf dem Gesicht der Erde als der durchschnittliche Weltenbürger. Das Wirtschaftsinstitut World Markets Research Center will herausgefunden haben, dass die USA in der Liste der lebenswerten Länder auf Rang 17 steht, und die Experten vom Börsendienst CBS Marketwatch wissen sogar: „Wir haben die beste Gesundheitsvorsorge, die besten Krankenhäuser und unser Bildungswesen ist das beste der Welt.“
Hört, hört! Und Amerikaner sind glücklicher und lächeln mehr als der Rest der Welt, sie sind größer und schöner, schlafen besser, tanzen besser Tango, haben buntere Farben, strammere Waden, schnellere Autos, sind der Nabel der Welt, das Zentrum aller Kultur, Herz und Mutter der Menschheit und sie Seele des Universums... vielleicht könnten die selbstverliebten Kritiker an dieser Stelle mal einen Gang zurückschalten.
Sicher, die USA sind die dominierende Weltmacht. Doch sollte die politische und wirtschaftliche Bedeutung auch vor dem Freudenfest Thanksgiving nicht den Blick für die Wahrheit verstellen, die nicht unbedingt und in jedem Detail der Bilderbuchwelt der CBS-Experten entspricht. „Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Amerika, um unsere Universitäten zu besuchen“, schreibt einer. Das ist richtig, hat aber nichts mit einem guten Bildungswesen per se zu tun. Die USA unterstützt eine Elite. Die Absolventen von Harvard, Yale und MIT gehören zu den smartesten Köpfen der Welt. Doch kommen auf jeden Studenten der noblen Ivy League Tausende von Kids, denen für eine angemessene Ausbildung das Geld fehlt.
Weiter sehen die CBS-Schreiber die Amerikaner an der Spitze der Altruismus-Charts. „In Sachen Wohlfahrt sind wir ganz vorne dabei“, lobt man. Tatsächlich spendet nach einem Bericht der Washingtoner Forschungsgruppe Independent Sector fast jeder zweite Amerikaner Zeit oder Geld an wohltätige Organisationen, doch sollte man sich nicht allzu schnell den Heiligenschein aufsetzen. Wer als Papa das Baseball-Team des Nachwuchses coacht oder als Mutti Nachhilfestunden gibt, tut zwar etwas Gutes. Doch macht man vor allem international nicht wett, was man anderen Ländern nimmt. In der Dritten Welt sind die USA an wirtschaftlich lukrativen Projekten mehr interessiert als am Aufbau von Schulen und Krankenhäusern.
Und in Sachen Umweltschutz, einem Thema das mehr und mehr zur zentralen Frage einer sozialen und zukunftsorientierten Politik wird, sind die USA gemessen an ihrer Größe und monetären Macht nicht mehr als ein Entwicklungsland. In New York hat man vor einem halben Jahr das Recycling von Glas und Dosen per Gesetz gestoppt, dem Daimler-Chrysler-Chef Dieter Zetsche weht ein rauer Wind ins Gesicht, wenn er beim Innovationsforum nur das Wort „Diesel“ ausspricht. Dem Amerikaner gefällt sein SUV, es darf auch gern ein „Hummer“ sein mit 120-Liter-Tank und einem Verbrauch von 24 Litern auf 100 Kilometer.
Thanksgiving? – Klar, danke für alles was wir haben und vor allem dafür, dass wir uns nicht mit einem ökologischen oder sozialen Gewissen rumschlagen müssen. Allen Ernstes mahnt der CBS-Schreiber kurz vor dem Fest, dass es in den nächsten Jahrzehnten mit Blick auf die weitere Bevölkerungsexplosion vor allem auf das Vertrauen der Völker untereinander ankomme, und dass auch damit die Amerikaner gesegnet seien. „Völkerübergreifendes Vertrauen hat Amerikaner und Indianer im 17. Jahrhundert an einen Tisch gebracht“, schreibt er. Wie weit die Indianer von den Verhandlungen mit den Besatzern profitiert haben ist bekannt.
Dennoch sieht man auch in Zukunft Handlungsbedarf. „Wir müssen mehr tun als Brot brechen“, so CBS. Bis zum Jahre 2050 rechnet die Weltbank mit einem Bruttosozialprodukt von weltweit 140 Bill. Dollar – das ist fünfmal mehr als heute. Die USA will ihren Anteil halten und man hat den Trend erkannt. „Grundbedürfnisse erkennen“, will der CBS-Autor, zum Beispiel den gigantischen Energiebedarf, den bis zu 10 Milliarden Menschen haben werden. Wie will man den decken? Die USA blockiert seit Jahren umweltfreundliche Technologien, stattdessen will man in Naturschutzgebieten in Alaska nach Öl bohren. „Danke“, sagt Präsident Bush wohl am Feiertag. „Danke, dass wir zunächst einmal genügend Öl haben.“
Es wäre schön, wenn „Thanks“ auch nur ein kleines bisschen mit „think“ zu tun hätte, und wenn mancher über dem Truthahn zum Nachdenken käme. Wenn sich CBS-Kommentatoren, Politiker und andere Lenker in den USA ernsthaft und langfristig mit globalen Problemen und Strategien auseinandersetzen würden, anstatt sich am Donnerstag für den Status Quo zu bedanken. Aber das ist natürlich viel einfacher. Happy Thanksgiving.
bevor wir nun bei aller DJ-Euphorie nun die Orientierung verlieren
sollten wir uns vielleicht doch besser an Peter Wedemeier´s "Mahnung" halten :

sollten wir uns vielleicht doch besser an Peter Wedemeier´s "Mahnung" halten :

#101,#102,#103
Das übliche Bullengeschwafel der Mainstreamjournallie, auch die werden es vielleicht irgendwann einmal kapieren.
Dax: -3,26%
Dow: - 1,95%
Nase comp: -2,53%
Meine gestern erworbenen 721821 entwickeln sich prächtig.
CU Jodie
Das übliche Bullengeschwafel der Mainstreamjournallie, auch die werden es vielleicht irgendwann einmal kapieren.
Dax: -3,26%
Dow: - 1,95%
Nase comp: -2,53%
Meine gestern erworbenen 721821 entwickeln sich prächtig.
CU Jodie

das könnte den Bullen evtl auf die Beine verhelfen
Hilversum. (dpa) Niederländische Polizisten haben eine manipulierte Parkscheibe sichergestellt, deren Anzeiger jede halbe Stunde automatisch weitersprang. Wie sich herausstellte, hatte eine 54jährige Autofahrerin aus Laren bei Hilveresumein batteriebetriebenes Uhrwerk eingebaut. Die Scheibe fiel zwei Polizisten auf, weil sie auffällig dick war. `Als die beiden nach einer halben Stunde noch einmal vorbeischauten, zeigte der Zeiger eine andere Zeit an`, berichtete am Montag ein Polizeisprecher in Hilversum. Die Polizisten warteten daraufhin die Rückkehr der Wagenbesitzerin ab und stellten sie zur Rede. Die Frau gab alles zu und sagte, daß sie in einem Geschäft auf der anderen Straßenseite arbeitete und nicht alle zwei Stunden zu ihrem Auto gehen wollte, um die Parkscheibe von Hand umzustellen. Sie bekam einen Strafzettel über 80 Gulden (70 Mark).
Ist Hilversum noch nicht Mitglied des Euro-Raums?
mfg
thefarmer
mfg
thefarmer
Colin Powell – der wahre Held ... ? 
Die WELT 27.11.2002
Bob Woodward :
Kampf ums Herz des Präsidenten
Was passierte wirklich im Weißen Haus, als über das Vorgehen gegen den Irak entschieden wurde? Eine Geschichte von Machtkämpfen, Pannen und vier Menschen
Anfang August 2001 unternahm Außenminister Colin Powell eine diplomatische Reise ins Ausland. Wie immer, ließ er sich über das, was zu Hause passierte, genauestens informieren. Zu dieser Zeit gärte das Thema Irak. Brent Scowcroft, der frühere nationale Sicherheitsberater von George Bush senior, hatte in einer Talkshow gesagt, ein Angriff auf den Irak könne den Nahen Osten in einen „Hexenkessel verwandeln und damit den Krieg gegen den Terror zunichte machen“.
Deutliche Worte, aber im Wesentlichen war Powell der gleichen Meinung. Er hatte dem Präsidenten seine Lagebeurteilung bisher vorenthalten. Jetzt sah er ein, dass es an der Zeit war, offen mit George W. Bush zu reden. Praktisch alle Irak-Diskussionen im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) drehten sich um Kriegspläne: Wie greifen wir an? Wann greifen wir an? Mit welcher Truppenstärke? Powell befürchtete, dass man dabei war, die großen Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren. Der Präsident hatte immer begierig zugehört, wenn Vizepräsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sprachen. Die beiden bildeten eine Art Team innerhalb des Kriegskabinetts. Powell wollte der alternativen Sicht der Dinge Gehör verschaffen. Es gab aber ein Problem: Nach außen musste es so aussehen, als gebe es im Kriegskabinett keine Meinungsverschiedenheiten. Bush würde einen öffentlichen Dissens nicht dulden.
Außerdem wurde Powell, der frühere General, von seinem Verhaltenskodex zurückgehalten: Ein Soldat gehorcht. Aber Bush könnte befehlen: Holt die Waffen! Auf die Pferde! Diese Art von Texas-Machotum empfand Powell als unangenehm. Allerdings glaubte er, dass sich der Präsident von Argumenten überzeugen ließe. Am Ende, so hoffte er, würde Bush einsehen, dass ein Alleingang keiner tieferen Analyse standhielt. In Powells Augen waren Rumsfeld und Cheney die Strippenzieher. Sie riefen zu oft: Holt die Waffen – auf die Pferde!
Am Abend des 5. August lud Bush Powell und seine Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice ins Weiße Haus ein, um über den Irak zu sprechen. Powell verlangte, über die Folgen des Krieges nachzudenken: Die ganze Region könne destabilisiert werden – und US-freundliche Regierungen in Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien geschwächt oder gestürzt. Es würde allem, was die USA sonst tun und planen, den Boden entziehen. Das gelte nicht nur für den Anti-Terror-Krieg, sondern für sämtliche diplomatischen, militärischen und nachrichtendienstlichen Bemühungen, sagte Powell. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten verheerend sein, möglicherweise würde der Ölpreis in unvorstellbare Höhen katapultiert.
Auch bei einem Sieg – und Powell war sicher, dass die USA siegen würden – wären die Auswirkungen immens. „Kann man sich vorstellen, dass ein arabisches Land für längere Zeit von einem US-General regiert wird? Ein McArthur in Bagdad?“, fragte er. „Es ist eine tolle Sache zu sagen, wir können es im Alleingang machen“, sagte Powell dem Präsidenten geradeheraus, „es sei denn, man kann es nicht.“
Saddam Hussein sei verrückt, unberechenbar, eine echte Gefahr, aber die Politik der Abschreckung und Eindämmung habe seit dem Golfkrieg im Großen und Ganzen funktioniert. Ein neuer Krieg aber könne genau das zur Folge haben, was man verhindern wolle: einen irakischen Diktator, der, in die Enge getrieben, seine Massenvernichtungswaffen einsetzt.
Der Präsident schien fasziniert zu lauschen. Ab und zu stellte er Fragen, hütete sich aber, Argumente allzu entschieden zurückzuweisen. Powell wusste, dass Bush Lösungsvorschläge schätzt, ja darauf besteht. „Sie können immer noch auf eine Koalition oder auf ein Aktivwerden der Vereinten Nationen setzen“, sagte er also. Jedenfalls müsse internationale Unterstützung eingeholt werden. Ein Krieg im Irak könne sich als viel komplizierter und blutiger erweisen als der in Afghanistan – und der sei ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit einer Koalition. Am Ende hatte der Außenminister das Gefühl, nichts ungesagt gelassen zu haben. Bush bedankte sich. Das Gespräch hatte zwei Stunden gedauert – nicht die Dimensionen von Bill Clintons spätabendlichen Schlafzimmerdebatten, aber für den Präsidenten und Powell außergewöhnlich lange.
Am Mittwoch, dem 14. August, trafen sich Cheney, Rumsfeld, Powell, Rice und CIA-Chef George Tenet ohne den Präsidenten in Washington. Powell sagte, dass Bush am 12. September Gelegenheit haben werde, das Irak-Problem vor der UN-Vollversammlung anzusprechen. Am Ende stimmten alle überein: Eine Rede zum Irak wäre sinnvoll. Keine Einigkeit herrschte darüber, was genau der Präsident sagen sollte. Zwei Tage später traf sich der Nationale Sicherheitsrat. Bush nahm qua Videoschaltung teil. Für Powell bestand das einzige Ziel dieses Treffens darin, seine Ideen von einer Rede durchzusetzen: Der Präsident solle die UNO oder eine Koalition von Ländern um Unterstützung bitten. Bush fragte jeden der Reihe nach nach seiner Meinung. Es gab einen breiten Rückhalt für den Ansatz, es mit der UNO zu versuchen – sogar von Cheney und Rumsfeld. „Prima!“, sagte der Präsident schließlich, und Powell verließ das Treffen mit dem Gefühl, alles geregelt zu haben. Dann fuhr er in den Urlaub.
Als er in seinem Ferienhaus auf Long Island am 27. August die Zeitung aufschlug, traute er seinen Augen kaum. „Cheney: Risiko eines atomar bewaffneten Irak rechtfertigt Angriff“, stand da. Am Vortag hatte der Vizepräsident in einer Rede erklärt, dass Waffeninspektionen im Grunde zwecklos seien. „Eine Rückkehr der Inspekteure würde keine Garantie bieten, dass der Irak die UN-Resolutionen befolgt“, so Cheney, „im Gegenteil: es bedeutet eine ernste Gefahr, denn es würde viele in der trügerischen Sicherheit wiegen, dass der böse Geist Saddam wieder in der Flasche‘ ist.“ Die Risiken, untätig zu sein, seien weit größer, als das Risiko zu handeln. Cheneys Rede wurde weithin als Haltung der Administration verstanden. Ihr Tonfall war rau und unversöhnlich. Ähnlich äußerte sich Rumsfeld. Beide schlossen ein unilaterales Vorgehen ausdrücklich nicht aus.
Auf Powell wirkte dies wie ein Präventivschlag gegen das, was seiner Meinung nach zehn Tage zuvor vereinbart worden war – nämlich den Vereinten Nationen eine Chance zu geben. Etwa zur gleichen Zeit begannen Geschichten zu kursieren: Powell habe sich gegen Cheney gestellt. Einige Kommentatoren warfen Powell Illoyalität vor. Er zählte sieben Leitartikel, in denen seine Entlassung gefordert oder ihm der Rücktritt nahe gelegt wurde. „Wie kann ich illoyal sein, wenn ich die Position des Präsidenten vertrete?“, wunderte er sich.
Am 6. September war Powell aus dem Urlaub zurück und traf sich in Camp David mit den anderen Mitgliedern des NSC. Cheney behauptete nun, das Streben nach einer neuen Resolution würde sie wieder in das bekannte Gewirr der UN-Verfahren verstricken – ein unentschlossenes, nicht enden wollendes Durcheinander. „Der Präsident braucht doch nur eins zu tun: Sagen, dass Saddam böse ist, dass er frühere UN-Resolutionen ignoriert, willentlich verletzt und verhöhnt hat und dass sich die Vereinigten Staaten das Recht vorbehalten, unilateral zu handeln“, polterte er. „Aber so bittet man die UNO doch nicht um Unterstützung“, erwiderte Powell. Die Vereinten Nationen würden nicht gerade darauf brennen, Saddam für böse zu erklären und die USA zu einem Militärschlag zu ermächtigen. Cheneys Idee ließe sich nicht verkaufen, sagte Powell. Zudem habe sich der Präsident bereits dafür entschieden, der UNO eine Chance zu geben. Und der einzige Weg hierfür sei, sie um eine Resolution zu bitten.
Powell versuchte, den anderen die Konsequenzen eines Alleingangs vor Augen zu führen. Wenn sie unilateral handelten, müsse er zum Beispiel überall auf der Welt amerikanische Botschaften schließen. „Das ist nicht das Problem“, erwiderte Cheney. Saddam und seine himmelschreiende Bedrohung seien das Problem. „Vielleicht läuft es nicht so, wie Sie es sich vorstellen“, entgegnete Powell. Ein Krieg könne alle möglichen unerwarteten und unbeabsichtigten Folgen nach sich ziehen. „Das ist nicht das Problem“, sagte Cheney erneut. Die Debatte wuchs sich zu einem harten Schlagabtausch aus.
Am nächsten Tag kamen die wichtigsten Mitglieder des NSC mit dem Präsidenten zusammen. Bush schien inzwischen gewillt, die Vereinten Nationen um eine Resolution zu ersuchen. Doch Cheney und Rumsfeld übten weiter Druck aus. Schließlich kamen sie überein, dass Bush die Vereinten Nationen ersuchen sollte zu „handeln“. Powell akzeptierte, denn die einzige Weise, in der die Vereinten Nationen handeln konnten, war durch Resolutionen.
Am Abend vor der Rede sprach Bush noch einmal mit Powell und Rice. Der Präsident hatte sich endgültig entschieden, die UNO um neue Resolutionen zu ersuchen. Zunächst wollte er Powell und Rice autorisieren, nach der Rede zu erklären, dass die Vereinigten Staaten hierfür mit der UNO zusammenarbeiten würden. Doch dann beschloss er, dass er es auch selbst sagen könne. Ihm gefiel die Vorstellung, dass die Schlagzeile ein Zitat aus seiner Rede sein würde. Also ordnete er an, einen Satz einzufügen. Darin sollte zum Ausdruck kommen, dass Washington mit dem UN-Sicherheitsrat bei den notwendigen „Resolutionen“ zusammenarbeiten werde.
Doch als Bush am nächsten Tag vor der UN-Vollversammlung die Stelle seiner Rede erreicht hatte, an der er sich für Resolutionen aussprechen sollte, erschien der Satz nicht auf dem Teleprompter. Auf dem Manuskript war die Änderung vergessen worden. Folglich las Bush die alte Zeile: „Mein Land wird mit dem UN-Sicherheitsrat zusammenarbeiten, um uns der gemeinsamen Herausforderung zu stellen.“ Powell, der die Rede auf seiner Kopie gegenlas, um Stegreif-Bemerkungen des Präsidenten zu notieren, blieb fast das Herz stehen. Der Satz über die Resolutionen war nicht da! Bush hatte ihn nicht gesagt. Es war die Pointe. Aber Bush hatte bemerkt, dass der Teil fehlte. Ein wenig unbeholfen improvisierte er: „Wir werden mit dem UN-Sicherheitsrat bei den notwendigen Resolutionen zusammenarbeiten. Powell atmete tief durch.
Die Rede galt allgemein als Durchbruch. Einen Tag später kündigte der Irak an, dass er neue Waffeninspekteure billigen werde. Von da an wurde die öffentliche Rhetorik des Präsidenten maßvoller. Statt von einem Regimewechsel zu sprechen, sagte er nun: „Meine Politik besteht darin, den Irak dazu zu bringen, seine Waffenvernichtungswaffen aufzugeben.“ Nicht eine Militäraktion sei oberstes Ziel, „sondern diesen Mann [Saddam] zu entwaffnen.“ Dies alles war ein Sieg für Powell, aber vielleicht nur ein momentaner. Bushs zurückgenommene Rhetorik bedeutete, dass er zu Cheney und Rumsfeld Nein sagen konnte, aber es bedeutete nicht, dass seine verbissene Entschlossenheit nachließ. Das Ringen um Herz und Geist des Präsidenten ging weiter.
Am 8. November verabschiedete der UN-Sicherheitsrat mit 15 zu null Stimmen eine neue Resolution. Darin wurde der Irak aufgefordert, Waffeninspekteure einreisen zu lassen. In einer Stellungnahme im Rosengarten des Weißen Hauses lobte der Präsident Außenminister Powell „für seine Führungsstärke, seine gute Arbeit und seine Bestimmtheit während der vergangenen zwei Monate.“
Bob Woodward deckte vor 25 Jahren in der "Washington Post" den Watergate-Skandal auf

Die WELT 27.11.2002
Bob Woodward :
Kampf ums Herz des Präsidenten
Was passierte wirklich im Weißen Haus, als über das Vorgehen gegen den Irak entschieden wurde? Eine Geschichte von Machtkämpfen, Pannen und vier Menschen
Anfang August 2001 unternahm Außenminister Colin Powell eine diplomatische Reise ins Ausland. Wie immer, ließ er sich über das, was zu Hause passierte, genauestens informieren. Zu dieser Zeit gärte das Thema Irak. Brent Scowcroft, der frühere nationale Sicherheitsberater von George Bush senior, hatte in einer Talkshow gesagt, ein Angriff auf den Irak könne den Nahen Osten in einen „Hexenkessel verwandeln und damit den Krieg gegen den Terror zunichte machen“.
Deutliche Worte, aber im Wesentlichen war Powell der gleichen Meinung. Er hatte dem Präsidenten seine Lagebeurteilung bisher vorenthalten. Jetzt sah er ein, dass es an der Zeit war, offen mit George W. Bush zu reden. Praktisch alle Irak-Diskussionen im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) drehten sich um Kriegspläne: Wie greifen wir an? Wann greifen wir an? Mit welcher Truppenstärke? Powell befürchtete, dass man dabei war, die großen Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren. Der Präsident hatte immer begierig zugehört, wenn Vizepräsident Dick Cheney und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sprachen. Die beiden bildeten eine Art Team innerhalb des Kriegskabinetts. Powell wollte der alternativen Sicht der Dinge Gehör verschaffen. Es gab aber ein Problem: Nach außen musste es so aussehen, als gebe es im Kriegskabinett keine Meinungsverschiedenheiten. Bush würde einen öffentlichen Dissens nicht dulden.
Außerdem wurde Powell, der frühere General, von seinem Verhaltenskodex zurückgehalten: Ein Soldat gehorcht. Aber Bush könnte befehlen: Holt die Waffen! Auf die Pferde! Diese Art von Texas-Machotum empfand Powell als unangenehm. Allerdings glaubte er, dass sich der Präsident von Argumenten überzeugen ließe. Am Ende, so hoffte er, würde Bush einsehen, dass ein Alleingang keiner tieferen Analyse standhielt. In Powells Augen waren Rumsfeld und Cheney die Strippenzieher. Sie riefen zu oft: Holt die Waffen – auf die Pferde!
Am Abend des 5. August lud Bush Powell und seine Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice ins Weiße Haus ein, um über den Irak zu sprechen. Powell verlangte, über die Folgen des Krieges nachzudenken: Die ganze Region könne destabilisiert werden – und US-freundliche Regierungen in Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien geschwächt oder gestürzt. Es würde allem, was die USA sonst tun und planen, den Boden entziehen. Das gelte nicht nur für den Anti-Terror-Krieg, sondern für sämtliche diplomatischen, militärischen und nachrichtendienstlichen Bemühungen, sagte Powell. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten verheerend sein, möglicherweise würde der Ölpreis in unvorstellbare Höhen katapultiert.
Auch bei einem Sieg – und Powell war sicher, dass die USA siegen würden – wären die Auswirkungen immens. „Kann man sich vorstellen, dass ein arabisches Land für längere Zeit von einem US-General regiert wird? Ein McArthur in Bagdad?“, fragte er. „Es ist eine tolle Sache zu sagen, wir können es im Alleingang machen“, sagte Powell dem Präsidenten geradeheraus, „es sei denn, man kann es nicht.“
Saddam Hussein sei verrückt, unberechenbar, eine echte Gefahr, aber die Politik der Abschreckung und Eindämmung habe seit dem Golfkrieg im Großen und Ganzen funktioniert. Ein neuer Krieg aber könne genau das zur Folge haben, was man verhindern wolle: einen irakischen Diktator, der, in die Enge getrieben, seine Massenvernichtungswaffen einsetzt.
Der Präsident schien fasziniert zu lauschen. Ab und zu stellte er Fragen, hütete sich aber, Argumente allzu entschieden zurückzuweisen. Powell wusste, dass Bush Lösungsvorschläge schätzt, ja darauf besteht. „Sie können immer noch auf eine Koalition oder auf ein Aktivwerden der Vereinten Nationen setzen“, sagte er also. Jedenfalls müsse internationale Unterstützung eingeholt werden. Ein Krieg im Irak könne sich als viel komplizierter und blutiger erweisen als der in Afghanistan – und der sei ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit einer Koalition. Am Ende hatte der Außenminister das Gefühl, nichts ungesagt gelassen zu haben. Bush bedankte sich. Das Gespräch hatte zwei Stunden gedauert – nicht die Dimensionen von Bill Clintons spätabendlichen Schlafzimmerdebatten, aber für den Präsidenten und Powell außergewöhnlich lange.
Am Mittwoch, dem 14. August, trafen sich Cheney, Rumsfeld, Powell, Rice und CIA-Chef George Tenet ohne den Präsidenten in Washington. Powell sagte, dass Bush am 12. September Gelegenheit haben werde, das Irak-Problem vor der UN-Vollversammlung anzusprechen. Am Ende stimmten alle überein: Eine Rede zum Irak wäre sinnvoll. Keine Einigkeit herrschte darüber, was genau der Präsident sagen sollte. Zwei Tage später traf sich der Nationale Sicherheitsrat. Bush nahm qua Videoschaltung teil. Für Powell bestand das einzige Ziel dieses Treffens darin, seine Ideen von einer Rede durchzusetzen: Der Präsident solle die UNO oder eine Koalition von Ländern um Unterstützung bitten. Bush fragte jeden der Reihe nach nach seiner Meinung. Es gab einen breiten Rückhalt für den Ansatz, es mit der UNO zu versuchen – sogar von Cheney und Rumsfeld. „Prima!“, sagte der Präsident schließlich, und Powell verließ das Treffen mit dem Gefühl, alles geregelt zu haben. Dann fuhr er in den Urlaub.
Als er in seinem Ferienhaus auf Long Island am 27. August die Zeitung aufschlug, traute er seinen Augen kaum. „Cheney: Risiko eines atomar bewaffneten Irak rechtfertigt Angriff“, stand da. Am Vortag hatte der Vizepräsident in einer Rede erklärt, dass Waffeninspektionen im Grunde zwecklos seien. „Eine Rückkehr der Inspekteure würde keine Garantie bieten, dass der Irak die UN-Resolutionen befolgt“, so Cheney, „im Gegenteil: es bedeutet eine ernste Gefahr, denn es würde viele in der trügerischen Sicherheit wiegen, dass der böse Geist Saddam wieder in der Flasche‘ ist.“ Die Risiken, untätig zu sein, seien weit größer, als das Risiko zu handeln. Cheneys Rede wurde weithin als Haltung der Administration verstanden. Ihr Tonfall war rau und unversöhnlich. Ähnlich äußerte sich Rumsfeld. Beide schlossen ein unilaterales Vorgehen ausdrücklich nicht aus.
Auf Powell wirkte dies wie ein Präventivschlag gegen das, was seiner Meinung nach zehn Tage zuvor vereinbart worden war – nämlich den Vereinten Nationen eine Chance zu geben. Etwa zur gleichen Zeit begannen Geschichten zu kursieren: Powell habe sich gegen Cheney gestellt. Einige Kommentatoren warfen Powell Illoyalität vor. Er zählte sieben Leitartikel, in denen seine Entlassung gefordert oder ihm der Rücktritt nahe gelegt wurde. „Wie kann ich illoyal sein, wenn ich die Position des Präsidenten vertrete?“, wunderte er sich.
Am 6. September war Powell aus dem Urlaub zurück und traf sich in Camp David mit den anderen Mitgliedern des NSC. Cheney behauptete nun, das Streben nach einer neuen Resolution würde sie wieder in das bekannte Gewirr der UN-Verfahren verstricken – ein unentschlossenes, nicht enden wollendes Durcheinander. „Der Präsident braucht doch nur eins zu tun: Sagen, dass Saddam böse ist, dass er frühere UN-Resolutionen ignoriert, willentlich verletzt und verhöhnt hat und dass sich die Vereinigten Staaten das Recht vorbehalten, unilateral zu handeln“, polterte er. „Aber so bittet man die UNO doch nicht um Unterstützung“, erwiderte Powell. Die Vereinten Nationen würden nicht gerade darauf brennen, Saddam für böse zu erklären und die USA zu einem Militärschlag zu ermächtigen. Cheneys Idee ließe sich nicht verkaufen, sagte Powell. Zudem habe sich der Präsident bereits dafür entschieden, der UNO eine Chance zu geben. Und der einzige Weg hierfür sei, sie um eine Resolution zu bitten.
Powell versuchte, den anderen die Konsequenzen eines Alleingangs vor Augen zu führen. Wenn sie unilateral handelten, müsse er zum Beispiel überall auf der Welt amerikanische Botschaften schließen. „Das ist nicht das Problem“, erwiderte Cheney. Saddam und seine himmelschreiende Bedrohung seien das Problem. „Vielleicht läuft es nicht so, wie Sie es sich vorstellen“, entgegnete Powell. Ein Krieg könne alle möglichen unerwarteten und unbeabsichtigten Folgen nach sich ziehen. „Das ist nicht das Problem“, sagte Cheney erneut. Die Debatte wuchs sich zu einem harten Schlagabtausch aus.
Am nächsten Tag kamen die wichtigsten Mitglieder des NSC mit dem Präsidenten zusammen. Bush schien inzwischen gewillt, die Vereinten Nationen um eine Resolution zu ersuchen. Doch Cheney und Rumsfeld übten weiter Druck aus. Schließlich kamen sie überein, dass Bush die Vereinten Nationen ersuchen sollte zu „handeln“. Powell akzeptierte, denn die einzige Weise, in der die Vereinten Nationen handeln konnten, war durch Resolutionen.
Am Abend vor der Rede sprach Bush noch einmal mit Powell und Rice. Der Präsident hatte sich endgültig entschieden, die UNO um neue Resolutionen zu ersuchen. Zunächst wollte er Powell und Rice autorisieren, nach der Rede zu erklären, dass die Vereinigten Staaten hierfür mit der UNO zusammenarbeiten würden. Doch dann beschloss er, dass er es auch selbst sagen könne. Ihm gefiel die Vorstellung, dass die Schlagzeile ein Zitat aus seiner Rede sein würde. Also ordnete er an, einen Satz einzufügen. Darin sollte zum Ausdruck kommen, dass Washington mit dem UN-Sicherheitsrat bei den notwendigen „Resolutionen“ zusammenarbeiten werde.
Doch als Bush am nächsten Tag vor der UN-Vollversammlung die Stelle seiner Rede erreicht hatte, an der er sich für Resolutionen aussprechen sollte, erschien der Satz nicht auf dem Teleprompter. Auf dem Manuskript war die Änderung vergessen worden. Folglich las Bush die alte Zeile: „Mein Land wird mit dem UN-Sicherheitsrat zusammenarbeiten, um uns der gemeinsamen Herausforderung zu stellen.“ Powell, der die Rede auf seiner Kopie gegenlas, um Stegreif-Bemerkungen des Präsidenten zu notieren, blieb fast das Herz stehen. Der Satz über die Resolutionen war nicht da! Bush hatte ihn nicht gesagt. Es war die Pointe. Aber Bush hatte bemerkt, dass der Teil fehlte. Ein wenig unbeholfen improvisierte er: „Wir werden mit dem UN-Sicherheitsrat bei den notwendigen Resolutionen zusammenarbeiten. Powell atmete tief durch.
Die Rede galt allgemein als Durchbruch. Einen Tag später kündigte der Irak an, dass er neue Waffeninspekteure billigen werde. Von da an wurde die öffentliche Rhetorik des Präsidenten maßvoller. Statt von einem Regimewechsel zu sprechen, sagte er nun: „Meine Politik besteht darin, den Irak dazu zu bringen, seine Waffenvernichtungswaffen aufzugeben.“ Nicht eine Militäraktion sei oberstes Ziel, „sondern diesen Mann [Saddam] zu entwaffnen.“ Dies alles war ein Sieg für Powell, aber vielleicht nur ein momentaner. Bushs zurückgenommene Rhetorik bedeutete, dass er zu Cheney und Rumsfeld Nein sagen konnte, aber es bedeutete nicht, dass seine verbissene Entschlossenheit nachließ. Das Ringen um Herz und Geist des Präsidenten ging weiter.
Am 8. November verabschiedete der UN-Sicherheitsrat mit 15 zu null Stimmen eine neue Resolution. Darin wurde der Irak aufgefordert, Waffeninspekteure einreisen zu lassen. In einer Stellungnahme im Rosengarten des Weißen Hauses lobte der Präsident Außenminister Powell „für seine Führungsstärke, seine gute Arbeit und seine Bestimmtheit während der vergangenen zwei Monate.“
Bob Woodward deckte vor 25 Jahren in der "Washington Post" den Watergate-Skandal auf
Damit alle gut von mir denken, beginne ich auch mal mit dem "kopieren"
aus kitco com:
Turk goes so far as to reference Robert Prechter`s Elliott Wave forecast - that the price of gold will move below $200 an ounce before finally ending its 22-year bear market.
aus kitco com:
Turk goes so far as to reference Robert Prechter`s Elliott Wave forecast - that the price of gold will move below $200 an ounce before finally ending its 22-year bear market.
Grani,
du bist heute einfach an Konstruktivitaet nicht mehr zu uebertreffen.
Hat dir deine Mammi dein Spielzeug weggenommen?
MfG
du bist heute einfach an Konstruktivitaet nicht mehr zu uebertreffen.

Hat dir deine Mammi dein Spielzeug weggenommen?

MfG
FTD vom 28.11.2002
Die Erholung hat die Wall Street längst antizipiert
Da muss die Fed aber mächtig daneben liegen. Gemäß ihrem jüngsten Beige Book war in der US-Wirtschaft nicht viel los gegen Ende Oktober und Anfang November. Dennoch ist den Händlern am Mittwoch mal wieder das Blut aus dem Hirn geschossen.
Vor allem der Chicagoer Einkaufsmanagerindex und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurden ekstatisch begrüßt. Dabei meint die Fed, dass die Industrie unter anderem in Chicago schwach ist. Derweil bleibt die Arbeitsnachfrage in fast allen Bezirken mäßig. Zudem sind die laufenden Ansprüche erneut gestiegen, was auf höhere Arbeitslosigkeit hindeutet. Die Gebrauchsgüteraufträge liegen noch um drei Prozent unter dem Juli diesen Jahres - und übrigens auch um drei Prozent unter dem Juli 1997. An der Wall Street ist das schon ein Grund zu feiern - kosten Aktien doch nur das 50fache der von S&P berechneten Kerngewinne.
Die ökonomische Realität indes ist anders. Die volkswirtschaftlichen Gewinne sind im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 14,1 Mrd. $ geschrumpft, nach dem Rückgang von 12,6 Mrd. $ im zweiten Quartal. Zu Recht weist die Dresdner Bank darauf hin, dass die Preise, welche die US-Firmen außerhalb der Finanzindustrie pro realer BIP-Einheit erzielen können, im dritten Quartal um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen sind, nach 0,6 Prozent im zweiten Quartal. Die Ökonomen meinen, dass Deflation für den US-Unternehmenssektor bereits Realität ist.
Derweil sind die Lohnstückkosten seit dem Frühjahr wieder leicht am steigen. Solange die Wirtschaft alles in allem nur so dahintrottet und die Lücke zur Potenzialproduktion steigt, können die Lohnstückkosten ohnehin kaum schnell genug sinken, um den Preisdruck auszugleichen. Insofern bleibt den Firmen nichts übrig, als zu entlassen. Das wiederum macht sich im Konsumklima bemerkbar, das so gedrückt ist wie seit 1994 nicht mehr. Und woher soll Nachfrage kommen, wenn Konsumenten wie Firmen in Schulden ersticken, die Kapazitätsauslastung sogar wieder sinkt und die Sparquote trotz der Steuergeschenke um vier Prozentpunkte unter ihrem Nachkriegsschnitt liegt?
Klar: Es gibt Zeichen für eine kurze zyklische Erholung, etwa die Seefrachtpreise, die maßgeblich von den aufstrebenden Wirtschaften Asiens geprägt werden, wo es wegen der rekordniedrigen Zinsen gut läuft. Natürlich sind Sondereffekte im Spiel. Aber immerhin werden 98 Prozent des Welthandels auf dem Seeweg abgewickelt. Nur ist die Erholung an der Börse nach dem jüngsten Anstieg von 21 Prozent im S&P 500 schon zu einem guten Teil antizipiert. Vielleicht sind noch zehn Prozent drin. Aber bei derlei Bewertungen ist das Risiko inzwischen enorm.
---
mal so am Rande – ich hab es erst heute entdeckt
Das World Gold Council hat einen Trendbericht zur Goldnachfrage herausgebracht.
Die PDF-Datei lässt sich abrufen unter:
http://www.gold.org/value/markets/Gdt/Gdt41/WGC_GDT_Nov_2002…
- und wem das noch nicht reicht kann dazu ein Interview mit RHONA O’CONNELL (Gold Council) lesen:
http://www.mips1.net/mgcl.nsf/Current/85256BEA0026513A85256C…
Die Erholung hat die Wall Street längst antizipiert
Da muss die Fed aber mächtig daneben liegen. Gemäß ihrem jüngsten Beige Book war in der US-Wirtschaft nicht viel los gegen Ende Oktober und Anfang November. Dennoch ist den Händlern am Mittwoch mal wieder das Blut aus dem Hirn geschossen.
Vor allem der Chicagoer Einkaufsmanagerindex und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurden ekstatisch begrüßt. Dabei meint die Fed, dass die Industrie unter anderem in Chicago schwach ist. Derweil bleibt die Arbeitsnachfrage in fast allen Bezirken mäßig. Zudem sind die laufenden Ansprüche erneut gestiegen, was auf höhere Arbeitslosigkeit hindeutet. Die Gebrauchsgüteraufträge liegen noch um drei Prozent unter dem Juli diesen Jahres - und übrigens auch um drei Prozent unter dem Juli 1997. An der Wall Street ist das schon ein Grund zu feiern - kosten Aktien doch nur das 50fache der von S&P berechneten Kerngewinne.
Die ökonomische Realität indes ist anders. Die volkswirtschaftlichen Gewinne sind im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 14,1 Mrd. $ geschrumpft, nach dem Rückgang von 12,6 Mrd. $ im zweiten Quartal. Zu Recht weist die Dresdner Bank darauf hin, dass die Preise, welche die US-Firmen außerhalb der Finanzindustrie pro realer BIP-Einheit erzielen können, im dritten Quartal um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen sind, nach 0,6 Prozent im zweiten Quartal. Die Ökonomen meinen, dass Deflation für den US-Unternehmenssektor bereits Realität ist.
Derweil sind die Lohnstückkosten seit dem Frühjahr wieder leicht am steigen. Solange die Wirtschaft alles in allem nur so dahintrottet und die Lücke zur Potenzialproduktion steigt, können die Lohnstückkosten ohnehin kaum schnell genug sinken, um den Preisdruck auszugleichen. Insofern bleibt den Firmen nichts übrig, als zu entlassen. Das wiederum macht sich im Konsumklima bemerkbar, das so gedrückt ist wie seit 1994 nicht mehr. Und woher soll Nachfrage kommen, wenn Konsumenten wie Firmen in Schulden ersticken, die Kapazitätsauslastung sogar wieder sinkt und die Sparquote trotz der Steuergeschenke um vier Prozentpunkte unter ihrem Nachkriegsschnitt liegt?
Klar: Es gibt Zeichen für eine kurze zyklische Erholung, etwa die Seefrachtpreise, die maßgeblich von den aufstrebenden Wirtschaften Asiens geprägt werden, wo es wegen der rekordniedrigen Zinsen gut läuft. Natürlich sind Sondereffekte im Spiel. Aber immerhin werden 98 Prozent des Welthandels auf dem Seeweg abgewickelt. Nur ist die Erholung an der Börse nach dem jüngsten Anstieg von 21 Prozent im S&P 500 schon zu einem guten Teil antizipiert. Vielleicht sind noch zehn Prozent drin. Aber bei derlei Bewertungen ist das Risiko inzwischen enorm.
---
mal so am Rande – ich hab es erst heute entdeckt

Das World Gold Council hat einen Trendbericht zur Goldnachfrage herausgebracht.
Die PDF-Datei lässt sich abrufen unter:
http://www.gold.org/value/markets/Gdt/Gdt41/WGC_GDT_Nov_2002…
- und wem das noch nicht reicht kann dazu ein Interview mit RHONA O’CONNELL (Gold Council) lesen:
http://www.mips1.net/mgcl.nsf/Current/85256BEA0026513A85256C…
.
Schlecht für Gold ? - Die Gerüchte um eine mögliche Dollarabwertung verdichten sich :
Die Reden der Fed-Herren Greenspan, Moskow und Bernanke haben der geldpolitischen Diskussion in den USA eine neue Dimension verliehen. Es wirkte schon sehr abgestimmt, wie vor allem Fed-Chairman Alan Greenspan und das neue Fed-Board-Mitglied Ben Bernanke, ein international reputierter Geldtheoretiker, die Zuversicht streuten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Deflation in den USA sehr gering sei und die US-Notenbank jederzeit die Mittel habe, selbst bei Nullzinsen einem solchen Prozess entgegenzuwirken.
Konjunkturoptimisten mag das beruhigt haben, die Pessimisten hingegen dürften weiter verunsichert sein.
Stephen S. Roach von Morgan Stanley, der bereits seit langem vor den Gefahren einer weltweiten Deflation warnt, sieht die Fed nach diesen Reden zwar vielleicht nicht am Beginn einer Schlacht, zumindest aber doch in der Offensive gegen das Alptraum-Szenario Deflation. Und für diese Offensive sieht sich die US-Notenbank bestens gerüstet.
Vor allem Bernanke hat explizit eine Reihe von Instrumenten genannt, mit denen die Fed die drohende Gefahr der Deflation abwenden will, sollte dies tatsächlich notwendig werden. Denn bei Leitzinsen von 1,25 Prozent besteht wenig Spielraum und noch weniger psychologisches Stützungspotenzial.
Dabei scheint es darauf hinauszulaufen, dass die Fed ähnlich vorgehen wird, wie dies bereits jetzt die Bank of Japan seit geraumer Zeit mit zweifelhaftem Erfolg tut: nämlich über den Ankauf von Staatstiteln, um so möglichst großen Einfluss auf das gesamte Renditespektrum zu haben bzw erwünschte Renditen zu erzwingen. Die Politik, die dahinter steht, kann letztlich in eine Monetisierung der Staatsverschuldung münden, was vielleicht sogar im Interesse des Treasury ist. Ob jedoch die mit einer solchen Politik verbundene Inflationierung und Enteignung der übrigen Staatsgläubiger wünschenswert ist, ist aus deren Blickwinkel fraglich.
Roach stellt zudem einen weiteren Punkt in der Rede Bernankes heraus, der die internationale Gemeinschaft aufhorchen lassen sollte. Als erster offizieller US-Vertreter hat Bernanke auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, über eine Dollar-Abwertung Inflation zu importieren. Sicherlich, Bernanke hat gleichzeitig eingeräumt, dass er einen solchen Schritt weder vorhersagen noch empfehlen werde, dennoch hat er auf die mögliche Effizienz einer solchen Maßnahme verwiesen:
So habe zwischen 1933 und 1934 eine Dollar-Abwertung von 40 Prozent mit dazu beigetragen, eine Defaltionsrate von 10,3 Prozent in eine Inflation von 3,4 Prozent umzuwandeln.
Die offensive Herangehensweise der Fed dürfte zudem noch einen anderen Hingrund haben. Es scheint so, als ob die US-Notenbank ihren Druck auf die EZB und selbst auf die Bank of Japan verstärken will, um diese zu (noch) expansiveren Maßnahmen zur Konjunkturbelebung zu drängen. Dabei werden ihr aber wohl kaum die 25 oder 50 Basispunkte reichen, die jetzt bereits für die EZB-Rat-Sitzung am 5. Dezember erwartet werden. Vielleicht wird damit eine Dollar-Abwertung eine realistische Alternative, würde sie es doch der EZB erlauben, schneller ihr Preisstabilitätsziel zu erreichen. Ob dies aber den Exporteuren der Eurozone gefallen wird, ist mehr als zweifelhaft.
Quelle: vwd 25.11.02
Schlecht für Gold ? - Die Gerüchte um eine mögliche Dollarabwertung verdichten sich :
Die Reden der Fed-Herren Greenspan, Moskow und Bernanke haben der geldpolitischen Diskussion in den USA eine neue Dimension verliehen. Es wirkte schon sehr abgestimmt, wie vor allem Fed-Chairman Alan Greenspan und das neue Fed-Board-Mitglied Ben Bernanke, ein international reputierter Geldtheoretiker, die Zuversicht streuten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Deflation in den USA sehr gering sei und die US-Notenbank jederzeit die Mittel habe, selbst bei Nullzinsen einem solchen Prozess entgegenzuwirken.
Konjunkturoptimisten mag das beruhigt haben, die Pessimisten hingegen dürften weiter verunsichert sein.
Stephen S. Roach von Morgan Stanley, der bereits seit langem vor den Gefahren einer weltweiten Deflation warnt, sieht die Fed nach diesen Reden zwar vielleicht nicht am Beginn einer Schlacht, zumindest aber doch in der Offensive gegen das Alptraum-Szenario Deflation. Und für diese Offensive sieht sich die US-Notenbank bestens gerüstet.
Vor allem Bernanke hat explizit eine Reihe von Instrumenten genannt, mit denen die Fed die drohende Gefahr der Deflation abwenden will, sollte dies tatsächlich notwendig werden. Denn bei Leitzinsen von 1,25 Prozent besteht wenig Spielraum und noch weniger psychologisches Stützungspotenzial.
Dabei scheint es darauf hinauszulaufen, dass die Fed ähnlich vorgehen wird, wie dies bereits jetzt die Bank of Japan seit geraumer Zeit mit zweifelhaftem Erfolg tut: nämlich über den Ankauf von Staatstiteln, um so möglichst großen Einfluss auf das gesamte Renditespektrum zu haben bzw erwünschte Renditen zu erzwingen. Die Politik, die dahinter steht, kann letztlich in eine Monetisierung der Staatsverschuldung münden, was vielleicht sogar im Interesse des Treasury ist. Ob jedoch die mit einer solchen Politik verbundene Inflationierung und Enteignung der übrigen Staatsgläubiger wünschenswert ist, ist aus deren Blickwinkel fraglich.
Roach stellt zudem einen weiteren Punkt in der Rede Bernankes heraus, der die internationale Gemeinschaft aufhorchen lassen sollte. Als erster offizieller US-Vertreter hat Bernanke auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, über eine Dollar-Abwertung Inflation zu importieren. Sicherlich, Bernanke hat gleichzeitig eingeräumt, dass er einen solchen Schritt weder vorhersagen noch empfehlen werde, dennoch hat er auf die mögliche Effizienz einer solchen Maßnahme verwiesen:
So habe zwischen 1933 und 1934 eine Dollar-Abwertung von 40 Prozent mit dazu beigetragen, eine Defaltionsrate von 10,3 Prozent in eine Inflation von 3,4 Prozent umzuwandeln.
Die offensive Herangehensweise der Fed dürfte zudem noch einen anderen Hingrund haben. Es scheint so, als ob die US-Notenbank ihren Druck auf die EZB und selbst auf die Bank of Japan verstärken will, um diese zu (noch) expansiveren Maßnahmen zur Konjunkturbelebung zu drängen. Dabei werden ihr aber wohl kaum die 25 oder 50 Basispunkte reichen, die jetzt bereits für die EZB-Rat-Sitzung am 5. Dezember erwartet werden. Vielleicht wird damit eine Dollar-Abwertung eine realistische Alternative, würde sie es doch der EZB erlauben, schneller ihr Preisstabilitätsziel zu erreichen. Ob dies aber den Exporteuren der Eurozone gefallen wird, ist mehr als zweifelhaft.
Quelle: vwd 25.11.02
@konradi
Warum soll eine Dollarabwertung schlecht für Gold sein?
Ist doch eher positiv.
Gruss Mic
Warum soll eine Dollarabwertung schlecht für Gold sein?

Ist doch eher positiv.
Gruss Mic

@ mickym
Ich sehe es so: Japan hat gezeigt, dass eine Deflation die Anleger ins Gold treibt, siehe erste Jahreshälfte 02. So wie es die VWLer sehen, ist offenbar eine Inflation - so sie denn "instrumentabel" bleibt - das kleinere Übel in der Bewältigung der Krise. Ob das so richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Von neuen Unternehmensinvestitionen profitieren aber zumindest die Aktienmärkte. Für uns heißt das: Doomsday wird abgesagt, eine "Flucht" in physisches Gold bleibt für die nächsten Monate Wunschgedanke.
Und wenn der Goldpreis nicht bis zum Jahresende die 325 nimmt, werden alle Charttechniker endgültig das Halali blasen ...
Gruß Konradi
Ich sehe es so: Japan hat gezeigt, dass eine Deflation die Anleger ins Gold treibt, siehe erste Jahreshälfte 02. So wie es die VWLer sehen, ist offenbar eine Inflation - so sie denn "instrumentabel" bleibt - das kleinere Übel in der Bewältigung der Krise. Ob das so richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Von neuen Unternehmensinvestitionen profitieren aber zumindest die Aktienmärkte. Für uns heißt das: Doomsday wird abgesagt, eine "Flucht" in physisches Gold bleibt für die nächsten Monate Wunschgedanke.
Und wenn der Goldpreis nicht bis zum Jahresende die 325 nimmt, werden alle Charttechniker endgültig das Halali blasen ...

Gruß Konradi
@ mickym
Ich sehe es so: Japan hat gezeigt, dass eine Deflation die Anleger ins Gold treibt, siehe erste Jahreshälfte 02. So wie es die VWLer sehen, ist offenbar eine Inflation - so sie denn "instrumentabel" bleibt - das kleinere Übel in der Bewältigung der Krise. Ob das so richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Von neuen Unternehmensinvestitionen profitieren aber zumindest die Aktienmärkte. Für uns heißt das: Doomsday wird abgesagt, eine "Flucht" in physisches Gold bleibt für die nächsten Monate Wunschgedanke.
Und wenn der Goldpreis nicht bis zum Jahresende die 325 nimmt, werden alle Charttechniker endgültig das Halali blasen ...
Gruß Konradi
Ich sehe es so: Japan hat gezeigt, dass eine Deflation die Anleger ins Gold treibt, siehe erste Jahreshälfte 02. So wie es die VWLer sehen, ist offenbar eine Inflation - so sie denn "instrumentabel" bleibt - das kleinere Übel in der Bewältigung der Krise. Ob das so richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Von neuen Unternehmensinvestitionen profitieren aber zumindest die Aktienmärkte. Für uns heißt das: Doomsday wird abgesagt, eine "Flucht" in physisches Gold bleibt für die nächsten Monate Wunschgedanke.
Und wenn der Goldpreis nicht bis zum Jahresende die 325 nimmt, werden alle Charttechniker endgültig das Halali blasen ...

Gruß Konradi
@konradi
Lass mich nur mal wie folgt dagegenhalten:
Du magst recht haben, dass eine Inflation in USA, nicht unbedingt zu physischen Goldkäufen in den anderen Regionen führt.
Für die US-Anleger bedeutet aber eine Inflationierung des Dollars ein Steigerung der Preise. Wenn also Gold aus fundamentaler Sicht nur den heutigen Wert behielte, steigt jedenfalls der Goldpreis in Dollar (siehe auch Korrealation EUR<->Gold).
Damit auch die Gewinne der Minen. Ob das für die Europäer nicht durch die Dollarentwertung wieder aufgefressen wird, ist dann die Frage.
In dieser Zeit würde ich den physischen Besitz von Gold aber als Werterhaltung funktionieren - und auf jede Hyperinflation folgt eine Deflation (Währungsreform oder was weiss ich) - denn es kann ja nicht bis ins Unendliche "inflationiert" werden (s. 1923).
Also ob früher oder später der eigentliche Wert zum Trafgen kommt ist eigentlich egal. Das Beispiel Japan greift für den GOP deshalb nicht, da der Weltmarktpreis für Gold nun mal in $ und nicht in YEN gemacht wird.
Und die negative Korrelation zwischen Gold und $ ist implizit und in den Charts nachzuschauen.
Gruss Mic
Lass mich nur mal wie folgt dagegenhalten:
Du magst recht haben, dass eine Inflation in USA, nicht unbedingt zu physischen Goldkäufen in den anderen Regionen führt.
Für die US-Anleger bedeutet aber eine Inflationierung des Dollars ein Steigerung der Preise. Wenn also Gold aus fundamentaler Sicht nur den heutigen Wert behielte, steigt jedenfalls der Goldpreis in Dollar (siehe auch Korrealation EUR<->Gold).
Damit auch die Gewinne der Minen. Ob das für die Europäer nicht durch die Dollarentwertung wieder aufgefressen wird, ist dann die Frage.
In dieser Zeit würde ich den physischen Besitz von Gold aber als Werterhaltung funktionieren - und auf jede Hyperinflation folgt eine Deflation (Währungsreform oder was weiss ich) - denn es kann ja nicht bis ins Unendliche "inflationiert" werden (s. 1923).
Also ob früher oder später der eigentliche Wert zum Trafgen kommt ist eigentlich egal. Das Beispiel Japan greift für den GOP deshalb nicht, da der Weltmarktpreis für Gold nun mal in $ und nicht in YEN gemacht wird.
Und die negative Korrelation zwischen Gold und $ ist implizit und in den Charts nachzuschauen.
Gruss Mic

Die Welt 02.12.2002
Wirtschaftsexperten fürchten Irak-Krieg
Politiker schätzen die Kosten einer Auseinandersetzung auf 200 Milliarden Dollar
Düsseldorf/Frankfurt - Unter Ökonomen wächst die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen eines Irak-Krieges. Im Falle eines längeren Krieges am Golf könnte die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise geraten, warnt die Westdeutsche Landesbank (WestLB) im Rahmen ihrer aktuellen Deutschlandprognose 2002/2004. „Die gesamtwirtschaftliche Produktion in den USA wie in Europa würde für mindestens sechs bis neun Monate stagnieren oder leicht sinken“, schreiben die Experten. Nach Schätzungen der WestLB dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA 2003 in diesem Fall nicht mehr als ein Prozent wachsen, in der EU etwa 0,5 Prozent und in Deutschland sogar leicht schrumpfen.
Politiker und Wissenschaftler in den USA schätzen die Kosten eines Irak-Krieges auf mindestens 200 Mrd. Dollar. Auch die frühere Wirtschaftsberaterin von Ex-US-Präsident Clinton und heutige Dekanin der London Business School befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen: „Eine lange Militäraktion würde die amerikanische Wirtschaft wohl wieder in eine Rezession zurück stürzen.“
Den WestLB-Experten bereitet vor allem der Ölpreis Sorge, der im Fall einer längeren kriegerischen Auseinandersetzung auf über 35 Dollar je Barrel steigen könnte. Dies würde die Verbraucherpreise nach Berechnungen der WestLB in der Folge um bis zu einen Prozentpunkt erhöhen. An den Aktienmärkte könnte sogar der Absturz unter die Tiefs von Anfang Oktober drohen.
Allerdings räumt die WestLB diesem Szenario nur eine Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent ein. Für realistischer halten es die Ökonomen, dass eine Auseinandersetzung im Irak nur kurz stattfindet oder ganz ausbleibt. In diesem Fall dürften ein sinkender Ölpreis sowie eine Wende am Aktienmarkt zusammen rasch zu einer deutlichen Verbesserung des globalen Konjunkturklimas führen, heißt es in der Studie. „Eine Auseinandersetzung am Golf würde den erwarteten Aufschwung auf jeden Fall verzögern“, meint hingegen Jörg Krämer, Chefvolkswirt von Invesco. Ähnlich wie bereits während des Golfkriegs Anfang der 90er Jahre dürfte nach Einschätzung des Ökonomen noch mehr als ein steigender Ölpreis vor allem ein rapide sinkendes Verbrauchervertrauen die Konjunktur stark belasten.
Auch die Vorstandschefs großer amerikanischer Unternehmen und Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) warnen bereits seit Wochen vor den negativen Folgen eines Waffengangs im Nahen Osten. Erst jüngst hatte der IWF seine Prognosen für das Wachstum in Amerika von 3,4 auf 2,6 Prozent im kommenden Jahr gesenkt. Py/as
Wirtschaftsexperten fürchten Irak-Krieg
Politiker schätzen die Kosten einer Auseinandersetzung auf 200 Milliarden Dollar
Düsseldorf/Frankfurt - Unter Ökonomen wächst die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen eines Irak-Krieges. Im Falle eines längeren Krieges am Golf könnte die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise geraten, warnt die Westdeutsche Landesbank (WestLB) im Rahmen ihrer aktuellen Deutschlandprognose 2002/2004. „Die gesamtwirtschaftliche Produktion in den USA wie in Europa würde für mindestens sechs bis neun Monate stagnieren oder leicht sinken“, schreiben die Experten. Nach Schätzungen der WestLB dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA 2003 in diesem Fall nicht mehr als ein Prozent wachsen, in der EU etwa 0,5 Prozent und in Deutschland sogar leicht schrumpfen.
Politiker und Wissenschaftler in den USA schätzen die Kosten eines Irak-Krieges auf mindestens 200 Mrd. Dollar. Auch die frühere Wirtschaftsberaterin von Ex-US-Präsident Clinton und heutige Dekanin der London Business School befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen: „Eine lange Militäraktion würde die amerikanische Wirtschaft wohl wieder in eine Rezession zurück stürzen.“
Den WestLB-Experten bereitet vor allem der Ölpreis Sorge, der im Fall einer längeren kriegerischen Auseinandersetzung auf über 35 Dollar je Barrel steigen könnte. Dies würde die Verbraucherpreise nach Berechnungen der WestLB in der Folge um bis zu einen Prozentpunkt erhöhen. An den Aktienmärkte könnte sogar der Absturz unter die Tiefs von Anfang Oktober drohen.
Allerdings räumt die WestLB diesem Szenario nur eine Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent ein. Für realistischer halten es die Ökonomen, dass eine Auseinandersetzung im Irak nur kurz stattfindet oder ganz ausbleibt. In diesem Fall dürften ein sinkender Ölpreis sowie eine Wende am Aktienmarkt zusammen rasch zu einer deutlichen Verbesserung des globalen Konjunkturklimas führen, heißt es in der Studie. „Eine Auseinandersetzung am Golf würde den erwarteten Aufschwung auf jeden Fall verzögern“, meint hingegen Jörg Krämer, Chefvolkswirt von Invesco. Ähnlich wie bereits während des Golfkriegs Anfang der 90er Jahre dürfte nach Einschätzung des Ökonomen noch mehr als ein steigender Ölpreis vor allem ein rapide sinkendes Verbrauchervertrauen die Konjunktur stark belasten.
Auch die Vorstandschefs großer amerikanischer Unternehmen und Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) warnen bereits seit Wochen vor den negativen Folgen eines Waffengangs im Nahen Osten. Erst jüngst hatte der IWF seine Prognosen für das Wachstum in Amerika von 3,4 auf 2,6 Prozent im kommenden Jahr gesenkt. Py/as
DIE ZEIT 49/2002
Gespräch mit Gerhard Schröder:
Notfalls auch mit Zwang
DIE ZEIT: Herr Bundeskanzler, wann treten Sie zurück?
Gerhard Schröder: Warum sollte ich? Diese Mehrheit und diese Regierung gibt es für vier Jahre – und den diese Regierung führenden deutschen Bundeskanzler auch. Die Alternativen waren völlig klar: Schwarz-Gelb auf der einen, Rot-Grün auf der anderen Seite. Wir haben vor der Bundestagswahl niemanden im Zweifel darüber gelassen, dass wir Rot-Grün wollen. Wir haben eine Mehrheit für Rot-Grün bekommen, vielleicht anders als 1998.
DIE ZEIT: Auch wenn Regieren nicht zum Vergnügen da ist, man hat, ähnlich wie beim schwierigen Start vor vier Jahren, nicht den Eindruck, dass es zurzeit die fröhlichsten Monate Ihres Lebens sind.
Schröder: Richtig ist, dass Regieren selten mit Freude zu tun hat, meistens mit Pflicht. Aber Pflichten kann man auch gern ausüben. Es ist aber auch keine Frage, dass ein Wahlkampf, der so auf eine Person zugeschnitten war, mit all den Hoffnungen und Erwartungen, die daran hingen, unendlich viel Kraft kostete.
DIE ZEIT: Sie hätten nach dem 22. September eine Woche Urlaub machen können.
Schröder: Das ging nicht. Ich hatte unmittelbar nach dem Wahlkampf Koalitionsverhandlungen zu führen. Ich musste für ein Personaltableau sorgen, das nicht ganz einfach war. Es gab berechtigte Erwartungen im Osten unseres Landes, wo wichtige Teile des Wahlerfolges errungen waren. Strukturfragen in der Regierung waren zu lösen, etwa die Zusammenlegung des Ministeriums von Wirtschaft und Arbeit, und dafür mussten wir die geeignetste Persönlichkeit finden. Und wenn das der Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes ist, braucht das schon einiges an …
DIE ZEIT: ... Zeit ...?
Schröder: ... vor allen Dingen an Überzeugungskraft. Hinzu kam dann, dass bei den Koalitionsverhandlungen eine Art Sucht vorherrschte, jedes Detail von Verhandlungen öffentlich werden zu lassen. Wenn dann nach der Detailkritik etwas korrigiert werden muss, entsteht der Eindruck, der entstanden ist.
DIE ZEIT: Es ist ein Eindruck einer chaotischen, unkoordinierten Regierung entstanden, der es bei allen Beteiligten vor allem an einem mangelt: der Furcht vor dem Herrn.
Schröder: Ich habe nie den Anspruch gehabt, Furcht zu verbreiten. Respekt reicht mir. Meine Vorstellungen werden zunehmend deutlicher werden. Mir geht es um drei Leitlinien. Erstens: Eine Außenpolitik, die der Souveränität des Landes gerecht wird, die bündnisfähig ist und bleibt, die aber gleichzeitig die Kraft und den Mut zur Differenzierung entwickelt. Zweitens: Eine Wirtschaftspolitik, die Dynamik in der Wirtschaft verbindet mit sozialer Sensibilität in der Gesellschaft, um der Wirtschaft auch soziale Grenzen zu setzen. Drittens: Es geht darum, eine aufgeklärte, tolerante Gesellschaft zu bewahren, ohne dass der Respekt vor den staatlichen Institutionen und die Behauptung des Gewaltmonopols in irgendeiner Form in Zweifel gezogen werden. Für diese Grundpositionen mussten wir materielle Voraussetzungen schaffen. Wer fair ist, wird feststellen, dass wir in diesem Sinne auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
DIE ZEIT: Die Union hat sich im Wahlkampf sozialdemokratisch geriert, zu einer wirklich inhaltlichen Auseinandersetzung ist es nicht gekommen. Könnte das der Grund sein, dass jetzt auch Parteifreunde von Ihnen die klaren Linien vermissen oder die Opposition Ihnen vorhält, Sie seien unehrlich gewesen?
Schröder: Das ist falsch. Richtig ist nur, dass es ein bisher nie gekanntes Maß an sozialer Demagogie auf der Seite der Union gegeben hat. Mit der Unternehmenssteuerreform haben wir – im Ausland sehr beachtet – dafür gesorgt, dass die Veräußerungsgewinne aus Beteiligungsverkäufen steuerfrei realisiert werden können. Das sollte die Deutschland-AG auflockern. Sie wissen wie ich, mit welcher hemmungslosen Demagogie die Union dagegen zu Felde gezogen ist – übrigens ohne dass die ihr zugeneigten Verbände entschieden widersprochen hätten.
DIE ZEIT: Es scheint Sie auch persönlich verletzt zu haben, so dass ein Teil Ihrer jetzigen Wirtschaftspolitik wie eine persönliche Reaktion auf diese Enttäuschung wirkt.
Schröder: Das ist falsch. Aber noch einmal zum Beispiel der Körperschaftsteuer: Wir wussten, dass die Veränderung im System, die wir gemacht haben, für eine Übergangszeit zu einem niedrigeren Körperschaftssteueraufkommen führen würde, kompensiert durch das Aufkommen aus der Kapitalertragssteuer. Auch dagegen ist polemisiert worden. Und damit sind gleichfalls Fakten geschaffen worden, über die man in der öffentlichen Debatte schwer hinwegkommen kann. Insofern stimmt es schon, dass der Wahlkampf – nicht von uns verursacht –, äußerst unsachlich ausgetragen worden ist. Und das hat es nicht erleichtert, deutlich zu machen, was nötig ist.
DIE ZEIT: In der internationalen Presse ist häufig von der „deutschen Krankheit“ die Rede. Deutschland sei ökonomisch das Schlusslicht in Europa. Wie sehen Sie das?
Schröder: Das Deutschland-Bild, das in der ausländischen Presse – ob bewusst oder unbewusst – häufig gezeichnet wird, ist falsch. Auch von der Brüsseler Kommission und von vielen Beobachtern wird übersehen, dass kein Land Europas und auch kein Land der Welt ökonomisch die Einheit zu verkraften hatte. Nur zwei Daten dazu: Wir verlieren jährlich real 0,6 Prozent Wachstumspunkte durch den Abbau der Kapazitäten in der Bauwirtschaft, vor allen Dingen im Osten, die im Einigungsboom aufgebaut worden sind. Und wir hätten bei den Rentenversicherungsbeiträgen – die unter Kohl übrigens schon einmal bei 20,3 Prozent waren – einen Beitragssatz von etwas über 17 Prozent, und nicht von 19,5 Prozent, wenn darin nicht so viele Lasten steckten.
DIE ZEIT: Das ganze Benchmarking ist also irreführend?
Schröder: Ja, natürlich, weil ein großer Teil der Beobachter diese Tatbestände nicht kennt oder nicht kennen will, da es auch um eine Konkurrenz von Volkswirtschaften geht. Wer mich glauben machen will, dass die Berichterstattung über Deutschland in der angelsächsischen Presse nur von dem Willen getragen wäre, uns die richtigen Ratschläge zu geben, der irrt. In diesen Medien werden nationale Befindlichkeiten eher berücksichtigt als bei uns. Das kann Vorteil oder Nachteil sein. Hinzu kommt: Wir führen auch eine Auseinandersetzung um ein Gesellschaftsmodell, man kann auch sagen, um ein Sozialmodell. Und wenn Sie sich ansehen, wie diese Kontroverse in der anglo-amerikanischen Presse wiedergegeben wird, dann erkennen Sie auch den Versuch, das angelsächsische oder das amerikanische Gesellschafts- und Sozialmodell auf Deutschland zu übertragen. Und das funktioniert nicht.
DIE ZEIT: Das ist zu ideologiekritisch.
Schröder: Immer wenn es ernsthaft wird, vermuten Sie Ideologie. Das ist nicht Ideologie, das ist die blanke Wahrheit.
DIE ZEIT: Niemand wünscht sich doch sehnlicher, dass die Deutschen wieder nach vorne kommen, als unsere Nachbarn, denn wir ziehen Europa, weil wir ein Drittel des gesamteuropäischen Sozialprodukts ausmachen. Die wollen einfach Wachstum sehen.
Schröder: Was heißt, die wollen Wachstum? Warum wächst die amerikanische Wirtschaft deutlich schneller als unsere? Das hängt zusammen mit der Einwanderung und mit den Bedingungen, unter denen zum Beispiel die jeweils erste Einwanderergeneration zum Wachstum beiträgt. Ich bin sehr für Wachstum und wir arbeiten an der Beseitigung von Wachstumshemmnissen. Wir müssen aber auch klar machen, in welcher Weise Wachstum in Gesellschaften wie unserer erreichbar ist, ohne die soziale Qualität unserer Gesellschaft aufzugeben. Das wird auch die zentrale Auseinandersetzung der nächsten Zeit werden.
DIE ZEIT: Was Sie eben umrissen haben, könnte der Kern der von vielen ersehnten, von Ihnen aber bisher nicht gelieferten „Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede“ sein.
Schröder: Es geht nicht um Blut, Schweiß oder Tränen, sondern um die Beschreibung dessen, was ist und was sein soll.
DIE ZEIT: Die Rede kommt?
Schröder: Dem dient doch dieses Interview. Bezogen auf das, was wir an Reformvorhaben vor uns haben, heißt das zum Beispiel, dass wir natürlich im Arbeitsmarkt etwas verändern müssen und werden. Wir werden bei den Leistungen und Transferleistungen Einschnitte machen. Wenn Sie allein in diesem Bereich in Nürnberg fast sieben Milliarden Euro kürzen, wie wir es getan haben, bedeutet das empfindliche Einbußen für diejenigen, die es angeht. Man muss sich vorstellen, was das für jemanden bedeutet, der von wesentlich weniger im Monat leben muss, als wir hier alle am Tisch in der Woche. Wir werden in der Gesundheitspolitik auf der einen Seite dafür sorgen müssen, dass Transparenz und Wettbewerb in das System kommen, wir werden uns auf der anderen Seite aber natürlich unterhalten müssen, was gebraucht wird, und zwar für alle, um das medizinisch Notwendige zu leisten. Dazu müssen wir uns mit allen Interessengruppen anlegen. Und wir werden natürlich auch nicht medizinisch notwendige Ansprüche von Patienten zurücknehmen. Drittens müssen wir in die Qualität unseres Bildungssystems, vor allem in die Kinderbetreuung, massiv investieren. Das alles bedeutet, dass wir Zöpfe, die es gibt, auch abschneiden müssen. Die Frage ist nur: Wie macht man das? Und zu wessen Lasten? Will man es so machen, dass die Qualität dieser Gesellschaft unter veränderten Bedingungen aufrechterhalten wird? Und die Qualität dieser Gesellschaft ist gekennzeichnet dadurch, dass Lasten einigermaßen gerecht verteilt werden. Mehr sage ich ja gar nicht. Die zentrale Frage heißt: Mit welchen Maßnahmen lässt sich unter den Bedingungen globalisierter Wirtschaft Sozialstaatlichkeit aufrechterhalten?
DIE ZEIT: Das heißt, es geht in unserer wohlhabenden Gesellschaft um Grundsicherungen für jeden?
Schröder: Nicht nur. Es geht darum, dass Partizipation im Politischen, aber auch im Ökonomischen möglich bleibt. Und jetzt sage ich etwas Ketzerisches: Man wird klar machen müssen, dass der berühmte Satz Lampedusas im „Gattopardo“, wonach sich alles ändern muss, damit es bleiben kann, wie es ist, eigentlich die Leitlinie von Politik werden muss. All diejenigen, die sich vor Veränderung fürchten, weil ihre soziale Rolle, auf welchem Level auch immer, beeinträchtigt wird, werden sich fragen müssen – und wir müssen ihnen diese Fragen aufzwingen –: Verlieren wir unsere soziale Rolle nicht gerade dadurch, dass sich nichts verändert?
DIE ZEIT: Als dieser Veränderer werden Sie im Moment aber gerade nicht wahrgenommen.
Schröder: Dann ist es meine Arbeit, dafür zu sorgen, dass das wieder so ist. Und das wird auch so sein. Ich will keine „Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede“ halten, weil ich von diesen Begriffen überhaupt nichts halte. Diese ganzen Übertreibungen, auch diese Vergleiche mit Weimar, von angeblich bedeutenden Historikern, die es bei Licht betrachtet nicht sind, diese Verzerrungen habe ich wegzuwischen, und dahinter muss eine realistische Beschreibung des Zustandes unseres Landes stehen.
DIE ZEIT: Vielleicht könnte man es auch auf zwei andere Begriffe zuspitzen: Sie müssen letztlich ein Austeritätskanzler sein, aber es fällt Ihnen schwer, so etwas auszusprechen. Und Sie müssen den Leuten sagen, dass wir an Grenzen gestoßen sind, und auch das fällt sehr schwer.
Schröder: Austerity ist auch wieder so ein Begriff, der historisch entlehnt ist, und wenn man so etwas verwendet, geht es immer schief. Es geht um eine realistische Beschreibung. Es geht darum, auch zu sagen, dass, was Sozialstaatlichkeit angeht, nichts, aber auch gar nichts mehr draufgesattelt werden kann. Im Gegenteil, wenn man den Sozialstaat in der Substanz erhalten will, unter völlig veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen, muss es auch ein Zurücknehmen der Ansprüche geben. Und wenn das nicht freiwillig geschieht, muss die Regierung das erzwingen.
DIE ZEIT: Es kommt einem manchmal so vor, als würden wir in zwei Realitäten leben. Die eine Realität ist: Mehr oder weniger das ganze Volk hat erkannt, was geschehen muss. Und die andere Realität ist, dass gesagt wird: Aber bitte beim anderen. Zur Gruppen- und Verbandsrealität gehört es, wenn die Krankenkassen um Millionensummen betrogen oder wenn 16 Prozent des Bruttosozialprodukts auf dem grauen oder schwarzen Markt erwirtschaftet werden. Da fragt man sich schon, wann endlich eine Rede, vielleicht sogar eine Predigt kommt: Macht euch ehrlich über euch selbst!
Schröder: Ich will es dabei bewenden lassen, was ich über Realismus und Realitätssinn gesagt habe. Diese „Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden“ werden ja meistens von denen gefordert, die sie selber nicht halten mögen. Aber was die Verbände angeht – wenn ich sage, ein unverbindliches Gespräch reicht mir nicht, wird mir entgegengehalten, ich sei gar nicht mehr gesprächsbereit. Im "Bündnis für Arbeit" habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gewerkschaften auf der einen Seite und Arbeitgeber auf der anderen diesen Gesprächskreis und auch die Regierung dann und nur dann in Ordnung fanden, wenn sie sie jeweils für ihre Eigeninteressen instrumentalisieren konnten. Das ist dann aber kein Dialog mehr. Wie demokratisiert man also den Prozess? Ich will die Verbände nicht abschaffen. In Fragen der Steuerpolitik zum Beispiel, wo wir die Dinge nach langen Auseinandersetzungen, das gebe ich zu, eigentlich ganz vernünftig gemacht haben, müssen sich die großen, die mächtigen Mitglieder angewöhnen, ihren Verbandsoberen auch mal zu sagen: Lasst das Taktieren sein, was hier gemacht wird, ist schon in Ordnung.
DIE ZEIT: Zu den Verbänden gehören auch die Gewerkschaften. Der Beamtenbund und ver.di fordern Lohnabschlüsse, die weit über das hinausgehen, was die in die Pleite gehenden Länder und Städte und der Bund zahlen können.
Schröder: Ich kann und will mich nicht in die Tarifverhandlungen einmischen. Wenn es dort einen Abschluss geben soll, der schnell ist, dann wird das nur einer sein können, der haushaltsverträglich ist. Und das liegt sicher weit unter dem, was die Gewerkschaften sich vorstellen.
DIE ZEIT: Und was ist, wenn ver.di den Müll nicht mehr wegfährt und die Straßen blockiert?
Schröder: Jeder Vorsitzende einer Gewerkschaft wird, wenn er sich zum Streik entscheidet, auch überlegen müssen: Wie ist denn eigentlich die Bewertung meiner Gewerkschaft in der Öffentlichkeit?
DIE ZEIT: Die Deutschen haben sich oft als ein durchaus patriotisches Land erwiesen. Nur bei den Auseinandersetzungen zwischen den Verbänden, aber auch zwischen den verschiedenen Parteien scheint genau dieses Element des Patriotismus zu fehlen.
Schröder: Ich denke, dass diese patriotische Gesinnung – und das ist ja auch etwas Schönes – immer dann deutlich wird, wenn sie nicht organisiert ist. Wenn man versucht, Patriotismus über Verbände zu organisieren, geht es schief. Wenn man aber das Volk emotional auf eine Situation reagieren lässt, kommt etwas Gutes dabei heraus.
DIE ZEIT: Also muss der Kanzler mit dem Volk direkt kommunizieren.
Schröder: Genau. Und es geht einem gut, wenn das gelingt, und weniger gut, wenn es nicht gelingt.
DIE ZEIT: Werden wir konkret, Ihr Vertrauter Peter Hartz wirft schon das Handtuch und zeigt auf die Gewerkschaften, die jeglichen Versuch stoppen wollen, Arbeit wenigstens in Teilbereichen billiger zu machen. Wo bleibt die Reform des Arbeitsmarktes?
Schröder: Peter Hartz hat einen Punkt genannt, ihn zugleich aber überzeichnet. Es geht um die Erleichterung der Leih- und Zeitarbeit. Unser System sieht so aus, dass man jedenfalls den Versuch machen sollte, es tariflich zu regeln, wobei es natürlich Tarifverträge sein müssen, die unter dem liegen …
DIE ZEIT: … 30 Prozent etwa, sagt Hartz …
Schröder: … ich will keine Prozentsätze nennen. Sie müssen aber unter den normalen branchenüblichen Tarifverträgen liegen. Darüber müssen Personalserviceagenturen und Gewerkschaften sprechen, das wünsche ich mir.
DIE ZEIT: Wären Sie bereit, sich mit den Gewerkschaften anzulegen, um eine Tarifauflockerung zu erreichen?
Schröder: Ich glaube, dass man sich gar nicht anlegen muss.
DIE ZEIT: Nächstes Stichwort: Kündigungsschutz.
Schröder: Der Kündigungsschutz ist dadurch, dass es diese Personalserviceagenturen geben wird, kein so großes Problem mehr. Wichtige Kündigungsschutzbereiche werden durch diese Art der Leih- und Zeitarbeit faktisch außer Kraft gesetzt.
DIE ZEIT: Der Kommissionsvorsitzende Hartz sagt, auch an der Stelle werde das Konzept nicht „eins zu eins“ umgesetzt, es sei gescheitert an der Mutlosigkeit der politischen Eliten.
Schröder: Ich schätze Peter Hartz sehr. Er ist einer der intelligentesten und kreativsten Arbeitszeit- und Tarifpolitiker, die ich kenne, außerdem bin ich mit ihm befreundet – ich hoffe, das schadet ihm nicht, wenn ich das sage. Nur: Jemand, der aus einem Unternehmen kommt und gewohnt ist, dass das, was ein Vorstand anordnet, exekutiert wird, hat das eine oder andere Problem mit den sehr viel schwierigeren und gelegentlich auch langwierigen politischen Prozessen. Leider kann ich dem Bundestag und auch der Koalitionsmehrheit nicht sagen: Hiermit ordne ich an, dass …!
DIE ZEIT: Gibt es für den Bundeskanzler wirklich keinen größeren Hebel?
Schröder: Der einzige Hebel ist die Vertrauensfrage und eine Rücktrittsdrohung. Beide Instrumente eignen sich aber nicht für die gesellschaftliche und politische „Normallage“, in der wir nach meinem Urteil sind. Mit Machtworten verbindet sich doch ein Problem: Wenn Sie dazu greifen müssen, ist es häufig zu spät, und wenn Sie den Gebrauch inflationieren, erreichen Sie nicht das, was Sie wollen. Der demokratische Prozess ist etwas schwieriger. Das aber hat gute Gründe, die auch auf einer Machtbalance beruhen.
DIE ZEIT: Auf der einen Seite hat man einen Bundeskanzler, der sich durchaus als Machtmensch und als „Unternehmer“ versteht. Gleichzeitig sind die Schwerfälligkeiten in einem durch und durch und bis in den letzten Zipfel verwalteten Land inzwischen so groß, dass der normale Bürger merkt, es bewegt sich nichts mehr, die Hebel sind festgeschweißt.
Schröder: Der Befund ist in zwei Punkten, glaube ich, richtig: Sie müssen alles, was Sie tun, durch einen Bundesrat bringen, der eine anders geartete Mehrheit hat. Das ist ein Nachteil, es ist aber zugleich ein Stückchen Machtbalance, die in einem Staat auch nicht zu unterschätzen ist, was die heilsamen Wirkungen auf den Umgang mit Macht angeht. Das System muss effizienter werden. Aber ich reihe mich nicht ein bei denen, die nun zentralstaatliche Vorstellungen gegen den Föderalismus entfalten.
DIE ZEIT: Ein bisschen mehr Solidarität der Fraktion mit dem Kanzler aber könnte es vielleicht geben.
Schröder: Es hat in der Geschichte der SPD selten Situationen gegeben, in denen sich der Parteivorsitzende so wenig über einen Mangel an Solidarität – in Partei und Fraktion – persönlich wie sachlich beklagen kann. Aber noch einmal zum Zustand der Republik: Ich halte es für ein ernsthaftes, vielleicht sogar für das ernsthafteste Problem, dass sich die Menschen – und das ist nicht nur ein deutschen Phänomen – eingeengt fühlen durch ein Übermaß an Bürokratie und einer obrigkeitsstaatlichen Haltung, die es bei uns immer noch zu häufig gibt.
DIE ZEIT: Die Beamten führen Verordnungen aus und der Gesetzesausstoß des Parlaments ist weiterhin enorm.
Schröder: Ehrgeizig haben wir deshalb in die Koalitionsvereinbarung geschrieben, in dieser Legislaturperiode dafür sorgen zu wollen, dass dem nichts weiter hinzugefügt wird. Ganz im Gegenteil, wir möchten beispielsweise diese unzähligen Statistikvorschriften beseitigen, die den Mittelstand häufig wirklich zu viel Arbeit bereiten. Allerdings – eine Fülle der Richtlinien kommt inzwischen aus Europa.
DIE ZEIT: Als Reaktion auf den Nationalsozialismus ist in diesem Land Macht diffundiert und dezentralisiert. Das Motto scheint wahr geworden zu sein: „Keine Macht für niemand“. Wer sorgt in diesem System für das Gesamtinteresse?
Schröder: Das kann nur die Regierung sein und die Parlamentsmehrheit, die sie trägt. Das versuchen wir gerade, Stichwort Steuerpolitik und Arbeitsmarkt, aber die unterschiedlichsten Gruppen verteidigen sofort mit Zähnen und Klauen ihr jeweiliges partielles Interesse.
DIE ZEIT: Müssen Sie ihnen zuhören?
Schröder: Zuhören muss ich. Aber ich muss mir die Freiheit erkämpfen, gegen die Summe der Einzelinteressen das Gemeinwohl zu definieren. Was gegenwärtig als Vertrauensverlust beschrieben wird, hat zu tun mit der Tatsache, dass wir gesagt haben: Im Gesundheitssystem werden alle Interessengruppen rangenommen, bei der Haushaltssanierung verbreitern wir die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Wirtschaft und kürzen gleichzeitig Transferleistungen, etwa bei der Nürnberger Anstalt, im Arbeitsmarkt legen wir Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammen und verändern die Anrechnungsvorschriften für Lebenspartner und Eheleute. Das alles hat Folgen für die Betroffenen. Daher bekommen wir von allen Seiten Ärger. Das ist unschön, aber unumgänglich, damit müssen wir leben.
DIE ZEIT: Warum gelingt es nicht öfter, „Projektkoalitionen“ – auch ein Begriff von Peter Hartz – zu schmieden?
Schröder: Projektkoalitionen zu schmieden bedeutet immer, einer Gruppe mehr Recht zu geben als einer anderen.
DIE ZEIT: Ja!
Schröder: Nehmen wir die Leih- und Zeitarbeit. Wir haben gesagt, wir schaffen alle Restriktionen ab, die es gegenwärtig gibt, und sind damit den Leiharbeitsfirmen und natürlich auch der Wirtschaft entgegengekommen. Um die Menschen aber nicht rechtlos zu stellen, machen wir das mit dem Instrument der Tarifverträge, also sozial gesteuert. Es wäre eigentlich im Interesse beider Seiten gewesen, darauf einzugehen. Beide waren durchaus auch bereit dazu. Bis dann, angetrieben vom Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, die seriösen Leih- und Zeitarbeitsfirmen gesagt haben, sie könnten ihre Zustimmung unter dem Druck der Verbandsinteressen nicht aufrecht erhalten.
DIE ZEIT: Wahrscheinlich wird die Union bis zur nächsten Wahl im Parlament alles blockieren. Wir erleben einen permanenten Wahlkampf. Könnte man sich nicht ein System wie in Amerika vorstellen mit Wahlen am selben Tag alle zwei oder vier Jahre?
Schröder: Es machte Sinn, die Legislaturperiode wie in den meisten Ländern auf fünf Jahre zu verlängern. Es ist aber auch sehr überlegenswert, die Hälfte der Wahlen in der Mitte der Legislaturperiode und die andere Hälfte zusammen mit der Bundestagswahl abzuhalten.
DIE ZEIT: Den nächsten Schritt aber wollen Sie nicht gehen und eine wirkliche Föderalismusdebatte entfachen?
Schröder: Die haben die Länder doch schon begonnen und wir beteiligen uns lebhaft daran.
DIE ZEIT: Wir sollten nicht in Utopien verfallen. Das werden wir wohl nicht mehr erleben.
Schröder: Ich weiß nicht, wie Ihre Lebenserwartung ist. Meine ist groß. Das meine ich jetzt nicht politisch. Aber auch insoweit mehr, als man sich auf der anderen Seite erhofft.
DIE ZEIT: Wie gehen Sie eigentlich mit diesem in Deutschland doch relativ neuen Tonfall der Opposition um, mit dem an Sie adressierten Vorwurf der Lüge und des Betrugs?
Schröder: Ich glaube nicht, dass man bei vernünftigen Leuten mit solchem Klamauk auf Dauer eigene Qualität beweisen kann. Ich will aber sagen, woher das kommt. Es hat etwas mit dem Wahlkampf zu tun. Der war nach dem Urteil verständiger Beobachter sehr personalisiert und ist letztlich entschieden worden durch den Vergleich zwischen zwei Personen, zwischen Herrn Stoiber und mir. Und er ist zu unseren Gunsten entschieden worden. Deswegen ist es nun die Strategie der Union, so wie ich sie wahrnehme: Wir müssen dessen Integrität zerstören. Und darin ist sie völlig bedenkenlos. Übrigens gibt es da auch keinen Unterschied zwischen Frau Merkel und Herrn Stoiber.
DIE ZEIT: Selbst die Frankfurter Rundschau spricht von einem Tohuwabohu, einem Dilettantismus, der nicht zu toppen ist. Ähnliche kritische Worte finden Sie in der Süddeutschen Zeitung oder auch im Spiegel. Handelt es sich wirklich nur um den Versuch der Opposition, die verlorene Wahl doch noch zu gewinnen?
Schröder: Ich beobachte schon sehr viel Aggressivität. So hat sie Willy Brandt erlebt, Helmut Schmidt weniger. Eine absolut negative Begleiterscheinung ist, dass diese Art der Aggressivität in der Sprache sich auch auf Menschen auswirkt, die sich nicht wehren können, zum Beispiel die Familie. Und wenn sie sich wehren, weil sie es nicht aushalten, richtet sich dann die gleiche Aggressivität gegen sie. Da sollte man vielleicht doch einmal überlegen, ob das zu einer zivilisierten Auseinandersetzung passt. Ich selber handele nach dem Motto: Mich könnt ihr mit dieser Art von Kritik gar nicht erreichen. Die übrige Kritik, die Sie erwähnt haben, nehme ich sehr genau wahr. Und bei der weiß ich auch sehr genau zu unterscheiden, was wirklich berechtigt ist. Und da war eine ganze Menge berechtigt.
DIE ZEIT: Was ist berechtigt?
Schröder: Die Kritik zum Beispiel, dass der Entscheidungsfindungsprozess nicht in Ordnung war. Wir hatten lange genug Zeit, uns auf die Neuauflage der Koalitionsverhandlungen vorzubereiten. Und wenn dann steuerliche Vorschläge auf den Tisch kommen, deren wirtschaftliche Konsequenzen nicht hinreichend abgeklopft sind, jedenfalls nicht im ersten Durchgang, kann man das besser machen.
DIE ZEIT: Einer der Hauptvorwürfe lautet, Sie hätten sich im Vorfeld der Wahl nicht ehrlich genug über die wahre ökonomische Lage geäußert.
Schröder: Es wäre wirklich reizvoll, in einer großen Zeitung einmal analysieren zu lassen, wie denn die fast wöchentlich abgegebenen Prognosen der großen Forschungsinstitute und der internationalen Institutionen zur wirtschaftlichen Entwicklung seit Beginn diesen Jahres ausfielen. Sie sind von Quartal zu Quartal korrigiert worden. In der gesamten Debatte, von Beginn des Jahres an, ist immer wieder deutlich gemacht worden: Ihr könnt mit einem sich verstärkenden Wachstum in der zweiten Hälfte diesen Jahres mit absoluter Sicherheit rechnen. Kein einziges Institut hat das relativiert. Daraufhin sind bestimmte Wachstumsraten angenommen und bestimmte Annahmen im Haushalt gemacht worden. Die mögen sich im Nachhinein als überzogen darstellen. Sie waren aber das Ergebnis dieser Prognosen. Und natürlich stützt sich auch die Bundesregierung in der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung auf Prognosen von solchen Institutionen. Der Vorwurf, der jetzt gemacht wird, wir wären damit zu euphorisch umgegangen, ist falsch.
DIE ZEIT: Befürchten Sie, dass man sich in der jetzigen Stimmung in eine deflationäre Entwicklung hineinredet?
Schröder: Der Finanzminister und erst recht der Wirtschaftsminister stehen bei der Bewertung solcher Prognosen immer vor demselben Problem: Korrigieren sie sie zu weit nach unten, beflügeln sie eine negative Entwicklung, man kann sich auch in eine Deflation hineinreden. Korrigieren sie sie zu weit nach oben, hält man ihnen vor, zu blauäugig gewesen zu sein. Im Übrigen waren wir, auch das lässt sich beweisen, bei den Wachstumsannahmen immer eher im unteren Mittelfeld der verfügbaren Prognosen und deshalb nach unserer Einschätzung auf der sicheren Seite. Was die Opposition angeht, ist allerdings der Hinweis berechtigt, dass es in den Ländern Finanzminister gibt, die direkter als der Bundesfinanzminister über Daten verfügen, weil die über ihre Behörden die Steuereingänge unmittelbar mitbekommen. Deshalb ist es Humbug zu sagen, wir hätten hier etwas verschwiegen.
DIE ZEIT: Demnächst kommt aus Brüssel der „Blaue Brief“. Mit Stabilitätspakt und Euro haben die Regierungen die beiden wichtigsten makroökonomischen Steuerungsinstrumente aus der Hand gegeben. Was bleibt einer Regierung da noch anderes übrig, als sich einem Gesetz zu unterwerfen, das wir selbst den Europäern aufgezwungen haben?
Schröder: Der Stabilitätspakt bietet, wenn man ihn vernünftig interpretiert, eine Reihe von Flexibilitäten, die man nicht unterschätzen sollte. Wir sagen, wir wollen in einer konjunkturell schwierigen Lage, in der wir davon ausgehen müssen, das Defizitkriterium zu überschreiten, dies auch bewusst machen, weil die Alternative weitere harte Einschnitte hieße. Angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit ginge das im Jahr 2002 nur bei den Investitionen, was aber konjunkturpolitisch kontraproduktiv wäre. Deshalb verschulden wir uns. In dem Moment, in dem man nachweisen kann, dass man das in absehbarer Zeit wieder in Ordnung bringt, gibt es zwar eine Intervention aus Brüssel, aber keine Strafe. Dieser Dialog ist an sich ganz vernünftig, wenn man ihn nicht denunziatorisch führt. Aber Ihre Frage führt ja weiter. Es gibt eine interessante Debatte, was den Stabilitätspakt angeht: Ob es angemessen ist, als einziges Kriterium die Defizitgrenze zu nehmen. Man könnte sich doch auch einmal fragen: Spielt die absolute Verschuldung, spielen Inflationsraten und spielt Arbeitslosigkeit nicht eine Rolle bei der Bewertung dessen, was ökonomisch vernünftig ist und was nicht? Ich glaube, dies und nicht die Aufweichung oder gar die Eliminierung des Paktes ist die richtige Diskussion, wenn es um die mittelfristige Zukunft geht.
DIE ZEIT: Sie wollen das Korsett lockern?
Schröder: Ich möchte das Korsett flexibler machen, so dass man darin atmen kann. Wir wollen nicht weg vom Stabilitätspakt. Mir geht es um die Frage: Gibt es eigentlich als Inhalt dieses Paktes und damit als Inhalt von Wirtschaftspolitik in Europa nur das eine Kriterium oder müssen wir nicht dafür sorgen, dass diese anderen Kriterien – also Staatsverschuldung insgesamt, Inflationsrate und Höhe der Arbeitslosigkeit – in die Bewertung von Wirtschaftspolitik in den Nationalstaaten, wie sie die Kommission vornimmt, mit einfließen? Ob man dazu eine formale Änderung des Paktes braucht, wage ich zu bezweifeln. Wichtig wäre mir aber, dass man sich auf eine solche Interpretation einlässt.
DIE ZEIT: Zur Außenpolitik: Ist in Prag das Eis zwischen Deutschland und Amerika gebrochen?
Schröder: Wenn es eines gegeben hätte in dem Maße, wie behauptet, dann sicher. Ich finde aber, dass man in Prag ein bisschen viel Aufmerksamkeit verwandt hat auf die Frage, wer in welcher Form wem die Hand gibt. Sowohl auf amerikanischer als auch auf unserer Seite stand immer die Frage im Vordergrund: Was bedeuten wir füreinander bei der Lösung der zentralen politischen Fragen, die sich die internationale Staatengemeinschaft und die Nato stellen? Und da war doch von Anfang an viel mehr an Gemeinsamkeit, als berichtet worden ist. Ich habe in Prag sehr deutlich gesagt, dass für mich der Kampf gegen den internationalen Terrorismus nach wie vor Vorrang hat. Die Taliban sind nicht besiegt, Bin Laden lebt vermutlich, es gibt latente Bedrohungen. Deshalb konzentrieren wir unsere Kräfte auf die Bekämpfung solcher realen Gefahren. Das ist in Amerika verstanden worden.
DIE ZEIT: Was sagt das militärische Establishment Europas und auch Amerikas dazu?
Schröder: Ich kann Ihnen das nicht sagen, aber wir machen das Gegenteil von Uns-heraushalten. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller in der international legitimierten Bekämpfung des Terrorismus, und das werden wir auch bleiben. Für mich hat das, was in Afghanistan geschieht oder nicht geschieht, auch etwas mit Legitimation unserer Politik zu tun, und zwar nach innen wie nach außen. Gleichzeitig lassen wir es dabei nicht bewenden, sondern beteiligen uns am Wiederaufbau Afghanistans. Das hat den Grund, den Völkern der Dritten Welt deutlich zu machen, dass es eine Dividende gibt für die Rückkehr in die zivilisierte Welt. Um diese Dividende müssen wir kämpfen, sonst gewinnen wir, wenn ich das so pathetisch sagen darf, keinen Frieden und verlieren die Seelen.
DIE ZEIT: Der Knackpunkt mit Amerika aber war – und könnte wieder sein – der Irak. Was ist die Theorie hinter der deutschen Verweigerung, auch nicht bei einem ganz klaren UN-Mandat mitzumachen, was ist die Philosophie?
Schröder: Über einen Grund habe ich eben gesprochen, das ist der Schwerpunkt „Antiterrorismus“. Der andere Grund ist, dass Deutschland seine Kräfte auch aus legitimatorischen Gründen auf diese Auseinandersetzung konzentriert. Und das machen wir mit großem Erfolg. Wir bauen darauf, dass man regionale Konflikte weniger konfrontativ als kooperativ lösen kann. Das ist vielleicht auch die Erfahrung, die man im Nahen Osten insgesamt machen kann.
DIE ZEIT: Warum haben Sie sich nicht mit Chirac zusammengeschlossen, der doch mit seinem UN-Vorstoß einen sehr geschickten Schachzug gemacht hat?
Schröder: Die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich waren nicht groß. Als Chirac in Hannover war, ist deutlich geworden, dass man in der prinzipiellen Bewertung einer Meinung ist, aber natürlich als ständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrates andere Operationsmöglichkeiten braucht als eines, das nicht Mitglied des Sicherheitsrates ist.
DIE ZEIT: Tatsache ist, dass die Franzosen, wenn es zum Krieg kommt, mitmachen werden. Tatsache ist, dass wir unter keinen Umständen. Deshalb noch einmal: Ist das ein grundsätzliches oder ist es ein praktisches Nein, weil wir nicht die Mittel haben, um an einem solchen Krieg teilzunehmen?
Schröder: Was Frankreich tun wird, bleibt abzuwarten. Ich meine, das grundsätzliche Nein zu militärischen Interventionen haben wir längst überwunden. Sie wissen, dass ich die deutsche Teilnahme an „Enduring Freedom“ mit Hilfe der Vertrauensfrage durchgesetzt habe. In Sachen Irak halten wir allerdings die andere Prioritätensetzung für falsch und deshalb werden wir uns militärisch nicht beteiligen.
DIE ZEIT: Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie mit Ihrer Position an einen latent vorhandenen Anti-Amerikanismus appellieren, ja ihn vielleicht sogar verkörpern?
Schröder: Das geht völlig an der Sache vorbei. Erstens gibt es diesen Antiamerikanismus nicht. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie stark sich manchmal auch gegenüber der eigenen Kultur, der amerikanische way of life durchgesetzt hat, nicht zuletzt in der Jugend, dann ist es völlig abwegig, von Antiamerikanismus zu reden. Zweitens wäre ich der Verkehrteste, dem man unterstellen könnte, die Speerspitze eines solchen Antiamerikanismus zu bilden. Es ist mir ganz fremd. Ich könnte das nicht, obwohl ich in einer Phase politisch sozialisiert worden bin, in der ein bisschen en vogue war – und wo es, was die Außenpolitik angeht, auch Gründe dafür gab; denken Sie an Vietnam. Selbst da stand ich dem relativ fern. Meine erste studentische Aktion, die ich in Göttingen mitgemacht habe, war der Fackelmarsch aus Anlass der Ermordung von Kennedy.
DIE ZEIT: Sie haben den Amerikanern einiges angeboten: Überflugrechte, Nutzung der Basen, vielleicht sogar Geleitschutz durch die Bundesmarine. Das ist der Preis, den Sie bezahlen. Hätte Sie ihn nicht dadurch vermeiden können, dass Sie im Wahlkampf eine andere Sprache gesprochen hätte?
Schröder: Nein, das ist kein Preis, der bezahlt worden ist, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Es gibt ein Truppenstatut, es gibt einen Stationierungsvertrag. Und selbst wenn es dort Interventionsmöglichkeiten der Art, wie ins Auge gefasst, gäbe, würde ich sie nicht nutzen. Denn selbst wenn ich eine andere Priorität für falsch halte, kann ich schlecht hergehen und den Freunden sagen: „Aber ihr dürft eure eigenen Basen in Deutschland nicht benutzen, ihr kriegt von mir keine Überflugrechte, und ich schränke euch die Bewegungsfreiheit der eigenen Truppen in Deutschland und von Deutschland aus ein.“ Ich will im Übrigen daran erinnern, dass ich zu keinem Zeitpunkt, auch im Wahlkampf nicht, gesagt habe: „Es gibt keine Überflugrechte.“ Das war jemand anderes, wenn ich mich richtig erinnere.
DIE ZEIT: Werden wir Geleitschutz fahren?
Schröder: Im Rahmen von „Enduring Freedom“ engagieren wir uns, darüber hinaus nicht. Wenn es allgemeine Bitten gibt, die nicht konkretisiert sind, wird man im Zuge der Gespräche herausfinden müssen, was darüber hinaus gewünscht ist. Das wird bewertet werden auf der glasklaren Position, die wir in Prag eingenommen haben und davor eingenommen haben: Es gibt keine militärische Beteiligung Deutschlands an einem Krieg im Irak. Im Übrigen hoffe ich, dass die Iraki die Resolution vollständig erfüllen und der Krieg vermeidbar ist.
DIE ZEIT: Involviert werden wir, mindestens indirekt, so oder so: Jetzt meldet sich Israel mit der Bitte, Abwehrraketen vom Typ „Patriot“ zur Verfügung zu stellen. Wie stehen Sie dazu?
Schröder: Das System „Patriot“ ist rein defensiv. Es bietet Schutz gegen Raketenangriffe. Die Sicherheit des Staats Israel und seiner Bürger ist uns überragend wichtig. Wenn die israelische Regierung diesen Zuwachs an Sicherheit braucht, werden wir helfen – und zwar rechtzeitig. Das gebietet unsere historische und moralische Pflicht.
DIE ZEIT: Das Bild, das sich bietet, ist, dass die drei Hauptmächte in Europa – England, Frankreich, Deutschland – in dieser Frage in ziemlich verschiedene Richtung streben. Was wird aus der gemeinsamen Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, wenn die drei ihre eigenen Wege gehen? Die ESVP war nie gedacht als Interventionstruppe irgendwo in der Welt, sondern dazu, im Rahmen der Nato europäische Konflikte zu lösen, etwa die auf dem Balkan und denkbare andere. Unter dem Aspekt halte ich das auch für vernünftig. Was jetzt über Europa hinaus diskutiert wird, ist die Nato-Eingreiftruppe. Da muss man schauen, ob man das mit der ESVP-Eingreiftruppe kompatibel machen kann oder nicht. Ich glaube, das geht. Der Vorteil der Nato-Eingreiftruppe ist, dass in der Nato über deren Einsatz nicht einseitig entschieden werden kann. Es wird genau umgekehrt ein Schuh daraus. Wichtig scheint mir zu sein, dass man, was Europa angeht, möglichst mehr an Gemeinsamkeiten entwickelt. Natürlich wird es immer mal wieder Situationen geben, wo das aufgrund ganz spezifischer Beziehungen wie etwa zwischen Amerika und Großbritannien nicht möglich ist. Was wir hier versuchen, ist ein Verzicht auf nationale Souveränität in der vielleicht für die Nationalstaaten empfindsamsten Frage, die es gibt, nämlich in der Frage der Verfügung über Außenpolitik … zeit:… Krieg oder Frieden …
Schröder: … letztlich, wenn man so will, über Militär und damit über Krieg und Frieden. Und das kann nicht auf einmal gelöst werden. Wir haben begonnen, die Strukturen aufzubauen. Darum geht es jetzt auch im Konvent. Europas Werden ist immer ein Prozess gewesen, in dem es auch bisweilen Rückschläge gegeben hat.
DIE ZEIT: Sie haben als Erster vorgeschlagen, „ein Datum für ein Datum“ der Verhandlungsaufnahme zum EU-Beitritt der Türkei zu nennen. Die Union kündigt inzwischen einen Wahlkampf darüber an. Davon ganz abgesehen – würde es Europa nicht überstrapazieren, wenn es um die Türkei erweitert wird?
Schröder: In dieser Frage ist die Union europaweit und darüber hinaus isoliert. Mir geht es aber um die Frage: Was müssen wir wollen im eigenen nationalen Interesse und im Interesse Europas? Bezogen auf die Türkei, bin ich jedenfalls nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir letztlich vor der Frage stehen: Schaffen wir es, eine säkularisierte Türkei mit festen Bindungen an den Westen – das heißt Europa – aufrechtzuerhalten oder begeben wir uns in die Gefahr – ich will nicht dramatisieren –, dass die Türkei in den islamischen Fundamentalismus abrutscht? Das nationale wie das europäische Interesse gebieten, das zu verhindern.
DIE ZEIT: Und wie?
Schröder: Ich bin dafür, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, im Dezember beim EU-Gipfel in Kopenhagen über die Brüsseler Beschlüsse hinauszugehen. Mit dem Vorsitzenden der neuen türkischen Mehrheitspartei habe ich gesprochen. Das war, was eine säkularisierte Türkei angeht, an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen. Er hat mir gesagt, er verstünde gar nicht, wie man eine Religion in den Namen einer Partei schreiben könne. Ich habe ihm erwidert, ich verstehe das schon. Natürlich beteuert die neue türkische Regierung, sie würden den Weg der Reformen weitergehen. Ich möchte die Türkei gerne an Taten messen und sehen, ob sie dann eine Dauervereinbarung zwischen EU und Nato zu Stande kommen lässt, damit zum Beispiel Europa in Mazedonien Lead-Nation werden kann. Diese Dauervereinbarung braucht man, weil wir die Nato-Strukturen brauchen. Die Türkei hat das immer verhindert. Zweitens würden wir gerne wissen, was die Türken von den Vorschlägen Annans zum Zypern-Konflikt halten. Je nachdem, wie sie sich verhalten, ist Deutschland durchaus bereit, in Kopenhagen ein Signal über Brüssel hinaus zu geben, also etwa eine „Rendezvous-Klausel“ zu vereinbaren.
Das Gespräch führten Gunter Hofmann, Josef Joffe und Michael Naumann
Gespräch mit Gerhard Schröder:
Notfalls auch mit Zwang
DIE ZEIT: Herr Bundeskanzler, wann treten Sie zurück?
Gerhard Schröder: Warum sollte ich? Diese Mehrheit und diese Regierung gibt es für vier Jahre – und den diese Regierung führenden deutschen Bundeskanzler auch. Die Alternativen waren völlig klar: Schwarz-Gelb auf der einen, Rot-Grün auf der anderen Seite. Wir haben vor der Bundestagswahl niemanden im Zweifel darüber gelassen, dass wir Rot-Grün wollen. Wir haben eine Mehrheit für Rot-Grün bekommen, vielleicht anders als 1998.
DIE ZEIT: Auch wenn Regieren nicht zum Vergnügen da ist, man hat, ähnlich wie beim schwierigen Start vor vier Jahren, nicht den Eindruck, dass es zurzeit die fröhlichsten Monate Ihres Lebens sind.
Schröder: Richtig ist, dass Regieren selten mit Freude zu tun hat, meistens mit Pflicht. Aber Pflichten kann man auch gern ausüben. Es ist aber auch keine Frage, dass ein Wahlkampf, der so auf eine Person zugeschnitten war, mit all den Hoffnungen und Erwartungen, die daran hingen, unendlich viel Kraft kostete.
DIE ZEIT: Sie hätten nach dem 22. September eine Woche Urlaub machen können.
Schröder: Das ging nicht. Ich hatte unmittelbar nach dem Wahlkampf Koalitionsverhandlungen zu führen. Ich musste für ein Personaltableau sorgen, das nicht ganz einfach war. Es gab berechtigte Erwartungen im Osten unseres Landes, wo wichtige Teile des Wahlerfolges errungen waren. Strukturfragen in der Regierung waren zu lösen, etwa die Zusammenlegung des Ministeriums von Wirtschaft und Arbeit, und dafür mussten wir die geeignetste Persönlichkeit finden. Und wenn das der Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes ist, braucht das schon einiges an …
DIE ZEIT: ... Zeit ...?
Schröder: ... vor allen Dingen an Überzeugungskraft. Hinzu kam dann, dass bei den Koalitionsverhandlungen eine Art Sucht vorherrschte, jedes Detail von Verhandlungen öffentlich werden zu lassen. Wenn dann nach der Detailkritik etwas korrigiert werden muss, entsteht der Eindruck, der entstanden ist.
DIE ZEIT: Es ist ein Eindruck einer chaotischen, unkoordinierten Regierung entstanden, der es bei allen Beteiligten vor allem an einem mangelt: der Furcht vor dem Herrn.
Schröder: Ich habe nie den Anspruch gehabt, Furcht zu verbreiten. Respekt reicht mir. Meine Vorstellungen werden zunehmend deutlicher werden. Mir geht es um drei Leitlinien. Erstens: Eine Außenpolitik, die der Souveränität des Landes gerecht wird, die bündnisfähig ist und bleibt, die aber gleichzeitig die Kraft und den Mut zur Differenzierung entwickelt. Zweitens: Eine Wirtschaftspolitik, die Dynamik in der Wirtschaft verbindet mit sozialer Sensibilität in der Gesellschaft, um der Wirtschaft auch soziale Grenzen zu setzen. Drittens: Es geht darum, eine aufgeklärte, tolerante Gesellschaft zu bewahren, ohne dass der Respekt vor den staatlichen Institutionen und die Behauptung des Gewaltmonopols in irgendeiner Form in Zweifel gezogen werden. Für diese Grundpositionen mussten wir materielle Voraussetzungen schaffen. Wer fair ist, wird feststellen, dass wir in diesem Sinne auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
DIE ZEIT: Die Union hat sich im Wahlkampf sozialdemokratisch geriert, zu einer wirklich inhaltlichen Auseinandersetzung ist es nicht gekommen. Könnte das der Grund sein, dass jetzt auch Parteifreunde von Ihnen die klaren Linien vermissen oder die Opposition Ihnen vorhält, Sie seien unehrlich gewesen?
Schröder: Das ist falsch. Richtig ist nur, dass es ein bisher nie gekanntes Maß an sozialer Demagogie auf der Seite der Union gegeben hat. Mit der Unternehmenssteuerreform haben wir – im Ausland sehr beachtet – dafür gesorgt, dass die Veräußerungsgewinne aus Beteiligungsverkäufen steuerfrei realisiert werden können. Das sollte die Deutschland-AG auflockern. Sie wissen wie ich, mit welcher hemmungslosen Demagogie die Union dagegen zu Felde gezogen ist – übrigens ohne dass die ihr zugeneigten Verbände entschieden widersprochen hätten.
DIE ZEIT: Es scheint Sie auch persönlich verletzt zu haben, so dass ein Teil Ihrer jetzigen Wirtschaftspolitik wie eine persönliche Reaktion auf diese Enttäuschung wirkt.
Schröder: Das ist falsch. Aber noch einmal zum Beispiel der Körperschaftsteuer: Wir wussten, dass die Veränderung im System, die wir gemacht haben, für eine Übergangszeit zu einem niedrigeren Körperschaftssteueraufkommen führen würde, kompensiert durch das Aufkommen aus der Kapitalertragssteuer. Auch dagegen ist polemisiert worden. Und damit sind gleichfalls Fakten geschaffen worden, über die man in der öffentlichen Debatte schwer hinwegkommen kann. Insofern stimmt es schon, dass der Wahlkampf – nicht von uns verursacht –, äußerst unsachlich ausgetragen worden ist. Und das hat es nicht erleichtert, deutlich zu machen, was nötig ist.
DIE ZEIT: In der internationalen Presse ist häufig von der „deutschen Krankheit“ die Rede. Deutschland sei ökonomisch das Schlusslicht in Europa. Wie sehen Sie das?
Schröder: Das Deutschland-Bild, das in der ausländischen Presse – ob bewusst oder unbewusst – häufig gezeichnet wird, ist falsch. Auch von der Brüsseler Kommission und von vielen Beobachtern wird übersehen, dass kein Land Europas und auch kein Land der Welt ökonomisch die Einheit zu verkraften hatte. Nur zwei Daten dazu: Wir verlieren jährlich real 0,6 Prozent Wachstumspunkte durch den Abbau der Kapazitäten in der Bauwirtschaft, vor allen Dingen im Osten, die im Einigungsboom aufgebaut worden sind. Und wir hätten bei den Rentenversicherungsbeiträgen – die unter Kohl übrigens schon einmal bei 20,3 Prozent waren – einen Beitragssatz von etwas über 17 Prozent, und nicht von 19,5 Prozent, wenn darin nicht so viele Lasten steckten.
DIE ZEIT: Das ganze Benchmarking ist also irreführend?
Schröder: Ja, natürlich, weil ein großer Teil der Beobachter diese Tatbestände nicht kennt oder nicht kennen will, da es auch um eine Konkurrenz von Volkswirtschaften geht. Wer mich glauben machen will, dass die Berichterstattung über Deutschland in der angelsächsischen Presse nur von dem Willen getragen wäre, uns die richtigen Ratschläge zu geben, der irrt. In diesen Medien werden nationale Befindlichkeiten eher berücksichtigt als bei uns. Das kann Vorteil oder Nachteil sein. Hinzu kommt: Wir führen auch eine Auseinandersetzung um ein Gesellschaftsmodell, man kann auch sagen, um ein Sozialmodell. Und wenn Sie sich ansehen, wie diese Kontroverse in der anglo-amerikanischen Presse wiedergegeben wird, dann erkennen Sie auch den Versuch, das angelsächsische oder das amerikanische Gesellschafts- und Sozialmodell auf Deutschland zu übertragen. Und das funktioniert nicht.
DIE ZEIT: Das ist zu ideologiekritisch.
Schröder: Immer wenn es ernsthaft wird, vermuten Sie Ideologie. Das ist nicht Ideologie, das ist die blanke Wahrheit.
DIE ZEIT: Niemand wünscht sich doch sehnlicher, dass die Deutschen wieder nach vorne kommen, als unsere Nachbarn, denn wir ziehen Europa, weil wir ein Drittel des gesamteuropäischen Sozialprodukts ausmachen. Die wollen einfach Wachstum sehen.
Schröder: Was heißt, die wollen Wachstum? Warum wächst die amerikanische Wirtschaft deutlich schneller als unsere? Das hängt zusammen mit der Einwanderung und mit den Bedingungen, unter denen zum Beispiel die jeweils erste Einwanderergeneration zum Wachstum beiträgt. Ich bin sehr für Wachstum und wir arbeiten an der Beseitigung von Wachstumshemmnissen. Wir müssen aber auch klar machen, in welcher Weise Wachstum in Gesellschaften wie unserer erreichbar ist, ohne die soziale Qualität unserer Gesellschaft aufzugeben. Das wird auch die zentrale Auseinandersetzung der nächsten Zeit werden.
DIE ZEIT: Was Sie eben umrissen haben, könnte der Kern der von vielen ersehnten, von Ihnen aber bisher nicht gelieferten „Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede“ sein.
Schröder: Es geht nicht um Blut, Schweiß oder Tränen, sondern um die Beschreibung dessen, was ist und was sein soll.
DIE ZEIT: Die Rede kommt?
Schröder: Dem dient doch dieses Interview. Bezogen auf das, was wir an Reformvorhaben vor uns haben, heißt das zum Beispiel, dass wir natürlich im Arbeitsmarkt etwas verändern müssen und werden. Wir werden bei den Leistungen und Transferleistungen Einschnitte machen. Wenn Sie allein in diesem Bereich in Nürnberg fast sieben Milliarden Euro kürzen, wie wir es getan haben, bedeutet das empfindliche Einbußen für diejenigen, die es angeht. Man muss sich vorstellen, was das für jemanden bedeutet, der von wesentlich weniger im Monat leben muss, als wir hier alle am Tisch in der Woche. Wir werden in der Gesundheitspolitik auf der einen Seite dafür sorgen müssen, dass Transparenz und Wettbewerb in das System kommen, wir werden uns auf der anderen Seite aber natürlich unterhalten müssen, was gebraucht wird, und zwar für alle, um das medizinisch Notwendige zu leisten. Dazu müssen wir uns mit allen Interessengruppen anlegen. Und wir werden natürlich auch nicht medizinisch notwendige Ansprüche von Patienten zurücknehmen. Drittens müssen wir in die Qualität unseres Bildungssystems, vor allem in die Kinderbetreuung, massiv investieren. Das alles bedeutet, dass wir Zöpfe, die es gibt, auch abschneiden müssen. Die Frage ist nur: Wie macht man das? Und zu wessen Lasten? Will man es so machen, dass die Qualität dieser Gesellschaft unter veränderten Bedingungen aufrechterhalten wird? Und die Qualität dieser Gesellschaft ist gekennzeichnet dadurch, dass Lasten einigermaßen gerecht verteilt werden. Mehr sage ich ja gar nicht. Die zentrale Frage heißt: Mit welchen Maßnahmen lässt sich unter den Bedingungen globalisierter Wirtschaft Sozialstaatlichkeit aufrechterhalten?
DIE ZEIT: Das heißt, es geht in unserer wohlhabenden Gesellschaft um Grundsicherungen für jeden?
Schröder: Nicht nur. Es geht darum, dass Partizipation im Politischen, aber auch im Ökonomischen möglich bleibt. Und jetzt sage ich etwas Ketzerisches: Man wird klar machen müssen, dass der berühmte Satz Lampedusas im „Gattopardo“, wonach sich alles ändern muss, damit es bleiben kann, wie es ist, eigentlich die Leitlinie von Politik werden muss. All diejenigen, die sich vor Veränderung fürchten, weil ihre soziale Rolle, auf welchem Level auch immer, beeinträchtigt wird, werden sich fragen müssen – und wir müssen ihnen diese Fragen aufzwingen –: Verlieren wir unsere soziale Rolle nicht gerade dadurch, dass sich nichts verändert?
DIE ZEIT: Als dieser Veränderer werden Sie im Moment aber gerade nicht wahrgenommen.
Schröder: Dann ist es meine Arbeit, dafür zu sorgen, dass das wieder so ist. Und das wird auch so sein. Ich will keine „Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede“ halten, weil ich von diesen Begriffen überhaupt nichts halte. Diese ganzen Übertreibungen, auch diese Vergleiche mit Weimar, von angeblich bedeutenden Historikern, die es bei Licht betrachtet nicht sind, diese Verzerrungen habe ich wegzuwischen, und dahinter muss eine realistische Beschreibung des Zustandes unseres Landes stehen.
DIE ZEIT: Vielleicht könnte man es auch auf zwei andere Begriffe zuspitzen: Sie müssen letztlich ein Austeritätskanzler sein, aber es fällt Ihnen schwer, so etwas auszusprechen. Und Sie müssen den Leuten sagen, dass wir an Grenzen gestoßen sind, und auch das fällt sehr schwer.
Schröder: Austerity ist auch wieder so ein Begriff, der historisch entlehnt ist, und wenn man so etwas verwendet, geht es immer schief. Es geht um eine realistische Beschreibung. Es geht darum, auch zu sagen, dass, was Sozialstaatlichkeit angeht, nichts, aber auch gar nichts mehr draufgesattelt werden kann. Im Gegenteil, wenn man den Sozialstaat in der Substanz erhalten will, unter völlig veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen, muss es auch ein Zurücknehmen der Ansprüche geben. Und wenn das nicht freiwillig geschieht, muss die Regierung das erzwingen.
DIE ZEIT: Es kommt einem manchmal so vor, als würden wir in zwei Realitäten leben. Die eine Realität ist: Mehr oder weniger das ganze Volk hat erkannt, was geschehen muss. Und die andere Realität ist, dass gesagt wird: Aber bitte beim anderen. Zur Gruppen- und Verbandsrealität gehört es, wenn die Krankenkassen um Millionensummen betrogen oder wenn 16 Prozent des Bruttosozialprodukts auf dem grauen oder schwarzen Markt erwirtschaftet werden. Da fragt man sich schon, wann endlich eine Rede, vielleicht sogar eine Predigt kommt: Macht euch ehrlich über euch selbst!
Schröder: Ich will es dabei bewenden lassen, was ich über Realismus und Realitätssinn gesagt habe. Diese „Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden“ werden ja meistens von denen gefordert, die sie selber nicht halten mögen. Aber was die Verbände angeht – wenn ich sage, ein unverbindliches Gespräch reicht mir nicht, wird mir entgegengehalten, ich sei gar nicht mehr gesprächsbereit. Im "Bündnis für Arbeit" habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gewerkschaften auf der einen Seite und Arbeitgeber auf der anderen diesen Gesprächskreis und auch die Regierung dann und nur dann in Ordnung fanden, wenn sie sie jeweils für ihre Eigeninteressen instrumentalisieren konnten. Das ist dann aber kein Dialog mehr. Wie demokratisiert man also den Prozess? Ich will die Verbände nicht abschaffen. In Fragen der Steuerpolitik zum Beispiel, wo wir die Dinge nach langen Auseinandersetzungen, das gebe ich zu, eigentlich ganz vernünftig gemacht haben, müssen sich die großen, die mächtigen Mitglieder angewöhnen, ihren Verbandsoberen auch mal zu sagen: Lasst das Taktieren sein, was hier gemacht wird, ist schon in Ordnung.
DIE ZEIT: Zu den Verbänden gehören auch die Gewerkschaften. Der Beamtenbund und ver.di fordern Lohnabschlüsse, die weit über das hinausgehen, was die in die Pleite gehenden Länder und Städte und der Bund zahlen können.
Schröder: Ich kann und will mich nicht in die Tarifverhandlungen einmischen. Wenn es dort einen Abschluss geben soll, der schnell ist, dann wird das nur einer sein können, der haushaltsverträglich ist. Und das liegt sicher weit unter dem, was die Gewerkschaften sich vorstellen.
DIE ZEIT: Und was ist, wenn ver.di den Müll nicht mehr wegfährt und die Straßen blockiert?
Schröder: Jeder Vorsitzende einer Gewerkschaft wird, wenn er sich zum Streik entscheidet, auch überlegen müssen: Wie ist denn eigentlich die Bewertung meiner Gewerkschaft in der Öffentlichkeit?
DIE ZEIT: Die Deutschen haben sich oft als ein durchaus patriotisches Land erwiesen. Nur bei den Auseinandersetzungen zwischen den Verbänden, aber auch zwischen den verschiedenen Parteien scheint genau dieses Element des Patriotismus zu fehlen.
Schröder: Ich denke, dass diese patriotische Gesinnung – und das ist ja auch etwas Schönes – immer dann deutlich wird, wenn sie nicht organisiert ist. Wenn man versucht, Patriotismus über Verbände zu organisieren, geht es schief. Wenn man aber das Volk emotional auf eine Situation reagieren lässt, kommt etwas Gutes dabei heraus.
DIE ZEIT: Also muss der Kanzler mit dem Volk direkt kommunizieren.
Schröder: Genau. Und es geht einem gut, wenn das gelingt, und weniger gut, wenn es nicht gelingt.
DIE ZEIT: Werden wir konkret, Ihr Vertrauter Peter Hartz wirft schon das Handtuch und zeigt auf die Gewerkschaften, die jeglichen Versuch stoppen wollen, Arbeit wenigstens in Teilbereichen billiger zu machen. Wo bleibt die Reform des Arbeitsmarktes?
Schröder: Peter Hartz hat einen Punkt genannt, ihn zugleich aber überzeichnet. Es geht um die Erleichterung der Leih- und Zeitarbeit. Unser System sieht so aus, dass man jedenfalls den Versuch machen sollte, es tariflich zu regeln, wobei es natürlich Tarifverträge sein müssen, die unter dem liegen …
DIE ZEIT: … 30 Prozent etwa, sagt Hartz …
Schröder: … ich will keine Prozentsätze nennen. Sie müssen aber unter den normalen branchenüblichen Tarifverträgen liegen. Darüber müssen Personalserviceagenturen und Gewerkschaften sprechen, das wünsche ich mir.
DIE ZEIT: Wären Sie bereit, sich mit den Gewerkschaften anzulegen, um eine Tarifauflockerung zu erreichen?
Schröder: Ich glaube, dass man sich gar nicht anlegen muss.
DIE ZEIT: Nächstes Stichwort: Kündigungsschutz.
Schröder: Der Kündigungsschutz ist dadurch, dass es diese Personalserviceagenturen geben wird, kein so großes Problem mehr. Wichtige Kündigungsschutzbereiche werden durch diese Art der Leih- und Zeitarbeit faktisch außer Kraft gesetzt.
DIE ZEIT: Der Kommissionsvorsitzende Hartz sagt, auch an der Stelle werde das Konzept nicht „eins zu eins“ umgesetzt, es sei gescheitert an der Mutlosigkeit der politischen Eliten.
Schröder: Ich schätze Peter Hartz sehr. Er ist einer der intelligentesten und kreativsten Arbeitszeit- und Tarifpolitiker, die ich kenne, außerdem bin ich mit ihm befreundet – ich hoffe, das schadet ihm nicht, wenn ich das sage. Nur: Jemand, der aus einem Unternehmen kommt und gewohnt ist, dass das, was ein Vorstand anordnet, exekutiert wird, hat das eine oder andere Problem mit den sehr viel schwierigeren und gelegentlich auch langwierigen politischen Prozessen. Leider kann ich dem Bundestag und auch der Koalitionsmehrheit nicht sagen: Hiermit ordne ich an, dass …!
DIE ZEIT: Gibt es für den Bundeskanzler wirklich keinen größeren Hebel?
Schröder: Der einzige Hebel ist die Vertrauensfrage und eine Rücktrittsdrohung. Beide Instrumente eignen sich aber nicht für die gesellschaftliche und politische „Normallage“, in der wir nach meinem Urteil sind. Mit Machtworten verbindet sich doch ein Problem: Wenn Sie dazu greifen müssen, ist es häufig zu spät, und wenn Sie den Gebrauch inflationieren, erreichen Sie nicht das, was Sie wollen. Der demokratische Prozess ist etwas schwieriger. Das aber hat gute Gründe, die auch auf einer Machtbalance beruhen.
DIE ZEIT: Auf der einen Seite hat man einen Bundeskanzler, der sich durchaus als Machtmensch und als „Unternehmer“ versteht. Gleichzeitig sind die Schwerfälligkeiten in einem durch und durch und bis in den letzten Zipfel verwalteten Land inzwischen so groß, dass der normale Bürger merkt, es bewegt sich nichts mehr, die Hebel sind festgeschweißt.
Schröder: Der Befund ist in zwei Punkten, glaube ich, richtig: Sie müssen alles, was Sie tun, durch einen Bundesrat bringen, der eine anders geartete Mehrheit hat. Das ist ein Nachteil, es ist aber zugleich ein Stückchen Machtbalance, die in einem Staat auch nicht zu unterschätzen ist, was die heilsamen Wirkungen auf den Umgang mit Macht angeht. Das System muss effizienter werden. Aber ich reihe mich nicht ein bei denen, die nun zentralstaatliche Vorstellungen gegen den Föderalismus entfalten.
DIE ZEIT: Ein bisschen mehr Solidarität der Fraktion mit dem Kanzler aber könnte es vielleicht geben.
Schröder: Es hat in der Geschichte der SPD selten Situationen gegeben, in denen sich der Parteivorsitzende so wenig über einen Mangel an Solidarität – in Partei und Fraktion – persönlich wie sachlich beklagen kann. Aber noch einmal zum Zustand der Republik: Ich halte es für ein ernsthaftes, vielleicht sogar für das ernsthafteste Problem, dass sich die Menschen – und das ist nicht nur ein deutschen Phänomen – eingeengt fühlen durch ein Übermaß an Bürokratie und einer obrigkeitsstaatlichen Haltung, die es bei uns immer noch zu häufig gibt.
DIE ZEIT: Die Beamten führen Verordnungen aus und der Gesetzesausstoß des Parlaments ist weiterhin enorm.
Schröder: Ehrgeizig haben wir deshalb in die Koalitionsvereinbarung geschrieben, in dieser Legislaturperiode dafür sorgen zu wollen, dass dem nichts weiter hinzugefügt wird. Ganz im Gegenteil, wir möchten beispielsweise diese unzähligen Statistikvorschriften beseitigen, die den Mittelstand häufig wirklich zu viel Arbeit bereiten. Allerdings – eine Fülle der Richtlinien kommt inzwischen aus Europa.
DIE ZEIT: Als Reaktion auf den Nationalsozialismus ist in diesem Land Macht diffundiert und dezentralisiert. Das Motto scheint wahr geworden zu sein: „Keine Macht für niemand“. Wer sorgt in diesem System für das Gesamtinteresse?
Schröder: Das kann nur die Regierung sein und die Parlamentsmehrheit, die sie trägt. Das versuchen wir gerade, Stichwort Steuerpolitik und Arbeitsmarkt, aber die unterschiedlichsten Gruppen verteidigen sofort mit Zähnen und Klauen ihr jeweiliges partielles Interesse.
DIE ZEIT: Müssen Sie ihnen zuhören?
Schröder: Zuhören muss ich. Aber ich muss mir die Freiheit erkämpfen, gegen die Summe der Einzelinteressen das Gemeinwohl zu definieren. Was gegenwärtig als Vertrauensverlust beschrieben wird, hat zu tun mit der Tatsache, dass wir gesagt haben: Im Gesundheitssystem werden alle Interessengruppen rangenommen, bei der Haushaltssanierung verbreitern wir die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Wirtschaft und kürzen gleichzeitig Transferleistungen, etwa bei der Nürnberger Anstalt, im Arbeitsmarkt legen wir Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammen und verändern die Anrechnungsvorschriften für Lebenspartner und Eheleute. Das alles hat Folgen für die Betroffenen. Daher bekommen wir von allen Seiten Ärger. Das ist unschön, aber unumgänglich, damit müssen wir leben.
DIE ZEIT: Warum gelingt es nicht öfter, „Projektkoalitionen“ – auch ein Begriff von Peter Hartz – zu schmieden?
Schröder: Projektkoalitionen zu schmieden bedeutet immer, einer Gruppe mehr Recht zu geben als einer anderen.
DIE ZEIT: Ja!
Schröder: Nehmen wir die Leih- und Zeitarbeit. Wir haben gesagt, wir schaffen alle Restriktionen ab, die es gegenwärtig gibt, und sind damit den Leiharbeitsfirmen und natürlich auch der Wirtschaft entgegengekommen. Um die Menschen aber nicht rechtlos zu stellen, machen wir das mit dem Instrument der Tarifverträge, also sozial gesteuert. Es wäre eigentlich im Interesse beider Seiten gewesen, darauf einzugehen. Beide waren durchaus auch bereit dazu. Bis dann, angetrieben vom Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, die seriösen Leih- und Zeitarbeitsfirmen gesagt haben, sie könnten ihre Zustimmung unter dem Druck der Verbandsinteressen nicht aufrecht erhalten.
DIE ZEIT: Wahrscheinlich wird die Union bis zur nächsten Wahl im Parlament alles blockieren. Wir erleben einen permanenten Wahlkampf. Könnte man sich nicht ein System wie in Amerika vorstellen mit Wahlen am selben Tag alle zwei oder vier Jahre?
Schröder: Es machte Sinn, die Legislaturperiode wie in den meisten Ländern auf fünf Jahre zu verlängern. Es ist aber auch sehr überlegenswert, die Hälfte der Wahlen in der Mitte der Legislaturperiode und die andere Hälfte zusammen mit der Bundestagswahl abzuhalten.
DIE ZEIT: Den nächsten Schritt aber wollen Sie nicht gehen und eine wirkliche Föderalismusdebatte entfachen?
Schröder: Die haben die Länder doch schon begonnen und wir beteiligen uns lebhaft daran.
DIE ZEIT: Wir sollten nicht in Utopien verfallen. Das werden wir wohl nicht mehr erleben.
Schröder: Ich weiß nicht, wie Ihre Lebenserwartung ist. Meine ist groß. Das meine ich jetzt nicht politisch. Aber auch insoweit mehr, als man sich auf der anderen Seite erhofft.
DIE ZEIT: Wie gehen Sie eigentlich mit diesem in Deutschland doch relativ neuen Tonfall der Opposition um, mit dem an Sie adressierten Vorwurf der Lüge und des Betrugs?
Schröder: Ich glaube nicht, dass man bei vernünftigen Leuten mit solchem Klamauk auf Dauer eigene Qualität beweisen kann. Ich will aber sagen, woher das kommt. Es hat etwas mit dem Wahlkampf zu tun. Der war nach dem Urteil verständiger Beobachter sehr personalisiert und ist letztlich entschieden worden durch den Vergleich zwischen zwei Personen, zwischen Herrn Stoiber und mir. Und er ist zu unseren Gunsten entschieden worden. Deswegen ist es nun die Strategie der Union, so wie ich sie wahrnehme: Wir müssen dessen Integrität zerstören. Und darin ist sie völlig bedenkenlos. Übrigens gibt es da auch keinen Unterschied zwischen Frau Merkel und Herrn Stoiber.
DIE ZEIT: Selbst die Frankfurter Rundschau spricht von einem Tohuwabohu, einem Dilettantismus, der nicht zu toppen ist. Ähnliche kritische Worte finden Sie in der Süddeutschen Zeitung oder auch im Spiegel. Handelt es sich wirklich nur um den Versuch der Opposition, die verlorene Wahl doch noch zu gewinnen?
Schröder: Ich beobachte schon sehr viel Aggressivität. So hat sie Willy Brandt erlebt, Helmut Schmidt weniger. Eine absolut negative Begleiterscheinung ist, dass diese Art der Aggressivität in der Sprache sich auch auf Menschen auswirkt, die sich nicht wehren können, zum Beispiel die Familie. Und wenn sie sich wehren, weil sie es nicht aushalten, richtet sich dann die gleiche Aggressivität gegen sie. Da sollte man vielleicht doch einmal überlegen, ob das zu einer zivilisierten Auseinandersetzung passt. Ich selber handele nach dem Motto: Mich könnt ihr mit dieser Art von Kritik gar nicht erreichen. Die übrige Kritik, die Sie erwähnt haben, nehme ich sehr genau wahr. Und bei der weiß ich auch sehr genau zu unterscheiden, was wirklich berechtigt ist. Und da war eine ganze Menge berechtigt.
DIE ZEIT: Was ist berechtigt?
Schröder: Die Kritik zum Beispiel, dass der Entscheidungsfindungsprozess nicht in Ordnung war. Wir hatten lange genug Zeit, uns auf die Neuauflage der Koalitionsverhandlungen vorzubereiten. Und wenn dann steuerliche Vorschläge auf den Tisch kommen, deren wirtschaftliche Konsequenzen nicht hinreichend abgeklopft sind, jedenfalls nicht im ersten Durchgang, kann man das besser machen.
DIE ZEIT: Einer der Hauptvorwürfe lautet, Sie hätten sich im Vorfeld der Wahl nicht ehrlich genug über die wahre ökonomische Lage geäußert.
Schröder: Es wäre wirklich reizvoll, in einer großen Zeitung einmal analysieren zu lassen, wie denn die fast wöchentlich abgegebenen Prognosen der großen Forschungsinstitute und der internationalen Institutionen zur wirtschaftlichen Entwicklung seit Beginn diesen Jahres ausfielen. Sie sind von Quartal zu Quartal korrigiert worden. In der gesamten Debatte, von Beginn des Jahres an, ist immer wieder deutlich gemacht worden: Ihr könnt mit einem sich verstärkenden Wachstum in der zweiten Hälfte diesen Jahres mit absoluter Sicherheit rechnen. Kein einziges Institut hat das relativiert. Daraufhin sind bestimmte Wachstumsraten angenommen und bestimmte Annahmen im Haushalt gemacht worden. Die mögen sich im Nachhinein als überzogen darstellen. Sie waren aber das Ergebnis dieser Prognosen. Und natürlich stützt sich auch die Bundesregierung in der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung auf Prognosen von solchen Institutionen. Der Vorwurf, der jetzt gemacht wird, wir wären damit zu euphorisch umgegangen, ist falsch.
DIE ZEIT: Befürchten Sie, dass man sich in der jetzigen Stimmung in eine deflationäre Entwicklung hineinredet?
Schröder: Der Finanzminister und erst recht der Wirtschaftsminister stehen bei der Bewertung solcher Prognosen immer vor demselben Problem: Korrigieren sie sie zu weit nach unten, beflügeln sie eine negative Entwicklung, man kann sich auch in eine Deflation hineinreden. Korrigieren sie sie zu weit nach oben, hält man ihnen vor, zu blauäugig gewesen zu sein. Im Übrigen waren wir, auch das lässt sich beweisen, bei den Wachstumsannahmen immer eher im unteren Mittelfeld der verfügbaren Prognosen und deshalb nach unserer Einschätzung auf der sicheren Seite. Was die Opposition angeht, ist allerdings der Hinweis berechtigt, dass es in den Ländern Finanzminister gibt, die direkter als der Bundesfinanzminister über Daten verfügen, weil die über ihre Behörden die Steuereingänge unmittelbar mitbekommen. Deshalb ist es Humbug zu sagen, wir hätten hier etwas verschwiegen.
DIE ZEIT: Demnächst kommt aus Brüssel der „Blaue Brief“. Mit Stabilitätspakt und Euro haben die Regierungen die beiden wichtigsten makroökonomischen Steuerungsinstrumente aus der Hand gegeben. Was bleibt einer Regierung da noch anderes übrig, als sich einem Gesetz zu unterwerfen, das wir selbst den Europäern aufgezwungen haben?
Schröder: Der Stabilitätspakt bietet, wenn man ihn vernünftig interpretiert, eine Reihe von Flexibilitäten, die man nicht unterschätzen sollte. Wir sagen, wir wollen in einer konjunkturell schwierigen Lage, in der wir davon ausgehen müssen, das Defizitkriterium zu überschreiten, dies auch bewusst machen, weil die Alternative weitere harte Einschnitte hieße. Angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit ginge das im Jahr 2002 nur bei den Investitionen, was aber konjunkturpolitisch kontraproduktiv wäre. Deshalb verschulden wir uns. In dem Moment, in dem man nachweisen kann, dass man das in absehbarer Zeit wieder in Ordnung bringt, gibt es zwar eine Intervention aus Brüssel, aber keine Strafe. Dieser Dialog ist an sich ganz vernünftig, wenn man ihn nicht denunziatorisch führt. Aber Ihre Frage führt ja weiter. Es gibt eine interessante Debatte, was den Stabilitätspakt angeht: Ob es angemessen ist, als einziges Kriterium die Defizitgrenze zu nehmen. Man könnte sich doch auch einmal fragen: Spielt die absolute Verschuldung, spielen Inflationsraten und spielt Arbeitslosigkeit nicht eine Rolle bei der Bewertung dessen, was ökonomisch vernünftig ist und was nicht? Ich glaube, dies und nicht die Aufweichung oder gar die Eliminierung des Paktes ist die richtige Diskussion, wenn es um die mittelfristige Zukunft geht.
DIE ZEIT: Sie wollen das Korsett lockern?
Schröder: Ich möchte das Korsett flexibler machen, so dass man darin atmen kann. Wir wollen nicht weg vom Stabilitätspakt. Mir geht es um die Frage: Gibt es eigentlich als Inhalt dieses Paktes und damit als Inhalt von Wirtschaftspolitik in Europa nur das eine Kriterium oder müssen wir nicht dafür sorgen, dass diese anderen Kriterien – also Staatsverschuldung insgesamt, Inflationsrate und Höhe der Arbeitslosigkeit – in die Bewertung von Wirtschaftspolitik in den Nationalstaaten, wie sie die Kommission vornimmt, mit einfließen? Ob man dazu eine formale Änderung des Paktes braucht, wage ich zu bezweifeln. Wichtig wäre mir aber, dass man sich auf eine solche Interpretation einlässt.
DIE ZEIT: Zur Außenpolitik: Ist in Prag das Eis zwischen Deutschland und Amerika gebrochen?
Schröder: Wenn es eines gegeben hätte in dem Maße, wie behauptet, dann sicher. Ich finde aber, dass man in Prag ein bisschen viel Aufmerksamkeit verwandt hat auf die Frage, wer in welcher Form wem die Hand gibt. Sowohl auf amerikanischer als auch auf unserer Seite stand immer die Frage im Vordergrund: Was bedeuten wir füreinander bei der Lösung der zentralen politischen Fragen, die sich die internationale Staatengemeinschaft und die Nato stellen? Und da war doch von Anfang an viel mehr an Gemeinsamkeit, als berichtet worden ist. Ich habe in Prag sehr deutlich gesagt, dass für mich der Kampf gegen den internationalen Terrorismus nach wie vor Vorrang hat. Die Taliban sind nicht besiegt, Bin Laden lebt vermutlich, es gibt latente Bedrohungen. Deshalb konzentrieren wir unsere Kräfte auf die Bekämpfung solcher realen Gefahren. Das ist in Amerika verstanden worden.
DIE ZEIT: Was sagt das militärische Establishment Europas und auch Amerikas dazu?
Schröder: Ich kann Ihnen das nicht sagen, aber wir machen das Gegenteil von Uns-heraushalten. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller in der international legitimierten Bekämpfung des Terrorismus, und das werden wir auch bleiben. Für mich hat das, was in Afghanistan geschieht oder nicht geschieht, auch etwas mit Legitimation unserer Politik zu tun, und zwar nach innen wie nach außen. Gleichzeitig lassen wir es dabei nicht bewenden, sondern beteiligen uns am Wiederaufbau Afghanistans. Das hat den Grund, den Völkern der Dritten Welt deutlich zu machen, dass es eine Dividende gibt für die Rückkehr in die zivilisierte Welt. Um diese Dividende müssen wir kämpfen, sonst gewinnen wir, wenn ich das so pathetisch sagen darf, keinen Frieden und verlieren die Seelen.
DIE ZEIT: Der Knackpunkt mit Amerika aber war – und könnte wieder sein – der Irak. Was ist die Theorie hinter der deutschen Verweigerung, auch nicht bei einem ganz klaren UN-Mandat mitzumachen, was ist die Philosophie?
Schröder: Über einen Grund habe ich eben gesprochen, das ist der Schwerpunkt „Antiterrorismus“. Der andere Grund ist, dass Deutschland seine Kräfte auch aus legitimatorischen Gründen auf diese Auseinandersetzung konzentriert. Und das machen wir mit großem Erfolg. Wir bauen darauf, dass man regionale Konflikte weniger konfrontativ als kooperativ lösen kann. Das ist vielleicht auch die Erfahrung, die man im Nahen Osten insgesamt machen kann.
DIE ZEIT: Warum haben Sie sich nicht mit Chirac zusammengeschlossen, der doch mit seinem UN-Vorstoß einen sehr geschickten Schachzug gemacht hat?
Schröder: Die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich waren nicht groß. Als Chirac in Hannover war, ist deutlich geworden, dass man in der prinzipiellen Bewertung einer Meinung ist, aber natürlich als ständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrates andere Operationsmöglichkeiten braucht als eines, das nicht Mitglied des Sicherheitsrates ist.
DIE ZEIT: Tatsache ist, dass die Franzosen, wenn es zum Krieg kommt, mitmachen werden. Tatsache ist, dass wir unter keinen Umständen. Deshalb noch einmal: Ist das ein grundsätzliches oder ist es ein praktisches Nein, weil wir nicht die Mittel haben, um an einem solchen Krieg teilzunehmen?
Schröder: Was Frankreich tun wird, bleibt abzuwarten. Ich meine, das grundsätzliche Nein zu militärischen Interventionen haben wir längst überwunden. Sie wissen, dass ich die deutsche Teilnahme an „Enduring Freedom“ mit Hilfe der Vertrauensfrage durchgesetzt habe. In Sachen Irak halten wir allerdings die andere Prioritätensetzung für falsch und deshalb werden wir uns militärisch nicht beteiligen.
DIE ZEIT: Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie mit Ihrer Position an einen latent vorhandenen Anti-Amerikanismus appellieren, ja ihn vielleicht sogar verkörpern?
Schröder: Das geht völlig an der Sache vorbei. Erstens gibt es diesen Antiamerikanismus nicht. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie stark sich manchmal auch gegenüber der eigenen Kultur, der amerikanische way of life durchgesetzt hat, nicht zuletzt in der Jugend, dann ist es völlig abwegig, von Antiamerikanismus zu reden. Zweitens wäre ich der Verkehrteste, dem man unterstellen könnte, die Speerspitze eines solchen Antiamerikanismus zu bilden. Es ist mir ganz fremd. Ich könnte das nicht, obwohl ich in einer Phase politisch sozialisiert worden bin, in der ein bisschen en vogue war – und wo es, was die Außenpolitik angeht, auch Gründe dafür gab; denken Sie an Vietnam. Selbst da stand ich dem relativ fern. Meine erste studentische Aktion, die ich in Göttingen mitgemacht habe, war der Fackelmarsch aus Anlass der Ermordung von Kennedy.
DIE ZEIT: Sie haben den Amerikanern einiges angeboten: Überflugrechte, Nutzung der Basen, vielleicht sogar Geleitschutz durch die Bundesmarine. Das ist der Preis, den Sie bezahlen. Hätte Sie ihn nicht dadurch vermeiden können, dass Sie im Wahlkampf eine andere Sprache gesprochen hätte?
Schröder: Nein, das ist kein Preis, der bezahlt worden ist, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Es gibt ein Truppenstatut, es gibt einen Stationierungsvertrag. Und selbst wenn es dort Interventionsmöglichkeiten der Art, wie ins Auge gefasst, gäbe, würde ich sie nicht nutzen. Denn selbst wenn ich eine andere Priorität für falsch halte, kann ich schlecht hergehen und den Freunden sagen: „Aber ihr dürft eure eigenen Basen in Deutschland nicht benutzen, ihr kriegt von mir keine Überflugrechte, und ich schränke euch die Bewegungsfreiheit der eigenen Truppen in Deutschland und von Deutschland aus ein.“ Ich will im Übrigen daran erinnern, dass ich zu keinem Zeitpunkt, auch im Wahlkampf nicht, gesagt habe: „Es gibt keine Überflugrechte.“ Das war jemand anderes, wenn ich mich richtig erinnere.
DIE ZEIT: Werden wir Geleitschutz fahren?
Schröder: Im Rahmen von „Enduring Freedom“ engagieren wir uns, darüber hinaus nicht. Wenn es allgemeine Bitten gibt, die nicht konkretisiert sind, wird man im Zuge der Gespräche herausfinden müssen, was darüber hinaus gewünscht ist. Das wird bewertet werden auf der glasklaren Position, die wir in Prag eingenommen haben und davor eingenommen haben: Es gibt keine militärische Beteiligung Deutschlands an einem Krieg im Irak. Im Übrigen hoffe ich, dass die Iraki die Resolution vollständig erfüllen und der Krieg vermeidbar ist.
DIE ZEIT: Involviert werden wir, mindestens indirekt, so oder so: Jetzt meldet sich Israel mit der Bitte, Abwehrraketen vom Typ „Patriot“ zur Verfügung zu stellen. Wie stehen Sie dazu?
Schröder: Das System „Patriot“ ist rein defensiv. Es bietet Schutz gegen Raketenangriffe. Die Sicherheit des Staats Israel und seiner Bürger ist uns überragend wichtig. Wenn die israelische Regierung diesen Zuwachs an Sicherheit braucht, werden wir helfen – und zwar rechtzeitig. Das gebietet unsere historische und moralische Pflicht.
DIE ZEIT: Das Bild, das sich bietet, ist, dass die drei Hauptmächte in Europa – England, Frankreich, Deutschland – in dieser Frage in ziemlich verschiedene Richtung streben. Was wird aus der gemeinsamen Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, wenn die drei ihre eigenen Wege gehen? Die ESVP war nie gedacht als Interventionstruppe irgendwo in der Welt, sondern dazu, im Rahmen der Nato europäische Konflikte zu lösen, etwa die auf dem Balkan und denkbare andere. Unter dem Aspekt halte ich das auch für vernünftig. Was jetzt über Europa hinaus diskutiert wird, ist die Nato-Eingreiftruppe. Da muss man schauen, ob man das mit der ESVP-Eingreiftruppe kompatibel machen kann oder nicht. Ich glaube, das geht. Der Vorteil der Nato-Eingreiftruppe ist, dass in der Nato über deren Einsatz nicht einseitig entschieden werden kann. Es wird genau umgekehrt ein Schuh daraus. Wichtig scheint mir zu sein, dass man, was Europa angeht, möglichst mehr an Gemeinsamkeiten entwickelt. Natürlich wird es immer mal wieder Situationen geben, wo das aufgrund ganz spezifischer Beziehungen wie etwa zwischen Amerika und Großbritannien nicht möglich ist. Was wir hier versuchen, ist ein Verzicht auf nationale Souveränität in der vielleicht für die Nationalstaaten empfindsamsten Frage, die es gibt, nämlich in der Frage der Verfügung über Außenpolitik … zeit:… Krieg oder Frieden …
Schröder: … letztlich, wenn man so will, über Militär und damit über Krieg und Frieden. Und das kann nicht auf einmal gelöst werden. Wir haben begonnen, die Strukturen aufzubauen. Darum geht es jetzt auch im Konvent. Europas Werden ist immer ein Prozess gewesen, in dem es auch bisweilen Rückschläge gegeben hat.
DIE ZEIT: Sie haben als Erster vorgeschlagen, „ein Datum für ein Datum“ der Verhandlungsaufnahme zum EU-Beitritt der Türkei zu nennen. Die Union kündigt inzwischen einen Wahlkampf darüber an. Davon ganz abgesehen – würde es Europa nicht überstrapazieren, wenn es um die Türkei erweitert wird?
Schröder: In dieser Frage ist die Union europaweit und darüber hinaus isoliert. Mir geht es aber um die Frage: Was müssen wir wollen im eigenen nationalen Interesse und im Interesse Europas? Bezogen auf die Türkei, bin ich jedenfalls nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir letztlich vor der Frage stehen: Schaffen wir es, eine säkularisierte Türkei mit festen Bindungen an den Westen – das heißt Europa – aufrechtzuerhalten oder begeben wir uns in die Gefahr – ich will nicht dramatisieren –, dass die Türkei in den islamischen Fundamentalismus abrutscht? Das nationale wie das europäische Interesse gebieten, das zu verhindern.
DIE ZEIT: Und wie?
Schröder: Ich bin dafür, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, im Dezember beim EU-Gipfel in Kopenhagen über die Brüsseler Beschlüsse hinauszugehen. Mit dem Vorsitzenden der neuen türkischen Mehrheitspartei habe ich gesprochen. Das war, was eine säkularisierte Türkei angeht, an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen. Er hat mir gesagt, er verstünde gar nicht, wie man eine Religion in den Namen einer Partei schreiben könne. Ich habe ihm erwidert, ich verstehe das schon. Natürlich beteuert die neue türkische Regierung, sie würden den Weg der Reformen weitergehen. Ich möchte die Türkei gerne an Taten messen und sehen, ob sie dann eine Dauervereinbarung zwischen EU und Nato zu Stande kommen lässt, damit zum Beispiel Europa in Mazedonien Lead-Nation werden kann. Diese Dauervereinbarung braucht man, weil wir die Nato-Strukturen brauchen. Die Türkei hat das immer verhindert. Zweitens würden wir gerne wissen, was die Türken von den Vorschlägen Annans zum Zypern-Konflikt halten. Je nachdem, wie sie sich verhalten, ist Deutschland durchaus bereit, in Kopenhagen ein Signal über Brüssel hinaus zu geben, also etwa eine „Rendezvous-Klausel“ zu vereinbaren.
Das Gespräch führten Gunter Hofmann, Josef Joffe und Michael Naumann
Dazu ein Kommentar aus der Financial Times :
Offenbarungseid
Als Gerhard Schröder sich im Sommer dieses Jahre kategorisch gegen Steuererhöhungen aussprach, hat er sich nicht geirrt. Er hat gelogen. Deshalb ist auch völlig egal, was Schröder am Mittwoch in seiner Rede vor dem Bundestag verspricht. Man wird ihm nicht glauben.
Regierungen haben auch in der Vergangenheit wirtschaftspolitische Fehler gemacht. Die Finanzierung der Wiedervereinigung etwa gehört zu den katastrophalen Fehlentscheidung in der modernen europäischen Wirtschaftsgeschichte. Aber noch nie hat die deutsche Wirtschaftspolitik so sehr an fehlender Glaubwürdigkeit gelitten wie jetzt. Schöne Worte sind wirkungslos geworden - jetzt zählt nur noch, wie die Regierung handelt.
Des Kanzlers Machtwort vom Montag, es werde nicht zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer kommen, ist wirtschaftspolitisch wertlos. Die Bundesregierung wird alles tun, um das Haushaltsdefizit im nächsten Jahr auf unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Da Schröder sich nicht auf harte Einsparungen im Sozialbereich einlassen wird, bleibt ihm nur übrig, die Abgaben weiter zu erhöhen - auch wenn damit die letzte kleine Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung im nächsten Jahr komplett zunichte gemacht wird. Der intellektuell überforderte SPD-Fraktionschef Franz Müntefering hat am Wochenende nur offen ausgesprochen, was die Regierung ohnehin als letzten Ausweg plant: Die Mehrwertsteuer wird 2003 erhöht, zu Gunsten von Bund und Ländern, zu Ungunsten der Konsumenten.
Verwirrung in den eigenen Reihen
Schröder steht auch unter Druck, weil die Unbestimmtheit des politischen Kurses in den eigenen Reihen Verwirrung und Illusionen wuchern lässt. Die unsäglichen Äußerungen des SPD-Fraktionsvize Ludwig Stiegler sind dafür bezeichnend: Wer den Vorsitzenden der wichtigsten Reformkommission der Regierung, den Sozialversicherungsexperten Bert Rürup, hemmungslos anpöbelt, der hat offensichtlich ein ganz anderes Programm im Kopf als der Kanzler oder manche Koalitionskollegen. Der Hoffnungsträger Rürup muss sich fragen, ob er gegen solche Widerstände in der größten Regierungspartei überhaupt noch antreten sollte.
Stiegler ist trotz des Schröderschen Machtworts vorgeprescht, seine Rüpeleien richten sich daher auch gegen die Autorität des Kanzlers. Auch SPD-Generalsekretär Olaf Scholz ignoriert munter die Mahnungen des Chefs.
Schröder wird gegen diesen Zwergenaufstand hart durchgreifen müssen. Das Grundproblem ist damit aber nicht gelöst. Schröder hat nicht nur den Wählern manches verschwiegen. Er hat auch seine Partei auf die anstehenden Probleme nie ernsthaft vorbereitet. Solange jedermann in die Reden des Kanzlers die eigenen Wunschvorstellungen hineinprojizieren kann, ist mit politischen Querschlägern und Enttäuschungen regelmäßig zu rechnen.
Schröder könnte sich natürlich vor den Bundestag stellen, die Fehler der letzten Monate eingestehen und alle bislang beschlossenen Steuer- und Abgabenerhöhungen aussetzen. Er könnte sogar noch weiter gehen und die zweite und dritte Stufe der Steuerreform sofort implementieren - gegenfinanziert durch harte Einsparungen im Haushalt. Er könnte das Rentenproblem mit einem Schlag lösen, indem er - wie Rürup vorschlägt - das Rentenalter in Schritten um zwei Jahre erhöht.
Schlechter kann es kaum noch kommen
Die Stieglers im Saal könnte er vor die Wahl stellen: Geht diesen Weg mit mir, oder sucht euch einen anderen. Es wäre eine Herausforderung, aber auch die größte Chance für Rot-Grün. Wenn es je eine Zeit gegeben hätte, politisch Unpopuläres zutun, jetzt wäre der ideale Moment. Schlechter kann es für Schröder und seine Mannschaft kaum noch kommen.
Doch es spricht nichts dafür, dass der Kanzler so reden wird. Er wird das verwässerte Hartz-Konzept zur Arbeitsmarktreform verteidigen und die Opposition dafür angreifen, dass sie den Plan im Bundesrat blockiert hat. Er wird Versprechen abgeben und vielleicht andeuten, dass man auch Fehler gemacht habe. Aber er wird die kapitalen Fehler der vergangenen Wochen nicht rückgängig machen.
Die Schröder-Rezession wird kommen. Sie wird Tausende von Firmen in den Bankrott treiben, Hunderttausende von Menschen den Arbeitsplatz kosten. Am Ende wird die traurige Erkenntnis bleiben, dass es zwischen den politischen Interessen des Bundeskanzlers und den wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik keine Berührungspunkte gibt.
FTD 04.12.2002
Offenbarungseid
Als Gerhard Schröder sich im Sommer dieses Jahre kategorisch gegen Steuererhöhungen aussprach, hat er sich nicht geirrt. Er hat gelogen. Deshalb ist auch völlig egal, was Schröder am Mittwoch in seiner Rede vor dem Bundestag verspricht. Man wird ihm nicht glauben.
Regierungen haben auch in der Vergangenheit wirtschaftspolitische Fehler gemacht. Die Finanzierung der Wiedervereinigung etwa gehört zu den katastrophalen Fehlentscheidung in der modernen europäischen Wirtschaftsgeschichte. Aber noch nie hat die deutsche Wirtschaftspolitik so sehr an fehlender Glaubwürdigkeit gelitten wie jetzt. Schöne Worte sind wirkungslos geworden - jetzt zählt nur noch, wie die Regierung handelt.
Des Kanzlers Machtwort vom Montag, es werde nicht zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer kommen, ist wirtschaftspolitisch wertlos. Die Bundesregierung wird alles tun, um das Haushaltsdefizit im nächsten Jahr auf unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Da Schröder sich nicht auf harte Einsparungen im Sozialbereich einlassen wird, bleibt ihm nur übrig, die Abgaben weiter zu erhöhen - auch wenn damit die letzte kleine Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung im nächsten Jahr komplett zunichte gemacht wird. Der intellektuell überforderte SPD-Fraktionschef Franz Müntefering hat am Wochenende nur offen ausgesprochen, was die Regierung ohnehin als letzten Ausweg plant: Die Mehrwertsteuer wird 2003 erhöht, zu Gunsten von Bund und Ländern, zu Ungunsten der Konsumenten.
Verwirrung in den eigenen Reihen
Schröder steht auch unter Druck, weil die Unbestimmtheit des politischen Kurses in den eigenen Reihen Verwirrung und Illusionen wuchern lässt. Die unsäglichen Äußerungen des SPD-Fraktionsvize Ludwig Stiegler sind dafür bezeichnend: Wer den Vorsitzenden der wichtigsten Reformkommission der Regierung, den Sozialversicherungsexperten Bert Rürup, hemmungslos anpöbelt, der hat offensichtlich ein ganz anderes Programm im Kopf als der Kanzler oder manche Koalitionskollegen. Der Hoffnungsträger Rürup muss sich fragen, ob er gegen solche Widerstände in der größten Regierungspartei überhaupt noch antreten sollte.
Stiegler ist trotz des Schröderschen Machtworts vorgeprescht, seine Rüpeleien richten sich daher auch gegen die Autorität des Kanzlers. Auch SPD-Generalsekretär Olaf Scholz ignoriert munter die Mahnungen des Chefs.
Schröder wird gegen diesen Zwergenaufstand hart durchgreifen müssen. Das Grundproblem ist damit aber nicht gelöst. Schröder hat nicht nur den Wählern manches verschwiegen. Er hat auch seine Partei auf die anstehenden Probleme nie ernsthaft vorbereitet. Solange jedermann in die Reden des Kanzlers die eigenen Wunschvorstellungen hineinprojizieren kann, ist mit politischen Querschlägern und Enttäuschungen regelmäßig zu rechnen.
Schröder könnte sich natürlich vor den Bundestag stellen, die Fehler der letzten Monate eingestehen und alle bislang beschlossenen Steuer- und Abgabenerhöhungen aussetzen. Er könnte sogar noch weiter gehen und die zweite und dritte Stufe der Steuerreform sofort implementieren - gegenfinanziert durch harte Einsparungen im Haushalt. Er könnte das Rentenproblem mit einem Schlag lösen, indem er - wie Rürup vorschlägt - das Rentenalter in Schritten um zwei Jahre erhöht.
Schlechter kann es kaum noch kommen
Die Stieglers im Saal könnte er vor die Wahl stellen: Geht diesen Weg mit mir, oder sucht euch einen anderen. Es wäre eine Herausforderung, aber auch die größte Chance für Rot-Grün. Wenn es je eine Zeit gegeben hätte, politisch Unpopuläres zutun, jetzt wäre der ideale Moment. Schlechter kann es für Schröder und seine Mannschaft kaum noch kommen.
Doch es spricht nichts dafür, dass der Kanzler so reden wird. Er wird das verwässerte Hartz-Konzept zur Arbeitsmarktreform verteidigen und die Opposition dafür angreifen, dass sie den Plan im Bundesrat blockiert hat. Er wird Versprechen abgeben und vielleicht andeuten, dass man auch Fehler gemacht habe. Aber er wird die kapitalen Fehler der vergangenen Wochen nicht rückgängig machen.
Die Schröder-Rezession wird kommen. Sie wird Tausende von Firmen in den Bankrott treiben, Hunderttausende von Menschen den Arbeitsplatz kosten. Am Ende wird die traurige Erkenntnis bleiben, dass es zwischen den politischen Interessen des Bundeskanzlers und den wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik keine Berührungspunkte gibt.
FTD 04.12.2002
.
Henning Sussebach:
Anfang am Ende
Kaum hat die Karriere begonnen, da ist sie für viele von uns schon wieder vorbei.
Die Krise erreicht die Wohlstandskinder. Ein Anflug von Panik
Die Krise. Erst las ich nur von ihr, da war sie noch weit weg. Dann hörte ich von ihr, über drei Ecken. Dann erwischte sie Freunde von Freunden, dann die Freunde selbst, die Einschläge kamen immer näher. Als Ersten traf es Christian, wie ich ein Journalist. Dann Katrin, Grafikerin. Dann Petra, Lektorin. Seit Oktober geht auch Stefan, unser Nachbar aus dem vierten Stock, morgens nicht mehr zur Arbeit. Er ist der Mann, der den Slogan »It’s not a trick, it’s a Sony« erfunden hat. Sein Job ist weg, sein Dienst-Passat, sein Siegerlächeln. Es ist kein Jahr vergangen, und mein Adressbuch ist zum Nummern-Friedhof geworden, überall tote Festnetzanschlüsse und durchgestrichene E-Mail-Adressen. Wer früher @faz, @siemens, @pixelpark war, sitzt heute @home. Ich blättere von A bis Z, zähle nach und komme zu dem Ergebnis: Ich habe nicht mehr viele Freunde, die noch eine feste Stelle haben.
Bin ich der Nächste? Ich habe Angst.
Es ist eine Angst, die ich nicht kannte. Ich wuchs auf mit der Erfahrung zu bekommen, was ich bekommen wollte, und zu werden, was ich werden wollte. Als ich auf der Grundschule war, wollte ich aufs Gymnasium. Als ich auf dem Gymnasium war, wollte ich auf die Universität. Als ich auf der Universität war, wollte ich in den Beruf. Als ich im Beruf war, wollte ich eine Familie. Als ich eine Familie hatte, wollte ich eine Eigentumswohnung.
Als ich die Eigentumswohnung hatte (mithilfe von Eltern, Erbe und nicht zuletzt einem Kredit, den ich dreißig Jahre lang abbezahlen werde), war mein persönliches Wirtschaftswunder vollbracht. Schnell zwar, aber im Resultat doch nur das bürgerliche Glück, das immer Ziel des ganzen Strebens war. Alles war derart glatt gegangen, dass ich – bis dahin ein Rastloser – ein ruhiger Mensch zu werden schien. Ich träumte nicht mehr diesen Albtraum, dass alles, was ich erreicht hatte, ungültig ist, solange ich nicht diese Mathearbeit nachgeschrieben habe, die ich in der siebten Klasse mal versäumt hatte. Ich hörte sogar auf, mit den Zähnen zu knirschen.
Mein Leben? Ein Sammeln, ein Zugewinn, jede Handlung verzinst, jedes Jahr etwas mehr: Bildung, Erfahrung, Verantwortung, Geld, Selbstsicherheit, auch die. Mein Lebenskonto war im Plus, als ich Anfang des Jahres 30 wurde. Ich feierte in meinem Dachgeschoss, blickte hinunter auf den Park und die Stadt und fühlte eher, als dass ich dachte: »Ich bin angekommen. So könnte es bleiben.«
Jetzt, am Ende des Jahres, wohnen wir immer noch mit Blick auf den Park, meine Frau, meine Tochter und ich. Es sieht so aus, als habe sich nichts verändert, und doch ist vieles anders. Ich habe alle Gewissheiten eines Wohlstandskindes verloren, Gewissheiten, die andere längst aufgegeben hatten, die für mich aber noch gegolten hatten. Dass ich mein Leben lenken kann. Dass Leistung und Erfolg zusammenhängen. Dass ich auch im schlimmsten Fall stets eine neue Stelle finden würde. Und jetzt? Soll nicht mal mehr meine Lebensversicherung garantiert sein.
Wegen der Krise. Dieses eine Wort fasst zusammen, was innerhalb eines Jahres so vielen Lebensläufen eine andere Richtung gab: die kranke Weltwirtschaft, die Winkelzüge der Bilanzbetrüger, die geplatzten Blasen an den Börsen, die Angst vor Terror und Krieg.
Ich weiß, größer als die Krise ist oft das Krisengerede, vielleicht auch dieses hier. Und Rezessionen hat es viele gegeben, ganze Generationen von Bergleuten und Stahlarbeitern wurden in die Arbeitslosigkeit gekippt. In meiner westdeutschen Reihenhausjugend habe ich nur nichts davon mitbekommen. Ich lebte in einem Land mit vier Millionen Arbeitslosen, ohne einen einzigen zu kennen – und ohne mich darüber zu wundern. Vielleicht reißt mich das, was jetzt geschieht, endlich in die Realität.
Lebenslinien stürzen ab wie Aktienkurse
Doch einen Sturz wie diesen, gab es den schon mal für ganze Jahrgänge von Berufsstartern? In Friedenszeiten? Eine Antwort hat die Bundesanstalt für Arbeit: Die Zahl der arbeitslosen Akademiker ist noch nie so schnell gestiegen; um 25 Prozent in einem Jahr. Am häufigsten trifft es junge Menschen mit ähnlichen Biografien wie meiner, Menschen, die gerade beginnen wollten, sich in ihrem Leben einzurichten, und die sich jetzt mühsam von Jahresvertrag zu Jahresvertrag oder nur noch von Auftrag zu Auftrag hangeln.
Das ist ein ziemlicher Einbruch, verglichen mit den Perspektiven, die wir in den letzten Jahren hatten. Da gab es viele Lebenslinien, die in dieselbe Richtung wiesen wie die Aktienkurse. Steil nach oben. Dann steil nach unten. Jetzt werden wir vom Markt genommen. Abgestempelt sind wir auch schon, vom Spiegel als »jung, erfolgreich, entlassen«, vom stern als »Generation arbeitslos«, von der Süddeutschen Zeitung als »Generation fear«, die einmal die »Generation fun« gewesen ist. Manchmal schwingt da Genugtuung mit, dass es ausgerechnet diese Generation getroffen hat. Einige waren ja auch ekelhaft in Zeiten des Booms, neureich, mit sehr spitzen Ellenbogen. Sie dachten, sie seien gerissener als der Kapitalismus selbst.
Vielleicht mussten wir so werden. Wir, die wir aufgewachsen sind mit Fernsehsendungen, die Heiteres Beruferaten hießen und später dann Wetten, dass…?, dieser samstäglichen Muskelschau voller Zuversicht und Optimismus, diesem Zeitgeist-Konzentrat der achtziger Jahre: »Seht her, was ich kann! Jeder ist seines Glückes Schmied! Ein bisschen Zielstrebigkeit, und alles ist möglich!« So liefen wir ins Leben, lernten, sparten uns die Revolution, legten unsere Prüfungen ab und eilten in die Büros – jeder mit seiner eigenen, zumindest fantasierten, Erfolgsgeschichte unterwegs, Superstar im eigenen Kopfkino, Regisseur und Hauptdarsteller zugleich. Schöner Film. Dann riss das Band.
Vielleicht ist es ein Trost für die Millionen Menschen, denen es schon lange viel schlechter geht, ohne dass sich jemand für sie interessiert hätte: Die Arbeitslosigkeit kriecht langsam von unten nach oben, in der gesamten Gesellschaft und in meinem Leben auch. Sie kam drüben aus dem Park, wo sie seit Jahren mit den Alkoholikern auf den Bänken saß, ist über die Straße in unser Haus geschlichen, steigt Stockwerk für Stockwerk hinauf und hat sich jetzt den Werbemann in der vierten Etage gepackt. Und ganz oben, im ausgebauten Dach, sitze ich und glotze auf das Elend hinab, obwohl es mir noch am besten von allen geht.
Ich frage mich, ob ich das so schreiben darf in meinem (soweit ich weiß) sicheren Job.
Es könnte nach Hysterie eines Besserverdienenden klingen. Doch habe nicht auch ich ein Recht auf Angst, mit einer Familie zumal?
Fast möchte man darüber lachen: Ausgerechnet wir, die wir nie gegen das System aufbegehrt haben, werden jetzt von ihm verstoßen. Der freie Markt galt uns nicht als »Schweinesystem«, sondern als Chance. Es gab Eltern, Lehrer, Professoren, die uns für unseren Pragmatismus verachtet haben. Jetzt bekommen wir zu hören, dass unser Dasein nicht viel mehr sein soll als ein ökonomisches Problem, dass wir »zu teuer« sind – ob als Arbeitnehmer mit unseren Löhnen, mit Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld oder als Arbeitslose, die den anderen auf der Tasche liegen.
Ich kenne Menschen, die kommen damit klar. Die sagen: »Kommt Zeit, kommt Rat. Ich schlage mich schon durch. Dann ziehe ich halt um.« Eine beneidenswerte Lebenseinstellung, zeitgemäß dazu. Jedenfalls aus Sicht der Arbeitgeber.
Ich kriege das nicht hin. Wohl, weil ich traditionelle Ideale habe – und nicht weiß, was schlecht sein soll an dem Wunsch nach einer stabilen Familie, an langjährigen Freundschaften vor Ort, an gewachsenen sozialen Netzen.
Schlecht erscheint mir allenfalls, dass diese Ideale für immer mehr meiner Freunde nicht mehr realisierbar, nicht mehr bezahlbar sind, was mich wiederum verunsichert: Wenn ich meiner Tochter aus ihren Kinderbüchern vorlese, frage ich mich, ob es Sinn macht, ihr Geschichten zu erzählen, in denen eine Familie 20 Jahre lang in einer Stadt, in einem Haus lebt. Kann ich ihr meine Werte noch als lebenswert verkaufen, wenn ich längst weiß, dass sie damit in ihrem Leben nicht mehr »kompatibel« sein wird mit »ökonomischen Zwängen«?
»Wer weiß, was in einem Jahr ist«, sagen mir jetzt schon die Prediger von Flexibilität und Mobilität. Ein Satz wie ein Tätscheln. Ich hasse diesen Satz. Ich will wissen, was in einem Jahr ist. Ich will wissen, dass ich dann noch an Ort und Stelle bin. Ich will meiner Tochter, wenn wir in einigen Jahren Kinderfotos anschauen, nicht nach jedem Umblättern erklären müssen: »Das war in Berlin … das war in Düsseldorf … da wohnten wir in München.«
Ich kann Entlassungen und erzwungenen Ortswechseln nicht das schönfärberische Etikett »Lebenserfahrung« ankleben. Ich will nicht immer unterwegs sein wie Peter, noch ein Freund, Lehrer für Latein und Griechisch, dem beharrlich die Verbeamtung verwehrt wird. Jahrelang ist er mit seiner Familie von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule gezogen. Er hat sich nicht frei gefühlt dabei, sondern wie ein Tagelöhner. Es mag seltsam klingen für einen jungen Mann, aber mein Zukunftswunsch war dieser: Ich wollte irgendwann ankommen, Verantwortung übernehmen, in Würde altern wie diese Männer in den Werbespots der Lebensversicherer.
Ist das zu viel verlangt vom Leben? Ein Ausweis deutscher Vollkasko-Mentalität? »Vom Staat ist nicht mehr viel zu erwarten, ihr werdet für euch selber sorgen müssen, beweglich sein, mobil«, sagen mir einige Alte und fordern dann höhere Rentenbeiträge für ihren Vollkasko-Lebensabend (freilich haben sie mir und vielen anderen einen Vollkasko-Start ins Leben ermöglicht.)
In diesem Dilemma schaue ich mit einem Anflug von Neid auf die vielleicht letzten Glücklichen, Sesshaften in unserer Gesellschaft: meine Eltern und ihre Freunde. Sie sind alle um die 60, haben die Rente sicher, die Kinder durchgebracht, das Haus abbezahlt. Natürlich ist ihnen das nicht alles zugefallen, hatten sie es nicht leicht in ihren ersten Jahren, doch gerieten sie stetig in ruhigeres Fahrwasser. Uns, habe ich den Eindruck, steht der umgekehrte Kurs bevor. Wie sich plötzlich alles dreht: Ich möchte ihnen Sätze sagen, die jahrzehntelang wir Kinder zu hören bekommen haben. »Ihr wisst ja gar nicht, wie gut es euch geht.« Absurd klingt das: Ich bin neidisch auf gelebte Leben. Diesen Neid, den gibt es wohl nur, wenn die Zukunft mehr Risiken als Chancen birgt. Die Vergangenheit hat man sicher.
Revolution? Nur in unserem Innersten
»Damit gehst du besser zum Therapeuten«, sagte neulich ein Kollege belustigt. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass in dieser Krise noch mehr abhanden kommen könnte als Selbstbewusstsein und Besitzstand. Dass es auch nicht nur um mich geht. Sondern um das Miteinander der Generationen und das Gesicht einer Gesellschaft. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei der Sanierung des über hundert Jahre alten Stadtbades in unserem Viertel zu helfen; ich wollte Verantwortung in unserer Eigentümergemeinschaft übernehmen; mich im Kindergarten meiner Tochter engagieren. Ich zögere jetzt. Man überlegt sich so etwas noch gründlicher, wenn man sich nicht mehr sicher sein kann, wo, was und wer man im nächsten Jahr ist. So kommt es, dass eine Tatsache (die arbeitslosen Freunde) zu einem vielleicht übertriebenen Gefühl führt (die Sorge um den Job), das wiederum eine Tatsache schafft: den Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben, wenn man darunter mehr als nur Partys versteht.
Dabei sah es so aus, als wollten einige von uns gerade einen Weg einschlagen, der uns doch noch mit den Biografien unserer Eltern, Lehrer und Professoren versöhnt hätte: zwar nicht erst engagiert und dann etabliert, aber immerhin erst etabliert und dann engagiert.
Doch was tun? Man sitzt und redet. »Vielleicht zehn Prozent runter mit allem, mit Löhnen, Renten, Subventionen«, sagt ein Freund. »Quatsch, das gibt doch nur noch mehr Pleiten und Arbeitslose«, sagt ein anderer. »Halbe Rente für Kinderlose«, sage ich dann immer, »zumindest für diese Double-income-no-kids-Schnösel, die später üppig vom Staat versorgt werden. Die haben ja eigentlich genug Geld, um privat vorzusorgen.« Wenn ich dann aber lese, dass durch die höheren Rentenbeiträge im nächsten Jahr die Lohnnebenkosten so sehr steigen, dass nur deshalb noch mal 60000 Menschen ihre Arbeit verlieren werden (darunter bestimmt auch viele Double-income-no-kids-Schnösel), dann weiß ich nicht mehr, ob die Konfliktlinie zwischen Familien und Kinderlosen verläuft oder doch eher zwischen Jung und Alt. Am Ende haben sich zahllose Gräben aufgetan, mal stehe ich auf der einen Seite, mal auf der anderen, nur eine Lösung finde ich nicht, findet niemand von uns. Vielleicht verzetteln wir uns in Details. Menschen, die bisher mit dem System konform gingen, fällt es schwer, plötzlich aufzubegehren.
Die einzige Revolution, der einzige Umsturz, findet deshalb in unserem Innersten statt: Wir leben jetzt präventiv. Denken jeden Schritt voraus, sind in Gedanken immer in der Zukunft, ob wir gerade auf Konsum verzichten, uns gegen Kinder entscheiden oder mit ganz anderer Absicht als früher den Bettlern ein paar Münzen in den Plastikbecher werfen. Bei mir ist es tatsächlich so: Bislang gab ich ihnen Geld, weil ich wusste, dass sie es gebrauchen können, wofür auch immer. Jetzt gebe ich ihnen noch etwas mehr – weil ich hoffe, dass mich das gegen jedwede Form des Absturzes versichert. Ein Ablasshandel auf die Zukunft.
Ein Freund von mir hat zwar Arbeit, aber er weiß nie, wie lange noch. Er weiß nur, dass er sparen muss, vorsichtshalber. Er sagt immer, das mache ihm nichts aus. Aber in diesem Sommer wollten wir beide mit unseren Kindern für ein Wochenende zelten fahren. Raus aus der Stadt, nur ein paar Kilometer. Die Meteorologen waren sich nicht sicher, wie das Wetter werden würde, erst heiter, am Abend eventuell Gewitter. Der Freund rief an, er wirkte wie so oft gehetzt und gestresst und sagte: »Acht Euro für den Zeltplatz, und dann regnet es vielleicht, und wir fahren noch am selben Tag nach Hause? Das Risiko ist mir zu groß.«
Ich fuhr, die Sonne schien. Es war ein wunderbares Wochenende, aber mein Kumpel war nicht dabei. Wegen acht Euro. So ist das mittlerweile: Wir dachten, uns gehört die Zukunft. Jetzt sparen sich die Ersten von uns aus Angst davor die Gegenwart.
DIE ZEIT 49 /2002
Henning Sussebach:
Anfang am Ende
Kaum hat die Karriere begonnen, da ist sie für viele von uns schon wieder vorbei.
Die Krise erreicht die Wohlstandskinder. Ein Anflug von Panik
Die Krise. Erst las ich nur von ihr, da war sie noch weit weg. Dann hörte ich von ihr, über drei Ecken. Dann erwischte sie Freunde von Freunden, dann die Freunde selbst, die Einschläge kamen immer näher. Als Ersten traf es Christian, wie ich ein Journalist. Dann Katrin, Grafikerin. Dann Petra, Lektorin. Seit Oktober geht auch Stefan, unser Nachbar aus dem vierten Stock, morgens nicht mehr zur Arbeit. Er ist der Mann, der den Slogan »It’s not a trick, it’s a Sony« erfunden hat. Sein Job ist weg, sein Dienst-Passat, sein Siegerlächeln. Es ist kein Jahr vergangen, und mein Adressbuch ist zum Nummern-Friedhof geworden, überall tote Festnetzanschlüsse und durchgestrichene E-Mail-Adressen. Wer früher @faz, @siemens, @pixelpark war, sitzt heute @home. Ich blättere von A bis Z, zähle nach und komme zu dem Ergebnis: Ich habe nicht mehr viele Freunde, die noch eine feste Stelle haben.
Bin ich der Nächste? Ich habe Angst.
Es ist eine Angst, die ich nicht kannte. Ich wuchs auf mit der Erfahrung zu bekommen, was ich bekommen wollte, und zu werden, was ich werden wollte. Als ich auf der Grundschule war, wollte ich aufs Gymnasium. Als ich auf dem Gymnasium war, wollte ich auf die Universität. Als ich auf der Universität war, wollte ich in den Beruf. Als ich im Beruf war, wollte ich eine Familie. Als ich eine Familie hatte, wollte ich eine Eigentumswohnung.
Als ich die Eigentumswohnung hatte (mithilfe von Eltern, Erbe und nicht zuletzt einem Kredit, den ich dreißig Jahre lang abbezahlen werde), war mein persönliches Wirtschaftswunder vollbracht. Schnell zwar, aber im Resultat doch nur das bürgerliche Glück, das immer Ziel des ganzen Strebens war. Alles war derart glatt gegangen, dass ich – bis dahin ein Rastloser – ein ruhiger Mensch zu werden schien. Ich träumte nicht mehr diesen Albtraum, dass alles, was ich erreicht hatte, ungültig ist, solange ich nicht diese Mathearbeit nachgeschrieben habe, die ich in der siebten Klasse mal versäumt hatte. Ich hörte sogar auf, mit den Zähnen zu knirschen.
Mein Leben? Ein Sammeln, ein Zugewinn, jede Handlung verzinst, jedes Jahr etwas mehr: Bildung, Erfahrung, Verantwortung, Geld, Selbstsicherheit, auch die. Mein Lebenskonto war im Plus, als ich Anfang des Jahres 30 wurde. Ich feierte in meinem Dachgeschoss, blickte hinunter auf den Park und die Stadt und fühlte eher, als dass ich dachte: »Ich bin angekommen. So könnte es bleiben.«
Jetzt, am Ende des Jahres, wohnen wir immer noch mit Blick auf den Park, meine Frau, meine Tochter und ich. Es sieht so aus, als habe sich nichts verändert, und doch ist vieles anders. Ich habe alle Gewissheiten eines Wohlstandskindes verloren, Gewissheiten, die andere längst aufgegeben hatten, die für mich aber noch gegolten hatten. Dass ich mein Leben lenken kann. Dass Leistung und Erfolg zusammenhängen. Dass ich auch im schlimmsten Fall stets eine neue Stelle finden würde. Und jetzt? Soll nicht mal mehr meine Lebensversicherung garantiert sein.
Wegen der Krise. Dieses eine Wort fasst zusammen, was innerhalb eines Jahres so vielen Lebensläufen eine andere Richtung gab: die kranke Weltwirtschaft, die Winkelzüge der Bilanzbetrüger, die geplatzten Blasen an den Börsen, die Angst vor Terror und Krieg.
Ich weiß, größer als die Krise ist oft das Krisengerede, vielleicht auch dieses hier. Und Rezessionen hat es viele gegeben, ganze Generationen von Bergleuten und Stahlarbeitern wurden in die Arbeitslosigkeit gekippt. In meiner westdeutschen Reihenhausjugend habe ich nur nichts davon mitbekommen. Ich lebte in einem Land mit vier Millionen Arbeitslosen, ohne einen einzigen zu kennen – und ohne mich darüber zu wundern. Vielleicht reißt mich das, was jetzt geschieht, endlich in die Realität.
Lebenslinien stürzen ab wie Aktienkurse
Doch einen Sturz wie diesen, gab es den schon mal für ganze Jahrgänge von Berufsstartern? In Friedenszeiten? Eine Antwort hat die Bundesanstalt für Arbeit: Die Zahl der arbeitslosen Akademiker ist noch nie so schnell gestiegen; um 25 Prozent in einem Jahr. Am häufigsten trifft es junge Menschen mit ähnlichen Biografien wie meiner, Menschen, die gerade beginnen wollten, sich in ihrem Leben einzurichten, und die sich jetzt mühsam von Jahresvertrag zu Jahresvertrag oder nur noch von Auftrag zu Auftrag hangeln.
Das ist ein ziemlicher Einbruch, verglichen mit den Perspektiven, die wir in den letzten Jahren hatten. Da gab es viele Lebenslinien, die in dieselbe Richtung wiesen wie die Aktienkurse. Steil nach oben. Dann steil nach unten. Jetzt werden wir vom Markt genommen. Abgestempelt sind wir auch schon, vom Spiegel als »jung, erfolgreich, entlassen«, vom stern als »Generation arbeitslos«, von der Süddeutschen Zeitung als »Generation fear«, die einmal die »Generation fun« gewesen ist. Manchmal schwingt da Genugtuung mit, dass es ausgerechnet diese Generation getroffen hat. Einige waren ja auch ekelhaft in Zeiten des Booms, neureich, mit sehr spitzen Ellenbogen. Sie dachten, sie seien gerissener als der Kapitalismus selbst.
Vielleicht mussten wir so werden. Wir, die wir aufgewachsen sind mit Fernsehsendungen, die Heiteres Beruferaten hießen und später dann Wetten, dass…?, dieser samstäglichen Muskelschau voller Zuversicht und Optimismus, diesem Zeitgeist-Konzentrat der achtziger Jahre: »Seht her, was ich kann! Jeder ist seines Glückes Schmied! Ein bisschen Zielstrebigkeit, und alles ist möglich!« So liefen wir ins Leben, lernten, sparten uns die Revolution, legten unsere Prüfungen ab und eilten in die Büros – jeder mit seiner eigenen, zumindest fantasierten, Erfolgsgeschichte unterwegs, Superstar im eigenen Kopfkino, Regisseur und Hauptdarsteller zugleich. Schöner Film. Dann riss das Band.
Vielleicht ist es ein Trost für die Millionen Menschen, denen es schon lange viel schlechter geht, ohne dass sich jemand für sie interessiert hätte: Die Arbeitslosigkeit kriecht langsam von unten nach oben, in der gesamten Gesellschaft und in meinem Leben auch. Sie kam drüben aus dem Park, wo sie seit Jahren mit den Alkoholikern auf den Bänken saß, ist über die Straße in unser Haus geschlichen, steigt Stockwerk für Stockwerk hinauf und hat sich jetzt den Werbemann in der vierten Etage gepackt. Und ganz oben, im ausgebauten Dach, sitze ich und glotze auf das Elend hinab, obwohl es mir noch am besten von allen geht.
Ich frage mich, ob ich das so schreiben darf in meinem (soweit ich weiß) sicheren Job.
Es könnte nach Hysterie eines Besserverdienenden klingen. Doch habe nicht auch ich ein Recht auf Angst, mit einer Familie zumal?
Fast möchte man darüber lachen: Ausgerechnet wir, die wir nie gegen das System aufbegehrt haben, werden jetzt von ihm verstoßen. Der freie Markt galt uns nicht als »Schweinesystem«, sondern als Chance. Es gab Eltern, Lehrer, Professoren, die uns für unseren Pragmatismus verachtet haben. Jetzt bekommen wir zu hören, dass unser Dasein nicht viel mehr sein soll als ein ökonomisches Problem, dass wir »zu teuer« sind – ob als Arbeitnehmer mit unseren Löhnen, mit Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld oder als Arbeitslose, die den anderen auf der Tasche liegen.
Ich kenne Menschen, die kommen damit klar. Die sagen: »Kommt Zeit, kommt Rat. Ich schlage mich schon durch. Dann ziehe ich halt um.« Eine beneidenswerte Lebenseinstellung, zeitgemäß dazu. Jedenfalls aus Sicht der Arbeitgeber.
Ich kriege das nicht hin. Wohl, weil ich traditionelle Ideale habe – und nicht weiß, was schlecht sein soll an dem Wunsch nach einer stabilen Familie, an langjährigen Freundschaften vor Ort, an gewachsenen sozialen Netzen.
Schlecht erscheint mir allenfalls, dass diese Ideale für immer mehr meiner Freunde nicht mehr realisierbar, nicht mehr bezahlbar sind, was mich wiederum verunsichert: Wenn ich meiner Tochter aus ihren Kinderbüchern vorlese, frage ich mich, ob es Sinn macht, ihr Geschichten zu erzählen, in denen eine Familie 20 Jahre lang in einer Stadt, in einem Haus lebt. Kann ich ihr meine Werte noch als lebenswert verkaufen, wenn ich längst weiß, dass sie damit in ihrem Leben nicht mehr »kompatibel« sein wird mit »ökonomischen Zwängen«?
»Wer weiß, was in einem Jahr ist«, sagen mir jetzt schon die Prediger von Flexibilität und Mobilität. Ein Satz wie ein Tätscheln. Ich hasse diesen Satz. Ich will wissen, was in einem Jahr ist. Ich will wissen, dass ich dann noch an Ort und Stelle bin. Ich will meiner Tochter, wenn wir in einigen Jahren Kinderfotos anschauen, nicht nach jedem Umblättern erklären müssen: »Das war in Berlin … das war in Düsseldorf … da wohnten wir in München.«
Ich kann Entlassungen und erzwungenen Ortswechseln nicht das schönfärberische Etikett »Lebenserfahrung« ankleben. Ich will nicht immer unterwegs sein wie Peter, noch ein Freund, Lehrer für Latein und Griechisch, dem beharrlich die Verbeamtung verwehrt wird. Jahrelang ist er mit seiner Familie von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule gezogen. Er hat sich nicht frei gefühlt dabei, sondern wie ein Tagelöhner. Es mag seltsam klingen für einen jungen Mann, aber mein Zukunftswunsch war dieser: Ich wollte irgendwann ankommen, Verantwortung übernehmen, in Würde altern wie diese Männer in den Werbespots der Lebensversicherer.
Ist das zu viel verlangt vom Leben? Ein Ausweis deutscher Vollkasko-Mentalität? »Vom Staat ist nicht mehr viel zu erwarten, ihr werdet für euch selber sorgen müssen, beweglich sein, mobil«, sagen mir einige Alte und fordern dann höhere Rentenbeiträge für ihren Vollkasko-Lebensabend (freilich haben sie mir und vielen anderen einen Vollkasko-Start ins Leben ermöglicht.)
In diesem Dilemma schaue ich mit einem Anflug von Neid auf die vielleicht letzten Glücklichen, Sesshaften in unserer Gesellschaft: meine Eltern und ihre Freunde. Sie sind alle um die 60, haben die Rente sicher, die Kinder durchgebracht, das Haus abbezahlt. Natürlich ist ihnen das nicht alles zugefallen, hatten sie es nicht leicht in ihren ersten Jahren, doch gerieten sie stetig in ruhigeres Fahrwasser. Uns, habe ich den Eindruck, steht der umgekehrte Kurs bevor. Wie sich plötzlich alles dreht: Ich möchte ihnen Sätze sagen, die jahrzehntelang wir Kinder zu hören bekommen haben. »Ihr wisst ja gar nicht, wie gut es euch geht.« Absurd klingt das: Ich bin neidisch auf gelebte Leben. Diesen Neid, den gibt es wohl nur, wenn die Zukunft mehr Risiken als Chancen birgt. Die Vergangenheit hat man sicher.
Revolution? Nur in unserem Innersten
»Damit gehst du besser zum Therapeuten«, sagte neulich ein Kollege belustigt. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass in dieser Krise noch mehr abhanden kommen könnte als Selbstbewusstsein und Besitzstand. Dass es auch nicht nur um mich geht. Sondern um das Miteinander der Generationen und das Gesicht einer Gesellschaft. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei der Sanierung des über hundert Jahre alten Stadtbades in unserem Viertel zu helfen; ich wollte Verantwortung in unserer Eigentümergemeinschaft übernehmen; mich im Kindergarten meiner Tochter engagieren. Ich zögere jetzt. Man überlegt sich so etwas noch gründlicher, wenn man sich nicht mehr sicher sein kann, wo, was und wer man im nächsten Jahr ist. So kommt es, dass eine Tatsache (die arbeitslosen Freunde) zu einem vielleicht übertriebenen Gefühl führt (die Sorge um den Job), das wiederum eine Tatsache schafft: den Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben, wenn man darunter mehr als nur Partys versteht.
Dabei sah es so aus, als wollten einige von uns gerade einen Weg einschlagen, der uns doch noch mit den Biografien unserer Eltern, Lehrer und Professoren versöhnt hätte: zwar nicht erst engagiert und dann etabliert, aber immerhin erst etabliert und dann engagiert.
Doch was tun? Man sitzt und redet. »Vielleicht zehn Prozent runter mit allem, mit Löhnen, Renten, Subventionen«, sagt ein Freund. »Quatsch, das gibt doch nur noch mehr Pleiten und Arbeitslose«, sagt ein anderer. »Halbe Rente für Kinderlose«, sage ich dann immer, »zumindest für diese Double-income-no-kids-Schnösel, die später üppig vom Staat versorgt werden. Die haben ja eigentlich genug Geld, um privat vorzusorgen.« Wenn ich dann aber lese, dass durch die höheren Rentenbeiträge im nächsten Jahr die Lohnnebenkosten so sehr steigen, dass nur deshalb noch mal 60000 Menschen ihre Arbeit verlieren werden (darunter bestimmt auch viele Double-income-no-kids-Schnösel), dann weiß ich nicht mehr, ob die Konfliktlinie zwischen Familien und Kinderlosen verläuft oder doch eher zwischen Jung und Alt. Am Ende haben sich zahllose Gräben aufgetan, mal stehe ich auf der einen Seite, mal auf der anderen, nur eine Lösung finde ich nicht, findet niemand von uns. Vielleicht verzetteln wir uns in Details. Menschen, die bisher mit dem System konform gingen, fällt es schwer, plötzlich aufzubegehren.
Die einzige Revolution, der einzige Umsturz, findet deshalb in unserem Innersten statt: Wir leben jetzt präventiv. Denken jeden Schritt voraus, sind in Gedanken immer in der Zukunft, ob wir gerade auf Konsum verzichten, uns gegen Kinder entscheiden oder mit ganz anderer Absicht als früher den Bettlern ein paar Münzen in den Plastikbecher werfen. Bei mir ist es tatsächlich so: Bislang gab ich ihnen Geld, weil ich wusste, dass sie es gebrauchen können, wofür auch immer. Jetzt gebe ich ihnen noch etwas mehr – weil ich hoffe, dass mich das gegen jedwede Form des Absturzes versichert. Ein Ablasshandel auf die Zukunft.
Ein Freund von mir hat zwar Arbeit, aber er weiß nie, wie lange noch. Er weiß nur, dass er sparen muss, vorsichtshalber. Er sagt immer, das mache ihm nichts aus. Aber in diesem Sommer wollten wir beide mit unseren Kindern für ein Wochenende zelten fahren. Raus aus der Stadt, nur ein paar Kilometer. Die Meteorologen waren sich nicht sicher, wie das Wetter werden würde, erst heiter, am Abend eventuell Gewitter. Der Freund rief an, er wirkte wie so oft gehetzt und gestresst und sagte: »Acht Euro für den Zeltplatz, und dann regnet es vielleicht, und wir fahren noch am selben Tag nach Hause? Das Risiko ist mir zu groß.«
Ich fuhr, die Sonne schien. Es war ein wunderbares Wochenende, aber mein Kumpel war nicht dabei. Wegen acht Euro. So ist das mittlerweile: Wir dachten, uns gehört die Zukunft. Jetzt sparen sich die Ersten von uns aus Angst davor die Gegenwart.
DIE ZEIT 49 /2002
SPIEGEL ONLINE - 06. Dezember 2002
Ex-Bundesbankchef Pöhl fürchtet japanische Malaise
Die deutsche Wirtschaft ist nach Ansicht des früheren Bundesbankchefs Karl-Otto Pöhl in einem ähnlich kritischen Zustand wie die japanische vor Beginn ihrer zehnjährigen Dauerkrise. Besonders besorgt ist Pöhl über den Zustand des deutschen Bankensystems.
Frankfurt am Main - Er hoffe zwar, dass Deutschland nicht wie Japan vor einer Dekade der Stagnation stehe, wird der frühere Notenbanker vom Wirtschaftsdienst Bloomberg zitiert. "Das ist das letzte, was wir brauchen". Die Ähnlichkeiten zwischen der deutschen Wirtschaft heute und der japanischen Anfang der neunziger Jahre seien aber so augenfällig wie vielfältig.
So hätten in Deutschland gehandelte Aktien im Vergleich zu anderen überproportional an Wert verloren - der Dax etwa gab allein in diesem Jahr rund 36 Prozent nach, weit mehr als Indizes in Amerika, Japan oder anderen Staaten Europas. Drastische Verluste erlitt auch die Börse in Tokio Anfang der neunziger Jahre, als die so genannte "Immobilienblase" platzte. Von den Folgen dieses Crashs hat sich die größte Volkswirtschaft Asiens noch immer nicht erholt.
Unter anderem auf Grund der Schwäche der Kapitalmärkte würden die deutschen Banken nur noch zögerlich Geld verleihen, so Pöhl weiter. "Man bekommt keine Kredite, weil sich die Banken die Finger zu stark verbrannt haben". In Japan leiden die Banken seit langem unter einer immensen Last "fauler" Kredite. Vielen Firmen fehlt daher die Möglichkeit, Expansion mit geliehenem Geld zu finanzieren.
Zudem gelinge es der Europäischen Zentralbank EZB nicht, mit zinspolitischen Maßnahmen die Konjunktur in Deutschland zu beleben, sagte Pöhl: "Wenn die EZB die Zinsen senkt, hat es keine Wirkung". Japan rutschte auf Grund deflationärer Tendenzen immer wieder in die Rezession, obwohl die Notenbank ihre Zinsen zeitweise auf Null senkte. Die EZB hatte ihren Leitzins erst am Donnerstag von 3,25 auf 2,75 Prozent ermäßigt. Pöhl kritisierte, dieser Zinsschritt komme spät: "Die EZB hätte früher die Zinsen senken können", wird er zitiert. "Sie ist manchmal ein bisschen ängstlich".
Pöhl zufolge gibt es weitere Ähnlichkeiten: Wie in Japan nehme die Überalterung der deutschen Bevölkerung zu. Zugleich habe es die Politik in beiden Ländern versäumt, den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme zu reformieren.
Pöhl war elf Jahre lang Chef der Bundesbank. Er legte sein Amt 1991 anlässlich der Einführung der D-Mark in Ostdeutschland nieder, weil er den von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) durchgesetzten Wechselkurs für die Ostmark für falsch hielt.
Ex-Bundesbankchef Pöhl fürchtet japanische Malaise
Die deutsche Wirtschaft ist nach Ansicht des früheren Bundesbankchefs Karl-Otto Pöhl in einem ähnlich kritischen Zustand wie die japanische vor Beginn ihrer zehnjährigen Dauerkrise. Besonders besorgt ist Pöhl über den Zustand des deutschen Bankensystems.
Frankfurt am Main - Er hoffe zwar, dass Deutschland nicht wie Japan vor einer Dekade der Stagnation stehe, wird der frühere Notenbanker vom Wirtschaftsdienst Bloomberg zitiert. "Das ist das letzte, was wir brauchen". Die Ähnlichkeiten zwischen der deutschen Wirtschaft heute und der japanischen Anfang der neunziger Jahre seien aber so augenfällig wie vielfältig.
So hätten in Deutschland gehandelte Aktien im Vergleich zu anderen überproportional an Wert verloren - der Dax etwa gab allein in diesem Jahr rund 36 Prozent nach, weit mehr als Indizes in Amerika, Japan oder anderen Staaten Europas. Drastische Verluste erlitt auch die Börse in Tokio Anfang der neunziger Jahre, als die so genannte "Immobilienblase" platzte. Von den Folgen dieses Crashs hat sich die größte Volkswirtschaft Asiens noch immer nicht erholt.
Unter anderem auf Grund der Schwäche der Kapitalmärkte würden die deutschen Banken nur noch zögerlich Geld verleihen, so Pöhl weiter. "Man bekommt keine Kredite, weil sich die Banken die Finger zu stark verbrannt haben". In Japan leiden die Banken seit langem unter einer immensen Last "fauler" Kredite. Vielen Firmen fehlt daher die Möglichkeit, Expansion mit geliehenem Geld zu finanzieren.
Zudem gelinge es der Europäischen Zentralbank EZB nicht, mit zinspolitischen Maßnahmen die Konjunktur in Deutschland zu beleben, sagte Pöhl: "Wenn die EZB die Zinsen senkt, hat es keine Wirkung". Japan rutschte auf Grund deflationärer Tendenzen immer wieder in die Rezession, obwohl die Notenbank ihre Zinsen zeitweise auf Null senkte. Die EZB hatte ihren Leitzins erst am Donnerstag von 3,25 auf 2,75 Prozent ermäßigt. Pöhl kritisierte, dieser Zinsschritt komme spät: "Die EZB hätte früher die Zinsen senken können", wird er zitiert. "Sie ist manchmal ein bisschen ängstlich".
Pöhl zufolge gibt es weitere Ähnlichkeiten: Wie in Japan nehme die Überalterung der deutschen Bevölkerung zu. Zugleich habe es die Politik in beiden Ländern versäumt, den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme zu reformieren.
Pöhl war elf Jahre lang Chef der Bundesbank. Er legte sein Amt 1991 anlässlich der Einführung der D-Mark in Ostdeutschland nieder, weil er den von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) durchgesetzten Wechselkurs für die Ostmark für falsch hielt.
Hallo Konradi, Hallo Alle!
Limitierte freie Zeit erzwingt ein Selektieren, schon nach Titel – schliesslich ist Info aus dem www saugen, wie Wasser trinken wollen aus einem C-Schlauch. Der etwas apokalyptische Titel dieses Threads erregte bisher nicht meine Aufmerksamkeit.
Mit Konradi hatte ich bereits bei meist kontroverser Grundeinstellung recht angenehmen Meinungsaustausch in dem einen oder anderen Nachbarthread. Zu einem aktuellen, im Thread-Nr.: 667695 absolut fehlplatziertem Thema, mit dem wir schon fast durchwaren, wollte er lieber hier antworten. So bin ich nun hier gelandet, habe das Umfeld angesehen, mich diagonal eingelesen in dem bereits umfangreichen, jetzt allerdings etwas dümpelnden Schriftverkehr, und einen Versuch unternommen, zu verstehen, worum es hier eigentlich geht …
Ich glaube, ich hab´s erkannt:
Gut essen, gut trinken ist die zentrale Achse, neben einem gepflegten Meinungsaustausch … Da könnte ich mich wohlfühlen, auch, wenn ich mich selbst heute noch mit Grauen an dauerhaft vorgesetzten Labskaus bei einem mehrwöchigen Jugend-Erholungsaufenthalt in Wyck auf Föhr erinnere … Konradi, Dein Rezept dazu weiter oben, war da entsprechend meiner Erinnerung nicht durchgedrehter Fisch darin??? War doch sozusagen ein Marineessen, so wurde es uns jedenfalls verkauft.
Ihr habt aber auch viel Besseres angeführt, was mich dann doch interessiert, die Dinger mit den Zwetschen z.B., erinnert etwas an Zwetschenknödel, welche ich in gebratenem Paniermehl gerollt und hernach gezuckert als Nachspeise oder die ich zu Wild oder Sauerbraten gerne esse ... wird also baldigst nachgebaut!
Selbst einen alten Mitstreiter sehe ich hier aus einigermaßen erfolgreichen „DBBH - Dicke Ende Zeiten“ dessen „simplifizierenden Erklärungen“ bei der damaligen Stimmung in jener Bude sehr ausgleichend gewirkt hatten: Thefarmer … meine Grüße an Dich!
Und ich dachte, Du hättest es geschafft und räkelst Dich mit den seinerzeitigen Gewinnen am Balaton : - )) Gibt mir zu hoffen, dass wir wieder mal gemeinsam eine Richtungsfindung erarbeiten können! Ich weiß nicht, an der Wievielten es bei Dir ist, ich arbeite heute schon an meiner vierten Million … da die ersten drei leider nicht so ganz geklappt haben, wie ich es gewünscht hätte : - (((
Auffassungsunterschiede sehe ich eine Menge, auch Gemeinsamkeiten, so stehe ich Konradi´s Hausmannskost näher, denn Sovereign´s Gourmethäppchen, obwohl ich Aprikosengeist bevorzuge, teile ich aber auch seine Single Malt Liebe. Das Thema hier betreffend, erwarte ich nach einer himmelhoch jauchzender Anfangsphase, den Goldpreisanstieg (noch nicht ganz zu Tode betrübt) schon seit zweieinhalb Jahrzehnten! Macht nichts, ich bin Angler und habe Geduld …,
Also, bei etwas Bereitschaft könnte Freude aufkommen, nicht nur anbetracht der allem Anschein nach nun tatsächlich endenden Durstphase, dessen Verlauf ich gerne, wie Farmer sich vielleicht erinnert, auch unter Zuhilfenahme von zwei simplen Linien betrachte!
Meinen Einstand gebe ich gerne!
Um Gemeinsamkeiten zu finden, erstmal ein Mitteldingen, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht fein, als Beilage zu saftigen Fleischgerichten genossen auch nicht zu deftig. Manche essen es gar gerne auch als Nachspeise, ich bevorzuge es jedoch als Hauptgericht, direkt von der Platte weg, vielleicht mit einer deftigen Bohnensuppe mit geräuchertem Eisbein darinnen vorweg …
Also:
Durchwachsenen geräucherten Speck nicht zu klein gewürfelt, Menge nach belieben, in etwas Schweineschmalz angebraten, leicht angebräunt zwar, aber nicht ganz ausgelassen,
Frischer, gut abgetropfter trockener Quark, ½ Pfund oder etwas mehr, aufgelockert,
Sauere Sahne, nicht allzu fettarm, ein kleiner Becher,
Gute Qualität Bandnudeln 500 Gramm, (evtl. Lasagne-Nudel nach dem Kochen in unregelmäßige Streifen geschnitten).
Die Nudel in Salzwasser nicht ganz „al dente“ kochen, gut abtropfen, nach dem Abschütten im ausgelassenem heißen Fett vom Speck durchmischen.
Auf Jena-Glasplatte (ich nehme dazu gerne den Glasdeckel unserer Backschüssel) lagenweise: Nudel, Quark, Speck eingestreut, etwas Saure Sahne darübergepritzt, je nach Plattengröße ca. 2-3 Schichten , als oberste Lage Nudel mit Speck bestreut.
Im 200°C vorgeheiztem Backofen erst mit Alufolie abgedeckt, ca. ¾ Std., dann ohne Folie, bis die Oberseite knusprig und angebräunt ist weiterbacken.
Dazu einen knackigen Eisbergsalat mit viel grobgehackten Zwiebel, in Wasser, Öl und Essig zubereitet … wobei ich wegen dem Geschmack gerne Kürbiskernöl benutze ...
Ach so, gerne trinke ich dazu einen halbtrockenen Weissen, und, meist beim Kochen vorweg einen leckeren Hefeweizen : - ))
Einen guten Appetit!
Grüße
Magor
Limitierte freie Zeit erzwingt ein Selektieren, schon nach Titel – schliesslich ist Info aus dem www saugen, wie Wasser trinken wollen aus einem C-Schlauch. Der etwas apokalyptische Titel dieses Threads erregte bisher nicht meine Aufmerksamkeit.
Mit Konradi hatte ich bereits bei meist kontroverser Grundeinstellung recht angenehmen Meinungsaustausch in dem einen oder anderen Nachbarthread. Zu einem aktuellen, im Thread-Nr.: 667695 absolut fehlplatziertem Thema, mit dem wir schon fast durchwaren, wollte er lieber hier antworten. So bin ich nun hier gelandet, habe das Umfeld angesehen, mich diagonal eingelesen in dem bereits umfangreichen, jetzt allerdings etwas dümpelnden Schriftverkehr, und einen Versuch unternommen, zu verstehen, worum es hier eigentlich geht …
Ich glaube, ich hab´s erkannt:
Gut essen, gut trinken ist die zentrale Achse, neben einem gepflegten Meinungsaustausch … Da könnte ich mich wohlfühlen, auch, wenn ich mich selbst heute noch mit Grauen an dauerhaft vorgesetzten Labskaus bei einem mehrwöchigen Jugend-Erholungsaufenthalt in Wyck auf Föhr erinnere … Konradi, Dein Rezept dazu weiter oben, war da entsprechend meiner Erinnerung nicht durchgedrehter Fisch darin??? War doch sozusagen ein Marineessen, so wurde es uns jedenfalls verkauft.
Ihr habt aber auch viel Besseres angeführt, was mich dann doch interessiert, die Dinger mit den Zwetschen z.B., erinnert etwas an Zwetschenknödel, welche ich in gebratenem Paniermehl gerollt und hernach gezuckert als Nachspeise oder die ich zu Wild oder Sauerbraten gerne esse ... wird also baldigst nachgebaut!
Selbst einen alten Mitstreiter sehe ich hier aus einigermaßen erfolgreichen „DBBH - Dicke Ende Zeiten“ dessen „simplifizierenden Erklärungen“ bei der damaligen Stimmung in jener Bude sehr ausgleichend gewirkt hatten: Thefarmer … meine Grüße an Dich!
Und ich dachte, Du hättest es geschafft und räkelst Dich mit den seinerzeitigen Gewinnen am Balaton : - )) Gibt mir zu hoffen, dass wir wieder mal gemeinsam eine Richtungsfindung erarbeiten können! Ich weiß nicht, an der Wievielten es bei Dir ist, ich arbeite heute schon an meiner vierten Million … da die ersten drei leider nicht so ganz geklappt haben, wie ich es gewünscht hätte : - (((
Auffassungsunterschiede sehe ich eine Menge, auch Gemeinsamkeiten, so stehe ich Konradi´s Hausmannskost näher, denn Sovereign´s Gourmethäppchen, obwohl ich Aprikosengeist bevorzuge, teile ich aber auch seine Single Malt Liebe. Das Thema hier betreffend, erwarte ich nach einer himmelhoch jauchzender Anfangsphase, den Goldpreisanstieg (noch nicht ganz zu Tode betrübt) schon seit zweieinhalb Jahrzehnten! Macht nichts, ich bin Angler und habe Geduld …,
Also, bei etwas Bereitschaft könnte Freude aufkommen, nicht nur anbetracht der allem Anschein nach nun tatsächlich endenden Durstphase, dessen Verlauf ich gerne, wie Farmer sich vielleicht erinnert, auch unter Zuhilfenahme von zwei simplen Linien betrachte!
Meinen Einstand gebe ich gerne!
Um Gemeinsamkeiten zu finden, erstmal ein Mitteldingen, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht fein, als Beilage zu saftigen Fleischgerichten genossen auch nicht zu deftig. Manche essen es gar gerne auch als Nachspeise, ich bevorzuge es jedoch als Hauptgericht, direkt von der Platte weg, vielleicht mit einer deftigen Bohnensuppe mit geräuchertem Eisbein darinnen vorweg …
Also:
Durchwachsenen geräucherten Speck nicht zu klein gewürfelt, Menge nach belieben, in etwas Schweineschmalz angebraten, leicht angebräunt zwar, aber nicht ganz ausgelassen,
Frischer, gut abgetropfter trockener Quark, ½ Pfund oder etwas mehr, aufgelockert,
Sauere Sahne, nicht allzu fettarm, ein kleiner Becher,
Gute Qualität Bandnudeln 500 Gramm, (evtl. Lasagne-Nudel nach dem Kochen in unregelmäßige Streifen geschnitten).
Die Nudel in Salzwasser nicht ganz „al dente“ kochen, gut abtropfen, nach dem Abschütten im ausgelassenem heißen Fett vom Speck durchmischen.
Auf Jena-Glasplatte (ich nehme dazu gerne den Glasdeckel unserer Backschüssel) lagenweise: Nudel, Quark, Speck eingestreut, etwas Saure Sahne darübergepritzt, je nach Plattengröße ca. 2-3 Schichten , als oberste Lage Nudel mit Speck bestreut.
Im 200°C vorgeheiztem Backofen erst mit Alufolie abgedeckt, ca. ¾ Std., dann ohne Folie, bis die Oberseite knusprig und angebräunt ist weiterbacken.
Dazu einen knackigen Eisbergsalat mit viel grobgehackten Zwiebel, in Wasser, Öl und Essig zubereitet … wobei ich wegen dem Geschmack gerne Kürbiskernöl benutze ...
Ach so, gerne trinke ich dazu einen halbtrockenen Weissen, und, meist beim Kochen vorweg einen leckeren Hefeweizen : - ))
Einen guten Appetit!
Grüße
Magor
Wir sollten uns alle ein Beispiel nehmen am Hort der freiesten und erfolgreichsten Marktwirtschaft der Welt...
oder doch nicht ganz sooo frei??
Factory fizzle
The bulk of job losses last month were concentrated in manufacturing, down 45,000, and retail, off 39,000, although construction hiring was soft as well. Service and government jobs increased.
Average hours worked, the factory workweek and overtime hours were all unchanged last month, a reflection of lackluster demand and high productivity among workers. Average hourly earnings rose 0.3 percent as expected.
The report won`t do much to restore faith in a recovery that has shown very mixed signs in recent weeks.
Although the report missed the target, the story is really little changed: factory job weakness continues to prove a drag on the broader economy, while service and government jobs have held up relatively well.
In the past four months, public jobs have accounted for 59 percent of the 266,000 net new jobs. And the federal government has now completed its hiring of 50,000 security guards for airports, cutting back on its chief reason to hire.
----------
Quelle: CBS http://cbs.marketwatch.com/news/story.asp?guid=%7BE4D82C26%2…
Staatswirtschaft, Sozialismus, ABM in den USA???
Wird Deutschland jetzt links überholt???






oder doch nicht ganz sooo frei??

Factory fizzle
The bulk of job losses last month were concentrated in manufacturing, down 45,000, and retail, off 39,000, although construction hiring was soft as well. Service and government jobs increased.
Average hours worked, the factory workweek and overtime hours were all unchanged last month, a reflection of lackluster demand and high productivity among workers. Average hourly earnings rose 0.3 percent as expected.
The report won`t do much to restore faith in a recovery that has shown very mixed signs in recent weeks.
Although the report missed the target, the story is really little changed: factory job weakness continues to prove a drag on the broader economy, while service and government jobs have held up relatively well.
In the past four months, public jobs have accounted for 59 percent of the 266,000 net new jobs. And the federal government has now completed its hiring of 50,000 security guards for airports, cutting back on its chief reason to hire.
----------
Quelle: CBS http://cbs.marketwatch.com/news/story.asp?guid=%7BE4D82C26%2…
Staatswirtschaft, Sozialismus, ABM in den USA???
Wird Deutschland jetzt links überholt???






.
Hallo Magor, - (#122)
ich seh schon: Du bist ein fleißiger Mensch !
– also das sag ich Dir gleich: da werde ich auf Dauer nicht mithalten
Tja, worum geht´s hier? – Um die wirklich wichtigen Dinge natürlich:
zum Beispiel um Labskaus und die Wahl der richtige Whiskymarke !
Ab und zu fällt dann noch was zur Weltlage im Allgemeinen und zur Befindlichkeit im Besonderen ab...
Wie Du gesehen hast kopiere ich hier zur Erbauung querbeet eine Auswahl meiner "Lesefrüchte". Am Anfang war mir das noch ein wenig peinlich, - ist ja nix auf eigenem Mist gewachsen - aber dann habe ich mir gesagt: Du kriegst keine Kohle dafür, keine Sau wird gezwungen, den Mist hier lesen und zudem kannste sowieso nur das nachplappern, was längst schon irgendwo anders durchgekaut wurde. Und damit bleibt es nun dabei: copy & paste ... -(Aber was hier fehlt kann man stets blitzaktuell bei Thaiguru nachlesen
-(Aber was hier fehlt kann man stets blitzaktuell bei Thaiguru nachlesen 
Erstaunlicherweise gibt es kaum Gemecker. - Im Gegenteil, sogar der "Boardadel" ließ sich hier hin und wieder zu einem Bonmot herab. Da Du vermutlich noch neu hier bist sollte ich wohl hinzufügen: zum "boardadel" zählen (unter viele, vielen anderen natürlich ...) der Hauptstadtgeschädigte Jeffery mit seinem trocken Humor, der Dithmarscher Highlander "Sovereign", ein absolut profunder Malt- und Goldminenexperte - der Japanexperte und Verzweiflungsesoteriker (ich sage nur: Martin Armstrong) "Saccard" – und kürzlich auch der eher ruhige SER-gebeutelte "farmer". Meist glänzend gelaunt sind die Chartexperten talvi, und mickym - und ein ganz besonderer Gruß geht natürlich an Freund waschbär, weil nicht mit der Wimper gezuckt hat, als wir ihm so das Fell über die Ohren gezogen haben ...
So und nun zu den Richtigstellungen:
"durchgedrehter Fisch" ? – und dazu womöglich Aprikosengeist ? - igitt !!!
Original-Labskaus wird nur mit Pökelfleisch oder Corned Beef zubereitet.
Schweinefleisch kommt nur rein, wenn es der Geldbeutel zulässt. Hier noch mal das Originalrezept:
http://www.plattmaster.de/labskaus.htm
Über Dein Rezept müssen wir auch noch reden ! Hat Dein – ich nenne es mal vorsichtig "Nudelauflauf" auch einen Namen ? - Und welcher Kategorie und kulinarischen Region ist es zugehörig ? –
Fragen über Fragen ! – Aber ich höre jetzt erst mal auf,
weil ich mir die NDR 3 – talkshow ansehen möchte.
Einen schönen Abend wünscht
Konradi
PS: Über die Zukunft Afrikas reden wir später noch mal...
Hallo Magor, - (#122)
ich seh schon: Du bist ein fleißiger Mensch !
– also das sag ich Dir gleich: da werde ich auf Dauer nicht mithalten

Tja, worum geht´s hier? – Um die wirklich wichtigen Dinge natürlich:
zum Beispiel um Labskaus und die Wahl der richtige Whiskymarke !

Ab und zu fällt dann noch was zur Weltlage im Allgemeinen und zur Befindlichkeit im Besonderen ab...
Wie Du gesehen hast kopiere ich hier zur Erbauung querbeet eine Auswahl meiner "Lesefrüchte". Am Anfang war mir das noch ein wenig peinlich, - ist ja nix auf eigenem Mist gewachsen - aber dann habe ich mir gesagt: Du kriegst keine Kohle dafür, keine Sau wird gezwungen, den Mist hier lesen und zudem kannste sowieso nur das nachplappern, was längst schon irgendwo anders durchgekaut wurde. Und damit bleibt es nun dabei: copy & paste ...
 -(Aber was hier fehlt kann man stets blitzaktuell bei Thaiguru nachlesen
-(Aber was hier fehlt kann man stets blitzaktuell bei Thaiguru nachlesen 
Erstaunlicherweise gibt es kaum Gemecker. - Im Gegenteil, sogar der "Boardadel" ließ sich hier hin und wieder zu einem Bonmot herab. Da Du vermutlich noch neu hier bist sollte ich wohl hinzufügen: zum "boardadel" zählen (unter viele, vielen anderen natürlich ...) der Hauptstadtgeschädigte Jeffery mit seinem trocken Humor, der Dithmarscher Highlander "Sovereign", ein absolut profunder Malt- und Goldminenexperte - der Japanexperte und Verzweiflungsesoteriker (ich sage nur: Martin Armstrong) "Saccard" – und kürzlich auch der eher ruhige SER-gebeutelte "farmer". Meist glänzend gelaunt sind die Chartexperten talvi, und mickym - und ein ganz besonderer Gruß geht natürlich an Freund waschbär, weil nicht mit der Wimper gezuckt hat, als wir ihm so das Fell über die Ohren gezogen haben ...

So und nun zu den Richtigstellungen:

"durchgedrehter Fisch" ? – und dazu womöglich Aprikosengeist ? - igitt !!!

Original-Labskaus wird nur mit Pökelfleisch oder Corned Beef zubereitet.
Schweinefleisch kommt nur rein, wenn es der Geldbeutel zulässt. Hier noch mal das Originalrezept:
http://www.plattmaster.de/labskaus.htm
Über Dein Rezept müssen wir auch noch reden ! Hat Dein – ich nenne es mal vorsichtig "Nudelauflauf" auch einen Namen ? - Und welcher Kategorie und kulinarischen Region ist es zugehörig ? –
Fragen über Fragen ! – Aber ich höre jetzt erst mal auf,
weil ich mir die NDR 3 – talkshow ansehen möchte.
Einen schönen Abend wünscht
Konradi

PS: Über die Zukunft Afrikas reden wir später noch mal...
Hallo Konradi, 
Danke für die netten Grüsse und gute Laune, denke ich, tut dem Board doch auch oft gut.
Gruss und guten Appetit
Mic

Danke für die netten Grüsse und gute Laune, denke ich, tut dem Board doch auch oft gut.

Gruss und guten Appetit
Mic

Hi all,
habe gerade einen Bekannten getroffen, der in einem Rheinland-Pfälzer Forstamt (er ist selber auch Förster) tätig ist.
Dem ist vor kurzem folgendes passiert:
Morgens kommt er ins Amt und ließt ein Fax, welches besagt, daß bald eine Krisensitzung ansteht weil angeblich 43 Forstämter in Rheinland-Pfalz geschlossen werden sollen.
Wohlgemerkt: In diesem Bundesland gibt es ganze 88 Forstämter!
Abends kommt er in seine Stube zurück;
ein weiteres Fax liegt da: 43 Forstämter werden Ende 2003 endgültig geschlossen! Die dort beschäftigten Mitarbeiter werden bis dahin "sozial verträglich zurückgeführt"...
Junge, junge, junge! Wie abgrundtief muß die finanzielle Misere der öffentlichen Kasse sein, wenn das dafür zuständige Ministerium solche Nacht- und Nebelaktionen tätigen muß!!!!!!!!!!
Was wird das erst in den verschiedenen Forstrevieren geben?
Mir stehen die Haare zu Berge,
Grüße,
Waschbär
habe gerade einen Bekannten getroffen, der in einem Rheinland-Pfälzer Forstamt (er ist selber auch Förster) tätig ist.
Dem ist vor kurzem folgendes passiert:
Morgens kommt er ins Amt und ließt ein Fax, welches besagt, daß bald eine Krisensitzung ansteht weil angeblich 43 Forstämter in Rheinland-Pfalz geschlossen werden sollen.
Wohlgemerkt: In diesem Bundesland gibt es ganze 88 Forstämter!
Abends kommt er in seine Stube zurück;
ein weiteres Fax liegt da: 43 Forstämter werden Ende 2003 endgültig geschlossen! Die dort beschäftigten Mitarbeiter werden bis dahin "sozial verträglich zurückgeführt"...
Junge, junge, junge! Wie abgrundtief muß die finanzielle Misere der öffentlichen Kasse sein, wenn das dafür zuständige Ministerium solche Nacht- und Nebelaktionen tätigen muß!!!!!!!!!!
Was wird das erst in den verschiedenen Forstrevieren geben?
Mir stehen die Haare zu Berge,
Grüße,
Waschbär
Dazu ist ein Wald doch da, damit abgeholzt wird. 
Zurück aus der warmen Türkei....ey Mann und was war denn hier los zum Donnerwetter, .....hatten wir auch 40 Stunden Gewitter am Stück habe ich noch nie erlebt, Allah hat zum Zuckerfest richtig draufgehauen.
J2

Zurück aus der warmen Türkei....ey Mann und was war denn hier los zum Donnerwetter, .....hatten wir auch 40 Stunden Gewitter am Stück habe ich noch nie erlebt, Allah hat zum Zuckerfest richtig draufgehauen.
J2

@waschbär
Das Schliessen der Forstämter ist ökonomisch unsinnig. Gerade beim Thema Wald kommen mir viele schöne Ideen, wie man das Heer der Sozailhilfeempfänger angemessen beschäftigen könnte.
Also frischauf zum Holzschlagen mit denen in den Wald, natürlich alles ökologisch in Handarbeit (Beil und Keil und Handsäge), das ist gesund, die Leuts sind an der frischen Luft und abends sind sie so müde, daß sie nicht in irgendwelchen Bahnhöfen rumlungern oder auf Klautour gehen...
Tolle Idee, oder?
Und wenn jetzt jemand sagt: Es gibt nicht genug Wälder für all die Penner in diesem Land: Wie wär es mit Deichbauarbeiten in Ostdeutschland oder Granitbrechen im Steinbruch?
Bezahlt wird natürlich nichts, wozu bekommen die denn ihre Sozialhilfe?
Gruß
Sovereign
Das Schliessen der Forstämter ist ökonomisch unsinnig. Gerade beim Thema Wald kommen mir viele schöne Ideen, wie man das Heer der Sozailhilfeempfänger angemessen beschäftigen könnte.
Also frischauf zum Holzschlagen mit denen in den Wald, natürlich alles ökologisch in Handarbeit (Beil und Keil und Handsäge), das ist gesund, die Leuts sind an der frischen Luft und abends sind sie so müde, daß sie nicht in irgendwelchen Bahnhöfen rumlungern oder auf Klautour gehen...

Tolle Idee, oder?

Und wenn jetzt jemand sagt: Es gibt nicht genug Wälder für all die Penner in diesem Land: Wie wär es mit Deichbauarbeiten in Ostdeutschland oder Granitbrechen im Steinbruch?
Bezahlt wird natürlich nichts, wozu bekommen die denn ihre Sozialhilfe?
Gruß
Sovereign
Hallo Konradi,
nein, eine Ausgeburt an Fleiß bin ich wahrlich nicht, kann nur aufdrehen,
wenn´s pressiert und mir etwas als wichtig erscheint.
Ich finde es super, daß Du den Fleiß aufbringst interessante Nachrichten vorzufiltern und hier reinzustellen!
Finde ich auch bemerkenswert und klasse an Thai.
Eine einzige Kleinigkeit ..., obwohl schon unverschämt wenn man selbst nicht ähnlichen Fleiß aufbringt:
Ihr habt gute Gründe gefunden, diesen oder jenen Artikel auszuwählen und aufzuzeigen ...
die sind allerdings häufig ellenlang ...
Thai kommentiert seine schonmal kurz, bzw. fettet meist die für ihn wichtig erscheinenden Passagen ... das ist schon beim überfliegen morgens, kurz vor´m Weg zur Arbeit eine riesige Hilfe, herausfiltern zu können, was einen selbst interessierte davon, ergo, ein sich dort durchlesen lohnte ...
Natürlich hat mein Gericht einen Namen, Quark-Rutsche nennt man´s da, wo ich´s herhabe. Bei den Österreichern gibt es Ähnliches, die nennen es Topfennudeln mit Grammerln ... und, Aprikosengeist haben die auch, wennauch mit spürbar viel weniger Sonne ...
Grüße
Magor
nein, eine Ausgeburt an Fleiß bin ich wahrlich nicht, kann nur aufdrehen,
wenn´s pressiert und mir etwas als wichtig erscheint.
Ich finde es super, daß Du den Fleiß aufbringst interessante Nachrichten vorzufiltern und hier reinzustellen!
Finde ich auch bemerkenswert und klasse an Thai.
Eine einzige Kleinigkeit ..., obwohl schon unverschämt wenn man selbst nicht ähnlichen Fleiß aufbringt:
Ihr habt gute Gründe gefunden, diesen oder jenen Artikel auszuwählen und aufzuzeigen ...
die sind allerdings häufig ellenlang ...
Thai kommentiert seine schonmal kurz, bzw. fettet meist die für ihn wichtig erscheinenden Passagen ... das ist schon beim überfliegen morgens, kurz vor´m Weg zur Arbeit eine riesige Hilfe, herausfiltern zu können, was einen selbst interessierte davon, ergo, ein sich dort durchlesen lohnte ...
Natürlich hat mein Gericht einen Namen, Quark-Rutsche nennt man´s da, wo ich´s herhabe. Bei den Österreichern gibt es Ähnliches, die nennen es Topfennudeln mit Grammerln ... und, Aprikosengeist haben die auch, wennauch mit spürbar viel weniger Sonne ...
Grüße
Magor
Ach, Magor, - man kann faul sein und braucht trotzdem nicht auf gutes Essen zu verzichten... 
Hier gibt´s kein fast food, der nachfolgende Bericht holt besonders weit aus...
Damit Du ihn aber schneller verdauen kannst, habe ich extra für Dich einige Zeilen "eingefettet"
Gruß Konradi
- - -
Saturday, December 14, 2002
Australia´s Canadian gold rush
Drew Hasselback
Canadian mining companies control more Australian gold than any other country-including Australia itself. Mining reporter Drew Hasselback travelled to Kalgoorlie, the capital of the continent`s gold industry, and spoke with industry leaders to find out why Canadians have set their sights on this vast desert.
More than a century has passed since saloons and brothels started popping up in this Outback town to cater to starry eyed prospectors on their way to making their fortunes. Today, the ground continues to yield massive amounts of gold and the red light district is as busy as ever, but those scruffy prospectors have been replaced by global mining companies.
"If you want to find gold, you go where the gold is," said David Karpin, director of Placer Dome Inc., at an interview in Sydney. Increasingly, the world`s largest players have been rushing to Australia. Over the past 18 months, Canadian firms alone have spent a staggering $3-billion on acquisitions.
Vancouver-based Placer, Toronto-based Barrick Gold Corp., and the former Franco-Nevada Mining Co. Ltd., have engineered deals that have put Canadian companies in control of more Australian gold than any other country-including Australia itself.
More than 75% of Australia`s gold comes from the vast, empty desert that surrounds Kalgoorlie, the historical and spiritual heart of the continent`s gold industry.
"It`s quite a town, Kalgoorlie. It`s like the Wild West," says Jay Taylor, chief executive of Placer, which has just closed its 100% takeover of AurionGold Ltd., giving it about 5,000 square kilometres of exploration property around Kalgoorlie, not to mention the low-cost Granny Smith mine about 400 kilometres away. "They still have scantily clad gals in bars and things like that. It`s right out of the burlesque days."
Of course, Canadians have flocked to Kalgoorlie for more than the nightlife. In mid-2001, a variety of factors fell into place that triggered a round of consolidation in the gold industry. The major producers were starting to exhaust their existing mines and gold reserves. The price of gold had fallen below US$260 an ounce, lowering the cost of takeover targets. There were signs the gold price was bouncing back, so acquisition minded companies needed to act fast if they wanted to take advantage of the bottom of the market.
The Canadian gold miners were in an excellent position.
"It is true that Toronto, Canada, is the mining capital of the world," says John Ing, president of Maison Placements Canada Ltd. "Any time you want to raise money, you raise it here in Canada. So we`ve been able to build up war chests for these companies and they`ve been able to buy the assets."
Institutional investors have always put a high value on the liquidity of large metal and mining stocks and they were driving gold companies to develop even bigger market capitalizations, says Hamish Douglas, head of mergers and acquisitions for the Sydney office of Deutsche Bank. "The big institutional investors want to get in and out in dollar sizes that matter."
Cheap gold prices made the market ripe for consolidation, and the holy grail of hefty market cap gave Canadian gold producers the motivation to pursue some deals. The only question was where to look. Australia emerged as the natural target.
The world`s two largest gold producing countries are South Africa and the United States.
Nevada, which is responsible for three-quarters of U.S. gold production, was a tough target because mines there are expensive to buy. The geology can also be tricky, making it also an expensive place to mine. Placer learned this the hard way when it bought Getchell Gold Corp. for US$1.1-billion in 1999. It wrote off its investment in Getchell in October, 2001, for US$292-million after mothballing plans to expand and reopen an old mine on the property.
South Africa has cheap assets, but its political situation is risky, especially as the country tries to move beyond the wasted years of apartheid. Toronto-based Franco-Nevada tried to merge with Johannesburg-based Gold Fields Ltd. in 2000 but South African regulators blocked the $3.7-billion proposal. Analysts say the South Africans were upset by plans to base the merged company`s headquarters in Toronto. New South Africa legislation designed to give blacks more of a stake in the country`s mining industry has also left investors skittish, says Ross Norman, analyst with London-based TheBullionDesk.com.
"The problem is that with the mining act, the devil is in the detail and there ain`t no detail. There`s too much discretionary power in there and there`s a fear that with discretionary power ministers will be able to manipulate the situation at some point in time."
So consolidators zeroed in on third-ranked Australia, where a cheap dollar, a hugely unexplored land mass, and political stability have triggered the 21st century gold rush.
"In Australia, you`ve got a common language, stable mining law, freedom of capital and lots of gold in the ground," Mr. Ing says.
Randall Oliphant, Barrick`s chief executive, summed it up in a radio interview with the Australian Broadcasting Corporation last spring: "We like everything about Australia. We like the people here, it`s easy to work in English, there`s a great mining tradition, there`s extraordinary miners, there`s great geological potential."
Foreign companies used to own less than 30% of Australia`s annual gold production. In less than two years, foreigners have acquired control of 74%. Canadians have been front and centre, buying 25% of that production through several notable deals. Placer bought Aurion. Barrick acquired a 50% stake in the Kalgoorlie Super Pit, which is Australia`s largest gold mine. And Toronto-based Franco-Nevada took part in a three-way merger with the other 50% owner of the Super Pit, Australia-based Normandy Mining Ltd. and Denver-based Newmont Mining Corp. The world`s five largest gold producers-Newmont, Barrick, AngloGold Ltd., Gold Fields and Placer-now control 35% of global output. Mr.
Norman believes there`s room for a lot more consolidation down the road. The top five producers in the platinum business control 90% of production, for example. "So the gold market still has a long way to go in terms of consolidating."
The Kalgoorlie deals have left Newmont and Barrick as the two largest gold producers in the world and likely the ones who will drive consolidation in the future. Fifth-ranked Placer has also beefed up in size, though some speculate this may have made it more of a potential target than buyer. "In the end there`s only going to be three of four major producers," says Mr. Douglas of Deutsche Bank in Sydney.
You can debate whether there are opportunities for gold consolidation in the rest of the world, but Australia`s have been largely locked up. Now those consolidators have their hands full trying to tap into Kalgoorlie`s wealth-wealth they can eventually use to expand their empires into other parts of the world.
Kalgoorlie is a long way from Canada. The 19,300-kilometre one-way journey to Kalgoorlie from Toronto involves more than 26 hours of flying time, five in-flight meals and seven in-flight movies. The sun moves into the northern sky as you cross the Equator, and a day drops off the calendar as you cross the International Date Line.
The final leg of the journey involves a flight across a scrubby plain. The earth looks very dry, very red and very empty. If Qantas could fly you to Mars, Western Australia is probably what it would look like.
It`s rough, unforgiving country. In the old days, water was so precious that Kalgoorlie saloon keepers could charge more for it than whisky. The desert appears bland and uninviting, but gold bugs figure there is a lot of gold to be had beneath those sands. The desert landscape does offer a few hints on where to look.
If you look at a map of Western Australia, you`ll see that Kalgoorlie appears to be surrounded by lots of lakes. But this is geographic false advertising. The light blue smudges that purport to be lakes are actually mucky salt flats. The odd splash of rain fills the lake bed, but the water quickly evaporates in the merciless desert heat.
"The first time I ever went out there they showed me a map with this sea of blue on it that said `Lake Carey,`" recalls Mr. Taylor. "Then I went to the spot on the map. I asked, `Where`s the lake?` And they told me, `Right there.` It was dry desert."
Geologists know those salt flats are a clue as to why Western Australia has so much gold. Mr. Taylor`s "Lake" Carey is the product of a bone dry river bed that cuts through the desert. The river is in turn the product of a fault line. Some 1.7 billion years ago, molten gold zoomed up through the crack created by that fault and came to rest in thick horizontal layers near the Earth`s surface, sort of like bands of jelly in a layer cake. The remote, forbidden desert has left these gold bands untouched beneath the sand for eons.
"The gold here is the oldest in the world because Australia is the oldest continent," explains Malcolm Titley, a geologist at Placer`s Granny Smith project. "Australia is an old piece of dirt."
Kalgoorlie`s gold remained hidden until 1893. Paddy Hannan, an Irish prospector, was travelling through the desert when his horse lost a shoe just north of what is today Kalgoorlie. He found 100 ounces of gold near where he stopped to make repairs.
As soon as the find became public, prospectors rushed to Kalgoorlie in search of more gold. But they only looked near the surface. The old-timers had neither the technology nor the financial resources to drill any deeper than 100 metres or so. Which was fine by them.
"Everything was near the surface and they wanted to get at it quickly. The idea was to grab the cash fast," says Research Capital`s Barry Allan. These days a company like Placer has access to more money and better technology. Placer is gambling the sands of the Western Desert, particularly the 5,000 square kilometres of exploration land around Kalgoorlie the company acquired with its purchase of Aurion, will surrender even more gold.
"One of the things that intrigued us about the land package down there is that 98% of the drilling around Kalgoorlie has gone only 100 metres deep," Mr. Taylor says. "We`re going to look in the basement to see what`s there. That to me is exciting."
Indeed, if Mr. Taylor`s explorations reveal that Kalgoorlie is home to more gold than previously thought, it won`t be the first time gold has turned up directly under everyone`s feet.
When the booming town decided it should pave the streets in the early 1900s, it quarried a bunch of local rocks for use as cobblestones. Shortly thereafter, someone figured out the rocks were tellurides, a form of gold-bearing ore. Kalgoorlie had literally paved its streets with gold. It didn`t take long for Kalgoorlie to rip up its valuable cobblestones and squeeze out the gold.
Today, Kalgoorlie is surrounded by stepped kidney-shaped gashes: what Canadians would call open pit mines, but what the Australians call open cuts. The cluster of gold mines around Kalgoorlie make up about 225 tonnes, or 75%, of the 300 tonnes of gold Australia produces each year.
Canadian geologists might be dreaming about the gold yet to be found in the Australian sand, but shareholders tend to be more interested in what companies can get out of the ground immediately. The Canadian rush into Western Australia has left Barrick and Placer owning a lot of those money pits.
The biggest gash is the Kalgoorlie Super Pit, shared 50/50 by Barrick and Newmont. Some 4.5 kilometres long, 1.5 kilometres wide and about 300 metres deep, the hole is so big it can be seen from space. It produces 800,000 ounces of gold a year-about US$250-million worth at today`s prices.
"It`s a fantastic asset," says John Cathcart, mining analyst with the Melbourne office of Commonwealth Bank. But it`s not a great money maker. According to the Australian Gold Council, it costs an average US$231 an ounce to produce gold at the Super Pit, while the average across Australia is US$189. "It`s a low grade deposit that has challenging conditions," Mr. Oliphant says. Barrick and Newmont are drawing up plans to cut costs at the property, something that may result in one of the two companies assuming full operating control. The two firms currently split management duties.
Mr. Oliphant says he does not care which company assumes operating control so long as the Super Pit runs more efficiently. "It`s not about ego. If someone else is prepared to operate it, do a good job and send us the cheques, I`m more than happy to do that."
Wayne Murdy, Newmont`s chief executive, agrees. "Neither one of us were particularly excited about the way the property has been run in the past. We would like one of us to be the operator and not have the kind of management structure we currently have. I`ll be honest with you, my view is that I don`t care who operates it, whether we do or they do. But one of us should operate it."
Placer`s Granny Smith is a five-hour drive north of Kalgoorlie-spitting distance in the endless horizon of the Outback. Placer owned 60% of the mine until this year, when it seized control of Aurion. Now it owns the property outright. Granny Smith consists of several gold deposits spread out along a broad swath of desert. Each deposit has resulted in a large open pit mine. The current pit is called Wallaby, and it is producing about 490,000 ounces of gold a year a cash cost of about US$120 an ounce, well below the Australian average of US$190 an ounce.
"The interesting thing about Western Australia is that the deposits are somewhat like raisins in a huge sea of porridge," Mr. Taylor says. "We started Granny Smith in 1989 with three deposits to exploit. We have ended up with Wallaby, which is the largest anybody has ever seen in that area and is our eleventh deposit."
Open pit mines work because of economies of scale. A hundred years ago, miners could recover more than 40 grams of gold for every tonne of ore they chipped out of the rock, a stunning bonanza by today`s standards. A modern open pit mine in Australia recovers between two and three grams per tonne. But in the old days, miners worked with candlelight, a pickaxe and a wheelbarrow. By comparison, a modern 242-tonne dump truck used today can move as much rock in a few minutes as the old timers could in a lifetime.
"Australia is so underexplored. We`ve hardly touched the surface. People say Australia is inhospitable but it`s nothing like Canada. You can get around 12 months of the year and it`s very, very cheap," says Australia mining legend Robert Champion de Crespigny, who founded and led Normandy until its takeover by Newmont. Mr. Champion de Crespigny oversaw an extraordinary bidding war for Normandy that saw the original bid rise more than 40% in four months to close at US$3.3-billion.
"North America has been fairly well explored. But if you look at Australia, there`s still a lot to do. That was a big appeal to us when we got into the Normandy thing," says Wayne Murdy, chief executive of Newmont. "As exploration technology has improved, there`s clearly a view that there`s a lot more to be found in Australia. It`s a huge, huge area. For the most part, all that`s been discovered have been the outcrops on the surface."

Hier gibt´s kein fast food, der nachfolgende Bericht holt besonders weit aus...
Damit Du ihn aber schneller verdauen kannst, habe ich extra für Dich einige Zeilen "eingefettet"

Gruß Konradi
- - -
Saturday, December 14, 2002
Australia´s Canadian gold rush
Drew Hasselback
Canadian mining companies control more Australian gold than any other country-including Australia itself. Mining reporter Drew Hasselback travelled to Kalgoorlie, the capital of the continent`s gold industry, and spoke with industry leaders to find out why Canadians have set their sights on this vast desert.
More than a century has passed since saloons and brothels started popping up in this Outback town to cater to starry eyed prospectors on their way to making their fortunes. Today, the ground continues to yield massive amounts of gold and the red light district is as busy as ever, but those scruffy prospectors have been replaced by global mining companies.
"If you want to find gold, you go where the gold is," said David Karpin, director of Placer Dome Inc., at an interview in Sydney. Increasingly, the world`s largest players have been rushing to Australia. Over the past 18 months, Canadian firms alone have spent a staggering $3-billion on acquisitions.
Vancouver-based Placer, Toronto-based Barrick Gold Corp., and the former Franco-Nevada Mining Co. Ltd., have engineered deals that have put Canadian companies in control of more Australian gold than any other country-including Australia itself.
More than 75% of Australia`s gold comes from the vast, empty desert that surrounds Kalgoorlie, the historical and spiritual heart of the continent`s gold industry.
"It`s quite a town, Kalgoorlie. It`s like the Wild West," says Jay Taylor, chief executive of Placer, which has just closed its 100% takeover of AurionGold Ltd., giving it about 5,000 square kilometres of exploration property around Kalgoorlie, not to mention the low-cost Granny Smith mine about 400 kilometres away. "They still have scantily clad gals in bars and things like that. It`s right out of the burlesque days."
Of course, Canadians have flocked to Kalgoorlie for more than the nightlife. In mid-2001, a variety of factors fell into place that triggered a round of consolidation in the gold industry. The major producers were starting to exhaust their existing mines and gold reserves. The price of gold had fallen below US$260 an ounce, lowering the cost of takeover targets. There were signs the gold price was bouncing back, so acquisition minded companies needed to act fast if they wanted to take advantage of the bottom of the market.
The Canadian gold miners were in an excellent position.
"It is true that Toronto, Canada, is the mining capital of the world," says John Ing, president of Maison Placements Canada Ltd. "Any time you want to raise money, you raise it here in Canada. So we`ve been able to build up war chests for these companies and they`ve been able to buy the assets."
Institutional investors have always put a high value on the liquidity of large metal and mining stocks and they were driving gold companies to develop even bigger market capitalizations, says Hamish Douglas, head of mergers and acquisitions for the Sydney office of Deutsche Bank. "The big institutional investors want to get in and out in dollar sizes that matter."
Cheap gold prices made the market ripe for consolidation, and the holy grail of hefty market cap gave Canadian gold producers the motivation to pursue some deals. The only question was where to look. Australia emerged as the natural target.
The world`s two largest gold producing countries are South Africa and the United States.
Nevada, which is responsible for three-quarters of U.S. gold production, was a tough target because mines there are expensive to buy. The geology can also be tricky, making it also an expensive place to mine. Placer learned this the hard way when it bought Getchell Gold Corp. for US$1.1-billion in 1999. It wrote off its investment in Getchell in October, 2001, for US$292-million after mothballing plans to expand and reopen an old mine on the property.
South Africa has cheap assets, but its political situation is risky, especially as the country tries to move beyond the wasted years of apartheid. Toronto-based Franco-Nevada tried to merge with Johannesburg-based Gold Fields Ltd. in 2000 but South African regulators blocked the $3.7-billion proposal. Analysts say the South Africans were upset by plans to base the merged company`s headquarters in Toronto. New South Africa legislation designed to give blacks more of a stake in the country`s mining industry has also left investors skittish, says Ross Norman, analyst with London-based TheBullionDesk.com.
"The problem is that with the mining act, the devil is in the detail and there ain`t no detail. There`s too much discretionary power in there and there`s a fear that with discretionary power ministers will be able to manipulate the situation at some point in time."
So consolidators zeroed in on third-ranked Australia, where a cheap dollar, a hugely unexplored land mass, and political stability have triggered the 21st century gold rush.
"In Australia, you`ve got a common language, stable mining law, freedom of capital and lots of gold in the ground," Mr. Ing says.
Randall Oliphant, Barrick`s chief executive, summed it up in a radio interview with the Australian Broadcasting Corporation last spring: "We like everything about Australia. We like the people here, it`s easy to work in English, there`s a great mining tradition, there`s extraordinary miners, there`s great geological potential."
Foreign companies used to own less than 30% of Australia`s annual gold production. In less than two years, foreigners have acquired control of 74%. Canadians have been front and centre, buying 25% of that production through several notable deals. Placer bought Aurion. Barrick acquired a 50% stake in the Kalgoorlie Super Pit, which is Australia`s largest gold mine. And Toronto-based Franco-Nevada took part in a three-way merger with the other 50% owner of the Super Pit, Australia-based Normandy Mining Ltd. and Denver-based Newmont Mining Corp. The world`s five largest gold producers-Newmont, Barrick, AngloGold Ltd., Gold Fields and Placer-now control 35% of global output. Mr.
Norman believes there`s room for a lot more consolidation down the road. The top five producers in the platinum business control 90% of production, for example. "So the gold market still has a long way to go in terms of consolidating."
The Kalgoorlie deals have left Newmont and Barrick as the two largest gold producers in the world and likely the ones who will drive consolidation in the future. Fifth-ranked Placer has also beefed up in size, though some speculate this may have made it more of a potential target than buyer. "In the end there`s only going to be three of four major producers," says Mr. Douglas of Deutsche Bank in Sydney.
You can debate whether there are opportunities for gold consolidation in the rest of the world, but Australia`s have been largely locked up. Now those consolidators have their hands full trying to tap into Kalgoorlie`s wealth-wealth they can eventually use to expand their empires into other parts of the world.
Kalgoorlie is a long way from Canada. The 19,300-kilometre one-way journey to Kalgoorlie from Toronto involves more than 26 hours of flying time, five in-flight meals and seven in-flight movies. The sun moves into the northern sky as you cross the Equator, and a day drops off the calendar as you cross the International Date Line.
The final leg of the journey involves a flight across a scrubby plain. The earth looks very dry, very red and very empty. If Qantas could fly you to Mars, Western Australia is probably what it would look like.
It`s rough, unforgiving country. In the old days, water was so precious that Kalgoorlie saloon keepers could charge more for it than whisky. The desert appears bland and uninviting, but gold bugs figure there is a lot of gold to be had beneath those sands. The desert landscape does offer a few hints on where to look.
If you look at a map of Western Australia, you`ll see that Kalgoorlie appears to be surrounded by lots of lakes. But this is geographic false advertising. The light blue smudges that purport to be lakes are actually mucky salt flats. The odd splash of rain fills the lake bed, but the water quickly evaporates in the merciless desert heat.
"The first time I ever went out there they showed me a map with this sea of blue on it that said `Lake Carey,`" recalls Mr. Taylor. "Then I went to the spot on the map. I asked, `Where`s the lake?` And they told me, `Right there.` It was dry desert."
Geologists know those salt flats are a clue as to why Western Australia has so much gold. Mr. Taylor`s "Lake" Carey is the product of a bone dry river bed that cuts through the desert. The river is in turn the product of a fault line. Some 1.7 billion years ago, molten gold zoomed up through the crack created by that fault and came to rest in thick horizontal layers near the Earth`s surface, sort of like bands of jelly in a layer cake. The remote, forbidden desert has left these gold bands untouched beneath the sand for eons.
"The gold here is the oldest in the world because Australia is the oldest continent," explains Malcolm Titley, a geologist at Placer`s Granny Smith project. "Australia is an old piece of dirt."
Kalgoorlie`s gold remained hidden until 1893. Paddy Hannan, an Irish prospector, was travelling through the desert when his horse lost a shoe just north of what is today Kalgoorlie. He found 100 ounces of gold near where he stopped to make repairs.
As soon as the find became public, prospectors rushed to Kalgoorlie in search of more gold. But they only looked near the surface. The old-timers had neither the technology nor the financial resources to drill any deeper than 100 metres or so. Which was fine by them.
"Everything was near the surface and they wanted to get at it quickly. The idea was to grab the cash fast," says Research Capital`s Barry Allan. These days a company like Placer has access to more money and better technology. Placer is gambling the sands of the Western Desert, particularly the 5,000 square kilometres of exploration land around Kalgoorlie the company acquired with its purchase of Aurion, will surrender even more gold.
"One of the things that intrigued us about the land package down there is that 98% of the drilling around Kalgoorlie has gone only 100 metres deep," Mr. Taylor says. "We`re going to look in the basement to see what`s there. That to me is exciting."
Indeed, if Mr. Taylor`s explorations reveal that Kalgoorlie is home to more gold than previously thought, it won`t be the first time gold has turned up directly under everyone`s feet.
When the booming town decided it should pave the streets in the early 1900s, it quarried a bunch of local rocks for use as cobblestones. Shortly thereafter, someone figured out the rocks were tellurides, a form of gold-bearing ore. Kalgoorlie had literally paved its streets with gold. It didn`t take long for Kalgoorlie to rip up its valuable cobblestones and squeeze out the gold.
Today, Kalgoorlie is surrounded by stepped kidney-shaped gashes: what Canadians would call open pit mines, but what the Australians call open cuts. The cluster of gold mines around Kalgoorlie make up about 225 tonnes, or 75%, of the 300 tonnes of gold Australia produces each year.
Canadian geologists might be dreaming about the gold yet to be found in the Australian sand, but shareholders tend to be more interested in what companies can get out of the ground immediately. The Canadian rush into Western Australia has left Barrick and Placer owning a lot of those money pits.
The biggest gash is the Kalgoorlie Super Pit, shared 50/50 by Barrick and Newmont. Some 4.5 kilometres long, 1.5 kilometres wide and about 300 metres deep, the hole is so big it can be seen from space. It produces 800,000 ounces of gold a year-about US$250-million worth at today`s prices.
"It`s a fantastic asset," says John Cathcart, mining analyst with the Melbourne office of Commonwealth Bank. But it`s not a great money maker. According to the Australian Gold Council, it costs an average US$231 an ounce to produce gold at the Super Pit, while the average across Australia is US$189. "It`s a low grade deposit that has challenging conditions," Mr. Oliphant says. Barrick and Newmont are drawing up plans to cut costs at the property, something that may result in one of the two companies assuming full operating control. The two firms currently split management duties.
Mr. Oliphant says he does not care which company assumes operating control so long as the Super Pit runs more efficiently. "It`s not about ego. If someone else is prepared to operate it, do a good job and send us the cheques, I`m more than happy to do that."
Wayne Murdy, Newmont`s chief executive, agrees. "Neither one of us were particularly excited about the way the property has been run in the past. We would like one of us to be the operator and not have the kind of management structure we currently have. I`ll be honest with you, my view is that I don`t care who operates it, whether we do or they do. But one of us should operate it."
Placer`s Granny Smith is a five-hour drive north of Kalgoorlie-spitting distance in the endless horizon of the Outback. Placer owned 60% of the mine until this year, when it seized control of Aurion. Now it owns the property outright. Granny Smith consists of several gold deposits spread out along a broad swath of desert. Each deposit has resulted in a large open pit mine. The current pit is called Wallaby, and it is producing about 490,000 ounces of gold a year a cash cost of about US$120 an ounce, well below the Australian average of US$190 an ounce.
"The interesting thing about Western Australia is that the deposits are somewhat like raisins in a huge sea of porridge," Mr. Taylor says. "We started Granny Smith in 1989 with three deposits to exploit. We have ended up with Wallaby, which is the largest anybody has ever seen in that area and is our eleventh deposit."
Open pit mines work because of economies of scale. A hundred years ago, miners could recover more than 40 grams of gold for every tonne of ore they chipped out of the rock, a stunning bonanza by today`s standards. A modern open pit mine in Australia recovers between two and three grams per tonne. But in the old days, miners worked with candlelight, a pickaxe and a wheelbarrow. By comparison, a modern 242-tonne dump truck used today can move as much rock in a few minutes as the old timers could in a lifetime.
"Australia is so underexplored. We`ve hardly touched the surface. People say Australia is inhospitable but it`s nothing like Canada. You can get around 12 months of the year and it`s very, very cheap," says Australia mining legend Robert Champion de Crespigny, who founded and led Normandy until its takeover by Newmont. Mr. Champion de Crespigny oversaw an extraordinary bidding war for Normandy that saw the original bid rise more than 40% in four months to close at US$3.3-billion.
"North America has been fairly well explored. But if you look at Australia, there`s still a lot to do. That was a big appeal to us when we got into the Normandy thing," says Wayne Murdy, chief executive of Newmont. "As exploration technology has improved, there`s clearly a view that there`s a lot more to be found in Australia. It`s a huge, huge area. For the most part, all that`s been discovered have been the outcrops on the surface."
hier gibt´s ein paar Bildchen von Kalgoorlie :
http://www.kalgoorlie.com/imagegal.asp
http://www.kalgoorlie.com/imagegal.asp
Hallo Konradi!
Du in DownUnder? Dich hat´s aber weit verschlagen, mitten ins Nowhere ...
Den Shiraz Kabernet lasse ich mir gerne von dort einfliegen : - ),
bist Du dafür dorthin, oder wolltest Du Dir die Nuggets selber holen?
Viel Spaß und Erfolg beim schürfen!
Wäre Esperance nicht eher etwas zum faulenzen und gut essen?
Danke für Deinen "Special Service"! Macht der Text auch gleich mehr her!
Grüße
Magor
Du in DownUnder? Dich hat´s aber weit verschlagen, mitten ins Nowhere ...
Den Shiraz Kabernet lasse ich mir gerne von dort einfliegen : - ),
bist Du dafür dorthin, oder wolltest Du Dir die Nuggets selber holen?
Viel Spaß und Erfolg beim schürfen!
Wäre Esperance nicht eher etwas zum faulenzen und gut essen?
Danke für Deinen "Special Service"! Macht der Text auch gleich mehr her!
Grüße
Magor
schön wär´s ...
ich erhole mich nur von meiner Grippe und reise
via Internet durch die Kontinente ...
ich erhole mich nur von meiner Grippe und reise
via Internet durch die Kontinente ...

FAZ 17.12.2002
San Francisco : Der Rausch ist vorbei
Von Heinrich Wefing
San Francisco steckt in der Krise: Die Stadt stürzt, und die Aussicht nach unten ist grausam ...
Auf Ansichtskarten von San Francisco ist immer nur die Golden Gate Bridge zu sehen, das majestätische Monstrum aus rotem Stahl, das scheinbar schwebend das "Goldene Tor" am Pazifischen Ozean überspannt. Dabei ist es gar nicht die Golden Gate Bridge, an der die Stadt hängt, sondern eher deren unansehnliche Schwester, die Bay Bridge, über die Menschen und Waren von Ost nach West in die Metropole strömen oder zurück in die Vororte am Ostufer der Bucht, nach Berkeley und weiter in die Tiefe des amerikanischen Raums.
Auf zehn Spuren in zwei Ebenen übereinander rollt der Verkehr unaufhörlich hin und her, quält sich auf einer langen Rampe von Oakland kommend in die Höhe, taucht auf der künstlichen Insel Treasure Island durch einen Tunnel und rast dann auf die Türme von downtown zu, lauter Ausrufezeichen aus Beton und Spiegelglas und Stahl, die San Francisco ein wenig wie New York aussehen lassen. Eine Weile scheint es fast, als führe die Hochstraße direkt in den Finanzdistrikt hinein, als wolle sich die enorme Trasse zwischen den Wolkenkratzern hindurchschlängeln, doch ehe man Bankiers oder Anwälten auf ihre Schreibtische im dreißigsten Stock schauen kann, geht der gewaltigen Brücke die Luft aus, die Rampen sinken hinab, und die Betonbänder drehen nach links weg, nach Süden, in Richtung Silicon Valley.
Illuminierter Leerstand
Wie in jedem Dezember ist die Silhouette der Hochhäuser gegenüber der Bay Bridge auch in diesem Jahr prächtig illuminiert. Blau, rot und golden glühen die Dächer und Kuppeln der Türme. Die Büros sind lang nach Feierabend noch erleuchtet, und Lichtbänder zeichnen so raffiniert die Konturen der Wolkenkratzer nach, daß diese sich zu vervielfachen scheinen. Wo tagsüber nur ein einziger Vielgeschosser aufragt, da glaubt man nachts, wenn man auf der Brücke fährt, vier oder fünf funkelnde Turmhäuser zu sehen.
Natürlich ist diese Illusion der Fülle festlich gedacht, als Vorglanz des Weihnachtsschmucks daheim und als Manifest des Überflusses. Aber das Zauberwerk aus Neon kann den Mangel nur für einen Moment verhüllen. So wie die skyscraper im Morgengrauen ihre vertrauten Umrisse zurückgewinnen, so verfliegt bei näherem Hinsehen auch der Eindruck der Geschäftigkeit. Hinter dem weihnachtlichen Lichterschleier liegen viele Etagen verwaist und kalt. Gut dreißig Prozent der Büroflächen in San Francisco stehen leer, die Nachfrage sinkt weiter. Es ist, einstweilen jedenfalls, das deutlichste Zeichen der Krise, in der die Stadt an der Bucht steckt.
Einsparziel: Zehn Milliarden Dollar
Ganz Kalifornien wird von der Rezession gebeutelt. Der Staat, der sich gern damit brüstet, seine Wirtschaftskraft liege gleichauf mit der von Frankreich, hat gewaltige Schulden. Als die Steuern dank des High-Tech-Booms Ende der neunziger Jahre wie ein breiter Strom in die öffentlichen Kassen flossen, da warfen die Politiker mit dem Geld nur so um sich. Sie stellten vierzigtausend neue Staatsdiener ein, weiteten die Gesundheitsversorgung für die unteren Einkommensschichten aus und senkten sogar die Gebühren für die Führerscheinprüfung. Nun, da die Blase geplatzt ist, sind die Tage des staatlichen Konsumrauschs vorbei.
Der eben erst wiedergewählte Gouverneur Davis hat gerade ein Notprogramm verkündet, das mit einer Härte, die in Deutschland undenkbar wäre, bis zum kommenden Juli zehn Milliarden Dollar einsparen soll. Aber das wird nicht genügen. Das Haushaltsloch ist, in den Worten des Parlamentspräsidenten Herb Wesson, "so tief und so breit, daß wir immer noch mit sechs Milliarden Dollar in der Kreide stünden, selbst wenn wir jeden Staatsbediensteten - jeden Park-Ranger, jeden College-Professor und jeden Polizisten - entlassen würden".
Aufwachen nach Jahren des Rauschs
Mit dröhnendem Schädel erwacht Kalifornien aus den Träumen von der schönen neuen Technologie-Welt. Aber nirgends ist der Kater so schlimm wie in San Francisco. Denn San Francisco war die Hauptstadt der Internet-Welt. Aufstieg und Fall der Dot.Com-Konjunktur sind oft beschrieben worden. Die Legenden von den pickeligen Multimillionären, die morgens für atemraubende Summen virtuelle Geschäftsideen an Wagniskapitalisten losschlugen und nachts Partys feierten, werden immer noch mit einer Mischung aus Wehmut und Erstaunen erzählt.
In fünf Jahren wuchs die Stadt um fast fünfzigtausend Einwohner, alljährlich wurden an die 700.000 Websites freigeschaltet, fünfzig Milliarden Dollar flossen allein im Jahr 2000 in "start up"-Unternehmen der Stadt, und die Zahl der Haushalte mit einem Jahreseinkommen über 150.000 Dollar stieg um satte 327 Prozent. In San Francisco Geld zu verdienen, schrieb unlängst der Londoner "Independent", war so unkompliziert wie die Liebe in den Tagen der Hippies. Niemand, der dabei war, möchte diese späten Neunziger missen. Es war ein rauschhafter Moment, der vier, fünf Jahre dauerte und dann mit einem Schlag endete. Mit einem Schlag, den die ganze Welt zu hören bekam.
Stadtflucht des Mittelstands
Manche Chronisten des Crashs datieren den Beginn des Zusammenbruchs auf die Woche um den 10. April 2001, als die Technologiebörse Nasdaq in New York innerhalb kürzester Zeit ein Viertel ihres Wertes verlor und sich die unfaßbare Summe von fünfundzwanzig Trillionen, also fünfundzwanzigtausend Milliarden Dollar in Luft auflöste. Wie ein Mann, der mit Anlauf über eine Klippe gesprungen ist, noch eine Weile mit den Beinen strampelt, während er fällt, zappelten auch die Börsenkurse noch ein wenig, zogen für ein paar Tage immer mal wieder an, ehe sie hinabsausten. Seither stürzt auch San Francisco. Immer tiefer. Der Fallwind reißt eisig an der Stadt, und die Aussicht nach unten ist grausam.
Niemand weiß so recht, wo die Milliarden und Abermilliarden geblieben sind, die in die Blasenwirtschaft gepumpt wurden, und ebenso unklar ist, wohin sich die jugendlichen Entrepreneure von einst verdrückt haben, all die porschefahrenden Bengel, die für ein, zwei Einfälle Millionen kassieren konnten, wenn in ihrem Konzept nur die Worte Netz und Zukunft und Innovation auftauchten. Aber um diese heute Dreißigjährigen, die schneller enorme Vermögen verdient und verloren haben als ihre Eltern Bausparverträge unterzeichnen konnten, muß man sich keine großen Sorgen machen. Viel ärger hat es die getroffen, die von der Internet-Schickeria verdrängt wurden: die Immigranten, Einzelhändler und Handwerker, die aus ihren Wohnungen und Werkstätten getrieben wurden, als die Mieten auf der Höhe des Booms explodierten und aus jeder Garage ein Loft werden sollte. Die Mittelständler, die nur vierzigtausend Dollar im Jahr verdienen, sind an die Peripherie geflohen, in die nicht-schicken Vororte oder haben ganz aufgegeben. Und sie werden nicht wiederkehren.
Die brennenden Mülltonnen kommen wieder
Weite Stadtteile, die ehedem eine halbwegs lebendige Mischung aus Wohnen und Gewerbe kannten, sind verödet. Das Quartier "South of Market" etwa, das Investoren und Stadtplaner schon zum zweiten Silicon Valley emporphantasiert hatten, liegt weithin brach. Die wenigen Bürohäuser, an denen dort noch gebaut wird, werden für den Leerstand vollendet. Der "South Park", ein Rasenoval, das von niedrigen Häusern umstanden wird, die fast holländisch anmuten, ist wieder in seine frühere Beschaulichkeit zurückgefallen. Vorbei die Tage, da man in den Bistros ringsum keinen Café Latte trinken konnte, ohne ein paar Jobangebote in der Internet-Industrie auszuschlagen. Noch sind die Obdachlosen nicht zurückgekehrt, die sich hier Anfang der Neunziger an brennenden Mülleimern wärmten. Aber wenn es so weitergeht mit der Stadt und dem Staat Kalifornien, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Penner den "South Park" wieder übernehmen.
Es gibt kaum mehr einen Lebensbereich, der von der Rezession verschont wäre. Die Zahl der Arbeitslosen steigt, immer mehr Firmen müssen Konkurs anmelden, der Anteil derer, die krankenversichert sind, sinkt. Und zu den schlechten Unternehmensnachrichten kommen die Hiobsbotschaften aus der Gesellschaft. Lehrer werden entlassen, Studiengebühren erhöht, und die Wohltätigkeitsorganisationen haben kaum genug, um die wachsende Schar der Hungrigen zu speisen. In den Regalen der Heilsarmee von San Francisco, die zu Weihnachten Geschenke an Kinder aus armen Familien verteilt, herrscht beängstigende Leere. Auf einem Foto in der Lokalzeitung sah man jüngst in den Schränken, die sonst um diese Jahreszeit überquellen, nur einen einsamen Teddybär neben einem Plüschhund sitzen.
Kein Geld für neue Impulse
Auch die Kultur, in den Vereinigten Staaten traditionell noch weitaus stärker auf die guten Gaben privater Wohltäter angewiesen als in Europa, leidet unter der Krise. Die Oper von San Francisco mußte ihre Spielpläne straffen, die San Jose Symphony hat Mitte November nach 123 Jahren den Betrieb eingestellt. Das Jüdische Museum San Francisco, das sich eben erst mit seinem Schwesterinstitut in Berkeley zusammengeschlossen hatte, entläßt acht seiner neunzehn Mitarbeiter, darunter die stellvertretende Direktorin, und hat sich einstweilen von dem Traum verabschiedet, ein altes Kraftwerk nach rasanten Skizzen des Berliner Architekten Daniel Libeskind umbauen zu lassen.
Natürlich ist das abrupte Ende ehrgeiziger Bauvorhaben dieser Tage keine Spezialität von San Francisco. In New York mußte das arg gerupfte Guggenheim-Imperium die Pläne für einen Neubau von Frank Gehry begraben, und in Los Angeles hat das "County Museum of Art" eben erst bekanntgegeben, daß es nichts werde mit der Totalsanierung des Kunstquartiers am Wilshire Boulevard nach Entwürfen des Architekturgurus Rem Koolhaas: Die vierhundert Millionen Dollar für den Bau ließen sich momentan einfach nicht auftreiben. Gleichwohl ist der Aufschub des Libeskind-Projekts in San Francisco doppelt bitter. Denn auch das dafür vorgesehene Grundstück liegt "South of Market", in dem Stadtteil also, der vom Ende des Silizium-Rauschs besonders hart getroffen wurde und neue Impulse dringend nötig hätte.
Spendenbüchsen an der Golden Gate Bridge
Längst schon ist das wachsende Elend auf den Straßen kaum mehr zu übersehen. Auch an Ecken, die bislang als "ordentlich" galten, tauchen mehr und mehr Obdachlose auf. Auf den Hauptstraßen steht mitunter an jeder Ampel ein Zerzauster mit verfilztem Bart, streckt den bei Rot Haltenden die leeren Hände entgegen. Bei den Wahlen im November hat denn auch eine lokale Initiative überwältigende Zustimmung gefunden, die vorgeschlagen hatte, den Obdachlosen die Sozialhilfe nicht mehr bar, sondern in Form von Warengutscheinen auszuzahlen. Für San Francisco, das sich so viel auf seine liberale Gesinnung und altlinke Zivilität zugute hält, ist das mehr als nur ein administratives Detail. Die Entscheidung, mit der sich die Hoffnung auf ein Verschwinden der "homeless" verbindet, ist so etwas wie eine politische Wetterwende, ein Klimasturz, der ahnen läßt, wie tief die Verunsicherung reicht.
Und es ist nicht ohne ätzende Ironie, daß dieselbe Stadt, die die Bettler zu verdrängen sucht, demnächst selbst mit der Wegelagerei beginnen will. Ausgerechnet an den Fußgängerzugängen zur Golden Gate Bridge will die Brückenverwaltung Spendenbüchsen anbringen lassen. Sie hofft, mit den milden Gaben der Touristen ihr gewaltiges Defizit ein wenig drücken zu können. Seit dem 11. September sind die Versicherungsprämien und die Kosten für die Bewachung des Wahrzeichens von San Francisco in die Höhe geschnellt, während zugleich deutlich weniger Autos und Laster die Mautstellen passieren. Nicht einmal eine saftige Anhebung des Brückenzolls auf fünf Dollar hat der unabhängig wirtschaftenden "Transit Authority" einen ausgeglichenen Haushalt beschert. Deshalb hoffen die Brückenmanager jetzt auf die Opferbereitschaft der Schaulustigen. "Wenn jemand zwei Dollar geben will, um über die schöne Brücke zu spazieren, werden wir das Geld gerne nehmen", erklärte jüngst die stellvertretende Direktorin der Brückenverwaltung. Aber es müssen nicht unbedingt zwei Dollar sein: "Wir nehmen auch Yen oder Euro. Wir nehmen, was wir kriegen können."
San Francisco : Der Rausch ist vorbei
Von Heinrich Wefing
San Francisco steckt in der Krise: Die Stadt stürzt, und die Aussicht nach unten ist grausam ...
Auf Ansichtskarten von San Francisco ist immer nur die Golden Gate Bridge zu sehen, das majestätische Monstrum aus rotem Stahl, das scheinbar schwebend das "Goldene Tor" am Pazifischen Ozean überspannt. Dabei ist es gar nicht die Golden Gate Bridge, an der die Stadt hängt, sondern eher deren unansehnliche Schwester, die Bay Bridge, über die Menschen und Waren von Ost nach West in die Metropole strömen oder zurück in die Vororte am Ostufer der Bucht, nach Berkeley und weiter in die Tiefe des amerikanischen Raums.
Auf zehn Spuren in zwei Ebenen übereinander rollt der Verkehr unaufhörlich hin und her, quält sich auf einer langen Rampe von Oakland kommend in die Höhe, taucht auf der künstlichen Insel Treasure Island durch einen Tunnel und rast dann auf die Türme von downtown zu, lauter Ausrufezeichen aus Beton und Spiegelglas und Stahl, die San Francisco ein wenig wie New York aussehen lassen. Eine Weile scheint es fast, als führe die Hochstraße direkt in den Finanzdistrikt hinein, als wolle sich die enorme Trasse zwischen den Wolkenkratzern hindurchschlängeln, doch ehe man Bankiers oder Anwälten auf ihre Schreibtische im dreißigsten Stock schauen kann, geht der gewaltigen Brücke die Luft aus, die Rampen sinken hinab, und die Betonbänder drehen nach links weg, nach Süden, in Richtung Silicon Valley.
Illuminierter Leerstand
Wie in jedem Dezember ist die Silhouette der Hochhäuser gegenüber der Bay Bridge auch in diesem Jahr prächtig illuminiert. Blau, rot und golden glühen die Dächer und Kuppeln der Türme. Die Büros sind lang nach Feierabend noch erleuchtet, und Lichtbänder zeichnen so raffiniert die Konturen der Wolkenkratzer nach, daß diese sich zu vervielfachen scheinen. Wo tagsüber nur ein einziger Vielgeschosser aufragt, da glaubt man nachts, wenn man auf der Brücke fährt, vier oder fünf funkelnde Turmhäuser zu sehen.
Natürlich ist diese Illusion der Fülle festlich gedacht, als Vorglanz des Weihnachtsschmucks daheim und als Manifest des Überflusses. Aber das Zauberwerk aus Neon kann den Mangel nur für einen Moment verhüllen. So wie die skyscraper im Morgengrauen ihre vertrauten Umrisse zurückgewinnen, so verfliegt bei näherem Hinsehen auch der Eindruck der Geschäftigkeit. Hinter dem weihnachtlichen Lichterschleier liegen viele Etagen verwaist und kalt. Gut dreißig Prozent der Büroflächen in San Francisco stehen leer, die Nachfrage sinkt weiter. Es ist, einstweilen jedenfalls, das deutlichste Zeichen der Krise, in der die Stadt an der Bucht steckt.
Einsparziel: Zehn Milliarden Dollar
Ganz Kalifornien wird von der Rezession gebeutelt. Der Staat, der sich gern damit brüstet, seine Wirtschaftskraft liege gleichauf mit der von Frankreich, hat gewaltige Schulden. Als die Steuern dank des High-Tech-Booms Ende der neunziger Jahre wie ein breiter Strom in die öffentlichen Kassen flossen, da warfen die Politiker mit dem Geld nur so um sich. Sie stellten vierzigtausend neue Staatsdiener ein, weiteten die Gesundheitsversorgung für die unteren Einkommensschichten aus und senkten sogar die Gebühren für die Führerscheinprüfung. Nun, da die Blase geplatzt ist, sind die Tage des staatlichen Konsumrauschs vorbei.
Der eben erst wiedergewählte Gouverneur Davis hat gerade ein Notprogramm verkündet, das mit einer Härte, die in Deutschland undenkbar wäre, bis zum kommenden Juli zehn Milliarden Dollar einsparen soll. Aber das wird nicht genügen. Das Haushaltsloch ist, in den Worten des Parlamentspräsidenten Herb Wesson, "so tief und so breit, daß wir immer noch mit sechs Milliarden Dollar in der Kreide stünden, selbst wenn wir jeden Staatsbediensteten - jeden Park-Ranger, jeden College-Professor und jeden Polizisten - entlassen würden".
Aufwachen nach Jahren des Rauschs
Mit dröhnendem Schädel erwacht Kalifornien aus den Träumen von der schönen neuen Technologie-Welt. Aber nirgends ist der Kater so schlimm wie in San Francisco. Denn San Francisco war die Hauptstadt der Internet-Welt. Aufstieg und Fall der Dot.Com-Konjunktur sind oft beschrieben worden. Die Legenden von den pickeligen Multimillionären, die morgens für atemraubende Summen virtuelle Geschäftsideen an Wagniskapitalisten losschlugen und nachts Partys feierten, werden immer noch mit einer Mischung aus Wehmut und Erstaunen erzählt.
In fünf Jahren wuchs die Stadt um fast fünfzigtausend Einwohner, alljährlich wurden an die 700.000 Websites freigeschaltet, fünfzig Milliarden Dollar flossen allein im Jahr 2000 in "start up"-Unternehmen der Stadt, und die Zahl der Haushalte mit einem Jahreseinkommen über 150.000 Dollar stieg um satte 327 Prozent. In San Francisco Geld zu verdienen, schrieb unlängst der Londoner "Independent", war so unkompliziert wie die Liebe in den Tagen der Hippies. Niemand, der dabei war, möchte diese späten Neunziger missen. Es war ein rauschhafter Moment, der vier, fünf Jahre dauerte und dann mit einem Schlag endete. Mit einem Schlag, den die ganze Welt zu hören bekam.
Stadtflucht des Mittelstands
Manche Chronisten des Crashs datieren den Beginn des Zusammenbruchs auf die Woche um den 10. April 2001, als die Technologiebörse Nasdaq in New York innerhalb kürzester Zeit ein Viertel ihres Wertes verlor und sich die unfaßbare Summe von fünfundzwanzig Trillionen, also fünfundzwanzigtausend Milliarden Dollar in Luft auflöste. Wie ein Mann, der mit Anlauf über eine Klippe gesprungen ist, noch eine Weile mit den Beinen strampelt, während er fällt, zappelten auch die Börsenkurse noch ein wenig, zogen für ein paar Tage immer mal wieder an, ehe sie hinabsausten. Seither stürzt auch San Francisco. Immer tiefer. Der Fallwind reißt eisig an der Stadt, und die Aussicht nach unten ist grausam.
Niemand weiß so recht, wo die Milliarden und Abermilliarden geblieben sind, die in die Blasenwirtschaft gepumpt wurden, und ebenso unklar ist, wohin sich die jugendlichen Entrepreneure von einst verdrückt haben, all die porschefahrenden Bengel, die für ein, zwei Einfälle Millionen kassieren konnten, wenn in ihrem Konzept nur die Worte Netz und Zukunft und Innovation auftauchten. Aber um diese heute Dreißigjährigen, die schneller enorme Vermögen verdient und verloren haben als ihre Eltern Bausparverträge unterzeichnen konnten, muß man sich keine großen Sorgen machen. Viel ärger hat es die getroffen, die von der Internet-Schickeria verdrängt wurden: die Immigranten, Einzelhändler und Handwerker, die aus ihren Wohnungen und Werkstätten getrieben wurden, als die Mieten auf der Höhe des Booms explodierten und aus jeder Garage ein Loft werden sollte. Die Mittelständler, die nur vierzigtausend Dollar im Jahr verdienen, sind an die Peripherie geflohen, in die nicht-schicken Vororte oder haben ganz aufgegeben. Und sie werden nicht wiederkehren.
Die brennenden Mülltonnen kommen wieder
Weite Stadtteile, die ehedem eine halbwegs lebendige Mischung aus Wohnen und Gewerbe kannten, sind verödet. Das Quartier "South of Market" etwa, das Investoren und Stadtplaner schon zum zweiten Silicon Valley emporphantasiert hatten, liegt weithin brach. Die wenigen Bürohäuser, an denen dort noch gebaut wird, werden für den Leerstand vollendet. Der "South Park", ein Rasenoval, das von niedrigen Häusern umstanden wird, die fast holländisch anmuten, ist wieder in seine frühere Beschaulichkeit zurückgefallen. Vorbei die Tage, da man in den Bistros ringsum keinen Café Latte trinken konnte, ohne ein paar Jobangebote in der Internet-Industrie auszuschlagen. Noch sind die Obdachlosen nicht zurückgekehrt, die sich hier Anfang der Neunziger an brennenden Mülleimern wärmten. Aber wenn es so weitergeht mit der Stadt und dem Staat Kalifornien, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Penner den "South Park" wieder übernehmen.
Es gibt kaum mehr einen Lebensbereich, der von der Rezession verschont wäre. Die Zahl der Arbeitslosen steigt, immer mehr Firmen müssen Konkurs anmelden, der Anteil derer, die krankenversichert sind, sinkt. Und zu den schlechten Unternehmensnachrichten kommen die Hiobsbotschaften aus der Gesellschaft. Lehrer werden entlassen, Studiengebühren erhöht, und die Wohltätigkeitsorganisationen haben kaum genug, um die wachsende Schar der Hungrigen zu speisen. In den Regalen der Heilsarmee von San Francisco, die zu Weihnachten Geschenke an Kinder aus armen Familien verteilt, herrscht beängstigende Leere. Auf einem Foto in der Lokalzeitung sah man jüngst in den Schränken, die sonst um diese Jahreszeit überquellen, nur einen einsamen Teddybär neben einem Plüschhund sitzen.
Kein Geld für neue Impulse
Auch die Kultur, in den Vereinigten Staaten traditionell noch weitaus stärker auf die guten Gaben privater Wohltäter angewiesen als in Europa, leidet unter der Krise. Die Oper von San Francisco mußte ihre Spielpläne straffen, die San Jose Symphony hat Mitte November nach 123 Jahren den Betrieb eingestellt. Das Jüdische Museum San Francisco, das sich eben erst mit seinem Schwesterinstitut in Berkeley zusammengeschlossen hatte, entläßt acht seiner neunzehn Mitarbeiter, darunter die stellvertretende Direktorin, und hat sich einstweilen von dem Traum verabschiedet, ein altes Kraftwerk nach rasanten Skizzen des Berliner Architekten Daniel Libeskind umbauen zu lassen.
Natürlich ist das abrupte Ende ehrgeiziger Bauvorhaben dieser Tage keine Spezialität von San Francisco. In New York mußte das arg gerupfte Guggenheim-Imperium die Pläne für einen Neubau von Frank Gehry begraben, und in Los Angeles hat das "County Museum of Art" eben erst bekanntgegeben, daß es nichts werde mit der Totalsanierung des Kunstquartiers am Wilshire Boulevard nach Entwürfen des Architekturgurus Rem Koolhaas: Die vierhundert Millionen Dollar für den Bau ließen sich momentan einfach nicht auftreiben. Gleichwohl ist der Aufschub des Libeskind-Projekts in San Francisco doppelt bitter. Denn auch das dafür vorgesehene Grundstück liegt "South of Market", in dem Stadtteil also, der vom Ende des Silizium-Rauschs besonders hart getroffen wurde und neue Impulse dringend nötig hätte.
Spendenbüchsen an der Golden Gate Bridge
Längst schon ist das wachsende Elend auf den Straßen kaum mehr zu übersehen. Auch an Ecken, die bislang als "ordentlich" galten, tauchen mehr und mehr Obdachlose auf. Auf den Hauptstraßen steht mitunter an jeder Ampel ein Zerzauster mit verfilztem Bart, streckt den bei Rot Haltenden die leeren Hände entgegen. Bei den Wahlen im November hat denn auch eine lokale Initiative überwältigende Zustimmung gefunden, die vorgeschlagen hatte, den Obdachlosen die Sozialhilfe nicht mehr bar, sondern in Form von Warengutscheinen auszuzahlen. Für San Francisco, das sich so viel auf seine liberale Gesinnung und altlinke Zivilität zugute hält, ist das mehr als nur ein administratives Detail. Die Entscheidung, mit der sich die Hoffnung auf ein Verschwinden der "homeless" verbindet, ist so etwas wie eine politische Wetterwende, ein Klimasturz, der ahnen läßt, wie tief die Verunsicherung reicht.
Und es ist nicht ohne ätzende Ironie, daß dieselbe Stadt, die die Bettler zu verdrängen sucht, demnächst selbst mit der Wegelagerei beginnen will. Ausgerechnet an den Fußgängerzugängen zur Golden Gate Bridge will die Brückenverwaltung Spendenbüchsen anbringen lassen. Sie hofft, mit den milden Gaben der Touristen ihr gewaltiges Defizit ein wenig drücken zu können. Seit dem 11. September sind die Versicherungsprämien und die Kosten für die Bewachung des Wahrzeichens von San Francisco in die Höhe geschnellt, während zugleich deutlich weniger Autos und Laster die Mautstellen passieren. Nicht einmal eine saftige Anhebung des Brückenzolls auf fünf Dollar hat der unabhängig wirtschaftenden "Transit Authority" einen ausgeglichenen Haushalt beschert. Deshalb hoffen die Brückenmanager jetzt auf die Opferbereitschaft der Schaulustigen. "Wenn jemand zwei Dollar geben will, um über die schöne Brücke zu spazieren, werden wir das Geld gerne nehmen", erklärte jüngst die stellvertretende Direktorin der Brückenverwaltung. Aber es müssen nicht unbedingt zwei Dollar sein: "Wir nehmen auch Yen oder Euro. Wir nehmen, was wir kriegen können."
"San Francisco steckt in der Krise: Die Stadt stürzt, und die Aussicht nach unten ist grausam ... "
Fehlt eigentlich nur noch, daß der St. Andreasgraben mal wieder seismisch aktiv wird. Bei einem Beben auf der Richterskala von 8,5 (wäre zeitlich gesehen mal wieder überfällig) hat der Begriif "Die Stadt stürzt" gleich eine ganz andere Bedeutung....Also Münchener Rück shorten!
Fehlt eigentlich nur noch, daß der St. Andreasgraben mal wieder seismisch aktiv wird. Bei einem Beben auf der Richterskala von 8,5 (wäre zeitlich gesehen mal wieder überfällig) hat der Begriif "Die Stadt stürzt" gleich eine ganz andere Bedeutung....Also Münchener Rück shorten!

DIE ZEIT 52/2002

Atombombe gefällig ?
Terroristen brauchen keine Schurkenstaaten, um sich mit Massenvernichtungswaffen einzudecken.
Ein ABC der Bedrohung von Jochen Bittner
Auf völkerrechtliche Verträge hoffen? Das ist nichts für eine Supermacht im Dauerkriegszustand mit einer Armee von Terroristen. – So steht’s zwischen den Zeilen des neuen Strategiepapiers aus Washington. Explizit lautet die klare Ansage aus dem Weißen Haus: „Die Vereinigten Staaten (…) behalten sich das Recht vor, (…) mit allen Mitteln auf den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu reagieren.“ Sollten Pockenviren aus dem Irak in die New Yorker U-Bahn gelangen, könnte als Vergeltung eine Atomrakete gen Bagdad fliegen.
Nur fünf Tage nach der Veröffentlichung dieses Dokuments scheint ein Brief aus Pjöngjang an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien der neuen amerikanischen Abschreckungsstrategie gegen die Verbreitung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen Recht zu geben. Nordkorea verlangt von der IAEO, sie möge ihre Kameras zur Überwachung der Kernkraftwerke wieder abschrauben. Die Volksrepublik wolle ihr Atomprogramm künftig ungestört betreiben. – Faktisch eine Kündigung des Nichtverbreitungsvertrages, mit dem sich seit 1970 188 Staaten verpflichteten, Atomenergie nur friedlich und unter Aufsicht einzusetzen. „Kontrolle ist gut, atomare Abschreckung ist besser“ – so falsch scheint die amerikanische Sicht nicht zu sein.
Aber sind es wirklich die ABC-Arsenale der angeblichen Terrorismussponsoren wie Nordkorea, Irak, Iran, Syrien und Libyen, von denen der westlichen Welt katastrophale Angriffe drohen? Sie sind es jedenfalls nicht allein. Wollten Terroristen tatsächlich radioaktive Bomben basteln, tödliche Viren verbreiten oder Giftgas einsetzen – sie wären nicht auf die Hilfe von „Schurkenstaaten“ angewiesen.
„Quellen für radioaktives Material gibt es überall auf der Welt“, sagt der Generaldirektor der IAEO, Mohamed ElBaradei. „Das Problem des nuklearen Terrorismus gründet nicht notwendig im Irak, sondern in all dem Material, das nicht vernünftig geschützt ist, besonders in der früheren Sowjetunion.“ Es ist vor allem die Erbmasse des Ost-West-Konflikts, aus dem der neue Terrorismus seine Waffen schmieden könnte. So seltsam es klingt: Die Abrüstung ist auch ein Risiko.
Annähernd 20 000 demontierte taktische Nuklearsprengköpfe lagern immer noch in Russland. Und die spärlich bewachten Lagerplätze quellen schon jetzt über. Mark Galeotti, Russlandforscher an der britischen Universität Keele, berichtet, von den 123 ehemals sowjetischen Lagern für Nuklearwaffen und -material seien bisher nur 60 mit modernen Zäunen und Alarmanlagen ausgerüstet. Hinzu kommen Depots mit schätzungsweise 1000 Tonnen hochangereichertem Uran – genug für 20 000 Atombomben – sowie 160 Tonnen waffenfähiges Plutonium. Von den verrottenden Atom-U-Booten in Murmansk ganz zu schweigen. Kaum noch überwacht werden laut Galeotti Abfallhalden für radioaktives Material aus ziviler Nutzung. Ausgerechnet in Tschetschenien befinde sich eine solche Nuklearmüllhalde. Niemand wisse, sagt Galeotti, ob sie nicht bereits von tschetschenischen Rebellen geplündert worden sei. Auf den Weltmeeren sind außerdem ständig Frachter mit radioaktivem Abfall unterwegs. Leichte Beute für Kaperer.
Das Gefährliche an Atomschrott mit Resten von Cäsium oder Strontium: Er wäre das Rohmaterial für so genannte Schmutzige Bomben, ein vergleichsweise leicht herzustellendes Gemisch aus konventionellem Sprengstoff und strahlenden Substanzen. Bei der Explosion einer solchen „ABombe des armen Mannes“ müssten Menschen nicht einmal unmittelbar verletzt werden. Aber das Zentrum einer Großstadt ließe sich damit auf Jahrzehnte unbewohnbar machen.
Anfang dieses Jahres veröffentlichte der amerikanische Rat der Nachrichtendienste einen Bericht, wonach russische Behörden zwischen 1991 und 1999 insgesamt 23 Diebstahlsversuche von Nuklearmaterial vereitelten. Zudem habe es mehrere bestätigte Diebstahlsfälle in Größenord- nungen gegeben, die zusammen ausreichten, um eine Atombombe zu produzieren. Die IAEO registrierte bereits 175 Fälle, in denen Nuklearmaterial beschlagnahmt wurde, das aus den früheren Sowjetstaaten herausgeschmuggelt werden sollte. „Es ist eine fürchterliche Ironie, dass wir heute mit einer größeren Bedrohung konfrontiert sind als zu Hochzeiten des Kalten Krieges“, bilanziert der US-Senator Richard Lugar. Er ist einer der Initiatoren eines amerikanisch-russischen Programms zum Abbau nuklearer Altlasten, für das die USA in den vergangenen zehn Jahren etwa 4 Milliarden Dollar ausgegeben haben.
Eine vergleichsweise bescheidene Investition, denn glaubt man einer aktuellen Hochrechnung aus dem Haushaltsbüro des US-Kongresses, könnte ein zweimonatiger Krieg gegen den Irak bis zu 200 Milliarden verschlingen. Immerhin: Im Sommer einigten sich die G-8-Staaten darauf, in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Dollar aufzubringen, um die Profilerationskontrollen an den Grenzen zu verstärken, vorhandenes Nuklearmaterial besser zu sichern und das russische Plutonium zu entsorgen.
Beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf sitzen ein Jurist und ein Mediziner, die einem gründlich den Tag verderben können. Peter Herby, Leiter der Abteilung für Minen und Waffen, und den B-Waffenexperten Robin Coupland verbindet seit einiger Zeit eine gemeinsame Sorge. Alle Welt jubele über die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, aber offenbar, warnen die beiden, mache sich niemand Gedanken darüber, was dieser medizinische Meilenstein für die Entwicklung neuartiger biologischer Waffen bedeuten könne. Viren, die gezielt Träger bestimmter genetischer Merkmale angreifen, etwa Menschen mit dunkler Haut oder blauen Augen? Ein grippeähnlicher Erreger, der alle Männer einer Bevölkerungsgruppe unfruchtbar macht?
Schon 1999 beantwortete die British Medical Association in einem Report mit dem Titel Biotechnology, Weapons and Humanity die Frage, ob derartige genetische Waffen in absehbarer Zukunft hergestellt werden könnten, mit einem vorsichtigen Ja. Demnach könnten spezifische Eigenschaften im Erbgut nicht nur als Andockstellen für hoffnungsvolle pharmazeutische Entwicklungen dienen, sondern auch als Zielkoordinaten für maßgeschneiderte Ethnowaffen.
1998 berichteten die britische Sunday Times und die Militärfachzeitschrift Jane’s Foreign Report,
Israel arbeite an der Produktion transgener Bakterien und Viren, „die nur im Organismus von Arabern, vornehmlich Irakis, tödliche Reaktionen hervorrufen würden“. Die Erreger hätten – als Antwort auf einen etwaigen B- oder C-Waffenschlag Saddam Husseins – in das Trinkwassersystem von Bagdad eingeschleust werden sollen. „Falls das alles nicht möglich ist“, sagt Robin Coupland, „sollten wir keinen Alarm schlagen. Falls doch, sollten wir dies allerdings tun. Das Problem ist: Wir wissen es nicht.“ Gerade deswegen, mahnen die Genfer Spezialisten, sei es Zeit zu handeln. „Wir müssen die moralische Debatte jetzt eröffnen“, fordert der Jurist Peter Herby.
Im September veröffentlichte das IKRK einen eindringlichen Appell, nicht nur an Regierungen, sondern auch an Industrie und Wissenschaft. Um die Verbreitung von mörderischer Biotechnologie zu verhindern, müssten schnellstens schärfere Gesetze und Kontrollen geschaffen werden, und zwar überall auf der Welt: „Wir rufen Sie dringend auf zu bedenken, an welcher Schwelle wir stehen, und sich auf unsere gemeinsame Humanität zu besinnen.“ Einen vergleichbaren Appell des IKRK hat es bisher nur einmal gegeben: 1918, nach den Giftgaseinsätzen im Ersten Weltkrieg. Zwar verbietet seit 1975 das Biowaffen-Übereinkommen die Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer Waffen und fordert deren Vernichtung. Seit mittlerweile zehn Jahren aber beraten die Mitgliedsländer darüber, wie die Einhaltung des Abkommens in der Praxis kontrolliert werden könnte; gedacht war an eine Lösung nach dem Vorbild der Wiener Atomaufsichtsbehörde. Im November scheiterten die Verhandlungen endgültig, nicht zuletzt, weil die USA alle Vorschläge zur besseren Kontrolle als aussichtslos verwarfen.
Die Supermacht setzt lieber auf verlässliche Eigenvorsorge. Als Teil eines milliardenschweren Terrorschutzprogramms entsteht in Los Alamos gerade ein neues Hochsicherheitslabor, in dem auch an lebenden Erregern geforscht werden kann. Offizieller Zweck der Einrichtung: „Verminderung der Biobedrohung“. Der amerikanische Rechtsprofessor Francis Boyle, bekannt geworden als Architekt von Anti-Biowaffen-Gesetzen, hat Zweifel: „Ich bin mir sicher, dass der Ausbau der Herstellung von Waffen dienen soll.“
Chemiewaffenforscher träumen schon lange von einem Gas, das Menschen schlagartig bewusstlos macht, sie aber nicht tötet. Im Moskauer Musicaltheater hat das offenbar nicht funktioniert – das mysteriöse K.-o.-Gas der Spezialeinheiten tötete 117 Menschen. Offiziell ließ die russische Regierung verlauten, es habe sich um Fentanyl gehandelt, ein Opiat, das nicht auf der Verbotsliste des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) auftaucht. In Fachkreisen aber zeigte man sich beeindruckt von der ungeheuren Wirksamkeit des Agens. „Irgendwer hat da etwas gefunden, das den Körper in Sekundenschnelle lahm legt“, wundert sich der britische Chemiewaffenexperte Julian Robinson.
Ebenso wie bei den Biowaffen wächst auch die Entwicklung von Chemiewaffen über die völkerrechtlichen Restriktionen hinaus. „Die meisten neuen Wirkstoffe werden aus Vorläufern hergestellt, die nicht im CWÜ aufgelistet sind“, sagt Mark Wheelis, Mikrobiologe an der Universität von Kalifornien. „Sie sind für das Abkommen daher praktisch unsichtbar, obwohl sie natürlich verboten sein müssten.“ Neue, gefährliche Kampfstoffe, die in kein Kontrollraster fallen – sie ließen sich mühelos über Grenzen verbreiten.
Mindestens genauso besorgniserregend sind die chemischen Altlasten. Das CWÜ, von 147 Staaten ratifiziert, fordert seit 1997 die Vernichtung aller C-Waffen. Bis Ende April 2000 sollte danach wenigstens 1 Prozent aller VX-, Sarin- und Senfgasbestände unschädlich gemacht sein. Während Amerika über dieses Ziel hinausschoss und bis Ende 2000 bereits 19 Prozent der Kampfstoffe vernichtet hatte, hofft Russland, von seinen 40000 Tonnen bis zum kommenden Mai wenigstens 400 entsorgen zu können. Und niemand weiß, wie viel chemische Munition nach dem Zweiten Weltkrieg in Afrika zurückgeblieben ist. Allein in das besetzte Äthiopien soll der italienische Diktator Mussolini in den dreißiger Jahren mehrere Tonnen Giftgas verschifft haben. Verbleib unbekannt.
In Moskau fehlt derzeit schlicht das Geld für die Beseitigung des Overkill-Potenzials. Das verarmte Riesenreich müsste dafür schätzungsweise 3 Milliarden Dollar aufbringen. Gerade erst hat der US-Kongress 70 Millionen Dollar eingefroren, mit denen das russische Arsenal weiter abgebaut werden sollte. Der einstige Erzfeind ist verärgert, weil die Russen ihren Pflichten aus dem CWÜ nicht pünktlich nachkommen.
Damit, klagt Abrüstungslobbyist Richard Lugar, blieben der Welt vorerst zwei Millionen chemischer Artilleriegranaten und Scud-Raketensprengköpfe erhalten. „Klein und leicht zu transportieren und tödlich in den Händen von Terroristen.“ Von sieben russischen Depots meinen Experten, sie seien auch für unautorisierte Personen zugänglich.
War al-Qaida vielleicht schon da? Im Oktober 2001 prahlte Osama Bin Laden gegenüber einer pakistanischen Zeitung mit einer Drohung, die ebenso entschlossen wirkt wie das neue Strategiepapier aus Washington: „Falls Amerika chemische oder nukleare Waffen gegen uns einsetzt, werden wir mit chemischen und nuklearen Waffen zurückschlagen. Wir besitzen solche Waffen als Abschreckungsmittel.“

Atombombe gefällig ?
Terroristen brauchen keine Schurkenstaaten, um sich mit Massenvernichtungswaffen einzudecken.
Ein ABC der Bedrohung von Jochen Bittner
Auf völkerrechtliche Verträge hoffen? Das ist nichts für eine Supermacht im Dauerkriegszustand mit einer Armee von Terroristen. – So steht’s zwischen den Zeilen des neuen Strategiepapiers aus Washington. Explizit lautet die klare Ansage aus dem Weißen Haus: „Die Vereinigten Staaten (…) behalten sich das Recht vor, (…) mit allen Mitteln auf den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu reagieren.“ Sollten Pockenviren aus dem Irak in die New Yorker U-Bahn gelangen, könnte als Vergeltung eine Atomrakete gen Bagdad fliegen.
Nur fünf Tage nach der Veröffentlichung dieses Dokuments scheint ein Brief aus Pjöngjang an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien der neuen amerikanischen Abschreckungsstrategie gegen die Verbreitung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen Recht zu geben. Nordkorea verlangt von der IAEO, sie möge ihre Kameras zur Überwachung der Kernkraftwerke wieder abschrauben. Die Volksrepublik wolle ihr Atomprogramm künftig ungestört betreiben. – Faktisch eine Kündigung des Nichtverbreitungsvertrages, mit dem sich seit 1970 188 Staaten verpflichteten, Atomenergie nur friedlich und unter Aufsicht einzusetzen. „Kontrolle ist gut, atomare Abschreckung ist besser“ – so falsch scheint die amerikanische Sicht nicht zu sein.
Aber sind es wirklich die ABC-Arsenale der angeblichen Terrorismussponsoren wie Nordkorea, Irak, Iran, Syrien und Libyen, von denen der westlichen Welt katastrophale Angriffe drohen? Sie sind es jedenfalls nicht allein. Wollten Terroristen tatsächlich radioaktive Bomben basteln, tödliche Viren verbreiten oder Giftgas einsetzen – sie wären nicht auf die Hilfe von „Schurkenstaaten“ angewiesen.
„Quellen für radioaktives Material gibt es überall auf der Welt“, sagt der Generaldirektor der IAEO, Mohamed ElBaradei. „Das Problem des nuklearen Terrorismus gründet nicht notwendig im Irak, sondern in all dem Material, das nicht vernünftig geschützt ist, besonders in der früheren Sowjetunion.“ Es ist vor allem die Erbmasse des Ost-West-Konflikts, aus dem der neue Terrorismus seine Waffen schmieden könnte. So seltsam es klingt: Die Abrüstung ist auch ein Risiko.
Annähernd 20 000 demontierte taktische Nuklearsprengköpfe lagern immer noch in Russland. Und die spärlich bewachten Lagerplätze quellen schon jetzt über. Mark Galeotti, Russlandforscher an der britischen Universität Keele, berichtet, von den 123 ehemals sowjetischen Lagern für Nuklearwaffen und -material seien bisher nur 60 mit modernen Zäunen und Alarmanlagen ausgerüstet. Hinzu kommen Depots mit schätzungsweise 1000 Tonnen hochangereichertem Uran – genug für 20 000 Atombomben – sowie 160 Tonnen waffenfähiges Plutonium. Von den verrottenden Atom-U-Booten in Murmansk ganz zu schweigen. Kaum noch überwacht werden laut Galeotti Abfallhalden für radioaktives Material aus ziviler Nutzung. Ausgerechnet in Tschetschenien befinde sich eine solche Nuklearmüllhalde. Niemand wisse, sagt Galeotti, ob sie nicht bereits von tschetschenischen Rebellen geplündert worden sei. Auf den Weltmeeren sind außerdem ständig Frachter mit radioaktivem Abfall unterwegs. Leichte Beute für Kaperer.
Das Gefährliche an Atomschrott mit Resten von Cäsium oder Strontium: Er wäre das Rohmaterial für so genannte Schmutzige Bomben, ein vergleichsweise leicht herzustellendes Gemisch aus konventionellem Sprengstoff und strahlenden Substanzen. Bei der Explosion einer solchen „ABombe des armen Mannes“ müssten Menschen nicht einmal unmittelbar verletzt werden. Aber das Zentrum einer Großstadt ließe sich damit auf Jahrzehnte unbewohnbar machen.
Anfang dieses Jahres veröffentlichte der amerikanische Rat der Nachrichtendienste einen Bericht, wonach russische Behörden zwischen 1991 und 1999 insgesamt 23 Diebstahlsversuche von Nuklearmaterial vereitelten. Zudem habe es mehrere bestätigte Diebstahlsfälle in Größenord- nungen gegeben, die zusammen ausreichten, um eine Atombombe zu produzieren. Die IAEO registrierte bereits 175 Fälle, in denen Nuklearmaterial beschlagnahmt wurde, das aus den früheren Sowjetstaaten herausgeschmuggelt werden sollte. „Es ist eine fürchterliche Ironie, dass wir heute mit einer größeren Bedrohung konfrontiert sind als zu Hochzeiten des Kalten Krieges“, bilanziert der US-Senator Richard Lugar. Er ist einer der Initiatoren eines amerikanisch-russischen Programms zum Abbau nuklearer Altlasten, für das die USA in den vergangenen zehn Jahren etwa 4 Milliarden Dollar ausgegeben haben.
Eine vergleichsweise bescheidene Investition, denn glaubt man einer aktuellen Hochrechnung aus dem Haushaltsbüro des US-Kongresses, könnte ein zweimonatiger Krieg gegen den Irak bis zu 200 Milliarden verschlingen. Immerhin: Im Sommer einigten sich die G-8-Staaten darauf, in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Dollar aufzubringen, um die Profilerationskontrollen an den Grenzen zu verstärken, vorhandenes Nuklearmaterial besser zu sichern und das russische Plutonium zu entsorgen.
Beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf sitzen ein Jurist und ein Mediziner, die einem gründlich den Tag verderben können. Peter Herby, Leiter der Abteilung für Minen und Waffen, und den B-Waffenexperten Robin Coupland verbindet seit einiger Zeit eine gemeinsame Sorge. Alle Welt jubele über die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, aber offenbar, warnen die beiden, mache sich niemand Gedanken darüber, was dieser medizinische Meilenstein für die Entwicklung neuartiger biologischer Waffen bedeuten könne. Viren, die gezielt Träger bestimmter genetischer Merkmale angreifen, etwa Menschen mit dunkler Haut oder blauen Augen? Ein grippeähnlicher Erreger, der alle Männer einer Bevölkerungsgruppe unfruchtbar macht?
Schon 1999 beantwortete die British Medical Association in einem Report mit dem Titel Biotechnology, Weapons and Humanity die Frage, ob derartige genetische Waffen in absehbarer Zukunft hergestellt werden könnten, mit einem vorsichtigen Ja. Demnach könnten spezifische Eigenschaften im Erbgut nicht nur als Andockstellen für hoffnungsvolle pharmazeutische Entwicklungen dienen, sondern auch als Zielkoordinaten für maßgeschneiderte Ethnowaffen.
1998 berichteten die britische Sunday Times und die Militärfachzeitschrift Jane’s Foreign Report,
Israel arbeite an der Produktion transgener Bakterien und Viren, „die nur im Organismus von Arabern, vornehmlich Irakis, tödliche Reaktionen hervorrufen würden“. Die Erreger hätten – als Antwort auf einen etwaigen B- oder C-Waffenschlag Saddam Husseins – in das Trinkwassersystem von Bagdad eingeschleust werden sollen. „Falls das alles nicht möglich ist“, sagt Robin Coupland, „sollten wir keinen Alarm schlagen. Falls doch, sollten wir dies allerdings tun. Das Problem ist: Wir wissen es nicht.“ Gerade deswegen, mahnen die Genfer Spezialisten, sei es Zeit zu handeln. „Wir müssen die moralische Debatte jetzt eröffnen“, fordert der Jurist Peter Herby.
Im September veröffentlichte das IKRK einen eindringlichen Appell, nicht nur an Regierungen, sondern auch an Industrie und Wissenschaft. Um die Verbreitung von mörderischer Biotechnologie zu verhindern, müssten schnellstens schärfere Gesetze und Kontrollen geschaffen werden, und zwar überall auf der Welt: „Wir rufen Sie dringend auf zu bedenken, an welcher Schwelle wir stehen, und sich auf unsere gemeinsame Humanität zu besinnen.“ Einen vergleichbaren Appell des IKRK hat es bisher nur einmal gegeben: 1918, nach den Giftgaseinsätzen im Ersten Weltkrieg. Zwar verbietet seit 1975 das Biowaffen-Übereinkommen die Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer Waffen und fordert deren Vernichtung. Seit mittlerweile zehn Jahren aber beraten die Mitgliedsländer darüber, wie die Einhaltung des Abkommens in der Praxis kontrolliert werden könnte; gedacht war an eine Lösung nach dem Vorbild der Wiener Atomaufsichtsbehörde. Im November scheiterten die Verhandlungen endgültig, nicht zuletzt, weil die USA alle Vorschläge zur besseren Kontrolle als aussichtslos verwarfen.
Die Supermacht setzt lieber auf verlässliche Eigenvorsorge. Als Teil eines milliardenschweren Terrorschutzprogramms entsteht in Los Alamos gerade ein neues Hochsicherheitslabor, in dem auch an lebenden Erregern geforscht werden kann. Offizieller Zweck der Einrichtung: „Verminderung der Biobedrohung“. Der amerikanische Rechtsprofessor Francis Boyle, bekannt geworden als Architekt von Anti-Biowaffen-Gesetzen, hat Zweifel: „Ich bin mir sicher, dass der Ausbau der Herstellung von Waffen dienen soll.“
Chemiewaffenforscher träumen schon lange von einem Gas, das Menschen schlagartig bewusstlos macht, sie aber nicht tötet. Im Moskauer Musicaltheater hat das offenbar nicht funktioniert – das mysteriöse K.-o.-Gas der Spezialeinheiten tötete 117 Menschen. Offiziell ließ die russische Regierung verlauten, es habe sich um Fentanyl gehandelt, ein Opiat, das nicht auf der Verbotsliste des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) auftaucht. In Fachkreisen aber zeigte man sich beeindruckt von der ungeheuren Wirksamkeit des Agens. „Irgendwer hat da etwas gefunden, das den Körper in Sekundenschnelle lahm legt“, wundert sich der britische Chemiewaffenexperte Julian Robinson.
Ebenso wie bei den Biowaffen wächst auch die Entwicklung von Chemiewaffen über die völkerrechtlichen Restriktionen hinaus. „Die meisten neuen Wirkstoffe werden aus Vorläufern hergestellt, die nicht im CWÜ aufgelistet sind“, sagt Mark Wheelis, Mikrobiologe an der Universität von Kalifornien. „Sie sind für das Abkommen daher praktisch unsichtbar, obwohl sie natürlich verboten sein müssten.“ Neue, gefährliche Kampfstoffe, die in kein Kontrollraster fallen – sie ließen sich mühelos über Grenzen verbreiten.
Mindestens genauso besorgniserregend sind die chemischen Altlasten. Das CWÜ, von 147 Staaten ratifiziert, fordert seit 1997 die Vernichtung aller C-Waffen. Bis Ende April 2000 sollte danach wenigstens 1 Prozent aller VX-, Sarin- und Senfgasbestände unschädlich gemacht sein. Während Amerika über dieses Ziel hinausschoss und bis Ende 2000 bereits 19 Prozent der Kampfstoffe vernichtet hatte, hofft Russland, von seinen 40000 Tonnen bis zum kommenden Mai wenigstens 400 entsorgen zu können. Und niemand weiß, wie viel chemische Munition nach dem Zweiten Weltkrieg in Afrika zurückgeblieben ist. Allein in das besetzte Äthiopien soll der italienische Diktator Mussolini in den dreißiger Jahren mehrere Tonnen Giftgas verschifft haben. Verbleib unbekannt.
In Moskau fehlt derzeit schlicht das Geld für die Beseitigung des Overkill-Potenzials. Das verarmte Riesenreich müsste dafür schätzungsweise 3 Milliarden Dollar aufbringen. Gerade erst hat der US-Kongress 70 Millionen Dollar eingefroren, mit denen das russische Arsenal weiter abgebaut werden sollte. Der einstige Erzfeind ist verärgert, weil die Russen ihren Pflichten aus dem CWÜ nicht pünktlich nachkommen.
Damit, klagt Abrüstungslobbyist Richard Lugar, blieben der Welt vorerst zwei Millionen chemischer Artilleriegranaten und Scud-Raketensprengköpfe erhalten. „Klein und leicht zu transportieren und tödlich in den Händen von Terroristen.“ Von sieben russischen Depots meinen Experten, sie seien auch für unautorisierte Personen zugänglich.
War al-Qaida vielleicht schon da? Im Oktober 2001 prahlte Osama Bin Laden gegenüber einer pakistanischen Zeitung mit einer Drohung, die ebenso entschlossen wirkt wie das neue Strategiepapier aus Washington: „Falls Amerika chemische oder nukleare Waffen gegen uns einsetzt, werden wir mit chemischen und nuklearen Waffen zurückschlagen. Wir besitzen solche Waffen als Abschreckungsmittel.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2002, Nr. 296 / Seite 27
Gold ist so teuer wie seit 5 Jahren nicht mehr
Jahresrendite erreicht auf Dollarbasis 26 Prozent / Rally von niedrigen Zinsen begünstigt
ruh. FRANKFURT, 19. Dezember. Die wachsende Angst der Anleger vor den Folgen eines Kriegs im Irak hat den Preisanstieg auf dem Goldmarkt verstärkt. Am Donnerstag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,104 Gramm) erstmals seit gut fünf Jahren über 350 Dollar. In der Spitze wurde Gold mit 355 Dollar gehandelt. Allerdings fiel der Preis im weiteren Verlauf wieder und lag am Nachmittag bei 344 Dollar je Feinunze. Trotz dieser Gegenbewegung hat er seit Anfang Dezember knapp 10 Prozent zugelegt. Gold-Anleger, die in Dollar abrechnen, freuen sich seit Jahresbeginn über eine Rendite von rund 26 Prozent. Für Investoren aus dem Euro-Raum allerdings sind es nur 9 Prozent. Die Mehrzahl der Analysten und Händler hält eine Fortsetzung des Trends für möglich. Sie warnen aber vor den Risiken.
"Vor allem die Longpositionen der Hedgefonds machen uns Sorgen", sagt Michael Blumenroth, Frankfurter Edelmetallhändler der Deutschen Bank. Die meisten Hedgefonds setzen auf einen steigenden Goldpreis; gerade ihr Optimismus könnte zum Ursprung des nächsten Rückschlags werden. So ist die Zahl der spekulativen Kaufpositionen an der New Yorker Terminbörse Comex auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen. Die Netto-Longpositionen der Hedgefonds betragen 100 000. Sie haben also gut 10 Millionen Unzen oder 311 Tonnen Gold auf Termin gekauft. An einem schwachen Tag mit fallendem Goldpreis müßten viele dieser Hausse-Spekulanten ihre Positionen aufgeben, um Verluste zu vermeiden. So könnte eine sich selbst verstärkende Abwärtsbewegung beginnen.
Trotz dieses Rückschlagrisikos erwartet Blumenroth aber, daß die Aussichten für Gold-Investoren günstig bleiben. So wirke sich günstig aus, daß viele Produzenten ihr Gold nicht mehr auf Termin verkauften, bevor es überhaupt gefördert ist. In der langen Phase fallender Preise hatten sie sich so erträgliche Abnahmepreise gesichert - und zugleich zum Preisverfall beigetragen. Diese Preissicherung (Hedging) werde derzeit in weitaus geringerem Umfang betrieben.
Positiv für den Goldpreis sei zudem das niedrige Zinsniveau, ergänzt Hans-Günter Ritter, Händler bei Heraeus. Gold ist eine Geldanlage, die abgesehen von möglichen Preissteigerungen keine Rendite abwirft. Je niedriger das Zinsniveau, desto geringer sind auch die Erträge, auf die die Anleger verzichten, wenn sie ihrem Sicherheitsbedürfnis nachgeben und das gelbe Metall kaufen. Gold sei außerdem als Fluchtwährung eine Alternative zum Dollar, erläutert Ritter. Diese Vermutung wird durch die Korrelation des Goldpreises mit dem Außenwert des Dollar belegt. Wenn der Dollar in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber anderen Währungen an Attraktivität verlor, profitierte auch der Goldmarkt.
Privatanleger haben eine Reihe von Möglichkeiten von einem steigenden Goldpreis zu profitieren. Besonders riskant ist ein Engagement an der Terminbörse. Zudem liegt die Einschußverpflichtung für einen Kontrakt auf 100 Unzen bei rund 5000 Dollar. Sicherheitsfanatiker sollten eher auf eine direkte Investition setzen. Dafür stellen einige Banken ein Goldkonto bereit, das wie ein Devisenkonto funktioniert. Auch der Kauf von Goldbarren ist möglich. Er lohnt sich allerdings erst bei größeren Mengen. Denn die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis der Banken beträgt bei 10-Gramm-Barren etwa 15 Prozent (103/121 Euro). Bei einem 500-Gramm-Barren sind es 5 Prozent (5268/5547 Euro). Wer das Edelmetall nicht selbst besitzen will, kann sich auch an den Minengesellschaften beteiligen, die Gold fördern. Fonds, die solche Aktien besitzen, haben in diesem Jahr Wertsteigerungen von bis zu 70 Prozent verzeichnet.
Gold ist so teuer wie seit 5 Jahren nicht mehr
Jahresrendite erreicht auf Dollarbasis 26 Prozent / Rally von niedrigen Zinsen begünstigt
ruh. FRANKFURT, 19. Dezember. Die wachsende Angst der Anleger vor den Folgen eines Kriegs im Irak hat den Preisanstieg auf dem Goldmarkt verstärkt. Am Donnerstag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,104 Gramm) erstmals seit gut fünf Jahren über 350 Dollar. In der Spitze wurde Gold mit 355 Dollar gehandelt. Allerdings fiel der Preis im weiteren Verlauf wieder und lag am Nachmittag bei 344 Dollar je Feinunze. Trotz dieser Gegenbewegung hat er seit Anfang Dezember knapp 10 Prozent zugelegt. Gold-Anleger, die in Dollar abrechnen, freuen sich seit Jahresbeginn über eine Rendite von rund 26 Prozent. Für Investoren aus dem Euro-Raum allerdings sind es nur 9 Prozent. Die Mehrzahl der Analysten und Händler hält eine Fortsetzung des Trends für möglich. Sie warnen aber vor den Risiken.
"Vor allem die Longpositionen der Hedgefonds machen uns Sorgen", sagt Michael Blumenroth, Frankfurter Edelmetallhändler der Deutschen Bank. Die meisten Hedgefonds setzen auf einen steigenden Goldpreis; gerade ihr Optimismus könnte zum Ursprung des nächsten Rückschlags werden. So ist die Zahl der spekulativen Kaufpositionen an der New Yorker Terminbörse Comex auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen. Die Netto-Longpositionen der Hedgefonds betragen 100 000. Sie haben also gut 10 Millionen Unzen oder 311 Tonnen Gold auf Termin gekauft. An einem schwachen Tag mit fallendem Goldpreis müßten viele dieser Hausse-Spekulanten ihre Positionen aufgeben, um Verluste zu vermeiden. So könnte eine sich selbst verstärkende Abwärtsbewegung beginnen.
Trotz dieses Rückschlagrisikos erwartet Blumenroth aber, daß die Aussichten für Gold-Investoren günstig bleiben. So wirke sich günstig aus, daß viele Produzenten ihr Gold nicht mehr auf Termin verkauften, bevor es überhaupt gefördert ist. In der langen Phase fallender Preise hatten sie sich so erträgliche Abnahmepreise gesichert - und zugleich zum Preisverfall beigetragen. Diese Preissicherung (Hedging) werde derzeit in weitaus geringerem Umfang betrieben.
Positiv für den Goldpreis sei zudem das niedrige Zinsniveau, ergänzt Hans-Günter Ritter, Händler bei Heraeus. Gold ist eine Geldanlage, die abgesehen von möglichen Preissteigerungen keine Rendite abwirft. Je niedriger das Zinsniveau, desto geringer sind auch die Erträge, auf die die Anleger verzichten, wenn sie ihrem Sicherheitsbedürfnis nachgeben und das gelbe Metall kaufen. Gold sei außerdem als Fluchtwährung eine Alternative zum Dollar, erläutert Ritter. Diese Vermutung wird durch die Korrelation des Goldpreises mit dem Außenwert des Dollar belegt. Wenn der Dollar in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber anderen Währungen an Attraktivität verlor, profitierte auch der Goldmarkt.
Privatanleger haben eine Reihe von Möglichkeiten von einem steigenden Goldpreis zu profitieren. Besonders riskant ist ein Engagement an der Terminbörse. Zudem liegt die Einschußverpflichtung für einen Kontrakt auf 100 Unzen bei rund 5000 Dollar. Sicherheitsfanatiker sollten eher auf eine direkte Investition setzen. Dafür stellen einige Banken ein Goldkonto bereit, das wie ein Devisenkonto funktioniert. Auch der Kauf von Goldbarren ist möglich. Er lohnt sich allerdings erst bei größeren Mengen. Denn die Spanne zwischen An- und Verkaufspreis der Banken beträgt bei 10-Gramm-Barren etwa 15 Prozent (103/121 Euro). Bei einem 500-Gramm-Barren sind es 5 Prozent (5268/5547 Euro). Wer das Edelmetall nicht selbst besitzen will, kann sich auch an den Minengesellschaften beteiligen, die Gold fördern. Fonds, die solche Aktien besitzen, haben in diesem Jahr Wertsteigerungen von bis zu 70 Prozent verzeichnet.
@konradi
Wenn ich diesen von Dir sehr interessanten Bericht aus der FAZ gepostet hätte, wäre eher dieser Abschnitt im Artikel hervorgehoben worden.
"Trotz dieses Rückschlagrisikos erwartet Blumenroth aber, daß die Aussichten für Gold-Investoren günstig bleiben. So wirke sich günstig aus, daß viele Produzenten ihr Gold nicht mehr auf Termin verkauften, bevor es überhaupt gefördert ist. In der langen Phase fallender Preise hatten sie sich so erträgliche Abnahmepreise gesichert - und zugleich zum Preisverfall beigetragen. Diese Preissicherung (Hedging) werde derzeit in weitaus geringerem Umfang betrieben."
Gruss
ThaiGuru
Wenn ich diesen von Dir sehr interessanten Bericht aus der FAZ gepostet hätte, wäre eher dieser Abschnitt im Artikel hervorgehoben worden.
"Trotz dieses Rückschlagrisikos erwartet Blumenroth aber, daß die Aussichten für Gold-Investoren günstig bleiben. So wirke sich günstig aus, daß viele Produzenten ihr Gold nicht mehr auf Termin verkauften, bevor es überhaupt gefördert ist. In der langen Phase fallender Preise hatten sie sich so erträgliche Abnahmepreise gesichert - und zugleich zum Preisverfall beigetragen. Diese Preissicherung (Hedging) werde derzeit in weitaus geringerem Umfang betrieben."
Gruss
ThaiGuru
... das glaube ich Dir sofort 
meine "Hervorhebung" sollte auch nicht verschrecken,
sondern nur eine mögliche Erkärung für den augenblicklichen downmove sein.
Wieso bist Du jetzt eigentlich nicht im Bett ? - Wie spät ist es denn jetzt in Thailand eigentlich ?
- kenne mich da leider überhaupt nicht aus ...
Gruß Konradi

meine "Hervorhebung" sollte auch nicht verschrecken,
sondern nur eine mögliche Erkärung für den augenblicklichen downmove sein.
Wieso bist Du jetzt eigentlich nicht im Bett ? - Wie spät ist es denn jetzt in Thailand eigentlich ?
- kenne mich da leider überhaupt nicht aus ...
Gruß Konradi

Es ist hier in Thailand jetzt 03:23 Uhr
DIE ZEIT 01/2003
Shanghai - Das Prinzip Weiblichkeit
Von Georg Blume
Die Frauen von Shanghai haben ihre Stadt zu einer blühenden Metropole Chinas gemacht. Jetzt gefährden die Prestigevorhaben alter Männerseilschaften das größte wirtschaftliche Reformprojekt in der Volksrepublik
Der Winter in Shanghai ist sehr kalt. Zitternd, eine rote Filzjacke schützend über die Knie gezogen, hockt ein kleines Mädchen am Straßenrand, vor dem Blumenstand ihres Vaters. Es schaut den Menschen nach, die zur nahen Bushaltestelle laufen, um sich in die Nummer 606 in Richtung Hafen zu quetschen. Es ist acht Uhr morgens im alten Arbeiterviertel des Stadtbezirks Pudong, und wie fast jeden Morgen eilt eine junge, elegante Frau auf den Blumenstand zu. Freundlich begrüßt Acho Tang die Tochter des Blumenhändlers und deren Vater. Seit 15 Jahren schon wohnt die junge Chefmanagerin der Firma Cosmobic hier im Viertel und kennt beide gut. Als sie kurz darauf in ein Taxi steigt und davonfährt, schaut ihr das kleine Mädchen noch lange nach. Gut möglich, dass sie in Acho Tang ihre eigene Zukunft erkennt.
Es ist ja auch nicht schwer. Obwohl noch keine 30 Jahre alt, ist Tang Chief Business Planning Officer eines milliardenschweren Mobilfunk-Joint-Venture der japanischen Elektronikriesen NEC und Panasonic. Ihr Weg aus der engen Arbeiterwohnung, wo sie seit der Kindheit mit den Eltern lebt, in die neue Welt der Hochtechnologie ist nicht weit. Nach nur zehnminütiger Fahrt lässt Tang das Taxi vor dem höchsten Haus Chinas, dem 88 Stockwerke hohen, einer traditionellen Tempelpagode nachempfundenen Jin Mao Building in Pudong, halten. Der oberere Teil des Gebäudes hat sich an diesem Morgen in Nebel gehüllt. „Ich arbeite über den Wolken!“, ruft Tang und lacht dabei fröhlich und unbekümmert. Ihr älterer Bruder, der es in Peking zum Filmregisseur gebracht hat, sagt über sie: „Mit ihrem Lächeln hat sie mich eine Kindheit lang ausgestochen und anschließend die Welt erobert.“
So aber war das immer mit Shanghai und seinen, in ganz China für ihre Schönheit und Durchsetzungskraft bewunderten Frauen. Ihrem Lächeln verdankte die Stadt in der Kolonialzeit den Ruf, das „Paris des Ostens“ zu sein. Doch es war ein zweifelhafter Ruf. Shanghai war zugleich „Hure des Orients“, ausgebeutet von fremden Mächten. Nach der Befreiung im Jahr 1949 setzten die Pekinger Kommunisten die Fremdherrschaft fort. Erst in den vergangenen zehn Jahren, unter den Gesetzen eines sich ausbreitenden Kapitalismus, ist die Stadt neu aufgeblüht. Ihre wiedergewonnene Anziehungskraft aber verdankt sie dem Erfolgskonzept ihrer Frauen: schön zu sein und hart zu arbeiten. Keine andere Stadt in China ist heute so anmutig wie Shanghai mit seinen alten Kolonialvillen und neuen Finanzhochbauten. Und keine andere Stadt arbeitet so hart.
Europa ist Sozialismus
Acho Tang hat es vorgemacht. Während ihr Bruder vor dem Schulstress kapitulierte und in die Ballettschule auswich, nahm sie eine Prüfungshürde nach der anderen, studierte Volkswirtschaft an der besten Shanghaier Universität, ging zum MBA-Studium nach Paris, wechselte nach dem Abschluss in einen großen französischen Konzern, nutzte die Chance zum Neuaufbau von Cosmobic für den Karrieresprung – und verlor dabei ihr Lächeln nicht. Doch wehe dem, der Tang zu Hause bei den Eltern besuchen will! Da würden die Nachbarn denken, sie brächte den zukünftigen Ehemann mit. Tang aber will Freiheit und Erfolg durch nichts gefährden. Sie denkt wie ihre Stadt: nur an das nächste Geschäft. Mit Cosmobic will sie der erste Anbieter von Multimedia-Handys in China sein. Diese Woche ist sie in London, um den Konkurrenten Hutchison Whampoa bei der Einführung seiner neuen UMTS-Geräte in England zu beobachten. An Europa verschwendet sie dabei keine Gedanken. „Meine Shanghaier Freundin, die jetzt in Stuttgart lebt, sagt, das Studium dort sei wie Faulenzen. Mir kam während des Studiums Paris viel sozialistischer als Shanghai vor. Unser Wachstum ist eben viel schneller. Deshalb ist hier der beste Ort für meine Karriere“, sagt Tang in fließendem Französisch, das gelernt zu haben sie dennoch nicht bereut: „Ich werde jetzt vier Jahre durcharbeiten und dann ein Jahr in Frankreich Ferien machen.“
Europa gleich Sozialismus und Ferien, Shanghai gleich Wachstum und Karriere – aus Sicht der Arbeitertochter Acho Tang, die sich aus eigener Kraft emporgearbeitet hat, macht das Sinn. Doch in Wirklichkeit hat Shanghai seine kommunistische Vergangenheit noch längst nicht abgeschüttelt. An nebelfreien Tagen in Sichtweite von Tangs Büro, in etwa gleicher Lufthöhe auf der anderen Seite des Huangpu-Flusses, regieren noch immer die Männer, die ihre Stadt und ihre Frauen stets betrogen haben. Typen wie Yu Zhifei, die es nicht stört, wenn ihr grauer Büropullover den Bierbauch betont, die beim Gespräch auf der Ledercouch die Beine nicht zusammenbekommen – als wollten sie vor dem nächsten Termin ihre Sekretärin flachlegen. Yu – Anfang 40, MBA-Titel, aber ohne ausländischen Studienabschluss – hat sein Büro im 29. Stock des vornehmsten, weil vom englischen Stararchitekten Norman Foster konzipierten Wolkenkratzers der Stadt. Hier schlägt das Herz der Shanghaier Stadtplanung. Unter dem Dach der stadteigenen Shanghai Juishi Corporation, nach der auch das Gebäude benannt ist, logieren die Gesellschaften für den Bau des Transrapids, der Shanghaier U-Bahn, des zukünftigen Weltausstellungsgeländes und der neuen Formel-1-Strecke der Stadt. Yu leitet das Rennbahnprojekt – mit Erfolg. Die Entscheidung von Formel-1-Chef Bernie Ecclestone, schon im Herbst 2004 das erste Rennen in Shanghai stattfinden zu lassen, hat ihn zum offiziellen Stadthelden gemacht. Täglich berichtet die Shanghaier Parteipresse von ihm, sogar die International Herald Tribune erkannte Yus „Charisma“. Nun glaubt er, sich alles erlauben zu können. Vor den Glaswänden Norman Fosters wischt Yu mit einer Handbewegung über das benachbarte 30-stöckige Hochhaus der Bank of Shanghai und einen neuen Apartment-Komplex mit mehreren Hochbauten hinweg. „All das wurde illegal errichtet und muss verschwinden, denn hier wird das Gelände für die Weltausstellung 2010 entstehen“, bestimmt der Formel-1-Guru.
So ähnlich muss die Entscheidung für den deutschen Transrapid in Shanghai auch einmal gefallen sein. Was dabei legal oder illegal war, welche Häuser für den Bau der Strecke niedergerissen wurden und welche nicht, entschieden nicht Gerichte, sondern Männer wie Yu. Weshalb sich heute ganz Deutschland für die Gesetzlosigkeit Shanghais zu begeistern scheint: In weniger als zwei Jahren wurde fertig gestellt, wozu man in Deutschland in den drei Jahrzehnten seit Erfindung der Magnetbahntechnik nicht fähig war – die erste voll betriebsfähige Transrapidstrecke der Welt. Bundeskanzler Gerhard Schröder wird sie am Silvesterabend einweihen. Doch Schröder ehrt nicht das neue, sondern das alte Shanghai. „Möglich ist der Transrapid in Shanghai nur, weil es hier immer noch eine Kommandostrukur gibt, wo einer oben etwas befiehlt und alle anderen ihm folgen“, lästert einer der großen Männer der Stadt. Er war Professor und Richter, bevor er eines der wichtigsten Ämter Shanghais im Kampf gegen die Korruption annahm. Seither ist er ein gefürchteter Mann. Was ihm in Shanghai nicht gefällt, ist der Missbrauch staatlicher Gelder. „Das Volk ärgert sich mehr über die Kleinkriminalität in den Straßen, aber die eigentliche Gefahr droht von der großen Kriminalität in den Amtsstuben. Zu viele glauben, dass sie ungeschoren davonkommen, wenn sie sich aus der Staatskasse selbst bedienen“, warnt der unerbittliche Gesetzeshüter.
Das ist das andere Shanghai: hässliche Männer, die mit fragwürdigen Methoden der schönsten Stadt Chinas die Zukunft verbauen. Ein Loch von mehreren Milliarden Yuan wird der Transrapid in die Shanghaier Stadtkasse reißen. Die Formel-1-Rennstrecke wird dem Verluste in Höhe von 200 Millionen Yuan (etwa 24 Millionen Euro) hinzufügen. Ganz zu schweigen von den Kosten der Expo, deren Investitionsvolumen sich auf mindestens 200 Milliarden Yuan (rund 24 Milliarden Euro) belaufen wird. „Es wäre gut, wenn sich Shanghai etwas weniger mit Tokyo oder New York vergleichen würde und, statt auf eine blinde Aufholjagd zu setzen, sein eigenes Tempo finden würde“, rät der ehemalige Richter. Doch Rennstreckenboss Yu will bewusst alle Geschwindigkeitsbegrenzungen brechen. „Wir sind bereits in die Liga der bekanntesten Städte der Welt aufgestiegen. Vielleicht werden wir das New York des 21. Jahrhunderts.“ Diesen Anspruch soll auch ein Sonderflugzeug der Shanghaier Formel-1-Gesellschaft für ausländische Gäste unterstreichen. Auf dem Flugzeug wird zu lesen sein: „Die Schnellste, die Höchste, die Anspruchsvollste“. Gemeint ist Shanghai, das mit dem Transrapid die schnellste Bahn der Welt hat (in Testfahrten erreicht er bereits 400 Stundenkilometer), mit dem Jin Mao Building das höchste Haus Chinas und der neuen Formel-1-Strecke die demnächst anspruchvollste Rennbahn der Welt.
Wohin die Superlative führen, hat der niederländische Autor Ian Buruma früh nach dem Bau des überdimensionalen Fernsehturms in Pudong erkannt. Buruma beschrieb das Wahrzeichen Shanghais als Phallussymbol. Doch wären die Frauen der Stadt nicht berühmter als ihre Männer, wenn maskuline Exponate hier stilprägend wirkten. So steht heute unweit des Fernsehturms die neue Börse: ein feingliedriges Werk kanadischer Architekten, das in Form eines Torbogens Chinas Öffnung zur Weltwirtschaft symbolisiert. „Die neue Börse ist niedriger als alle Gebäude um sie herum, aber viel schöner als sie“, findet Chefmanagerin Acho Tang. Die Öffnung ist eben ein weibliches Symbol – und wirtschaftlich der letztlich entscheidende Faktor.
2050: 70 Millionen Bewohner
Über 6000 internationale Firmenniederlassungen zählt die Stadt heute – nach 20 Jahren zweistelliger Wachstumsraten lässt kein Weltkonzern Shanghai mehr aus. Schon leben 300000 taiwanische Geschäftsleute in der Huangpu-Metropole und haben hier über die Jahre 60 Milliarden Dollar investiert. So viel Öffnung war in China noch nie, sie hat Shanghai zum wichtigsten Reformmodell der Republik gemacht. Könnte es also sein, dass es der Stadt gelingt, die Waage zu halten: zwischen weiblicher Tüchtigkeit in den neuen, international verzahnten Privatbetrieben und männlicher Cliquenwirtschaft in den alten, chauvinistischen Staatsgesellschaften? Finden Kapitalismus und Kommunismus in Shanghai eine neue Balance – frei nach dem chinesischen Prinzip der vereinten Gegensätze, Yin und Yang, Mann und Frau?
„Nein“, spricht der derzeit wichtigste Dichter der Stadt, als er in der Nacht, in der in Paris Shanghai die Austragungsrechte für die Expo 2010 zugesprochen werden, durch die jubelnde Menschenmenge im neuen Vergnügungsviertel Xintiandi schreitet. Eigentlich will Chen Dong Dong – Ende 30, berühmt für seine melancholischen Vierzeiler – zu dieser Stunde nicht hier sein. Für ihn ist es nicht das richtige Volk, das hier jubelt. „Ich freue mich nicht. Jetzt werden dem Volk die Mieten erhöht. Nur Beamte, Geschäftsleute und Politiker freuen sich heute“, sagt Chen, während um ihn herum die Cheer-Girls der Expo-Förderer tanzen. Wenig später sitzt der Dichter in Jeans und Anorak auf einer Couch der T8-Bar in Xintiandi. Die Bar ist Teil des Fuchun Resort Club und bietet ihren Mitgliedern gerade einen ermäßigten Jahresbeitrag von 85000 US-Dollar an. Irgendwo muss das neue Geld der Stadt ja bleiben. Chen wendet sich angewidert ab: „Ich nehme an dieser Entwicklung nicht teil. Ich schreibe wie im Leerlauf, während sich alles um mich herum vorwärts bewegt.“ Den Rest der Nacht verharrt der Dichter in steifer Haltung auf der Couchkante. Neben ihm liegt ein Teddybär, Maskottchen der T8-Bar. Chen rührt den Bären nicht an – als sei er ein Wesen aus einer anderen Welt.
Viele Europäer würden den Dichter Chen verstehen. Auf den ersten Blick wirkt Shanghai gespenstisch unberührbar – ein Meer von Hochhäusern. Nach den neuesten Regierungsplänen soll aus der 16-Millionen-Stadt innerhalb von 50 Jahren eine Metropole mit 70 Millionen Einwohnern entstehen. Wer fürchtet da nicht, dass die Stadt, die die Chinesen als ihren Drachenkopf bezeichnen, neue Gefahren birgt. Könnte sie nicht bald alle Chip- und Autofabriken dieser Welt verschlucken? Immerhin fließen derzeit schon jährliche Direktinvestitionen in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro aus dem Ausland nach Shanghai. Und etwa doppelt so viel investieren chinesische Unternehmen – meist unter staatlicher Kontrolle. Für Volkswagen, den größten Autoproduzenten am Ort, ist China heute schon der zweitgrößte Markt der Erde. Die Verkäufe wuchsen dieses Jahr um 40 Prozent.
Einen Sinn für das grenzüberschreitende Wesen Shanghais vermittelt der Maler Li Shan, der dieser Tage in der Shanghart-Galerie im alten Fuxing-Park Bilder des neuen Shanghai-Menschen zeigt, wie er ihn sich vorstellt. Es sind riesenhafte Gemälde von mit Fischen und Schmetterlingen geklonten Menschen. „Wir sollten mehr Mut haben, uns mit anderen Lebewesen kreuzen zu lassen“, meint Li Shan, ein ehrlicher, begeisterungsfähiger Typ, dessen zwittrige Mao-Porträts Ende der achtziger Jahre den Aufbruch der ersten chinesischen Avantgarde vermeldeten. Mehr als jeder neue Wolkenkratzer, jede neue Magnetbahn oder Rennstrecke verweisen Lis neue Lebewesen auf das Ungebändigte und Unkontrollierte des Shanghai-Booms.
Wenn nur die Frauen diese boomende Stadt Shanghai dieses Mal in den Griff bekämen!
Auf das kleine Mädchen vor dem Blumenstand kommt es an.
Shanghai - Das Prinzip Weiblichkeit
Von Georg Blume
Die Frauen von Shanghai haben ihre Stadt zu einer blühenden Metropole Chinas gemacht. Jetzt gefährden die Prestigevorhaben alter Männerseilschaften das größte wirtschaftliche Reformprojekt in der Volksrepublik
Der Winter in Shanghai ist sehr kalt. Zitternd, eine rote Filzjacke schützend über die Knie gezogen, hockt ein kleines Mädchen am Straßenrand, vor dem Blumenstand ihres Vaters. Es schaut den Menschen nach, die zur nahen Bushaltestelle laufen, um sich in die Nummer 606 in Richtung Hafen zu quetschen. Es ist acht Uhr morgens im alten Arbeiterviertel des Stadtbezirks Pudong, und wie fast jeden Morgen eilt eine junge, elegante Frau auf den Blumenstand zu. Freundlich begrüßt Acho Tang die Tochter des Blumenhändlers und deren Vater. Seit 15 Jahren schon wohnt die junge Chefmanagerin der Firma Cosmobic hier im Viertel und kennt beide gut. Als sie kurz darauf in ein Taxi steigt und davonfährt, schaut ihr das kleine Mädchen noch lange nach. Gut möglich, dass sie in Acho Tang ihre eigene Zukunft erkennt.
Es ist ja auch nicht schwer. Obwohl noch keine 30 Jahre alt, ist Tang Chief Business Planning Officer eines milliardenschweren Mobilfunk-Joint-Venture der japanischen Elektronikriesen NEC und Panasonic. Ihr Weg aus der engen Arbeiterwohnung, wo sie seit der Kindheit mit den Eltern lebt, in die neue Welt der Hochtechnologie ist nicht weit. Nach nur zehnminütiger Fahrt lässt Tang das Taxi vor dem höchsten Haus Chinas, dem 88 Stockwerke hohen, einer traditionellen Tempelpagode nachempfundenen Jin Mao Building in Pudong, halten. Der oberere Teil des Gebäudes hat sich an diesem Morgen in Nebel gehüllt. „Ich arbeite über den Wolken!“, ruft Tang und lacht dabei fröhlich und unbekümmert. Ihr älterer Bruder, der es in Peking zum Filmregisseur gebracht hat, sagt über sie: „Mit ihrem Lächeln hat sie mich eine Kindheit lang ausgestochen und anschließend die Welt erobert.“
So aber war das immer mit Shanghai und seinen, in ganz China für ihre Schönheit und Durchsetzungskraft bewunderten Frauen. Ihrem Lächeln verdankte die Stadt in der Kolonialzeit den Ruf, das „Paris des Ostens“ zu sein. Doch es war ein zweifelhafter Ruf. Shanghai war zugleich „Hure des Orients“, ausgebeutet von fremden Mächten. Nach der Befreiung im Jahr 1949 setzten die Pekinger Kommunisten die Fremdherrschaft fort. Erst in den vergangenen zehn Jahren, unter den Gesetzen eines sich ausbreitenden Kapitalismus, ist die Stadt neu aufgeblüht. Ihre wiedergewonnene Anziehungskraft aber verdankt sie dem Erfolgskonzept ihrer Frauen: schön zu sein und hart zu arbeiten. Keine andere Stadt in China ist heute so anmutig wie Shanghai mit seinen alten Kolonialvillen und neuen Finanzhochbauten. Und keine andere Stadt arbeitet so hart.
Europa ist Sozialismus
Acho Tang hat es vorgemacht. Während ihr Bruder vor dem Schulstress kapitulierte und in die Ballettschule auswich, nahm sie eine Prüfungshürde nach der anderen, studierte Volkswirtschaft an der besten Shanghaier Universität, ging zum MBA-Studium nach Paris, wechselte nach dem Abschluss in einen großen französischen Konzern, nutzte die Chance zum Neuaufbau von Cosmobic für den Karrieresprung – und verlor dabei ihr Lächeln nicht. Doch wehe dem, der Tang zu Hause bei den Eltern besuchen will! Da würden die Nachbarn denken, sie brächte den zukünftigen Ehemann mit. Tang aber will Freiheit und Erfolg durch nichts gefährden. Sie denkt wie ihre Stadt: nur an das nächste Geschäft. Mit Cosmobic will sie der erste Anbieter von Multimedia-Handys in China sein. Diese Woche ist sie in London, um den Konkurrenten Hutchison Whampoa bei der Einführung seiner neuen UMTS-Geräte in England zu beobachten. An Europa verschwendet sie dabei keine Gedanken. „Meine Shanghaier Freundin, die jetzt in Stuttgart lebt, sagt, das Studium dort sei wie Faulenzen. Mir kam während des Studiums Paris viel sozialistischer als Shanghai vor. Unser Wachstum ist eben viel schneller. Deshalb ist hier der beste Ort für meine Karriere“, sagt Tang in fließendem Französisch, das gelernt zu haben sie dennoch nicht bereut: „Ich werde jetzt vier Jahre durcharbeiten und dann ein Jahr in Frankreich Ferien machen.“
Europa gleich Sozialismus und Ferien, Shanghai gleich Wachstum und Karriere – aus Sicht der Arbeitertochter Acho Tang, die sich aus eigener Kraft emporgearbeitet hat, macht das Sinn. Doch in Wirklichkeit hat Shanghai seine kommunistische Vergangenheit noch längst nicht abgeschüttelt. An nebelfreien Tagen in Sichtweite von Tangs Büro, in etwa gleicher Lufthöhe auf der anderen Seite des Huangpu-Flusses, regieren noch immer die Männer, die ihre Stadt und ihre Frauen stets betrogen haben. Typen wie Yu Zhifei, die es nicht stört, wenn ihr grauer Büropullover den Bierbauch betont, die beim Gespräch auf der Ledercouch die Beine nicht zusammenbekommen – als wollten sie vor dem nächsten Termin ihre Sekretärin flachlegen. Yu – Anfang 40, MBA-Titel, aber ohne ausländischen Studienabschluss – hat sein Büro im 29. Stock des vornehmsten, weil vom englischen Stararchitekten Norman Foster konzipierten Wolkenkratzers der Stadt. Hier schlägt das Herz der Shanghaier Stadtplanung. Unter dem Dach der stadteigenen Shanghai Juishi Corporation, nach der auch das Gebäude benannt ist, logieren die Gesellschaften für den Bau des Transrapids, der Shanghaier U-Bahn, des zukünftigen Weltausstellungsgeländes und der neuen Formel-1-Strecke der Stadt. Yu leitet das Rennbahnprojekt – mit Erfolg. Die Entscheidung von Formel-1-Chef Bernie Ecclestone, schon im Herbst 2004 das erste Rennen in Shanghai stattfinden zu lassen, hat ihn zum offiziellen Stadthelden gemacht. Täglich berichtet die Shanghaier Parteipresse von ihm, sogar die International Herald Tribune erkannte Yus „Charisma“. Nun glaubt er, sich alles erlauben zu können. Vor den Glaswänden Norman Fosters wischt Yu mit einer Handbewegung über das benachbarte 30-stöckige Hochhaus der Bank of Shanghai und einen neuen Apartment-Komplex mit mehreren Hochbauten hinweg. „All das wurde illegal errichtet und muss verschwinden, denn hier wird das Gelände für die Weltausstellung 2010 entstehen“, bestimmt der Formel-1-Guru.
So ähnlich muss die Entscheidung für den deutschen Transrapid in Shanghai auch einmal gefallen sein. Was dabei legal oder illegal war, welche Häuser für den Bau der Strecke niedergerissen wurden und welche nicht, entschieden nicht Gerichte, sondern Männer wie Yu. Weshalb sich heute ganz Deutschland für die Gesetzlosigkeit Shanghais zu begeistern scheint: In weniger als zwei Jahren wurde fertig gestellt, wozu man in Deutschland in den drei Jahrzehnten seit Erfindung der Magnetbahntechnik nicht fähig war – die erste voll betriebsfähige Transrapidstrecke der Welt. Bundeskanzler Gerhard Schröder wird sie am Silvesterabend einweihen. Doch Schröder ehrt nicht das neue, sondern das alte Shanghai. „Möglich ist der Transrapid in Shanghai nur, weil es hier immer noch eine Kommandostrukur gibt, wo einer oben etwas befiehlt und alle anderen ihm folgen“, lästert einer der großen Männer der Stadt. Er war Professor und Richter, bevor er eines der wichtigsten Ämter Shanghais im Kampf gegen die Korruption annahm. Seither ist er ein gefürchteter Mann. Was ihm in Shanghai nicht gefällt, ist der Missbrauch staatlicher Gelder. „Das Volk ärgert sich mehr über die Kleinkriminalität in den Straßen, aber die eigentliche Gefahr droht von der großen Kriminalität in den Amtsstuben. Zu viele glauben, dass sie ungeschoren davonkommen, wenn sie sich aus der Staatskasse selbst bedienen“, warnt der unerbittliche Gesetzeshüter.
Das ist das andere Shanghai: hässliche Männer, die mit fragwürdigen Methoden der schönsten Stadt Chinas die Zukunft verbauen. Ein Loch von mehreren Milliarden Yuan wird der Transrapid in die Shanghaier Stadtkasse reißen. Die Formel-1-Rennstrecke wird dem Verluste in Höhe von 200 Millionen Yuan (etwa 24 Millionen Euro) hinzufügen. Ganz zu schweigen von den Kosten der Expo, deren Investitionsvolumen sich auf mindestens 200 Milliarden Yuan (rund 24 Milliarden Euro) belaufen wird. „Es wäre gut, wenn sich Shanghai etwas weniger mit Tokyo oder New York vergleichen würde und, statt auf eine blinde Aufholjagd zu setzen, sein eigenes Tempo finden würde“, rät der ehemalige Richter. Doch Rennstreckenboss Yu will bewusst alle Geschwindigkeitsbegrenzungen brechen. „Wir sind bereits in die Liga der bekanntesten Städte der Welt aufgestiegen. Vielleicht werden wir das New York des 21. Jahrhunderts.“ Diesen Anspruch soll auch ein Sonderflugzeug der Shanghaier Formel-1-Gesellschaft für ausländische Gäste unterstreichen. Auf dem Flugzeug wird zu lesen sein: „Die Schnellste, die Höchste, die Anspruchsvollste“. Gemeint ist Shanghai, das mit dem Transrapid die schnellste Bahn der Welt hat (in Testfahrten erreicht er bereits 400 Stundenkilometer), mit dem Jin Mao Building das höchste Haus Chinas und der neuen Formel-1-Strecke die demnächst anspruchvollste Rennbahn der Welt.
Wohin die Superlative führen, hat der niederländische Autor Ian Buruma früh nach dem Bau des überdimensionalen Fernsehturms in Pudong erkannt. Buruma beschrieb das Wahrzeichen Shanghais als Phallussymbol. Doch wären die Frauen der Stadt nicht berühmter als ihre Männer, wenn maskuline Exponate hier stilprägend wirkten. So steht heute unweit des Fernsehturms die neue Börse: ein feingliedriges Werk kanadischer Architekten, das in Form eines Torbogens Chinas Öffnung zur Weltwirtschaft symbolisiert. „Die neue Börse ist niedriger als alle Gebäude um sie herum, aber viel schöner als sie“, findet Chefmanagerin Acho Tang. Die Öffnung ist eben ein weibliches Symbol – und wirtschaftlich der letztlich entscheidende Faktor.
2050: 70 Millionen Bewohner
Über 6000 internationale Firmenniederlassungen zählt die Stadt heute – nach 20 Jahren zweistelliger Wachstumsraten lässt kein Weltkonzern Shanghai mehr aus. Schon leben 300000 taiwanische Geschäftsleute in der Huangpu-Metropole und haben hier über die Jahre 60 Milliarden Dollar investiert. So viel Öffnung war in China noch nie, sie hat Shanghai zum wichtigsten Reformmodell der Republik gemacht. Könnte es also sein, dass es der Stadt gelingt, die Waage zu halten: zwischen weiblicher Tüchtigkeit in den neuen, international verzahnten Privatbetrieben und männlicher Cliquenwirtschaft in den alten, chauvinistischen Staatsgesellschaften? Finden Kapitalismus und Kommunismus in Shanghai eine neue Balance – frei nach dem chinesischen Prinzip der vereinten Gegensätze, Yin und Yang, Mann und Frau?
„Nein“, spricht der derzeit wichtigste Dichter der Stadt, als er in der Nacht, in der in Paris Shanghai die Austragungsrechte für die Expo 2010 zugesprochen werden, durch die jubelnde Menschenmenge im neuen Vergnügungsviertel Xintiandi schreitet. Eigentlich will Chen Dong Dong – Ende 30, berühmt für seine melancholischen Vierzeiler – zu dieser Stunde nicht hier sein. Für ihn ist es nicht das richtige Volk, das hier jubelt. „Ich freue mich nicht. Jetzt werden dem Volk die Mieten erhöht. Nur Beamte, Geschäftsleute und Politiker freuen sich heute“, sagt Chen, während um ihn herum die Cheer-Girls der Expo-Förderer tanzen. Wenig später sitzt der Dichter in Jeans und Anorak auf einer Couch der T8-Bar in Xintiandi. Die Bar ist Teil des Fuchun Resort Club und bietet ihren Mitgliedern gerade einen ermäßigten Jahresbeitrag von 85000 US-Dollar an. Irgendwo muss das neue Geld der Stadt ja bleiben. Chen wendet sich angewidert ab: „Ich nehme an dieser Entwicklung nicht teil. Ich schreibe wie im Leerlauf, während sich alles um mich herum vorwärts bewegt.“ Den Rest der Nacht verharrt der Dichter in steifer Haltung auf der Couchkante. Neben ihm liegt ein Teddybär, Maskottchen der T8-Bar. Chen rührt den Bären nicht an – als sei er ein Wesen aus einer anderen Welt.
Viele Europäer würden den Dichter Chen verstehen. Auf den ersten Blick wirkt Shanghai gespenstisch unberührbar – ein Meer von Hochhäusern. Nach den neuesten Regierungsplänen soll aus der 16-Millionen-Stadt innerhalb von 50 Jahren eine Metropole mit 70 Millionen Einwohnern entstehen. Wer fürchtet da nicht, dass die Stadt, die die Chinesen als ihren Drachenkopf bezeichnen, neue Gefahren birgt. Könnte sie nicht bald alle Chip- und Autofabriken dieser Welt verschlucken? Immerhin fließen derzeit schon jährliche Direktinvestitionen in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro aus dem Ausland nach Shanghai. Und etwa doppelt so viel investieren chinesische Unternehmen – meist unter staatlicher Kontrolle. Für Volkswagen, den größten Autoproduzenten am Ort, ist China heute schon der zweitgrößte Markt der Erde. Die Verkäufe wuchsen dieses Jahr um 40 Prozent.
Einen Sinn für das grenzüberschreitende Wesen Shanghais vermittelt der Maler Li Shan, der dieser Tage in der Shanghart-Galerie im alten Fuxing-Park Bilder des neuen Shanghai-Menschen zeigt, wie er ihn sich vorstellt. Es sind riesenhafte Gemälde von mit Fischen und Schmetterlingen geklonten Menschen. „Wir sollten mehr Mut haben, uns mit anderen Lebewesen kreuzen zu lassen“, meint Li Shan, ein ehrlicher, begeisterungsfähiger Typ, dessen zwittrige Mao-Porträts Ende der achtziger Jahre den Aufbruch der ersten chinesischen Avantgarde vermeldeten. Mehr als jeder neue Wolkenkratzer, jede neue Magnetbahn oder Rennstrecke verweisen Lis neue Lebewesen auf das Ungebändigte und Unkontrollierte des Shanghai-Booms.
Wenn nur die Frauen diese boomende Stadt Shanghai dieses Mal in den Griff bekämen!
Auf das kleine Mädchen vor dem Blumenstand kommt es an.
DIE ZEIT 01/2003
Dann gibt es nur eins: nie wieder!
Von Jan Ross
Krieg gegen Saddam? Ohne uns! Der deutsche Pazifismus, geboren aus Schuld und Angst, prägt längst die bürgerliche Mitte. Zugleich gewöhnt sich die Linke an den bewaffneten Kampf für die Menschenrechte. Eine Reise durch die Gefühlswelt der Bundesrepublik
Wie würde, wie wird bei einem Angriff auf den Irak die deutsche Öffentlichkeit reagieren? Im Golfkrieg von 1991 war die Stimmung fast hysterisch, mit weißen Bettlaken, die aus den Fenstern hingen, und allmorgendlich atemlos verfolgtem Frühstücksfernsehen – obwohl die Bundesrepublik sich militärisch gar nicht beteiligte. Bei der Intervention im Kosovo 1998 taten deutsche Soldaten mit, aber auf den Straßen blieb es ruhig, wohl weil der erste Kriegseinsatz nach 1945 durch eine linke Regierung gleichsam moralisch abgeschirmt wurde. Am aufgewühltesten ging es zu, als gar kein Schuss fiel, im Nachrüstungsstreit der frühen achtziger Jahre: Weltuntergangsängste im Schatten der atomaren Mittelstreckenraketen, von Pershing und SS-20. Wie also sieht es diesmal aus? © Foto [M]: Hohlfeld/Ullstein Bild; Denkmal vor dem UN-Hauptquartier in New York
Über Frieden, Friedenssehnsucht, Friedensbewegung, Friedenspolitik ist schwer vernünftig zu reden. Für manche, ziemlich viele sogar, liegt hier das Unantastbare schlechthin, ein moralisches Sperrgebiet, ein beinahe oder buchstäblich religiös bewehrtes Tabu. Anderen dagegen stößt gerade beim Friedensthema ein besonders ungenießbares Gutmenschentum auf, der schlechte Geschmack von politischem Kitsch. Manchmal wirken die Sanftmütigen in der Tat wie ihre eigene Karikatur. Bei jedem Satiriker hätte man den Einfall billig und albern gefunden, dass neulich während einer Irak-Diskussion in der hannoverschen Marktkirche als erster Publikumsbeitrag via Internet das Statement der Pfarrerin Tina Hülsebus eintraf, Absender „Dahab, Süd-Sinai, Ägypten“, mit strengen Urteilen über die unchristliche Arroganz der Vereinigten Staaten. Aber genau so ist es gewesen: Frau Pastorin ordnet vom Berge Sinai aus das Weltgeschehen. Dieses Milieu gibt es also wirklich noch.
Trotzdem ist der Kirchentagspazifismus der frühen achtziger Jahre nicht mehr der Schlüssel zur bundesdeutschen Friedensbefindlichkeit. Die hannoversche Veranstaltung hatte nichts von Apokalyptik oder Fanatismus an sich. Es war eine Talkshow mit leidlich professioneller Moderation, Ausstrahlung ein paar Tage später auf Phönix, und Christian Ströbele und Peter Scholl-Latour als Stargästen. So glatt im Medien-Mainstream hatten sich die Nachrüstungsgegner nicht bewegt. Vor allem aber lohnten die Zuhörer einen genaueren Blick, die jetzt aus Sorge vor einem Angriff auf den Irak erschienen waren – zahlreich, sodass viele draußen bleiben mussten. Es war ein ausgesprochen bürgerliches Publikum, wohlgekleidet und paarweise erschienen, im Alter recht gleichmäßig gestreut zwischen vierzig und siebzig. Das ist die Mitte der deutschen Gesellschaft, und wer sie hier sitzen sah, der wusste sofort, dass Gerhard Schröder tatsächlich mit der Parole „Krieg? Ohne uns!“ die Bundestagswahl gewonnen hat. Es ist nichts Linkes, nichts Alternatives und nichts Radikales mehr, gegen Bomben, Raketen, Panzer und besonders gegen die Amerikaner zu sein, es ist eine deutsche Grund- und Mehrheitsstimmung.
Mehrheitsfähig, heißt das, auch bei den Wählern und im Wertekosmos der Union. Das ist neu. Wolfgang Schäuble hat es zu spüren bekommen, als er im Wahlkampf als zuständiger Außenpolitiker der Stoiber-Kampagne die Kriegsoption zumindest nicht ganz ausschließen wollte. Der Kandidat und seine Strategen wollten mit diesem unpopulären Realismus nichts zu tun haben. Im Adenauer-Haus gingen mehr Protestbriefe ein als bei der Nominierung der unverheirateten Mutter Katherina Reiche zur künftigen Familienministerin, die angeblich die Seele der Partei so erregt hatte. Es sind, wie Schäuble beobachtet, gerade die Älteren, für die der Krieg der Übel größtes bleibt. Für die „Erlebnisgeneration“ von Stalingrad und Dresden war er das in gewisser Weise immer. Aber hier saßen auch der Antikommunismus und die Angst vor der Sowjetunion besonders tief. Jetzt, da man sich vor den Russen nicht länger fürchten muss, hat das Kriegstrauma gleichsam freie Bahn. Und die Vereinigten Staaten werden auch nicht mehr so dringend gebraucht.
Wie denkt und fühlt „es“ in der Bundesrepublik beim Thema Krieg und Frieden? Unter den gebrannten Kindern des Wahlkampfs versucht man sich einen Reim zu machen auf die massive Verweigerungsstimmung, die im Sommer und Herbst jede rationale Irak-Diskussion verhindert hat. Hans-Ulrich Klose, in dieser Frage der Schäuble der SPD und in seiner Partei auf ähnlich einsamem Posten, würde es nicht Pazifismus nennen: „Es ist eher so, dass da eine verletzte Nation die Schultern hochzieht; wir ticken da anders als die Amerikaner oder Briten, mehr wie die Japaner.“ Krieg bedeutet in der deutschen kollektiven Erinnerung Schuld und Niederlage. Und er bedeutet Leid für die Zivilbevölkerung – wie sehr, das zeigt in diesen Wochen der sensationelle Erfolg von Jörg Friedrichs Buch über die Bombardierung der deutschen Städte. In der angelsächsischen Welt wird des Zweiten Weltkriegs, trotz aller Zerstörungen in England, letztlich anders gedacht, heroisch, als Sieg der gerechten Sache. Schuld ist dabei auch ein Thema – aber nicht die Schuld des Angriffskriegs, sondern des allzu langen Abwartens und Zusehens, des Appeasements. Das Berliner Geschichtsgespenst ist der Verbrecher Hitler, das Londoner der Versager Chamberlain.
Doch gibt es nicht gleichzeitig, neben der intensiven Gewaltscheu, in der Bundesrepublik eine ganz andere, gegenläufige Tendenz? Vor wenigen Jahren noch waren deutsche Blauhelme ein Ding der Unmöglichkeit, inzwischen hat sich die Bundeswehr an Kampfeinsätzen im Kosovo und in Afghanistan beteiligt, ohne Massenproteste oder auch nur demoskopische Einbrüche für die Regierenden. Für Hardcore-Antimilitaristen wie den Grünen-Abgeordneten Christian Ströbele sind das in der Tat Sündenfälle und gefährliche Präzedenzien, Beispiele einer Militarisierung der Außenpolitik. Auch in der mehr oder weniger organisierten Friedensbewegung, bei den übrig gebliebenen Aktivisten aus der Nachrüstungszeit oder neuerdings im Umfeld der Globalisierungskritiker von attac, wird jeder Schritt eines deutschen Soldaten irgendwo auf der Welt mit tiefem Misstrauen betrachtet.
Die Geschichte seit 1989 erscheint aus diesem Blickwinkel als Prozess der Abkehr von zivilen Konfliktlösungen. Krieg ist, im Unterschied zu den dann doch irgendwie idyllischen Zeiten des atomaren Patts, wieder möglich, führbar, akzeptabel geworden. So gesehen führt von den Balkan-Interventionen zu einem drohenden Angriff auf den Irak in der Tat eine gerade Linie, ein Weg ins Verderben. Diese Katastrophentheorie ist kein Privileg eines pazifistischen Milieus, sie findet sich auch in der akademischen Friedensforschung. Ernst-Otto Czempiel etwa, der Doyen der Disziplin in Deutschland und ein hoch seriöser Politologe auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, schätzt die Entwicklung kaum anders ein. Selbstverständlich, erklärt er, war der Einsatz der Nato-Bomber gegen Serbien 1999 ein Fehler, geradezu ein zivilisatorischer Rückschritt. Und selbstverständlich löst der Krieg, ganz wie die Friedensdemonstranten sagen, keine Probleme. Nie. Er ist ein Anachronismus, das Überbleibsel eine längst überholten „Staatenwelt“ der Großmachtambitionen. Die Zukunft, oder eigentlich schon die Gegenwart, gehört der „Gesellschaftswelt“, einer globalen Innenpolitik, in der Wohlstand und Demokratie die Völker kampfunlustig machen. Dass der Westen nach dem Untergang der Sowjetunion nicht wirklich abgerüstet hat, dass er mittlerweile Tyrannensturz und Menschenrechtsschutz mit Waffengewalt betreibt, dass unter Bush jr. in den Vereinigten Staaten sogar wieder ein ausgewachsener Militarismus regiert – das alles sind in Czempiels Augen Facetten eines großen Versäumnisses, den Augenblick von 1989/90 zu ergreifen und die Konfliktbehandlung endlich auf Prävention umzustellen.
So weit die reine Lehre. Sie wird es allerdings nicht gewesen sein, die dem Bundeskanzler bei seiner Wehrdienstverweigerung in Sachen Irak die Wähler zugetrieben hat. Es gibt, sosehr Friedensbewegung und Friedensforschung das bedauern mögen, keinen generellen Widerstand gegen eine „Militarisierung der Außenpolitik“. Was es gibt, ist eine tiefe, schuld- und angstbesetzte Aversion gegen Krieg – aber genau darin dürfte paradoxerweise der Grund dafür liegen, dass die Engagements auf dem Balkan und in der ersten Phase des Antiterrorkampfs so leicht durchzusetzen waren. Sie werden offenbar als Polizeiaktionen mit militärischen Mitteln wahrgenommen, im Grunde ganz im Sinne von Czempiels internationaler Innenpolitik, wenngleich nicht gewaltfrei. Der Wachtmeister braucht ja auch für den Notfall eine Pistole. Krieg, richtiger Krieg, zwischen Staaten und womöglich wegen nackter Interessen, um Energiequellen oder um Macht – das ist etwas anderes.
Man stößt da übrigens nebenbei auf einen charakteristischen West-Ost-Unterschied. Christian Ströbeles Wahlkreis umfasst Kreuzberg und Friedrichshain, also je einen Bezirk aus den beiden Stadthälften des einst geteilten Berlin, stark grün geprägt der eine, mehr rot-rot, postsozialistisch-sozialdemokratisch der andere. Ströbeles Antimilitarismus findet hier wie da starken Zuspruch. Aber in Kreuzberg, im emanzipatorisch-alternativen Publikum, bleibt die neue Joschka-Fischer-Doktrin von der bewaffneten Humanität nicht ganz ohne Echo und Wirkung. Wie war es denn mit den Massakrierten von Srebrenica oder den geknechteten Frauen der Taliban – kann, muss man da nicht eingreifen? Im Gegenzug brechen dann freilich wieder die alten antiimperialistischen Gewissheiten durch: Es geht in Wahrheit bloß um billiges Benzin, Bush ist ein Mann des militärisch-industriellen Komplexes und so weiter, und so fort.
In Friedrichshain, so Ströbele, ist das Klima anders, „eine tiefe, ruhige Grundstimmung“ gegen alle Kriegsgewalt. Keine aggressive Systemfeindschaft wie etwa in der Autonomen-Szene des Westens. Aber auch keine Sympathie für Militärinterventionen im Dienste der Menschenrechte. Der Osten wirkt überwiegend nicht ansprechbar für jenes Argument, das der bundesdeutschen Linken und zumal den Grünen den Pazifismus immer zweifelhafter gemacht hat – dass nämlich Freiheit und Recht sich manchmal nur mit Gewalt schützen oder wiederherstellen lassen, im Extremfall also: dass Krieg nötig war, um die Todesmühlen von Auschwitz zum Halten zu bringen.
Gleichviel: Es bleibt der verbreitete Wahrnehmungsunterschied zwischen „polizeilicher“ Militärintervention, die weithin hingenommen wird, und „echtem“ Staatenkrieg, der Furcht und Abwehr auslöst. Die Unterscheidung ist nicht grundlos, sie kann jedoch einer neuen Art von Realitätsverweigerung Vorschub leisten. Wohl bildet sich allmählich ein Konsens darüber heraus, dass man den Risiken von Terrorismus, ethnischen Unruhen und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bisweilen nicht anders als durch Zwang und Gewalt begegnen kann. Zugleich ist aber die Hauptbotschaft: So, wie das Pentagon es sich vorstellt, lässt sich damit jedenfalls nicht umgehen. Es gibt eine Flut gescheiter Kommentare und Traktate über die „asymmetrische“ Natur heutiger Konflikte, in denen Armeen nicht mehr viel nützen gegen fanatisierte Einzelkämpfer und schattenhafte Terrornetzwerke; Erhard Eppler, dem der Bundeskanzler bisweilen sein Ohr leiht, zeichnet ein globales Panorama „privatisierter Gewalt“ von Warlords, Drogenbanden und Glaubenspartisanen, in dem al-Qaida als eine Art multinationales Unternehmen des Schreckens figuriert.
Daran ist gewiss viel wahr. Aber dass Staaten bei diesem Problem eine Rolle spielen können, und zwar nicht nur als failing states, wo der Kollaps der öffentlichen Ordnung die Einnistung des Verbrechens erlaubt, sondern auch durch state sponsorship, durch die Bereitstellung einer Infrastruktur für den Terrorismus – das wird bei der Fixierung auf die „privatisierte Gewalt“ ausgeblendet. Hier beginnt dann doch die tabuisierte Zone des Krieges. Man will „weiter“ sein als die anderen, die dinosaurierhaften Schlachtrösser der Supermacht – vielleicht nicht mehr als Avantgarde der Gewaltlosigkeit, wie sich viele entspannungsfreudige Deutsche in den Zeiten der Blockkonfrontation empfanden, aber nun durch die tiefere Einsicht in das Wesen der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, denen nicht mit Rezepten à la Rumsfeld beizukommen ist. Eine gewisse Neigung zu Besserwisserei und selektiver Wirklichkeitswahrnehmung ist geblieben.
Als die bundesdeutsche Friedensbewegung Anfang der achtziger Jahre gegen die westliche Nachrüstung mobilmachte, war ihr moralischer Kredit gewaltig. Man mochte ihre Vorschläge für pragmatisch falsch oder ihr ganzes Weltbild für naiv halten, aber ihr Idealismus verlangte und gewann Respekt. Mit den Protesten gegen den Golfkrieg verhielt es sich etwas anders. Damals begann die Friedfertigkeit auch vielen liberalen und linken Beobachtern unbehaglich zu werden. Wie stand es wirklich um die moralische Substanz eines Pazifismus, der die völkerrechtswidrige Okkupation Kuwaits hinzunehmen bereit war, dem ein Schlächter wie Saddam keine schlaflosen Nächte bereitete und der für die Existenzbedrohung Israels nicht viel mehr als ein Achselzucken übrig hatte – wenn nicht sogar gelegentlich ein antisemitisch gefärbtes „Selber schuld!“ an die Adresse des jüdischen Staates hörbar wurde? Damals begann, was sich im Angesicht der völkermörderischen Vertreibungen auf dem Balkan voll entfaltete, die Entwicklung eines progressiven „Bellizismus“, der als letzte Abhilfe gegen die Unmenschlichkeit auch die Entsendung von Bombern und Truppen guthieß.
Die Lage vor einem möglichen Angriff auf den Irak ist wiederum eine andere. Auch wer Kuwait gewaltsam befreit sehen oder die ethnischen Säuberungen im Kosovo gestoppt wissen wollte, mag jetzt vielleicht keine Rechtfertigung für eine Intervention erkennen. Es gibt keine intellektuelle „Kriegspartei“. Der Balkan-Bellizist Peter Schneider etwa oder Micha Brumlik, dem die deutsche Friedensbewegung im Golfkonflikt unerträglich wurde, sind strikt gegen einen pre-emptive strike, einen Präventivschlag. Es gilt keinen akuten Genozid zu verhindern, und der rechtliche Grund eines Einmarschs wäre, vorsichtig gesprochen, schwankend. Die Sache des Friedens, könnte man sagen, ist diesmal moralisch wieder so stark wie seit langem nicht.
Nur gibt es noch immer Erlebnisse, die einen zweifeln lassen. In adventlicher Stimmung hat der tiefenpsychologisch angehauchte Theologe Eugen Drewermann kürzlich in der Berliner Urania einen Vortrag zum Thema Warum Krieg? gehalten. Es ging anfangs des Längeren und Breiteren um die menschliche Aggressivität im Allgemeinen, dann bald natürlich um den Irak, zunächst auch noch in einer gewissen globalen Grundsätzlichkeit. Nun aber, erklärte Drewermann dann, müsse man doch auf das wirkliche Motiv des drohenden Krieges zu sprechen kommen. Er machte eine Pause, und in die Stille des überfüllten Saales hinein trat, dutzendfach hörbar, ausgesprochen, von Hunderten aber leise gedacht, ein einziges, einsilbiges Wort: „Öl“. Das war ein unheimlicher Augenblick. Nicht, dass das Misstrauen gegen die geheimen Absichten und die vorgeschobenen Scheingründe der Mächtigen schlecht wäre; im Gegenteil, es ist eine demokratische Tugend. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der das ganze Grau in Grau von Politik, Recht und Ethik hier zusammenschnurrte in einen einzigen dunklen Punkt, in die nachtschwarze Gewissheit, dass in der Welt nur nacktes Interesse herrscht und dass Lug und Trug sein muss, was sich als gerechte Sache ausgibt – das berührte doch merkwürdig. Es ist in der Friedfertigkeit nicht immer und nicht allein das hohe moralische Ideal am Werk. Es gibt darin auch verstörende Spuren von Abgebrühtheit und hoffnungslosem Zynismus.
Dann gibt es nur eins: nie wieder!
Von Jan Ross
Krieg gegen Saddam? Ohne uns! Der deutsche Pazifismus, geboren aus Schuld und Angst, prägt längst die bürgerliche Mitte. Zugleich gewöhnt sich die Linke an den bewaffneten Kampf für die Menschenrechte. Eine Reise durch die Gefühlswelt der Bundesrepublik
Wie würde, wie wird bei einem Angriff auf den Irak die deutsche Öffentlichkeit reagieren? Im Golfkrieg von 1991 war die Stimmung fast hysterisch, mit weißen Bettlaken, die aus den Fenstern hingen, und allmorgendlich atemlos verfolgtem Frühstücksfernsehen – obwohl die Bundesrepublik sich militärisch gar nicht beteiligte. Bei der Intervention im Kosovo 1998 taten deutsche Soldaten mit, aber auf den Straßen blieb es ruhig, wohl weil der erste Kriegseinsatz nach 1945 durch eine linke Regierung gleichsam moralisch abgeschirmt wurde. Am aufgewühltesten ging es zu, als gar kein Schuss fiel, im Nachrüstungsstreit der frühen achtziger Jahre: Weltuntergangsängste im Schatten der atomaren Mittelstreckenraketen, von Pershing und SS-20. Wie also sieht es diesmal aus? © Foto [M]: Hohlfeld/Ullstein Bild; Denkmal vor dem UN-Hauptquartier in New York
Über Frieden, Friedenssehnsucht, Friedensbewegung, Friedenspolitik ist schwer vernünftig zu reden. Für manche, ziemlich viele sogar, liegt hier das Unantastbare schlechthin, ein moralisches Sperrgebiet, ein beinahe oder buchstäblich religiös bewehrtes Tabu. Anderen dagegen stößt gerade beim Friedensthema ein besonders ungenießbares Gutmenschentum auf, der schlechte Geschmack von politischem Kitsch. Manchmal wirken die Sanftmütigen in der Tat wie ihre eigene Karikatur. Bei jedem Satiriker hätte man den Einfall billig und albern gefunden, dass neulich während einer Irak-Diskussion in der hannoverschen Marktkirche als erster Publikumsbeitrag via Internet das Statement der Pfarrerin Tina Hülsebus eintraf, Absender „Dahab, Süd-Sinai, Ägypten“, mit strengen Urteilen über die unchristliche Arroganz der Vereinigten Staaten. Aber genau so ist es gewesen: Frau Pastorin ordnet vom Berge Sinai aus das Weltgeschehen. Dieses Milieu gibt es also wirklich noch.
Trotzdem ist der Kirchentagspazifismus der frühen achtziger Jahre nicht mehr der Schlüssel zur bundesdeutschen Friedensbefindlichkeit. Die hannoversche Veranstaltung hatte nichts von Apokalyptik oder Fanatismus an sich. Es war eine Talkshow mit leidlich professioneller Moderation, Ausstrahlung ein paar Tage später auf Phönix, und Christian Ströbele und Peter Scholl-Latour als Stargästen. So glatt im Medien-Mainstream hatten sich die Nachrüstungsgegner nicht bewegt. Vor allem aber lohnten die Zuhörer einen genaueren Blick, die jetzt aus Sorge vor einem Angriff auf den Irak erschienen waren – zahlreich, sodass viele draußen bleiben mussten. Es war ein ausgesprochen bürgerliches Publikum, wohlgekleidet und paarweise erschienen, im Alter recht gleichmäßig gestreut zwischen vierzig und siebzig. Das ist die Mitte der deutschen Gesellschaft, und wer sie hier sitzen sah, der wusste sofort, dass Gerhard Schröder tatsächlich mit der Parole „Krieg? Ohne uns!“ die Bundestagswahl gewonnen hat. Es ist nichts Linkes, nichts Alternatives und nichts Radikales mehr, gegen Bomben, Raketen, Panzer und besonders gegen die Amerikaner zu sein, es ist eine deutsche Grund- und Mehrheitsstimmung.
Mehrheitsfähig, heißt das, auch bei den Wählern und im Wertekosmos der Union. Das ist neu. Wolfgang Schäuble hat es zu spüren bekommen, als er im Wahlkampf als zuständiger Außenpolitiker der Stoiber-Kampagne die Kriegsoption zumindest nicht ganz ausschließen wollte. Der Kandidat und seine Strategen wollten mit diesem unpopulären Realismus nichts zu tun haben. Im Adenauer-Haus gingen mehr Protestbriefe ein als bei der Nominierung der unverheirateten Mutter Katherina Reiche zur künftigen Familienministerin, die angeblich die Seele der Partei so erregt hatte. Es sind, wie Schäuble beobachtet, gerade die Älteren, für die der Krieg der Übel größtes bleibt. Für die „Erlebnisgeneration“ von Stalingrad und Dresden war er das in gewisser Weise immer. Aber hier saßen auch der Antikommunismus und die Angst vor der Sowjetunion besonders tief. Jetzt, da man sich vor den Russen nicht länger fürchten muss, hat das Kriegstrauma gleichsam freie Bahn. Und die Vereinigten Staaten werden auch nicht mehr so dringend gebraucht.
Wie denkt und fühlt „es“ in der Bundesrepublik beim Thema Krieg und Frieden? Unter den gebrannten Kindern des Wahlkampfs versucht man sich einen Reim zu machen auf die massive Verweigerungsstimmung, die im Sommer und Herbst jede rationale Irak-Diskussion verhindert hat. Hans-Ulrich Klose, in dieser Frage der Schäuble der SPD und in seiner Partei auf ähnlich einsamem Posten, würde es nicht Pazifismus nennen: „Es ist eher so, dass da eine verletzte Nation die Schultern hochzieht; wir ticken da anders als die Amerikaner oder Briten, mehr wie die Japaner.“ Krieg bedeutet in der deutschen kollektiven Erinnerung Schuld und Niederlage. Und er bedeutet Leid für die Zivilbevölkerung – wie sehr, das zeigt in diesen Wochen der sensationelle Erfolg von Jörg Friedrichs Buch über die Bombardierung der deutschen Städte. In der angelsächsischen Welt wird des Zweiten Weltkriegs, trotz aller Zerstörungen in England, letztlich anders gedacht, heroisch, als Sieg der gerechten Sache. Schuld ist dabei auch ein Thema – aber nicht die Schuld des Angriffskriegs, sondern des allzu langen Abwartens und Zusehens, des Appeasements. Das Berliner Geschichtsgespenst ist der Verbrecher Hitler, das Londoner der Versager Chamberlain.
Doch gibt es nicht gleichzeitig, neben der intensiven Gewaltscheu, in der Bundesrepublik eine ganz andere, gegenläufige Tendenz? Vor wenigen Jahren noch waren deutsche Blauhelme ein Ding der Unmöglichkeit, inzwischen hat sich die Bundeswehr an Kampfeinsätzen im Kosovo und in Afghanistan beteiligt, ohne Massenproteste oder auch nur demoskopische Einbrüche für die Regierenden. Für Hardcore-Antimilitaristen wie den Grünen-Abgeordneten Christian Ströbele sind das in der Tat Sündenfälle und gefährliche Präzedenzien, Beispiele einer Militarisierung der Außenpolitik. Auch in der mehr oder weniger organisierten Friedensbewegung, bei den übrig gebliebenen Aktivisten aus der Nachrüstungszeit oder neuerdings im Umfeld der Globalisierungskritiker von attac, wird jeder Schritt eines deutschen Soldaten irgendwo auf der Welt mit tiefem Misstrauen betrachtet.
Die Geschichte seit 1989 erscheint aus diesem Blickwinkel als Prozess der Abkehr von zivilen Konfliktlösungen. Krieg ist, im Unterschied zu den dann doch irgendwie idyllischen Zeiten des atomaren Patts, wieder möglich, führbar, akzeptabel geworden. So gesehen führt von den Balkan-Interventionen zu einem drohenden Angriff auf den Irak in der Tat eine gerade Linie, ein Weg ins Verderben. Diese Katastrophentheorie ist kein Privileg eines pazifistischen Milieus, sie findet sich auch in der akademischen Friedensforschung. Ernst-Otto Czempiel etwa, der Doyen der Disziplin in Deutschland und ein hoch seriöser Politologe auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, schätzt die Entwicklung kaum anders ein. Selbstverständlich, erklärt er, war der Einsatz der Nato-Bomber gegen Serbien 1999 ein Fehler, geradezu ein zivilisatorischer Rückschritt. Und selbstverständlich löst der Krieg, ganz wie die Friedensdemonstranten sagen, keine Probleme. Nie. Er ist ein Anachronismus, das Überbleibsel eine längst überholten „Staatenwelt“ der Großmachtambitionen. Die Zukunft, oder eigentlich schon die Gegenwart, gehört der „Gesellschaftswelt“, einer globalen Innenpolitik, in der Wohlstand und Demokratie die Völker kampfunlustig machen. Dass der Westen nach dem Untergang der Sowjetunion nicht wirklich abgerüstet hat, dass er mittlerweile Tyrannensturz und Menschenrechtsschutz mit Waffengewalt betreibt, dass unter Bush jr. in den Vereinigten Staaten sogar wieder ein ausgewachsener Militarismus regiert – das alles sind in Czempiels Augen Facetten eines großen Versäumnisses, den Augenblick von 1989/90 zu ergreifen und die Konfliktbehandlung endlich auf Prävention umzustellen.
So weit die reine Lehre. Sie wird es allerdings nicht gewesen sein, die dem Bundeskanzler bei seiner Wehrdienstverweigerung in Sachen Irak die Wähler zugetrieben hat. Es gibt, sosehr Friedensbewegung und Friedensforschung das bedauern mögen, keinen generellen Widerstand gegen eine „Militarisierung der Außenpolitik“. Was es gibt, ist eine tiefe, schuld- und angstbesetzte Aversion gegen Krieg – aber genau darin dürfte paradoxerweise der Grund dafür liegen, dass die Engagements auf dem Balkan und in der ersten Phase des Antiterrorkampfs so leicht durchzusetzen waren. Sie werden offenbar als Polizeiaktionen mit militärischen Mitteln wahrgenommen, im Grunde ganz im Sinne von Czempiels internationaler Innenpolitik, wenngleich nicht gewaltfrei. Der Wachtmeister braucht ja auch für den Notfall eine Pistole. Krieg, richtiger Krieg, zwischen Staaten und womöglich wegen nackter Interessen, um Energiequellen oder um Macht – das ist etwas anderes.
Man stößt da übrigens nebenbei auf einen charakteristischen West-Ost-Unterschied. Christian Ströbeles Wahlkreis umfasst Kreuzberg und Friedrichshain, also je einen Bezirk aus den beiden Stadthälften des einst geteilten Berlin, stark grün geprägt der eine, mehr rot-rot, postsozialistisch-sozialdemokratisch der andere. Ströbeles Antimilitarismus findet hier wie da starken Zuspruch. Aber in Kreuzberg, im emanzipatorisch-alternativen Publikum, bleibt die neue Joschka-Fischer-Doktrin von der bewaffneten Humanität nicht ganz ohne Echo und Wirkung. Wie war es denn mit den Massakrierten von Srebrenica oder den geknechteten Frauen der Taliban – kann, muss man da nicht eingreifen? Im Gegenzug brechen dann freilich wieder die alten antiimperialistischen Gewissheiten durch: Es geht in Wahrheit bloß um billiges Benzin, Bush ist ein Mann des militärisch-industriellen Komplexes und so weiter, und so fort.
In Friedrichshain, so Ströbele, ist das Klima anders, „eine tiefe, ruhige Grundstimmung“ gegen alle Kriegsgewalt. Keine aggressive Systemfeindschaft wie etwa in der Autonomen-Szene des Westens. Aber auch keine Sympathie für Militärinterventionen im Dienste der Menschenrechte. Der Osten wirkt überwiegend nicht ansprechbar für jenes Argument, das der bundesdeutschen Linken und zumal den Grünen den Pazifismus immer zweifelhafter gemacht hat – dass nämlich Freiheit und Recht sich manchmal nur mit Gewalt schützen oder wiederherstellen lassen, im Extremfall also: dass Krieg nötig war, um die Todesmühlen von Auschwitz zum Halten zu bringen.
Gleichviel: Es bleibt der verbreitete Wahrnehmungsunterschied zwischen „polizeilicher“ Militärintervention, die weithin hingenommen wird, und „echtem“ Staatenkrieg, der Furcht und Abwehr auslöst. Die Unterscheidung ist nicht grundlos, sie kann jedoch einer neuen Art von Realitätsverweigerung Vorschub leisten. Wohl bildet sich allmählich ein Konsens darüber heraus, dass man den Risiken von Terrorismus, ethnischen Unruhen und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bisweilen nicht anders als durch Zwang und Gewalt begegnen kann. Zugleich ist aber die Hauptbotschaft: So, wie das Pentagon es sich vorstellt, lässt sich damit jedenfalls nicht umgehen. Es gibt eine Flut gescheiter Kommentare und Traktate über die „asymmetrische“ Natur heutiger Konflikte, in denen Armeen nicht mehr viel nützen gegen fanatisierte Einzelkämpfer und schattenhafte Terrornetzwerke; Erhard Eppler, dem der Bundeskanzler bisweilen sein Ohr leiht, zeichnet ein globales Panorama „privatisierter Gewalt“ von Warlords, Drogenbanden und Glaubenspartisanen, in dem al-Qaida als eine Art multinationales Unternehmen des Schreckens figuriert.
Daran ist gewiss viel wahr. Aber dass Staaten bei diesem Problem eine Rolle spielen können, und zwar nicht nur als failing states, wo der Kollaps der öffentlichen Ordnung die Einnistung des Verbrechens erlaubt, sondern auch durch state sponsorship, durch die Bereitstellung einer Infrastruktur für den Terrorismus – das wird bei der Fixierung auf die „privatisierte Gewalt“ ausgeblendet. Hier beginnt dann doch die tabuisierte Zone des Krieges. Man will „weiter“ sein als die anderen, die dinosaurierhaften Schlachtrösser der Supermacht – vielleicht nicht mehr als Avantgarde der Gewaltlosigkeit, wie sich viele entspannungsfreudige Deutsche in den Zeiten der Blockkonfrontation empfanden, aber nun durch die tiefere Einsicht in das Wesen der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, denen nicht mit Rezepten à la Rumsfeld beizukommen ist. Eine gewisse Neigung zu Besserwisserei und selektiver Wirklichkeitswahrnehmung ist geblieben.
Als die bundesdeutsche Friedensbewegung Anfang der achtziger Jahre gegen die westliche Nachrüstung mobilmachte, war ihr moralischer Kredit gewaltig. Man mochte ihre Vorschläge für pragmatisch falsch oder ihr ganzes Weltbild für naiv halten, aber ihr Idealismus verlangte und gewann Respekt. Mit den Protesten gegen den Golfkrieg verhielt es sich etwas anders. Damals begann die Friedfertigkeit auch vielen liberalen und linken Beobachtern unbehaglich zu werden. Wie stand es wirklich um die moralische Substanz eines Pazifismus, der die völkerrechtswidrige Okkupation Kuwaits hinzunehmen bereit war, dem ein Schlächter wie Saddam keine schlaflosen Nächte bereitete und der für die Existenzbedrohung Israels nicht viel mehr als ein Achselzucken übrig hatte – wenn nicht sogar gelegentlich ein antisemitisch gefärbtes „Selber schuld!“ an die Adresse des jüdischen Staates hörbar wurde? Damals begann, was sich im Angesicht der völkermörderischen Vertreibungen auf dem Balkan voll entfaltete, die Entwicklung eines progressiven „Bellizismus“, der als letzte Abhilfe gegen die Unmenschlichkeit auch die Entsendung von Bombern und Truppen guthieß.
Die Lage vor einem möglichen Angriff auf den Irak ist wiederum eine andere. Auch wer Kuwait gewaltsam befreit sehen oder die ethnischen Säuberungen im Kosovo gestoppt wissen wollte, mag jetzt vielleicht keine Rechtfertigung für eine Intervention erkennen. Es gibt keine intellektuelle „Kriegspartei“. Der Balkan-Bellizist Peter Schneider etwa oder Micha Brumlik, dem die deutsche Friedensbewegung im Golfkonflikt unerträglich wurde, sind strikt gegen einen pre-emptive strike, einen Präventivschlag. Es gilt keinen akuten Genozid zu verhindern, und der rechtliche Grund eines Einmarschs wäre, vorsichtig gesprochen, schwankend. Die Sache des Friedens, könnte man sagen, ist diesmal moralisch wieder so stark wie seit langem nicht.
Nur gibt es noch immer Erlebnisse, die einen zweifeln lassen. In adventlicher Stimmung hat der tiefenpsychologisch angehauchte Theologe Eugen Drewermann kürzlich in der Berliner Urania einen Vortrag zum Thema Warum Krieg? gehalten. Es ging anfangs des Längeren und Breiteren um die menschliche Aggressivität im Allgemeinen, dann bald natürlich um den Irak, zunächst auch noch in einer gewissen globalen Grundsätzlichkeit. Nun aber, erklärte Drewermann dann, müsse man doch auf das wirkliche Motiv des drohenden Krieges zu sprechen kommen. Er machte eine Pause, und in die Stille des überfüllten Saales hinein trat, dutzendfach hörbar, ausgesprochen, von Hunderten aber leise gedacht, ein einziges, einsilbiges Wort: „Öl“. Das war ein unheimlicher Augenblick. Nicht, dass das Misstrauen gegen die geheimen Absichten und die vorgeschobenen Scheingründe der Mächtigen schlecht wäre; im Gegenteil, es ist eine demokratische Tugend. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der das ganze Grau in Grau von Politik, Recht und Ethik hier zusammenschnurrte in einen einzigen dunklen Punkt, in die nachtschwarze Gewissheit, dass in der Welt nur nacktes Interesse herrscht und dass Lug und Trug sein muss, was sich als gerechte Sache ausgibt – das berührte doch merkwürdig. Es ist in der Friedfertigkeit nicht immer und nicht allein das hohe moralische Ideal am Werk. Es gibt darin auch verstörende Spuren von Abgebrühtheit und hoffnungslosem Zynismus.
FTD - 27.12.2002
Kriegsrhetorik hält Goldpreis auf hohem Niveau
Von Doris Grass
Die Angst vor einem Krieg in Irak sowie die Sorge über die wachsenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben den Goldpreis auch über die Weihnachtsfeiertage hoch gehalten. Washington warnte Nordkorea und erklärte, die USA seien durchaus in der Lage zwei Kriege zur gleichen Zeit zu kämpfen.
Sowohl der schwache Dollar als auch der hohe Ölpreis trugen weiterhin zur Nachfrage nach dem Edelmetall bei. Am Donnerstag kletterte der Preis für die Feinunze Gold zur Lieferung im Februar in New York bei sehr ruhigem Handel bis 19 Uhr MEZ um 2,20 $ auf 349,50 $. Kassagold war nahezu umsatzlos. "Februar-Gold ist unter 340 $ gut unterstützt, der nächste Widerstand liegt über 352 $, aber ich sehe Gold weder heute noch morgen in diese Regionen abgleiten oder steigen", sagte ein Händler in New York.
Am Heiligabend war Gold zur Lieferung im Februar in New York nach einer verkürzten Sitzung mit 347,30 $ je Feinunze um 1,70 $ fester aus dem Handel gegangen, Kassagold schloss 0,9 $ fester bei 346,55 $. Der Londoner Markt blieb an Weihnachten geschlossen. Am Dienstag war die Feinunze beim Morgenfixing mit 345 $ notiert worden.
Silber stieg am Donnerstag wie schon am Dienstag leicht im Gefolge des Goldes. Platin zur Lieferung im Januar legte am Donnerstag in New York zeitweise um 4 $ auf 589 $ zu. Dagegen fiel Palladium zurück.
Ende des US-Wunders
Der schleichende Imageverlust des Dollar schlägt sich langsam am Markt nieder. Ganz deutlich wird dies daran, dass der drohende Irak-Krieg jetzt der US-Währung schadet.
Über Weihnachten erreichte der Euro zum ersten Mal seit drei Jahren wieder den Wert
von 1,0350 $. Da der Dollar auch gegenüber anderen Währungen verliert, kann man konstatieren: Es handelt sich nicht um einen Imagegewinn des Euro, sondern um einen Verlust beim Dollar.
Seit Präsident George W. Bush die wichtigsten Figuren seines Wirtschaftsteams ausgewechselt hat, geht am Devisenmarkt der Verdacht um, die gute alte Rhetorik vom "starken Dollar" werde fallen gelassen, sofern es der heimischen Industrie nutzt.
Das ist sicher ein Anlass für Dollar-Bullen, ein wenig vorsichtiger zu sein. Der wahre Grund für die neue Zurückhaltung ist aber das Ende des amerikanischen Wunders. Der Glaube an eine unentwegt vorwärts stürmende Wirtschaft, die auch dem Kapitalanleger aus Übersee höhere Renditen als anderswo bietet, verblasst. In den vergangenen Monaten wurde diese Entwicklung zwar mehrfach durch Zinssenkungen der Notenbank oder durch Zwischenrallys am Aktienmarkt unterbrochen. Das Ausland finanziert die Lücke in der US-Leistungsbilanz jedoch lange nicht mehr so freudvoll wie zuvor.
Für das konkurrierende Euroland ist diese Entwicklung wenig erfreulich. Eine deutliche Abwertung des Dollar mag es Amerika besser ermöglichen, seine Importe zu finanzieren und Schulden zu begleichen. Als Konjunkturtreiber für Europa kommen die USA bei weiter fallendem Dollar aber nicht mehr in Frage.
Kriegsrhetorik hält Goldpreis auf hohem Niveau
Von Doris Grass
Die Angst vor einem Krieg in Irak sowie die Sorge über die wachsenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA haben den Goldpreis auch über die Weihnachtsfeiertage hoch gehalten. Washington warnte Nordkorea und erklärte, die USA seien durchaus in der Lage zwei Kriege zur gleichen Zeit zu kämpfen.
Sowohl der schwache Dollar als auch der hohe Ölpreis trugen weiterhin zur Nachfrage nach dem Edelmetall bei. Am Donnerstag kletterte der Preis für die Feinunze Gold zur Lieferung im Februar in New York bei sehr ruhigem Handel bis 19 Uhr MEZ um 2,20 $ auf 349,50 $. Kassagold war nahezu umsatzlos. "Februar-Gold ist unter 340 $ gut unterstützt, der nächste Widerstand liegt über 352 $, aber ich sehe Gold weder heute noch morgen in diese Regionen abgleiten oder steigen", sagte ein Händler in New York.
Am Heiligabend war Gold zur Lieferung im Februar in New York nach einer verkürzten Sitzung mit 347,30 $ je Feinunze um 1,70 $ fester aus dem Handel gegangen, Kassagold schloss 0,9 $ fester bei 346,55 $. Der Londoner Markt blieb an Weihnachten geschlossen. Am Dienstag war die Feinunze beim Morgenfixing mit 345 $ notiert worden.
Silber stieg am Donnerstag wie schon am Dienstag leicht im Gefolge des Goldes. Platin zur Lieferung im Januar legte am Donnerstag in New York zeitweise um 4 $ auf 589 $ zu. Dagegen fiel Palladium zurück.
Ende des US-Wunders
Der schleichende Imageverlust des Dollar schlägt sich langsam am Markt nieder. Ganz deutlich wird dies daran, dass der drohende Irak-Krieg jetzt der US-Währung schadet.
Über Weihnachten erreichte der Euro zum ersten Mal seit drei Jahren wieder den Wert
von 1,0350 $. Da der Dollar auch gegenüber anderen Währungen verliert, kann man konstatieren: Es handelt sich nicht um einen Imagegewinn des Euro, sondern um einen Verlust beim Dollar.
Seit Präsident George W. Bush die wichtigsten Figuren seines Wirtschaftsteams ausgewechselt hat, geht am Devisenmarkt der Verdacht um, die gute alte Rhetorik vom "starken Dollar" werde fallen gelassen, sofern es der heimischen Industrie nutzt.
Das ist sicher ein Anlass für Dollar-Bullen, ein wenig vorsichtiger zu sein. Der wahre Grund für die neue Zurückhaltung ist aber das Ende des amerikanischen Wunders. Der Glaube an eine unentwegt vorwärts stürmende Wirtschaft, die auch dem Kapitalanleger aus Übersee höhere Renditen als anderswo bietet, verblasst. In den vergangenen Monaten wurde diese Entwicklung zwar mehrfach durch Zinssenkungen der Notenbank oder durch Zwischenrallys am Aktienmarkt unterbrochen. Das Ausland finanziert die Lücke in der US-Leistungsbilanz jedoch lange nicht mehr so freudvoll wie zuvor.
Für das konkurrierende Euroland ist diese Entwicklung wenig erfreulich. Eine deutliche Abwertung des Dollar mag es Amerika besser ermöglichen, seine Importe zu finanzieren und Schulden zu begleichen. Als Konjunkturtreiber für Europa kommen die USA bei weiter fallendem Dollar aber nicht mehr in Frage.
.

Roland Leuschel : Das Jahr 2003
Das Jahr 2003
Weltwirtschaft: Globale Rezession
Börse besser als 2002
Rückkehr der Inflation ?
Gold auf dem Marsch zu neuen Höchstkursen ?
Eine Kapitalmarktexpertin und Geschäftsführerin einer der grossen deutschen Investmentfondsgesellschaften hat Mitte Dezember dieses Jahres die Meinung der Fondsmanager auf den Punkt gebracht : « Die Stimmung hat sich seit dem Tief im Oktober deutlich aufgehellt. Und bekanntlich nehmen die Börsen wirtschaftliche Verbesserungen meistens um einige Monate vorweg. » Als Realist frage ich mich « welche wirtschaftlichen Verbesserungen » haben dann die Aktienbörsen Ende 1999 vorweggenommen, als der Dow Jones über 11.500, der Dax über 8.000 und die Nasdaq bei 5.000 lagen ? 67% der Fondsmanager erwarten einen Anstieg der Weltkonjunktur und sind entsprechend optimistisch über die Unternehmensgewinne.
Ich hoffe Sie haben meine letzte Kolumne vom 21. November (Ist das Ende der zweiten Kursrallye im aktuellen Bärenmarkt eingeleitet ?) gelesen. Zwei Tage später titelte die Financial Times Deutschland ihre Finanzzeitung « An den Börsen sind die Bullen los » und fasste so die Meinung vieler Medien zusammen. Ich fühlte mich in den Bärenmarkt von 1968 bis 1982 zurückversetzt. Auch damals wurden die Anleger konstant von den Medien und von ihren Investmentbanken in die Irre geführt, indem Ihnen der Beginn eines neuen Bullenmarkt angekündigt wurde.
Mein Szenario für das kommende Jahr sieht anders aus ; denn wenn Optimisten Recht haben sollten, wie zum Beispiel auch die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley, die mit Kurssteigerungen von rund 20% in Europa im kommenden Jahr rechnen, und als Begründung angeben, die Eurozone wird mit 1,4% wachsen, aber gleichzeitig vor dem Ende des Zyklus der bisherigen Zinssenkungen warnen, dann wird der Rentenmarkt schwach und die Zinsen werden ansteigen. Das würde bedeuten, Anleihen werden gegenüber Aktien noch attraktiver ! Ich gehe nach wir vor davon aus, dass die Gefahr einer globalen Rezession noch lange nicht gebannt ist, und zitiere den jüngsten Bericht der Weltbank, der die Gefahren für das Wachstum im kommenden Jahr aufzeigt : sinkendes Vertrauen der Verbraucher als Folge der Finanzskandale bedeutender Unternehmen in Amerika, Schieflage der japanischen Banken und die Schuldenprobleme lateinamerikanischer Staaten. Ich füge hinzu, die Gefahr eines Krieges gehört zu diesen Unwägbarkeiten. Zwei deutsche Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass in diesem Jahr in Deutschland das Wachstum bei 0,2% liegt, also geringer als letztes Jahr, und dass 2003 mit kaum mehr als 1% gerechnet werden kann. Und am Anfang dieses Jahres sprach die ganze Welt von der Konjunkturerholung… Wir sind also noch lange nicht aus dem Konjunkturtal heraus, aber das bedeutet nicht, dass wir an den Aktienbörsen kein Geld verdienen können. Zunächst einmal werden wir noch neue Tiefstkurse erreichen, und ich wiederhole meine Prognose vom Sommer dieses Jahres (vergleiche auch Interview in der Welt am Sonntag vom 6. Oktober), dass der Dax auf das Niveau von 2.250 – 2.500 zurückfallen kann. Dabei bin ich bei weitem nicht am pessimistischsten. Der bekannte Aktienanalyst Wieland Staud glaubt, dass der Dax « zumindest vorrübergehend ein Niveau erreicht, das mit einer eins beginnt », andere Techniker sehen ein Kursziel für den Dax bei 2.032 entweder im Sommer oder im frühen Herbst.
Meine Begründung für höhere Kurse Ende 2003 gegenüber 2002 : Nur zweimal seit 1925 ist der Dow Jones in drei Jahren in Folge eingebrochen, 1929 und 1939. Ende 2002 wird es also zum dritten Mal geschehen, aber und das erscheint mir sehr wichtig, ein viertes negatives Börsenjahr hintereinander ist bisher noch nicht eingetreten, und daher extrem unwahrscheinlich. Ausschliessen kann man es dennoch nicht, denn Märkte haben kein Gedächtnis. Ein anderer Grund : Seit es den Dax gibt (1959) hat er in einer Baisse noch nie so viel verloren wie zwischen März 2000 und Oktober 2002 (rund 70%). Der einzige vergleichbare Kursrückgang ereignete sich nach der Kubakrise (1962), dem Jahr in dem ich als Finanzanalyst in Frankfurt begann. Praktisch hatte der Dax bis zum Juli 1982 eine Seitwärtsbewegung. Wenn ich also für Ende 2003 höhere Aktienkurse vorhersehe, dann muss ich gleichzeitig davor warnen, dass wir noch viele Jahre in einer Seitwärtsbewegung bleiben werden, wahrscheinlich bis 2012. Ein Faktor für diese Szenario ist die nach wie vor extrem hohe Börsenbewertung der Aktien. Der Gewinn pro Aktie des Standard & Poors 500 Index in den vergangenen 12 Monaten beträgt 26,74 US-Dollar. Im historischen Vergleich wäre das ungefähr das Niveau von Ende 1994, als der Standard & Poors Index bei 460 lag (heute 900). Aber Standard & Poors hat die Gewinne neu berechnet (sogenannte Core Earnings), und dabei die Verpflichtungen der Unternehmen aus Mitarbeiter-Optionsprogrammen und Pensionskassen berücksichtigt und kommt auf 18,48 Dollar, das heisst die KGV des Standard & Poors 500 wäre bei augenblicklichem Indexstand bei 50. Da auch andere klassische Kennzahlen der Fundamentalanalyse sich auf einem derart hohen Niveau befinden, die eher das Ende eines Bullenmarktes als dessen Anfang signalisieren, werden wir wohl noch einige Jahre mit einer Konsolidierung zu rechnen haben. Den verbliebenen, zahlreichen Bullen bleibt im Grunde genommen nur noch das sogenannte Fed-Modell, das die Unternehmensgewinne mit dem langfristigen Zins für Staatsanleihen vergleicht. Ganz abgesehen davon, dass dieses Fed-Modell wirklich nicht funktioniert und eher eine Schimäre ist (der Nikkei 225 müsste nach diesem Modell bei 30.000 stehen !), rechne ich wegen der enorm steigenden Staatsverschuldung mit höheren langfristigen Zinsen, und damit wäre auch dieses Argument Fed-Modell hinfällig. Ich rechne damit, dass Sir Print A Lot of Money weiterhin die kurzfristigen Zinsen senken wird und notfalls das Geld mit Hubschraubern über den grossen Städten Amerikas abwerfen wird, sodass der Markt einfach zu viel Liquidität bekommt. Da gleichzeitig der jetzt noch boomende Immobilienmarkt in Amerika und Grossbritannien einen Kollaps erleiden könnte, werden die Anleger versucht sein, ihr Glück in Aktien zu suchen, die ja auch Substanzwerte sein können. Die hohen Staatsdefizite und die Kosten eines Krieges könnten die Inflationsraten in der Welt steigen lassen, und eine Renaissance des Goldpreises bewirken.
Ich empfehle nach wie vor 70 bis 90% in Cash bzw kurzlaufende Triple A Anleihen zu investieren, 3 bis 5% in physisches Gold und wie in diesem Jahr die Zwischenerholungen zu nutzen, um mit Value-Aktien, wie IBM, Allianz, Phillip Morris, Siemens etc., Gewinne einzufahren.
In der Vergangenheit haben Berufsoptimisten und auch viele Investmentbanken dem Anleger eingehämmert, dass Aktien langfristig Anleihen schlagen. Das stimmt, allerdings nur langfristig. Es ist bemerkenswert, dass ein amerikanischer Stratege James Montier von der DrKW errechnet hat, dass « unter den derzeit herrschenden Bedingungen es 52 Jahre dauern wird, bis die akkumulierten, realen Einkünfte aus amerikanischen Aktien die akkumulierten, realen Einkünfte aus Anleihen übertreffen werden ». Wie die Ergebnisse eines Berufsoptimisten an der Börse ausfallen, sehen Sie an Heiko Thieme, sein Fonds Thieme Fonds International hat seit Jahresbeginn 65% seines Wertes verloren und seit 3 Jahren 85%. Er ist damit unter den 3 schlechtesten der insgesamt 462 Fonds Aktien International. James Montier hat mit Sicherheit nicht an diesen Fonds gedacht, als er seinen Anlagehorizont auf 52 Jahre setzte.
Roland Leuschel
P.S. Am 25.1.2003 findet im Künstlerhaus in München das Goldbrief-Seminar statt, auf dem ich ausführlich über den drohenden Kollaps des Weltfinanz- und Rentensystems sprechen werde. Unter anderen wird Johann A. Saiger über die Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor berichten. (Information unter der Telefonnummer : 0174 – 84.58.147)
---
zur Person: Roland Leuschel:
Direktor der Banque Bruxelles Lambert
Roland Leuschel, ehemaliger Stratege und Direktor der Banque Bruxelles Lambert, Autor mehrerer Bücher (u. a. Die amerikanische Idee, Wachstum unsere Zukunft 1984, Sonntags nie am liebsten im Oktober 1990), erkannte rechtzeitig im Jahr 1982 die Aktienhausse in den USA und in Europa. Im Sommer 1987 sah er den Oktober-Crash exakt voraus und gilt seither als "Crash-Prophet", der zu den großen Börsenberühmtheiten in Europa zählt (Börse Online). In Japan begann 1990 der von ihm vorausgesagte Salami- Crash (Crash auf Raten), der die damals größte Börsenkapitalisierung der Welt um rund 40 % fallen ließ (Nikkei 225 von 40.000 auf 12.800 im Jahr 1998). Der von ihm vorausgesagte Crash fand in Amerika und Europa nicht statt. Leuschel behauptet aber: Seit 1997 bzw. 1998 befinden wir uns in Amerika und Europa in einem Salami-Crash.
Die Kolumnen von Roland Leuschel werden u. a. von
www.boerse.de veröffentlicht !

Roland Leuschel : Das Jahr 2003
Das Jahr 2003
Weltwirtschaft: Globale Rezession
Börse besser als 2002
Rückkehr der Inflation ?
Gold auf dem Marsch zu neuen Höchstkursen ?
Eine Kapitalmarktexpertin und Geschäftsführerin einer der grossen deutschen Investmentfondsgesellschaften hat Mitte Dezember dieses Jahres die Meinung der Fondsmanager auf den Punkt gebracht : « Die Stimmung hat sich seit dem Tief im Oktober deutlich aufgehellt. Und bekanntlich nehmen die Börsen wirtschaftliche Verbesserungen meistens um einige Monate vorweg. » Als Realist frage ich mich « welche wirtschaftlichen Verbesserungen » haben dann die Aktienbörsen Ende 1999 vorweggenommen, als der Dow Jones über 11.500, der Dax über 8.000 und die Nasdaq bei 5.000 lagen ? 67% der Fondsmanager erwarten einen Anstieg der Weltkonjunktur und sind entsprechend optimistisch über die Unternehmensgewinne.
Ich hoffe Sie haben meine letzte Kolumne vom 21. November (Ist das Ende der zweiten Kursrallye im aktuellen Bärenmarkt eingeleitet ?) gelesen. Zwei Tage später titelte die Financial Times Deutschland ihre Finanzzeitung « An den Börsen sind die Bullen los » und fasste so die Meinung vieler Medien zusammen. Ich fühlte mich in den Bärenmarkt von 1968 bis 1982 zurückversetzt. Auch damals wurden die Anleger konstant von den Medien und von ihren Investmentbanken in die Irre geführt, indem Ihnen der Beginn eines neuen Bullenmarkt angekündigt wurde.
Mein Szenario für das kommende Jahr sieht anders aus ; denn wenn Optimisten Recht haben sollten, wie zum Beispiel auch die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley, die mit Kurssteigerungen von rund 20% in Europa im kommenden Jahr rechnen, und als Begründung angeben, die Eurozone wird mit 1,4% wachsen, aber gleichzeitig vor dem Ende des Zyklus der bisherigen Zinssenkungen warnen, dann wird der Rentenmarkt schwach und die Zinsen werden ansteigen. Das würde bedeuten, Anleihen werden gegenüber Aktien noch attraktiver ! Ich gehe nach wir vor davon aus, dass die Gefahr einer globalen Rezession noch lange nicht gebannt ist, und zitiere den jüngsten Bericht der Weltbank, der die Gefahren für das Wachstum im kommenden Jahr aufzeigt : sinkendes Vertrauen der Verbraucher als Folge der Finanzskandale bedeutender Unternehmen in Amerika, Schieflage der japanischen Banken und die Schuldenprobleme lateinamerikanischer Staaten. Ich füge hinzu, die Gefahr eines Krieges gehört zu diesen Unwägbarkeiten. Zwei deutsche Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass in diesem Jahr in Deutschland das Wachstum bei 0,2% liegt, also geringer als letztes Jahr, und dass 2003 mit kaum mehr als 1% gerechnet werden kann. Und am Anfang dieses Jahres sprach die ganze Welt von der Konjunkturerholung… Wir sind also noch lange nicht aus dem Konjunkturtal heraus, aber das bedeutet nicht, dass wir an den Aktienbörsen kein Geld verdienen können. Zunächst einmal werden wir noch neue Tiefstkurse erreichen, und ich wiederhole meine Prognose vom Sommer dieses Jahres (vergleiche auch Interview in der Welt am Sonntag vom 6. Oktober), dass der Dax auf das Niveau von 2.250 – 2.500 zurückfallen kann. Dabei bin ich bei weitem nicht am pessimistischsten. Der bekannte Aktienanalyst Wieland Staud glaubt, dass der Dax « zumindest vorrübergehend ein Niveau erreicht, das mit einer eins beginnt », andere Techniker sehen ein Kursziel für den Dax bei 2.032 entweder im Sommer oder im frühen Herbst.
Meine Begründung für höhere Kurse Ende 2003 gegenüber 2002 : Nur zweimal seit 1925 ist der Dow Jones in drei Jahren in Folge eingebrochen, 1929 und 1939. Ende 2002 wird es also zum dritten Mal geschehen, aber und das erscheint mir sehr wichtig, ein viertes negatives Börsenjahr hintereinander ist bisher noch nicht eingetreten, und daher extrem unwahrscheinlich. Ausschliessen kann man es dennoch nicht, denn Märkte haben kein Gedächtnis. Ein anderer Grund : Seit es den Dax gibt (1959) hat er in einer Baisse noch nie so viel verloren wie zwischen März 2000 und Oktober 2002 (rund 70%). Der einzige vergleichbare Kursrückgang ereignete sich nach der Kubakrise (1962), dem Jahr in dem ich als Finanzanalyst in Frankfurt begann. Praktisch hatte der Dax bis zum Juli 1982 eine Seitwärtsbewegung. Wenn ich also für Ende 2003 höhere Aktienkurse vorhersehe, dann muss ich gleichzeitig davor warnen, dass wir noch viele Jahre in einer Seitwärtsbewegung bleiben werden, wahrscheinlich bis 2012. Ein Faktor für diese Szenario ist die nach wie vor extrem hohe Börsenbewertung der Aktien. Der Gewinn pro Aktie des Standard & Poors 500 Index in den vergangenen 12 Monaten beträgt 26,74 US-Dollar. Im historischen Vergleich wäre das ungefähr das Niveau von Ende 1994, als der Standard & Poors Index bei 460 lag (heute 900). Aber Standard & Poors hat die Gewinne neu berechnet (sogenannte Core Earnings), und dabei die Verpflichtungen der Unternehmen aus Mitarbeiter-Optionsprogrammen und Pensionskassen berücksichtigt und kommt auf 18,48 Dollar, das heisst die KGV des Standard & Poors 500 wäre bei augenblicklichem Indexstand bei 50. Da auch andere klassische Kennzahlen der Fundamentalanalyse sich auf einem derart hohen Niveau befinden, die eher das Ende eines Bullenmarktes als dessen Anfang signalisieren, werden wir wohl noch einige Jahre mit einer Konsolidierung zu rechnen haben. Den verbliebenen, zahlreichen Bullen bleibt im Grunde genommen nur noch das sogenannte Fed-Modell, das die Unternehmensgewinne mit dem langfristigen Zins für Staatsanleihen vergleicht. Ganz abgesehen davon, dass dieses Fed-Modell wirklich nicht funktioniert und eher eine Schimäre ist (der Nikkei 225 müsste nach diesem Modell bei 30.000 stehen !), rechne ich wegen der enorm steigenden Staatsverschuldung mit höheren langfristigen Zinsen, und damit wäre auch dieses Argument Fed-Modell hinfällig. Ich rechne damit, dass Sir Print A Lot of Money weiterhin die kurzfristigen Zinsen senken wird und notfalls das Geld mit Hubschraubern über den grossen Städten Amerikas abwerfen wird, sodass der Markt einfach zu viel Liquidität bekommt. Da gleichzeitig der jetzt noch boomende Immobilienmarkt in Amerika und Grossbritannien einen Kollaps erleiden könnte, werden die Anleger versucht sein, ihr Glück in Aktien zu suchen, die ja auch Substanzwerte sein können. Die hohen Staatsdefizite und die Kosten eines Krieges könnten die Inflationsraten in der Welt steigen lassen, und eine Renaissance des Goldpreises bewirken.
Ich empfehle nach wie vor 70 bis 90% in Cash bzw kurzlaufende Triple A Anleihen zu investieren, 3 bis 5% in physisches Gold und wie in diesem Jahr die Zwischenerholungen zu nutzen, um mit Value-Aktien, wie IBM, Allianz, Phillip Morris, Siemens etc., Gewinne einzufahren.
In der Vergangenheit haben Berufsoptimisten und auch viele Investmentbanken dem Anleger eingehämmert, dass Aktien langfristig Anleihen schlagen. Das stimmt, allerdings nur langfristig. Es ist bemerkenswert, dass ein amerikanischer Stratege James Montier von der DrKW errechnet hat, dass « unter den derzeit herrschenden Bedingungen es 52 Jahre dauern wird, bis die akkumulierten, realen Einkünfte aus amerikanischen Aktien die akkumulierten, realen Einkünfte aus Anleihen übertreffen werden ». Wie die Ergebnisse eines Berufsoptimisten an der Börse ausfallen, sehen Sie an Heiko Thieme, sein Fonds Thieme Fonds International hat seit Jahresbeginn 65% seines Wertes verloren und seit 3 Jahren 85%. Er ist damit unter den 3 schlechtesten der insgesamt 462 Fonds Aktien International. James Montier hat mit Sicherheit nicht an diesen Fonds gedacht, als er seinen Anlagehorizont auf 52 Jahre setzte.
Roland Leuschel
P.S. Am 25.1.2003 findet im Künstlerhaus in München das Goldbrief-Seminar statt, auf dem ich ausführlich über den drohenden Kollaps des Weltfinanz- und Rentensystems sprechen werde. Unter anderen wird Johann A. Saiger über die Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor berichten. (Information unter der Telefonnummer : 0174 – 84.58.147)
---
zur Person: Roland Leuschel:
Direktor der Banque Bruxelles Lambert
Roland Leuschel, ehemaliger Stratege und Direktor der Banque Bruxelles Lambert, Autor mehrerer Bücher (u. a. Die amerikanische Idee, Wachstum unsere Zukunft 1984, Sonntags nie am liebsten im Oktober 1990), erkannte rechtzeitig im Jahr 1982 die Aktienhausse in den USA und in Europa. Im Sommer 1987 sah er den Oktober-Crash exakt voraus und gilt seither als "Crash-Prophet", der zu den großen Börsenberühmtheiten in Europa zählt (Börse Online). In Japan begann 1990 der von ihm vorausgesagte Salami- Crash (Crash auf Raten), der die damals größte Börsenkapitalisierung der Welt um rund 40 % fallen ließ (Nikkei 225 von 40.000 auf 12.800 im Jahr 1998). Der von ihm vorausgesagte Crash fand in Amerika und Europa nicht statt. Leuschel behauptet aber: Seit 1997 bzw. 1998 befinden wir uns in Amerika und Europa in einem Salami-Crash.
Die Kolumnen von Roland Leuschel werden u. a. von
www.boerse.de veröffentlicht !
.

Goldbugs in Bombenstimmung :
Endzeitstimmung in Jammerland
Die Stimmung der Deutschen ist Umfragen zufolge auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Nicht einmal jeder Dritte geht mit Hoffnungen ins neue Jahr - stattdessen herrschen Angst und Skepsis vor. Droht Deutschland eine Dauerkrise?
Dass die Deutschen das Glas gerne halbleer sehen, ist bekannt und nicht unbedingt Anlass dafür, den Arzt zu rufen. Anders als die daueroptimistischen Amerikaner pflegen die Menschen zwischen Rhein und Oder die Kunst des Klagens, die Bedenkenträgerei.
Doch was die Demoskopen zum Ende des Krisenjahres 2002 ermitteln, gibt Anlass zu größter Sorge. Als seien die Deutschen einer kollektiven Depression verfallen, ist die Zuversicht auf historische Tiefstwerte gesunken: Endzeitstimmung in Jammerland.
In der repräsentativen Allensbach-Traditionsumfrage wird seit 1949 stets im Dezember die Frage "Sehen Sie dem neuen Jahr mit Hoffnungen oder mit Befürchtungen entgegen?" gestellt. In diesem Jahr äußerten sich nur noch 31 Prozent der Bundesbürger hoffnungsfroh. Ebenso viele Menschen gehen mit Befürchtungen ins Jahr 2003, 30 Prozent zeigten sich skeptisch. Unentschieden äußerten sich 8 Prozent.
Weniger Optimismus als heute habe es nur 1950 zur Zeit des Koreakrieges, 1973 während der Ölkrise sowie zu Beginn der 80er Jahre als Reaktion auf kritische Zahlen aus der Wirtschaft und vom Arbeitsmarkt gegeben, so das Allensbach-Institut.
"Die Angst breitet sich aus"
Das Ergebnis der Umfrage deckt sich mit dem einer Erhebung des Hamburger BAT-Freizeit-Forschungsinstituts. Viele Deutsche sähen dem kommenden Jahr "unsicher und mit gemischten Gefühlen" entgegen, sagte der Institutsleiter Horst Opaschowski. "Die Angst vor Konsumverzicht und Wohlstandsverlusten breitet sich aus." Die Menschen fürchteten zunehmend einen sozialen Abstieg. "Niemand will zu den Wohlstandsverlierern gehören", erklärte Opaschowski. "Noch nie erschien in den letzten fünf Jahren die Zukunft so unsicher wie heute."
"In Deutschland gerät die gewohnte Balance von Wohlstand und Wohlfahrt ins Wanken", meinte der Wissenschaftler. So fürchteten die Menschen um ihre Rente, immerhin 79 Prozent der 2000 von seinem Institut befragten Menschen über 14 Jahren hätten die Sicherung der Renten als "vordringlich vom Staat zu lösendes Problem" genannt. Nur die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (94 Prozent) sei als noch wichtiger eingestuft worden. Auf dem dritten Platz rangierte die Schaffung von Ausbildungsplätzen (70 Prozent).
Gefährliche Abwärtsspirale
Die düstere Stimmung könnte eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzen: Die wirtschaftliche Dynamik eines Landes ist nicht nur abhängig von äußeren Faktoren wie Steuerlast oder Arbeitsgesetzen, sondern in hohem Maß auch von Psychologie...
Wer Hoffnung mit der Zukunft verbindet, ist risikobereiter, investiert eher. Wer dagegen nur Düsternis sieht, richtet sich aufs Überleben ein, nicht auf einen Sieges-Lauf. Etliche Wirtschaftsexperten mahnen, dass die Deutschen die Lage mittlerweile viel pessimistischer sehen würden, als eigentlich angebracht sei und sich so immer tiefer in den Abschwung hineinredeten.
Andere warnen, dass die Politik viel zu lethargisch agiert. "Wir haben noch keine japanischen Verhältnisse. Aber sie drohen", sagt selbst der als nüchtern bekannte Ökonom Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Pünktlich zum Jahreswechsel drohen den Deutschen neue Belastungen auf breiter Front: Die Ökosteuer wird zum fünften Mal angehoben, Renten- und Krankenkasse werden erheblich teurer, auch Erdgas kostet künftig mehr. Ab April steigt die Mehrwertsteuer für Produkte wie Blumen, Holz, Saatgut oder Tierfutter. Den Aktiensparern droht eine Ausweitung der Spekulationssteuer, den Unternehmen eine Mindeststeuer. Die Menschen haben weniger Geld, um zu konsumieren, um die Wirtschaft anzutreiben.
Nachbarländer wie die Niederlande, Schweden oder Dänemark haben vorgemacht, wie mit Reformen die Stimmung herumzureißen ist, das Land wieder auf Zukunftskurs gebracht werden kann. Doch sie erfordern Mut, Durchsetzungskraft und die Bereitschaft, den Menschen zu sagen, was auf sie zukommt - nicht unbedingt Eigenschaften, mit denen sich die Bundesregierung bisher einen Namen gemacht hat.

Goldbugs in Bombenstimmung :
Endzeitstimmung in Jammerland
Die Stimmung der Deutschen ist Umfragen zufolge auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Nicht einmal jeder Dritte geht mit Hoffnungen ins neue Jahr - stattdessen herrschen Angst und Skepsis vor. Droht Deutschland eine Dauerkrise?
Dass die Deutschen das Glas gerne halbleer sehen, ist bekannt und nicht unbedingt Anlass dafür, den Arzt zu rufen. Anders als die daueroptimistischen Amerikaner pflegen die Menschen zwischen Rhein und Oder die Kunst des Klagens, die Bedenkenträgerei.
Doch was die Demoskopen zum Ende des Krisenjahres 2002 ermitteln, gibt Anlass zu größter Sorge. Als seien die Deutschen einer kollektiven Depression verfallen, ist die Zuversicht auf historische Tiefstwerte gesunken: Endzeitstimmung in Jammerland.
In der repräsentativen Allensbach-Traditionsumfrage wird seit 1949 stets im Dezember die Frage "Sehen Sie dem neuen Jahr mit Hoffnungen oder mit Befürchtungen entgegen?" gestellt. In diesem Jahr äußerten sich nur noch 31 Prozent der Bundesbürger hoffnungsfroh. Ebenso viele Menschen gehen mit Befürchtungen ins Jahr 2003, 30 Prozent zeigten sich skeptisch. Unentschieden äußerten sich 8 Prozent.
Weniger Optimismus als heute habe es nur 1950 zur Zeit des Koreakrieges, 1973 während der Ölkrise sowie zu Beginn der 80er Jahre als Reaktion auf kritische Zahlen aus der Wirtschaft und vom Arbeitsmarkt gegeben, so das Allensbach-Institut.
"Die Angst breitet sich aus"
Das Ergebnis der Umfrage deckt sich mit dem einer Erhebung des Hamburger BAT-Freizeit-Forschungsinstituts. Viele Deutsche sähen dem kommenden Jahr "unsicher und mit gemischten Gefühlen" entgegen, sagte der Institutsleiter Horst Opaschowski. "Die Angst vor Konsumverzicht und Wohlstandsverlusten breitet sich aus." Die Menschen fürchteten zunehmend einen sozialen Abstieg. "Niemand will zu den Wohlstandsverlierern gehören", erklärte Opaschowski. "Noch nie erschien in den letzten fünf Jahren die Zukunft so unsicher wie heute."
"In Deutschland gerät die gewohnte Balance von Wohlstand und Wohlfahrt ins Wanken", meinte der Wissenschaftler. So fürchteten die Menschen um ihre Rente, immerhin 79 Prozent der 2000 von seinem Institut befragten Menschen über 14 Jahren hätten die Sicherung der Renten als "vordringlich vom Staat zu lösendes Problem" genannt. Nur die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (94 Prozent) sei als noch wichtiger eingestuft worden. Auf dem dritten Platz rangierte die Schaffung von Ausbildungsplätzen (70 Prozent).
Gefährliche Abwärtsspirale
Die düstere Stimmung könnte eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzen: Die wirtschaftliche Dynamik eines Landes ist nicht nur abhängig von äußeren Faktoren wie Steuerlast oder Arbeitsgesetzen, sondern in hohem Maß auch von Psychologie...

Wer Hoffnung mit der Zukunft verbindet, ist risikobereiter, investiert eher. Wer dagegen nur Düsternis sieht, richtet sich aufs Überleben ein, nicht auf einen Sieges-Lauf. Etliche Wirtschaftsexperten mahnen, dass die Deutschen die Lage mittlerweile viel pessimistischer sehen würden, als eigentlich angebracht sei und sich so immer tiefer in den Abschwung hineinredeten.
Andere warnen, dass die Politik viel zu lethargisch agiert. "Wir haben noch keine japanischen Verhältnisse. Aber sie drohen", sagt selbst der als nüchtern bekannte Ökonom Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Pünktlich zum Jahreswechsel drohen den Deutschen neue Belastungen auf breiter Front: Die Ökosteuer wird zum fünften Mal angehoben, Renten- und Krankenkasse werden erheblich teurer, auch Erdgas kostet künftig mehr. Ab April steigt die Mehrwertsteuer für Produkte wie Blumen, Holz, Saatgut oder Tierfutter. Den Aktiensparern droht eine Ausweitung der Spekulationssteuer, den Unternehmen eine Mindeststeuer. Die Menschen haben weniger Geld, um zu konsumieren, um die Wirtschaft anzutreiben.
Nachbarländer wie die Niederlande, Schweden oder Dänemark haben vorgemacht, wie mit Reformen die Stimmung herumzureißen ist, das Land wieder auf Zukunftskurs gebracht werden kann. Doch sie erfordern Mut, Durchsetzungskraft und die Bereitschaft, den Menschen zu sagen, was auf sie zukommt - nicht unbedingt Eigenschaften, mit denen sich die Bundesregierung bisher einen Namen gemacht hat.
Dem Artikel kann ich nur zustimmen.

"-stattdessen herrschen Angst und Skepsis vor"
Das ist der Stoff, aus dem die Goldhausse gemacht ist!
" Etliche Wirtschaftsexperten mahnen, dass die Deutschen die Lage mittlerweile viel
pessimistischer sehen würden, als eigentlich angebracht sei und sich so immer tiefer in den Abschwung hineinredeten."
Pessimismus ist auch oft ein Realismus. Was nützt es, mit Hurrageschrei in die Pleite zu gehen? Nein, die Leute brauchen "Vertrauen" und vertrauen in dieser verlogenen Welt kann man eigentlich nur noch Gold (und seiner 9mm vielleicht).
Gruß
Sovereign
Das ist der Stoff, aus dem die Goldhausse gemacht ist!
" Etliche Wirtschaftsexperten mahnen, dass die Deutschen die Lage mittlerweile viel
pessimistischer sehen würden, als eigentlich angebracht sei und sich so immer tiefer in den Abschwung hineinredeten."
Pessimismus ist auch oft ein Realismus. Was nützt es, mit Hurrageschrei in die Pleite zu gehen? Nein, die Leute brauchen "Vertrauen" und vertrauen in dieser verlogenen Welt kann man eigentlich nur noch Gold (und seiner 9mm vielleicht).
Gruß
Sovereign
Pessimismus ist auch oft ein Realismus. Was nützt es, mit Hurrageschrei in die Pleite zu gehen? Nein, die Leute brauchen "Vertrauen" und vertrauen in dieser verlogenen Welt kann man eigentlich nur noch Gold (und seiner 9mm vielleicht).
Sovereign, laß das mit der 9 mm, oder gehen die Malt-Vorräte zu Neige ? - Die SPIEGEL-Journalisten befinden sich nun offenbar auch im postweihnachtlichen Trauma. Einen letzten Versuch der Behauptung gegen die eigene Panik unternimmt gerade der von mir sehr geschätzte Matthias Matussek, aber er scheint der eigenen Rhetorik nicht so ganz zu trauen ...
Gruß Konradi
---
DER SPIEGEL 1/2003 - 30. Dezember 2002
Ziemlich vergeigt
Die Welt zerfällt nicht mehr in Linke oder Rechte, sondern in Aktionäre und Nichtaktionäre.
Nach zwei Crash-Jahren zieht ein Kleinanleger Bilanz.
Von Matthias Matussek
Alles ist schwer besinnlich: Die Frau schmückt den Baum. Der Kleine übt im Nebenzimmer "Stille Nacht" auf seiner neuen Geige. Opa liest Lenins "Was tun?". Alle lächeln und haben diesen Glanz in den Augen. Nur ich störe. Ich bin plötzlich sehr launisch. Ich starre auf dieses Ding, auf das ich beim Aufräumen gestoßen bin. Und es ist wie mit James Stewart in diesem Weihnachtsfilm, wo er bankrott ist und weiß, dass es das Vernünftigste wäre, Schluss zu machen. Man muss beim Schlussmachen ja vielleicht nicht gleich mit dem Leben anfangen.
Natürlich kann die Geschichte nur mit diesem Ding beginnen, also mit einer Rückblende auf die Zeiten der Triumphe, als der Champagner in Strömen floss und jeder so ein Ding hatte.
Es ist ein Pager, eines dieser elektronischen Spielzeuge der Börsenjungs, womit man rund um die Uhr die neuesten Nachrichten bekam. Auf Knopfdruck konnte es anzeigen, wie AOL stand oder Daimler. Carola Ferstl, die Frontfrau der "Telebörse", hatte es mal beim Essen aus ihrer Louis-Vuitton-Tasche gezogen und mir damit schwer imponiert.
Sie arbeitete damals gerade an ihrem Buch "Geld tut Frauen richtig gut". Da ich auch mal so erfolgreich sein wollte wie Carola - meine Bücher waren bis dahin eher in begrenzten Auflagen für Liebhaber erschienen -, erwog ich für mein nächstes Buch auch irgendwas mit Geld im Titel. Zum Beispiel: "GELD und andere Reportagen". Oder: "Noch mehr Geld tut Männern richtig gut".
Damals guckte ich gern auf den Pager. Diese indonesischen Banktitel, die mir mein Freund Kai als Geheimtipp genannt hatte, wurden von dem Ding nicht erfasst, aber man konnte sich darauf verlassen, dass sowieso alles nach oben ging.
Das war 1999, im vorigen Jahrhundert, als die Geschichte noch für beendet erklärt war und der Kapitalismus derart triumphierte, dass einem der Kopf wackelte. Der Rest ist, na ja, Geschichte und wie die sich ächzend und mit Crashs und Terrorakten und Blitzkriegen zurückmeldet. Was die indonesischen Bankpapiere angeht: Der Geheimtipp war so geheim, dass die Aktie außer Kai und dem Indonesier, dem die Bank gehörte, keiner kannte. Letzterer hatte sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht - wie das ganze System. Hat sich als Sache von Hütchenspielern erwiesen, die dem "Kleinen Mann" (also mir) einige Einstiegserfolge gestatteten, und die dann ganz hastig die Einsätze vom Tisch räumten, weil die ersten Polizeiautos bereits um die Ecke bogen.
Nur der Kleinanleger (auch ich) stand noch auf der Straße herum und rieb sich die Augen. Täterbeschreibung? Na ja, die sahen alle irgendwie gleich aus, wie Bodo Schäfer oder Thomas Haffa ...
Weltweit wurden in drei Jahren über zwölf Billionen Euro vernichtet, und das nicht etwa von Hasardeuren in irgendwelchen Gurkenrepubliken, sondern von seriösen Fondsmanagern seriöser Finanzinstitute, die sich einfach irgendwie vergriffen haben, in den USA und Europa und Japan ganz vorneweg, und in der Explosionswolke sind viele Ersparnisse verpufft (auch meine).
Na ja, ein Teil. Ein schmerzhafter Teil.
Dabei sah mein Kleinanleger-Portfolio nach damaligen Maßstäben äußerst konservativ aus. Neben AOL noch eine Menge T-Aktien. Dazu Daimler, die ich bei rund 90 Euro in mein Portfolio gelegt hatte. Zu Letzterem hatte mir der Anlageberater meiner Bank ausdrücklich gratuliert: "Sie machen eben nicht diesen Start-up-Hype mit, sondern setzen auf Qualität!"
Seither ist die AOL-Aktie zu Asche zerfallen und die T-Aktie, die Volksaktie, die so Vertrauen erweckend nach Volkswagen und deutscher Wertarbeit klang, hatte sich als ähnlich spekulativ erwiesen wie der indonesische Bankentitel. Und Daimler? Hat um 70 Prozent "nachgegeben", wie es in Carola Ferstls Börsendeutsch heißt. Übrig geblieben ist eigentlich nur das Ding.
Wenn mein Geld arbeitete, dann konnte man ihm mit dem Ding den Puls nehmen. Ihm und dem ganzen System. Jetzt liegt das Ding zerbrochen vor mir auf dem Schreibtisch. Und daneben eine dieser Werbesendungen, die ihr Motto schon außen auf den Umschlag schreiben, wo es in dicken Lettern brüllt: "Ist der Crash vorbei? IM LEBEN NICHT!"
Was denken die Aasgeier sich dabei, so was vor Weihnachten zu verschicken? Wollen sie die Leute vom Fenstersims stoßen?
Im Kuvert: das Anforderungsformular für einen Börsenbrief "Ja, ich möchte mich und mein Vermögen zuverlässig schützen. Bitte senden Sie mir Ihren Börsen-Informationsdienst `Sicheres Geld` sofort zu."
Das ist die Hütchenspieler-Nachhut. Das Geschwader, das sich über die Reste hermacht. Früher appellierten diese Briefe an die Gier und versprachen, das Vermögen in acht Tagen zu vervielfältigen. Jetzt versuchen sie, mit der schieren Angst zu kassieren. Der Anlegerkapitalismus ist nun mal eine Sache heftiger Gefühlsschwankungen.
Ich gehöre zu der Generation, die 16 war, als das "White Album" der Beatles herauskam, und folglich sowohl zum System wie zur Revolution ein ironisches Verhältnis hat. Wir sind die neomarxistische Frankfurter-Schule-Engagement-Generation. Wir lieben heftige Statements und heftige Investitionen. Es gibt ziemlich viele von uns. Im Moment wissen wir nicht genau, ob wir uns schief lachen sollen darüber, dass wir Recht behalten haben, oder Amok laufen. Soweit ich die Sache überblicke, ist die Mehrheit fürs Schieflachen.
Wir wissen und wussten immer, dass wir in einem Schweinesystem leben. Das unterscheidet uns erheblich von der nachfolgenden Generation Golf oder jener noch jüngeren, die sich kürzlich unter dem Namen "Sussebach" in der "Zeit" meldete.
Das Generationsexemplar Sussebach bejammerte konkret, dass er, Sussebach, nun vielleicht sein ausgebautes Dachgeschoss verliere wegen der Krisenanfälligkeit dieses Systems, obwohl er doch ideologisch immer schon also so was von absolut freundlich diesem System gegenüber eingestellt war: "Der freie Markt galt uns nicht als Schweinesystem, sondern als Chance", schreibt Herr Sussebach in der "Zeit".
Junger Freund, es ist ein Schweinesystem. Und das sollte man nie vergessen. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus taktischen Gründen. Als Marxist weiß man, dass die sieben Achtel, die schlechter dran sind, einem irgendwann mal den Schädel einschlagen und womöglich damit Recht haben.
Was ich sagen will: Meine Altersgenossen und ich, wir sind eine besondere Sorte von Kleinanlegern. Wir halten das System für verrottet und müssen ihm trotzdem die Daumen drücken, dass es gewinnt, damit es die Kohle wieder rausrückt, die wir ihm anvertraut haben, um uns mit einem möglichst sonnigen Lebensabend zu versorgen.
Die Welt zerfällt längst nicht mehr in Links oder Rechts, sondern in Anleger und Nichtanleger. Der marxistische Kleinanleger versteht, dass alles unter diesem Licht zu sehen ist, selbst der Pazifismus. Sorry, aber Krieg, das gab kurz vor Weihnachten ein Analyst empört zu bedenken, Krieg ist im Moment echt schlecht für Technologie-Titel.
Dann wiederum ist alles schlecht für Technologie-Titel. Im letzten Jahrhundert hatten wir Anleger nur mit Bill Clintons Lewinsky-Affäre zu kämpfen, die auf die Kurse drückte. Jetzt gibt es Krieg, Terror, knappes Öl. Mittlerweile drücken selbst die Kurse auf die Kurse.
Die Situation eines marxistischen Kleinanlegers war dabei schon immer eine schizophrene. Doch solange sie Gewinne abwarf, war sie ehestressfrei und verführte durchaus zu Generosität. Man hatte die Gewinne dieser kapitalistischen Raserei mit dem überraschten Lächeln eines Las-Vegas-Spielers eingestrichen, und überall standen Analysten herum, die einen als sachverständig lobten.
Nun geht es seit fast drei Jahren in die andere Richtung. Nun hat man dauernd Recht. Widerwärtig Recht. Nun könnte man jeden zweiten Tag grimmig nickend vor BBC und CNN sitzen, die News über betrügerische Analysten, größenwahnsinnige Unternehmer, (Bilanz-)Friseure wie Haffa sehen und murmeln: "Hamwerdoch schon immer gesacht!"
Das hatten wir alles schon hinter uns. Abgehakt. Und da fällt uns das Ding wieder in die Hände, und es erinnert uns an alles: das Jacketkronengrinsen dieser neureichen Ganovenvisagen und auch durchaus die älteren oligarchischen Tränensäcke, die entweder beim Klauen erwischt worden waren oder in die Schlagzeilen gerieten, weil sie sich nach mondänem Missmanagement mit Zig-Millionen-Dollar-Abfindungen auf irgendwelche Privatinseln zurückgezogen hatten.
Ein Jahr ist zu Ende, das mit einer erstaunlichen Erholung an der Börse begonnen hatte. Ein Jahr, von dem viele Analysten prophezeit hatten, dass es die Startrampe zum neuen Aufschwung sein werde. Deshalb rieten sie, "vorsichtig und klug hinzuzukaufen".
In der Kleinanleger-Psychologie ist es so: Wer vorsichtig und klug dazukauft, macht alle vorherigen Niederlagen ungeschehen. Er hat den Blick fest auf den Horizont eines neuen Aufschwungs gerichtet und weiß, dass er eines Tages Recht haben wird.
In diesen Momenten weiß ich: Mein Sohn, der sich gerade zum dritten Mal an der gleichen Stelle verschrammt, wird es einmal besser haben als ich - mit AOL. Wenn er "Stille Nacht" überlebt ...
Drei Dinge verstören mich an diesem Tag: erstens, dass die Stelle "Holder Knaaaabe ..." so schwierig zu geigen ist; zweitens, dass die Irak-Intervention näher gerückt ist, und - drittens -, dass Micron enttäuschende Ergebnisse gemeldet hat, was bei CNN das gewohnte Bild produziert: Eine Blondine jammert auf dem Wall-Street-Parkett, dass alles noch weiter ins Rutschen geraten sei und keiner genau wisse, ob es am Irak liege oder an Micron.
Es liegt an keinem von beidem, Dummchen. Es liegt an den zyklischen Kapitalvernichtungsanfällen des Kapitalismus, der sich die entsprechenden Ausreden immer hinterher zurechtlegt.
Mal unmarxistisch gesprochen: Der Kapitalismus ist so was wie der Golfstrom. Wie das Konjunkturwetter in den nächsten Jahren sein wird, weiß er selbst nicht. Er tut einfach. Es kann einen hübschen Sommer geben. Aber auch einige zigtausend Obdachlose und Flutopfer.
Reden wir also nicht drum herum: Wir haben alles selbst vergeigt. Unsere Portfolios sind ziemlich abgefackelt. Wahrscheinlich war das die ganze Zeit mit "start up" gemeint: Wir müssen ganz neu anfangen, gerade wir, die wir das System verachten.
Da wäre die Weisheit des einstigen Anleger-Gurus Kostolany, der gesagt hatte, man solle Aktien kaufen und dann Schlaftabletten nehmen. Er hat aber nicht gesagt, wie viele. Ein Röhrchen, zwei Röhrchen?
Was mir als marxistischem Kleinanleger besonders zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass ich mit meinen Investitionen eine größere Systemgläubigkeit an den Tag gelegt habe als die als systemkonform geltende Elterngeneration. Die hatte ihr Geld auf dem Postsparbuch sichergestellt, also in der systemfernsten und misstrauischsten Anlageform, die es gibt. Das ist schon fast DDR.
Das war die Nachkriegsgeneration. Ich bin die Middelhoff-Generation. Thomas Middelhoff ist bei Bertelsmann gefeuert worden, obwohl er, aus Sicht des Kleinanlegers, alles richtig gemacht hat. Er hat AOL rechtzeitig verkauft. Er hat 7,5 Milliarden Euro in die Konzernkasse gespült und ist von den Spießern des Konzerns vor die Tür gesetzt worden. Die Spießer gewinnen immer.
Der Witz ist wohl einfach der, dass wir marxistischen Kleinanleger die zyklische Kapitalvernichtung durch den Kapitalismus zwar einstudiert haben wie nichts sonst, sie aber nie auf uns persönlich bezogen haben, sondern immer nur auf die englischen Weber des 19. Jahrhunderts. Nun hat es uns erwischt. Warum auch nicht?
In Brasilien, wo ich derzeit lebe, werden die Ersparnisse meiner Freunde durch die Inflation vernichtet, Ergebnis einer Spekulationswelle von der Wucht einer Naturkatastrophe, unvorhersehbar und schicksalhaft. Deshalb sitzen sie jetzt auch in der Weihnachtszeit zusammen, an den Kiosken, am Strand, und diskutieren die drängende Frage, ob Robinho mit seinem sensationellen Übersteiger im Meisterschaftsfinale nun die legitime Pele-Nachfolge angetreten hat oder nicht. Von Brasilien lernen heißt siegen lernen!
Vertrauen wir auf die irrationalen Übertreibungen des Kapitals, die todsicher irgendwann einmal wieder zu unseren Gunsten arbeiten. Alle Analysten sind Schwachköpfe, auch die, die schwarz sehen.
Das Ding liegt immer noch auf dem Schreibtisch. Vielleicht ist ja noch Leben in ihm? Vielleicht glüht es noch einmal auf, wie das Dioden-Auge von Arnold Schwarzenegger am Ende von "Terminator II", und dann kommt die ganze Kampfmaschine wieder auf Touren und erschlägt den Bösewicht, den Bärenmarkt.
Wir Kleinanleger haben ein freundliches Verhältnis zur Welt.
Wir sind Optimisten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig.

Sovereign, laß das mit der 9 mm, oder gehen die Malt-Vorräte zu Neige ? - Die SPIEGEL-Journalisten befinden sich nun offenbar auch im postweihnachtlichen Trauma. Einen letzten Versuch der Behauptung gegen die eigene Panik unternimmt gerade der von mir sehr geschätzte Matthias Matussek, aber er scheint der eigenen Rhetorik nicht so ganz zu trauen ...

Gruß Konradi
---
DER SPIEGEL 1/2003 - 30. Dezember 2002
Ziemlich vergeigt
Die Welt zerfällt nicht mehr in Linke oder Rechte, sondern in Aktionäre und Nichtaktionäre.
Nach zwei Crash-Jahren zieht ein Kleinanleger Bilanz.
Von Matthias Matussek
Alles ist schwer besinnlich: Die Frau schmückt den Baum. Der Kleine übt im Nebenzimmer "Stille Nacht" auf seiner neuen Geige. Opa liest Lenins "Was tun?". Alle lächeln und haben diesen Glanz in den Augen. Nur ich störe. Ich bin plötzlich sehr launisch. Ich starre auf dieses Ding, auf das ich beim Aufräumen gestoßen bin. Und es ist wie mit James Stewart in diesem Weihnachtsfilm, wo er bankrott ist und weiß, dass es das Vernünftigste wäre, Schluss zu machen. Man muss beim Schlussmachen ja vielleicht nicht gleich mit dem Leben anfangen.
Natürlich kann die Geschichte nur mit diesem Ding beginnen, also mit einer Rückblende auf die Zeiten der Triumphe, als der Champagner in Strömen floss und jeder so ein Ding hatte.
Es ist ein Pager, eines dieser elektronischen Spielzeuge der Börsenjungs, womit man rund um die Uhr die neuesten Nachrichten bekam. Auf Knopfdruck konnte es anzeigen, wie AOL stand oder Daimler. Carola Ferstl, die Frontfrau der "Telebörse", hatte es mal beim Essen aus ihrer Louis-Vuitton-Tasche gezogen und mir damit schwer imponiert.
Sie arbeitete damals gerade an ihrem Buch "Geld tut Frauen richtig gut". Da ich auch mal so erfolgreich sein wollte wie Carola - meine Bücher waren bis dahin eher in begrenzten Auflagen für Liebhaber erschienen -, erwog ich für mein nächstes Buch auch irgendwas mit Geld im Titel. Zum Beispiel: "GELD und andere Reportagen". Oder: "Noch mehr Geld tut Männern richtig gut".
Damals guckte ich gern auf den Pager. Diese indonesischen Banktitel, die mir mein Freund Kai als Geheimtipp genannt hatte, wurden von dem Ding nicht erfasst, aber man konnte sich darauf verlassen, dass sowieso alles nach oben ging.
Das war 1999, im vorigen Jahrhundert, als die Geschichte noch für beendet erklärt war und der Kapitalismus derart triumphierte, dass einem der Kopf wackelte. Der Rest ist, na ja, Geschichte und wie die sich ächzend und mit Crashs und Terrorakten und Blitzkriegen zurückmeldet. Was die indonesischen Bankpapiere angeht: Der Geheimtipp war so geheim, dass die Aktie außer Kai und dem Indonesier, dem die Bank gehörte, keiner kannte. Letzterer hatte sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht - wie das ganze System. Hat sich als Sache von Hütchenspielern erwiesen, die dem "Kleinen Mann" (also mir) einige Einstiegserfolge gestatteten, und die dann ganz hastig die Einsätze vom Tisch räumten, weil die ersten Polizeiautos bereits um die Ecke bogen.
Nur der Kleinanleger (auch ich) stand noch auf der Straße herum und rieb sich die Augen. Täterbeschreibung? Na ja, die sahen alle irgendwie gleich aus, wie Bodo Schäfer oder Thomas Haffa ...
Weltweit wurden in drei Jahren über zwölf Billionen Euro vernichtet, und das nicht etwa von Hasardeuren in irgendwelchen Gurkenrepubliken, sondern von seriösen Fondsmanagern seriöser Finanzinstitute, die sich einfach irgendwie vergriffen haben, in den USA und Europa und Japan ganz vorneweg, und in der Explosionswolke sind viele Ersparnisse verpufft (auch meine).
Na ja, ein Teil. Ein schmerzhafter Teil.
Dabei sah mein Kleinanleger-Portfolio nach damaligen Maßstäben äußerst konservativ aus. Neben AOL noch eine Menge T-Aktien. Dazu Daimler, die ich bei rund 90 Euro in mein Portfolio gelegt hatte. Zu Letzterem hatte mir der Anlageberater meiner Bank ausdrücklich gratuliert: "Sie machen eben nicht diesen Start-up-Hype mit, sondern setzen auf Qualität!"
Seither ist die AOL-Aktie zu Asche zerfallen und die T-Aktie, die Volksaktie, die so Vertrauen erweckend nach Volkswagen und deutscher Wertarbeit klang, hatte sich als ähnlich spekulativ erwiesen wie der indonesische Bankentitel. Und Daimler? Hat um 70 Prozent "nachgegeben", wie es in Carola Ferstls Börsendeutsch heißt. Übrig geblieben ist eigentlich nur das Ding.
Wenn mein Geld arbeitete, dann konnte man ihm mit dem Ding den Puls nehmen. Ihm und dem ganzen System. Jetzt liegt das Ding zerbrochen vor mir auf dem Schreibtisch. Und daneben eine dieser Werbesendungen, die ihr Motto schon außen auf den Umschlag schreiben, wo es in dicken Lettern brüllt: "Ist der Crash vorbei? IM LEBEN NICHT!"
Was denken die Aasgeier sich dabei, so was vor Weihnachten zu verschicken? Wollen sie die Leute vom Fenstersims stoßen?
Im Kuvert: das Anforderungsformular für einen Börsenbrief "Ja, ich möchte mich und mein Vermögen zuverlässig schützen. Bitte senden Sie mir Ihren Börsen-Informationsdienst `Sicheres Geld` sofort zu."
Das ist die Hütchenspieler-Nachhut. Das Geschwader, das sich über die Reste hermacht. Früher appellierten diese Briefe an die Gier und versprachen, das Vermögen in acht Tagen zu vervielfältigen. Jetzt versuchen sie, mit der schieren Angst zu kassieren. Der Anlegerkapitalismus ist nun mal eine Sache heftiger Gefühlsschwankungen.
Ich gehöre zu der Generation, die 16 war, als das "White Album" der Beatles herauskam, und folglich sowohl zum System wie zur Revolution ein ironisches Verhältnis hat. Wir sind die neomarxistische Frankfurter-Schule-Engagement-Generation. Wir lieben heftige Statements und heftige Investitionen. Es gibt ziemlich viele von uns. Im Moment wissen wir nicht genau, ob wir uns schief lachen sollen darüber, dass wir Recht behalten haben, oder Amok laufen. Soweit ich die Sache überblicke, ist die Mehrheit fürs Schieflachen.
Wir wissen und wussten immer, dass wir in einem Schweinesystem leben. Das unterscheidet uns erheblich von der nachfolgenden Generation Golf oder jener noch jüngeren, die sich kürzlich unter dem Namen "Sussebach" in der "Zeit" meldete.
Das Generationsexemplar Sussebach bejammerte konkret, dass er, Sussebach, nun vielleicht sein ausgebautes Dachgeschoss verliere wegen der Krisenanfälligkeit dieses Systems, obwohl er doch ideologisch immer schon also so was von absolut freundlich diesem System gegenüber eingestellt war: "Der freie Markt galt uns nicht als Schweinesystem, sondern als Chance", schreibt Herr Sussebach in der "Zeit".
Junger Freund, es ist ein Schweinesystem. Und das sollte man nie vergessen. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus taktischen Gründen. Als Marxist weiß man, dass die sieben Achtel, die schlechter dran sind, einem irgendwann mal den Schädel einschlagen und womöglich damit Recht haben.
Was ich sagen will: Meine Altersgenossen und ich, wir sind eine besondere Sorte von Kleinanlegern. Wir halten das System für verrottet und müssen ihm trotzdem die Daumen drücken, dass es gewinnt, damit es die Kohle wieder rausrückt, die wir ihm anvertraut haben, um uns mit einem möglichst sonnigen Lebensabend zu versorgen.
Die Welt zerfällt längst nicht mehr in Links oder Rechts, sondern in Anleger und Nichtanleger. Der marxistische Kleinanleger versteht, dass alles unter diesem Licht zu sehen ist, selbst der Pazifismus. Sorry, aber Krieg, das gab kurz vor Weihnachten ein Analyst empört zu bedenken, Krieg ist im Moment echt schlecht für Technologie-Titel.
Dann wiederum ist alles schlecht für Technologie-Titel. Im letzten Jahrhundert hatten wir Anleger nur mit Bill Clintons Lewinsky-Affäre zu kämpfen, die auf die Kurse drückte. Jetzt gibt es Krieg, Terror, knappes Öl. Mittlerweile drücken selbst die Kurse auf die Kurse.
Die Situation eines marxistischen Kleinanlegers war dabei schon immer eine schizophrene. Doch solange sie Gewinne abwarf, war sie ehestressfrei und verführte durchaus zu Generosität. Man hatte die Gewinne dieser kapitalistischen Raserei mit dem überraschten Lächeln eines Las-Vegas-Spielers eingestrichen, und überall standen Analysten herum, die einen als sachverständig lobten.
Nun geht es seit fast drei Jahren in die andere Richtung. Nun hat man dauernd Recht. Widerwärtig Recht. Nun könnte man jeden zweiten Tag grimmig nickend vor BBC und CNN sitzen, die News über betrügerische Analysten, größenwahnsinnige Unternehmer, (Bilanz-)Friseure wie Haffa sehen und murmeln: "Hamwerdoch schon immer gesacht!"
Das hatten wir alles schon hinter uns. Abgehakt. Und da fällt uns das Ding wieder in die Hände, und es erinnert uns an alles: das Jacketkronengrinsen dieser neureichen Ganovenvisagen und auch durchaus die älteren oligarchischen Tränensäcke, die entweder beim Klauen erwischt worden waren oder in die Schlagzeilen gerieten, weil sie sich nach mondänem Missmanagement mit Zig-Millionen-Dollar-Abfindungen auf irgendwelche Privatinseln zurückgezogen hatten.
Ein Jahr ist zu Ende, das mit einer erstaunlichen Erholung an der Börse begonnen hatte. Ein Jahr, von dem viele Analysten prophezeit hatten, dass es die Startrampe zum neuen Aufschwung sein werde. Deshalb rieten sie, "vorsichtig und klug hinzuzukaufen".
In der Kleinanleger-Psychologie ist es so: Wer vorsichtig und klug dazukauft, macht alle vorherigen Niederlagen ungeschehen. Er hat den Blick fest auf den Horizont eines neuen Aufschwungs gerichtet und weiß, dass er eines Tages Recht haben wird.
In diesen Momenten weiß ich: Mein Sohn, der sich gerade zum dritten Mal an der gleichen Stelle verschrammt, wird es einmal besser haben als ich - mit AOL. Wenn er "Stille Nacht" überlebt ...
Drei Dinge verstören mich an diesem Tag: erstens, dass die Stelle "Holder Knaaaabe ..." so schwierig zu geigen ist; zweitens, dass die Irak-Intervention näher gerückt ist, und - drittens -, dass Micron enttäuschende Ergebnisse gemeldet hat, was bei CNN das gewohnte Bild produziert: Eine Blondine jammert auf dem Wall-Street-Parkett, dass alles noch weiter ins Rutschen geraten sei und keiner genau wisse, ob es am Irak liege oder an Micron.
Es liegt an keinem von beidem, Dummchen. Es liegt an den zyklischen Kapitalvernichtungsanfällen des Kapitalismus, der sich die entsprechenden Ausreden immer hinterher zurechtlegt.
Mal unmarxistisch gesprochen: Der Kapitalismus ist so was wie der Golfstrom. Wie das Konjunkturwetter in den nächsten Jahren sein wird, weiß er selbst nicht. Er tut einfach. Es kann einen hübschen Sommer geben. Aber auch einige zigtausend Obdachlose und Flutopfer.
Reden wir also nicht drum herum: Wir haben alles selbst vergeigt. Unsere Portfolios sind ziemlich abgefackelt. Wahrscheinlich war das die ganze Zeit mit "start up" gemeint: Wir müssen ganz neu anfangen, gerade wir, die wir das System verachten.
Da wäre die Weisheit des einstigen Anleger-Gurus Kostolany, der gesagt hatte, man solle Aktien kaufen und dann Schlaftabletten nehmen. Er hat aber nicht gesagt, wie viele. Ein Röhrchen, zwei Röhrchen?
Was mir als marxistischem Kleinanleger besonders zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass ich mit meinen Investitionen eine größere Systemgläubigkeit an den Tag gelegt habe als die als systemkonform geltende Elterngeneration. Die hatte ihr Geld auf dem Postsparbuch sichergestellt, also in der systemfernsten und misstrauischsten Anlageform, die es gibt. Das ist schon fast DDR.
Das war die Nachkriegsgeneration. Ich bin die Middelhoff-Generation. Thomas Middelhoff ist bei Bertelsmann gefeuert worden, obwohl er, aus Sicht des Kleinanlegers, alles richtig gemacht hat. Er hat AOL rechtzeitig verkauft. Er hat 7,5 Milliarden Euro in die Konzernkasse gespült und ist von den Spießern des Konzerns vor die Tür gesetzt worden. Die Spießer gewinnen immer.
Der Witz ist wohl einfach der, dass wir marxistischen Kleinanleger die zyklische Kapitalvernichtung durch den Kapitalismus zwar einstudiert haben wie nichts sonst, sie aber nie auf uns persönlich bezogen haben, sondern immer nur auf die englischen Weber des 19. Jahrhunderts. Nun hat es uns erwischt. Warum auch nicht?
In Brasilien, wo ich derzeit lebe, werden die Ersparnisse meiner Freunde durch die Inflation vernichtet, Ergebnis einer Spekulationswelle von der Wucht einer Naturkatastrophe, unvorhersehbar und schicksalhaft. Deshalb sitzen sie jetzt auch in der Weihnachtszeit zusammen, an den Kiosken, am Strand, und diskutieren die drängende Frage, ob Robinho mit seinem sensationellen Übersteiger im Meisterschaftsfinale nun die legitime Pele-Nachfolge angetreten hat oder nicht. Von Brasilien lernen heißt siegen lernen!
Vertrauen wir auf die irrationalen Übertreibungen des Kapitals, die todsicher irgendwann einmal wieder zu unseren Gunsten arbeiten. Alle Analysten sind Schwachköpfe, auch die, die schwarz sehen.
Das Ding liegt immer noch auf dem Schreibtisch. Vielleicht ist ja noch Leben in ihm? Vielleicht glüht es noch einmal auf, wie das Dioden-Auge von Arnold Schwarzenegger am Ende von "Terminator II", und dann kommt die ganze Kampfmaschine wieder auf Touren und erschlägt den Bösewicht, den Bärenmarkt.
Wir Kleinanleger haben ein freundliches Verhältnis zur Welt.
Wir sind Optimisten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig.

Hat er aber teilweise schön ausgedrückt.

tja, mainstream geschädigt. Ham sich keine eigene Meinung gebildet, wie Sep immer sagt. Solls geben

"Sovereign, laß das mit der 9 mm, oder gehen die Malt-Vorräte zu Neige?"
Geschätzter konradi, hier hast Du mich wohl mißverstanden. Es geht um "Vertrauen", d.h. ich vertraue darauf, daß man sich mit Gold immer etwas kaufen kann (und wenn`s ne halbe Unze für nen Sack Mehl ist)...allerdings, denke diesen "Notgroschenaspekt" einen Schritt weiter: Was ist wenn das System vollends kollabiert und die Leute marodierend durch die Straßen ziehen? Meinst Du ein nettes Lächeln und eine hochgehaltene Goldmünze nützen dann noch etwas? Also kommt besagte 9mm als "Argumentationshilfe" ins Spiel...ich will ja nicht sagen, daß dies verhindert, daß einem jemand das Gold wegnimmt, aber es gibt zumindest die beruhigende Sicherheit, daß die ersten zwei oder drei Typen, die aus dem Mob ausscheren und es versuchen, ne Ladung Blei bekommen.
Ansonsten ein netter Artikel:
"Dabei sah mein Kleinanleger-Portfolio nach damaligen Maßstäben äußerst konservativ aus. Neben AOL noch eine Menge T-Aktien. Dazu Daimler, die ich bei rund 90 Euro in mein Portfolio gelegt hatte. Zu Letzterem hatte mir der Anlageberater meiner Bank ausdrücklich gratuliert: "Sie machen eben nicht diesen Start-up-Hype mit, sondern setzen auf Qualität!"
Genau das ist der Unterschied. Als ich in Goldaktien umschichtete, sah mich mein Bankberater dumm an, da die Papiere noch nicht im WKN-Stammnummern-Verzeichnis im Hauptrechner eingepflegt waren und er deshalb erst lange mit der Zentrale telefonieren mußte. Ich war also der erste Anleger in dieser Bank überhaupt, der solch exotisches Zeugs wie High River oder Viceroy kaufen wollte (wohlgemerkt einer Großbank). Insofern hat mir nie ein Berater zu meiner Aktienauswahl gratuliert (eher bei Ansicht der Langfristcharts an meinem Verstand gezweifelt). Das ist die "Ehre" des contraian investors, nämlich immer das Gegenteil der Masse zu machen und daher als "verrückt" zu erscheinen.
"Wir Kleinanleger haben ein freundliches Verhältnis zur Welt. Wir sind Optimisten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig."
Ja, und wir Goldbugs haben eben ein feindliches Verhältnis zur Welt. Wir sind Pessimisten; denn Chaos, Kriege und Notzeiten sind der Stoff, der dem Gold erst richtig seinen Glanz verleiht.
Das Spiel an der Börse war schon immer so aufgebaut, daß einer gewinnt und der andere verliert. Die Konjunktur-Optimisten und Goldshorts haben 20 Jahre gewonnen und sich über die antiquirten und weltfremden Goldbugs mokiert. Es ist an der Zeit, daß sich dies ändert
Gruß
Sovereign
Geschätzter konradi, hier hast Du mich wohl mißverstanden. Es geht um "Vertrauen", d.h. ich vertraue darauf, daß man sich mit Gold immer etwas kaufen kann (und wenn`s ne halbe Unze für nen Sack Mehl ist)...allerdings, denke diesen "Notgroschenaspekt" einen Schritt weiter: Was ist wenn das System vollends kollabiert und die Leute marodierend durch die Straßen ziehen? Meinst Du ein nettes Lächeln und eine hochgehaltene Goldmünze nützen dann noch etwas? Also kommt besagte 9mm als "Argumentationshilfe" ins Spiel...ich will ja nicht sagen, daß dies verhindert, daß einem jemand das Gold wegnimmt, aber es gibt zumindest die beruhigende Sicherheit, daß die ersten zwei oder drei Typen, die aus dem Mob ausscheren und es versuchen, ne Ladung Blei bekommen.
Ansonsten ein netter Artikel:
"Dabei sah mein Kleinanleger-Portfolio nach damaligen Maßstäben äußerst konservativ aus. Neben AOL noch eine Menge T-Aktien. Dazu Daimler, die ich bei rund 90 Euro in mein Portfolio gelegt hatte. Zu Letzterem hatte mir der Anlageberater meiner Bank ausdrücklich gratuliert: "Sie machen eben nicht diesen Start-up-Hype mit, sondern setzen auf Qualität!"
Genau das ist der Unterschied. Als ich in Goldaktien umschichtete, sah mich mein Bankberater dumm an, da die Papiere noch nicht im WKN-Stammnummern-Verzeichnis im Hauptrechner eingepflegt waren und er deshalb erst lange mit der Zentrale telefonieren mußte. Ich war also der erste Anleger in dieser Bank überhaupt, der solch exotisches Zeugs wie High River oder Viceroy kaufen wollte (wohlgemerkt einer Großbank). Insofern hat mir nie ein Berater zu meiner Aktienauswahl gratuliert (eher bei Ansicht der Langfristcharts an meinem Verstand gezweifelt). Das ist die "Ehre" des contraian investors, nämlich immer das Gegenteil der Masse zu machen und daher als "verrückt" zu erscheinen.

"Wir Kleinanleger haben ein freundliches Verhältnis zur Welt. Wir sind Optimisten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig."
Ja, und wir Goldbugs haben eben ein feindliches Verhältnis zur Welt. Wir sind Pessimisten; denn Chaos, Kriege und Notzeiten sind der Stoff, der dem Gold erst richtig seinen Glanz verleiht.

Das Spiel an der Börse war schon immer so aufgebaut, daß einer gewinnt und der andere verliert. Die Konjunktur-Optimisten und Goldshorts haben 20 Jahre gewonnen und sich über die antiquirten und weltfremden Goldbugs mokiert. Es ist an der Zeit, daß sich dies ändert

Gruß
Sovereign
# 151
"Als ich in Goldaktien umschichtete, sah mich mein Bankberater dumm an ... "
Die mit solchem dummen ansehen meist einhergehenden "Gute Ratschläge" hatten mich veranlasst, Börsengeschäfte nur noch über´s e-banking zu erledigen.
Denn, bei noch so fester Meinung beeinflusst diese, meist sogar gutgemeinte Laberei, irgendwie doch meine eigene Entscheidungsfreiheit.
Grüße, und einen guten Rutsch wünscht
Magor
"Als ich in Goldaktien umschichtete, sah mich mein Bankberater dumm an ... "
Die mit solchem dummen ansehen meist einhergehenden "Gute Ratschläge" hatten mich veranlasst, Börsengeschäfte nur noch über´s e-banking zu erledigen.
Denn, bei noch so fester Meinung beeinflusst diese, meist sogar gutgemeinte Laberei, irgendwie doch meine eigene Entscheidungsfreiheit.
Grüße, und einen guten Rutsch wünscht
Magor
#152
"Die mit solchem dummen ansehen meist einhergehenden "Gute Ratschläge"
Hier muß man eben die natürliche Autorität des Kunden hervorheben, d.h. ich habe meinem "Berater" schon vor Jahren unmißverständlich klargemacht, daß ich keinen Wert auf wie auch immer geartete Ratschläge lege...mit dem Erfolg das ich keine geschlossenen Immofonds, Lebensversicherungen, Riester-Rente, Bausparvertrag, sonstige Versicherungen, Fonds oder Aktien aufgeschwatzt bekomme. Ebenso geht mir auch niemand mit abendlichen "cold calls" am Telefon auf die Nerven.
Einfach sagen: "Wenn ich als Kunde etwas will, dann spreche ich die Bank an und nicht die Bank mich! Capiche?"
Gruß
Sovereign
"Die mit solchem dummen ansehen meist einhergehenden "Gute Ratschläge"
Hier muß man eben die natürliche Autorität des Kunden hervorheben, d.h. ich habe meinem "Berater" schon vor Jahren unmißverständlich klargemacht, daß ich keinen Wert auf wie auch immer geartete Ratschläge lege...mit dem Erfolg das ich keine geschlossenen Immofonds, Lebensversicherungen, Riester-Rente, Bausparvertrag, sonstige Versicherungen, Fonds oder Aktien aufgeschwatzt bekomme. Ebenso geht mir auch niemand mit abendlichen "cold calls" am Telefon auf die Nerven.
Einfach sagen: "Wenn ich als Kunde etwas will, dann spreche ich die Bank an und nicht die Bank mich! Capiche?"
Gruß
Sovereign
Sovereign, für die 9mm Argumentationshilfe braucht man aber hierzulande immer noch einen Waffenschein ...  Im Übrigen wollen wir aber doch nicht hoffen dass unser Salonmarxist recht behält:
Im Übrigen wollen wir aber doch nicht hoffen dass unser Salonmarxist recht behält:
... Junger Freund, es ist ein Schweinesystem. Und das sollte man nie vergessen. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus taktischen Gründen. Als Marxist weiß man, dass die sieben Achtel, die schlechter dran sind, einem irgendwann mal den Schädel einschlagen und womöglich damit Recht haben...
Und was die "Hütchenspieler-Nachhut" betrifft: Meine Bank ist – was auch sonst ? – die "Hamburger Sparkasse"
(In Hamburg wird das "HASPA"- Sparbuch Sinnvollerweise zugleich mit der Geburtsurkunde ausgehändigt ...)
Meine "Privatkundenbetreuerin" war aber sehr tapfer als ich ihr erklärte mir bitte keine Bausparverträge und Lebensversicherungen anzudienen zu wollen und ihr Lächeln ist so bezaubernd, dass ich es trotz der horrenden Gebühren einfach nicht fertig bringe zu kündigen ... Gegen einen "warm call" nach Geschäftsschluß hätte ich daher nichts einzuwenden ...
Dir, Magor und allen anderen ein erfolgreiches Jahr 2003 wünscht
Konradi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviw mit Paul Krugman : "Koalition der Eliten"
US-Ökonom Paul Krugman über die zwiespältigen Aussichten für die Weltwirtschaft, die notwendigen Reformen in Deutschland und seinen publizistischen Kampf gegen Präsident Bush
SPIEGEL: Professor Krugman, die Wirtschaftslage in den USA hat sich nach dem Einbruch in 2001 wieder aufgehellt. Ist die US-Wirtschaft über das Gröbste hinweg?
Krugmann: Die wirtschaftliche Lage ist seit einem Jahr im Grunde nahezu unverändert: kaum Erholung bei Investitionen, aber dafür ein starker Konsum, der die Ökonomie vor einem Abschwung bewahrt. Die Optimisten sagen die ganze Zeit, dass die Unternehmen schon bald beginnen werden, wieder neu zu investieren - was nicht geschieht. Die Pessimisten glauben, dass die Verbraucher zurückstecken - auch das ist bislang nicht passiert. Klar ist, dass die US-Wirtschaft zu langsam wächst, um ihre Produktionskapazitäten auszulasten. Das drückt auf die Preise und damit auf die Gewinne und lässt die Zahl der Arbeitslosen weiter steigen. Die Parallelen zur Situation in Japan Anfang der neunziger Jahre sind stärker, als uns lieb sein kann.
SPIEGEL: Trauen Sie sich eine Konjunkturprognose für 2003 zu?
Krugman: Meine Vorhersage wäre zwei bis drei Prozent Wachstum übers Jahr gerechnet. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob die US-Wirtschaft in eine neue Rezession stürzen kann, muss ich sagen: ja, absolut. Kann sie im Gegenteil um fünf Prozent nach oben drehen? Ebenfalls gut möglich.
SPIEGEL: Die Republikaner planen eine weitere Runde von Steuersenkungen, um der Wirtschaft noch einmal Schwung zu geben. Die Demokraten sind entschieden dagegen und verweisen auf die wachsenden Staatsschulden. Auf welcher Seite stehen Sie bei diesem Streit?
Krugman: Ein hoher Beamter im Finanzministerium hat einmal gesagt, dass der Staat im Grunde genommen nichts anderes ist als eine riesige Versicherungsanstalt, die nebenbei noch ein nationales Verteidigungsunternehmen unterhält. Die vernünftigste Position wäre also, die dauerhaften Steuersenkungen, die 2001 beschlossen wurden, wieder zurückzunehmen, weil wir sie uns derzeit nicht leisten können und sie dem Auftrag des Staates zuwiderlaufen, ausreichend Vorsorge für seine Verpflichtungen in der Zukunft zu treffen. Ich gebe zu, diese Position ist in der politischen Debatte nicht so leicht zu vermitteln, was auch die Schwierigkeiten der Demokraten ausmacht, die Diskussion zu ihren Gunsten zu entscheiden.
SPIEGEL: Was soll die Regierung Ihrer Meinung nach tun: Einfach dasitzen und abwarten, dass sich die Dinge schon fügen?
Krugman: Wenn ich wie Bush die Kontrolle über Senat, Repräsentantenhaus und das Weiße Haus hätte, würde ich erstens die Finanzhilfen für die Bundesstaaten aufstocken, zweitens die Sozialabgaben senken und drittens die Arbeitslosenzahlungen verbessern, denn dieses Geld wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort wieder ausgegeben. Mein Schwerpunkt läge auf einer Entlastung der Mittelschichten und Geringverdiener. Doch was bekommen wir stattdessen? Klassische konservative Steuerpolitik, von der vor allem die Wohlhabenden profitieren, die Wirtschaft und die Investoren. Wenn man die Vorschläge durchrechnet, die derzeit vom Weißen Haus in Umlauf gebracht werden, dann gehen zwei Drittel der Vergünstigungen an die oberen fünf Prozent der Bevölkerung.
SPIEGEL: Liegt es nicht in der Natur einer Steuerreform, dass diejenigen, die die meisten Steuern zahlen, auch am meisten von ihr profitieren? Von diesen oberen fünf Prozent in der amerikanischen Einkommenspyramide kommen immerhin auch 50 Prozent der Einkommensteuern.
Krugman: Man kann auch eine ganz andere Rechnung aufmachen: Wenn Sie sich nämlich die Steuersenkungen für das oberste ein Prozent der Gesellschaft ansehen, dann stellen Sie fest, dass auf diese kleine Gruppe gut 40 Prozent der vorgesehenen 1,35 Billionen Dollar an Erleichterungen, wenn sie erst einmal voll greifen, entfallen, und das, obwohl ihr Beitrag zum Steueraufkommen des Staates nur bei 24 Prozent liegt. Es ist genau dieses Ungleichgewicht zu Gunsten der Reichen, das charakteristisch ist für alles, was die Bush-Regierung tut. Sie repräsentiert, was man gemeinhin Plutokratie nennt, eine Koalition der Eliten.
SPIEGEL: Die deutsche Bundesregierung setzt statt auf Steuerentlastungen auf Steuererhöhungen, mit zweifelhaftem Erfolg: Die Konjunkturprognosen für 2003 sind noch einmal nach unten korrigiert worden, die Arbeitslosenquote hängt bei knapp 10 Prozent. Was wäre in diesem Fall Ihre Empfehlung?
Krugman: Bei Ihnen sieht es besonders trostlos aus, das stimmt. Was Deutschland dringend braucht, ist eine Abwertung der Währung, aber das ist ja nun, nach Einführung des Euro, nicht mehr möglich. Zunächst einmal würde ich versuchen, die Europäische Zentralbank davon zu überzeugen, doch bitte mehr wie die hiesige Notenbank zu handeln. Die Zinssätze in Europa sind eindeutig zu hoch, und es spricht absolut nichts dagegen, das Inflationsziel etwas höher zu setzen. Darüber hinaus? Strukturreformen, was sonst.
SPIEGEL: In diesem Fall also doch Vorbild USA?
Krugman: Wenn Amerika zu viel Vertrauen in freie Märkte setzt, dann Deutschland eindeutig zu wenig. Da ist doch alles sehr eng gezurrt, von den Kündigungsregeln bis zum Ladenschluss. Was Deutschland heute fehlt, ist eine Margaret Thatcher.
SPIEGEL: Die USA bereiten sich auf einen neuen Waffengang gegen Saddam Hussein vor. Wird ein Krieg der US-Wirtschaft schaden oder im Gegenteil, wie manche glauben, sogar einen zusätzlichen Schub geben?
Krugman: Jede Militärausgabe steigert die Nachfrage, das ist schon richtig. Anderseits werden sowohl Washington als auch die einzelnen Bundesstaaten in diesem Jahr wegen der schlechten Haushaltslage gezwungen sein, gerade die Sozialbudgets zusammenzustreichen, so dass der Nettoeffekt eher negativ sein wird. Ich denke, dass die wirtschaftlichen Folgen eines neuen Irak-Kriegs zunächst eher unbedeutend sind. Richtig teuer wird es erst, wenn die USA gezwungen sind, im Golf auf Dauer große Truppenkontingente zu stationieren.
SPIEGEL: Das Jahr 2002 war auch das Jahr der spektakulären Firmenpleiten. Sie haben prophezeit, dass das Enron-Debakel im Rückblick für das Selbstverständnis Amerikas wichtiger sein könnte als der 11. September. Sehen Sie sich im Nachhinein in Ihrer Einschätzung bestätigt?
Krugman: Ich muss zugeben, dass es mich überrascht und auch ein wenig bestürzt hat, wie schnell die Erinnerung an Skandale wie den Fall von Enron oder WorldCom aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist.
SPIEGEL: Sie haben auch den US-Wähler falsch eingeschätzt. Die Republikaner haben bei den Zwischenwahlen im November einen glänzenden Wahlsieg eingefahren, Präsident Bush ist nach wie vor ungemein populär. Anscheinend stören sich die Amerikaner nicht besonders an dem, was Sie eine Koalition der alten Eliten nennen.
Krugman: Ich war leider nie besonders gut in der Prognose, wie Wähler reagieren. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass ein Land in Vorbereitung auf einen Krieg das Beste ist, was einer Regierung passieren kann. Krieg macht sich im Fernsehen immer gut.
SPIEGEL: Sie glauben wirklich, dass die Kriegsvorbereitungen die Bürger hinreichend von dem deprimierenden Stand ihrer Aktiendepots ablenken? Man sollte annehmen, dass sie allen Grund haben, wütend zu sein, zumal die Regierung erkennbar bremst, wenn es um eine effektivere Aufsicht der Unternehmen geht.
Krugman: Sicher, die Leute finden ihre Depots halbiert, aber dann schalten sie den Fernseher ein und sehen ihren Präsidenten, mit wehenden Flaggen im Hintergrund, und sie nehmen einfach an, dass er auf ihrer Seite steht. Sie wollen nicht glauben, dass er Teil des Systems ist, das sie um ihre Altersrücklagen gebracht hat. Es ist ein sehr verstörender Gedanke, dass ausgerechnet die Autoritäten, an die man sich um Hilfe wendet, mit der Räuberclique unter einer Decke stecken könnten. Die Psychologen nennen das kognitive Dissonanz.
SPIEGEL: Sie schreiben nahezu wöchentlich gegen Präsident George W. Bush und seine Regierung an. Glaubt man Ihren Artikeln, dann sitzt im Weißen Haus eine Bande von Betrügern und Lügnern, die nur ein Ziel kennt: die Reichen noch reicher zu machen und die Armen noch ärmer. Meinen Sie das ernst?
Krugman: Niemand erwartet, dass der Präsident ein Heiliger ist. Jeder geht davon aus, dass diejenigen, die im Weißen Haus sitzen, die Wahrheit ein wenig zu ihren Gunsten biegen. Aber in welchem Ausmaß diese Regierung die Öffentlichkeit zu täuschen versucht, das ist schon ziemlich spektakulär. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe nicht in einer der ältesten Demokratien der Welt, sondern auf den Philippinen unter einem neuen Marcos.
SPIEGEL: Wo täuscht und belügt Sie denn Ihre Regierung?
Krugman: Das beginnt bei der doppelten Buchführung in Wirtschaftsplänen, bei denen derselbe Billionenbetrag einfach zweimal für verschiedene Zwecke gezählt wird. Sie finden diesen entstellenden Umgang mit Fakten aber auch, wenn es um den Irak-Krieg geht und die Frage, welche Beweise tatsächlich gegen Saddam Hussein vorliegen, oder um die engen Beziehungen von Regierungsmitgliedern zu großen Konzernen. Da hat sich eine Art Muster entwickelt, das fraglos etwas Neues in der amerikanischen Politik darstellt.
SPIEGEL: Nach den Bilanzskandalen bei WorldCom und Enron ist es vergleichsweise ruhig geworden. War`s das? Oder drohen möglicherweise weitere Betrugsfälle?
Krugman: Die derzeitige Ruhe ist wahrscheinlich trügerisch. Man muss sich nur die Gewinne ansehen, die die 500 wichtigsten, bei Standard & Poors aufgeführten US-Unternehmen zwischen 1997 und 2001 ausgewiesen haben, und diese dann mit den Zahlen des Nipa, der Volkseinkommensstatistik des US-Wirtschaftsministeriums, vergleichen, die man nicht schönen kann und die sich bemerkenswerterweise in diesem Zeitraum kaum bewegt haben. Wir können deshalb mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die S&P-500-Unternehmen als Gruppe genommen ihre Profite um etwa 30 Prozent zu hoch angegeben haben, was bedeutet, dass da noch einige Enrons auffliegen werden.
SPIEGEL: Es gibt viele Experten, die Notenbankchef Alan Greenspan vorwerfen, die Börsenblase mit seiner Zinspolitik begünstigt zu haben. Denken Sie das auch?
Krugman: Man kann daran Zweifel haben, ob er die Blase hätte verhindern können, aber er hat es jedenfalls nie ernsthaft versucht. Tatsächlich hat er die Börse sogar hochgeredet. Er war einer der prominentesten Vertreter dieses grenzenlosen Millenniums-Optimismus. Er wurde zum Cheerleader, und wenn es etwas gibt, was ein Zentralbanker nie sein sollte, dann das.
SPIEGEL: Die Frage ist allerdings, ob es Aufgabe der Notenbank ist, sich um Aktienpreise zu sorgen. Soll sie wirklich über die Zinsen intervenieren?
Krugman: Das ist eine schwierige Debatte, die unter Ökonomen derzeit auch sehr ernsthaft geführt wird. Einerseits wissen wir genau, wie Blasen entstehen und zu welchen gesamtwirtschaftlichen Problemen sie führen können. Auf der anderen Seite steht die Frage, ob wir den Auftrag der Zentralbank wirklich noch weiter ausdehnen wollen. Meine Haltung ist da sehr schwankend, man kann mit gutem Grund beide Positionen vertreten.
SPIEGEL: Haben Sie selbst Geld an der Börse verloren?
Krugman: Ja, aber nicht sehr viel.
SPIEGEL: Sie schreiben mittlerweile zweimal in der Woche für die "New York Times", bringen Bücher heraus, halten Vorträge. Kommen Sie noch zum Unterrichten?
Krugman: Ich bereite mich gerade auf meine nächste Vorlesung vor. Ich bin, ehrlich gesagt, auch ziemlich froh, dass ich nicht vom Schreiben leben muss, sondern noch eine Karriere als Wissenschaftler habe. Deshalb kann ich ganz andere Risiken eingehen als ein normaler Journalist. Ich bin nicht auf guten Zugang zum Weißen Haus angewiesen, ich kann es mir mit allen dort verderben.
SPIEGEL: Das haben Sie offenbar geschafft.
Krugman: Es ist schon eigenartig, denn als ich im Herbst 1999 meine Kolumne mit der "New York Times" vereinbarte, dachte ich eigentlich daran, gut gelaunte Anmerkungen zu den Eigentümlichkeiten der New Economy zu liefern. Stattdessen finde ich mich nun wieder als die einsame Stimme der Wahrheit in einem Meer von Korruption. Manchmal denke ich, dass ich eines Tages in einem dieser Käfige in Guantanamo Bay lande (lacht). Aber ich kann ja immer noch in der Bundesrepublik um Asyl bitten. Ich hoffe, Sie nehmen mich im Notfall auf.
SPIEGEL: Professor Krugman, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Der SPIEGEL 1 / 2003
Das Gespräch führten die Redakteure Jan Fleischhauer und Gerhard Spörl.
Paul Krugmann gehört zu den schärfsten Kritikern der Wirtschaftspolitik der Regierung Bush. Der Ökonom lehrt an der Universität in Princeton und schreibt zweimal pro Woche eine viel beachtete Kolumne in der "New York Times". Krugman, 49, gilt als Wunderkind seiner Disziplin und Anwärter auf den Nobelpreis, weil er jung an Jahren eine bahnbrechende Theorie über internationalen Handel veröffentlichte. Er verbrachte 1982/83 "erhellende Monate" im Weißen Haus unter Ronald Reagan und gehörte zu den Beratern Bill Clintons, bekam aber keinen Job wegen seines Freimuts und seiner Unabhängigkeit. Für das Verhältnis George W. Bushs zur Wirtschaft prägte er den treffenden Ausdruck "crony capitalism" - Kapitalismus unter Busenfreunden.
siehe auch Beitrag #80 in diesem Thread !
 Im Übrigen wollen wir aber doch nicht hoffen dass unser Salonmarxist recht behält:
Im Übrigen wollen wir aber doch nicht hoffen dass unser Salonmarxist recht behält:... Junger Freund, es ist ein Schweinesystem. Und das sollte man nie vergessen. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus taktischen Gründen. Als Marxist weiß man, dass die sieben Achtel, die schlechter dran sind, einem irgendwann mal den Schädel einschlagen und womöglich damit Recht haben...

Und was die "Hütchenspieler-Nachhut" betrifft: Meine Bank ist – was auch sonst ? – die "Hamburger Sparkasse"

(In Hamburg wird das "HASPA"- Sparbuch Sinnvollerweise zugleich mit der Geburtsurkunde ausgehändigt ...)
Meine "Privatkundenbetreuerin" war aber sehr tapfer als ich ihr erklärte mir bitte keine Bausparverträge und Lebensversicherungen anzudienen zu wollen und ihr Lächeln ist so bezaubernd, dass ich es trotz der horrenden Gebühren einfach nicht fertig bringe zu kündigen ... Gegen einen "warm call" nach Geschäftsschluß hätte ich daher nichts einzuwenden ...

Dir, Magor und allen anderen ein erfolgreiches Jahr 2003 wünscht
Konradi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviw mit Paul Krugman : "Koalition der Eliten"
US-Ökonom Paul Krugman über die zwiespältigen Aussichten für die Weltwirtschaft, die notwendigen Reformen in Deutschland und seinen publizistischen Kampf gegen Präsident Bush
SPIEGEL: Professor Krugman, die Wirtschaftslage in den USA hat sich nach dem Einbruch in 2001 wieder aufgehellt. Ist die US-Wirtschaft über das Gröbste hinweg?
Krugmann: Die wirtschaftliche Lage ist seit einem Jahr im Grunde nahezu unverändert: kaum Erholung bei Investitionen, aber dafür ein starker Konsum, der die Ökonomie vor einem Abschwung bewahrt. Die Optimisten sagen die ganze Zeit, dass die Unternehmen schon bald beginnen werden, wieder neu zu investieren - was nicht geschieht. Die Pessimisten glauben, dass die Verbraucher zurückstecken - auch das ist bislang nicht passiert. Klar ist, dass die US-Wirtschaft zu langsam wächst, um ihre Produktionskapazitäten auszulasten. Das drückt auf die Preise und damit auf die Gewinne und lässt die Zahl der Arbeitslosen weiter steigen. Die Parallelen zur Situation in Japan Anfang der neunziger Jahre sind stärker, als uns lieb sein kann.
SPIEGEL: Trauen Sie sich eine Konjunkturprognose für 2003 zu?
Krugman: Meine Vorhersage wäre zwei bis drei Prozent Wachstum übers Jahr gerechnet. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob die US-Wirtschaft in eine neue Rezession stürzen kann, muss ich sagen: ja, absolut. Kann sie im Gegenteil um fünf Prozent nach oben drehen? Ebenfalls gut möglich.
SPIEGEL: Die Republikaner planen eine weitere Runde von Steuersenkungen, um der Wirtschaft noch einmal Schwung zu geben. Die Demokraten sind entschieden dagegen und verweisen auf die wachsenden Staatsschulden. Auf welcher Seite stehen Sie bei diesem Streit?
Krugman: Ein hoher Beamter im Finanzministerium hat einmal gesagt, dass der Staat im Grunde genommen nichts anderes ist als eine riesige Versicherungsanstalt, die nebenbei noch ein nationales Verteidigungsunternehmen unterhält. Die vernünftigste Position wäre also, die dauerhaften Steuersenkungen, die 2001 beschlossen wurden, wieder zurückzunehmen, weil wir sie uns derzeit nicht leisten können und sie dem Auftrag des Staates zuwiderlaufen, ausreichend Vorsorge für seine Verpflichtungen in der Zukunft zu treffen. Ich gebe zu, diese Position ist in der politischen Debatte nicht so leicht zu vermitteln, was auch die Schwierigkeiten der Demokraten ausmacht, die Diskussion zu ihren Gunsten zu entscheiden.
SPIEGEL: Was soll die Regierung Ihrer Meinung nach tun: Einfach dasitzen und abwarten, dass sich die Dinge schon fügen?
Krugman: Wenn ich wie Bush die Kontrolle über Senat, Repräsentantenhaus und das Weiße Haus hätte, würde ich erstens die Finanzhilfen für die Bundesstaaten aufstocken, zweitens die Sozialabgaben senken und drittens die Arbeitslosenzahlungen verbessern, denn dieses Geld wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort wieder ausgegeben. Mein Schwerpunkt läge auf einer Entlastung der Mittelschichten und Geringverdiener. Doch was bekommen wir stattdessen? Klassische konservative Steuerpolitik, von der vor allem die Wohlhabenden profitieren, die Wirtschaft und die Investoren. Wenn man die Vorschläge durchrechnet, die derzeit vom Weißen Haus in Umlauf gebracht werden, dann gehen zwei Drittel der Vergünstigungen an die oberen fünf Prozent der Bevölkerung.
SPIEGEL: Liegt es nicht in der Natur einer Steuerreform, dass diejenigen, die die meisten Steuern zahlen, auch am meisten von ihr profitieren? Von diesen oberen fünf Prozent in der amerikanischen Einkommenspyramide kommen immerhin auch 50 Prozent der Einkommensteuern.
Krugman: Man kann auch eine ganz andere Rechnung aufmachen: Wenn Sie sich nämlich die Steuersenkungen für das oberste ein Prozent der Gesellschaft ansehen, dann stellen Sie fest, dass auf diese kleine Gruppe gut 40 Prozent der vorgesehenen 1,35 Billionen Dollar an Erleichterungen, wenn sie erst einmal voll greifen, entfallen, und das, obwohl ihr Beitrag zum Steueraufkommen des Staates nur bei 24 Prozent liegt. Es ist genau dieses Ungleichgewicht zu Gunsten der Reichen, das charakteristisch ist für alles, was die Bush-Regierung tut. Sie repräsentiert, was man gemeinhin Plutokratie nennt, eine Koalition der Eliten.
SPIEGEL: Die deutsche Bundesregierung setzt statt auf Steuerentlastungen auf Steuererhöhungen, mit zweifelhaftem Erfolg: Die Konjunkturprognosen für 2003 sind noch einmal nach unten korrigiert worden, die Arbeitslosenquote hängt bei knapp 10 Prozent. Was wäre in diesem Fall Ihre Empfehlung?
Krugman: Bei Ihnen sieht es besonders trostlos aus, das stimmt. Was Deutschland dringend braucht, ist eine Abwertung der Währung, aber das ist ja nun, nach Einführung des Euro, nicht mehr möglich. Zunächst einmal würde ich versuchen, die Europäische Zentralbank davon zu überzeugen, doch bitte mehr wie die hiesige Notenbank zu handeln. Die Zinssätze in Europa sind eindeutig zu hoch, und es spricht absolut nichts dagegen, das Inflationsziel etwas höher zu setzen. Darüber hinaus? Strukturreformen, was sonst.
SPIEGEL: In diesem Fall also doch Vorbild USA?
Krugman: Wenn Amerika zu viel Vertrauen in freie Märkte setzt, dann Deutschland eindeutig zu wenig. Da ist doch alles sehr eng gezurrt, von den Kündigungsregeln bis zum Ladenschluss. Was Deutschland heute fehlt, ist eine Margaret Thatcher.
SPIEGEL: Die USA bereiten sich auf einen neuen Waffengang gegen Saddam Hussein vor. Wird ein Krieg der US-Wirtschaft schaden oder im Gegenteil, wie manche glauben, sogar einen zusätzlichen Schub geben?
Krugman: Jede Militärausgabe steigert die Nachfrage, das ist schon richtig. Anderseits werden sowohl Washington als auch die einzelnen Bundesstaaten in diesem Jahr wegen der schlechten Haushaltslage gezwungen sein, gerade die Sozialbudgets zusammenzustreichen, so dass der Nettoeffekt eher negativ sein wird. Ich denke, dass die wirtschaftlichen Folgen eines neuen Irak-Kriegs zunächst eher unbedeutend sind. Richtig teuer wird es erst, wenn die USA gezwungen sind, im Golf auf Dauer große Truppenkontingente zu stationieren.
SPIEGEL: Das Jahr 2002 war auch das Jahr der spektakulären Firmenpleiten. Sie haben prophezeit, dass das Enron-Debakel im Rückblick für das Selbstverständnis Amerikas wichtiger sein könnte als der 11. September. Sehen Sie sich im Nachhinein in Ihrer Einschätzung bestätigt?
Krugman: Ich muss zugeben, dass es mich überrascht und auch ein wenig bestürzt hat, wie schnell die Erinnerung an Skandale wie den Fall von Enron oder WorldCom aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist.
SPIEGEL: Sie haben auch den US-Wähler falsch eingeschätzt. Die Republikaner haben bei den Zwischenwahlen im November einen glänzenden Wahlsieg eingefahren, Präsident Bush ist nach wie vor ungemein populär. Anscheinend stören sich die Amerikaner nicht besonders an dem, was Sie eine Koalition der alten Eliten nennen.
Krugman: Ich war leider nie besonders gut in der Prognose, wie Wähler reagieren. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass ein Land in Vorbereitung auf einen Krieg das Beste ist, was einer Regierung passieren kann. Krieg macht sich im Fernsehen immer gut.
SPIEGEL: Sie glauben wirklich, dass die Kriegsvorbereitungen die Bürger hinreichend von dem deprimierenden Stand ihrer Aktiendepots ablenken? Man sollte annehmen, dass sie allen Grund haben, wütend zu sein, zumal die Regierung erkennbar bremst, wenn es um eine effektivere Aufsicht der Unternehmen geht.
Krugman: Sicher, die Leute finden ihre Depots halbiert, aber dann schalten sie den Fernseher ein und sehen ihren Präsidenten, mit wehenden Flaggen im Hintergrund, und sie nehmen einfach an, dass er auf ihrer Seite steht. Sie wollen nicht glauben, dass er Teil des Systems ist, das sie um ihre Altersrücklagen gebracht hat. Es ist ein sehr verstörender Gedanke, dass ausgerechnet die Autoritäten, an die man sich um Hilfe wendet, mit der Räuberclique unter einer Decke stecken könnten. Die Psychologen nennen das kognitive Dissonanz.
SPIEGEL: Sie schreiben nahezu wöchentlich gegen Präsident George W. Bush und seine Regierung an. Glaubt man Ihren Artikeln, dann sitzt im Weißen Haus eine Bande von Betrügern und Lügnern, die nur ein Ziel kennt: die Reichen noch reicher zu machen und die Armen noch ärmer. Meinen Sie das ernst?
Krugman: Niemand erwartet, dass der Präsident ein Heiliger ist. Jeder geht davon aus, dass diejenigen, die im Weißen Haus sitzen, die Wahrheit ein wenig zu ihren Gunsten biegen. Aber in welchem Ausmaß diese Regierung die Öffentlichkeit zu täuschen versucht, das ist schon ziemlich spektakulär. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe nicht in einer der ältesten Demokratien der Welt, sondern auf den Philippinen unter einem neuen Marcos.
SPIEGEL: Wo täuscht und belügt Sie denn Ihre Regierung?
Krugman: Das beginnt bei der doppelten Buchführung in Wirtschaftsplänen, bei denen derselbe Billionenbetrag einfach zweimal für verschiedene Zwecke gezählt wird. Sie finden diesen entstellenden Umgang mit Fakten aber auch, wenn es um den Irak-Krieg geht und die Frage, welche Beweise tatsächlich gegen Saddam Hussein vorliegen, oder um die engen Beziehungen von Regierungsmitgliedern zu großen Konzernen. Da hat sich eine Art Muster entwickelt, das fraglos etwas Neues in der amerikanischen Politik darstellt.
SPIEGEL: Nach den Bilanzskandalen bei WorldCom und Enron ist es vergleichsweise ruhig geworden. War`s das? Oder drohen möglicherweise weitere Betrugsfälle?
Krugman: Die derzeitige Ruhe ist wahrscheinlich trügerisch. Man muss sich nur die Gewinne ansehen, die die 500 wichtigsten, bei Standard & Poors aufgeführten US-Unternehmen zwischen 1997 und 2001 ausgewiesen haben, und diese dann mit den Zahlen des Nipa, der Volkseinkommensstatistik des US-Wirtschaftsministeriums, vergleichen, die man nicht schönen kann und die sich bemerkenswerterweise in diesem Zeitraum kaum bewegt haben. Wir können deshalb mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die S&P-500-Unternehmen als Gruppe genommen ihre Profite um etwa 30 Prozent zu hoch angegeben haben, was bedeutet, dass da noch einige Enrons auffliegen werden.
SPIEGEL: Es gibt viele Experten, die Notenbankchef Alan Greenspan vorwerfen, die Börsenblase mit seiner Zinspolitik begünstigt zu haben. Denken Sie das auch?
Krugman: Man kann daran Zweifel haben, ob er die Blase hätte verhindern können, aber er hat es jedenfalls nie ernsthaft versucht. Tatsächlich hat er die Börse sogar hochgeredet. Er war einer der prominentesten Vertreter dieses grenzenlosen Millenniums-Optimismus. Er wurde zum Cheerleader, und wenn es etwas gibt, was ein Zentralbanker nie sein sollte, dann das.
SPIEGEL: Die Frage ist allerdings, ob es Aufgabe der Notenbank ist, sich um Aktienpreise zu sorgen. Soll sie wirklich über die Zinsen intervenieren?
Krugman: Das ist eine schwierige Debatte, die unter Ökonomen derzeit auch sehr ernsthaft geführt wird. Einerseits wissen wir genau, wie Blasen entstehen und zu welchen gesamtwirtschaftlichen Problemen sie führen können. Auf der anderen Seite steht die Frage, ob wir den Auftrag der Zentralbank wirklich noch weiter ausdehnen wollen. Meine Haltung ist da sehr schwankend, man kann mit gutem Grund beide Positionen vertreten.
SPIEGEL: Haben Sie selbst Geld an der Börse verloren?
Krugman: Ja, aber nicht sehr viel.
SPIEGEL: Sie schreiben mittlerweile zweimal in der Woche für die "New York Times", bringen Bücher heraus, halten Vorträge. Kommen Sie noch zum Unterrichten?
Krugman: Ich bereite mich gerade auf meine nächste Vorlesung vor. Ich bin, ehrlich gesagt, auch ziemlich froh, dass ich nicht vom Schreiben leben muss, sondern noch eine Karriere als Wissenschaftler habe. Deshalb kann ich ganz andere Risiken eingehen als ein normaler Journalist. Ich bin nicht auf guten Zugang zum Weißen Haus angewiesen, ich kann es mir mit allen dort verderben.
SPIEGEL: Das haben Sie offenbar geschafft.
Krugman: Es ist schon eigenartig, denn als ich im Herbst 1999 meine Kolumne mit der "New York Times" vereinbarte, dachte ich eigentlich daran, gut gelaunte Anmerkungen zu den Eigentümlichkeiten der New Economy zu liefern. Stattdessen finde ich mich nun wieder als die einsame Stimme der Wahrheit in einem Meer von Korruption. Manchmal denke ich, dass ich eines Tages in einem dieser Käfige in Guantanamo Bay lande (lacht). Aber ich kann ja immer noch in der Bundesrepublik um Asyl bitten. Ich hoffe, Sie nehmen mich im Notfall auf.
SPIEGEL: Professor Krugman, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Der SPIEGEL 1 / 2003
Das Gespräch führten die Redakteure Jan Fleischhauer und Gerhard Spörl.
Paul Krugmann gehört zu den schärfsten Kritikern der Wirtschaftspolitik der Regierung Bush. Der Ökonom lehrt an der Universität in Princeton und schreibt zweimal pro Woche eine viel beachtete Kolumne in der "New York Times". Krugman, 49, gilt als Wunderkind seiner Disziplin und Anwärter auf den Nobelpreis, weil er jung an Jahren eine bahnbrechende Theorie über internationalen Handel veröffentlichte. Er verbrachte 1982/83 "erhellende Monate" im Weißen Haus unter Ronald Reagan und gehörte zu den Beratern Bill Clintons, bekam aber keinen Job wegen seines Freimuts und seiner Unabhängigkeit. Für das Verhältnis George W. Bushs zur Wirtschaft prägte er den treffenden Ausdruck "crony capitalism" - Kapitalismus unter Busenfreunden.
siehe auch Beitrag #80 in diesem Thread !
Du hast auf den Punkt gebracht Konradi, was ich ausdrücken wollte!
Über Mangel an Autorität gegenüber meinen Bankern brauche ich mich nicht zu beklagen, von den Zeiten einer leichten Beeinflussung habe ich mich schon sehr lange entfernt. Hat mir übrigens auch ausreichend Lehrgeld gekostet. Auch meine Banker hatten, genauso, wie bei Sovereign erst durch für sie unbekanntes Anlageverhalten so einiges dazulernen müssen ...
Allerdings, sie sind mir z.T. seit jahrzehnten vertraut, und unterstellt, nicht gegen sondern im „besorgten Sinne“ für mich eingestellt.
Nun meine ich dennoch, trotz aller Autorität und Durchsetzungsvermögen nicht derjenige zu sein, der die Weisheit mit dem größten Löffel einverleibt bekommen hat, und alle anderen wären Ahnungslos. Ganz im Gegenteil! Nur bei sehr wenigen Anlageentscheidungen hatte ich die absolute Gewißheit ... also, keimt immer irgendwie ein Hoffnungsschimmer mit, daß die mit ihrem Heer an Analysten im Rücken vielleicht doch den tieferen Durchblick haben und evtl. Info´s besitzen, an die ich, wenn überhaupt, erst die nächste Woche drankomme ...
Geschweige von den schönen Augen der Beraterin, die, ach Gott wie mitleidig mich ansehen würden, wenn ich gerade die vorgestern mit ihr hoffnungsvoll gekauften Papiere heute, wegen anderer Erkenntnisse nun plötzlich doch wieder abstoßen möchte ...
Ergo sind das irgendwie, irgendwo doch Entscheidungsbeeinflussende Hemmschwellen, meine ich zumindest, die man sich nicht leisten sollte ...
Ein „Warm-call“ von ihr ist allemale wahrscheinlicher, solange ich noch Bestand auf meinem Konto bei ihr habe, anstatt, wenn die Manövriermasse dahingeschmolzen sein sollte : - )))
Grüße und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedliches und erfolgreiches Jahr 2003
wünscht
Magor
Über Mangel an Autorität gegenüber meinen Bankern brauche ich mich nicht zu beklagen, von den Zeiten einer leichten Beeinflussung habe ich mich schon sehr lange entfernt. Hat mir übrigens auch ausreichend Lehrgeld gekostet. Auch meine Banker hatten, genauso, wie bei Sovereign erst durch für sie unbekanntes Anlageverhalten so einiges dazulernen müssen ...
Allerdings, sie sind mir z.T. seit jahrzehnten vertraut, und unterstellt, nicht gegen sondern im „besorgten Sinne“ für mich eingestellt.
Nun meine ich dennoch, trotz aller Autorität und Durchsetzungsvermögen nicht derjenige zu sein, der die Weisheit mit dem größten Löffel einverleibt bekommen hat, und alle anderen wären Ahnungslos. Ganz im Gegenteil! Nur bei sehr wenigen Anlageentscheidungen hatte ich die absolute Gewißheit ... also, keimt immer irgendwie ein Hoffnungsschimmer mit, daß die mit ihrem Heer an Analysten im Rücken vielleicht doch den tieferen Durchblick haben und evtl. Info´s besitzen, an die ich, wenn überhaupt, erst die nächste Woche drankomme ...
Geschweige von den schönen Augen der Beraterin, die, ach Gott wie mitleidig mich ansehen würden, wenn ich gerade die vorgestern mit ihr hoffnungsvoll gekauften Papiere heute, wegen anderer Erkenntnisse nun plötzlich doch wieder abstoßen möchte ...
Ergo sind das irgendwie, irgendwo doch Entscheidungsbeeinflussende Hemmschwellen, meine ich zumindest, die man sich nicht leisten sollte ...
Ein „Warm-call“ von ihr ist allemale wahrscheinlicher, solange ich noch Bestand auf meinem Konto bei ihr habe, anstatt, wenn die Manövriermasse dahingeschmolzen sein sollte : - )))
Grüße und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedliches und erfolgreiches Jahr 2003
wünscht
Magor
@konradi
"Meine Bank ist – was auch sonst ? – die "Hamburger Sparkasse""
Haspa? Muß denn das sein? Orientier Dich bei den Banken doch lieber in Richtung Innenalster: Bei Berenberg am Jungfernstieg hält Dir ein Portier in Livrée die Wagentür auf. Gegenüber am anderen Alsterufer (Ballindamm) gibt`s M.M. Warburg, SMH und Marcard, Stein & Cie.
Da marschierst Du gleich im Januar rein (schwarzen Kammgarnanzug und Kamelhaarmantel nicht vergessen) und eröffnest ein Goldaktiendepot. Laß Dir anschließend vom Berater im Konferenzraum 3. Stock mit Alsterblick (die Fontäne ist immer wieder nett anzusehen) nen alten Cognac servieren und unterhalte Dich über die Implikationen der weltwirtschaftlichen Zerwürfnisse auf den Goldmarkt (und nicht vergessen: Dann und wann über die unfähige Sozi-Regierung schimpfen...das gehört dazu). Anschließend lädst Du den Berater zum Brunch ins benachbarte Vier Jahreszeiten ein (oder in den benachbarten Überseeclub, so Du eine Mitgliedschaft besitzt (wenn nicht: Abwarten, sowas ergibt sich im Laufe der Bankverbindung)...die Küche ist die gleiche).
Gruß
Sovereign
"Meine Bank ist – was auch sonst ? – die "Hamburger Sparkasse""
Haspa? Muß denn das sein? Orientier Dich bei den Banken doch lieber in Richtung Innenalster: Bei Berenberg am Jungfernstieg hält Dir ein Portier in Livrée die Wagentür auf. Gegenüber am anderen Alsterufer (Ballindamm) gibt`s M.M. Warburg, SMH und Marcard, Stein & Cie.
Da marschierst Du gleich im Januar rein (schwarzen Kammgarnanzug und Kamelhaarmantel nicht vergessen) und eröffnest ein Goldaktiendepot. Laß Dir anschließend vom Berater im Konferenzraum 3. Stock mit Alsterblick (die Fontäne ist immer wieder nett anzusehen) nen alten Cognac servieren und unterhalte Dich über die Implikationen der weltwirtschaftlichen Zerwürfnisse auf den Goldmarkt (und nicht vergessen: Dann und wann über die unfähige Sozi-Regierung schimpfen...das gehört dazu). Anschließend lädst Du den Berater zum Brunch ins benachbarte Vier Jahreszeiten ein (oder in den benachbarten Überseeclub, so Du eine Mitgliedschaft besitzt (wenn nicht: Abwarten, sowas ergibt sich im Laufe der Bankverbindung)...die Küche ist die gleiche).
Gruß
Sovereign
aber Sovereign,
hand auf´s Herz, magst Du denen gegenüber locker Deine vorgestrige Fehleinschätzung eingestehen und aus dem Kauf trotz Verluste rausspringen ... ?
Oder hemmt da nicht die aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung doch ein wenig das eigene Wertgefühl, vor diesen Typen, denen gegenüber Du gerade die eigene Fehleinschätzung = Unzulänglichkeit eingestehst ...
Nichtsdestotrotz, jedem das Seine, wobei ich Dir schon Recht gebe, die Wahl der Bank genauestens zu erwägen, letztendlich schon wegen den derzeit dürftigen Überlebenschancen ...
Wasser für´n Kamillentee habe ich aufgesetzt, es gibt weder Sekt noch Selters, weder Malt noch Aprikose, habe einen eingefangenen Flotten auszukurieren ... mal sehen, ab welcher Uhrzeit ich über die Possen meiner Gäste nicht mehr mitlachen kann, hatte bisher nie die Gelegenheit das eingehend zu beobachten : - (((
Grüße
Magor
hand auf´s Herz, magst Du denen gegenüber locker Deine vorgestrige Fehleinschätzung eingestehen und aus dem Kauf trotz Verluste rausspringen ... ?
Oder hemmt da nicht die aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung doch ein wenig das eigene Wertgefühl, vor diesen Typen, denen gegenüber Du gerade die eigene Fehleinschätzung = Unzulänglichkeit eingestehst ...
Nichtsdestotrotz, jedem das Seine, wobei ich Dir schon Recht gebe, die Wahl der Bank genauestens zu erwägen, letztendlich schon wegen den derzeit dürftigen Überlebenschancen ...
Wasser für´n Kamillentee habe ich aufgesetzt, es gibt weder Sekt noch Selters, weder Malt noch Aprikose, habe einen eingefangenen Flotten auszukurieren ... mal sehen, ab welcher Uhrzeit ich über die Possen meiner Gäste nicht mehr mitlachen kann, hatte bisher nie die Gelegenheit das eingehend zu beobachten : - (((
Grüße
Magor
@ magor
Kamillentee ? – Silvester ? – Mein Beileid !
Mich wundert schon, weshalb Sovereign Dir nicht gleich einen "Atholl Brose" empfohlen hat (250 g Honig und 250 g Haferflocken zu gleichen Teilen in kaltem Wasser verrühren mit einem Liter Whisky auffüllen und zwei Tage stehen lassen) – in verträglichen (!!) Mengen eingenommen hilft dieser leicht verdauliche Brei gegen Befindlichkeitsstörungen jeglicher Art ...
@ Sovereign
es scheitert schon am Kamelhaarmantel, mein Lieber ...
Die Welt die Du mir da wieder distinguiert und versiert unterbreitest, ist leider nicht die Meine...
Meine Villa steht weder an der "Elbchausse" noch an der "Bellevue" - meinen Rotwein kaufe ich auch schon mal bei ALDI
(ich weiß, ein für Dich unverzeihlicher fauxpass, aber ich bemühe mich ja, ehrlich sein ... )
)
- und meine Oberhemden bei Peek & Cloppenburg ...
Sicher, eine Einladung von Marcard, Stein & Co könnte man mit einem vorherigen Besuch bei Giorgio Armani am Neuen Wall aufwerten, aber was werden die erlauchten Herren denken, wenn ich mit meinem leicht angekratzten 10 Jahre alten Volvo in die Tiefgarage einbiege ? - Und ein gemieteter Porsche verrät sich bekanntlich durch das Kennzeichen ...
Aber wo wir nun schon bei den besseren Hamburger Einzelhändlern sind:
Im Chilehaus – Eingang Burchardplatz - hat kürzlich eine Filiale des Versanhandels "Manufactum"
eine großzügig ausgestattete Filiale eröffnet: http://www.manufactum.de
Sovereign, ich bin mir sicher: das ist Deine Welt !
- schau Dich da mal bei Deinem nächsten Hamburgaufenthalt um, - Du wirst dort Deine helle Freude haben ...
Einen guten Start ins Neue Jahr wünscht
Konradi
Börsenausblick 2003:
Weltweit lassen die Notenbanken steigende Preise zu – für Aktionäre wird das zum Problem
Von Robert von Heusinger
Drei Worte fassen die Sehnsüchte der Investoren, Händler und Analysten an den internationalen Aktienmärkten zusammen: „Zurück zur Normalität.“ So überschreibt die Commerzbank ihren Ausblick auf den europäischen Aktienmarkt 2003. Genauso titelten auch die Strategen von Sal. Oppenheim – allerdings schon zwölf Monate zuvor. Entgegen aller Hoffnungen entpuppte sich das gerade zu Ende gegangene Börsenjahr als das schwärzeste seit dem Zweiten Weltkrieg: Zum ersten Mal fielen die Kurse das dritte Jahr in Folge, mehr als 40 Prozent verlor der Dax, mehr als 20 Prozent der amerikanische Index Standard & Poor’s 500. Zum dritten Mal hintereinander schlugen Staatsanleihen die Aktie.
Auch wenn die Prognosen für 2003 etwas moderater geworden sind und die Baisse zur Vorsicht mahnt: Die Banken setzen schon wieder auf steigende Aktienkurse. Auf Normalität eben. Kein einziges der 32 vom Handelsblatt befragten Kreditinstitute sagt fallende Kurse bis Ende des Jahres voraus – im Gegenteil. Bei 3915 Punkten soll der Dax in zwölf Monaten stehen, knapp 30 Prozent höher als heute. Zum Vergleich: Für Ende 2002 haben dieselben Analysten im Durchschnitt einen Stand von 5780 Punkten vorhergesagt. Es wurden knapp 3000 Punkte weniger.
Auch die neuen Studien haben das Zeug dazu, kräftig danebenzuliegen. „Ich habe selten so viele orientierungslose Analysen gelesen“, sagt Klaus Sterzig, Manager bei dem deutschen Hedgefonds Arsago. Ganz gleich, welche Analysten man zu Rate zieht, ob die der Deutschen Bank, der holländischen ABN Amro oder der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, alle erwähnen zwar die großen Risiken für 2003, ignorieren sie aber weitgehend bei der Berechnung ihrer Prognosen.
Und das liest sich so: Risiko Nummer eins ist der drohende Krieg im Irak. Es wird zwar zum Krieg kommen, setzen die Analysten voraus, die Amerikaner werden ihn aber rasch gewinnen. „Abnehmende Unsicherheiten im Zuge einer erfolgreichen Invasion im Irak“ werden die konjunkturelle Erholung stützen, heißt es bei der Deutschen Bank. Die Folge eines schnellen Sieges der US-Truppen am Golf wären angenehm: Der Ölpreis würde kräftig nachgeben, und Konsumenten und Unternehmen könnten ihr Geld statt dessen anderweitig ausgeben.
Risiko Nummer zwei ist eine weltweite Deflation, also fallende Preise und damit einhergehend eine schrumpfende Wirtschaft. Doch da ist Alan Greenspan vor, der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), verehrt als der mächtigste Mann an den internationalen Finanzmärkten. „Wir verlassen uns auf den Greenspan-Put“, gibt Rolf Elgeti zu, Aktienstratege der Commerzbank. Mit „Greenspan-Put“ beschreiben Investoren und Analysten ihr Vertrauen in den Fed-Chef, der alles in seiner Macht stehende tun werde, um die Deflation zu verhindern.
Normalität ist ausgeschlossen
Bei aller Bewunderung für Alan Greenspan übersehen die Aktienmarktexperten allerdings etwas Entscheidendes: Der Kampf gegen die Deflation schließt die Rückkehr zur Normalität aus. Vielmehr verschiebt sich das Koordinatensystem der gängigen Wirtschaftspolitik. Oberstes Ziel der Notenbanken ist es nicht mehr, die Inflation im Zaum zu halten, sondern die Wirtschaft zu stimulieren – auf Teufel komm raus. „Reflation“ heißt das neue Zauberwort. Die Fehler der großen Depression von 1930 und der japanischen Malaise von 1990 sollen vermieden werden. Deflation muss abgewehrt werden, bevor sie eintritt. Das war die Botschaft eines Forschungspapiers der amerikanischen Notenbank von Mitte Juni. Jetzt wird diese Erkenntnis in die Tat umgesetzt.
Spätestens mit der Rede von Fed-Gouverneur Ben Bernanke am 22. November, Making Sure That „It“ Doesn’t Happen Here („Sicherstellen, dass ,Es’ hier nicht passiert“), hat die US-Notenbank einen epochalen Wechsel eingeleitet. Bernanke zeigte, dass selbst bei einem Notenbankzins von null Prozent, wovon die Amerikaner mit 1,25 Prozent nicht mehr allzu weit entfernt sind, die Zentralbank nicht machtlos wird. „Die US-Regierung hat eine Technologie, Gelddruckmaschine genannt, die es erlaubt, so viele Dollar zu drucken, wie sie will, zu vernachlässigbaren Kosten“, sagte er. Irgendwann werden die vielen Dollar die Preise steigen lassen, also zu Inflation führen. Aber Bernanke beließ es nicht bei dieser für einen Notenbanker provozierenden Aussage. Er zeigte sogar auf, wie die Fed im kommenden Jahr agieren werde, sollte das Deflationsgespenst nicht verschwunden sein: Die Möglichkeiten reichen vom unbegrenzten Kauf länger laufender Staatspapiere über direkte Kredite an überschuldete Unternehmen bis hin zur kräftigen Dollarabwertung.
Die Rede sei „bahnbrechend“, attestiert Stephen Roach, der Vordenker unter den amerikanischen Analysten. Sie beendet die Epoche der Inflationsbekämpfung, die der damalige US-Notenbankpräsident Paul Volcker am 6. Oktober 1979 eingeläutet hatte.
Nicht ganz so schrill, aber im Tenor ähnlich äußern sich die beiden anderen großen Notenbanken der Welt, die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB). Letztere hat zum Schrecken vieler konservativer Beobachter Anfang Dezember die Leitzinsen kräftig gesenkt und durchblicken lassen, dass es dennoch mehr Konjunktur- als Inflationsrisiken gebe. Sie hat sogar die Überprüfung ihres engen Inflationszieles von unter zwei Prozent angekündigt. Und der Präsident der BoJ muss in der nächsten Zeit vor allem eine Qualifikation mitbringen. „Er muss ein Deflationsbekämpfer sein“, sagt der japanische Premier Junichiro Koizumi.
Wenn die drei größten Wirtschaftsmächte der Welt alles auf eine Karte setzen, nämlich die Wirtschaft unter Inkaufnahme von Inflation anzukurbeln, dürfte es ungemütlich werden. „Diese Politik kann zu noch mehr Instabilität an den Finanzmärkten führen, als wir sie in den vergangenen Jahren erlebt haben“, warnt Bill Gross, der Anleihespezialist der Fondsgesellschaft Pimco.
Erste Anzeichen für die Vorwegnahme des Kurswechsels der Notenbanken an den Finanzmärkten sind bereits sichtbar. So hat der Goldpreis 2002 den höchsten Stand seit fünfeinhalb Jahren erreicht. Das alte Image der Fluchtwährung lebt wieder auf. „Gold wird der Star unter den Anlagealternativen der kommenden Jahre“, ist sich Hedgefondsmanager Sterzig sicher.
Ein Aufschwung? Woher?
Das Dilemma der Notenbanken: Sie haben keine Alternative zur Reflationierung, wollen sie nicht eine schwere Wirtschaftskrise wie in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts heraufbeschwören. Die Ungleichgewichte der Hausse, die im Börsen- und Konjunkturabschwung offen zutage treten, müssen auf sanfte Weise behoben werden. Zu viel Investitionen, zu viel Konsum, zu viel Schulden: Auf diese Formel lässt sich das Leiden Amerikas und mit Abstrichen auch das Problem Europas bringen. US-Unternehmen produzieren unterhalb ihrer Kapazitäten und haben damit keinerlei Macht, Preise zu setzen. Oder andersherum: Die Preise für ihre Güter fallen. Hinzu kommt, dass der amerikanische Konsument, an dem noch immer das Wohl und Wehe der Weltwirtschaft hängt, erst allmählich zu sparen beginnt. „Woher soll der Aufschwung kommen?“, fragt Jan Hatzius, Analyst für die amerikanische Wirtschaft bei Goldman Sachs.
Normalerweise beginnen die Konsumenten am Ende der Rezession ihre aufgestaute Nachfrage zu befriedigen und leiten damit den Aufschwung ein, erklärt er. Doch diesmal ist es anders. „Die Sparquote muss zunächst auf sechs bis zehn Prozent steigen“, sagt Hatzius. Im abgelaufenen Jahr ist sie immerhin schon von 2,5 auf 4 Prozent geklettert. Als letzte Stütze für den ungehemmten Verbrauch erweist sich der noch immer boomende Immobilienmarkt. Erst wenn dort die Preise stagnieren, schlägt die Stunde der Wahrheit. Und obwohl die Fed die Zinsen radikal gesenkt hat, haben sich die Finanzierungskonditionen der Unternehmen nicht verbessert. „Sie sind so schlecht wie vor einem Jahr“, sagt Hatzius.
Kampf gegen die Deflation
Für manche gilt es deshalb als ausgemacht, dass die Fed Mitte nächsten Jahres beginnt, massiv gegen die Deflation vorzugehen. Die Lage werde sich Anfang 2003 so stark verschlimmern, dass die Fed ihren Worten Taten folgen lasse, erwartet John Butler, Anleihestratege von Dresdner Kleinwort Wasserstein. Am Erfolg zweifelt er nicht: „Eher Mitte 2004 als Ende 2004 wird die Inflation zurück sein.“
Inflation sei die ideale Lösung für die globale Finanzkrise, so Butler. Die Schuldenlast der Unternehmen verringert sich, sie erhalten Spielraum für höhere Preise und können einfacher Gewinne erzielen. Die Banken müssen weniger faule Kredite abschreiben und sind eher bereit, Geld auszuleihen. Versicherungen und Pensionsfonds können ihre garantierten Mindestauszahlungen besser erfüllen. Und die Konsumenten erfreuen sich ebenso an der verringerten Schuldenlast. Die großen Verlierer einer erfolgreichen Reflationierung sind die Besitzer von Staatsanleihen. Steigt die Inflation, brechen die Kurse ein.
Doch was bedeutet Inflation für Aktien? Zunächst ist Inflation besser als Deflation, da mehr Unternehmen die Krise überleben werden. Allerdings bedeute Inflation nicht automatisch Wirtschaftswachstum, bemerkt Barton Biggs von Morgan Stanley und warnt vor Stagflation, also kaum Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Inflation – so wie in den siebziger Jahren. Das war ein verlorenes Jahrzehnt für die Besitzer von Dividendentiteln. Und es macht auch einen Unterschied, ob die Inflation den Notenbanken, die sich so nach ihr sehnen, aus dem Ruder läuft oder unter Kontrolle bleibt. „Eine zweistellige Inflationsrate wäre ein Desaster“, prophezeit Biggs. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse würden kollabieren und damit die Aktienkurse. „Aktien haben sich in der Vergangenheit stets in einem Umfeld geringer Inflation am besten entwickelt.“
Zurzeit ist Inflation kein Thema, und niemand weiß, ob die Reflationierung überhaupt gelingt. Deshalb wäre es klug, die Anleger nähmen die Sorgen der Notenbanker vor einer heraufziehenden Deflation ernst. Leider tun sie es nicht. Die Dezember-Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch unter weltweit tätigen Fondsmanagern zeigt eine weiter ansteigende Zuversicht für Aktien. 83 Prozent der Fondsmanager rechnen mit steigenden Kursen auf Jahressicht. „Dieser Optimismus spricht gegen die Aktie“, sagt Richard Bernstein von Merrill Lynch, der größte Pessimist unter Amerikas Aktienstrategen, der allerdings drei Jahre in Folge Recht behalten hat. Die ungebrochene Lust auf Aktien, an der Spekulation, ist typisch für das Ende eines Zyklus. Ein neuer Trend wird nur dann geboren, wenn niemand mehr etwas von Aktien wissen will.
DIE ZEIT 02/2003
Kamillentee ? – Silvester ? – Mein Beileid !
Mich wundert schon, weshalb Sovereign Dir nicht gleich einen "Atholl Brose" empfohlen hat (250 g Honig und 250 g Haferflocken zu gleichen Teilen in kaltem Wasser verrühren mit einem Liter Whisky auffüllen und zwei Tage stehen lassen) – in verträglichen (!!) Mengen eingenommen hilft dieser leicht verdauliche Brei gegen Befindlichkeitsstörungen jeglicher Art ...

@ Sovereign
es scheitert schon am Kamelhaarmantel, mein Lieber ...

Die Welt die Du mir da wieder distinguiert und versiert unterbreitest, ist leider nicht die Meine...

Meine Villa steht weder an der "Elbchausse" noch an der "Bellevue" - meinen Rotwein kaufe ich auch schon mal bei ALDI
(ich weiß, ein für Dich unverzeihlicher fauxpass, aber ich bemühe mich ja, ehrlich sein ...
 )
)- und meine Oberhemden bei Peek & Cloppenburg ...
Sicher, eine Einladung von Marcard, Stein & Co könnte man mit einem vorherigen Besuch bei Giorgio Armani am Neuen Wall aufwerten, aber was werden die erlauchten Herren denken, wenn ich mit meinem leicht angekratzten 10 Jahre alten Volvo in die Tiefgarage einbiege ? - Und ein gemieteter Porsche verrät sich bekanntlich durch das Kennzeichen ...
Aber wo wir nun schon bei den besseren Hamburger Einzelhändlern sind:
Im Chilehaus – Eingang Burchardplatz - hat kürzlich eine Filiale des Versanhandels "Manufactum"
eine großzügig ausgestattete Filiale eröffnet: http://www.manufactum.de
Sovereign, ich bin mir sicher: das ist Deine Welt !
- schau Dich da mal bei Deinem nächsten Hamburgaufenthalt um, - Du wirst dort Deine helle Freude haben ...
Einen guten Start ins Neue Jahr wünscht
Konradi

Börsenausblick 2003:
Weltweit lassen die Notenbanken steigende Preise zu – für Aktionäre wird das zum Problem
Von Robert von Heusinger
Drei Worte fassen die Sehnsüchte der Investoren, Händler und Analysten an den internationalen Aktienmärkten zusammen: „Zurück zur Normalität.“ So überschreibt die Commerzbank ihren Ausblick auf den europäischen Aktienmarkt 2003. Genauso titelten auch die Strategen von Sal. Oppenheim – allerdings schon zwölf Monate zuvor. Entgegen aller Hoffnungen entpuppte sich das gerade zu Ende gegangene Börsenjahr als das schwärzeste seit dem Zweiten Weltkrieg: Zum ersten Mal fielen die Kurse das dritte Jahr in Folge, mehr als 40 Prozent verlor der Dax, mehr als 20 Prozent der amerikanische Index Standard & Poor’s 500. Zum dritten Mal hintereinander schlugen Staatsanleihen die Aktie.
Auch wenn die Prognosen für 2003 etwas moderater geworden sind und die Baisse zur Vorsicht mahnt: Die Banken setzen schon wieder auf steigende Aktienkurse. Auf Normalität eben. Kein einziges der 32 vom Handelsblatt befragten Kreditinstitute sagt fallende Kurse bis Ende des Jahres voraus – im Gegenteil. Bei 3915 Punkten soll der Dax in zwölf Monaten stehen, knapp 30 Prozent höher als heute. Zum Vergleich: Für Ende 2002 haben dieselben Analysten im Durchschnitt einen Stand von 5780 Punkten vorhergesagt. Es wurden knapp 3000 Punkte weniger.
Auch die neuen Studien haben das Zeug dazu, kräftig danebenzuliegen. „Ich habe selten so viele orientierungslose Analysen gelesen“, sagt Klaus Sterzig, Manager bei dem deutschen Hedgefonds Arsago. Ganz gleich, welche Analysten man zu Rate zieht, ob die der Deutschen Bank, der holländischen ABN Amro oder der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley, alle erwähnen zwar die großen Risiken für 2003, ignorieren sie aber weitgehend bei der Berechnung ihrer Prognosen.
Und das liest sich so: Risiko Nummer eins ist der drohende Krieg im Irak. Es wird zwar zum Krieg kommen, setzen die Analysten voraus, die Amerikaner werden ihn aber rasch gewinnen. „Abnehmende Unsicherheiten im Zuge einer erfolgreichen Invasion im Irak“ werden die konjunkturelle Erholung stützen, heißt es bei der Deutschen Bank. Die Folge eines schnellen Sieges der US-Truppen am Golf wären angenehm: Der Ölpreis würde kräftig nachgeben, und Konsumenten und Unternehmen könnten ihr Geld statt dessen anderweitig ausgeben.
Risiko Nummer zwei ist eine weltweite Deflation, also fallende Preise und damit einhergehend eine schrumpfende Wirtschaft. Doch da ist Alan Greenspan vor, der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), verehrt als der mächtigste Mann an den internationalen Finanzmärkten. „Wir verlassen uns auf den Greenspan-Put“, gibt Rolf Elgeti zu, Aktienstratege der Commerzbank. Mit „Greenspan-Put“ beschreiben Investoren und Analysten ihr Vertrauen in den Fed-Chef, der alles in seiner Macht stehende tun werde, um die Deflation zu verhindern.
Normalität ist ausgeschlossen
Bei aller Bewunderung für Alan Greenspan übersehen die Aktienmarktexperten allerdings etwas Entscheidendes: Der Kampf gegen die Deflation schließt die Rückkehr zur Normalität aus. Vielmehr verschiebt sich das Koordinatensystem der gängigen Wirtschaftspolitik. Oberstes Ziel der Notenbanken ist es nicht mehr, die Inflation im Zaum zu halten, sondern die Wirtschaft zu stimulieren – auf Teufel komm raus. „Reflation“ heißt das neue Zauberwort. Die Fehler der großen Depression von 1930 und der japanischen Malaise von 1990 sollen vermieden werden. Deflation muss abgewehrt werden, bevor sie eintritt. Das war die Botschaft eines Forschungspapiers der amerikanischen Notenbank von Mitte Juni. Jetzt wird diese Erkenntnis in die Tat umgesetzt.
Spätestens mit der Rede von Fed-Gouverneur Ben Bernanke am 22. November, Making Sure That „It“ Doesn’t Happen Here („Sicherstellen, dass ,Es’ hier nicht passiert“), hat die US-Notenbank einen epochalen Wechsel eingeleitet. Bernanke zeigte, dass selbst bei einem Notenbankzins von null Prozent, wovon die Amerikaner mit 1,25 Prozent nicht mehr allzu weit entfernt sind, die Zentralbank nicht machtlos wird. „Die US-Regierung hat eine Technologie, Gelddruckmaschine genannt, die es erlaubt, so viele Dollar zu drucken, wie sie will, zu vernachlässigbaren Kosten“, sagte er. Irgendwann werden die vielen Dollar die Preise steigen lassen, also zu Inflation führen. Aber Bernanke beließ es nicht bei dieser für einen Notenbanker provozierenden Aussage. Er zeigte sogar auf, wie die Fed im kommenden Jahr agieren werde, sollte das Deflationsgespenst nicht verschwunden sein: Die Möglichkeiten reichen vom unbegrenzten Kauf länger laufender Staatspapiere über direkte Kredite an überschuldete Unternehmen bis hin zur kräftigen Dollarabwertung.
Die Rede sei „bahnbrechend“, attestiert Stephen Roach, der Vordenker unter den amerikanischen Analysten. Sie beendet die Epoche der Inflationsbekämpfung, die der damalige US-Notenbankpräsident Paul Volcker am 6. Oktober 1979 eingeläutet hatte.
Nicht ganz so schrill, aber im Tenor ähnlich äußern sich die beiden anderen großen Notenbanken der Welt, die Bank of Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB). Letztere hat zum Schrecken vieler konservativer Beobachter Anfang Dezember die Leitzinsen kräftig gesenkt und durchblicken lassen, dass es dennoch mehr Konjunktur- als Inflationsrisiken gebe. Sie hat sogar die Überprüfung ihres engen Inflationszieles von unter zwei Prozent angekündigt. Und der Präsident der BoJ muss in der nächsten Zeit vor allem eine Qualifikation mitbringen. „Er muss ein Deflationsbekämpfer sein“, sagt der japanische Premier Junichiro Koizumi.
Wenn die drei größten Wirtschaftsmächte der Welt alles auf eine Karte setzen, nämlich die Wirtschaft unter Inkaufnahme von Inflation anzukurbeln, dürfte es ungemütlich werden. „Diese Politik kann zu noch mehr Instabilität an den Finanzmärkten führen, als wir sie in den vergangenen Jahren erlebt haben“, warnt Bill Gross, der Anleihespezialist der Fondsgesellschaft Pimco.
Erste Anzeichen für die Vorwegnahme des Kurswechsels der Notenbanken an den Finanzmärkten sind bereits sichtbar. So hat der Goldpreis 2002 den höchsten Stand seit fünfeinhalb Jahren erreicht. Das alte Image der Fluchtwährung lebt wieder auf. „Gold wird der Star unter den Anlagealternativen der kommenden Jahre“, ist sich Hedgefondsmanager Sterzig sicher.
Ein Aufschwung? Woher?
Das Dilemma der Notenbanken: Sie haben keine Alternative zur Reflationierung, wollen sie nicht eine schwere Wirtschaftskrise wie in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts heraufbeschwören. Die Ungleichgewichte der Hausse, die im Börsen- und Konjunkturabschwung offen zutage treten, müssen auf sanfte Weise behoben werden. Zu viel Investitionen, zu viel Konsum, zu viel Schulden: Auf diese Formel lässt sich das Leiden Amerikas und mit Abstrichen auch das Problem Europas bringen. US-Unternehmen produzieren unterhalb ihrer Kapazitäten und haben damit keinerlei Macht, Preise zu setzen. Oder andersherum: Die Preise für ihre Güter fallen. Hinzu kommt, dass der amerikanische Konsument, an dem noch immer das Wohl und Wehe der Weltwirtschaft hängt, erst allmählich zu sparen beginnt. „Woher soll der Aufschwung kommen?“, fragt Jan Hatzius, Analyst für die amerikanische Wirtschaft bei Goldman Sachs.
Normalerweise beginnen die Konsumenten am Ende der Rezession ihre aufgestaute Nachfrage zu befriedigen und leiten damit den Aufschwung ein, erklärt er. Doch diesmal ist es anders. „Die Sparquote muss zunächst auf sechs bis zehn Prozent steigen“, sagt Hatzius. Im abgelaufenen Jahr ist sie immerhin schon von 2,5 auf 4 Prozent geklettert. Als letzte Stütze für den ungehemmten Verbrauch erweist sich der noch immer boomende Immobilienmarkt. Erst wenn dort die Preise stagnieren, schlägt die Stunde der Wahrheit. Und obwohl die Fed die Zinsen radikal gesenkt hat, haben sich die Finanzierungskonditionen der Unternehmen nicht verbessert. „Sie sind so schlecht wie vor einem Jahr“, sagt Hatzius.
Kampf gegen die Deflation
Für manche gilt es deshalb als ausgemacht, dass die Fed Mitte nächsten Jahres beginnt, massiv gegen die Deflation vorzugehen. Die Lage werde sich Anfang 2003 so stark verschlimmern, dass die Fed ihren Worten Taten folgen lasse, erwartet John Butler, Anleihestratege von Dresdner Kleinwort Wasserstein. Am Erfolg zweifelt er nicht: „Eher Mitte 2004 als Ende 2004 wird die Inflation zurück sein.“
Inflation sei die ideale Lösung für die globale Finanzkrise, so Butler. Die Schuldenlast der Unternehmen verringert sich, sie erhalten Spielraum für höhere Preise und können einfacher Gewinne erzielen. Die Banken müssen weniger faule Kredite abschreiben und sind eher bereit, Geld auszuleihen. Versicherungen und Pensionsfonds können ihre garantierten Mindestauszahlungen besser erfüllen. Und die Konsumenten erfreuen sich ebenso an der verringerten Schuldenlast. Die großen Verlierer einer erfolgreichen Reflationierung sind die Besitzer von Staatsanleihen. Steigt die Inflation, brechen die Kurse ein.
Doch was bedeutet Inflation für Aktien? Zunächst ist Inflation besser als Deflation, da mehr Unternehmen die Krise überleben werden. Allerdings bedeute Inflation nicht automatisch Wirtschaftswachstum, bemerkt Barton Biggs von Morgan Stanley und warnt vor Stagflation, also kaum Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Inflation – so wie in den siebziger Jahren. Das war ein verlorenes Jahrzehnt für die Besitzer von Dividendentiteln. Und es macht auch einen Unterschied, ob die Inflation den Notenbanken, die sich so nach ihr sehnen, aus dem Ruder läuft oder unter Kontrolle bleibt. „Eine zweistellige Inflationsrate wäre ein Desaster“, prophezeit Biggs. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse würden kollabieren und damit die Aktienkurse. „Aktien haben sich in der Vergangenheit stets in einem Umfeld geringer Inflation am besten entwickelt.“
Zurzeit ist Inflation kein Thema, und niemand weiß, ob die Reflationierung überhaupt gelingt. Deshalb wäre es klug, die Anleger nähmen die Sorgen der Notenbanker vor einer heraufziehenden Deflation ernst. Leider tun sie es nicht. Die Dezember-Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch unter weltweit tätigen Fondsmanagern zeigt eine weiter ansteigende Zuversicht für Aktien. 83 Prozent der Fondsmanager rechnen mit steigenden Kursen auf Jahressicht. „Dieser Optimismus spricht gegen die Aktie“, sagt Richard Bernstein von Merrill Lynch, der größte Pessimist unter Amerikas Aktienstrategen, der allerdings drei Jahre in Folge Recht behalten hat. Die ungebrochene Lust auf Aktien, an der Spekulation, ist typisch für das Ende eines Zyklus. Ein neuer Trend wird nur dann geboren, wenn niemand mehr etwas von Aktien wissen will.
DIE ZEIT 02/2003
@konradi
Ach was, auf`s Auto kommt`s nicht an. Ich habe im Umkehrschluß auch schon völlig abgerissene Typen aus nen nagelneuen Jag aussteigen sehen, genauso wie ich "Spesenritterjuristen" kenne, die im Mini durch die Gegend fahren.
"Sicher, eine Einladung von Marcard, Stein & Co könnte man mit einem vorherigen Besuch bei Giorgio Armani am Neuen Wall aufwerten."
Ach was, wir sind hier im Hamburg, nicht in München. Also statt dem Designerkram lieber Harris-Tweed und Glencheck-Muster (P&C ist doch nicht schlecht, hat manchmal gute Krawatten). Und was die "Kapitalanforderungen" der Banken angeht: Sag ihnen, du investierst ausschließlich in Goldaktien und wirst in 3 bis 5 Jahren damit einen siebenstelligen Betrag zusammenhaben...
"meinen Rotwein kaufe ich auch schon mal bei ALDI"
Habe kürzlich gehört, das 85 % der Bevölkerung bei Aldi kauft...vielleicht entgeht mir ja was, aber irgendwie ist mir der ganze Laden (incl. Kundschaft und Sortiment) zu versifft (genauso wie dieser Penny-, Lidl- und Plus-Kram...gibt`s da überhaupt Single Malt, englische Orangenmarmelade, Frischfisch, Roquefort-Käse und Bordeaux?) Also wirklich: Über Aldi war ich froh, als ich noch in der Immo-Branche war und man Ladenflächen an den vermieten konnte (zählt in Shopping-Centern als sog. "Ankermieter", aber soweit herabgelassen in den Laden reinzugehen habe ich mich nicht!).
"Im Chilehaus – Eingang Burchardplatz - hat kürzlich eine Filiale des Versanhandels "Manufactum" eine großzügig ausgestattete Filiale eröffnet"...Die Regenschirme von denen sind toll (Brigg), allerdings muß man sich glaube ich einen solchen Schrim mit Sterlingsilberknauf beim Hersteller direkt bestellen...das wäre doch ein schönes Geschenk an sich selbst, bei Silber 10 $ die Unze.
Gruß
Sovereign
Ach was, auf`s Auto kommt`s nicht an. Ich habe im Umkehrschluß auch schon völlig abgerissene Typen aus nen nagelneuen Jag aussteigen sehen, genauso wie ich "Spesenritterjuristen" kenne, die im Mini durch die Gegend fahren.
"Sicher, eine Einladung von Marcard, Stein & Co könnte man mit einem vorherigen Besuch bei Giorgio Armani am Neuen Wall aufwerten."
Ach was, wir sind hier im Hamburg, nicht in München. Also statt dem Designerkram lieber Harris-Tweed und Glencheck-Muster (P&C ist doch nicht schlecht, hat manchmal gute Krawatten). Und was die "Kapitalanforderungen" der Banken angeht: Sag ihnen, du investierst ausschließlich in Goldaktien und wirst in 3 bis 5 Jahren damit einen siebenstelligen Betrag zusammenhaben...

"meinen Rotwein kaufe ich auch schon mal bei ALDI"
Habe kürzlich gehört, das 85 % der Bevölkerung bei Aldi kauft...vielleicht entgeht mir ja was, aber irgendwie ist mir der ganze Laden (incl. Kundschaft und Sortiment) zu versifft (genauso wie dieser Penny-, Lidl- und Plus-Kram...gibt`s da überhaupt Single Malt, englische Orangenmarmelade, Frischfisch, Roquefort-Käse und Bordeaux?) Also wirklich: Über Aldi war ich froh, als ich noch in der Immo-Branche war und man Ladenflächen an den vermieten konnte (zählt in Shopping-Centern als sog. "Ankermieter", aber soweit herabgelassen in den Laden reinzugehen habe ich mich nicht!).
"Im Chilehaus – Eingang Burchardplatz - hat kürzlich eine Filiale des Versanhandels "Manufactum" eine großzügig ausgestattete Filiale eröffnet"...Die Regenschirme von denen sind toll (Brigg), allerdings muß man sich glaube ich einen solchen Schrim mit Sterlingsilberknauf beim Hersteller direkt bestellen...das wäre doch ein schönes Geschenk an sich selbst, bei Silber 10 $ die Unze.

Gruß
Sovereign
Hallo Konradi!
Danke für Dein Mitgefühl : - ))
Wurde dann dennoch nicht so schlimm, dank der Sucht, die man(n) in sich hat ...,
irgendwann, denk ich, ein trockener Rotwein, den kann ich wohl schon ab... gedacht, getrunken ... zweiter .. dritter ...
der Test verlief erfolgreich, so durfte irgendwann auch ein Geist hinterher ...
das war beste Medizin, nun brauche ich die Klotüre nicht mehr im Auge zu behalten : - ))
Deine Atholl Brose hört sich als ein etwas zähes Getränk an ... scheint allerdings eine recht genießbare Medizin zu sein!
Grüße
Magor
Danke für Dein Mitgefühl : - ))
Wurde dann dennoch nicht so schlimm, dank der Sucht, die man(n) in sich hat ...,
irgendwann, denk ich, ein trockener Rotwein, den kann ich wohl schon ab... gedacht, getrunken ... zweiter .. dritter ...
der Test verlief erfolgreich, so durfte irgendwann auch ein Geist hinterher ...
das war beste Medizin, nun brauche ich die Klotüre nicht mehr im Auge zu behalten : - ))
Deine Atholl Brose hört sich als ein etwas zähes Getränk an ... scheint allerdings eine recht genießbare Medizin zu sein!
Grüße
Magor
Nachdem unsere Anlagen ja in die richtige Richtung, sozusagen in ruhigem Fahrwasser dümpeln ...
wäre doch die Gelegenheit für Wichtigeres ...
Vor kurzem hate ich beruflich in S/O Finnland Einsatz.
Bei einem netten Abend in einem guten einheimischen Restaurant hatte ich als Vorspeise bestellt: "Blini"
Nun, Blini kenne ich aus russischen Gefilden als eine Bezeichnung für Pfannekuchen ...
Es kam:
Eine Scheibe Pfannekuchen,
untertassengroß auf einem Kuchenteller,
darauf eine esslöffelmenge kleingehackter Zwiebel (Schalotten ?)
eine Lage Frischkäse
darauf ein-zwei Esslöffel roter, kleinkörniger Kaviar
darauf wieder Frischkäse
bestreut mit Dill ...
War richtig köstlich
dazu ein trockener Weisswein ...
Ich werde versuchen diese Vorspeise bei nächster Gelegenheit für meine Gäste nachzubauen!
Grüße
Magor
wäre doch die Gelegenheit für Wichtigeres ...
Vor kurzem hate ich beruflich in S/O Finnland Einsatz.
Bei einem netten Abend in einem guten einheimischen Restaurant hatte ich als Vorspeise bestellt: "Blini"
Nun, Blini kenne ich aus russischen Gefilden als eine Bezeichnung für Pfannekuchen ...
Es kam:
Eine Scheibe Pfannekuchen,
untertassengroß auf einem Kuchenteller,
darauf eine esslöffelmenge kleingehackter Zwiebel (Schalotten ?)
eine Lage Frischkäse
darauf ein-zwei Esslöffel roter, kleinkörniger Kaviar
darauf wieder Frischkäse
bestreut mit Dill ...
War richtig köstlich
dazu ein trockener Weisswein ...
Ich werde versuchen diese Vorspeise bei nächster Gelegenheit für meine Gäste nachzubauen!
Grüße
Magor
@magor
Klingt lecker...Blinis sind übrigens Fladen aus Buchweizenmehl...ich würde als Variante dazu einen eiskalten Wodka nehmen
macvin
Klingt lecker...Blinis sind übrigens Fladen aus Buchweizenmehl...ich würde als Variante dazu einen eiskalten Wodka nehmen

macvin
Credo eines überzeugten Goldbugs: Jason Hommel
Normalerweise hätte wohl ein Link zu "gold-eagle" genügt. Weil dieser Essay aber ebenso treffend wie zuspitzend all unsere Überlegungen zusammenfasst, soll er hier doch in voller Länge erscheinen :
Jason Hommel :
Why no talk of $32,567/oz ?
What I learned at the San Francisco Gold Mining and Precious Metals Conference on Dec. 1-2, 2002:
I have been diligently studying the precious metals markets through the internet and books for five years now. I`ve written a few articles, trying my best to explain my understanding of the fundamentals of the gold market.
But Dec. 1-2, 2002, was the first time I attended a precious metals convention. It was a unique and incredible learning opportunity. Reading the works of others is just not the same as being able to question the authors in person. I already knew of several areas where my views differ from many gold experts, which is why I have already written on those subjects. The question I had was why virtually nobody is saying the things I wrote about two years ago with my first article for GOLD-EAGLE.com. I found my answer, and it`s worth knowing, because it helps to understand both where we are headed, why so few will speak of it, and why my analysis is sound.
But first, I need to lay the foundation for why I say a rational dollar price for an ounce of gold is $32,567/oz.
I think it`s very important for precious metals investors to know where we are headed so they don`t exit the gold market too soon. I fear the most for those who consider themselves "long and strong" gold investors who think we are headed for only $600 to $1000/oz.
Today, the bottom of the gold market has clearly passed, and now it`s time to determine what the top will be. As I see it, an investor needs to call both the bottom and the top. You have to accurately call both in order to make the best trade to buy low and sell high.
For example, let`s assume for a moment that gold will go to a price in excess of $30,000/oz. What would happen if you invested in gold at $300/oz. and sold gold for cash at $3000?
You`d first make 10 times the original investment, but then get hit as your cash lost 90% of it`s value as gold went up the next ten fold increase, and you`d just break even. Or, if the dollar continued crashing to zero, you`d lose everything.
That`s my fear: that people don`t know what`s possible in gold, that they don`t know the huge number of dollars that are out there and their current purchasing power relative to the gold market. (Of course, many gold bugs know that paper is worthless and never need to be told that.) Consider the potential of U.S. dollar purchasing power. There are 8.5 Trillion dollars (or near equivalent) in U.S. Banks.
To put that huge number into perspective, let`s look at India. According to the World Gold Council at www.gold.org, India buys about 855 tonnes of gold annually. India is the largest buyer of gold per year in a market that consumes about 4000 tonnes annually.
But 1% of the $8.5 Trillion U.S. dollars is $85 Billion, which, at $350/oz., can buy 243 million ounces, or 7550 tonnes, which is almost 9 times as much as India! One percent of U.S. dollars can buy nine times as much gold as India buys in a year.
Stop for a moment and think about that. One percent of U.S. dollars would completely overwhelm the gold market.
Currently, the U.S. buys only about 400 tonnes a year, according to gold.org. At $350/oz, 400 tonnes could be purchased for a mere $4.5 Billion.
To understand how small $4.5 Billion is in relative terms, it`s 1/1,888th of 8.5 Trillion. That means that only one dollar, out of 1,888 dollars, is interested in buying gold each year! Consider this: if 1/1000th of U.S. dollars bought gold in a year, then U.S. demand would just about double to be about equal to India`s annual gold demand.
There are many corporations and investment funds that have far more than $4.5 Billion to invest. Imagine if only one such giant investment fund that manages in excess of $100 Billion decided to allocate 10% of their holdings to gold, say about $10 Billion worth. One such purchase alone would be more than double current annual U.S. gold demand, and would probably drive the gold price wildly high. But, how high?
To predict a dollar price of gold is to assign rational values to both dollars and to gold. Since the dollar is based on fraud and has no gold backing, then rationally, it has no value.
The only way to assign a rational value to the dollar is to assume it could be 100% backed by gold. If the dollar were backed up by less than 100%, say only 5% backed by gold, then the dollar would be valued 20 times more than it should be, and a rational price prediction would require saying that the dollar price for gold should increase 20 fold, or increase 20 times, or increase by a factor of 20, meaning that you`d take the current dollar price for gold, multiply by 20, and then you`d have your rational value figure for gold. But there is not 5% gold backing, there is theoretically only about 1% gold backing, which is why the gold price needs to go up by about 100 times.
Until and unless the dollar is backed 100% by gold, then the dollar is fraud. You cannot predict a rational price for a fraudulent piece of paper, other than zero! Fraudulent dollars may have temporary value to buy things in the real world, but that value is simply not rational, and is the by-product of deception, habit, and the collective insanity of society. It is the job of a rational investor to recognize and avoid buying insanely high values, and to buy undervalued assets. Essentially, the dollar is a bubble based on irrational values, and thus, it will and must collapse. The dollar has the potential to collapse completely, since it has no rational value at all.
Theoretically, however, the dollar could stop collapsing at the point where there were equal amounts of dollars and gold, and then a collapse could be halted if all the gold available were to be pledged to be converted equally into all the available dollars.
Therefore, a rational dollar price prediction for gold can be obtained by dividing available dollars by available gold. The best official figures for these are M3 and the U.S. gold hoard. For those of you who don`t know, M3 is the best measure of the dollar money supply that the U.S. Federal Reserve uses.
M3 http://www.federalreserve.gov/releases/h6/Current/ $8.5 Trillion or (8,500,000 million) U.S. Gold www.fms.treas.gov/gold/index.html261 million oz.
Admittedly, the official numbers are not very reliable. There are more dollars available than is listed as M3 because there are foreign bank accounts and many counterfeit dollars that are used as money in the world.
And the U.S. gold has not been audited since the 1960`s, and many suspect it is totally gone, and not available at all. Nevertheless, the official numbers are the best figures available that we have to work with. If the figures are wrong, M3 is surely higher, and U.S. gold is surely lower. If either is the case, it would only mean that the rational dollar price for gold should be much higher than $32,000/oz.
At my web site goldismoney.com, I present a simple calculation: M3 / U.S. gold.
Since gold is money, each dollar in existence could potentially buy gold. Current figures as of Nov. 2002 are: 8.5 Trillion dollars / 261 million oz. of gold. This ratio tells us the level to which the dollar needs to devalue if it were to be backed 100% by the U.S. "official" gold again. This number gives me an idea of a potential top of the gold market. This number, at the moment, is $32,567/oz - a number that I do not see discussed by anybody. Why not?
Two years ago, in my first article for GOLD-EAGLE.com, this figure was only $25,000/oz. The difference between $25,000 and $32,567 represents inflation of M3 from 6.6 Trillion in the year 2000, to 8.5 Trillion in late 2002.
The question burning in my mind at the gold mining conference was "Why does nobody mention M3 as a force that can drive the dollar price of gold to about $30,000/oz.?"
This was an extremely important question to me because I believe the excess creation of dollars is the biggest reason why gold will go up in value as measured by dollars. I believe it is this inflation that has already happened (the excess creation of electronic money deposits and paper dollars) that will be the largest driving force behind the rise to come in the gold price. I believe this is bigger than secretive central bank selling, bigger than an impending gold default in futures contracts, bigger than the supply/demand imbalance, bigger than China or Japan or India, or any other factor.
The other reason these numbers are important is that M3 and the U.S. gold are not secret figures, they are public numbers. It takes no conspiracy theory detective work to deduce that they have printed up and put into circulation in the banking system far, far more dollars than is rational.
It is important to note that the chart of the dollar price for gold tells us nothing about how many extra dollars have been created and have yet to express themselves as price inflation, or as a higher price for gold.
In other words, the technical chart analysis that we often read from other analysts can say absolutely nothing about how high the gold price will rise in dollars. All they can allude to is potential price movements that would be "off the charts", but that is too vague and is not very useful.
It is important for my readers to realize that I am not saying that gold will have the value that $32,000 has today. Most likely, the dollar will devalue, and gold will rise in value. If the dollar declines in value by a factor of 10, and gold rises in value by a factor of 10, then that (or some variation thereof) could account for the relative change in value between them which would result in the increase in the dollar gold price by a factor of 100. Perhaps the dollar will devalue by a factor of 5, and gold will increase by a factor of 20. Or the dollar will devalue by a factor of 20, and gold will increase in value by a factor of 5. I am not sure which way things will be valued once the irrational dollar excesses are destroyed. But that is a topic for another time.
However, it is possible that the value of gold and it`s purchasing power does increase 100 fold for certain items. For example, if housing prices are inflated by a factor of ten today due to the easy availability of government granted fiat money loans, and gold is undervalued by a factor of ten, then housing prices, denominated in gold, might swing by a combined factor of 100 when rational values return.
As a real-world example of this, a bag of $1000 face value junk silver coins, in 1980, when silver was at $50/oz., was worth about $35,000, which could buy a house. Today, a house costs about $350,000 and a bag of $1000 face value silver might cost about $3500, or 1/100th the price of the house.
I fully expect that a bag of silver will be able to buy a house once again--but this time it will be a much nicer home, simply because there is less silver in the world today than there was in 1980, and therefore it will have more value. The point of this factual historical example is to show that silver has decreased in value by a factor of 100. And if commodities and asset classes move in cycles, then it is not out of the realm of possibility to suggest that gold, or silver, or both, will move up in value by a factor of 100. And thus, there are now two entirely different and solid reasons behind my analysis showing that gold will increase in value by a factor of 100.
Back to the occasion for this article. I had the wonderful opportunity to personally question several people at the mining conference last month who are in the newsletter writing business who have each been commenting on the gold market for well over 20 years. These guys know their stuff. They are well respected in the mining industry, and they make money by selling their advice and knowledge. So, they must be doing something right. They each had booths at the conference, and each spoke several times over the course of the weekend in the large conference hall. I`m a smart man and I did very well in school, but I was very impressed with the verbal ability that these men all had, and how they were able to easily recall in conversation many facts and figures relative to the gold market and the market in general. These men were all absolutely brilliant thinkers and analysts--even if they occasionally did buy into and repeat one or more of the many gold myths that I have identified and debunked in my last essay for gold-eagle.
John Doody and James Dines each mentioned at the conference that gold could reach $3000/oz. Richard Russell (who was not at the conference) also recently wrote of gold hitting $3000/oz. Those predictions alone are very bullish factors for gold, because two years ago, most analysts had a hard time saying $300 was a possibility, and GATA was brave, and virtually alone, in advocating $600/oz. as a possible gold price.
But is $3,000/oz. a rational price for gold, simply because several experts now say so, or is my number more accurate?
I was thinking about indicating by name what each newsletter writer said to me personally, but I decided not to report names, for two reasons. First, given the nature of what some said, I think they would rather remain private. Second, I`m reporting conversations from memory that took place over a week ago, and I might misquote someone slightly, so I will speak about what I learned from the conversations in general, without quoting individuals by name.
When I approached the first expert, I asked, "If you divide M3, which is over 8 Trillion dollars, by the U.S. gold supply, you get over $30,000/oz. gold. (Little did I realize that the number has actually increased to over $32,000 in recent months.) Why is it that nobody seems to mention that number?"
He began, "You don`t need to tell me what M3 means…" He continued by saying it will be foreigners who dump dollars for gold who will push up the gold price, and so therefore, M3 is not a factor compared to the dollars and bonds held by foreigners.
So, again, I asked bluntly, "You mean you don`t think Americans will sell dollars for gold as I have?" This question seemed to fluster him a bit, but this time he replied about how he knows a dollar is fraud and that it takes only pennies to print them, but that it`s a confidence game. He said as long as people have confidence in dollars, the paper dollar will continue to have value. And the conversation ended.
I don`t think his answer really answers my question, because I know that the confidence game is continuing rather well right now. My question concerns what happens when the confidence game ends!
I asked a few further questions, such as "Given that 1% of that $8.5 Trillion still represents a huge amount of buying pressure related to the gold market ($85 Billion dollars, which is about the current valuation of the U.S. official gold reserves), what do you think would happen to the price of gold if 1% of that $8.5 Trillion started buying gold?"
He replied by saying that he didn`t think 1% would buy gold any time soon.
Again, that did not really answer my question. I did not ask about the likelihood or timing of when 1% of $8.5 Trillion will buy gold. Instead, I take it as a given fact that will occur at some point rather soon, whether it happens in a year or two years, I don`t care, and it makes no difference to me.
Therefore, I did not ask when that will happen. I essentially asked what would happen to the gold price when roughly $85 Billion dollars tries to buy gold? At a gold price of $340/oz., that would be the equivalent of placing an order for 250 million ounces, or 7775 tonnes in a gold market that has annual supply from the mines of 2500 tonnes! Obviously, if a mere 1% of dollars chased physical gold, it would completely overwhelm the gold market and push the dollar price sky high, which is my entire point!
I know that current market psychology is against gold in America, and that Americans are mostly ignorant about gold and how many dollars have been created and are now in the banking system. My question represents a hypothetical "what if" scenario, considering what might happen when 1% of that ignorance starts to end!
I went up to the next expert and I said that the various newsletter writers at the conference have begun to predict a $3000 gold price, but I asked why not $30,000? He seemed amused by my suggestion of such a large number. He said plainly, "Let`s worry about getting to $3000 first." And he also said, "Besides, by that time, I`ll be retired on the beach." I suppose that was a fair enough answer.
I asked a third expert the same question. He said essentially the same thing, but in a different way, and he gave more reasons. First, he also indicated he would retire in comfort by the time gold hit $3000. But he also said that by that time, he would probably no longer be a public figure in the gold market trying to make a living, but rather, he would retire in privacy. This is why I decided to not mention any names, because of the private nature of the conversation.
But he gave another very interesting reason. Essentially, he said, "What benefit would there be to calling such a top so long in advance?
Who would want to be remembered as the person who made such a call by the time it turns out to be right? The world tends to shoot the messenger."
Again, I think that is a fair enough answer.
Note, in none of the cases did the experts say that $32,000 was not a rational number, nor did they refute it as a possibility.
At the conference in a lecture, an important point was raised: The market commentators and newsletter editors are not necessarily in the business of "being right".
You can be right, but the market might have a different answer. These guys are in the business of selling newsletters, not "being right". People who buy newsletters simply will not subscribe to a service that makes what might appear to be outlandish predictions. People who buy newsletters that are bullish on gold are also the type who have witnessed the 20 year bear market in gold. The average age of the person at the conference seemed to be about 50 or older. The conference attendees, and likely newsletter subscriber base, are not dummies. They all have heard and know that the dollar can potentially become worthless, and the dollar value of gold can go sky high, since that`s the essential factor that sets gold apart. They would much rather know the answer to the much bigger question, which is the agonizing, "When?!"
Now, related to this question of "when", a number of experts predicted that if gold went through $327 or $330, or $340-$350, then gold would "break out", and really take off. I spoke with one man who was making this kind of prediction, and I asked another very important question. I said, "In 1971, before the default, gold went from $35 to $43, and then it was pushed down again to $35 and then the default happened. Might the same thing happen today, where gold is pushed down to $300, and then the default will happen and you might not be able to get gold at any price because the market would be virtually closed due to limit up days until a much higher price is reached?" First, he objected to my phrasing, "gold was pushed down". He said that was a judgment call on why the price moved, so he said let`s just say the price "went down". Ok, fine. But basically, he agreed that a default could happen at any price at any time, and the market could virtually close down at any price, just like last time. But he didn`t believe that was likely to happen.
Now, back in 1980, I believe people were predicting that the price of gold would rise to $5000/oz. I believe the reason for that prediction was because M3 was about 1.8 Trillion, not the 8.5 Trillion we have today. The M3 to U.S. gold ratio in 1980, at 1.8 Trillion dollars, gives $6896/oz., which is close to the $5000/oz. prediction of the times.
So, my perspective then, is not that the gold price has been manipulated since about the middle of the 1990`s, as GATA has been arguing. This is why GATA predicts a gold price rise to about $600-$1000/oz, and why I`m predicting a gold price rise to about $32,000/oz.
My perspective is that the gold price has been manipulated and held back since 1980, when the government used every deceiving trick available to stop the rapid rise in the gold price. They lured people back into bonds by paying around 20% if I`m not mistaken. This was a high rate, sure, but I do not believe it should have been enough to get people out of gold because gold rose 34% per year from 1970 to 1980.
The other trick used to halt the rise in the gold price was introducing futures and options. They introduced futures trading on Dec. 31, 1974, the very day before they legalized physical gold ownership in the U.S. on Jan 1, 1975.
Futures contracts and options lured people into believing that you could invest in these "paper bets" to take advantage of the rising gold price, instead of investing in actual physical metal. I believe buying futures contracts is about as foolish as buying a "gold backed dollar," the kind that Nixon defaulted on in 1971.
In essence, futures contracts siphon away investment demand and keep potentially large buyers away from buying actual metal. Even those who don`t buy futures will falsely reason to themselves, "When the time is right, I`ll invest in gold futures contracts, or options on those futures, if I see gold going up and if I think that trend will continue."
These people are deceived because paper contracts are prone to default, and physical gold in one`s possession can not default. Therefore, a paper promise can never be a substitute for gold.
I believe futures contracts will soon default. My perspective on futures contracts, therefore, is that when the open interest increases, it is not a bullish sign for the gold market. Every time the open interest increases, that represents more deceived investors who want to go long on gold, but think they can do it by not owning actual gold.
My point is that the 20-year bear market in gold discredited the idea that a rational gold price could be calculated by looking at M3 size and growth. For 20 years, this statistical calculation became meaningless to everyone, as mass deception set in on an entire generation of investors. This is probably the main reason why so few speak of this today, but instead speak vaguely and generally about how inflation will cause the gold price to rise.
It is not future inflation that will be the cause of the rise of the gold price. It is the inflation of the past that will drive the price.
But just because M3 hasn`t been useful in the past as an accurate predictor, does not mean that it won`t be useful in the future to predict where we are headed. If it`s not a useful predictor, I invite people to email me and correct me where they think I`m wrong on any of this.
So, why am I writing about $32,000/oz. gold if the idea is mostly discredited and scoffed at? Probably because I`m young (age 32), brave, and I`m not in the business of selling a newsletter. I still "just want to be right" and give people useful information.
As I understand it, the higher gold can potentially go, the longer you can afford to wait after buying gold! More importantly, I take it as a given that a default in the gold futures contracts can occur at any moment, and the gold market could literally shut down for days or weeks at a time during which time there are limit up days and you can`t trade or get into the metals market at any price. Therefore, from my perspective, I believe it is best to invest in the precious metals market with nearly 100% of my portfolio, and I don`t believe it would be wise to wait for a break out to invest in the metals market, and I don`t plan to do any trading in and out of the precious metals market by selling any rallies or buying any dips.
The stakes and destination are simply too great an opportunity to pass up. Although I don`t plan to trade out of the metals market anytime soon, I will re-allocate my portfolio within the sector, by selling stocks of mining and exploring companies if I find another mining company that looks like a better opportunity. I also plan to buy more physical metal as the price rises.
Furthermore, I write about $32,000/oz. gold because I have no basis and no rational reason to predict a $1000-3000/oz. price, or any number lower than $32,000/oz. The only rational dollar price for gold is the one that takes into account the essential difference between dollars and gold, and that is that the dollar is fraud. This is my bias. I can`t help it. The dollar fraud would only end when there is an equal amount of dollars and gold. Therefore, it is only pure logic that dictates the $32,000/oz. price, and not hype, not wishful thinking, not pie-in-the-sky dreaming, not irrational hopes, not emotive speculations, and I`m certainly not pandering to sensationalism. It`s pure logic based on the best available data, and nothing else.
Also, I believe there is no better reason to be in gold than the rational and logical realization that the dollar can, and will, and must, eventually devalue all the way to $32,000/oz. gold or even further. Normally, it takes about a 45 year time period for one dollar invested to grow to a hundred dollars. Investment advisors often say that if you invest $10,000 when you are a teenager, and it compounds at 10-12%, then by the time you retire, you will have $1,000,000, or a hundred times as much. Investing in gold, now, quite literally, is the investment of a lifetime! And since there is no better reason to own gold, then it makes no sense to me to ignore presenting the best one.
Several well-meaning people have suggested that I should not write about a number such as $32,000/oz. for gold in my articles because people can`t conceive of it, and it may turn people off. Further they say it might harm my credibility, and even prevent people from investing in gold because I (and gold bugs in general) would be seen as portraying something insane or improbable. Well, the truth is more important to me than what other people think. I am trying my best to make the truth palatable for people, and I do not think telling the truth hurts my credibility at all.
I will not do or say what is wrong to make other people happy. I consider a $3000/oz. prediction for gold to be wrong, a lie, misleading, untruthful, less than the whole truth, not telling the full story, and deceptive. If I predicted a $3000/oz. price, I would feel that my prediction would be a support or endorsement as if that represented a rational price. I cannot endorse that as a rational price. If I said that $3000/oz. was a rational price that gold should move to, then I feel I would be helping to perpetuate the dollar fraud scheme. I would feel that I would be suggesting that a 10% gold backing for the dollar would be ok. Let me state quite frankly, I do not think a 90% fraud is ok. It would still be fraud and theft, and I cannot support that in any way, shape or form. Again, this is my bias.
I do not even think a dollar that is 100% backed up by gold is ok. I think that a paper claim on an asset held by another is one short step away from allowing fraud to take place, and is almost an invitation to allowing that fraud to take place. If you wouldn`t leave your car unlocked in an unsavory neighborhood, you likewise shouldn`t trust a banker with your gold and agree to hold a 100% gold backed dollar based on his word alone. Holding a dollar backed up 100% by gold is literally a refusal to take responsibility to protect the wealth you own. Holding a dollar backed 100% by gold is wrong on so many levels. The person holding the dollar has confidence that he has an asset, but he does not have an asset. The person holding a dollar backed 100% by gold is holding a liability! The person holding a dollar backed 100% by gold is actually a lender of wealth, not a possessor of wealth.
Therefore, the battle between currencies and gold is not a battle between "competitive asset classes". Fiat currencies such as the dollar, the yen, and the euro, are not even assets, they are liabilities! And the dollar is a liability that has already been defaulted on, twice! When I think in those terms, it`s hard for me to imagine why defaulted promissory notes still have value, but that`s the insane bias of this stupid, stupid society I live in.
Therefore, even if gold were being traded at $32,000/oz., I still would not trade my gold for dollars unless I needed to do so in order to eat food for the day.
So, given the fact that a dollar backed 100% by gold rattles my conscience, then I cannot support something that is so much worse, such as a dollar backed 10% by gold. Thus, I cannot endorse (by predicting) a price of around $3000/oz. gold. I simply cannot.
To declare the dollar is fraud is to declare that the only rational dollar price for gold is M3 divided by U.S. gold holdings. Currently, given the official numbers, the figure works out to about $32,000/oz. There is no other rational price that can be calculated by looking at official figures. Holding dollars when gold is trading less than $32,000/oz., therefore, is irrational, and is literally investing in fraud. It is irrational to knowingly invest in a fraud such as the dollar or any fiat currency.
Most of the other explanations of what is going on in the gold market are merely side explanations and comments and speculations on how and why the dollar fraud has managed to continue for as long as it has. Those other topics, such as bonds and their interest rates, gold futures contracts, central bank leasing, and the like are certainly interesting, but they all ignore the big question which always must remain, "How many excess dollars have actually been printed and/or put into circulation that will eventually show up and be reflected by a higher dollar gold price?"
Therefore my dear readers, when people ask you, "Why is gold going up in price?", or, "Why will gold go up in price?" I believe you should say: "Because the U.S. has created over 32,000 dollars for every ounce of gold they claim to have."
Now, although this article is mostly focused on a particular question I had about how the gold market is discussed (and/or not discussed) by the experts, I`m far more bullish on silver than gold. Silver has everything going for it that gold does, and much more. The 8.5 Trillion in dollars held by people could just as easily begin to chase after silver as gold. In fact, about 70-80% of the people at the conference raised their hands when David Morgan asked, "Who here owns actual physical silver?" It was truly a unique and wise crowd.
Silver is so out of favor, so scarce, and in such demand by industry, and so undervalued compared to historic norms, that when the silver market seizes up, some experts have theorized that the gold/silver ratio could swing well past the historic ratio of 1:16 and even hit 1:1 for a brief time. Currently, at $350 oz. Gold, and $4.70 oz.
Silver, the ratio is 1:74.
So far, we have looked at what might happen if dollars are invested in gold. Well, how many dollars could potentially buy silver? The obvious answer is an infinite amount of dollars could attempt to buy silver and drive the price incalculably high. But using available known silver supplies in the world, at available prices, we can get a dollar figure.
Ted Butler has written extensively that there are only 150 million ounces of silver in known verifiable places in the world, and that is shrinking due to the ongoing supply/demand deficit in the silver market. At $4.70/oz., that silver is valued at only 705 million dollars.
There are stocks of silver mining companies that have the potential to rise in value even faster than silver. The three silver companies mentioned repeatedly and positively at the mining conference by several analysts were Pan American Silver (PAAS), Silver Standard (SSRI), and Apex Silver (SIL). I was invited to the conference by SSRI because I`m a shareholder in SSRI. Two other silver mining companies are Hecla Mining (HL), Cour d`Alene Mines (CDE). Two smaller silver explorers are Wheaton River Minerals (WHT), and Cardero Resources (CDU.V or CUEAF.PK) This not an exhaustive list of silver mining companies. Do your own due diligence. I hold shares of SSRI, PAAS, SIL, CDU.V and also various other gold mining companies.
02.Januar 2003
jasonhommel@yahoo.com
Normalerweise hätte wohl ein Link zu "gold-eagle" genügt. Weil dieser Essay aber ebenso treffend wie zuspitzend all unsere Überlegungen zusammenfasst, soll er hier doch in voller Länge erscheinen :
Jason Hommel :
Why no talk of $32,567/oz ?
What I learned at the San Francisco Gold Mining and Precious Metals Conference on Dec. 1-2, 2002:
I have been diligently studying the precious metals markets through the internet and books for five years now. I`ve written a few articles, trying my best to explain my understanding of the fundamentals of the gold market.
But Dec. 1-2, 2002, was the first time I attended a precious metals convention. It was a unique and incredible learning opportunity. Reading the works of others is just not the same as being able to question the authors in person. I already knew of several areas where my views differ from many gold experts, which is why I have already written on those subjects. The question I had was why virtually nobody is saying the things I wrote about two years ago with my first article for GOLD-EAGLE.com. I found my answer, and it`s worth knowing, because it helps to understand both where we are headed, why so few will speak of it, and why my analysis is sound.
But first, I need to lay the foundation for why I say a rational dollar price for an ounce of gold is $32,567/oz.
I think it`s very important for precious metals investors to know where we are headed so they don`t exit the gold market too soon. I fear the most for those who consider themselves "long and strong" gold investors who think we are headed for only $600 to $1000/oz.
Today, the bottom of the gold market has clearly passed, and now it`s time to determine what the top will be. As I see it, an investor needs to call both the bottom and the top. You have to accurately call both in order to make the best trade to buy low and sell high.
For example, let`s assume for a moment that gold will go to a price in excess of $30,000/oz. What would happen if you invested in gold at $300/oz. and sold gold for cash at $3000?
You`d first make 10 times the original investment, but then get hit as your cash lost 90% of it`s value as gold went up the next ten fold increase, and you`d just break even. Or, if the dollar continued crashing to zero, you`d lose everything.
That`s my fear: that people don`t know what`s possible in gold, that they don`t know the huge number of dollars that are out there and their current purchasing power relative to the gold market. (Of course, many gold bugs know that paper is worthless and never need to be told that.) Consider the potential of U.S. dollar purchasing power. There are 8.5 Trillion dollars (or near equivalent) in U.S. Banks.
To put that huge number into perspective, let`s look at India. According to the World Gold Council at www.gold.org, India buys about 855 tonnes of gold annually. India is the largest buyer of gold per year in a market that consumes about 4000 tonnes annually.
But 1% of the $8.5 Trillion U.S. dollars is $85 Billion, which, at $350/oz., can buy 243 million ounces, or 7550 tonnes, which is almost 9 times as much as India! One percent of U.S. dollars can buy nine times as much gold as India buys in a year.
Stop for a moment and think about that. One percent of U.S. dollars would completely overwhelm the gold market.
Currently, the U.S. buys only about 400 tonnes a year, according to gold.org. At $350/oz, 400 tonnes could be purchased for a mere $4.5 Billion.
To understand how small $4.5 Billion is in relative terms, it`s 1/1,888th of 8.5 Trillion. That means that only one dollar, out of 1,888 dollars, is interested in buying gold each year! Consider this: if 1/1000th of U.S. dollars bought gold in a year, then U.S. demand would just about double to be about equal to India`s annual gold demand.
There are many corporations and investment funds that have far more than $4.5 Billion to invest. Imagine if only one such giant investment fund that manages in excess of $100 Billion decided to allocate 10% of their holdings to gold, say about $10 Billion worth. One such purchase alone would be more than double current annual U.S. gold demand, and would probably drive the gold price wildly high. But, how high?
To predict a dollar price of gold is to assign rational values to both dollars and to gold. Since the dollar is based on fraud and has no gold backing, then rationally, it has no value.
The only way to assign a rational value to the dollar is to assume it could be 100% backed by gold. If the dollar were backed up by less than 100%, say only 5% backed by gold, then the dollar would be valued 20 times more than it should be, and a rational price prediction would require saying that the dollar price for gold should increase 20 fold, or increase 20 times, or increase by a factor of 20, meaning that you`d take the current dollar price for gold, multiply by 20, and then you`d have your rational value figure for gold. But there is not 5% gold backing, there is theoretically only about 1% gold backing, which is why the gold price needs to go up by about 100 times.
Until and unless the dollar is backed 100% by gold, then the dollar is fraud. You cannot predict a rational price for a fraudulent piece of paper, other than zero! Fraudulent dollars may have temporary value to buy things in the real world, but that value is simply not rational, and is the by-product of deception, habit, and the collective insanity of society. It is the job of a rational investor to recognize and avoid buying insanely high values, and to buy undervalued assets. Essentially, the dollar is a bubble based on irrational values, and thus, it will and must collapse. The dollar has the potential to collapse completely, since it has no rational value at all.
Theoretically, however, the dollar could stop collapsing at the point where there were equal amounts of dollars and gold, and then a collapse could be halted if all the gold available were to be pledged to be converted equally into all the available dollars.
Therefore, a rational dollar price prediction for gold can be obtained by dividing available dollars by available gold. The best official figures for these are M3 and the U.S. gold hoard. For those of you who don`t know, M3 is the best measure of the dollar money supply that the U.S. Federal Reserve uses.
M3 http://www.federalreserve.gov/releases/h6/Current/ $8.5 Trillion or (8,500,000 million) U.S. Gold www.fms.treas.gov/gold/index.html261 million oz.
Admittedly, the official numbers are not very reliable. There are more dollars available than is listed as M3 because there are foreign bank accounts and many counterfeit dollars that are used as money in the world.
And the U.S. gold has not been audited since the 1960`s, and many suspect it is totally gone, and not available at all. Nevertheless, the official numbers are the best figures available that we have to work with. If the figures are wrong, M3 is surely higher, and U.S. gold is surely lower. If either is the case, it would only mean that the rational dollar price for gold should be much higher than $32,000/oz.
At my web site goldismoney.com, I present a simple calculation: M3 / U.S. gold.
Since gold is money, each dollar in existence could potentially buy gold. Current figures as of Nov. 2002 are: 8.5 Trillion dollars / 261 million oz. of gold. This ratio tells us the level to which the dollar needs to devalue if it were to be backed 100% by the U.S. "official" gold again. This number gives me an idea of a potential top of the gold market. This number, at the moment, is $32,567/oz - a number that I do not see discussed by anybody. Why not?
Two years ago, in my first article for GOLD-EAGLE.com, this figure was only $25,000/oz. The difference between $25,000 and $32,567 represents inflation of M3 from 6.6 Trillion in the year 2000, to 8.5 Trillion in late 2002.
The question burning in my mind at the gold mining conference was "Why does nobody mention M3 as a force that can drive the dollar price of gold to about $30,000/oz.?"
This was an extremely important question to me because I believe the excess creation of dollars is the biggest reason why gold will go up in value as measured by dollars. I believe it is this inflation that has already happened (the excess creation of electronic money deposits and paper dollars) that will be the largest driving force behind the rise to come in the gold price. I believe this is bigger than secretive central bank selling, bigger than an impending gold default in futures contracts, bigger than the supply/demand imbalance, bigger than China or Japan or India, or any other factor.
The other reason these numbers are important is that M3 and the U.S. gold are not secret figures, they are public numbers. It takes no conspiracy theory detective work to deduce that they have printed up and put into circulation in the banking system far, far more dollars than is rational.
It is important to note that the chart of the dollar price for gold tells us nothing about how many extra dollars have been created and have yet to express themselves as price inflation, or as a higher price for gold.
In other words, the technical chart analysis that we often read from other analysts can say absolutely nothing about how high the gold price will rise in dollars. All they can allude to is potential price movements that would be "off the charts", but that is too vague and is not very useful.
It is important for my readers to realize that I am not saying that gold will have the value that $32,000 has today. Most likely, the dollar will devalue, and gold will rise in value. If the dollar declines in value by a factor of 10, and gold rises in value by a factor of 10, then that (or some variation thereof) could account for the relative change in value between them which would result in the increase in the dollar gold price by a factor of 100. Perhaps the dollar will devalue by a factor of 5, and gold will increase by a factor of 20. Or the dollar will devalue by a factor of 20, and gold will increase in value by a factor of 5. I am not sure which way things will be valued once the irrational dollar excesses are destroyed. But that is a topic for another time.
However, it is possible that the value of gold and it`s purchasing power does increase 100 fold for certain items. For example, if housing prices are inflated by a factor of ten today due to the easy availability of government granted fiat money loans, and gold is undervalued by a factor of ten, then housing prices, denominated in gold, might swing by a combined factor of 100 when rational values return.
As a real-world example of this, a bag of $1000 face value junk silver coins, in 1980, when silver was at $50/oz., was worth about $35,000, which could buy a house. Today, a house costs about $350,000 and a bag of $1000 face value silver might cost about $3500, or 1/100th the price of the house.
I fully expect that a bag of silver will be able to buy a house once again--but this time it will be a much nicer home, simply because there is less silver in the world today than there was in 1980, and therefore it will have more value. The point of this factual historical example is to show that silver has decreased in value by a factor of 100. And if commodities and asset classes move in cycles, then it is not out of the realm of possibility to suggest that gold, or silver, or both, will move up in value by a factor of 100. And thus, there are now two entirely different and solid reasons behind my analysis showing that gold will increase in value by a factor of 100.
Back to the occasion for this article. I had the wonderful opportunity to personally question several people at the mining conference last month who are in the newsletter writing business who have each been commenting on the gold market for well over 20 years. These guys know their stuff. They are well respected in the mining industry, and they make money by selling their advice and knowledge. So, they must be doing something right. They each had booths at the conference, and each spoke several times over the course of the weekend in the large conference hall. I`m a smart man and I did very well in school, but I was very impressed with the verbal ability that these men all had, and how they were able to easily recall in conversation many facts and figures relative to the gold market and the market in general. These men were all absolutely brilliant thinkers and analysts--even if they occasionally did buy into and repeat one or more of the many gold myths that I have identified and debunked in my last essay for gold-eagle.
John Doody and James Dines each mentioned at the conference that gold could reach $3000/oz. Richard Russell (who was not at the conference) also recently wrote of gold hitting $3000/oz. Those predictions alone are very bullish factors for gold, because two years ago, most analysts had a hard time saying $300 was a possibility, and GATA was brave, and virtually alone, in advocating $600/oz. as a possible gold price.
But is $3,000/oz. a rational price for gold, simply because several experts now say so, or is my number more accurate?
I was thinking about indicating by name what each newsletter writer said to me personally, but I decided not to report names, for two reasons. First, given the nature of what some said, I think they would rather remain private. Second, I`m reporting conversations from memory that took place over a week ago, and I might misquote someone slightly, so I will speak about what I learned from the conversations in general, without quoting individuals by name.
When I approached the first expert, I asked, "If you divide M3, which is over 8 Trillion dollars, by the U.S. gold supply, you get over $30,000/oz. gold. (Little did I realize that the number has actually increased to over $32,000 in recent months.) Why is it that nobody seems to mention that number?"
He began, "You don`t need to tell me what M3 means…" He continued by saying it will be foreigners who dump dollars for gold who will push up the gold price, and so therefore, M3 is not a factor compared to the dollars and bonds held by foreigners.
So, again, I asked bluntly, "You mean you don`t think Americans will sell dollars for gold as I have?" This question seemed to fluster him a bit, but this time he replied about how he knows a dollar is fraud and that it takes only pennies to print them, but that it`s a confidence game. He said as long as people have confidence in dollars, the paper dollar will continue to have value. And the conversation ended.
I don`t think his answer really answers my question, because I know that the confidence game is continuing rather well right now. My question concerns what happens when the confidence game ends!
I asked a few further questions, such as "Given that 1% of that $8.5 Trillion still represents a huge amount of buying pressure related to the gold market ($85 Billion dollars, which is about the current valuation of the U.S. official gold reserves), what do you think would happen to the price of gold if 1% of that $8.5 Trillion started buying gold?"
He replied by saying that he didn`t think 1% would buy gold any time soon.
Again, that did not really answer my question. I did not ask about the likelihood or timing of when 1% of $8.5 Trillion will buy gold. Instead, I take it as a given fact that will occur at some point rather soon, whether it happens in a year or two years, I don`t care, and it makes no difference to me.
Therefore, I did not ask when that will happen. I essentially asked what would happen to the gold price when roughly $85 Billion dollars tries to buy gold? At a gold price of $340/oz., that would be the equivalent of placing an order for 250 million ounces, or 7775 tonnes in a gold market that has annual supply from the mines of 2500 tonnes! Obviously, if a mere 1% of dollars chased physical gold, it would completely overwhelm the gold market and push the dollar price sky high, which is my entire point!
I know that current market psychology is against gold in America, and that Americans are mostly ignorant about gold and how many dollars have been created and are now in the banking system. My question represents a hypothetical "what if" scenario, considering what might happen when 1% of that ignorance starts to end!
I went up to the next expert and I said that the various newsletter writers at the conference have begun to predict a $3000 gold price, but I asked why not $30,000? He seemed amused by my suggestion of such a large number. He said plainly, "Let`s worry about getting to $3000 first." And he also said, "Besides, by that time, I`ll be retired on the beach." I suppose that was a fair enough answer.
I asked a third expert the same question. He said essentially the same thing, but in a different way, and he gave more reasons. First, he also indicated he would retire in comfort by the time gold hit $3000. But he also said that by that time, he would probably no longer be a public figure in the gold market trying to make a living, but rather, he would retire in privacy. This is why I decided to not mention any names, because of the private nature of the conversation.
But he gave another very interesting reason. Essentially, he said, "What benefit would there be to calling such a top so long in advance?
Who would want to be remembered as the person who made such a call by the time it turns out to be right? The world tends to shoot the messenger."
Again, I think that is a fair enough answer.
Note, in none of the cases did the experts say that $32,000 was not a rational number, nor did they refute it as a possibility.
At the conference in a lecture, an important point was raised: The market commentators and newsletter editors are not necessarily in the business of "being right".
You can be right, but the market might have a different answer. These guys are in the business of selling newsletters, not "being right". People who buy newsletters simply will not subscribe to a service that makes what might appear to be outlandish predictions. People who buy newsletters that are bullish on gold are also the type who have witnessed the 20 year bear market in gold. The average age of the person at the conference seemed to be about 50 or older. The conference attendees, and likely newsletter subscriber base, are not dummies. They all have heard and know that the dollar can potentially become worthless, and the dollar value of gold can go sky high, since that`s the essential factor that sets gold apart. They would much rather know the answer to the much bigger question, which is the agonizing, "When?!"
Now, related to this question of "when", a number of experts predicted that if gold went through $327 or $330, or $340-$350, then gold would "break out", and really take off. I spoke with one man who was making this kind of prediction, and I asked another very important question. I said, "In 1971, before the default, gold went from $35 to $43, and then it was pushed down again to $35 and then the default happened. Might the same thing happen today, where gold is pushed down to $300, and then the default will happen and you might not be able to get gold at any price because the market would be virtually closed due to limit up days until a much higher price is reached?" First, he objected to my phrasing, "gold was pushed down". He said that was a judgment call on why the price moved, so he said let`s just say the price "went down". Ok, fine. But basically, he agreed that a default could happen at any price at any time, and the market could virtually close down at any price, just like last time. But he didn`t believe that was likely to happen.
Now, back in 1980, I believe people were predicting that the price of gold would rise to $5000/oz. I believe the reason for that prediction was because M3 was about 1.8 Trillion, not the 8.5 Trillion we have today. The M3 to U.S. gold ratio in 1980, at 1.8 Trillion dollars, gives $6896/oz., which is close to the $5000/oz. prediction of the times.
So, my perspective then, is not that the gold price has been manipulated since about the middle of the 1990`s, as GATA has been arguing. This is why GATA predicts a gold price rise to about $600-$1000/oz, and why I`m predicting a gold price rise to about $32,000/oz.
My perspective is that the gold price has been manipulated and held back since 1980, when the government used every deceiving trick available to stop the rapid rise in the gold price. They lured people back into bonds by paying around 20% if I`m not mistaken. This was a high rate, sure, but I do not believe it should have been enough to get people out of gold because gold rose 34% per year from 1970 to 1980.
The other trick used to halt the rise in the gold price was introducing futures and options. They introduced futures trading on Dec. 31, 1974, the very day before they legalized physical gold ownership in the U.S. on Jan 1, 1975.
Futures contracts and options lured people into believing that you could invest in these "paper bets" to take advantage of the rising gold price, instead of investing in actual physical metal. I believe buying futures contracts is about as foolish as buying a "gold backed dollar," the kind that Nixon defaulted on in 1971.
In essence, futures contracts siphon away investment demand and keep potentially large buyers away from buying actual metal. Even those who don`t buy futures will falsely reason to themselves, "When the time is right, I`ll invest in gold futures contracts, or options on those futures, if I see gold going up and if I think that trend will continue."
These people are deceived because paper contracts are prone to default, and physical gold in one`s possession can not default. Therefore, a paper promise can never be a substitute for gold.
I believe futures contracts will soon default. My perspective on futures contracts, therefore, is that when the open interest increases, it is not a bullish sign for the gold market. Every time the open interest increases, that represents more deceived investors who want to go long on gold, but think they can do it by not owning actual gold.
My point is that the 20-year bear market in gold discredited the idea that a rational gold price could be calculated by looking at M3 size and growth. For 20 years, this statistical calculation became meaningless to everyone, as mass deception set in on an entire generation of investors. This is probably the main reason why so few speak of this today, but instead speak vaguely and generally about how inflation will cause the gold price to rise.
It is not future inflation that will be the cause of the rise of the gold price. It is the inflation of the past that will drive the price.
But just because M3 hasn`t been useful in the past as an accurate predictor, does not mean that it won`t be useful in the future to predict where we are headed. If it`s not a useful predictor, I invite people to email me and correct me where they think I`m wrong on any of this.
So, why am I writing about $32,000/oz. gold if the idea is mostly discredited and scoffed at? Probably because I`m young (age 32), brave, and I`m not in the business of selling a newsletter. I still "just want to be right" and give people useful information.
As I understand it, the higher gold can potentially go, the longer you can afford to wait after buying gold! More importantly, I take it as a given that a default in the gold futures contracts can occur at any moment, and the gold market could literally shut down for days or weeks at a time during which time there are limit up days and you can`t trade or get into the metals market at any price. Therefore, from my perspective, I believe it is best to invest in the precious metals market with nearly 100% of my portfolio, and I don`t believe it would be wise to wait for a break out to invest in the metals market, and I don`t plan to do any trading in and out of the precious metals market by selling any rallies or buying any dips.
The stakes and destination are simply too great an opportunity to pass up. Although I don`t plan to trade out of the metals market anytime soon, I will re-allocate my portfolio within the sector, by selling stocks of mining and exploring companies if I find another mining company that looks like a better opportunity. I also plan to buy more physical metal as the price rises.
Furthermore, I write about $32,000/oz. gold because I have no basis and no rational reason to predict a $1000-3000/oz. price, or any number lower than $32,000/oz. The only rational dollar price for gold is the one that takes into account the essential difference between dollars and gold, and that is that the dollar is fraud. This is my bias. I can`t help it. The dollar fraud would only end when there is an equal amount of dollars and gold. Therefore, it is only pure logic that dictates the $32,000/oz. price, and not hype, not wishful thinking, not pie-in-the-sky dreaming, not irrational hopes, not emotive speculations, and I`m certainly not pandering to sensationalism. It`s pure logic based on the best available data, and nothing else.
Also, I believe there is no better reason to be in gold than the rational and logical realization that the dollar can, and will, and must, eventually devalue all the way to $32,000/oz. gold or even further. Normally, it takes about a 45 year time period for one dollar invested to grow to a hundred dollars. Investment advisors often say that if you invest $10,000 when you are a teenager, and it compounds at 10-12%, then by the time you retire, you will have $1,000,000, or a hundred times as much. Investing in gold, now, quite literally, is the investment of a lifetime! And since there is no better reason to own gold, then it makes no sense to me to ignore presenting the best one.
Several well-meaning people have suggested that I should not write about a number such as $32,000/oz. for gold in my articles because people can`t conceive of it, and it may turn people off. Further they say it might harm my credibility, and even prevent people from investing in gold because I (and gold bugs in general) would be seen as portraying something insane or improbable. Well, the truth is more important to me than what other people think. I am trying my best to make the truth palatable for people, and I do not think telling the truth hurts my credibility at all.
I will not do or say what is wrong to make other people happy. I consider a $3000/oz. prediction for gold to be wrong, a lie, misleading, untruthful, less than the whole truth, not telling the full story, and deceptive. If I predicted a $3000/oz. price, I would feel that my prediction would be a support or endorsement as if that represented a rational price. I cannot endorse that as a rational price. If I said that $3000/oz. was a rational price that gold should move to, then I feel I would be helping to perpetuate the dollar fraud scheme. I would feel that I would be suggesting that a 10% gold backing for the dollar would be ok. Let me state quite frankly, I do not think a 90% fraud is ok. It would still be fraud and theft, and I cannot support that in any way, shape or form. Again, this is my bias.
I do not even think a dollar that is 100% backed up by gold is ok. I think that a paper claim on an asset held by another is one short step away from allowing fraud to take place, and is almost an invitation to allowing that fraud to take place. If you wouldn`t leave your car unlocked in an unsavory neighborhood, you likewise shouldn`t trust a banker with your gold and agree to hold a 100% gold backed dollar based on his word alone. Holding a dollar backed up 100% by gold is literally a refusal to take responsibility to protect the wealth you own. Holding a dollar backed 100% by gold is wrong on so many levels. The person holding the dollar has confidence that he has an asset, but he does not have an asset. The person holding a dollar backed 100% by gold is holding a liability! The person holding a dollar backed 100% by gold is actually a lender of wealth, not a possessor of wealth.
Therefore, the battle between currencies and gold is not a battle between "competitive asset classes". Fiat currencies such as the dollar, the yen, and the euro, are not even assets, they are liabilities! And the dollar is a liability that has already been defaulted on, twice! When I think in those terms, it`s hard for me to imagine why defaulted promissory notes still have value, but that`s the insane bias of this stupid, stupid society I live in.
Therefore, even if gold were being traded at $32,000/oz., I still would not trade my gold for dollars unless I needed to do so in order to eat food for the day.
So, given the fact that a dollar backed 100% by gold rattles my conscience, then I cannot support something that is so much worse, such as a dollar backed 10% by gold. Thus, I cannot endorse (by predicting) a price of around $3000/oz. gold. I simply cannot.
To declare the dollar is fraud is to declare that the only rational dollar price for gold is M3 divided by U.S. gold holdings. Currently, given the official numbers, the figure works out to about $32,000/oz. There is no other rational price that can be calculated by looking at official figures. Holding dollars when gold is trading less than $32,000/oz., therefore, is irrational, and is literally investing in fraud. It is irrational to knowingly invest in a fraud such as the dollar or any fiat currency.
Most of the other explanations of what is going on in the gold market are merely side explanations and comments and speculations on how and why the dollar fraud has managed to continue for as long as it has. Those other topics, such as bonds and their interest rates, gold futures contracts, central bank leasing, and the like are certainly interesting, but they all ignore the big question which always must remain, "How many excess dollars have actually been printed and/or put into circulation that will eventually show up and be reflected by a higher dollar gold price?"
Therefore my dear readers, when people ask you, "Why is gold going up in price?", or, "Why will gold go up in price?" I believe you should say: "Because the U.S. has created over 32,000 dollars for every ounce of gold they claim to have."
Now, although this article is mostly focused on a particular question I had about how the gold market is discussed (and/or not discussed) by the experts, I`m far more bullish on silver than gold. Silver has everything going for it that gold does, and much more. The 8.5 Trillion in dollars held by people could just as easily begin to chase after silver as gold. In fact, about 70-80% of the people at the conference raised their hands when David Morgan asked, "Who here owns actual physical silver?" It was truly a unique and wise crowd.
Silver is so out of favor, so scarce, and in such demand by industry, and so undervalued compared to historic norms, that when the silver market seizes up, some experts have theorized that the gold/silver ratio could swing well past the historic ratio of 1:16 and even hit 1:1 for a brief time. Currently, at $350 oz. Gold, and $4.70 oz.
Silver, the ratio is 1:74.
So far, we have looked at what might happen if dollars are invested in gold. Well, how many dollars could potentially buy silver? The obvious answer is an infinite amount of dollars could attempt to buy silver and drive the price incalculably high. But using available known silver supplies in the world, at available prices, we can get a dollar figure.
Ted Butler has written extensively that there are only 150 million ounces of silver in known verifiable places in the world, and that is shrinking due to the ongoing supply/demand deficit in the silver market. At $4.70/oz., that silver is valued at only 705 million dollars.
There are stocks of silver mining companies that have the potential to rise in value even faster than silver. The three silver companies mentioned repeatedly and positively at the mining conference by several analysts were Pan American Silver (PAAS), Silver Standard (SSRI), and Apex Silver (SIL). I was invited to the conference by SSRI because I`m a shareholder in SSRI. Two other silver mining companies are Hecla Mining (HL), Cour d`Alene Mines (CDE). Two smaller silver explorers are Wheaton River Minerals (WHT), and Cardero Resources (CDU.V or CUEAF.PK) This not an exhaustive list of silver mining companies. Do your own due diligence. I hold shares of SSRI, PAAS, SIL, CDU.V and also various other gold mining companies.
02.Januar 2003
jasonhommel@yahoo.com
@Konradi
Dieses Credo ist interessant, es läßt sich auf den Nenner reduzieren:
Es quantifiziert schlicht die Entwertung des US-Dollars, was sinngemäß allerdings auch auf fast alle anderen Währungen "Fiat Money" mehr oder minder anwendbar ist.
Geringfügig kann man auch Nutzen daraus ziehen. So konnte ein DM/Euro Investor trotz stagnierender, bzw. nur mäßig sich entwickelnder Goldpreise blendend profitieren durch den Anstieg des USD gegenüber dem Euro. Seit der Umkehr der Situation macht es keinen oder wenig Sinn, Edelmetall ohne Absicherung der Währung, in diesem Falle gegenüber dem Euro zu besitzen. Das geht am einfachsten mit Optionsscheinen, wie z.B. den von mir derzeit favorisierten: UBS WARBURG AG KOS01/17.3.03 EO/DL 1, 10 WKN:574305 FSE , wobei im Board "Internationale Währungen" unter Thema: Wohin geht der EUR?
kontroverse Diskussionen dazu einsehbar sind.
@Macvin
Buchweizenpfannekuchen?
Früheres Armenessen im Münsterland, heute neben Panhas ein Renner auf Weihnachts- und Bauernmärkten.
Wodka .. ja, wenn´s eine gute Sorte ist, allerdings mag ich weniger die Trinkart "Runterkippen und sich schütteln", ich bevorzuge handwarme geistige Getränke, an denen man ausgiebig erst riechen kann und welchen man nippend trinkt ... nach dem Motto: Nip für Nip ein Genuß ...
und, das geht mit Wodka weniger : - ))
Grüße
Magor
Dieses Credo ist interessant, es läßt sich auf den Nenner reduzieren:
Es quantifiziert schlicht die Entwertung des US-Dollars, was sinngemäß allerdings auch auf fast alle anderen Währungen "Fiat Money" mehr oder minder anwendbar ist.
Geringfügig kann man auch Nutzen daraus ziehen. So konnte ein DM/Euro Investor trotz stagnierender, bzw. nur mäßig sich entwickelnder Goldpreise blendend profitieren durch den Anstieg des USD gegenüber dem Euro. Seit der Umkehr der Situation macht es keinen oder wenig Sinn, Edelmetall ohne Absicherung der Währung, in diesem Falle gegenüber dem Euro zu besitzen. Das geht am einfachsten mit Optionsscheinen, wie z.B. den von mir derzeit favorisierten: UBS WARBURG AG KOS01/17.3.03 EO/DL 1, 10 WKN:574305 FSE , wobei im Board "Internationale Währungen" unter Thema: Wohin geht der EUR?
kontroverse Diskussionen dazu einsehbar sind.
@Macvin
Buchweizenpfannekuchen?
Früheres Armenessen im Münsterland, heute neben Panhas ein Renner auf Weihnachts- und Bauernmärkten.
Wodka .. ja, wenn´s eine gute Sorte ist, allerdings mag ich weniger die Trinkart "Runterkippen und sich schütteln", ich bevorzuge handwarme geistige Getränke, an denen man ausgiebig erst riechen kann und welchen man nippend trinkt ... nach dem Motto: Nip für Nip ein Genuß ...
und, das geht mit Wodka weniger : - ))
Grüße
Magor
Passt wohl gerade zur aktuellen Diskussion:

Ist eigentlich schon mal jemand aufgefallen, dass Gold in EUR schon 18 Monate früher im Aufwärtstrend ist (Ende 1999) im Gegensatz zur USA (Anfang 2001).
Gruss Mic

Ist eigentlich schon mal jemand aufgefallen, dass Gold in EUR schon 18 Monate früher im Aufwärtstrend ist (Ende 1999) im Gegensatz zur USA (Anfang 2001).

Gruss Mic

Die Charts sind super Mickym!
Jetzt brauchtest Du nur noch die jeweiligen (tatsächlichen) Inflationsraten einzublenden,
das wäre dann das "Non plus Ultra"
: - ))
Grüße
Magor
Jetzt brauchtest Du nur noch die jeweiligen (tatsächlichen) Inflationsraten einzublenden,
das wäre dann das "Non plus Ultra"
: - ))
Grüße
Magor
@ macvin + magor

BLINY
also jetzt bin ich ja doch mal neugierig geworden: russische Küche ?
– Da kommt mir eigentlich nur Kohlsuppein den Sinn, ... brrr ...
Habe mal gegoogelt: http://www.russianfoods.com/
Viel ist es ja nicht, was da in russischen Töpfen schmort. Vermutlich trinken die Russen zum Essen soviel Brotbier und Wodka,
daß feine geschmacklich Differenzierungen sowieso nicht mehr wahrgenommen werden können
Immerhin, der "Bojaren-Kwas" http://www.lemenu.de/Getraenke/t0233.html
kommt mir als geborener Hamburger irgendwie bekannt vor: mit einer zusätzlichen Büchse Corned Beef vermengt
würde das ganze wohl so ähnliches schmecken wie Labskaus
---
Magor, Wärungsspekulationen sind mir zu heiß, aber ich schau mich gern mal um im Board "Internationale Währungen"
Beim Stöbern in den Threads aus grauer Vorzeit habe ich übrigens gerade einen Beitrag von Sovereign wiederentdeckt:
Thread: Die Akte Ashanti – einfach vorbildlich, da kann man nur noch in Ehrfurcht erstarren...
na sdarowje !
Konradi
.

BLINY
also jetzt bin ich ja doch mal neugierig geworden: russische Küche ?
– Da kommt mir eigentlich nur Kohlsuppein den Sinn, ... brrr ...

Habe mal gegoogelt: http://www.russianfoods.com/
Viel ist es ja nicht, was da in russischen Töpfen schmort. Vermutlich trinken die Russen zum Essen soviel Brotbier und Wodka,
daß feine geschmacklich Differenzierungen sowieso nicht mehr wahrgenommen werden können

Immerhin, der "Bojaren-Kwas" http://www.lemenu.de/Getraenke/t0233.html
kommt mir als geborener Hamburger irgendwie bekannt vor: mit einer zusätzlichen Büchse Corned Beef vermengt
würde das ganze wohl so ähnliches schmecken wie Labskaus

---
Magor, Wärungsspekulationen sind mir zu heiß, aber ich schau mich gern mal um im Board "Internationale Währungen"
Beim Stöbern in den Threads aus grauer Vorzeit habe ich übrigens gerade einen Beitrag von Sovereign wiederentdeckt:
Thread: Die Akte Ashanti – einfach vorbildlich, da kann man nur noch in Ehrfurcht erstarren...

na sdarowje !
Konradi

.
@magor #161 und 164
Versuch doch mal den Frischkäse durch Sour Cream zu ersetzen und am Wodka auch nur zu nippen....
Das klassische russische Gedeck für 4 Personen besteht aus 2 Flaschen Wodka (0,5l) und 2 Flaschen Wasser (1l). Dazu reicht man in einer Schale sehr junge Frühlingszwiebeln (roh, ganz) sowie frische Dill- und Petersiliensträusse. Also zwischen den Trinksprüchen und den Wodkas immer etwas Wasser trinken und rohes Grünzeug futtern - dann ist das alles sehr bekömmlich.
@konradi
Kwas habe ich auch schon auf russischen Märkten genossen - mein Ding ist das nicht . Aber nur auf "Kohlsuppen" sollte man die russische Küche dann auch nicht reduzieren. Probier mal Borschtsch: ein Rote-Beete-Eintopf mit Weisskohl
. Aber nur auf "Kohlsuppen" sollte man die russische Küche dann auch nicht reduzieren. Probier mal Borschtsch: ein Rote-Beete-Eintopf mit Weisskohl  und zarten Rindfleichstreifen (bitte kein Knorpelzeug verwenden wie die Russen sondern Schulter oder besseres), verfeinert mit saurer Sahne und viiiel frischer gehackte Petersilie....passt ausgezeichnet zu einem kühlen Herbstabend.
und zarten Rindfleichstreifen (bitte kein Knorpelzeug verwenden wie die Russen sondern Schulter oder besseres), verfeinert mit saurer Sahne und viiiel frischer gehackte Petersilie....passt ausgezeichnet zu einem kühlen Herbstabend.
Alternativ ein russisches Pilzgericht: Steinpilze in Butter geschmort mit gebratenen Streifen aus Schweinebauch, Zwiebeln und Sahne, viiiel gehackte Petersilie, dazu ein Semmelknödel.
Danach natürlich einen Wodka...
Weisskraut, rote Beete (Wintergemüse) sowie die üppige Verwendung von frischem Dill, Petersilie, Frühlingszwiebeln und saurer Sahne sind landestypisch und sorgen in den lange dauernden Wintermonaten in Russland für ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Milchsäuren...
Und... Währungsspekulationen werden längst nicht so heiss gegessen wie Borschtsch, wenn man einige wenige Regeln beachtet.
Leider sind die freien Tage nun zu Ende und ich werde mich wieder etwas rarer machen müssen.
Gold bei 349,85 EURUSD 1.042 - Business as usual...
Grüsse
macvin
Versuch doch mal den Frischkäse durch Sour Cream zu ersetzen und am Wodka auch nur zu nippen....
Das klassische russische Gedeck für 4 Personen besteht aus 2 Flaschen Wodka (0,5l) und 2 Flaschen Wasser (1l). Dazu reicht man in einer Schale sehr junge Frühlingszwiebeln (roh, ganz) sowie frische Dill- und Petersiliensträusse. Also zwischen den Trinksprüchen und den Wodkas immer etwas Wasser trinken und rohes Grünzeug futtern - dann ist das alles sehr bekömmlich.

@konradi
Kwas habe ich auch schon auf russischen Märkten genossen - mein Ding ist das nicht
 . Aber nur auf "Kohlsuppen" sollte man die russische Küche dann auch nicht reduzieren. Probier mal Borschtsch: ein Rote-Beete-Eintopf mit Weisskohl
. Aber nur auf "Kohlsuppen" sollte man die russische Küche dann auch nicht reduzieren. Probier mal Borschtsch: ein Rote-Beete-Eintopf mit Weisskohl  und zarten Rindfleichstreifen (bitte kein Knorpelzeug verwenden wie die Russen sondern Schulter oder besseres), verfeinert mit saurer Sahne und viiiel frischer gehackte Petersilie....passt ausgezeichnet zu einem kühlen Herbstabend.
und zarten Rindfleichstreifen (bitte kein Knorpelzeug verwenden wie die Russen sondern Schulter oder besseres), verfeinert mit saurer Sahne und viiiel frischer gehackte Petersilie....passt ausgezeichnet zu einem kühlen Herbstabend.Alternativ ein russisches Pilzgericht: Steinpilze in Butter geschmort mit gebratenen Streifen aus Schweinebauch, Zwiebeln und Sahne, viiiel gehackte Petersilie, dazu ein Semmelknödel.
Danach natürlich einen Wodka...
Weisskraut, rote Beete (Wintergemüse) sowie die üppige Verwendung von frischem Dill, Petersilie, Frühlingszwiebeln und saurer Sahne sind landestypisch und sorgen in den lange dauernden Wintermonaten in Russland für ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Milchsäuren...
Und... Währungsspekulationen werden längst nicht so heiss gegessen wie Borschtsch, wenn man einige wenige Regeln beachtet.

Leider sind die freien Tage nun zu Ende und ich werde mich wieder etwas rarer machen müssen.
Gold bei 349,85 EURUSD 1.042 - Business as usual...
Grüsse
macvin

# 167 / 168 Konradi / Macvin
„Leider sind die freien Tage nun zu Ende und ich werde mich wieder etwas rarer machen müssen …“
Der Alltag hat uns wieder, was leider auch für meine Zeiteinteilung zutrifft …
„Wärungsspekulationen sind mir zu heiß …„
Kurssicherung betreibt jede Bank bzw. Unternehmer, der ein Auslandsgeschäft abwickelt. So gesehen ist es bei auf USD-basierenden Edelmetallkursen ausschließlich eine Kurssicherung des USD gegen den Euro, um durch die erwartete Entwertung des USD die Gewinne mit den Edelmetallen nicht (zum Teil) wieder abgeben zu müssen. Der Kursverlauf ist nämlich zumeist gegenläufig, so gehört eine parallele Absicherung der eingesetzten Summe m.E. zwangsläufig zu einer „Spekulation“ auf (in USD) steigende Edelmetallpreise.
„Da kommt mir eigentlich nur Kohlsuppe in den Sinn, ... brrr ..“
Kohlsuppe … ? warum brrr … ?
Ich weiß nicht, ob ich genau die russische Kohlsuppe kenne, die Du meinst. Eine Kohlsuppe in Tomatenmark-Fond kenne ich aus manch anderen Ländern als recht genießbar! Eine als Gemüse gereichte, eingedickte Version davon schmeckt sehr gut zu saftigem, in Schweineschmalz gebratenem Fleisch oder Frikadelle. Im Sauerland gibt es ganz schmackhafte „Sauerkrautsuppe“ zu essen, hervorragend kann ich da nur sagen!
Sorry, aber Deine pauschalisierende Aussage kann ich daher als Kohl-Fan nicht widerspruchlos durchgehen lassen!
Es gibt eigentlich nur einen Kohl, den ich nie ausstehen konnte …
Den russischen Borschtsch, den es ebenso auch in Polen gibt, hatte ich auch häufiger original genossen und als sehr schmackhaft gefunden, allerdings: „ … so heiss gegessen wie Borschtsch …“ da hatte ich häufig meine Mühe mit den Restaurantküchen, die Gerichte auch wirklich heiss serviert zu bekommen.
Meine Erfahrungen damit stammen nur zum Teil direkt aus Russland, sondern von Besuchen in Kasachstan, die allerdings dermaßen vom russischen „Brudervolk“ unterwandert sind, dass sie selbst ihre kasachische Sprache kaum noch beherrschen.
In einem Provinznest namens Termirtau hatte ich an häufigen Abenden auch den Umgang der Einheimischen mit dem „Klassischen russischen Gedeck“ studieren können.
Macvin, Du hast Recht, pinnchenweise gekippt werden solcherlei Getränke eigentlich dort nicht, eher in Deutschland. Fehlt hier vielleicht eine Trinkkultur? Ich bin konsterniert, wenn einer meiner Gäste z.B. einen guten Aprikosenbrand wie´n Fuhrmann runterkippt. Nächstens bekommt der von mir nur noch Fusel, wie´n Korn, Aquavit oder Wacholder eingeschenkt, den kann er dann getrost kippen!
Allerdings, als Nippen kann man in Kasachstan das Wodkatrinken auch nicht mehr bezeichnen …
Eine nette diesbezügliche Erinnerung:
In der Hotelbar trinke ich mit meinem Kollegen so einige Gläser „Pils“, als zur fortgeschrittener Stunde ein junger Mann reinkommt und sich in unsere Nähe gesellt. Er bekam das besagte „Russische Gedeck“, mit der Variation, dass er zu dem Limonadenglas voll Wodka ein Glas Orangensaft bestellte … nach kurzer Zeit versuchte er radebrechend einige Sätze seiner Deutschkenntnisse rüberzubringen, was weniger zu einer Konversation verhalf, als die weiteren Gläser Wodka zu dem kaum angerührten Orangensaft …
Fast synchron, wenn wir ein Pils bestellten, bestellte er ein Wodka … das ging 3-4 mal so, bis er uns, noch weit vor der Zielgeraden zum Benebeltwerden, mit wehenden Fahnen überholte … leider ließen sich die auf solche Fälle bestens vorbereiteten „Aufpasser“ nicht überreden, ihn doch friedlich weiterlallen zu lassen, sondern komplimentierten und bugsierten ihn (vor uns zumindest) höflich, aber bestimmt hinaus und setzten ihn vor die Türe …
Dobroj nocci und daswedanje Briederchen …
Grüße
Magor
„Leider sind die freien Tage nun zu Ende und ich werde mich wieder etwas rarer machen müssen …“
Der Alltag hat uns wieder, was leider auch für meine Zeiteinteilung zutrifft …
„Wärungsspekulationen sind mir zu heiß …„
Kurssicherung betreibt jede Bank bzw. Unternehmer, der ein Auslandsgeschäft abwickelt. So gesehen ist es bei auf USD-basierenden Edelmetallkursen ausschließlich eine Kurssicherung des USD gegen den Euro, um durch die erwartete Entwertung des USD die Gewinne mit den Edelmetallen nicht (zum Teil) wieder abgeben zu müssen. Der Kursverlauf ist nämlich zumeist gegenläufig, so gehört eine parallele Absicherung der eingesetzten Summe m.E. zwangsläufig zu einer „Spekulation“ auf (in USD) steigende Edelmetallpreise.
„Da kommt mir eigentlich nur Kohlsuppe in den Sinn, ... brrr ..“
Kohlsuppe … ? warum brrr … ?
Ich weiß nicht, ob ich genau die russische Kohlsuppe kenne, die Du meinst. Eine Kohlsuppe in Tomatenmark-Fond kenne ich aus manch anderen Ländern als recht genießbar! Eine als Gemüse gereichte, eingedickte Version davon schmeckt sehr gut zu saftigem, in Schweineschmalz gebratenem Fleisch oder Frikadelle. Im Sauerland gibt es ganz schmackhafte „Sauerkrautsuppe“ zu essen, hervorragend kann ich da nur sagen!
Sorry, aber Deine pauschalisierende Aussage kann ich daher als Kohl-Fan nicht widerspruchlos durchgehen lassen!
Es gibt eigentlich nur einen Kohl, den ich nie ausstehen konnte …
Den russischen Borschtsch, den es ebenso auch in Polen gibt, hatte ich auch häufiger original genossen und als sehr schmackhaft gefunden, allerdings: „ … so heiss gegessen wie Borschtsch …“ da hatte ich häufig meine Mühe mit den Restaurantküchen, die Gerichte auch wirklich heiss serviert zu bekommen.
Meine Erfahrungen damit stammen nur zum Teil direkt aus Russland, sondern von Besuchen in Kasachstan, die allerdings dermaßen vom russischen „Brudervolk“ unterwandert sind, dass sie selbst ihre kasachische Sprache kaum noch beherrschen.
In einem Provinznest namens Termirtau hatte ich an häufigen Abenden auch den Umgang der Einheimischen mit dem „Klassischen russischen Gedeck“ studieren können.
Macvin, Du hast Recht, pinnchenweise gekippt werden solcherlei Getränke eigentlich dort nicht, eher in Deutschland. Fehlt hier vielleicht eine Trinkkultur? Ich bin konsterniert, wenn einer meiner Gäste z.B. einen guten Aprikosenbrand wie´n Fuhrmann runterkippt. Nächstens bekommt der von mir nur noch Fusel, wie´n Korn, Aquavit oder Wacholder eingeschenkt, den kann er dann getrost kippen!
Allerdings, als Nippen kann man in Kasachstan das Wodkatrinken auch nicht mehr bezeichnen …
Eine nette diesbezügliche Erinnerung:
In der Hotelbar trinke ich mit meinem Kollegen so einige Gläser „Pils“, als zur fortgeschrittener Stunde ein junger Mann reinkommt und sich in unsere Nähe gesellt. Er bekam das besagte „Russische Gedeck“, mit der Variation, dass er zu dem Limonadenglas voll Wodka ein Glas Orangensaft bestellte … nach kurzer Zeit versuchte er radebrechend einige Sätze seiner Deutschkenntnisse rüberzubringen, was weniger zu einer Konversation verhalf, als die weiteren Gläser Wodka zu dem kaum angerührten Orangensaft …
Fast synchron, wenn wir ein Pils bestellten, bestellte er ein Wodka … das ging 3-4 mal so, bis er uns, noch weit vor der Zielgeraden zum Benebeltwerden, mit wehenden Fahnen überholte … leider ließen sich die auf solche Fälle bestens vorbereiteten „Aufpasser“ nicht überreden, ihn doch friedlich weiterlallen zu lassen, sondern komplimentierten und bugsierten ihn (vor uns zumindest) höflich, aber bestimmt hinaus und setzten ihn vor die Türe …
Dobroj nocci und daswedanje Briederchen …
Grüße
Magor
@ macvin
Probier mal Borschtsch: ein Rote-Beete-Eintopf mit Weisskohl und zarten Rindfleichstreifen (bitte kein Knorpelzeug verwenden wie die Russen sondern Schulter oder besseres), verfeinert mit saurer Sahne und viiiel frischer gehackte Petersilie....passt ausgezeichnet zu einem kühlen Herbstabend.
Hallo macvin, na da bin ich mit Euch beiden ja wohl auf zwei Rußlandexperten gestoßen ?
Das mit dem Pilzgericht kann man sich ja mal überlegen, aber Rote-Beete-Eintopf ? Nee, bei aller Völkerfreundschaft ... - muß nicht sein...
Wenn schon Osteuropa, dann vielleicht tschechische Knödel oder polnische Piroggen ...
@ magor
...so gesehen ist es bei auf USD-basierenden Edelmetallkursen ausschließlich eine Kurssicherung des USD gegen den Euro, um durch die erwartete Entwertung des USD die Gewinne mit den Edelmetallen nicht (zum Teil) wieder abgeben zu müssen. Der Kursverlauf ist nämlich zumeist gegenläufig, so gehört eine parallele Absicherung der eingesetzten Summe m.E. zwangsläufig zu einer „Spekulation“ auf (in USD) steigende Edelmetallpreise
völlig klar, Magor, - wenn es zu einem Währungsschnitt kommt, sind alle unsere schönen Gewinne futsch. Deshalb decken sich ja auch weitsichtige Goldbugs schon jetzt – wo es noch geht – physisch ein. - Es ist ein riskantes Spiel – so oder so, denn die EZB wird nicht tatenlos zusehen, wenn Herr Bernanke die große Druckmaschine anwirft, Euro und Yen werden nicht über Nacht ihren Wert verdoppeln. Eher kracht JPM und das ganze System zusammen. Wenn sich diese Situation tatsächlich abzeichnet, werde ich aber kein Säckchen mit Krügerrand im Vorgarten verbuddeln, sondern die letzten Papierwerte zusammenkratzen und mir davon in der Uckermark ein altes Gehöft kaufen...
Aber jetzt lassen wir mal das traurige Thema ...
Du scheinst mir ein weitgereister Mensch zu sein, mehrjähriger Aufenthalt in Afrika, - jetzt auch noch Kasachstan –
das hört sich irgenwie nach Entwicklungshilfe und GTZ an...?
Eine Freundin von mir war mal als Entwicklungshelferin in Benin (Westküste Afrika) - Sie ist nach zwei Jahren völlig desillusioniert zurückgekommen und ihre ganzen idealistischen Träume von einer gerechteren Welt sind in dieser Zeit zerbrochen.
Wo wir hier schon beim "Schöngeistigen" sind, Magor, wohin zieht´s Dich denn hin,
wenn Du die Wahl hättest ? – Gibt´s irgend ein Fleckchen was Du empfehlen kannst ?
Ich denke da so an ein provencalisches Dorf, wo man friedlich in der Abendsonne ein Gläschen Rotwein genießen kann ...
Ein paar goldbugs hier schwören ja auf Südafrika ...
(Zum Verständnis: ich bin zur Zeit gerade beim Urlaubsprospekteblättern -
Motto: Hauptsache raus aus diesem regennassen Jammertal ... )
)
In der engeren Wahl befindet sich Portugal und natürlich wieder mal ...

Korsika !!!
Beste Grüße Konradi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land ohne Leute - Die vergreiste Republik
Von Elisabeth Niejahr
Deutschland verliert jährlich 200000 Einwohner, da mehr Menschen sterben als geboren werden. Es wächst ein demografisches Problem ungeheuren Ausmaßes heran, doch die Politiker ignorieren es
Was der demografische Wandel für Deutschland bedeutet, lässt sich mit einem Radiergummi vorführen. Man stelle sich vor, auf einer Deutschlandkarte würde ein Ort nach dem anderen ausradiert: erst Lübeck, dann Magdeburg, schließlich Erfurt und Kassel. Ungefähr 200000 Einwohner müssten die Städte haben, denn so stark schrumpft nach Prognosen der Vereinten Nationen pro Jahr die Bevölkerung Deutschlands. Am Ende der kleinen Vorführung wäre das Jahr 2050 erreicht. Die Landkarte hätte 47 blanke Stellen. Wo Städte eingezeichnet waren, sind jetzt nur noch weiße Flecken übrig
Man kann das Spiel auch anders spielen. Dafür müsste man auf der Deutschlandkarte nichts ausradieren, sondern die Fläche vom Bodensee bis zur dänischen Grenze allmählich rot schraffieren. Rot bedeutet Stadtgebiet. Pro Jahr kämen bei diesem Experiment 3,4 Millionen Zuwanderer ins Land. Auch diese Zahl stammt von den Bevölkerungsexperten der UN: So viele Neuankömmlinge mittleren Alters wären nötig, damit trotz der rapiden Alterung der Alteingesessenen das Durchschnittsalter nicht steigt. Am Ende, im Jahr 2050, würden in Deutschland 300 Millionen Menschen leben. Es gäbe keine unbesiedelten Gebiete mehr. Die ganze Karte wäre rot.
Deutschland altert unaufhaltsam, und es altert schnell. So schnell, das zeigen die beiden Statistiken, dass sogar massive Zuwanderung oder ein neuer Geburtenboom diesen Prozess allenfalls leicht bremsen könnte. Die Szenarien mögen irreal, bizarr, weit hergeholt scheinen. Bei Langzeitprognosen ist grundsätzlich Skepsis angebracht. Doch in der Vergangenheit erwiesen sich die Vorhersagen der Vereinten Nationen als recht treffsicher. Einwohnerzahlen sind leichter zu prognostizieren als beispielsweise der Klimawandel. Die Alten von morgen sind schließlich heute schon auf der Welt.
Deutschland schrumpft und altert leise. Mit dem demografischen Wandel verhält es sich wie mit einem Kind. Seine Familie sieht es wachsen, aber das geschieht langsam und beständig, sodass es nicht auffällt. Es sind Außenstehende, Besucher, die sagen: „Mein Gott, ist der aber groß geworden!“ Wer den Wandel täglich erlebt, hält ihn für selbstverständlich. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Deutschen so merkwürdig desinteressiert sind an dem Prozess, der das Land in den kommenden Jahren radikal verändern wird. Man kann verstehen, dass Rainer Münz, Professor für Bevölkerungswissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, seinen Studenten vorhält, sie würden das Problem niedriger Geburtenraten wahrscheinlich erst im Rollstuhl erkennen – wenn niemand mehr da sei, um sie zu schieben.
Es gibt heutzutage nicht mehr viele Tabuthemen. Aber das Altern scheint eines zu sein. Nach dem Geburtsjahr von anderen wird nicht gefragt, bei den eigenen Daten wird gern geschummelt. Fast alle Rentner fühlen sich deutlich jünger, als sie sind. Das lässt sich als Zeichen von Vitalität und Lebensfreude deuten – oder als Zeichen kollektiven Realitätsverlusts. Alt sind immer nur die anderen. Jeder will alt werden, keiner will alt sein.
Wer Produkte oder Dienstleistungen für Ältere anbietet, kennt das Problem: Der Mittsechziger bucht eine Busreise ins Ausland, steigt in ein Fahrzeug voller Rentner und kommt sofort entsetzt wieder heraus, stöhnt: „Da sind ja nur alte Leute!“
Der Mittsiebziger engagiert sich für den Bau eines Seniorenwohnheims in der Nachbarschaft, ohne auch nur eine Sekunde daran zu denken, dass er selber dort einziehen könnte. Die Darmstädter Schader-Stiftung beschrieb diesen Hausbewohnertypus kürzlich in einer Studie über ein alterndes Frankfurter Wohnviertel und resümierte: „Der Glaube an die Fähigkeit, sein eigenes Leben selbstständig zu gestalten, wird oft bis zum Selbstbetrug aufrechterhalten.“ Das gilt für den Einzelnen, und es gilt für das ganze Land: Das Altern, das eigene und das der anderen, will niemand wahrhaben.
Beim Umgang von Alt und Jung stimmt etwas nicht in Deutschland, es läuft etwas falsch in den Personalabteilungen, in den Kreditinstituten, an den Universitäten, in der Politik. Wie soll man es auch verstehen, dass der 76-jährige Alan Greenspan zwar als amerikanischer Notenbankchef die internationalen Finanzströme lenken darf, aber bei einer deutschen Bank wegen seines fortgeschrittenen Alters keinen Kredit bekommen würde? Bei vielen Banken gibt es eine strikte Altersgrenze von 70 oder 68. Wer älter ist, wird abgelehnt.
Wie soll man begreifen, dass angesehene Wissenschaftler in die Vereinigten Staaten auswandern müssen, wenn sie auch jenseits der Pensionsgrenze weiter forschen und lehren wollen? Gerade erst verabschiedete sich der 65-jährige Kölner Genforscher Klaus Rajwsky nach Amerika. Ganz ohne Altersgrenzen für den Ruhestand geht es zwar nicht, aber wenn selbst Spitzenkräfte ohne Wenn und Aber vertrieben werden, ist das System fehlerhaft.
Und wie soll es einleuchten, dass Innenminister Otto Schily zwar als 70-Jähriger eines der wichtigsten Ressorts der rot-grünen Regierung leiten kann, dass ebendiese Regierung aber 58-jährige Arbeitslose nicht mehr in ihren Statistiken vermerkt? Es handelt sich um Zehntausende: Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab, dass in kaum einem Industrieland so wenige Menschen über 55 beschäftigt sind. Nur jeder dritte Mann zwischen 60 und 64 in Deutschland ist noch berufstätig, in den Vereinigten Staaten jeder zweite.
In den meisten anderen Industrieländern gibt es Gesetze gegen solche bizarren Regeln (siehe Kasten S. 10). In Deutschland findet eine Kölner Initiative, das Büro gegen Altersdiskriminierung, nicht einmal bei den Gewerkschaften wirklich Unterstützung. „Vermutlich liegt das daran, dass sie so lange selbst an Vorruhestandsmodellen mitgebastelt haben“, sagt Hanne Schweitzer, eine der Initiatorinnen.
Vermutlich kommt für uns noch das spezifisch deutsche Problem hinzu: Wer ein Wort wie „Bevölkerungspolitik“ überhaupt in den Mund nimmt, muss sehr genau überlegen, was er sagt – eine Folge des Rassenwahns der Nazis. Das führt dazu, dass Demografie-Argumente in den Diskussionen der Außenpolitiker keine Rolle spielen. Andere Nationen gehen wie selbstverständlich davon aus, dass der Machtkampf zwischen Staaten auch in Kreißsälen und Wochenbetten entschieden werden kann.
Außenpolitiker der Vereinigten Staaten, der einzigen Industrienation mit steigender Einwohnerzahl, verweisen gern auf ihre hohe fertility rate – wörtlich übersetzt: die Fruchtbarkeitsrate – und preisen die Jugendlichkeit ihrer Nation als Garant für Innovationskraft und Dynamik. Chinesen reden ganz selbstverständlich von Europa als „vergreisendem Kontinent“ – obwohl ihnen die eigene Politik der strengen Geburtenkontrolle vermutlich bald ähnliche Probleme schaffen wird. Israelis haben den Kinderreichtum der Palästinenser fest im Blick: Die palästinensischen Frauen bringen durchschnittlich 6 Kinder zur Welt, die israelischen Frauen kommen im Schnitt auf 2,9 Geburten. Erweisen sich die gängigen Bevölkerungsprognosen als korrekt, wird es in 50 Jahren mehr Palästinenser als Israelis geben.
In Deutschland würde womöglich der Streit über die Osterweiterung der Europäischen Union anders verlaufen, wenn demografische Argumente zählen würden. Nirgendwo ist der Geburtenrückgang so dramatisch wie in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Auf der Liste der Nationen mit den niedrigsten Geburtenraten werden die ersten zehn Plätze von osteuropäischen Ländern belegt. Estland, Bulgarien, die Ukraine, Russland und Lettland stehen an der Spitze. Osteuropa wird zum Altersheim der Welt, aus diesen Ländern werden die Pflegekräfte nicht kommen, die sich dereinst um die bettlägerigen deutschen Babyboomer kümmern sollen. Das muss kein Argument für oder wider einen Beitritt sein, doch ist es bemerkenswert, dass solche Gedanken nie laut werden.
„Keine Partei hat das Demografieproblem bisher wirklich zur Kenntnis genommen“, sagt auch Günter Krings, Chef der Jungen Gruppe der Union im Bundestag: „Wir rasen auf einen Abgrund zu, und um uns zu retten, suchen wir einen anderen Sender im Autoradio.“ Dabei kann man den Politikern nicht vorwerfen, das Altersthema völlig ignoriert zu haben. Bei den politischen Debatten über die Zuwanderung, die Renten- und Gesundheitspolitik oder auch die Sanierung der öffentlichen Haushalte klangen die Warnungen der Bevölkerungsexperten immer durch.
Doch schlagen sich diese Einsichten nicht in der politischen Praxis nieder. Deshalb hat der CDU-Abgeordnete Krings mit seiner pessimistischen Betrachtung Recht. Noch vor vier Jahren machte sich die SPD für eine „Rente ab 60“ stark – trotz aller Empfehlungen von Fachleuten, die Lebensarbeitszeit nicht zu verkürzen, sondern zu verlängern. Noch im Hartz-Konzept für die Reform des Arbeitsmarktes war ein „Brückengeld“ vorgesehen, das Älteren den vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben erleichtern sollte. Am selben Tag, an dem das Papier von der zuständigen Kommission beschlossen wurde, feierte der Erfinder Hartz seinen 61. Geburtstag und verkündete fröhlich: „Einen wie mich würde ich doch heute auch nicht mehr einstellen.“
Die Union kippte die Brückengeld-Idee schließlich in letzter Minute bei den Verhandlungen im Bundesrat. Das war ein seltener Verdienst – im Allgemeinen ringen sich auch CDU und CSU nicht zu besonders viel Ehrlichkeit in der Altersdebatte durch. Wer sich da vorwagt, bereut es schnell. So erging es dem stellvertretenden Fraktionschef Friedrich Merz, als er öffentlich für eine längere Lebensarbeitszeit plädierte. Die Aufregung war groß, von seinen Parteifreunden wurde ihm der Vorstoß als schwerer Fehler angekreidet. Merz relativierte seine Thesen prompt.
Das größte Versäumnis aber ist ein anderes: Keiner Partei, keinem Institut und keinem Autor ist es bisher gelungen, ein Bild der Gesellschaft von morgen zu entwerfen. In 20 Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Die Sozialsysteme werden dann bis aufs Äußerste strapaziert. Das ist seit vielen Jahren bekannt.
Aber wie wird sich das Lebensgefühl ändern, was heißt das alles für die Verteilungsdebatte, wie ändern sich Risikobereitschaft und Unternehmergeist, wenn plötzlich mehr als ein Drittel der Einwohner Deutschlands über 60 Jahre alt ist? Seit Jahren geben sich Experten ausgiebigen Debatten über die ideale Rentenformel für die Zeit nach 2010 hin. Eine Vorstellung der Welt von morgen entstand dabei nicht.
Dabei brauchen die Bundestagsabgeordneten für Inspirationen nicht einmal weit zu reisen. Weiße, bevölkerungsleere Flecken auf der deutschen Landkarte gibt es heute schon. Die Welt von morgen mit verwaisten Höfen und menschenleeren Dörfern beginnt kurz hinter der Stadtgrenze von Berlin. In fast allen ostdeutschen Kommunen sind die Einwohnerzahlen seit der deutschen Vereinigung dramatisch gesunken. 1,3 Millionen Wohnungen stehen in den neuen Bundesländern leer. In Städten wie Cottbus und Leipzig werden ganze Straßenzüge abgerissen. „Rückbau“ nennen Architekten und Städteplaner das beschönigend. Gemeint ist Abbau Ost.
In Zahlen liest sich die Bevölkerungsimplosion so: Rostock minus 18 Prozent, Magdeburg minus 16 Prozent, Cottbus minus 12 Prozent, Greifswald minus 17 Prozent. Momentan ist diese Entwicklung noch zu einem Drittel auf die ungünstige Altersstruktur zurückzuführen und zu zwei Dritteln auf Abwanderung. In wenigen Jahren schon wird es umgekehrt sein, weil sich vor allem die jungen, qualifizierten Ostdeutschen verabschieden, die Alten aber bleiben. Dann wird man sich erst recht an den Anblick von Geisterstädten gewöhnen, belebt allenfalls durch Wochenenddomizile wohlhabender Berliner oder das eine oder andere Pflegeheim.
In den Kleinstädten dürfte es mehr Geschäfte für Prothesen als für Kinderspielzeug geben. Gut möglich, dass dann die Ampelphasen etwas länger dauern und die Mittelstreifen etwas breiter sind, wie heute schon in einigen Seniorensiedlungen in Florida. Es wird viel Streit darüber geben, wie viel von der Infrastruktur an Krankenhäusern, Straßen, Busverbindungen oder Schulen noch beizubehalten ist. Das Büro für Zukunftsgestaltung in Essen untersucht gerade im Auftrag des Umweltbundesamtes, wie sich Verkehrspolitiker und Raumplaner heute schon auf den bevorstehenden demografischen Wandel einstellen könnten. „Eigentlich müssten zum Beispiel bei der Autobahnplanung demografische Prognosen eine Rolle spielen – schließlich ist die Infrastruktur ja für die kommenden 50 Jahre gedacht“, erklärt Projektleiterin Cornelia Daheim. Sicher ist auch, dass es den Osten nicht nur wegen der Arbeitsmarktmisere trifft. Eine Stadt wie Berlin wirkt zugleich auf viele junge Menschen wie ein Magnet. „Europa wird in Zukunft wieder sehr viel mehr Wälder haben als heute“, prognostiziert der Bonner Sozialforscher Meinhard Miegel. Dem Ruhrgebiet könnte das vielleicht sogar gut tun.
Klaus Wermker sieht indes noch wenig Grünes, wenn er aus dem Fenster schaut. Von seinem geräumigen Büro in der 14. Etage schaut er auf Hochhäuser, Straßen, eine Synagoge und viel morgenroten Himmel. Am Horizont einige Schlote, dahinter beginnt Duisburg. Viel dichter besiedelt kann eine Region kaum sein. Könnte man meinen.
„Der Eindruck täuscht“, sagt Wermker, der das Büro für Stadtentwicklung in der Essener Kommunalverwaltung leitet. „Für uns ist der Rückgang der Bevölkerung ein riesiges Problem.“ In der Zeit von 1962 bis 1999 sank die Zahl der Einwohner von Essen um 20,3 Prozent, teils durch Abwanderung, teils dadurch, dass mehr Menschen starben als geboren wurden. Das hat eine ganze Reihe unerwünschter Folgen: Steuereinnahmen und Kaufkraft fallen weg, die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt leidet, Infrastruktur wird nicht mehr gebraucht. Typisch ist nur der Streit, welcher Stadtteil zuerst auf sein Hallenbad verzichten muss.
Auf Wermkers Schreibtisch liegen Grafiken und Tabellen, die allesamt düstere Zukunftsaussichten illustrieren: Die Stadt rechnet damit, bis 2015 weitere 83000 Einwohner zu verlieren – fortan wegen der ungünstigen Altersstruktur. Man müsse jetzt „weiterer Überalterung entgegenwirken“, heißt es in einer Planungsvorlage der Stadt, „zentrale Zielgruppen sind größere Haushalte mit Kindern und jüngere Zwei-Personen-Haushalte in der Expansionsphase“. Obwohl die Stadt pleite ist, hat sie Prämien in Höhe von mehreren tausend Euro für junge Hauskäufer von außerhalb ausgesetzt.
In Essen ist der Süden alt und wohlhabend und der Norden arm und kinderreich. In den meisten Städten im Ruhrgebiet ist das so. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) warnte gerade vor einer wachsenden Kluft zwischen beiden Welten. „Altersaufbau und Einkommensniveau von Nachbarschaften werden immer einseitiger“, heißt es in einer Studie über das Ruhrgebiet. Früher sei der Stadtteil Hinweis auf die soziale Herkunft gewesen, heute teilten sich die Städte zunehmend auch nach Altersgruppen auf. Teilen des Reviers drohe die „Vergreisung“, heißt es.
Wermker wohnt im Ortsteil Baldeney im Süden. Dort kann man, wie er sagt, tatsächlich sehen, dass nicht nur Menschen, sondern ganze Viertel altern. Auch im Sommer spielen keine Kinder auf den Bürgersteigen; dafür stehen vor den Häusern die kleinen Autos von der ambulanten Pflege. Für die Fahrt in den nördlichen Stadtteil Katernberg hat Wermker sich Zeit genommen. Man fährt vorbei an alten, geschwärzten Zechensiedlungen, viele Geschäfte haben türkische Namen. Der Ausländeranteil liegt hier bei 39 Prozent, in der Kindertagesstätte, die Wermker ansteuert, sogar bei 80 Prozent. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein hat die Stadt in einem umgebauten Schalthaus mit alten Metallstreben und weißem Mauerwerk eine riesige Kita eingerichtet. Auf fast tausend Quadratmetern können sich die Kinder austoben.
Wermker, ein Sozialdemokrat, ist stolz auf die restaurierte Industriearchitektur. Er kann viel von der Mentalität des Ruhrgebiets erzählen, vom unterentwickelten Selbstbewusstsein der Region und davon, dass erst mit dem Hochschulbau der vergangenen 30 Jahre eine akademisch gebildete Mittelschicht entstanden ist.
Wer mit dem Stadtentwickler in Essen unterwegs ist, fragt sich zwangsläufig, wie lange diese Mittelschicht sich halten kann. Auch in Essen hat sie nur wenige Kinder. In den alten proletarischen Vierteln wächst derweil eine Generation heran, deren Chancen, in der Welt von morgen mitzuhalten, schlecht stehen. Eines von vier Kindern in Katernberg ist auf Sozialhilfe angewiesen, in ganz Essen eines von sechs. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der ausgerechnet die benachteiligten Familien den Nachwuchs aufziehen“, warnt der Bochumer Professor Klaus Peter Strohmeier, der ebenfalls die demografischen Probleme im Ruhrgebiet untersucht hat.
Nicht nur aus Essen kommen die Warnsignale, die auf Wohlstandseinbußen in der Altengesellschaft von morgen hindeuten. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel beispielsweise rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung Deutschlands um jährlich 0,4 bis 1,0 Prozent. Nicht nur die Bildungsmisere von heute wird morgen den Wohlstand schmälern. Vielen Anlegern ist immer noch nicht klar, dass der demografische Wandel neben der staatlichen Rente auch die verschiedensten Varianten privater Vorsorge trifft. Wenn die heutigen Babyboomer in Rente gehen, werden sie einen Teil ihrer Aktien und Immobilien verkaufen müssen, um ihren längeren Ruhestand zu finanzieren. Der Bevölkerungsschwund dürfte gerade dann dazu führen, dass es weniger Käufer gibt und die Preise fallen. Die eigene Wohnung, das eigene Haus eignet sich deshalb – von hervorragenden Lagen abgesehen – weniger als in den vorangegangenen Jahrzehnten zur Altersvorsorge.
Auch viele Hoffnungen auf große Erbschaften dürften sich als Illusionen erweisen. Die Generation der heute 60-Jährigen lebe und konsumiere anders als die Nachkriegsgeneration ihrer Eltern, warnte kürzlich die Deutsche Bank. Der Ruheständler von heute freue sich nach dem Arbeitsleben auf Auslandsreisen und teure Hobbys, die Ansprüche seien höher, Rücklagen würden früher aufgezehrt. Den Kindern werde deshalb weniger hinterlassen.
Und noch eine weitere Erwartung könnte sich als falsch erweisen: die gängige Annahme, dass die demografische Entwicklung automatisch Entlastung auf dem Arbeitsmarkt bringt. Zunächst scheint es zwar plausibel, dass sich die Lage entspannt, wenn weniger junge Menschen nach Stellen suchen. Nach dieser Logik dürfte es eigentlich heute kaum noch Jugendarbeitslosigkeit geben. Denn die Teenager von heute, geboren Mitte der achtziger Jahre, gehören längst zu den geburtenschwachen Jahrgängen.
Doch: „Die Rechnung geht nur mit flexibleren Arbeitsmärkten auf.“ So warnt Axel Börsch-Supan, Leiter des Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und Demographischer Wandel: „Sonst haben wir weiterhin vier Millionen Arbeitslose mit Qualifikationen, die nicht gebraucht werden, und obendrein offene Stellen, die ganz anderer Qualifikationen bedürfen.“
Der Verteilungskonflikt zwischen Arm und Reich wird mit Sicherheit nicht durch Interessengegensätze von Jungen und Alten überdeckt, wie häufig zu lesen ist. Im Gegenteil: Beides wird es geben, Verteilungskämpfe zwischen Arm und Reich und zwischen Jung und Alt – und sie werden härter ausgetragen als bisher. Gerade bei den Älteren sind Einkommen und Lebensstile heute so einheitlich wie nie. Altersarmut ist eine Ausnahmeerscheinung, hohe Vermögenseinkünfte allerdings auch – man lebt weitgehend von den Renten.
Das wird in Zukunft anders sein. Die Renten werden niedriger ausfallen – Verlierer sind dann die Langzeitarbeitslosen und die Langzeitstudenten von heute, auch die gering verdienenden Selbstständigen. Sie zahlen in die Rentenkassen kürzer ein und erwerben weniger Ansprüche. Privates Vermögen wird eine größere Rolle spielen. Die Gerechtigkeitsdebatten dürften heftiger geführt werden als bisher.
Viele Babyboomer reagieren auf die dramatische Entwicklung mit demonstrativem Selbstmitleid. Ein Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung, selber in den Sechzigern geboren, klagt: „Wir werden die Welt hässlich machen, wenn wir lebensgierige alte Säcke geworden sind“, und bangt: „Wer wird uns anlächeln, wenn wir achtzig sind?“ Vor allem Singles und kinderlose Paare erschreckt die Aussicht auf anonyme Massenabfertigung in überfüllten Pflegeheimen. Eine Sorge, die Meinhard Miegel angesichts der stark wachsenden Zahl für berechtigt hält: „Es wird eine hohe zivilisatorische Leistung sein, den heutigen Standard der Altenpflege aufrecht zu erhalten.“
Eine kleine Wohnsiedlung in Kölner Norden zeigt, dass es auch anders gehen könnte. 32 Parteien haben sich in der Wohnanlage Mobile eingerichtet – junge Familien, alleinerziehende Mütter und ungefähr ein Drittel alleinstehende Bewohner im Rentenalter. Viele wohnen zur Miete in preiswerten, aber hellen und modernen Sozialwohnungen, andere haben ihre Wohnungen gekauft. Die Innenstadt ist nah und gut durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen, die meisten Älteren haben deshalb ihre Autos abgeschafft.
Der ganze Wohnblock ist mit Rücksicht auf alte Menschen gebaut, mit breiten, rollstuhlgerechten Fahrstühlen und geräumigen Badezimmern. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, der gemietet werden kann und für gemeinsame Treffen offen steht, außerdem ein Stadtteilcafé.
Der Umgang miteinander lässt sich vielleicht mit dem einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft vergleichen. Man hilft einander aus – die Älteren hüten gelegentlich die Kinder von nebenan, die Jüngeren schleppen dafür schwere Einkaufstaschen oder bringen im Rentnerhaushalt Gardinenhaken an. Mehr als eine überdurchschnittliche Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit wird nicht verlangt. Das Ideal ist nicht die Großfamilie, sondern gute Nachbarschaft.
Einige der Älteren waren gemeinsam im Urlaub; etliche Bewohner stießen Silvester um Mitternacht auf der großen Dachterrasse gemeinsam an – alles ohne Zwang. „Wir brauchen nicht mal eine Hausordnung“, sagt Trude Unstrut stolz, eine Rentnerin, die sich darauf einstellt, den Rest ihres Lebens im Haus Mobile zu verbringen. Sie glaubt, die Chancen seien gut, mit der Kombination aus ambulanter Pflegehilfe und netten Nachbarn es hier lange aushalten zu können.
Das Interessanteste am Wohnprojekt in Köln-Weidenpesch ist dessen Normalität. Man braucht weder viel Geld noch Glück, noch Beziehungen oder gar Wohngemeinschaftserfahrungen, um mitzumachen. Was hier funktioniert, ginge überall gut – passende Häuser vorausgesetzt. Noch sind die meisten Wohnungen in Deutschland auf die Bedürfnisse der klassischen Kleinfamilie zugeschnitten, obwohl schon 1999 nur noch jeder dritte Haushalt ein Familienhaushalt mit zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind war.
Viele Kommunen interessieren sich für Wohnprojekte für Ältere. Sie müssen sparen. Alles, was die Kosten für professionelle Altenpflege verringert, ist in ihrem Sinn. Teure Pflegefälle werden mit Sozialhilfe bezahlt – und belasten daher die städtischen Etats.
In der Vergangenheit gingen die Kommunalpolitiker das Problem falsch an. Sie versprachen einfach nur hohe Geldprämien, damit alte Menschen ihre großen Wohnungen verließen – und wunderten sich dann über die geringe Resonanz. Dabei käme es darauf an, wie man für einen Umzug wirbt, schreibt die Darmstädter Schader-Stiftung in einem Bericht über Wohnprojekte für Ältere: Wer vor einer „Vergreisung“ der Viertel warne, habe keine Chance. Niemand lasse sich schließlich gern vertreiben. „Den meisten Bewohnern waren jenseits des Horrorbilds Altersheim kaum Wohnalternativen für das Alter bekannt“, schreibt die Stiftung. „Ein Umzug kam nur dann in Frage, wenn Gebrechen oder materielle Not dazu zwangen.“
Dabei gibt es heute schon über tausend selbst organisierte Wohnprojekte für Ältere in Deutschland: Bauernhöfe in der Eifel mit ökologischem Gemüseanbau, Frauenprojekte mit Titeln wie Altweibersommer oder auch komfortable Wohnanlagen für alternde Homosexuelle wie das Projekt Village im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Schlechte Chancen, das zeigen mehrere Untersuchungen, haben indes echte Rentner-Wohngemeinschaften mit gemeinsamer Nutzung von Bad und Küche. Jenseits der 60 stellt man sich nicht mehr so leicht aufeinander ein.
Keines dieser Projekte funktioniert ohne eine neue Haltung zum Alter, dem eigenen und dem der anderen. Vermutlich ist eine gewisse Aufrichtigkeit der Alten von morgen ohnehin das beste Rüstzeug für die künftige Greisenrepublik: statt Diskriminierung eine realistische Einschätzung dessen, was die Älteren können. Eine Bereitschaft zum Verzicht. Und schließlich die Einsicht, dass nicht nur die Rentner von heute den Jüngeren etwas zumuten, wie das aktuelle Geschrei vermuten lässt. Die Alten von morgen sind das Problem. Da empfiehlt es sich, heute die Tonart anzuschlagen, in der man selber in Zukunft angesprochen werden will.
DIE ZEIT 02/2003
Probier mal Borschtsch: ein Rote-Beete-Eintopf mit Weisskohl und zarten Rindfleichstreifen (bitte kein Knorpelzeug verwenden wie die Russen sondern Schulter oder besseres), verfeinert mit saurer Sahne und viiiel frischer gehackte Petersilie....passt ausgezeichnet zu einem kühlen Herbstabend.
Hallo macvin, na da bin ich mit Euch beiden ja wohl auf zwei Rußlandexperten gestoßen ?

Das mit dem Pilzgericht kann man sich ja mal überlegen, aber Rote-Beete-Eintopf ? Nee, bei aller Völkerfreundschaft ... - muß nicht sein...
Wenn schon Osteuropa, dann vielleicht tschechische Knödel oder polnische Piroggen ...
@ magor
...so gesehen ist es bei auf USD-basierenden Edelmetallkursen ausschließlich eine Kurssicherung des USD gegen den Euro, um durch die erwartete Entwertung des USD die Gewinne mit den Edelmetallen nicht (zum Teil) wieder abgeben zu müssen. Der Kursverlauf ist nämlich zumeist gegenläufig, so gehört eine parallele Absicherung der eingesetzten Summe m.E. zwangsläufig zu einer „Spekulation“ auf (in USD) steigende Edelmetallpreise
völlig klar, Magor, - wenn es zu einem Währungsschnitt kommt, sind alle unsere schönen Gewinne futsch. Deshalb decken sich ja auch weitsichtige Goldbugs schon jetzt – wo es noch geht – physisch ein. - Es ist ein riskantes Spiel – so oder so, denn die EZB wird nicht tatenlos zusehen, wenn Herr Bernanke die große Druckmaschine anwirft, Euro und Yen werden nicht über Nacht ihren Wert verdoppeln. Eher kracht JPM und das ganze System zusammen. Wenn sich diese Situation tatsächlich abzeichnet, werde ich aber kein Säckchen mit Krügerrand im Vorgarten verbuddeln, sondern die letzten Papierwerte zusammenkratzen und mir davon in der Uckermark ein altes Gehöft kaufen...
Aber jetzt lassen wir mal das traurige Thema ...
Du scheinst mir ein weitgereister Mensch zu sein, mehrjähriger Aufenthalt in Afrika, - jetzt auch noch Kasachstan –
das hört sich irgenwie nach Entwicklungshilfe und GTZ an...?
Eine Freundin von mir war mal als Entwicklungshelferin in Benin (Westküste Afrika) - Sie ist nach zwei Jahren völlig desillusioniert zurückgekommen und ihre ganzen idealistischen Träume von einer gerechteren Welt sind in dieser Zeit zerbrochen.
Wo wir hier schon beim "Schöngeistigen" sind, Magor, wohin zieht´s Dich denn hin,
wenn Du die Wahl hättest ? – Gibt´s irgend ein Fleckchen was Du empfehlen kannst ?
Ich denke da so an ein provencalisches Dorf, wo man friedlich in der Abendsonne ein Gläschen Rotwein genießen kann ...
Ein paar goldbugs hier schwören ja auf Südafrika ...

(Zum Verständnis: ich bin zur Zeit gerade beim Urlaubsprospekteblättern -
Motto: Hauptsache raus aus diesem regennassen Jammertal ...
 )
)In der engeren Wahl befindet sich Portugal und natürlich wieder mal ...

Korsika !!!
Beste Grüße Konradi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land ohne Leute - Die vergreiste Republik
Von Elisabeth Niejahr
Deutschland verliert jährlich 200000 Einwohner, da mehr Menschen sterben als geboren werden. Es wächst ein demografisches Problem ungeheuren Ausmaßes heran, doch die Politiker ignorieren es
Was der demografische Wandel für Deutschland bedeutet, lässt sich mit einem Radiergummi vorführen. Man stelle sich vor, auf einer Deutschlandkarte würde ein Ort nach dem anderen ausradiert: erst Lübeck, dann Magdeburg, schließlich Erfurt und Kassel. Ungefähr 200000 Einwohner müssten die Städte haben, denn so stark schrumpft nach Prognosen der Vereinten Nationen pro Jahr die Bevölkerung Deutschlands. Am Ende der kleinen Vorführung wäre das Jahr 2050 erreicht. Die Landkarte hätte 47 blanke Stellen. Wo Städte eingezeichnet waren, sind jetzt nur noch weiße Flecken übrig
Man kann das Spiel auch anders spielen. Dafür müsste man auf der Deutschlandkarte nichts ausradieren, sondern die Fläche vom Bodensee bis zur dänischen Grenze allmählich rot schraffieren. Rot bedeutet Stadtgebiet. Pro Jahr kämen bei diesem Experiment 3,4 Millionen Zuwanderer ins Land. Auch diese Zahl stammt von den Bevölkerungsexperten der UN: So viele Neuankömmlinge mittleren Alters wären nötig, damit trotz der rapiden Alterung der Alteingesessenen das Durchschnittsalter nicht steigt. Am Ende, im Jahr 2050, würden in Deutschland 300 Millionen Menschen leben. Es gäbe keine unbesiedelten Gebiete mehr. Die ganze Karte wäre rot.
Deutschland altert unaufhaltsam, und es altert schnell. So schnell, das zeigen die beiden Statistiken, dass sogar massive Zuwanderung oder ein neuer Geburtenboom diesen Prozess allenfalls leicht bremsen könnte. Die Szenarien mögen irreal, bizarr, weit hergeholt scheinen. Bei Langzeitprognosen ist grundsätzlich Skepsis angebracht. Doch in der Vergangenheit erwiesen sich die Vorhersagen der Vereinten Nationen als recht treffsicher. Einwohnerzahlen sind leichter zu prognostizieren als beispielsweise der Klimawandel. Die Alten von morgen sind schließlich heute schon auf der Welt.
Deutschland schrumpft und altert leise. Mit dem demografischen Wandel verhält es sich wie mit einem Kind. Seine Familie sieht es wachsen, aber das geschieht langsam und beständig, sodass es nicht auffällt. Es sind Außenstehende, Besucher, die sagen: „Mein Gott, ist der aber groß geworden!“ Wer den Wandel täglich erlebt, hält ihn für selbstverständlich. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Deutschen so merkwürdig desinteressiert sind an dem Prozess, der das Land in den kommenden Jahren radikal verändern wird. Man kann verstehen, dass Rainer Münz, Professor für Bevölkerungswissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, seinen Studenten vorhält, sie würden das Problem niedriger Geburtenraten wahrscheinlich erst im Rollstuhl erkennen – wenn niemand mehr da sei, um sie zu schieben.
Es gibt heutzutage nicht mehr viele Tabuthemen. Aber das Altern scheint eines zu sein. Nach dem Geburtsjahr von anderen wird nicht gefragt, bei den eigenen Daten wird gern geschummelt. Fast alle Rentner fühlen sich deutlich jünger, als sie sind. Das lässt sich als Zeichen von Vitalität und Lebensfreude deuten – oder als Zeichen kollektiven Realitätsverlusts. Alt sind immer nur die anderen. Jeder will alt werden, keiner will alt sein.
Wer Produkte oder Dienstleistungen für Ältere anbietet, kennt das Problem: Der Mittsechziger bucht eine Busreise ins Ausland, steigt in ein Fahrzeug voller Rentner und kommt sofort entsetzt wieder heraus, stöhnt: „Da sind ja nur alte Leute!“
Der Mittsiebziger engagiert sich für den Bau eines Seniorenwohnheims in der Nachbarschaft, ohne auch nur eine Sekunde daran zu denken, dass er selber dort einziehen könnte. Die Darmstädter Schader-Stiftung beschrieb diesen Hausbewohnertypus kürzlich in einer Studie über ein alterndes Frankfurter Wohnviertel und resümierte: „Der Glaube an die Fähigkeit, sein eigenes Leben selbstständig zu gestalten, wird oft bis zum Selbstbetrug aufrechterhalten.“ Das gilt für den Einzelnen, und es gilt für das ganze Land: Das Altern, das eigene und das der anderen, will niemand wahrhaben.
Beim Umgang von Alt und Jung stimmt etwas nicht in Deutschland, es läuft etwas falsch in den Personalabteilungen, in den Kreditinstituten, an den Universitäten, in der Politik. Wie soll man es auch verstehen, dass der 76-jährige Alan Greenspan zwar als amerikanischer Notenbankchef die internationalen Finanzströme lenken darf, aber bei einer deutschen Bank wegen seines fortgeschrittenen Alters keinen Kredit bekommen würde? Bei vielen Banken gibt es eine strikte Altersgrenze von 70 oder 68. Wer älter ist, wird abgelehnt.
Wie soll man begreifen, dass angesehene Wissenschaftler in die Vereinigten Staaten auswandern müssen, wenn sie auch jenseits der Pensionsgrenze weiter forschen und lehren wollen? Gerade erst verabschiedete sich der 65-jährige Kölner Genforscher Klaus Rajwsky nach Amerika. Ganz ohne Altersgrenzen für den Ruhestand geht es zwar nicht, aber wenn selbst Spitzenkräfte ohne Wenn und Aber vertrieben werden, ist das System fehlerhaft.
Und wie soll es einleuchten, dass Innenminister Otto Schily zwar als 70-Jähriger eines der wichtigsten Ressorts der rot-grünen Regierung leiten kann, dass ebendiese Regierung aber 58-jährige Arbeitslose nicht mehr in ihren Statistiken vermerkt? Es handelt sich um Zehntausende: Eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab, dass in kaum einem Industrieland so wenige Menschen über 55 beschäftigt sind. Nur jeder dritte Mann zwischen 60 und 64 in Deutschland ist noch berufstätig, in den Vereinigten Staaten jeder zweite.
In den meisten anderen Industrieländern gibt es Gesetze gegen solche bizarren Regeln (siehe Kasten S. 10). In Deutschland findet eine Kölner Initiative, das Büro gegen Altersdiskriminierung, nicht einmal bei den Gewerkschaften wirklich Unterstützung. „Vermutlich liegt das daran, dass sie so lange selbst an Vorruhestandsmodellen mitgebastelt haben“, sagt Hanne Schweitzer, eine der Initiatorinnen.
Vermutlich kommt für uns noch das spezifisch deutsche Problem hinzu: Wer ein Wort wie „Bevölkerungspolitik“ überhaupt in den Mund nimmt, muss sehr genau überlegen, was er sagt – eine Folge des Rassenwahns der Nazis. Das führt dazu, dass Demografie-Argumente in den Diskussionen der Außenpolitiker keine Rolle spielen. Andere Nationen gehen wie selbstverständlich davon aus, dass der Machtkampf zwischen Staaten auch in Kreißsälen und Wochenbetten entschieden werden kann.
Außenpolitiker der Vereinigten Staaten, der einzigen Industrienation mit steigender Einwohnerzahl, verweisen gern auf ihre hohe fertility rate – wörtlich übersetzt: die Fruchtbarkeitsrate – und preisen die Jugendlichkeit ihrer Nation als Garant für Innovationskraft und Dynamik. Chinesen reden ganz selbstverständlich von Europa als „vergreisendem Kontinent“ – obwohl ihnen die eigene Politik der strengen Geburtenkontrolle vermutlich bald ähnliche Probleme schaffen wird. Israelis haben den Kinderreichtum der Palästinenser fest im Blick: Die palästinensischen Frauen bringen durchschnittlich 6 Kinder zur Welt, die israelischen Frauen kommen im Schnitt auf 2,9 Geburten. Erweisen sich die gängigen Bevölkerungsprognosen als korrekt, wird es in 50 Jahren mehr Palästinenser als Israelis geben.
In Deutschland würde womöglich der Streit über die Osterweiterung der Europäischen Union anders verlaufen, wenn demografische Argumente zählen würden. Nirgendwo ist der Geburtenrückgang so dramatisch wie in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Auf der Liste der Nationen mit den niedrigsten Geburtenraten werden die ersten zehn Plätze von osteuropäischen Ländern belegt. Estland, Bulgarien, die Ukraine, Russland und Lettland stehen an der Spitze. Osteuropa wird zum Altersheim der Welt, aus diesen Ländern werden die Pflegekräfte nicht kommen, die sich dereinst um die bettlägerigen deutschen Babyboomer kümmern sollen. Das muss kein Argument für oder wider einen Beitritt sein, doch ist es bemerkenswert, dass solche Gedanken nie laut werden.
„Keine Partei hat das Demografieproblem bisher wirklich zur Kenntnis genommen“, sagt auch Günter Krings, Chef der Jungen Gruppe der Union im Bundestag: „Wir rasen auf einen Abgrund zu, und um uns zu retten, suchen wir einen anderen Sender im Autoradio.“ Dabei kann man den Politikern nicht vorwerfen, das Altersthema völlig ignoriert zu haben. Bei den politischen Debatten über die Zuwanderung, die Renten- und Gesundheitspolitik oder auch die Sanierung der öffentlichen Haushalte klangen die Warnungen der Bevölkerungsexperten immer durch.
Doch schlagen sich diese Einsichten nicht in der politischen Praxis nieder. Deshalb hat der CDU-Abgeordnete Krings mit seiner pessimistischen Betrachtung Recht. Noch vor vier Jahren machte sich die SPD für eine „Rente ab 60“ stark – trotz aller Empfehlungen von Fachleuten, die Lebensarbeitszeit nicht zu verkürzen, sondern zu verlängern. Noch im Hartz-Konzept für die Reform des Arbeitsmarktes war ein „Brückengeld“ vorgesehen, das Älteren den vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben erleichtern sollte. Am selben Tag, an dem das Papier von der zuständigen Kommission beschlossen wurde, feierte der Erfinder Hartz seinen 61. Geburtstag und verkündete fröhlich: „Einen wie mich würde ich doch heute auch nicht mehr einstellen.“
Die Union kippte die Brückengeld-Idee schließlich in letzter Minute bei den Verhandlungen im Bundesrat. Das war ein seltener Verdienst – im Allgemeinen ringen sich auch CDU und CSU nicht zu besonders viel Ehrlichkeit in der Altersdebatte durch. Wer sich da vorwagt, bereut es schnell. So erging es dem stellvertretenden Fraktionschef Friedrich Merz, als er öffentlich für eine längere Lebensarbeitszeit plädierte. Die Aufregung war groß, von seinen Parteifreunden wurde ihm der Vorstoß als schwerer Fehler angekreidet. Merz relativierte seine Thesen prompt.
Das größte Versäumnis aber ist ein anderes: Keiner Partei, keinem Institut und keinem Autor ist es bisher gelungen, ein Bild der Gesellschaft von morgen zu entwerfen. In 20 Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Die Sozialsysteme werden dann bis aufs Äußerste strapaziert. Das ist seit vielen Jahren bekannt.
Aber wie wird sich das Lebensgefühl ändern, was heißt das alles für die Verteilungsdebatte, wie ändern sich Risikobereitschaft und Unternehmergeist, wenn plötzlich mehr als ein Drittel der Einwohner Deutschlands über 60 Jahre alt ist? Seit Jahren geben sich Experten ausgiebigen Debatten über die ideale Rentenformel für die Zeit nach 2010 hin. Eine Vorstellung der Welt von morgen entstand dabei nicht.
Dabei brauchen die Bundestagsabgeordneten für Inspirationen nicht einmal weit zu reisen. Weiße, bevölkerungsleere Flecken auf der deutschen Landkarte gibt es heute schon. Die Welt von morgen mit verwaisten Höfen und menschenleeren Dörfern beginnt kurz hinter der Stadtgrenze von Berlin. In fast allen ostdeutschen Kommunen sind die Einwohnerzahlen seit der deutschen Vereinigung dramatisch gesunken. 1,3 Millionen Wohnungen stehen in den neuen Bundesländern leer. In Städten wie Cottbus und Leipzig werden ganze Straßenzüge abgerissen. „Rückbau“ nennen Architekten und Städteplaner das beschönigend. Gemeint ist Abbau Ost.
In Zahlen liest sich die Bevölkerungsimplosion so: Rostock minus 18 Prozent, Magdeburg minus 16 Prozent, Cottbus minus 12 Prozent, Greifswald minus 17 Prozent. Momentan ist diese Entwicklung noch zu einem Drittel auf die ungünstige Altersstruktur zurückzuführen und zu zwei Dritteln auf Abwanderung. In wenigen Jahren schon wird es umgekehrt sein, weil sich vor allem die jungen, qualifizierten Ostdeutschen verabschieden, die Alten aber bleiben. Dann wird man sich erst recht an den Anblick von Geisterstädten gewöhnen, belebt allenfalls durch Wochenenddomizile wohlhabender Berliner oder das eine oder andere Pflegeheim.
In den Kleinstädten dürfte es mehr Geschäfte für Prothesen als für Kinderspielzeug geben. Gut möglich, dass dann die Ampelphasen etwas länger dauern und die Mittelstreifen etwas breiter sind, wie heute schon in einigen Seniorensiedlungen in Florida. Es wird viel Streit darüber geben, wie viel von der Infrastruktur an Krankenhäusern, Straßen, Busverbindungen oder Schulen noch beizubehalten ist. Das Büro für Zukunftsgestaltung in Essen untersucht gerade im Auftrag des Umweltbundesamtes, wie sich Verkehrspolitiker und Raumplaner heute schon auf den bevorstehenden demografischen Wandel einstellen könnten. „Eigentlich müssten zum Beispiel bei der Autobahnplanung demografische Prognosen eine Rolle spielen – schließlich ist die Infrastruktur ja für die kommenden 50 Jahre gedacht“, erklärt Projektleiterin Cornelia Daheim. Sicher ist auch, dass es den Osten nicht nur wegen der Arbeitsmarktmisere trifft. Eine Stadt wie Berlin wirkt zugleich auf viele junge Menschen wie ein Magnet. „Europa wird in Zukunft wieder sehr viel mehr Wälder haben als heute“, prognostiziert der Bonner Sozialforscher Meinhard Miegel. Dem Ruhrgebiet könnte das vielleicht sogar gut tun.
Klaus Wermker sieht indes noch wenig Grünes, wenn er aus dem Fenster schaut. Von seinem geräumigen Büro in der 14. Etage schaut er auf Hochhäuser, Straßen, eine Synagoge und viel morgenroten Himmel. Am Horizont einige Schlote, dahinter beginnt Duisburg. Viel dichter besiedelt kann eine Region kaum sein. Könnte man meinen.
„Der Eindruck täuscht“, sagt Wermker, der das Büro für Stadtentwicklung in der Essener Kommunalverwaltung leitet. „Für uns ist der Rückgang der Bevölkerung ein riesiges Problem.“ In der Zeit von 1962 bis 1999 sank die Zahl der Einwohner von Essen um 20,3 Prozent, teils durch Abwanderung, teils dadurch, dass mehr Menschen starben als geboren wurden. Das hat eine ganze Reihe unerwünschter Folgen: Steuereinnahmen und Kaufkraft fallen weg, die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt leidet, Infrastruktur wird nicht mehr gebraucht. Typisch ist nur der Streit, welcher Stadtteil zuerst auf sein Hallenbad verzichten muss.
Auf Wermkers Schreibtisch liegen Grafiken und Tabellen, die allesamt düstere Zukunftsaussichten illustrieren: Die Stadt rechnet damit, bis 2015 weitere 83000 Einwohner zu verlieren – fortan wegen der ungünstigen Altersstruktur. Man müsse jetzt „weiterer Überalterung entgegenwirken“, heißt es in einer Planungsvorlage der Stadt, „zentrale Zielgruppen sind größere Haushalte mit Kindern und jüngere Zwei-Personen-Haushalte in der Expansionsphase“. Obwohl die Stadt pleite ist, hat sie Prämien in Höhe von mehreren tausend Euro für junge Hauskäufer von außerhalb ausgesetzt.
In Essen ist der Süden alt und wohlhabend und der Norden arm und kinderreich. In den meisten Städten im Ruhrgebiet ist das so. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) warnte gerade vor einer wachsenden Kluft zwischen beiden Welten. „Altersaufbau und Einkommensniveau von Nachbarschaften werden immer einseitiger“, heißt es in einer Studie über das Ruhrgebiet. Früher sei der Stadtteil Hinweis auf die soziale Herkunft gewesen, heute teilten sich die Städte zunehmend auch nach Altersgruppen auf. Teilen des Reviers drohe die „Vergreisung“, heißt es.
Wermker wohnt im Ortsteil Baldeney im Süden. Dort kann man, wie er sagt, tatsächlich sehen, dass nicht nur Menschen, sondern ganze Viertel altern. Auch im Sommer spielen keine Kinder auf den Bürgersteigen; dafür stehen vor den Häusern die kleinen Autos von der ambulanten Pflege. Für die Fahrt in den nördlichen Stadtteil Katernberg hat Wermker sich Zeit genommen. Man fährt vorbei an alten, geschwärzten Zechensiedlungen, viele Geschäfte haben türkische Namen. Der Ausländeranteil liegt hier bei 39 Prozent, in der Kindertagesstätte, die Wermker ansteuert, sogar bei 80 Prozent. Auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein hat die Stadt in einem umgebauten Schalthaus mit alten Metallstreben und weißem Mauerwerk eine riesige Kita eingerichtet. Auf fast tausend Quadratmetern können sich die Kinder austoben.
Wermker, ein Sozialdemokrat, ist stolz auf die restaurierte Industriearchitektur. Er kann viel von der Mentalität des Ruhrgebiets erzählen, vom unterentwickelten Selbstbewusstsein der Region und davon, dass erst mit dem Hochschulbau der vergangenen 30 Jahre eine akademisch gebildete Mittelschicht entstanden ist.
Wer mit dem Stadtentwickler in Essen unterwegs ist, fragt sich zwangsläufig, wie lange diese Mittelschicht sich halten kann. Auch in Essen hat sie nur wenige Kinder. In den alten proletarischen Vierteln wächst derweil eine Generation heran, deren Chancen, in der Welt von morgen mitzuhalten, schlecht stehen. Eines von vier Kindern in Katernberg ist auf Sozialhilfe angewiesen, in ganz Essen eines von sechs. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der ausgerechnet die benachteiligten Familien den Nachwuchs aufziehen“, warnt der Bochumer Professor Klaus Peter Strohmeier, der ebenfalls die demografischen Probleme im Ruhrgebiet untersucht hat.
Nicht nur aus Essen kommen die Warnsignale, die auf Wohlstandseinbußen in der Altengesellschaft von morgen hindeuten. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel beispielsweise rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung Deutschlands um jährlich 0,4 bis 1,0 Prozent. Nicht nur die Bildungsmisere von heute wird morgen den Wohlstand schmälern. Vielen Anlegern ist immer noch nicht klar, dass der demografische Wandel neben der staatlichen Rente auch die verschiedensten Varianten privater Vorsorge trifft. Wenn die heutigen Babyboomer in Rente gehen, werden sie einen Teil ihrer Aktien und Immobilien verkaufen müssen, um ihren längeren Ruhestand zu finanzieren. Der Bevölkerungsschwund dürfte gerade dann dazu führen, dass es weniger Käufer gibt und die Preise fallen. Die eigene Wohnung, das eigene Haus eignet sich deshalb – von hervorragenden Lagen abgesehen – weniger als in den vorangegangenen Jahrzehnten zur Altersvorsorge.
Auch viele Hoffnungen auf große Erbschaften dürften sich als Illusionen erweisen. Die Generation der heute 60-Jährigen lebe und konsumiere anders als die Nachkriegsgeneration ihrer Eltern, warnte kürzlich die Deutsche Bank. Der Ruheständler von heute freue sich nach dem Arbeitsleben auf Auslandsreisen und teure Hobbys, die Ansprüche seien höher, Rücklagen würden früher aufgezehrt. Den Kindern werde deshalb weniger hinterlassen.
Und noch eine weitere Erwartung könnte sich als falsch erweisen: die gängige Annahme, dass die demografische Entwicklung automatisch Entlastung auf dem Arbeitsmarkt bringt. Zunächst scheint es zwar plausibel, dass sich die Lage entspannt, wenn weniger junge Menschen nach Stellen suchen. Nach dieser Logik dürfte es eigentlich heute kaum noch Jugendarbeitslosigkeit geben. Denn die Teenager von heute, geboren Mitte der achtziger Jahre, gehören längst zu den geburtenschwachen Jahrgängen.
Doch: „Die Rechnung geht nur mit flexibleren Arbeitsmärkten auf.“ So warnt Axel Börsch-Supan, Leiter des Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und Demographischer Wandel: „Sonst haben wir weiterhin vier Millionen Arbeitslose mit Qualifikationen, die nicht gebraucht werden, und obendrein offene Stellen, die ganz anderer Qualifikationen bedürfen.“
Der Verteilungskonflikt zwischen Arm und Reich wird mit Sicherheit nicht durch Interessengegensätze von Jungen und Alten überdeckt, wie häufig zu lesen ist. Im Gegenteil: Beides wird es geben, Verteilungskämpfe zwischen Arm und Reich und zwischen Jung und Alt – und sie werden härter ausgetragen als bisher. Gerade bei den Älteren sind Einkommen und Lebensstile heute so einheitlich wie nie. Altersarmut ist eine Ausnahmeerscheinung, hohe Vermögenseinkünfte allerdings auch – man lebt weitgehend von den Renten.
Das wird in Zukunft anders sein. Die Renten werden niedriger ausfallen – Verlierer sind dann die Langzeitarbeitslosen und die Langzeitstudenten von heute, auch die gering verdienenden Selbstständigen. Sie zahlen in die Rentenkassen kürzer ein und erwerben weniger Ansprüche. Privates Vermögen wird eine größere Rolle spielen. Die Gerechtigkeitsdebatten dürften heftiger geführt werden als bisher.
Viele Babyboomer reagieren auf die dramatische Entwicklung mit demonstrativem Selbstmitleid. Ein Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung, selber in den Sechzigern geboren, klagt: „Wir werden die Welt hässlich machen, wenn wir lebensgierige alte Säcke geworden sind“, und bangt: „Wer wird uns anlächeln, wenn wir achtzig sind?“ Vor allem Singles und kinderlose Paare erschreckt die Aussicht auf anonyme Massenabfertigung in überfüllten Pflegeheimen. Eine Sorge, die Meinhard Miegel angesichts der stark wachsenden Zahl für berechtigt hält: „Es wird eine hohe zivilisatorische Leistung sein, den heutigen Standard der Altenpflege aufrecht zu erhalten.“
Eine kleine Wohnsiedlung in Kölner Norden zeigt, dass es auch anders gehen könnte. 32 Parteien haben sich in der Wohnanlage Mobile eingerichtet – junge Familien, alleinerziehende Mütter und ungefähr ein Drittel alleinstehende Bewohner im Rentenalter. Viele wohnen zur Miete in preiswerten, aber hellen und modernen Sozialwohnungen, andere haben ihre Wohnungen gekauft. Die Innenstadt ist nah und gut durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen, die meisten Älteren haben deshalb ihre Autos abgeschafft.
Der ganze Wohnblock ist mit Rücksicht auf alte Menschen gebaut, mit breiten, rollstuhlgerechten Fahrstühlen und geräumigen Badezimmern. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, der gemietet werden kann und für gemeinsame Treffen offen steht, außerdem ein Stadtteilcafé.
Der Umgang miteinander lässt sich vielleicht mit dem einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft vergleichen. Man hilft einander aus – die Älteren hüten gelegentlich die Kinder von nebenan, die Jüngeren schleppen dafür schwere Einkaufstaschen oder bringen im Rentnerhaushalt Gardinenhaken an. Mehr als eine überdurchschnittliche Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit wird nicht verlangt. Das Ideal ist nicht die Großfamilie, sondern gute Nachbarschaft.
Einige der Älteren waren gemeinsam im Urlaub; etliche Bewohner stießen Silvester um Mitternacht auf der großen Dachterrasse gemeinsam an – alles ohne Zwang. „Wir brauchen nicht mal eine Hausordnung“, sagt Trude Unstrut stolz, eine Rentnerin, die sich darauf einstellt, den Rest ihres Lebens im Haus Mobile zu verbringen. Sie glaubt, die Chancen seien gut, mit der Kombination aus ambulanter Pflegehilfe und netten Nachbarn es hier lange aushalten zu können.
Das Interessanteste am Wohnprojekt in Köln-Weidenpesch ist dessen Normalität. Man braucht weder viel Geld noch Glück, noch Beziehungen oder gar Wohngemeinschaftserfahrungen, um mitzumachen. Was hier funktioniert, ginge überall gut – passende Häuser vorausgesetzt. Noch sind die meisten Wohnungen in Deutschland auf die Bedürfnisse der klassischen Kleinfamilie zugeschnitten, obwohl schon 1999 nur noch jeder dritte Haushalt ein Familienhaushalt mit zwei Erwachsenen und mindestens einem Kind war.
Viele Kommunen interessieren sich für Wohnprojekte für Ältere. Sie müssen sparen. Alles, was die Kosten für professionelle Altenpflege verringert, ist in ihrem Sinn. Teure Pflegefälle werden mit Sozialhilfe bezahlt – und belasten daher die städtischen Etats.
In der Vergangenheit gingen die Kommunalpolitiker das Problem falsch an. Sie versprachen einfach nur hohe Geldprämien, damit alte Menschen ihre großen Wohnungen verließen – und wunderten sich dann über die geringe Resonanz. Dabei käme es darauf an, wie man für einen Umzug wirbt, schreibt die Darmstädter Schader-Stiftung in einem Bericht über Wohnprojekte für Ältere: Wer vor einer „Vergreisung“ der Viertel warne, habe keine Chance. Niemand lasse sich schließlich gern vertreiben. „Den meisten Bewohnern waren jenseits des Horrorbilds Altersheim kaum Wohnalternativen für das Alter bekannt“, schreibt die Stiftung. „Ein Umzug kam nur dann in Frage, wenn Gebrechen oder materielle Not dazu zwangen.“
Dabei gibt es heute schon über tausend selbst organisierte Wohnprojekte für Ältere in Deutschland: Bauernhöfe in der Eifel mit ökologischem Gemüseanbau, Frauenprojekte mit Titeln wie Altweibersommer oder auch komfortable Wohnanlagen für alternde Homosexuelle wie das Projekt Village im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Schlechte Chancen, das zeigen mehrere Untersuchungen, haben indes echte Rentner-Wohngemeinschaften mit gemeinsamer Nutzung von Bad und Küche. Jenseits der 60 stellt man sich nicht mehr so leicht aufeinander ein.
Keines dieser Projekte funktioniert ohne eine neue Haltung zum Alter, dem eigenen und dem der anderen. Vermutlich ist eine gewisse Aufrichtigkeit der Alten von morgen ohnehin das beste Rüstzeug für die künftige Greisenrepublik: statt Diskriminierung eine realistische Einschätzung dessen, was die Älteren können. Eine Bereitschaft zum Verzicht. Und schließlich die Einsicht, dass nicht nur die Rentner von heute den Jüngeren etwas zumuten, wie das aktuelle Geschrei vermuten lässt. Die Alten von morgen sind das Problem. Da empfiehlt es sich, heute die Tonart anzuschlagen, in der man selber in Zukunft angesprochen werden will.
DIE ZEIT 02/2003
@konradi
Ich mach`s kurz: Borschtsch - einfach probieren, schlimmer als Labskaus kann`s nicht sein...
GTZ hattest du bei magor vermutet - auf mich trifft das zumindest zu...
Nun, ob JPM zusammenbricht, da hab ich noch so meine Zweifel...dass ein längerfristiger Dollarverfall eintritt, ist sehr viel wahrscheinlicher. Ich habe den Dollar schon bei 3.50 DM gesehen aber auch bei 1.35 DM. und Ende der 70er Jahre war ein erstes signifikantes Tief bei ca. 1.80, das mit einem Goldpreis von 880$ korrelierte...
Ich wollte den Dollar schon immer bei 1 DM sehen - sprich EURUSD 2.00. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ob es on the long run unrealistisch ist????
Falls du Dich für Portugal entscheidest (schön an Ostern) vergiss nicht frisches Zicklein (Geiss )zu probieren. Leider nicht in jedem Restaurant verfügbar...also vorbestellen.
)zu probieren. Leider nicht in jedem Restaurant verfügbar...also vorbestellen.
@magor
über russsische/östliche Trinkerlebnisse gäbe es viel zu berichten...vielleicht später einmal
Cu
macvin
Ich mach`s kurz: Borschtsch - einfach probieren, schlimmer als Labskaus kann`s nicht sein...

GTZ hattest du bei magor vermutet - auf mich trifft das zumindest zu...

Nun, ob JPM zusammenbricht, da hab ich noch so meine Zweifel...dass ein längerfristiger Dollarverfall eintritt, ist sehr viel wahrscheinlicher. Ich habe den Dollar schon bei 3.50 DM gesehen aber auch bei 1.35 DM. und Ende der 70er Jahre war ein erstes signifikantes Tief bei ca. 1.80, das mit einem Goldpreis von 880$ korrelierte...
Ich wollte den Dollar schon immer bei 1 DM sehen - sprich EURUSD 2.00. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ob es on the long run unrealistisch ist????
Falls du Dich für Portugal entscheidest (schön an Ostern) vergiss nicht frisches Zicklein (Geiss
 )zu probieren. Leider nicht in jedem Restaurant verfügbar...also vorbestellen.
)zu probieren. Leider nicht in jedem Restaurant verfügbar...also vorbestellen.@magor
über russsische/östliche Trinkerlebnisse gäbe es viel zu berichten...vielleicht später einmal

Cu
macvin
@konradi
"Zum Verständnis: ich bin zur Zeit gerade beim Urlaubsprospekteblättern -
Motto: Hauptsache raus aus diesem regennassen Jammertal ..."
Negativ! Urlaub gibt`s dieses Jahr nicht! Kratz lieber das Urlaubsgeld zusammen und kauf Dir ein paar Goldaktien. Und wenn Du Sonne brauchst: "Erwärm Dich am sonnigen Glanz einer Goldunze." Du mußt schon Prioritäten setzen, wenn`s zum hauptberuflichen Goldbug reichen soll.
"Sie ist nach zwei Jahren völlig desillusioniert zurückgekommen und ihre ganzen idealistischen Träume von einer gerechteren Welt sind in dieser Zeit zerbrochen."
Hört sich interessant an. Sag ihr: "Willkommen in der Realität." Ich hoffe, der Schock war nicht zu groß für sie...LOL. Sag ihr: "Wenn man keine Ideale hat, können auch keine zerbrechen."
Ich hoffe, der Schock war nicht zu groß für sie...LOL. Sag ihr: "Wenn man keine Ideale hat, können auch keine zerbrechen."
Gruß
Sovereign
"Zum Verständnis: ich bin zur Zeit gerade beim Urlaubsprospekteblättern -
Motto: Hauptsache raus aus diesem regennassen Jammertal ..."
Negativ! Urlaub gibt`s dieses Jahr nicht! Kratz lieber das Urlaubsgeld zusammen und kauf Dir ein paar Goldaktien. Und wenn Du Sonne brauchst: "Erwärm Dich am sonnigen Glanz einer Goldunze." Du mußt schon Prioritäten setzen, wenn`s zum hauptberuflichen Goldbug reichen soll.

"Sie ist nach zwei Jahren völlig desillusioniert zurückgekommen und ihre ganzen idealistischen Träume von einer gerechteren Welt sind in dieser Zeit zerbrochen."
Hört sich interessant an. Sag ihr: "Willkommen in der Realität."
 Ich hoffe, der Schock war nicht zu groß für sie...LOL. Sag ihr: "Wenn man keine Ideale hat, können auch keine zerbrechen."
Ich hoffe, der Schock war nicht zu groß für sie...LOL. Sag ihr: "Wenn man keine Ideale hat, können auch keine zerbrechen."Gruß
Sovereign
So macht man aus einem Gold-Thread einen Thread für Gaumenkitzel und Austausch von Reise- und Saufgeschichten …
Katastrophe, Katastrophe …
Eur/USD bei 2.00? Absolut nicht unrealistisch und vielleicht auch nicht ungewollt in naher Zukunft. An die Zeiten mit ehemals 1.35 DM für den USD habe ich gute Erinnerungen, muß so ´82 gewesen sein, herrlich günstigen USA / Mexiko-Urlaub verlebt, und dank dieser Situation und der Hochzinsphase von bis zu 15% im USD noch richtig Asche gemacht! Gegen die DM abgesichert natürlich!
„… die letzten Papierwerte zusammenkratzen und mir davon in der Uckermark ein altes Gehöft kaufen...“ mit dererlei Vorgehen hatten nur sehr wenige Glück gehabt bei einer Währungsreform, die wurden zum Ausgleich mit einer Zwangshypothek belastet …
Also, Das Säcklein mit den Goldmünzen, erscheint mir da werterhaltender …
Als Russlandexperten kann ich mich nicht bezeichnen, meine Aufenthalte im eigentlichen Russland beschränken sich auf Zwischenlandungen und kurze Reiseunterbrechungen bis zum Weiterflug. So kenne ich Russland eher aus der Vogelperspektive, aus dem Flieger betrachtet. Die russische Mentalität, die habe ich allerdings ausgiebig kennenlernen dürfen, u.A. im von denen mit Gewalt bis zur Unkenntlichkeit verrussischten und ausgebeutetem Kasachstan.
Nein, mit GTZ habe ich nichts zu tun, und mit Entwicklungshilfe nur im entferntesten Sinne … Ich beackere einen fachbezogenen Part im weiten Feld des Großanlagenbaus. Und die Kundschaft ist im seltensten Falle in Deutschland.
Die Desillusionierung Deiner Freundin kann ich bestens nachempfinden, als einer, der als junger, seinerzeit vielleicht auch zu naiver Mensch mit völlig unvorbelasteter Einstellung zu den Problemen zwischen Schwarz und Weiß, aber auch den Problemen zwischen Schwarz und Schwarz in Entsendung meiner Firma nach Nigeria gegangen bin. Dieser, meinerseits etwas skeptisch angegangene Schritt hatte aber auch neben der Bereicherung mit den vielfältigsten Erfahrungen auch noch so einiges, für mich recht Positives zur Folge. Einmal sich bei solchen Einsätzen im Beruf bewährt, das klebt in den Papieren und spricht sich herum. So wirst Du immer wieder die Gelegenheit bekommen entsandt zu werden, was im Umkehrschluss allerdings im Angestelltenverhältnis nur schlecht zurückweisbar ist (entweder, Du gehst, oder Du gehst … ). So bin ich tatsächlich sehr viel und auch sehr gerne rumgekommen, und kenne viele Ecken unserer Erde nicht nur aus touristischen Gesichtspunkten. Heute, familiär etwas behinderter in der Bereitwilligkeit zu längerfristigen Einsätzen, habe ich weitestgehend die Möglichkeit, meine eigenen Einsätze vor Ort auf wenige Wochen oder Monate zu limitieren und, ausser, wenn´s „brennt“, die Fäden eher von Deutschland aus zusammenzuhalten.
Wo es mich hinzieht … ? Wenn ich unterwegs bin, immer wieder nachhause … das, je weiter ich weg bin und je länger, als umso schöner erscheint! Vielleicht weisst Du, wie sehr man das bei längerer Abwesendheit zu schätzen lernt. Ab dem 4. Jahr trällert man sogar heimische Lieder … : - )) dann ist es allerdings meist an der Zeit heimgehen zu müssen ….
Das ist allerdings nicht, was Du mich fragen wolltest. Entscheidend ist sicherlich, was man sucht, die Wüste oder die Großstadt, pulsierendes Leben oder eher Ruhe …und alles ist auch mit gewissen Abstrichen/Kompromissen zu betrachten, eigentlich genauso wie das Zuhause, das im seltensten Falle am schönsten Fleck der Erde liegt.
Als eines der schönsten Städte, die ich kenne, finde ich Sydney, wennauch der puritanisch-britische Umgang der Behörden mit der Bevölkerung dort mir etwas missfällt. Sehr schön und (noch!) bezahlbar ist Shanghai nebst Umfeld aber z.B. auch das Moloch Bangkok, wobei Letzteres mit einem Besichtigungs- und Badeaufenthalt auf und um die Insel Phuket unbedingt verbunden werden müsste (Thai könnte Dir da bestimmt gute Tips geben). Auf Europa beschränkt finde ich je nach Jahreszeit die Städte Rom, Budapest, Barcelona, Venedig und Genua aber auch München und Heidelberg sehr besuchenswert. Straßburg und der Elsaß ist auch eine Reise Wert, allerdings sind die Preise dort, ähnlich Venedig und Rom arg abgehoben.
Das in Deine engere Wahl gezogene Portugal finde ich als eine lohnenswerte Idee. Die Algarve ist wunderschön, und gerade im Frühjahr auch wettermäßig schon zu geniessen. Es ist empfehlenswert sie mit einem (Miet-) Wagen insgesamt abzufahren. Auch eine Fahrt hoch nach Lissabon mit einigen Tagen Aufenthalt dort solltest Du einplanen! Versäume nicht einen möglichst originalen, nicht für Touristen veranstalteten Fado-Abend mitzumachen, d.h., nur wenn Du meinst, Dich für etwas schwerere Volksmusik und Volkstanz erwärmen zu können!
„… ein provencalisches Dorf, wo man friedlich in der Abendsonne ein Gläschen Rotwein genießen kann ...“
nein, das wäre nichts für mich, schon alleine wegen der mir nicht so ganz behagenden Allüren und dem aussenpolitischen Gehabe dieser romanischen „Grand Nation“.
Für "die Seele durchbaumeln lassen zu können und ausgiebig Lebensfreude aufzutanken" habe ich ein kleines Örtchen am Plattensee mir auserwählt, am Südufer, von wo aus gesehen die untergehende Abendsonne hinter den nordseitigen Bergen bilderbuchartig versinkt, während ich mit meinem Hund am Steg dort sitze, und einen aus dem Faß vom Kleinwinzer gekauften offenen Rotwein mit meinen Freunden trinke …
allerdings, möglichst ausserhalb der Hochsaison!
Grüße
Magor
Katastrophe, Katastrophe …
Eur/USD bei 2.00? Absolut nicht unrealistisch und vielleicht auch nicht ungewollt in naher Zukunft. An die Zeiten mit ehemals 1.35 DM für den USD habe ich gute Erinnerungen, muß so ´82 gewesen sein, herrlich günstigen USA / Mexiko-Urlaub verlebt, und dank dieser Situation und der Hochzinsphase von bis zu 15% im USD noch richtig Asche gemacht! Gegen die DM abgesichert natürlich!
„… die letzten Papierwerte zusammenkratzen und mir davon in der Uckermark ein altes Gehöft kaufen...“ mit dererlei Vorgehen hatten nur sehr wenige Glück gehabt bei einer Währungsreform, die wurden zum Ausgleich mit einer Zwangshypothek belastet …
Also, Das Säcklein mit den Goldmünzen, erscheint mir da werterhaltender …
Als Russlandexperten kann ich mich nicht bezeichnen, meine Aufenthalte im eigentlichen Russland beschränken sich auf Zwischenlandungen und kurze Reiseunterbrechungen bis zum Weiterflug. So kenne ich Russland eher aus der Vogelperspektive, aus dem Flieger betrachtet. Die russische Mentalität, die habe ich allerdings ausgiebig kennenlernen dürfen, u.A. im von denen mit Gewalt bis zur Unkenntlichkeit verrussischten und ausgebeutetem Kasachstan.
Nein, mit GTZ habe ich nichts zu tun, und mit Entwicklungshilfe nur im entferntesten Sinne … Ich beackere einen fachbezogenen Part im weiten Feld des Großanlagenbaus. Und die Kundschaft ist im seltensten Falle in Deutschland.
Die Desillusionierung Deiner Freundin kann ich bestens nachempfinden, als einer, der als junger, seinerzeit vielleicht auch zu naiver Mensch mit völlig unvorbelasteter Einstellung zu den Problemen zwischen Schwarz und Weiß, aber auch den Problemen zwischen Schwarz und Schwarz in Entsendung meiner Firma nach Nigeria gegangen bin. Dieser, meinerseits etwas skeptisch angegangene Schritt hatte aber auch neben der Bereicherung mit den vielfältigsten Erfahrungen auch noch so einiges, für mich recht Positives zur Folge. Einmal sich bei solchen Einsätzen im Beruf bewährt, das klebt in den Papieren und spricht sich herum. So wirst Du immer wieder die Gelegenheit bekommen entsandt zu werden, was im Umkehrschluss allerdings im Angestelltenverhältnis nur schlecht zurückweisbar ist (entweder, Du gehst, oder Du gehst … ). So bin ich tatsächlich sehr viel und auch sehr gerne rumgekommen, und kenne viele Ecken unserer Erde nicht nur aus touristischen Gesichtspunkten. Heute, familiär etwas behinderter in der Bereitwilligkeit zu längerfristigen Einsätzen, habe ich weitestgehend die Möglichkeit, meine eigenen Einsätze vor Ort auf wenige Wochen oder Monate zu limitieren und, ausser, wenn´s „brennt“, die Fäden eher von Deutschland aus zusammenzuhalten.
Wo es mich hinzieht … ? Wenn ich unterwegs bin, immer wieder nachhause … das, je weiter ich weg bin und je länger, als umso schöner erscheint! Vielleicht weisst Du, wie sehr man das bei längerer Abwesendheit zu schätzen lernt. Ab dem 4. Jahr trällert man sogar heimische Lieder … : - )) dann ist es allerdings meist an der Zeit heimgehen zu müssen ….
Das ist allerdings nicht, was Du mich fragen wolltest. Entscheidend ist sicherlich, was man sucht, die Wüste oder die Großstadt, pulsierendes Leben oder eher Ruhe …und alles ist auch mit gewissen Abstrichen/Kompromissen zu betrachten, eigentlich genauso wie das Zuhause, das im seltensten Falle am schönsten Fleck der Erde liegt.
Als eines der schönsten Städte, die ich kenne, finde ich Sydney, wennauch der puritanisch-britische Umgang der Behörden mit der Bevölkerung dort mir etwas missfällt. Sehr schön und (noch!) bezahlbar ist Shanghai nebst Umfeld aber z.B. auch das Moloch Bangkok, wobei Letzteres mit einem Besichtigungs- und Badeaufenthalt auf und um die Insel Phuket unbedingt verbunden werden müsste (Thai könnte Dir da bestimmt gute Tips geben). Auf Europa beschränkt finde ich je nach Jahreszeit die Städte Rom, Budapest, Barcelona, Venedig und Genua aber auch München und Heidelberg sehr besuchenswert. Straßburg und der Elsaß ist auch eine Reise Wert, allerdings sind die Preise dort, ähnlich Venedig und Rom arg abgehoben.
Das in Deine engere Wahl gezogene Portugal finde ich als eine lohnenswerte Idee. Die Algarve ist wunderschön, und gerade im Frühjahr auch wettermäßig schon zu geniessen. Es ist empfehlenswert sie mit einem (Miet-) Wagen insgesamt abzufahren. Auch eine Fahrt hoch nach Lissabon mit einigen Tagen Aufenthalt dort solltest Du einplanen! Versäume nicht einen möglichst originalen, nicht für Touristen veranstalteten Fado-Abend mitzumachen, d.h., nur wenn Du meinst, Dich für etwas schwerere Volksmusik und Volkstanz erwärmen zu können!
„… ein provencalisches Dorf, wo man friedlich in der Abendsonne ein Gläschen Rotwein genießen kann ...“
nein, das wäre nichts für mich, schon alleine wegen der mir nicht so ganz behagenden Allüren und dem aussenpolitischen Gehabe dieser romanischen „Grand Nation“.
Für "die Seele durchbaumeln lassen zu können und ausgiebig Lebensfreude aufzutanken" habe ich ein kleines Örtchen am Plattensee mir auserwählt, am Südufer, von wo aus gesehen die untergehende Abendsonne hinter den nordseitigen Bergen bilderbuchartig versinkt, während ich mit meinem Hund am Steg dort sitze, und einen aus dem Faß vom Kleinwinzer gekauften offenen Rotwein mit meinen Freunden trinke …
allerdings, möglichst ausserhalb der Hochsaison!
Grüße
Magor
So, wird mal Zeit, diesen Thread wiederzubeleben... 
macvin, meine Freundin plädiert eindeutig für Korsika ...
Eswird aber wohl etwas spät im Jahr werden, vermutlich September, aber immerhin sind dann die Touristenmassen weg, es ist auch am Meer wieder erträglich und in den Bergen laden die kleinen Seen, Bäche und Wasserfälle zum Baden ein.
(Gute deutschsprachige website über Korsika ist übrigens: http://www.paradisu.de)
Du hast übrigens mit Deinem humorvollen statement im "wardriverthread" (#259) auch meine Einschätzung getroffen. Ich bin ja, wie ihr wißt, nicht sehr beschlagen im Börsengeschäft, aber aus den derzeitigen Chartindikatoren und den COT-Zahlen zu schließen, daß der POG in Kürze unter die 325 rauscht halte ich dann doch für völlig ausgeschlossen.
Magor, Du bist ja doch wieder recht fleißig, und das nicht nur hier, wie ich sehen konnte
So macht man aus einem Gold-Thread einen Thread für Gaumenkitzel und Austausch von Reise- und Saufgeschichten … Katastrophe, Katastrophe …
Naja, ein Alfred-Biolek-Kultthread sollte es nun auch nicht werden und daher häng´ ich mal zur Abwechslung wieder was Nachdenkliches hintendran. Aber grundsätzlich sind wir uns doch wohl einig: Nur immer POG rauf und runter wird irgendwann auch langweilig...
Schön, daß Dir Dein Beruf die Möglichkeit bietet, in der Welt herumzukommen, ich kann es kaum glauben, wenn Du schreibst: Wo es mich hinzieht … ? Wenn ich unterwegs bin, immer wieder nachhause … das, je weiter ich weg bin und je länger, als umso schöner erscheint! Vielleicht weisst Du, wie sehr man das bei längerer Abwesendheit zu schätzen lernt. Ab dem 4. Jahr trällert man sogar heimische Lieder … : - )) dann ist es allerdings meist an der Zeit heimgehen zu müssen...
Heimweh kenne ich nicht, - nur Fernweh , - wenn mein Urlaub sich dem Ende neigt, bin ich stets todunglücklich. Ich habe unseren alten Kontinent auch noch nie verlassen, und da ist die Sehnsucht natürlich noch riesengroß.
Vier Jahre Nigeria, Rußland, Sydney, Shanghai, Bangkok... ? - Tja, ich hätte mir wohl doch einen anderen Beruf wählen sollen, ich arbeite in der Altenpflege und da geht es mit unseren Heimbewohnern über´s Wochenende gerade mal nach Travemünde und Büsum...
Aber zwei Reiseziele liegen dann doch in beidseitiger Gunst: Venedig und das Elsaß. An Venedig scheiden sich bekanntlich die Geister, vielen ist die Atmosphäre zu morbide. Aber ich liebe diese traumschwere Stadt, die vom Verfall gekennzeichnet und doch so voller Leben ist...
Wenn der POG auf 500 US klettert werde ich vielleicht ein Wochenende im Hotel "Des Bains" buchen
( http://holidaycityeurope.com/des-bains-venice/index.htm)
und bei ein paar längeren Spaziergängen am Lido über die erträgliche Leichtigkeit des Seins nachdenken ...

Das Elsaß habe ich – wie sollte es anders sein – durch die Weinstraße kennen- und schätzen gelernt. Vor allem im Herbst sehr zu empfehlen – vielleicht wäre ein Wochenende in Colmar auch mal was für Dich, Sovereign, wo Du doch immer so knapp in der Zeit bist ? – vom Flughafen Frankfurt aus ist es nicht weit !
http://www.europaregions.com/alsace_hotels/tourisme/rtevin/…

Urlaub gibt`s dieses Jahr nicht! Kratz lieber das Urlaubsgeld zusammen und kauf Dir ein paar Goldaktien. Und wenn Du Sonne brauchst: "Erwärm Dich am sonnigen Glanz einer Goldunze." Du mußt schon Prioritäten setzen, wenn`s zum hauptberuflichen Goldbug reichen soll
Sovereign, ich fürchte ich bin wohl doch ein kläglicher Versager, und zum hauptamtlichen Goldbug reicht es nicht.
Du weißt doch: das Leben ist kurz, das Glas ist fast leer und der Rand ist dreckig ...
Aber eines muß ich dann doch anmerken: wer in einem Dorf lebt, daß durch eine Ameisenplage in die Annalen eingegangen ist, sollte eigentlich Verständnis für Fluchtreflexe haben ...
Gruß an alle Hedonisten -
Konradi
---
SPIEGEL Interview mit Ex-CIA-Direktor James Woolsey :
"Wir fangen mit dem Irak an"
Jahrelang war James Wollsey der Chef des mächtigen US-Geheimdienstes CIA. Im Interview rechtfertigt er nun einen US-Angriff auf den Irak, fordert von den Inspektoren im Irak schärfere Kontrollen und spricht über die Rolle des Öls bei der Kriegsfrage.
SPIEGEL: Mr. Woolsey, die Uno-Inspektoren suchen im Irak noch immer nach Massenvernichtungswaffen. Können sie am 27. Januar überhaupt ein Ergebnis vorlegen, das einen Krieg zunächst entbehrlich macht?
Woolsey: Die Inspektoren werden kaum etwas finden, wenn sie nicht endlich die Vollmacht nutzen, die sie nach der Uno-Resolution haben, nämlich Wissenschaftler und deren Familien außer Landes zu bringen. Beim bloßen Herumlaufen im Irak lässt sich schwerlich etwas finden.
SPIEGEL: England und Frankreich argumentieren mittlerweile, dass der 27. Januar nicht der endgültige Stichtag sei und die Inspektoren mehr Zeit benötigten.
Woolsey: Die Uno-Suchtrupps könnten ewig weitersuchen. Ohne frische Informationen von Insidern werden sie die chemischen und biologischen Waffen, die sich leicht verstecken und leicht verlegen lassen, aller Wahrscheinlichkeit nicht aufspüren.
SPIEGEL: Hans Blix führt Beschwerde, dass die Vereinigten Staaten ihm noch immer die Kenntnisse der Geheimdienste vorenthalten. Warum rücken die nichts heraus?
Woolsey: Er hat schon etwas bekommen, aber falls die Erkenntnisse, was oft der Fall ist, zur Identifizierung unserer Quellen führen, wird Saddam sie und ihre Familien töten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Wissenschaftler und ihre Familien aus dem Irak herausgebracht werden.
SPIEGEL: Tony Blair droht ein Aufstand in der eigenen Partei, und Frankreich zögert, dem Irak einen Bruch der Uno-Resolution 1441 vorzuwerfen - sollten die Vereinigten Staaten allein gegen Saddam vorgehen?
Woolsey: Wir brauchen keine weitere Resolution des Sicherheitsrates. Natürlich wäre es eine Schande, wenn die Briten nicht mitmachen würden, aber letztlich kommt es darauf auch nicht an. Und Frankreich kann ohnehin tun, was es will.
SPIEGEL: Warum eigentlich ist Saddam der Inbegriff des Bösen für Amerikaner wie Sie? Nordkorea verstößt gegen bestehende Verträge, hat die Atom-Inspektoren des Landes verwiesen, stößt wüste Drohungen aus, um Amerika zu Verhandlungen zu zwingen. Zudem ist Iran augenscheinlich entschlossen, Massenvernichtungswaffen zu bauen. Warum sind die Vereinigten Staaten dennoch auf den Irak fixiert?
Woolsey: Weil wir pragmatisch vorgehen. Das ist keine Übung in cartesianischer Logik, wonach wir alle Länder über einen Kamm scheren, die nach unserer Kenntnis Massenvernichtungswaffen besitzen. Das ist eine Frage der Dringlichkeit.
SPIEGEL: Wo sehen Sie denn die größte Dringlichkeit?
Woolsey: Iran und die verrückten Mullahs, die das Land beherrschen, sind in einer sehr schwachen Position. Ihre Ideologie ist tot, sie sind auf dem absteigenden Ast. Ich will nicht vorhersagen, dass ihre Herrschaft in einem Monat oder einem Jahr zusammenbricht. Aber nichts wäre törichter, als mit militärischer Gewalt gegen sie vorzugehen und damit all die wunderbaren Studenten in die Arme der Mullahs zu treiben.
SPIEGEL: Warum aber ist Nordkorea nur ein diplomatisches Problem für die Regierung Bush?
Woolsey: Nordkorea ist ein ganz anderer Fall. Anders als der Irak hat Nordkorea in den letzten 22 Jahren nicht zwei Kriege vom Zaun gebrochen. Anders als der Irak hat Nordkorea nicht Massenvernichtungswaffen gegen das eigene Volk und seinen Nachbarn eingesetzt. Außerdem ist Nordkorea von zwei Nuklearmächten - Russland und China - und von zwei weiteren starken Mächten - Japan und Südkorea - umgeben, und dazu kommt noch als fünfte Macht Amerika mit starken Streitkräften in Japan und Südkorea. Der Irak ist jedoch eine Diktatur, die wir daran hindern müssen, so weit wie Nordkorea zu kommen, zum Beispiel in den Besitz atomarer Waffen. Es gibt keine Aussicht darauf, dass der Irak sich aus eigenen Kräften reformiert - es ist wie Nazi-Deutschland -, und die Probleme lösen sich nicht, indem man auf den Tod Saddams wartet. Dessen Sohn Udai ist ein Spezialist fürs Vergewaltigen und Ermorden von Frauen, sein Sohn Kussei versteht sich auf Foltermethoden.
SPIEGEL: Sie vergleichen Saddam mit Hitler, eine historische Analogie, die momentan in Washington gern angewandt wird. Ist das nur ein rhetorisches Mittel, um die Dringlichkeit des Falles zu steigern?
Woolsey: Saddam hat sich bis heute mehr zu Schulden kommen lassen als Hitler im Jahre 1936, als er ins demilitarisierte Rheinland einrückte. Und unsere Freunde in Europa haben eine Neigung zur Appeasement-Politik gegenüber Saddam, genauso wie Teile Europas gegenüber Hitler Appeasement walten ließen, als der schon Tausende seiner Landsleute ins Gefängnis gesteckt und gegen den Versailler Vertrag verstoßen hatte.
SPIEGEL: Zurück zur Achse des Bösen: Irak hat Erdöl, Nordkorea nicht. Die Regierung Bush hat schon im Mai 2001 eine Neuausrichtung ihrer Energiepolitik angekündigt. Macht die Abhängigkeit von importiertem Öl Amerika nicht besonders verwundbar?
Woolsey: Öl ist die Lebensader aller Industrienationen. Zwei Drittel der bekannten Ölvorräte liegen am Persischen Golf. Als Saddam 1990 in Kuweit einmarschierte und sich den saudi-arabischen Ölfeldern näherte, war er lediglich einige hundert Kilometer davon entfernt, knapp die Hälfte aller weltweit nachgewiesenen Ölreserven unter seine Kontrolle zu bringen.
SPIEGEL: Also geht es auch diesmal um Öl ...
Woolsey: ... aber nicht nur um Amerikas Abhängigkeit vom Öl, sondern um die der ganzen Welt. Auf kurze Sicht liegt unsere grundlegende Verwundbarkeit darin, dass die Saudis die Fördermenge schnell drosseln oder steigern können, weil sie über die Hälfte der weltweiten "swing capacity", insgesamt vier Millionen Barrel, verfügen. Damit haben die Saudis entscheidenden Einfluss auf den Ölpreis. Wir müssen dem Nahen Osten die Ölwaffe wegnehmen.
SPIEGEL: War es fahrlässig oder kurzsichtig, dass sich die Vereinigten Staaten in weitgehende Abhängigkeit von Saudi-Arabien begeben haben - einem Land, das mittlerweile als unzuverlässig gilt?
Woolsey: Die ehemalige israelische Premierministerin Golda Meïr hat einmal gesagt: Wie kann Israel das auserwählte Volk sein, wo uns doch Gott 40 Jahre in der Wüste herumwandern ließ und uns dann den einzigen Ort im Nahen Osten zuwies, an dem es kein Öl gibt? Unglücklicherweise verfügen nicht Demokratien wie Israel über Öl, sondern autoritäre Regierungen. Daraus folgt, dass die Welt, solange sie abhängig vom Öl ist, irgendwie mit diesen Ländern zurechtkommen muss. Man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Man braucht eine langfristige Strategie.
SPIEGEL: Und wir sollen daraus den Schluss ziehen, dass der Irak erst der Anfang ist?
Woolsey: Während fast ganz Europa demokratisch ist, bleibt der Nahe Osten der Härtefall für die Verbreitung der Demokratie. Wir fangen jetzt mit dem Irak an, weil Saddam am tückischsten und gefährlichsten ist. Wir können ihn nicht an der Regierung belassen und stattdessen die Region von ihren Rändern her demokratisieren. Man muss im Zentrum des Problems beginnen.
SPIEGEL: Die amerikanische Außenpolitik ist allerdings beileibe nicht unschuldig an den Schwierigkeiten des Nahen Ostens.
Woolsey: Der Nahe Osten ist ein exzellentes Beispiel, um Churchills Satz zu illustrieren, dass die Amerikaner am Ende immer das Richtige tun, aber erst nachdem sie alle falschen Möglichkeiten ausprobiert haben.
SPIEGEL: Wie lässt sich der Satz am Nahen Osten illustrieren?
Woolsey: Wir haben den Nahen Osten lange als unsere Tankstelle betrachtet. Einer der Gründe, weshalb die Demokratie in der arabischen Welt keinen Fortschritt gemacht hat, ist unsere Fixierung aufs Öl.
Das herausragende Beispiel dafür spielte sich 1991 ab, als der damalige Präsident Bush bemerkenswert geschickt eine Koalition gegen den Irak zusammenbrachte, den Krieg gewann und sich dann auf einen Waffenstillstand einließ, der Saddams Republikanische Garde fortbestehen ließ - und dann haben wir uns zurückgelehnt und zugeschaut, wie die kurdischen und schiitischen Rebellen abgeschlachtet wurden. Die Welt und der Nahe Osten verstanden die Botschaft so: Wenn erst einmal die Ölzufuhr gesichert ist, sind uns die Menschen im Nahen Osten egal. Ich glaube, das war die schlechteste außenpolitische Entscheidung der USA im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts.
SPIEGEL: Und Amerika will den Fehler jetzt wieder gutmachen?
Woolsey: Die Entscheidung aus dem Jahr 1991 verfolgt uns wie ein Gespenst. Menschen werden beim Regimewechsel im Irak sterben - viel mehr, als damals gestorben wären, wenn wir nur den Kurden und Schiiten beigestanden hätten oder wenigstens die Republikanische Garde am Angriff gehindert hätten.
INTERVIEW: CAROLIN EMCKE, GERHARD SPÖRL
DER SPIEGEL 4/2003

macvin, meine Freundin plädiert eindeutig für Korsika ...

Eswird aber wohl etwas spät im Jahr werden, vermutlich September, aber immerhin sind dann die Touristenmassen weg, es ist auch am Meer wieder erträglich und in den Bergen laden die kleinen Seen, Bäche und Wasserfälle zum Baden ein.
(Gute deutschsprachige website über Korsika ist übrigens: http://www.paradisu.de)
Du hast übrigens mit Deinem humorvollen statement im "wardriverthread" (#259) auch meine Einschätzung getroffen. Ich bin ja, wie ihr wißt, nicht sehr beschlagen im Börsengeschäft, aber aus den derzeitigen Chartindikatoren und den COT-Zahlen zu schließen, daß der POG in Kürze unter die 325 rauscht halte ich dann doch für völlig ausgeschlossen.
Magor, Du bist ja doch wieder recht fleißig, und das nicht nur hier, wie ich sehen konnte

So macht man aus einem Gold-Thread einen Thread für Gaumenkitzel und Austausch von Reise- und Saufgeschichten … Katastrophe, Katastrophe …
Naja, ein Alfred-Biolek-Kultthread sollte es nun auch nicht werden und daher häng´ ich mal zur Abwechslung wieder was Nachdenkliches hintendran. Aber grundsätzlich sind wir uns doch wohl einig: Nur immer POG rauf und runter wird irgendwann auch langweilig...
Schön, daß Dir Dein Beruf die Möglichkeit bietet, in der Welt herumzukommen, ich kann es kaum glauben, wenn Du schreibst: Wo es mich hinzieht … ? Wenn ich unterwegs bin, immer wieder nachhause … das, je weiter ich weg bin und je länger, als umso schöner erscheint! Vielleicht weisst Du, wie sehr man das bei längerer Abwesendheit zu schätzen lernt. Ab dem 4. Jahr trällert man sogar heimische Lieder … : - )) dann ist es allerdings meist an der Zeit heimgehen zu müssen...
Heimweh kenne ich nicht, - nur Fernweh , - wenn mein Urlaub sich dem Ende neigt, bin ich stets todunglücklich. Ich habe unseren alten Kontinent auch noch nie verlassen, und da ist die Sehnsucht natürlich noch riesengroß.
Vier Jahre Nigeria, Rußland, Sydney, Shanghai, Bangkok... ? - Tja, ich hätte mir wohl doch einen anderen Beruf wählen sollen, ich arbeite in der Altenpflege und da geht es mit unseren Heimbewohnern über´s Wochenende gerade mal nach Travemünde und Büsum...

Aber zwei Reiseziele liegen dann doch in beidseitiger Gunst: Venedig und das Elsaß. An Venedig scheiden sich bekanntlich die Geister, vielen ist die Atmosphäre zu morbide. Aber ich liebe diese traumschwere Stadt, die vom Verfall gekennzeichnet und doch so voller Leben ist...
Wenn der POG auf 500 US klettert werde ich vielleicht ein Wochenende im Hotel "Des Bains" buchen
( http://holidaycityeurope.com/des-bains-venice/index.htm)
und bei ein paar längeren Spaziergängen am Lido über die erträgliche Leichtigkeit des Seins nachdenken ...

Das Elsaß habe ich – wie sollte es anders sein – durch die Weinstraße kennen- und schätzen gelernt. Vor allem im Herbst sehr zu empfehlen – vielleicht wäre ein Wochenende in Colmar auch mal was für Dich, Sovereign, wo Du doch immer so knapp in der Zeit bist ? – vom Flughafen Frankfurt aus ist es nicht weit !
http://www.europaregions.com/alsace_hotels/tourisme/rtevin/…

Urlaub gibt`s dieses Jahr nicht! Kratz lieber das Urlaubsgeld zusammen und kauf Dir ein paar Goldaktien. Und wenn Du Sonne brauchst: "Erwärm Dich am sonnigen Glanz einer Goldunze." Du mußt schon Prioritäten setzen, wenn`s zum hauptberuflichen Goldbug reichen soll
Sovereign, ich fürchte ich bin wohl doch ein kläglicher Versager, und zum hauptamtlichen Goldbug reicht es nicht.
Du weißt doch: das Leben ist kurz, das Glas ist fast leer und der Rand ist dreckig ...
Aber eines muß ich dann doch anmerken: wer in einem Dorf lebt, daß durch eine Ameisenplage in die Annalen eingegangen ist, sollte eigentlich Verständnis für Fluchtreflexe haben ...

Gruß an alle Hedonisten -
Konradi

---
SPIEGEL Interview mit Ex-CIA-Direktor James Woolsey :
"Wir fangen mit dem Irak an"
Jahrelang war James Wollsey der Chef des mächtigen US-Geheimdienstes CIA. Im Interview rechtfertigt er nun einen US-Angriff auf den Irak, fordert von den Inspektoren im Irak schärfere Kontrollen und spricht über die Rolle des Öls bei der Kriegsfrage.
SPIEGEL: Mr. Woolsey, die Uno-Inspektoren suchen im Irak noch immer nach Massenvernichtungswaffen. Können sie am 27. Januar überhaupt ein Ergebnis vorlegen, das einen Krieg zunächst entbehrlich macht?
Woolsey: Die Inspektoren werden kaum etwas finden, wenn sie nicht endlich die Vollmacht nutzen, die sie nach der Uno-Resolution haben, nämlich Wissenschaftler und deren Familien außer Landes zu bringen. Beim bloßen Herumlaufen im Irak lässt sich schwerlich etwas finden.
SPIEGEL: England und Frankreich argumentieren mittlerweile, dass der 27. Januar nicht der endgültige Stichtag sei und die Inspektoren mehr Zeit benötigten.
Woolsey: Die Uno-Suchtrupps könnten ewig weitersuchen. Ohne frische Informationen von Insidern werden sie die chemischen und biologischen Waffen, die sich leicht verstecken und leicht verlegen lassen, aller Wahrscheinlichkeit nicht aufspüren.
SPIEGEL: Hans Blix führt Beschwerde, dass die Vereinigten Staaten ihm noch immer die Kenntnisse der Geheimdienste vorenthalten. Warum rücken die nichts heraus?
Woolsey: Er hat schon etwas bekommen, aber falls die Erkenntnisse, was oft der Fall ist, zur Identifizierung unserer Quellen führen, wird Saddam sie und ihre Familien töten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Wissenschaftler und ihre Familien aus dem Irak herausgebracht werden.
SPIEGEL: Tony Blair droht ein Aufstand in der eigenen Partei, und Frankreich zögert, dem Irak einen Bruch der Uno-Resolution 1441 vorzuwerfen - sollten die Vereinigten Staaten allein gegen Saddam vorgehen?
Woolsey: Wir brauchen keine weitere Resolution des Sicherheitsrates. Natürlich wäre es eine Schande, wenn die Briten nicht mitmachen würden, aber letztlich kommt es darauf auch nicht an. Und Frankreich kann ohnehin tun, was es will.
SPIEGEL: Warum eigentlich ist Saddam der Inbegriff des Bösen für Amerikaner wie Sie? Nordkorea verstößt gegen bestehende Verträge, hat die Atom-Inspektoren des Landes verwiesen, stößt wüste Drohungen aus, um Amerika zu Verhandlungen zu zwingen. Zudem ist Iran augenscheinlich entschlossen, Massenvernichtungswaffen zu bauen. Warum sind die Vereinigten Staaten dennoch auf den Irak fixiert?
Woolsey: Weil wir pragmatisch vorgehen. Das ist keine Übung in cartesianischer Logik, wonach wir alle Länder über einen Kamm scheren, die nach unserer Kenntnis Massenvernichtungswaffen besitzen. Das ist eine Frage der Dringlichkeit.
SPIEGEL: Wo sehen Sie denn die größte Dringlichkeit?
Woolsey: Iran und die verrückten Mullahs, die das Land beherrschen, sind in einer sehr schwachen Position. Ihre Ideologie ist tot, sie sind auf dem absteigenden Ast. Ich will nicht vorhersagen, dass ihre Herrschaft in einem Monat oder einem Jahr zusammenbricht. Aber nichts wäre törichter, als mit militärischer Gewalt gegen sie vorzugehen und damit all die wunderbaren Studenten in die Arme der Mullahs zu treiben.
SPIEGEL: Warum aber ist Nordkorea nur ein diplomatisches Problem für die Regierung Bush?
Woolsey: Nordkorea ist ein ganz anderer Fall. Anders als der Irak hat Nordkorea in den letzten 22 Jahren nicht zwei Kriege vom Zaun gebrochen. Anders als der Irak hat Nordkorea nicht Massenvernichtungswaffen gegen das eigene Volk und seinen Nachbarn eingesetzt. Außerdem ist Nordkorea von zwei Nuklearmächten - Russland und China - und von zwei weiteren starken Mächten - Japan und Südkorea - umgeben, und dazu kommt noch als fünfte Macht Amerika mit starken Streitkräften in Japan und Südkorea. Der Irak ist jedoch eine Diktatur, die wir daran hindern müssen, so weit wie Nordkorea zu kommen, zum Beispiel in den Besitz atomarer Waffen. Es gibt keine Aussicht darauf, dass der Irak sich aus eigenen Kräften reformiert - es ist wie Nazi-Deutschland -, und die Probleme lösen sich nicht, indem man auf den Tod Saddams wartet. Dessen Sohn Udai ist ein Spezialist fürs Vergewaltigen und Ermorden von Frauen, sein Sohn Kussei versteht sich auf Foltermethoden.
SPIEGEL: Sie vergleichen Saddam mit Hitler, eine historische Analogie, die momentan in Washington gern angewandt wird. Ist das nur ein rhetorisches Mittel, um die Dringlichkeit des Falles zu steigern?
Woolsey: Saddam hat sich bis heute mehr zu Schulden kommen lassen als Hitler im Jahre 1936, als er ins demilitarisierte Rheinland einrückte. Und unsere Freunde in Europa haben eine Neigung zur Appeasement-Politik gegenüber Saddam, genauso wie Teile Europas gegenüber Hitler Appeasement walten ließen, als der schon Tausende seiner Landsleute ins Gefängnis gesteckt und gegen den Versailler Vertrag verstoßen hatte.
SPIEGEL: Zurück zur Achse des Bösen: Irak hat Erdöl, Nordkorea nicht. Die Regierung Bush hat schon im Mai 2001 eine Neuausrichtung ihrer Energiepolitik angekündigt. Macht die Abhängigkeit von importiertem Öl Amerika nicht besonders verwundbar?
Woolsey: Öl ist die Lebensader aller Industrienationen. Zwei Drittel der bekannten Ölvorräte liegen am Persischen Golf. Als Saddam 1990 in Kuweit einmarschierte und sich den saudi-arabischen Ölfeldern näherte, war er lediglich einige hundert Kilometer davon entfernt, knapp die Hälfte aller weltweit nachgewiesenen Ölreserven unter seine Kontrolle zu bringen.
SPIEGEL: Also geht es auch diesmal um Öl ...
Woolsey: ... aber nicht nur um Amerikas Abhängigkeit vom Öl, sondern um die der ganzen Welt. Auf kurze Sicht liegt unsere grundlegende Verwundbarkeit darin, dass die Saudis die Fördermenge schnell drosseln oder steigern können, weil sie über die Hälfte der weltweiten "swing capacity", insgesamt vier Millionen Barrel, verfügen. Damit haben die Saudis entscheidenden Einfluss auf den Ölpreis. Wir müssen dem Nahen Osten die Ölwaffe wegnehmen.
SPIEGEL: War es fahrlässig oder kurzsichtig, dass sich die Vereinigten Staaten in weitgehende Abhängigkeit von Saudi-Arabien begeben haben - einem Land, das mittlerweile als unzuverlässig gilt?
Woolsey: Die ehemalige israelische Premierministerin Golda Meïr hat einmal gesagt: Wie kann Israel das auserwählte Volk sein, wo uns doch Gott 40 Jahre in der Wüste herumwandern ließ und uns dann den einzigen Ort im Nahen Osten zuwies, an dem es kein Öl gibt? Unglücklicherweise verfügen nicht Demokratien wie Israel über Öl, sondern autoritäre Regierungen. Daraus folgt, dass die Welt, solange sie abhängig vom Öl ist, irgendwie mit diesen Ländern zurechtkommen muss. Man kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Man braucht eine langfristige Strategie.
SPIEGEL: Und wir sollen daraus den Schluss ziehen, dass der Irak erst der Anfang ist?
Woolsey: Während fast ganz Europa demokratisch ist, bleibt der Nahe Osten der Härtefall für die Verbreitung der Demokratie. Wir fangen jetzt mit dem Irak an, weil Saddam am tückischsten und gefährlichsten ist. Wir können ihn nicht an der Regierung belassen und stattdessen die Region von ihren Rändern her demokratisieren. Man muss im Zentrum des Problems beginnen.
SPIEGEL: Die amerikanische Außenpolitik ist allerdings beileibe nicht unschuldig an den Schwierigkeiten des Nahen Ostens.
Woolsey: Der Nahe Osten ist ein exzellentes Beispiel, um Churchills Satz zu illustrieren, dass die Amerikaner am Ende immer das Richtige tun, aber erst nachdem sie alle falschen Möglichkeiten ausprobiert haben.
SPIEGEL: Wie lässt sich der Satz am Nahen Osten illustrieren?
Woolsey: Wir haben den Nahen Osten lange als unsere Tankstelle betrachtet. Einer der Gründe, weshalb die Demokratie in der arabischen Welt keinen Fortschritt gemacht hat, ist unsere Fixierung aufs Öl.
Das herausragende Beispiel dafür spielte sich 1991 ab, als der damalige Präsident Bush bemerkenswert geschickt eine Koalition gegen den Irak zusammenbrachte, den Krieg gewann und sich dann auf einen Waffenstillstand einließ, der Saddams Republikanische Garde fortbestehen ließ - und dann haben wir uns zurückgelehnt und zugeschaut, wie die kurdischen und schiitischen Rebellen abgeschlachtet wurden. Die Welt und der Nahe Osten verstanden die Botschaft so: Wenn erst einmal die Ölzufuhr gesichert ist, sind uns die Menschen im Nahen Osten egal. Ich glaube, das war die schlechteste außenpolitische Entscheidung der USA im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts.
SPIEGEL: Und Amerika will den Fehler jetzt wieder gutmachen?
Woolsey: Die Entscheidung aus dem Jahr 1991 verfolgt uns wie ein Gespenst. Menschen werden beim Regimewechsel im Irak sterben - viel mehr, als damals gestorben wären, wenn wir nur den Kurden und Schiiten beigestanden hätten oder wenigstens die Republikanische Garde am Angriff gehindert hätten.
INTERVIEW: CAROLIN EMCKE, GERHARD SPÖRL
DER SPIEGEL 4/2003
@Konradi
Du hast eine Freundin ?
Das hätte ich Dir gar nicht zugetraut.
Immerhin etwas.
Seid ihr beide in der JU.
Aber was macht man nicht alles um an die Weiber
heranzukommen.
 ... JU-Haveland. Naja, man kann sich sein Gesicht leider nicht aussuchen.
... JU-Haveland. Naja, man kann sich sein Gesicht leider nicht aussuchen.
GO ... der JU-Aktivist
Du hast eine Freundin ?
Das hätte ich Dir gar nicht zugetraut.
Immerhin etwas.
Seid ihr beide in der JU.
Aber was macht man nicht alles um an die Weiber
heranzukommen.

 ... JU-Haveland. Naja, man kann sich sein Gesicht leider nicht aussuchen.
... JU-Haveland. Naja, man kann sich sein Gesicht leider nicht aussuchen.GO ... der JU-Aktivist
DIE ZEIT - 04/2003
"Ein Krieg ums Öl ist ökonomischer Unsinn"
Das Ende Saddam Husseins würde den Amerikanern wirtschaftlich nicht nützen – ein ZEIT-Gespräch mit dem Wirtschaftsforscher William Nordhaus
Die Zeit: Professor Nordhaus, Kritiker in aller Welt behaupten, der amerikanische Präsident George Bush wolle den Irak nur wegen des Öls angreifen.
William D. Nordhaus: Das ist ökonomischer Unsinn. Es dürfte für die USA sehr schwer werden, von diesem Krieg zu profitieren. Im Gegenteil, mit Kriegsbeginn wird wahrscheinlich der Ölpreis weiter steigen, das Konsumentenvertrauen einbrechen, und das wird der amerikanischen Volkswirtschaft schaden. Der europäischen übrigens auch.
Zeit: Obwohl es im Augenblick so aussieht, als würden sich die Europäer kaum an diesem Krieg beteiligen. In der Bush-Administration fiel bereits das Wort „Trittbrettfahrer“…
Nordhaus: Richtig, die direkten Kriegskosten werden womöglich allein die USA tragen. Aber die machen ja nur einen Teil der gesamten Kosten aus. Die indirekten Kosten sind größer, und sie entstehen durch die Auswirkungen auf die Konjunktur. Ich habe das einmal durchgerechnet: Bei einem kurzen Krieg lägen die rein militärischen Kosten bei rund 50 Milliarden Dollar und damit bei etwa der Hälfte der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von 100 Milliarden Dollar. Bei einem längeren, schwierigen Krieg beliefen sich die Kriegskosten hingegen auf 140 Milliarden, aber das wäre weniger als ein Zehntel der dann zu erwartenden Gesamtkosten von 1,9 Billionen Dollar. Wohlgemerkt, das sind nur die Kosten für die USA. Die konjunkturellen Schäden blieben natürlich nicht auf ein Land beschränkt.
Zeit: Demnach fallen kurzfristig hohe Kosten an. Aber zahlt es sich nicht langfristig doch aus, wenn die USA und die westliche Welt sich das irakische Öl sichern?
Nordhaus: Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, der Krieg führt zum Auseinanderbrechen des Opec-Ölkartells. Wenn dann ein neues Regime im Irak wie verrückt Öl förderte, fiele der Ölpreis dramatisch. Zugleich stiege allerdings unsere Abhängigkeit vom Öl aus dem Persischen Golf noch mehr.
Zeit: Auch ohne eine Zunahme der Fördermengen – ist die langfristige Sicherung der Ölversorgung nicht allein schon ein ökonomisch sinnvoller Kriegsgrund für die USA?
Nordhaus: Ich glaube nicht, dass die politische Ausrichtung eines irakischen Regimes einen wirklichen Unterschied macht. Öl ist das Hauptexportprodukt des Irak, die Iraker müssen es einfach exportieren. Der Westen bekommt das Öl also in jedem Fall. Wenn die amerikanische Regierung einigermaßen klar über diese Dinge nachdenkt – was ich nicht garantieren kann, aber nehmen wir es einmal an –, dann ist Öl kein wesentlicher Kriegsgrund.
Zeit: Auch ohne Öl haben Kriege in der Vergangenheit oft Wirtschaftsaufschwünge ausgelöst. Schon allein weil der Staat plötzlich so viel für Waffen ausgibt.
Nordhaus: Historisch gesehen stimmt das. Kriegszeiten waren oft Zeiten der Vollbeschäftigung und des schnellen Wirtschaftswachstums in Amerika, siehe die beiden Weltkriege, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg. Aber schon im ersten Golfkrieg 1990/91 war es nicht mehr so. Ganz im Gegenteil, die Wirtschaft rutschte in eine Rezession.
Zeit: Worin lag der Unterschied?
Nordhaus: In der Vergangenheit gingen amerikanische Kriege tatsächlich mit einem rapiden Anstieg der Verteidigungsausgaben einher. Im Zweiten Weltkrieg betrugen die zusätzlichen Rüstungsausgaben 41 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, im Koreakrieg acht Prozent, im Vietnamkrieg immerhin noch zwei Prozent. Aber Sie merken schon, diese Zahl sinkt, und im Golfkrieg 1990/91 gab es kaum noch einen Anstieg der Verteidigungsausgaben über das Normalmaß hinaus. Also dominieren in der Wirkung auf die Wirtschaft andere Faktoren – die Psychologie, der Ölpreis. Im Golfkrieg fiel die Börse, das Konsumentenvertrauen verschwand, der Dollar fiel. Die Lage besserte sich erst wieder, als der Krieg vorbei war. Diesmal wird es uns nicht anders ergehen.
Zeit: Aber die Börsenkurse sind ja bereits im Keller, die Zuversicht der Verbraucher und der Unternehmer ist gedrückt wegen der Furcht vor einem Krieg, der Ölpreis steigt. Könnte nicht allein der Ausbruch eines Krieges die Spannung lösen und die Stimmung wieder anheben? Ganz zu schweigen von frühen militärischen Erfolgen?
Nordhaus: Im Fall eines kurzen, günstig verlaufenden Krieges rechne ich in der Tat mit einer kurzfristig positiven Wirkung. Aber, ehrlich gesagt, mit keiner besonders großen. Wir reden hier von Bruchteilen eines Prozents an zusätzlichem Wachstum. Wenn es andererseits einen längeren, komplizierten Krieg gibt, werden wir erneut in eine Rezession schlittern.
Zeit: Nun hat Präsident Bush ja vorgesorgt und in den vergangenen Monaten gleich mehrere Steuersenkungs- und „Stimulations“-Programme verabschiedet. Werden die das Schlimmste verhindern?
Nordhaus: Möglich, aber ich sehe es mit Sorge, dass die Regierung Bush zugleich den Bundeshaushalt plündert. Aus Überschüssen in Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind inzwischen Defizite in derselben Größenordnung geworden, und es wird noch deutlich schlimmer kommen. Diese Verschlechterung kann man nur zur Hälfte dem Konjunkturzyklus zuschreiben.
Zeit: In der jetzigen Lage ist ein unausgeglichener Haushalt wohl das kleinere Problem.
Nordhaus: Ich glaube, dass wir mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt anstreben sollten. Aber in der Tat, in einem wirtschaftlichen Abschwung hat das nicht unbedingt Priorität. Sie kennen dieses Problem ja aus Deutschland: Ausgerechnet in Zeiten ökonomischer Probleme und hoher Arbeitslosigkeit fordert der Stabilitätspakt, die Haushalte zu beschneiden, was die Krise nur noch verschlimmert.
Zeit: Sprich, die amerikanischen Steuersenkungen kommen zur rechten Zeit.
Nordhaus: Das eine Problem ist, dass die Regierung Bush, wie einst die frühe Regierung Reagan, das Haushaltsdefizit praktisch ignoriert. Das andere Problem liegt darin, dass die jüngsten Steuersenkungen relativ wenig Wirkung zeigen werden. Um die Konjunktur anzukurbeln, müsste man die Steuern viel schneller senken oder sie stärker den Mittelschichten und den ärmeren Amerikanern zugute kommen lassen. Denn die tragen einen deutlich größeren Anteil ihres Einkommens in die Geschäfte als die reichen Amerikaner.
Zeit: Als wesentlichen Kostenpunkt eines Golfkriegs haben Sie in Ihrer Studie die längere Besetzung des Iraks aufgeführt, die möglichen Kosten einer „Nationenbildung“. Wird es dazu wirklich kommen? Eigentlich will sich die US-Regierung aus solchen Dingen doch heraushalten.
Nordhaus: Allmählich begreift sie, dass sie zumindest kurzfristig um solche Kosten nicht herumkommt. Die letzte offizielle Schätzung geht von 18 Monaten Besetzungszeit aus, persönlich glaube ich an ein realistisches Minimum von fünf Jahren. Warum sollte der Aufbau eines neuen Staates im Irak einfacher sein als in Jugoslawien?
Zeit: Man könnte die Besetzung den Vereinten Nationen überlassen oder einzelnen anderen Ländern.
Nordhaus: Sicher, Pakistan zum Beispiel. Der wesentliche Punkt ist, dass nach einem Krieg politische Stabilität im Irak herrschen muss. Dazu sind nach meiner Einschätzung Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Besatzungssoldaten nötig. Und es kann passieren, dass dies dem Kongress nach anderthalb Jahren als viel zu teuer erscheint, dass die Truppen dann abgezogen werden und ein gewaltiges Chaos ausbricht – sozusagen das Modell Afghanistan.
Zeit: Der Irak ist aber kein armes Land. Könnte man nicht zumindest die Kosten für die Besetzung und den Wiederaufbau mit Öl decken?
Nordhaus: Der Irak wird nach dem Krieg jährlich für 20 Milliarden Dollar Öl exportieren. Das ist nicht sehr viel. Erst recht nicht, wenn man von den Erträgen erst mal die Bevölkerung versorgt. Man kann die Iraker ja kaum verhungern lassen.
Zeit: Sie haben in der Vergangenheit argumentiert, die amerikanische Öffentlichkeit werde den Krieg nur unter einer Bedingung unterstützen: Wenn die Kosten an Menschenleben, aber auch die ökonomischen Kosten gering bleiben.
Nordhaus: Richtig, wir müssen allerdings zwischen dem Krieg selbst und der Zeit danach unterscheiden. Die Kosten des Krieges werden sehr sichtbar sein. Wenn die ersten grausigen Szenen aus Bagdad über die Bildschirme flimmern, mit getroffenen Zivilisten und zerstörten Häusern, werden sich viele Amerikaner sehr schnell gegen den Krieg wenden. Die Nachkriegssituation ist viel schwieriger zu analysieren. Viel hängt von den Kosten ab, wer sich daran beteiligt, ob eine erneute Rezession kommt oder nicht. Eines sage ich jedenfalls heute schon sicher voraus: Wenn der Krieg schlecht verläuft und die Konjunktur in Mitleidenschaft zieht, dann wird es politisch bald sehr übel für George W. Bush aussehen.
Die Fragen stellte Thomas Fischermann
NEW YORK TIMES - 05.01.2003
A War for Oil?
By THOMAS L. FRIEDMAN
Our family spent winter vacation in Colorado, and one day I saw the most unusual site: two women marching around the Aspen Mountain ski lift, waving signs protesting against war in Iraq. One sign said: "Just War or Just Oil?" As I watched this two-woman demonstration, I couldn`t help notice the auto traffic whizzing by them: one gas-guzzling S.U.V. or Jeep after another, with even a Humvee or two tossed in for good measure. The whole scene made me wonder whether those two women weren`t — indeed — asking the right question: Is the war that the Bush team is preparing to launch in Iraq really a war for oil?
My short answer is yes. Any war we launch in Iraq will certainly be — in part — about oil. To deny that is laughable. But whether it is seen to be only about oil will depend on how we behave before an invasion and what we try to build once we`re there.
I say this possible Iraq war is partly about oil because it is impossible to explain the Bush team`s behavior otherwise. Why are they going after Saddam Hussein with the 82nd Airborne and North Korea with diplomatic kid gloves — when North Korea already has nuclear weapons, the missiles to deliver them, a record of selling dangerous weapons to anyone with cash, 100,000 U.S. troops in its missile range and a leader who is even more cruel to his own people than Saddam?
One reason, of course, is that it is easier to go after Saddam. But the other reason is oil — even if the president doesn`t want to admit it. (Mr. Bush`s recent attempt to hype the Iraqi threat by saying that an Iraqi attack on America — which is most unlikely — "would cripple our economy" was embarrassing. It made the president look as if he was groping for an excuse to go to war, absent a smoking gun.)
Let`s cut the nonsense. The primary reason the Bush team is more focused on Saddam is because if he were to acquire weapons of mass destruction, it might give him the leverage he has long sought — not to attack us, but to extend his influence over the world`s largest source of oil, the Persian Gulf.
But wait a minute. There is nothing illegitimate or immoral about the U.S. being concerned that an evil, megalomaniacal dictator might acquire excessive influence over the natural resource that powers the world`s industrial base.
"Would those women protesting in Aspen prefer that Saddam Hussein control the oil instead — is that morally better?" asks Michael Mandelbaum, the Johns Hopkins foreign policy expert and author of "The Ideas That Conquered the World." "Up to now, Saddam has used his oil wealth not to benefit his people, but to wage war against all his neighbors, build lavish palaces and acquire weapons of mass destruction."
This is a good point, but the Bush team would have a stronger case for fighting a war partly for oil if it made clear by its behavior that it was acting for the benefit of the planet, not simply to fuel American excesses.
I have no problem with a war for oil — if we accompany it with a real program for energy conservation. But when we tell the world that we couldn`t care less about climate change, that we feel entitled to drive whatever big cars we feel like, that we feel entitled to consume however much oil we like, the message we send is that a war for oil in the gulf is not a war to protect the world`s right to economic survival — but our right to indulge. Now that will be seen as immoral.
And should we end up occupying Iraq, and the first thing we do is hand out drilling concessions to U.S. oil companies alone, that perception would only be intensified.
And that leads to my second point.
If we occupy Iraq and simply install a more pro-U.S. autocrat to run the Iraqi gas station (as we have in other Arab oil states), then this war partly for oil would also be immoral.
If, on the other hand, the Bush team, and the American people, prove willing to stay in Iraq and pay the full price, in money and manpower, needed to help Iraqis build a more progressive, democratizing Arab state — one that would use its oil income for the benefit of all its people and serve as a model for its neighbors — then a war partly over oil would be quite legitimate.
It would be a critical step toward building a better Middle East.
So, I have no problem with a war for oil — provided that it is to fuel the first progressive Arab regime, and not just our S.U.V.`s, and provided we behave in a way that makes clear to the world we are protecting everyone`s access to oil at reasonable prices — not simply our right to binge on it.
DIE WELT - 18.01.2003
"Wir dürfen uns nicht selbst belügen"
US-Außenminister Colin Powell fordert einen kompromisslosen Umgang mit dem Irak. Washington werde notfalls "individuelle Entscheidungen" treffen – Interview
Washington - Gut eine Woche vor dem Abschlussbericht über die Waffenkontrollen im Irak wächst der Druck der USA auf die UNO. Washington will Chefinspekteur Hans Blix keine zusätzliche Zeit für Untersuchungen gewähren. Pedro Rodríguez sprach mit US-Außenminister Colin Powell über die Haltung seiner Regierung.
DIE WELT: Bedauert Ihre Regierung, dass Sie die UNO überhaupt in der Irak-Frage konsultiert hat?
Colin Powell: Im Gegenteil – die internationale Gemeinschaft muss sich mit dem Problem Irak auseinander setzen. Aus diesem Grund hat Präsident George W. Bush die Vollversammlung in New York an ihre Verantwortung erinnert. Er hat sie erinnert an all die in den vergangenen zwölf Jahren systematisch von Bagdad ignorierten Resolutionen. Wir sprechen hier über ein Problem der UNO. Die Resolution 1441 sagt ganz klar, dass die Chefinspekteure Hans Blix und Mohammed el Baradei den Sicherheitsrat am 27. Januar informieren müssen. Und dass danach jedes der fünf ständigen Mitglieder seine Konsequenzen aus dem Bericht ziehen muss. Bis dahin werden wir abwarten – aber nach allem, was wir bisher erfahren haben, erfüllt der Irak die in der Resolution gestellten Forderungen in keiner Weise. Bagdad kooperiert nicht, es hat keine wahrheitsgemäßen Deklarationen geliefert, es erschwert den Zugang zu Dokumenten, belügt die Inspekteure und behindert deren Arbeit. Die Frage, die sich die USA und die Mitglieder des Sicherheitsrats am 27. Januar stellen müssen, ist eine ganz einfache: Kommt der Irak der Resolution nach? Hat Bagdad seine Waffen wirklich vernichtet? Darüber wird der Rat urteilen müssen. Und da dürfen wir uns nicht selbst belügen.
DIE WELT: Was wird im Rat die entscheidende Nagelprobe sein?
Powell: In diesem Fall liegt die ganze Beweislast bei einem Regime, das schon früher Massenvernichtungswaffen zu entwickeln versucht hat, dies noch immer beabsichtigt und auch die Kapazitäten dazu hat. Genau das sind die Tatsachen – auch wenn es sehr viele Leute gibt, die angeblich keinerlei Beweise dafür sehen, nichts von all dem wissen wollen und sich am liebsten gar nicht mit diesem Problem auseinander setzen.
DIE WELT: Derzeit entsteht der Eindruck, dass die USA den Waffeninspekteuren keine weitere Zeit mehr gewähren wollen . . .
Powell: Die Kontrolleure sind doch überhaupt erst in den Irak zurückgekehrt, weil wir klar gesagt haben, dass Saddam Hussein auf die eine oder andere Art entwaffnet werden muss. Der Militäraufmarsch der USA und anderer Alliierter ist Teil des diplomatischen Drucks, den wir auf Bagdad ausüben. Präsident Bush hat sich noch nicht für einen Krieg entschieden. Er hat gesagt, dass er eine friedliche Lösung gern sähe, aber wenn es diese nicht gibt, dann ist die internationale Gemeinschaft verpflichtet, den Irak mit Gewalt zu entwaffnen. Und da ist der 27. Januar ein wichtiger Tag, an dem wir beginnen müssen, gemeinsame und auch individuelle Entscheidungen zu treffen.
DIE WELT: Woher kommt dann die plötzliche Eile Washingtons? Möchte Präsident Bush mit dem Irak fertig sein, bevor er in einem Jahr in New Hampshire den Wahlkampf für seine Wiederwahl startet?
Powell: Aber nein. Das alles hat nichts mit unserer Innenpolitik zu tun. Aber wir müssen endlich einer Bedrohung ins Auge sehen, auf die seit vielen Jahren nicht reagiert wird. Wir wollen nicht, dass Bagdad weiter mit uns und der ganzen Welt spielt. Wenn Saddam Hussein in ein oder zwei Jahren plötzlich seine Massenvernichtungswaffen zückt, dann werden wir uns anschauen und fragen, warum niemand etwas zur rechten Zeit dagegen getan hat. Wir beeilen uns absolut nicht mit unserer Beurteilung – ganz im Gegenteil, wir denken, dass dieser Prozess in den vergangenen zwölf Jahren ziemlich langsam fortgeschritten ist.
DIE WELT: Zieht die US-Regierung eine zweite Resolution des Sicherheitsrates in Betracht? Und braucht sie diese überhaupt?
Powell: Eine zweite Resolution ist möglich. Aber wir haben immer klar gesagt, dass die USA – auch ohne eine zweite Abstimmung im Rat – sich das Recht zu handeln vorbehalten, wenn der Irak noch immer Massenvernichtungswaffen besitzt und sein Arsenal sogar auszubauen versucht. Wir denken, dass das internationale Recht genügend Autorität besitzt, um angesichts der zahllosen Verstöße gegen UN-Resolutionen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und das Land zu entwaffnen. Über eine zweite Resolution will ich nicht spekulieren. Aber es ist uns bewusst, dass viele Nationen gern eine solche hätten, als legale Basis für Militäraktionen. Das berücksichtigen wir auch. Wir sind geduldig und übereilen nichts. Gleichzeitig aber können die zu ziehenden Konsequenzen nicht verhindert werden, nur weil manch einer Aktionen befürchtet, die ihm nicht passen und die er nicht unterstützen will. Saddam Hussein hat mit der Resolution 1441 seine letzte Chance bekommen – aber alles deutet bisher darauf hin, dass er diese Chance nicht nutzt.
DIE WELT: Wie berechtigt ist die Kritik, dass Washington den Irak und Nordkorea mit zwei verschiedenen Maßen misst?
Powell: Wir haben im Fall des Irak zwölf Jahre lang den diplomatischen Weg versucht. Bagdad aber hat gelernt, dies zu missbrauchen. Was Nordkorea betrifft, da hat man acht Jahre lang diplomatische Mittel eingesetzt und schließlich in einer Situation – die nicht viel anders war als die heutige – einen Rahmen für die Verständigung gefunden. Und dabei hat Clinton, wie man weiß, eine militärische Intervention zum Schutz Südkoreas und unserer eigenen Interessen seinerzeit nicht ausgeschlossen. Acht Jahre lang hat die internationale Gemeinschaft, haben die USA geglaubt, dass der Geist wieder in der Flasche wäre. Als wir unsere Beziehungen zu Nordkorea weiterentwickeln wollten, haben wir auf einmal herausgefunden, dass sie Uran anreicherten. Und als wir Pjöngjang um eine Erklärung dafür baten, haben sie den Verstoß gegenüber drei unserer besten Übersetzer zugegeben – auch wenn dort jetzt das Gegenteil behauptet wird. Das war vor drei Monaten. Wir wollen keine Krise, wir wollen auch keinen Krieg, wir haben keine bösen Absichten gegenüber Nordkorea. Aber wir sind besorgt, weil das Land seine Zusagen gebrochen hat, und jetzt suchen wir nach einer diplomatischen Lösung. Ich sehe da keinen Widerspruch. Wir haben nie gesagt, dass alle Mitglieder der „Achse des Bösen“ das bekämen, was sie verdienen. Was wir gesagt haben, ist, dass diese Länder Dinge tun, die ihrem Volk oder der Welt schaden. Nur weil wir bisweilen auf eine bestimmte Art handeln, heißt das noch lange nicht, dass das immer und überall der Fall sein muss.
DIE WELT: Besorgt Sie der weltweit aufkeimende Antiamerikanismus und das mögliche Erliegen imperialistischer Verführungen?
Powell: Es gibt Antiamerikanismus. Aber in Wellen, die kommen und gehen. Ich hoffe, dass wir die internationale Gemeinschaft davon überzeugen können, dass das, was wir tun, nichts mit einem US-Imperialismus zu tun hat. Die USA sind keine imperialistische Macht. Wir sind keine Kolonialherren gewesen, ganz im Gegenteil.
"Ein Krieg ums Öl ist ökonomischer Unsinn"
Das Ende Saddam Husseins würde den Amerikanern wirtschaftlich nicht nützen – ein ZEIT-Gespräch mit dem Wirtschaftsforscher William Nordhaus
Die Zeit: Professor Nordhaus, Kritiker in aller Welt behaupten, der amerikanische Präsident George Bush wolle den Irak nur wegen des Öls angreifen.
William D. Nordhaus: Das ist ökonomischer Unsinn. Es dürfte für die USA sehr schwer werden, von diesem Krieg zu profitieren. Im Gegenteil, mit Kriegsbeginn wird wahrscheinlich der Ölpreis weiter steigen, das Konsumentenvertrauen einbrechen, und das wird der amerikanischen Volkswirtschaft schaden. Der europäischen übrigens auch.
Zeit: Obwohl es im Augenblick so aussieht, als würden sich die Europäer kaum an diesem Krieg beteiligen. In der Bush-Administration fiel bereits das Wort „Trittbrettfahrer“…
Nordhaus: Richtig, die direkten Kriegskosten werden womöglich allein die USA tragen. Aber die machen ja nur einen Teil der gesamten Kosten aus. Die indirekten Kosten sind größer, und sie entstehen durch die Auswirkungen auf die Konjunktur. Ich habe das einmal durchgerechnet: Bei einem kurzen Krieg lägen die rein militärischen Kosten bei rund 50 Milliarden Dollar und damit bei etwa der Hälfte der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von 100 Milliarden Dollar. Bei einem längeren, schwierigen Krieg beliefen sich die Kriegskosten hingegen auf 140 Milliarden, aber das wäre weniger als ein Zehntel der dann zu erwartenden Gesamtkosten von 1,9 Billionen Dollar. Wohlgemerkt, das sind nur die Kosten für die USA. Die konjunkturellen Schäden blieben natürlich nicht auf ein Land beschränkt.
Zeit: Demnach fallen kurzfristig hohe Kosten an. Aber zahlt es sich nicht langfristig doch aus, wenn die USA und die westliche Welt sich das irakische Öl sichern?
Nordhaus: Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, der Krieg führt zum Auseinanderbrechen des Opec-Ölkartells. Wenn dann ein neues Regime im Irak wie verrückt Öl förderte, fiele der Ölpreis dramatisch. Zugleich stiege allerdings unsere Abhängigkeit vom Öl aus dem Persischen Golf noch mehr.
Zeit: Auch ohne eine Zunahme der Fördermengen – ist die langfristige Sicherung der Ölversorgung nicht allein schon ein ökonomisch sinnvoller Kriegsgrund für die USA?
Nordhaus: Ich glaube nicht, dass die politische Ausrichtung eines irakischen Regimes einen wirklichen Unterschied macht. Öl ist das Hauptexportprodukt des Irak, die Iraker müssen es einfach exportieren. Der Westen bekommt das Öl also in jedem Fall. Wenn die amerikanische Regierung einigermaßen klar über diese Dinge nachdenkt – was ich nicht garantieren kann, aber nehmen wir es einmal an –, dann ist Öl kein wesentlicher Kriegsgrund.
Zeit: Auch ohne Öl haben Kriege in der Vergangenheit oft Wirtschaftsaufschwünge ausgelöst. Schon allein weil der Staat plötzlich so viel für Waffen ausgibt.
Nordhaus: Historisch gesehen stimmt das. Kriegszeiten waren oft Zeiten der Vollbeschäftigung und des schnellen Wirtschaftswachstums in Amerika, siehe die beiden Weltkriege, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg. Aber schon im ersten Golfkrieg 1990/91 war es nicht mehr so. Ganz im Gegenteil, die Wirtschaft rutschte in eine Rezession.
Zeit: Worin lag der Unterschied?
Nordhaus: In der Vergangenheit gingen amerikanische Kriege tatsächlich mit einem rapiden Anstieg der Verteidigungsausgaben einher. Im Zweiten Weltkrieg betrugen die zusätzlichen Rüstungsausgaben 41 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, im Koreakrieg acht Prozent, im Vietnamkrieg immerhin noch zwei Prozent. Aber Sie merken schon, diese Zahl sinkt, und im Golfkrieg 1990/91 gab es kaum noch einen Anstieg der Verteidigungsausgaben über das Normalmaß hinaus. Also dominieren in der Wirkung auf die Wirtschaft andere Faktoren – die Psychologie, der Ölpreis. Im Golfkrieg fiel die Börse, das Konsumentenvertrauen verschwand, der Dollar fiel. Die Lage besserte sich erst wieder, als der Krieg vorbei war. Diesmal wird es uns nicht anders ergehen.
Zeit: Aber die Börsenkurse sind ja bereits im Keller, die Zuversicht der Verbraucher und der Unternehmer ist gedrückt wegen der Furcht vor einem Krieg, der Ölpreis steigt. Könnte nicht allein der Ausbruch eines Krieges die Spannung lösen und die Stimmung wieder anheben? Ganz zu schweigen von frühen militärischen Erfolgen?
Nordhaus: Im Fall eines kurzen, günstig verlaufenden Krieges rechne ich in der Tat mit einer kurzfristig positiven Wirkung. Aber, ehrlich gesagt, mit keiner besonders großen. Wir reden hier von Bruchteilen eines Prozents an zusätzlichem Wachstum. Wenn es andererseits einen längeren, komplizierten Krieg gibt, werden wir erneut in eine Rezession schlittern.
Zeit: Nun hat Präsident Bush ja vorgesorgt und in den vergangenen Monaten gleich mehrere Steuersenkungs- und „Stimulations“-Programme verabschiedet. Werden die das Schlimmste verhindern?
Nordhaus: Möglich, aber ich sehe es mit Sorge, dass die Regierung Bush zugleich den Bundeshaushalt plündert. Aus Überschüssen in Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind inzwischen Defizite in derselben Größenordnung geworden, und es wird noch deutlich schlimmer kommen. Diese Verschlechterung kann man nur zur Hälfte dem Konjunkturzyklus zuschreiben.
Zeit: In der jetzigen Lage ist ein unausgeglichener Haushalt wohl das kleinere Problem.
Nordhaus: Ich glaube, dass wir mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt anstreben sollten. Aber in der Tat, in einem wirtschaftlichen Abschwung hat das nicht unbedingt Priorität. Sie kennen dieses Problem ja aus Deutschland: Ausgerechnet in Zeiten ökonomischer Probleme und hoher Arbeitslosigkeit fordert der Stabilitätspakt, die Haushalte zu beschneiden, was die Krise nur noch verschlimmert.
Zeit: Sprich, die amerikanischen Steuersenkungen kommen zur rechten Zeit.
Nordhaus: Das eine Problem ist, dass die Regierung Bush, wie einst die frühe Regierung Reagan, das Haushaltsdefizit praktisch ignoriert. Das andere Problem liegt darin, dass die jüngsten Steuersenkungen relativ wenig Wirkung zeigen werden. Um die Konjunktur anzukurbeln, müsste man die Steuern viel schneller senken oder sie stärker den Mittelschichten und den ärmeren Amerikanern zugute kommen lassen. Denn die tragen einen deutlich größeren Anteil ihres Einkommens in die Geschäfte als die reichen Amerikaner.
Zeit: Als wesentlichen Kostenpunkt eines Golfkriegs haben Sie in Ihrer Studie die längere Besetzung des Iraks aufgeführt, die möglichen Kosten einer „Nationenbildung“. Wird es dazu wirklich kommen? Eigentlich will sich die US-Regierung aus solchen Dingen doch heraushalten.
Nordhaus: Allmählich begreift sie, dass sie zumindest kurzfristig um solche Kosten nicht herumkommt. Die letzte offizielle Schätzung geht von 18 Monaten Besetzungszeit aus, persönlich glaube ich an ein realistisches Minimum von fünf Jahren. Warum sollte der Aufbau eines neuen Staates im Irak einfacher sein als in Jugoslawien?
Zeit: Man könnte die Besetzung den Vereinten Nationen überlassen oder einzelnen anderen Ländern.
Nordhaus: Sicher, Pakistan zum Beispiel. Der wesentliche Punkt ist, dass nach einem Krieg politische Stabilität im Irak herrschen muss. Dazu sind nach meiner Einschätzung Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Besatzungssoldaten nötig. Und es kann passieren, dass dies dem Kongress nach anderthalb Jahren als viel zu teuer erscheint, dass die Truppen dann abgezogen werden und ein gewaltiges Chaos ausbricht – sozusagen das Modell Afghanistan.
Zeit: Der Irak ist aber kein armes Land. Könnte man nicht zumindest die Kosten für die Besetzung und den Wiederaufbau mit Öl decken?
Nordhaus: Der Irak wird nach dem Krieg jährlich für 20 Milliarden Dollar Öl exportieren. Das ist nicht sehr viel. Erst recht nicht, wenn man von den Erträgen erst mal die Bevölkerung versorgt. Man kann die Iraker ja kaum verhungern lassen.
Zeit: Sie haben in der Vergangenheit argumentiert, die amerikanische Öffentlichkeit werde den Krieg nur unter einer Bedingung unterstützen: Wenn die Kosten an Menschenleben, aber auch die ökonomischen Kosten gering bleiben.
Nordhaus: Richtig, wir müssen allerdings zwischen dem Krieg selbst und der Zeit danach unterscheiden. Die Kosten des Krieges werden sehr sichtbar sein. Wenn die ersten grausigen Szenen aus Bagdad über die Bildschirme flimmern, mit getroffenen Zivilisten und zerstörten Häusern, werden sich viele Amerikaner sehr schnell gegen den Krieg wenden. Die Nachkriegssituation ist viel schwieriger zu analysieren. Viel hängt von den Kosten ab, wer sich daran beteiligt, ob eine erneute Rezession kommt oder nicht. Eines sage ich jedenfalls heute schon sicher voraus: Wenn der Krieg schlecht verläuft und die Konjunktur in Mitleidenschaft zieht, dann wird es politisch bald sehr übel für George W. Bush aussehen.
Die Fragen stellte Thomas Fischermann
NEW YORK TIMES - 05.01.2003
A War for Oil?
By THOMAS L. FRIEDMAN
Our family spent winter vacation in Colorado, and one day I saw the most unusual site: two women marching around the Aspen Mountain ski lift, waving signs protesting against war in Iraq. One sign said: "Just War or Just Oil?" As I watched this two-woman demonstration, I couldn`t help notice the auto traffic whizzing by them: one gas-guzzling S.U.V. or Jeep after another, with even a Humvee or two tossed in for good measure. The whole scene made me wonder whether those two women weren`t — indeed — asking the right question: Is the war that the Bush team is preparing to launch in Iraq really a war for oil?
My short answer is yes. Any war we launch in Iraq will certainly be — in part — about oil. To deny that is laughable. But whether it is seen to be only about oil will depend on how we behave before an invasion and what we try to build once we`re there.
I say this possible Iraq war is partly about oil because it is impossible to explain the Bush team`s behavior otherwise. Why are they going after Saddam Hussein with the 82nd Airborne and North Korea with diplomatic kid gloves — when North Korea already has nuclear weapons, the missiles to deliver them, a record of selling dangerous weapons to anyone with cash, 100,000 U.S. troops in its missile range and a leader who is even more cruel to his own people than Saddam?
One reason, of course, is that it is easier to go after Saddam. But the other reason is oil — even if the president doesn`t want to admit it. (Mr. Bush`s recent attempt to hype the Iraqi threat by saying that an Iraqi attack on America — which is most unlikely — "would cripple our economy" was embarrassing. It made the president look as if he was groping for an excuse to go to war, absent a smoking gun.)
Let`s cut the nonsense. The primary reason the Bush team is more focused on Saddam is because if he were to acquire weapons of mass destruction, it might give him the leverage he has long sought — not to attack us, but to extend his influence over the world`s largest source of oil, the Persian Gulf.
But wait a minute. There is nothing illegitimate or immoral about the U.S. being concerned that an evil, megalomaniacal dictator might acquire excessive influence over the natural resource that powers the world`s industrial base.
"Would those women protesting in Aspen prefer that Saddam Hussein control the oil instead — is that morally better?" asks Michael Mandelbaum, the Johns Hopkins foreign policy expert and author of "The Ideas That Conquered the World." "Up to now, Saddam has used his oil wealth not to benefit his people, but to wage war against all his neighbors, build lavish palaces and acquire weapons of mass destruction."
This is a good point, but the Bush team would have a stronger case for fighting a war partly for oil if it made clear by its behavior that it was acting for the benefit of the planet, not simply to fuel American excesses.
I have no problem with a war for oil — if we accompany it with a real program for energy conservation. But when we tell the world that we couldn`t care less about climate change, that we feel entitled to drive whatever big cars we feel like, that we feel entitled to consume however much oil we like, the message we send is that a war for oil in the gulf is not a war to protect the world`s right to economic survival — but our right to indulge. Now that will be seen as immoral.
And should we end up occupying Iraq, and the first thing we do is hand out drilling concessions to U.S. oil companies alone, that perception would only be intensified.
And that leads to my second point.
If we occupy Iraq and simply install a more pro-U.S. autocrat to run the Iraqi gas station (as we have in other Arab oil states), then this war partly for oil would also be immoral.
If, on the other hand, the Bush team, and the American people, prove willing to stay in Iraq and pay the full price, in money and manpower, needed to help Iraqis build a more progressive, democratizing Arab state — one that would use its oil income for the benefit of all its people and serve as a model for its neighbors — then a war partly over oil would be quite legitimate.
It would be a critical step toward building a better Middle East.
So, I have no problem with a war for oil — provided that it is to fuel the first progressive Arab regime, and not just our S.U.V.`s, and provided we behave in a way that makes clear to the world we are protecting everyone`s access to oil at reasonable prices — not simply our right to binge on it.
DIE WELT - 18.01.2003
"Wir dürfen uns nicht selbst belügen"
US-Außenminister Colin Powell fordert einen kompromisslosen Umgang mit dem Irak. Washington werde notfalls "individuelle Entscheidungen" treffen – Interview
Washington - Gut eine Woche vor dem Abschlussbericht über die Waffenkontrollen im Irak wächst der Druck der USA auf die UNO. Washington will Chefinspekteur Hans Blix keine zusätzliche Zeit für Untersuchungen gewähren. Pedro Rodríguez sprach mit US-Außenminister Colin Powell über die Haltung seiner Regierung.
DIE WELT: Bedauert Ihre Regierung, dass Sie die UNO überhaupt in der Irak-Frage konsultiert hat?
Colin Powell: Im Gegenteil – die internationale Gemeinschaft muss sich mit dem Problem Irak auseinander setzen. Aus diesem Grund hat Präsident George W. Bush die Vollversammlung in New York an ihre Verantwortung erinnert. Er hat sie erinnert an all die in den vergangenen zwölf Jahren systematisch von Bagdad ignorierten Resolutionen. Wir sprechen hier über ein Problem der UNO. Die Resolution 1441 sagt ganz klar, dass die Chefinspekteure Hans Blix und Mohammed el Baradei den Sicherheitsrat am 27. Januar informieren müssen. Und dass danach jedes der fünf ständigen Mitglieder seine Konsequenzen aus dem Bericht ziehen muss. Bis dahin werden wir abwarten – aber nach allem, was wir bisher erfahren haben, erfüllt der Irak die in der Resolution gestellten Forderungen in keiner Weise. Bagdad kooperiert nicht, es hat keine wahrheitsgemäßen Deklarationen geliefert, es erschwert den Zugang zu Dokumenten, belügt die Inspekteure und behindert deren Arbeit. Die Frage, die sich die USA und die Mitglieder des Sicherheitsrats am 27. Januar stellen müssen, ist eine ganz einfache: Kommt der Irak der Resolution nach? Hat Bagdad seine Waffen wirklich vernichtet? Darüber wird der Rat urteilen müssen. Und da dürfen wir uns nicht selbst belügen.
DIE WELT: Was wird im Rat die entscheidende Nagelprobe sein?
Powell: In diesem Fall liegt die ganze Beweislast bei einem Regime, das schon früher Massenvernichtungswaffen zu entwickeln versucht hat, dies noch immer beabsichtigt und auch die Kapazitäten dazu hat. Genau das sind die Tatsachen – auch wenn es sehr viele Leute gibt, die angeblich keinerlei Beweise dafür sehen, nichts von all dem wissen wollen und sich am liebsten gar nicht mit diesem Problem auseinander setzen.
DIE WELT: Derzeit entsteht der Eindruck, dass die USA den Waffeninspekteuren keine weitere Zeit mehr gewähren wollen . . .
Powell: Die Kontrolleure sind doch überhaupt erst in den Irak zurückgekehrt, weil wir klar gesagt haben, dass Saddam Hussein auf die eine oder andere Art entwaffnet werden muss. Der Militäraufmarsch der USA und anderer Alliierter ist Teil des diplomatischen Drucks, den wir auf Bagdad ausüben. Präsident Bush hat sich noch nicht für einen Krieg entschieden. Er hat gesagt, dass er eine friedliche Lösung gern sähe, aber wenn es diese nicht gibt, dann ist die internationale Gemeinschaft verpflichtet, den Irak mit Gewalt zu entwaffnen. Und da ist der 27. Januar ein wichtiger Tag, an dem wir beginnen müssen, gemeinsame und auch individuelle Entscheidungen zu treffen.
DIE WELT: Woher kommt dann die plötzliche Eile Washingtons? Möchte Präsident Bush mit dem Irak fertig sein, bevor er in einem Jahr in New Hampshire den Wahlkampf für seine Wiederwahl startet?
Powell: Aber nein. Das alles hat nichts mit unserer Innenpolitik zu tun. Aber wir müssen endlich einer Bedrohung ins Auge sehen, auf die seit vielen Jahren nicht reagiert wird. Wir wollen nicht, dass Bagdad weiter mit uns und der ganzen Welt spielt. Wenn Saddam Hussein in ein oder zwei Jahren plötzlich seine Massenvernichtungswaffen zückt, dann werden wir uns anschauen und fragen, warum niemand etwas zur rechten Zeit dagegen getan hat. Wir beeilen uns absolut nicht mit unserer Beurteilung – ganz im Gegenteil, wir denken, dass dieser Prozess in den vergangenen zwölf Jahren ziemlich langsam fortgeschritten ist.
DIE WELT: Zieht die US-Regierung eine zweite Resolution des Sicherheitsrates in Betracht? Und braucht sie diese überhaupt?
Powell: Eine zweite Resolution ist möglich. Aber wir haben immer klar gesagt, dass die USA – auch ohne eine zweite Abstimmung im Rat – sich das Recht zu handeln vorbehalten, wenn der Irak noch immer Massenvernichtungswaffen besitzt und sein Arsenal sogar auszubauen versucht. Wir denken, dass das internationale Recht genügend Autorität besitzt, um angesichts der zahllosen Verstöße gegen UN-Resolutionen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und das Land zu entwaffnen. Über eine zweite Resolution will ich nicht spekulieren. Aber es ist uns bewusst, dass viele Nationen gern eine solche hätten, als legale Basis für Militäraktionen. Das berücksichtigen wir auch. Wir sind geduldig und übereilen nichts. Gleichzeitig aber können die zu ziehenden Konsequenzen nicht verhindert werden, nur weil manch einer Aktionen befürchtet, die ihm nicht passen und die er nicht unterstützen will. Saddam Hussein hat mit der Resolution 1441 seine letzte Chance bekommen – aber alles deutet bisher darauf hin, dass er diese Chance nicht nutzt.
DIE WELT: Wie berechtigt ist die Kritik, dass Washington den Irak und Nordkorea mit zwei verschiedenen Maßen misst?
Powell: Wir haben im Fall des Irak zwölf Jahre lang den diplomatischen Weg versucht. Bagdad aber hat gelernt, dies zu missbrauchen. Was Nordkorea betrifft, da hat man acht Jahre lang diplomatische Mittel eingesetzt und schließlich in einer Situation – die nicht viel anders war als die heutige – einen Rahmen für die Verständigung gefunden. Und dabei hat Clinton, wie man weiß, eine militärische Intervention zum Schutz Südkoreas und unserer eigenen Interessen seinerzeit nicht ausgeschlossen. Acht Jahre lang hat die internationale Gemeinschaft, haben die USA geglaubt, dass der Geist wieder in der Flasche wäre. Als wir unsere Beziehungen zu Nordkorea weiterentwickeln wollten, haben wir auf einmal herausgefunden, dass sie Uran anreicherten. Und als wir Pjöngjang um eine Erklärung dafür baten, haben sie den Verstoß gegenüber drei unserer besten Übersetzer zugegeben – auch wenn dort jetzt das Gegenteil behauptet wird. Das war vor drei Monaten. Wir wollen keine Krise, wir wollen auch keinen Krieg, wir haben keine bösen Absichten gegenüber Nordkorea. Aber wir sind besorgt, weil das Land seine Zusagen gebrochen hat, und jetzt suchen wir nach einer diplomatischen Lösung. Ich sehe da keinen Widerspruch. Wir haben nie gesagt, dass alle Mitglieder der „Achse des Bösen“ das bekämen, was sie verdienen. Was wir gesagt haben, ist, dass diese Länder Dinge tun, die ihrem Volk oder der Welt schaden. Nur weil wir bisweilen auf eine bestimmte Art handeln, heißt das noch lange nicht, dass das immer und überall der Fall sein muss.
DIE WELT: Besorgt Sie der weltweit aufkeimende Antiamerikanismus und das mögliche Erliegen imperialistischer Verführungen?
Powell: Es gibt Antiamerikanismus. Aber in Wellen, die kommen und gehen. Ich hoffe, dass wir die internationale Gemeinschaft davon überzeugen können, dass das, was wir tun, nichts mit einem US-Imperialismus zu tun hat. Die USA sind keine imperialistische Macht. Wir sind keine Kolonialherren gewesen, ganz im Gegenteil.
DIE WELT – 16.01.2003
Bushs Politik ist konsequent
von Mariam Lau
Bagdad ja, Pjöngjang nein:
Washington geht es um eine Friedensordnung in Nahost, nicht um Öl
Fast mit Erleichterung, so scheint es, haben die Gegner eines Kriegs gegen den Irak den Konflikt mit Nordkorea zur Kenntnis genommen. Die triumphierende Logik des Protestes lautet nun auf Demonstrationen von Los Angeles bis Berlin: Ginge es der Regierung Bush wirklich um die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen oder gar um die Installation demokratischer Verhältnisse, dann wäre Nordkorea der dringlichere Kandidat. Die „Inkonsequenz" erklärt man sich, neben dem Verweis auf das Öl, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, gern mit ödipalen Konflikten: George W. Bush müsse die Niederlage seines Vaters ausbügeln, und andere Schlaumeiereien.
Worauf die Forderung nach angeblicher Konsequenz hinausläuft, wissen wir spätestens seit dem Balkankrieg, wo sie auch im Zusammenhang mit Slobodan Milosevic ins Feld geführt wurde: auf ratlose Untätigkeit. Auf diese Weise ist die Intervention gegen Saddam Hussein schon seit etwa einem Jahr auf die lange Bank geschoben worden, was ja nicht nur Herta Däubler-Gmelins entflammbares Gemüt auf die Idee gebracht hat, sie werde eh nur zur Ablenkung von wirtschaftlichen Problemen gebraucht. Mark Steyn spielt im „Spectator" durch, was geschehen wäre, wenn man Saddam schon letztes Frühjahr gestürzt hätte: Arafat wäre nicht mehr im Amt, die Ayatollahs würden ihre Koffer packen müssen, das Königreich Saudi-Arabien wäre vom niedrigen Ölpreis unter Druck gesetzt, Assad hätte sich zum Tee bei der Königin eingefunden, und die europäische Friedensbewegung wäre nicht umgekehrt proportional zum tatsächlichen Kriegsgeschehen angewachsen.
Drohende Kriegsgefahr hat selten zur Förderung von Scharfsinnigkeit beigetragen. Aber der altkluge Hinweis auf die Inkonsequenz der amerikanischen Außenpolitik ist von einer Einfältigkeit, die nur aus Verantwortungsferne entspringen kann. Der richtige Zeitpunkt, gegen Saddam vorzugehen, liegt vor seinem Erwerb von Massenvernichtungswaffen. Wenn er sie einmal hat, kann man nichts mehr tun.
Kim Jong Il hingegen stellt für Amerika keine vergleichbare Gefahr dar: Seoul oder Tokio wären sehr viel plausiblere Ziele für einen Atomwaffenangriff Nordkoreas als Amerika, dessen Antwort es nicht überleben würde.
Den Schaden, den Pjöngjang den USA zufügen könnte, hat es zum größten Teil längst ins Werk gesetzt: die Belieferung Pakistans oder des Iran - und wer weiß wem noch - mit Material zur Entwicklung von Nuklearwaffen. Haschemi Rafsandschani, Ex-Präsident des Iran und einer der berühmten „moderaten Kräfte", hat bereits erklärt, sollte ein islamisches Land die Atombombe besitzen, wäre die israelische Frage ein für alle Mal erledigt.
Wer sich mit der Inkonsequenz der amerikanischen Außenpolitik beschäftigen möchte, muss also nur zum Atlas greifen. Während der Irak eine einflussreiche Kraft in einer labilen Region ist, gibt Nordkorea einen hässlichen kleinen Freak ab, der von Weltmächten und ökonomischen Erfolgsgeschichten umgeben ist. Für Millionen junger Araber ist Saddam der neue Saladin, von dem man sich Revanche für die Demütigungen durch den Westen und den finalen Triumph des Panarabismus über Israel erhofft. Wer möchte in Tokio - oder in Peking - so werden wie Kim Jong Il? Außer seinem nuklearen Gemischtwarenhandel gibt es keinen Grund für die Amerikaner, ihn zu fürchten; überhaupt scheint das Engagement in der Region überflüssig zu sein, wenn nun auch die Südkoreaner, die es ohne Amerika gar nicht geben würde, sich gegen Uncle Sam erheben.
Nur kann man sich jetzt nicht zurückziehen, weil es wie eine Kapitulation aussehen würde. Schon schreiben irakische Zeitungen, man müsse sich nur ein Vorbild an Nordkorea nehmen. Jeder Monat, der ohne Irak-Intervention verstreicht, verlängert die Liste nordkoreanischer Kunden.
Was den beliebten Einwurf „Kein Blut für Öl" angeht, bleibt die Frage: Warum eigentlich nicht? Die Abhängigkeit vom saudi-arabischen Öl zwingt zu Konzessionen an ein weiteres tyrannisches Regime, die Herr Ströbele dann auch wieder als inkonsistent bezeichnen muss.
Für die Zeit nach Saddam sind in der US-Administration nach einem Bericht der „New Republic" zwei Szenarien im Spiel. Die „Tauben" um Colin Powell wollen das Öl in erster Linie dazu nutzen, um den Nachbarn des Irak und der befreiten irakischen Mittelschicht zu signalisieren, dass der Krieg nur zum Sturz von Saddam, nicht zur Kontrolle der Ölfelder geführt worden ist. Eine multilaterale Truppe, die im Prinzip das „Öl für Nahrungsmittel"-Programm der UNO fortsetzt, könnte über eine verstaatlichte Industrie wachen.
Demgegenüber wollen die „Falken" um Donald Rumsfeld das Öl aktiv dazu nutzen, die gesamte Region in Richtung Demokratisierung und Marktliberalisierung zu öffnen - bewusst in Analogie zum Europa der Nachkriegszeit. Empörte Reaktionen aus dem Iran, Syrien oder Saudi-Arabien stören sie nicht, weil sie an einem Erhalt dieser Regimes ohnehin kein Interesse haben.
Von Europa oder der UNO erwartet man nicht allzu viel, und wen könnte das verwundern. Die Häme und Schadenfreude, mit der europäische Medien und Politiker „Inkonsequenz" krähen und eigene, gar ökonomische Interessen nicht zu formulieren wagen, gibt wenig Anlass zur Hoffnung.
Es geht nicht darum, Politik für Chevron und Ölmultis zu machen.Wäre es nach ihnen gegangen, hätte man einfach die Sanktionen gegen den Irak aufgehoben und basta. Es geht, wie damals in Europa, um die Art von Sicherheit, die eben nur in Freiheit existieren kann.
DIE WELT - 23.12.2002
Europa – ein Wintermärchen
von Shlomo Avineri
Denk` ich an Europa in der Nacht ...“ – diese Anspielung auf Heines „Deutschland, ein Wintermärchen“ drängt sich auf, wenn man einen kritischen Blick auf das heutige Europa wirft. Denn durch die äußerst problematischen Einstellungen vieler Europäer zur Irak-Frage hallen die Echos der Vergangenheit. Zweimal ist es der Alten Welt im zurückliegenden Jahrhundert nicht gelungen, aus eigener Kraft über die Tyrannei zu obsiegen. Vor den eigenen Dämonen wurde sie nur durch eine fremde Macht gerettet: Amerika.
Zunächst gelang es Europa nicht, den Faschismus nieder zu ringen. Hätte es die Vereinigten Staaten nicht gegeben, würden in den meisten europäischen Ländern, mit Ausnahme Großbritanniens, noch immer faschistische oder nazistische Regimes herrschen. Und hätte es später nicht die strategische und ökonomische Zielstrebigkeit der USA gegeben – das Europa der Nachkriegszeit würde Kompromisse mit dem Stalinismus geschlossen haben.
Die gutgemeinte, aber fehlgeleitete Reaktion der Europäer auf die Bedrohung durch Saddam Hussein erinnert bedenklich an den Geist der Appeasement-Politik. Saddam ist offenkundig nicht Hitler – aber einige Parallelen zum Europa des Jahres 1936 sind keineswegs fehl am Platz: Zu jener Zeit hatte das „Dritte Reich“ noch keinen anderen Staat angegriffen, doch es hatte den Versailler Vertrag über Bord geworfen und damit begonnen, unter Verletzung internationaler Abkommen wieder aufzurüsten, es hatte das Rheinland remilitarisiert, den Völkerbund verlassen sowie zu verstehen gegeben, dass es eine Revision der deutschen Grenzen anstrebt. Die demokratische Verfassung Deutschlands war abgeschafft worden, alle politischen Parteien, mit Ausnahme der NSDAP, verboten. Das Regime hatte auch erste Konzentrationslager eingerichtet – für Mitglieder der Opposition, Juden, „Zigeuner“, Homosexuelle. Es hatte Juden aus dem öffentlichen Leben verbannt, Gesetze verabschiedet, die sie diskriminierten, und viele von ihnen enteignet.
Man stelle sich vor, wie anders die Welt heute aussähe, hätten Großbritannien und Frankreich 1936 Gewalt gegen das „Dritte Reich“ eingesetzt. Österreich, die Tschechoslowakei und Polen wären nicht überfallen worden, Europa hätte keine Nazibesetzung durchleiden müssen, es hätte keinen Holocaust gegeben, und nicht zu vergessen: Zehn Millionen Deutsche wären nicht aus ihrer Heimat im Osten vertrieben worden.
Saddam hat in der Vergangenheit schlimmere Verbrechen begangen als Hitler bis zum Jahre 1936: Im nachhinein mag es unpassend klingen, etwas Derartiges zu sagen. Es ist indes eine Tatsache, dass der irakische Diktator die Kurden im Irak schlechter behandelt hat als Hitler die Juden im Jahr 1936. Er griff zwei Länder an – den Iran und Kuwait – und beschoss zwei andere – Israel und Saudi-Arabien – mit Raketen. Er setzte Giftgas gegen innere und äußere Feinde ein. Sein Regime ist viel repressiver als Nazideutschland anno 1936. Außerdem entwickelt er ABC-Waffen und verstößt seit zehn Jahren gegen das Völkerrecht sowie UN-Resolutionen.
Dennoch zögert Europa. Zu zögern, ehe man in den Krieg zieht, ist eine verständliche Regung. Aber wenn man der Meinung ist, Hitler hätte gewaltsam aufgehalten werden sollen – welches sind dann die moralischen und strategischen Argumente dagegen, dass man heute das gleiche im Fall Saddam tut? In einer kabbalistischen Tradition heißt es, dass Dämonen aus nicht ausgelebten Leidenschaften entstehen: Politische Ohnmacht in Verbindung mit moralistischer Überheblichkeit gebiert politische Dämonen – und hilft Tyrannen und Massenmördern, heute ebenso wie in den 30er und den 60er Jahren.
Wenn die EU eine Wertegemeinschaft sein soll, dann ist ihr Gedankenaustausch mit dem Nahen Osten völlig misslungen. Die einzige Weltgegend, in der es keinen ernsthaften Versuch einer Demokratisierung gab, ist der arabische Raum: kein einziger der 22 Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga ist eine Demokratie oder auf dem Weg zu einer Demokratie. Die Gründe hierfür liegen nicht im Islam: Man betrachte sich die Türkei, Indonesien oder Bangladesch – oder sogar die atemberaubend ermutigende Entwicklung im Iran. Aber in der arabischen Welt gab es keinen arabischen Gorbatschow und keine arabische Solidarnosc.
Nach dem 11. September ist dieser Mangel an Demokratie und innerer Freiheit kein rein arabisches Problem mehr. Durch unzufriedene, aber gut ausgebildete Ägypter und Saudis wird dieser Missstand in die westlichen Länder hineingetragen – nach Hamburg, Paris oder London. Und dann weiter nach New York, Washington, Djerba, Bali und Mombasa.
Und Europa? Hier vernimmt man einen Schmerzensschrei über amerikanischen Unilateralismus. Natürlich sollen die USA kritisiert werden, ebenso wie sie für so manche Übertreibung der Kalte-Kriegs-Rhetorik hätten kritisiert werden sollen. Aber Europa verdankt seine Freiheit nicht dem eigenen Durchhaltevermögen, sondern amerikanischen Waffen und amerikanischer Entschlossenheit. Auf europäischer Seite wäre daher Demut angebracht, weniger Moralismus und etwas mehr moralischem Verantwortungsbewusstsein.
Aus dem Englischen von Daniel Eckert.
DIE WELT - 03.01.2003
"Es muss ja nicht immer gleich Al Qaida sein"
Verzweifelt gesucht: Eine Verbindung zwischen Saddam und Bin Laden – Beweise für Iraks Engagement gegen Israel gibt es genug
von Rolf Tophoven
Berlin - In den Hauptquartieren von CIA und FBI können sie es drehen und wenden wie sie wollen – das gewünschte Ergebnis lässt sich nicht herbeizaubern. Saddam Hussein, Erzfeind der US-Führungsspitze um Präsident George W. Bush, lässt sich nicht mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in Verbindung bringen. Fraglich ist auch, ob der Irak Al-Qaida-Kämpfern bei ihrer Flucht aus Afghanistan logistische Hilfe gewährt hat. Sicher ist dagegen, dass sich wohl einige hundert Männer des Bin-Laden-Netzwerkes im nordirakischen Kurdengebiet aufhalten.
Hartnäckig halten sich die Auffassungen nahöstlichen Geheimdienste, wonach Mitte Juli 2001 Al-Qaida-Mitglieder an geheimen Orten im Irak von irakischen Militärexperten im Umgang mit Bomben und Sprengmaterial mit chemischen und biologischen Substanzen geschult wurden. Tragfähige Beweise dafür fehlen aber, genauso wie für ein mutmaßliches Treffen Mohammed Attas mit einem Vertreter des irakischen Geheimdienstes in Prag. Vielmehr hat der tschechische Nachrichtendienst Kontakte Attas mit den Irakern in Prag wiederholt bestritten.
Dennoch: Trotz fehlender klarer Indizien besteht kein Zweifel daran, dass der Irak terroristische Gruppierungen in der Vergangenheit unterstützt hat und weiter unterstützt. „Es muss ja nicht immer gleich Al Qaida sein“, so ein US-Fahnder. Einige Jahre gewährte Saddam Hussein und sein Geheimdienst dem berüchtigten palästinensischen Terrorchef Abu Nidal und der so genannten ANO (Abu Nidal Organisation) Herberge und Schutz in Bagdad. In den siebziger und achtziger Jahren pflügten Abu Nidal und seine Killer eine breite blutige Spur durch den Nahen Osten und Europa. Von ihrem Hauptquartier in Bagdad aus attackierten Nidals Kommandos syrische Minister, Vertreter von Arafats PLO in Europa, jüdische Interessen. Sie griffen Synagogen in Wien, Rom und Brüssel an sowie jüdische Schulen und Restaurants in Antwerpen und Paris. Höhepunkt der Terrorkampagne war im Sommer 1982 der Anschlag auf den israelischen Botschafter in London, was schließlich Israels Libanonfeldzug im gleichen Jahr auslöste.
Nach seiner „Abschiebung“ aus Bagdad 1983 tauchte Abu Nidal eine Weile in arabischen Ländern unter, unter anderem beim Libyer Muammar el Gaddafi. Ende der neunziger Jahre kehrte er nach Bagdad zurück und lebte unter dem Protektorat Saddam Husseins. Doch am 16. August 2002 kam fur Abu Nidal selbst das Ende. Bei einem Treffen mit irakischen Geheimdienstagenten wurde er erschossen. Es war Taher Dschalil Haboush, Chef des irakischen Nachrichtendienstes, der in einer Pressekonferenz den Tod Abu Nidals bekanntgab.
Abu Nidal war dem Irak unbequem geworden und zugleich bot sein Tod dem Regime Saddams eine glänzende Gelegenheit, sich sozusagen „offiziell“ vom Terror zu distanzieren. So wurde der Welt die Mär verkauft, der Irak habe Abu Nidal keinen Schutz gewährt, sondern dieser habe 1999 das Land illegal betreten. Außerdem habe der Palästinenser gegen irakische Interessen verstoßen, indem er mit Gegnern Saddams, möglicherweise kuwaitischen Geheimagenten, Kontakt pflegte. Der wahre Grund für die Liquidierung Nidal war wohl eher der, dass er zuviel über die Rolle des Irak im internationalen Terrorismus wusste und dieses Wissen gegen den Irak hätte verwenden konnen – erst recht in einer Phase, wo die USA alles versuchen, Saddams Verwicklungen in den nahöstlichen Terror aufzudecken.
Geheimdienstkreise in Israel sind davon überzeugt, dass auch die palästinensische Autonomiebehörde und Jassir Arafat selbst ihre Finger beim Tode Abu Nidals im Spiel hatten, denn seit einem Mordversuch an Arafat in den siebziger Jahren herrscht Todfeindschaft zwischen den beiden Männern. Arafat ließ Abu Nidal sogar in absentia zum Tode verurteilen. Den Mord an Nidal sollen Arafats Geheimdienstchef im Westjordanland, Oberst Tawfiq Tirawi, sowie Mohammed Abbas, Führer und Generalsekretär der in Bagdad residierenden „Palästinensischen Befreiungsfront“ (PLF), eingefädelt haben.
Abbas ist kein unbeschriebenes Blatt: 1985 entführte ein Kommando unter seiner Führung das italienische Kreuzfahrtschiff „Achille Lauro“ im Mittelmeer. Bei dieser Aktion wurde der an den Rollstuhl gefesselte US-Amerikaner Leon Klinghoffer getötet. Im Oktober 2000, nach dem Ausbruch der zweiten Intifada, erklärte Abbas im irakischen Fernsehen, auch die PLF würde nun die verschärfte Konfrontation mit Israel suchen. Fortan rekrutierten und trainierten irakische Experten Aktivisten der PLF in Militärcamps für den Kampf gegen Israel.
Im Juli 2001 wurde der Palästinenser Mohammed Kandil von israelischen Sicherheitskräften festgenommen. Er stammt aus dem Westjordanland. Kandil war vom irakischen Geheimdienst rekrutiert und ausgebildet worden mit der klaren Maßgabe, eine terroristische Infrastruktur im Westjordanland aufzubauen. Zu seinen operativen Plänen gehörte ein Anschlag auf den internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv mit einer Autobombe. Al-Hadsch Rateb al-Amleh, Führer der „Arabischen Befreiungsfront“, einer Organisation des Hussein-Regimes, wurde von Saddam beauftragt, die Familien von palästinensischen Selbstmord-Terroristen materiell und finanziell zu unterstützen. Aus den Schatullen Bagdads fließen den Angehörigen von „Märtyrern“ rund 25 000 US-Dollar zu.
Die Kette der Indizien für die Rolle des Irak im internationalen Terrorismus ist lang – Al Qaida aber scheint nicht auf der Liste der Terror-Günstlinge Saddam Husseins zu stehen. Es fehlen stichhaltige Beweise – noch. Denn es dauerte fast fünf Jahre, bis die USA die letzten Stücke im Aufklärungspuzzle um die Anschläge 1996 auf die US-Basis im saudischen Dhahran (Khobar Towers) zusammengesetzt und iranische Geheimagenten sowie die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah als Täter identifiziert hatten. Die US-Ermittler hoffen, dass es bei den Beweisen gegen Saddam Hussein schneller gehen möge.
DIE WELT - 09.01.2003
Eine Lösung im Irak birgt Chance für die Region
von Schlomo Ben Ami
Tel Aviv - Dass Saddam Hussein eine große Bedrohung für Frieden und Stabilität im Nahen Osten darstellt, steht außer Frage. Ihn zu entwaffnen und Bedingungen für das Entstehen eines alternativen Regimes in Bagdad zu schaffen sind löbliche Ziele. Wie auch immer diese Ziele erreicht werden, ob durch militärisches Vorgehen oder – vorzugsweise – friedliche Mittel, die Lage im Irak wird zwangsläufig zahlreiche ernsthafte Auswirkungen auf die ganze Region haben.
In der gesamten Region fühlen sich die Araber gedemütigt. Obwohl es ganz offensichtliche Unterschiede gibt zwischen der israelisch-palästinensischen Situation und der im Fall Irak, verlangten die arabischen Führer und die arabische Öffentlichkeit immer, die internationale Gemeinschaft möge Israel mit kompromisslosen Resolutionen des Sicherheitsrates dazu zwingen, UN-Entscheidungen zu befolgen. Und jetzt werden sie, wie die arabischen Medien es nennen, von Amerika dazu „vergewaltigt“, genau so einer Resolution gegen einen arabischen Staat zuzustimmen – zu einer Zeit, da man Israel bei der Niederschlagung der palästinensischen Intifada freie Hand lässt.
In einer Region, in der die Führer meist „prowestlich“ und die Massen „antiwestlich“ sind, gibt es eine ernste Gefahr öffentlicher Unruhen, und falls die Krise sich zum Krieg auswächst, steht das bloße Überleben von gemäßigten Regimes auf dem Spiel. Saddam Hussein ist nicht der erste und auch nicht der einzige arabische Führer, der seine Sünden in den Mantel der palästinensischen Sache hüllt. Doch man muss sich nicht an dem zynischen Diskurs beteiligen, der besagt, dass alle Übel in der arabischen Welt von der Besetzung Israels herrühren, um anzuerkennen, dass der israelisch-palästinensische Konflikt eine Hauptursache für die Instabilität in der Region ist und in der gesamten arabischen und islamischen Welt eine bequeme Plattform für Massenhysterien bietet.
Ohne jeden Zweifel hat Israel ein entschiedenes Interesse daran, den Konflikt mit den Palästinensern sowie mit der arabischen und islamischen Welt zu beenden, bevor die Region in unkontrolliertem nuklearen Wettrüsten versinkt. Die eigentliche Prüfung für die amerikanische Führung liegt also darin, die Lösung des Irak-Problems als Katalysator zu nutzen für das größere Unterfangen, eine Architektur des Friedens und der Sicherheit im Nahen Osten zu entwerfen. Frieden zwischen Israel und den Palästinensern muss ein zentraler Pfeiler eines solchen Gefüges regionaler Stabilität sein.
Der Krieg, den Palästinenserchef Jassir Arafat gegen Israel begonnen hat, hat dem Friedensprozess jedes Leben genommen. Alle friedensstiftenden Mechanismen sind im Feuer der blutigsten Auseinandersetzung aufgegangen, die es je zwischen Israelis und Palästinensern gegeben hat. Die Konfliktparteien sind offensichtlich nicht fähig, von ihrem apokalyptischen Kollisionskurs abzuweichen. Die Lösung muss entweder international sein, oder es wird keine Lösung geben.
Die Konstellation, die sich durch die Irak-Krise ergeben hat, ist gleichzeitig eine Gelegenheit und eine Bedrohung. Dass Amerika transatlantische Solidarität und Europas politische Unterstützung braucht, um den Krieg zu legitimieren, könnte auch zu einer günstigen Gelegenheit für die EU werden. Angesichts dieser neuen Konstellation sollte die EU ihren gesamten Einfluss nutzen, um ein gemeinsames und aktives Engagement zur Konfliktlösung im Nahen Osten zu fördern.
Für eine solche gemeinsame Initiative muss Europa jedoch seine schwierigen Beziehungen zu Israel verbessern und seine Glaubwürdigkeit im jüdischen Staat wiederherstellen. Europa hat eigene Einflussmöglichkeiten auf die Palästinenser, und diese müssen zu einem entscheidenden Pfeiler der einzig möglichen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts werden: Eine internationale Lösung auf Grundlage der Rahmenlinien Bill Clintons vom 23. Dezember 2000, die durch ein internationales Mandat im Westjordanland und im Gazastreifen – manche nennen es heute lieber Treuhänderschaft – umgesetzt werden.
Das Beharren Israels und der internationalen Gemeinschaft darauf, dass in der palästinensischen Autonomiebehörde durchgreifende institutionelle Reformen durchgeführt werden sollen, ist verständlich und legitim. Genauso vernünftig ist aber auch die palästinensische Reaktion, dass nämlich Reformen und freie Wahlen unmöglich sind, „solange die Besatzung anhält?. Reformen und das Ende der Besatzung sind untrennbar miteinander verknüpft. Der einzige Weg aus dieser Sackgasse ist ein internationales Mandat in den Palästinensergebieten, das die palästinensische Autonomiebehörde unterstützen sollte bei ihrem Wandel zu demokratischer Unabhängigkeit, wirklich freien Wahlen, einer Wirtschaftsordnung und einem zentralen Sicherheitssystem.
Der Friedensplan Clintons bietet die am weitesten entwickelten und genauesten Richtlinien, auf denen ein schwieriger, aber vernünftiger Kompromiss mit überwältigender internationaler Legitimität formuliert werden kann. Alle Details sind bereits ausformuliert worden. Die internationale Gemeinschaft unter Leitung der USA und mit Beteiligung ihrer europäischen Verbündeten muss die Parteien nur dazu bringen, sie auch anzunehmen.
Solch ein internationaler Ansatz – natürlich immer unter der Leitung Amerikas – steht nicht im Widerspruch zum Willen der israelischen Öffentlichkeit. Es ist notwendig, die Logik des Golfkriegs von 1990/91 zu wiederholen. Die Koalition, die den Krieg führte, war die gleiche, die danach die Madrider Friedenskonferenz zusammenbrachte. Die Globalisierung der Anstrengungen im Krieg gegen den Terror und bei der Einschränkung des unverantwortlichen Handelns von „Schurkenstaaten“ könnte ein viel versprechendes Modell liefern für eine verbesserte Weltordnung – allerdings nur, wenn es ergänzt wird durch die Mobilisierung interner Energien zur Konfliktlösung.
Schlomo Ben Ami war Israels Außenminister im Kabinett Ehud Barak.
Bushs Politik ist konsequent
von Mariam Lau
Bagdad ja, Pjöngjang nein:
Washington geht es um eine Friedensordnung in Nahost, nicht um Öl
Fast mit Erleichterung, so scheint es, haben die Gegner eines Kriegs gegen den Irak den Konflikt mit Nordkorea zur Kenntnis genommen. Die triumphierende Logik des Protestes lautet nun auf Demonstrationen von Los Angeles bis Berlin: Ginge es der Regierung Bush wirklich um die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen oder gar um die Installation demokratischer Verhältnisse, dann wäre Nordkorea der dringlichere Kandidat. Die „Inkonsequenz" erklärt man sich, neben dem Verweis auf das Öl, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, gern mit ödipalen Konflikten: George W. Bush müsse die Niederlage seines Vaters ausbügeln, und andere Schlaumeiereien.
Worauf die Forderung nach angeblicher Konsequenz hinausläuft, wissen wir spätestens seit dem Balkankrieg, wo sie auch im Zusammenhang mit Slobodan Milosevic ins Feld geführt wurde: auf ratlose Untätigkeit. Auf diese Weise ist die Intervention gegen Saddam Hussein schon seit etwa einem Jahr auf die lange Bank geschoben worden, was ja nicht nur Herta Däubler-Gmelins entflammbares Gemüt auf die Idee gebracht hat, sie werde eh nur zur Ablenkung von wirtschaftlichen Problemen gebraucht. Mark Steyn spielt im „Spectator" durch, was geschehen wäre, wenn man Saddam schon letztes Frühjahr gestürzt hätte: Arafat wäre nicht mehr im Amt, die Ayatollahs würden ihre Koffer packen müssen, das Königreich Saudi-Arabien wäre vom niedrigen Ölpreis unter Druck gesetzt, Assad hätte sich zum Tee bei der Königin eingefunden, und die europäische Friedensbewegung wäre nicht umgekehrt proportional zum tatsächlichen Kriegsgeschehen angewachsen.
Drohende Kriegsgefahr hat selten zur Förderung von Scharfsinnigkeit beigetragen. Aber der altkluge Hinweis auf die Inkonsequenz der amerikanischen Außenpolitik ist von einer Einfältigkeit, die nur aus Verantwortungsferne entspringen kann. Der richtige Zeitpunkt, gegen Saddam vorzugehen, liegt vor seinem Erwerb von Massenvernichtungswaffen. Wenn er sie einmal hat, kann man nichts mehr tun.
Kim Jong Il hingegen stellt für Amerika keine vergleichbare Gefahr dar: Seoul oder Tokio wären sehr viel plausiblere Ziele für einen Atomwaffenangriff Nordkoreas als Amerika, dessen Antwort es nicht überleben würde.
Den Schaden, den Pjöngjang den USA zufügen könnte, hat es zum größten Teil längst ins Werk gesetzt: die Belieferung Pakistans oder des Iran - und wer weiß wem noch - mit Material zur Entwicklung von Nuklearwaffen. Haschemi Rafsandschani, Ex-Präsident des Iran und einer der berühmten „moderaten Kräfte", hat bereits erklärt, sollte ein islamisches Land die Atombombe besitzen, wäre die israelische Frage ein für alle Mal erledigt.
Wer sich mit der Inkonsequenz der amerikanischen Außenpolitik beschäftigen möchte, muss also nur zum Atlas greifen. Während der Irak eine einflussreiche Kraft in einer labilen Region ist, gibt Nordkorea einen hässlichen kleinen Freak ab, der von Weltmächten und ökonomischen Erfolgsgeschichten umgeben ist. Für Millionen junger Araber ist Saddam der neue Saladin, von dem man sich Revanche für die Demütigungen durch den Westen und den finalen Triumph des Panarabismus über Israel erhofft. Wer möchte in Tokio - oder in Peking - so werden wie Kim Jong Il? Außer seinem nuklearen Gemischtwarenhandel gibt es keinen Grund für die Amerikaner, ihn zu fürchten; überhaupt scheint das Engagement in der Region überflüssig zu sein, wenn nun auch die Südkoreaner, die es ohne Amerika gar nicht geben würde, sich gegen Uncle Sam erheben.
Nur kann man sich jetzt nicht zurückziehen, weil es wie eine Kapitulation aussehen würde. Schon schreiben irakische Zeitungen, man müsse sich nur ein Vorbild an Nordkorea nehmen. Jeder Monat, der ohne Irak-Intervention verstreicht, verlängert die Liste nordkoreanischer Kunden.
Was den beliebten Einwurf „Kein Blut für Öl" angeht, bleibt die Frage: Warum eigentlich nicht? Die Abhängigkeit vom saudi-arabischen Öl zwingt zu Konzessionen an ein weiteres tyrannisches Regime, die Herr Ströbele dann auch wieder als inkonsistent bezeichnen muss.
Für die Zeit nach Saddam sind in der US-Administration nach einem Bericht der „New Republic" zwei Szenarien im Spiel. Die „Tauben" um Colin Powell wollen das Öl in erster Linie dazu nutzen, um den Nachbarn des Irak und der befreiten irakischen Mittelschicht zu signalisieren, dass der Krieg nur zum Sturz von Saddam, nicht zur Kontrolle der Ölfelder geführt worden ist. Eine multilaterale Truppe, die im Prinzip das „Öl für Nahrungsmittel"-Programm der UNO fortsetzt, könnte über eine verstaatlichte Industrie wachen.
Demgegenüber wollen die „Falken" um Donald Rumsfeld das Öl aktiv dazu nutzen, die gesamte Region in Richtung Demokratisierung und Marktliberalisierung zu öffnen - bewusst in Analogie zum Europa der Nachkriegszeit. Empörte Reaktionen aus dem Iran, Syrien oder Saudi-Arabien stören sie nicht, weil sie an einem Erhalt dieser Regimes ohnehin kein Interesse haben.
Von Europa oder der UNO erwartet man nicht allzu viel, und wen könnte das verwundern. Die Häme und Schadenfreude, mit der europäische Medien und Politiker „Inkonsequenz" krähen und eigene, gar ökonomische Interessen nicht zu formulieren wagen, gibt wenig Anlass zur Hoffnung.
Es geht nicht darum, Politik für Chevron und Ölmultis zu machen.Wäre es nach ihnen gegangen, hätte man einfach die Sanktionen gegen den Irak aufgehoben und basta. Es geht, wie damals in Europa, um die Art von Sicherheit, die eben nur in Freiheit existieren kann.
DIE WELT - 23.12.2002
Europa – ein Wintermärchen
von Shlomo Avineri
Denk` ich an Europa in der Nacht ...“ – diese Anspielung auf Heines „Deutschland, ein Wintermärchen“ drängt sich auf, wenn man einen kritischen Blick auf das heutige Europa wirft. Denn durch die äußerst problematischen Einstellungen vieler Europäer zur Irak-Frage hallen die Echos der Vergangenheit. Zweimal ist es der Alten Welt im zurückliegenden Jahrhundert nicht gelungen, aus eigener Kraft über die Tyrannei zu obsiegen. Vor den eigenen Dämonen wurde sie nur durch eine fremde Macht gerettet: Amerika.
Zunächst gelang es Europa nicht, den Faschismus nieder zu ringen. Hätte es die Vereinigten Staaten nicht gegeben, würden in den meisten europäischen Ländern, mit Ausnahme Großbritanniens, noch immer faschistische oder nazistische Regimes herrschen. Und hätte es später nicht die strategische und ökonomische Zielstrebigkeit der USA gegeben – das Europa der Nachkriegszeit würde Kompromisse mit dem Stalinismus geschlossen haben.
Die gutgemeinte, aber fehlgeleitete Reaktion der Europäer auf die Bedrohung durch Saddam Hussein erinnert bedenklich an den Geist der Appeasement-Politik. Saddam ist offenkundig nicht Hitler – aber einige Parallelen zum Europa des Jahres 1936 sind keineswegs fehl am Platz: Zu jener Zeit hatte das „Dritte Reich“ noch keinen anderen Staat angegriffen, doch es hatte den Versailler Vertrag über Bord geworfen und damit begonnen, unter Verletzung internationaler Abkommen wieder aufzurüsten, es hatte das Rheinland remilitarisiert, den Völkerbund verlassen sowie zu verstehen gegeben, dass es eine Revision der deutschen Grenzen anstrebt. Die demokratische Verfassung Deutschlands war abgeschafft worden, alle politischen Parteien, mit Ausnahme der NSDAP, verboten. Das Regime hatte auch erste Konzentrationslager eingerichtet – für Mitglieder der Opposition, Juden, „Zigeuner“, Homosexuelle. Es hatte Juden aus dem öffentlichen Leben verbannt, Gesetze verabschiedet, die sie diskriminierten, und viele von ihnen enteignet.
Man stelle sich vor, wie anders die Welt heute aussähe, hätten Großbritannien und Frankreich 1936 Gewalt gegen das „Dritte Reich“ eingesetzt. Österreich, die Tschechoslowakei und Polen wären nicht überfallen worden, Europa hätte keine Nazibesetzung durchleiden müssen, es hätte keinen Holocaust gegeben, und nicht zu vergessen: Zehn Millionen Deutsche wären nicht aus ihrer Heimat im Osten vertrieben worden.
Saddam hat in der Vergangenheit schlimmere Verbrechen begangen als Hitler bis zum Jahre 1936: Im nachhinein mag es unpassend klingen, etwas Derartiges zu sagen. Es ist indes eine Tatsache, dass der irakische Diktator die Kurden im Irak schlechter behandelt hat als Hitler die Juden im Jahr 1936. Er griff zwei Länder an – den Iran und Kuwait – und beschoss zwei andere – Israel und Saudi-Arabien – mit Raketen. Er setzte Giftgas gegen innere und äußere Feinde ein. Sein Regime ist viel repressiver als Nazideutschland anno 1936. Außerdem entwickelt er ABC-Waffen und verstößt seit zehn Jahren gegen das Völkerrecht sowie UN-Resolutionen.
Dennoch zögert Europa. Zu zögern, ehe man in den Krieg zieht, ist eine verständliche Regung. Aber wenn man der Meinung ist, Hitler hätte gewaltsam aufgehalten werden sollen – welches sind dann die moralischen und strategischen Argumente dagegen, dass man heute das gleiche im Fall Saddam tut? In einer kabbalistischen Tradition heißt es, dass Dämonen aus nicht ausgelebten Leidenschaften entstehen: Politische Ohnmacht in Verbindung mit moralistischer Überheblichkeit gebiert politische Dämonen – und hilft Tyrannen und Massenmördern, heute ebenso wie in den 30er und den 60er Jahren.
Wenn die EU eine Wertegemeinschaft sein soll, dann ist ihr Gedankenaustausch mit dem Nahen Osten völlig misslungen. Die einzige Weltgegend, in der es keinen ernsthaften Versuch einer Demokratisierung gab, ist der arabische Raum: kein einziger der 22 Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga ist eine Demokratie oder auf dem Weg zu einer Demokratie. Die Gründe hierfür liegen nicht im Islam: Man betrachte sich die Türkei, Indonesien oder Bangladesch – oder sogar die atemberaubend ermutigende Entwicklung im Iran. Aber in der arabischen Welt gab es keinen arabischen Gorbatschow und keine arabische Solidarnosc.
Nach dem 11. September ist dieser Mangel an Demokratie und innerer Freiheit kein rein arabisches Problem mehr. Durch unzufriedene, aber gut ausgebildete Ägypter und Saudis wird dieser Missstand in die westlichen Länder hineingetragen – nach Hamburg, Paris oder London. Und dann weiter nach New York, Washington, Djerba, Bali und Mombasa.
Und Europa? Hier vernimmt man einen Schmerzensschrei über amerikanischen Unilateralismus. Natürlich sollen die USA kritisiert werden, ebenso wie sie für so manche Übertreibung der Kalte-Kriegs-Rhetorik hätten kritisiert werden sollen. Aber Europa verdankt seine Freiheit nicht dem eigenen Durchhaltevermögen, sondern amerikanischen Waffen und amerikanischer Entschlossenheit. Auf europäischer Seite wäre daher Demut angebracht, weniger Moralismus und etwas mehr moralischem Verantwortungsbewusstsein.
Aus dem Englischen von Daniel Eckert.
DIE WELT - 03.01.2003
"Es muss ja nicht immer gleich Al Qaida sein"
Verzweifelt gesucht: Eine Verbindung zwischen Saddam und Bin Laden – Beweise für Iraks Engagement gegen Israel gibt es genug
von Rolf Tophoven
Berlin - In den Hauptquartieren von CIA und FBI können sie es drehen und wenden wie sie wollen – das gewünschte Ergebnis lässt sich nicht herbeizaubern. Saddam Hussein, Erzfeind der US-Führungsspitze um Präsident George W. Bush, lässt sich nicht mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in Verbindung bringen. Fraglich ist auch, ob der Irak Al-Qaida-Kämpfern bei ihrer Flucht aus Afghanistan logistische Hilfe gewährt hat. Sicher ist dagegen, dass sich wohl einige hundert Männer des Bin-Laden-Netzwerkes im nordirakischen Kurdengebiet aufhalten.
Hartnäckig halten sich die Auffassungen nahöstlichen Geheimdienste, wonach Mitte Juli 2001 Al-Qaida-Mitglieder an geheimen Orten im Irak von irakischen Militärexperten im Umgang mit Bomben und Sprengmaterial mit chemischen und biologischen Substanzen geschult wurden. Tragfähige Beweise dafür fehlen aber, genauso wie für ein mutmaßliches Treffen Mohammed Attas mit einem Vertreter des irakischen Geheimdienstes in Prag. Vielmehr hat der tschechische Nachrichtendienst Kontakte Attas mit den Irakern in Prag wiederholt bestritten.
Dennoch: Trotz fehlender klarer Indizien besteht kein Zweifel daran, dass der Irak terroristische Gruppierungen in der Vergangenheit unterstützt hat und weiter unterstützt. „Es muss ja nicht immer gleich Al Qaida sein“, so ein US-Fahnder. Einige Jahre gewährte Saddam Hussein und sein Geheimdienst dem berüchtigten palästinensischen Terrorchef Abu Nidal und der so genannten ANO (Abu Nidal Organisation) Herberge und Schutz in Bagdad. In den siebziger und achtziger Jahren pflügten Abu Nidal und seine Killer eine breite blutige Spur durch den Nahen Osten und Europa. Von ihrem Hauptquartier in Bagdad aus attackierten Nidals Kommandos syrische Minister, Vertreter von Arafats PLO in Europa, jüdische Interessen. Sie griffen Synagogen in Wien, Rom und Brüssel an sowie jüdische Schulen und Restaurants in Antwerpen und Paris. Höhepunkt der Terrorkampagne war im Sommer 1982 der Anschlag auf den israelischen Botschafter in London, was schließlich Israels Libanonfeldzug im gleichen Jahr auslöste.
Nach seiner „Abschiebung“ aus Bagdad 1983 tauchte Abu Nidal eine Weile in arabischen Ländern unter, unter anderem beim Libyer Muammar el Gaddafi. Ende der neunziger Jahre kehrte er nach Bagdad zurück und lebte unter dem Protektorat Saddam Husseins. Doch am 16. August 2002 kam fur Abu Nidal selbst das Ende. Bei einem Treffen mit irakischen Geheimdienstagenten wurde er erschossen. Es war Taher Dschalil Haboush, Chef des irakischen Nachrichtendienstes, der in einer Pressekonferenz den Tod Abu Nidals bekanntgab.
Abu Nidal war dem Irak unbequem geworden und zugleich bot sein Tod dem Regime Saddams eine glänzende Gelegenheit, sich sozusagen „offiziell“ vom Terror zu distanzieren. So wurde der Welt die Mär verkauft, der Irak habe Abu Nidal keinen Schutz gewährt, sondern dieser habe 1999 das Land illegal betreten. Außerdem habe der Palästinenser gegen irakische Interessen verstoßen, indem er mit Gegnern Saddams, möglicherweise kuwaitischen Geheimagenten, Kontakt pflegte. Der wahre Grund für die Liquidierung Nidal war wohl eher der, dass er zuviel über die Rolle des Irak im internationalen Terrorismus wusste und dieses Wissen gegen den Irak hätte verwenden konnen – erst recht in einer Phase, wo die USA alles versuchen, Saddams Verwicklungen in den nahöstlichen Terror aufzudecken.
Geheimdienstkreise in Israel sind davon überzeugt, dass auch die palästinensische Autonomiebehörde und Jassir Arafat selbst ihre Finger beim Tode Abu Nidals im Spiel hatten, denn seit einem Mordversuch an Arafat in den siebziger Jahren herrscht Todfeindschaft zwischen den beiden Männern. Arafat ließ Abu Nidal sogar in absentia zum Tode verurteilen. Den Mord an Nidal sollen Arafats Geheimdienstchef im Westjordanland, Oberst Tawfiq Tirawi, sowie Mohammed Abbas, Führer und Generalsekretär der in Bagdad residierenden „Palästinensischen Befreiungsfront“ (PLF), eingefädelt haben.
Abbas ist kein unbeschriebenes Blatt: 1985 entführte ein Kommando unter seiner Führung das italienische Kreuzfahrtschiff „Achille Lauro“ im Mittelmeer. Bei dieser Aktion wurde der an den Rollstuhl gefesselte US-Amerikaner Leon Klinghoffer getötet. Im Oktober 2000, nach dem Ausbruch der zweiten Intifada, erklärte Abbas im irakischen Fernsehen, auch die PLF würde nun die verschärfte Konfrontation mit Israel suchen. Fortan rekrutierten und trainierten irakische Experten Aktivisten der PLF in Militärcamps für den Kampf gegen Israel.
Im Juli 2001 wurde der Palästinenser Mohammed Kandil von israelischen Sicherheitskräften festgenommen. Er stammt aus dem Westjordanland. Kandil war vom irakischen Geheimdienst rekrutiert und ausgebildet worden mit der klaren Maßgabe, eine terroristische Infrastruktur im Westjordanland aufzubauen. Zu seinen operativen Plänen gehörte ein Anschlag auf den internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv mit einer Autobombe. Al-Hadsch Rateb al-Amleh, Führer der „Arabischen Befreiungsfront“, einer Organisation des Hussein-Regimes, wurde von Saddam beauftragt, die Familien von palästinensischen Selbstmord-Terroristen materiell und finanziell zu unterstützen. Aus den Schatullen Bagdads fließen den Angehörigen von „Märtyrern“ rund 25 000 US-Dollar zu.
Die Kette der Indizien für die Rolle des Irak im internationalen Terrorismus ist lang – Al Qaida aber scheint nicht auf der Liste der Terror-Günstlinge Saddam Husseins zu stehen. Es fehlen stichhaltige Beweise – noch. Denn es dauerte fast fünf Jahre, bis die USA die letzten Stücke im Aufklärungspuzzle um die Anschläge 1996 auf die US-Basis im saudischen Dhahran (Khobar Towers) zusammengesetzt und iranische Geheimagenten sowie die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah als Täter identifiziert hatten. Die US-Ermittler hoffen, dass es bei den Beweisen gegen Saddam Hussein schneller gehen möge.
DIE WELT - 09.01.2003
Eine Lösung im Irak birgt Chance für die Region
von Schlomo Ben Ami
Tel Aviv - Dass Saddam Hussein eine große Bedrohung für Frieden und Stabilität im Nahen Osten darstellt, steht außer Frage. Ihn zu entwaffnen und Bedingungen für das Entstehen eines alternativen Regimes in Bagdad zu schaffen sind löbliche Ziele. Wie auch immer diese Ziele erreicht werden, ob durch militärisches Vorgehen oder – vorzugsweise – friedliche Mittel, die Lage im Irak wird zwangsläufig zahlreiche ernsthafte Auswirkungen auf die ganze Region haben.
In der gesamten Region fühlen sich die Araber gedemütigt. Obwohl es ganz offensichtliche Unterschiede gibt zwischen der israelisch-palästinensischen Situation und der im Fall Irak, verlangten die arabischen Führer und die arabische Öffentlichkeit immer, die internationale Gemeinschaft möge Israel mit kompromisslosen Resolutionen des Sicherheitsrates dazu zwingen, UN-Entscheidungen zu befolgen. Und jetzt werden sie, wie die arabischen Medien es nennen, von Amerika dazu „vergewaltigt“, genau so einer Resolution gegen einen arabischen Staat zuzustimmen – zu einer Zeit, da man Israel bei der Niederschlagung der palästinensischen Intifada freie Hand lässt.
In einer Region, in der die Führer meist „prowestlich“ und die Massen „antiwestlich“ sind, gibt es eine ernste Gefahr öffentlicher Unruhen, und falls die Krise sich zum Krieg auswächst, steht das bloße Überleben von gemäßigten Regimes auf dem Spiel. Saddam Hussein ist nicht der erste und auch nicht der einzige arabische Führer, der seine Sünden in den Mantel der palästinensischen Sache hüllt. Doch man muss sich nicht an dem zynischen Diskurs beteiligen, der besagt, dass alle Übel in der arabischen Welt von der Besetzung Israels herrühren, um anzuerkennen, dass der israelisch-palästinensische Konflikt eine Hauptursache für die Instabilität in der Region ist und in der gesamten arabischen und islamischen Welt eine bequeme Plattform für Massenhysterien bietet.
Ohne jeden Zweifel hat Israel ein entschiedenes Interesse daran, den Konflikt mit den Palästinensern sowie mit der arabischen und islamischen Welt zu beenden, bevor die Region in unkontrolliertem nuklearen Wettrüsten versinkt. Die eigentliche Prüfung für die amerikanische Führung liegt also darin, die Lösung des Irak-Problems als Katalysator zu nutzen für das größere Unterfangen, eine Architektur des Friedens und der Sicherheit im Nahen Osten zu entwerfen. Frieden zwischen Israel und den Palästinensern muss ein zentraler Pfeiler eines solchen Gefüges regionaler Stabilität sein.
Der Krieg, den Palästinenserchef Jassir Arafat gegen Israel begonnen hat, hat dem Friedensprozess jedes Leben genommen. Alle friedensstiftenden Mechanismen sind im Feuer der blutigsten Auseinandersetzung aufgegangen, die es je zwischen Israelis und Palästinensern gegeben hat. Die Konfliktparteien sind offensichtlich nicht fähig, von ihrem apokalyptischen Kollisionskurs abzuweichen. Die Lösung muss entweder international sein, oder es wird keine Lösung geben.
Die Konstellation, die sich durch die Irak-Krise ergeben hat, ist gleichzeitig eine Gelegenheit und eine Bedrohung. Dass Amerika transatlantische Solidarität und Europas politische Unterstützung braucht, um den Krieg zu legitimieren, könnte auch zu einer günstigen Gelegenheit für die EU werden. Angesichts dieser neuen Konstellation sollte die EU ihren gesamten Einfluss nutzen, um ein gemeinsames und aktives Engagement zur Konfliktlösung im Nahen Osten zu fördern.
Für eine solche gemeinsame Initiative muss Europa jedoch seine schwierigen Beziehungen zu Israel verbessern und seine Glaubwürdigkeit im jüdischen Staat wiederherstellen. Europa hat eigene Einflussmöglichkeiten auf die Palästinenser, und diese müssen zu einem entscheidenden Pfeiler der einzig möglichen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts werden: Eine internationale Lösung auf Grundlage der Rahmenlinien Bill Clintons vom 23. Dezember 2000, die durch ein internationales Mandat im Westjordanland und im Gazastreifen – manche nennen es heute lieber Treuhänderschaft – umgesetzt werden.
Das Beharren Israels und der internationalen Gemeinschaft darauf, dass in der palästinensischen Autonomiebehörde durchgreifende institutionelle Reformen durchgeführt werden sollen, ist verständlich und legitim. Genauso vernünftig ist aber auch die palästinensische Reaktion, dass nämlich Reformen und freie Wahlen unmöglich sind, „solange die Besatzung anhält?. Reformen und das Ende der Besatzung sind untrennbar miteinander verknüpft. Der einzige Weg aus dieser Sackgasse ist ein internationales Mandat in den Palästinensergebieten, das die palästinensische Autonomiebehörde unterstützen sollte bei ihrem Wandel zu demokratischer Unabhängigkeit, wirklich freien Wahlen, einer Wirtschaftsordnung und einem zentralen Sicherheitssystem.
Der Friedensplan Clintons bietet die am weitesten entwickelten und genauesten Richtlinien, auf denen ein schwieriger, aber vernünftiger Kompromiss mit überwältigender internationaler Legitimität formuliert werden kann. Alle Details sind bereits ausformuliert worden. Die internationale Gemeinschaft unter Leitung der USA und mit Beteiligung ihrer europäischen Verbündeten muss die Parteien nur dazu bringen, sie auch anzunehmen.
Solch ein internationaler Ansatz – natürlich immer unter der Leitung Amerikas – steht nicht im Widerspruch zum Willen der israelischen Öffentlichkeit. Es ist notwendig, die Logik des Golfkriegs von 1990/91 zu wiederholen. Die Koalition, die den Krieg führte, war die gleiche, die danach die Madrider Friedenskonferenz zusammenbrachte. Die Globalisierung der Anstrengungen im Krieg gegen den Terror und bei der Einschränkung des unverantwortlichen Handelns von „Schurkenstaaten“ könnte ein viel versprechendes Modell liefern für eine verbesserte Weltordnung – allerdings nur, wenn es ergänzt wird durch die Mobilisierung interner Energien zur Konfliktlösung.
Schlomo Ben Ami war Israels Außenminister im Kabinett Ehud Barak.
.
Die Mär vom Ölkrieg
Falsche Argumente gegen einen gefahrvollen Waffengang
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Eine immer junge These macht wieder Karriere: In Wahrheit sei das Öl der Treibstoff des drohenden Krieges. Eine Allianz aus Kapital und Kanonen, die „Achse des Öls“, mache sich auf, den Irak zur amerikanischen Tankstelle auszubauen, um den Sprit-Preis auf Dauer niedrig zu halten. Deshalb ruft von links Oskar Lafontaine ins Land: „Es geht um Öl.“ Von rechts geißelt Jürgen Todenhöfer die „rohstoffpolitische Kolonisierung“ des Irak. Auf dem Titelblatt des Spiegels wird eine Kreuzung aus Maschinengewehr und Zapfhahn zum Symbol Amerikas. Keine der Großdemonstrationen vom Wochenende kam ohne den Slogan „Blut für Öl“ aus.
Der Charme der Ölkrieg-Theorie besteht darin, dass er so einleuchtend wirkt. Denn niemand will sich mit der Behauptung lächerlich machen, Öl sei bei einem Krieg inmitten von Ölfeldern bedeutungslos. Ein jeder ahnt, dass die Konzerne (nicht nur die amerikanischen) bereits um die Bohrrechte im neuen Öldorado buhlen. Wer im meinungsbunten Washington lange genug sucht, wird schon jemanden finden, der zitierfähig behauptet, die Neuverteilung der Lizenzen sei nicht Folge, sondern Motiv des heraufziehenden Krieges. Schließlich regierten im Weißen Haus die Öl-Männer Bush und Cheney. Alles klar?
Vorbei: Schonzeit für die Saudis
Das Problem ist bloß, dass diese verschwörerische Lesart die große Wende der amerikanischen Politik nach dem 11. September ignoriert. Zuvor hatte ein ebenso stiller wie dubioser Pakt das Verhältnis zum wichtigsten Lieferanten am Golf regiert: Die Saudis pumpen Öl zu moderaten Preisen, und die Amerikaner stützen dafür die korrupte Prinzengarde. Dieser Deal ist mit den Türmen des World Trade Center zusammengebrochen. Stattdessen wächst die Einsicht, dass die traditionelle Nahost-Politik in der Sackgasse steckt. Politiker aller Couleur glauben jetzt, dass Terror gebiert, wer im Nahen Osten doppelzüngig Demokratie predigt und Autokratie fördert. So ist das gewaltige Missionsprojekt der Demokratisierung Arabiens entstanden. Ein herkulisches Unternehmen, das dem Glauben entspringt, nur gute Demokraten seien gute Partner. Diese Vision sehen Arabiens Alleinherrscher zu Recht als Bedrohung. Sie stellt einen radikalen Bruch dar: Idealpolitik ersetzt Realpolitik. Es ist, als wäre Woodrow Wilson wieder auferstanden, der die Welt nach 1918 „safe for democracy“ machen wollte.
Die Ent-Saddamisierung des Irak ist Teil dieses Projekts. Es wird aus der Angst geboren und nicht aus der Gier – aus der Asche der Wolkenkratzer, nicht aus Bauzeichnungen für Bohrtürme.
Zum Gemeingut gehört in Washington die Befürchtung, beim nächsten Anschlag würde es nicht bei zwei Bürotürmen bleiben. Fast sicher wären dann Massenvernichtungswaffen im Spiel. Deshalb hat Amerika die Jagd auf Diktatoren mit solchen Waffen eröffnet. Deshalb wird der Abwehrkampf zu einer Präventionspolitik, der jedes Mittel recht zu sein scheint. Deshalb ist es George Bush auch letztlich egal, ob Saddam für den 11.September mitverantwortlich ist oder nicht.
Diese Politik, die in ihrem Bekehrungsdrang bisweilen obsessiv wirkt, wirft viele quälende Fragen auf: Ist die Demokratisierung Arabiens von außen überhaupt möglich? Was sind die Grenzen eines Universalismus, der auf Panzerketten daherkommt? Ist Präventivkrieg auf Verdacht legitim? Es ist diese neue Außenpolitik, ihre Radikalität und ihr Hang zur Grenzverletzung, die nach Diskussion geradezu schreit. Doch Amerika zusätzlich sinistere Motive zu unterstellen, führt in die Irre.
Die schrillsten Kritiker wollen Amerika zugleich Materialismus (Öl!) und Moralismus (Achse des Bösen!) vorwerfen. Beides geht aber schon logisch nicht zusammen.
Seit einigen Wochen verleiht die Nordkorea-Krise dem Öl-Argument scheinbar neuen Auftrieb. Da gibt es neben dem Irak ein weiteres Land – diktatorisch geführt, feindlich gesinnt –, das Massenvernichtungswaffen baut. Nordkorea soll aber nicht mit Krieg überzogen werden? Weil dort kein Öl sprudelt!, schallt es zurück.
Merkwürdig, wie Amerikas Konservative noch immer unterschätzt werden. Natürlich weiß auch George Bush, dass er mit unterschiedlicher Elle misst. Aber ihm ist klar, dass er zwei Kriege gleichzeitig nicht riskieren darf. Deshalb bietet er Gespräche mit den Nordkoreanern an. Sind sie erfolgreich, soll es gut sein. Sind sie es nicht, hat er Zeit gewonnen, um zuerst Saddam zu verjagen. Dann wird auch Nordkorea nicht mit Konzilianz rechnen dürfen.
Denn es geht in beiden Fällen nicht um Öl, sondern um Massenvernichtungswaffen. Das Öl verleiht Saddam nur ein zusätzliches Erpressungspotenzial. Mit den Planungen für den Irak-Krieg wurde genau sechs Tage nach den Anschlägen von New York und Washington begonnen. Glaubt jemand ernsthaft, dass damals ein Rohstoff-Krieg in Aussicht genommen wurde?
In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt. Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche „Angstprämie“. Ein Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika ja Erfahrung.
"Antiwestliches Ressentiment"
Leider ist der Öl-Vorwurf gegen Fakten weitgehend resistent. Er gehört zum Grundbestand transatlantischer Vorurteile. Mit dem Öl-Argument lässt sich sogar Europa diskreditieren, wie der Rechts-Intellektuelle Charles Krauthammer vorführt. Er schreibt, das Verhalten Frankreichs im UN-Sicherheitsrat werde von „Öl-Interessen“ geprägt. Vorsichtshalber fragt er nicht nach, ob Frankreich auch lautere Motive hat und die Legitimität eines Krieges sicherstellen will.
In Deutschland lebt der Vorwurf des kalten Materialismus seit den Tagen der linken Rebellion unverwüstlich fort, freilich auf Amerika gemünzt. Er ist zum „zentralen Bestandteil antiwestlichen Ressentiments“ geworden, wie Dan Diner in seinem jüngsten Buch Feindbild Amerika schreibt. Im Protest gegen den Golfkrieg wurde 1990 „Blut für Öl“ zum Schlachtruf.
Diesen Vorwurf vermochte nicht mal der Kriegsverlauf zu erschüttern: Die Amerikaner, angeblich des Öls wegen gekommen, haben Iraks Ölfelder gar nicht eingenommen.
Trotzdem erlebt der Verdacht 1993 seine Wiedergeburt, als sich die Amerikaner anschicken, im öllosen Somalia gegen Hunger und Warlords anzugehen. Prompt findet sich im Stern das Gerücht, US-Ölkonzerne hätten dort die „reichsten Ölfelder des arabisch-afrikanischen Tales“ entdeckt. Leider ist aus der Erschließung trotz US-Truppen nichts geworden, sonst wäre Somalia heute reich. Und nun der Irak-Feldzug: Das Weiße Haus kann die Mär vom lupenreinen Ölkrieg tagtäglich zu widerlegen versuchen – vergebens.
Nein, Bushs riskante Nahost-Politik hat eine schlagkräftigere Kritik verdient. Eine, die amerikanische Außenpolitik nicht auf zwei Buchstaben reduziert. Das Problem ist nicht der Regimewechsel, obwohl ein bisschen mehr Demokratie nicht nur Arabien, sondern der ganzen Welt gut täte.
Das Problem ist der Krieg als Mittel. Einen Krieg zu beginnen ist einfacher, als den Frieden zu gewinnen.
.
Die Mär vom Ölkrieg
Falsche Argumente gegen einen gefahrvollen Waffengang
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Eine immer junge These macht wieder Karriere: In Wahrheit sei das Öl der Treibstoff des drohenden Krieges. Eine Allianz aus Kapital und Kanonen, die „Achse des Öls“, mache sich auf, den Irak zur amerikanischen Tankstelle auszubauen, um den Sprit-Preis auf Dauer niedrig zu halten. Deshalb ruft von links Oskar Lafontaine ins Land: „Es geht um Öl.“ Von rechts geißelt Jürgen Todenhöfer die „rohstoffpolitische Kolonisierung“ des Irak. Auf dem Titelblatt des Spiegels wird eine Kreuzung aus Maschinengewehr und Zapfhahn zum Symbol Amerikas. Keine der Großdemonstrationen vom Wochenende kam ohne den Slogan „Blut für Öl“ aus.
Der Charme der Ölkrieg-Theorie besteht darin, dass er so einleuchtend wirkt. Denn niemand will sich mit der Behauptung lächerlich machen, Öl sei bei einem Krieg inmitten von Ölfeldern bedeutungslos. Ein jeder ahnt, dass die Konzerne (nicht nur die amerikanischen) bereits um die Bohrrechte im neuen Öldorado buhlen. Wer im meinungsbunten Washington lange genug sucht, wird schon jemanden finden, der zitierfähig behauptet, die Neuverteilung der Lizenzen sei nicht Folge, sondern Motiv des heraufziehenden Krieges. Schließlich regierten im Weißen Haus die Öl-Männer Bush und Cheney. Alles klar?
Vorbei: Schonzeit für die Saudis
Das Problem ist bloß, dass diese verschwörerische Lesart die große Wende der amerikanischen Politik nach dem 11. September ignoriert. Zuvor hatte ein ebenso stiller wie dubioser Pakt das Verhältnis zum wichtigsten Lieferanten am Golf regiert: Die Saudis pumpen Öl zu moderaten Preisen, und die Amerikaner stützen dafür die korrupte Prinzengarde. Dieser Deal ist mit den Türmen des World Trade Center zusammengebrochen. Stattdessen wächst die Einsicht, dass die traditionelle Nahost-Politik in der Sackgasse steckt. Politiker aller Couleur glauben jetzt, dass Terror gebiert, wer im Nahen Osten doppelzüngig Demokratie predigt und Autokratie fördert. So ist das gewaltige Missionsprojekt der Demokratisierung Arabiens entstanden. Ein herkulisches Unternehmen, das dem Glauben entspringt, nur gute Demokraten seien gute Partner. Diese Vision sehen Arabiens Alleinherrscher zu Recht als Bedrohung. Sie stellt einen radikalen Bruch dar: Idealpolitik ersetzt Realpolitik. Es ist, als wäre Woodrow Wilson wieder auferstanden, der die Welt nach 1918 „safe for democracy“ machen wollte.
Die Ent-Saddamisierung des Irak ist Teil dieses Projekts. Es wird aus der Angst geboren und nicht aus der Gier – aus der Asche der Wolkenkratzer, nicht aus Bauzeichnungen für Bohrtürme.
Zum Gemeingut gehört in Washington die Befürchtung, beim nächsten Anschlag würde es nicht bei zwei Bürotürmen bleiben. Fast sicher wären dann Massenvernichtungswaffen im Spiel. Deshalb hat Amerika die Jagd auf Diktatoren mit solchen Waffen eröffnet. Deshalb wird der Abwehrkampf zu einer Präventionspolitik, der jedes Mittel recht zu sein scheint. Deshalb ist es George Bush auch letztlich egal, ob Saddam für den 11.September mitverantwortlich ist oder nicht.
Diese Politik, die in ihrem Bekehrungsdrang bisweilen obsessiv wirkt, wirft viele quälende Fragen auf: Ist die Demokratisierung Arabiens von außen überhaupt möglich? Was sind die Grenzen eines Universalismus, der auf Panzerketten daherkommt? Ist Präventivkrieg auf Verdacht legitim? Es ist diese neue Außenpolitik, ihre Radikalität und ihr Hang zur Grenzverletzung, die nach Diskussion geradezu schreit. Doch Amerika zusätzlich sinistere Motive zu unterstellen, führt in die Irre.
Die schrillsten Kritiker wollen Amerika zugleich Materialismus (Öl!) und Moralismus (Achse des Bösen!) vorwerfen. Beides geht aber schon logisch nicht zusammen.
Seit einigen Wochen verleiht die Nordkorea-Krise dem Öl-Argument scheinbar neuen Auftrieb. Da gibt es neben dem Irak ein weiteres Land – diktatorisch geführt, feindlich gesinnt –, das Massenvernichtungswaffen baut. Nordkorea soll aber nicht mit Krieg überzogen werden? Weil dort kein Öl sprudelt!, schallt es zurück.
Merkwürdig, wie Amerikas Konservative noch immer unterschätzt werden. Natürlich weiß auch George Bush, dass er mit unterschiedlicher Elle misst. Aber ihm ist klar, dass er zwei Kriege gleichzeitig nicht riskieren darf. Deshalb bietet er Gespräche mit den Nordkoreanern an. Sind sie erfolgreich, soll es gut sein. Sind sie es nicht, hat er Zeit gewonnen, um zuerst Saddam zu verjagen. Dann wird auch Nordkorea nicht mit Konzilianz rechnen dürfen.
Denn es geht in beiden Fällen nicht um Öl, sondern um Massenvernichtungswaffen. Das Öl verleiht Saddam nur ein zusätzliches Erpressungspotenzial. Mit den Planungen für den Irak-Krieg wurde genau sechs Tage nach den Anschlägen von New York und Washington begonnen. Glaubt jemand ernsthaft, dass damals ein Rohstoff-Krieg in Aussicht genommen wurde?
In Wahrheit würde der Irak-Krieg nicht wegen, sondern trotz des Öls geführt. Schon jetzt lastet auf dem Barrel-Preis eine beträchtliche „Angstprämie“. Ein Krieg, wäre er kurz, kostete konjunkturdämpfende 100 Milliarden Dollar. Zöge er sich hin, gäbe es im Irak nichts mehr zu verteilen, und eine globale Rezession wäre unausweichlich. Die ökonomischen Risiken des Krieges sind unabsehbar und auch die Meriten schwer kalkulierbar. Ginge es nur darum, den Ölpreis niedrig zu halten, wäre es risikoloser, das Ölembargo aufzuheben und Saddam zu rehabilitieren. Im auskömmlichen Umgang mit Diktatoren hat Amerika ja Erfahrung.
"Antiwestliches Ressentiment"
Leider ist der Öl-Vorwurf gegen Fakten weitgehend resistent. Er gehört zum Grundbestand transatlantischer Vorurteile. Mit dem Öl-Argument lässt sich sogar Europa diskreditieren, wie der Rechts-Intellektuelle Charles Krauthammer vorführt. Er schreibt, das Verhalten Frankreichs im UN-Sicherheitsrat werde von „Öl-Interessen“ geprägt. Vorsichtshalber fragt er nicht nach, ob Frankreich auch lautere Motive hat und die Legitimität eines Krieges sicherstellen will.
In Deutschland lebt der Vorwurf des kalten Materialismus seit den Tagen der linken Rebellion unverwüstlich fort, freilich auf Amerika gemünzt. Er ist zum „zentralen Bestandteil antiwestlichen Ressentiments“ geworden, wie Dan Diner in seinem jüngsten Buch Feindbild Amerika schreibt. Im Protest gegen den Golfkrieg wurde 1990 „Blut für Öl“ zum Schlachtruf.
Diesen Vorwurf vermochte nicht mal der Kriegsverlauf zu erschüttern: Die Amerikaner, angeblich des Öls wegen gekommen, haben Iraks Ölfelder gar nicht eingenommen.
Trotzdem erlebt der Verdacht 1993 seine Wiedergeburt, als sich die Amerikaner anschicken, im öllosen Somalia gegen Hunger und Warlords anzugehen. Prompt findet sich im Stern das Gerücht, US-Ölkonzerne hätten dort die „reichsten Ölfelder des arabisch-afrikanischen Tales“ entdeckt. Leider ist aus der Erschließung trotz US-Truppen nichts geworden, sonst wäre Somalia heute reich. Und nun der Irak-Feldzug: Das Weiße Haus kann die Mär vom lupenreinen Ölkrieg tagtäglich zu widerlegen versuchen – vergebens.
Nein, Bushs riskante Nahost-Politik hat eine schlagkräftigere Kritik verdient. Eine, die amerikanische Außenpolitik nicht auf zwei Buchstaben reduziert. Das Problem ist nicht der Regimewechsel, obwohl ein bisschen mehr Demokratie nicht nur Arabien, sondern der ganzen Welt gut täte.
Das Problem ist der Krieg als Mittel. Einen Krieg zu beginnen ist einfacher, als den Frieden zu gewinnen.
.
Guter Artikel #178
... links Oskar Lafontaine ins Land: „Es geht um Öl.“
Wenn es beim Irak-Konflikt nur um das Öl ginge, dann könnte dies ohne Problem UND OHNE KRIEG ganz einfach gelöst werden: Die UN lässt den Irak das Öl am Weltmarkt verkaufen und der Preis würde drastisch sinken. Also, hier kann das Problem wirklich nicht liegen. Aber wo liegt es dann ??
HI
... links Oskar Lafontaine ins Land: „Es geht um Öl.“
Wenn es beim Irak-Konflikt nur um das Öl ginge, dann könnte dies ohne Problem UND OHNE KRIEG ganz einfach gelöst werden: Die UN lässt den Irak das Öl am Weltmarkt verkaufen und der Preis würde drastisch sinken. Also, hier kann das Problem wirklich nicht liegen. Aber wo liegt es dann ??
HI
Das ich nicht lache , es geht nicht um Öl, sondern um Demokratie, Menschenrechte und die Vernichtung von Massenvernichtungswaffen.
Wer baut und verkauft denn auf der Welt die meisten Massenvernichtungswaffen?
Wer unterstützt denn Diktatoren, wenn es um die eigenen Vorteile und Profite geht?
Wer verlangt denn für seine Soldaten Immunität?
Zum Schurken werden sie degradiert, wenn sie nicht die Vasallen spielen.

Wer baut und verkauft denn auf der Welt die meisten Massenvernichtungswaffen?
Wer unterstützt denn Diktatoren, wenn es um die eigenen Vorteile und Profite geht?
Wer verlangt denn für seine Soldaten Immunität?
Zum Schurken werden sie degradiert, wenn sie nicht die Vasallen spielen.
Hallo Konradi,
Du hast zwar den Satz Fett gedruck, aber hast Du ihn auch verstanden?
"Deshalb ist es George Bush auch letztlich egal, ob Saddam für den 11.September mitverantwortlich ist oder nicht. "
So lange die Frage nicht beantwortet ist, ist es völlig Banane ober für Demokratie oder Öl gekämpft werden soll. Es ist dann beides verwerflich!!!
Basic
Du hast zwar den Satz Fett gedruck, aber hast Du ihn auch verstanden?
"Deshalb ist es George Bush auch letztlich egal, ob Saddam für den 11.September mitverantwortlich ist oder nicht. "
So lange die Frage nicht beantwortet ist, ist es völlig Banane ober für Demokratie oder Öl gekämpft werden soll. Es ist dann beides verwerflich!!!
Basic
@ basic
ich habe an der betreffenden Stelle fünf Sätze fett gedruckt. Sie sind einfach zu verstehen und bilden eine logische Kette.
Gruß Konradi
ich habe an der betreffenden Stelle fünf Sätze fett gedruckt. Sie sind einfach zu verstehen und bilden eine logische Kette.

Gruß Konradi
DIE WELT 25.01.2003
Gold-Spekulation gleicht Roulette
Irak-Krise verzerrt Preise für Edelmetall – Experten erwarten kräftige Kursausschläge
von Jens Wiegmann
Wer als Anleger auf Gold setzt, könnte ebenso gut beim Roulette auf Rot oder Schwarz setzen. Denn je näher ein Krieg gegen den Irak rückt, desto schwieriger und riskanter wird eine Prognose des Goldpreises. Zwar hat die Feinunze die Marke von 367 Dollar überschritten und kostet damit soviel wie seit Januar 1997 nicht mehr. Der Preis für Platin zieht ebenfalls an und erreichte am Freitag ein 17-Jahres-Hoch. Doch Experten warnen, Spekulanten hätten die „Kriegsprämie“ viel zu stark aufgeblasen. Sie setzen mit Termingeschäften bereits auf ein Sinken des Goldpreises und verweisen auf den ersten Irak-Konflikt: 1991 wurde Gold mit Ausbruch des Krieges billiger.
Die Höhe der „Kriegsprämie“ zu beziffern sei sehr schwierig, sagt John Reade, Edelmetall-Analyst von UBS Warburg. Er schätzt sie auf 30 bis 50 Dollar. Im Laufe des ersten Halbjahres rechnet Reade mit einem durchschnittlichen Niveau von 360 Dollar, allerdings bei hoher Volatiliät: „Die Spanne sehe ich zwischen 330 und 420 Dollar.“ Das Spekulieren auf einen Krieg sei aber nicht der alleinige Grund für die Edelmetall-Rally, sagt Michael Blumenroth, Edelmetallhändler der Deutschen Bank. Er schätze die Kriegsprämie beim Gold auf 15 Dollar.
Blumenroth sieht mehrere Gründe für einen weiteren Preisanstieg, zum Beispiel eine erstaunliche Zurückhaltung der Goldminengesellschaften: „Viele Beobachter hatten bei dem aktuellen Preisniveau erwartet, dass die Produzenten viel Gold auf den Markt werfen – das ist aber nicht geschehen.“ Zudem würden die Unternehmen weniger hedgen, sich also weniger durch den Verkauf noch nicht geförderten Goldes gegen sinkende Preise absichern. Einige Produzenten hätten kürzlich angekündigt, weitere Hedges zurückkaufen zu wollen, so Blumenroth: „Bei einem Rückgang auf 340 oder 330 Dollar pro Unze werden deshalb vermutlich massive Käufe einsetzen.“ Dann käme ein Nachfrageanstieg von Seiten der Anleger und der goldverarbeitenden Industrie hinzu.
Ein anderer Goldexperte spricht angesichts der weltweiten Disziplin in Anspielung auf das Ölkartell schon von einer „Gold-Opec“. Allerdings gehen hier die Ansichten der Experten auseinander. So glaubt Reade, dass der hohe Preis dazu führen wird, dass die Produzenten die Kapazitäten steigern.
Norbert Faller, Manager des Fonds Uni Sector Basic Industries bei Union Investment, ist eher ein Gold-Optimist. Er verweist auf die Stilllegung von Kapazitäten in den vergangenen Jahren, deshalb würden die Fördermengen bis 2005 sinken. „Sicher wird die eine oder andere stillgelegte Mine auf Grund des hohen Preises reaktiviert, aber der Effekt wird minimal sein.“
„Gold-Bären“ wie Reade weisen auf einen fundamentalen Faktor hin, der gegen einen starken Anstieg spreche: eine sinkende Nachfrage. Faller gibt zu, dass der wichtige Abnehmer Indien weniger Gold gekauft habe. „Aber das wurde durch einen Anstieg in Asien ausgeglichen.“
Blumenroth sieht zudem in der selbst auferlegten Zurückhaltung der Notenbanken beim Goldverkauf, dem niedrigen Zinsniveau und vor allem der Politik des schwachen Dollar weitere Gründe für einen Aufwärtstrend beim Gold. Die Spekulation auf einen fallenden Preis sei riskant. Alle würden ein Platzen der Blase mit einem Irak-Krieg erwarten. „Aber vielleicht passiert genau das Gegenteil.“
So schwierig wie der Goldpreis selbst sind auch die Aktienkurse von Goldproduzenten zu prognostizieren. So verweisen einige Analysten auf eine Seitwärtsbewegung der Aktien und sehen darin ein Warnsignal für einen fallenden Goldpreis. Andere interpretieren dies als einen Beweis, dass die Titel noch Nachholbedarf haben.
Faller warnt vor dem hohen Risikos einzelner Titel und empfiehlt sie nur zur Beimischung im Portfolio (maximal fünf Prozent). Ganz Fondsmanager rät er eher zu einem breiter angelegten Rohstoff-Fonds. Zertifikate, die die Goldpreisentwicklung direkt abbilden, sind zwar praktischer als Goldbarren, aber ebenfalls riskant: Sie sind weder nach oben noch nach unten abgesichert.
Gold-Spekulation gleicht Roulette
Irak-Krise verzerrt Preise für Edelmetall – Experten erwarten kräftige Kursausschläge
von Jens Wiegmann
Wer als Anleger auf Gold setzt, könnte ebenso gut beim Roulette auf Rot oder Schwarz setzen. Denn je näher ein Krieg gegen den Irak rückt, desto schwieriger und riskanter wird eine Prognose des Goldpreises. Zwar hat die Feinunze die Marke von 367 Dollar überschritten und kostet damit soviel wie seit Januar 1997 nicht mehr. Der Preis für Platin zieht ebenfalls an und erreichte am Freitag ein 17-Jahres-Hoch. Doch Experten warnen, Spekulanten hätten die „Kriegsprämie“ viel zu stark aufgeblasen. Sie setzen mit Termingeschäften bereits auf ein Sinken des Goldpreises und verweisen auf den ersten Irak-Konflikt: 1991 wurde Gold mit Ausbruch des Krieges billiger.
Die Höhe der „Kriegsprämie“ zu beziffern sei sehr schwierig, sagt John Reade, Edelmetall-Analyst von UBS Warburg. Er schätzt sie auf 30 bis 50 Dollar. Im Laufe des ersten Halbjahres rechnet Reade mit einem durchschnittlichen Niveau von 360 Dollar, allerdings bei hoher Volatiliät: „Die Spanne sehe ich zwischen 330 und 420 Dollar.“ Das Spekulieren auf einen Krieg sei aber nicht der alleinige Grund für die Edelmetall-Rally, sagt Michael Blumenroth, Edelmetallhändler der Deutschen Bank. Er schätze die Kriegsprämie beim Gold auf 15 Dollar.
Blumenroth sieht mehrere Gründe für einen weiteren Preisanstieg, zum Beispiel eine erstaunliche Zurückhaltung der Goldminengesellschaften: „Viele Beobachter hatten bei dem aktuellen Preisniveau erwartet, dass die Produzenten viel Gold auf den Markt werfen – das ist aber nicht geschehen.“ Zudem würden die Unternehmen weniger hedgen, sich also weniger durch den Verkauf noch nicht geförderten Goldes gegen sinkende Preise absichern. Einige Produzenten hätten kürzlich angekündigt, weitere Hedges zurückkaufen zu wollen, so Blumenroth: „Bei einem Rückgang auf 340 oder 330 Dollar pro Unze werden deshalb vermutlich massive Käufe einsetzen.“ Dann käme ein Nachfrageanstieg von Seiten der Anleger und der goldverarbeitenden Industrie hinzu.
Ein anderer Goldexperte spricht angesichts der weltweiten Disziplin in Anspielung auf das Ölkartell schon von einer „Gold-Opec“. Allerdings gehen hier die Ansichten der Experten auseinander. So glaubt Reade, dass der hohe Preis dazu führen wird, dass die Produzenten die Kapazitäten steigern.
Norbert Faller, Manager des Fonds Uni Sector Basic Industries bei Union Investment, ist eher ein Gold-Optimist. Er verweist auf die Stilllegung von Kapazitäten in den vergangenen Jahren, deshalb würden die Fördermengen bis 2005 sinken. „Sicher wird die eine oder andere stillgelegte Mine auf Grund des hohen Preises reaktiviert, aber der Effekt wird minimal sein.“
„Gold-Bären“ wie Reade weisen auf einen fundamentalen Faktor hin, der gegen einen starken Anstieg spreche: eine sinkende Nachfrage. Faller gibt zu, dass der wichtige Abnehmer Indien weniger Gold gekauft habe. „Aber das wurde durch einen Anstieg in Asien ausgeglichen.“
Blumenroth sieht zudem in der selbst auferlegten Zurückhaltung der Notenbanken beim Goldverkauf, dem niedrigen Zinsniveau und vor allem der Politik des schwachen Dollar weitere Gründe für einen Aufwärtstrend beim Gold. Die Spekulation auf einen fallenden Preis sei riskant. Alle würden ein Platzen der Blase mit einem Irak-Krieg erwarten. „Aber vielleicht passiert genau das Gegenteil.“
So schwierig wie der Goldpreis selbst sind auch die Aktienkurse von Goldproduzenten zu prognostizieren. So verweisen einige Analysten auf eine Seitwärtsbewegung der Aktien und sehen darin ein Warnsignal für einen fallenden Goldpreis. Andere interpretieren dies als einen Beweis, dass die Titel noch Nachholbedarf haben.
Faller warnt vor dem hohen Risikos einzelner Titel und empfiehlt sie nur zur Beimischung im Portfolio (maximal fünf Prozent). Ganz Fondsmanager rät er eher zu einem breiter angelegten Rohstoff-Fonds. Zertifikate, die die Goldpreisentwicklung direkt abbilden, sind zwar praktischer als Goldbarren, aber ebenfalls riskant: Sie sind weder nach oben noch nach unten abgesichert.
die aussenpolitischen aktivitäten der usa im letzten jahrhundert lassen sich me wie folgt beschreiben.
1. wirtschaftliche prioritäten haben immer vorrang
2. partner, freunde und aliierte werden je nach gutdünken ausgetauscht
3. destabilisierung der gegner durch verdeckte alianzen der usa mit ihren gegner.
bleiben wir nur bei den wichtigen partner der usa (zur durchsetzung verdeckter ziel) aus den letzten 2 jahrzehn.
1. sadam hussein wurde nach dem putsch im irak vom cia unterstützt. im iran-irakkrieg mit waffen und satelitenaufklärungsinformationen. vor der kuweitkriese durch cia-desinformation in ein abenteuer getrieben und anschließend von seinen vermeintlichen freunden mit krieg überzogen.
2. israel wurde in der gleichen zeit von den usa derart hochgerüstet, das dieses land heute ein atomwaffenarsenal hat, welches den gesamten arabischen raum gefährdet. speziell unter dem recht agressiven ariel sharon.
3. saudiarabien wurde als hoflieferant für billiges oel aufgebaut. die königsfamilie wurde für ihr wohlwollen durch den us-geheimdienst vor demokratischen umsturzversuchen gestützt.
durch die dauerhafte us-armee-präsens auf saudischem "heiligem" boden haben die usa die entstehung von terroristischen gruppen wie al quaida selbst forciert.
4. milosewitsch, wurde über jahre vom cia mit waffen und finanzmitteln unterstützt. das ergebnis ist bekannt.
5. bin laden, sohn einer der reichsten arabischen familien, die mit dem bush-clan gemeinsame oelaktivitäten in gigantischem stiel betreibt, wurde im afghanistan-krieg vom cia mit waffen und mitteln gegen die russen eingesetzt.
6. die taliban wurden ebenfalls mit waffen und mitteln vom cia gegen die russen im afghanistankrieg eingesetzt.
die amis bzw. ihre dienst haben all diese selbst herangezüchteten freunde, benutzt, verarscht und schlußendlich zu ihren feind erklärt (ausnahme israel, aber das wird mittelfristig auch noch kommen).
das die sich dafür bedanken ist menschlich verständlich und nur folgerichtig.
wenn man dann auch noch berücksichtigt, das die usa über jahrzehnte ihre kreditfinanzierte konsumwut durch ausbeutung mittel und südamerikas über sanfte erpressung durch den iwf und andere internationale (usa-dominierte) institutionen finanziert, dann weiß man, dass sich sehr bald auch die wahren freunde von den usa abwenden werden.
demnach vorsicht vor den amis, die sind link.
die lassen, wenn es sich rechnet, selbst ihre wichtigsten freunde im regen stehen und schlagen hinterrücks auf sie ein.
mal sehen, wann wir, die brd, zur achse des bösen gehören.
ocjm
gedanken in kurzform zu der recht unübersichtlichen gemengelage.
hergott, schütze mich vor meinen freunden und verwandten. vor meinen feinden kann ich mich schon selbst schützen.
1. wirtschaftliche prioritäten haben immer vorrang
2. partner, freunde und aliierte werden je nach gutdünken ausgetauscht
3. destabilisierung der gegner durch verdeckte alianzen der usa mit ihren gegner.
bleiben wir nur bei den wichtigen partner der usa (zur durchsetzung verdeckter ziel) aus den letzten 2 jahrzehn.
1. sadam hussein wurde nach dem putsch im irak vom cia unterstützt. im iran-irakkrieg mit waffen und satelitenaufklärungsinformationen. vor der kuweitkriese durch cia-desinformation in ein abenteuer getrieben und anschließend von seinen vermeintlichen freunden mit krieg überzogen.
2. israel wurde in der gleichen zeit von den usa derart hochgerüstet, das dieses land heute ein atomwaffenarsenal hat, welches den gesamten arabischen raum gefährdet. speziell unter dem recht agressiven ariel sharon.
3. saudiarabien wurde als hoflieferant für billiges oel aufgebaut. die königsfamilie wurde für ihr wohlwollen durch den us-geheimdienst vor demokratischen umsturzversuchen gestützt.
durch die dauerhafte us-armee-präsens auf saudischem "heiligem" boden haben die usa die entstehung von terroristischen gruppen wie al quaida selbst forciert.
4. milosewitsch, wurde über jahre vom cia mit waffen und finanzmitteln unterstützt. das ergebnis ist bekannt.
5. bin laden, sohn einer der reichsten arabischen familien, die mit dem bush-clan gemeinsame oelaktivitäten in gigantischem stiel betreibt, wurde im afghanistan-krieg vom cia mit waffen und mitteln gegen die russen eingesetzt.
6. die taliban wurden ebenfalls mit waffen und mitteln vom cia gegen die russen im afghanistankrieg eingesetzt.
die amis bzw. ihre dienst haben all diese selbst herangezüchteten freunde, benutzt, verarscht und schlußendlich zu ihren feind erklärt (ausnahme israel, aber das wird mittelfristig auch noch kommen).
das die sich dafür bedanken ist menschlich verständlich und nur folgerichtig.
wenn man dann auch noch berücksichtigt, das die usa über jahrzehnte ihre kreditfinanzierte konsumwut durch ausbeutung mittel und südamerikas über sanfte erpressung durch den iwf und andere internationale (usa-dominierte) institutionen finanziert, dann weiß man, dass sich sehr bald auch die wahren freunde von den usa abwenden werden.
demnach vorsicht vor den amis, die sind link.
die lassen, wenn es sich rechnet, selbst ihre wichtigsten freunde im regen stehen und schlagen hinterrücks auf sie ein.
mal sehen, wann wir, die brd, zur achse des bösen gehören.
ocjm
gedanken in kurzform zu der recht unübersichtlichen gemengelage.
hergott, schütze mich vor meinen freunden und verwandten. vor meinen feinden kann ich mich schon selbst schützen.
@ ocjm
es ist zwar nicht alles falsch, was Du da zusammengetragen hast, aber es umreißt nur ein Zehntel der Wahrheit. Ich will hier niemand missionieren, aber manchmal frage ich mich bei Leuten wie Dir schon, was Dir Deine Lehrer in der Schule beigebracht haben.
Hast Du eigentlich die davorliegenden Artikel und Essays #176 bis #183 gelesen ?
Falls nicht, bitte ich Dich, Deine künftigen Beiträge im Thread " Antiamerikanischer Rassismus ..." zu posten.
Dort findest Du die von keinen Zweifeln angekränkelte Unterstützung Deiner Weltsicht.
Gruß Konradi
es ist zwar nicht alles falsch, was Du da zusammengetragen hast, aber es umreißt nur ein Zehntel der Wahrheit. Ich will hier niemand missionieren, aber manchmal frage ich mich bei Leuten wie Dir schon, was Dir Deine Lehrer in der Schule beigebracht haben.
Hast Du eigentlich die davorliegenden Artikel und Essays #176 bis #183 gelesen ?
Falls nicht, bitte ich Dich, Deine künftigen Beiträge im Thread " Antiamerikanischer Rassismus ..." zu posten.
Dort findest Du die von keinen Zweifeln angekränkelte Unterstützung Deiner Weltsicht.
Gruß Konradi
@Konradi
Warum versteckst Du Dich immer hinter irgendwelchen superlangen abgekupferten Beiträgen ?
Hast Du keine eigene Meinung ?
Bist Du in der Börsensprache ein "Lemming" ?
Sozusagen ein opportunistischer Nachplapperer ?
So wie jetzt teilweise in der CDU:
Schwafel- und Rollstuhlchampion Schäuble labert etwas von `überzeugender Drohkulisse`
und die CDU-Lemminge Merkel, Rühe, Pflüger (CDU-Doktor a la Barschel ?)
plappern das unbedarft hinterher.
Pfui Deibel
GO
Warum versteckst Du Dich immer hinter irgendwelchen superlangen abgekupferten Beiträgen ?
Hast Du keine eigene Meinung ?
Bist Du in der Börsensprache ein "Lemming" ?
Sozusagen ein opportunistischer Nachplapperer ?
So wie jetzt teilweise in der CDU:
Schwafel- und Rollstuhlchampion Schäuble labert etwas von `überzeugender Drohkulisse`
und die CDU-Lemminge Merkel, Rühe, Pflüger (CDU-Doktor a la Barschel ?)
plappern das unbedarft hinterher.
Pfui Deibel
GO
zu #185 von konradi
meine lehrer haben mir beigebracht, von leuten wie dir nichts, anzunehmen.
anmerkung: meinungsbekundungen -wie auf diesem board- betrachte ich als "gesprochenes wort" demnach weder gramatik noch rechtschreibung überprüft.
dazu fehlt mir einfach die zeit.
ocjm1
meine lehrer haben mir beigebracht, von leuten wie dir nichts, anzunehmen.
anmerkung: meinungsbekundungen -wie auf diesem board- betrachte ich als "gesprochenes wort" demnach weder gramatik noch rechtschreibung überprüft.
dazu fehlt mir einfach die zeit.
ocjm1
.
Die Akte Saddam -
Das System des Schreckens
von Kenneth Pollack
Der "unverzichtbare Führer" des Irak sieht sich in der Tradition historischer Heldenfiguren - von Nebukadnezar bis zu Saladin: Saddam Hussein, der selbst ernannte Vorkämpfer der arabischen Nationen, träumt vom Aufstieg zur atomaren Supermacht.
Der Irak heute ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen hat sich für das irakische Volk als Katastrophe erwiesen. Zwar lebten die Iraker auch schon vor dem Krieg in einer stalinistischen Hölle, aber gemessen an anderen Staaten der Region ging es ihnen relativ gut: Ernährungslage, Ausbildung und Gesundheitswesen waren verlässlich, das Öl bescherte ihnen einigen Wohlstand. Heute müssen sie neben Saddams Terror täglich Demütigungen ertragen, dazu erdrückende wirtschaftliche Not und eine kollabierende Gesundheitsversorgung. Schlimmer noch: Die Sanktionen haben Saddams eisernen Griff verstärkt und liefern das irakische Volk hilflos seinen Schergen aus.
Saddams Position ist heute paradoxerweise gleichzeitig schwächer und stärker als vor der Invasion Kuweits. Sie ist schwächer, weil er den größten Teil seiner militärischen Potenz verloren hat, die den Irak zu einer regionalen Macht hatte aufsteigen lassen. Sie ist erschüttert, seitdem wiederholte Putschversuche und Aufstände das Ausmaß seiner Unbeliebtheit zeigten und Oppositionskräften Mut machten. Weder hat er die Kontrolle über die kurdischen Landstriche im Norden zurückgewonnen, noch herrscht er über einen souveränen Staat. Britische und amerikanische Kampfflieger kontrollieren fast 60 Prozent des irakischen Luftraums. Darüber hinaus hat Saddams Machtbasis - die Stämme und Städte, die ihn während seiner Präsidentschaft unterstützt haben und deren Mitglieder das Gros seiner Sicherheitsdienste und der wichtigsten militärischen Einheiten ausmachen - erkennen müssen, wie tief Kraft und Ansehen des Irak gesunken sind - eine Demütigung, die selbst seine Anhänger verärgert hat.
Zugleich ist Saddam aber auch stärker als zuvor. So viele Gegner haben bereits versucht, ihn zu stürzen und sind daran gescheitert - und wurden dafür mit Hinrichtung oder Verbannung bestraft -, dass es heute buchstäblich keinen politischen Führer von Rang und Namen innerhalb des Irak gibt, um den sich die Bevölkerung scharen könnte.
Saddams Macht hat sich paradoxerweise auch gefestigt, weil die Mechanismen der Uno-Sanktionen und das Programm "Öl für Lebensmittel" ihm die Kontrolle über Einzelheiten des täglichen Lebens im Irak zuschob, die er früher nie besaß. Und sie ist größer, weil Saddam alle Versuche Amerikas, ihn zu stürzen, überlebt hat und seine frühere Position zurückgewinnen könnte, wenn die Sanktionen erst einmal aufgehoben sind.
Ein wichtiges Element für den Erfolg, sich seit 1979 an der Macht zu halten, war seine Fähigkeit, ein Netzwerk von Gruppen zu bilden, die sein Regime unterstützen. Ein altes arabisches Sprichwort sagt: "Ich und mein Bruder gegen unseren Cousin, ich und mein Cousin gegen einen Fremden." In anderen Worten: Innerhalb der traditionellen arabischen Gesellschaft gibt es konzentrische Ringe von Loyalität, auf die sich Saddam stets stützen konnte. So verließ er sich auf enge Verwandte, die ihn gegen alle Rivalen aus seiner näheren Umgebung verteidigten. Und er konnte sich auf entferntere Verwandte, Klan-Mitglieder, Stammesmitglieder sowie die Bewohner seiner Geburtsstadt Tikrit verlassen, die ihn gegen andere Herausforderer verteidigten.
Deshalb besetzt Saddam den innersten Zirkel seines Regimes ausschließlich mit Personen, die er stets am vertrauenswürdigsten befunden hat: Familienmitglieder. Nach seiner Machtergreifung blieb sein Cousin und engster Freund, Adnan Cheirallah, Verteidigungsminister, sein Halbbruder Barsan Ibrahim leitete den Geheimdienst, sein Onkel Cheirallah Tulfah wurde Bürgermeister von Bagdad. Auch seine Halbbrüder Watban und Sabawi wurden später zum Innenminister beziehungsweise zum Sicherheitschef ernannt.
Seine beiden Söhne Udai und Kussei nehmen inzwischen wichtige Positionen ein. Der jähzornige Udai leitet nach verschiedenen anderen Posten heute mehrere Zeitungen, ist Chef des Irakischen Olympischen Komitees (und damit de facto Jugendminister) und befehligt die Fedajin, Saddams paramilitärische Einheiten. Kussei ist der neue Star der Familie. Ruhig, verlässlich und brutal, leitet er jene Sondersicherheitsgruppe, die heute der wichtigste Geheimdienst des Irak ist. Saddam überließ ihm größere Verantwortung als je zuvor einem anderen Sicherheitschef.
Doch so groß die Familie auch ist, ihre Mitgliederzahl reicht nicht aus, um all jene Spitzenpositionen zu besetzen, die notwendig sind, um ein Volk von 23 Millionen Einwohnern zu kontrollieren. Deshalb rekrutiert Saddam viele Mitglieder aus seinem Beidschat-Clan, aus dem Bu-Nasir-Stamm und aus seiner Heimatstadt Tikrit, weil diese Stammesbeziehungen ein hohes Maß an Loyalität garantieren. Darüber hinaus unterstützt er generell die sunnitischen Araber in ihrem Kampf um die Vorherrschaft gegen die zahlenmäßig überlegenen Schiiten, gegen die Kurden und andere Nationalitäten. Mitglieder der großen sunnitischen Stämme besetzen die wichtigsten Posten bei der Republikanischen Garde und den Sicherheitsdiensten.
Eine weitere Quelle der Unterstützung für Saddam ist die Baath-Partei, die derzeit über 1,5 Millionen Mitglieder verfügt. Zwar hat ihr Einfluss im Laufe der Jahre nachgelassen - auch weil sie sich im iranisch-irakischen Krieg und während der Kurden- und Schiitenaufstände als wankelmütig und feige erwiesen hat. Dennoch können die Parteimitglieder jederzeit für große Straßendemonstrationen mobilisiert werden und dem Regime als Propagandaarmee dienen. Kommt es zur Krise, könnten sie bewaffnet auf die Straße geschickt werden.
Saddam arbeitet hart dafür, die Loyalität seiner Anhänger zu festigen. Seine Familie, Freunde und andere Führungsfunktionäre genießen üppige Privilegien. Die Offiziere der Sicherheitsdienste und Republikanischen Garde erhalten mehr Sold, größere Autos und andere Vorteile. Andererseits droht Saddam aber auch ständig mit den Strafen, die auf Verräter warten. Seit seinem Amtsantritt 1979 beteiligt der Diktator seine Mitarbeiter systematisch an seinen Verbrechen.
Von Anfang an hat Saddam die Bedeutung des Überwachungsapparates beim Ausbau seiner Macht erkannt. Immer wieder im Verlauf seiner Karriere hat er die Sicherheitsmaschinerie Nazi-Deutschlands und des stalinistischen Russland studiert. Ständig war er bestrebt, die Mitglieder seines eigenen Sicherheitsapparats noch enger an sich zu binden. Soldaten, Polizisten und Agenten sind pausenloser Propaganda ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sie die Welt genauso betrachten wie er.
Es gibt annähernd zwei Dutzend irakische Geheim- und Sicherheitsdienste. Mit insgesamt etwa 500 000 Mitgliedern in den Geheimdienst-, Staatsschutz- und Polizeiorganisationen. Rechnet man die Streitkräfte und paramilitärischen Einheiten hinzu, erreicht die Zahl etwa 1,3 Millionen - bei einer Bevölkerung von 23 Millionen. Die Iraker glauben, dass die Sicherheitsdienste außerdem noch über 2 bis 4 Millionen Informanten verfügen. All diese Organisationen belauern sich gegenseitig; jedes Mitglied einer Sicherheitsgruppe muss damit rechnen, seinerseits von vielen anderen überwacht zu werden.
Die wichtigsten Einheiten sind:
Sondergruppe Sicherheit, al-Amn al-Chass. Die Organisation wurde 1982 gegründet und wird gegenwärtig von Kussei geleitet. Sie trägt zum Teil die Verantwortung für den Schutz von Saddam selbst. Andere Mitglieder werden als Leibwachen für die bedeutendsten Funktionäre des Regimes und für alle Militärkommandeure abgestellt.
Die Begleiter, Murafikin. Hierbei handelt es sich um die 40 persönlichen Leibwächter von Saddam selbst. Alle entstammen dem Beidschat-Clan des Bu-Nasir-Stamms. Die Murafikin-Chefs gehören zu den gefürchtetsten Männern im Irak. Die Truppe wird geleitet von Abd al-hamid Humud, Saddams persönlichem Sekretär und drittmächtigstem Mann im Irak nach dem Staatschef und Kussei.
Die Präsidentengarde, al-Himaja. Ihre Stärke beträgt etwa 2000 Mann, die fast alle dem Bu-Nasir-Stamm angehören. Es gibt drei Einheiten. Die mobile Gruppe ist verantwortlich für den Schutz von Saddams Reisen. Sie sichert die Fahrstrecken und die Zielorte.
Die Sondereinheiten der Republikanischen Garde, al-Haras al-Dschumhuri al-Chass. Diese Sondereinheiten bestehen aus vier Brigaden mit etwa 30 000 Soldaten, die vor allem aus Tikrit und den umliegenden Dörfern rekrutiert wurden. Sie sind schwer bewaffnet, verfügen über eigene Artillerie und Panzerfahrzeuge und dienen vornehmlich dazu, Aufstände oder einen militärischen Staatsstreich niederzuschlagen.
Der Geheimdienst, al-Muchabarat al-Amma. Die Behörde ist der älteste und wichtigste Geheimdienst. Ihr obliegen Spionage und Gegenspionage, aber auch verdeckte Operationen.
Allgemeiner Sicherheitsdienst, al-Amn al-Amm. Dies ist der größte Geheimdienst mit Zehntausenden von Agenten. Es ist der Apparat, mit dem es ein Durchschnitts-Iraker am ehesten zu tun bekommt. In jeder Stadt und jedem ländlichen Bezirk ist ein Amn-Büro untergebracht, wo Mitarbeiter alles registrieren, was in ihrem Distrikt geschieht. Amn-Agenten sind aber auch verantwortlich für den Terror gegenüber der eigenen Bevölkerung.
Militärischer Geheimdienst, al-Istichbarat al-Askarija. Das Amt ist verantwortlich für das Sammeln von Informationen über ausländisches Militär. Seine wichtigste Aufgabe besteht jedoch darin, über die Loyalität der eigenen Streitkräfte zu wachen.
Paramilitärische Einheiten, Fedajin Saddam haben etwa 100 000 Mitglieder. Obwohl ihre Schlagkraft nicht an die der Republikanischen Garde heranreicht, sind sie doch ein weiteres wichtiges Element in Saddams Gleichgewicht des Schreckens.
Agenten, Polizisten und Soldaten hat Saddam gleichermaßen dazu benutzt, im ganzen Land ein Klima des Terrors zu erzeugen - das hervorstechendste Merkmal des irakischen Totalitarismus. Im April 2002 verabschiedete die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen eine Resolution, in der es heißt: "Die systematischen, weit verbreiteten und äußerst schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung des Irak haben ein allumfassendes Klima von Repression und Unterdrückung geschaffen. Es wird aufrechterhalten durch ein System von Diskriminierungen und Terror."
"WIR WOLLEN, DASS DER IRAK DASSELBE GEWICHT HAT WIE CHINA, DIE SOWJETUNION ODER DIE VEREINIGTEN STAATEN."
Dies ist ein Regime, das Kindern die Augen aussticht, um von Eltern oder Großeltern Geständnisse zu erpressen. Dies ist ein Regime, das alle Fußknochen eines zweijährigen Mädchens einzeln zerbricht, um seine Mutter zu zwingen, den Aufenthaltsort ihres Mannes preiszugeben. Dies ist ein Regime, das einen Säugling auf Armeslänge von seiner Mutter entfernt hält und das Kind verhungern lässt, um seine Mutter zu einer Aussage zu bewegen. Dies ist ein Regime, das seine Opfer langsam in riesige Kessel von Säure herablässt, entweder, um ihren Willen zu brechen, oder einfach nur als Hinrichtungsart. Dies ist ein Regime, das seinen Opfern Elektroschocks verabreicht, vor allem an den Genitalien, und bei dieser Tortur große Kreativität zeigt.
Dies ist ein Regime, das im Jahre 2000 als Strafe für jede Kritik - und da reicht es schon, darauf hinzuweisen, dass Saddams Kleidung nicht zusammenpasst - festsetzte, dass dem Delinquenten die Zunge abgeschnitten wird. Dies ist ein Regime, das eine Frau, eine Tochter oder andere weibliche Verwandte wiederholt vor den Augen eines Mannes vergewaltigt. Dies ist ein Regime, das seine Opfer mit rot glühenden Eisenstäben pfählt. Dies ist ein Regime, das eine junge Mutter auf der Straße vor ihrem Haus und in Anwesenheit ihrer Kinder enthauptet, weil ihr Mann in Verdacht steht, ein Gegner ebendieses Regimes zu sein.
Dies ist ein Regime, das biologische und chemische Kampfstoffe an seinen iranischen Kriegsgefangenen erprobte, um herauszufinden, auf welche Weise diese Gifte ihre größte Wirkung erzielen.
Obwohl Saddam das irakische Volk täglicher Knechtschaft unterwirft, wird sich seine Bedrohlichkeit für die USA und die Welt eher mittelfristig entfalten. Es könnte noch einige Jahre dauern, bis er zu einer übermächtigen, unumgänglichen Gefahr wird. Die konventionellen Streitkräfte des Irak sind seit ihrer Niederlage im vorigen Golfkrieg geschwächt, ihre Schlagkraft ist durch die bestehenden Sanktionen eingeschränkt. Obwohl Bagdad inzwischen dank des Programms "Öl für Lebensmittel" wieder in der Lage war, Teile seiner konventionellen Streitkräfte zu stärken, wären mindestens noch weitere fünf Jahre und die Aufhebung der Sanktionen nötig, um die gleichen Kapazitäten aufzubauen, über die der Irak vor dem Krieg verfügte.
Doch Saddam war stets ein Mann von großen Ambitionen. Jerrold Post, ein Psychologe, der früher für US-Geheimdienste gearbeitet und sich ausführlich mit Saddam beschäftigt hat, schrieb: "Sein Streben nach Macht für sich selbst und für den Irak kennt keine Grenzen. In seiner Vorstellung gibt es keinen Unterschied zwischen dem Schicksal Saddams und dem des Irak." Der Tyrann vom Tigris nennt sich selbst "al-Kaid al-daruri", der unverzichtbare Führer. Der Titel bringt zum Ausdruck, dass er in einem eschatologischen Sinn dazu bestimmt sei, über den Irak zu herrschen.
In der Tat empfindet er sich als eine geschichtliche Figur, als jemand, der dazu ausersehen ist, große Dinge zu vollbringen. In dem von ihm entfesselten Personenkult wird er mit den großen Figuren der irakischen Vergangenheit verglichen. Er ist der neue Nebukadnezar, jener babylonische König, der das biblische Israel eroberte, Jerusalem einnahm und die Juden in die Gefangenschaft führte. Er ist al-Mansur, jener Kalif, der Bagdad erbaute und neue Länder für den Islam eroberte. Er ist der neue Saladin, jener islamische General, der die Kreuzzügler besiegte und Jerusalem zurückeroberte.
Saddam glaubt sich selbst zum neuen Führer der arabischen Nationen ausersehen, und er will diese Position mit einer Kombination von Eroberungen und Akklamation gewinnen.
Wiederholt hat der Staatschef klargestellt, er wolle eine arabische Union schaffen, die, von einem mächtigen Irak geleitet, zur neuen Supermacht aufsteigt. 1980, sechs Monate nach seinem Amtsantritt als Präsident, sagte er: "Wir wollen, dass der Irak dasselbe Gewicht hat wie China, wie die Sowjetunion oder wie die Vereinigten Staaten."
Darüber hinaus verfolgt er beharrlich die Idee, eines Tages Jerusalem zu befreien, obwohl das nicht seine wichtigste Priorität zu sein scheint. Er erblickt darin wohl eher einen krönenden Abschluss seiner Arbeit. Dennoch erwähnt er dieses Ziel zu häufig, als dass man es als bloße Propaganda abtun könnte. Bezeichnenderweise hatte er - wie die Uno-Waffeninspektoren kurz nach dem jüngsten Golfkrieg erfahren sollten - den irakischen Scud-Einheiten Anweisungen gegeben, ihre mit biologischen und chemischen Waffen bestückten Raketen auf Tel Aviv abzufeuern, falls die Allianz nach Bagdad vorgerückt wäre. Er empfindet sich eben als historische Figur, die eines Tages die arabische Welt von der israelischen Präsenz befreit.
Der Golfkrieg und die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten haben Saddam schließlich ein neues Motiv und ein neues Ziel gegeben: Rache. In einer Stammesgesellschaft, der Saddam entstammt, ist Rache ein treibendes Motiv. Auf Rache zu verzichten ist ein Zeichen von Schwäche.
Während seiner gesamten Amtszeit hat Saddam den Terrorismus unterstützt. Dennoch stellt diese Gewalt noch die geringste Gefahr dar, die vom Irak ausgeht. Auf einer Rangliste von Unterstützern des Terrorismus würde der Irak nur einen niedrigen Platz einnehmen, weit hinter Iran, Syrien, Pakistan und anderen Staaten.
Saddams Haltung entspringt mehreren Motiven. Zunächst einmal will er weiterhin ein Akteur im arabischisraelischen Konflikt bleiben, außerdem hat er sich stets entschlossen gezeigt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um die eigenen Interessen zu befördern. Während der siebziger und in den frühen achtziger Jahren hat der Irak deshalb den internationalen Terrorismus unterstützt, vor allem radikale Palästinenser-Gruppen. Von Anfang an hat das Baath-Regime der PLO in ihrem Kampf gegen Israel geholfen. Nach 1974 jedoch zerstritt sich Saddam mit Jassir Arafat, weil der PLO-Chef einen gemäßigteren Kurs einschlug. Als Revanche half der Irak fortan der Abu-Nidal-Gruppe und anderen palästinensischen Arafat-Gegnern.
Saddams wachsende Furcht vor einer Niederlage im iranisch-irakischen Krieg führte jedoch zu einer Wende in seiner Haltung zum Terrorismus. Je mehr der Irak auf die Hilfe europäischer und gemäßigter arabischer Staaten sowie der USA angewiesen war, desto mehr distanzierte er sich von seinen früheren Bundesgenossen. Der Bericht des amerikanischen Außenministeriums aus dem Jahr 1986 lobte den Irak ausdrücklich für diese Wende.
"DIE DOKUMENTE KONNTEN WIR SO VERSTECKEN, DASS FREMDE NICHT IN DER LAGE WAREN, SIE AUFZUSPÜREN."
Das irakische Interesse am Terrorismus erwachte wieder während des Kriegs gegen die USA. Bekannte Extremisten wurden nach Bagdad eingeladen und mit Waffen und anderen Mitteln eingedeckt. Als der ehemalige Präsident Bush 1993 den Emir von Kuweit besuchte, schickte Saddam ein Muchabarat-Team, das beide töten sollte. Die Agenten jedoch stellten sich so unprofessionell an, dass ihr Vorhaben schnell aufgedeckt wurde.
Auch heute gewährt der Irak Terrorgruppen Unterstützung, wenngleich nicht im selben Ausmaß wie in den siebziger Jahren. Zudem hilft er radikalen Palästinenser-Gruppen, obwohl er sie gleichzeitig seit mehr als 15 Jahren daran hindert, aktiv zu werden. Er pflegt beste Beziehungen zur kurdischen Arbeiterpartei PKK sowie zu den iranischen Mudschahidin-e chalgh. Seit dem Ausbruch der Aksa-Intifada in den Palästinenser-Gebieten im Herbst 2000 hat Saddam auch die Hamas gefördert.
Dennoch haben US-Geheimdienste bislang keine glaubwürdigen Beweise dafür gefunden, dass der Irak seit jenem verpatzten Mordanschlag gegen Bush Sr. in irgendeiner Form am Terrorismus gegen die USA beteiligt ist. Es gibt jedoch den Verdacht, dass der Irak an einer Reihe terroristischer Planspiele arbeitet. Zwar hat es auch Beziehungen zu al-Qaida gegeben, aber diese Verbindungen sind nach unserem Wissen spärlich und unbedeutend. Sowohl irakische Geheimdienstler als auch verschiedene Untergruppen von al-Qaida operieren in der Unterwelt des Nahost-Terrorismus und sind dort einander zweifellos begegnet. Wahrscheinlich haben sie sich auch schon gegenseitig geholfen, etwa durch den Austausch von gefälschten Pässen oder von Know-how. Möglicherweise haben beide Seiten auch dieselben terroristischen Gruppen unterstützt wie etwa Ansar-e Islam, die sich im irakischen Teil Kurdistans organisiert haben soll.
Eine Einschätzung der konventionellen militärischen Kapazitäten des Irak ergibt ein Bild voller Widersprüche. 1990 verfügte das irakische Militär über ein Potenzial, das es, verglichen mit dem regionalen Rüstungsniveau, zu einer bedeutenden Macht werden ließ. An den Armeen der Ersten Welt gemessen, mussten Bagdads Streitkräfte dagegen als unbedeutend gelten. Als Ergebnis der katastrophalen Niederlage gegen die Amerikaner im Golfkrieg und als Folge der Uno-Sanktionen hat das irakische Militär obendrein viele seiner einstigen Vorzüge verloren. Gegen die Truppe von George W. Bush könnten die irakischen Streitkräfte heute nichts mehr ausrichten; sie stellen aber noch immer eine Bedrohung für kleinere Nachbarn des Irak dar und könnten erst recht mit Leichtigkeit all jene Truppen überwältigen, die eine interne Opposition aufstellen würde.
Die reguläre Armee besteht aus 17 Divisionen mit zusammen 300 000 Mann, darunter drei Panzer- und drei Panzergrenadier-Divisionen. Der Großteil seiner Armee, insgesamt elf Divisionen, ist gegen die Kurden im Norden aufgestellt, drei weitere dienen der Sabotageabwehr schiitischer Guerrillagruppen im Südirak. Die restlichen drei Divisionen bewachen die Südgrenze des Irak gegenüber Iran. Die reguläre Armee wurde am heftigsten durch die Operation "Wüstensturm", die anschließenden Aufstände und die Uno-Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen. Die Moral der Truppe ist niedrig, besonders bei den Infanterie-Divisionen, die sich größtenteils aus schiitischen Wehrpflichtigen zusammensetzen.
Die Republikanische Garde bildet dagegen weiterhin die Elitetruppe des Irak - was jedoch ein relativer Begriff ist. Gegenwärtig besteht die Garde aus 80 000 Soldaten, die in sechs Divisionen aufgeteilt sind. Die drei Panzerbrigaden, die schlagkräftigsten Einheiten des Irak, sind in einem Ring um Bagdad aufgestellt. Sie bilden einen Gürtel, der kaum zu durchbrechen wäre, sollten Einheiten der regulären Armee versuchen, das Regime zu stürzen.
In der Luftwaffe dienen 30 000 Soldaten, die über etwa 300 Flugzeuge verfügen. Allerdings sind höchstens 150 einsatzbereit, darunter ein paar Dutzend MiG-29 und Mirage F-1. Alle anderen Typen sind veraltet und nur dazu in der Lage, Bomben über großen Zielen abzuwerfen.
Die Luftabwehr war schon immer der am meisten vernachlässigte Teil der Streitkräfte, obwohl sie es ist, die seit der Niederlage 1991 die Angriffe amerikanischer und britischer Kampfflieger ertragen muss. Etwa 15 000 Soldaten verfügen über 500 Abschussvorrichtungen für Boden-Luft-Raketen, die meisten davon veraltet und keine Gefahr für die US-Streitkräfte.
Wegen der begrenzten Kapazitäten der konventionellen Streitkräfte sind Saddams Massenvernichtungswaffen umso bedeutsamer. Obwohl die ersten Uno-Inspektoren weit mehr irakische Massenvernichtungswaffen zerstörten, als Bagdad in seinen schlimmsten Träumen befürchtete, war der Irak in der Lage, sein Wissen und die Ausrüstung für die Herstellung dieser Waffen zu bewahren. Ein hochrangiger irakischer Überlaufer formulierte das so: "Es ist unmöglich, chemische und biologische Waffen komplett zu vernichten. Niemand kann das Know-how in den Köpfen unserer Wissenschaftler zerstören. Installationen für die Produktionen biologischer und chemischer Waffen wurden bereits abgebaut, bevor die Uno-Kontrolleure ankamen. Sie wurden verborgen und wieder zusammengesetzt. Die Dokumente konnten wir so verstecken, dass Fremde nicht in der Lage waren, sie aufzuspüren."
Ballistische Raketen
Nach 1973 hat der Irak von der Sowjetunion insgesamt 819 Scud-B-Raketen sowie 11 Abschussvorrichtungen gekauft. Die Unscom-Inspektoren ermittelten 1996, dass der Irak etwa 80 Scud-ähnliche Raketen selbst hergestellt hatte, obwohl die meisten von ihnen offenbar nicht einsatzfähig waren. Der Irak baute außerdem 8 mobile und 28 ortsfeste Abschussvorrichtungen. Es waren Raketen vom Typ Scud-B, die der Irak modifizierte, um ihre Reichweite auf 650 Kilometer auszuweiten. Stolz wurde das neue Geschoss "al-Hussein" genannt. Insgesamt feuerte Bagdad 330 Scud-B und 203 al-Hussein-Raketen im ersten Golfkrieg gegen iranische Städte ab und während des zweiten Golfkriegs weitere 88 al-Hussein-Geschosse gegen Ziele in Israel, Saudi-Arabien und Bahrein. Zusätzliche Scud-Raketen benötigten die Konstrukteure für Tests, andere wurden für den Bau der al-Husseins ausgeschlachtet. Teile dreier Scud-B-Raketen ergaben zwei al-Hussein-Flugkörper. Nach ihrer Niederlage haben irakische Militärs zugegeben, etwa 50 Gefechtsköpfe mit chemischen Kampfstoffen (Nervengas Sarin) und 25 mit biologischen Kampfstoffen (Botulin, Milzbrand und Aflatoxin) gefüllt zu haben.
US-Geheimdienste glauben, dass der Irak einige al-Hussein-Raketen beiseite schaffen konnte; ihre Zahl liegt vermutlich zwischen 12 und 40. Mitte der neunziger Jahre entdeckten die Unscom-Fahnder eine Fabrik, in der immer noch Raketenmotoren hergestellt wurden. Als sie 1998 das Land verlassen mussten, schätzten sie, der Irak verfüge über mindestens ein Dutzend einsatzfähige al-Husseins. Überläufer berichteten, dass die wahre Anzahl eher zwischen 30 und 45 läge.
Als Fehler erwies sich, dass die Sicherheitsratsresolution 687 von 1991 dem Irak weiterhin den Besitz von ballistischen Raketen mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern gestattete. Auch die Erforschung und Entwicklung solcher Raketen ist weiterhin erlaubt. Seinerzeit verfügte Bagdad über russische Kurzstreckenraketen vom Typ Frog mit einer Reichweite von etwa 90 Kilometern. Die Uno glaubte, es sei wichtig, den Irak so stark zu lassen, dass er den feindlichen Nachbarn Iran in Schach halten könne. Deshalb solle Bagdad erlaubt werden, weiterhin ein aktives Raketenentwicklungsprogramm zu betreiben. Kernstück dieses Projekts ist die al-Samud, eine Boden-Boden-Rakete auf der Grundlage eines Luftabwehrgeschosses vom Typ SA-2, deren Technik aber alles enthält, was der Irak aus seinem Scud-Programm gelernt hat. Bagdad behauptet, die Samud habe eine Reichweite von 150 Kilometern, US-Geheimdienste trauen ihr dagegen 200 Kilometer zu.
Überdies entwickelt der Irak eine Rakete mit Namen Ababil-100, die Festtreibstoff nutzt. Sie dient als Testmodell für künftige komplexere Projekte und hat wahrscheinlich eine Reichweite, die ebenfalls größer ist als die angegebenen 100 Kilometer. Amerikanische Dienste glauben, dass der Irak wahrscheinlich in der Lage sein würde, innerhalb der nächsten 15 Jahre Interkontinental-Raketen zu entwickeln, die auch die USA treffen könnten - wenn man ihn nicht rechtzeitig daran hindert.
Chemische Kampfstoffe
1974 begann der Irak die Produktion von Senfgas. In den achtziger Jahren folgten vergleichsweise simple Nervengase wie Sarin und Tabun. Zu einem bestimmten Zeitpunkt während des iranisch-irakischen Kriegs waren Bagdads Wissenschaftler in der Lage, das tödliche, hochwirksame Nervengas VX zu entwickeln. Saddams Militärs setzten ihre chemischen Kampfstoffe erstmals 1983 gegen iranische Truppen ein und haben damals nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Geschosse mit chemischer Munition abgefeuert.
Zwar zerstörten die Uno-Inspektoren riesige Mengen chemischer Munition und Kampfstoffe. Bis zum Ende der Inspektionen aber kämpften sie vergebens um eine vollständige Auflistung aller Munition mit chemischen Kampfstoffen. Es gelang den Inspektoren auch nicht, die Vorräte an VX-Gas oder bereits abgefüllte Granaten zu zerstören.
Unscom-Mitarbeiter glauben deshalb, dass der Irak über 6000 Stück Munition mit chemischen Kampfstoffen inklusive der Raketensprengköpfe zurückbehalten hat, dazu große Mengen der zur Herstellung notwendigen Chemikalien und Apparaturen. Sie glauben, dass Bagdad daher die Fähigkeit hat, zusätzliche Kampfstoffe und Munition herzustellen.
Seit dem Golfkrieg hat das Regime vor allem in Falludscha mehrere große Fabriken gebaut, die Chemikalien für militärische Anwendung produzieren sollen, aber ebenso zivil nutzbar sind. Weil sich die meisten chemischen Kampfstoffe im Laufe der Zeit zersetzen, andererseits aber vergleichsweise schnell hergestellt werden können, ergibt sich für Saddam keine Notwendigkeit, riesige Vorräte anzulegen.
Biologische Kriegführung
Der Irak begann sein biologisches Waffenprogramm 1972. Es war dieses Programm, welches Saddam gegenüber den Uno-Inspektoren am liebsten vollständig verheimlicht hätte. Der Irak hat zugegeben, Milzbrand, Botulin und Aflatoxin für den Waffengebrauch hergestellt zu haben. Die Unscom-Inspektoren haben überdies entdeckt, dass der Irak auch mit den Erregern des Wundbrands geforscht hat. In den Labors befanden sich ferner Testreihen mit dem Gift Ricin und verschiedene Viren, daneben auch Pestbakterien. Die Waffentechniker hatten bereits erste Schritte unternommen, um solche Kampfstoffe genetisch zu verändern und damit ihre Resistenz gegenüber Antibiotika zu erhöhen.
Obwohl es keinen Beleg dafür gibt, dass der Irak biologische Waffen vor dem Golfkrieg von 1990/91 eingesetzt hat, glauben einige Experten, Saddam habe während der späten achtziger Jahre versuchsweise biologische Kampfstoffe gegen die Kurden benutzt. Anfang 1991 verfügte die Armee insgesamt über zehn Milliarden Einheiten biologischer Kampfstoffe. Im Dezember 1990, unmittelbar vor der Operation "Wüstensturm", befahl Saddam, so schnell wie möglich Artilleriegranaten und 25 al-Hussein-Sprengköpfe mit biologischen Kampfstoffen auszurüsten. Sie sollten eingesetzt werden, falls die Allianz auf Bagdad vorrückte.
Der Irak verfügt noch immer über Restbestände seines Programms für biologische Waffen und dazu noch einen Vorrat an Munition, der mit einiger Sicherheit auch Raketensprengköpfe umfasst. Er hat überdies eine gewisse Anzahl Trainingsflugzeuge zu unbemannten Drohnen umgebaut, die sowohl biologische wie chemische Kampfstoffe versprühen können.
Nachdem er mehrfach die Existenz eines Programms zur Entwicklung von biologischen Kampfstoffen geleugnet hatte, behauptete der Irak später gegenüber den Uno-Inspektoren, er habe alle Kampfstoffe und Munitionsvorräte zerstören lassen, lieferte aber keinen Beweis dafür. Uno-Inspektoren glauben heute, dass der Irak drei- oder viermal so viel biologische Kampfstoffe besessen hat wie angegeben.
Das schwierigste Problem für eine realistische Einschätzung irakischer Bio-Waffen-Kapazitäten ist die Tatsache, dass es keiner großen Einrichtungen bedarf, um die Waffen herzustellen. Überläufer haben sogar behauptet, dass Saddam das ganze Programm auf die Straße verlegt habe. Bagdad verfüge nun über mobile Labore zur biologischen Kampfstoffentwicklung, die im Lande herumfahren können und keine Spuren hinterlassen, die westliche Geheimdienste entdecken können.
Charles Duelfer, langjähriger Vizechef der Unscom, sagte 2002 vor einem Kongress-Ausschuss aus: "Die Art der Forschung, die der Irak unternommen hat, weist darauf hin, dass sich sein Interesse im Bereich biologischer Kampfstoffe nicht nur auf taktische Waffen erstreckt, sondern auch auf deren Einsatz zu strategischen, ökonomischen oder terroristischen Zwecken, womöglich sogar als Waffen für einen Völkermord."
Atomwaffen
Das Nuklearwaffen-Programm begann 1971, als Saddam einer kleinen Gruppe von Physikern befahl, sich unter dem Deckmantel ziviler Atomnutzung an die Arbeit zu machen. 1976 unterzeichnete der Irak ein Abkommen mit Frankreich für einen Reaktor, von dem Paris wusste, dass er in Wahrheit zur Gewinnung von Bombenmaterial bestimmt war. Sehr schnell bekam auch Israel Wind von dem Projekt, und der Mossad machte sich daran, das Waffenprogramm aufzuhalten, zu verlangsamen und zu zerstören. Israelische Agenten ermordeten irakische Wissenschaftler; 1981, kurz vor Inbetriebnahme des Reaktors, wurde er von der israelischen Luftwaffe zerstört.
Dieser Angriff brachte die Wende im irakischen Programm für Massenvernichtungswaffen. Bagdad hatte erfahren müssen, dass seine Produktionsstätten höchst verwundbar waren. Zwar machten sich die Iraker sofort daran, den Reaktor wieder aufzubauen, doch von diesem Zeitpunkt an unternahm das Regime alle Anstrengungen, wesentliche Produktionsanlagen mindestens an zwei verschiedenen Orten zu verstecken, sie unter die Erde zu verlegen oder einzubunkern und sie zu verteidigen. Als der Golfkrieg ausbrach, verfügte der Irak über zahlreiche Herstellungsstädte, die alle schwer bewacht waren. Manche waren so gut getarnt, dass westliche Geheimdienste nichts von ihrer Existenz wussten. Bei Ausbruch dieses Golfkriegs verfügte der Irak über ausreichend Know-how, um eine Atomwaffe herzustellen. Seine größte Schwierigkeit bestand darin, genügend spaltbares Material zu beschaffen.
Der Irak verfolgte mehrere Methoden der Urananreicherung. Er setzte Zentrifugen ein, versuchte Laser-Isotopentrennung, Gas-Diffusion, Ionenaustausch und elektromagnetische Isotopentrennung. Im August 1990 befahl Saddam, in höchster Eile eine Atombombe zu bauen, mit der er einen Raketensprengkopf ausrüsten könnte. Die Rakete wollte er gegen Tel Aviv einsetzen, falls seine Herrschaft ernsthaft in Gefahr geriete. Es gelang seinen Ingenieuren, ein primitives Exemplar anzufertigen, das allerdings zu groß für eine Rakete war und mit einem Flugzeug, einem Lastwagen oder einem Schiff ins Ziel hätte gebracht werden müssen. Allerdings besaßen die Iraker nicht das notwendige spaltbare Material. Uno-Inspektoren glauben, dass Bagdads Nuklearwissenschaftler innerhalb eines weiteren Jahres in der Lage gewesen wären, eine funktionsfähige Atombombe herzustellen - wenn die Weltgemeinschaft ihnen die Zeit dazu gelassen hätte.
Inzwischen herrscht bei Experten Konsens darüber, dass der Irak die Arbeit an einem Nuklearwaffen-Programm wieder aufgenommen hat. Saddam ließ das Projekt offenbar in viele kleine Forschungsprogramme aufteilen, die er an unverdächtigen Orten verstecken konnte. Khidhir Hamza, für lange Zeit der Chef des irakischen Waffenentwicklungsprogramms, lief 1994 in den Westen über und berichtete, der Irak habe seine Bemühungen um Nuklearwaffen nach dem Golfkrieg sogar noch verstärkt. 1993/94 hätten 2000 Ingenieure und 12 000 andere Arbeiter in diesem Bereich Beschäftigung gefunden. CIA-Chef George Tenet erklärte vor dem Geheimdienstausschuss des Senats: "Wir glauben, dass Saddam sein Nuklearwaffen-Programm niemals aufgegeben hat."
Niemand weiß jedoch, wie viel Zeit der Irak für den Wiederaufbau seines Anreicherungssystems und für die Produktion waffenfähigen Urans braucht, um eine oder mehrere Atombomben herzustellen. In Anbetracht der Schwierigkeiten, die Saddams Ingenieure mit verschiedenen Anreicherungsmethoden vor dem Golfkrieg hatten, schätzen US-Geheimdienste, dass es von Beginn des Programms an fünf bis zehn Jahre dauern würde, um genügend Material für eine oder mehrere Atomwaffen zu erhalten. Setzt man den Beginn des Programms mit dem Jahr 1999 an, könnte der Irak frühestens 2004 eine erste Waffe bauen. Um noch einmal Duelfer zu zitieren: "Präzise Schätzungen des irakischen Nuklear-Programms sind unmöglich, aber sicher ist, dass Bagdad über den Vorsatz, das Know-how und die Ressourcen verfügt, eine Nuklearwaffe zu bauen, wenn man dem Regime dazu die Zeit lässt."
Für Saddam ist der Besitz von Massenvernichtungswaffen mit seiner Kontrolle über den Irak verbunden. Er ist davon überzeugt, dass dieses Arsenal mögliche Rivalen davon abhält, ihn herauszufordern. Im Kampf gegen die Kurdenaufstände haben sich diese Waffen in seinen Augen bewährt. Saddams Legitimität, so wie er sie sieht, leitet sich von dem Versprechen ab, den Irak groß und mächtig zu machen - ein Versprechen, von dem er immer noch glaubt, er habe es eingehalten. Eine Aufgabe seiner Massenvernichtungswaffen käme einer Gefährdung seiner Militärmacht und der Aufgabe seiner Legitimität gleich.
Schließlich ist das Programm von Massenvernichtungswaffen von kritischer Bedeutung für die Verwirklichung seines großen außenpolitischen Ziels, den Irak zu einem mächtigen Staat und zum Führer der arabischen Welt zu machen. Mitglied im Club der Atomwaffenbesitzer zu sein hat schon immer Großmachtstatus verliehen, und Saddam weiß das. In seinen Reden hat er die Überzeugung vertreten, er könne Massenvernichtungswaffen dazu benutzen, um Konzessionen anderer Staaten zu erzwingen, die über solche Fähigkeiten nicht verfügen.
Sollte es Saddam schließlich gelingen, Atomwaffen zu erwerben, träten alle anderen Bedrohungen daneben in den Hintergrund. Gemessen an seinem eigenen Auftreten und an den Aussagen von Überläufern wird klar, dass Saddam sein Nuklearwaffen-Programm als eine ganz besondere Kategorie ansieht.
Er ist sich sicher, dass die Welt ihn mit mehr Respekt behandeln wird, wenn er erst einmal eine solche Waffe besitzt. Dann, so ist er überzeugt, könne er auch Israel und die USA abschrecken, jedenfalls solange er keinen eigenen Nuklearangriff auf diese Länder unternimmt. Als Mitglied im Atomclub, so das Kalkül seines Regimes, brauche Bagdad nicht länger auf die Forderungen der Vereinten Nationen zu hören und könne alle Staaten der Region dazu überreden, die Uno-Sanktionen schlicht zu ignorieren.
Übersetzung Hans Hoyng
Die Akte Saddam -
Das System des Schreckens
von Kenneth Pollack
Der "unverzichtbare Führer" des Irak sieht sich in der Tradition historischer Heldenfiguren - von Nebukadnezar bis zu Saladin: Saddam Hussein, der selbst ernannte Vorkämpfer der arabischen Nationen, träumt vom Aufstieg zur atomaren Supermacht.
Der Irak heute ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen hat sich für das irakische Volk als Katastrophe erwiesen. Zwar lebten die Iraker auch schon vor dem Krieg in einer stalinistischen Hölle, aber gemessen an anderen Staaten der Region ging es ihnen relativ gut: Ernährungslage, Ausbildung und Gesundheitswesen waren verlässlich, das Öl bescherte ihnen einigen Wohlstand. Heute müssen sie neben Saddams Terror täglich Demütigungen ertragen, dazu erdrückende wirtschaftliche Not und eine kollabierende Gesundheitsversorgung. Schlimmer noch: Die Sanktionen haben Saddams eisernen Griff verstärkt und liefern das irakische Volk hilflos seinen Schergen aus.
Saddams Position ist heute paradoxerweise gleichzeitig schwächer und stärker als vor der Invasion Kuweits. Sie ist schwächer, weil er den größten Teil seiner militärischen Potenz verloren hat, die den Irak zu einer regionalen Macht hatte aufsteigen lassen. Sie ist erschüttert, seitdem wiederholte Putschversuche und Aufstände das Ausmaß seiner Unbeliebtheit zeigten und Oppositionskräften Mut machten. Weder hat er die Kontrolle über die kurdischen Landstriche im Norden zurückgewonnen, noch herrscht er über einen souveränen Staat. Britische und amerikanische Kampfflieger kontrollieren fast 60 Prozent des irakischen Luftraums. Darüber hinaus hat Saddams Machtbasis - die Stämme und Städte, die ihn während seiner Präsidentschaft unterstützt haben und deren Mitglieder das Gros seiner Sicherheitsdienste und der wichtigsten militärischen Einheiten ausmachen - erkennen müssen, wie tief Kraft und Ansehen des Irak gesunken sind - eine Demütigung, die selbst seine Anhänger verärgert hat.
Zugleich ist Saddam aber auch stärker als zuvor. So viele Gegner haben bereits versucht, ihn zu stürzen und sind daran gescheitert - und wurden dafür mit Hinrichtung oder Verbannung bestraft -, dass es heute buchstäblich keinen politischen Führer von Rang und Namen innerhalb des Irak gibt, um den sich die Bevölkerung scharen könnte.
Saddams Macht hat sich paradoxerweise auch gefestigt, weil die Mechanismen der Uno-Sanktionen und das Programm "Öl für Lebensmittel" ihm die Kontrolle über Einzelheiten des täglichen Lebens im Irak zuschob, die er früher nie besaß. Und sie ist größer, weil Saddam alle Versuche Amerikas, ihn zu stürzen, überlebt hat und seine frühere Position zurückgewinnen könnte, wenn die Sanktionen erst einmal aufgehoben sind.
Ein wichtiges Element für den Erfolg, sich seit 1979 an der Macht zu halten, war seine Fähigkeit, ein Netzwerk von Gruppen zu bilden, die sein Regime unterstützen. Ein altes arabisches Sprichwort sagt: "Ich und mein Bruder gegen unseren Cousin, ich und mein Cousin gegen einen Fremden." In anderen Worten: Innerhalb der traditionellen arabischen Gesellschaft gibt es konzentrische Ringe von Loyalität, auf die sich Saddam stets stützen konnte. So verließ er sich auf enge Verwandte, die ihn gegen alle Rivalen aus seiner näheren Umgebung verteidigten. Und er konnte sich auf entferntere Verwandte, Klan-Mitglieder, Stammesmitglieder sowie die Bewohner seiner Geburtsstadt Tikrit verlassen, die ihn gegen andere Herausforderer verteidigten.
Deshalb besetzt Saddam den innersten Zirkel seines Regimes ausschließlich mit Personen, die er stets am vertrauenswürdigsten befunden hat: Familienmitglieder. Nach seiner Machtergreifung blieb sein Cousin und engster Freund, Adnan Cheirallah, Verteidigungsminister, sein Halbbruder Barsan Ibrahim leitete den Geheimdienst, sein Onkel Cheirallah Tulfah wurde Bürgermeister von Bagdad. Auch seine Halbbrüder Watban und Sabawi wurden später zum Innenminister beziehungsweise zum Sicherheitschef ernannt.
Seine beiden Söhne Udai und Kussei nehmen inzwischen wichtige Positionen ein. Der jähzornige Udai leitet nach verschiedenen anderen Posten heute mehrere Zeitungen, ist Chef des Irakischen Olympischen Komitees (und damit de facto Jugendminister) und befehligt die Fedajin, Saddams paramilitärische Einheiten. Kussei ist der neue Star der Familie. Ruhig, verlässlich und brutal, leitet er jene Sondersicherheitsgruppe, die heute der wichtigste Geheimdienst des Irak ist. Saddam überließ ihm größere Verantwortung als je zuvor einem anderen Sicherheitschef.
Doch so groß die Familie auch ist, ihre Mitgliederzahl reicht nicht aus, um all jene Spitzenpositionen zu besetzen, die notwendig sind, um ein Volk von 23 Millionen Einwohnern zu kontrollieren. Deshalb rekrutiert Saddam viele Mitglieder aus seinem Beidschat-Clan, aus dem Bu-Nasir-Stamm und aus seiner Heimatstadt Tikrit, weil diese Stammesbeziehungen ein hohes Maß an Loyalität garantieren. Darüber hinaus unterstützt er generell die sunnitischen Araber in ihrem Kampf um die Vorherrschaft gegen die zahlenmäßig überlegenen Schiiten, gegen die Kurden und andere Nationalitäten. Mitglieder der großen sunnitischen Stämme besetzen die wichtigsten Posten bei der Republikanischen Garde und den Sicherheitsdiensten.
Eine weitere Quelle der Unterstützung für Saddam ist die Baath-Partei, die derzeit über 1,5 Millionen Mitglieder verfügt. Zwar hat ihr Einfluss im Laufe der Jahre nachgelassen - auch weil sie sich im iranisch-irakischen Krieg und während der Kurden- und Schiitenaufstände als wankelmütig und feige erwiesen hat. Dennoch können die Parteimitglieder jederzeit für große Straßendemonstrationen mobilisiert werden und dem Regime als Propagandaarmee dienen. Kommt es zur Krise, könnten sie bewaffnet auf die Straße geschickt werden.
Saddam arbeitet hart dafür, die Loyalität seiner Anhänger zu festigen. Seine Familie, Freunde und andere Führungsfunktionäre genießen üppige Privilegien. Die Offiziere der Sicherheitsdienste und Republikanischen Garde erhalten mehr Sold, größere Autos und andere Vorteile. Andererseits droht Saddam aber auch ständig mit den Strafen, die auf Verräter warten. Seit seinem Amtsantritt 1979 beteiligt der Diktator seine Mitarbeiter systematisch an seinen Verbrechen.
Von Anfang an hat Saddam die Bedeutung des Überwachungsapparates beim Ausbau seiner Macht erkannt. Immer wieder im Verlauf seiner Karriere hat er die Sicherheitsmaschinerie Nazi-Deutschlands und des stalinistischen Russland studiert. Ständig war er bestrebt, die Mitglieder seines eigenen Sicherheitsapparats noch enger an sich zu binden. Soldaten, Polizisten und Agenten sind pausenloser Propaganda ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sie die Welt genauso betrachten wie er.
Es gibt annähernd zwei Dutzend irakische Geheim- und Sicherheitsdienste. Mit insgesamt etwa 500 000 Mitgliedern in den Geheimdienst-, Staatsschutz- und Polizeiorganisationen. Rechnet man die Streitkräfte und paramilitärischen Einheiten hinzu, erreicht die Zahl etwa 1,3 Millionen - bei einer Bevölkerung von 23 Millionen. Die Iraker glauben, dass die Sicherheitsdienste außerdem noch über 2 bis 4 Millionen Informanten verfügen. All diese Organisationen belauern sich gegenseitig; jedes Mitglied einer Sicherheitsgruppe muss damit rechnen, seinerseits von vielen anderen überwacht zu werden.
Die wichtigsten Einheiten sind:
Sondergruppe Sicherheit, al-Amn al-Chass. Die Organisation wurde 1982 gegründet und wird gegenwärtig von Kussei geleitet. Sie trägt zum Teil die Verantwortung für den Schutz von Saddam selbst. Andere Mitglieder werden als Leibwachen für die bedeutendsten Funktionäre des Regimes und für alle Militärkommandeure abgestellt.
Die Begleiter, Murafikin. Hierbei handelt es sich um die 40 persönlichen Leibwächter von Saddam selbst. Alle entstammen dem Beidschat-Clan des Bu-Nasir-Stamms. Die Murafikin-Chefs gehören zu den gefürchtetsten Männern im Irak. Die Truppe wird geleitet von Abd al-hamid Humud, Saddams persönlichem Sekretär und drittmächtigstem Mann im Irak nach dem Staatschef und Kussei.
Die Präsidentengarde, al-Himaja. Ihre Stärke beträgt etwa 2000 Mann, die fast alle dem Bu-Nasir-Stamm angehören. Es gibt drei Einheiten. Die mobile Gruppe ist verantwortlich für den Schutz von Saddams Reisen. Sie sichert die Fahrstrecken und die Zielorte.
Die Sondereinheiten der Republikanischen Garde, al-Haras al-Dschumhuri al-Chass. Diese Sondereinheiten bestehen aus vier Brigaden mit etwa 30 000 Soldaten, die vor allem aus Tikrit und den umliegenden Dörfern rekrutiert wurden. Sie sind schwer bewaffnet, verfügen über eigene Artillerie und Panzerfahrzeuge und dienen vornehmlich dazu, Aufstände oder einen militärischen Staatsstreich niederzuschlagen.
Der Geheimdienst, al-Muchabarat al-Amma. Die Behörde ist der älteste und wichtigste Geheimdienst. Ihr obliegen Spionage und Gegenspionage, aber auch verdeckte Operationen.
Allgemeiner Sicherheitsdienst, al-Amn al-Amm. Dies ist der größte Geheimdienst mit Zehntausenden von Agenten. Es ist der Apparat, mit dem es ein Durchschnitts-Iraker am ehesten zu tun bekommt. In jeder Stadt und jedem ländlichen Bezirk ist ein Amn-Büro untergebracht, wo Mitarbeiter alles registrieren, was in ihrem Distrikt geschieht. Amn-Agenten sind aber auch verantwortlich für den Terror gegenüber der eigenen Bevölkerung.
Militärischer Geheimdienst, al-Istichbarat al-Askarija. Das Amt ist verantwortlich für das Sammeln von Informationen über ausländisches Militär. Seine wichtigste Aufgabe besteht jedoch darin, über die Loyalität der eigenen Streitkräfte zu wachen.
Paramilitärische Einheiten, Fedajin Saddam haben etwa 100 000 Mitglieder. Obwohl ihre Schlagkraft nicht an die der Republikanischen Garde heranreicht, sind sie doch ein weiteres wichtiges Element in Saddams Gleichgewicht des Schreckens.
Agenten, Polizisten und Soldaten hat Saddam gleichermaßen dazu benutzt, im ganzen Land ein Klima des Terrors zu erzeugen - das hervorstechendste Merkmal des irakischen Totalitarismus. Im April 2002 verabschiedete die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen eine Resolution, in der es heißt: "Die systematischen, weit verbreiteten und äußerst schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung des Irak haben ein allumfassendes Klima von Repression und Unterdrückung geschaffen. Es wird aufrechterhalten durch ein System von Diskriminierungen und Terror."
"WIR WOLLEN, DASS DER IRAK DASSELBE GEWICHT HAT WIE CHINA, DIE SOWJETUNION ODER DIE VEREINIGTEN STAATEN."
Dies ist ein Regime, das Kindern die Augen aussticht, um von Eltern oder Großeltern Geständnisse zu erpressen. Dies ist ein Regime, das alle Fußknochen eines zweijährigen Mädchens einzeln zerbricht, um seine Mutter zu zwingen, den Aufenthaltsort ihres Mannes preiszugeben. Dies ist ein Regime, das einen Säugling auf Armeslänge von seiner Mutter entfernt hält und das Kind verhungern lässt, um seine Mutter zu einer Aussage zu bewegen. Dies ist ein Regime, das seine Opfer langsam in riesige Kessel von Säure herablässt, entweder, um ihren Willen zu brechen, oder einfach nur als Hinrichtungsart. Dies ist ein Regime, das seinen Opfern Elektroschocks verabreicht, vor allem an den Genitalien, und bei dieser Tortur große Kreativität zeigt.
Dies ist ein Regime, das im Jahre 2000 als Strafe für jede Kritik - und da reicht es schon, darauf hinzuweisen, dass Saddams Kleidung nicht zusammenpasst - festsetzte, dass dem Delinquenten die Zunge abgeschnitten wird. Dies ist ein Regime, das eine Frau, eine Tochter oder andere weibliche Verwandte wiederholt vor den Augen eines Mannes vergewaltigt. Dies ist ein Regime, das seine Opfer mit rot glühenden Eisenstäben pfählt. Dies ist ein Regime, das eine junge Mutter auf der Straße vor ihrem Haus und in Anwesenheit ihrer Kinder enthauptet, weil ihr Mann in Verdacht steht, ein Gegner ebendieses Regimes zu sein.
Dies ist ein Regime, das biologische und chemische Kampfstoffe an seinen iranischen Kriegsgefangenen erprobte, um herauszufinden, auf welche Weise diese Gifte ihre größte Wirkung erzielen.
Obwohl Saddam das irakische Volk täglicher Knechtschaft unterwirft, wird sich seine Bedrohlichkeit für die USA und die Welt eher mittelfristig entfalten. Es könnte noch einige Jahre dauern, bis er zu einer übermächtigen, unumgänglichen Gefahr wird. Die konventionellen Streitkräfte des Irak sind seit ihrer Niederlage im vorigen Golfkrieg geschwächt, ihre Schlagkraft ist durch die bestehenden Sanktionen eingeschränkt. Obwohl Bagdad inzwischen dank des Programms "Öl für Lebensmittel" wieder in der Lage war, Teile seiner konventionellen Streitkräfte zu stärken, wären mindestens noch weitere fünf Jahre und die Aufhebung der Sanktionen nötig, um die gleichen Kapazitäten aufzubauen, über die der Irak vor dem Krieg verfügte.
Doch Saddam war stets ein Mann von großen Ambitionen. Jerrold Post, ein Psychologe, der früher für US-Geheimdienste gearbeitet und sich ausführlich mit Saddam beschäftigt hat, schrieb: "Sein Streben nach Macht für sich selbst und für den Irak kennt keine Grenzen. In seiner Vorstellung gibt es keinen Unterschied zwischen dem Schicksal Saddams und dem des Irak." Der Tyrann vom Tigris nennt sich selbst "al-Kaid al-daruri", der unverzichtbare Führer. Der Titel bringt zum Ausdruck, dass er in einem eschatologischen Sinn dazu bestimmt sei, über den Irak zu herrschen.
In der Tat empfindet er sich als eine geschichtliche Figur, als jemand, der dazu ausersehen ist, große Dinge zu vollbringen. In dem von ihm entfesselten Personenkult wird er mit den großen Figuren der irakischen Vergangenheit verglichen. Er ist der neue Nebukadnezar, jener babylonische König, der das biblische Israel eroberte, Jerusalem einnahm und die Juden in die Gefangenschaft führte. Er ist al-Mansur, jener Kalif, der Bagdad erbaute und neue Länder für den Islam eroberte. Er ist der neue Saladin, jener islamische General, der die Kreuzzügler besiegte und Jerusalem zurückeroberte.
Saddam glaubt sich selbst zum neuen Führer der arabischen Nationen ausersehen, und er will diese Position mit einer Kombination von Eroberungen und Akklamation gewinnen.
Wiederholt hat der Staatschef klargestellt, er wolle eine arabische Union schaffen, die, von einem mächtigen Irak geleitet, zur neuen Supermacht aufsteigt. 1980, sechs Monate nach seinem Amtsantritt als Präsident, sagte er: "Wir wollen, dass der Irak dasselbe Gewicht hat wie China, wie die Sowjetunion oder wie die Vereinigten Staaten."
Darüber hinaus verfolgt er beharrlich die Idee, eines Tages Jerusalem zu befreien, obwohl das nicht seine wichtigste Priorität zu sein scheint. Er erblickt darin wohl eher einen krönenden Abschluss seiner Arbeit. Dennoch erwähnt er dieses Ziel zu häufig, als dass man es als bloße Propaganda abtun könnte. Bezeichnenderweise hatte er - wie die Uno-Waffeninspektoren kurz nach dem jüngsten Golfkrieg erfahren sollten - den irakischen Scud-Einheiten Anweisungen gegeben, ihre mit biologischen und chemischen Waffen bestückten Raketen auf Tel Aviv abzufeuern, falls die Allianz nach Bagdad vorgerückt wäre. Er empfindet sich eben als historische Figur, die eines Tages die arabische Welt von der israelischen Präsenz befreit.
Der Golfkrieg und die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten haben Saddam schließlich ein neues Motiv und ein neues Ziel gegeben: Rache. In einer Stammesgesellschaft, der Saddam entstammt, ist Rache ein treibendes Motiv. Auf Rache zu verzichten ist ein Zeichen von Schwäche.
Während seiner gesamten Amtszeit hat Saddam den Terrorismus unterstützt. Dennoch stellt diese Gewalt noch die geringste Gefahr dar, die vom Irak ausgeht. Auf einer Rangliste von Unterstützern des Terrorismus würde der Irak nur einen niedrigen Platz einnehmen, weit hinter Iran, Syrien, Pakistan und anderen Staaten.
Saddams Haltung entspringt mehreren Motiven. Zunächst einmal will er weiterhin ein Akteur im arabischisraelischen Konflikt bleiben, außerdem hat er sich stets entschlossen gezeigt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um die eigenen Interessen zu befördern. Während der siebziger und in den frühen achtziger Jahren hat der Irak deshalb den internationalen Terrorismus unterstützt, vor allem radikale Palästinenser-Gruppen. Von Anfang an hat das Baath-Regime der PLO in ihrem Kampf gegen Israel geholfen. Nach 1974 jedoch zerstritt sich Saddam mit Jassir Arafat, weil der PLO-Chef einen gemäßigteren Kurs einschlug. Als Revanche half der Irak fortan der Abu-Nidal-Gruppe und anderen palästinensischen Arafat-Gegnern.
Saddams wachsende Furcht vor einer Niederlage im iranisch-irakischen Krieg führte jedoch zu einer Wende in seiner Haltung zum Terrorismus. Je mehr der Irak auf die Hilfe europäischer und gemäßigter arabischer Staaten sowie der USA angewiesen war, desto mehr distanzierte er sich von seinen früheren Bundesgenossen. Der Bericht des amerikanischen Außenministeriums aus dem Jahr 1986 lobte den Irak ausdrücklich für diese Wende.
"DIE DOKUMENTE KONNTEN WIR SO VERSTECKEN, DASS FREMDE NICHT IN DER LAGE WAREN, SIE AUFZUSPÜREN."
Das irakische Interesse am Terrorismus erwachte wieder während des Kriegs gegen die USA. Bekannte Extremisten wurden nach Bagdad eingeladen und mit Waffen und anderen Mitteln eingedeckt. Als der ehemalige Präsident Bush 1993 den Emir von Kuweit besuchte, schickte Saddam ein Muchabarat-Team, das beide töten sollte. Die Agenten jedoch stellten sich so unprofessionell an, dass ihr Vorhaben schnell aufgedeckt wurde.
Auch heute gewährt der Irak Terrorgruppen Unterstützung, wenngleich nicht im selben Ausmaß wie in den siebziger Jahren. Zudem hilft er radikalen Palästinenser-Gruppen, obwohl er sie gleichzeitig seit mehr als 15 Jahren daran hindert, aktiv zu werden. Er pflegt beste Beziehungen zur kurdischen Arbeiterpartei PKK sowie zu den iranischen Mudschahidin-e chalgh. Seit dem Ausbruch der Aksa-Intifada in den Palästinenser-Gebieten im Herbst 2000 hat Saddam auch die Hamas gefördert.
Dennoch haben US-Geheimdienste bislang keine glaubwürdigen Beweise dafür gefunden, dass der Irak seit jenem verpatzten Mordanschlag gegen Bush Sr. in irgendeiner Form am Terrorismus gegen die USA beteiligt ist. Es gibt jedoch den Verdacht, dass der Irak an einer Reihe terroristischer Planspiele arbeitet. Zwar hat es auch Beziehungen zu al-Qaida gegeben, aber diese Verbindungen sind nach unserem Wissen spärlich und unbedeutend. Sowohl irakische Geheimdienstler als auch verschiedene Untergruppen von al-Qaida operieren in der Unterwelt des Nahost-Terrorismus und sind dort einander zweifellos begegnet. Wahrscheinlich haben sie sich auch schon gegenseitig geholfen, etwa durch den Austausch von gefälschten Pässen oder von Know-how. Möglicherweise haben beide Seiten auch dieselben terroristischen Gruppen unterstützt wie etwa Ansar-e Islam, die sich im irakischen Teil Kurdistans organisiert haben soll.
Eine Einschätzung der konventionellen militärischen Kapazitäten des Irak ergibt ein Bild voller Widersprüche. 1990 verfügte das irakische Militär über ein Potenzial, das es, verglichen mit dem regionalen Rüstungsniveau, zu einer bedeutenden Macht werden ließ. An den Armeen der Ersten Welt gemessen, mussten Bagdads Streitkräfte dagegen als unbedeutend gelten. Als Ergebnis der katastrophalen Niederlage gegen die Amerikaner im Golfkrieg und als Folge der Uno-Sanktionen hat das irakische Militär obendrein viele seiner einstigen Vorzüge verloren. Gegen die Truppe von George W. Bush könnten die irakischen Streitkräfte heute nichts mehr ausrichten; sie stellen aber noch immer eine Bedrohung für kleinere Nachbarn des Irak dar und könnten erst recht mit Leichtigkeit all jene Truppen überwältigen, die eine interne Opposition aufstellen würde.
Die reguläre Armee besteht aus 17 Divisionen mit zusammen 300 000 Mann, darunter drei Panzer- und drei Panzergrenadier-Divisionen. Der Großteil seiner Armee, insgesamt elf Divisionen, ist gegen die Kurden im Norden aufgestellt, drei weitere dienen der Sabotageabwehr schiitischer Guerrillagruppen im Südirak. Die restlichen drei Divisionen bewachen die Südgrenze des Irak gegenüber Iran. Die reguläre Armee wurde am heftigsten durch die Operation "Wüstensturm", die anschließenden Aufstände und die Uno-Sanktionen in Mitleidenschaft gezogen. Die Moral der Truppe ist niedrig, besonders bei den Infanterie-Divisionen, die sich größtenteils aus schiitischen Wehrpflichtigen zusammensetzen.
Die Republikanische Garde bildet dagegen weiterhin die Elitetruppe des Irak - was jedoch ein relativer Begriff ist. Gegenwärtig besteht die Garde aus 80 000 Soldaten, die in sechs Divisionen aufgeteilt sind. Die drei Panzerbrigaden, die schlagkräftigsten Einheiten des Irak, sind in einem Ring um Bagdad aufgestellt. Sie bilden einen Gürtel, der kaum zu durchbrechen wäre, sollten Einheiten der regulären Armee versuchen, das Regime zu stürzen.
In der Luftwaffe dienen 30 000 Soldaten, die über etwa 300 Flugzeuge verfügen. Allerdings sind höchstens 150 einsatzbereit, darunter ein paar Dutzend MiG-29 und Mirage F-1. Alle anderen Typen sind veraltet und nur dazu in der Lage, Bomben über großen Zielen abzuwerfen.
Die Luftabwehr war schon immer der am meisten vernachlässigte Teil der Streitkräfte, obwohl sie es ist, die seit der Niederlage 1991 die Angriffe amerikanischer und britischer Kampfflieger ertragen muss. Etwa 15 000 Soldaten verfügen über 500 Abschussvorrichtungen für Boden-Luft-Raketen, die meisten davon veraltet und keine Gefahr für die US-Streitkräfte.
Wegen der begrenzten Kapazitäten der konventionellen Streitkräfte sind Saddams Massenvernichtungswaffen umso bedeutsamer. Obwohl die ersten Uno-Inspektoren weit mehr irakische Massenvernichtungswaffen zerstörten, als Bagdad in seinen schlimmsten Träumen befürchtete, war der Irak in der Lage, sein Wissen und die Ausrüstung für die Herstellung dieser Waffen zu bewahren. Ein hochrangiger irakischer Überlaufer formulierte das so: "Es ist unmöglich, chemische und biologische Waffen komplett zu vernichten. Niemand kann das Know-how in den Köpfen unserer Wissenschaftler zerstören. Installationen für die Produktionen biologischer und chemischer Waffen wurden bereits abgebaut, bevor die Uno-Kontrolleure ankamen. Sie wurden verborgen und wieder zusammengesetzt. Die Dokumente konnten wir so verstecken, dass Fremde nicht in der Lage waren, sie aufzuspüren."
Ballistische Raketen
Nach 1973 hat der Irak von der Sowjetunion insgesamt 819 Scud-B-Raketen sowie 11 Abschussvorrichtungen gekauft. Die Unscom-Inspektoren ermittelten 1996, dass der Irak etwa 80 Scud-ähnliche Raketen selbst hergestellt hatte, obwohl die meisten von ihnen offenbar nicht einsatzfähig waren. Der Irak baute außerdem 8 mobile und 28 ortsfeste Abschussvorrichtungen. Es waren Raketen vom Typ Scud-B, die der Irak modifizierte, um ihre Reichweite auf 650 Kilometer auszuweiten. Stolz wurde das neue Geschoss "al-Hussein" genannt. Insgesamt feuerte Bagdad 330 Scud-B und 203 al-Hussein-Raketen im ersten Golfkrieg gegen iranische Städte ab und während des zweiten Golfkriegs weitere 88 al-Hussein-Geschosse gegen Ziele in Israel, Saudi-Arabien und Bahrein. Zusätzliche Scud-Raketen benötigten die Konstrukteure für Tests, andere wurden für den Bau der al-Husseins ausgeschlachtet. Teile dreier Scud-B-Raketen ergaben zwei al-Hussein-Flugkörper. Nach ihrer Niederlage haben irakische Militärs zugegeben, etwa 50 Gefechtsköpfe mit chemischen Kampfstoffen (Nervengas Sarin) und 25 mit biologischen Kampfstoffen (Botulin, Milzbrand und Aflatoxin) gefüllt zu haben.
US-Geheimdienste glauben, dass der Irak einige al-Hussein-Raketen beiseite schaffen konnte; ihre Zahl liegt vermutlich zwischen 12 und 40. Mitte der neunziger Jahre entdeckten die Unscom-Fahnder eine Fabrik, in der immer noch Raketenmotoren hergestellt wurden. Als sie 1998 das Land verlassen mussten, schätzten sie, der Irak verfüge über mindestens ein Dutzend einsatzfähige al-Husseins. Überläufer berichteten, dass die wahre Anzahl eher zwischen 30 und 45 läge.
Als Fehler erwies sich, dass die Sicherheitsratsresolution 687 von 1991 dem Irak weiterhin den Besitz von ballistischen Raketen mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern gestattete. Auch die Erforschung und Entwicklung solcher Raketen ist weiterhin erlaubt. Seinerzeit verfügte Bagdad über russische Kurzstreckenraketen vom Typ Frog mit einer Reichweite von etwa 90 Kilometern. Die Uno glaubte, es sei wichtig, den Irak so stark zu lassen, dass er den feindlichen Nachbarn Iran in Schach halten könne. Deshalb solle Bagdad erlaubt werden, weiterhin ein aktives Raketenentwicklungsprogramm zu betreiben. Kernstück dieses Projekts ist die al-Samud, eine Boden-Boden-Rakete auf der Grundlage eines Luftabwehrgeschosses vom Typ SA-2, deren Technik aber alles enthält, was der Irak aus seinem Scud-Programm gelernt hat. Bagdad behauptet, die Samud habe eine Reichweite von 150 Kilometern, US-Geheimdienste trauen ihr dagegen 200 Kilometer zu.
Überdies entwickelt der Irak eine Rakete mit Namen Ababil-100, die Festtreibstoff nutzt. Sie dient als Testmodell für künftige komplexere Projekte und hat wahrscheinlich eine Reichweite, die ebenfalls größer ist als die angegebenen 100 Kilometer. Amerikanische Dienste glauben, dass der Irak wahrscheinlich in der Lage sein würde, innerhalb der nächsten 15 Jahre Interkontinental-Raketen zu entwickeln, die auch die USA treffen könnten - wenn man ihn nicht rechtzeitig daran hindert.
Chemische Kampfstoffe
1974 begann der Irak die Produktion von Senfgas. In den achtziger Jahren folgten vergleichsweise simple Nervengase wie Sarin und Tabun. Zu einem bestimmten Zeitpunkt während des iranisch-irakischen Kriegs waren Bagdads Wissenschaftler in der Lage, das tödliche, hochwirksame Nervengas VX zu entwickeln. Saddams Militärs setzten ihre chemischen Kampfstoffe erstmals 1983 gegen iranische Truppen ein und haben damals nach eigenen Angaben mehr als 100 000 Geschosse mit chemischer Munition abgefeuert.
Zwar zerstörten die Uno-Inspektoren riesige Mengen chemischer Munition und Kampfstoffe. Bis zum Ende der Inspektionen aber kämpften sie vergebens um eine vollständige Auflistung aller Munition mit chemischen Kampfstoffen. Es gelang den Inspektoren auch nicht, die Vorräte an VX-Gas oder bereits abgefüllte Granaten zu zerstören.
Unscom-Mitarbeiter glauben deshalb, dass der Irak über 6000 Stück Munition mit chemischen Kampfstoffen inklusive der Raketensprengköpfe zurückbehalten hat, dazu große Mengen der zur Herstellung notwendigen Chemikalien und Apparaturen. Sie glauben, dass Bagdad daher die Fähigkeit hat, zusätzliche Kampfstoffe und Munition herzustellen.
Seit dem Golfkrieg hat das Regime vor allem in Falludscha mehrere große Fabriken gebaut, die Chemikalien für militärische Anwendung produzieren sollen, aber ebenso zivil nutzbar sind. Weil sich die meisten chemischen Kampfstoffe im Laufe der Zeit zersetzen, andererseits aber vergleichsweise schnell hergestellt werden können, ergibt sich für Saddam keine Notwendigkeit, riesige Vorräte anzulegen.
Biologische Kriegführung
Der Irak begann sein biologisches Waffenprogramm 1972. Es war dieses Programm, welches Saddam gegenüber den Uno-Inspektoren am liebsten vollständig verheimlicht hätte. Der Irak hat zugegeben, Milzbrand, Botulin und Aflatoxin für den Waffengebrauch hergestellt zu haben. Die Unscom-Inspektoren haben überdies entdeckt, dass der Irak auch mit den Erregern des Wundbrands geforscht hat. In den Labors befanden sich ferner Testreihen mit dem Gift Ricin und verschiedene Viren, daneben auch Pestbakterien. Die Waffentechniker hatten bereits erste Schritte unternommen, um solche Kampfstoffe genetisch zu verändern und damit ihre Resistenz gegenüber Antibiotika zu erhöhen.
Obwohl es keinen Beleg dafür gibt, dass der Irak biologische Waffen vor dem Golfkrieg von 1990/91 eingesetzt hat, glauben einige Experten, Saddam habe während der späten achtziger Jahre versuchsweise biologische Kampfstoffe gegen die Kurden benutzt. Anfang 1991 verfügte die Armee insgesamt über zehn Milliarden Einheiten biologischer Kampfstoffe. Im Dezember 1990, unmittelbar vor der Operation "Wüstensturm", befahl Saddam, so schnell wie möglich Artilleriegranaten und 25 al-Hussein-Sprengköpfe mit biologischen Kampfstoffen auszurüsten. Sie sollten eingesetzt werden, falls die Allianz auf Bagdad vorrückte.
Der Irak verfügt noch immer über Restbestände seines Programms für biologische Waffen und dazu noch einen Vorrat an Munition, der mit einiger Sicherheit auch Raketensprengköpfe umfasst. Er hat überdies eine gewisse Anzahl Trainingsflugzeuge zu unbemannten Drohnen umgebaut, die sowohl biologische wie chemische Kampfstoffe versprühen können.
Nachdem er mehrfach die Existenz eines Programms zur Entwicklung von biologischen Kampfstoffen geleugnet hatte, behauptete der Irak später gegenüber den Uno-Inspektoren, er habe alle Kampfstoffe und Munitionsvorräte zerstören lassen, lieferte aber keinen Beweis dafür. Uno-Inspektoren glauben heute, dass der Irak drei- oder viermal so viel biologische Kampfstoffe besessen hat wie angegeben.
Das schwierigste Problem für eine realistische Einschätzung irakischer Bio-Waffen-Kapazitäten ist die Tatsache, dass es keiner großen Einrichtungen bedarf, um die Waffen herzustellen. Überläufer haben sogar behauptet, dass Saddam das ganze Programm auf die Straße verlegt habe. Bagdad verfüge nun über mobile Labore zur biologischen Kampfstoffentwicklung, die im Lande herumfahren können und keine Spuren hinterlassen, die westliche Geheimdienste entdecken können.
Charles Duelfer, langjähriger Vizechef der Unscom, sagte 2002 vor einem Kongress-Ausschuss aus: "Die Art der Forschung, die der Irak unternommen hat, weist darauf hin, dass sich sein Interesse im Bereich biologischer Kampfstoffe nicht nur auf taktische Waffen erstreckt, sondern auch auf deren Einsatz zu strategischen, ökonomischen oder terroristischen Zwecken, womöglich sogar als Waffen für einen Völkermord."
Atomwaffen
Das Nuklearwaffen-Programm begann 1971, als Saddam einer kleinen Gruppe von Physikern befahl, sich unter dem Deckmantel ziviler Atomnutzung an die Arbeit zu machen. 1976 unterzeichnete der Irak ein Abkommen mit Frankreich für einen Reaktor, von dem Paris wusste, dass er in Wahrheit zur Gewinnung von Bombenmaterial bestimmt war. Sehr schnell bekam auch Israel Wind von dem Projekt, und der Mossad machte sich daran, das Waffenprogramm aufzuhalten, zu verlangsamen und zu zerstören. Israelische Agenten ermordeten irakische Wissenschaftler; 1981, kurz vor Inbetriebnahme des Reaktors, wurde er von der israelischen Luftwaffe zerstört.
Dieser Angriff brachte die Wende im irakischen Programm für Massenvernichtungswaffen. Bagdad hatte erfahren müssen, dass seine Produktionsstätten höchst verwundbar waren. Zwar machten sich die Iraker sofort daran, den Reaktor wieder aufzubauen, doch von diesem Zeitpunkt an unternahm das Regime alle Anstrengungen, wesentliche Produktionsanlagen mindestens an zwei verschiedenen Orten zu verstecken, sie unter die Erde zu verlegen oder einzubunkern und sie zu verteidigen. Als der Golfkrieg ausbrach, verfügte der Irak über zahlreiche Herstellungsstädte, die alle schwer bewacht waren. Manche waren so gut getarnt, dass westliche Geheimdienste nichts von ihrer Existenz wussten. Bei Ausbruch dieses Golfkriegs verfügte der Irak über ausreichend Know-how, um eine Atomwaffe herzustellen. Seine größte Schwierigkeit bestand darin, genügend spaltbares Material zu beschaffen.
Der Irak verfolgte mehrere Methoden der Urananreicherung. Er setzte Zentrifugen ein, versuchte Laser-Isotopentrennung, Gas-Diffusion, Ionenaustausch und elektromagnetische Isotopentrennung. Im August 1990 befahl Saddam, in höchster Eile eine Atombombe zu bauen, mit der er einen Raketensprengkopf ausrüsten könnte. Die Rakete wollte er gegen Tel Aviv einsetzen, falls seine Herrschaft ernsthaft in Gefahr geriete. Es gelang seinen Ingenieuren, ein primitives Exemplar anzufertigen, das allerdings zu groß für eine Rakete war und mit einem Flugzeug, einem Lastwagen oder einem Schiff ins Ziel hätte gebracht werden müssen. Allerdings besaßen die Iraker nicht das notwendige spaltbare Material. Uno-Inspektoren glauben, dass Bagdads Nuklearwissenschaftler innerhalb eines weiteren Jahres in der Lage gewesen wären, eine funktionsfähige Atombombe herzustellen - wenn die Weltgemeinschaft ihnen die Zeit dazu gelassen hätte.
Inzwischen herrscht bei Experten Konsens darüber, dass der Irak die Arbeit an einem Nuklearwaffen-Programm wieder aufgenommen hat. Saddam ließ das Projekt offenbar in viele kleine Forschungsprogramme aufteilen, die er an unverdächtigen Orten verstecken konnte. Khidhir Hamza, für lange Zeit der Chef des irakischen Waffenentwicklungsprogramms, lief 1994 in den Westen über und berichtete, der Irak habe seine Bemühungen um Nuklearwaffen nach dem Golfkrieg sogar noch verstärkt. 1993/94 hätten 2000 Ingenieure und 12 000 andere Arbeiter in diesem Bereich Beschäftigung gefunden. CIA-Chef George Tenet erklärte vor dem Geheimdienstausschuss des Senats: "Wir glauben, dass Saddam sein Nuklearwaffen-Programm niemals aufgegeben hat."
Niemand weiß jedoch, wie viel Zeit der Irak für den Wiederaufbau seines Anreicherungssystems und für die Produktion waffenfähigen Urans braucht, um eine oder mehrere Atombomben herzustellen. In Anbetracht der Schwierigkeiten, die Saddams Ingenieure mit verschiedenen Anreicherungsmethoden vor dem Golfkrieg hatten, schätzen US-Geheimdienste, dass es von Beginn des Programms an fünf bis zehn Jahre dauern würde, um genügend Material für eine oder mehrere Atomwaffen zu erhalten. Setzt man den Beginn des Programms mit dem Jahr 1999 an, könnte der Irak frühestens 2004 eine erste Waffe bauen. Um noch einmal Duelfer zu zitieren: "Präzise Schätzungen des irakischen Nuklear-Programms sind unmöglich, aber sicher ist, dass Bagdad über den Vorsatz, das Know-how und die Ressourcen verfügt, eine Nuklearwaffe zu bauen, wenn man dem Regime dazu die Zeit lässt."
Für Saddam ist der Besitz von Massenvernichtungswaffen mit seiner Kontrolle über den Irak verbunden. Er ist davon überzeugt, dass dieses Arsenal mögliche Rivalen davon abhält, ihn herauszufordern. Im Kampf gegen die Kurdenaufstände haben sich diese Waffen in seinen Augen bewährt. Saddams Legitimität, so wie er sie sieht, leitet sich von dem Versprechen ab, den Irak groß und mächtig zu machen - ein Versprechen, von dem er immer noch glaubt, er habe es eingehalten. Eine Aufgabe seiner Massenvernichtungswaffen käme einer Gefährdung seiner Militärmacht und der Aufgabe seiner Legitimität gleich.
Schließlich ist das Programm von Massenvernichtungswaffen von kritischer Bedeutung für die Verwirklichung seines großen außenpolitischen Ziels, den Irak zu einem mächtigen Staat und zum Führer der arabischen Welt zu machen. Mitglied im Club der Atomwaffenbesitzer zu sein hat schon immer Großmachtstatus verliehen, und Saddam weiß das. In seinen Reden hat er die Überzeugung vertreten, er könne Massenvernichtungswaffen dazu benutzen, um Konzessionen anderer Staaten zu erzwingen, die über solche Fähigkeiten nicht verfügen.
Sollte es Saddam schließlich gelingen, Atomwaffen zu erwerben, träten alle anderen Bedrohungen daneben in den Hintergrund. Gemessen an seinem eigenen Auftreten und an den Aussagen von Überläufern wird klar, dass Saddam sein Nuklearwaffen-Programm als eine ganz besondere Kategorie ansieht.
Er ist sich sicher, dass die Welt ihn mit mehr Respekt behandeln wird, wenn er erst einmal eine solche Waffe besitzt. Dann, so ist er überzeugt, könne er auch Israel und die USA abschrecken, jedenfalls solange er keinen eigenen Nuklearangriff auf diese Länder unternimmt. Als Mitglied im Atomclub, so das Kalkül seines Regimes, brauche Bagdad nicht länger auf die Forderungen der Vereinten Nationen zu hören und könne alle Staaten der Region dazu überreden, die Uno-Sanktionen schlicht zu ignorieren.
Übersetzung Hans Hoyng
Puh. 2 Tage habe ich mich hier eingelesen, und hier viele interessante Artikel entdeckt-
ich komme auch aus dem Norden, gar nicht so weit weg von euch, aus Buchholz, und meine Bank heißt auch Haspa...
Besonders die Artikel von Krugmann haben vieles für sich, vieles habe ich in vielen verstreuten Threads schon gelesen, vieles kann ich nachempfinden, als Vertreter der 30- jährigen Generation, die beginnt, Angst zu haben.
Vieles von euren Strategien habe ich mir auch schon überlegt, mir fehlt es bis jetzt noch an zwei Dingen:
Geld um mich aus dieser Angst freizukaufen
und dem letztendlichen Willen, wirklich mich auf die drohenden Szenarien einzulassen.
Auch wenn ich Befürchtungen habe, und mir vieles ausmalen kann, möchte ich gar kein Krisengewinner sein.
Vielmehr möchte ich gar keine Krise haben, sondern Wege finden, wie man sie immer noch mäßigen kann ( das sie kommen wird halte ich für ausgemacht! )
oder wie man alternativ damit umgehen kann.
Denn was nützt mir Reichtum in der Krise ( für eine Unze Gold ein Sack Mehl kaufen ) wenn um mich rum alles zerstört wird, Freunde, Familie, soziale Bindungen, soziale Sicherheit, etc.
) wenn um mich rum alles zerstört wird, Freunde, Familie, soziale Bindungen, soziale Sicherheit, etc.
Die 9mm-Lösung ist vielleicht schon realistisch, und ich würde schon wieder in Angst leben müssen.
Eine der Wege aus unserer überalternden, schrumpfenden Individualgesellschaft mit allen Krisensymptomen halte ich für Tauschringe, weil sie die soziale Nähe wieder fördern, generell freiwirtschaftliche Experimente, und vielleicht damit kombiniert den Aspekt "Bauernhof in der...Mark", so wie es heute auch schon Projekte selbstversorgender Gemeinwesen gibt. Dort würde ganz automatisch wieder eine andere Moral vom leben entstehen, da Leben als das wieder wahrgenommen würde, was es wirklich ist- nämlich nicht als Kostenfaktor, sondern fleisch gewordene Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, auch das menschliche Arbeiten als solches genannt!
Nur müßte dann bei allen Dingen der Staat dabei mitspielen, und das kann und wird er nicht, wenn es ihm an den Kragen geht, siehe Hauszinssteuer während WWKI.
Viele halten mich hier für einen linken Spinner, weil ich die besorgniserregenden Umstände immer wieder anprangere, und dabei auch nicht mit Kritik an unserem System hinterm Berg halte, auch wenn ich dabei z.B. marxistisch angehauchte Kritiker zitiere. Kritik an unserer Gesellschaft kommt nun mal vorzugsweise von links, und der Artikel des Weihnachtsmarxisten ( ) gibt einen schon zu denken. Die Zeichen der Krise sind da, und anscheinend sind sie nicht für alle überraschend, natürlich für Ökonomen, Volkswirtschaftlern, Banken, Regierungen etc. nie zu erahnen gewesen...
) gibt einen schon zu denken. Die Zeichen der Krise sind da, und anscheinend sind sie nicht für alle überraschend, natürlich für Ökonomen, Volkswirtschaftlern, Banken, Regierungen etc. nie zu erahnen gewesen...
Was tun?
ich komme auch aus dem Norden, gar nicht so weit weg von euch, aus Buchholz, und meine Bank heißt auch Haspa...

Besonders die Artikel von Krugmann haben vieles für sich, vieles habe ich in vielen verstreuten Threads schon gelesen, vieles kann ich nachempfinden, als Vertreter der 30- jährigen Generation, die beginnt, Angst zu haben.
Vieles von euren Strategien habe ich mir auch schon überlegt, mir fehlt es bis jetzt noch an zwei Dingen:
Geld um mich aus dieser Angst freizukaufen
und dem letztendlichen Willen, wirklich mich auf die drohenden Szenarien einzulassen.
Auch wenn ich Befürchtungen habe, und mir vieles ausmalen kann, möchte ich gar kein Krisengewinner sein.
Vielmehr möchte ich gar keine Krise haben, sondern Wege finden, wie man sie immer noch mäßigen kann ( das sie kommen wird halte ich für ausgemacht! )
oder wie man alternativ damit umgehen kann.
Denn was nützt mir Reichtum in der Krise ( für eine Unze Gold ein Sack Mehl kaufen
 ) wenn um mich rum alles zerstört wird, Freunde, Familie, soziale Bindungen, soziale Sicherheit, etc.
) wenn um mich rum alles zerstört wird, Freunde, Familie, soziale Bindungen, soziale Sicherheit, etc.Die 9mm-Lösung ist vielleicht schon realistisch, und ich würde schon wieder in Angst leben müssen.
Eine der Wege aus unserer überalternden, schrumpfenden Individualgesellschaft mit allen Krisensymptomen halte ich für Tauschringe, weil sie die soziale Nähe wieder fördern, generell freiwirtschaftliche Experimente, und vielleicht damit kombiniert den Aspekt "Bauernhof in der...Mark", so wie es heute auch schon Projekte selbstversorgender Gemeinwesen gibt. Dort würde ganz automatisch wieder eine andere Moral vom leben entstehen, da Leben als das wieder wahrgenommen würde, was es wirklich ist- nämlich nicht als Kostenfaktor, sondern fleisch gewordene Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, auch das menschliche Arbeiten als solches genannt!
Nur müßte dann bei allen Dingen der Staat dabei mitspielen, und das kann und wird er nicht, wenn es ihm an den Kragen geht, siehe Hauszinssteuer während WWKI.
Viele halten mich hier für einen linken Spinner, weil ich die besorgniserregenden Umstände immer wieder anprangere, und dabei auch nicht mit Kritik an unserem System hinterm Berg halte, auch wenn ich dabei z.B. marxistisch angehauchte Kritiker zitiere. Kritik an unserer Gesellschaft kommt nun mal vorzugsweise von links, und der Artikel des Weihnachtsmarxisten (
 ) gibt einen schon zu denken. Die Zeichen der Krise sind da, und anscheinend sind sie nicht für alle überraschend, natürlich für Ökonomen, Volkswirtschaftlern, Banken, Regierungen etc. nie zu erahnen gewesen...
) gibt einen schon zu denken. Die Zeichen der Krise sind da, und anscheinend sind sie nicht für alle überraschend, natürlich für Ökonomen, Volkswirtschaftlern, Banken, Regierungen etc. nie zu erahnen gewesen...Was tun?
#189
"vieles kann ich nachempfinden, als Vertreter der 30- jährigen Generation, die beginnt, Angst zu haben."
Wovor hast Du genau Angst? Ist es das? "Denn was nützt mir Reichtum in der Krise ( für eine Unze Gold ein Sack Mehl kaufen ) wenn um mich rum alles zerstört wird, Freunde,
Familie, soziale Bindungen, soziale Sicherheit, etc."
Irgendjemand verdient immer in jeder denkbaren Situation....es gibt immer irgendwelche Händler, Zocker, Hehler, Schieber, die gerade in Notzeiten unermeßliche Vermögenswerte ansammeln. Mit ner genügend großen Menge Gold und der nötigen Skrupellosigkeit kann man sich sollte unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zusammenbrechen ganze Imperien zusammenkaufen und mischt dann beim folgenden Wiederaufbau ganz vorne mit.
Ich finde sowas interessant und begreife es eher als Chance, denn die von Dir genannte "soziale Sicherheit" besteht sowieso nur in der Phanatsie. Fakt ist, daß wir unser Leben nicht planen können. Wir selbst existieren und wir selbst sind für unsere Handlungen verantwortlich, nicht mehr und nicht weniger. Sei froh über jeden Tag, den Du zu leben hast, aber erwarte nichts und vor allem keine Sicherheit...dann hat sich das Thema Angst erledigt.
Bedenke: Was hast Du zu verlieren? Nichts! Also wovor Angst haben?
Gruß
Sovereign
"vieles kann ich nachempfinden, als Vertreter der 30- jährigen Generation, die beginnt, Angst zu haben."
Wovor hast Du genau Angst? Ist es das? "Denn was nützt mir Reichtum in der Krise ( für eine Unze Gold ein Sack Mehl kaufen ) wenn um mich rum alles zerstört wird, Freunde,
Familie, soziale Bindungen, soziale Sicherheit, etc."
Irgendjemand verdient immer in jeder denkbaren Situation....es gibt immer irgendwelche Händler, Zocker, Hehler, Schieber, die gerade in Notzeiten unermeßliche Vermögenswerte ansammeln. Mit ner genügend großen Menge Gold und der nötigen Skrupellosigkeit kann man sich sollte unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zusammenbrechen ganze Imperien zusammenkaufen und mischt dann beim folgenden Wiederaufbau ganz vorne mit.
Ich finde sowas interessant und begreife es eher als Chance, denn die von Dir genannte "soziale Sicherheit" besteht sowieso nur in der Phanatsie. Fakt ist, daß wir unser Leben nicht planen können. Wir selbst existieren und wir selbst sind für unsere Handlungen verantwortlich, nicht mehr und nicht weniger. Sei froh über jeden Tag, den Du zu leben hast, aber erwarte nichts und vor allem keine Sicherheit...dann hat sich das Thema Angst erledigt.
Bedenke: Was hast Du zu verlieren? Nichts! Also wovor Angst haben?
Gruß
Sovereign
Eine Debatte über Angst würde diesen Thread sprengen und auch nicht gerecht werden, oder?
Ich versuch es mal kurz zu fassen:
Angst vor materiellen Verlust, ja, durchaus, Angst davor, seine Familie nicht mehr ernähren zu können. Sein Haus zu verlieren. Angst davor, Leid im Freundeskreis kennenzulernen. Oder am eigenen Leib.
Angst vor Leid...
Im übrigen glaube ich nicht an eine völlig angstbefreite Existenz, da diese zur Leichtsinnigkeit führen würde.
Die Frage ist nur- wie viel Angst ist noch gut-
und kann sie angesichts der für mich klaren Zeichen nicht doch etwas durch Autosuggestion übertrieben sein?
Ich sehe es durchaus auch als Chance, denn jede Krise ist auch eine Chance, aber nicht so sehr mich selbst zu bereichern, das könnte ich nicht auf Basis Leid und Entbehrungen anderer...
Sondern als wirklichen gerechten Neuanfang mit leicht anderen moralischen Grundvoraussetzungen, die unsere einzige Lebensgrundlage, nämlich unsere Erde, als lebenswerten Platz für viele kommende Generationen hinterläßt, ohne Ausbeutung irgendwelcher Ressourcen.
Ich versuch es mal kurz zu fassen:
Angst vor materiellen Verlust, ja, durchaus, Angst davor, seine Familie nicht mehr ernähren zu können. Sein Haus zu verlieren. Angst davor, Leid im Freundeskreis kennenzulernen. Oder am eigenen Leib.
Angst vor Leid...
Im übrigen glaube ich nicht an eine völlig angstbefreite Existenz, da diese zur Leichtsinnigkeit führen würde.
Die Frage ist nur- wie viel Angst ist noch gut-
und kann sie angesichts der für mich klaren Zeichen nicht doch etwas durch Autosuggestion übertrieben sein?
Ich sehe es durchaus auch als Chance, denn jede Krise ist auch eine Chance, aber nicht so sehr mich selbst zu bereichern, das könnte ich nicht auf Basis Leid und Entbehrungen anderer...
Sondern als wirklichen gerechten Neuanfang mit leicht anderen moralischen Grundvoraussetzungen, die unsere einzige Lebensgrundlage, nämlich unsere Erde, als lebenswerten Platz für viele kommende Generationen hinterläßt, ohne Ausbeutung irgendwelcher Ressourcen.
Hallo sitting bull,
wie ich sehe gehörst Du ja zur Weltverbessererfraktion (ist jetzt augenzwinkernd gemeint)
- ist die website www.denkmodelle.de eigentlich von Dir ?
Eine Debatte über die Angst ? – Mein Gott - man kann hier alles diskutieren, aber ob´s das richtige Forum dafür ist ...?
Zumindest kriegt man hier sofort kräftig auf die Fresse, wenn man nicht mit den Wölfen heult ...
Im Oktober letzten Jahres, zum Zeitpunkt also als ich diesen Thread losgetreten habe, hatte das Thema "Ende der Spaßgesellschaft" gerade die Topposition in den Lifestylemagazinen erklommen. Mittlerweile hat der Untergang des Abendlandes sogar schon die Bernecker / Thieme – Fraktion erreicht. Wenn das mal kein böser Kontraindikator ist ...
Ich denke, die Gaußsche Normalverteilung kann man auch auf weltanschauliche Diskussionen anwenden. Zur Zeit ist es der Irak, in einem halben Jahr vermutlich die globale Wirtschaftskrise und Weihnachten der Kohlenklau, aber wir wollen ja dem Thema nicht vorgreifen ...
Das Gefühl oder die Zustandsbeschreibung "Angst" läßt sich besser im Zusammenhang zu seinem Komplementärzustand "Lust" erklären - von pathologischen Gemütszuständen mal abgesehen.
Beispiel: die "Angstlust" der goldbugs:
"hoffentlich kracht es bald richtig im Gebälk, (Atombombe ? - geil !!) - dann werden wir mit unseren Goldminen endlich unsere schwer "verdienten" Gewinne einstreichen ! Zuvor muß allerdings noch schnell das schlechte Gewissen rationalisiert werden. - Das geht zur Zeit recht gut mit: "Pfui und Schande über den Kriegstreiber Bush !" (Und wenn dann meine australischen Explorer endlich durch die Decke knallen, wird es schon reichen für die Villa in der ersten Reihe von Marbella ...)
Meine ganz persönliche Angslust ist mittlerweile reichlich gesättigt, daher freue mich, hier mal wieder Sovereigns treffsicheren Lagekommentar zur Kenntnis nehmen zu dürfen.
Sovereign, es wird wirklich langsam Zeit für Dein erstes Buch, - wie hoch muß denn Cambior noch steigen,
damit Du "Vladi´s Private Islands" konsultierst ?
Gruß Konradi
wie ich sehe gehörst Du ja zur Weltverbessererfraktion (ist jetzt augenzwinkernd gemeint)
- ist die website www.denkmodelle.de eigentlich von Dir ?
Eine Debatte über die Angst ? – Mein Gott - man kann hier alles diskutieren, aber ob´s das richtige Forum dafür ist ...?
Zumindest kriegt man hier sofort kräftig auf die Fresse, wenn man nicht mit den Wölfen heult ...

Im Oktober letzten Jahres, zum Zeitpunkt also als ich diesen Thread losgetreten habe, hatte das Thema "Ende der Spaßgesellschaft" gerade die Topposition in den Lifestylemagazinen erklommen. Mittlerweile hat der Untergang des Abendlandes sogar schon die Bernecker / Thieme – Fraktion erreicht. Wenn das mal kein böser Kontraindikator ist ...
Ich denke, die Gaußsche Normalverteilung kann man auch auf weltanschauliche Diskussionen anwenden. Zur Zeit ist es der Irak, in einem halben Jahr vermutlich die globale Wirtschaftskrise und Weihnachten der Kohlenklau, aber wir wollen ja dem Thema nicht vorgreifen ...
Das Gefühl oder die Zustandsbeschreibung "Angst" läßt sich besser im Zusammenhang zu seinem Komplementärzustand "Lust" erklären - von pathologischen Gemütszuständen mal abgesehen.
Beispiel: die "Angstlust" der goldbugs:
"hoffentlich kracht es bald richtig im Gebälk, (Atombombe ? - geil !!) - dann werden wir mit unseren Goldminen endlich unsere schwer "verdienten" Gewinne einstreichen ! Zuvor muß allerdings noch schnell das schlechte Gewissen rationalisiert werden. - Das geht zur Zeit recht gut mit: "Pfui und Schande über den Kriegstreiber Bush !" (Und wenn dann meine australischen Explorer endlich durch die Decke knallen, wird es schon reichen für die Villa in der ersten Reihe von Marbella ...)
Meine ganz persönliche Angslust ist mittlerweile reichlich gesättigt, daher freue mich, hier mal wieder Sovereigns treffsicheren Lagekommentar zur Kenntnis nehmen zu dürfen.

Sovereign, es wird wirklich langsam Zeit für Dein erstes Buch, - wie hoch muß denn Cambior noch steigen,
damit Du "Vladi´s Private Islands" konsultierst ?
Gruß Konradi
Hi Konradi,
Zum Thema Angst: Es ist nicht so, daß ich total angstfrei wäre! Ich habe Angst vor der Atombombe, denn dann hätte ich nichts mehr vom schönen Gold und es wäre besser gewesen, wenn ich das letzte Jahr auf Weltreise verbracht hätte...Außerdem: Wer soll dann meine Bordeaux- und Maltvorräte austrinken? Und diese Schätze hier so einfach zurückzulassen, wäre ein unerträglicher Gedanke
Was die "Insel" betrifft: Es reicht noch nicht. Ich werde erst dann hier alles hinschmeißen und mich verdrücken, wenn ich sicher bin, daß es für den Rest des Lebens reicht um mit "Stil" zu leben. Bedenke die heutige Inflation konradi...ergo müssen die Goldaktien schon noch um einiges teurer werden (eine Verzehnfachung vom jetzigen Niveau uas wäre gut...ich bin ja schließlich nicht gierig, sonst hätte ich eine Verzwanzigfachung gefordert). Außerdem weiß ich nicht, ob das Leben eines Privatiers schon was für mich wäre....am Ende ergebe ich mich vor Langeweile dem Suff...nicht auszudenken

Gruß
Sovereign
Zum Thema Angst: Es ist nicht so, daß ich total angstfrei wäre! Ich habe Angst vor der Atombombe, denn dann hätte ich nichts mehr vom schönen Gold und es wäre besser gewesen, wenn ich das letzte Jahr auf Weltreise verbracht hätte...Außerdem: Wer soll dann meine Bordeaux- und Maltvorräte austrinken? Und diese Schätze hier so einfach zurückzulassen, wäre ein unerträglicher Gedanke

Was die "Insel" betrifft: Es reicht noch nicht. Ich werde erst dann hier alles hinschmeißen und mich verdrücken, wenn ich sicher bin, daß es für den Rest des Lebens reicht um mit "Stil" zu leben. Bedenke die heutige Inflation konradi...ergo müssen die Goldaktien schon noch um einiges teurer werden (eine Verzehnfachung vom jetzigen Niveau uas wäre gut...ich bin ja schließlich nicht gierig, sonst hätte ich eine Verzwanzigfachung gefordert). Außerdem weiß ich nicht, ob das Leben eines Privatiers schon was für mich wäre....am Ende ergebe ich mich vor Langeweile dem Suff...nicht auszudenken


Gruß
Sovereign
Huhu konradi! 
nein, ich bin aus Buchholz, Frank Baldus von denkmodelle.de aus Wuppertal!
Aber evtl. arbeite ich demnächst mit!
Ich würde mich gar nicht als Weltverbesserer ansehen,
sondern nur als Wachrüttler, als Denkanstoßlieferant. Obs dann wirklich besser gemacht wird, ist mir zwar nicht egal, liegt aber nicht in meiner Verantwortung.
Nur so zu tun, als gäbe es keine Probleme, wäre für mich nicht akzeptabel und weltfremd, deswegen engagiere ich mich so gut es eben geht, wenn man noch abhängig Beschäftigter ist!
Ich bin schon länger als der trendy Trend etwas negativ, verrenne mich aber auch zu schnell, vor allem wenn ich nur mit Permabären rede!
Diese Leute sind mir suspekt, ihnen ist gar nicht bewußt, auf welchen Grundlagen sie Geld verdienen wollen,
und hoffentlich wird es ihnen auch nie bewußt, denn deren Gewissensbisse möchte ich nicht haben.
Wahrscheinlich haben sie aber so etwas gar nicht, weil sie nur einem Zweck dienen, dem Herren des Geldes, und der kennt bekanntermaßen kein Gewissen.
Ich sage immer: Schön, so lange ihr auf der Gewinnerseite steht, ist es euch egal, wie es den anderen ergeht, und ich wünsche wirklich für alle, dass sich das nicht ändert.
Denn die Welt sieht aus einer niederen Ebene betrachtet wesentlich perspektivloser aus.
Auch für die Gewinner!
Und die Zeichen der Zeit, insbesondere was die Entwicklung der individuellen Freiheit angeht, sieht man in den USA ja schon recht gut.
America first, für alle unsere Interessen, notfalls mit globaler Gewalt. Leider ist das keine Welt, in der ich leben möchte, genausowenig wie in einer Postkrisengesellschaft oder in einer Welt, in der Regional Despoten die die ganze Erde bedrohen können.

nein, ich bin aus Buchholz, Frank Baldus von denkmodelle.de aus Wuppertal!

Aber evtl. arbeite ich demnächst mit!

Ich würde mich gar nicht als Weltverbesserer ansehen,
sondern nur als Wachrüttler, als Denkanstoßlieferant. Obs dann wirklich besser gemacht wird, ist mir zwar nicht egal, liegt aber nicht in meiner Verantwortung.
Nur so zu tun, als gäbe es keine Probleme, wäre für mich nicht akzeptabel und weltfremd, deswegen engagiere ich mich so gut es eben geht, wenn man noch abhängig Beschäftigter ist!

Ich bin schon länger als der trendy Trend etwas negativ, verrenne mich aber auch zu schnell, vor allem wenn ich nur mit Permabären rede!

Diese Leute sind mir suspekt, ihnen ist gar nicht bewußt, auf welchen Grundlagen sie Geld verdienen wollen,
und hoffentlich wird es ihnen auch nie bewußt, denn deren Gewissensbisse möchte ich nicht haben.
Wahrscheinlich haben sie aber so etwas gar nicht, weil sie nur einem Zweck dienen, dem Herren des Geldes, und der kennt bekanntermaßen kein Gewissen.
Ich sage immer: Schön, so lange ihr auf der Gewinnerseite steht, ist es euch egal, wie es den anderen ergeht, und ich wünsche wirklich für alle, dass sich das nicht ändert.
Denn die Welt sieht aus einer niederen Ebene betrachtet wesentlich perspektivloser aus.
Auch für die Gewinner!
Und die Zeichen der Zeit, insbesondere was die Entwicklung der individuellen Freiheit angeht, sieht man in den USA ja schon recht gut.
America first, für alle unsere Interessen, notfalls mit globaler Gewalt. Leider ist das keine Welt, in der ich leben möchte, genausowenig wie in einer Postkrisengesellschaft oder in einer Welt, in der Regional Despoten die die ganze Erde bedrohen können.
Hi sittin bull inv....Bist Du am Ende gar so einer von den "Gutmenschen"? Warum investierst Du dann in Gold? 
"Diese Leute sind mir suspekt, ihnen ist gar nicht bewußt, auf welchen Grundlagen sie Geld verdienen wollen."
Ist mir schon klar...des Einen Tod ist des Anderen Brot...ist der Kreislauf der Natur...meinetwegen auch "Sozialdarwinismus"...die Welt ist nunmal schlecht, ich habe sie nicht erschaffen und ich habe daher auch nicht vor, sie zu ändern.
"Wahrscheinlich haben sie aber so etwas gar nicht, weil sie nur einem Zweck dienen, dem Herren des Geldes, und der kennt bekanntermaßen kein Gewissen."
Schau mal: Früher hat man Theologie studiert um Gott zu dienen, heute studiert man BWL um dem Mammon, dem Geld, als Herrn dieser Welt zu dienen.
Und was mein Gewissen betrifft: Das wurde mir vor Zulassung der Termingeschäftsfähigkeit operativ entfernt....LOL...das hier ist die Börse Junge, der einzige Ort absolut freien, egoistischen Handelns, den es noch gibt. Hier gilt das Gesetz des Dschungels: Fressen oder gefressen werden, kein Mitleid, wir machen keine Gefangenen....und heute werden eben die Goldshorts serviert...gefangen in ihrer eigenen Gier und nun den Goldbugs gebraten am Spieß serviert...Also mir schmeckts!



"Diese Leute sind mir suspekt, ihnen ist gar nicht bewußt, auf welchen Grundlagen sie Geld verdienen wollen."
Ist mir schon klar...des Einen Tod ist des Anderen Brot...ist der Kreislauf der Natur...meinetwegen auch "Sozialdarwinismus"...die Welt ist nunmal schlecht, ich habe sie nicht erschaffen und ich habe daher auch nicht vor, sie zu ändern.
"Wahrscheinlich haben sie aber so etwas gar nicht, weil sie nur einem Zweck dienen, dem Herren des Geldes, und der kennt bekanntermaßen kein Gewissen."
Schau mal: Früher hat man Theologie studiert um Gott zu dienen, heute studiert man BWL um dem Mammon, dem Geld, als Herrn dieser Welt zu dienen.
Und was mein Gewissen betrifft: Das wurde mir vor Zulassung der Termingeschäftsfähigkeit operativ entfernt....LOL...das hier ist die Börse Junge, der einzige Ort absolut freien, egoistischen Handelns, den es noch gibt. Hier gilt das Gesetz des Dschungels: Fressen oder gefressen werden, kein Mitleid, wir machen keine Gefangenen....und heute werden eben die Goldshorts serviert...gefangen in ihrer eigenen Gier und nun den Goldbugs gebraten am Spieß serviert...Also mir schmeckts!


@ sovereign: gute Antwort, konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen, aber:
das bin ich nicht!
während man bei allen anderen Geschäften, bei denen man verliert ( ) man zwar auch andere die Haut aus dem Gesicht reißen kann ( oder sogar muß? ), ist es beim Goldbug ja wohl so, dass dieser die Katastrophe förmlich herbeisehnt, und zwar nur aus schnöden finanziellen Interessen. Ist ähnlich der Debatte wer ist moralischer?
) man zwar auch andere die Haut aus dem Gesicht reißen kann ( oder sogar muß? ), ist es beim Goldbug ja wohl so, dass dieser die Katastrophe förmlich herbeisehnt, und zwar nur aus schnöden finanziellen Interessen. Ist ähnlich der Debatte wer ist moralischer?
Ein Call oder Putbesitzer?
Für mich ist Geld zwar zweifelsohne ein Mittel, bei dem man weniger Sorgen hat, wenn man mehr davon hat, aber vor allem ist es für mich ein Mittel, um meine Arbeit bezahlt zu bekommen und mir selbst mein beschauliches Leben einzurichten.
Ich wüßte nicht, was es mir ( außer einer sogar zweifelhaften Tendenz zu mehr Sorgenfreiheit ) persönlich bringen würde, viel davon zu besitzen.
Meine Wünsche werden zwar extravaganter, aber auch belangloser, wirklich wichtige menschliche Werte verkümmern sogar mit dem Mehrbesitz, ganz bestimmt!
Ich halte es da eher wie die Indianer Nordamerikas.
Geld hat auch deshlab für mich keinerlei Wertaufbewahrungsfunktion. Neben den Realwirtschaftlichen Gründen, die alle paar Generationen alles Geld wertlos wird.
Gold wegen der permanenten Gier der Weißen dagegen schon!
das bin ich nicht!
während man bei allen anderen Geschäften, bei denen man verliert (
 ) man zwar auch andere die Haut aus dem Gesicht reißen kann ( oder sogar muß? ), ist es beim Goldbug ja wohl so, dass dieser die Katastrophe förmlich herbeisehnt, und zwar nur aus schnöden finanziellen Interessen. Ist ähnlich der Debatte wer ist moralischer?
) man zwar auch andere die Haut aus dem Gesicht reißen kann ( oder sogar muß? ), ist es beim Goldbug ja wohl so, dass dieser die Katastrophe förmlich herbeisehnt, und zwar nur aus schnöden finanziellen Interessen. Ist ähnlich der Debatte wer ist moralischer?Ein Call oder Putbesitzer?
Für mich ist Geld zwar zweifelsohne ein Mittel, bei dem man weniger Sorgen hat, wenn man mehr davon hat, aber vor allem ist es für mich ein Mittel, um meine Arbeit bezahlt zu bekommen und mir selbst mein beschauliches Leben einzurichten.
Ich wüßte nicht, was es mir ( außer einer sogar zweifelhaften Tendenz zu mehr Sorgenfreiheit ) persönlich bringen würde, viel davon zu besitzen.
Meine Wünsche werden zwar extravaganter, aber auch belangloser, wirklich wichtige menschliche Werte verkümmern sogar mit dem Mehrbesitz, ganz bestimmt!
Ich halte es da eher wie die Indianer Nordamerikas.
Geld hat auch deshlab für mich keinerlei Wertaufbewahrungsfunktion. Neben den Realwirtschaftlichen Gründen, die alle paar Generationen alles Geld wertlos wird.
Gold wegen der permanenten Gier der Weißen dagegen schon!
@sittin bull
"Ich wüßte nicht, was es mir ( außer einer sogar zweifelhaften Tendenz zu mehr Sorgenfreiheit ) persönlich bringen würde, viel davon zu besitzen."
Das Spiel, das in unserer Gesellschaft gespielt wird, heißt: Wer am meisten zusammenrafft hat gewonnen! Was es persönlich bringen soll? Nun neben dem Geld was man zum persönlichen Lebensunterhalt braucht, bedeutet es auch Macht. Mehr Geld bedeutet mehr Macht.
Was die allgemeine Ethik zu Goldinvestments angeht: Beachte die Ursache und die Wirkung. Haben wir Goldbugs Schuld am Wirtschaftszusammenbruch? Führt Bush seinen Privatkrieg wegen uns Goldbugs? Können wir Leid und Blutvergießen vermeiden wenn wir nicht in Gold investieren? ...Nein! Wir reagieren nur auf die Gegebenheiten und profitieren eben davon, wenn sich die Dinge so schlecht entwickeln wie gedacht.
Insofern sehe ich nichts verwerfliches an derartigen Tun.
Wenn Du damit Probleme hast: Dann bist Du vielleicht zu gut für diese Welt. Mir jedenfalls gefällt der Tanz auf dem Vulkan und ich liebe was ich an Negativmeldungen sehe!
Gruß
Sovereign
"Ich wüßte nicht, was es mir ( außer einer sogar zweifelhaften Tendenz zu mehr Sorgenfreiheit ) persönlich bringen würde, viel davon zu besitzen."
Das Spiel, das in unserer Gesellschaft gespielt wird, heißt: Wer am meisten zusammenrafft hat gewonnen! Was es persönlich bringen soll? Nun neben dem Geld was man zum persönlichen Lebensunterhalt braucht, bedeutet es auch Macht. Mehr Geld bedeutet mehr Macht.
Was die allgemeine Ethik zu Goldinvestments angeht: Beachte die Ursache und die Wirkung. Haben wir Goldbugs Schuld am Wirtschaftszusammenbruch? Führt Bush seinen Privatkrieg wegen uns Goldbugs? Können wir Leid und Blutvergießen vermeiden wenn wir nicht in Gold investieren? ...Nein! Wir reagieren nur auf die Gegebenheiten und profitieren eben davon, wenn sich die Dinge so schlecht entwickeln wie gedacht.
Insofern sehe ich nichts verwerfliches an derartigen Tun.
Wenn Du damit Probleme hast: Dann bist Du vielleicht zu gut für diese Welt. Mir jedenfalls gefällt der Tanz auf dem Vulkan und ich liebe was ich an Negativmeldungen sehe!
Gruß
Sovereign
Vielleicht noch ein Aspekt an sitting bull.
Da jedem Geschäft das du an der Börse tätigst und das du mit Gewinn realisierst natürlich auch ein Verlierer gegenübersteht, seh es doch als hilfreiche Lehre für den Verlierer, die Folgen seiner eigenen Gier zu erkennen. Sollte der Verlierer der Goldspekulation das Finanzsystem (die ewigen Gewinner der Wachstumslüge) sein, um so besser. Die Menschheit kann aus den Lehren einer falschen Wachstums und Wohlstandstheorie nur profitieren. Und du als Goldbug hast mitgeholfen, dies zu forcieren

Da jedem Geschäft das du an der Börse tätigst und das du mit Gewinn realisierst natürlich auch ein Verlierer gegenübersteht, seh es doch als hilfreiche Lehre für den Verlierer, die Folgen seiner eigenen Gier zu erkennen. Sollte der Verlierer der Goldspekulation das Finanzsystem (die ewigen Gewinner der Wachstumslüge) sein, um so besser. Die Menschheit kann aus den Lehren einer falschen Wachstums und Wohlstandstheorie nur profitieren. Und du als Goldbug hast mitgeholfen, dies zu forcieren


schloss, sovereign, ihr habt beide recht!
Klang es so, als ob ich deswegen ein Problem mit Goldbugs hätte? Das war nicht meine Intention, ich halte im Gegenteil Gold für einen probates Mittel, durch anstehende Krisen durchzukommen.
Aber wegen einer anderen Intention als ihr.
Nicht wegen der Macht, oder des Ruhms, sondern wegen einer einfachen Formel:
Meine Familie und ich sollen überleben.
Was kann ich mir für Macht dann noch kaufen, wenn alles in Trümmern liegt?
Was hat einem Macht während der Great Depression genützt?
Gar nichts, man formte im Gegenteil den New Deal, damit ein menschenwürdiges Leben wieder möglich war!
@ schloss: sehr richtiger Aspekt! Trotzdem würde ich keine Genugtuung bei Erfüllung der Szenarien empfinden, weil es tausendfaches Leid bedeuten wird. Leid, das wir Menschen selbst verursacht haben werden, nicht irgendeine Umweltkatastrophe.
Klang es so, als ob ich deswegen ein Problem mit Goldbugs hätte? Das war nicht meine Intention, ich halte im Gegenteil Gold für einen probates Mittel, durch anstehende Krisen durchzukommen.
Aber wegen einer anderen Intention als ihr.
Nicht wegen der Macht, oder des Ruhms, sondern wegen einer einfachen Formel:
Meine Familie und ich sollen überleben.
Was kann ich mir für Macht dann noch kaufen, wenn alles in Trümmern liegt?
Was hat einem Macht während der Great Depression genützt?
Gar nichts, man formte im Gegenteil den New Deal, damit ein menschenwürdiges Leben wieder möglich war!
@ schloss: sehr richtiger Aspekt! Trotzdem würde ich keine Genugtuung bei Erfüllung der Szenarien empfinden, weil es tausendfaches Leid bedeuten wird. Leid, das wir Menschen selbst verursacht haben werden, nicht irgendeine Umweltkatastrophe.
@ Sovereign
... Ich habe Angst vor der Atombombe, denn dann hätte ich nichts mehr vom schönen Gold und es wäre besser gewesen, wenn ich das letzte Jahr auf Weltreise verbracht hätte...
Sovereign, denk an den alten kubanischen Fischer Santiago. Der fängt mit letzter Kraft auf hoher See endlich seinen Schwertfisch und behält auf der Heimfahrt doch nur die Gräten zurück, weil die Haie ihm alles wegfressen.
Außerdem weiß ich nicht, ob das Leben eines Privatiers schon was für mich wäre....am Ende ergebe ich mich vor Langeweile dem Suff...nicht auszudenken
"Der alte Mann schlief und träumte von den Löwen."
Können wir Leid und Blutvergießen vermeiden wenn wir nicht in Gold investieren?
...Nein! Wir reagieren nur auf die Gegebenheiten und profitieren eben davon, wenn sich die Dinge so schlecht entwickeln wie gedacht. Insofern sehe ich nichts verwerfliches an derartigen Tun
"Vielleicht war es eine Sünde, den Fisch zu töten", überlegt er. "Wahrscheinlich war es das, obwohl ich es tat, um mein Leben zu fristen und viele Leute damit zu ernähren. Aber dann ist alles eine Sünde."
und wieso überhaupt Weltreise ??
- Hattest Du mir nicht kürzlich dringend dazu geraten,meinen Urlaub besser ausfallen zu lassen und das ganze Urlaubsgeld in Goldminenaktien anzulegen ?
Sag mal Dir geht´s doch gut, oder ? – man macht sich ja Sorgen ...
@ schloss
wo wir schon beim alten Hemmingway sind:
"Das Merkwürdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, daß man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird."
@ sitting bull
Du willst uns alle wachrütteln ? Das ist ehrenwert, aber schau Dir mal z.B. so einen typischen alten "68er" an.
- Willst Du wirklich so enden wie Goldonly ?
Also ich denke ein Abonnement des "SPIEGEL" oder der "ZEIT" reicht für´s Erste ...
und – die Zustimmung fällt schwer , aber Sovereign trifft mal wieder ins Schwarze:
, aber Sovereign trifft mal wieder ins Schwarze:
das hier ist die Börse Junge, der einzige Ort absolut freien, egoistischen Handelns, den es noch gibt. Hier gilt das Gesetz des Dschungels: Fressen oder gefressen werden, kein Mitleid, wir machen keine Gefangenen...
So und jetzt werde ich Euch wieder mal ein wenig mit Cut & Paste ärgern.
Zuvor aber auch für die nützlichen Idioten von der Saddam-Fraktion ein Hemmingway-Zitat:
"Wenn die Wölfe spüren, dass man bereit ist zu töten, dann greifen sie erst gar nicht an."
Gruß an alle Freunde der Vernunft -
Konradi
---
Die Angst vor Saddams Kindersoldaten
Von Markus Becker
Sollte es zum Krieg im Irak und zum Häuserkampf in Bagdad kommen, werden amerikanische Soldaten auf eine Bedrohung stoßen, die sie in einen grausamen Gewissenskonflikt bringen kann: Kindersoldaten, die zu Tausenden in Saddam Husseins Heer kämpfen und auf Töten programmiert sind - wie etwa der "Löwenclub Saddams".
Nathan Ross Chapman ahnte nicht, dass er nur noch wenige Minuten zu leben haben würde. Am 4. Januar stand er auf einem Kleinlaster und ließ seinen Blick über die zerklüftete Bergregion vor den Toren der afghanischen Stadt Khost schweifen. Sein Auftrag: Die Ergebnisse alliierter Bombenangriffe überprüfen - ein Routineeinsatz für den 31-jährigen Kommandosoldaten der amerikanischen Special Forces, der schon in Panama, im Irak und auf Haiti gekämpft hatte.
Plötzlich ging scheinbar aus dem Nichts ein Geschossregen auf Chapman und seine Begleiter nieder. Mehrere Kugeln durchschlugen Chapmans Beine und durchtrennten eine Arterie. Der Elitekämpfer verblutete. Er war der erste US-Soldat, der bei der Operation "Enduring Freedom" starb. Hätte Chapman seinen Angreifer gesehen, vielleicht hätte er sich dennoch nicht gewehrt: Der zweifache Vater hätte vor der Wahl gestanden, entweder selbst zu sterben oder einen 14-jährigen Jungen zu erschießen.
Die Episode war Thema bei einer Tagung des Center For Emerging Threats and Opportunities, einer vom US-Marinekorps und dem Potomac-Institut für Politische Studien gegründeten Organisation zur Analyse neuer Bedrohungen der Nationalen Sicherheit. Sie könnte ein Vorgeschmack auf eine der grausamsten Seiten sein, die eine Invasion im Irak annehmen könnte: Saddam Hussein könnte Tausende Kinder in die Schlacht schicken, um die Moral der angreifenden Alliierten zu schwächen. Beispiele dafür gibt es: schon im ersten Golfkrieg schickten Iran und der Irak Brigaden von Kindersoldaten in die Schlacht.
Dass diese Rechnung aufgehen könnte, wissen westliche Streitkräfte aus Erfahrung. Im Zweiten Weltkrieg mussten amerikanische und britische Soldaten auf Kinder schießen: Hitlerjungen, die während der letzten Kriegsmonate in den Ruinen deutscher Städte verheizt wurden. Die Wirkung auf die Moral der betroffenen alliierten Einheiten war verheerend, ungeachtet der Tatsache, dass die Alliierten kurz vor dem Sieg standen.
Noch im Jahr 2001 zeigte sich, wie ratlos westliche Streitkräfte in solchen Situationen reagieren können: Im westafrikanischen Sierra Leone geriet eine komplette britische Patrouille in Gefangenschaft, als sie auf Kindersoldaten stieß und vor einem Feuergefecht zurückschreckte. Die rund 150 britischen Kommandosoldaten, die ihre Kameraden anschließend befreiten, hatten diese Wahl nicht: Sie lieferten sich eine heftige Schießerei mit den jungen Geiselnehmern. Das Ergebnis waren mehrere Dutzend Tote. Manche der Briten, berichtete das renommierte Brookings Institute in Washington, litten später unter Depressionen und dem Posttraumatischen Stress-Syndrom.
"Kinder verstehen nichts von Taktik und bilden keine zusammenhängenden Einheiten", erklärt Major Jim Gray, Attaché der britischen Royal Marines in den USA. "Sie sind nur Kinder, aber Kinder auf Drogen und mit Waffen. Wenn sie angegriffen werden, kämpfen sie wie wild." Westliche Soldaten, fordert Gray, müssten deshalb unbedingt auf den "Schock" vorbereitet werden, gegen Kinder kämpfen zu müssen.
Saddam Hussein hat seine Lehren aus der Geschichte offenbar gezogen: Er bereitete den militärischen Missbrauch von Kindern sorgfältig vor. Seit Mitte der neunziger Jahre veranstaltet das Bagdader Regime nach Informationen des Brookings Institute jährliche Trainingscamps, in denen Tausende Jungen drei Wochen lang militärisch gedrillt, im Umgang mit Handfeuerwaffen geschult und der Ideologie der regierenden Baath-Partei ausgesetzt werden. Das Eintrittsalter der Teilnehmer: zehn Jahre.
Seit 1998 existieren auch militärische Übungsprogramme für die gesamte Bevölkerung. Einmal im Jahr werden alle Iraker ab 15 Jahren 40 Tage lang zwei Stunden täglich gedrillt und an Handfeuerwaffen ausgebildet. Darüber hinaus existieren paramilitärische Kindersoldaten-Einheiten innerhalb der "Futuwah"-Jugendbewegung, einer Organisation der Baath-Partei, die bereits in den siebziger Jahren gegründet wurde und Kinder ab zwölf Jahren militärisch ausbildet.
Für das irakische Regime bietet der Zugriff auf die Jugend gleich zwei Vorteile. Anders als in westlichen Ländern bildet diese Altersgruppe im Irak einen enormen Anteil an der Gesamtbevölkerung: Etwa die Hälfte der 22 Millionen Einwohner des Landes ist jünger als 18 Jahre. Ihre Militarisierung ergibt ein gewaltiges Nachwuchspotenzial für Saddams Truppen, ihre Indoktrinierung trägt darüber hinaus zur Stabilisierung des Regimes bei.
Die wichtigste Kindersoldaten-Organisation, so das renommierte Brookings Institute in einer Mitte des Monats vorgelegten Untersuchung, sind die "Ashbal Saddam", die "Löwenclubs Saddams", die nach der Niederlage im Golfkrieg von 1991 gebildet wurden. Zehn- bis 15-Jährige werden bis zu 14 Stunden täglich in Camps gedrillt, politisch auf Linie gebracht und gegen Gewalt abgestumpft, unter anderem durch regelmäßiges Verprügeln und Tierquälereien. Allein in Bagdad sollen rund 8000 Kindersoldaten der "Ashbal Saddam" stationiert sein. Sie würden, so die Befürchtung von Experten, in kleinen Gruppen als leichte Infanterie und Scharfschützen eingesetzt, um irakische Städte, vor allem aber Bagdad zu verteidigen. Ob Saddam wirklich in einem möglichen Krieg gegen die USA solche Pläne hat, ist allerdings völlig unklar.
Viele Kindersoldaten, warnt Peter Singer vom Brookings Institute, seien ihren älteren Gegnern in Sachen Kampferfahrung um Jahre voraus, da sie buchstäblich auf dem Schlachtfeld groß geworden seien. Zudem legten sie in Gefechten oft eine erschreckende Grausamkeit an den Tag und seien sehr viel schwerer auszurechnen, risikobereiter und brutaler als erwachsene Soldaten. Die Tatsache, dass Erwachsene oft zögern, ehe sie auf Kinder schießen, verschaffe den halbwüchsigen Kämpfern einen weiteren Vorteil. Bei einem Häuserkampf um die irakische Hauptstadt könnte das grausame Folgen haben.
Zwar könnten Kindersoldaten, auch wenn das irakische Regime sie zu Tausenden in den Kampf schicken sollte, kein ernsthaftes Gegengewicht zur Überlegenheit westlicher Militärs darstellen. An der Propagandafront aber, warnten die Fachleute auf der Tagung des Center For Emerging Threats and Opportunities (Ceto), könnten Bilder von toten Kindern, erschossen von US-Soldaten, eine verheerende Wirkung entfalten. Im Nahen Osten wäre ihnen die Verehrung als Märtyrer sicher.
Was die Experten an Gegenmaßnahmen vorschlagen, dokumentiert die ganze Hilflosigkeit westlicher Militärs gegenüber Kindern, die über Jahre hinweg brutalisiert und fanatisiert wurden. Das Ausschalten der erwachsenen Führungsperson etwa sei ein probates Mittel, Kindersoldaten zur Aufgabe zu bewegen. Oder aber die halbwüchsigen Gegner auf Distanz zu halten, Warnschüsse abzugeben oder nicht-tödliche Waffen einzusetzen. Alternativen, die während eines Kampfs um jede Straße und jedes Haus nur schwer zu realisieren sein dürften - zumal dann, wenn die feindlichen Einheiten nicht ausschließlich aus Kindern bestehen.
So beziehen sich die praktikabelsten Ideen der Experten auf die Zeit nach dem Kindstod auf dem Schlachtfeld: Sprecher der US-Regierung, empfiehlt Brookings-Mitarbeiter Singer, sollten unbedingt erreichen, dass "die Schuld dem Regime gegeben wird, das die Kinder illegal ins Militär zwingt und sie die Drecksarbeit tun lässt - im vollen Bewusstsein, dass sie sterben werden".
.
... Ich habe Angst vor der Atombombe, denn dann hätte ich nichts mehr vom schönen Gold und es wäre besser gewesen, wenn ich das letzte Jahr auf Weltreise verbracht hätte...
Sovereign, denk an den alten kubanischen Fischer Santiago. Der fängt mit letzter Kraft auf hoher See endlich seinen Schwertfisch und behält auf der Heimfahrt doch nur die Gräten zurück, weil die Haie ihm alles wegfressen.
Außerdem weiß ich nicht, ob das Leben eines Privatiers schon was für mich wäre....am Ende ergebe ich mich vor Langeweile dem Suff...nicht auszudenken
"Der alte Mann schlief und träumte von den Löwen."
Können wir Leid und Blutvergießen vermeiden wenn wir nicht in Gold investieren?
...Nein! Wir reagieren nur auf die Gegebenheiten und profitieren eben davon, wenn sich die Dinge so schlecht entwickeln wie gedacht. Insofern sehe ich nichts verwerfliches an derartigen Tun
"Vielleicht war es eine Sünde, den Fisch zu töten", überlegt er. "Wahrscheinlich war es das, obwohl ich es tat, um mein Leben zu fristen und viele Leute damit zu ernähren. Aber dann ist alles eine Sünde."
und wieso überhaupt Weltreise ??
- Hattest Du mir nicht kürzlich dringend dazu geraten,meinen Urlaub besser ausfallen zu lassen und das ganze Urlaubsgeld in Goldminenaktien anzulegen ?
Sag mal Dir geht´s doch gut, oder ? – man macht sich ja Sorgen ...
@ schloss
wo wir schon beim alten Hemmingway sind:
"Das Merkwürdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, daß man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird."
@ sitting bull
Du willst uns alle wachrütteln ? Das ist ehrenwert, aber schau Dir mal z.B. so einen typischen alten "68er" an.
- Willst Du wirklich so enden wie Goldonly ?
Also ich denke ein Abonnement des "SPIEGEL" oder der "ZEIT" reicht für´s Erste ...
und – die Zustimmung fällt schwer
 , aber Sovereign trifft mal wieder ins Schwarze:
, aber Sovereign trifft mal wieder ins Schwarze: das hier ist die Börse Junge, der einzige Ort absolut freien, egoistischen Handelns, den es noch gibt. Hier gilt das Gesetz des Dschungels: Fressen oder gefressen werden, kein Mitleid, wir machen keine Gefangenen...
So und jetzt werde ich Euch wieder mal ein wenig mit Cut & Paste ärgern.

Zuvor aber auch für die nützlichen Idioten von der Saddam-Fraktion ein Hemmingway-Zitat:
"Wenn die Wölfe spüren, dass man bereit ist zu töten, dann greifen sie erst gar nicht an."
Gruß an alle Freunde der Vernunft -
Konradi

---
Die Angst vor Saddams Kindersoldaten
Von Markus Becker
Sollte es zum Krieg im Irak und zum Häuserkampf in Bagdad kommen, werden amerikanische Soldaten auf eine Bedrohung stoßen, die sie in einen grausamen Gewissenskonflikt bringen kann: Kindersoldaten, die zu Tausenden in Saddam Husseins Heer kämpfen und auf Töten programmiert sind - wie etwa der "Löwenclub Saddams".
Nathan Ross Chapman ahnte nicht, dass er nur noch wenige Minuten zu leben haben würde. Am 4. Januar stand er auf einem Kleinlaster und ließ seinen Blick über die zerklüftete Bergregion vor den Toren der afghanischen Stadt Khost schweifen. Sein Auftrag: Die Ergebnisse alliierter Bombenangriffe überprüfen - ein Routineeinsatz für den 31-jährigen Kommandosoldaten der amerikanischen Special Forces, der schon in Panama, im Irak und auf Haiti gekämpft hatte.
Plötzlich ging scheinbar aus dem Nichts ein Geschossregen auf Chapman und seine Begleiter nieder. Mehrere Kugeln durchschlugen Chapmans Beine und durchtrennten eine Arterie. Der Elitekämpfer verblutete. Er war der erste US-Soldat, der bei der Operation "Enduring Freedom" starb. Hätte Chapman seinen Angreifer gesehen, vielleicht hätte er sich dennoch nicht gewehrt: Der zweifache Vater hätte vor der Wahl gestanden, entweder selbst zu sterben oder einen 14-jährigen Jungen zu erschießen.
Die Episode war Thema bei einer Tagung des Center For Emerging Threats and Opportunities, einer vom US-Marinekorps und dem Potomac-Institut für Politische Studien gegründeten Organisation zur Analyse neuer Bedrohungen der Nationalen Sicherheit. Sie könnte ein Vorgeschmack auf eine der grausamsten Seiten sein, die eine Invasion im Irak annehmen könnte: Saddam Hussein könnte Tausende Kinder in die Schlacht schicken, um die Moral der angreifenden Alliierten zu schwächen. Beispiele dafür gibt es: schon im ersten Golfkrieg schickten Iran und der Irak Brigaden von Kindersoldaten in die Schlacht.
Dass diese Rechnung aufgehen könnte, wissen westliche Streitkräfte aus Erfahrung. Im Zweiten Weltkrieg mussten amerikanische und britische Soldaten auf Kinder schießen: Hitlerjungen, die während der letzten Kriegsmonate in den Ruinen deutscher Städte verheizt wurden. Die Wirkung auf die Moral der betroffenen alliierten Einheiten war verheerend, ungeachtet der Tatsache, dass die Alliierten kurz vor dem Sieg standen.
Noch im Jahr 2001 zeigte sich, wie ratlos westliche Streitkräfte in solchen Situationen reagieren können: Im westafrikanischen Sierra Leone geriet eine komplette britische Patrouille in Gefangenschaft, als sie auf Kindersoldaten stieß und vor einem Feuergefecht zurückschreckte. Die rund 150 britischen Kommandosoldaten, die ihre Kameraden anschließend befreiten, hatten diese Wahl nicht: Sie lieferten sich eine heftige Schießerei mit den jungen Geiselnehmern. Das Ergebnis waren mehrere Dutzend Tote. Manche der Briten, berichtete das renommierte Brookings Institute in Washington, litten später unter Depressionen und dem Posttraumatischen Stress-Syndrom.
"Kinder verstehen nichts von Taktik und bilden keine zusammenhängenden Einheiten", erklärt Major Jim Gray, Attaché der britischen Royal Marines in den USA. "Sie sind nur Kinder, aber Kinder auf Drogen und mit Waffen. Wenn sie angegriffen werden, kämpfen sie wie wild." Westliche Soldaten, fordert Gray, müssten deshalb unbedingt auf den "Schock" vorbereitet werden, gegen Kinder kämpfen zu müssen.
Saddam Hussein hat seine Lehren aus der Geschichte offenbar gezogen: Er bereitete den militärischen Missbrauch von Kindern sorgfältig vor. Seit Mitte der neunziger Jahre veranstaltet das Bagdader Regime nach Informationen des Brookings Institute jährliche Trainingscamps, in denen Tausende Jungen drei Wochen lang militärisch gedrillt, im Umgang mit Handfeuerwaffen geschult und der Ideologie der regierenden Baath-Partei ausgesetzt werden. Das Eintrittsalter der Teilnehmer: zehn Jahre.
Seit 1998 existieren auch militärische Übungsprogramme für die gesamte Bevölkerung. Einmal im Jahr werden alle Iraker ab 15 Jahren 40 Tage lang zwei Stunden täglich gedrillt und an Handfeuerwaffen ausgebildet. Darüber hinaus existieren paramilitärische Kindersoldaten-Einheiten innerhalb der "Futuwah"-Jugendbewegung, einer Organisation der Baath-Partei, die bereits in den siebziger Jahren gegründet wurde und Kinder ab zwölf Jahren militärisch ausbildet.
Für das irakische Regime bietet der Zugriff auf die Jugend gleich zwei Vorteile. Anders als in westlichen Ländern bildet diese Altersgruppe im Irak einen enormen Anteil an der Gesamtbevölkerung: Etwa die Hälfte der 22 Millionen Einwohner des Landes ist jünger als 18 Jahre. Ihre Militarisierung ergibt ein gewaltiges Nachwuchspotenzial für Saddams Truppen, ihre Indoktrinierung trägt darüber hinaus zur Stabilisierung des Regimes bei.
Die wichtigste Kindersoldaten-Organisation, so das renommierte Brookings Institute in einer Mitte des Monats vorgelegten Untersuchung, sind die "Ashbal Saddam", die "Löwenclubs Saddams", die nach der Niederlage im Golfkrieg von 1991 gebildet wurden. Zehn- bis 15-Jährige werden bis zu 14 Stunden täglich in Camps gedrillt, politisch auf Linie gebracht und gegen Gewalt abgestumpft, unter anderem durch regelmäßiges Verprügeln und Tierquälereien. Allein in Bagdad sollen rund 8000 Kindersoldaten der "Ashbal Saddam" stationiert sein. Sie würden, so die Befürchtung von Experten, in kleinen Gruppen als leichte Infanterie und Scharfschützen eingesetzt, um irakische Städte, vor allem aber Bagdad zu verteidigen. Ob Saddam wirklich in einem möglichen Krieg gegen die USA solche Pläne hat, ist allerdings völlig unklar.
Viele Kindersoldaten, warnt Peter Singer vom Brookings Institute, seien ihren älteren Gegnern in Sachen Kampferfahrung um Jahre voraus, da sie buchstäblich auf dem Schlachtfeld groß geworden seien. Zudem legten sie in Gefechten oft eine erschreckende Grausamkeit an den Tag und seien sehr viel schwerer auszurechnen, risikobereiter und brutaler als erwachsene Soldaten. Die Tatsache, dass Erwachsene oft zögern, ehe sie auf Kinder schießen, verschaffe den halbwüchsigen Kämpfern einen weiteren Vorteil. Bei einem Häuserkampf um die irakische Hauptstadt könnte das grausame Folgen haben.
Zwar könnten Kindersoldaten, auch wenn das irakische Regime sie zu Tausenden in den Kampf schicken sollte, kein ernsthaftes Gegengewicht zur Überlegenheit westlicher Militärs darstellen. An der Propagandafront aber, warnten die Fachleute auf der Tagung des Center For Emerging Threats and Opportunities (Ceto), könnten Bilder von toten Kindern, erschossen von US-Soldaten, eine verheerende Wirkung entfalten. Im Nahen Osten wäre ihnen die Verehrung als Märtyrer sicher.
Was die Experten an Gegenmaßnahmen vorschlagen, dokumentiert die ganze Hilflosigkeit westlicher Militärs gegenüber Kindern, die über Jahre hinweg brutalisiert und fanatisiert wurden. Das Ausschalten der erwachsenen Führungsperson etwa sei ein probates Mittel, Kindersoldaten zur Aufgabe zu bewegen. Oder aber die halbwüchsigen Gegner auf Distanz zu halten, Warnschüsse abzugeben oder nicht-tödliche Waffen einzusetzen. Alternativen, die während eines Kampfs um jede Straße und jedes Haus nur schwer zu realisieren sein dürften - zumal dann, wenn die feindlichen Einheiten nicht ausschließlich aus Kindern bestehen.
So beziehen sich die praktikabelsten Ideen der Experten auf die Zeit nach dem Kindstod auf dem Schlachtfeld: Sprecher der US-Regierung, empfiehlt Brookings-Mitarbeiter Singer, sollten unbedingt erreichen, dass "die Schuld dem Regime gegeben wird, das die Kinder illegal ins Militär zwingt und sie die Drecksarbeit tun lässt - im vollen Bewusstsein, dass sie sterben werden".
.
@Konradi
Ich galt zu Schulzeiten als mathematisches Genie.
Wohl zu Recht, leider hab ich nicht viel daraus germacht.
Also ganz simpel, speziell für Dich: Ich finde Kriegstreiber einfach nur Schei..ße.
Auch finde ich Menschen, die aus lauter Schiß um ihr jämmerliches Dasein
andere Menschen verrecken lassen wollen, Schei..ße.
Nun rate mal, rein mathematisch, Dreisatz ,
,
was ich von die halte ?
Genau, du bist ein dufter Typ.
GO
Ich galt zu Schulzeiten als mathematisches Genie.
Wohl zu Recht, leider hab ich nicht viel daraus germacht.

Also ganz simpel, speziell für Dich: Ich finde Kriegstreiber einfach nur Schei..ße.
Auch finde ich Menschen, die aus lauter Schiß um ihr jämmerliches Dasein
andere Menschen verrecken lassen wollen, Schei..ße.
Nun rate mal, rein mathematisch, Dreisatz
 ,
,was ich von die halte ?
Genau, du bist ein dufter Typ.

GO
@ goldonly
tja, für den Dreisatz hat´s vielleicht gereicht,
aber gab es zu Deiner Zeit schon Boolesche Algebra ?
Konradi
tja, für den Dreisatz hat´s vielleicht gereicht,
aber gab es zu Deiner Zeit schon Boolesche Algebra ?

Konradi
@konradi
"und wieso überhaupt Weltreise ?? - Hattest Du mir nicht kürzlich dringend dazu geraten,meinen Urlaub besser ausfallen zu lassen und das ganze Urlaubsgeld in Goldminenaktien anzulegen ?"
Sparen ist gegenwärtiger Konsumverzicht. Als wirtschaftliche Entschädigung für dieses Aufschieben des Konsums gibt`s den Zins. Gesetzt dem Fall die Atombombe fällt (wovon ich nicht ausgehe), kommt man nicht mehr zum zukünftigen konsumieren seines Kapitals...das wäre aus ökonomischer Sicht pure Verschwendung (genauso wie gefüllte Bordeauxflaschen zurücklassen zu müssen)....daher mein hypothethischer Einwurf mit der Weltreise.
und konradi was Hemingway betrifft: Gute Wahl! Lies bitte im Anschluß mal den Moby Dick in voller Länge (paßt zur Thematik, kann ich nur empfehlen). Ich selber bin immer noch mit meiner Proust-Lektüre beschäftigt (aktuell: Die Welt der Guermantes). Ich hoffe, daß ich diese abgeschlossen habe, bevor dieser Winter beendet ist.
Gruß
Sovereign
"und wieso überhaupt Weltreise ?? - Hattest Du mir nicht kürzlich dringend dazu geraten,meinen Urlaub besser ausfallen zu lassen und das ganze Urlaubsgeld in Goldminenaktien anzulegen ?"
Sparen ist gegenwärtiger Konsumverzicht. Als wirtschaftliche Entschädigung für dieses Aufschieben des Konsums gibt`s den Zins. Gesetzt dem Fall die Atombombe fällt (wovon ich nicht ausgehe), kommt man nicht mehr zum zukünftigen konsumieren seines Kapitals...das wäre aus ökonomischer Sicht pure Verschwendung (genauso wie gefüllte Bordeauxflaschen zurücklassen zu müssen)....daher mein hypothethischer Einwurf mit der Weltreise.

und konradi was Hemingway betrifft: Gute Wahl! Lies bitte im Anschluß mal den Moby Dick in voller Länge (paßt zur Thematik, kann ich nur empfehlen). Ich selber bin immer noch mit meiner Proust-Lektüre beschäftigt (aktuell: Die Welt der Guermantes). Ich hoffe, daß ich diese abgeschlossen habe, bevor dieser Winter beendet ist.
Gruß
Sovereign
Aus einem anderen Forum:
Probleme für jene die Hauskäufe mit einer LV getätigt haben??
Tilgungen drohen zu platzen
Hauskäufe, die mit Lebensversicherungen finanziert wurden, sind einsturzgefährdet
Stuttgart - Hält die finanzielle Krise der Lebensversicherer weiter an, dürften die Folgen für Hunderttausende Immobilienkäufer hart werden. Und zwar für all diejenigen, die ihre Wohnung über eine Lebensversicherung finanziert haben. Sie müssen damit rechnen, dass sie bei Ende der Laufzeit viel weniger herausbekommen als erhofft. Sollten die Assekuranzen auf Dauer deutlich weniger ausschütten, wird das Geld bei vielen Kunden nicht mehr reichen, den Kredit wie geplant auf einen Schlag zu tilgen.
„Da können noch ganz gewaltige Zeitbomben schlummern“, befürchtet Peter Grieble, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er rechnet damit, dass 2003 „etliche Versicherer noch an den Rand der Pleite“ kommen. Nach Ansicht vieler Experten verspricht die Branche den Versicherten immer noch zu hohe Renditen. Und das, obwohl auch im vergangenen Jahr eine Assekuranz nach der anderen die Überschussbeteiligung senkte.
Im Schnitt liegt die Rendite derzeit bei etwa fünf Prozent. Bis zu sieben Prozent und mehr wurden noch in den Jahren 1999 und 2000 bei Neuabschlüssen vorgerechnet. Ein paar Prozent Differenz klingen nicht so dramatisch - können es aber sein, wie ein Beispiel des Bundesverbands der Verbraucherzentralen verdeutlicht: Gibt es auf 30 Jahre Laufzeit 5,5 statt 6,8 Prozent Rendite, kann die Ablaufleistung um bis zu ein Drittel schrumpfen.
Sollten die Renditen weiter absinken und womöglich nur noch den Garantiezins von 3,25 Prozent einbringen, könnten Tausende Baufinanzierungen ins Wanken geraten. „Wer sich beim Kauf hundertprozentig auf die schönen Prognosen der Versicherer verlassen hat, kann am Ende auf einem ganzen Berg Restschulden sitzen bleiben“, warnt Grieble.
Einen eleganten Ausweg aus der Misere gibt es nicht. Was derzeit bleibt ist nach Ansicht Griebles nur Folgendes, nämlich zu hoffen, dass die Märkte bald nach oben gehen, und Notgroschen zurücklegen. Um ihr Häuschen zu retten, sollten Betroffene auf keinen Fall panikartig ihren Vertrag kündigen. In den allermeisten Fällen bringe das nur hohe Verluste, betont Grieble. Außerdem bleiben bisher erzielte Überschüsse ja erhalten. „Wer noch fünf, acht oder zehn Jahre Laufzeit vor sich hat, braucht aber gerade diese Jahre, um auf eine vernünftige Rendite zu kommen“, gibt der Verbraucherschützer zu bedenken.
Nur im Einzelfall, vor allem in den ersten Jahren der Laufzeit, kann es sich lohnen, die Police aufzukündigen. Wer den Ausstieg erwägt, sollte sich von seiner Assekuranz die aktuelle Überschussprognose sowie den Rückkaufswert vorrechnen lassen.
Verbraucherzentralen helfen bei der Entscheidung, den Vertrag weiterlaufen zu lassen oder nicht. Wenig empfehlenswert ist es, eine Verkürzung der Laufzeit anzustreben, meint Grieble. So komme man zwar ohne Stornogebühr früher aus dem Vertrag heraus, müsse allerdings mit einer niedrigeren Durchschnittsrendite rechnen. Auch eine Stilllegung der Police sei wenig ratsam.
Wer bei Abschluss des Vertrags vom Versicherungsvertreter nicht auf die Risiken des Finanzierungsmodells hingewiesen wurde und dies nachweisen kann, kann wegen „Falschberatung“ in die Offensive gehen. Der Versicherer haftet für die Fehler seiner Vermittler. „Diesen Weg gehen falsch Beratene viel zu selten“, meint der Verbraucherschützer. AP
Probleme für jene die Hauskäufe mit einer LV getätigt haben??
Tilgungen drohen zu platzen
Hauskäufe, die mit Lebensversicherungen finanziert wurden, sind einsturzgefährdet
Stuttgart - Hält die finanzielle Krise der Lebensversicherer weiter an, dürften die Folgen für Hunderttausende Immobilienkäufer hart werden. Und zwar für all diejenigen, die ihre Wohnung über eine Lebensversicherung finanziert haben. Sie müssen damit rechnen, dass sie bei Ende der Laufzeit viel weniger herausbekommen als erhofft. Sollten die Assekuranzen auf Dauer deutlich weniger ausschütten, wird das Geld bei vielen Kunden nicht mehr reichen, den Kredit wie geplant auf einen Schlag zu tilgen.
„Da können noch ganz gewaltige Zeitbomben schlummern“, befürchtet Peter Grieble, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er rechnet damit, dass 2003 „etliche Versicherer noch an den Rand der Pleite“ kommen. Nach Ansicht vieler Experten verspricht die Branche den Versicherten immer noch zu hohe Renditen. Und das, obwohl auch im vergangenen Jahr eine Assekuranz nach der anderen die Überschussbeteiligung senkte.
Im Schnitt liegt die Rendite derzeit bei etwa fünf Prozent. Bis zu sieben Prozent und mehr wurden noch in den Jahren 1999 und 2000 bei Neuabschlüssen vorgerechnet. Ein paar Prozent Differenz klingen nicht so dramatisch - können es aber sein, wie ein Beispiel des Bundesverbands der Verbraucherzentralen verdeutlicht: Gibt es auf 30 Jahre Laufzeit 5,5 statt 6,8 Prozent Rendite, kann die Ablaufleistung um bis zu ein Drittel schrumpfen.
Sollten die Renditen weiter absinken und womöglich nur noch den Garantiezins von 3,25 Prozent einbringen, könnten Tausende Baufinanzierungen ins Wanken geraten. „Wer sich beim Kauf hundertprozentig auf die schönen Prognosen der Versicherer verlassen hat, kann am Ende auf einem ganzen Berg Restschulden sitzen bleiben“, warnt Grieble.
Einen eleganten Ausweg aus der Misere gibt es nicht. Was derzeit bleibt ist nach Ansicht Griebles nur Folgendes, nämlich zu hoffen, dass die Märkte bald nach oben gehen, und Notgroschen zurücklegen. Um ihr Häuschen zu retten, sollten Betroffene auf keinen Fall panikartig ihren Vertrag kündigen. In den allermeisten Fällen bringe das nur hohe Verluste, betont Grieble. Außerdem bleiben bisher erzielte Überschüsse ja erhalten. „Wer noch fünf, acht oder zehn Jahre Laufzeit vor sich hat, braucht aber gerade diese Jahre, um auf eine vernünftige Rendite zu kommen“, gibt der Verbraucherschützer zu bedenken.
Nur im Einzelfall, vor allem in den ersten Jahren der Laufzeit, kann es sich lohnen, die Police aufzukündigen. Wer den Ausstieg erwägt, sollte sich von seiner Assekuranz die aktuelle Überschussprognose sowie den Rückkaufswert vorrechnen lassen.
Verbraucherzentralen helfen bei der Entscheidung, den Vertrag weiterlaufen zu lassen oder nicht. Wenig empfehlenswert ist es, eine Verkürzung der Laufzeit anzustreben, meint Grieble. So komme man zwar ohne Stornogebühr früher aus dem Vertrag heraus, müsse allerdings mit einer niedrigeren Durchschnittsrendite rechnen. Auch eine Stilllegung der Police sei wenig ratsam.
Wer bei Abschluss des Vertrags vom Versicherungsvertreter nicht auf die Risiken des Finanzierungsmodells hingewiesen wurde und dies nachweisen kann, kann wegen „Falschberatung“ in die Offensive gehen. Der Versicherer haftet für die Fehler seiner Vermittler. „Diesen Weg gehen falsch Beratene viel zu selten“, meint der Verbraucherschützer. AP
Gerade zum Thema Immos als Krisensicherung hatte ich ein Gespräch mit einem "höheren" Angestellten einer "renomierten" Bank mit Sitz u.a. in Frankfurt.
Der erzählte mir, daß spätestens ab 2007 mit gewaltigen Einbrüchen zu rechnen sei.
Begründung: Vor allem 1997 seien zur Häuslefinanzierung (da waren die Preise auch noch ganz andere) sehr zinsgünstige Kredite gewährt worden (siehe Sparda-Bank). Die Zinsrate ist dabei auf maximal 10 Jahre Laufzeit festgeschrieben worden. Diese Kredite wurden wohl auch völlig ausgegeben (u.a. für "Wertanlagen" wie teure Küche, Autos usw...).
So, was passiert, wenn spätestens 2007 die Zinsen dem angemessenen Niveau angehoben werden? Glaubt dann noch jemand wirklich an günstige Zinsen? Bei der verfahrenen wirtschaftlichen Situation?
Die meisten Häuslebauer haben doch jetzt schon große Probleme ihre Raten zu zahlen (immer die Arbeitslosenrate im Hinterkopf). Wenn jemand zum Beispiel seinerzeit 250.000 DM aufgenommen hat, kann der- oder diejenige sich ausrechnen was blüht, wenn das Zinsniveau dann um ein bis zwei Prozentpunkte angehoben wird...
Just my view!
Grüße,
Waschbär
Der erzählte mir, daß spätestens ab 2007 mit gewaltigen Einbrüchen zu rechnen sei.
Begründung: Vor allem 1997 seien zur Häuslefinanzierung (da waren die Preise auch noch ganz andere) sehr zinsgünstige Kredite gewährt worden (siehe Sparda-Bank). Die Zinsrate ist dabei auf maximal 10 Jahre Laufzeit festgeschrieben worden. Diese Kredite wurden wohl auch völlig ausgegeben (u.a. für "Wertanlagen" wie teure Küche, Autos usw...).
So, was passiert, wenn spätestens 2007 die Zinsen dem angemessenen Niveau angehoben werden? Glaubt dann noch jemand wirklich an günstige Zinsen? Bei der verfahrenen wirtschaftlichen Situation?
Die meisten Häuslebauer haben doch jetzt schon große Probleme ihre Raten zu zahlen (immer die Arbeitslosenrate im Hinterkopf). Wenn jemand zum Beispiel seinerzeit 250.000 DM aufgenommen hat, kann der- oder diejenige sich ausrechnen was blüht, wenn das Zinsniveau dann um ein bis zwei Prozentpunkte angehoben wird...
Just my view!
Grüße,
Waschbär
.
Dramatisches Loch in US-Haushalt erwartet
Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (Congressional Budget Office - CBO) hat seine Prognosen für den amerikanischen Staatshaushalt am Mittwoch drastisch nach unten korrigiert. Dabei wurden nicht alle Risiken berücksichtigt.
Die unabhängige Einrichtung des Kongresses errechnete ein Haushaltsdefizit für das laufende Jahr von 199 Mrd. $ (183 Mrd. Euro) und von 149 Mrd. $ im kommenden Jahr. Damit fällt das Loch weitaus größer aus, als von der US-Regierung einkalkuliert. Die neuen Zahlen, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen, belegen den jüngsten Rückgang der seit zwei Jahren sinkenden Staatseinnahmen. Im August war die für 2003 errechnete Staatsverschuldung noch um 54 Mrd. $ geringer ausgefallen.
Im Jahr 2007 übersteigen die Einnahmen der Prognose zufolge die Ausgaben erstmals wieder, und zwar um 26 Mrd. $. Für die kommenden zehn Jahre, beginnend mit dem Jahr 2003, rechnet das CBO insgesamt mit einem Überschuss von 629 Mrd. $. Im August lag der errechnete Überschuss noch bei einer Billion $, im September 2000 bei mehr als drei Billionen $ bis zum Jahr 2010.
Weitere Risiken
Die tatsächlichen Zahlen dürften noch weit düsterer ausfallen, als vom CBO errechnet. Nicht berücksichtigt wurden das Konjunkturprogramm des amerikanischen Präsidenten George W. Bush, das in den kommenden zehn Jahren 674 Mrd. $ kosten soll, sowie ein möglicher Irak-Krieg.
In die Kasse des US-Verteidigungsministeriums riss besonders der Kampf gegen den Terrorismus ein großes Loch. Der Rechnungsprüfer des Pentagons, Dov Zakheim, sagte AP am Dienstag, die Lücke im Haushalt belaufe sich auf mindestens 15 Mrd. $ und müsse schnell geschlossen werden. Andernfalls müsse bei Truppenübungen, beispielsweise Trainingsflügen für Piloten, gespart werden.
Weiter verschärft hat sich die finanzielle Lage des Pentagons durch den Truppenaufmarsch am Persischen Golf. Die Kosten dafür könnten nicht genau beziffert werden, sagte Zakheim. "Das ändert sich fast täglich." Dramatisch anwachsen könnte das Haushaltsloch des Verteidigungsministeriums, wenn es zu einem Krieg gegen Irak kommt. Die Höhe der Ausgaben hänge von der Dauer des Krieges und den Verlusten ab, sagte Zakheim.
Das Investmenthaus Goldman Sachs prognostiziert nun für das im September 2004 endende Fiskaljahr einen Fehlbetrag im US-Bundeshaushalt von 375 Mrd. $ - der höchste Stand seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Damit bekommt der Trend zu immer höheren US-Staatsdefiziten eine neue Dimension, die Parallelen zur Situation Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre aufweist. Damals hatte die US-Wirtschaft mit enormen Defiziten im Staatshaushalt sowie im Außenhandel zu kämpfen.
Noch im Jahr 2000 hatte es im Bundesbudget einen Überschuss von 236 Mrd. $ gegeben. Dieser ist seitdem aufgezehrt worden durch die Rezession, massive Steuersenkungen und eine drastischen Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Das US-Leistungsbilanzdefizit gegenüber dem Ausland ist zugleich auf etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen.
Den bisherigen Höchststand hatte das US-Staatsdefizit 1992 erreicht - im letzten Amtsjahr von George Bush, dem Vater des heutigen Präsidenten. Damals war der Wert auf 290 Mrd. $ geklettert. Gemessen am BIP würde das von Goldman Sachs für 2004 erwartete Bundesdefizit mit einem Wert von 3,5 Prozent allerdings noch unter dem Wert von 1993 bleiben, als der Staatshaushalt ein Minus von 3,9 Prozent des BIP aufwies.
In gesamtstaatlicher Rechnung, bei der auch die Finanzen von Bundesstaaten und Kommunen berücksichtigt werden, liegt das US-Defizit 2004 laut Goldman Sachs allerdings bei 5,5 Prozent des BIP. Dieser Wert ist am ehesten mit der in Europa als Referenz geltenden Abgrenzung des Maastrichter Vertrags vergleichbar.
Defizit durch Steuersenkung
Die Experten rechnen damit, dass der Konflikt im Nahen Osten den Staatshaushalt etwa 50 Mrd. $ kostet; dies belaste den Etat größtenteils 2003. Diese Annahme über die Kriegskosten deckt sich mit den Projektionen der US-Regierung. Wissenschaftler wie William Nordhaus von der Yale University sagen jedoch wesentlich höhere Kriegskosten voraus.
Bereits in den Haushaltsdaten für Dezember 2002 zeigt sich der zunehmende Druck auf das Budget. Nach Angaben des Finanzministeriums wies der Etat zwar einen Überschuss von 4,4 Mrd. $ auf. Dies ist Experten zufolge jedoch allein auf saisonale Faktoren wie zum Jahresende fällige Steuern zurückzuführen. Gegenüber dem saisonal vergleichbaren Wert von Dezember 2001 (26,6 Mrd. $) ergibt sich dagegen ein drastischer Rückgang des Überschusses.
Auf Basis dieser Daten schätzen die Ökonomen der Deka-Bank das Defizit im Kalenderjahr 2002 insgesamt auf 300 Mrd. $ oder etwa 3,0 Prozent des BIP. 2001 hatte der Fehlbetrag nur 0,5 Prozent erreicht.
Zinsen langfristig höher
Volkswirte befürchten, dass sich die Verschlechterung bald in höheren langfristigen Zinsen niederschlägt. "Derzeit wird das steigende Angebot an Staatsanleihen noch dadurch kompensiert, dass sich die Privaten wegen der flauen Konjunktur mit Emissionen zurückhalten", sagte Jan Hatzius von Goldman Sachs. Wenn das Wachstum anziehe, könnten die Zinsen "scharf nach oben gehen".
Ähnlich äußerte sich Guido Zimmermann von der Deka-Bank. Auch in der Reagan-Ära seien die Realzinsen wegen der Defizite drastisch gestiegen. Die genaue Reaktion der Zinsen ist unter Ökonomen indes umstritten. Bushs Wirtschaftsberater Glenn Hubbard hatte unlängst argumentiert, dass höhere Budgetdefizite keinen Zinsanstieg zur Folge hätten. Höhere Zinsen verschlechtern die Finanzierung der Firmen.
Unklar ist nach Einschätzung der Experten auch, wie die US-Notenbank reagiert. Nach Einschätzung von Stephen Gallagher von der Société Générale ist "angesichts der Haushaltslage unwahrscheinlich, dass die Fed die von George W. Bush geplanten Steuersenkungen einfach so hinnimmt." Der Fed-Gouverneur Edward Gramlich hatte unlängst die Vorteile eines langfristig ausgeglichenen Haushalts ausdrücklich betont, was als Warnsignal an die US-amerikanische Regierung interpretiert worden war.
Weil dem höheren Etatdefizit eine gesamtwirtschaftlich niedrigere Ersparnis gegenübersteht, könnte es Experten zufolge auch das US-Leistungsbilanzdefizit weiter steigen lassen. Der wachsende Fehlbetrag gegenüber dem Ausland birgt das Risiko eines Dollar-Einbruchs, der zu einer Belastung für die gesamte Weltwirtschaft werden könnte.
FTD 29.01.2003
Die Kriegsszenarien der Investoren
Von Kai Lange
Ein Militärschlag gegen den Irak wird immer wahrscheinlicher. Experten rechnen mit einem US-Angriff im Februar. Börsianer spielen Kriegsszenarien und ihre Folgen durch.
Die Diskussion ist ebenso nüchtern wie zynisch. Ähnlich wie zu Zeiten des Golfkriegs, als die "chirurgischen Treffer" der US-Streitkräfte während der Video-Pressekonferenz vorgeführt und beklatscht wurden, treten die menschlichen Opfer in den Hintergrund.
Bestimmend für Volkswirte und Marktstrategen, die über Krieg und seine Auswirkungen reden, ist vor allem der Ölpreis: Teures Öl treibt die Inflation, sorgt für Zurückhaltung beim privaten Konsum und bremst die Investitionen der Unternehmen – mit allen Konsequenzen für Weltwirtschaft und Aktienmärkte. Die feinen Unterscheidungen, die die Bush-Administration zwischen den "Schurkenstaaten" Irak und Nord-Korea macht, beruhen auch auf der Tatsache, dass der Irak über riesige Ölvorräte verfügt. Wer über Krieg und Konjunktur redet, spricht also über Öl.
Beispiel Kuweit: Ölpreis fährt Achterbahn
Historische Vergleiche sind schnell zur Hand. Als irakische Truppen im August 1990 in Kuweit einmarschierten, stieg der Preis pro Barrel (159-Liter-Fass) kurzzeitig von 22 auf 40 Dollar, fiel dann aber rasch wieder ab. Als am 17. Januar 1991 die US-Streitkräfte mit der "Operation Wüstensturm" begannen, fiel der Ölpreis wieder auf das Ursprungsniveau von 22 Dollar zurück.
Ein solches Szenario halten Volkswirte auch diesmal für wahrscheinlich. Deshalb wird bereits jetzt eine zusätzliche "Risikoprämie" auf Öl bezahlt. Der Preis pro Barrel ist inzwischen auf mehr als 32 Dollar gestiegen. Eine Entspannung am Golf oder ein schneller Sieg der US-Truppen dürfte den Ölpreis innerhalb kurzer Zeit in den Keller drücken.
Das Basisszenario lautet Krieg
Das Basisszenario, vom dem die meisten Beobachter inzwischen ausgehen, lautet Krieg. Eine Entspannung am Golf würde den Ölpreis sehr rasch von seinem aktuellen Niveau herunterholen – schließlich hadert das Opec-Kartell derzeit eher mit dem Problem eines Überangebotes. "Die Rohstoffmärkte haben eine Unterbrechung der Lieferungen bereits vorweggenommen", meint Neil Williams, Stratege von Goldman Sachs. Wird der Krieg am Golf vermieden, dürfte der Ölpreis nach unten durchsacken und damit gleichzeitig den Aktienkursen Auftrieb geben.
Spanne von drei Wochen bis sechs Monate
Mit einer friedlichen Lösung rechnen angesichts der immer schärferen Töne zwischen Washington und Bagdad nur noch Optimisten. Am Montag, 27. Januar, legen die UN-Waffeninspektoren einen Zwischenbericht vor. Es ist mehr als zweifelhaft, dass die USA auf Grund dieses Berichtes die Gefahr gebannt sehen. Der Aufmarsch am Golf geht weiter: Militärstrategen diskutieren nicht mehr über das Ob, sondern über das Wann.
Beobachter rechnen mit einem Angriff Mitte Februar. Je später der Angriff, desto wärmer die Temperaturen und desto größer die Belastungen für die Truppe. Dass die USA am Ende als Sieger dastehen, scheint außer Frage: Sie haben ihre militärische Überlegenheit seit 1990 potenziert, während der Irak durch das Nachkriegsembargo weiter geschwächt wurde. Über die Dauer des Waffengangs herrscht dagegen weniger Einigkeit. Die Spanne reicht von drei Wochen bis zu mehreren Monaten.
Kuweit-Vergleich hinkt
Anleger, die kurz nach Beginn des Krieges mit einer fulminanten und nachhaltigen Rallye am Aktienmarkt rechnen, sollten vorsichtig sein. Der Blick zurück auf "Desert Storm" kann in die Irre führen: Nicht immer wiederholt sich die Geschichte, und ein schneller Sieg der US-Truppen ist keineswegs ausgemacht.
Zweiter Risikofaktor: Diesmal spielt sich das Säbelrasseln am Golf während einer weltwirtschaftlichen Schwächephase ab. Die Unternehmen bremsen, die US-Bürger haben Angst um ihren Job und sind auch auf Grund der herben Verluste am Aktienmarkt vorsichtiger geworden. Die US-Konjunktur ist instabil, schon geringe Erschütterungen können sie zurück in die Rezession werfen.
Die Bush-Administration hat seit dem 9. November 2001 mit Steuersenkungen im Wert von 130 Milliarden Dollar dagegengehalten. Die US-Notenbank hat mit einer Zinssenkungsorgie versucht, die Ausgaben bei Konsumenten und Unternehmen zu stimulieren. Bislang mit dürftigem Erfolg. Nun soll es ein gigantisches Konjunkturprogramm richten.
Sollte sich ein Krieg am Golf in die Länge ziehen, haben Regierung und Notenbank kaum noch Mittel, die wachsende Verunsicherung zu dämpfen. Ein schneller Erfolg muss her, sonst kommt der Double Dip.
Hoffen auf ein schnelles Ende
Die Anlagestrategen der Deutschen Bank rechnen in ihrem "wahrscheinlichen Szenario" mit einem schnellen Ende des Krieges. Dies bedeute, dass der Ölpreis nur für kurze Zeit auf etwa 35 Dollar steigen und dann schnell wieder Richtung 20-Dollar-Marke sinken wird. Ein militärischer Erfolg der USA dürfte dazu führen, dass das Vertrauen der US-Verbraucher wieder deutlich steigt und damit die Konsumausgaben klettern.
Dann hätten auch die Unternehmen wieder Anlass, mehr zu investieren: Die US-Wirtschaft könnte in diesem Szenario bereits im Jahr 2003 wieder um knapp drei Prozent wachsen, trotz der Kriegskosten von geschätzten 50 Milliarden Dollar und einem Staatsdefizit von dann 250 Milliarden Dollar.
"Buy the cannons, sell the trumpets"
Auch John Greenwood von Invesco Asset Managementsieht bei einem nur kurzen Waffengang die Rezessionsgefahr gebannt. Zwar könnten die USA auf Grund der deutlichen Kritik aus Frankreich und Deutschland nicht annährend so viele Kosten auf die Verbündeten abwälzen wie im Fall "Desert Storm". "Eine Verzögerung des Aufschwungs wäre wahrscheinlich", sagt Greenwood.
Mit einem fiskalpolitischen Schock sei trotz des steigenden Staatsdefizits aber nicht zu rechnen, da Fed-Chef Alan Greenspan die Zinssätze bereits auf ein sehr niedriges Niveau heruntergefahren hat. Selbst mit einem bescheidenen Wachstum von rund drei Prozent dürften die USA Japan und Europa hinter sich lassen.
Rückkehr zum Wachstum
Das Fazit der Strategen: Die Weltwirtschaft wird nach einem zeitlich befristeten Militärschlag am Golf bereits im Jahr 2003 langsam, aber sicher auf den Wachstumskurs zurückkehren. Die Aktienmärkte, die als Reaktion auf die ersten Bombeneinschläge zwischen zehn bis 20 Prozent nachgeben dürften, würden sich bei anziehender Konjunktur dann rasch wieder von ihren Verlusten erholen.
Die deutlichsten Gewinne würden dann die Spekulanten erzielen, die nach dem Motto "buy the cannons, sell the trumpets" bereits während der kriegsbedingten Schwächephase Aktien gekauft haben, meint Greenwood. Für Langfristanleger gilt, auch bei weiter nachgebenden Kursen nicht nervös zu werden.
Worst-Case-Szenario: Ölpreisschock und Rezession
Eine Erholung der Konjunktur im kommenden Jahr wird aber abgehakt, sollte sich der Krieg im Irak über Monate hinziehen. Die Deutsche Bank befürchtet in diesem Fall Ölpreise von bis zu 50 Dollar. Ein weiterer Kurssturz an der Börse wäre die Folge, ein Abgleiten der USA in die Rezession wahrscheinlich.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schätzt, dass ein Ölpreisschock das Bruttoinlandsprodukt der USA um 0,6 Prozent drosseln dürfte. Für den Internationalen Währungsfonds ist diese Schätzung noch sehr optimistisch, sie befürchten einen stärkeren Einbruch.
Risiken verstärken sich gegenseitig
Der Grund: Bei einem Ölpreisschock verstärken sich die Risikofaktoren für die Weltwirtschaft gegenseitig. Steigende Ölpreise, anziehende Inflation, fallende Aktiennotierungen, weniger Konsumausgaben und eine höhere Sparquote der Verbraucher sind die Elemente, die für eine Abwärtsspirale der Konjunktur sorgen.
Gernot Rumpf, Fondsmanager bei Union Investment, hält einen Ölpreis jenseits von 40 Dollar für unrealistisch, selbst wenn es zu einer langen und zähen Auseinandersetzung kommt. Aber die starke Verunsicherung der Verbraucher, Terrorangst und wachsende Sicherheitsausgaben weltweit dürften jeden Wachstumsimpuls lähmen. Die Gewinner unter den Anlegern sind dann diejenigen, die den Aktienmärkten rechtzeitig den Rücken gekehrt haben: mit Investitionen in die Krisenwährung Gold und in den Schweizer Franken.
manager-magazin 24.01.2003
Dramatisches Loch in US-Haushalt erwartet
Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (Congressional Budget Office - CBO) hat seine Prognosen für den amerikanischen Staatshaushalt am Mittwoch drastisch nach unten korrigiert. Dabei wurden nicht alle Risiken berücksichtigt.
Die unabhängige Einrichtung des Kongresses errechnete ein Haushaltsdefizit für das laufende Jahr von 199 Mrd. $ (183 Mrd. Euro) und von 149 Mrd. $ im kommenden Jahr. Damit fällt das Loch weitaus größer aus, als von der US-Regierung einkalkuliert. Die neuen Zahlen, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen, belegen den jüngsten Rückgang der seit zwei Jahren sinkenden Staatseinnahmen. Im August war die für 2003 errechnete Staatsverschuldung noch um 54 Mrd. $ geringer ausgefallen.
Im Jahr 2007 übersteigen die Einnahmen der Prognose zufolge die Ausgaben erstmals wieder, und zwar um 26 Mrd. $. Für die kommenden zehn Jahre, beginnend mit dem Jahr 2003, rechnet das CBO insgesamt mit einem Überschuss von 629 Mrd. $. Im August lag der errechnete Überschuss noch bei einer Billion $, im September 2000 bei mehr als drei Billionen $ bis zum Jahr 2010.
Weitere Risiken
Die tatsächlichen Zahlen dürften noch weit düsterer ausfallen, als vom CBO errechnet. Nicht berücksichtigt wurden das Konjunkturprogramm des amerikanischen Präsidenten George W. Bush, das in den kommenden zehn Jahren 674 Mrd. $ kosten soll, sowie ein möglicher Irak-Krieg.
In die Kasse des US-Verteidigungsministeriums riss besonders der Kampf gegen den Terrorismus ein großes Loch. Der Rechnungsprüfer des Pentagons, Dov Zakheim, sagte AP am Dienstag, die Lücke im Haushalt belaufe sich auf mindestens 15 Mrd. $ und müsse schnell geschlossen werden. Andernfalls müsse bei Truppenübungen, beispielsweise Trainingsflügen für Piloten, gespart werden.
Weiter verschärft hat sich die finanzielle Lage des Pentagons durch den Truppenaufmarsch am Persischen Golf. Die Kosten dafür könnten nicht genau beziffert werden, sagte Zakheim. "Das ändert sich fast täglich." Dramatisch anwachsen könnte das Haushaltsloch des Verteidigungsministeriums, wenn es zu einem Krieg gegen Irak kommt. Die Höhe der Ausgaben hänge von der Dauer des Krieges und den Verlusten ab, sagte Zakheim.
Das Investmenthaus Goldman Sachs prognostiziert nun für das im September 2004 endende Fiskaljahr einen Fehlbetrag im US-Bundeshaushalt von 375 Mrd. $ - der höchste Stand seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Damit bekommt der Trend zu immer höheren US-Staatsdefiziten eine neue Dimension, die Parallelen zur Situation Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre aufweist. Damals hatte die US-Wirtschaft mit enormen Defiziten im Staatshaushalt sowie im Außenhandel zu kämpfen.
Noch im Jahr 2000 hatte es im Bundesbudget einen Überschuss von 236 Mrd. $ gegeben. Dieser ist seitdem aufgezehrt worden durch die Rezession, massive Steuersenkungen und eine drastischen Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Das US-Leistungsbilanzdefizit gegenüber dem Ausland ist zugleich auf etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen.
Den bisherigen Höchststand hatte das US-Staatsdefizit 1992 erreicht - im letzten Amtsjahr von George Bush, dem Vater des heutigen Präsidenten. Damals war der Wert auf 290 Mrd. $ geklettert. Gemessen am BIP würde das von Goldman Sachs für 2004 erwartete Bundesdefizit mit einem Wert von 3,5 Prozent allerdings noch unter dem Wert von 1993 bleiben, als der Staatshaushalt ein Minus von 3,9 Prozent des BIP aufwies.
In gesamtstaatlicher Rechnung, bei der auch die Finanzen von Bundesstaaten und Kommunen berücksichtigt werden, liegt das US-Defizit 2004 laut Goldman Sachs allerdings bei 5,5 Prozent des BIP. Dieser Wert ist am ehesten mit der in Europa als Referenz geltenden Abgrenzung des Maastrichter Vertrags vergleichbar.
Defizit durch Steuersenkung
Die Experten rechnen damit, dass der Konflikt im Nahen Osten den Staatshaushalt etwa 50 Mrd. $ kostet; dies belaste den Etat größtenteils 2003. Diese Annahme über die Kriegskosten deckt sich mit den Projektionen der US-Regierung. Wissenschaftler wie William Nordhaus von der Yale University sagen jedoch wesentlich höhere Kriegskosten voraus.
Bereits in den Haushaltsdaten für Dezember 2002 zeigt sich der zunehmende Druck auf das Budget. Nach Angaben des Finanzministeriums wies der Etat zwar einen Überschuss von 4,4 Mrd. $ auf. Dies ist Experten zufolge jedoch allein auf saisonale Faktoren wie zum Jahresende fällige Steuern zurückzuführen. Gegenüber dem saisonal vergleichbaren Wert von Dezember 2001 (26,6 Mrd. $) ergibt sich dagegen ein drastischer Rückgang des Überschusses.
Auf Basis dieser Daten schätzen die Ökonomen der Deka-Bank das Defizit im Kalenderjahr 2002 insgesamt auf 300 Mrd. $ oder etwa 3,0 Prozent des BIP. 2001 hatte der Fehlbetrag nur 0,5 Prozent erreicht.
Zinsen langfristig höher
Volkswirte befürchten, dass sich die Verschlechterung bald in höheren langfristigen Zinsen niederschlägt. "Derzeit wird das steigende Angebot an Staatsanleihen noch dadurch kompensiert, dass sich die Privaten wegen der flauen Konjunktur mit Emissionen zurückhalten", sagte Jan Hatzius von Goldman Sachs. Wenn das Wachstum anziehe, könnten die Zinsen "scharf nach oben gehen".
Ähnlich äußerte sich Guido Zimmermann von der Deka-Bank. Auch in der Reagan-Ära seien die Realzinsen wegen der Defizite drastisch gestiegen. Die genaue Reaktion der Zinsen ist unter Ökonomen indes umstritten. Bushs Wirtschaftsberater Glenn Hubbard hatte unlängst argumentiert, dass höhere Budgetdefizite keinen Zinsanstieg zur Folge hätten. Höhere Zinsen verschlechtern die Finanzierung der Firmen.
Unklar ist nach Einschätzung der Experten auch, wie die US-Notenbank reagiert. Nach Einschätzung von Stephen Gallagher von der Société Générale ist "angesichts der Haushaltslage unwahrscheinlich, dass die Fed die von George W. Bush geplanten Steuersenkungen einfach so hinnimmt." Der Fed-Gouverneur Edward Gramlich hatte unlängst die Vorteile eines langfristig ausgeglichenen Haushalts ausdrücklich betont, was als Warnsignal an die US-amerikanische Regierung interpretiert worden war.
Weil dem höheren Etatdefizit eine gesamtwirtschaftlich niedrigere Ersparnis gegenübersteht, könnte es Experten zufolge auch das US-Leistungsbilanzdefizit weiter steigen lassen. Der wachsende Fehlbetrag gegenüber dem Ausland birgt das Risiko eines Dollar-Einbruchs, der zu einer Belastung für die gesamte Weltwirtschaft werden könnte.
FTD 29.01.2003
Die Kriegsszenarien der Investoren
Von Kai Lange
Ein Militärschlag gegen den Irak wird immer wahrscheinlicher. Experten rechnen mit einem US-Angriff im Februar. Börsianer spielen Kriegsszenarien und ihre Folgen durch.
Die Diskussion ist ebenso nüchtern wie zynisch. Ähnlich wie zu Zeiten des Golfkriegs, als die "chirurgischen Treffer" der US-Streitkräfte während der Video-Pressekonferenz vorgeführt und beklatscht wurden, treten die menschlichen Opfer in den Hintergrund.
Bestimmend für Volkswirte und Marktstrategen, die über Krieg und seine Auswirkungen reden, ist vor allem der Ölpreis: Teures Öl treibt die Inflation, sorgt für Zurückhaltung beim privaten Konsum und bremst die Investitionen der Unternehmen – mit allen Konsequenzen für Weltwirtschaft und Aktienmärkte. Die feinen Unterscheidungen, die die Bush-Administration zwischen den "Schurkenstaaten" Irak und Nord-Korea macht, beruhen auch auf der Tatsache, dass der Irak über riesige Ölvorräte verfügt. Wer über Krieg und Konjunktur redet, spricht also über Öl.
Beispiel Kuweit: Ölpreis fährt Achterbahn
Historische Vergleiche sind schnell zur Hand. Als irakische Truppen im August 1990 in Kuweit einmarschierten, stieg der Preis pro Barrel (159-Liter-Fass) kurzzeitig von 22 auf 40 Dollar, fiel dann aber rasch wieder ab. Als am 17. Januar 1991 die US-Streitkräfte mit der "Operation Wüstensturm" begannen, fiel der Ölpreis wieder auf das Ursprungsniveau von 22 Dollar zurück.
Ein solches Szenario halten Volkswirte auch diesmal für wahrscheinlich. Deshalb wird bereits jetzt eine zusätzliche "Risikoprämie" auf Öl bezahlt. Der Preis pro Barrel ist inzwischen auf mehr als 32 Dollar gestiegen. Eine Entspannung am Golf oder ein schneller Sieg der US-Truppen dürfte den Ölpreis innerhalb kurzer Zeit in den Keller drücken.
Das Basisszenario lautet Krieg
Das Basisszenario, vom dem die meisten Beobachter inzwischen ausgehen, lautet Krieg. Eine Entspannung am Golf würde den Ölpreis sehr rasch von seinem aktuellen Niveau herunterholen – schließlich hadert das Opec-Kartell derzeit eher mit dem Problem eines Überangebotes. "Die Rohstoffmärkte haben eine Unterbrechung der Lieferungen bereits vorweggenommen", meint Neil Williams, Stratege von Goldman Sachs. Wird der Krieg am Golf vermieden, dürfte der Ölpreis nach unten durchsacken und damit gleichzeitig den Aktienkursen Auftrieb geben.
Spanne von drei Wochen bis sechs Monate
Mit einer friedlichen Lösung rechnen angesichts der immer schärferen Töne zwischen Washington und Bagdad nur noch Optimisten. Am Montag, 27. Januar, legen die UN-Waffeninspektoren einen Zwischenbericht vor. Es ist mehr als zweifelhaft, dass die USA auf Grund dieses Berichtes die Gefahr gebannt sehen. Der Aufmarsch am Golf geht weiter: Militärstrategen diskutieren nicht mehr über das Ob, sondern über das Wann.
Beobachter rechnen mit einem Angriff Mitte Februar. Je später der Angriff, desto wärmer die Temperaturen und desto größer die Belastungen für die Truppe. Dass die USA am Ende als Sieger dastehen, scheint außer Frage: Sie haben ihre militärische Überlegenheit seit 1990 potenziert, während der Irak durch das Nachkriegsembargo weiter geschwächt wurde. Über die Dauer des Waffengangs herrscht dagegen weniger Einigkeit. Die Spanne reicht von drei Wochen bis zu mehreren Monaten.
Kuweit-Vergleich hinkt
Anleger, die kurz nach Beginn des Krieges mit einer fulminanten und nachhaltigen Rallye am Aktienmarkt rechnen, sollten vorsichtig sein. Der Blick zurück auf "Desert Storm" kann in die Irre führen: Nicht immer wiederholt sich die Geschichte, und ein schneller Sieg der US-Truppen ist keineswegs ausgemacht.
Zweiter Risikofaktor: Diesmal spielt sich das Säbelrasseln am Golf während einer weltwirtschaftlichen Schwächephase ab. Die Unternehmen bremsen, die US-Bürger haben Angst um ihren Job und sind auch auf Grund der herben Verluste am Aktienmarkt vorsichtiger geworden. Die US-Konjunktur ist instabil, schon geringe Erschütterungen können sie zurück in die Rezession werfen.
Die Bush-Administration hat seit dem 9. November 2001 mit Steuersenkungen im Wert von 130 Milliarden Dollar dagegengehalten. Die US-Notenbank hat mit einer Zinssenkungsorgie versucht, die Ausgaben bei Konsumenten und Unternehmen zu stimulieren. Bislang mit dürftigem Erfolg. Nun soll es ein gigantisches Konjunkturprogramm richten.
Sollte sich ein Krieg am Golf in die Länge ziehen, haben Regierung und Notenbank kaum noch Mittel, die wachsende Verunsicherung zu dämpfen. Ein schneller Erfolg muss her, sonst kommt der Double Dip.
Hoffen auf ein schnelles Ende
Die Anlagestrategen der Deutschen Bank rechnen in ihrem "wahrscheinlichen Szenario" mit einem schnellen Ende des Krieges. Dies bedeute, dass der Ölpreis nur für kurze Zeit auf etwa 35 Dollar steigen und dann schnell wieder Richtung 20-Dollar-Marke sinken wird. Ein militärischer Erfolg der USA dürfte dazu führen, dass das Vertrauen der US-Verbraucher wieder deutlich steigt und damit die Konsumausgaben klettern.
Dann hätten auch die Unternehmen wieder Anlass, mehr zu investieren: Die US-Wirtschaft könnte in diesem Szenario bereits im Jahr 2003 wieder um knapp drei Prozent wachsen, trotz der Kriegskosten von geschätzten 50 Milliarden Dollar und einem Staatsdefizit von dann 250 Milliarden Dollar.
"Buy the cannons, sell the trumpets"
Auch John Greenwood von Invesco Asset Managementsieht bei einem nur kurzen Waffengang die Rezessionsgefahr gebannt. Zwar könnten die USA auf Grund der deutlichen Kritik aus Frankreich und Deutschland nicht annährend so viele Kosten auf die Verbündeten abwälzen wie im Fall "Desert Storm". "Eine Verzögerung des Aufschwungs wäre wahrscheinlich", sagt Greenwood.
Mit einem fiskalpolitischen Schock sei trotz des steigenden Staatsdefizits aber nicht zu rechnen, da Fed-Chef Alan Greenspan die Zinssätze bereits auf ein sehr niedriges Niveau heruntergefahren hat. Selbst mit einem bescheidenen Wachstum von rund drei Prozent dürften die USA Japan und Europa hinter sich lassen.
Rückkehr zum Wachstum
Das Fazit der Strategen: Die Weltwirtschaft wird nach einem zeitlich befristeten Militärschlag am Golf bereits im Jahr 2003 langsam, aber sicher auf den Wachstumskurs zurückkehren. Die Aktienmärkte, die als Reaktion auf die ersten Bombeneinschläge zwischen zehn bis 20 Prozent nachgeben dürften, würden sich bei anziehender Konjunktur dann rasch wieder von ihren Verlusten erholen.
Die deutlichsten Gewinne würden dann die Spekulanten erzielen, die nach dem Motto "buy the cannons, sell the trumpets" bereits während der kriegsbedingten Schwächephase Aktien gekauft haben, meint Greenwood. Für Langfristanleger gilt, auch bei weiter nachgebenden Kursen nicht nervös zu werden.
Worst-Case-Szenario: Ölpreisschock und Rezession
Eine Erholung der Konjunktur im kommenden Jahr wird aber abgehakt, sollte sich der Krieg im Irak über Monate hinziehen. Die Deutsche Bank befürchtet in diesem Fall Ölpreise von bis zu 50 Dollar. Ein weiterer Kurssturz an der Börse wäre die Folge, ein Abgleiten der USA in die Rezession wahrscheinlich.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schätzt, dass ein Ölpreisschock das Bruttoinlandsprodukt der USA um 0,6 Prozent drosseln dürfte. Für den Internationalen Währungsfonds ist diese Schätzung noch sehr optimistisch, sie befürchten einen stärkeren Einbruch.
Risiken verstärken sich gegenseitig
Der Grund: Bei einem Ölpreisschock verstärken sich die Risikofaktoren für die Weltwirtschaft gegenseitig. Steigende Ölpreise, anziehende Inflation, fallende Aktiennotierungen, weniger Konsumausgaben und eine höhere Sparquote der Verbraucher sind die Elemente, die für eine Abwärtsspirale der Konjunktur sorgen.
Gernot Rumpf, Fondsmanager bei Union Investment, hält einen Ölpreis jenseits von 40 Dollar für unrealistisch, selbst wenn es zu einer langen und zähen Auseinandersetzung kommt. Aber die starke Verunsicherung der Verbraucher, Terrorangst und wachsende Sicherheitsausgaben weltweit dürften jeden Wachstumsimpuls lähmen. Die Gewinner unter den Anlegern sind dann diejenigen, die den Aktienmärkten rechtzeitig den Rücken gekehrt haben: mit Investitionen in die Krisenwährung Gold und in den Schweizer Franken.
manager-magazin 24.01.2003
lesenswert: Puplava vom 28.01.03 - http://www.financialsense.com/Market/daily/tuesday.htm
14:30 - ! US Arbeitskostenindex 4. Quartal
14:30 - ! US BIP 4. Quartal
14:30 - ! US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 - ! US BIP 4. Quartal
14:30 - ! US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
.
Die Galgenfrist
Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch abwenden können
Von Josef Joffe
Saddam hat nur einen knappen Aufschub erhalten – und Europa auch. Am Sonntag schien Außenminister Powell die Kriegsmaschinerie vom Autopiloten zu nehmen: „Die USA wollen sich nicht in den Krieg stürzen.“ Doch im Bericht zur Lage der Nation eskalierte George Bush den Nervenkrieg. Schon am 5. Februar will er den UN-Sicherheitsrat zusammenrufen, wo Powell „Beweise für das illegale Waffenprogramm“ des Irak vorlegen werde.
„Wir werden konsultieren, doch wenn Saddam sich nicht selbst entwaffnet, werden wir eine Koalition anführen, die es für ihn tut. Bedeutsamer war indes das Nichtgesagte: kein Wort zur Verlängerung der Inspektionen, kein Ja, aber auch kein Nein; also könnte die Automatik des Krieges noch Verzögerungsmomente enthalten. Mag sein, dass der Aufmarsch nicht vollendet, die Nation noch nicht überzeugt ist – vom Sicherheitsrat ganz zu schweigen. Mithin bleibt eine letzte Denk- und Diplomatiepause. Zumal die Atlantik-Anrainer, einst fest verschweißte Partner, können in den nächsten Wochen ihr verhunztes Verhältnis neu sortieren – ohne jene hochfahrenden Gesten, die nicht nur dem Don Rumsfeld anzukreiden sind.
Abrüstung per Simsalabim
Beginnen wir aber mit Saddam und dem dürren Fazit der UN-Inspektorenkompanie: Bagdad „hat anscheinend noch immer nicht die geforderte Abrüstung akzeptiert“. Man darf es beim Anblick der besenreinen Anlagen etwas sarkastischer ausdrücken. Hat Saddam nur noch Kunstdünger und Insektizide produziert, seitdem er 1998 die UN aus dem Land warf? Und wo ist das Zeug, das seinerzeit bekannt war? Tausende von Litern Anthrax und Botulin, drei Tonnen Nährlösung, 30000 Munitionshülsen, die C-Ladungen tragen können?
Powell hat Recht: „So sieht echte Entwaffnung nicht aus.“ Er verweist auf die nukleare Abrüstung Südafrikas, Kasachstans und der Ukraine. Das Geheimprogramm Pretorias wurde offen gelegt, die sieben Atombomben sichtbar verschrottet. Dito die beiden Ex-Sowjetrepubliken, die ihre Sprengköpfe nach Russland zurückschickten, ihre Raketensilos zubetonierten. Angesichts der mageren, aber nicht unbedeutenden Funde in einem Land, das größer ist als Deutschland, darf man es den Amerikanern nicht verdenken, wenn sie nun die Beweislast umkehren. Saddam muss zeigen, was er hat oder zerstört hat. Hierzulande wurde Weltkrieg-I-Senfgas Tropfen um Tropfen verbrannt, jahrzehntelang. Und Saddam will das per Simsalabim getan haben – spurenlos?
Will er seine letzte Chance nutzen, muss er die Bilanzen offen legen. Denn auf die Unschuldsvermutung darf keiner zählen, dessen Kerbholz so lang ist wie Saddams: zwei Angriffskriege, Giftgasattacken auf die Kurden und Iraner, Tod und Terror gegen Abertausende im eigenen Land. Er sollte sich aber auch nicht auf Berlin und Paris verlassen dürfen, die mit ihrem schroffen Nein (Schröder) oder schlüpfrigen non (Chirac) eine Bresche in die Druck-Kulisse geschlagen haben.
Von den Franzosen, die in diesen Tagen ihren Flugzeugträger Charles de Gaulle golfwärts entsenden, dürfen wir annehmen, dass sie spätestens dann in den Krieg eingreifen, wenn die ersten Marschflugkörper in die Bunker der Republikanergarde einschlagen. La grande nation, die seit 1781 an Amerikas Seite kämpft, wird wenigstens symbolisch mitschießen, um bei der Nachkriegsordnung mitreden zu können. C’est la vie.
Schröders Irak-Politik aber wird kaum in die Lehrbücher der Diplomatie eingehen. Dass er mit seinem „Abenteuer“-Wahlkampf im Sommer die Umfragen drehen konnte, mag man noch als wohlkalkulierte Taktik abheften. Dass er aber im Landtagswahlkampf den Wiederholungstäter gibt (Nein zu Intervention und Kriegsresolution), muss Bismarck und Stresemann im Grabe rotieren lassen. Doch ist Außenpolitik mit zwei linken Händen nicht der gröbste Kunstfehler. Denn der Kanzler muss sich fragen lassen, wohin er will.
Wenn sein Außenminister Saddam warnt, er habe „keinen Spielraum mehr für Taktik oder Ausweichmanöver“, zugleich aber „militärische Mittel“ ausschließt, fragt sich der Laie, welcher Zauberstab denn den Tiger in ein Lamm verwandeln soll.
Und wenn die Metamorphose ausbleibt? Gilt dann der Spruch: „Nehmen Sie das eventuell zurück? Nein? Dann ist die Sache für mich erledigt.“ Sollen sich doch andere mit den Schreckenswaffen des Angriffskriegers herumschlagen.
Was aber ist, wenn Schröder Größeres im Sinn hat, wenn er in der Übermacht Amerikas das größere Übel sieht als in Saddams ABC-Arsenal? Das wäre nach dem Untergang der Sowjetunion die Logik klassischer Gleichgewichtspolitik – Europa als Widerpart des befreiten Gulliver. Aber dazu müsste sich Schröder viel wärmer anziehen. Er müsste Europa hinter Berlin versammeln, dann den Amerikanern konsequent Stützpunkt- und Überflugrechte ent- und die Deutschen aus den Awacs abziehen. Doch wird ihm das Koalitions-Kunststück nicht gelingen; nicht einmal Paris wäre dabei ein zuverlässiger Bundesgenosse. Bis jetzt hat es der Kanzler nur geschafft, die alten Freunde gründlich zu provozieren. Den Riesen zu reizen, ohne ihn zu zähmen – das hätte der schlaue Hans-Dietrich Genscher nicht getan.
Eine Republik, kein Imperium
Wer den Krieg verhindern will, muss eine produktive Alternative anbieten, den USA gute Gründe liefern, damit sie von ihrem hohen Ast wieder herabsteigen. Vorweg mit einer schlichten Druckverschiebung: weg von Bush, hin zu Saddam, um ihm die Illusion zu rauben, dass die Europäer ihn vor den Amerikanern retten. Dann der Große Deal: Verzichtet auf den Krieg, dafür stehen wir fest im Eindämmungsring, der nichts mehr durchlässt – keine Vorläuferchemikalien, keine Anreicherungstechnik, keine Werkzeugmaschinen für Raketenhülsen. Notfalls patrouillieren wir zur Luft und zur See, bis der Despot seine Zähne verliert. Und wir helfen euch, Peking und Moskau einzubinden.
Und die Amerikaner? Sie müssen sich entscheiden, was sie wollen: Entwaffnung, Regimewechsel oder Demokratisierung? Ihre schwankenden Begründungen dienen nicht der Glaubwürdigkeit. Doch geht es um viel mehr – um Legitimität. Bei der Vertreibung des Kuwait-Räubers Saddam 1991 hat fast die ganze Welt mitgemacht; damals lag ein klarer Fall von Aggression vor. Heute aber fehlt neben dem „rauchenden Colt“ auch das schlagende Argument, warum Blut, Tod und Tränen die einzigen Mittel zur „Fortführung der Politik“ seien.
Rein militärisch hätten die USA ein leichtes Spiel, aber was dann? Eine geduldige, gar opferreiche Besetzung für die nächsten 40 Jahre? Nichts in ihrer jüngeren Geschichte lässt wähnen, dass diese „imperiale Republik“ (Raymond Aron) tatsächlich das Zeug zum Imperium hat. Demokratien sind ungeduldig und wankelmütig.
Doch geht die Sache noch tiefer. Wenn es Amerika nicht schafft, die Niedertracht Saddams zu offenbaren, und allein losschlägt, muss die „Hypermacht“ mit Knüppeln, nicht nur mit Schröders Stöckchen rechnen. Denn es wächst das Unbehagen an einem entfesselten Gulliver, der, wie Bush am Dienstag betonte, „seine Entscheidungen nicht anderen Nationen unterwerfen“ will. Denn schiere Macht ohne Vertrauen zeugt Gegenmacht und verwandelt Freunde in Widersacher.
Wer allein in den Krieg zieht, wird auch allein sein, wenn er den Rest der Welt für den Friedensdienst einspannen muss.
Die Welt muss wollen, dass Saddam sich doch noch beugt – schnell. Oder Amerika besser keinen, als einen einsamen Krieg führt.
---
Den Autopiloten auf Krieg gestellt
George Bush hat in seiner Rede zur Lage der Nation für einen Feldzug gegen Saddam geworben. Doch in Amerika wächst die Skepsis
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Washington
Sofern eines Tages die Geschichte des Irak-Krieges zu schreiben sein wird, können drei kleine Szenen erhellen, warum schier endlose Wirrungen dem Waffengang vorangehen. Die erste Begebenheit trägt sich am Morgen des 11. September 2001 im Bunker unter dem Weißen Haus zu. Dort sitzt, aus Sicherheitsgründen, der amerikanische Vizepräsident und telefoniert mit seinem derangierten Chef. Nebenbei schaut er fern. Als er sieht, wie das World Trade Center in sich zusammenfällt, sagt Richard Cheney: „Das alles mag unfassbar sein, aber es wäre noch viel schlimmer gekommen, hätten die Täter Massenvernichtungswaffen gehabt.“
In dieser düsteren Fantasie steckt schon der Nukleus der Doktrin vom preemptive strike, vom Präventivkrieg. Der Satz ist Vorbote jenes globalen Streits um die Frage, wem Krieg zu erklären sei: jenen, die für den Anschlag verantwortlich sind, oder auch jenen, die künftig Terror, auch nuklearen, planen könnten.
Die zweite Szene spielt vier Tage später in Camp David, dem Landsitz des Präsidenten. George Bush will mit seinen Ministern ausgiebig diskutieren. Obwohl nicht geladen, erscheint auch ein Stellvertreter, Paul Wolfowitz aus dem Verteidigungsministerium. Statt seines Chefs ergreift er das Wort und argumentiert wider die Jagd auf das Terrornetzwerk al-Qaida in Afghanistan. Als Alternative protegiert er einen Angriff auf den Irak. Vielleicht habe Saddam ja etwas mit dem Anschlag zu tun, meint Wolfowitz. Und selbst wenn nicht, könne kein Antiterror-Krieg ohne Angriff auf Saddam auskommen.
Hier bricht die obsessive Seite des Irak-Feldzugs hervor. Seit Jahren gehört Wolfowitz zum kleinen Kreis jener Revisionisten, die für einen „Regimewechsel“ im Irak trommeln. Nun nutzt er einen neuen Anlass zur Begründung einer alten Idee. Sofort widerspricht ihm Colin Powell. Die Intervention des Außenministers nimmt Amerikas weltumspannendes Kommunikationsproblem vorweg, das fortan um die Frage kreisen wird, warum Saddam eigentlich angegriffen werden soll: wegen seiner möglichen Verbrüderung mit al-Qaida? Um ihm jene Massenvernichtungswaffen zu entwinden, die er – wahrscheinlich – besitzt? Um ihn zu stürzen? Weil er UN-Resolutionen missachtet?
Der Glaube an die Mission
Die dritte Szene ist im Kongress zu beobachten, am Dienstagabend dieser Woche. Da tritt George Bush aus einer Seitentür ins Repräsentantenhaus, begrüßt und umjubelt von den Abgeordneten. So will es die Tradition, wenn der Präsident die Rede zur Lage der Nation vorträgt. Trotzdem ist nichts mehr wie im vergangenen Jahr, als die Begeisterung ihn zum Podium trug. Der Applaus ist diesmal gehörig, aber nicht mehr brausend. Ein Jahr nachdem er die „Achse des Bösen“ erfand und sich dem Projekt eines Präventivkrieges gegen den Irak hingab, ist er in die erste schwere Vertrauenskrise seit dem Anschlag vom 11. September geraten. Er hat sich verhaspelt in den Begründungen für diesen verflixten Krieg und die Kontrolle über die Debatte verloren.
Inzwischen ist das Parlament gespalten, das Land gespalten, der Westen gespalten, die Welt gespalten. Alle eint nur noch der Glaube, in Washington sei – warum auch immer – der Autopilot auf Krieg gestellt.
In dieser prekären Situation macht George Bush den Kongress zum Forum. Er will Antwort geben auf die Frage, die vielen so recht nicht beantwortet erscheint: „Warum Krieg?“ Ans Podium tritt ein Mann, der in diesem Moment nichts als eiserne Entschlossenheit ausstrahlt. Er beschreibt die Bedrohung und benennt die Konsequenz. Er erklärt nicht den Krieg, aber er kündigt ihn an. Er nennt kein Ultimatum, aber lässt keinen Zweifel, dass die Zeitspanne bis zum Kampf nur sehr klein sein kann. Seine Rede umfasst alle vertrauten Motive seiner Politik: den Glauben an die Mission Amerikas in der Welt, die Freiheitsrhetorik, die Existenz des Bösen und schließlich das Bedrohungsszenario.
Seine Furcht ist ein „Tag des Schreckens, wie wir ihn noch nie erlebt haben“, nämlich dann, wenn Terroristen oder verbrecherische Diktatoren mit Massenvernichtungswaffen zuschlagen. „Stellen Sie sich die 19 Flugzeug-Entführer mit anderen Plänen und anderen Waffen vor, diesmal bewaffnet von Saddam Hussein.“ Und dann der Satz, aus dem Politik wird: „Wir werden sicherstellen, dass dieser Tag nie kommt.“ Es ist ein Programm auf Jahrzehnte, und Saddam wäre nur der Anfang. Manche, sagt Bush, würden empfehlen zu warten, bis die Gefahr „akut“ sei.
Auf dieses Argument kontert er: „Seit wann haben Terroristen und Tyrannen angekündigt, wann sie zuschlagen? Auf die geistige Gesundheit und die Zurückhaltung von Saddam Hussein zu vertrauen, ist keine Strategie und keine Option.“ Nie zuvor hat sich der amerikanische Präsident derart entschlossen der Idee des Präventivkrieges verschrieben. Unklarheiten über seine Absichten wird es nach dieser Rede kaum mehr geben.
Allerdings ist schwer zu sagen, ob er mit diesem machtvollen Auftritt jene noch überzeugen kann, die er im ganzen vergangenen Jahr nicht hat gewinnen können. Was auf jeden Fall bleibt, sind seine Dilemmata: im Umgang mit den Militärs, mit der Öffentlichkeit, mit den Verbündeten.
Seit vergangener Woche gibt es ein Bild, das in Amerika wie kein zweites die Opposition zum Kurs George Bushs verkörpert. Es wird täglich mehrfach in den Nachrichten-Sendungen wiederholt. Es zeigt zwei Politiker vor ihren Landesflaggen. Zu sehen sind Jacques Chirac und Gerhard Schröder. Ersterer sieht „zurzeit“ keinen Grund, in den Krieg zu ziehen, letzterer gar keinen Grund. Das nennen die beiden „Übereinstimmung der Positionen“. Gegen dieses Bild von der „Achse des Widerstandes“ wird ein ganz ähnliches Bild zweier Politiker vor Landesflaggen geschnitten. Es sind ein Engländer und ein Amerikaner, die Außenminister Jack Straw und Colin Powell, die davon sprechen, „die Zeit wird knapp für den Irak“.
Sinnfälliger könnte die Spaltung des Westens nicht sein.
Im Bemühen, George Bush noch in letzter Minute zu stoppen, sind die Widerständler zugleich ihrem wichtigsten Partner in den Rücken gefallen. Denn die Schwachstelle der Regierung Bush bestand gerade in Flügelkämpfen zwischen Hardlinern und Moderaten. Die Europäer sahen in Außenminister Powell den Anwalt der Vorsicht.
Nun hat insbesondere der französische Vorfreispruch für Saddam den Außenminister desavouiert. Dessen eigene Mitarbeiter meinen jetzt, Deutschland und Frankreich würden nur immer neue Gründe suchen, warum die Inspektionen fortdauern müssten. Powell sagt, er wisse nicht mal mehr, ob Deutsche und Franzosen „überhaupt Schlüsse aus den Inspektionen ziehen wollen“. Beide Länder ließen sich durch Fakten nicht mehr überzeugen, nicht mal mehr durch jene Vorwürfe gegen den Irak, die Chefinspektor Hans Blix am Montag vorgelegt hat.
Deshalb ist Powell umgeschwenkt und gibt sich inzwischen härter als die Hardliner. Er sagt nun, Inspektionen „funktionieren nicht“ – obwohl er sie noch vor zwei Wochen lobte. Eine „dramatische Wende“ sieht darin Jessica Mathews, die Präsidentin des Carnegie Endowment for International Peace. Powell rechnet offenbar nicht mehr damit, die Nato-Alliierten mithilfe von Inspektionen für die Irak-Koalition zu gewinnen. So ist das kuriose Ergebnis der neuen deutsch-französischen Bekenntnisdiplomatie, die amerikanische Regierung in ihrem schwächsten Moment gestärkt und – einem Mitarbeiter Powells zufolge – „einen ziemlich soliden Konsens“ für einen baldigen Krieg erzeugt zu haben.
Die Amerikaner wähnten sich in einer stillen Abmachung mit den Deutschen, getroffen nach den anti-amerikanischen Ausfällen im deutschen Wahlkampf, wonach beide Seiten einander in der Irak-Politik nicht länger herausfordern wollten. Diesen Pakt, heißt es, habe Gerhard Schröder nun gebrochen. Im Herbst hatte er sich den „deutschen Weg“ genehmigt, nun attestiert er den Amerikanern den „flachen Weg“ (Originalton vom Marktplatz in Goslar). Das wollen sich die Gescholtenen nicht länger bieten lassen. Im Außenministerium wird erwogen, Deutsche wie Franzosen vor den UN zu dem Bekenntnis zu nötigen, Saddam habe die Weltgemeinschaft betrogen und jene Resolution 1441 verletzt, der beide Länder öffentlich zugestimmt haben. „Wir wollen denen die Fakten unter die Nase reiben“, sagt ein Mitarbeiter Colin Powells.
„Die Fakten unter die Nase reiben“
Hinter den Kulissen tobt in der amerikanischen Regierung der Streit, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine zweite Resolution in den UN-Sicherheitsrat einzubringen. Nutzlos!, rufen die Unilateralisten, denen schon die erste Resolution als Irrweg vorkam. Der deutsch-französische Vorstoß ist ihnen Vorwand, allein durchzumarschieren.
Dennoch wird im Außenministerium seit Sonntagnacht – für alle Fälle – an einem Entwurf gearbeitet. Dieser Fall könnte schon am Freitag eintreten. Dann besucht Tony Blair den amerikanischen Präsidenten. Englischen Diplomaten zufolge kommt er mit einer genuin europäischen Botschaft: Den Inspektoren mehr Zeit geben! Und: Den Sicherheitsrat über den Krieg abstimmen lassen! Möglich, dass George Bush beiden Wünschen entgegenkommt. Seine Rede zur Lage der Nation hat diese Möglichkeit jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Denn Bush ist in einer prekären Lage. Er kann sich nicht leisten, dass sein wichtigster Verbündeter abspringt. Das könnte das Ende des Feldzuges bedeuten.
Bislang ist die Kriegs-Koalition „bemerkenswert mickrig“, wie Ivo Daalder aus der angesehenen Denkfabrik der Brookings Institution meint. Zwar behauptet Verteidigungsminister Rumsfeld treuherzig, ständig würden sich neue Länder freiwillig melden. Doch nach den Namen befragt, blockt er ab: Die Partner müssten ihre Politik selbst verkünden. Wahrscheinlich handelt es sich, wie ein CNN-Kommentator meint, keineswegs um eine „Koalition der Willigen“, sondern um eine „Koalition der Widerwilligen“.
53 Staaten hat Amerika um Hilfe gebeten. Bisher stellen nur ein paar Nachbarländer des Irak Basen. Die Tschechen schicken einen Chemiewaffen-Suchtrupp. Kampftruppen haben den Amerikanern nur Großbritannien und Australien zugesagt.
Diese Trias ist für Thomas Friedman, den Nahost-Kommentator der New York Times, kein Zufall, sondern Modell: drei Englisch sprechende Seemächte, mit einer Tradition von Auslandseinsätzen und berühmt-berüchtigten Spezialkommandos. Alle Länder liebten Rugby oder Football. Raue Spiele, in denen es darauf ankomme, dem Gegner wehzutun. Nations Allied to Stop Tyrants nennt Friedman diese Zukunfts-Allianz, kurz: NASTY. Bleibe es allein bei dieser übellaunigen NASTY, werde Amerika womöglich sein (derzeit 1,4 Millionen Mann starkes) stehendes Heer vergrößern müssen, meint Michael O’Hanlon, der Brookings-Militärexperte. Denn ohne europäische Hilfe könne Amerika die jahrelangen Aufräumarbeiten im besiegten Irak nicht bewältigen.
All die Kriegs- und Nachkriegsszenarien haben das Militär aufhorchen lassen. Seit Monaten übt eine Gruppe pensionierter Generale heftige Kritik an den Plänen. Da ist einmal Wesley Clark, der Nato-Befehlshaber im Kosovo-Krieg. An seiner Seite weiß er Norman Schwarzkopf, den Kommandeur im Golfkrieg, sowie dessen ehemaligen Untergebenen Anthony Zinni, jüngst Nahost-Unterhändler eines anderen skeptischen Generals, Colin Powell. Sogar aktive Generale, der Heereschef sowie der Kommandeur der Marine-Infanterie, haben sich öffentlich geäußert. Dem Chef des Zentralkommandos in Tampa, Tommy Franks, der den Krieg zu befehligen hätte, wurde von Donald Rumsfeld eigens ein Stellvertreter als Aufpasser beigesellt.
Die Generäle nennen ihre zivilen Chefs chickenhawks, also Hühnerfalken. Das sind im Kasernenhof-Slang jene Zivilisten im Pentagon, die selbst nie gedient haben, aber die Soldaten kriegslüstern in die Schlacht schicken. Die Militärs wollen sehen, dass ernsthaft versucht wird, den Krieg zu vermeiden. Und wenn er doch geführt werden muss, so wollen sie ihn nur mit einer großen Streitmacht und in großer Allianz führen. Bekommen haben sie bisher nur die Übermacht.
Die Skepsis von Militärs und Alliierten hat inzwischen die Bevölkerung erreicht. Zwar ratterte ein Mitarbeiter George Bushs vergangene Woche im Präsidentenflugzeug all jene Umfrageergebnisse herunter, die eine solide Mehrheit für den Krieg verheißen. Man kann die Daten aber auch anders lesen: Die Zustimmungsrate ist drastisch gefallen, um 10 bis 18 Prozentpunkte binnen eines Jahres. Siebzig Prozent der Amerikaner verstehen die Eile nicht. Sie wollen den UN-Inspektoren noch „mehrere Monate“ Zeit geben.
Die verblüffendste Blitz-Umfrage hat CNN veröffentlicht. Befragt, ob Amerika auch ohne französische und deutsche Zustimmung in den Krieg ziehen solle, antwortete nur ein Drittel mit Ja, aber zwei Drittel mit Nein. Darin zeigt sich das gewaltige Vertrauen der Amerikaner in die Urteilskraft europäischer Bevölkerungen und auch die enorme transatlantische Verbundenheit – zumindest unterhalb der Regierungsebene.
Die Daten über die Stimmung im Lande deuten auf eine Öffentlichkeit, die genau versteht, welch einzigartiges Ereignis ein Präventivkrieg wäre. Sie will nicht nur ihrem Präsidenten vertrauen müssen. Ihr reicht es nicht, wenn der Irak eine Resolution bricht. Sie will Beweise sehen. Sie will verstehen, warum Amerika bedroht ist und zuerst schießen muss. „Die Schwelle zum Präventivkrieg müsste besonders hoch sein“, sagt John Ikenberry, Professor für Internationale Beziehungen an der Georgetown-Universität. „Aber Präsentation und Argumente der Regierung spiegeln das nicht wider.“
Alle warten auf die Beweise
Deshalb steigt seit Wochen der Druck, einen „Adlai-Stevenson-Moment“ zu inszenieren. So hieß 1962 Amerikas UN-Botschafter, der in der Kuba-Krise die Fotos sowjetischer Raketenlieferungen an die Insel auf den Tisch warf. Damals brachte Amerika die Welt mühelos hinter sich. Diesmal hat sich besonders das Pentagon wochenlang geweigert, Spionage-Erkenntnisse über Saddams Waffenprogramm öffentlich zu machen.
Tatsächlich gibt es einen Zielkonflikt. Publizierte die Regierung Kenntnisse über die Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen, würden die Iraker die Kampfstoffe sofort verlegen. Die amerikanischen Truppen müssten auf ein Ziel im Kriege verzichten. Die Soldaten wären großer Gefahr ausgesetzt. Das zu verhindern ist die erste Aufgabe jeder Militärführung. Ähnlich argumentiert die CIA. Sie will ihre Agenten nicht gefährden.
Andererseits wird für George Bush die Schlacht um die Meinung der Weltöffentlichkeit nicht ohne bessere Belege über Saddams gegenwärtige Missetaten zu gewinnen sein. Deshalb hat er am Dienstagabend in seiner Rede angekündigt, „neue Geheimdiensterkenntnisse und Informationen“ über Saddams „laufendes Waffenprogramm“ preiszugeben.
Das Material, das zeigen soll, wie Waffen vor den Inspektoren versteckt werden, wird Außenminister Powell dem UN-Sicherheitsrat am 5. Februar übergeben. Allerdings sind amerikanische Agenten und Spionageflugzeuge nicht unfehlbar. Jüngst haben UN-Inspektoren die amerikanische Behauptung widerlegt, der Irak habe Aluminium-Zentrifugen gekauft, um Uran anzureichern. Präsident Bush hat dieselbe Behauptung am Dienstagabend trotzdem wiederholt.
Bald wird sich demnach herausstellen, wer angesichts neuer Fakten über Saddam besser dasteht: George Bush mit seiner unverhohlenen Vorfestlegung auf Krieg oder Gerhard Schröder mit seiner unverhohlenen Vorfestlegung auf ein Nein zum Krieg.
---
Warme Brüder und EU-nuchen
Alle reden vom Anti-Amerikanismus der Europäer. Aber was ist eigentlich mit dem Anti-Europäismus der Amerikaner? Beobachtungen im transatlantischen Streit der Vorurteile
Von Timothy Garton Ash
Zur Einstimmung zwei Beispiele: „Auf die Liste der politischen Gebilde, die ausersehen sind, im Urinal der Geschichte runtergespült zu werden, müssen wir auch die Europäische Union und Frankreichs Fünfte Republik setzen. Die Frage ist nur, wie unerquicklich ihre Auflösung werden wird“ (Mark Steyn, Jewish World Review, 1.5.2002). Oder: „Wollen Sie wissen, was ich wirklich über die Europäer denke? Ich denke, sie haben sich in jeder wichtigeren internationalen Frage der letzten 20 Jahre geirrt“ (Martin Walker, UPI, 13.11.2002).
Ob in Boston, New York, Washington, in Kansas oder im Bibelgürtel: Wenn von Europa und den Europäern die Rede ist, kommt Gereiztheit auf. Sie übertrifft die letzte Verstimmung in den frühen achtziger Jahren bei weitem. Um „die Europäer“ oder auch „die Euros“, „die Euroiden“, die „Eurowürstchen“ anzuprangern, taucht man die Schreibfedern in Säure. Richard Perle, Vorsitzender des Defense Policy Board und ein führender Theoretiker der Bush-Regierung, bemängelt, Europa habe seinen „moralischen Kompass“ verloren.
Europäer gelten als Weichlinge, schwach, querulantisch, heuchlerisch, zerstritten, zuweilen antisemitisch. Zu oft erweisen sie sich als antiamerikanische Beschwichtiger. Sie sind halt „Eurowürstchen“. Sie haben ihre Werte in multilateralen, transnationalen, säkularen und postmodernen Spielereien verloren. Statt für Verteidigung geben sie ihre Euros für Wein, Urlaub und aufgeblähte Wohlfahrtsstaaten aus. Und dann johlen sie von den Zuschauerrängen, während die USA das schwierige und schmutzige Geschäft erledigen, in der Welt für Sicherheit zu sorgen – auch für die Europäer. Die Amerikaner dagegen sind starke, prinzipiengeleitete Verteidiger der Freiheit, aufrecht im Dienst für das Vaterland, den letzten wahrhaft souveränen Nationalstaat der Welt.
Die Achse der Beschwichtigung
Die sexuelle Konnotation dieser Stereotypen wäre eine Untersuchung wert. Sehen antiamerikanische Europäer „die Amerikaner“ als tyrannische Cowboys, so sehen antieuropäische Amerikaner „die Europäer“ als warme Brüder. Der Amerikaner ist ein viriles, heterosexuelles Mannsbild, der Europäer ist weiblich, impotent oder kastriert.
Vor allem militärisch kriegen die Europäer keinen hoch. Das Wort „Eunuchen“ findet auch in der Form „EU-nuchen“ Verwendung. Die sexuelle Metaphorik schleicht sich sogar in durchdachtere Darstellungen der europäisch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten ein. Unter dem Titel Macht und Schwäche schrieb Robert Kagan einmal in der Policy Review: „Amerikaner sind vom Mars, Europäer von der Venus.“ Er zitierte damit den Bestseller, der das Verhältnis der Geschlechter auf die Formel gebracht hatte, Männer seien vom Mars, Frauen von der Venus.
Die schlimmsten Beschimpfungen sind für die Franzosen reserviert. Der alte englische Zeitvertreib des Franzosenschmähens drang in die amerikanische Populärkultur ein. Unter amerikanischen Jugendlichen grassiert ein seltsames Vorurteil: Die Franzosen waschen sich nicht. „Ich fühlte mich ganz schön schmutzig“, erzählte eine Studentin von ihrer Frankreich-Reise. „Trotzdem warst du immer noch sauberer als die französischen Typen“, fügte ein anderer hinzu. Der Herausgeber von National Review Online und selbst ernannte konservative „Frosch-Verächter“ Jonah Goldberg hat die Bezeichnung der „Käse fressenden Äffchen mit Totstellreflex“ populär gemacht, die schon in einer Folge der Simpsons auftauchte.
Der amerikanische Antieuropäismus ist jedoch nicht mit dem europäischen „Antiamerikanismus“ identisch. Man muss zwischen einer legitimen und informierten Kritik an der EU und einer tiefer sitzenden, eingefleischten Feindseligkeit gegenüber Europa unterscheiden. So wie amerikanische Journalisten zwischen legitimer, informierter europäischer Kritik an der Bush-Regierung und Antiamerikanismus oder auch zwischen legitimer europäischer Kritik an Scharons Regierungspolitik und Antisemitismus unterscheiden sollten – was sie aber oft nicht tun. Die Frage lautet jedenfalls: Wo verläuft die Grenze?
Wir müssen uns vor allem Sinn für Humor bewahren. Ein Grund, warum die Europäer gern über George W. Bush lachen, sind seine lustigen Äußerungen (oder angeblichen Äußerungen). Zum Beispiel: „Das Problem mit den Franzosen ist doch, dass sie kein Wort für entrepreneur haben.“ Die Amerikaner wiederum lachen auch deshalb gern über die Franzosen, weil es in einer langen angelsächsischen Tradition des Spottens steht, die bis Shakespeare zurückreicht.
Doch auch das ist nicht ohne. Konservative beleidigen manchmal humorvoll, halb ernst oder ziemlich ernst. Wenn man protestiert, antworten sie: „Das war natürlich nur ein Scherz!“ Humor arbeitet mit der Übertreibung und spielt mit Stereotypen. Doch würde man lachen, wenn ein europäischer Journalist „die Juden“ als „Matzen fressende Äffchen mit Totstellreflex“ bezeichnete? Der Kontext ist selbstverständlich ein anderer: Einen Völkermord an den Franzosen hat es in den USA nicht gegeben. Das Gedankenexperiment gibt dennoch zu denken.
Der Antieuropäismus bildet keine Parallele zum Antiamerikanismus. Das Leitmotiv des Antiamerikanismus ist mit Neid durchsetzter Groll; die des Antieuropäismus mit Verachtung durchsetzte Gereiztheit. Antiamerikanismus ist für einzelne Länder geradezu eine Obsession – besonders für Frankreich. Der Antieuropäismus ist weit davon entfernt, eine amerikanische Obsession zu sein. Tatsächlich ist die am weitesten verbreitete amerikanische Haltung gegenüber Europa eine leichte, wohlwollende Gleichgültigkeit, untermischt von beeindruckender Unwissenheit.
Europa ist selbst denjenigen, die den Kontinent gut kennen, seit dem Ende des Kalten Kriegs gleichgültiger geworden. Europa wird weder als starker Verbündeter noch, wie China, als ein ernst zu nehmender Konkurrent angesehen. „Europa ist ein Altersheim“ oder, wie der Experte der Konservativen, Tucker Carlson, in einer politischen Talkshow auf CNN meinte: „Wen schert es, was die Europäer denken? Die EU vertut ihre Zeit damit, dafür zu sorgen, dass britische Wurst in Kilo und nicht in Pfund verkauft wird. Der ganze Kontinent ist für amerikanische Interessen zunehmend irrelevant.“
Amerikanische Kritiker Europas stehen Europa jedoch keineswegs gleichgültig gegenüber. Sie kennen Europa – anscheinend hat die Hälfte von ihnen in Oxford oder Paris studiert – und beeilen sich stets, ihre europäischen Freunde zu erwähnen. Wie die europäischen Kritiker der USA immer heftig bestreiten, dass sie antiamerikanisch eingestellt seien („Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe das Land und die Leute“), bestehen auch die Amerikaner ausnahmslos darauf, dass sie überhaupt nicht antieuropäisch seien.
Antiamerikanismus und Antieuropäismus sind Pole des politischen Spektrums. Der europäische Antiamerikanismus findet sich hauptsächlich auf der Linken, der amerikanische Antieuropäismus auf der Rechten. Die meisten amerikanischen Europa-Kritiker sind Neokonservative und benutzen gegen Europa dieselbe Kampfrhetorik wie gegen Liberale. William Kristol, einer dieser Neokonservativen, macht „eine Achse der Beschwichtigung“ aus, „die sich von Riad bis Brüssel und hin zum Foggy Bottom (Außenministerium) erstreckt“. Es gibt zwei Gruppierungen, die um Präsident Bushs Gehör in der Irak-Frage konkurrieren: die „Cheney-Rumsfeld-Gruppe“ und die „Powell-Blair-Gruppe“, die eine radikal, die andere etwas gemäßigter. Für atlantisch orientierte Europäer ist das aber kein Trost, denn selbst unter den liberalen Europa-Kennern des Außenministeriums herrscht herbe Enttäuschung über Europa. Ihr Schlüsselerlebnis war Europas entsetzliche Unfähigkeit, den Genozid an einer viertel Million bosnischer Muslime auf dem Balkan zu verhindern. Europa kann nicht einmal seine Außen- und Sicherheitspolitik koordinieren, sodass selbst ein Streit zwischen Spanien und Marokko um eine unbewohnte Insel von Colin Powell geschlichtet werden musste.
Kein Respekt vor den Griechen
Es gab immer eine starke Strömung des Antieuropäismus in den USA. „Amerika wurde als Gegenmittel zu Europa geschaffen“, stellt Michael Kelly, der ehemalige Herausgeber des Atlantic Monthly, fest. Für Millionen Amerikaner war Europa im 19. und 20. Jahrhundert der Ort, dem man entfloh. Trotzdem war Europa auch Gegenstand dauernder Faszination. Vor allem zwei europäischen Ländern wollte man nacheifern und sie übertreffen – England und Frankreich. „Jedermann hat zwei Länder“, sagte Thomas Jefferson, „sein eigenes und Frankreich.“ Wann sind die USA von dieser sympathischen Überzeugung abgekommen?
Fünfzig Jahre lang, von 1941 bis 1991, führten Amerikaner und Westeuropäer Krieg gegen einen gemeinsamen Feind: zuerst gegen den Nationalsozialismus, dann gegen den Sowjetkommunismus. Das war die Glanzzeit des geopolitischen „Westens“. Während des Kalten Kriegs kam es allerdings auch zu transatlantischen Spannungen. Einige der heutigen Stereotypen bildeten sich in den Kontroversen der achtziger Jahre um die Aufstellung von Cruise-Missiles und Pershings – und um die amerikanische Außenpolitik in Zentralamerika und Israel.
Der Australier Owen Harries sah vor fast zehn Jahren in einem Artikel in Foreign Affairs etwas vorher, dessen Zeugen wir womöglich jetzt sind: den Niedergang „des Westens“, jenes Westens als einer verlässlichen geopolitischen Achse, die mit dem Verschwinden eines gemeinsamen Feindes zerbricht. Europa war die Hauptbühne des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs, es ist nicht der Mittelpunkt des „Kriegs gegen den Terrorismus“. Die Machtlücke ist größer geworden.
Die USA sind nicht nur die einzige Supermacht der Welt. Sie sind eine Hypermacht, deren Militärausgaben bald das Volumen der 15 nach ihr mächtigsten Staaten insgesamt erreicht haben werden. Die EU hat ihre vergleichbare ökonomische Stärke nicht annäherungsweise in militärische Stärke oder außenpolitischen Einfluss umgesetzt.
Folgt man Robert Kagan, dann bewegt sich Europa in eine kantianische Welt der „Gesetze und Regeln und transnationalen Verhandlungen“ hinein, wohingegen die USA in einer hobbesschen Welt verharren, in der internationale (auch liberale) Ziele nach wie vor durch militärische Stärke errungen werden.
Stimmt das? Kagan rückt Europa in allzu günstiges Licht. Seine Formel hebt etwas in den Rang einer überlegten, geschlossenen Konzeption, was in Wirklichkeit Folge konfusen Herumexperimentierens und nationaler Unterschiede ist. Weitere Frage: Möchten Europäer und Amerikaner, dass Kagans These zutrifft? Die Antwort scheint „ja“ zu lauten, denn nicht wenige amerikanische Ideologen liebäugeln damit, während nicht wenige europäische Ideologen gern von sich glauben machen, sie seien immer schon „Kantianer“ gewesen. Die Rezeption von Kagans These ist also Teil ihrer eigenen Geschichte.
Da die EU vor ihrer Erweiterung nach einer klareren Identität sucht, ist die Versuchung groß, sich im Kontrast zu definieren: Europa klärt sein Selbstbild, indem es auflistet, worin es sich von Amerika unterscheidet. Den Amerikanern gefällt es aber nicht, als das „Andere“ bestimmt zu werden (wem gefällt das schon?). Frankreich und die USA sind die Nationen, die sich beide als Träger einer Mission in Sachen Universalismus und Zivilisation betrachten. Es gibt eine nicht unbedingt französische, aber europäische Version dieser Mission, ein „EU-topia“ der transnationalen, im Recht begründeten Integration, und die kollidiert derzeit äußerst heftig mit der neuesten Version einer amerikanischen Mission.
Jede Seite glaubt, ihr Modell sei besser. Dies gilt nicht nur für die konkurrierenden Modelle der internationalen Politik, sondern auch für die Modelle des demokratischen Kapitalismus: Es betrifft die unterschiedlichen Anteile von freiem Markt und Wohlfahrtsstaat, von individueller Freiheit und sozialer Solidarität. Das amerikanische Misstrauen gegenüber Europa war im 19. und 20. Jahrhundert noch mit Bewunderung und Faszination gemischt. Es gab einen kulturellen amerikanischen Minderwertigkeitskomplex. Diesen Minderwertigkeitskomplex gibt es kaum noch. Er hat sich seit dem Ende des Kalten Kriegs verflüchtigt. Das neue Rom verspürt keine Ehrfurcht mehr vor den alten Griechen.
Die Differenz wurde nach dem Fall der Berliner Mauer acht Jahre lang durch den Ehren-Europäer im Weißen Haus, durch Bill Clinton, verdeckt. 2001 indessen zog George W. Bush, das Geschenk für jeden antiamerikanischen Karikaturisten, mit einer unilateralen Agenda in das Weiße Haus ein, bereit, gleich mehrere internationale Abkommen über Bord zu werfen. Nach dem 11. September definierte er seine Präsidentschaft als eine Präsidentschaft in Kriegszeiten. Der „Krieg gegen den Terrorismus“ verstärkte die Tendenz in der republikanischen Elite, an eine, wie Robert Kaplan sagt, „Kriegerpolitik“ zu glauben, mit einem kräftigen Schuss fundamentalistischen Christentums – etwas, das dem säkularisierten Europa abgeht.
Nahostkonflikt als Wurzel
Die amerikanische Frage an die Europäer lautet also: „Seid ihr mit uns in den Schützengräben oder nicht?“ Zuerst war die Antwort ein lautes Ja. Jeder kennt die Überschrift von Le Monde, Wir alle sind Amerikaner. Doch eineinhalb Jahre später ist Tony Blair das einzige europäische Staatsoberhaupt, von dem die Amerikaner glauben, er liege mit ihnen im Graben. In Washington haben viele den Eindruck, dass die Franzosen zu ihren alten antiamerikanischen Einstellungen zurückgekehrt sind und dass der deutsche Kanzler Gerhard Schröder seine Wiederwahl im September 2002 nur durch zynische Ausnutzung antiamerikanischer Reflexe gewann.
Wann und wo haben sich europäische und amerikanische Ansichten endgültig voneinander entfernt? Mit der Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts im Nahen Osten. Der Nahe Osten ist Quelle wie Katalysator für das, was eine Abwärtsspirale des europäischen Antiamerikanismus und des beginnenden amerikanischen Antieuropäismus zu werden droht.
Der Antisemitismus in Europa und seine offensichtliche Verbindung mit der Kritik an Scharons Regierungspolitik ist von konservativen Kolumnenschreibern und Politikern in den USA mit ätzenden Kommentaren gewürdigt worden.
Einige dieser Kritiker sind selbst nicht bloß stark proisraelisch, sondern auch „natürliche Likud-Anhänger“, wie ein liberaler jüdischer Journalist das nannte. Propalästinensische Europäer, die aufgebracht sind, dass ihre Kritik an Scharon als Antisemitismus etikettiert wird, sprechen von einer mächtigen „jüdischen Lobby“ in den USA. Das wiederum bestätigt den schlimmsten Verdacht amerikanischer Likud-Anhänger, was den europäischen Antisemitismus betrifft. Und so geht es immer weiter.
Neben dem Gewirr der Vorurteile gibt es natürlich auch reale europäisch-amerikanische Unterschiede in der Sicht auf den Nahen Osten. Europäische Ideologen denken oft, eine Verhandlungslösung des israelisch-palästinensischen Konflikts trüge mehr zu einem langfristigen Sieg über den Terrorismus bei als ein Krieg gegen den Irak. Wichtiger ist hier aber, dass der Kalte Krieg Amerika und Europa zusammengeführt hatte, sie der „Krieg gegen den Terrorismus“ im Nahen Osten jedoch auseinander bringt. Nüchtern betrachtet, ist diese Uneinigkeit dumm.
Europa mit seiner wachsenden islamischen Bevölkerung hat ein vitaleres Interesse an einem friedlichen, wohlhabenden und demokratischen Nahen Osten, als es die USA haben. Augenblicklich scheint es, als würde ein neuer Golfkrieg die Kluft zwischen Europa und Amerika noch vergrößern. Und selbst wenn es zu keinem Krieg kommen sollte, kann der Nahe Osten weiterhin den Strudel bilden, in dem ein wirklicher oder angeblicher europäischer Antiamerikanismus einen wirklichen oder angeblichen amerikanischen Antieuropäismus anheizt, der wiederum weiteren Antiamerikanismus hervorruft – und beide von Vorwürfen eines europäischen Antisemitismus verschärft werden.
Eine Änderung ließe sich durch Anstrengungen auf beiden Seiten des Atlantiks – oder durch einen Regierungswechsel in Washington im Jahr 2005 oder 2009 herbeiführen. Zuvor kann jedoch großer Schaden angerichtet werden, und die derzeitige transatlantische Entfremdung ist auch Ausdruck der erwähnten tiefer reichenden historischen Trends. Der amerikanische Antieuropäismus existiert, und seine Boten sind vielleicht die Schwalben eines langen, schlechten Sommers.
Der englische Historiker Timothy Garton Ash lehrt in Oxford und wurde bei uns durch seine Bücher über das Ende des Ostblocks bekannt. Übersetzt von Karin Wördemann
ALLE ARTIKEL: DIE ZEIT 06/2003
Die Galgenfrist
Wie Saddam, Europa und Amerika den Krieg noch abwenden können
Von Josef Joffe
Saddam hat nur einen knappen Aufschub erhalten – und Europa auch. Am Sonntag schien Außenminister Powell die Kriegsmaschinerie vom Autopiloten zu nehmen: „Die USA wollen sich nicht in den Krieg stürzen.“ Doch im Bericht zur Lage der Nation eskalierte George Bush den Nervenkrieg. Schon am 5. Februar will er den UN-Sicherheitsrat zusammenrufen, wo Powell „Beweise für das illegale Waffenprogramm“ des Irak vorlegen werde.
„Wir werden konsultieren, doch wenn Saddam sich nicht selbst entwaffnet, werden wir eine Koalition anführen, die es für ihn tut. Bedeutsamer war indes das Nichtgesagte: kein Wort zur Verlängerung der Inspektionen, kein Ja, aber auch kein Nein; also könnte die Automatik des Krieges noch Verzögerungsmomente enthalten. Mag sein, dass der Aufmarsch nicht vollendet, die Nation noch nicht überzeugt ist – vom Sicherheitsrat ganz zu schweigen. Mithin bleibt eine letzte Denk- und Diplomatiepause. Zumal die Atlantik-Anrainer, einst fest verschweißte Partner, können in den nächsten Wochen ihr verhunztes Verhältnis neu sortieren – ohne jene hochfahrenden Gesten, die nicht nur dem Don Rumsfeld anzukreiden sind.
Abrüstung per Simsalabim
Beginnen wir aber mit Saddam und dem dürren Fazit der UN-Inspektorenkompanie: Bagdad „hat anscheinend noch immer nicht die geforderte Abrüstung akzeptiert“. Man darf es beim Anblick der besenreinen Anlagen etwas sarkastischer ausdrücken. Hat Saddam nur noch Kunstdünger und Insektizide produziert, seitdem er 1998 die UN aus dem Land warf? Und wo ist das Zeug, das seinerzeit bekannt war? Tausende von Litern Anthrax und Botulin, drei Tonnen Nährlösung, 30000 Munitionshülsen, die C-Ladungen tragen können?
Powell hat Recht: „So sieht echte Entwaffnung nicht aus.“ Er verweist auf die nukleare Abrüstung Südafrikas, Kasachstans und der Ukraine. Das Geheimprogramm Pretorias wurde offen gelegt, die sieben Atombomben sichtbar verschrottet. Dito die beiden Ex-Sowjetrepubliken, die ihre Sprengköpfe nach Russland zurückschickten, ihre Raketensilos zubetonierten. Angesichts der mageren, aber nicht unbedeutenden Funde in einem Land, das größer ist als Deutschland, darf man es den Amerikanern nicht verdenken, wenn sie nun die Beweislast umkehren. Saddam muss zeigen, was er hat oder zerstört hat. Hierzulande wurde Weltkrieg-I-Senfgas Tropfen um Tropfen verbrannt, jahrzehntelang. Und Saddam will das per Simsalabim getan haben – spurenlos?
Will er seine letzte Chance nutzen, muss er die Bilanzen offen legen. Denn auf die Unschuldsvermutung darf keiner zählen, dessen Kerbholz so lang ist wie Saddams: zwei Angriffskriege, Giftgasattacken auf die Kurden und Iraner, Tod und Terror gegen Abertausende im eigenen Land. Er sollte sich aber auch nicht auf Berlin und Paris verlassen dürfen, die mit ihrem schroffen Nein (Schröder) oder schlüpfrigen non (Chirac) eine Bresche in die Druck-Kulisse geschlagen haben.
Von den Franzosen, die in diesen Tagen ihren Flugzeugträger Charles de Gaulle golfwärts entsenden, dürfen wir annehmen, dass sie spätestens dann in den Krieg eingreifen, wenn die ersten Marschflugkörper in die Bunker der Republikanergarde einschlagen. La grande nation, die seit 1781 an Amerikas Seite kämpft, wird wenigstens symbolisch mitschießen, um bei der Nachkriegsordnung mitreden zu können. C’est la vie.
Schröders Irak-Politik aber wird kaum in die Lehrbücher der Diplomatie eingehen. Dass er mit seinem „Abenteuer“-Wahlkampf im Sommer die Umfragen drehen konnte, mag man noch als wohlkalkulierte Taktik abheften. Dass er aber im Landtagswahlkampf den Wiederholungstäter gibt (Nein zu Intervention und Kriegsresolution), muss Bismarck und Stresemann im Grabe rotieren lassen. Doch ist Außenpolitik mit zwei linken Händen nicht der gröbste Kunstfehler. Denn der Kanzler muss sich fragen lassen, wohin er will.
Wenn sein Außenminister Saddam warnt, er habe „keinen Spielraum mehr für Taktik oder Ausweichmanöver“, zugleich aber „militärische Mittel“ ausschließt, fragt sich der Laie, welcher Zauberstab denn den Tiger in ein Lamm verwandeln soll.
Und wenn die Metamorphose ausbleibt? Gilt dann der Spruch: „Nehmen Sie das eventuell zurück? Nein? Dann ist die Sache für mich erledigt.“ Sollen sich doch andere mit den Schreckenswaffen des Angriffskriegers herumschlagen.
Was aber ist, wenn Schröder Größeres im Sinn hat, wenn er in der Übermacht Amerikas das größere Übel sieht als in Saddams ABC-Arsenal? Das wäre nach dem Untergang der Sowjetunion die Logik klassischer Gleichgewichtspolitik – Europa als Widerpart des befreiten Gulliver. Aber dazu müsste sich Schröder viel wärmer anziehen. Er müsste Europa hinter Berlin versammeln, dann den Amerikanern konsequent Stützpunkt- und Überflugrechte ent- und die Deutschen aus den Awacs abziehen. Doch wird ihm das Koalitions-Kunststück nicht gelingen; nicht einmal Paris wäre dabei ein zuverlässiger Bundesgenosse. Bis jetzt hat es der Kanzler nur geschafft, die alten Freunde gründlich zu provozieren. Den Riesen zu reizen, ohne ihn zu zähmen – das hätte der schlaue Hans-Dietrich Genscher nicht getan.
Eine Republik, kein Imperium
Wer den Krieg verhindern will, muss eine produktive Alternative anbieten, den USA gute Gründe liefern, damit sie von ihrem hohen Ast wieder herabsteigen. Vorweg mit einer schlichten Druckverschiebung: weg von Bush, hin zu Saddam, um ihm die Illusion zu rauben, dass die Europäer ihn vor den Amerikanern retten. Dann der Große Deal: Verzichtet auf den Krieg, dafür stehen wir fest im Eindämmungsring, der nichts mehr durchlässt – keine Vorläuferchemikalien, keine Anreicherungstechnik, keine Werkzeugmaschinen für Raketenhülsen. Notfalls patrouillieren wir zur Luft und zur See, bis der Despot seine Zähne verliert. Und wir helfen euch, Peking und Moskau einzubinden.
Und die Amerikaner? Sie müssen sich entscheiden, was sie wollen: Entwaffnung, Regimewechsel oder Demokratisierung? Ihre schwankenden Begründungen dienen nicht der Glaubwürdigkeit. Doch geht es um viel mehr – um Legitimität. Bei der Vertreibung des Kuwait-Räubers Saddam 1991 hat fast die ganze Welt mitgemacht; damals lag ein klarer Fall von Aggression vor. Heute aber fehlt neben dem „rauchenden Colt“ auch das schlagende Argument, warum Blut, Tod und Tränen die einzigen Mittel zur „Fortführung der Politik“ seien.
Rein militärisch hätten die USA ein leichtes Spiel, aber was dann? Eine geduldige, gar opferreiche Besetzung für die nächsten 40 Jahre? Nichts in ihrer jüngeren Geschichte lässt wähnen, dass diese „imperiale Republik“ (Raymond Aron) tatsächlich das Zeug zum Imperium hat. Demokratien sind ungeduldig und wankelmütig.
Doch geht die Sache noch tiefer. Wenn es Amerika nicht schafft, die Niedertracht Saddams zu offenbaren, und allein losschlägt, muss die „Hypermacht“ mit Knüppeln, nicht nur mit Schröders Stöckchen rechnen. Denn es wächst das Unbehagen an einem entfesselten Gulliver, der, wie Bush am Dienstag betonte, „seine Entscheidungen nicht anderen Nationen unterwerfen“ will. Denn schiere Macht ohne Vertrauen zeugt Gegenmacht und verwandelt Freunde in Widersacher.
Wer allein in den Krieg zieht, wird auch allein sein, wenn er den Rest der Welt für den Friedensdienst einspannen muss.
Die Welt muss wollen, dass Saddam sich doch noch beugt – schnell. Oder Amerika besser keinen, als einen einsamen Krieg führt.
---
Den Autopiloten auf Krieg gestellt
George Bush hat in seiner Rede zur Lage der Nation für einen Feldzug gegen Saddam geworben. Doch in Amerika wächst die Skepsis
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Washington
Sofern eines Tages die Geschichte des Irak-Krieges zu schreiben sein wird, können drei kleine Szenen erhellen, warum schier endlose Wirrungen dem Waffengang vorangehen. Die erste Begebenheit trägt sich am Morgen des 11. September 2001 im Bunker unter dem Weißen Haus zu. Dort sitzt, aus Sicherheitsgründen, der amerikanische Vizepräsident und telefoniert mit seinem derangierten Chef. Nebenbei schaut er fern. Als er sieht, wie das World Trade Center in sich zusammenfällt, sagt Richard Cheney: „Das alles mag unfassbar sein, aber es wäre noch viel schlimmer gekommen, hätten die Täter Massenvernichtungswaffen gehabt.“
In dieser düsteren Fantasie steckt schon der Nukleus der Doktrin vom preemptive strike, vom Präventivkrieg. Der Satz ist Vorbote jenes globalen Streits um die Frage, wem Krieg zu erklären sei: jenen, die für den Anschlag verantwortlich sind, oder auch jenen, die künftig Terror, auch nuklearen, planen könnten.
Die zweite Szene spielt vier Tage später in Camp David, dem Landsitz des Präsidenten. George Bush will mit seinen Ministern ausgiebig diskutieren. Obwohl nicht geladen, erscheint auch ein Stellvertreter, Paul Wolfowitz aus dem Verteidigungsministerium. Statt seines Chefs ergreift er das Wort und argumentiert wider die Jagd auf das Terrornetzwerk al-Qaida in Afghanistan. Als Alternative protegiert er einen Angriff auf den Irak. Vielleicht habe Saddam ja etwas mit dem Anschlag zu tun, meint Wolfowitz. Und selbst wenn nicht, könne kein Antiterror-Krieg ohne Angriff auf Saddam auskommen.
Hier bricht die obsessive Seite des Irak-Feldzugs hervor. Seit Jahren gehört Wolfowitz zum kleinen Kreis jener Revisionisten, die für einen „Regimewechsel“ im Irak trommeln. Nun nutzt er einen neuen Anlass zur Begründung einer alten Idee. Sofort widerspricht ihm Colin Powell. Die Intervention des Außenministers nimmt Amerikas weltumspannendes Kommunikationsproblem vorweg, das fortan um die Frage kreisen wird, warum Saddam eigentlich angegriffen werden soll: wegen seiner möglichen Verbrüderung mit al-Qaida? Um ihm jene Massenvernichtungswaffen zu entwinden, die er – wahrscheinlich – besitzt? Um ihn zu stürzen? Weil er UN-Resolutionen missachtet?
Der Glaube an die Mission
Die dritte Szene ist im Kongress zu beobachten, am Dienstagabend dieser Woche. Da tritt George Bush aus einer Seitentür ins Repräsentantenhaus, begrüßt und umjubelt von den Abgeordneten. So will es die Tradition, wenn der Präsident die Rede zur Lage der Nation vorträgt. Trotzdem ist nichts mehr wie im vergangenen Jahr, als die Begeisterung ihn zum Podium trug. Der Applaus ist diesmal gehörig, aber nicht mehr brausend. Ein Jahr nachdem er die „Achse des Bösen“ erfand und sich dem Projekt eines Präventivkrieges gegen den Irak hingab, ist er in die erste schwere Vertrauenskrise seit dem Anschlag vom 11. September geraten. Er hat sich verhaspelt in den Begründungen für diesen verflixten Krieg und die Kontrolle über die Debatte verloren.
Inzwischen ist das Parlament gespalten, das Land gespalten, der Westen gespalten, die Welt gespalten. Alle eint nur noch der Glaube, in Washington sei – warum auch immer – der Autopilot auf Krieg gestellt.
In dieser prekären Situation macht George Bush den Kongress zum Forum. Er will Antwort geben auf die Frage, die vielen so recht nicht beantwortet erscheint: „Warum Krieg?“ Ans Podium tritt ein Mann, der in diesem Moment nichts als eiserne Entschlossenheit ausstrahlt. Er beschreibt die Bedrohung und benennt die Konsequenz. Er erklärt nicht den Krieg, aber er kündigt ihn an. Er nennt kein Ultimatum, aber lässt keinen Zweifel, dass die Zeitspanne bis zum Kampf nur sehr klein sein kann. Seine Rede umfasst alle vertrauten Motive seiner Politik: den Glauben an die Mission Amerikas in der Welt, die Freiheitsrhetorik, die Existenz des Bösen und schließlich das Bedrohungsszenario.
Seine Furcht ist ein „Tag des Schreckens, wie wir ihn noch nie erlebt haben“, nämlich dann, wenn Terroristen oder verbrecherische Diktatoren mit Massenvernichtungswaffen zuschlagen. „Stellen Sie sich die 19 Flugzeug-Entführer mit anderen Plänen und anderen Waffen vor, diesmal bewaffnet von Saddam Hussein.“ Und dann der Satz, aus dem Politik wird: „Wir werden sicherstellen, dass dieser Tag nie kommt.“ Es ist ein Programm auf Jahrzehnte, und Saddam wäre nur der Anfang. Manche, sagt Bush, würden empfehlen zu warten, bis die Gefahr „akut“ sei.
Auf dieses Argument kontert er: „Seit wann haben Terroristen und Tyrannen angekündigt, wann sie zuschlagen? Auf die geistige Gesundheit und die Zurückhaltung von Saddam Hussein zu vertrauen, ist keine Strategie und keine Option.“ Nie zuvor hat sich der amerikanische Präsident derart entschlossen der Idee des Präventivkrieges verschrieben. Unklarheiten über seine Absichten wird es nach dieser Rede kaum mehr geben.
Allerdings ist schwer zu sagen, ob er mit diesem machtvollen Auftritt jene noch überzeugen kann, die er im ganzen vergangenen Jahr nicht hat gewinnen können. Was auf jeden Fall bleibt, sind seine Dilemmata: im Umgang mit den Militärs, mit der Öffentlichkeit, mit den Verbündeten.
Seit vergangener Woche gibt es ein Bild, das in Amerika wie kein zweites die Opposition zum Kurs George Bushs verkörpert. Es wird täglich mehrfach in den Nachrichten-Sendungen wiederholt. Es zeigt zwei Politiker vor ihren Landesflaggen. Zu sehen sind Jacques Chirac und Gerhard Schröder. Ersterer sieht „zurzeit“ keinen Grund, in den Krieg zu ziehen, letzterer gar keinen Grund. Das nennen die beiden „Übereinstimmung der Positionen“. Gegen dieses Bild von der „Achse des Widerstandes“ wird ein ganz ähnliches Bild zweier Politiker vor Landesflaggen geschnitten. Es sind ein Engländer und ein Amerikaner, die Außenminister Jack Straw und Colin Powell, die davon sprechen, „die Zeit wird knapp für den Irak“.
Sinnfälliger könnte die Spaltung des Westens nicht sein.
Im Bemühen, George Bush noch in letzter Minute zu stoppen, sind die Widerständler zugleich ihrem wichtigsten Partner in den Rücken gefallen. Denn die Schwachstelle der Regierung Bush bestand gerade in Flügelkämpfen zwischen Hardlinern und Moderaten. Die Europäer sahen in Außenminister Powell den Anwalt der Vorsicht.
Nun hat insbesondere der französische Vorfreispruch für Saddam den Außenminister desavouiert. Dessen eigene Mitarbeiter meinen jetzt, Deutschland und Frankreich würden nur immer neue Gründe suchen, warum die Inspektionen fortdauern müssten. Powell sagt, er wisse nicht mal mehr, ob Deutsche und Franzosen „überhaupt Schlüsse aus den Inspektionen ziehen wollen“. Beide Länder ließen sich durch Fakten nicht mehr überzeugen, nicht mal mehr durch jene Vorwürfe gegen den Irak, die Chefinspektor Hans Blix am Montag vorgelegt hat.
Deshalb ist Powell umgeschwenkt und gibt sich inzwischen härter als die Hardliner. Er sagt nun, Inspektionen „funktionieren nicht“ – obwohl er sie noch vor zwei Wochen lobte. Eine „dramatische Wende“ sieht darin Jessica Mathews, die Präsidentin des Carnegie Endowment for International Peace. Powell rechnet offenbar nicht mehr damit, die Nato-Alliierten mithilfe von Inspektionen für die Irak-Koalition zu gewinnen. So ist das kuriose Ergebnis der neuen deutsch-französischen Bekenntnisdiplomatie, die amerikanische Regierung in ihrem schwächsten Moment gestärkt und – einem Mitarbeiter Powells zufolge – „einen ziemlich soliden Konsens“ für einen baldigen Krieg erzeugt zu haben.
Die Amerikaner wähnten sich in einer stillen Abmachung mit den Deutschen, getroffen nach den anti-amerikanischen Ausfällen im deutschen Wahlkampf, wonach beide Seiten einander in der Irak-Politik nicht länger herausfordern wollten. Diesen Pakt, heißt es, habe Gerhard Schröder nun gebrochen. Im Herbst hatte er sich den „deutschen Weg“ genehmigt, nun attestiert er den Amerikanern den „flachen Weg“ (Originalton vom Marktplatz in Goslar). Das wollen sich die Gescholtenen nicht länger bieten lassen. Im Außenministerium wird erwogen, Deutsche wie Franzosen vor den UN zu dem Bekenntnis zu nötigen, Saddam habe die Weltgemeinschaft betrogen und jene Resolution 1441 verletzt, der beide Länder öffentlich zugestimmt haben. „Wir wollen denen die Fakten unter die Nase reiben“, sagt ein Mitarbeiter Colin Powells.
„Die Fakten unter die Nase reiben“
Hinter den Kulissen tobt in der amerikanischen Regierung der Streit, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine zweite Resolution in den UN-Sicherheitsrat einzubringen. Nutzlos!, rufen die Unilateralisten, denen schon die erste Resolution als Irrweg vorkam. Der deutsch-französische Vorstoß ist ihnen Vorwand, allein durchzumarschieren.
Dennoch wird im Außenministerium seit Sonntagnacht – für alle Fälle – an einem Entwurf gearbeitet. Dieser Fall könnte schon am Freitag eintreten. Dann besucht Tony Blair den amerikanischen Präsidenten. Englischen Diplomaten zufolge kommt er mit einer genuin europäischen Botschaft: Den Inspektoren mehr Zeit geben! Und: Den Sicherheitsrat über den Krieg abstimmen lassen! Möglich, dass George Bush beiden Wünschen entgegenkommt. Seine Rede zur Lage der Nation hat diese Möglichkeit jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Denn Bush ist in einer prekären Lage. Er kann sich nicht leisten, dass sein wichtigster Verbündeter abspringt. Das könnte das Ende des Feldzuges bedeuten.
Bislang ist die Kriegs-Koalition „bemerkenswert mickrig“, wie Ivo Daalder aus der angesehenen Denkfabrik der Brookings Institution meint. Zwar behauptet Verteidigungsminister Rumsfeld treuherzig, ständig würden sich neue Länder freiwillig melden. Doch nach den Namen befragt, blockt er ab: Die Partner müssten ihre Politik selbst verkünden. Wahrscheinlich handelt es sich, wie ein CNN-Kommentator meint, keineswegs um eine „Koalition der Willigen“, sondern um eine „Koalition der Widerwilligen“.
53 Staaten hat Amerika um Hilfe gebeten. Bisher stellen nur ein paar Nachbarländer des Irak Basen. Die Tschechen schicken einen Chemiewaffen-Suchtrupp. Kampftruppen haben den Amerikanern nur Großbritannien und Australien zugesagt.
Diese Trias ist für Thomas Friedman, den Nahost-Kommentator der New York Times, kein Zufall, sondern Modell: drei Englisch sprechende Seemächte, mit einer Tradition von Auslandseinsätzen und berühmt-berüchtigten Spezialkommandos. Alle Länder liebten Rugby oder Football. Raue Spiele, in denen es darauf ankomme, dem Gegner wehzutun. Nations Allied to Stop Tyrants nennt Friedman diese Zukunfts-Allianz, kurz: NASTY. Bleibe es allein bei dieser übellaunigen NASTY, werde Amerika womöglich sein (derzeit 1,4 Millionen Mann starkes) stehendes Heer vergrößern müssen, meint Michael O’Hanlon, der Brookings-Militärexperte. Denn ohne europäische Hilfe könne Amerika die jahrelangen Aufräumarbeiten im besiegten Irak nicht bewältigen.
All die Kriegs- und Nachkriegsszenarien haben das Militär aufhorchen lassen. Seit Monaten übt eine Gruppe pensionierter Generale heftige Kritik an den Plänen. Da ist einmal Wesley Clark, der Nato-Befehlshaber im Kosovo-Krieg. An seiner Seite weiß er Norman Schwarzkopf, den Kommandeur im Golfkrieg, sowie dessen ehemaligen Untergebenen Anthony Zinni, jüngst Nahost-Unterhändler eines anderen skeptischen Generals, Colin Powell. Sogar aktive Generale, der Heereschef sowie der Kommandeur der Marine-Infanterie, haben sich öffentlich geäußert. Dem Chef des Zentralkommandos in Tampa, Tommy Franks, der den Krieg zu befehligen hätte, wurde von Donald Rumsfeld eigens ein Stellvertreter als Aufpasser beigesellt.
Die Generäle nennen ihre zivilen Chefs chickenhawks, also Hühnerfalken. Das sind im Kasernenhof-Slang jene Zivilisten im Pentagon, die selbst nie gedient haben, aber die Soldaten kriegslüstern in die Schlacht schicken. Die Militärs wollen sehen, dass ernsthaft versucht wird, den Krieg zu vermeiden. Und wenn er doch geführt werden muss, so wollen sie ihn nur mit einer großen Streitmacht und in großer Allianz führen. Bekommen haben sie bisher nur die Übermacht.
Die Skepsis von Militärs und Alliierten hat inzwischen die Bevölkerung erreicht. Zwar ratterte ein Mitarbeiter George Bushs vergangene Woche im Präsidentenflugzeug all jene Umfrageergebnisse herunter, die eine solide Mehrheit für den Krieg verheißen. Man kann die Daten aber auch anders lesen: Die Zustimmungsrate ist drastisch gefallen, um 10 bis 18 Prozentpunkte binnen eines Jahres. Siebzig Prozent der Amerikaner verstehen die Eile nicht. Sie wollen den UN-Inspektoren noch „mehrere Monate“ Zeit geben.
Die verblüffendste Blitz-Umfrage hat CNN veröffentlicht. Befragt, ob Amerika auch ohne französische und deutsche Zustimmung in den Krieg ziehen solle, antwortete nur ein Drittel mit Ja, aber zwei Drittel mit Nein. Darin zeigt sich das gewaltige Vertrauen der Amerikaner in die Urteilskraft europäischer Bevölkerungen und auch die enorme transatlantische Verbundenheit – zumindest unterhalb der Regierungsebene.
Die Daten über die Stimmung im Lande deuten auf eine Öffentlichkeit, die genau versteht, welch einzigartiges Ereignis ein Präventivkrieg wäre. Sie will nicht nur ihrem Präsidenten vertrauen müssen. Ihr reicht es nicht, wenn der Irak eine Resolution bricht. Sie will Beweise sehen. Sie will verstehen, warum Amerika bedroht ist und zuerst schießen muss. „Die Schwelle zum Präventivkrieg müsste besonders hoch sein“, sagt John Ikenberry, Professor für Internationale Beziehungen an der Georgetown-Universität. „Aber Präsentation und Argumente der Regierung spiegeln das nicht wider.“
Alle warten auf die Beweise
Deshalb steigt seit Wochen der Druck, einen „Adlai-Stevenson-Moment“ zu inszenieren. So hieß 1962 Amerikas UN-Botschafter, der in der Kuba-Krise die Fotos sowjetischer Raketenlieferungen an die Insel auf den Tisch warf. Damals brachte Amerika die Welt mühelos hinter sich. Diesmal hat sich besonders das Pentagon wochenlang geweigert, Spionage-Erkenntnisse über Saddams Waffenprogramm öffentlich zu machen.
Tatsächlich gibt es einen Zielkonflikt. Publizierte die Regierung Kenntnisse über die Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen, würden die Iraker die Kampfstoffe sofort verlegen. Die amerikanischen Truppen müssten auf ein Ziel im Kriege verzichten. Die Soldaten wären großer Gefahr ausgesetzt. Das zu verhindern ist die erste Aufgabe jeder Militärführung. Ähnlich argumentiert die CIA. Sie will ihre Agenten nicht gefährden.
Andererseits wird für George Bush die Schlacht um die Meinung der Weltöffentlichkeit nicht ohne bessere Belege über Saddams gegenwärtige Missetaten zu gewinnen sein. Deshalb hat er am Dienstagabend in seiner Rede angekündigt, „neue Geheimdiensterkenntnisse und Informationen“ über Saddams „laufendes Waffenprogramm“ preiszugeben.
Das Material, das zeigen soll, wie Waffen vor den Inspektoren versteckt werden, wird Außenminister Powell dem UN-Sicherheitsrat am 5. Februar übergeben. Allerdings sind amerikanische Agenten und Spionageflugzeuge nicht unfehlbar. Jüngst haben UN-Inspektoren die amerikanische Behauptung widerlegt, der Irak habe Aluminium-Zentrifugen gekauft, um Uran anzureichern. Präsident Bush hat dieselbe Behauptung am Dienstagabend trotzdem wiederholt.
Bald wird sich demnach herausstellen, wer angesichts neuer Fakten über Saddam besser dasteht: George Bush mit seiner unverhohlenen Vorfestlegung auf Krieg oder Gerhard Schröder mit seiner unverhohlenen Vorfestlegung auf ein Nein zum Krieg.
---
Warme Brüder und EU-nuchen
Alle reden vom Anti-Amerikanismus der Europäer. Aber was ist eigentlich mit dem Anti-Europäismus der Amerikaner? Beobachtungen im transatlantischen Streit der Vorurteile
Von Timothy Garton Ash
Zur Einstimmung zwei Beispiele: „Auf die Liste der politischen Gebilde, die ausersehen sind, im Urinal der Geschichte runtergespült zu werden, müssen wir auch die Europäische Union und Frankreichs Fünfte Republik setzen. Die Frage ist nur, wie unerquicklich ihre Auflösung werden wird“ (Mark Steyn, Jewish World Review, 1.5.2002). Oder: „Wollen Sie wissen, was ich wirklich über die Europäer denke? Ich denke, sie haben sich in jeder wichtigeren internationalen Frage der letzten 20 Jahre geirrt“ (Martin Walker, UPI, 13.11.2002).
Ob in Boston, New York, Washington, in Kansas oder im Bibelgürtel: Wenn von Europa und den Europäern die Rede ist, kommt Gereiztheit auf. Sie übertrifft die letzte Verstimmung in den frühen achtziger Jahren bei weitem. Um „die Europäer“ oder auch „die Euros“, „die Euroiden“, die „Eurowürstchen“ anzuprangern, taucht man die Schreibfedern in Säure. Richard Perle, Vorsitzender des Defense Policy Board und ein führender Theoretiker der Bush-Regierung, bemängelt, Europa habe seinen „moralischen Kompass“ verloren.
Europäer gelten als Weichlinge, schwach, querulantisch, heuchlerisch, zerstritten, zuweilen antisemitisch. Zu oft erweisen sie sich als antiamerikanische Beschwichtiger. Sie sind halt „Eurowürstchen“. Sie haben ihre Werte in multilateralen, transnationalen, säkularen und postmodernen Spielereien verloren. Statt für Verteidigung geben sie ihre Euros für Wein, Urlaub und aufgeblähte Wohlfahrtsstaaten aus. Und dann johlen sie von den Zuschauerrängen, während die USA das schwierige und schmutzige Geschäft erledigen, in der Welt für Sicherheit zu sorgen – auch für die Europäer. Die Amerikaner dagegen sind starke, prinzipiengeleitete Verteidiger der Freiheit, aufrecht im Dienst für das Vaterland, den letzten wahrhaft souveränen Nationalstaat der Welt.
Die Achse der Beschwichtigung
Die sexuelle Konnotation dieser Stereotypen wäre eine Untersuchung wert. Sehen antiamerikanische Europäer „die Amerikaner“ als tyrannische Cowboys, so sehen antieuropäische Amerikaner „die Europäer“ als warme Brüder. Der Amerikaner ist ein viriles, heterosexuelles Mannsbild, der Europäer ist weiblich, impotent oder kastriert.
Vor allem militärisch kriegen die Europäer keinen hoch. Das Wort „Eunuchen“ findet auch in der Form „EU-nuchen“ Verwendung. Die sexuelle Metaphorik schleicht sich sogar in durchdachtere Darstellungen der europäisch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten ein. Unter dem Titel Macht und Schwäche schrieb Robert Kagan einmal in der Policy Review: „Amerikaner sind vom Mars, Europäer von der Venus.“ Er zitierte damit den Bestseller, der das Verhältnis der Geschlechter auf die Formel gebracht hatte, Männer seien vom Mars, Frauen von der Venus.
Die schlimmsten Beschimpfungen sind für die Franzosen reserviert. Der alte englische Zeitvertreib des Franzosenschmähens drang in die amerikanische Populärkultur ein. Unter amerikanischen Jugendlichen grassiert ein seltsames Vorurteil: Die Franzosen waschen sich nicht. „Ich fühlte mich ganz schön schmutzig“, erzählte eine Studentin von ihrer Frankreich-Reise. „Trotzdem warst du immer noch sauberer als die französischen Typen“, fügte ein anderer hinzu. Der Herausgeber von National Review Online und selbst ernannte konservative „Frosch-Verächter“ Jonah Goldberg hat die Bezeichnung der „Käse fressenden Äffchen mit Totstellreflex“ populär gemacht, die schon in einer Folge der Simpsons auftauchte.
Der amerikanische Antieuropäismus ist jedoch nicht mit dem europäischen „Antiamerikanismus“ identisch. Man muss zwischen einer legitimen und informierten Kritik an der EU und einer tiefer sitzenden, eingefleischten Feindseligkeit gegenüber Europa unterscheiden. So wie amerikanische Journalisten zwischen legitimer, informierter europäischer Kritik an der Bush-Regierung und Antiamerikanismus oder auch zwischen legitimer europäischer Kritik an Scharons Regierungspolitik und Antisemitismus unterscheiden sollten – was sie aber oft nicht tun. Die Frage lautet jedenfalls: Wo verläuft die Grenze?
Wir müssen uns vor allem Sinn für Humor bewahren. Ein Grund, warum die Europäer gern über George W. Bush lachen, sind seine lustigen Äußerungen (oder angeblichen Äußerungen). Zum Beispiel: „Das Problem mit den Franzosen ist doch, dass sie kein Wort für entrepreneur haben.“ Die Amerikaner wiederum lachen auch deshalb gern über die Franzosen, weil es in einer langen angelsächsischen Tradition des Spottens steht, die bis Shakespeare zurückreicht.
Doch auch das ist nicht ohne. Konservative beleidigen manchmal humorvoll, halb ernst oder ziemlich ernst. Wenn man protestiert, antworten sie: „Das war natürlich nur ein Scherz!“ Humor arbeitet mit der Übertreibung und spielt mit Stereotypen. Doch würde man lachen, wenn ein europäischer Journalist „die Juden“ als „Matzen fressende Äffchen mit Totstellreflex“ bezeichnete? Der Kontext ist selbstverständlich ein anderer: Einen Völkermord an den Franzosen hat es in den USA nicht gegeben. Das Gedankenexperiment gibt dennoch zu denken.
Der Antieuropäismus bildet keine Parallele zum Antiamerikanismus. Das Leitmotiv des Antiamerikanismus ist mit Neid durchsetzter Groll; die des Antieuropäismus mit Verachtung durchsetzte Gereiztheit. Antiamerikanismus ist für einzelne Länder geradezu eine Obsession – besonders für Frankreich. Der Antieuropäismus ist weit davon entfernt, eine amerikanische Obsession zu sein. Tatsächlich ist die am weitesten verbreitete amerikanische Haltung gegenüber Europa eine leichte, wohlwollende Gleichgültigkeit, untermischt von beeindruckender Unwissenheit.
Europa ist selbst denjenigen, die den Kontinent gut kennen, seit dem Ende des Kalten Kriegs gleichgültiger geworden. Europa wird weder als starker Verbündeter noch, wie China, als ein ernst zu nehmender Konkurrent angesehen. „Europa ist ein Altersheim“ oder, wie der Experte der Konservativen, Tucker Carlson, in einer politischen Talkshow auf CNN meinte: „Wen schert es, was die Europäer denken? Die EU vertut ihre Zeit damit, dafür zu sorgen, dass britische Wurst in Kilo und nicht in Pfund verkauft wird. Der ganze Kontinent ist für amerikanische Interessen zunehmend irrelevant.“
Amerikanische Kritiker Europas stehen Europa jedoch keineswegs gleichgültig gegenüber. Sie kennen Europa – anscheinend hat die Hälfte von ihnen in Oxford oder Paris studiert – und beeilen sich stets, ihre europäischen Freunde zu erwähnen. Wie die europäischen Kritiker der USA immer heftig bestreiten, dass sie antiamerikanisch eingestellt seien („Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe das Land und die Leute“), bestehen auch die Amerikaner ausnahmslos darauf, dass sie überhaupt nicht antieuropäisch seien.
Antiamerikanismus und Antieuropäismus sind Pole des politischen Spektrums. Der europäische Antiamerikanismus findet sich hauptsächlich auf der Linken, der amerikanische Antieuropäismus auf der Rechten. Die meisten amerikanischen Europa-Kritiker sind Neokonservative und benutzen gegen Europa dieselbe Kampfrhetorik wie gegen Liberale. William Kristol, einer dieser Neokonservativen, macht „eine Achse der Beschwichtigung“ aus, „die sich von Riad bis Brüssel und hin zum Foggy Bottom (Außenministerium) erstreckt“. Es gibt zwei Gruppierungen, die um Präsident Bushs Gehör in der Irak-Frage konkurrieren: die „Cheney-Rumsfeld-Gruppe“ und die „Powell-Blair-Gruppe“, die eine radikal, die andere etwas gemäßigter. Für atlantisch orientierte Europäer ist das aber kein Trost, denn selbst unter den liberalen Europa-Kennern des Außenministeriums herrscht herbe Enttäuschung über Europa. Ihr Schlüsselerlebnis war Europas entsetzliche Unfähigkeit, den Genozid an einer viertel Million bosnischer Muslime auf dem Balkan zu verhindern. Europa kann nicht einmal seine Außen- und Sicherheitspolitik koordinieren, sodass selbst ein Streit zwischen Spanien und Marokko um eine unbewohnte Insel von Colin Powell geschlichtet werden musste.
Kein Respekt vor den Griechen
Es gab immer eine starke Strömung des Antieuropäismus in den USA. „Amerika wurde als Gegenmittel zu Europa geschaffen“, stellt Michael Kelly, der ehemalige Herausgeber des Atlantic Monthly, fest. Für Millionen Amerikaner war Europa im 19. und 20. Jahrhundert der Ort, dem man entfloh. Trotzdem war Europa auch Gegenstand dauernder Faszination. Vor allem zwei europäischen Ländern wollte man nacheifern und sie übertreffen – England und Frankreich. „Jedermann hat zwei Länder“, sagte Thomas Jefferson, „sein eigenes und Frankreich.“ Wann sind die USA von dieser sympathischen Überzeugung abgekommen?
Fünfzig Jahre lang, von 1941 bis 1991, führten Amerikaner und Westeuropäer Krieg gegen einen gemeinsamen Feind: zuerst gegen den Nationalsozialismus, dann gegen den Sowjetkommunismus. Das war die Glanzzeit des geopolitischen „Westens“. Während des Kalten Kriegs kam es allerdings auch zu transatlantischen Spannungen. Einige der heutigen Stereotypen bildeten sich in den Kontroversen der achtziger Jahre um die Aufstellung von Cruise-Missiles und Pershings – und um die amerikanische Außenpolitik in Zentralamerika und Israel.
Der Australier Owen Harries sah vor fast zehn Jahren in einem Artikel in Foreign Affairs etwas vorher, dessen Zeugen wir womöglich jetzt sind: den Niedergang „des Westens“, jenes Westens als einer verlässlichen geopolitischen Achse, die mit dem Verschwinden eines gemeinsamen Feindes zerbricht. Europa war die Hauptbühne des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs, es ist nicht der Mittelpunkt des „Kriegs gegen den Terrorismus“. Die Machtlücke ist größer geworden.
Die USA sind nicht nur die einzige Supermacht der Welt. Sie sind eine Hypermacht, deren Militärausgaben bald das Volumen der 15 nach ihr mächtigsten Staaten insgesamt erreicht haben werden. Die EU hat ihre vergleichbare ökonomische Stärke nicht annäherungsweise in militärische Stärke oder außenpolitischen Einfluss umgesetzt.
Folgt man Robert Kagan, dann bewegt sich Europa in eine kantianische Welt der „Gesetze und Regeln und transnationalen Verhandlungen“ hinein, wohingegen die USA in einer hobbesschen Welt verharren, in der internationale (auch liberale) Ziele nach wie vor durch militärische Stärke errungen werden.
Stimmt das? Kagan rückt Europa in allzu günstiges Licht. Seine Formel hebt etwas in den Rang einer überlegten, geschlossenen Konzeption, was in Wirklichkeit Folge konfusen Herumexperimentierens und nationaler Unterschiede ist. Weitere Frage: Möchten Europäer und Amerikaner, dass Kagans These zutrifft? Die Antwort scheint „ja“ zu lauten, denn nicht wenige amerikanische Ideologen liebäugeln damit, während nicht wenige europäische Ideologen gern von sich glauben machen, sie seien immer schon „Kantianer“ gewesen. Die Rezeption von Kagans These ist also Teil ihrer eigenen Geschichte.
Da die EU vor ihrer Erweiterung nach einer klareren Identität sucht, ist die Versuchung groß, sich im Kontrast zu definieren: Europa klärt sein Selbstbild, indem es auflistet, worin es sich von Amerika unterscheidet. Den Amerikanern gefällt es aber nicht, als das „Andere“ bestimmt zu werden (wem gefällt das schon?). Frankreich und die USA sind die Nationen, die sich beide als Träger einer Mission in Sachen Universalismus und Zivilisation betrachten. Es gibt eine nicht unbedingt französische, aber europäische Version dieser Mission, ein „EU-topia“ der transnationalen, im Recht begründeten Integration, und die kollidiert derzeit äußerst heftig mit der neuesten Version einer amerikanischen Mission.
Jede Seite glaubt, ihr Modell sei besser. Dies gilt nicht nur für die konkurrierenden Modelle der internationalen Politik, sondern auch für die Modelle des demokratischen Kapitalismus: Es betrifft die unterschiedlichen Anteile von freiem Markt und Wohlfahrtsstaat, von individueller Freiheit und sozialer Solidarität. Das amerikanische Misstrauen gegenüber Europa war im 19. und 20. Jahrhundert noch mit Bewunderung und Faszination gemischt. Es gab einen kulturellen amerikanischen Minderwertigkeitskomplex. Diesen Minderwertigkeitskomplex gibt es kaum noch. Er hat sich seit dem Ende des Kalten Kriegs verflüchtigt. Das neue Rom verspürt keine Ehrfurcht mehr vor den alten Griechen.
Die Differenz wurde nach dem Fall der Berliner Mauer acht Jahre lang durch den Ehren-Europäer im Weißen Haus, durch Bill Clinton, verdeckt. 2001 indessen zog George W. Bush, das Geschenk für jeden antiamerikanischen Karikaturisten, mit einer unilateralen Agenda in das Weiße Haus ein, bereit, gleich mehrere internationale Abkommen über Bord zu werfen. Nach dem 11. September definierte er seine Präsidentschaft als eine Präsidentschaft in Kriegszeiten. Der „Krieg gegen den Terrorismus“ verstärkte die Tendenz in der republikanischen Elite, an eine, wie Robert Kaplan sagt, „Kriegerpolitik“ zu glauben, mit einem kräftigen Schuss fundamentalistischen Christentums – etwas, das dem säkularisierten Europa abgeht.
Nahostkonflikt als Wurzel
Die amerikanische Frage an die Europäer lautet also: „Seid ihr mit uns in den Schützengräben oder nicht?“ Zuerst war die Antwort ein lautes Ja. Jeder kennt die Überschrift von Le Monde, Wir alle sind Amerikaner. Doch eineinhalb Jahre später ist Tony Blair das einzige europäische Staatsoberhaupt, von dem die Amerikaner glauben, er liege mit ihnen im Graben. In Washington haben viele den Eindruck, dass die Franzosen zu ihren alten antiamerikanischen Einstellungen zurückgekehrt sind und dass der deutsche Kanzler Gerhard Schröder seine Wiederwahl im September 2002 nur durch zynische Ausnutzung antiamerikanischer Reflexe gewann.
Wann und wo haben sich europäische und amerikanische Ansichten endgültig voneinander entfernt? Mit der Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts im Nahen Osten. Der Nahe Osten ist Quelle wie Katalysator für das, was eine Abwärtsspirale des europäischen Antiamerikanismus und des beginnenden amerikanischen Antieuropäismus zu werden droht.
Der Antisemitismus in Europa und seine offensichtliche Verbindung mit der Kritik an Scharons Regierungspolitik ist von konservativen Kolumnenschreibern und Politikern in den USA mit ätzenden Kommentaren gewürdigt worden.
Einige dieser Kritiker sind selbst nicht bloß stark proisraelisch, sondern auch „natürliche Likud-Anhänger“, wie ein liberaler jüdischer Journalist das nannte. Propalästinensische Europäer, die aufgebracht sind, dass ihre Kritik an Scharon als Antisemitismus etikettiert wird, sprechen von einer mächtigen „jüdischen Lobby“ in den USA. Das wiederum bestätigt den schlimmsten Verdacht amerikanischer Likud-Anhänger, was den europäischen Antisemitismus betrifft. Und so geht es immer weiter.
Neben dem Gewirr der Vorurteile gibt es natürlich auch reale europäisch-amerikanische Unterschiede in der Sicht auf den Nahen Osten. Europäische Ideologen denken oft, eine Verhandlungslösung des israelisch-palästinensischen Konflikts trüge mehr zu einem langfristigen Sieg über den Terrorismus bei als ein Krieg gegen den Irak. Wichtiger ist hier aber, dass der Kalte Krieg Amerika und Europa zusammengeführt hatte, sie der „Krieg gegen den Terrorismus“ im Nahen Osten jedoch auseinander bringt. Nüchtern betrachtet, ist diese Uneinigkeit dumm.
Europa mit seiner wachsenden islamischen Bevölkerung hat ein vitaleres Interesse an einem friedlichen, wohlhabenden und demokratischen Nahen Osten, als es die USA haben. Augenblicklich scheint es, als würde ein neuer Golfkrieg die Kluft zwischen Europa und Amerika noch vergrößern. Und selbst wenn es zu keinem Krieg kommen sollte, kann der Nahe Osten weiterhin den Strudel bilden, in dem ein wirklicher oder angeblicher europäischer Antiamerikanismus einen wirklichen oder angeblichen amerikanischen Antieuropäismus anheizt, der wiederum weiteren Antiamerikanismus hervorruft – und beide von Vorwürfen eines europäischen Antisemitismus verschärft werden.
Eine Änderung ließe sich durch Anstrengungen auf beiden Seiten des Atlantiks – oder durch einen Regierungswechsel in Washington im Jahr 2005 oder 2009 herbeiführen. Zuvor kann jedoch großer Schaden angerichtet werden, und die derzeitige transatlantische Entfremdung ist auch Ausdruck der erwähnten tiefer reichenden historischen Trends. Der amerikanische Antieuropäismus existiert, und seine Boten sind vielleicht die Schwalben eines langen, schlechten Sommers.
Der englische Historiker Timothy Garton Ash lehrt in Oxford und wurde bei uns durch seine Bücher über das Ende des Ostblocks bekannt. Übersetzt von Karin Wördemann
ALLE ARTIKEL: DIE ZEIT 06/2003
sorry, leicht angetrunken.
die frage heißt doch eigentlich für die us-administration nur:
wie schaffen wir das, dass die "alliierten" am besten alle einschließlich deutschland (die haben immer gut bezahlt) die neue kriegerische auseinandersetzung bezahlen und wir daran verdienen.
die "kuweit-befreiung" hat uns deutsche doch nur 17,1 mrd $ gekostet.
rent an army??????
wir haben keine us-armee zum golf bestellt un wollen die jungs auch nicht bezahlen.
ich hoffe bush und seine jungs werden das, auch wenn sie die weltpresse noch stärker manipulieren, verstehen.
ich hoffe, die kommen nicht auf das schmale brett uns, zur legitimierung ihrer aktivitäten, noch ein attentat auf das "white house" oder "den reichstag" zu servieren.
die amis haben in den letzten jahren schon zu viel gelogen um ihre mititärischen aktivitäten vor der weltöffentlichkeit zu legitimieren.
ocjm1
die frage heißt doch eigentlich für die us-administration nur:
wie schaffen wir das, dass die "alliierten" am besten alle einschließlich deutschland (die haben immer gut bezahlt) die neue kriegerische auseinandersetzung bezahlen und wir daran verdienen.
die "kuweit-befreiung" hat uns deutsche doch nur 17,1 mrd $ gekostet.
rent an army??????
wir haben keine us-armee zum golf bestellt un wollen die jungs auch nicht bezahlen.
ich hoffe bush und seine jungs werden das, auch wenn sie die weltpresse noch stärker manipulieren, verstehen.
ich hoffe, die kommen nicht auf das schmale brett uns, zur legitimierung ihrer aktivitäten, noch ein attentat auf das "white house" oder "den reichstag" zu servieren.
die amis haben in den letzten jahren schon zu viel gelogen um ihre mititärischen aktivitäten vor der weltöffentlichkeit zu legitimieren.
ocjm1
"noch ein attentat auf das "white house" oder "den reichstag" zu
servieren."
Wo ist da das Bedrohungspotential?...LOL
servieren."
Wo ist da das Bedrohungspotential?...LOL

manager magazin 12/2002

Lob der Eitelkeit
Von Holger Rust
In Zeiten von Größenwahn und Raffgier ist eine wichtige Tatsache fast in Vergessenheit geraten - ein selbstbewusstes Ego, ja sogar ein wenig Eitelkeit und Narzissmus, sind wichtige Triebkräfte für den beruflichen Erfolg.
Klassentreffen, o Mann. Da sitzt du nun seit zwei Stunden mit diesem ehemaligen Mitschüler am Tisch, und der redet und redet und redet und hat nur ein Thema: sich selbst. Seine Biografie, seine Erfolge, seine Pläne, seine ich weiß nicht was. Und dass er es ist, der auf Geschäftspapieren unten links signieren darf, an der wichtigsten Stelle, wie jeder weiß.
Er redet so lange, bis es ihm selbst peinlich wird und er - aufatmen - sich unterbricht. "Du lieber Himmel, da rede ich die ganze Zeit über mich, wie unhöflich. Lass uns doch mal über dich reden: Wie hat dir der Artikel im manager magazin über mich gefallen?"
Sollst du nun lachen, hysterisch aufschreien oder weinen?
Aber für die Antwort bleibt gar keine Zeit. Plötzlich wird dir klar: Das Ego ist die treibende Kraft des Erfolgs. Das große "M" steht nicht mehr für Management. Nicht mehr für Modelle und Methoden. Es steht für kreativen Mut und individuelle Meisterschaft, geboren aus der Lust an der Selbstdarstellung großartiger Leistungsfähigkeit. Diese Eitelkeit, dieser Narzissmus, dieser Drang zum Erfolg, der mit deinem Namen verbunden ist, lässt dich all das aushalten, was ein Spitzenjob heute erfordert: Anspannung, Zeitnot, Verlust des Privatlebens, Druck und Hektik.
Gleichzeitig aber raunt die warnende Stimme des professionellen Gewissens: Wenn du so wirst wie dieser Typ da neben dir, landest du dann nicht früher oder später in einer unkontrollierten Überheblichkeit?
Doch schon verweht auch dieser Gedanke wieder, und die Porträts der Erfolgreichen erscheinen auf der Projektionswand deiner Zukunftsträume. Es sind die Köpfe derer, die eitel sind und erfolgreich, große Namen der deutschen Wirtschaft.
Diese neuen Siegertypen, diese unübersehbaren Egos beflügeln die Karriereträume von jungen Leuten, so viel ist schon mal sicher. In einer Befragung des manager magazins im Jahr 2000 nannten 500 Uni-Absolventen ihre Vorbilder. Da standen sie alle auf den vorderen Plätzen, die großen Namen: DaimlerChrysler-Lenker Jürgen Schrempp, Ron Sommer, zu jener Zeit noch Chef der Deutschen Telekom, Ferdinand Piëch, damals Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns, Wendelin Wiedeking, der menschgewordene Porsche. Ebenfalls ganz oben auf der Liste rangierte Thomas Haffa , damals noch Chef von EMTV.
Mal ehrlich: Wer wollte nicht so sein? Mitten im Lichtgewitter der Fotografen stehen, dass es ohne Ray Ban kaum auszuhalten ist? Du weißt schon, diese Sonnenbrille aus "Men in Black", die amerikanische Filmpolizisten und smarte New-Economy-Manager so unglaublich cool aussehen lässt. Solche Egos braucht das Land, hieß es damals.
Und nun?
Ron Sommer. Wie schnell zerstob der Traum vom Reichtum für alle, dessen Garant der Telekom-Chef sein sollte. Und wie plötzlich endete die Karriere des einst hofierten Börsenlieblings.
Thomas Haffa. Einer der bestaussehenden Bankrotteure. Großmutters Spruchweisheiten scheinen so falsch nicht: Hochmut kommt vor dem Fall.
Genau diese Typen wecken deinen Zweifel, du spürst das Dilemma:
Ohne Eitelkeit kein Erfolg. Doch wenn du die Grenze überschreitest, diese fast unsichtbare, gestrichelte graue Linie zwischen notwendiger Eitelkeit und drohendem Größenwahn, wirst du scheitern.
Diese kleine Schramme in der Eitelkeit, weil dein ehemaliger Schulkamerad links unterschreiben darf - markiert sie nicht längst jenen Schritt, der unweigerlich über die Grenze führen wird, wo das selbstbewusste Ego in peinliche Eitelkeit übergeht? Bist du nicht längst gefährdet, für den äußerlichen Erfolg dein wahres Ego unbotmäßig aufzuputzen und dich zu korrumpieren?
Dieser Haffa hat seinen Laden ja nicht mit Absicht ins Aus manövriert: Da drängt sich schon die Frage auf: An welchem Punkt verlor er die Kontrolle? Und die anderen, die jüngst in den Schlagzeilen standen: In welchem Moment übertrat der 1999 noch als erfolgreichster Manager der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte gefeierte Enron-Chef Kenneth Lay die gestrichelte Linie vom übersteigerten Selbstbewusstsein zur zerstörerischen Egomanie?
Man sieht es ja am Anfang nicht. Doch dann übersetzt sich tief innen in der Seele mancher Supermanager der öffentliche Jubel in das Gefühl, auserwählt zu sein, befreit von allen Regeln der schnöden wirtschaftlichen Normalität.
Von diesem Zeitpunkt an geht es schnell.
Die Ansammlung von Jasagern, die sich wechselseitig bestätigen, schwächt das Krisenbewusstsein. Fusionen, Expansionen, Prestigeobjekte werden kritiklos beklatscht. Die Anmaßungen wachsen, bis hin zur himmelstürmenden Omnipotenzfantasie, wie viele New-Economy-Ikarusse sie goutierlich pflegten, bis ihnen die Flügel verbrannten.
Doch auf der Projektionsfläche der Karriereträume glänzten ja auch Namen, die nicht nur für Eitelkeit standen, sondern für dauerhaften Erfolg. Wendelin Wiedeking zum Beispiel, der Porsche-Chef.
Wie der sich sonnt im Applaus seiner Auftritte, seiner auf Wirkung hin maßgeschneiderten Rhetorik. Wie der es genoss, sich im feinen Hamburger "Atlantic Hotel" für den ersten Platz der Imageprofile des manager magazins von der Elite der deutschen Wirtschaft feiern zu lassen, und zwar zum zweiten Mal in Folge.
Aber Wiedekings Eitelkeit riegelt, anders als die Rassemotoren seiner Autos, bei einer gewissen Geschwindigkeit ab. "Ich weiß, dass es nun gefährlich wird", zügelte er sich selbst in seiner Dankesrede, wohl wissend, dass die Neider frohlocken werden, wenn es beim nächsten Mal nur zum zweiten Platz reicht. Eitelkeit mit eingebautem ESP, dem Elektronischen Stabilitätsprogramm, das ein Auto daran hindert, aus der Kurve zu fliegen.
Nun ja, mit großartigen Ausnahmepersönlichkeiten und schillernden Marken lässt sich gut argumentieren. Aber führt eine solche Show nicht in die Irre? Was ist in den Biotopen des ganz normalen Alltags in Deutschland? Wie ist es da?
Nicht anders.
Es gibt ungezählte überzogene Patriarchen und selbstherrliche Bosse, die sich auf Kosten ihrer Mitarbeiter profilieren, miese Stimmung verbreiten und böse gucken, wenn einer ein größeres Auto fährt als sie.
Aber da sind auch die anderen, die sich bremsen können, die es halten wie Wiedeking.
Was ist ihr Geheimnis?
Nichts Besonderes. Keine Morgengebete um Bescheidenheit, keine Askese in griechischen Bergklöstern. Was wir da draußen finden, sind normale Typen. Sie sind selbstbewusst bis zur Eitelkeit und mitunter eitel bis an den Rand des Narzissmus.
Doch mit einem ganz einfachen Mittel haben sie sich im Griff: Ihr Selbstbewusstsein gründet im nachweislichen Erfolg ihrer beruflichen Aufgabe. Es scheint zwar manchmal, als ginge es um bloße Selbstinszenierung. Aber der erste Eindruck kann täuschen.
Säße da zum Beispiel statt dieses ehemaligen Schulkameradenein Wolfgang Grupp (60) an deinem Tisch, alleiniger Inhaber der Trigema T-Shirt-Fabrik in Burladingen auf der Schwäbischen Alb, dann wäre dieser Eindruck unvermeidlich.
Selbst in der Werbung (du erinnerst dich, das ist die Werbung mit dem Schimpansen) tritt der Chef als sein eigenes Model auf. Braun gebrannt, gepflegt und sportlich sitzt er einem gegenüber. Du würdest verwundert zur Kenntnis nehmen, dass nicht einmal die Maßkleidung wagt, eine einzige Falte zu werfen.
Mensch, ist der eitel, würdest du denken, und dich bestätigt sehen, wenn du seiner Einladung ins Unternehmen nach Burladingen folgen würdest. In der kurzen Wartezeit im Treppenhaus hättest du ausgiebigst Gelegenheit, den Chef zu bewundern: Überall hängen Fotos der Grupp-Familie, von der Hochzeit mit der 24 Jahre jüngeren Frau, von den blitzsauberen Kindern. Broschüren über Firmenjubiläen zeigen ihn, Grupp, mit der Familie die Spaliere der Mitarbeiter abschreitend.
Wer die Inszenierung des Stücks "Grupp" lediglich als eitle Selbstdarstellung versteht, der nimmt nur das oberflächliche Bild wahr: Grupps Liebe zur Publicity resultiert aus der Lust am Beweis, dass mittelständische Textilunternehmen auch in Deutschland viel Geld verdienen können und dass er, der Unternehmer Grupp, diesen Beweis leibhaftig verkörpert. Seine Selbstdarstellung ist untrennbar verbunden mit dem Erfolg seiner Firma. Der Burladinger Fabrikant würde es als Verletzung seines ausladenden Selbstbewusstseins empfinden, wenn er auch nur einen Mitarbeiter entlassen müsste.
Oder stell dir vor, du säßest mit einem Herbert Detharding (64) an einem Tisch, vielleicht in einem kleinen italienischen Restaurant in Hamburg. Er würde von seinen großartigen Erfolgen berichten. Aber er würde auch ein sehr wirksames Mittel gegen die Verführung durch den Jubel der Umgebung, der Analysten und Shareholder schildern: beizeiten die Mitarbeiter qualifizieren, Talente entwickeln und rechtzeitig dafür sorgen, dass ein Headhunter den richtigen Nachfolger auftreibt.
40 Jahre dauerte Dethardings Karriere, vom Lehrling bei Mobil Oil bis zum Chef der BASF-Tochter Wintershall. Von 1991 bis 2001 war er Vorstandsvorsitzender, jetzt ist er pensioniert. Eitelkeit sei ihm fremd, Statussymbole bedeuteten ihm nichts, sagt er. Selbst als CEO habe er dienstlich lange Zeit die Mercedes-E-Klasse gefahren. "Passte von der Größe einfach besser zu mir." Auch sonst: keine großartigen Inszenierungen.
Aber wenn es um den Erfolg seiner Arbeit geht, gibt es klare Ansagen: Das Unternehmen sei unter seiner Leitung "um Größenordnungen besser" geworden, das operative Ergebnis von 100 Millionen auf 2,5 Milliarden Mark gestiegen. Der wichtigste Punkt, das betont Detharding - und du merkst, dass er darauf sehr stolz ist -, war allerdings die nahtlose Übergabe der Geschäfte. Nicht nur für die Position des Vorstandsvorsitzenden, sondern auch auf den Ebenen darunter. Nun regieren die und fahren selbstverständlich S-Klasse als Dienstwagen.
Detharding macht kein Hehl aus der Tatsache, dass er sich an seine neue Rolle als Ruheständler noch nicht gewöhnt hat: "Es ist schwer, in der Bedeutungslosigkeit leben zu müssen." Doch er wird den Fehler vieler seiner Leidensgenossen nicht wiederholen und den Nachfolgern ins Geschäft hineinpfuschen. Sie würden ihn als störend empfinden, und das will er nicht, dazu ist er dann doch zu eitel.
Diese Haltung ist allerdings nicht allein vorsorgliche Eitelkeit. Sie ist auch eine Sache des Charakters: Ein Mensch mit ausgereiftem Ego schafft die Grenzziehung zwischen dem Anspruch fortgesetzter Bedeutung und der Selbsterkenntnis, dass er im Grunde nur Träger einer opulent ausstaffierten Position war und ist. Wunderbare Annehmlichkeiten, große Autos, Reisen, Prominenz, gelten nicht in erster Linie dem Einzelnen, sondern dem Unternehmen, das er zu vertreten hat. Beizeiten loslassen zu können, das zeugt vom Charakter eines selbstbewussten Egos.
Charakter? Du lieber Himmel!
Erneut kneift das Dilemma: Viele der umstrittenen Charaktere sind doch gerade mit ihrem Machtstreben, mit ihrer Egozentrik, mit ihrem kalten Narzissmus und ihren gigantischen Ansprüchen so weit nach oben gekommen, dass ihnen nun nichts mehr passieren kann, selbst wenn sie scheitern.
Was würde zum Beispiel für Kajo Neukirchen oder Jürgen Schrempp - stets zitierte Figuren, wenn es um das Thema Ego und Eitelkeit geht - das Zerbersten ihrer Perspektive bedeuten? Eine persönliche Niederlage vielleicht.
Was bedeutete das Aus für Haffa?
Der wird doch schon wieder in den Klatschspalten der Boulevardpresse abgelichtet - strahlend grüßt er (mit einem mutmaßlichen Vermögen von 250 Millionen Euro im Hintergrund) von Bord einer bronzefarbenen Jacht namens "Tiketitoo". Mit Ray Ban auf der Nase und einer Ersatzsonnenbrille in der Hand. Die südliche Sonne des dolce far niente ist grell.
Solche Misserfolge würdest du gern mehrere haben, oder?
Ethik?
Junger Mann!
Verehrteste!
Ethik!
Wir sind in einem Spiel. Reality-Monopoly.
Spiel mit.
Stell dir vor, du wärst an der Stelle von Klaus Esser, mit einer Abfertigung von rund 30 Millionen Euro. Von den Fällen gibt es ja noch ein paar. Lebenslänglich verurteilt zu Champagner im Chatöchen in einem sonnigen Landstrich in Frankreich.
Der Weg ist gefährlich, o ja.
Aber er ist gangbar.
Die Welt ist eben so.
Doch die Frage, die jeder für sich beantworten muss, ist die: Bist du so? Hart, machiavellistisch, kriegerisch und nichts als rücksichtslos erfolgreich? Oder einer dieser Anpassungsvirtuosen, die der Philosoph Gerd Achenbach als situationskonforme windige Chamäleons bezeichnet hat?
Du meinst, dass du ein solches Leben aushalten kannst? Okay. Dann sind auch die Konsequenzen klar: Jasager um dich herum. Du wirst niemals mehr wissen, ob es irgendjemand ehrlich meint, wenn er dir zuhört.
Bevor du dich für diesen Weg entscheidest, blättere erst einmal in den Krankenakten vieler deiner Vorbilder: Paranoide Zustände, emotionale Verkümmerung, zwangsneurotisch um Kontrolle der Umgebung bemüht, von Misstrauen zerfressen, depressiv und mühsam von persönlichen Coaches aufrechterhalten.
Sieht so Erfolg aus?
Erfolg sieht anders aus.
Nicht zufällig wabert das Thema Work-Life-Balance durch die Gedanken der Spitzenkräfte. Wer bei diesem Schlagwort allein an die lieben Kinderchen daheim denkt, die man häufiger mal sehen möchte, hat den Kern des Problems missverstanden. Es geht um die seelische Gesundheit. Die ist ohne solides Selbstbewusstsein nicht zu denken. Eitelkeit, Narzissmus, himmelstürmender Wahnsinn utopischer Pläne und sei es die Herrschaft über den Weltmarkt, ja, ja und noch mal ja. Für jeden Berufseinsteiger und jungen Professionellen gehört der Traum von der Großartigkeit zum Leben. Nur so kann ein unverwechselbares Lebenswerk entstehen, das untrennbar mit deiner Person verbunden ist.
Hängst du allerdings um bloßer Karrierestürme willen dein Ego an die Großartigkeit einer Position, reihst dich ein in die jasagende Gefolgschaft führender Egomanen, um vielleicht etwas abzukriegen vom Glanz des Status und seiner Symbole, wirst du nie etwas anderes sein als eine austauschbare Charaktermaske.
Irgendwann wirst du mit Äußerlichkeiten herumprahlen - wie dieser geschwätzige Schulkamerad an deinem Tisch, der sich nicht einkriegen kann, dass er links unterschreiben darf, dieser Blödmann. Es wird das letzte Warnzeichen sein, kurz vor dem Totalverlust deines Egos.
sehr lesenswert übrigens auch der Artikel:
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,233614,00.…

Lob der Eitelkeit
Von Holger Rust
In Zeiten von Größenwahn und Raffgier ist eine wichtige Tatsache fast in Vergessenheit geraten - ein selbstbewusstes Ego, ja sogar ein wenig Eitelkeit und Narzissmus, sind wichtige Triebkräfte für den beruflichen Erfolg.
Klassentreffen, o Mann. Da sitzt du nun seit zwei Stunden mit diesem ehemaligen Mitschüler am Tisch, und der redet und redet und redet und hat nur ein Thema: sich selbst. Seine Biografie, seine Erfolge, seine Pläne, seine ich weiß nicht was. Und dass er es ist, der auf Geschäftspapieren unten links signieren darf, an der wichtigsten Stelle, wie jeder weiß.
Er redet so lange, bis es ihm selbst peinlich wird und er - aufatmen - sich unterbricht. "Du lieber Himmel, da rede ich die ganze Zeit über mich, wie unhöflich. Lass uns doch mal über dich reden: Wie hat dir der Artikel im manager magazin über mich gefallen?"
Sollst du nun lachen, hysterisch aufschreien oder weinen?
Aber für die Antwort bleibt gar keine Zeit. Plötzlich wird dir klar: Das Ego ist die treibende Kraft des Erfolgs. Das große "M" steht nicht mehr für Management. Nicht mehr für Modelle und Methoden. Es steht für kreativen Mut und individuelle Meisterschaft, geboren aus der Lust an der Selbstdarstellung großartiger Leistungsfähigkeit. Diese Eitelkeit, dieser Narzissmus, dieser Drang zum Erfolg, der mit deinem Namen verbunden ist, lässt dich all das aushalten, was ein Spitzenjob heute erfordert: Anspannung, Zeitnot, Verlust des Privatlebens, Druck und Hektik.
Gleichzeitig aber raunt die warnende Stimme des professionellen Gewissens: Wenn du so wirst wie dieser Typ da neben dir, landest du dann nicht früher oder später in einer unkontrollierten Überheblichkeit?
Doch schon verweht auch dieser Gedanke wieder, und die Porträts der Erfolgreichen erscheinen auf der Projektionswand deiner Zukunftsträume. Es sind die Köpfe derer, die eitel sind und erfolgreich, große Namen der deutschen Wirtschaft.
Diese neuen Siegertypen, diese unübersehbaren Egos beflügeln die Karriereträume von jungen Leuten, so viel ist schon mal sicher. In einer Befragung des manager magazins im Jahr 2000 nannten 500 Uni-Absolventen ihre Vorbilder. Da standen sie alle auf den vorderen Plätzen, die großen Namen: DaimlerChrysler-Lenker Jürgen Schrempp, Ron Sommer, zu jener Zeit noch Chef der Deutschen Telekom, Ferdinand Piëch, damals Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns, Wendelin Wiedeking, der menschgewordene Porsche. Ebenfalls ganz oben auf der Liste rangierte Thomas Haffa , damals noch Chef von EMTV.
Mal ehrlich: Wer wollte nicht so sein? Mitten im Lichtgewitter der Fotografen stehen, dass es ohne Ray Ban kaum auszuhalten ist? Du weißt schon, diese Sonnenbrille aus "Men in Black", die amerikanische Filmpolizisten und smarte New-Economy-Manager so unglaublich cool aussehen lässt. Solche Egos braucht das Land, hieß es damals.
Und nun?
Ron Sommer. Wie schnell zerstob der Traum vom Reichtum für alle, dessen Garant der Telekom-Chef sein sollte. Und wie plötzlich endete die Karriere des einst hofierten Börsenlieblings.
Thomas Haffa. Einer der bestaussehenden Bankrotteure. Großmutters Spruchweisheiten scheinen so falsch nicht: Hochmut kommt vor dem Fall.
Genau diese Typen wecken deinen Zweifel, du spürst das Dilemma:
Ohne Eitelkeit kein Erfolg. Doch wenn du die Grenze überschreitest, diese fast unsichtbare, gestrichelte graue Linie zwischen notwendiger Eitelkeit und drohendem Größenwahn, wirst du scheitern.
Diese kleine Schramme in der Eitelkeit, weil dein ehemaliger Schulkamerad links unterschreiben darf - markiert sie nicht längst jenen Schritt, der unweigerlich über die Grenze führen wird, wo das selbstbewusste Ego in peinliche Eitelkeit übergeht? Bist du nicht längst gefährdet, für den äußerlichen Erfolg dein wahres Ego unbotmäßig aufzuputzen und dich zu korrumpieren?
Dieser Haffa hat seinen Laden ja nicht mit Absicht ins Aus manövriert: Da drängt sich schon die Frage auf: An welchem Punkt verlor er die Kontrolle? Und die anderen, die jüngst in den Schlagzeilen standen: In welchem Moment übertrat der 1999 noch als erfolgreichster Manager der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte gefeierte Enron-Chef Kenneth Lay die gestrichelte Linie vom übersteigerten Selbstbewusstsein zur zerstörerischen Egomanie?
Man sieht es ja am Anfang nicht. Doch dann übersetzt sich tief innen in der Seele mancher Supermanager der öffentliche Jubel in das Gefühl, auserwählt zu sein, befreit von allen Regeln der schnöden wirtschaftlichen Normalität.
Von diesem Zeitpunkt an geht es schnell.
Die Ansammlung von Jasagern, die sich wechselseitig bestätigen, schwächt das Krisenbewusstsein. Fusionen, Expansionen, Prestigeobjekte werden kritiklos beklatscht. Die Anmaßungen wachsen, bis hin zur himmelstürmenden Omnipotenzfantasie, wie viele New-Economy-Ikarusse sie goutierlich pflegten, bis ihnen die Flügel verbrannten.
Doch auf der Projektionsfläche der Karriereträume glänzten ja auch Namen, die nicht nur für Eitelkeit standen, sondern für dauerhaften Erfolg. Wendelin Wiedeking zum Beispiel, der Porsche-Chef.
Wie der sich sonnt im Applaus seiner Auftritte, seiner auf Wirkung hin maßgeschneiderten Rhetorik. Wie der es genoss, sich im feinen Hamburger "Atlantic Hotel" für den ersten Platz der Imageprofile des manager magazins von der Elite der deutschen Wirtschaft feiern zu lassen, und zwar zum zweiten Mal in Folge.
Aber Wiedekings Eitelkeit riegelt, anders als die Rassemotoren seiner Autos, bei einer gewissen Geschwindigkeit ab. "Ich weiß, dass es nun gefährlich wird", zügelte er sich selbst in seiner Dankesrede, wohl wissend, dass die Neider frohlocken werden, wenn es beim nächsten Mal nur zum zweiten Platz reicht. Eitelkeit mit eingebautem ESP, dem Elektronischen Stabilitätsprogramm, das ein Auto daran hindert, aus der Kurve zu fliegen.
Nun ja, mit großartigen Ausnahmepersönlichkeiten und schillernden Marken lässt sich gut argumentieren. Aber führt eine solche Show nicht in die Irre? Was ist in den Biotopen des ganz normalen Alltags in Deutschland? Wie ist es da?
Nicht anders.
Es gibt ungezählte überzogene Patriarchen und selbstherrliche Bosse, die sich auf Kosten ihrer Mitarbeiter profilieren, miese Stimmung verbreiten und böse gucken, wenn einer ein größeres Auto fährt als sie.
Aber da sind auch die anderen, die sich bremsen können, die es halten wie Wiedeking.
Was ist ihr Geheimnis?
Nichts Besonderes. Keine Morgengebete um Bescheidenheit, keine Askese in griechischen Bergklöstern. Was wir da draußen finden, sind normale Typen. Sie sind selbstbewusst bis zur Eitelkeit und mitunter eitel bis an den Rand des Narzissmus.
Doch mit einem ganz einfachen Mittel haben sie sich im Griff: Ihr Selbstbewusstsein gründet im nachweislichen Erfolg ihrer beruflichen Aufgabe. Es scheint zwar manchmal, als ginge es um bloße Selbstinszenierung. Aber der erste Eindruck kann täuschen.
Säße da zum Beispiel statt dieses ehemaligen Schulkameradenein Wolfgang Grupp (60) an deinem Tisch, alleiniger Inhaber der Trigema T-Shirt-Fabrik in Burladingen auf der Schwäbischen Alb, dann wäre dieser Eindruck unvermeidlich.
Selbst in der Werbung (du erinnerst dich, das ist die Werbung mit dem Schimpansen) tritt der Chef als sein eigenes Model auf. Braun gebrannt, gepflegt und sportlich sitzt er einem gegenüber. Du würdest verwundert zur Kenntnis nehmen, dass nicht einmal die Maßkleidung wagt, eine einzige Falte zu werfen.
Mensch, ist der eitel, würdest du denken, und dich bestätigt sehen, wenn du seiner Einladung ins Unternehmen nach Burladingen folgen würdest. In der kurzen Wartezeit im Treppenhaus hättest du ausgiebigst Gelegenheit, den Chef zu bewundern: Überall hängen Fotos der Grupp-Familie, von der Hochzeit mit der 24 Jahre jüngeren Frau, von den blitzsauberen Kindern. Broschüren über Firmenjubiläen zeigen ihn, Grupp, mit der Familie die Spaliere der Mitarbeiter abschreitend.
Wer die Inszenierung des Stücks "Grupp" lediglich als eitle Selbstdarstellung versteht, der nimmt nur das oberflächliche Bild wahr: Grupps Liebe zur Publicity resultiert aus der Lust am Beweis, dass mittelständische Textilunternehmen auch in Deutschland viel Geld verdienen können und dass er, der Unternehmer Grupp, diesen Beweis leibhaftig verkörpert. Seine Selbstdarstellung ist untrennbar verbunden mit dem Erfolg seiner Firma. Der Burladinger Fabrikant würde es als Verletzung seines ausladenden Selbstbewusstseins empfinden, wenn er auch nur einen Mitarbeiter entlassen müsste.
Oder stell dir vor, du säßest mit einem Herbert Detharding (64) an einem Tisch, vielleicht in einem kleinen italienischen Restaurant in Hamburg. Er würde von seinen großartigen Erfolgen berichten. Aber er würde auch ein sehr wirksames Mittel gegen die Verführung durch den Jubel der Umgebung, der Analysten und Shareholder schildern: beizeiten die Mitarbeiter qualifizieren, Talente entwickeln und rechtzeitig dafür sorgen, dass ein Headhunter den richtigen Nachfolger auftreibt.
40 Jahre dauerte Dethardings Karriere, vom Lehrling bei Mobil Oil bis zum Chef der BASF-Tochter Wintershall. Von 1991 bis 2001 war er Vorstandsvorsitzender, jetzt ist er pensioniert. Eitelkeit sei ihm fremd, Statussymbole bedeuteten ihm nichts, sagt er. Selbst als CEO habe er dienstlich lange Zeit die Mercedes-E-Klasse gefahren. "Passte von der Größe einfach besser zu mir." Auch sonst: keine großartigen Inszenierungen.
Aber wenn es um den Erfolg seiner Arbeit geht, gibt es klare Ansagen: Das Unternehmen sei unter seiner Leitung "um Größenordnungen besser" geworden, das operative Ergebnis von 100 Millionen auf 2,5 Milliarden Mark gestiegen. Der wichtigste Punkt, das betont Detharding - und du merkst, dass er darauf sehr stolz ist -, war allerdings die nahtlose Übergabe der Geschäfte. Nicht nur für die Position des Vorstandsvorsitzenden, sondern auch auf den Ebenen darunter. Nun regieren die und fahren selbstverständlich S-Klasse als Dienstwagen.
Detharding macht kein Hehl aus der Tatsache, dass er sich an seine neue Rolle als Ruheständler noch nicht gewöhnt hat: "Es ist schwer, in der Bedeutungslosigkeit leben zu müssen." Doch er wird den Fehler vieler seiner Leidensgenossen nicht wiederholen und den Nachfolgern ins Geschäft hineinpfuschen. Sie würden ihn als störend empfinden, und das will er nicht, dazu ist er dann doch zu eitel.
Diese Haltung ist allerdings nicht allein vorsorgliche Eitelkeit. Sie ist auch eine Sache des Charakters: Ein Mensch mit ausgereiftem Ego schafft die Grenzziehung zwischen dem Anspruch fortgesetzter Bedeutung und der Selbsterkenntnis, dass er im Grunde nur Träger einer opulent ausstaffierten Position war und ist. Wunderbare Annehmlichkeiten, große Autos, Reisen, Prominenz, gelten nicht in erster Linie dem Einzelnen, sondern dem Unternehmen, das er zu vertreten hat. Beizeiten loslassen zu können, das zeugt vom Charakter eines selbstbewussten Egos.
Charakter? Du lieber Himmel!
Erneut kneift das Dilemma: Viele der umstrittenen Charaktere sind doch gerade mit ihrem Machtstreben, mit ihrer Egozentrik, mit ihrem kalten Narzissmus und ihren gigantischen Ansprüchen so weit nach oben gekommen, dass ihnen nun nichts mehr passieren kann, selbst wenn sie scheitern.
Was würde zum Beispiel für Kajo Neukirchen oder Jürgen Schrempp - stets zitierte Figuren, wenn es um das Thema Ego und Eitelkeit geht - das Zerbersten ihrer Perspektive bedeuten? Eine persönliche Niederlage vielleicht.
Was bedeutete das Aus für Haffa?
Der wird doch schon wieder in den Klatschspalten der Boulevardpresse abgelichtet - strahlend grüßt er (mit einem mutmaßlichen Vermögen von 250 Millionen Euro im Hintergrund) von Bord einer bronzefarbenen Jacht namens "Tiketitoo". Mit Ray Ban auf der Nase und einer Ersatzsonnenbrille in der Hand. Die südliche Sonne des dolce far niente ist grell.
Solche Misserfolge würdest du gern mehrere haben, oder?
Ethik?
Junger Mann!
Verehrteste!
Ethik!
Wir sind in einem Spiel. Reality-Monopoly.
Spiel mit.
Stell dir vor, du wärst an der Stelle von Klaus Esser, mit einer Abfertigung von rund 30 Millionen Euro. Von den Fällen gibt es ja noch ein paar. Lebenslänglich verurteilt zu Champagner im Chatöchen in einem sonnigen Landstrich in Frankreich.
Der Weg ist gefährlich, o ja.
Aber er ist gangbar.
Die Welt ist eben so.
Doch die Frage, die jeder für sich beantworten muss, ist die: Bist du so? Hart, machiavellistisch, kriegerisch und nichts als rücksichtslos erfolgreich? Oder einer dieser Anpassungsvirtuosen, die der Philosoph Gerd Achenbach als situationskonforme windige Chamäleons bezeichnet hat?
Du meinst, dass du ein solches Leben aushalten kannst? Okay. Dann sind auch die Konsequenzen klar: Jasager um dich herum. Du wirst niemals mehr wissen, ob es irgendjemand ehrlich meint, wenn er dir zuhört.
Bevor du dich für diesen Weg entscheidest, blättere erst einmal in den Krankenakten vieler deiner Vorbilder: Paranoide Zustände, emotionale Verkümmerung, zwangsneurotisch um Kontrolle der Umgebung bemüht, von Misstrauen zerfressen, depressiv und mühsam von persönlichen Coaches aufrechterhalten.
Sieht so Erfolg aus?
Erfolg sieht anders aus.
Nicht zufällig wabert das Thema Work-Life-Balance durch die Gedanken der Spitzenkräfte. Wer bei diesem Schlagwort allein an die lieben Kinderchen daheim denkt, die man häufiger mal sehen möchte, hat den Kern des Problems missverstanden. Es geht um die seelische Gesundheit. Die ist ohne solides Selbstbewusstsein nicht zu denken. Eitelkeit, Narzissmus, himmelstürmender Wahnsinn utopischer Pläne und sei es die Herrschaft über den Weltmarkt, ja, ja und noch mal ja. Für jeden Berufseinsteiger und jungen Professionellen gehört der Traum von der Großartigkeit zum Leben. Nur so kann ein unverwechselbares Lebenswerk entstehen, das untrennbar mit deiner Person verbunden ist.
Hängst du allerdings um bloßer Karrierestürme willen dein Ego an die Großartigkeit einer Position, reihst dich ein in die jasagende Gefolgschaft führender Egomanen, um vielleicht etwas abzukriegen vom Glanz des Status und seiner Symbole, wirst du nie etwas anderes sein als eine austauschbare Charaktermaske.
Irgendwann wirst du mit Äußerlichkeiten herumprahlen - wie dieser geschwätzige Schulkamerad an deinem Tisch, der sich nicht einkriegen kann, dass er links unterschreiben darf, dieser Blödmann. Es wird das letzte Warnzeichen sein, kurz vor dem Totalverlust deines Egos.
sehr lesenswert übrigens auch der Artikel:
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,233614,00.…
.
Powells Kriegsgericht
Von Gerhard Spörl, Washington
In der Genesis zur Vorbereitung eines zweiten Golfkriegs war das der bisher dramatischste Augenblick: Ein amerikanischer Außenminister verwandelt den Uno-Sicherheitsrat in ein Gericht über Saddam Hussein. Er präsentiert Beweise und plädiert für maximale Verurteilung.
Kein anderer amerikanischer Politiker besitzt mehr Autorität und Nimbus als Colin Powell. Kein anderer versteht es besser, die werbende Kraft seiner Argumente zu entfalten, um ein Publikum von der Rechtfertigung eines Krieges gegen den Irak zu überzeugen, mit dem Ziel, Saddam Hussein davon abzuhalten, seine Massenvernichtungswaffen einzusetzen oder an Terroristen weiter zu geben.
Aber will da überhaupt noch jemand überzeugt werden? Haben sich nicht alle schon ihre Meinung gebildet - die 15 Mitglieder im Sicherheitsrat, das Weiße Haus, die Menschen in Europa? War Powells Multimedia-Darbietung am Ende vergebliche Liebesmüh - oder nichts als eine Alibi-Veranstaltung?
Natürlich hinterlassen die Telefonate zwischen Kommandeuren der Republikanischen Garde, die einander Befehle zur Beiseiteschaffung von Massenvernichtungswaffen erteilen, großen Eindruck. Natürlich bleiben die Satellitenaufnahmen im Gedächtnis haften, auf denen unschwer zu erkennen ist, wie Lastwagen mit Ladungen davonfahren, die gerade noch in Anlagen herumstanden, und zwar rechtzeitig, ehe die Waffeninspektoren zu einem "überraschenden" Besuch auftauchen.
Schwieriger ist es schon mit der Beweisführung, was die ominösen Aluminiumröhren anbelangt, die für Gaszentrifugen zum Zwecke der Anreicherung des Urans umgebaut werden können - Voraussetzung zum Bau von Atomwaffen. Noch schwerer fiel es Powell, den Bogen zwischen der al-Qaida und dem Regime in Bagdad zu schlagen. Wenn die Photos aus dem Weltraum und die abgehörten Telefonate vor jedem Gericht als schlagende Beweise gelten könnten, ist die Wahrheitsfindung, inwieweit Osama bin Laden und Saddam Hussein gemeinsame Sache machen, längst zur Glaubenssache geworden.
In der Einschätzung Saddams macht sich niemand unter den Außenministern, die heute im Sicherheitsrat lauschten, irgendwelche Illusionen. Die Fülle der waffenfähigen biologischen und chemischen Substanzen, über die der Irak verfügt - und deren Besitz das Regime ebenso standhaft wie schamlos abstreitet - ist ein Graus. Dass Saddam den Ehrgeiz aufgegeben haben soll, nukleare Waffen in die Hände zu bekommen, glaubt auch niemand. Die Frage ist nur, ob die Welt sich Powells pathetischen Schlusssatz zu eigen macht: "Saddam lässt sich durch nichts stoppen, bis die Welt ihn stoppt."
Manches wäre für die Regierung Bush leichter, wenn sie ihre Begründung für einen zweiten Golfkrieg nicht so oft geändert hätte. Über die Monate nahm die hochmoralische Rechtfertigung zu, als Versuche gescheitert waren, den Krieg gegen den Terrorismus mit dem Regimewechsel in Bagdad zu verknüpfen. Sie mischte sich mit den imperialen Ideen, die eine kleine radikale neokonservative Minderheit in der Washingtoner Regierung seit dem Ende des Kalten Krieges hegt.
Manches wäre auch einfacher, wenn tatsächlich auf dem Irak die Last des Beweises läge, wenn die Inspektoren sich darauf beschränkt hätten, die Behauptungen zu überprüfen, wie wann welche Massenvernichtungswaffen vernichtet worden sind. Statt dessen durchstreifen sie wie ihre Vorgänger in den neunziger Jahren das Land, so groß wie Frankreich oder Kalifornien, auf der Suche nach mehr oder minder zufälligen Funden, die falsifizieren, was das Regime in seiner 12000-Seiten-Deklaration angegeben hat.
Im Übrigen liegt der Verdacht nahe, dass die Blix-Truppe unter umfassender Bewachung steht, womit der Irak wirkliche Überraschungsbesuche wirkungsvoll verhindert.
Amerika plant einen Präventivschlag, weil der Präsident das Problem Saddam erledigen möchte. Er lässt sich von nahe liegenden Einwänden nicht abhalten - "Warum jetzt? Sind die möglichen Folgen eines Krieges im Nahen Osten nicht schlimmer als die Gegenwart?"
Der Gang in die Vereinten Nationen war aus Sicht Washingtons ein Zugeständnis, das Donald Rumsfeld oder Richard Cheney erkennbar bedauern. Nun gibt es keine Alternative mehr zum geordneten Prozess, zumal auch die Mehrheit aller Amerikaner eine zweite Resolution im Sicherheitsrat jedem Alleingang der Vereinigten Staaten vorzieht.
Das Minimum wäre die Verurteilung Saddams durch den Sicherheitsrat wegen des "flagranten Bruchs" mit der Uno-Resolution im Herbst, wobei die "ernsthaften Konsequenzen", von denen in der Resolution 1441 drohend die Rede ist, unausgesprochen den USA überlassen bleiben. Das Maximum wäre eine zweite Resolution mit 15:0 Verurteilung, woran noch nicht einmal hartnäckige Optimisten glauben.
Außenminister Powell wird in den nächsten Wochen die ganze Macht der einzigen Supermacht auf Erden einsetzen, um die maximale Lösung zu verwirklichen. Ein entscheidendes Argument wird sein, dass von den Verhandlungen im Sicherheitsrat das zukünftige Gewicht der Uno abhängt.
Werden Präventivschläge Amerikas zum Signum des 21.Jahrhunderts, wobei künftige Präsidenten sich den mühsamen Weg durch die Institutionen in New York ersparen, würden sich die Vereinten Nationen in einen zweiten machtlosen Völkerbund verwandeln - eine durchaus ernst zu nehmende Drohung.
Dass die Zeit ausrinnt, hat Außenminister Powell gerade wiederholt. Mit diesem Memento werden die Protagonisten der amerikanischen Regierung den Meinungsfindungsprozess unter den 15 Mitgliedsstaaten der Uno ungeduldig begleiten. Das Zwischenergebnis von diesem Mittwoch ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Die Russen lassen mittlerweile mehr Konzilianz erkennen, China hält sich weiterhin alle Optionen offen. Frankreich plädiert bis auf weiteres für Fortsetzung der Inspektionen und Geduld und dürfte hinter den Kulissen, wie im Herbst, die Bedingungen für eine zweite Resolution aufstellen. Frankreich bleibt unter den Vetomächten der Gegenspieler Amerikas, eine Rolle, die Jacques Chirac bis zur Neige genießen wird.
Und die Deutschen? Sie sind dort, wo sie hin wollten, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Joschka Fischer durfte die historische Sitzung leiten, darin erschöpft sich aber auch der deutsche Einfluss.
DER SPIEGEL 05.02.2003
Powells Kriegsgericht
Von Gerhard Spörl, Washington
In der Genesis zur Vorbereitung eines zweiten Golfkriegs war das der bisher dramatischste Augenblick: Ein amerikanischer Außenminister verwandelt den Uno-Sicherheitsrat in ein Gericht über Saddam Hussein. Er präsentiert Beweise und plädiert für maximale Verurteilung.
Kein anderer amerikanischer Politiker besitzt mehr Autorität und Nimbus als Colin Powell. Kein anderer versteht es besser, die werbende Kraft seiner Argumente zu entfalten, um ein Publikum von der Rechtfertigung eines Krieges gegen den Irak zu überzeugen, mit dem Ziel, Saddam Hussein davon abzuhalten, seine Massenvernichtungswaffen einzusetzen oder an Terroristen weiter zu geben.
Aber will da überhaupt noch jemand überzeugt werden? Haben sich nicht alle schon ihre Meinung gebildet - die 15 Mitglieder im Sicherheitsrat, das Weiße Haus, die Menschen in Europa? War Powells Multimedia-Darbietung am Ende vergebliche Liebesmüh - oder nichts als eine Alibi-Veranstaltung?
Natürlich hinterlassen die Telefonate zwischen Kommandeuren der Republikanischen Garde, die einander Befehle zur Beiseiteschaffung von Massenvernichtungswaffen erteilen, großen Eindruck. Natürlich bleiben die Satellitenaufnahmen im Gedächtnis haften, auf denen unschwer zu erkennen ist, wie Lastwagen mit Ladungen davonfahren, die gerade noch in Anlagen herumstanden, und zwar rechtzeitig, ehe die Waffeninspektoren zu einem "überraschenden" Besuch auftauchen.
Schwieriger ist es schon mit der Beweisführung, was die ominösen Aluminiumröhren anbelangt, die für Gaszentrifugen zum Zwecke der Anreicherung des Urans umgebaut werden können - Voraussetzung zum Bau von Atomwaffen. Noch schwerer fiel es Powell, den Bogen zwischen der al-Qaida und dem Regime in Bagdad zu schlagen. Wenn die Photos aus dem Weltraum und die abgehörten Telefonate vor jedem Gericht als schlagende Beweise gelten könnten, ist die Wahrheitsfindung, inwieweit Osama bin Laden und Saddam Hussein gemeinsame Sache machen, längst zur Glaubenssache geworden.
In der Einschätzung Saddams macht sich niemand unter den Außenministern, die heute im Sicherheitsrat lauschten, irgendwelche Illusionen. Die Fülle der waffenfähigen biologischen und chemischen Substanzen, über die der Irak verfügt - und deren Besitz das Regime ebenso standhaft wie schamlos abstreitet - ist ein Graus. Dass Saddam den Ehrgeiz aufgegeben haben soll, nukleare Waffen in die Hände zu bekommen, glaubt auch niemand. Die Frage ist nur, ob die Welt sich Powells pathetischen Schlusssatz zu eigen macht: "Saddam lässt sich durch nichts stoppen, bis die Welt ihn stoppt."
Manches wäre für die Regierung Bush leichter, wenn sie ihre Begründung für einen zweiten Golfkrieg nicht so oft geändert hätte. Über die Monate nahm die hochmoralische Rechtfertigung zu, als Versuche gescheitert waren, den Krieg gegen den Terrorismus mit dem Regimewechsel in Bagdad zu verknüpfen. Sie mischte sich mit den imperialen Ideen, die eine kleine radikale neokonservative Minderheit in der Washingtoner Regierung seit dem Ende des Kalten Krieges hegt.
Manches wäre auch einfacher, wenn tatsächlich auf dem Irak die Last des Beweises läge, wenn die Inspektoren sich darauf beschränkt hätten, die Behauptungen zu überprüfen, wie wann welche Massenvernichtungswaffen vernichtet worden sind. Statt dessen durchstreifen sie wie ihre Vorgänger in den neunziger Jahren das Land, so groß wie Frankreich oder Kalifornien, auf der Suche nach mehr oder minder zufälligen Funden, die falsifizieren, was das Regime in seiner 12000-Seiten-Deklaration angegeben hat.
Im Übrigen liegt der Verdacht nahe, dass die Blix-Truppe unter umfassender Bewachung steht, womit der Irak wirkliche Überraschungsbesuche wirkungsvoll verhindert.
Amerika plant einen Präventivschlag, weil der Präsident das Problem Saddam erledigen möchte. Er lässt sich von nahe liegenden Einwänden nicht abhalten - "Warum jetzt? Sind die möglichen Folgen eines Krieges im Nahen Osten nicht schlimmer als die Gegenwart?"
Der Gang in die Vereinten Nationen war aus Sicht Washingtons ein Zugeständnis, das Donald Rumsfeld oder Richard Cheney erkennbar bedauern. Nun gibt es keine Alternative mehr zum geordneten Prozess, zumal auch die Mehrheit aller Amerikaner eine zweite Resolution im Sicherheitsrat jedem Alleingang der Vereinigten Staaten vorzieht.
Das Minimum wäre die Verurteilung Saddams durch den Sicherheitsrat wegen des "flagranten Bruchs" mit der Uno-Resolution im Herbst, wobei die "ernsthaften Konsequenzen", von denen in der Resolution 1441 drohend die Rede ist, unausgesprochen den USA überlassen bleiben. Das Maximum wäre eine zweite Resolution mit 15:0 Verurteilung, woran noch nicht einmal hartnäckige Optimisten glauben.
Außenminister Powell wird in den nächsten Wochen die ganze Macht der einzigen Supermacht auf Erden einsetzen, um die maximale Lösung zu verwirklichen. Ein entscheidendes Argument wird sein, dass von den Verhandlungen im Sicherheitsrat das zukünftige Gewicht der Uno abhängt.
Werden Präventivschläge Amerikas zum Signum des 21.Jahrhunderts, wobei künftige Präsidenten sich den mühsamen Weg durch die Institutionen in New York ersparen, würden sich die Vereinten Nationen in einen zweiten machtlosen Völkerbund verwandeln - eine durchaus ernst zu nehmende Drohung.
Dass die Zeit ausrinnt, hat Außenminister Powell gerade wiederholt. Mit diesem Memento werden die Protagonisten der amerikanischen Regierung den Meinungsfindungsprozess unter den 15 Mitgliedsstaaten der Uno ungeduldig begleiten. Das Zwischenergebnis von diesem Mittwoch ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Die Russen lassen mittlerweile mehr Konzilianz erkennen, China hält sich weiterhin alle Optionen offen. Frankreich plädiert bis auf weiteres für Fortsetzung der Inspektionen und Geduld und dürfte hinter den Kulissen, wie im Herbst, die Bedingungen für eine zweite Resolution aufstellen. Frankreich bleibt unter den Vetomächten der Gegenspieler Amerikas, eine Rolle, die Jacques Chirac bis zur Neige genießen wird.
Und die Deutschen? Sie sind dort, wo sie hin wollten, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Joschka Fischer durfte die historische Sitzung leiten, darin erschöpft sich aber auch der deutsche Einfluss.
DER SPIEGEL 05.02.2003
.
Der Fall Irak
Kein schlagender Beweis, aber die Belege gegen Bagdad sind erdrückend
von Jakob Menge
Die Frage der Beweise gegen den Irak ist zur Frage von Krieg oder Frieden geworden. Die USA sehen den Irak in der Pflicht: Das Regime müsse belegen, dass es keine Massenvernichtungswaffen mehr produziert und seinen Bestand vernichtet hat. Grundsätzlich stimmen die Inspekteure dem zu. Die Kritiker fordern aber vor allem von den USA einen unwiderlegbaren Beweis. Den konnte Powell nicht liefern, aber die Belege waren erdrückend.
Mobile Labore:
Informanten haben der USA berichtet, dass der Irak biologische Waffen in rollenden Laboren entwickelt und herstellt. Die Labore sind demnach als normale Kleinlastwagen und Waggons auf Zuggleisen getarnt. Die USA wisse von mindestens 18 solcher rollenden Labore.
B- und C-Waffen:
Die Inspekteure wiesen bereits darauf hin, dass der Irak über Bestände an B- und C-Waffen keine Rechenschaft gegeben habe: 6500 Bomben, die rund 1000 Tonnen chemische Kampfstoffe enthalten; 550 Senfgas-Artilleriegranaten; 650 Kilo Ausgangsmaterial für hochtoxische Erreger. US-Präsident Bush spricht sogar von 30 000 Trägern von Chemiewaffen und 25 000 Liter Anthrax. Nach Schätzungen der USA hätten die Irakis noch 100 bis 500 Tonnen chemischer Agenten, erklärte Powell. In 1995 seien tausende von zum Tode Verurteilten Experimenten mit chemischen Waffen ausgesetzt gewesen. Auch habe Saddam jüngst Offiziere angewiesen, notfalls Chemiewaffen einzusetzen.
Atomwaffen:
Nach US-Angaben führt Saddam Husseins Regime sein Programm zur Herstellung von Atomwaffen unverändert weiter. Viele Male, sogar noch nach Beginn der Inspektionen, habe Bagdad versucht, spezielle Aluminiumrohre zu kaufen, die in ihren Spezifikationen ideal für Zentrifugen zur Urananreichung sind, sagte Powell.
Raketen:
Auch das geheime Raketenprogramm werde fortgeführt. Auf einem Satellitenbild aus dem April 2002, das Powell dem Sicherheitsrat präsentierte, war eine neue Abschussrampe zu sehen, die eine Rakete bis zu 1200 Kilometer weit schießen kann. Erlaubt sind dem Irak nur 150 km Reichweite. Danach sei ein Dach über die Rampe gebaut worden, um sie zu verstecken.
Verstecken:
Powell hat Belege dafür vorgelegt, dass der Irak die Inspekteure täuscht und Waffen versteckt. So führte er Satellitenbilder von chemischen Munitionsbunkern vor: Am 10. November 2002 waren sie offenbar noch in voller Funktion. Doch zum Zeitpunkt der Inspektion am 22. Dezember waren die Bunker „gereinigt“. Genauso seien biologischen Waffen aus der Al-Kindi-Fabrik entfernt worden. Wieder präsentierte Powell ein Satellitenbild, auf dem Laster beladen werden. Insgesamt sei dieser „Hausputz“ (Powell) in 30 Anlagen durchgeführt worden. Der US-Außenminister untermauerte seine Ausführungen mit einer Tonbandaufnahme, auf denen ein irakischer Offizier der Republikanischen Garde seinem Vorgesetzten berichtete: „Wir haben alles evakuiert. Es ist nichts mehr da.“
Überwachung:
Eine Armee von Aufpassern verfolge die Inspekteure, sagte Powell. Laut britischer Regierung spionieren 20 000 irakische Geheimdienstmitarbeiter sie aus. Saddam habe dafür sogar ein spezielles Komitee gegründet, dem sein Sohn Qusay und Vizepräsident Ramadan angehören. Sie berichten direkt dem Diktator.
Einschüchterung:
Laut US-Informanten sollen die irakischen Wissenschaftler dem Regime Dokumente unterschrieben haben, wonach die Herausgabe von Informationen mit dem Tode bestraft wird. Ein Dutzend Wissenschaftler sei gemeinsam unter Hausarrest gestellt worden. Ein anderer sei versteckt worden, den Inspekteuren hätte man eine gefälschte Todesurkunde vorgelegt.
Die Kontakte:
Schon seit den Neunzigern gebe es regen Kontakt zwischen irakischen Offiziellen und dem Terrornetzwerk, erklärte Powell. Irakische Offizielle hätten Osama Bin Laden persönlich öfters in Afghanistan getroffen, berichteten Informanten.
l Aufenthalt im Irak: Abu Musab Zarkawi, ein enger Vertrauter Bin Ladens, habe, so Powell, mit seiner Organisation Anwar el Islam bereits zwei Trainingscamps für Terroristen aufgebaut. Spezialität: die Produktion von Gift, speziell Ricin. Zwar seien die Orte der Camps außerhalb von Saddams Kontrolle, doch ein Führungsoffizier von Anwar el Islam sei ein Agent aus Bagdad, der Al-Qaida-Mitglieder nach dem Afghanistan-Krieg explizit in den Irak eingeladen habe. Zarkawi selbst reiste vergangenen Sommer nach Bagdad – zu einer medizinischen Untersuchung. Er blieb zwei Monate und währenddessen seien ihm zwei Dutzend Terroristen mit Kontakt zu Al Qaida nach Bagdad gefolgt. Powell berief sich auf Informanten der US-Geheimdienste.
DIE WELT 06. 02. 2003
Der Fall Irak
Kein schlagender Beweis, aber die Belege gegen Bagdad sind erdrückend
von Jakob Menge
Die Frage der Beweise gegen den Irak ist zur Frage von Krieg oder Frieden geworden. Die USA sehen den Irak in der Pflicht: Das Regime müsse belegen, dass es keine Massenvernichtungswaffen mehr produziert und seinen Bestand vernichtet hat. Grundsätzlich stimmen die Inspekteure dem zu. Die Kritiker fordern aber vor allem von den USA einen unwiderlegbaren Beweis. Den konnte Powell nicht liefern, aber die Belege waren erdrückend.
Mobile Labore:
Informanten haben der USA berichtet, dass der Irak biologische Waffen in rollenden Laboren entwickelt und herstellt. Die Labore sind demnach als normale Kleinlastwagen und Waggons auf Zuggleisen getarnt. Die USA wisse von mindestens 18 solcher rollenden Labore.
B- und C-Waffen:
Die Inspekteure wiesen bereits darauf hin, dass der Irak über Bestände an B- und C-Waffen keine Rechenschaft gegeben habe: 6500 Bomben, die rund 1000 Tonnen chemische Kampfstoffe enthalten; 550 Senfgas-Artilleriegranaten; 650 Kilo Ausgangsmaterial für hochtoxische Erreger. US-Präsident Bush spricht sogar von 30 000 Trägern von Chemiewaffen und 25 000 Liter Anthrax. Nach Schätzungen der USA hätten die Irakis noch 100 bis 500 Tonnen chemischer Agenten, erklärte Powell. In 1995 seien tausende von zum Tode Verurteilten Experimenten mit chemischen Waffen ausgesetzt gewesen. Auch habe Saddam jüngst Offiziere angewiesen, notfalls Chemiewaffen einzusetzen.
Atomwaffen:
Nach US-Angaben führt Saddam Husseins Regime sein Programm zur Herstellung von Atomwaffen unverändert weiter. Viele Male, sogar noch nach Beginn der Inspektionen, habe Bagdad versucht, spezielle Aluminiumrohre zu kaufen, die in ihren Spezifikationen ideal für Zentrifugen zur Urananreichung sind, sagte Powell.
Raketen:
Auch das geheime Raketenprogramm werde fortgeführt. Auf einem Satellitenbild aus dem April 2002, das Powell dem Sicherheitsrat präsentierte, war eine neue Abschussrampe zu sehen, die eine Rakete bis zu 1200 Kilometer weit schießen kann. Erlaubt sind dem Irak nur 150 km Reichweite. Danach sei ein Dach über die Rampe gebaut worden, um sie zu verstecken.
Verstecken:
Powell hat Belege dafür vorgelegt, dass der Irak die Inspekteure täuscht und Waffen versteckt. So führte er Satellitenbilder von chemischen Munitionsbunkern vor: Am 10. November 2002 waren sie offenbar noch in voller Funktion. Doch zum Zeitpunkt der Inspektion am 22. Dezember waren die Bunker „gereinigt“. Genauso seien biologischen Waffen aus der Al-Kindi-Fabrik entfernt worden. Wieder präsentierte Powell ein Satellitenbild, auf dem Laster beladen werden. Insgesamt sei dieser „Hausputz“ (Powell) in 30 Anlagen durchgeführt worden. Der US-Außenminister untermauerte seine Ausführungen mit einer Tonbandaufnahme, auf denen ein irakischer Offizier der Republikanischen Garde seinem Vorgesetzten berichtete: „Wir haben alles evakuiert. Es ist nichts mehr da.“
Überwachung:
Eine Armee von Aufpassern verfolge die Inspekteure, sagte Powell. Laut britischer Regierung spionieren 20 000 irakische Geheimdienstmitarbeiter sie aus. Saddam habe dafür sogar ein spezielles Komitee gegründet, dem sein Sohn Qusay und Vizepräsident Ramadan angehören. Sie berichten direkt dem Diktator.
Einschüchterung:
Laut US-Informanten sollen die irakischen Wissenschaftler dem Regime Dokumente unterschrieben haben, wonach die Herausgabe von Informationen mit dem Tode bestraft wird. Ein Dutzend Wissenschaftler sei gemeinsam unter Hausarrest gestellt worden. Ein anderer sei versteckt worden, den Inspekteuren hätte man eine gefälschte Todesurkunde vorgelegt.
Die Kontakte:
Schon seit den Neunzigern gebe es regen Kontakt zwischen irakischen Offiziellen und dem Terrornetzwerk, erklärte Powell. Irakische Offizielle hätten Osama Bin Laden persönlich öfters in Afghanistan getroffen, berichteten Informanten.
l Aufenthalt im Irak: Abu Musab Zarkawi, ein enger Vertrauter Bin Ladens, habe, so Powell, mit seiner Organisation Anwar el Islam bereits zwei Trainingscamps für Terroristen aufgebaut. Spezialität: die Produktion von Gift, speziell Ricin. Zwar seien die Orte der Camps außerhalb von Saddams Kontrolle, doch ein Führungsoffizier von Anwar el Islam sei ein Agent aus Bagdad, der Al-Qaida-Mitglieder nach dem Afghanistan-Krieg explizit in den Irak eingeladen habe. Zarkawi selbst reiste vergangenen Sommer nach Bagdad – zu einer medizinischen Untersuchung. Er blieb zwei Monate und währenddessen seien ihm zwei Dutzend Terroristen mit Kontakt zu Al Qaida nach Bagdad gefolgt. Powell berief sich auf Informanten der US-Geheimdienste.
DIE WELT 06. 02. 2003
.
Das Pentagon- Puzzle
Hortet der Irak Terrorwaffen? Amerika präsentiert neue Indizien. Geschichte einer krampfhaften Suche
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Alle Welt redet also nun von „Beweisen“ und hofft, den „rauchenden Colt“ zu sehen, den Saddam Hussein noch tatwarm in der Hand hält. In diesen komplizierten Zeiten wäre das ja auch wunderbar unzweideutig: Die Amerikaner präsentieren Fakten, unwiderlegbar und gerichtsfest, wonach der Diktator aus Bagdad schuldig im Sinne der Anklage von George Bush ist. Und schon entwirrt sich die verschlungene Diskussion um die Legitimität eines Krieges gegen den Irak.
Doch, ach, von dieser Welt ist nur der Wunsch und nicht die Wirklichkeit. Denn George Bush hat niemals „Beweise“ versprochen, wie es landauf, landab geschrieben steht. In seiner Rede zur Lage der Nation kündigte er, viel bescheidener, „Geheimdienstinformationen“ an – ein wichtiger Unterschied.
Denn nichts, was aus der Welt der Schlapphüte kommt, ist automatisch wasserdicht, stoßfest, idiotensicher. Im Gegenteil: Es ist „voller Ungewissheit und voller Unbestimmheit“, wie Bruce Berkowitz, ein Wissenschaftler der konservativen Hoover-Institution, am Wochenende schrieb. Der Mann wird es wissen, denn er begann seine Karriere als Agent bei der CIA. Weshalb er zu dem vernünftigen Schluss kommt, eine demokratische Gesellschaft solle die Frage von Krieg oder Frieden nicht allein „aufgrund von Geheimdienstinformationen entscheiden“.
So viel also zur Einordnung. Nun zu dem, was die Amerikaner seit Anfang der Woche bruchstückhaft veröffentlichen (und was Außenminister Colin Powell der Welt am Mittwoch – wenige Stunden nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – als multimediales Gesamtkunstwerk präsentieren wollte). Es ist ein Mosaik aus Berichten von Überläufern und verhafteten Terrorverdächtigen, von Satellitenbildern und von abgehörten Gesprächen.
Es soll beweisen:
–dass Saddam Husseins Regime enge Kontakte zur Terrorgruppe al-Qaida unterhält
–dass der Irak verbotene Massenvernichtungswaffen vor UN-Inspektoren versteckt
–dass der Irak nicht nur alte Massenvernichtungswaffen hortet, sondern auch neue
herstellt.
Die Labors für Biowaffen sollen beweglich und im Notfall auf Rädern durchs Land rollbar sein. Sie befänden sich, heißt es, in jenen vom Irak gekauften Renault-Lastwagen, über deren Zweck schon seit Monaten öffentlich spekuliert wird. Das klingt wie ein guter Beleg. Allerdings stammen die Informationen von drei Überläufern, wie Präsident Bush in seiner Rede zur Lage der Nation preisgab, und sie datieren aus der Zeit vor 1999. Heute sind die Lastwagen für die Amerikaner offenbar schwer zu lokalisieren. „Ich fände es prima, wenn die Labors in der Wüste rumführen. Dann könnten wir sie leicht erkennen und zerstören“, sagte am Wochenende Richard Armitage, der stellvertretende Außenminister. „Wir glauben aber, dass die Dinger in einem dieser vielen Tunnels oder unterirdischen Lagerhallen stehen, vielleicht auch in Garagen.“
Die Iraker behaupten übrigens, dass die Lastwagen im Einsatz sind, um Lebensmittel und Getreide vor Pilz- und Schimmelbefall zu schützen. Wenn das stimmt, stellt sich die Frage, warum die Iraker ihre mobilen Schädlingsbekämpfungs-Stationen noch nicht den UN-Waffeninspektoren gezeigt haben.
Seit die Inspektoren wieder im Lande sind, überwacht die National Security Agency (NSA) elektronisch, was im Irak gesprochen wird. Das Ohr Amerikas hat offenbar aufgeschnappt, wie ein ganzes Team von Staatsbediensteten Hans Blix und seine Truppe an der Nase herumführt. Jene, die schon Mitschnitte gehört haben, berichten im Magazin Newsweek davon, wie sich die Betrüger im Staatsdienst ihrer Taten brüsten. „Verlegt das!“, soll jemand rufen. Ein anderer gebe Anweisung: „Berichte darüber nicht!“ Und wieder ein anderer: „Ha, können Sie glauben, dass die das nicht gefunden haben?“ Auch bei diesem Indiz bleibt manches unklar. Was die Iraker zu verstecken scheinen, muss nicht unbedingt eine Waffe sein. Es könnten Vorläuferstoffe sein oder auch Dokumente und CD-ROMs. Sie zu verbergen wäre allerdings in jedem Falle illegal; es würde auf den Willen zum Betrug an der Weltgemeinschaft hindeuten.
Besonders wichtig ist der amerikanischen Regierung der Nachweis, dass Husseins Regime stärker mit der Terrororganisation al-Qaida zusammenarbeitet als bisher bekannt. Der Verbindungsmann soll der Jordanier Abu Mussab al-Zarqawi sein. Er ist einer der Anführer der Terrorzelle al-Tawhid, einer Art Tochtergesellschaft des verzweigten Terrorkonzerns al-Qaida. Seine Spezialität scheint Giftmischerei aller Art zu sein. Bevor er im vergangenen Jahr in den Nordirak ging, hat er sich offenbar in einem Bagdader Krankhaus behandeln lassen. Er soll nämlich bei den Kämpfen mit den Amerikanern in Afghanistan verwundet worden sein. Al-Zarqawi, so heißt es, habe im vergangenen Oktober in Jordanien einen Mordanschlag auf einen amerikanischen Diplomaten organisiert. So jedenfalls hätten es die beiden mutmaßlichen Attentäter den jordanischen Behörden nach ihrer Verhaftung gestanden. Allerdings: dass irakische Behörden bei dem Mordkomplott mit al-Qaida konspirierten, haben die Amerikaner bis Dienstag nicht behauptet.
Gelänge es, eine Verbindung zur Regierung in Badgad nachzuzeichnen – dann wäre der entschiedendste Teil von Washingtons Kriegspartei dort, wo er seit dem 11. September 2001 hinwill: Ein Angriff auf den Irak müsste nicht mehr als Präventivschlag gelten, sondern wäre als Selbstverteidigungskrieg gegen al-Qaida zu rechtfertigen. Dass der Herrscher von Bagdad hinter dem Anschlag auf das World Trade Center steckt, ist den wackeren Saddam-Feinden im Pentagon schon am Morgen des 11. September 2001 zur unumstößlichen Überzeugung geworden. Ihre eigene Gewissheit zu beweisen, gilt seither all ihr Trachten.
Zuerst sollte die CIA Husseins Fingerabdruck aus dem Schutt des World Trade Center herausfischen. Doch es fand sich keine Spur. Was den Pentagon-Berater Richard Perle zu der Bemerkung veranlasste, die CIA sei „im Hinblick auf den Irak unfähig“.
Richtig daran war immerhin, dass die US-Spione die Gefahr des Saddam-Regimes jahrelang unterschätzt hatten. Sie übersahen bis zum Golfkrieg 1991 Iraks komplettes Atomprogramm. Ebenso das Biowaffenprogramm, das 1995 ein Überläufer sowie die UN-Inspektoren entdeckten.
Also umging das Pentagon die CIA und beauftragte Jim Woolsey mit einer Privatermittlung. Der Mann war zwar einst CIA-Direktor, gilt den neokonservativen Falken aber als Parteigänger. Woolsey beharrte sogar noch auf der „Irak-Connection“, als der tschechische Präsident Václav Havel das wichtigste Indiz zur Fehlinformation erklärte: die Vermutung nämlich, dass der New-York-Attentäter Mohammed Atta in Prag einen irakischen Agenten getroffen haben könnte.
Aus Frustration gründete die Kriegspartei ihren eigenen kleinen Geheimdienst mitten in ihrer Bastion, im Pentagon. Seit Herbst 2001 tagt im fünften Stock eine fünfköpfige Arbeitsgruppe unter Führung eines ideologisch sattelfesten Neokonservativen. Sie arbeitet die Rohdaten der CIA täglich neu auf.
Als die Geheimgruppe im Herbst 2002 durch Zufall bekannt wurde, musste das Pentagon einräumen, es gehe allein darum, Nachweise über die Verbindung des Irak zu al-Qaida zu suchen – eine Verbindung, die Tausende CIA-Analysten angeblich seit Jahren hartnäckig übersehen. „Die Linse, durch die man schaut, beinflusst, wonach man sucht“, sagte Pentagon-Vize Paul Wolfowitz.
Die kleine Einheit ist offenbar in der ganzen Geheimdienstgemeinde verhasst. Das berichtet jedenfalls – anonym – ein Schlapphut. Die Gruppe sei ein Symbol für den politischen Missbrauch von Geheiminformationen. Tatsächlich erinnert die Irak-Zelle an die Bemühungen des ehemaligen CIA-Chefs William Casey, der 1981 versuchte, dem damaligen „Reich des Bösen“ den Anschlag auf den Papst anzuhängen: „Die Ersten, die Indizien sowjetischer Beteiligung finden, werden befördert“, rief er damals. Am Ende setzte es Beförderungen zuhauf, den gewünschten Tatnachweis fand niemand.
Angesichts dieser Vorgeschichte ist nicht erstaunlich, dass Präsident Bush seit seiner jüngsten Bemerkung über die „Irak-Connection“ der al-Qaida energischen Widerspruch von Ermittlern und Agenten erhält. CIA-Analysten beschweren sich, die Regierung übertreibe die Bedeutung einzelner Indizien. Und ein FBI-Ermittler lässt sich in der New York Times mit folgendem Satz zitieren: „Wir haben uns die Sache seit mehr als einem Jahr angeschaut, und wissen Sie was? Wir glauben nicht, dass irgendwas dran ist.“ Damit konfrontiert, musste Vizeaußenminister Richard Armitage am Wochenende einräumen, die Regierung habe ihre Irak-Argumentation „in der Vergangenheit gelegentlich“ auf zweifelhafte Informationen gestützt. Fragt sich, ob die Enthüllungen dieser Woche von der „moderaten“ CIA oder dem „offensiven“ Pentagon stammen.
Die Seriosität der amerikanischen Argumente zu prüfen wird in Deutschland Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes sein. Gerade im Irak unterhält der BND seit Jahren eigene Quellen. Am 13. November 2002 hat BND-Chef August Hanning den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages über das, was er wusste, informiert.
Er bestätigte einige amerikanische Befürchtungen und reicherte sie mit eigenen Erkenntnissen an. Danach gibt es die rollenden Biowaffenlabors offenbar bis heute. Einzelne Teile seien von deutschen Unternehmen – deklariert als Ausrüstung für die Landwirtschaft – zugeliefert worden. Das Regime besitze unbemannte Drohnen, um Kampfstoffe großflächig zu versprühen. Der BND schätzt, dass Saddam Hussein mehrere hundert Tonnen Kampfstoffe hortet.
Die Abgeordneten waren schockiert. Was sie erfuhren, ist der Öffentlichkeit bis heute unbekannt geblieben, weil die Parlamentarier im November zum Stillschweigen verpflichtet wurden. Wenn nun die Amerikaner ihre Erkenntnisse präsentiert haben, ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung nachzieht und (wenigstens begrenzte) Redefreiheit für ihren Nachrichtendienst gibt. Sie wird den Verdacht vermeiden wollen, Geheimdiensterkenntnisse genauso politisch einzusetzen wie die Kriegspartei in Washington. In Berlin bestände der Missbrauch im Verschweigen.
DIE ZEIT 7/2003 - Mitarbeit: Bruno Schirra
Das Pentagon- Puzzle
Hortet der Irak Terrorwaffen? Amerika präsentiert neue Indizien. Geschichte einer krampfhaften Suche
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Alle Welt redet also nun von „Beweisen“ und hofft, den „rauchenden Colt“ zu sehen, den Saddam Hussein noch tatwarm in der Hand hält. In diesen komplizierten Zeiten wäre das ja auch wunderbar unzweideutig: Die Amerikaner präsentieren Fakten, unwiderlegbar und gerichtsfest, wonach der Diktator aus Bagdad schuldig im Sinne der Anklage von George Bush ist. Und schon entwirrt sich die verschlungene Diskussion um die Legitimität eines Krieges gegen den Irak.
Doch, ach, von dieser Welt ist nur der Wunsch und nicht die Wirklichkeit. Denn George Bush hat niemals „Beweise“ versprochen, wie es landauf, landab geschrieben steht. In seiner Rede zur Lage der Nation kündigte er, viel bescheidener, „Geheimdienstinformationen“ an – ein wichtiger Unterschied.
Denn nichts, was aus der Welt der Schlapphüte kommt, ist automatisch wasserdicht, stoßfest, idiotensicher. Im Gegenteil: Es ist „voller Ungewissheit und voller Unbestimmheit“, wie Bruce Berkowitz, ein Wissenschaftler der konservativen Hoover-Institution, am Wochenende schrieb. Der Mann wird es wissen, denn er begann seine Karriere als Agent bei der CIA. Weshalb er zu dem vernünftigen Schluss kommt, eine demokratische Gesellschaft solle die Frage von Krieg oder Frieden nicht allein „aufgrund von Geheimdienstinformationen entscheiden“.
So viel also zur Einordnung. Nun zu dem, was die Amerikaner seit Anfang der Woche bruchstückhaft veröffentlichen (und was Außenminister Colin Powell der Welt am Mittwoch – wenige Stunden nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – als multimediales Gesamtkunstwerk präsentieren wollte). Es ist ein Mosaik aus Berichten von Überläufern und verhafteten Terrorverdächtigen, von Satellitenbildern und von abgehörten Gesprächen.
Es soll beweisen:
–dass Saddam Husseins Regime enge Kontakte zur Terrorgruppe al-Qaida unterhält
–dass der Irak verbotene Massenvernichtungswaffen vor UN-Inspektoren versteckt
–dass der Irak nicht nur alte Massenvernichtungswaffen hortet, sondern auch neue
herstellt.
Die Labors für Biowaffen sollen beweglich und im Notfall auf Rädern durchs Land rollbar sein. Sie befänden sich, heißt es, in jenen vom Irak gekauften Renault-Lastwagen, über deren Zweck schon seit Monaten öffentlich spekuliert wird. Das klingt wie ein guter Beleg. Allerdings stammen die Informationen von drei Überläufern, wie Präsident Bush in seiner Rede zur Lage der Nation preisgab, und sie datieren aus der Zeit vor 1999. Heute sind die Lastwagen für die Amerikaner offenbar schwer zu lokalisieren. „Ich fände es prima, wenn die Labors in der Wüste rumführen. Dann könnten wir sie leicht erkennen und zerstören“, sagte am Wochenende Richard Armitage, der stellvertretende Außenminister. „Wir glauben aber, dass die Dinger in einem dieser vielen Tunnels oder unterirdischen Lagerhallen stehen, vielleicht auch in Garagen.“
Die Iraker behaupten übrigens, dass die Lastwagen im Einsatz sind, um Lebensmittel und Getreide vor Pilz- und Schimmelbefall zu schützen. Wenn das stimmt, stellt sich die Frage, warum die Iraker ihre mobilen Schädlingsbekämpfungs-Stationen noch nicht den UN-Waffeninspektoren gezeigt haben.
Seit die Inspektoren wieder im Lande sind, überwacht die National Security Agency (NSA) elektronisch, was im Irak gesprochen wird. Das Ohr Amerikas hat offenbar aufgeschnappt, wie ein ganzes Team von Staatsbediensteten Hans Blix und seine Truppe an der Nase herumführt. Jene, die schon Mitschnitte gehört haben, berichten im Magazin Newsweek davon, wie sich die Betrüger im Staatsdienst ihrer Taten brüsten. „Verlegt das!“, soll jemand rufen. Ein anderer gebe Anweisung: „Berichte darüber nicht!“ Und wieder ein anderer: „Ha, können Sie glauben, dass die das nicht gefunden haben?“ Auch bei diesem Indiz bleibt manches unklar. Was die Iraker zu verstecken scheinen, muss nicht unbedingt eine Waffe sein. Es könnten Vorläuferstoffe sein oder auch Dokumente und CD-ROMs. Sie zu verbergen wäre allerdings in jedem Falle illegal; es würde auf den Willen zum Betrug an der Weltgemeinschaft hindeuten.
Besonders wichtig ist der amerikanischen Regierung der Nachweis, dass Husseins Regime stärker mit der Terrororganisation al-Qaida zusammenarbeitet als bisher bekannt. Der Verbindungsmann soll der Jordanier Abu Mussab al-Zarqawi sein. Er ist einer der Anführer der Terrorzelle al-Tawhid, einer Art Tochtergesellschaft des verzweigten Terrorkonzerns al-Qaida. Seine Spezialität scheint Giftmischerei aller Art zu sein. Bevor er im vergangenen Jahr in den Nordirak ging, hat er sich offenbar in einem Bagdader Krankhaus behandeln lassen. Er soll nämlich bei den Kämpfen mit den Amerikanern in Afghanistan verwundet worden sein. Al-Zarqawi, so heißt es, habe im vergangenen Oktober in Jordanien einen Mordanschlag auf einen amerikanischen Diplomaten organisiert. So jedenfalls hätten es die beiden mutmaßlichen Attentäter den jordanischen Behörden nach ihrer Verhaftung gestanden. Allerdings: dass irakische Behörden bei dem Mordkomplott mit al-Qaida konspirierten, haben die Amerikaner bis Dienstag nicht behauptet.
Gelänge es, eine Verbindung zur Regierung in Badgad nachzuzeichnen – dann wäre der entschiedendste Teil von Washingtons Kriegspartei dort, wo er seit dem 11. September 2001 hinwill: Ein Angriff auf den Irak müsste nicht mehr als Präventivschlag gelten, sondern wäre als Selbstverteidigungskrieg gegen al-Qaida zu rechtfertigen. Dass der Herrscher von Bagdad hinter dem Anschlag auf das World Trade Center steckt, ist den wackeren Saddam-Feinden im Pentagon schon am Morgen des 11. September 2001 zur unumstößlichen Überzeugung geworden. Ihre eigene Gewissheit zu beweisen, gilt seither all ihr Trachten.
Zuerst sollte die CIA Husseins Fingerabdruck aus dem Schutt des World Trade Center herausfischen. Doch es fand sich keine Spur. Was den Pentagon-Berater Richard Perle zu der Bemerkung veranlasste, die CIA sei „im Hinblick auf den Irak unfähig“.
Richtig daran war immerhin, dass die US-Spione die Gefahr des Saddam-Regimes jahrelang unterschätzt hatten. Sie übersahen bis zum Golfkrieg 1991 Iraks komplettes Atomprogramm. Ebenso das Biowaffenprogramm, das 1995 ein Überläufer sowie die UN-Inspektoren entdeckten.
Also umging das Pentagon die CIA und beauftragte Jim Woolsey mit einer Privatermittlung. Der Mann war zwar einst CIA-Direktor, gilt den neokonservativen Falken aber als Parteigänger. Woolsey beharrte sogar noch auf der „Irak-Connection“, als der tschechische Präsident Václav Havel das wichtigste Indiz zur Fehlinformation erklärte: die Vermutung nämlich, dass der New-York-Attentäter Mohammed Atta in Prag einen irakischen Agenten getroffen haben könnte.
Aus Frustration gründete die Kriegspartei ihren eigenen kleinen Geheimdienst mitten in ihrer Bastion, im Pentagon. Seit Herbst 2001 tagt im fünften Stock eine fünfköpfige Arbeitsgruppe unter Führung eines ideologisch sattelfesten Neokonservativen. Sie arbeitet die Rohdaten der CIA täglich neu auf.
Als die Geheimgruppe im Herbst 2002 durch Zufall bekannt wurde, musste das Pentagon einräumen, es gehe allein darum, Nachweise über die Verbindung des Irak zu al-Qaida zu suchen – eine Verbindung, die Tausende CIA-Analysten angeblich seit Jahren hartnäckig übersehen. „Die Linse, durch die man schaut, beinflusst, wonach man sucht“, sagte Pentagon-Vize Paul Wolfowitz.
Die kleine Einheit ist offenbar in der ganzen Geheimdienstgemeinde verhasst. Das berichtet jedenfalls – anonym – ein Schlapphut. Die Gruppe sei ein Symbol für den politischen Missbrauch von Geheiminformationen. Tatsächlich erinnert die Irak-Zelle an die Bemühungen des ehemaligen CIA-Chefs William Casey, der 1981 versuchte, dem damaligen „Reich des Bösen“ den Anschlag auf den Papst anzuhängen: „Die Ersten, die Indizien sowjetischer Beteiligung finden, werden befördert“, rief er damals. Am Ende setzte es Beförderungen zuhauf, den gewünschten Tatnachweis fand niemand.
Angesichts dieser Vorgeschichte ist nicht erstaunlich, dass Präsident Bush seit seiner jüngsten Bemerkung über die „Irak-Connection“ der al-Qaida energischen Widerspruch von Ermittlern und Agenten erhält. CIA-Analysten beschweren sich, die Regierung übertreibe die Bedeutung einzelner Indizien. Und ein FBI-Ermittler lässt sich in der New York Times mit folgendem Satz zitieren: „Wir haben uns die Sache seit mehr als einem Jahr angeschaut, und wissen Sie was? Wir glauben nicht, dass irgendwas dran ist.“ Damit konfrontiert, musste Vizeaußenminister Richard Armitage am Wochenende einräumen, die Regierung habe ihre Irak-Argumentation „in der Vergangenheit gelegentlich“ auf zweifelhafte Informationen gestützt. Fragt sich, ob die Enthüllungen dieser Woche von der „moderaten“ CIA oder dem „offensiven“ Pentagon stammen.
Die Seriosität der amerikanischen Argumente zu prüfen wird in Deutschland Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes sein. Gerade im Irak unterhält der BND seit Jahren eigene Quellen. Am 13. November 2002 hat BND-Chef August Hanning den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages über das, was er wusste, informiert.
Er bestätigte einige amerikanische Befürchtungen und reicherte sie mit eigenen Erkenntnissen an. Danach gibt es die rollenden Biowaffenlabors offenbar bis heute. Einzelne Teile seien von deutschen Unternehmen – deklariert als Ausrüstung für die Landwirtschaft – zugeliefert worden. Das Regime besitze unbemannte Drohnen, um Kampfstoffe großflächig zu versprühen. Der BND schätzt, dass Saddam Hussein mehrere hundert Tonnen Kampfstoffe hortet.
Die Abgeordneten waren schockiert. Was sie erfuhren, ist der Öffentlichkeit bis heute unbekannt geblieben, weil die Parlamentarier im November zum Stillschweigen verpflichtet wurden. Wenn nun die Amerikaner ihre Erkenntnisse präsentiert haben, ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung nachzieht und (wenigstens begrenzte) Redefreiheit für ihren Nachrichtendienst gibt. Sie wird den Verdacht vermeiden wollen, Geheimdiensterkenntnisse genauso politisch einzusetzen wie die Kriegspartei in Washington. In Berlin bestände der Missbrauch im Verschweigen.
DIE ZEIT 7/2003 - Mitarbeit: Bruno Schirra
#5 von rodex 06.02.03 12:42:56 Beitrag Nr.: 8.528.782 8528782
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
Seoul, 06. Feb (Reuters) - Nordkorea hat den USA im Streit
um sein Atomprogramm einem Zeitungsbericht zufolge mit einem
Präventivschlag gedroht.
"Die USA sagen, wir sind nach Irak als nächste dran",
zitierte die britische Zeitung "Guardian" am Donnerstag auf
ihrer Website Ri Pyong Gap, einen führenden Vertreter des
nordkoreanischen Außenministeriums. "Aber wir haben unsere
eigenen Gegenmaßnahmen. Präventivangriffe sind nicht das
alleinige Recht der USA", sagte Ridem Blatt zufolge am Vortag.
Damit ging Ri deutlich über die bisherige Position des
kommunistischen Landes hinaus.
Nordkorea hatte am Mittwoch angekündigt, mit stärkeren
Maßnahmen zur Selbstverteidigung auf US-Pläne zur Aufstockung
seiner Militärpräsenz im Pazifik-Raum zu reagieren.
Der gegenwärtige Streit um das Atomprogramm gehe deutlich
über den vor einem Jahrzehnt hinaus, sagte Ri der Zeitung
zufolge. "Die derzeitige Lage ist ernster als 1993. Es ist
völlig offen." Vor zehn Jahren hatten beide Länder am Rande
eines Krieges gestanden, sich dann aber 1994 auf ein Abkommen
geeinigt, in dem Nordkorea auf sein Atomprogramm verzichtete.
Dieses Abkommen hat Nordkorea nach US-Angaben allerdings
gebrochen. Die USA werfen dem Land, das US-Präsident George W.
Bush mit Irak und Iran zur "Achse des Bösen" zählt, vor, im
Rahmen des Atomwaffenprogrammes waffentaugliches Plutonium
herzustellen.
Am Vortag hatte der frühere UNO-Waffeninspektor und heutige
Kritiker der US-Politik gegenüber Irak, Scott Ritter, davor
gewarnt, dass "Nordkorea, wenn es sieht, wie die Vereinigten
Staaten Irak völkerrechtswidrig vernichten, sich nicht
zurücklehnt und abwartet, dass die Amerikaner kommen". Nordkorea
werde einen Präventivschlag gegen US-Truppen und deren
Verbündete in Asien führen, prophezeite er: "Sie werden nicht
eher zufrieden sein, bevor Tokio auf ein Stück radioaktiven
Abfalls reduziert ist."
#6 von rodex 06.02.03 12:43:47 Beitrag Nr.: 8.528.794 8528794
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
Seoul, 06. Feb (Reuters) - Nordkorea hat den USA für den
Fall eines Überraschungsangriffs auf seinen Atomreaktor mit
einem "gewaltigen Gegenschlag" gedroht.
"Wenn die USA einen Überraschungsangriff auf unsere
friedlichen Atomanlagen starten, dann wird das einen totalen
Krieg auslösen", schrieb die Parteizeitung "Rodong Sinmun" in
einem Kommentar. "Es ist dumm von den USA zu denken, dass wir
still mit verschränkten Arme da sitzen und warten, bis sie den
Befehl für einen vorbeugenden Angriff geben." Das kommunistische
Land hatte am Mittwoch angekündigt, mit stärkeren Maßnahmen zur
Selbstverteidigung auf US-Pläne zur Aufstockung seiner
Militärpräsenz im Pazifik-Raum zu reagieren.
Nordkorea hat nach US-Angaben gegen ein Abkommen von 1994
verstoßen, in dem es auf sein Atomprogramm verzichtete. Die USA
werfen dem Land vor, im Rahmen des Atomwaffenprogrammes
waffentaugliches Plutonium herzustellen.
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
Seoul, 06. Feb (Reuters) - Nordkorea hat den USA im Streit
um sein Atomprogramm einem Zeitungsbericht zufolge mit einem
Präventivschlag gedroht.
"Die USA sagen, wir sind nach Irak als nächste dran",
zitierte die britische Zeitung "Guardian" am Donnerstag auf
ihrer Website Ri Pyong Gap, einen führenden Vertreter des
nordkoreanischen Außenministeriums. "Aber wir haben unsere
eigenen Gegenmaßnahmen. Präventivangriffe sind nicht das
alleinige Recht der USA", sagte Ridem Blatt zufolge am Vortag.
Damit ging Ri deutlich über die bisherige Position des
kommunistischen Landes hinaus.
Nordkorea hatte am Mittwoch angekündigt, mit stärkeren
Maßnahmen zur Selbstverteidigung auf US-Pläne zur Aufstockung
seiner Militärpräsenz im Pazifik-Raum zu reagieren.
Der gegenwärtige Streit um das Atomprogramm gehe deutlich
über den vor einem Jahrzehnt hinaus, sagte Ri der Zeitung
zufolge. "Die derzeitige Lage ist ernster als 1993. Es ist
völlig offen." Vor zehn Jahren hatten beide Länder am Rande
eines Krieges gestanden, sich dann aber 1994 auf ein Abkommen
geeinigt, in dem Nordkorea auf sein Atomprogramm verzichtete.
Dieses Abkommen hat Nordkorea nach US-Angaben allerdings
gebrochen. Die USA werfen dem Land, das US-Präsident George W.
Bush mit Irak und Iran zur "Achse des Bösen" zählt, vor, im
Rahmen des Atomwaffenprogrammes waffentaugliches Plutonium
herzustellen.
Am Vortag hatte der frühere UNO-Waffeninspektor und heutige
Kritiker der US-Politik gegenüber Irak, Scott Ritter, davor
gewarnt, dass "Nordkorea, wenn es sieht, wie die Vereinigten
Staaten Irak völkerrechtswidrig vernichten, sich nicht
zurücklehnt und abwartet, dass die Amerikaner kommen". Nordkorea
werde einen Präventivschlag gegen US-Truppen und deren
Verbündete in Asien führen, prophezeite er: "Sie werden nicht
eher zufrieden sein, bevor Tokio auf ein Stück radioaktiven
Abfalls reduziert ist."
#6 von rodex 06.02.03 12:43:47 Beitrag Nr.: 8.528.794 8528794
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
Seoul, 06. Feb (Reuters) - Nordkorea hat den USA für den
Fall eines Überraschungsangriffs auf seinen Atomreaktor mit
einem "gewaltigen Gegenschlag" gedroht.
"Wenn die USA einen Überraschungsangriff auf unsere
friedlichen Atomanlagen starten, dann wird das einen totalen
Krieg auslösen", schrieb die Parteizeitung "Rodong Sinmun" in
einem Kommentar. "Es ist dumm von den USA zu denken, dass wir
still mit verschränkten Arme da sitzen und warten, bis sie den
Befehl für einen vorbeugenden Angriff geben." Das kommunistische
Land hatte am Mittwoch angekündigt, mit stärkeren Maßnahmen zur
Selbstverteidigung auf US-Pläne zur Aufstockung seiner
Militärpräsenz im Pazifik-Raum zu reagieren.
Nordkorea hat nach US-Angaben gegen ein Abkommen von 1994
verstoßen, in dem es auf sein Atomprogramm verzichtete. Die USA
werfen dem Land vor, im Rahmen des Atomwaffenprogrammes
waffentaugliches Plutonium herzustellen.
Was ist nur aus Recht und Unrecht geworden?
von Dr. med. Roberta M. Gilbert, Falls Church, Virginia, USA
Im Jahre 1973 schrieb Dr. Karl Menninger, möglicherweise der beste Psychiater, den Amerika damals oder jemals hatte, «Was ist nur aus der Sünde geworden?». Er schrieb, es gebe wichtige Gründe für eine Rückkehr zum Begriff der Sünde als Gegenmittel für vieles, was in unserer Gesellschaft im argen liegt. Ich glaube, seine Auffassung ist heute von noch grösserer Bedeutung. Unter anderen abscheulichen Sünden der Gesellschaft nannte er auch den Krieg. Er war der Ansicht, dass der Krieg niemals als ein Mittel zur Lösung von Problemen betrachtet werden sollte. Das ist auch meine Meinung.
Aber wir stehen am Rande eines - wie es scheint - unabwendbaren Krieges, und ich denke, dass wir uns selbst dazu einige unangenehme Fragen stellen müssen. Die meisten Amerikaner glauben an den Grundsatz von Recht und Unrecht. Mir scheint, es gibt viele offene Fragen im Zusammenhang mit diesem Krieg, die wir abklopfen müssen. Wenn wir uns überhaupt über Probleme wie Recht oder Unrecht Gedanken machen oder über Verantwortung gegenüber rücksichtslosem Egoismus, dann müssen wir noch einmal auf den Begriff des gerechten Krieges zurückkommen. Ich kann hier nicht die lange Tradition dieser interessanten Ansicht erörtern. Ich bin jedoch der Meinung, dass es, ausser im Falle der Selbstverteidigung bei einem konkreten Einmarsch (von Truppen und nicht von ein paar Einzelmenschen) auf dem eigenen Territorium, keinen gerechten Krieg gibt. Wenn wir einen ungerechten Krieg führen, dann sind wir im Unrecht. In allen grossen Religionen oder Sittenlehren gibt es die Sicht, dass aggressives Verhalten wiederkehrt und einen dann verfolgt.
Warum wollen wir denn einen Krieg führen? Gibt es eine vernünftige Erklärung dafür? Die Gründe dafür, die mir zu Ohren kamen, sind folgende:
1. Der Feind hat Massenvernichtungswaffen. Sie sind eine direkte Bedrohung für uns, unsere Bevölkerung und unsere Lebensart.
2. Der Feind ist unmenschlich, er tötet und foltert sein eigenes Volk. Sein Volk möchte einen Regimewechsel.
3. Wenn der Feind uns zuerst angreift, würde unser Wirtschaftssystem ruiniert.
4. Wir müssen die Interessen unseres Verbündeten Israel schützen.
5. Wir müssen die Gewinnung und den Ölabfluss vom Nahen Osten in die USA schützen.
6. Saddam Hussein unterstützt den Terrorismus und, weil Terroristen in unser Land eingedrungen sind, haben wir das Recht, einzumarschieren und ihn zu stürzen.
Lassen Sie uns nun jeden einzelnen Grund der Reihe nach betrachten, um festzustellen, ob dadurch unsere Kriegserklärung gerechtfertigt wird.
«Der Feind hat Massenvernichtungswaffen, die eine direkte Bedrohung für uns sind»
Kann sein, dass der Feind diese Waffen hat. Wie gemein, ja sogar schrecklich, dass Menschen mit wenig oder gar keinem moralischen Gewissen ein solches Zerstörungspotential in ihrer Gewalt haben würden. Andererseits sind seit dem ersten Golfkrieg nun schon zehn Jahre vergangen. Wenn unser «Feind» diese Waffen hat (wofür bisher aber noch keine Beweise erbracht worden sind), dann hat er aber bisher noch keine Anstalten gemacht, sie gegen uns einzusetzen. Er hat nicht mit Krieg gedroht, aber wir! Und vergessen wir nicht, dass er diese entsetzlichen Möglichkeiten ohne einen erheblichen Beitrag auf diesem Gebiet von verschiedenen westlichen Firmen gar nicht hätte. Ohne einen direkten Angriff auf uns und nur, weil wir Angst haben vor eventuellen Absichten oder Möglichkeiten, die unser Feind haben könnte, ist es ein Unrecht, einen Krieg zu führen.
«Der Feind ist unmenschlich, er tötet und foltert sein eigenes Volk, das einen Regimewechsel haben möchte»
Das mag schon stimmen. Der Gedanke ist sicherlich vernünftig, dass ein Tyrann, der sein eigenes Volk misshandelt und sogar ermordet, ein Unrecht tut und abgesetzt werden sollte. Doch ich frage mich, von wem soll er abgesetzt werden - etwa von uns? Wir wissen doch, dass niemand regiert ohne die Zustimmung derjenigen, die er regiert. Überlässt man das Volk im Irak sich selbst, wird seine Kraft anwachsen. Man wird dort mit der Zeit das Problem immer gründlicher erfassen und einen Weg zu seiner Lösung finden, so wie es die Völker in allen Zeiten getan haben.
Wenn jedoch Staaten von aussen eingreifen, vor allem sehr mächtige, dann verlieren die Menschen, die direkt betroffen sind, ihre Energie und ihr Ziel aus den Augen. Dann passiert überhaupt nichts. Nur weil die USA heute die einzige «Supermacht» sind - gibt uns das denn das Recht zu bestimmen, wie die Dinge für alle anderen Länder auf der Welt zu laufen haben? Und haben wir das Recht, die Ermordung von Herrschern anderer Länder überhaupt zu erörtern? Würden denn bei einem Krieg, den die USA auslösen, etwa weniger Unschuldige vernichtet werden? Im Gegenteil, weitaus mehr Menschen würden in einem Krieg von unserer Seite getötet werden als durch irgendeinen Tyrannen, und ihr Blut würde an unseren Händen kleben. Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wie irgendein Staat - ausser unserem eigenen - regiert werden muss. Und es ist nicht unsere Angelegenheit, über den Herrscher eines anderen Landes ein Urteil zu fällen. Wenn sie ihn nicht wollen, werden sie Wege finden, ihn loszuwerden, vielleicht mit unserer Unterstützung, aber nur, wenn wir gefragt werden. Einen Krieg zu führen, nur weil wir einen Herrscher als böse beurteilen, ist ein Unrecht.
«Wenn der Feind uns zuerst angreift, würde unser Wirtschaftssystem ruiniert»
Das ist jedoch ein grosses Wort, dieses «Wenn». Wenn der Feind uns in den letzten zehn Jahren nicht angegriffen hat, warum nehmen wir dann einen hypothetischen Angriff als Begründung dafür, selber den Präventivschlag durchzuführen? Ausserdem ist dieses «Wenn» für mich keine Rechtfertigung für den Einmarsch und die Besetzung eines anderen Landes. Die Wirtschaft aufzurechnen gegen Menschenleben (zehn, Hunderte oder Tausende) ist doch kein Wettbewerb. Was würde denn ein Krieg unserer Wirtschaft bringen? Eventuelle wirtschaftliche Gründe als Anlass für einen Krieg sind ein Unrecht.
«Wir müssen die Interessen unseres Verbündeten Israel schützen»
In Israel fand kein Einmarsch statt. Bei uns fand kein Einmarsch statt. Wahrscheinlich hätte es Israel sehr gern, dass wir einen Krieg gegen den Irak führen. Manche Leute behaupten sogar, dass Israel im Hintergrund die Fäden zieht und uns anstachelt. Man kann ja schon sehen, wie das möglich sein könnte. Doch Israel ist durchaus in der Lage, seine eigenen Schlachten zu schlagen, wie es das ja auch fortlaufend demonstriert hat. Israel als Argument zu nehmen, dass Amerika in den Krieg zieht, ist ein Unrecht.
«Wir müssen die Gewinnung und den Abfluss von Öl im Nahen Osten schützen»
Hier kann man wieder einmal sehen, wie die grösste und stärkste Nation auf der Welt begründet, dass sie ein Recht hat, alles zu tun, was sie will. Warum erklären wir dann nicht einfach einen Krieg, gehen hin und besetzen irgendein Land, das die Ressourcen hat, die wir gerade wollen? Zu dieser Sicht kommt noch das Argument, weil diese Ressourcen ja in einer instabilen Region liegen, dass wir eine Begründung finden müssen, warum wir dorthin gehen und die Lage stabilisieren. Das ist nicht meine Meinung. Wenn wir finden, der Krieg wäre gerechtfertigt, weil eine Ressource, die wir brauchen, in einer instabilen Gegend liegt, dann fallen wir mit dieser Ansicht völlig aus dem Rahmen jeglicher moralischen oder ethischen Betrachtung, die ich je gehört habe. Wenn dies die Begründung der USA dafür ist, diesen Krieg zu rechtfertigen, dann sind sie im Unrecht. Öl als Grund für einen Krieg ist ein Unrecht.
«Saddam Hussein fördert und unterstützt die Terroristen, unsere Feinde»
Dies ist vielleicht das stärkste Argument von allen. Doch wird der Terrorismus von vielen Zentren und von vielen Staaten auf der ganzen Welt unterstützt. Diejenigen, die am 11. September die Anschläge auf Amerika verübt und angestiftet haben, sollte man finden und vor Gericht bringen, egal, wie viele es da draussen sind. Wenn es einen direkten Beweis gegen Hussein gibt, dann sollte er angeklagt und vor ein amerikanisches Gericht gebracht werden. Wäre das nicht vernünftiger und auch das, was man von der stärksten Nation auf der Erde erwarten würde, als einen Krieg zu führen? Würde es unserem Land nicht mehr Schutz bieten, wenn man unsere eigenen Grenzen sichert und andere naheliegende Sicherheitsmassnahmen in Angriff nimmt, die immer noch vernachlässigt werden? Wie soll denn ein Krieg irgendein Problem lösen? Und wo hört der Krieg dann auf? Wie soll er gewonnen werden? Heisst Krieg nicht, dass wir uns auf ihr Niveau herablassen? Ein Krieg, weil der Feind eventuell daran teilnimmt oder die Absicht dazu hat, ist ein Unrecht.
Usama bin Ladin plante tatsächlich einen Angriff auf Hussein, als er in Kuwait eindrang, doch der König von Saudi-Arabien hielt ihn davon ab. Hätte Usama weitergehen dürfen, dann hätten unsere beiden Feinde gegeneinander Krieg geführt, und wir wären draussen geblieben aus einem sehr teuren und schrecklichen Krieg. Und wie es mit bösen Imperien immer passiert, wäre das ganze terroristische Netzwerk vielleicht in sich selbst zusammengefallen. Der 11. September hätte sich dann niemals ereignet.
«Wer die Macht hat, hat recht»?
Ich liebe mein Land. Ich bete jeden Tag für seinen Präsidenten. Aber ich habe Angst, dass Amerika ausser Kontrolle geraten ist. Die Moral der USA, die der Rechtfertigung eines Kriegsbeginns zugrunde liegt, ist offenbar: «Wer die Macht hat, hat recht.» Ist Amerika so tief gesunken? Wenn das der Fall ist, dann haben wir meiner Meinung nach allen Grund dazu, um unsere Zukunft zu bangen. In dem Falle werden wir selber zum bösen Imperium und zu denen, die früher oder später an sich selbst zerbrechen werden.
Wenn wir Tausenden von unschuldigen Menschen Tod und Zerstörung zufügen, dann glaube ich, wie jede grosse Religion oder ethische Tradition auf der Welt, dass dies auf uns selbst zurückkommen wird.
Übersetzung Zeit-Fragen
Artikel 1: Zeit-Fragen Nr.4 vom 3. 2. 2003, letzte Änderung am 4. 2. 2003
Zum Artikel-Anfang: auf den roten Balken klicken!
Offener Brief
Herrn Daniel Coats,
Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
in der Bundesrepublik Deutschland
Exzellenz!
In der Nachrichtensendung vom 22.1.03 des Fernsehsenders ZDF von 19 Uhr wurde der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Appell an irakische Soldaten zitiert, in dem er diese warnte, Befehle ihrer Vorgesetzten auszuführen, da sie dann als Kriegsverbrecher behandelt werden könnten.
In allen bewaffneten Kämpfen wird versucht, den Gegner durch Hinweis auf die eigene Stärke zu demoralisieren. Das überrascht nicht.
Schärfstens kritisieren muss ich aber, dass der militärisch mächtigste Mann der Welt öffentlich ankündigt, Gefangene nicht nach der Genfer Konvention zu behandeln, sondern nach Gutdünken als Verbrecher zu bestrafen. Damit werden pauschale Vorverurteilungen ausgesprochen, die jedem Recht Hohn sprechen. Wer die Bilder von der menschenunwürdigen Behandlung gefangener Taliban gesehen hat, muss solche Drohungen leider ernst nehmen.
Ich fordere Sie auf, Exzellenz, öffentlich klarzustellen, dass die Genfer Konvention uneingeschränkt auch für das Reden und Handeln aller Verantwortlichen der USA gilt. Aber Misstrauen bleibt. Deswegen werde ich auch weiter meine Kraft einsetzen, um einen Krieg um Öl und Macht in Mittelost zu verhindern. Frieden liegt auch im wohlverstandenen Interesse der US-Bürger selbst!
In der Hoffnung, dass doch noch Vernunft siegen kann
Dr. med. Dietrich Loeff
Artikel 4: Zeit-Fragen Nr.4 vom 3. 2. 2003, letzte Änderung am 4. 2. 2003
Herrn Daniel Coats,
Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
in der Bundesrepublik Deutschland
Exzellenz!
In der Nachrichtensendung vom 22.1.03 des Fernsehsenders ZDF von 19 Uhr wurde der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Appell an irakische Soldaten zitiert, in dem er diese warnte, Befehle ihrer Vorgesetzten auszuführen, da sie dann als Kriegsverbrecher behandelt werden könnten.
In allen bewaffneten Kämpfen wird versucht, den Gegner durch Hinweis auf die eigene Stärke zu demoralisieren. Das überrascht nicht.
Schärfstens kritisieren muss ich aber, dass der militärisch mächtigste Mann der Welt öffentlich ankündigt, Gefangene nicht nach der Genfer Konvention zu behandeln, sondern nach Gutdünken als Verbrecher zu bestrafen. Damit werden pauschale Vorverurteilungen ausgesprochen, die jedem Recht Hohn sprechen. Wer die Bilder von der menschenunwürdigen Behandlung gefangener Taliban gesehen hat, muss solche Drohungen leider ernst nehmen.
Ich fordere Sie auf, Exzellenz, öffentlich klarzustellen, dass die Genfer Konvention uneingeschränkt auch für das Reden und Handeln aller Verantwortlichen der USA gilt. Aber Misstrauen bleibt. Deswegen werde ich auch weiter meine Kraft einsetzen, um einen Krieg um Öl und Macht in Mittelost zu verhindern. Frieden liegt auch im wohlverstandenen Interesse der US-Bürger selbst!
In der Hoffnung, dass doch noch Vernunft siegen kann
Dr. med. Dietrich Loeff
Artikel 4: Zeit-Fragen Nr.4 vom 3. 2. 2003, letzte Änderung am 4. 2. 2003
@ bluemoons
seit Wochen instrumentalisierst Du meine Threads für die Verbreitung
Deiner politischen Überzeugungen. Ich denke es reicht, wenn ich Dir
einen Thread sozusagen "kampflos" überlassen habe.
Wenn Du für Deine Mission eine Bühne brauchst,
dann eröffne bitte einen eigenen Thread
und benutze nicht länger meinen Namen !
Konradi
seit Wochen instrumentalisierst Du meine Threads für die Verbreitung
Deiner politischen Überzeugungen. Ich denke es reicht, wenn ich Dir
einen Thread sozusagen "kampflos" überlassen habe.
Wenn Du für Deine Mission eine Bühne brauchst,
dann eröffne bitte einen eigenen Thread
und benutze nicht länger meinen Namen !
Konradi
Huhu, Katastrohen Goldbugs! 
Habe einen neuen Thread aufgemacht!
Thread: Krisenthread: Strategien zum Überleben
Krisenthread, Strategien zum Überleben
In Anschluß an unsere Diskussion hier!
Hoffe, ihr schaut mal rein!

Habe einen neuen Thread aufgemacht!
Thread: Krisenthread: Strategien zum Überleben
Krisenthread, Strategien zum Überleben
In Anschluß an unsere Diskussion hier!

Hoffe, ihr schaut mal rein!

Weiter so, bluemoons, Du postest hier mit die besten Beiträge.
Mein thread, dein thread, was für ein erbärmlicher Kindergarten.
Wobei ich hier eindeutig den Kindern unrecht tue.
CU Jodie
Mein thread, dein thread, was für ein erbärmlicher Kindergarten.

Wobei ich hier eindeutig den Kindern unrecht tue.
CU Jodie
Hallo BLUEMOONS,
auch von mir vielen Dank für Deine eingestellten Berichte. Klicke ich mit großem Interesse jeden Tag an.
Aufgrund von Konradi´s Kritik bin ich noch einmal zum Anfang des Threads:
Konradi, wirklich alles in Ordnung? Ich muß mich zwangsweise Leuten anschließen, die mit Thesen wie "30 Tage Krieg, 30 Jahre Terror" beschreiben, was uns in den kommenden Jahren bevorstehen wird. Ganz klar gegen Diktatur und unmenschliche Unterdrückung eines ganzen Volkes eingestellt, stellt für mich die derzeitige "Politik" der USA, wenn man Sie überhaupt so nennen kann, eine politische Ära dar, wie sie vor Beginn des 1. Weltkrieges betrieben wurde. Abgesehen, daß so eine Politik alles andere als den gegenwärtigen Problemen unseres Globus´ und seiner Gesamtbevölkerung gerecht wird, sollte jeder eigentlich in Erinnerung haben, daß daraus nicht ein, sondern zwei Weltkriege entstanden sind - mit unendlichen Leiden für unzählige Menschen!!!!
Das Niveau einiger Leute, wie z.B. SEP, erinnert mich doch stark an frühere Mitschüler, die in der "Jungen Union" etc. tätig waren. Damit spreche ich ihnen keinesfalls Intellekt ab, sondern eher die Fähigkeit, sich vom Einfluß der Medien freimachen zu können, noch absrakt vorausschauend denken zu können.
Im Kampf für die Freiheit des Iraks und dessen anschließender Demokratisierung sin d in den vordersten Linien garantiert noch Plätze frei, SEP!!!! Sollte es mit der Befreiung des IRAKS nicht zeitlich hinhauen, so wäre auch eine "Mitarbeit" in Syrien möglich, dem nach Aussage des ehemaligen NATO-Oberbefehlshabers WESLEY CLARK, vermeintlich nächsten Ziel ( der USA?!), ( siehe WamS, heute Seite 7).
Was den inneren Zustand der USA anbelangt, so empfehle ich zur Einstimmung/ Sensibilisierung auf den Zustand der USA den Kinofilm "Bowling for Columbine". Suche auch immer noch nach der Antwort, wieviel Menschen lebenslänglich in der USA " The Land of The Free" im Knast sitzen. Wer Probleme nach Innen hat, wendet sich in der Regel nach außen.
Die Problme der USA nach innen sind m.E. immens. Der ganze "american way of life" funktioniert nach innen immer weniger. "Die Wirtschaft" ist hochverschuldet. Kommt in naher Zukunft kein billiges Öl, wird der Dow Jones infolge nicht länger zu verschleiernder sinkender Gewinne in die Knie gehen. Daran hängt zum einem mehr oder minder ein großer Teil die Altersversorgung eines 2?? Mio Volkes. Ziemlich viel Zündstoff von dieser Seite. Ein anderer Aspekt: die hauptsächlich "jewish" dominierte Finanzwelt ( mit enormen Gewinnen in den vergangene Jahren), die Ihnen abgekauften Aktien bei der Mittelschicht ( WASPSs), immer geringere Integration neuer Immigranten ( nicht nnur Hispanics) etc, etc. etc.
Und noch etwas, Konradi, aus meinem kleinen Leben: bin am 07/12/91 nach auf der Ladefläche eines PickUps nach Guatemala eingereist. Als wir in die erste Stadt kamen, loderten auf der Straße überall Feuer, es standen überall Menschen auf der Straße, es knallte, und ich dachte, ohne jemanden fragen zu können, ich sei direkt im Film "Under Fire. Meine Sicht war nicht gut genug, um zu sehen, daß es sich lediglich um Knallkörper handelte. War einkomisches Gefühl. Nach ein paar Stunden erfuhr ich erleichter, daß es sich um einen kath. Feiertag handelte(Guatemalteken knallen für Ihr Leben gern)
Ein paar Tage später wurde vom Militär fast die gesamte männliche Bevölkerung eines Indiodorfes am Atitlan-See umgbracht- ohne das man im Ansatz etwas davon mitbekommen hat.
Wenn in Stuttgart ( z.B.) in Kürze evtl ein durchgeknallter Extremist eine Bombe hochgehen läßt, dann juckt Dich das in Hamburg nicht zwangsläufig. Wenn die Art der USA, jede Ihrer Interessen auf die zu in Kürze erwartende Art und Weise zu "klären", jedoch um sich greift , nicht nur auf andere "lernfähige"Länder, sondern auch auf Individuen jedweliger Länder auf diesem Globus, dann fühlst Du Dich auch nicht mehr in Deiner Wohnung in Hamburg sicher.
Ich habe im Urlaub eine Israelin kennengelernt und mich länger mit Ihr unterhalten: Sie machte Urlaub von der Angst!!!!............. das ist die Katastrophe, Konradi, die uns allen bevorsteht, wenn dieser ferngesteuerte, unterbelichtete Typ aus Texas weiter das Schicksal der Welt bestimmen darf!!!!
A_B
auch von mir vielen Dank für Deine eingestellten Berichte. Klicke ich mit großem Interesse jeden Tag an.
Aufgrund von Konradi´s Kritik bin ich noch einmal zum Anfang des Threads:
Konradi, wirklich alles in Ordnung? Ich muß mich zwangsweise Leuten anschließen, die mit Thesen wie "30 Tage Krieg, 30 Jahre Terror" beschreiben, was uns in den kommenden Jahren bevorstehen wird. Ganz klar gegen Diktatur und unmenschliche Unterdrückung eines ganzen Volkes eingestellt, stellt für mich die derzeitige "Politik" der USA, wenn man Sie überhaupt so nennen kann, eine politische Ära dar, wie sie vor Beginn des 1. Weltkrieges betrieben wurde. Abgesehen, daß so eine Politik alles andere als den gegenwärtigen Problemen unseres Globus´ und seiner Gesamtbevölkerung gerecht wird, sollte jeder eigentlich in Erinnerung haben, daß daraus nicht ein, sondern zwei Weltkriege entstanden sind - mit unendlichen Leiden für unzählige Menschen!!!!
Das Niveau einiger Leute, wie z.B. SEP, erinnert mich doch stark an frühere Mitschüler, die in der "Jungen Union" etc. tätig waren. Damit spreche ich ihnen keinesfalls Intellekt ab, sondern eher die Fähigkeit, sich vom Einfluß der Medien freimachen zu können, noch absrakt vorausschauend denken zu können.
Im Kampf für die Freiheit des Iraks und dessen anschließender Demokratisierung sin d in den vordersten Linien garantiert noch Plätze frei, SEP!!!! Sollte es mit der Befreiung des IRAKS nicht zeitlich hinhauen, so wäre auch eine "Mitarbeit" in Syrien möglich, dem nach Aussage des ehemaligen NATO-Oberbefehlshabers WESLEY CLARK, vermeintlich nächsten Ziel ( der USA?!), ( siehe WamS, heute Seite 7).
Was den inneren Zustand der USA anbelangt, so empfehle ich zur Einstimmung/ Sensibilisierung auf den Zustand der USA den Kinofilm "Bowling for Columbine". Suche auch immer noch nach der Antwort, wieviel Menschen lebenslänglich in der USA " The Land of The Free" im Knast sitzen. Wer Probleme nach Innen hat, wendet sich in der Regel nach außen.
Die Problme der USA nach innen sind m.E. immens. Der ganze "american way of life" funktioniert nach innen immer weniger. "Die Wirtschaft" ist hochverschuldet. Kommt in naher Zukunft kein billiges Öl, wird der Dow Jones infolge nicht länger zu verschleiernder sinkender Gewinne in die Knie gehen. Daran hängt zum einem mehr oder minder ein großer Teil die Altersversorgung eines 2?? Mio Volkes. Ziemlich viel Zündstoff von dieser Seite. Ein anderer Aspekt: die hauptsächlich "jewish" dominierte Finanzwelt ( mit enormen Gewinnen in den vergangene Jahren), die Ihnen abgekauften Aktien bei der Mittelschicht ( WASPSs), immer geringere Integration neuer Immigranten ( nicht nnur Hispanics) etc, etc. etc.
Und noch etwas, Konradi, aus meinem kleinen Leben: bin am 07/12/91 nach auf der Ladefläche eines PickUps nach Guatemala eingereist. Als wir in die erste Stadt kamen, loderten auf der Straße überall Feuer, es standen überall Menschen auf der Straße, es knallte, und ich dachte, ohne jemanden fragen zu können, ich sei direkt im Film "Under Fire. Meine Sicht war nicht gut genug, um zu sehen, daß es sich lediglich um Knallkörper handelte. War einkomisches Gefühl. Nach ein paar Stunden erfuhr ich erleichter, daß es sich um einen kath. Feiertag handelte(Guatemalteken knallen für Ihr Leben gern)
Ein paar Tage später wurde vom Militär fast die gesamte männliche Bevölkerung eines Indiodorfes am Atitlan-See umgbracht- ohne das man im Ansatz etwas davon mitbekommen hat.
Wenn in Stuttgart ( z.B.) in Kürze evtl ein durchgeknallter Extremist eine Bombe hochgehen läßt, dann juckt Dich das in Hamburg nicht zwangsläufig. Wenn die Art der USA, jede Ihrer Interessen auf die zu in Kürze erwartende Art und Weise zu "klären", jedoch um sich greift , nicht nur auf andere "lernfähige"Länder, sondern auch auf Individuen jedweliger Länder auf diesem Globus, dann fühlst Du Dich auch nicht mehr in Deiner Wohnung in Hamburg sicher.
Ich habe im Urlaub eine Israelin kennengelernt und mich länger mit Ihr unterhalten: Sie machte Urlaub von der Angst!!!!............. das ist die Katastrophe, Konradi, die uns allen bevorsteht, wenn dieser ferngesteuerte, unterbelichtete Typ aus Texas weiter das Schicksal der Welt bestimmen darf!!!!
A_B
@ all black
Respekt ! Deine persönliche Einschätzung weicht zwar im Grundsatz von meiner Sicht der Dinge ab, aber es gibt auch einige Übereinstimmungen:
- Der ganze "american way of life" funktioniert nach innen immer weniger. "Die Wirtschaft" ist hochverschuldet. Kommt in naher Zukunft kein billiges Öl, wird der Dow Jones infolge nicht länger zu verschleiernder sinkender Gewinne in die Knie gehen
so ist es !
Ich habe im Urlaub eine Israelin kennengelernt und mich länger mit Ihr unterhalten: Sie machte Urlaub von der Angst!!!!............. das ist die Katastrophe, Konradi, die uns allen bevorsteht
richtige Feststellung aber falsche Schlußfolgerung:
Die Terroristen heißen nicht Bush und Rumsfeld, sondern Bin Laden und Saddam Hussein ! Wenn wir uns darauf nicht einigen können, dann ist eine weitere Diskussion überflüssig.
Auch von mir ein persönliches statement:
Meine Zweifel am "gerechten Krieg" gegen den Irak sind weitaus größer als im 1. Golfkrieg 1991. Ich lese täglich die unterschiedlichen Meinungen in den den großen Tageszeitungen und ich verfolge intensiv die Diskussionen im Fernsehen. Ich denke, ich mache es mir nicht leicht und ein Urteil fällt mir verdammt schwer, das kannst Du mir ruhig glauben. Ich bin für eine Verlängerung der Frist für die UN-Inspektoren, aber Lichterketten und eine Friedensdemo in Berlin sind genau die Signale, auf die Saddam Hussein händereibend wartet.
Falls die USA ohne UN-Mandat losschlagen ist die von Dir vorgetragene These "30 Tage Krieg – 30 Jahre Terror" vorprogrammiert. Auch in diesem Argument stimmen wir überein und dazu mag der unten angefügte Essay zum Nachdenken anregen.
Aber es gibt auch gute Gründe für einen Krieg. Sie wurden hier in diesem Thread vorgetragen und ich zitiere hier noch einmal auszugsweise Shlomo Avineri (siehe posting # 177)
aber einige Parallelen zum Europa des Jahres 1936 sind keineswegs fehl am Platz: Zu jener Zeit hatte das „Dritte Reich“ noch keinen anderen Staat angegriffen, doch es hatte den Versailler Vertrag über Bord geworfen und damit begonnen, unter Verletzung internationaler Abkommen wieder aufzurüsten, es hatte das Rheinland remilitarisiert, den Völkerbund verlassen sowie zu verstehen gegeben, dass es eine Revision der deutschen Grenzen anstrebt. Die demokratische Verfassung Deutschlands war abgeschafft worden, alle politischen Parteien, mit Ausnahme der NSDAP, verboten. Das Regime hatte auch erste Konzentrationslager eingerichtet – für Mitglieder der Opposition, Juden, „Zigeuner“, Homosexuelle. Es hatte Juden aus dem öffentlichen Leben verbannt, Gesetze verabschiedet, die sie diskriminierten, und viele von ihnen enteignet.
Man stelle sich vor, wie anders die Welt heute aussähe, hätten Großbritannien und Frankreich 1936 Gewalt gegen das „Dritte Reich“ eingesetzt. Österreich, die Tschechoslowakei und Polen wären nicht überfallen worden, Europa hätte keine Nazibesetzung durchleiden müssen, es hätte keinen Holocaust gegeben, und nicht zu vergessen: Zehn Millionen Deutsche wären nicht aus ihrer Heimat im Osten vertrieben worden.
Saddam hat in der Vergangenheit schlimmere Verbrechen begangen als Hitler bis zum Jahre 1936: Im nachhinein mag es unpassend klingen, etwas Derartiges zu sagen. Es ist indes eine Tatsache, dass der irakische Diktator die Kurden im Irak schlechter behandelt hat als Hitler die Juden im Jahr 1936. Er griff zwei Länder an – den Iran und Kuwait – und beschoss zwei andere – Israel und Saudi-Arabien – mit Raketen. Er setzte Giftgas gegen innere und äußere Feinde ein. Sein Regime ist viel repressiver als Nazideutschland anno 1936. Außerdem entwickelt er ABC-Waffen und verstößt seit zehn Jahren gegen das Völkerrecht sowie UN-Resolutionen.
Abschließend ein Essay, der vermutlich keinen Dissens aufwirft.
Gruß Konradi
Der falsche Krieg
Von Avishai Margalit
Es wird einen Krieg gegen den Irak geben. Doch dieser Krieg ist der falsche Krieg. Ich brauche nicht auf den Bericht von Hans Blix zu warten: Ich bin bereits jetzt davon überzeugt, dass der Irak chemische und biologische Waffen versteckt. Ich glaube außerdem, dass der Irak einige dutzend Raketen in Westirak verborgen hält. Obwohl ich diese Überzeugungen hege, bin ich nach wie vor der Ansicht, dass Amerika den falschen Krieg führen wird.
Wenn man amerikanische Regierungsbeamte fragt, wer denn der Feind sei, bekommt man seit dem 11. September drei verschiedene Antworten zu hören: der weltweite Terrorismus, die Massenvernichtungswaffen in den Händen solcher Übeltäter wie Saddam Hussein und der radikale Islam nach Art von bin Laden. Ich glaube, das verworrene Denken der Amerikaner über den Irak-Krieg entsteht aus der Vermengung dieser drei Antworten – als handele es sich um ein und dieselbe Antwort, während es in Wahrheit doch sehr verschiedene Antworten sind, die ganz unvereinbare praktische Schlussfolgerungen mit sich bringen.
Deshalb meine These: Der radikale Islam vom Typus eines bin Laden ist der Feind und sollte auch als Feind betrachtet werden. Allerdings, die Bekämpfung von Saddam wird diesem Feind eine große Hilfe sein, anstatt ihn zurückzuwerfen. Das gilt selbst dann, wenn der Krieg erfolgreich verläuft, erst recht aber dann, wenn er es nicht ist.
Die islamische Welt, die ein Siebtel der Weltbevölkerung ausmacht, steht am Rande einer „revolutionären Situation“, wie man im alten Jargon sagte.
Lenin, der sich mit Revolutionen auskannte, charakterisierte die revolutionäre Situation als einen Zustand, in dem die Massen das Regime nicht mehr ertragen und in dem es für das Regime schwierig wird, die Massen unter Kontrolle zu halten. In fast allen islamischen Ländern sind 50 Prozent der Bevölkerung Jugendliche unter 18 Jahren. Ihre Lebensaussichten sind trostlos, und doch kennen sie das glitzernde Leben, überwiegend aus den westlichen Medien. Dies führt dazu, dass sie die Kluft zwischen ihren realen Aussichten und ihren Träumen noch schwerer verkraften können.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die explosive Kluft zwischen Realität und Traum zu überwinden. Entweder man verbessert die ökonomischen Aussichten und arbeitet für ein besseres Leben – oder man verändert die Erwartungen der Menschen, zum Beispiel ihre Vorstellungen von einem gutem Leben. Säkulare Ideologien richten sich auf reale Lebensaussichten, während sich religiöse Ideologien auf die Träume richten. Und wenn säkulare Ideologien scheitern, so wie sie in den islamischen Ländern elend gescheitert sind, wächst die Anziehungskraft der anderen, von religiösen Ideologien ermutigten Träume um ein Vielfaches. Aus diesem Grund macht der radikale Islam der islamischen Welt ein revolutionäres Angebot, und zwar in zwei Spielarten. Es gibt das „stalinistische“ Angebot der Revolution in einem einzigen Land, so wie sie Chomeini im Iran gelang. Die Idee ist, eine erfolgreiche islamische Revolution vorweisen zu können, die später als Vorbild für Revolutionen in anderen islamischen Ländern dienen wird. Und daneben gibt es ein „trotzkistisches“ Angebot für die islamische Revolution. Sie zielt darauf, die Revolution umgehend in die gesamte islamische Welt zu exportieren.
Von bin Laden kommt das zweite, das „trotzkistisches“ Angebot für eine permanente und universelle islamische Revolution. Die Idee ist, den Terror als Propaganda zu nutzen, spektakuläre Aktionen zu inszenieren wie den Anschlag auf die „babylonischen“ Türme Manhattans, die Wahrzeichen der götzendienerischen amerikanischen Heiligtümer. Das Ziel ist aber keineswegs, Amerika zum Islam zu bekehren. Es geht vielmehr darum, einen revolutionären Kader zu rekrutieren, der die islamische Welt übernehmen wird. Vielleicht beginnt die Eroberung an den heiligen arabischen Stätten und fegt dort den unechten Wahhabismus hinweg, um von da aus einen neuen, vitaleren puritanischen Wahhabismus in der islamischen Welt zu verbreiten.
Bekanntlich setzt Terror als Propaganda der Tat auf die Überreaktion der Opfer. Aus Wut wird der Getroffene in seiner Reaktion auf unschuldige Unbeteiligte einschlagen, die dann radikalisiert werden und leicht rekrutierbar sind. Doch Terrorbekämpfung ist keine Aufgabe für Elefanten im Porzellanladen und ganz gewiss nicht für die Elefanten aus der Partei der Republikaner. Sie ist eine heikle Angelegenheit.
Ungeachtet des Kriegs in Afghanistan ist der Kampf gegen den Terror kein konventioneller Krieg, bei dem man der Luftwaffe feste Ziele vorgeben kann. Der Kampf gegen den Terror ist auch keine Polizeioperation wie bei der Bekämpfung der Mafia. Er liegt irgendwo in der Mitte dazwischen, was eine andere Strategie verlangt. Worauf es ankommt, ist, den „Fehlschluss des Instruments“ zu vermeiden – nämlich nur das Instrument zu benutzen, das man zu gebrauchen versteht, weil es das einzige ist, dessen Gebrauch man erlernt hat.
Ich will der Frage nach dem richtigen Kampf und den richtigen Mitteln nicht ausweichen, möchte aber zunächst darauf eingehen, wie der falsche Krieg vermieden werden kann. Die Regime in der arabischen Welt lassen sich als Mukhabarat-Regime bezeichnen. „Mukhabarat“ ist der arabische Begriff für Geheimdienste, aber auch der Oberbegriff für den gesamten Apparat, der für die innere Sicherheit zuständig ist. Ein Mukhabarat-Regime wird von den Kräften der inneren Sicherheit aufrecht erhalten; ob der Herrscher „König“ oder „Präsident“ (der von 99 Prozent der Bevölkerung gewählt wird) heißt, ist unerheblich.
Das Regime ist so oder so ein Mukhabarat-Regime, dessen Tätigkeit sich im Wesentlichen im eigenen Machterhalt erschöpft. Zweifellos gibt es Unterschiede hinsichtlich der Brutalität. Saddams Regime ist vielleicht das repressivste.
Wie zynisch auch immer Saddam während seines langen Kampfs gegen Chomeini oder während seines jetzigen Kampfs gegen Israel von religiöser Propaganda Gebrauch gemacht hat, sein Regime ist brutal säkular. Seine Mukhabarat-Leute mögen sich wohl mit radikalen Islamisten treffen, aber sie treffen sie hauptsächlich in seinen erbärmlichen Gefängnissen. Zynismus hin oder her, es stellt sich tatsächlich die Frage, ob Saddam nicht doch dazu in der Lage ist, bin Laden mit den chemischen und biologischen Waffen zu beliefern, von denen ich glaube, dass er sie besitzt.
Saddam Hussein ist ein schreckliches Übel, aber verrückt ist er nicht. Mehr als alles andere will er an der Macht bleiben. In Anbetracht der Tatsache, dass er ständig beobachtet wird, müsste er verrückt sein, wenn er sein Schicksal in die Hände eines Abgesandten bin Ladens legen und mit al-Qaida kooperieren würde – nur um sich an den Amerikanern zu rächen. So betrifft die Frage nach den Massenvernichtungswaffen nicht Saddams Moral, sondern dessen Rationalität. Es gibt viele Regime, die bin Laden mit chemischen und biologischen Waffen ausstatten, lange bevor Saddam dies tun würde.
Nun hat Bush unmissverständlich klar gemacht, dass ihm ein Eingeständnis von Saddam nicht genügen wird und dass er – komme, was wolle – den Irak angreifen wird. Hätte Saddam Herrn Blix eine peinlich genaue Liste seiner Waffen übergeben, hätte man es als Zeichen dafür gewertet, dass es nur die Spitze des Eisbergs ist und dass er weit mehr davon versteckt. So oder so kann es Saddam den Amerikanern nicht recht machen – es sei denn, er gibt seine Macht ab. Doch sobald er mit dem Rücken zur Wand steht, könnte er versucht sein, biologische und chemische Waffen hauptsächlich gegen Israel einzusetzen. Das ist gewiss nicht einfach, aber es ist eine echte Möglichkeit. Ich finde es rätselhaft, warum meine Landsleute die Versuchung, diesen Krieg anzufangen, so unwiderstehlich finden.
Für moralische Besserwisser mit einem blutenden Herzen für das irakische Volk hat man derzeit nur wenig Geduld. Aber erinnern wir uns, dass im Golfkrieg, der der Welt wie ein riesiges Videospiel vorkam, ungefähr 150000 Iraker getötet wurden. Man mag nur ermessen, wie viele Zivilisten in dem bevorstehenden Krieg ihr Leben verlieren. Das ist ein weiterer guter Grund, den Irakern die Befreiung durch ferngesteuerte Raketen zu ersparen.
Und nun komme ich auf den richtigen Krieg zu sprechen. Die islamische Welt befindet sich am Rande einer revolutionären Situation. Dies, und nicht so sehr der Terror, ist das Hauptproblem, dem die Welt heute gegenübersteht. Die Weltwirtschaft hat die Netze sozialer Sicherung in den islamischen Ländern zerrissen. Oft blieb es den politischen Islamisten überlassen, solche Sicherungsnetze zu ersetzen: Auch das entwickelte sich zu einer Propaganda der Tat und überdies zu einer erfolgreichen.
Mir fällt es schwer zu glauben, dass irgendeine Ideologie, irgendeine Botschaft, mit Ausnahme einer harmlosen Variante des Islam, gegen die Mukhabarat-Regime und gegen den gefährlichen Islamismus eines bin Laden ein erfolgreiches Angebot machen kann. Eine Botschaft, die sowohl die Lebensaussichten als auch die Träume der Menschen in diesen Ländern ansprechen wird, kann nicht von außen erzwungen oder manipuliert werden, aber sie kann und sollte von außen unterstützt werden. Das ist die langfristige Perspektive. Kurzfristig stehen wir vor dem Phänomen des Bin-Laden-Terrors ohne territoriale Basis. Das ist der Feind. Und so schwierig es ist – dieser Feind sollte im Kleinen ins Visier genommen werden. Der Name des blutigen Spiels heißt: keine Überreaktion. Ein Vorgehen gegen den Irak ist ein eklatantes Beispiel für die Überreaktion.
Avishai Margalit ist Professor für Philosophie an der Hebrew-Universität Jerusalem. Aus dem Englischen von Karin Wördemann
Respekt ! Deine persönliche Einschätzung weicht zwar im Grundsatz von meiner Sicht der Dinge ab, aber es gibt auch einige Übereinstimmungen:
- Der ganze "american way of life" funktioniert nach innen immer weniger. "Die Wirtschaft" ist hochverschuldet. Kommt in naher Zukunft kein billiges Öl, wird der Dow Jones infolge nicht länger zu verschleiernder sinkender Gewinne in die Knie gehen
so ist es !
Ich habe im Urlaub eine Israelin kennengelernt und mich länger mit Ihr unterhalten: Sie machte Urlaub von der Angst!!!!............. das ist die Katastrophe, Konradi, die uns allen bevorsteht
richtige Feststellung aber falsche Schlußfolgerung:
Die Terroristen heißen nicht Bush und Rumsfeld, sondern Bin Laden und Saddam Hussein ! Wenn wir uns darauf nicht einigen können, dann ist eine weitere Diskussion überflüssig.
Auch von mir ein persönliches statement:
Meine Zweifel am "gerechten Krieg" gegen den Irak sind weitaus größer als im 1. Golfkrieg 1991. Ich lese täglich die unterschiedlichen Meinungen in den den großen Tageszeitungen und ich verfolge intensiv die Diskussionen im Fernsehen. Ich denke, ich mache es mir nicht leicht und ein Urteil fällt mir verdammt schwer, das kannst Du mir ruhig glauben. Ich bin für eine Verlängerung der Frist für die UN-Inspektoren, aber Lichterketten und eine Friedensdemo in Berlin sind genau die Signale, auf die Saddam Hussein händereibend wartet.
Falls die USA ohne UN-Mandat losschlagen ist die von Dir vorgetragene These "30 Tage Krieg – 30 Jahre Terror" vorprogrammiert. Auch in diesem Argument stimmen wir überein und dazu mag der unten angefügte Essay zum Nachdenken anregen.
Aber es gibt auch gute Gründe für einen Krieg. Sie wurden hier in diesem Thread vorgetragen und ich zitiere hier noch einmal auszugsweise Shlomo Avineri (siehe posting # 177)
aber einige Parallelen zum Europa des Jahres 1936 sind keineswegs fehl am Platz: Zu jener Zeit hatte das „Dritte Reich“ noch keinen anderen Staat angegriffen, doch es hatte den Versailler Vertrag über Bord geworfen und damit begonnen, unter Verletzung internationaler Abkommen wieder aufzurüsten, es hatte das Rheinland remilitarisiert, den Völkerbund verlassen sowie zu verstehen gegeben, dass es eine Revision der deutschen Grenzen anstrebt. Die demokratische Verfassung Deutschlands war abgeschafft worden, alle politischen Parteien, mit Ausnahme der NSDAP, verboten. Das Regime hatte auch erste Konzentrationslager eingerichtet – für Mitglieder der Opposition, Juden, „Zigeuner“, Homosexuelle. Es hatte Juden aus dem öffentlichen Leben verbannt, Gesetze verabschiedet, die sie diskriminierten, und viele von ihnen enteignet.
Man stelle sich vor, wie anders die Welt heute aussähe, hätten Großbritannien und Frankreich 1936 Gewalt gegen das „Dritte Reich“ eingesetzt. Österreich, die Tschechoslowakei und Polen wären nicht überfallen worden, Europa hätte keine Nazibesetzung durchleiden müssen, es hätte keinen Holocaust gegeben, und nicht zu vergessen: Zehn Millionen Deutsche wären nicht aus ihrer Heimat im Osten vertrieben worden.
Saddam hat in der Vergangenheit schlimmere Verbrechen begangen als Hitler bis zum Jahre 1936: Im nachhinein mag es unpassend klingen, etwas Derartiges zu sagen. Es ist indes eine Tatsache, dass der irakische Diktator die Kurden im Irak schlechter behandelt hat als Hitler die Juden im Jahr 1936. Er griff zwei Länder an – den Iran und Kuwait – und beschoss zwei andere – Israel und Saudi-Arabien – mit Raketen. Er setzte Giftgas gegen innere und äußere Feinde ein. Sein Regime ist viel repressiver als Nazideutschland anno 1936. Außerdem entwickelt er ABC-Waffen und verstößt seit zehn Jahren gegen das Völkerrecht sowie UN-Resolutionen.
Abschließend ein Essay, der vermutlich keinen Dissens aufwirft.
Gruß Konradi
Der falsche Krieg
Von Avishai Margalit
Es wird einen Krieg gegen den Irak geben. Doch dieser Krieg ist der falsche Krieg. Ich brauche nicht auf den Bericht von Hans Blix zu warten: Ich bin bereits jetzt davon überzeugt, dass der Irak chemische und biologische Waffen versteckt. Ich glaube außerdem, dass der Irak einige dutzend Raketen in Westirak verborgen hält. Obwohl ich diese Überzeugungen hege, bin ich nach wie vor der Ansicht, dass Amerika den falschen Krieg führen wird.
Wenn man amerikanische Regierungsbeamte fragt, wer denn der Feind sei, bekommt man seit dem 11. September drei verschiedene Antworten zu hören: der weltweite Terrorismus, die Massenvernichtungswaffen in den Händen solcher Übeltäter wie Saddam Hussein und der radikale Islam nach Art von bin Laden. Ich glaube, das verworrene Denken der Amerikaner über den Irak-Krieg entsteht aus der Vermengung dieser drei Antworten – als handele es sich um ein und dieselbe Antwort, während es in Wahrheit doch sehr verschiedene Antworten sind, die ganz unvereinbare praktische Schlussfolgerungen mit sich bringen.
Deshalb meine These: Der radikale Islam vom Typus eines bin Laden ist der Feind und sollte auch als Feind betrachtet werden. Allerdings, die Bekämpfung von Saddam wird diesem Feind eine große Hilfe sein, anstatt ihn zurückzuwerfen. Das gilt selbst dann, wenn der Krieg erfolgreich verläuft, erst recht aber dann, wenn er es nicht ist.
Die islamische Welt, die ein Siebtel der Weltbevölkerung ausmacht, steht am Rande einer „revolutionären Situation“, wie man im alten Jargon sagte.
Lenin, der sich mit Revolutionen auskannte, charakterisierte die revolutionäre Situation als einen Zustand, in dem die Massen das Regime nicht mehr ertragen und in dem es für das Regime schwierig wird, die Massen unter Kontrolle zu halten. In fast allen islamischen Ländern sind 50 Prozent der Bevölkerung Jugendliche unter 18 Jahren. Ihre Lebensaussichten sind trostlos, und doch kennen sie das glitzernde Leben, überwiegend aus den westlichen Medien. Dies führt dazu, dass sie die Kluft zwischen ihren realen Aussichten und ihren Träumen noch schwerer verkraften können.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die explosive Kluft zwischen Realität und Traum zu überwinden. Entweder man verbessert die ökonomischen Aussichten und arbeitet für ein besseres Leben – oder man verändert die Erwartungen der Menschen, zum Beispiel ihre Vorstellungen von einem gutem Leben. Säkulare Ideologien richten sich auf reale Lebensaussichten, während sich religiöse Ideologien auf die Träume richten. Und wenn säkulare Ideologien scheitern, so wie sie in den islamischen Ländern elend gescheitert sind, wächst die Anziehungskraft der anderen, von religiösen Ideologien ermutigten Träume um ein Vielfaches. Aus diesem Grund macht der radikale Islam der islamischen Welt ein revolutionäres Angebot, und zwar in zwei Spielarten. Es gibt das „stalinistische“ Angebot der Revolution in einem einzigen Land, so wie sie Chomeini im Iran gelang. Die Idee ist, eine erfolgreiche islamische Revolution vorweisen zu können, die später als Vorbild für Revolutionen in anderen islamischen Ländern dienen wird. Und daneben gibt es ein „trotzkistisches“ Angebot für die islamische Revolution. Sie zielt darauf, die Revolution umgehend in die gesamte islamische Welt zu exportieren.
Von bin Laden kommt das zweite, das „trotzkistisches“ Angebot für eine permanente und universelle islamische Revolution. Die Idee ist, den Terror als Propaganda zu nutzen, spektakuläre Aktionen zu inszenieren wie den Anschlag auf die „babylonischen“ Türme Manhattans, die Wahrzeichen der götzendienerischen amerikanischen Heiligtümer. Das Ziel ist aber keineswegs, Amerika zum Islam zu bekehren. Es geht vielmehr darum, einen revolutionären Kader zu rekrutieren, der die islamische Welt übernehmen wird. Vielleicht beginnt die Eroberung an den heiligen arabischen Stätten und fegt dort den unechten Wahhabismus hinweg, um von da aus einen neuen, vitaleren puritanischen Wahhabismus in der islamischen Welt zu verbreiten.
Bekanntlich setzt Terror als Propaganda der Tat auf die Überreaktion der Opfer. Aus Wut wird der Getroffene in seiner Reaktion auf unschuldige Unbeteiligte einschlagen, die dann radikalisiert werden und leicht rekrutierbar sind. Doch Terrorbekämpfung ist keine Aufgabe für Elefanten im Porzellanladen und ganz gewiss nicht für die Elefanten aus der Partei der Republikaner. Sie ist eine heikle Angelegenheit.
Ungeachtet des Kriegs in Afghanistan ist der Kampf gegen den Terror kein konventioneller Krieg, bei dem man der Luftwaffe feste Ziele vorgeben kann. Der Kampf gegen den Terror ist auch keine Polizeioperation wie bei der Bekämpfung der Mafia. Er liegt irgendwo in der Mitte dazwischen, was eine andere Strategie verlangt. Worauf es ankommt, ist, den „Fehlschluss des Instruments“ zu vermeiden – nämlich nur das Instrument zu benutzen, das man zu gebrauchen versteht, weil es das einzige ist, dessen Gebrauch man erlernt hat.
Ich will der Frage nach dem richtigen Kampf und den richtigen Mitteln nicht ausweichen, möchte aber zunächst darauf eingehen, wie der falsche Krieg vermieden werden kann. Die Regime in der arabischen Welt lassen sich als Mukhabarat-Regime bezeichnen. „Mukhabarat“ ist der arabische Begriff für Geheimdienste, aber auch der Oberbegriff für den gesamten Apparat, der für die innere Sicherheit zuständig ist. Ein Mukhabarat-Regime wird von den Kräften der inneren Sicherheit aufrecht erhalten; ob der Herrscher „König“ oder „Präsident“ (der von 99 Prozent der Bevölkerung gewählt wird) heißt, ist unerheblich.
Das Regime ist so oder so ein Mukhabarat-Regime, dessen Tätigkeit sich im Wesentlichen im eigenen Machterhalt erschöpft. Zweifellos gibt es Unterschiede hinsichtlich der Brutalität. Saddams Regime ist vielleicht das repressivste.
Wie zynisch auch immer Saddam während seines langen Kampfs gegen Chomeini oder während seines jetzigen Kampfs gegen Israel von religiöser Propaganda Gebrauch gemacht hat, sein Regime ist brutal säkular. Seine Mukhabarat-Leute mögen sich wohl mit radikalen Islamisten treffen, aber sie treffen sie hauptsächlich in seinen erbärmlichen Gefängnissen. Zynismus hin oder her, es stellt sich tatsächlich die Frage, ob Saddam nicht doch dazu in der Lage ist, bin Laden mit den chemischen und biologischen Waffen zu beliefern, von denen ich glaube, dass er sie besitzt.
Saddam Hussein ist ein schreckliches Übel, aber verrückt ist er nicht. Mehr als alles andere will er an der Macht bleiben. In Anbetracht der Tatsache, dass er ständig beobachtet wird, müsste er verrückt sein, wenn er sein Schicksal in die Hände eines Abgesandten bin Ladens legen und mit al-Qaida kooperieren würde – nur um sich an den Amerikanern zu rächen. So betrifft die Frage nach den Massenvernichtungswaffen nicht Saddams Moral, sondern dessen Rationalität. Es gibt viele Regime, die bin Laden mit chemischen und biologischen Waffen ausstatten, lange bevor Saddam dies tun würde.
Nun hat Bush unmissverständlich klar gemacht, dass ihm ein Eingeständnis von Saddam nicht genügen wird und dass er – komme, was wolle – den Irak angreifen wird. Hätte Saddam Herrn Blix eine peinlich genaue Liste seiner Waffen übergeben, hätte man es als Zeichen dafür gewertet, dass es nur die Spitze des Eisbergs ist und dass er weit mehr davon versteckt. So oder so kann es Saddam den Amerikanern nicht recht machen – es sei denn, er gibt seine Macht ab. Doch sobald er mit dem Rücken zur Wand steht, könnte er versucht sein, biologische und chemische Waffen hauptsächlich gegen Israel einzusetzen. Das ist gewiss nicht einfach, aber es ist eine echte Möglichkeit. Ich finde es rätselhaft, warum meine Landsleute die Versuchung, diesen Krieg anzufangen, so unwiderstehlich finden.
Für moralische Besserwisser mit einem blutenden Herzen für das irakische Volk hat man derzeit nur wenig Geduld. Aber erinnern wir uns, dass im Golfkrieg, der der Welt wie ein riesiges Videospiel vorkam, ungefähr 150000 Iraker getötet wurden. Man mag nur ermessen, wie viele Zivilisten in dem bevorstehenden Krieg ihr Leben verlieren. Das ist ein weiterer guter Grund, den Irakern die Befreiung durch ferngesteuerte Raketen zu ersparen.
Und nun komme ich auf den richtigen Krieg zu sprechen. Die islamische Welt befindet sich am Rande einer revolutionären Situation. Dies, und nicht so sehr der Terror, ist das Hauptproblem, dem die Welt heute gegenübersteht. Die Weltwirtschaft hat die Netze sozialer Sicherung in den islamischen Ländern zerrissen. Oft blieb es den politischen Islamisten überlassen, solche Sicherungsnetze zu ersetzen: Auch das entwickelte sich zu einer Propaganda der Tat und überdies zu einer erfolgreichen.
Mir fällt es schwer zu glauben, dass irgendeine Ideologie, irgendeine Botschaft, mit Ausnahme einer harmlosen Variante des Islam, gegen die Mukhabarat-Regime und gegen den gefährlichen Islamismus eines bin Laden ein erfolgreiches Angebot machen kann. Eine Botschaft, die sowohl die Lebensaussichten als auch die Träume der Menschen in diesen Ländern ansprechen wird, kann nicht von außen erzwungen oder manipuliert werden, aber sie kann und sollte von außen unterstützt werden. Das ist die langfristige Perspektive. Kurzfristig stehen wir vor dem Phänomen des Bin-Laden-Terrors ohne territoriale Basis. Das ist der Feind. Und so schwierig es ist – dieser Feind sollte im Kleinen ins Visier genommen werden. Der Name des blutigen Spiels heißt: keine Überreaktion. Ein Vorgehen gegen den Irak ist ein eklatantes Beispiel für die Überreaktion.
Avishai Margalit ist Professor für Philosophie an der Hebrew-Universität Jerusalem. Aus dem Englischen von Karin Wördemann
.
Biblischer Reichtum
Von Lutz C. Kleveman
Öl-Milliarden für US-Konzerne oder Gotteswahn - was treibt die Amerikaner in den Irak? Die Wahrheit ist: Die Machtpolitiker in Washington wollen die Vorherrschaft der radikalislamischen Saudis und der Opec brechen.
Hamburg - Das Angenehme an den Amtsträgern, die US-Präsident George W. Bush um sich geschart hat, ist ihre Vorliebe für klare Worte. Larry Lindsey, Ex-Wirtschaftsberater des obersten Amerikaners, drückte das Kriegsziel im vergangenen September so aus: "Wenn es einen Wechsel des Regimes im Irak gibt, kann man das globale Angebot an Rohöl um drei bis fünf Millionen Barrel erhöhen - ein erfolgreicher Krieg wäre also gut für die Wirtschaft."
Blut für Öl - der Fall scheint klar zu liegen, und die Verbindungen der Bush-Minister zu den Ölkonzernen des Landes machen das Argument noch schlagender. Die Kriegsplaner in Washington wollen den schwarzen Stoff, um ihre Wähler zu beglücken und ihre Freunde zu bereichern. So weit die gern bemühte Theorie.
Doch viele der Verfechter einer zu simplen "Blut-für-Öl"-Erklärung bellen bislang an den falschen Bäumen hoch: So nah die Bush-Regierung der amerikanischen Ölindustrie bekanntermaßen steht - sie würde kaum einen derart aufwändigen Krieg führen, nur um einigen befreundeten Ölbaronen zu guten Geschäften zu verhelfen. Wichtiger sind den Entscheidern in Washington - wie auch in Moskau oder Peking - strategische Überlegungen. Die Bush-Regierung will den Irak zu einem Verbündeten in der Region und Öl-Großversorger für die US-Wirtschaft machen - als Alternative zu Saudi-Arabien.
Tatsächlich haben die irakischen Ölfelder biblische Ausmaße. Investitionen von etwa 20 Milliarden Dollar würden genügen, um die Ölproduktion des Landes schon in wenigen Jahren von jetzt zwei Millionen auf bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag zu steigern - etwa ein Zehntel des weltweiten Verbrauchs. Das satte Angebot würde den Ölpreis kräftig drücken, der nunmehr dauerhaft billige Rohstoff würde die lahmenden westlichen Volkswirtschaften wieder anfeuern.
Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit im Januar 2001 entwarf die Bush-Regierung eine neue nationale Energiepolitik für die USA, wo vier Prozent der Erdbevölkerung mehr als ein Viertel der weltweiten Energie verbrauchen. Anlass waren damals massive Engpässe in der Stromversorgung, die über Monate Hunderttausende Bürger Kaliforniens immer wieder ohne Licht und Wärme ließen. Vize-Präsident Richard Cheney, selbst jahrelang mächtiger Chef des Ölzulieferer-Konzerns Halliburton, traf sich daraufhin mehrfach hinter verschlossenen Türen mit amerikanischen Energie-Magnaten. Ihre Namen sowie die Protokolle der Gespräche hält die US-Regierung bis heute geheim, was sonst nur in Fragen der nationalen Sicherheit üblich ist. Offenbar wollen Cheney und Bush verbergen, was sie mit den "Big Oil"-Wirtschaftsbossen vereinbart haben.
Globale Öl-Allianzen
Im Mai 2001 legte Cheney dann einen wegweisenden Kommissions-Bericht vor mit dem Titel: "Wie ist der Erdölbedarf der USA in den nächsten 25 Jahren zu sichern?" Die Autoren des Berichts empfahlen, dass "der Präsident Energiesicherheit zu einer Priorität in unserer Handels- und Außenpolitik" mache.
Um Ölquellen für den verschwenderischen American way of life zu sichern, plädiert der Cheney-Report für ein globales Engagement der USA an wichtigen Rohstoff-Lagerstätten wie dem Kaspischen Meer, Russland und Westafrika. Das Hauptaugenmerk aber fällt auf die Golfregion: "Die Ölproduzenten des Mittleren Ostens bleiben entscheidend für die Ölversorgung der Welt."
Schon heute müssen die USA etwa die Hälfte ihres Brennstoffbedarfs importieren. Da die eigene Rohölproduktion deutlich sinkt, werden die Einfuhren in zwei Jahrzehnten zwei Drittel betragen. Der Mittlere Osten ist dafür nach Kanada und Mexiko die derzeit drittgrößte Bezugsquelle der Amerikaner.
Die politischen Folgen sind brisant:
Seit der Ölkrise von 1973 benutzt das arabisch dominierte Opec-Kartell das Öl als Faustpfand und Druckmittel gegenüber dem Westen. Um ihre Abhängigkeit von den Scheichs zu mindern, verfolgen die USA seit Jahren das Ziel, ihre Ölversorgung zu "diversifizieren".
Dabei geht es darum, außerhalb der Opec liegende Ölressourcen wie die des Kaspischen Meers zu erschließen und zu kontrollieren.
Das Problem ist, dass viele Vorräte wie die der Nordsee inzwischen zur Neige gehen. Gleichzeitig lassen die Boomländer China und Indien den Weltölverbrauch nach Schätzungen der International Energy Agency von jetzt 73 Millionen Barrel pro Tag auf 90 Millionen im Jahr 2020 ansteigen. So baut die Opec ihre Marktführerschaft zwangsläufig weiter aus - und damit ihre politische Macht.
Besonders der Einfluss Saudi-Arabiens wird wachsen, denn das Land ist bislang als einziges in der Lage, als ein so genannter "Swing supplier" zu handeln und so den Ölpreis zu diktieren. Um weltweit Produktionsausfälle wie etwa wegen der derzeitigen politischen Krise in Venezuela auszugleichen, können die Saudis binnen dreier Monate ihre Fördermenge von acht auf 10,5 Millionen Barrel pro Tag hochfahren - oder es aber sein lassen und den Preis hochtreiben.
Vielen in Washington behagt die saudische Macht nicht. Spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als fast alle der Todespiloten Saudis waren, erweist sich der Wüstenstaat zunehmend als peinlicher, vielleicht gar gefährlicher Verbündeter. Das Risiko wächst, dass radikalislamische Gruppen das korrupte Saud-Königshaus stürzen und dann den Ölhahn für "Ungläubige" im Westen zudrehen.
Aber auch ohne eine anti-westliche Revolution wie im Iran 1979 - als über Nacht 5,6 Millionen Barrel ausfielen - ist das saudische Petroleum schon heute sozusagen ideologisch vergiftet:
In einer Art Ablasshandel finanziert das Regime in Riad nämlich die radikalsunnitische Sekte der Wahhabiten, die etwa die afghanischen Taliban unterstützt haben weltweit zu Terror gegen die USA aufrufen.
Sie sind eine Gefahr besonders für die Tausenden amerikanischen Soldaten, die seit dem ersten US-Feldzug gegen Hussein vor zwölf Jahren dauerhaft nahe den saudischen Ölquellen stationiert sind. Die militärische Präsenz auf dem für Muslime heiligen Boden, die die US-Steuerzahler jährlich etwa 50 Milliarden Dollar kostet, motiviert die Qaida von Terrorchef Osama Bin Laden maßgeblich zum fanatischen Kampf gegen die USA.
Solange die USA noch saudisches Öl und Unterstützung für den Irak-Feldzug brauchen, beteuert man in Washington offiziell sein Interesse an guten Beziehungen zum Königreich. Allerdings wächst die Zahl einflussreicher Politiker, die laut darüber nachdenken, den Kampf gegen den Terror gegen Riad auszuweiten und saudische Ölfelder zu besetzen.
Macht der Opec brechen
Mittelfristig sucht die US-Regierung einen neuen Verbündeten und Haupt-Öllieferanten im Mittleren Osten, und da kommt der Irak ins Spiel. Sein Anteil von zwölf Prozent an den Weltölreserven macht das Land zur einzigen Alternative als "Swing supplier". Eine von amerikanischen Streitkräften installierte Regierung in Bagdad müsste ohnehin versuchen, das abgewirtschaftete und womöglich von einem Krieg zerstörte Land mit Hilfe maximaler Petro-Einkünfte wieder aufzubauen. Auch die militärische Statthalterverwaltung durch US-Generäle, die das Pentagon für die Zeit nach einem Krieg vorsieht, will sich Washington nach Aussage von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld mit irakischem Öl bezahlen lassen.
Nicht unwahrscheinlich ist, dass der Irak unter einer neuen pro-amerikanischen Regierung gar aus der Opec austritt, um ausländische Investoren von ärgerlichen Förderlimits zu befreien. Der Block der Nicht-Mitglieder - zu dem auch Russland und die kaspischen Anrainerstaaten gehören - würde ausreichend Rohöl produzieren, so dass die Opec ihre Hochpreis-Absprachen nicht mehr durchsetzen könnte. Die Macht des Kartells und damit Saudi-Arabiens würde gebrochen, und das Öl könnte ungebremst und billig wie nie zuvor in den Westen fließen.
Ein von US-Militärs eingesetztes neues Regime in Bagdad würde Bohrrechte zweifelsohne bevorzugt an US-Firmen vergeben. Achmed Chalabi, der Führer der dubiosen irakischen Exil-Opposition, hat sich bereits mehrfach mit Managern von ExxonMobil and ChevronTexaco getroffen: "Amerikanische Unternehmen werden einen fetten Anteil am irakischen Öl bekommen", verhieß Chalabi danach. Allerdings ist es eher wahrscheinlich, dass die Ölfelder von internationalen Konsortien mehrerer Konzerne ausgebeutet werden. Diese Praxis, bei der Firmen ihre Investitionen streuen und so Risiken minimieren, setzt sich in der Branche weltweit zunehmend durch.
Auch ist es keineswegs sicher, dass eine auf Rückhalt im eigenen Volk bedachte Nachkriegsregierung in Bagdad die seit langem verstaatlichte Ölindustrie privatisieren würde. Aus ihrer Sicht könnte es sinnvoller erscheinen, die Ölerträge nicht mit Investoren teilen zu müssen, sondern schlicht westliche Technologie einzukaufen und selbst einzusetzen. So spielt der Wettstreit zwischen den Ölkonzernen der USA und ihren Widersachern in der Irak-Krise nur eine eher unbedeutende Rolle. Wichtiger ist den Polit-Strategen im großen Spiel um Öl und die Macht im Orient, dass das "schwarze Gold" ungehindert fließt.
Amnesty International zum Irak
"Bagdad braucht Menschenrechts-Inspektoren"
Die Irak-Expertin von Amnesty International, Ruth Jüttner, berichtet im SPIEGEL-ONLINE-Interview über die anhaltenden Menschenrechtsverstöße unter Saddam Hussein. Sie wünscht die Entsendung von Uno-Menschenrechtsbeobachtern. Einen Krieg als Mittel zur Beendigung der Verstöße hält sie für verfehlt.
SPIEGEL ONLINE: Als Irak-Expertin bei Amnesty International kümmern sie sich um die Menschenrechtsverletzungen unter dem Regime Saddam Husseins. Welche Verstöße stellen Sie fest?
Jüttner: Nach wie vor gibt es dort schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, darunter massive Verfolgungen von mutmaßlichen Oppositionellen, Hinrichtungswellen, sehr extensive Vollstreckung der Todesstrafe, auch die Verfolgung von ganzen Bevölkerungsgruppen.
SPIEGEL ONLINE: Wer ist besonders betroffen?
Jüttner: Ganze Bevölkerungsgruppen stehen unter einem besonderen Verdacht, oppositionell tätig zu sein. Dazu zählen die im Süden Iraks lebenden Schiiten, die die Bevölkerungsmehrheit stellen und denen unterstellt wird, dass sie mit dem Erzfeind des Irak, Iran, zusammenarbeiten. Gerade Menschen schiitischer Religionszugehörigkeit werden häufig Opfer von Verfolgung oder Festnahmen nur auf vagen Verdacht hin. Ihre Verfolgung folgt dann oft einem bestimmten Muster. Aber auch die kurdische Bevölkerung im Norden wird verfolgt.
SPIEGEL ONLINE: Wie äußert sich eine solche Verfolgung konkret?
Jüttner: Es wird Druck auf Familienangehörige ausgeübt, wenn der Verdacht besteht, dass ein Verwandter mit der Opposition zusammenarbeitet, untergetaucht ist oder im Exil lebt. Ziel ist es, ihn durch Einschüchterung zum Schweigen zu bringen, was auf viele Exil-Iraker bis heute nachdrücklich wirkt. Es gibt auch immer häufiger Berichte, dass Familienangehörige festgenommen werden und später im irakischen Fernsehen auftreten. Dort sagen sie sich von ihren Angehörigen los und machen deutlich, dass die irakische Regierung keine Kritik, auch nicht vom Ausland aus, duldet.
SPIEGEL ONLINE: In welchem Umfang wird die Todesstrafe verhängt?
Jüttner: Das ist schwer zu recherchieren, weil es keine offiziellen Angaben dazu gibt. Bekannt wurden Hinrichtungswellen wie 1997 und 1998, als die Gefängnisse sehr überfüllt gewesen sein sollen. Es sollen Hunderte Gefangene in den Gefängnissen gezielt umgebracht worden sein. Viele der Leichen sollen in Massengräbern in der Nähe der Gefängnisse vergraben worden sein. Bis heute halten auch Berichte an, dass Angehörige der Armee hingerichtet werden, wenn sie in den Verdacht oppositioneller Arbeit geraten. Aber die genauen Zahlen lassen sich nicht ermitteln, weil teilweise die Angehörigen gar nicht wissen, wo ihre Angehörigen eigentlich sind. Nur in Einzelfällen werden sie über Hinrichtungen informiert.
SPIEGEL ONLINE: Hatte der Irak nicht zwischenzeitlich andere Zeichen gesetzt? Im Oktober 2002 wurde eine große Amnestie versprochen.
Jüttner: Diese Amnestie hat sehr viele Fragen offen gelassen. Von der Regierung wurde zu keinem Zeitpunkt genau veröffentlicht, wer von dieser Amnestie profitiert hat oder profitieren sollte. Betroffen sollen angeblich zwischen 50.000 bis 100.000 Gefangenen gewesen sein. Wie hoch der Anteil politischer Gefangener daran ist, wurde aber nicht bekannt. Wir haben wiederholt gefordert, die Namen offen zu legen und vor allem das Schicksal derjenigen aufzuklären, die weiterhin verschwunden sind.
SPIEGEL ONLINE: Kann Amnesty International in den Irak reisen, um sich zu informieren?
Jüttner: Amnesty hat, wie auch andere Menschenrechtsorganisationen, seit Jahren keinen Zugang zum Irak. Wir haben die irakische Regierung wiederholt aufgefordert, uns Ermittlungen im Irak zu gewähren, vergeblich. So ist die Recherche im Irak extrem schwierigen Bedingungen unterworfen, die Bewegungsfreiheit für Besucher aus dem Westen ist in der Regel stark eingeschränkt und Journalisten haben stets einen staatlichen Aufpasser dabei. Amnesty würde nur dann dorthin reisen, wenn wir die Möglichkeit hätten, unbeobachtet zu bleiben und vertraulich mit Informanten reden zu können. Solange dies nicht möglich ist, machen solche Reisen gar keinen Sinn.
SPIEGEL ONLINE: Wie informieren Sie sich dann?
Jüttner: Aufgrund der geschilderten Probleme ist es nicht leicht, mehrere Quellen zu finden, um einen Bericht zu verifizieren. Wir werten für unsere Arbeit alle zugänglichen Quellen aus, zu denen Exilanten, Journalisten, Flüchtlinge, Reisende oder Iraker zählen, die sich in den Nachbarländern aufhalten. Wir wägen dann ab und veröffentlichen nur die Fälle, über die wir uns sicher sein können, weil sie mit vorliegenden Erkenntnissen übereinstimmen.
SPIEGEL ONLINE: Wie zuverlässig sind solche Angaben?
Jüttner: Leider hat es in der Vergangenheit auch Fälle gegeben, wo auch wir Propaganda aufgesessen sind. So wurden zu Beginn des ersten Golfkriegs grobe Menschenrechtsverletzungen von der kuweitischen Regierung zu Propagandazwecken erfunden, um die Öffentlichkeit gegen den Irak zu mobilisieren. Damals wurden irakische Soldaten beschuldigt, Säuglinge aus den Brutkästen in Krankenhäusern herausgerissen zu haben.
SPIEGEL ONLINE: Fürchten Sie auch jetzt solchen Missbrauch durch Propaganda? Derzeit gibt es britische und amerikanische Berichte über professionelle Vergewaltiger im Dienste Saddams.
Jüttner: Diese Berichte ziehe ich in Zweifel. Das ist etwas, was wir in dieser Form zuvor noch nie im Zusammenhang mit dem Irak gehört haben. Uns ist zwar bekannt, dass in irakischen Gefängnissen Personen Opfer von Vergewaltigungen werden, als Mittel der Folter oder um Gefangene unter Druck zu setzen, in dem ihre weiblichen Angehörigen vergewaltigt werden. Aber in dem Sinne, dass Einzelpersonen im Auftrag der Regierung Vergewaltigungen durchführen würden, ist uns so nicht bekannt.
SPIEGEL ONLINE: Befürworten die Exiliraker, die sie kennen, ein hartes Durchgreifen mittels Krieg?
Jüttner: Es mag Sie überraschen. Aber die Mehrzahl unserer irakischen Gesprächspartner legt keinen Wert auf einen Krieg, weil sie fürchten, dass die irakische Zivilbevölkerung wieder einmal in erster Linie das Opfer sein wird. Die Sorge vor den humanitären Folgen eines Krieges und die Zweifel an den Beweggründen überwiegen.
SPIEGEL ONLINE: Am Samstag wollen Zehntausende Menschen in Berlin gegen einen Krieg im Irak demonstrieren. Geht die Friedensbewegung - angesichts der andauernden Menschenrechtsverletzungen im Irak - Diktator Saddam Hussein auf den Leim?
Ruth Jüttner: Tatsächlich sollte die Friedensbewegung die Menschenrechtsverletzungen im Irak und das Leiden der irakischen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten nicht aus dem Blick verlieren. Das Ziel sollte Frieden UND die Verwirklichung der Menschenrechte im Irak sein.
SPIEGEL ONLINE: Ist - um der Menschenrechte Willen - also doch ein militärisches Eingreifen notwendig?
Jüttner: Wir weisen den Versuch, ein militärisches Vorgehen mit der schlechten Menschenrechtslage zu begründen, entschieden zurück. Das ist ein selektiver Missbrauch der Menschenrechte, deren Lage auch in den letzten Jahren schon sehr schlecht war. Aber das hat die Akteure oder Staaten, die jetzt besonders für einen Krieg aussprechen, wenig interessiert. Der Hinweis auf die Menschenrechtslage ist nur ein Vorwand, um ganz andere Interessen zu verfolgen. Der Einsatz für die Menschenrechte muss kontinuierlich erfolgen und nicht nur dann, wenn man ein militärisches Eingreifen begründen will. Schließlich verschwinden schon seit 15 bis 20 Jahren Menschen im Irak, ohne dass sich die USA oder Großbritannien darum besonders gekümmert haben.
SPIEGEL ONLINE: Was wissen Sie über die Verschollenen?
Jüttner: Genaue Zahlen gibt es nicht, aber man kann von mehreren Hunderttausenden Verschwundener ausgehen. Das begann im Verlauf des Krieges gegen den Iran in den achtziger Jahren, dann sehr stark nach der Invasion in Kuweit. Noch heute gelten allein 800 kuweitische Bürger als vermisst. Und neue Fälle gibt es bis heute. Der jüngste Fall ist der eines jungen Mannes, der sich am 25. Januar in einen Wagen der Uno-Waffeninspektoren flüchtete und dann von den Sicherheitskräften aus dem Auto entfernt worden ist. Es existieren bis heute keine Informationen über sein Schicksal. Deshalb fordert Amnesty seit Jahren, dass internationale Menschenrechtsbeobachter in den Irak entsendet werden.
SPIEGEL ONLINE: Sollten dies Uno-Menschenrechtsinspektoren sein?
Jüttner: Es wäre es gut, wenn sie von der Uno geschickt würden, weil das ihre Legitimation verbreitern würde. Wichtig ist, dass sie über eine entsprechende Ausbildung, Erfahrung und ein umfangreiches Mandat verfügen und dass sie unabhängig und fern jeder Beeinflussung Berichten über Menschenrechtsverletzungen nachgehen können. Schließlich müssen sie eigene Beweise und Zeugenaussagen sammeln können, um beispielsweise das Verschwinden von Menschen aufzuklären.
Das Gespräch führte Holger Kulick
SPIEGEL ONLINE - 14. Februar 2003
Stunde der Dilettanten
Drei Vorkriegs-Opfer: Europa, die Nato und eine alte Freundschaft
Von Josef Joffe
Stellen wir uns ein deutsches Geschichtsbuch in zehn, zwanzig Jahren vor. Hoffentlich steht dann nicht am Ende des Kapitels „Gerhard Schröder“ diese Passage: „Und dann entschied sich der Kanzler, alles auf eine Karte zu setzen, um in der Machtprobe mit Amerika zu obsiegen. Seine Gründe mögen nobel oder eigensüchtig, richtig oder kurzsichtig gewesen sein. Die Folge war der Kollaps zweier Pfeiler deutscher Außenpolitik, die fünfzig Jahre lang gehalten hatten: die deutsch-amerikanische Freundschaft und das atlantische Bündnis. Schröders Kanzlerschaft hat dieses waghalsige Spiel nicht überlebt.“
Was im Sommer als profitabler Wahlkampf-Einsatz begann, hat sich zur schlimmsten Krise deutscher Außenpolitik seit 1949 gesteigert. Der Irak-Krieg hat noch nicht begonnen, und schon liegen drei blutende Opfer auf der Walstatt. Und selbst die zungenflinksten Apologeten können nicht glaubhaft behaupten, Schröders Politik trage an deren Schicksal keinen Anteil.
Europa contra Europa
Opfer Nummer eins ist Europas gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Schröder und Chirac hatten in Versailles, zum 40. Jubiläum des Freundschaftspaktes, geglaubt, ihre ermüdete „Achse“ aufpolieren zu können. Rasch aber zeigte sich, dass sie ihre Rechnung ohne die anderen 18 Wirte in Europa gemacht hatten. Zuerst murrten die „Euro-8“, unter denen sich auch London, Rom und Madrid befanden. Dann kamen die „Vilnius-10“, von A wie Albanien bis S wie Slowakei. Im Klartext lautete die Botschaft der 18: „Wir verwahren uns gegen den Führungsanspruch von Berlin und Paris; vor die Wahl gestellt, stehen wir an der Seite Amerikas.“
Kein Wunder. Je näher ein Land geografisch bei Russland liegt, desto dichter will es politisch an Amerika heranrücken – nach dem kühlen Kalkül, dass seine Sicherheit dort besser aufgehoben ist als unter der Fuchtel von Paris und Berlin. Oder: Wenn schon abhängig, dann lieber von der entfernten Supermacht als von zwei vormachtheischenden Nachbarn. Auch für Madrid, Rom, London et al. gilt: Amerika, das ist ein hübsches Zusatzgewicht im neuen Spiel um Europa.
Es wird also etwas dauern, bis Europa wieder „mit einer Stimme“ spricht. Dieses Risiko hätten die beiden Dirigenten im Elysée und Kanzleramt bedenken sollen: Wer unilateralistisch (genauer: bilateralistisch) handelt, schafft Gegenwehr, nicht Gefolgschaft. Überdies verstärkt es nicht die Glaubwürdigkeit, wenn man selbst die Sünden begeht, die zu Recht den Bushisten anzukreiden sind. Doch ist das nicht der schlimmste Kunstfehler. Gefährlicher ist der zweite Schlag – gegen die Nato –, den das Duo mit der Pralinen-Supermacht Belgien geführt hat.
Diese Geschichte ist so trivial, wie ihr Ausgang für das Bündnis letal sein kann. Das Trio wollte ja nichts „präjudizieren“ und legte deshalb mit unschuldigem Augenaufschlag sein Veto gegen die bloße Nato-Planung für den Schutz der Türkei ein. Es wäre eine kleine, aber feine Geste gegenüber dem meistexponierten Nato-Mitglied gewesen – und noch kein Ja zu den amerikanischen Kriegsplänen. Doch scheinen Chirac und Schröder so besessen davon zu sein, die Amerikaner auch im Kleinsten zu konterkarieren, dass sie gleich zweierlei vergessen haben.
Erstens: Dieses Bündnis funktioniert nur so lange, wie das Prinzip „Einer für alle, alle für einen“ gilt – jedenfalls, wenn es um Abschreckung und Verteidigung geht. Patriots sind keine Angriffswaffen. Westdeutschland hat hinter dem Nato-Schild vierzig Jahre lang prächtig floriert. Mag sein, dass diese Wohltat aufgebraucht und Dank nicht der Kern aller Staatsräson ist. Bloß: Wer dieses Bündnis auf den Müllhaufen der Geschichte kippen will, muss es aus triftigem Grund (und mit gewichtigen Neu-Verbündeten) tun – nicht, um auf den unilateralistischen Schelmen anderthalb zu setzen.
Zweitens: Von welchem Meister der Staatskunst hat sich Schröder wohl die dialektische Volte abgeguckt, die ihn selbst ad absurdum führt? Denn nichts anderes bedeutet der Versuch, einen nervenstarken Gewaltherrscher durch den kategorischen Verzicht auf die Ultima Ratio zu entwaffnen. Das kann er nicht von Bismarck, nicht von Churchill gelernt haben. Es wäre nützlicher gewesen, in der ägyptischen Wochenschrift Al Usbou zu blättern. Dort räsonnierte Saddam Hussein im November: „Die Zeit ist auf unserer Seite. Wir müssen bloß Zeit gewinnen, und die anglo-amerikanische Koalition wird zerbrechen.“ Dieses Spiel sollten dem Despoten just jene verwehren, die den Krieg verhindern wollen.
Versuchsballon „Blauhelme“
Richtig hanebüchen aber wird’s, wenn im Spiegel Versuchsballons losgelassen werden, wonach „friedlich“ einmarschierende Blauhelm-Soldaten den Irak entwaffnen mögen. Eine „friedliche Invasion“ gilt Logikern als Oxymoron – als Widerspruch in sich selbst. Oder glauben die Ballonisten, dass Saddam, ein fröhliches „Salam“ auf den Lippen, seinen Besitz freiwillig zum „UN-Protektorat“ macht? Dass er den Europäern vor die Füße legt, was er listenreich zu retten sucht: seine Schreckensherrschaft? Ein Befehlshaber, der seine Truppen auf derlei Selbstmordkommando schickt, gehörte vor ein Kriegsgericht. Ach so, die Amerikaner mögen doch bitte in Stellung bleiben, um den Einmarsch der UN-Europäer „zu erzwingen und abzusichern“. Die regierungsamtlichen Autoren müssen zu viele Wildwest-B-Movies gesehen haben: Die Europäer, mit Frankreich an der Spitze, haben das Sagen, die US-Kavallerie haut sie heraus.
Der „Plan“, der fleißig von einem alten Gedankenspiel des Carnegie Endowment in Washington abkupfert, wurde natürlich sofort dementiert, aber er lässt ahnen, wie verzweifelt die Lage im Kanzleramt sein muss. Denn nicht nur Joschka Fischer wird es inzwischen schwanen, dass neben Europa und Nato ein drittes Opfer zurückbleiben könnte: die deutsch-amerikanische special relationship, die historisch segensreich zu nennen eine Untertreibung wäre.
Es geht hier nicht um die alte Litanei, die von Marshall-Plan und Berlin-Blockade zu Westintegration und Wiedervereinigung reicht. Das war im Kalten Krieg, und „Dankbarkeit“ definiert das nationale Interesse hauptsächlich in Sonntagsreden. Bemühen wir lieber die Staatsräson: Liegt es im deutschen Interesse, sich mit Amerika anzulegen? Wenn nämlich alles addiert worden ist – Wahlkampf und Parteiwohl, die Provokationen eines Rumsfeld ebenso wie die Ausfälle deutscher Politiker, schließlich das nüchterne Faktum, dass Washington mit einem wohlwollenden „Ohne uns“ plus Luftraum- und Basennutzung zufrieden gewesen wäre – was bleibt dann als halbwegs rationales Motiv Schröderscher Politik übrig?
Von der Torheit zur Tragödie
Wahrscheinlich nur die Hypothese, dass Schröder und (mit einigem Abstand) Chirac die Entfaltung amerikanischer Macht oder gar deren Triumph in Nahost als größeres Übel betrachten als die Massenvernichtungswaffen des Saddam Hussein. Das läge in der klassischen Logik von Gleichgewichtspolitik. Da Gulliver nun seine Fesseln verloren hat, muss Europa die einstige Aufgabe der Sowjetunion übernehmen: die Einhegung und Eindämmung amerikanischer Übermacht. Also: Balance of Power contra USA.
Derlei war jahrhundertelang die Räson aller Staatskunst. Warum nicht wieder – in einer Art Umkehrung der Allianzen? Vielleicht gelingt das auch, vielleicht entsteht tatsächlich ein diplomatisches Bündnis zwischen Paris/Berlin, Moskau und Peking, das in diesen Tagen hektisch geprobt wird. Vielleicht gelingt es auch so, den amerikanischen Vormarsch zu stoppen. Bloß ist das deutsche Risiko ein sehr hohes.
Das wäre das Ende der Nato, das Ende einer einst „wunderbaren Freundschaft“. Und der Beginn einer alt-neuen Gleichgewichtspolitik, die aber die „Euro-18“ und die Amerikaner auf der europäischen Bühne mindestens so gut spielen können wie die Großstrategen im Kanzleramt. Zudem haben die Deutschen nie eine glückliche Hand bei Machtproben mit Amerika bewiesen. Umgekehrt, wie nach 1945, war’s gewinnträchtiger. Schließlich: Moskau, Peking, auch Paris werden zum Schluss sehr sorgfältig abwägen, ob sie ihr Verhältnis zu Washington für Saddam Hussein riskieren wollen.
In diesen Tagen muss man für kleine Dinge dankbar sein. Zum Beispiel für jedes Türchen, das sich der Kanzler offen ließe, damit Torheiten nicht zur außenpolitischen Tragödie werden.
"Es gibt notwendige Kriege"
Paul Spiegel, Zentralratsvorsitzender der Juden, sieht die Öffentlichkeit in einem "Dornröschenschlaf" (Interview)
DIE WELT: Sie haben zur Irak-Debatte erklärt, nicht Demonstranten, sondern die Rote Armee habe Auschwitz befreit. Wollten Sie damit die aktuelle Lage mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg vergleichen?
Paul Spiegel: Wir haben heute zwar eine andere Situation, aber sie ist vergleichbar. Wieder geht es um einen Diktator, der sein eigenes Volk opfert und ins Verderben führt. Es gibt eigentlich keine gerechten, aber notwendige Kriege. In welcher Situation wären wir heute speziell in Deutschland, wenn damals die Alliierten nicht gegen Hitler Krieg geführt hätten? Wenn damals die Alliierten wie heute beispielsweise Franzosen und Deutsche gesagt hätten: Nein, wir wollen keinen Krieg, wir sind generell gegen Kriege – dann wäre das eine Katastrophe für Deutschland und Europa gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, die Konzentrationslager sind nicht von Demonstranten, sondern von amerikanischen und russischen Soldaten befreit worden.
DIE WELT: Warum hat dann gerade die deutsche Bevölkerung so wenig Verständnis für die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Irak?
Spiegel: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Auch heute erwartet die ganze Welt, dass sich Deutschland im Nahen Osten engagiert. Wer dagegen ist, ist der Großteil der deutschen Bevölkerung. Ich habe auch Verständnis, dass die Deutschen sagen, genug, wir wollen nicht mehr. Dabei ist Deutschland schon auf dem Balkan militärisch engagiert. Natürlich ist es viel einfacher, gegen einen Krieg zu sein, als zu begründen, warum man für einen Krieg ist. Ich frage mich aber auch, wenn ich jetzt wieder die vielen Demonstrationen sehe, wo sind diese Friedensdemonstranten in den letzten zehn Jahren gewesen, als Saddam Hussein seine Mitbürger umgebracht und immer wieder mit Krieg gedroht hat. Ich kenne keine einzige Demonstration in Deutschland gegen Saddam Hussein. Kaum jemand spricht auch davon, dass die Amerikaner und Engländer das irakische Volk von diesem Diktator befreien wollen.
DIE WELT: Befürworten Sie auch einen Präventivkrieg?
Spiegel: Selbstverständlich bin ich gegen Krieg. Was Kriege bedeuten, haben ich und meine Familie nun wirklich zu spüren bekommen. Und auch meine Verwandten und Freunde in Israel haben unter Kriegen gelitten. Doch klar ist, dass Saddam Hussein sowohl für sein Volk wie auch für die gesamte Region eine große Gefahr darstellt. Die Frage heißt also, können und wollen wir mit dieser Gefahr leben oder nicht? Wenn wir das nicht wollen, ist ein Angriff auf ihn möglicherweise ein Verteidigungskrieg. Wenn wir uns vorstellen, dass Saddam Hussein in der Lage wäre, chemische oder atomare Waffen über große Entfernungen zu befördern, was tun wir dagegen – wenn wir überhaupt noch dazu in der Lage sind? Deswegen ist die Frage nicht so einfach aus abstrakt moralisch-ethischen Gründen zu beantworten. Klar ist auch, dass wir nicht immer Amerika als Weltpolizisten allein lassen und uns bequem zurücklehnen können.
DIE WELT: Auf Transparenten in Deutschland wird nicht Saddam Hussein, sondern George W. Bush als Kriegstreiber attackiert.
Spiegel: Ich kann das nicht nachvollziehen und verurteile das entschieden. Man kann nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, denen Deutschland wirklich die Freiheit zu verdanken hat, heute hier als Verbrecher darstellen.
DIE WELT: Sie äußern damit eine deutlich andere Haltung als die beiden christlichen Kirchen in Deutschland.
Spiegel: Ich spreche als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland für die Gemeinschaft der Opfer. Die Juden in der ganzen Welt haben auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Israel. Denn dieses kleine Land und seine Menschen sind direkt bedroht durch Saddam und seine fürchterlichen Waffen. Deswegen haben wir gerade wegen dieser akuten Bedrohung ein ganz anderes Verhältnis zum möglichen Krieg als die beiden christlichen Kirchen. Ich habe große Angst davor, Saddam Hussein weiter sein gefährliches Spiel treiben zu lassen. Und ich hoffe nicht, dass Deutschland eines Tages aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und es dann vielleicht zu spät ist.
DIE WELT: Wie geht es nach dem Staatsvertrag mit dem Zentralrat und der Bundesrepublik Deutschland weiter?
Spiegel: Der Staatsvertrag ist ein wirkliches historisches Ereignis, das es bisher in der Geschichte Deutschlands noch nicht gegeben hat. Damit kommen wir wirklich auf den allerdings noch weiten Weg zur Normalität. Das ist wichtiger als die finanzielle Ausstattung, über die abenteuerliche Geldsummen durch die Welt schwirren. Tatsächlich handelt es sich nur um drei Millionen Euro. Damit sind wir endlich in der Lage, die Arbeit zu leisten, die man von uns erwartet. Denn wir können zur Betreuung der 83 jüdischen Gemeinden – und zur Wahrnehmung unserer politischen und kulturellen Interessen – in Deutschland mehr Personal einstellen. Auch damit sind wir auf dem Weg zum unbefangeneren Miteinander. Die volle Normalität im Umgang mit Juden und Nichtjuden wird aber weder mir noch meinem Nachfolger gelingen. Das, was vor knapp 58 Jahren in Deutschland zu Ende gegangen ist, wird uns noch lange gefangen halten. 58 Jahre sind im Leben eines Menschen sehr, sehr viel. Aber in historischen Dimensionen ist es nur ein Wimpernschlag. Dass aber in den letzten Jahren 70 000 Juden nach Deutschland gekommen sind und sich für Deutschland entschieden haben, ist ein großer Vertrauensbeweis in die Menschen dieses Landes.
DIE WELT: Sind Sie für die Aufnahme eines Gottesbezuges in die Präambel einer EU-Verfassung?
Spiegel: Ja. Da wir alle an einen und denselben Gott glauben, alle drei großen Religionen in Europa, sehe ich keinen Grund, warum das nicht so sein soll. Wenn die Präambel auf die verschiedenen monotheistischen Religionen ausgerichtet ist, sehe ich da kein Problem.
DIE WELT: Erwarten Sie irgendwann ein Ende des Antisemitismus?
Spiegel: Es ist eine Hoffnung. Der Antisemitismus kann endgültig überwunden werden, wenn endlich alle Menschen in Deutschland begreifen würden, dass Antisemitismus nicht nur ein Angriff auf Minderheiten wie etwa Juden ist, sondern ein Angriff auf die Gesamtgesellschaft. Antisemitismus ist in Wirklichkeit Menschenfeindlichkeit. Wenn alle das endlich einsehen, dann ist in Deutschland kein Platz mehr für Antisemitismus.
Das Gespräch führten Helmut Breuer und Gernot Facius
Artikel erschienen am 13. Feb 2003
Biblischer Reichtum
Von Lutz C. Kleveman
Öl-Milliarden für US-Konzerne oder Gotteswahn - was treibt die Amerikaner in den Irak? Die Wahrheit ist: Die Machtpolitiker in Washington wollen die Vorherrschaft der radikalislamischen Saudis und der Opec brechen.
Hamburg - Das Angenehme an den Amtsträgern, die US-Präsident George W. Bush um sich geschart hat, ist ihre Vorliebe für klare Worte. Larry Lindsey, Ex-Wirtschaftsberater des obersten Amerikaners, drückte das Kriegsziel im vergangenen September so aus: "Wenn es einen Wechsel des Regimes im Irak gibt, kann man das globale Angebot an Rohöl um drei bis fünf Millionen Barrel erhöhen - ein erfolgreicher Krieg wäre also gut für die Wirtschaft."
Blut für Öl - der Fall scheint klar zu liegen, und die Verbindungen der Bush-Minister zu den Ölkonzernen des Landes machen das Argument noch schlagender. Die Kriegsplaner in Washington wollen den schwarzen Stoff, um ihre Wähler zu beglücken und ihre Freunde zu bereichern. So weit die gern bemühte Theorie.
Doch viele der Verfechter einer zu simplen "Blut-für-Öl"-Erklärung bellen bislang an den falschen Bäumen hoch: So nah die Bush-Regierung der amerikanischen Ölindustrie bekanntermaßen steht - sie würde kaum einen derart aufwändigen Krieg führen, nur um einigen befreundeten Ölbaronen zu guten Geschäften zu verhelfen. Wichtiger sind den Entscheidern in Washington - wie auch in Moskau oder Peking - strategische Überlegungen. Die Bush-Regierung will den Irak zu einem Verbündeten in der Region und Öl-Großversorger für die US-Wirtschaft machen - als Alternative zu Saudi-Arabien.
Tatsächlich haben die irakischen Ölfelder biblische Ausmaße. Investitionen von etwa 20 Milliarden Dollar würden genügen, um die Ölproduktion des Landes schon in wenigen Jahren von jetzt zwei Millionen auf bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag zu steigern - etwa ein Zehntel des weltweiten Verbrauchs. Das satte Angebot würde den Ölpreis kräftig drücken, der nunmehr dauerhaft billige Rohstoff würde die lahmenden westlichen Volkswirtschaften wieder anfeuern.
Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit im Januar 2001 entwarf die Bush-Regierung eine neue nationale Energiepolitik für die USA, wo vier Prozent der Erdbevölkerung mehr als ein Viertel der weltweiten Energie verbrauchen. Anlass waren damals massive Engpässe in der Stromversorgung, die über Monate Hunderttausende Bürger Kaliforniens immer wieder ohne Licht und Wärme ließen. Vize-Präsident Richard Cheney, selbst jahrelang mächtiger Chef des Ölzulieferer-Konzerns Halliburton, traf sich daraufhin mehrfach hinter verschlossenen Türen mit amerikanischen Energie-Magnaten. Ihre Namen sowie die Protokolle der Gespräche hält die US-Regierung bis heute geheim, was sonst nur in Fragen der nationalen Sicherheit üblich ist. Offenbar wollen Cheney und Bush verbergen, was sie mit den "Big Oil"-Wirtschaftsbossen vereinbart haben.
Globale Öl-Allianzen
Im Mai 2001 legte Cheney dann einen wegweisenden Kommissions-Bericht vor mit dem Titel: "Wie ist der Erdölbedarf der USA in den nächsten 25 Jahren zu sichern?" Die Autoren des Berichts empfahlen, dass "der Präsident Energiesicherheit zu einer Priorität in unserer Handels- und Außenpolitik" mache.
Um Ölquellen für den verschwenderischen American way of life zu sichern, plädiert der Cheney-Report für ein globales Engagement der USA an wichtigen Rohstoff-Lagerstätten wie dem Kaspischen Meer, Russland und Westafrika. Das Hauptaugenmerk aber fällt auf die Golfregion: "Die Ölproduzenten des Mittleren Ostens bleiben entscheidend für die Ölversorgung der Welt."
Schon heute müssen die USA etwa die Hälfte ihres Brennstoffbedarfs importieren. Da die eigene Rohölproduktion deutlich sinkt, werden die Einfuhren in zwei Jahrzehnten zwei Drittel betragen. Der Mittlere Osten ist dafür nach Kanada und Mexiko die derzeit drittgrößte Bezugsquelle der Amerikaner.
Die politischen Folgen sind brisant:
Seit der Ölkrise von 1973 benutzt das arabisch dominierte Opec-Kartell das Öl als Faustpfand und Druckmittel gegenüber dem Westen. Um ihre Abhängigkeit von den Scheichs zu mindern, verfolgen die USA seit Jahren das Ziel, ihre Ölversorgung zu "diversifizieren".
Dabei geht es darum, außerhalb der Opec liegende Ölressourcen wie die des Kaspischen Meers zu erschließen und zu kontrollieren.
Das Problem ist, dass viele Vorräte wie die der Nordsee inzwischen zur Neige gehen. Gleichzeitig lassen die Boomländer China und Indien den Weltölverbrauch nach Schätzungen der International Energy Agency von jetzt 73 Millionen Barrel pro Tag auf 90 Millionen im Jahr 2020 ansteigen. So baut die Opec ihre Marktführerschaft zwangsläufig weiter aus - und damit ihre politische Macht.
Besonders der Einfluss Saudi-Arabiens wird wachsen, denn das Land ist bislang als einziges in der Lage, als ein so genannter "Swing supplier" zu handeln und so den Ölpreis zu diktieren. Um weltweit Produktionsausfälle wie etwa wegen der derzeitigen politischen Krise in Venezuela auszugleichen, können die Saudis binnen dreier Monate ihre Fördermenge von acht auf 10,5 Millionen Barrel pro Tag hochfahren - oder es aber sein lassen und den Preis hochtreiben.
Vielen in Washington behagt die saudische Macht nicht. Spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als fast alle der Todespiloten Saudis waren, erweist sich der Wüstenstaat zunehmend als peinlicher, vielleicht gar gefährlicher Verbündeter. Das Risiko wächst, dass radikalislamische Gruppen das korrupte Saud-Königshaus stürzen und dann den Ölhahn für "Ungläubige" im Westen zudrehen.
Aber auch ohne eine anti-westliche Revolution wie im Iran 1979 - als über Nacht 5,6 Millionen Barrel ausfielen - ist das saudische Petroleum schon heute sozusagen ideologisch vergiftet:
In einer Art Ablasshandel finanziert das Regime in Riad nämlich die radikalsunnitische Sekte der Wahhabiten, die etwa die afghanischen Taliban unterstützt haben weltweit zu Terror gegen die USA aufrufen.
Sie sind eine Gefahr besonders für die Tausenden amerikanischen Soldaten, die seit dem ersten US-Feldzug gegen Hussein vor zwölf Jahren dauerhaft nahe den saudischen Ölquellen stationiert sind. Die militärische Präsenz auf dem für Muslime heiligen Boden, die die US-Steuerzahler jährlich etwa 50 Milliarden Dollar kostet, motiviert die Qaida von Terrorchef Osama Bin Laden maßgeblich zum fanatischen Kampf gegen die USA.
Solange die USA noch saudisches Öl und Unterstützung für den Irak-Feldzug brauchen, beteuert man in Washington offiziell sein Interesse an guten Beziehungen zum Königreich. Allerdings wächst die Zahl einflussreicher Politiker, die laut darüber nachdenken, den Kampf gegen den Terror gegen Riad auszuweiten und saudische Ölfelder zu besetzen.
Macht der Opec brechen
Mittelfristig sucht die US-Regierung einen neuen Verbündeten und Haupt-Öllieferanten im Mittleren Osten, und da kommt der Irak ins Spiel. Sein Anteil von zwölf Prozent an den Weltölreserven macht das Land zur einzigen Alternative als "Swing supplier". Eine von amerikanischen Streitkräften installierte Regierung in Bagdad müsste ohnehin versuchen, das abgewirtschaftete und womöglich von einem Krieg zerstörte Land mit Hilfe maximaler Petro-Einkünfte wieder aufzubauen. Auch die militärische Statthalterverwaltung durch US-Generäle, die das Pentagon für die Zeit nach einem Krieg vorsieht, will sich Washington nach Aussage von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld mit irakischem Öl bezahlen lassen.
Nicht unwahrscheinlich ist, dass der Irak unter einer neuen pro-amerikanischen Regierung gar aus der Opec austritt, um ausländische Investoren von ärgerlichen Förderlimits zu befreien. Der Block der Nicht-Mitglieder - zu dem auch Russland und die kaspischen Anrainerstaaten gehören - würde ausreichend Rohöl produzieren, so dass die Opec ihre Hochpreis-Absprachen nicht mehr durchsetzen könnte. Die Macht des Kartells und damit Saudi-Arabiens würde gebrochen, und das Öl könnte ungebremst und billig wie nie zuvor in den Westen fließen.
Ein von US-Militärs eingesetztes neues Regime in Bagdad würde Bohrrechte zweifelsohne bevorzugt an US-Firmen vergeben. Achmed Chalabi, der Führer der dubiosen irakischen Exil-Opposition, hat sich bereits mehrfach mit Managern von ExxonMobil and ChevronTexaco getroffen: "Amerikanische Unternehmen werden einen fetten Anteil am irakischen Öl bekommen", verhieß Chalabi danach. Allerdings ist es eher wahrscheinlich, dass die Ölfelder von internationalen Konsortien mehrerer Konzerne ausgebeutet werden. Diese Praxis, bei der Firmen ihre Investitionen streuen und so Risiken minimieren, setzt sich in der Branche weltweit zunehmend durch.
Auch ist es keineswegs sicher, dass eine auf Rückhalt im eigenen Volk bedachte Nachkriegsregierung in Bagdad die seit langem verstaatlichte Ölindustrie privatisieren würde. Aus ihrer Sicht könnte es sinnvoller erscheinen, die Ölerträge nicht mit Investoren teilen zu müssen, sondern schlicht westliche Technologie einzukaufen und selbst einzusetzen. So spielt der Wettstreit zwischen den Ölkonzernen der USA und ihren Widersachern in der Irak-Krise nur eine eher unbedeutende Rolle. Wichtiger ist den Polit-Strategen im großen Spiel um Öl und die Macht im Orient, dass das "schwarze Gold" ungehindert fließt.
Amnesty International zum Irak
"Bagdad braucht Menschenrechts-Inspektoren"
Die Irak-Expertin von Amnesty International, Ruth Jüttner, berichtet im SPIEGEL-ONLINE-Interview über die anhaltenden Menschenrechtsverstöße unter Saddam Hussein. Sie wünscht die Entsendung von Uno-Menschenrechtsbeobachtern. Einen Krieg als Mittel zur Beendigung der Verstöße hält sie für verfehlt.
SPIEGEL ONLINE: Als Irak-Expertin bei Amnesty International kümmern sie sich um die Menschenrechtsverletzungen unter dem Regime Saddam Husseins. Welche Verstöße stellen Sie fest?
Jüttner: Nach wie vor gibt es dort schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, darunter massive Verfolgungen von mutmaßlichen Oppositionellen, Hinrichtungswellen, sehr extensive Vollstreckung der Todesstrafe, auch die Verfolgung von ganzen Bevölkerungsgruppen.
SPIEGEL ONLINE: Wer ist besonders betroffen?
Jüttner: Ganze Bevölkerungsgruppen stehen unter einem besonderen Verdacht, oppositionell tätig zu sein. Dazu zählen die im Süden Iraks lebenden Schiiten, die die Bevölkerungsmehrheit stellen und denen unterstellt wird, dass sie mit dem Erzfeind des Irak, Iran, zusammenarbeiten. Gerade Menschen schiitischer Religionszugehörigkeit werden häufig Opfer von Verfolgung oder Festnahmen nur auf vagen Verdacht hin. Ihre Verfolgung folgt dann oft einem bestimmten Muster. Aber auch die kurdische Bevölkerung im Norden wird verfolgt.
SPIEGEL ONLINE: Wie äußert sich eine solche Verfolgung konkret?
Jüttner: Es wird Druck auf Familienangehörige ausgeübt, wenn der Verdacht besteht, dass ein Verwandter mit der Opposition zusammenarbeitet, untergetaucht ist oder im Exil lebt. Ziel ist es, ihn durch Einschüchterung zum Schweigen zu bringen, was auf viele Exil-Iraker bis heute nachdrücklich wirkt. Es gibt auch immer häufiger Berichte, dass Familienangehörige festgenommen werden und später im irakischen Fernsehen auftreten. Dort sagen sie sich von ihren Angehörigen los und machen deutlich, dass die irakische Regierung keine Kritik, auch nicht vom Ausland aus, duldet.
SPIEGEL ONLINE: In welchem Umfang wird die Todesstrafe verhängt?
Jüttner: Das ist schwer zu recherchieren, weil es keine offiziellen Angaben dazu gibt. Bekannt wurden Hinrichtungswellen wie 1997 und 1998, als die Gefängnisse sehr überfüllt gewesen sein sollen. Es sollen Hunderte Gefangene in den Gefängnissen gezielt umgebracht worden sein. Viele der Leichen sollen in Massengräbern in der Nähe der Gefängnisse vergraben worden sein. Bis heute halten auch Berichte an, dass Angehörige der Armee hingerichtet werden, wenn sie in den Verdacht oppositioneller Arbeit geraten. Aber die genauen Zahlen lassen sich nicht ermitteln, weil teilweise die Angehörigen gar nicht wissen, wo ihre Angehörigen eigentlich sind. Nur in Einzelfällen werden sie über Hinrichtungen informiert.
SPIEGEL ONLINE: Hatte der Irak nicht zwischenzeitlich andere Zeichen gesetzt? Im Oktober 2002 wurde eine große Amnestie versprochen.
Jüttner: Diese Amnestie hat sehr viele Fragen offen gelassen. Von der Regierung wurde zu keinem Zeitpunkt genau veröffentlicht, wer von dieser Amnestie profitiert hat oder profitieren sollte. Betroffen sollen angeblich zwischen 50.000 bis 100.000 Gefangenen gewesen sein. Wie hoch der Anteil politischer Gefangener daran ist, wurde aber nicht bekannt. Wir haben wiederholt gefordert, die Namen offen zu legen und vor allem das Schicksal derjenigen aufzuklären, die weiterhin verschwunden sind.
SPIEGEL ONLINE: Kann Amnesty International in den Irak reisen, um sich zu informieren?
Jüttner: Amnesty hat, wie auch andere Menschenrechtsorganisationen, seit Jahren keinen Zugang zum Irak. Wir haben die irakische Regierung wiederholt aufgefordert, uns Ermittlungen im Irak zu gewähren, vergeblich. So ist die Recherche im Irak extrem schwierigen Bedingungen unterworfen, die Bewegungsfreiheit für Besucher aus dem Westen ist in der Regel stark eingeschränkt und Journalisten haben stets einen staatlichen Aufpasser dabei. Amnesty würde nur dann dorthin reisen, wenn wir die Möglichkeit hätten, unbeobachtet zu bleiben und vertraulich mit Informanten reden zu können. Solange dies nicht möglich ist, machen solche Reisen gar keinen Sinn.
SPIEGEL ONLINE: Wie informieren Sie sich dann?
Jüttner: Aufgrund der geschilderten Probleme ist es nicht leicht, mehrere Quellen zu finden, um einen Bericht zu verifizieren. Wir werten für unsere Arbeit alle zugänglichen Quellen aus, zu denen Exilanten, Journalisten, Flüchtlinge, Reisende oder Iraker zählen, die sich in den Nachbarländern aufhalten. Wir wägen dann ab und veröffentlichen nur die Fälle, über die wir uns sicher sein können, weil sie mit vorliegenden Erkenntnissen übereinstimmen.
SPIEGEL ONLINE: Wie zuverlässig sind solche Angaben?
Jüttner: Leider hat es in der Vergangenheit auch Fälle gegeben, wo auch wir Propaganda aufgesessen sind. So wurden zu Beginn des ersten Golfkriegs grobe Menschenrechtsverletzungen von der kuweitischen Regierung zu Propagandazwecken erfunden, um die Öffentlichkeit gegen den Irak zu mobilisieren. Damals wurden irakische Soldaten beschuldigt, Säuglinge aus den Brutkästen in Krankenhäusern herausgerissen zu haben.
SPIEGEL ONLINE: Fürchten Sie auch jetzt solchen Missbrauch durch Propaganda? Derzeit gibt es britische und amerikanische Berichte über professionelle Vergewaltiger im Dienste Saddams.
Jüttner: Diese Berichte ziehe ich in Zweifel. Das ist etwas, was wir in dieser Form zuvor noch nie im Zusammenhang mit dem Irak gehört haben. Uns ist zwar bekannt, dass in irakischen Gefängnissen Personen Opfer von Vergewaltigungen werden, als Mittel der Folter oder um Gefangene unter Druck zu setzen, in dem ihre weiblichen Angehörigen vergewaltigt werden. Aber in dem Sinne, dass Einzelpersonen im Auftrag der Regierung Vergewaltigungen durchführen würden, ist uns so nicht bekannt.
SPIEGEL ONLINE: Befürworten die Exiliraker, die sie kennen, ein hartes Durchgreifen mittels Krieg?
Jüttner: Es mag Sie überraschen. Aber die Mehrzahl unserer irakischen Gesprächspartner legt keinen Wert auf einen Krieg, weil sie fürchten, dass die irakische Zivilbevölkerung wieder einmal in erster Linie das Opfer sein wird. Die Sorge vor den humanitären Folgen eines Krieges und die Zweifel an den Beweggründen überwiegen.
SPIEGEL ONLINE: Am Samstag wollen Zehntausende Menschen in Berlin gegen einen Krieg im Irak demonstrieren. Geht die Friedensbewegung - angesichts der andauernden Menschenrechtsverletzungen im Irak - Diktator Saddam Hussein auf den Leim?
Ruth Jüttner: Tatsächlich sollte die Friedensbewegung die Menschenrechtsverletzungen im Irak und das Leiden der irakischen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten nicht aus dem Blick verlieren. Das Ziel sollte Frieden UND die Verwirklichung der Menschenrechte im Irak sein.
SPIEGEL ONLINE: Ist - um der Menschenrechte Willen - also doch ein militärisches Eingreifen notwendig?
Jüttner: Wir weisen den Versuch, ein militärisches Vorgehen mit der schlechten Menschenrechtslage zu begründen, entschieden zurück. Das ist ein selektiver Missbrauch der Menschenrechte, deren Lage auch in den letzten Jahren schon sehr schlecht war. Aber das hat die Akteure oder Staaten, die jetzt besonders für einen Krieg aussprechen, wenig interessiert. Der Hinweis auf die Menschenrechtslage ist nur ein Vorwand, um ganz andere Interessen zu verfolgen. Der Einsatz für die Menschenrechte muss kontinuierlich erfolgen und nicht nur dann, wenn man ein militärisches Eingreifen begründen will. Schließlich verschwinden schon seit 15 bis 20 Jahren Menschen im Irak, ohne dass sich die USA oder Großbritannien darum besonders gekümmert haben.
SPIEGEL ONLINE: Was wissen Sie über die Verschollenen?
Jüttner: Genaue Zahlen gibt es nicht, aber man kann von mehreren Hunderttausenden Verschwundener ausgehen. Das begann im Verlauf des Krieges gegen den Iran in den achtziger Jahren, dann sehr stark nach der Invasion in Kuweit. Noch heute gelten allein 800 kuweitische Bürger als vermisst. Und neue Fälle gibt es bis heute. Der jüngste Fall ist der eines jungen Mannes, der sich am 25. Januar in einen Wagen der Uno-Waffeninspektoren flüchtete und dann von den Sicherheitskräften aus dem Auto entfernt worden ist. Es existieren bis heute keine Informationen über sein Schicksal. Deshalb fordert Amnesty seit Jahren, dass internationale Menschenrechtsbeobachter in den Irak entsendet werden.
SPIEGEL ONLINE: Sollten dies Uno-Menschenrechtsinspektoren sein?
Jüttner: Es wäre es gut, wenn sie von der Uno geschickt würden, weil das ihre Legitimation verbreitern würde. Wichtig ist, dass sie über eine entsprechende Ausbildung, Erfahrung und ein umfangreiches Mandat verfügen und dass sie unabhängig und fern jeder Beeinflussung Berichten über Menschenrechtsverletzungen nachgehen können. Schließlich müssen sie eigene Beweise und Zeugenaussagen sammeln können, um beispielsweise das Verschwinden von Menschen aufzuklären.
Das Gespräch führte Holger Kulick
SPIEGEL ONLINE - 14. Februar 2003
Stunde der Dilettanten
Drei Vorkriegs-Opfer: Europa, die Nato und eine alte Freundschaft
Von Josef Joffe
Stellen wir uns ein deutsches Geschichtsbuch in zehn, zwanzig Jahren vor. Hoffentlich steht dann nicht am Ende des Kapitels „Gerhard Schröder“ diese Passage: „Und dann entschied sich der Kanzler, alles auf eine Karte zu setzen, um in der Machtprobe mit Amerika zu obsiegen. Seine Gründe mögen nobel oder eigensüchtig, richtig oder kurzsichtig gewesen sein. Die Folge war der Kollaps zweier Pfeiler deutscher Außenpolitik, die fünfzig Jahre lang gehalten hatten: die deutsch-amerikanische Freundschaft und das atlantische Bündnis. Schröders Kanzlerschaft hat dieses waghalsige Spiel nicht überlebt.“
Was im Sommer als profitabler Wahlkampf-Einsatz begann, hat sich zur schlimmsten Krise deutscher Außenpolitik seit 1949 gesteigert. Der Irak-Krieg hat noch nicht begonnen, und schon liegen drei blutende Opfer auf der Walstatt. Und selbst die zungenflinksten Apologeten können nicht glaubhaft behaupten, Schröders Politik trage an deren Schicksal keinen Anteil.
Europa contra Europa
Opfer Nummer eins ist Europas gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Schröder und Chirac hatten in Versailles, zum 40. Jubiläum des Freundschaftspaktes, geglaubt, ihre ermüdete „Achse“ aufpolieren zu können. Rasch aber zeigte sich, dass sie ihre Rechnung ohne die anderen 18 Wirte in Europa gemacht hatten. Zuerst murrten die „Euro-8“, unter denen sich auch London, Rom und Madrid befanden. Dann kamen die „Vilnius-10“, von A wie Albanien bis S wie Slowakei. Im Klartext lautete die Botschaft der 18: „Wir verwahren uns gegen den Führungsanspruch von Berlin und Paris; vor die Wahl gestellt, stehen wir an der Seite Amerikas.“
Kein Wunder. Je näher ein Land geografisch bei Russland liegt, desto dichter will es politisch an Amerika heranrücken – nach dem kühlen Kalkül, dass seine Sicherheit dort besser aufgehoben ist als unter der Fuchtel von Paris und Berlin. Oder: Wenn schon abhängig, dann lieber von der entfernten Supermacht als von zwei vormachtheischenden Nachbarn. Auch für Madrid, Rom, London et al. gilt: Amerika, das ist ein hübsches Zusatzgewicht im neuen Spiel um Europa.
Es wird also etwas dauern, bis Europa wieder „mit einer Stimme“ spricht. Dieses Risiko hätten die beiden Dirigenten im Elysée und Kanzleramt bedenken sollen: Wer unilateralistisch (genauer: bilateralistisch) handelt, schafft Gegenwehr, nicht Gefolgschaft. Überdies verstärkt es nicht die Glaubwürdigkeit, wenn man selbst die Sünden begeht, die zu Recht den Bushisten anzukreiden sind. Doch ist das nicht der schlimmste Kunstfehler. Gefährlicher ist der zweite Schlag – gegen die Nato –, den das Duo mit der Pralinen-Supermacht Belgien geführt hat.
Diese Geschichte ist so trivial, wie ihr Ausgang für das Bündnis letal sein kann. Das Trio wollte ja nichts „präjudizieren“ und legte deshalb mit unschuldigem Augenaufschlag sein Veto gegen die bloße Nato-Planung für den Schutz der Türkei ein. Es wäre eine kleine, aber feine Geste gegenüber dem meistexponierten Nato-Mitglied gewesen – und noch kein Ja zu den amerikanischen Kriegsplänen. Doch scheinen Chirac und Schröder so besessen davon zu sein, die Amerikaner auch im Kleinsten zu konterkarieren, dass sie gleich zweierlei vergessen haben.
Erstens: Dieses Bündnis funktioniert nur so lange, wie das Prinzip „Einer für alle, alle für einen“ gilt – jedenfalls, wenn es um Abschreckung und Verteidigung geht. Patriots sind keine Angriffswaffen. Westdeutschland hat hinter dem Nato-Schild vierzig Jahre lang prächtig floriert. Mag sein, dass diese Wohltat aufgebraucht und Dank nicht der Kern aller Staatsräson ist. Bloß: Wer dieses Bündnis auf den Müllhaufen der Geschichte kippen will, muss es aus triftigem Grund (und mit gewichtigen Neu-Verbündeten) tun – nicht, um auf den unilateralistischen Schelmen anderthalb zu setzen.
Zweitens: Von welchem Meister der Staatskunst hat sich Schröder wohl die dialektische Volte abgeguckt, die ihn selbst ad absurdum führt? Denn nichts anderes bedeutet der Versuch, einen nervenstarken Gewaltherrscher durch den kategorischen Verzicht auf die Ultima Ratio zu entwaffnen. Das kann er nicht von Bismarck, nicht von Churchill gelernt haben. Es wäre nützlicher gewesen, in der ägyptischen Wochenschrift Al Usbou zu blättern. Dort räsonnierte Saddam Hussein im November: „Die Zeit ist auf unserer Seite. Wir müssen bloß Zeit gewinnen, und die anglo-amerikanische Koalition wird zerbrechen.“ Dieses Spiel sollten dem Despoten just jene verwehren, die den Krieg verhindern wollen.
Versuchsballon „Blauhelme“
Richtig hanebüchen aber wird’s, wenn im Spiegel Versuchsballons losgelassen werden, wonach „friedlich“ einmarschierende Blauhelm-Soldaten den Irak entwaffnen mögen. Eine „friedliche Invasion“ gilt Logikern als Oxymoron – als Widerspruch in sich selbst. Oder glauben die Ballonisten, dass Saddam, ein fröhliches „Salam“ auf den Lippen, seinen Besitz freiwillig zum „UN-Protektorat“ macht? Dass er den Europäern vor die Füße legt, was er listenreich zu retten sucht: seine Schreckensherrschaft? Ein Befehlshaber, der seine Truppen auf derlei Selbstmordkommando schickt, gehörte vor ein Kriegsgericht. Ach so, die Amerikaner mögen doch bitte in Stellung bleiben, um den Einmarsch der UN-Europäer „zu erzwingen und abzusichern“. Die regierungsamtlichen Autoren müssen zu viele Wildwest-B-Movies gesehen haben: Die Europäer, mit Frankreich an der Spitze, haben das Sagen, die US-Kavallerie haut sie heraus.
Der „Plan“, der fleißig von einem alten Gedankenspiel des Carnegie Endowment in Washington abkupfert, wurde natürlich sofort dementiert, aber er lässt ahnen, wie verzweifelt die Lage im Kanzleramt sein muss. Denn nicht nur Joschka Fischer wird es inzwischen schwanen, dass neben Europa und Nato ein drittes Opfer zurückbleiben könnte: die deutsch-amerikanische special relationship, die historisch segensreich zu nennen eine Untertreibung wäre.
Es geht hier nicht um die alte Litanei, die von Marshall-Plan und Berlin-Blockade zu Westintegration und Wiedervereinigung reicht. Das war im Kalten Krieg, und „Dankbarkeit“ definiert das nationale Interesse hauptsächlich in Sonntagsreden. Bemühen wir lieber die Staatsräson: Liegt es im deutschen Interesse, sich mit Amerika anzulegen? Wenn nämlich alles addiert worden ist – Wahlkampf und Parteiwohl, die Provokationen eines Rumsfeld ebenso wie die Ausfälle deutscher Politiker, schließlich das nüchterne Faktum, dass Washington mit einem wohlwollenden „Ohne uns“ plus Luftraum- und Basennutzung zufrieden gewesen wäre – was bleibt dann als halbwegs rationales Motiv Schröderscher Politik übrig?
Von der Torheit zur Tragödie
Wahrscheinlich nur die Hypothese, dass Schröder und (mit einigem Abstand) Chirac die Entfaltung amerikanischer Macht oder gar deren Triumph in Nahost als größeres Übel betrachten als die Massenvernichtungswaffen des Saddam Hussein. Das läge in der klassischen Logik von Gleichgewichtspolitik. Da Gulliver nun seine Fesseln verloren hat, muss Europa die einstige Aufgabe der Sowjetunion übernehmen: die Einhegung und Eindämmung amerikanischer Übermacht. Also: Balance of Power contra USA.
Derlei war jahrhundertelang die Räson aller Staatskunst. Warum nicht wieder – in einer Art Umkehrung der Allianzen? Vielleicht gelingt das auch, vielleicht entsteht tatsächlich ein diplomatisches Bündnis zwischen Paris/Berlin, Moskau und Peking, das in diesen Tagen hektisch geprobt wird. Vielleicht gelingt es auch so, den amerikanischen Vormarsch zu stoppen. Bloß ist das deutsche Risiko ein sehr hohes.
Das wäre das Ende der Nato, das Ende einer einst „wunderbaren Freundschaft“. Und der Beginn einer alt-neuen Gleichgewichtspolitik, die aber die „Euro-18“ und die Amerikaner auf der europäischen Bühne mindestens so gut spielen können wie die Großstrategen im Kanzleramt. Zudem haben die Deutschen nie eine glückliche Hand bei Machtproben mit Amerika bewiesen. Umgekehrt, wie nach 1945, war’s gewinnträchtiger. Schließlich: Moskau, Peking, auch Paris werden zum Schluss sehr sorgfältig abwägen, ob sie ihr Verhältnis zu Washington für Saddam Hussein riskieren wollen.
In diesen Tagen muss man für kleine Dinge dankbar sein. Zum Beispiel für jedes Türchen, das sich der Kanzler offen ließe, damit Torheiten nicht zur außenpolitischen Tragödie werden.
"Es gibt notwendige Kriege"
Paul Spiegel, Zentralratsvorsitzender der Juden, sieht die Öffentlichkeit in einem "Dornröschenschlaf" (Interview)
DIE WELT: Sie haben zur Irak-Debatte erklärt, nicht Demonstranten, sondern die Rote Armee habe Auschwitz befreit. Wollten Sie damit die aktuelle Lage mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg vergleichen?
Paul Spiegel: Wir haben heute zwar eine andere Situation, aber sie ist vergleichbar. Wieder geht es um einen Diktator, der sein eigenes Volk opfert und ins Verderben führt. Es gibt eigentlich keine gerechten, aber notwendige Kriege. In welcher Situation wären wir heute speziell in Deutschland, wenn damals die Alliierten nicht gegen Hitler Krieg geführt hätten? Wenn damals die Alliierten wie heute beispielsweise Franzosen und Deutsche gesagt hätten: Nein, wir wollen keinen Krieg, wir sind generell gegen Kriege – dann wäre das eine Katastrophe für Deutschland und Europa gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, die Konzentrationslager sind nicht von Demonstranten, sondern von amerikanischen und russischen Soldaten befreit worden.
DIE WELT: Warum hat dann gerade die deutsche Bevölkerung so wenig Verständnis für die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Irak?
Spiegel: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Auch heute erwartet die ganze Welt, dass sich Deutschland im Nahen Osten engagiert. Wer dagegen ist, ist der Großteil der deutschen Bevölkerung. Ich habe auch Verständnis, dass die Deutschen sagen, genug, wir wollen nicht mehr. Dabei ist Deutschland schon auf dem Balkan militärisch engagiert. Natürlich ist es viel einfacher, gegen einen Krieg zu sein, als zu begründen, warum man für einen Krieg ist. Ich frage mich aber auch, wenn ich jetzt wieder die vielen Demonstrationen sehe, wo sind diese Friedensdemonstranten in den letzten zehn Jahren gewesen, als Saddam Hussein seine Mitbürger umgebracht und immer wieder mit Krieg gedroht hat. Ich kenne keine einzige Demonstration in Deutschland gegen Saddam Hussein. Kaum jemand spricht auch davon, dass die Amerikaner und Engländer das irakische Volk von diesem Diktator befreien wollen.
DIE WELT: Befürworten Sie auch einen Präventivkrieg?
Spiegel: Selbstverständlich bin ich gegen Krieg. Was Kriege bedeuten, haben ich und meine Familie nun wirklich zu spüren bekommen. Und auch meine Verwandten und Freunde in Israel haben unter Kriegen gelitten. Doch klar ist, dass Saddam Hussein sowohl für sein Volk wie auch für die gesamte Region eine große Gefahr darstellt. Die Frage heißt also, können und wollen wir mit dieser Gefahr leben oder nicht? Wenn wir das nicht wollen, ist ein Angriff auf ihn möglicherweise ein Verteidigungskrieg. Wenn wir uns vorstellen, dass Saddam Hussein in der Lage wäre, chemische oder atomare Waffen über große Entfernungen zu befördern, was tun wir dagegen – wenn wir überhaupt noch dazu in der Lage sind? Deswegen ist die Frage nicht so einfach aus abstrakt moralisch-ethischen Gründen zu beantworten. Klar ist auch, dass wir nicht immer Amerika als Weltpolizisten allein lassen und uns bequem zurücklehnen können.
DIE WELT: Auf Transparenten in Deutschland wird nicht Saddam Hussein, sondern George W. Bush als Kriegstreiber attackiert.
Spiegel: Ich kann das nicht nachvollziehen und verurteile das entschieden. Man kann nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, denen Deutschland wirklich die Freiheit zu verdanken hat, heute hier als Verbrecher darstellen.
DIE WELT: Sie äußern damit eine deutlich andere Haltung als die beiden christlichen Kirchen in Deutschland.
Spiegel: Ich spreche als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland für die Gemeinschaft der Opfer. Die Juden in der ganzen Welt haben auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Israel. Denn dieses kleine Land und seine Menschen sind direkt bedroht durch Saddam und seine fürchterlichen Waffen. Deswegen haben wir gerade wegen dieser akuten Bedrohung ein ganz anderes Verhältnis zum möglichen Krieg als die beiden christlichen Kirchen. Ich habe große Angst davor, Saddam Hussein weiter sein gefährliches Spiel treiben zu lassen. Und ich hoffe nicht, dass Deutschland eines Tages aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und es dann vielleicht zu spät ist.
DIE WELT: Wie geht es nach dem Staatsvertrag mit dem Zentralrat und der Bundesrepublik Deutschland weiter?
Spiegel: Der Staatsvertrag ist ein wirkliches historisches Ereignis, das es bisher in der Geschichte Deutschlands noch nicht gegeben hat. Damit kommen wir wirklich auf den allerdings noch weiten Weg zur Normalität. Das ist wichtiger als die finanzielle Ausstattung, über die abenteuerliche Geldsummen durch die Welt schwirren. Tatsächlich handelt es sich nur um drei Millionen Euro. Damit sind wir endlich in der Lage, die Arbeit zu leisten, die man von uns erwartet. Denn wir können zur Betreuung der 83 jüdischen Gemeinden – und zur Wahrnehmung unserer politischen und kulturellen Interessen – in Deutschland mehr Personal einstellen. Auch damit sind wir auf dem Weg zum unbefangeneren Miteinander. Die volle Normalität im Umgang mit Juden und Nichtjuden wird aber weder mir noch meinem Nachfolger gelingen. Das, was vor knapp 58 Jahren in Deutschland zu Ende gegangen ist, wird uns noch lange gefangen halten. 58 Jahre sind im Leben eines Menschen sehr, sehr viel. Aber in historischen Dimensionen ist es nur ein Wimpernschlag. Dass aber in den letzten Jahren 70 000 Juden nach Deutschland gekommen sind und sich für Deutschland entschieden haben, ist ein großer Vertrauensbeweis in die Menschen dieses Landes.
DIE WELT: Sind Sie für die Aufnahme eines Gottesbezuges in die Präambel einer EU-Verfassung?
Spiegel: Ja. Da wir alle an einen und denselben Gott glauben, alle drei großen Religionen in Europa, sehe ich keinen Grund, warum das nicht so sein soll. Wenn die Präambel auf die verschiedenen monotheistischen Religionen ausgerichtet ist, sehe ich da kein Problem.
DIE WELT: Erwarten Sie irgendwann ein Ende des Antisemitismus?
Spiegel: Es ist eine Hoffnung. Der Antisemitismus kann endgültig überwunden werden, wenn endlich alle Menschen in Deutschland begreifen würden, dass Antisemitismus nicht nur ein Angriff auf Minderheiten wie etwa Juden ist, sondern ein Angriff auf die Gesamtgesellschaft. Antisemitismus ist in Wirklichkeit Menschenfeindlichkeit. Wenn alle das endlich einsehen, dann ist in Deutschland kein Platz mehr für Antisemitismus.
Das Gespräch führten Helmut Breuer und Gernot Facius
Artikel erschienen am 13. Feb 2003
"Aber es gibt auch gute Gründe für einen Krieg. Sie wurden hier in diesem Thread vorgetragen und ich zitiere hier noch einmal auszugsweise Shlomo Avineri..."
Du hast überhaupt nichts begriffen. Wer nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts soetwas schreibt, hat sie nicht mehr alle.
Krieg ist kein politisches Mittel und durch nichts zu rechtfertigen, auch wenn manche Holzköpfe das immer noch meinen.
Unglaublich diese Ignoranz und Dekadenz.
CU Jodie
Du hast überhaupt nichts begriffen. Wer nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts soetwas schreibt, hat sie nicht mehr alle.
Krieg ist kein politisches Mittel und durch nichts zu rechtfertigen, auch wenn manche Holzköpfe das immer noch meinen.
Unglaublich diese Ignoranz und Dekadenz.
CU Jodie
@ jodie
Schau mal bitte in Sig`s Thread "Gehört Krieg zum System?".
Krieg ist nur ein Fazit unseres wirtschaftlichen Verhaltens, und deswegen zwingend notwenig.
Da nützt unsere Aufgeklärtheit wenig!
Diese Erkenntnis ist zwar hart, aber eben eine unausweichliche Folge, wenn wir unsere Systeme nicht ändern.
Stichwort Kreislaufwirtschaft,
Stichwort Freiwirtschaft
Stichwort Begrenzung der Macht durch Kapital
Schau mal bitte in Sig`s Thread "Gehört Krieg zum System?".
Krieg ist nur ein Fazit unseres wirtschaftlichen Verhaltens, und deswegen zwingend notwenig.
Da nützt unsere Aufgeklärtheit wenig!
Diese Erkenntnis ist zwar hart, aber eben eine unausweichliche Folge, wenn wir unsere Systeme nicht ändern.
Stichwort Kreislaufwirtschaft,
Stichwort Freiwirtschaft
Stichwort Begrenzung der Macht durch Kapital
Hallo Konradi,
ein früherer Thread, den ich wenige Tage nach dem "11.Sept."
aufgemacht hatte. Der Beitrag ist meiner Meinung nach wie vor brandaktuell:
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
DIE GOLDENEN 90-ziger, .....oder: Überzeugungen sind ein größerer Feind der Wahrheit als die Lüge: Für mich reflektiert dieser Spruch die Diskussionen hier im Sofa der vergangenen Woche bezüglich der
Anschläge in Amerika.
Meine Ideen zu den gezielten und genau in dieser beabsichtigten Wirkung geglückten Anschlägen gehen in Richtung der Betrachtungsweise von Susan
Sontag.
Innerlicher Abstand zu den Geschehnissen der vergangenen Woche würde vielen der hier Schreibenden gut tun. Nur um ein Beispiel der letzten Woche zu
nennen, das mich wirklich und nachhaltig schockiert und betroffen gemacht hat: wie kann man z.B. die umgehende, unbedingte Bündnistreueerklärung von
Gerhard Schröder am Tag des Terroranschlags einfach nur als Fakt zur Kenntnis nehmen: die Art und Weise, wie er sich ausdrückte, erinnerte mich z.B
an Reden Erich Honeckers, wenn er den sowjetischen "Freunden unbedingte Solidarität" schwor.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bestand in der westlichen Welt des Kapitalismus, d.h. nahezu ausnahmslos bei uns allen, das latente Gefühl,
das intelligentere, effizientere, gerechtere System habe den fast 50-jährigen Kampf aus deutlicher Überlegenheit gewonnen.
Die Chinesen oder Inder u.a., obwohl von der Bevölkerungszahl Europa und Amerika weit "überlegen", finden in gleichem Maße wie andere kulturfremde
Nationen ( z.B. Japan, Korea etc) nur wenig Beachtung in unserem gegenwärtigen Bewußtsein.
"Das größte Freiluftgefängnis" der Welt, im Dauerclinch mit Israel seit ich denken kann, ist nur einer von vielen Schwelbränden in der Welt, an den man sich
gewöhnt hat. Dieses Krisengebiet findet gerade nur deshalb Beachtung, weil viele Juden in Amerika nachhaltig Einfluß auf die Politik der USA nehmen
können, und der ganze Konflikt sich eben in der Region abspielt, die den "Treibstoff" für funktionierende Volkswirtschaften dieser Welt "besitzt", Für uns in
der westlichen Welt, mit Ausnahme von Israel, wurde dieser Konflikt aus Gewohnheit in den letzten Jahren zunehmend eher als Ärgernis, das
Börsenkurse maipulieren konnte, als eine Gefahr angesehen. Ernsthafte Konzepte: Fehlanzeige!!!, wie auch in fast allen anderen Krisengebieten der Welt
Israel als "Stachel im Fleisch der arabischen Welt", sehe ich eher als einen Katalysator für ein Problem an, unter dem die gesamte westliche Welt, und eben
allen voran Amerika leidet: das Unverständnis, daß es neben den eigenen Werten und Überzeugungen eben auch noch andere Kulturkreise gibt, die nach
anderen Gesichtpunkten gelebt haben, leben und auch entwicklungsfähig sein können( daß mir jetzt keiner mit Taliban usw kommt !). Und nicht jedes Land
der Welt möchte gerne nach westlichen Maßstäben und Werten leben.
Mir scheint es eben, daß Ignoranz / geistige Untätigkeit "unserer Politiker" auf der einen und Sendungsbewußtsein und Gier auf der anderen Seite, diese
latent in den vergangenen Jahren entstandene (Goldene 90-ziger???) und durch die "Terrorakte" zu Tage getretene, veränderte Situation in der Welt
geschaffen haben.
Diese Vakuum gilt es meines Erachtens schnellstens auf konstruktive Art und Weise zu füllen...... und hierin sehe ich auch den Grund, warum die politisch
und militärisch "Führenden" hinter George Bush noch immer keine Entscheidungen bezüglich kriegerischer Handlung getroffen haben. Es gibt auf diese
neue, veränderte Welt keinen wirkungsvollen Ansatz mit antiquierten Mitteln zu reagieren.
Darüberhinaus habe ich das Gefühl, daß Unsicherheiten innerhalb eines Systems immer dazu führen, daß es sich nach außen stabil darstellen muß, bzw
sich mit unlauteren Mitteln nach innen hin stabilisiert. Letzteres bezeichne ich als als "faschistoiden Kapitalismus": Mitbürger werden durch Konsum
seifenglatt gemacht (Absicht oder Selbstgänger als Teil des Systems???), ganz klar scheint mir allerdings, daß "unsere" Medien in zunehmenden Maße
dazu mißbraucht werden, um letztes selbständiges Denken zu egalisieren.
Leute, steigt mal´auf einen Berg, und guckt ´´mal in´s Tal, um Abstand von der Sache und von Euch selbst zu bekommen. Hier soll nicht der Weltuntergang
prognostiziert werden, dies ist keine antikapitalistische Hetze, erst recht kein Antiamerikanismus im klassischen Sinn, sondern die Aufforderung,
aufmerksam und kritisch den Geschehnissen gegenüberzustehen und sich wirklich eine eigene Meinung zu bilden anstatt die "eigene" Meinung laut ("tu
Gutes und sprich darüber") und chauvinistisch dem anderen überzustülpen: ............. Überzeugungen sind ein größerer Feind der Wahrheit als die Lüge,
das scheint im großen, also (welt)politisch, wie auch im kleinen hier im Sofa ein Teil des Übels zu sein. Klarsicht und neue konstruktive Ansätze werden im
Großen wie auch im Kleinen notwendig sein, um diese weltweite Krise in den Griff zu bekommen
Darüberhaus hätte ich zum "11/09" noch ein paar Fragen. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, daß dieser von der USA geplante Krieg und die vorgesehene "Neuordnung" und Kolonialisierung ( anders kann man es ja nicht bezeichnen!!!!)der Golfregion zu Ihrem Vorteil schon vor der Wahl G.W.Bush´s von dessen Wahlkampf-Sponsoren geplant war.
In diesem Zusammenhang liegt zumindestens nahe, noch einmal sich über den 11/09 unter dieser Prämisse Gedanken zu machen: seit dem 11/09 ist die Aufmerksamkeit der US-Amerikaner von vielen innenpolitischen Vorgängen ( z.B. dem Rückgang des DOW´s von 12000 auf 8000) abgelenkt. Das LAnd wurde zumindestens in dieser Katastrophe vorübergehend "geeint".
Meine Fragen: > es war damals bekannt, daß der Mossad von (diesen) geplanten Anschlägen wußte.
> wieviel Leute arbeiteten gewöhnlich in den Twin Towers um 10:00 am
> Könnte es sein, daß die Vorgänge des 11/09 nicht nur der Startschuß zu dem Projekt NEuordnung der Golfregion gebraucht würde.
Konradi, komm mir bitte nicht mit Paul Spiegel, für den ich mir wünsche, daß er möglichst schnell nach Israel auswandern möge: Deutschland hat im vergangenen Jahr rund 80 000 orthodoxe Juden aus Osteuropa aufgenommen, rund 100 000 Israelis bekamen den Deutschen Paß. Schön wäre es wenn Herr Spiegel auch so etwas mal erwähnen könnte, anstatt prinzipiell die alten Kamellen runterzulabern. Dieser Mann und diese Art, ist für ein zukunftsgerichtetes Zusammenleben von Juden und Nichtjuden(egal in welchem Land) eine Zumutung!!!!
Nein, ich korrigiere mich, ich wäre dafür, daß man Paul Spiegel in´s Exil schickt. Ich hoffe, er liest diese Zeilen
@sitting bull: interessanter Thread von Sig, leider bin ich mit Dir in Bezug auf die Notwendigkeit eines Krieges NICHT einig: Krieg mag u.U. daruas resultieren, aber es ist kein Grund dafür, Probleme nicht konstruktiv, zukunftsgerichtet und ohne Krieg zu klären.
ein früherer Thread, den ich wenige Tage nach dem "11.Sept."
aufgemacht hatte. Der Beitrag ist meiner Meinung nach wie vor brandaktuell:
Dieses Posting: versenden | melden | drucken | Antwort schreiben
DIE GOLDENEN 90-ziger, .....oder: Überzeugungen sind ein größerer Feind der Wahrheit als die Lüge: Für mich reflektiert dieser Spruch die Diskussionen hier im Sofa der vergangenen Woche bezüglich der
Anschläge in Amerika.
Meine Ideen zu den gezielten und genau in dieser beabsichtigten Wirkung geglückten Anschlägen gehen in Richtung der Betrachtungsweise von Susan
Sontag.
Innerlicher Abstand zu den Geschehnissen der vergangenen Woche würde vielen der hier Schreibenden gut tun. Nur um ein Beispiel der letzten Woche zu
nennen, das mich wirklich und nachhaltig schockiert und betroffen gemacht hat: wie kann man z.B. die umgehende, unbedingte Bündnistreueerklärung von
Gerhard Schröder am Tag des Terroranschlags einfach nur als Fakt zur Kenntnis nehmen: die Art und Weise, wie er sich ausdrückte, erinnerte mich z.B
an Reden Erich Honeckers, wenn er den sowjetischen "Freunden unbedingte Solidarität" schwor.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bestand in der westlichen Welt des Kapitalismus, d.h. nahezu ausnahmslos bei uns allen, das latente Gefühl,
das intelligentere, effizientere, gerechtere System habe den fast 50-jährigen Kampf aus deutlicher Überlegenheit gewonnen.
Die Chinesen oder Inder u.a., obwohl von der Bevölkerungszahl Europa und Amerika weit "überlegen", finden in gleichem Maße wie andere kulturfremde
Nationen ( z.B. Japan, Korea etc) nur wenig Beachtung in unserem gegenwärtigen Bewußtsein.
"Das größte Freiluftgefängnis" der Welt, im Dauerclinch mit Israel seit ich denken kann, ist nur einer von vielen Schwelbränden in der Welt, an den man sich
gewöhnt hat. Dieses Krisengebiet findet gerade nur deshalb Beachtung, weil viele Juden in Amerika nachhaltig Einfluß auf die Politik der USA nehmen
können, und der ganze Konflikt sich eben in der Region abspielt, die den "Treibstoff" für funktionierende Volkswirtschaften dieser Welt "besitzt", Für uns in
der westlichen Welt, mit Ausnahme von Israel, wurde dieser Konflikt aus Gewohnheit in den letzten Jahren zunehmend eher als Ärgernis, das
Börsenkurse maipulieren konnte, als eine Gefahr angesehen. Ernsthafte Konzepte: Fehlanzeige!!!, wie auch in fast allen anderen Krisengebieten der Welt
Israel als "Stachel im Fleisch der arabischen Welt", sehe ich eher als einen Katalysator für ein Problem an, unter dem die gesamte westliche Welt, und eben
allen voran Amerika leidet: das Unverständnis, daß es neben den eigenen Werten und Überzeugungen eben auch noch andere Kulturkreise gibt, die nach
anderen Gesichtpunkten gelebt haben, leben und auch entwicklungsfähig sein können( daß mir jetzt keiner mit Taliban usw kommt !). Und nicht jedes Land
der Welt möchte gerne nach westlichen Maßstäben und Werten leben.
Mir scheint es eben, daß Ignoranz / geistige Untätigkeit "unserer Politiker" auf der einen und Sendungsbewußtsein und Gier auf der anderen Seite, diese
latent in den vergangenen Jahren entstandene (Goldene 90-ziger???) und durch die "Terrorakte" zu Tage getretene, veränderte Situation in der Welt
geschaffen haben.
Diese Vakuum gilt es meines Erachtens schnellstens auf konstruktive Art und Weise zu füllen...... und hierin sehe ich auch den Grund, warum die politisch
und militärisch "Führenden" hinter George Bush noch immer keine Entscheidungen bezüglich kriegerischer Handlung getroffen haben. Es gibt auf diese
neue, veränderte Welt keinen wirkungsvollen Ansatz mit antiquierten Mitteln zu reagieren.
Darüberhinaus habe ich das Gefühl, daß Unsicherheiten innerhalb eines Systems immer dazu führen, daß es sich nach außen stabil darstellen muß, bzw
sich mit unlauteren Mitteln nach innen hin stabilisiert. Letzteres bezeichne ich als als "faschistoiden Kapitalismus": Mitbürger werden durch Konsum
seifenglatt gemacht (Absicht oder Selbstgänger als Teil des Systems???), ganz klar scheint mir allerdings, daß "unsere" Medien in zunehmenden Maße
dazu mißbraucht werden, um letztes selbständiges Denken zu egalisieren.
Leute, steigt mal´auf einen Berg, und guckt ´´mal in´s Tal, um Abstand von der Sache und von Euch selbst zu bekommen. Hier soll nicht der Weltuntergang
prognostiziert werden, dies ist keine antikapitalistische Hetze, erst recht kein Antiamerikanismus im klassischen Sinn, sondern die Aufforderung,
aufmerksam und kritisch den Geschehnissen gegenüberzustehen und sich wirklich eine eigene Meinung zu bilden anstatt die "eigene" Meinung laut ("tu
Gutes und sprich darüber") und chauvinistisch dem anderen überzustülpen: ............. Überzeugungen sind ein größerer Feind der Wahrheit als die Lüge,
das scheint im großen, also (welt)politisch, wie auch im kleinen hier im Sofa ein Teil des Übels zu sein. Klarsicht und neue konstruktive Ansätze werden im
Großen wie auch im Kleinen notwendig sein, um diese weltweite Krise in den Griff zu bekommen
Darüberhaus hätte ich zum "11/09" noch ein paar Fragen. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, daß dieser von der USA geplante Krieg und die vorgesehene "Neuordnung" und Kolonialisierung ( anders kann man es ja nicht bezeichnen!!!!)der Golfregion zu Ihrem Vorteil schon vor der Wahl G.W.Bush´s von dessen Wahlkampf-Sponsoren geplant war.
In diesem Zusammenhang liegt zumindestens nahe, noch einmal sich über den 11/09 unter dieser Prämisse Gedanken zu machen: seit dem 11/09 ist die Aufmerksamkeit der US-Amerikaner von vielen innenpolitischen Vorgängen ( z.B. dem Rückgang des DOW´s von 12000 auf 8000) abgelenkt. Das LAnd wurde zumindestens in dieser Katastrophe vorübergehend "geeint".
Meine Fragen: > es war damals bekannt, daß der Mossad von (diesen) geplanten Anschlägen wußte.
> wieviel Leute arbeiteten gewöhnlich in den Twin Towers um 10:00 am
> Könnte es sein, daß die Vorgänge des 11/09 nicht nur der Startschuß zu dem Projekt NEuordnung der Golfregion gebraucht würde.
Konradi, komm mir bitte nicht mit Paul Spiegel, für den ich mir wünsche, daß er möglichst schnell nach Israel auswandern möge: Deutschland hat im vergangenen Jahr rund 80 000 orthodoxe Juden aus Osteuropa aufgenommen, rund 100 000 Israelis bekamen den Deutschen Paß. Schön wäre es wenn Herr Spiegel auch so etwas mal erwähnen könnte, anstatt prinzipiell die alten Kamellen runterzulabern. Dieser Mann und diese Art, ist für ein zukunftsgerichtetes Zusammenleben von Juden und Nichtjuden(egal in welchem Land) eine Zumutung!!!!
Nein, ich korrigiere mich, ich wäre dafür, daß man Paul Spiegel in´s Exil schickt. Ich hoffe, er liest diese Zeilen
@sitting bull: interessanter Thread von Sig, leider bin ich mit Dir in Bezug auf die Notwendigkeit eines Krieges NICHT einig: Krieg mag u.U. daruas resultieren, aber es ist kein Grund dafür, Probleme nicht konstruktiv, zukunftsgerichtet und ohne Krieg zu klären.
All_Black:
das war nicht meine Meinung, sondern eine allgemeine Erkenntnis von mir über die Notwendigkeit von Krieg.
Natürlich lehne ich das als Mittel zur Aufrechterhaltung von Unterdrückungsstrukturen ( IMO gehts hier um nichts anderes ) ab!
das war nicht meine Meinung, sondern eine allgemeine Erkenntnis von mir über die Notwendigkeit von Krieg.
Natürlich lehne ich das als Mittel zur Aufrechterhaltung von Unterdrückungsstrukturen ( IMO gehts hier um nichts anderes ) ab!
.
Die Spielverderber
Anleger beschimpfen sie als Schwarzmaler, und in der eigenen Bank bekommen sie oft Ärger, weil sie das Geschäft schädigen - Alltag von Analysten, die fallende Kurse vorhersagen.
Als "sensationsgeiler Pessimist" und "Schlechtredner" wurde Nabil Khayat schon beleidigt. Und Susanne Marschner bekam bereits zu hören: "Ich finde es schlimm, dass Sie ihren Unsinn nicht wenigstens für sich behalten." Der Marktstratege bei der privaten Gesellschaft Fondex Vermögensmanagement aus München und die freiberufliche Chartanalystin aus Bad Soden haben eines gemeinsam: Sie gehören seit einiger Zeit zu den Bären an der Börse. Auch aktuell erwarten sie eine weitere Talfahrt an den Aktienmärkten, sehen den Deutschen Aktienmarkt in den nächsten Wochen sogar unter 2 000 Punkten. Mit derartigen Äußerungen machen sie sich mancherorts ziemlich unbeliebt.
Dabei ergeht es Khayat und Marschner nicht anders als anderen Finanzexperten: Börsen-Bären wird oft genug die Hölle heiß gemacht - innerhalb der Bank, wenn sie dort überhaupt Gehör finden, genauso wie von manchen Kunden. "Du lähmst uns mit deinem Pessimismus", steht beispielsweise in einer E-Mail an Khayat als Reaktion auf eine seiner kritischen Kolumnen, die er für den elektronischen Anlegerdienst Wall Street Online geschrieben hat.
Wer sich als Bär an der Börse outet, bekommt sogar oft persönlich Ärger mit dem eigenen Arbeitgeber. Das wissen alle in dem Geschäft, doch die wenigsten unter den Betroffenen wollen den Mund aufmachen. Eine Ausnahme ist da Michael Riesner, Chartanalyst bei der DZ Bank. Er gibt zu: "Nachdem ich im Jahr 2000 negative Prognosen zum Dax und Nemax 50 abgegeben habe, bin ich intern unter Druck geraten." Allgemein werde Analysten nahe gelegt, sich mit extrem negativen Kurszielen zurückzuhalten, diese zumindest nicht nach außen zu geben, berichtet Riesner.
Weit schlimmer ist es Frank Bloch (Name von der Redaktion geändert) ergangen, Analyst in einer anderen Frankfurter Großbank: "Meine Kollegen haben sich völlig von mir zurückgezogen. Mir wurde gesagt, an bestimmten Sitzungen brauchst du gar nicht mehr teilzunehmen." Sie beschimpften mich als "Doktor Doom", als Schwarzmaler, sagt Bloch.
Als er bei einem Nemax-50-Stand von 7 500 Punkten vorausgesagt hatte, das Kursbarometer würde sich mittelfristig mehr als dritteln, bekam er giftige Kommentare von Kollegen wie von Kunden. Bloch: "Sie sagten mir, ich wollte den Neuen Markt gezielt kaputtmachen. Die Leute, die die Party damals gefeiert haben, meinten, ich wollte ihnen nur in die Suppe spucken."
Zum Image des Miesmachers kommt jetzt, nachdem sich seine Prognosen erfüllt haben, auch noch der Neid der Kollegen hinzu. Bloch: "Ich werde oft gefragt, ob ich jetzt Millionär bin - wo ich doch die Talfahrt vorausgesehen habe und meine Anlagestrategie danach hätte ausrichten können." Das Bittere daran: Bloch hat seine Prognosen nicht im großen Stil umgesetzt - "sonst wäre ich jetzt reich", sagt der Enddreißiger mit leicht gedämpfter Stimme.
Ob er wenigstens von seinen Chefs Pluspunkte erhält, weil er Recht hatte? Bloch bringt nur ein schiefes Lächeln zu Stande:
"In der Bank geht es nicht ums Recht haben, sondern ums Geldverdienen." Den Banken ist es vor allem wichtig, ihre guten Kontakte zu den Unternehmen zu wahren, mit denen sie sonst öfter Geschäfte machen, etwa wenn sie die Konzerne bei Kapitalerhöhungen begleiten und anschließend dafür hübsche Provisionen kassieren.
Außerdem kommt es ihnen darauf an, ihre Produkte an den Anleger zu bringen; und die Produkte sind nun einmal überwiegend auf steigende Kurse ausgerichtet. Aus diesen Gründen geben die Analysten, die Research-Berichte veröffentlichen, viel mehr Kauf- als Verkaufsempfehlungen ab. Zum Beispiel raten derzeit 75 Prozent der Analysten, die ein Urteil zu Altana abgeben, zum Kauf, bei Schering liegt der Anteil bei über 65 Prozent; aktuell sind die beiden Werte damit die Spitzenreiter im Deutschen Aktienindex.
Am deutlichen Überhang der Kaufempfehlungen hat sich auch in der Krise nichts geändert; dass die Glaubwürdigkeit der Analysten darunter leidet, ist den Banken offenbar weniger wichtig.
Und auch an dem Zweckoptimismus wird sich so bald nichts ändern. Analyst Khayat bringt es auf den Punkt: Erst wenn hier zu Lande in größerem Stil die Grundlage für Spekulationen à la Baisse geschaffen wird - wenn etwa eine gesetzliche Grundlage für den Vertrieb von oft auch an fallenden Kursen prächtig verdienenden Hedge-Funds besteht -, könnten Statements von Bären als Verkaufsargumente gelten. Khayat: "Dann könnten auch die Bären an der Börse mehr Gehör finden - und das Image des Spielverderbers loswerden."
Kathrin Quandt, Handelsblatt 13.02.2003
.
Die Spielverderber
Anleger beschimpfen sie als Schwarzmaler, und in der eigenen Bank bekommen sie oft Ärger, weil sie das Geschäft schädigen - Alltag von Analysten, die fallende Kurse vorhersagen.
Als "sensationsgeiler Pessimist" und "Schlechtredner" wurde Nabil Khayat schon beleidigt. Und Susanne Marschner bekam bereits zu hören: "Ich finde es schlimm, dass Sie ihren Unsinn nicht wenigstens für sich behalten." Der Marktstratege bei der privaten Gesellschaft Fondex Vermögensmanagement aus München und die freiberufliche Chartanalystin aus Bad Soden haben eines gemeinsam: Sie gehören seit einiger Zeit zu den Bären an der Börse. Auch aktuell erwarten sie eine weitere Talfahrt an den Aktienmärkten, sehen den Deutschen Aktienmarkt in den nächsten Wochen sogar unter 2 000 Punkten. Mit derartigen Äußerungen machen sie sich mancherorts ziemlich unbeliebt.
Dabei ergeht es Khayat und Marschner nicht anders als anderen Finanzexperten: Börsen-Bären wird oft genug die Hölle heiß gemacht - innerhalb der Bank, wenn sie dort überhaupt Gehör finden, genauso wie von manchen Kunden. "Du lähmst uns mit deinem Pessimismus", steht beispielsweise in einer E-Mail an Khayat als Reaktion auf eine seiner kritischen Kolumnen, die er für den elektronischen Anlegerdienst Wall Street Online geschrieben hat.
Wer sich als Bär an der Börse outet, bekommt sogar oft persönlich Ärger mit dem eigenen Arbeitgeber. Das wissen alle in dem Geschäft, doch die wenigsten unter den Betroffenen wollen den Mund aufmachen. Eine Ausnahme ist da Michael Riesner, Chartanalyst bei der DZ Bank. Er gibt zu: "Nachdem ich im Jahr 2000 negative Prognosen zum Dax und Nemax 50 abgegeben habe, bin ich intern unter Druck geraten." Allgemein werde Analysten nahe gelegt, sich mit extrem negativen Kurszielen zurückzuhalten, diese zumindest nicht nach außen zu geben, berichtet Riesner.
Weit schlimmer ist es Frank Bloch (Name von der Redaktion geändert) ergangen, Analyst in einer anderen Frankfurter Großbank: "Meine Kollegen haben sich völlig von mir zurückgezogen. Mir wurde gesagt, an bestimmten Sitzungen brauchst du gar nicht mehr teilzunehmen." Sie beschimpften mich als "Doktor Doom", als Schwarzmaler, sagt Bloch.
Als er bei einem Nemax-50-Stand von 7 500 Punkten vorausgesagt hatte, das Kursbarometer würde sich mittelfristig mehr als dritteln, bekam er giftige Kommentare von Kollegen wie von Kunden. Bloch: "Sie sagten mir, ich wollte den Neuen Markt gezielt kaputtmachen. Die Leute, die die Party damals gefeiert haben, meinten, ich wollte ihnen nur in die Suppe spucken."
Zum Image des Miesmachers kommt jetzt, nachdem sich seine Prognosen erfüllt haben, auch noch der Neid der Kollegen hinzu. Bloch: "Ich werde oft gefragt, ob ich jetzt Millionär bin - wo ich doch die Talfahrt vorausgesehen habe und meine Anlagestrategie danach hätte ausrichten können." Das Bittere daran: Bloch hat seine Prognosen nicht im großen Stil umgesetzt - "sonst wäre ich jetzt reich", sagt der Enddreißiger mit leicht gedämpfter Stimme.
Ob er wenigstens von seinen Chefs Pluspunkte erhält, weil er Recht hatte? Bloch bringt nur ein schiefes Lächeln zu Stande:
"In der Bank geht es nicht ums Recht haben, sondern ums Geldverdienen." Den Banken ist es vor allem wichtig, ihre guten Kontakte zu den Unternehmen zu wahren, mit denen sie sonst öfter Geschäfte machen, etwa wenn sie die Konzerne bei Kapitalerhöhungen begleiten und anschließend dafür hübsche Provisionen kassieren.
Außerdem kommt es ihnen darauf an, ihre Produkte an den Anleger zu bringen; und die Produkte sind nun einmal überwiegend auf steigende Kurse ausgerichtet. Aus diesen Gründen geben die Analysten, die Research-Berichte veröffentlichen, viel mehr Kauf- als Verkaufsempfehlungen ab. Zum Beispiel raten derzeit 75 Prozent der Analysten, die ein Urteil zu Altana abgeben, zum Kauf, bei Schering liegt der Anteil bei über 65 Prozent; aktuell sind die beiden Werte damit die Spitzenreiter im Deutschen Aktienindex.
Am deutlichen Überhang der Kaufempfehlungen hat sich auch in der Krise nichts geändert; dass die Glaubwürdigkeit der Analysten darunter leidet, ist den Banken offenbar weniger wichtig.
Und auch an dem Zweckoptimismus wird sich so bald nichts ändern. Analyst Khayat bringt es auf den Punkt: Erst wenn hier zu Lande in größerem Stil die Grundlage für Spekulationen à la Baisse geschaffen wird - wenn etwa eine gesetzliche Grundlage für den Vertrieb von oft auch an fallenden Kursen prächtig verdienenden Hedge-Funds besteht -, könnten Statements von Bären als Verkaufsargumente gelten. Khayat: "Dann könnten auch die Bären an der Börse mehr Gehör finden - und das Image des Spielverderbers loswerden."
Kathrin Quandt, Handelsblatt 13.02.2003
.
Dummes Geschwätz von dieser Tante. Die Produkte sind schon längst da, niemand braucht undurchsichtige Hedgefonds, wo man sein Geld abliefert und dann nur hoffen kann, das vielleicht mehr daraus wird.
Beispiele aus meinem Portfolio gefällig ?
722206
722199
Das ist keine Anlageempfehlung !
Aber ansehen, verstehen, wenn nix capice, dann Finger weg.
Kurzbeschreibung: man verdient an fallenden Kursen und vice versa.
CU Jodie
Beispiele aus meinem Portfolio gefällig ?
722206
722199
Das ist keine Anlageempfehlung !
Aber ansehen, verstehen, wenn nix capice, dann Finger weg.
Kurzbeschreibung: man verdient an fallenden Kursen und vice versa.
CU Jodie
.
Warten auf Amerika
Die Iraker haben es verdient, dass ein Befreiungskrieg für sie geführt wird
von Hussain Al-Mozany
In den südlichen Gebieten Iraks pflegen die Menschen einen interessanten Ritus: Wenn sie ein Grundstück erwerben oder um die Hand eines Mädchens anhalten wollen, dann nicht nur für sich selbst, sondern zum Nutzen oder zur Ehre des ganzen Stammes. Sprechen sie nun in einer solchen Angelegenheit bei einem anderen Stamm vor, so reden sie über alles mögliche – nur nicht über das eigentliche Anliegen. Es wird nur mit Anspielungen auf die erfragte Angelegenheit hingedeutet, aber sie wird nie direkt zum Ausdruck gebracht; dies würde ja bedeuten, dass man dem Gesprächspartner unterstellt, er habe das Nichtgesagte missverstanden. Noch wichtiger ist es, den Gesprächspartner nicht unter Zugzwang oder einer ablehnenden Entscheidung gegenüber zu stellen.
Überträgt man diese Verhandlungskunst auf die weltweit entflammte Diskussion um die Irakfrage und den drohenden Krieg, so muss man feststellen: Die Angelegenheit erscheint um so verschachtelter und mysteriöser, je länger man darüber redet. Die Beteiligten und – schlimmer noch – die Nichtbeteiligten verbreiten Nebel um sich und stiften Wirrwarr. In diesem nebulösen Umfeld bahnt sich zielgerichtet die amerikanische und britische Armada gemächlich ihren Weg durch die Gewässer, um endlich den Schurken Saddam Hussein und seine Gefolgsleute zu ergreifen und zu beseitigen.
Zwölf Jahre lang sprach der Weltsicherheitsrat über die Abrüstung Iraks und die Vernichtung seiner Massenvernichtungswaffen, an deren Ende die Aufhebung der Sanktionen stehen würden. Beides wurde nicht erfüllt.
Was aber ununterbrochen und systematisch vor den Augen der Weltöffentlichkeit vor sich geht, ist die komplette Verwüstung des Landes und das Quälen seiner Menschen aufgrund verheerender doppelter Strafmaßnahmen – vom UNO-Sicherheitsrat einerseits und von Saddams Schergen andererseits. Das stillschweigende Hinschauen auf eine Katastrophe, die die älteste Kulturnation und eines der reichsten Länder dieser Erde heimsucht, kann man nur als Voyeurismus bezeichnen: als reine Lust am Zusehen der Tragödie der anderen.
Eine Welt, die es nicht fertig gebracht hat, einen millionenfachen Massenmörder aus dem Verkehr zu ziehen, die es trotz unzähliger Gelegenheiten nicht vermochte, eine rechtsstaatliche Ordnung zu errichten, die nicht einmal den richtigen Umgang mit einem Ungeheuer findet, das seine Schwiegersöhne und Enkel umbringt, sollte sich langsam Gedanken über die Rettung eines sterbenden Volkes machen.
Manche demokratische Staaten leisten ungewollt – vielleicht auch unreflektiert – politische und geistige Hilfe für Saddam. Ein blutiger Herrscher, dem es immer wieder gelang, die Welt zu spalten und aus der inneren Dynamik der westlichen Demokratien Vorteile und Überlebenschancen für sich zu herauszuschlagen, der sich die Großzügigkeit der Demokraten zunutze machte, um sein Volk hungern zu lassen, der es zu einem kollektiven Hungerkünstler im kafkaschen Sinne degradierte, fühlt sich noch sicherer und stärker innerhalb dieser bezeichnenden Teilnahmslosigkeit.
Saddam durfte Länder überfallen, Menschen aus rein rassistischen Gründen vertreiben, chemische Waffen einsetzen, spektakuläre – nach Saddams Sprachgebrauch: „demokratische“ – Exekutionen durchführen, an denen der gesamte Parteikader teilnahm, er durfte die Umwelt verseuchen, die ganze Region terrorisieren, die demokratische Weltordnung herausfordern, ja ihr sogar drohen, den fanatischen, religiös motivierten Gruppen den Nährboden bereiten – und doch kam er immer wieder ungeschoren davon, eben Dank der „nicht beabsichtigten“ Unterstützung demokratischer Staatsmänner.
Und jeder hat seinen Einwand parat: Man will kein Risiko eingehen. Wenn man interveniere, würde das Land, dessen Grenzen die Briten und nicht der Völkerbund festgelegt hatten, auseinanderfallen und ein neuer Diktator oder gar ein Schiit an seine Stelle rücken. Die Amerikaner schauten lediglich auf das für ihren motorisierten Lebensstil unentbehrliche Öl, sie hätten nichts anderes im Sinn als ihre geopolitischen Interessen, einschließlich der Sicherheit Israels. Die Opposition sei schwach, zerstritten, argumentiert man, aus diesen Gründen verbiete sich logischerweise ein Eingreifen. Die Iraker sollten ihre Sache lieber selber regeln.
Doch im Eifer der Argumentation vergessen die plötzlich aus dem Boden gestampften Pazifisten eine entscheidende Tatsache: Im Irak wüten die schlimmsten Sanktionen, welche die Vereinten Nationen jemals verhängt haben. Es handelt sich um eine vom höchsten internationalen Gremium legitimierte kollektive Bestrafung. Niemand wollte die Folgen dieser Maßnahmen auf sich nehmen. Wie dem auch immer sei: an dieser aussichtslosen Lage sind zwei Parteien beteiligt, ein entschlossener Saddam Hussein und der gespaltene Weltsicherheitsrat. Während der eine ausschließlich um seinen Kopf fürchtet, versucht die andere Seite mit Ausreden, diesen Kopf zu schonen. Dabei wäre es selbst bei einem normalen Verbrechen absurd, wenn man dem Mörder die Tatwaffe abnähme, ihn selbst aber freiließe.
Saddam war lange Zeit vor den Sanktionen Großverbrecher. Amerikaner und Europäer haben seine Taten ungeahndet hingenommen; sie haben ihm in seinem Krieg gegen den Iran sogar Hilfe geleistet. Die Geschichte wird ihnen diese mangelnde Courage und fehlende menschliche Solidarität nie verzeihen. Deshalb darf das auf der Basis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vereinigte Europa nicht noch einmal den verheerende Fehler begehen, einem blutigen Herrscher freie Hand zu lassen, ihm zu ermöglichen, unschuldige irakische Menschen zu schlachten, die Nachbarländer zu terrorisieren und die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Jede Sekunde im Leben der Bagdader Herrschaft bedeutet weiteres Elend für die Iraker und mehr Unsicherheit für die Welt.
Maßstab einer Völkergemeinschaft, die diesen Namen wirklich verdiente, ist es nicht allein, die Massenvernichtungsmittel eines Landes zu vernichten; sie muss die Verursacher dieses Übels ächten, isolieren und bekämpfen. Sie darf nur jenen Staaten eine Chance gewähren, die im eigenen Land die Menschenrechte achten. Nicht nur Paragraphen und Resolutionen sind wichtig (auch nicht die vom UNO-Sicherheitsrat beschlossenen), sondern auch der Gerechtigkeitssinn der Völkergemeinschaft.
Denn den Irakern macht es keine Freude, jedes Mal mit anzuschauen, wie Saddam diese Resolutionen aus purem Überlebensinstinkt tüchtig unterschreibt, damit die Waffeninspekteure, die ja inzwischen zu makabren Weltstars avanciert sind, nach verbotenen Waffen suchen – während sie dafür mit ihrem eigenen Brot und eigener Medizin bezahlen.
Sie wollen eine Lösung, eine endgültige Entscheidung. Eine von Kriegen, Angst und Hunger gemarterte Bevölkerung mit der höchsten Kindersterblichkeit der Welt erwartet von der freien Welt ein gewisses Erbarmen, auch wenn dieses Wort viel von seiner Originalität eingebüßt hat. Die Deutschen müssen dabei wenigstens einen humanitären Beitrag leisten: nicht indem sie sich zu den amerikanischen Plänen querstellen, sondern indem sie den alltäglichen Krieg Saddams gegen die eigene Bevölkerung stoppen. Denn nur darauf kommt es an.
Die meisten hier in Deutschland vorgetragenen Argumente, die gegen eine militärische Intervention im Irak sprechen, sind leider hinfällig – trotz der guten Absichten, die dahinter stecken mögen. Die irakische Führung unter Saddam hat alles getan, um das Land schließlich vor diese einzige Möglichkeit zu stellen: den militärischen Einsatz.
Sie hält sich an kein internationales Abkommen, sie hat die Souveränität des Landes preisgegeben und de facto die Teilung des Landes in einen kurdischen und einen arabischen Staat ermöglicht, die konfessionelle Spaltung wiederbelebt, den Terror gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen wie die Schiiten, aber auch missliebige Militärangehörige betrieben und zuletzt den verbalen Krieg dahin gesteigert, dass der irakische Vizepräsident ganz offen davon spricht, Selbstmordkommandos nach palästinensischem Muster zu organisieren. Diese Auseinandersetzungen nahmen nun die Amerikaner zum Anlass, den bevorstehenden Krieg noch konsequenter durchsetzen zu wollen.
Jetzt spricht Condoleezza Rice offen davon, den Irak nach dem Sturz Saddams unter direkte amerikanische Militärverwaltung zu stellen. Und genau diese Provokation beabsichtigt der irakische Despot.
In diesem Durcheinander sind keine klaren Positionen der Kriegsgegner zu erkennen, obwohl sie gerade jetzt gefragt sind, mäßigend auf die amerikanische Intervention zu wirken – vor allem in der Frage von Saddams Nachfolger.
Wenn die Iraker auch mit einem kurzen Militäreinsatz zum Sturz des „irakischen Revolutionsrates“ einverstanden wären, wird man doch keinen einzigen Iraker finden, der das Land unter der Obhut amerikanischer Gewalt sehen will – es sei denn für eine Übergangszeit.
Die einzige Vision, die von der Mehrheit der irakischen Bevölkerung halbwegs akzeptiert werden kann, ist die, dass man den Irak unter ein direktes UNO-Mandat stellt, mit der Aussicht, gezielt und behutsam einen demokratischen Prozess einzuleiten, an dessen Ende eine gewählte irakische Regierung stehen wird.
Die Amerikaner haben oft bewiesen, dass gewaltsame Demokratisierung möglich ist. Man muss endlich über die Tragödie der Menschen im Irak sprechen. Wenn die Entschlossenheit der Amerikaner und ihrer Verbündeten auch reichlich spät kommt, lohnt es sich dennoch, dass man sich dafür einsetzt, das Elend der Iraker ein für allemal zu beenden, ihnen die Freiheit zu geben und sie in die Völkergemeinschaft zurückzuführen.
.
Warten auf Amerika
Die Iraker haben es verdient, dass ein Befreiungskrieg für sie geführt wird
von Hussain Al-Mozany
In den südlichen Gebieten Iraks pflegen die Menschen einen interessanten Ritus: Wenn sie ein Grundstück erwerben oder um die Hand eines Mädchens anhalten wollen, dann nicht nur für sich selbst, sondern zum Nutzen oder zur Ehre des ganzen Stammes. Sprechen sie nun in einer solchen Angelegenheit bei einem anderen Stamm vor, so reden sie über alles mögliche – nur nicht über das eigentliche Anliegen. Es wird nur mit Anspielungen auf die erfragte Angelegenheit hingedeutet, aber sie wird nie direkt zum Ausdruck gebracht; dies würde ja bedeuten, dass man dem Gesprächspartner unterstellt, er habe das Nichtgesagte missverstanden. Noch wichtiger ist es, den Gesprächspartner nicht unter Zugzwang oder einer ablehnenden Entscheidung gegenüber zu stellen.
Überträgt man diese Verhandlungskunst auf die weltweit entflammte Diskussion um die Irakfrage und den drohenden Krieg, so muss man feststellen: Die Angelegenheit erscheint um so verschachtelter und mysteriöser, je länger man darüber redet. Die Beteiligten und – schlimmer noch – die Nichtbeteiligten verbreiten Nebel um sich und stiften Wirrwarr. In diesem nebulösen Umfeld bahnt sich zielgerichtet die amerikanische und britische Armada gemächlich ihren Weg durch die Gewässer, um endlich den Schurken Saddam Hussein und seine Gefolgsleute zu ergreifen und zu beseitigen.
Zwölf Jahre lang sprach der Weltsicherheitsrat über die Abrüstung Iraks und die Vernichtung seiner Massenvernichtungswaffen, an deren Ende die Aufhebung der Sanktionen stehen würden. Beides wurde nicht erfüllt.
Was aber ununterbrochen und systematisch vor den Augen der Weltöffentlichkeit vor sich geht, ist die komplette Verwüstung des Landes und das Quälen seiner Menschen aufgrund verheerender doppelter Strafmaßnahmen – vom UNO-Sicherheitsrat einerseits und von Saddams Schergen andererseits. Das stillschweigende Hinschauen auf eine Katastrophe, die die älteste Kulturnation und eines der reichsten Länder dieser Erde heimsucht, kann man nur als Voyeurismus bezeichnen: als reine Lust am Zusehen der Tragödie der anderen.
Eine Welt, die es nicht fertig gebracht hat, einen millionenfachen Massenmörder aus dem Verkehr zu ziehen, die es trotz unzähliger Gelegenheiten nicht vermochte, eine rechtsstaatliche Ordnung zu errichten, die nicht einmal den richtigen Umgang mit einem Ungeheuer findet, das seine Schwiegersöhne und Enkel umbringt, sollte sich langsam Gedanken über die Rettung eines sterbenden Volkes machen.
Manche demokratische Staaten leisten ungewollt – vielleicht auch unreflektiert – politische und geistige Hilfe für Saddam. Ein blutiger Herrscher, dem es immer wieder gelang, die Welt zu spalten und aus der inneren Dynamik der westlichen Demokratien Vorteile und Überlebenschancen für sich zu herauszuschlagen, der sich die Großzügigkeit der Demokraten zunutze machte, um sein Volk hungern zu lassen, der es zu einem kollektiven Hungerkünstler im kafkaschen Sinne degradierte, fühlt sich noch sicherer und stärker innerhalb dieser bezeichnenden Teilnahmslosigkeit.
Saddam durfte Länder überfallen, Menschen aus rein rassistischen Gründen vertreiben, chemische Waffen einsetzen, spektakuläre – nach Saddams Sprachgebrauch: „demokratische“ – Exekutionen durchführen, an denen der gesamte Parteikader teilnahm, er durfte die Umwelt verseuchen, die ganze Region terrorisieren, die demokratische Weltordnung herausfordern, ja ihr sogar drohen, den fanatischen, religiös motivierten Gruppen den Nährboden bereiten – und doch kam er immer wieder ungeschoren davon, eben Dank der „nicht beabsichtigten“ Unterstützung demokratischer Staatsmänner.
Und jeder hat seinen Einwand parat: Man will kein Risiko eingehen. Wenn man interveniere, würde das Land, dessen Grenzen die Briten und nicht der Völkerbund festgelegt hatten, auseinanderfallen und ein neuer Diktator oder gar ein Schiit an seine Stelle rücken. Die Amerikaner schauten lediglich auf das für ihren motorisierten Lebensstil unentbehrliche Öl, sie hätten nichts anderes im Sinn als ihre geopolitischen Interessen, einschließlich der Sicherheit Israels. Die Opposition sei schwach, zerstritten, argumentiert man, aus diesen Gründen verbiete sich logischerweise ein Eingreifen. Die Iraker sollten ihre Sache lieber selber regeln.
Doch im Eifer der Argumentation vergessen die plötzlich aus dem Boden gestampften Pazifisten eine entscheidende Tatsache: Im Irak wüten die schlimmsten Sanktionen, welche die Vereinten Nationen jemals verhängt haben. Es handelt sich um eine vom höchsten internationalen Gremium legitimierte kollektive Bestrafung. Niemand wollte die Folgen dieser Maßnahmen auf sich nehmen. Wie dem auch immer sei: an dieser aussichtslosen Lage sind zwei Parteien beteiligt, ein entschlossener Saddam Hussein und der gespaltene Weltsicherheitsrat. Während der eine ausschließlich um seinen Kopf fürchtet, versucht die andere Seite mit Ausreden, diesen Kopf zu schonen. Dabei wäre es selbst bei einem normalen Verbrechen absurd, wenn man dem Mörder die Tatwaffe abnähme, ihn selbst aber freiließe.
Saddam war lange Zeit vor den Sanktionen Großverbrecher. Amerikaner und Europäer haben seine Taten ungeahndet hingenommen; sie haben ihm in seinem Krieg gegen den Iran sogar Hilfe geleistet. Die Geschichte wird ihnen diese mangelnde Courage und fehlende menschliche Solidarität nie verzeihen. Deshalb darf das auf der Basis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vereinigte Europa nicht noch einmal den verheerende Fehler begehen, einem blutigen Herrscher freie Hand zu lassen, ihm zu ermöglichen, unschuldige irakische Menschen zu schlachten, die Nachbarländer zu terrorisieren und die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Jede Sekunde im Leben der Bagdader Herrschaft bedeutet weiteres Elend für die Iraker und mehr Unsicherheit für die Welt.
Maßstab einer Völkergemeinschaft, die diesen Namen wirklich verdiente, ist es nicht allein, die Massenvernichtungsmittel eines Landes zu vernichten; sie muss die Verursacher dieses Übels ächten, isolieren und bekämpfen. Sie darf nur jenen Staaten eine Chance gewähren, die im eigenen Land die Menschenrechte achten. Nicht nur Paragraphen und Resolutionen sind wichtig (auch nicht die vom UNO-Sicherheitsrat beschlossenen), sondern auch der Gerechtigkeitssinn der Völkergemeinschaft.
Denn den Irakern macht es keine Freude, jedes Mal mit anzuschauen, wie Saddam diese Resolutionen aus purem Überlebensinstinkt tüchtig unterschreibt, damit die Waffeninspekteure, die ja inzwischen zu makabren Weltstars avanciert sind, nach verbotenen Waffen suchen – während sie dafür mit ihrem eigenen Brot und eigener Medizin bezahlen.
Sie wollen eine Lösung, eine endgültige Entscheidung. Eine von Kriegen, Angst und Hunger gemarterte Bevölkerung mit der höchsten Kindersterblichkeit der Welt erwartet von der freien Welt ein gewisses Erbarmen, auch wenn dieses Wort viel von seiner Originalität eingebüßt hat. Die Deutschen müssen dabei wenigstens einen humanitären Beitrag leisten: nicht indem sie sich zu den amerikanischen Plänen querstellen, sondern indem sie den alltäglichen Krieg Saddams gegen die eigene Bevölkerung stoppen. Denn nur darauf kommt es an.
Die meisten hier in Deutschland vorgetragenen Argumente, die gegen eine militärische Intervention im Irak sprechen, sind leider hinfällig – trotz der guten Absichten, die dahinter stecken mögen. Die irakische Führung unter Saddam hat alles getan, um das Land schließlich vor diese einzige Möglichkeit zu stellen: den militärischen Einsatz.
Sie hält sich an kein internationales Abkommen, sie hat die Souveränität des Landes preisgegeben und de facto die Teilung des Landes in einen kurdischen und einen arabischen Staat ermöglicht, die konfessionelle Spaltung wiederbelebt, den Terror gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen wie die Schiiten, aber auch missliebige Militärangehörige betrieben und zuletzt den verbalen Krieg dahin gesteigert, dass der irakische Vizepräsident ganz offen davon spricht, Selbstmordkommandos nach palästinensischem Muster zu organisieren. Diese Auseinandersetzungen nahmen nun die Amerikaner zum Anlass, den bevorstehenden Krieg noch konsequenter durchsetzen zu wollen.
Jetzt spricht Condoleezza Rice offen davon, den Irak nach dem Sturz Saddams unter direkte amerikanische Militärverwaltung zu stellen. Und genau diese Provokation beabsichtigt der irakische Despot.
In diesem Durcheinander sind keine klaren Positionen der Kriegsgegner zu erkennen, obwohl sie gerade jetzt gefragt sind, mäßigend auf die amerikanische Intervention zu wirken – vor allem in der Frage von Saddams Nachfolger.
Wenn die Iraker auch mit einem kurzen Militäreinsatz zum Sturz des „irakischen Revolutionsrates“ einverstanden wären, wird man doch keinen einzigen Iraker finden, der das Land unter der Obhut amerikanischer Gewalt sehen will – es sei denn für eine Übergangszeit.
Die einzige Vision, die von der Mehrheit der irakischen Bevölkerung halbwegs akzeptiert werden kann, ist die, dass man den Irak unter ein direktes UNO-Mandat stellt, mit der Aussicht, gezielt und behutsam einen demokratischen Prozess einzuleiten, an dessen Ende eine gewählte irakische Regierung stehen wird.
Die Amerikaner haben oft bewiesen, dass gewaltsame Demokratisierung möglich ist. Man muss endlich über die Tragödie der Menschen im Irak sprechen. Wenn die Entschlossenheit der Amerikaner und ihrer Verbündeten auch reichlich spät kommt, lohnt es sich dennoch, dass man sich dafür einsetzt, das Elend der Iraker ein für allemal zu beenden, ihnen die Freiheit zu geben und sie in die Völkergemeinschaft zurückzuführen.
.
Mir kommen fast dir Tränen, welch ehrenrührige Motive die Amerikaner doch auf einmal haben sollen!
Während man früher alles dem Roll-back zuordnen konnte, und demtsprechend natürlich jedes Mittel recht war,
dem Kommunismus weltweit zu bekämpfen, hat doch die neue Bush-Doktrin erst die weitere Richung vorgeben:
Präemptivschläge
Deswegen kann nicht nur ich das kaum glauben,
es ist wirklich ein bizarrer Zufall, dass man sich erst ernsthaft für einen demokratisierungsprozeß dort einsetzt,
nachdem der andere große Feind sich in Luft aufgelöst hat,
und wir unbedingt einen neuen brauchten, um die amerikanische Kriegsmaschinerie am laufen zu halten...
Während man früher alles dem Roll-back zuordnen konnte, und demtsprechend natürlich jedes Mittel recht war,
dem Kommunismus weltweit zu bekämpfen, hat doch die neue Bush-Doktrin erst die weitere Richung vorgeben:
Präemptivschläge

Deswegen kann nicht nur ich das kaum glauben,
es ist wirklich ein bizarrer Zufall, dass man sich erst ernsthaft für einen demokratisierungsprozeß dort einsetzt,
nachdem der andere große Feind sich in Luft aufgelöst hat,
und wir unbedingt einen neuen brauchten, um die amerikanische Kriegsmaschinerie am laufen zu halten...
.
Interview mit dem irakischen Schriftsteller Al-Mozany
"Es grenzt an Schizophrenie"
Während sich die Vereinigten Staaten und die UNO streiten, wie sie mit Saddams Regime verfahren sollen, sterben im Irak Menschen durch Hinrichtung und Unterernährung. Für den Kölner Schriftsteller Hussain Al-Mozany, der 1978 aus Bagdad floh und seit zwölf Jahren deutscher Staatsbürger ist, gibt es nur eine Lösung: Saddam stürzen.
ZDFonline: Tagtäglich berichten die Medien über den drohenden Militärschlag im Irak und über die Diskussionen zwischen USA und UNO. Was geht Ihnen als ehemaliger irakischer Staatsbürger, der selbst Verwandte in Bagdad hat, in diesen Tagen durch den Kopf?
Hussain Al-Mozany: Im Laufe der letzten zwölf Jahre haben sich die USA in ihren Entscheidungen verselbstständigt. Was mir ununterbrochen durch den Kopf geht, ist die Tatsache, dass niemand das Schicksal des irakischen Volkes berücksichtigt. Ich denke primär an die Menschen. Weder die UNO, die Amerikaner noch die Europäer haben sich darüber Gedanken gemacht, wie es mit dem irakischen Volk weitergehen soll. Man hat dem Regime von Massenmördern an der Spitze der irakischen Regierung seit 30 Jahren freie Hand gelassen und sie nicht verpflichtet, die Menschenrechte zu achten.
ZDFonline: Das Leben der Menschen im Irak hat sich unter den Wirtschaftssanktionen in den vergangenen elf Jahren dramatisch verschlechtert. Ist der Ansatz, die Abrüstungsdiskussion mit einem Embargo zu verknüpfen, fehlgeschlagen?
Hussain Al-Mozany: Es war abzusehen, dass sich Saddam Hussein nicht an die UNO-Resolutionen hält. Es war ein Riesenfehler, dem irakischen Regime zu vertrauen. Die Lebensmittel der UNO müssen von den Häfen 1500 Kilometer weit transportiert werden, landen erst in Bagdad und werden von dort zentral verteilt. Die UNO hat darüber keine Kontrolle. Die Resultate sind miserabel. Im Laufe der Sanktionen sind schätzungsweise eine halbe Million Kinder ums Leben gekommen.
Die Sanktionen haben Saddam sogar genützt. Als es unmittelbar nach dem Zweiten Golfkrieg einen riesigen Volksaufstand gab, konnte er die Sanktionen als zusätzliche Strafe gegen die Aufständischen verwenden. Saddam hat den Süden des Iraks, die siebentausend Jahre alten Kulturstätten der Menschheit, wo Schrift, Kunst und Literatur erfunden worden sind, regelrecht gestraft.
ZDFonline: Warum hat die US-Armee ihrer Meinung nach die Auflehnung der inländischen Gruppen nicht unterstützt und schon damals dazu genutzt, das Regime unter Saddam zu stürzen?
Hussain Al-Mozany: Dafür gibt es drei wichtige Gründe. Die Aufständischen haben zu emotional reagiert. Es gab Übergriffe und Morde aus Rache, die nicht zu rechtfertigen sind. Außerdem waren sie nicht organisiert. Das Regime konnte die Aufständischen und Oppositionellen schnell verhaften und beseitigen.
Zweitens konnten sich die Amerikaner schon damals nicht leisten, einen starken, schiitisch dominierten Iran zu dulden und zusätzlich die schiitische Mehrheit im Irak zu stärken. Es entstünde ein unberechenbarer Block, von dem der Funke auf andere arabische Staaten mit schiitischen Minderheiten übergreifen könnte. Drittens hat die USA die schiitischen Führung abgetastet und falsche Signale empfangen. Die Schiiten beharrten darauf, dass das Öl allein Sache des irakischen Volkes sei. Außerdem schlugen sie harte Töne gegenüber Israel an.
ZDFonline: Ist die Gefahr, die vom Irak ausgeht, wirklich so groß, dass sie einen "Präventivschlag" der USA mit oder ohne UNO rechtfertigen würde?
Hussain Al-Mozany: Ich bin mir sicher, dass die Armee von Luxemburg die irakische Armee besiegen könnte. Das ist keine Behauptung, sondern eine Tatsache. Der Irak hat es nie geschafft, ein einziges Flugzeug der Amerikaner oder der Briten abzuschießen, obwohl die Bombardements seit zwölf Jahren weitergehen. Inzwischen ist die irakische Armee zerstritten, zerfallen und im Grunde führungslos.
Die Übergriffe des Iraks in den vergangenen Jahren waren nie mehr als Abschreckungstaktik. Saddams Strategie ist jedoch fehlgeschlagen, weil die Amerikaner die Gefahr für ihre Zwecke hochstilisieren. Man sorgt sich also um ein kleines und fast unbedeutendes Land, während sich niemand daran gestört hat, als die Sowjetunion in teilweise gigantische Atommächte zerfallen ist. Das ist Heuchelei. Es beweist, dass die Politiker vom Irak keine Ahnung haben. Und es grenzt an Schizophrenie: Man sieht ein Volk seit 30 Jahren leiden und tut nichts.
ZDFonline: Wie stark steht die irakische Bevölkerung hinter Saddam Hussein, auch im Falle eines Militärschlags?
Hussain Al-Mozany: Der südliche Teil Iraks, mehrheitlich schiitisch, steht nicht hinter Saddam Hussein. Und selbst die sunnitische Minderheit ist nicht mit ihm zufrieden. In seinem eigenen Haus gibt es Widerstand. Wir haben ja alle gesehen, wie Saddam seine beiden Schwiegersöhne auf bestialische Weise umgebracht hat. Die gängige Herrschaftsmethode besteht aus Gelüsten, Menschen umzubringen.
Saddam ist eine Person der Geheimdienste, des Versteckspiels und der Angst. Seine Partei funktioniert nach dem Strickmuster des Nationalsozialismus, aber primitiver Prägung. Die Ziele, die Bush in seiner Rede vor der UNO genannt hat, sind den Irakern recht. Auch sie wollen die Massenvernichtungsmittel loswerden, denn Giftgase sind gegen sie selbst eingesetzt worden.
ZDFonline: Der Irak steht seit mehr als 30 Jahren unter der Herrschaft der Baath-Partei und befindet sich seither mehr oder weniger ununterbrochen im Krieg. Welche Chancen hat so ein Land zum Aufbau einer Zivilgesellschaft und zur Demokratisierung?
Hussain Al-Mozany: Demokratie ist ein erstrebenswertes Ziel, aber problematisch. Für Demokratie muss die Infrastruktur stimmen. Es muss zwischen allen gegensätzlichen Gruppierungen einer Gesellschaft ein Grundkonsens bestehen. Demokratie ist für Deutschland mit all seinen verschiedenen Interessen unentbehrlich. Im Irak müssen wir aber erst die Schäden beseitigen
Saddam hat zwei Millionen Menschen umgebracht. Die psychische Belastung des irakischen Volkes unter dem Terror und den Sanktionen ist enorm. Die Menschen sind nicht in der Lage, politisch zu denken. Wie man in Deutschland sagt: Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Die Leute müssen erst zufrieden gestellt werden, damit der Irak schrittweise aufgebaut werden kann genauso wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke an die Worte des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, der sagte: "Wir sind befreit und vernichtet in einem."
ZDFonline: Was für alternative Wege gibt es zum Regimesturz von außen?
Hussain Al-Mozany: Bei einem unheilbar kranken Tier hilft nichts, außer es einzuschläfern. Krieg ist dennoch nicht die einzige Möglichkeit. Menschen aus dem Umfeld Saddams könnten ihn beseitigen. Ich plädiere nicht dafür, Saddam umzubringen. Grundsätzlich bin ich Pazifist. Er soll festgenommen und wie Milosevic nach Den Haag gebracht werden.
Entscheidend ist, dass die Völkergemeinschaft funktioniert. Die Völker dürfen nicht zusehen, wie ein anderes Volk von einem verrückten Herrscher geschlachtet wird. Ziel muss sein, Saddam zu stürzen. Die Sanktionen müssen aufgehoben werden, damit sich das Land öffnen kann. Die demokratischen Kräfte im Irak müssen unterstützt werden. Sie haben es schwer, sich gegen das religiöse Potential im Irak durchzusetzen, da es keinen dynamischen Prozess, keinen Meinungsaustausch gibt. Weil sich die religiös motivierten Gruppen auf Gott oder einen Propheten berufen, bringen sie sofort das gesamte Volk hinter sich. Sie haben es leichter, die Menschen zu mobilisieren als die Laizisten.
ZDFonline: Wer soll nachrücken, wenn Saddams Regime gestürzt ist, und wie stark und geschlossen ist die Opposition?
Hussain Al-Mozany: Die Presseberichte vom Zerfall der irakischen Bevölkerung und vom Bürgerkrieg sind falsch. Der irakische Tiegel ist sehr stark, er kann alles verschmelzen. Der Irak ist seit Ewigkeiten ein multikultureller und multinationaler Staat. Die irakischen Menschen werden nur durch die Politik auseinander dividiert. Es reicht nicht zu behaupten, es gebe keine Opposition. Sie bekämpft doch seit 30 Jahren das herrschende Regime und wird dabei mehr gehindert als unterstützt.
Im Ausland gibt es 1500 irakische Offiziere. Überall in Europa haben wir große irakische Gemeinden mit Menschen, die gebildet und in allen Bereichen der Wissenschaft, Kultur, Literatur hochqualifiziert sind. Vier bis fünf Millionen Menschen haben ihre Erfahrung im Westen gesammelt und wissen, wie die Demokratie funktioniert. Man muss diese Leute nur kontaktieren und sie schrittweise dabei begleiten, sich selbst zu demokratisieren. Wenn die Opposition allein gelassen wird, wird sie vermutlich selbst große Fehler begehen.
ZDFonline: Wie beurteilen Sie die kritische Haltung Deutschlands in der Irak-Frage?
Hussain Al-Mozany: Das Ziel Saddams ist es, die USA und den Rest der Welt auseinander zu bringen. Ich halte die Äußerungen Schröders für durchsichtige Propaganda. Denn er ist grundsätzlich bereit, mitzumachen und die Briten zu entlasten, wenn die Amerikaner im Irak losschlagen. Die Deutschen werden niemals verweigern, ihre Logistik zur Verfügung zu stellen. Es wird alles beim Alten bleiben.
ZDFonline: Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr eines Flächenbrandes, einer Art Kettenreaktion im Nahen Osten?
Hussain Al-Mozany: Man versucht die ganze Zeit, ein Junktim zwischen dem Irak-Problem und dem Konflikt der Israelis und Palästinensern herzustellen. Ich sehe keine Verbindung. Der Beweis: Den Palästinensern kann es nicht schlechter gehen, die Israelis haben Arafat regelrecht zerbombt, und die Araber haben nichts getan. Eine andere Behauptung wäre eine reine Lüge. Sie haben die Palästinenser im Stich gelassen. Und ob die Amerikaner den Irak nun bombardieren oder nicht, das ist dem Rest der arabischen Welt egal. Das Volk ist für die arabischen Herrscher, diese Psychopathen und Massenmörder, wertlos. Der lybische Präsident Khaddafi fühlt sich beschämt, die Lybier regieren zu müssen. Mubarak in Ägypten arbeitet nur in seine eigene Tasche.
Die arabischen Diktatoren haben mit ihrer Propaganda die Angst des Westens geschürt, weil sie Sorgen um sich selbst hatten. Wenn Saddam als erster Diktator gestürzt wird, dachten sie, dann sind wir auch bald dran. Das Problem ist, dass der Politik die Moral fehlt. Das Volk muss Priorität haben, nicht das Regime. Und wenn ein Volk leidet, müssen die anderen reagieren und intervenieren. Es gibt jetzt kein Zurück.
Das Interview führte Julia Morgenstern am 24.09.2002

Hussain Al-Mozany, irakischer Schriftsteller und Übersetzer
Al-Mozany wurde 1954 in Amarah im Südirak geboren und wuchs in Bagdad auf. 1978 flüchtete Al-Mozany in den Libanon und arbeitete dort als Journalist, bevor er 1980 nach Deutschland ging. Er studierte in Münster Arabistik, Islamwissenschaft, Germanistik und Publizistik. Heute ist Al-Mozany verheirateter Vater zweier Kinder und arbeitet als Schriftsteller und Übersetzer in Köln.
Neben zahlreichen Erzählungen, Aufsätzen und Gedichten verfasste Al-Mozany zwei Romane in deutscher Sprache: "Der Marschländer" und "Mansur oder der Duft des Abendlandes". Ins Arabische übersetzte er unter anderem "Die Blechtrommel" von Günther Grass.
.
Interview mit dem irakischen Schriftsteller Al-Mozany
"Es grenzt an Schizophrenie"
Während sich die Vereinigten Staaten und die UNO streiten, wie sie mit Saddams Regime verfahren sollen, sterben im Irak Menschen durch Hinrichtung und Unterernährung. Für den Kölner Schriftsteller Hussain Al-Mozany, der 1978 aus Bagdad floh und seit zwölf Jahren deutscher Staatsbürger ist, gibt es nur eine Lösung: Saddam stürzen.
ZDFonline: Tagtäglich berichten die Medien über den drohenden Militärschlag im Irak und über die Diskussionen zwischen USA und UNO. Was geht Ihnen als ehemaliger irakischer Staatsbürger, der selbst Verwandte in Bagdad hat, in diesen Tagen durch den Kopf?
Hussain Al-Mozany: Im Laufe der letzten zwölf Jahre haben sich die USA in ihren Entscheidungen verselbstständigt. Was mir ununterbrochen durch den Kopf geht, ist die Tatsache, dass niemand das Schicksal des irakischen Volkes berücksichtigt. Ich denke primär an die Menschen. Weder die UNO, die Amerikaner noch die Europäer haben sich darüber Gedanken gemacht, wie es mit dem irakischen Volk weitergehen soll. Man hat dem Regime von Massenmördern an der Spitze der irakischen Regierung seit 30 Jahren freie Hand gelassen und sie nicht verpflichtet, die Menschenrechte zu achten.
ZDFonline: Das Leben der Menschen im Irak hat sich unter den Wirtschaftssanktionen in den vergangenen elf Jahren dramatisch verschlechtert. Ist der Ansatz, die Abrüstungsdiskussion mit einem Embargo zu verknüpfen, fehlgeschlagen?
Hussain Al-Mozany: Es war abzusehen, dass sich Saddam Hussein nicht an die UNO-Resolutionen hält. Es war ein Riesenfehler, dem irakischen Regime zu vertrauen. Die Lebensmittel der UNO müssen von den Häfen 1500 Kilometer weit transportiert werden, landen erst in Bagdad und werden von dort zentral verteilt. Die UNO hat darüber keine Kontrolle. Die Resultate sind miserabel. Im Laufe der Sanktionen sind schätzungsweise eine halbe Million Kinder ums Leben gekommen.
Die Sanktionen haben Saddam sogar genützt. Als es unmittelbar nach dem Zweiten Golfkrieg einen riesigen Volksaufstand gab, konnte er die Sanktionen als zusätzliche Strafe gegen die Aufständischen verwenden. Saddam hat den Süden des Iraks, die siebentausend Jahre alten Kulturstätten der Menschheit, wo Schrift, Kunst und Literatur erfunden worden sind, regelrecht gestraft.
ZDFonline: Warum hat die US-Armee ihrer Meinung nach die Auflehnung der inländischen Gruppen nicht unterstützt und schon damals dazu genutzt, das Regime unter Saddam zu stürzen?
Hussain Al-Mozany: Dafür gibt es drei wichtige Gründe. Die Aufständischen haben zu emotional reagiert. Es gab Übergriffe und Morde aus Rache, die nicht zu rechtfertigen sind. Außerdem waren sie nicht organisiert. Das Regime konnte die Aufständischen und Oppositionellen schnell verhaften und beseitigen.
Zweitens konnten sich die Amerikaner schon damals nicht leisten, einen starken, schiitisch dominierten Iran zu dulden und zusätzlich die schiitische Mehrheit im Irak zu stärken. Es entstünde ein unberechenbarer Block, von dem der Funke auf andere arabische Staaten mit schiitischen Minderheiten übergreifen könnte. Drittens hat die USA die schiitischen Führung abgetastet und falsche Signale empfangen. Die Schiiten beharrten darauf, dass das Öl allein Sache des irakischen Volkes sei. Außerdem schlugen sie harte Töne gegenüber Israel an.
ZDFonline: Ist die Gefahr, die vom Irak ausgeht, wirklich so groß, dass sie einen "Präventivschlag" der USA mit oder ohne UNO rechtfertigen würde?
Hussain Al-Mozany: Ich bin mir sicher, dass die Armee von Luxemburg die irakische Armee besiegen könnte. Das ist keine Behauptung, sondern eine Tatsache. Der Irak hat es nie geschafft, ein einziges Flugzeug der Amerikaner oder der Briten abzuschießen, obwohl die Bombardements seit zwölf Jahren weitergehen. Inzwischen ist die irakische Armee zerstritten, zerfallen und im Grunde führungslos.
Die Übergriffe des Iraks in den vergangenen Jahren waren nie mehr als Abschreckungstaktik. Saddams Strategie ist jedoch fehlgeschlagen, weil die Amerikaner die Gefahr für ihre Zwecke hochstilisieren. Man sorgt sich also um ein kleines und fast unbedeutendes Land, während sich niemand daran gestört hat, als die Sowjetunion in teilweise gigantische Atommächte zerfallen ist. Das ist Heuchelei. Es beweist, dass die Politiker vom Irak keine Ahnung haben. Und es grenzt an Schizophrenie: Man sieht ein Volk seit 30 Jahren leiden und tut nichts.
ZDFonline: Wie stark steht die irakische Bevölkerung hinter Saddam Hussein, auch im Falle eines Militärschlags?
Hussain Al-Mozany: Der südliche Teil Iraks, mehrheitlich schiitisch, steht nicht hinter Saddam Hussein. Und selbst die sunnitische Minderheit ist nicht mit ihm zufrieden. In seinem eigenen Haus gibt es Widerstand. Wir haben ja alle gesehen, wie Saddam seine beiden Schwiegersöhne auf bestialische Weise umgebracht hat. Die gängige Herrschaftsmethode besteht aus Gelüsten, Menschen umzubringen.
Saddam ist eine Person der Geheimdienste, des Versteckspiels und der Angst. Seine Partei funktioniert nach dem Strickmuster des Nationalsozialismus, aber primitiver Prägung. Die Ziele, die Bush in seiner Rede vor der UNO genannt hat, sind den Irakern recht. Auch sie wollen die Massenvernichtungsmittel loswerden, denn Giftgase sind gegen sie selbst eingesetzt worden.
ZDFonline: Der Irak steht seit mehr als 30 Jahren unter der Herrschaft der Baath-Partei und befindet sich seither mehr oder weniger ununterbrochen im Krieg. Welche Chancen hat so ein Land zum Aufbau einer Zivilgesellschaft und zur Demokratisierung?
Hussain Al-Mozany: Demokratie ist ein erstrebenswertes Ziel, aber problematisch. Für Demokratie muss die Infrastruktur stimmen. Es muss zwischen allen gegensätzlichen Gruppierungen einer Gesellschaft ein Grundkonsens bestehen. Demokratie ist für Deutschland mit all seinen verschiedenen Interessen unentbehrlich. Im Irak müssen wir aber erst die Schäden beseitigen
Saddam hat zwei Millionen Menschen umgebracht. Die psychische Belastung des irakischen Volkes unter dem Terror und den Sanktionen ist enorm. Die Menschen sind nicht in der Lage, politisch zu denken. Wie man in Deutschland sagt: Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Die Leute müssen erst zufrieden gestellt werden, damit der Irak schrittweise aufgebaut werden kann genauso wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke an die Worte des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, der sagte: "Wir sind befreit und vernichtet in einem."
ZDFonline: Was für alternative Wege gibt es zum Regimesturz von außen?
Hussain Al-Mozany: Bei einem unheilbar kranken Tier hilft nichts, außer es einzuschläfern. Krieg ist dennoch nicht die einzige Möglichkeit. Menschen aus dem Umfeld Saddams könnten ihn beseitigen. Ich plädiere nicht dafür, Saddam umzubringen. Grundsätzlich bin ich Pazifist. Er soll festgenommen und wie Milosevic nach Den Haag gebracht werden.
Entscheidend ist, dass die Völkergemeinschaft funktioniert. Die Völker dürfen nicht zusehen, wie ein anderes Volk von einem verrückten Herrscher geschlachtet wird. Ziel muss sein, Saddam zu stürzen. Die Sanktionen müssen aufgehoben werden, damit sich das Land öffnen kann. Die demokratischen Kräfte im Irak müssen unterstützt werden. Sie haben es schwer, sich gegen das religiöse Potential im Irak durchzusetzen, da es keinen dynamischen Prozess, keinen Meinungsaustausch gibt. Weil sich die religiös motivierten Gruppen auf Gott oder einen Propheten berufen, bringen sie sofort das gesamte Volk hinter sich. Sie haben es leichter, die Menschen zu mobilisieren als die Laizisten.
ZDFonline: Wer soll nachrücken, wenn Saddams Regime gestürzt ist, und wie stark und geschlossen ist die Opposition?
Hussain Al-Mozany: Die Presseberichte vom Zerfall der irakischen Bevölkerung und vom Bürgerkrieg sind falsch. Der irakische Tiegel ist sehr stark, er kann alles verschmelzen. Der Irak ist seit Ewigkeiten ein multikultureller und multinationaler Staat. Die irakischen Menschen werden nur durch die Politik auseinander dividiert. Es reicht nicht zu behaupten, es gebe keine Opposition. Sie bekämpft doch seit 30 Jahren das herrschende Regime und wird dabei mehr gehindert als unterstützt.
Im Ausland gibt es 1500 irakische Offiziere. Überall in Europa haben wir große irakische Gemeinden mit Menschen, die gebildet und in allen Bereichen der Wissenschaft, Kultur, Literatur hochqualifiziert sind. Vier bis fünf Millionen Menschen haben ihre Erfahrung im Westen gesammelt und wissen, wie die Demokratie funktioniert. Man muss diese Leute nur kontaktieren und sie schrittweise dabei begleiten, sich selbst zu demokratisieren. Wenn die Opposition allein gelassen wird, wird sie vermutlich selbst große Fehler begehen.
ZDFonline: Wie beurteilen Sie die kritische Haltung Deutschlands in der Irak-Frage?
Hussain Al-Mozany: Das Ziel Saddams ist es, die USA und den Rest der Welt auseinander zu bringen. Ich halte die Äußerungen Schröders für durchsichtige Propaganda. Denn er ist grundsätzlich bereit, mitzumachen und die Briten zu entlasten, wenn die Amerikaner im Irak losschlagen. Die Deutschen werden niemals verweigern, ihre Logistik zur Verfügung zu stellen. Es wird alles beim Alten bleiben.
ZDFonline: Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr eines Flächenbrandes, einer Art Kettenreaktion im Nahen Osten?
Hussain Al-Mozany: Man versucht die ganze Zeit, ein Junktim zwischen dem Irak-Problem und dem Konflikt der Israelis und Palästinensern herzustellen. Ich sehe keine Verbindung. Der Beweis: Den Palästinensern kann es nicht schlechter gehen, die Israelis haben Arafat regelrecht zerbombt, und die Araber haben nichts getan. Eine andere Behauptung wäre eine reine Lüge. Sie haben die Palästinenser im Stich gelassen. Und ob die Amerikaner den Irak nun bombardieren oder nicht, das ist dem Rest der arabischen Welt egal. Das Volk ist für die arabischen Herrscher, diese Psychopathen und Massenmörder, wertlos. Der lybische Präsident Khaddafi fühlt sich beschämt, die Lybier regieren zu müssen. Mubarak in Ägypten arbeitet nur in seine eigene Tasche.
Die arabischen Diktatoren haben mit ihrer Propaganda die Angst des Westens geschürt, weil sie Sorgen um sich selbst hatten. Wenn Saddam als erster Diktator gestürzt wird, dachten sie, dann sind wir auch bald dran. Das Problem ist, dass der Politik die Moral fehlt. Das Volk muss Priorität haben, nicht das Regime. Und wenn ein Volk leidet, müssen die anderen reagieren und intervenieren. Es gibt jetzt kein Zurück.
Das Interview führte Julia Morgenstern am 24.09.2002

Hussain Al-Mozany, irakischer Schriftsteller und Übersetzer
Al-Mozany wurde 1954 in Amarah im Südirak geboren und wuchs in Bagdad auf. 1978 flüchtete Al-Mozany in den Libanon und arbeitete dort als Journalist, bevor er 1980 nach Deutschland ging. Er studierte in Münster Arabistik, Islamwissenschaft, Germanistik und Publizistik. Heute ist Al-Mozany verheirateter Vater zweier Kinder und arbeitet als Schriftsteller und Übersetzer in Köln.
Neben zahlreichen Erzählungen, Aufsätzen und Gedichten verfasste Al-Mozany zwei Romane in deutscher Sprache: "Der Marschländer" und "Mansur oder der Duft des Abendlandes". Ins Arabische übersetzte er unter anderem "Die Blechtrommel" von Günther Grass.
.
.
Schröder, der große Ablenker
von Christoph Keese, Chefredakteur Financial Times Deutschland
Der Kanzler setzt öffentlich alles gegen den Krieg. Dabei sollte er sich um die Wirtschaftspolitik kümmern.
Am Samstag hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder beim Blick aus seinem Amt zum Brandenburger Tor allen Grund zur Freude: Eine halbe Million Menschen demonstrierte gegen einen Krieg in Irak. Schröder ist es gelungen, den Altruismus, die Hilfsbereitschaft und die Begeisterungsfähigkeit der Deutschen für seine Zwecke zu instrumentalisieren. In den kommenden Tagen wird er den Partnern in der Europäischen Union, der Nato und im Weltsicherheitsrat diese Demonstration mit der Geste des überzeugten Demokraten vorhalten: Seht her, ich kann nicht anders. Mein Volk will keinen Krieg, wir sind die Guten, und wir stoppen die Kriegstreiber im Weißen Haus.
Die vielen Menschen, die jetzt in Berlin und anderen Städten protestieren, meinen es ernst, nicht weniger ernst, als meine Freunde und ich es 1981 im Bonner Hofgarten gemeint haben. Damals ging es um Nato-Doppelbeschluss und Pershing-Raketen. Ich war fest davon überzeugt, dass wir in einen Atomkrieg stürzen würden, wenn die USA ein Gegengewicht zu den sowjetischen SS-20 in Deutschland installieren dürften.
Seinerzeit nutzten einige Dutzend Organisationen die allgemeine Empörung als Trittbrettfahrer aus; es wimmelte von K-Gruppen und radikalen Splitterparteien. Doch wir Friedensbewegten bildeten die Mehrheit und empfanden es als große Ungerechtigkeit, dass die konservativen Zeitungen uns hinterher vorwarfen, wir seien von Moskau ferngesteuert. Genauso ungerecht wäre es heute, den Demonstranten entgegenzuhalten, dass Interessengruppen von Verdi bis zur PKK das Berliner Spektakel als Bühne für ihre eigenen Interessen nutzten. So ist das nun einmal bei großen Protestmärschen.
Falsche Drohkulisse, echte Empörung
Einen Vorwurf jedoch hat Schröder verdient: Er hat dem Land eine falsche Drohkulisse vorgespiegelt, auf die die Menschen jetzt mit echter Empörung reagieren. Schröder prioritisiert das Thema ebenso geschickt wie im vergangenen Herbst die Flut. Damals gab die Regierung in allen verfügbaren Räumen des Kanzleramts Pressekonferenzen und wischte alle anderen Themen von der Tagesordnung. Schröder übertrieb bewusst, um von seinem Versagen abzulenken und sein Publikum merkte nicht, was wirklich geschah: Wachstumsschwäche, steigende Arbeitslosigkeit und das Scheitern von Hans Eichel als Finanzminister, der sich unter dem Schutz der Flut-Show bis zur Wahl rettete.
Ähnlich funktioniert jetzt Schröders Irak-Inszenierung. Der Kanzler tut so, als ginge es um Krieg oder Frieden, als stünde ein Aggressor namens USA vor der Invasion in ein unschuldiges Irak. Dass Menschen dagegen demonstrieren, ist ehrenhaft. Nur lautet das Thema des Konflikts eben nicht "Krieg oder Frieden", wie Schröder glauben machen will, sondern "Entwaffnung des Irak" oder "Absetzung von Saddam Hussein" - je nachdem, ob man mehr auf die Tauben oder auf die Falken in der US-Regierung hört. Das sind ganz und gar andere Ziele. Man kann sie auch ohne Krieg erreichen, allerdings nur, wenn man glaubhaft droht und wenn die Nato geschlossen auftritt. Schröder spitzt die Debatte auf einen Scheinkonflikt zu und stabilisiert damit unweigerlich Saddam Hussein, der die Demonstrationen politisch ausweiden wird - womit dem deutschen Kanzler das diplomatische Kunststück gelingt, mit denselben Fakten und in dieselbe Richtung zu argumentieren wie der Diktator in Bagdad.
Steuersenkung per Schecks
Der Kanzler hätte Besseres zu tun, als sich im Fall Irak zu verstricken. Er muss dringend die Steuern senken, um einen Kollaps der Konjunktur und des Verbrauchervertrauens abzuwenden. Die Steuersenkung kann nicht bis zum Januar warten. Sie muss im Sommer kommen, ist technisch aber nicht leicht zu organisieren. Am besten löst man sie, indem die Finanzämter bis zum Juli Schecks an die Haushalte verschicken - als Abschlag, der am Jahresende verrechnet wird. Solche Schecks, das zeigen Erfahrungen aus den USA, können Vertrauen und Konsumlust anregen. Diese Initiative sollte Schröder jetzt starten.
Mehr Aufmerksamkeit des Kanzlers braucht auch die SPD-Fraktion im Bundestag. Nach seinem Auftritt vergangene Woche hat sie ihn auf den Händen getragen. Aber ist das ein Beweis für Führungsstärke? Schröder hat der linken Fraktionsmehrheit nur nach dem Mund geredet. Mit seiner Anti-USA-Politik hat er ihr so viel gegeben, dass er leicht eine Gegenleistung hätte verlangen können - zum Beispiel die Zustimmung zur Einführung des Wahlrechts zwischen Kündigungsschutz und Abfindungsregelung bei neuen Arbeitsverträgen. Doch das hat Schröder versäumt.
Umso entschlossener muss er jetzt darangehen, jedes Mitglied der Fraktion, insbesondere die Gewerkschafter, für Reformen zu gewinnen, und sie zu bitten, ihre Blockade gegen eine Modernisierung aufzugeben. Ohne Reformbereitschaft der SPD-Abgeordneten bleibt die Regierung weiter gelähmt. Schröder und Superminister Clement sehen im Beharrungsvermögen ihrer Fraktion das größte Hindernis für erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Dieses zu überwinden muss Chefsache sein, sonst wird das Kabinett keine nennenswerte Reform durch das Parlament bringen. Der Kanzler sollte die Bühne der Weltpolitik verlassen und seine Energie besser darauf verwenden, die dringenden Reformen im eigenen Land umzusetzen.
SPIEGEL ONLINE - 17.02.2003
Schröder, der große Ablenker
von Christoph Keese, Chefredakteur Financial Times Deutschland
Der Kanzler setzt öffentlich alles gegen den Krieg. Dabei sollte er sich um die Wirtschaftspolitik kümmern.
Am Samstag hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder beim Blick aus seinem Amt zum Brandenburger Tor allen Grund zur Freude: Eine halbe Million Menschen demonstrierte gegen einen Krieg in Irak. Schröder ist es gelungen, den Altruismus, die Hilfsbereitschaft und die Begeisterungsfähigkeit der Deutschen für seine Zwecke zu instrumentalisieren. In den kommenden Tagen wird er den Partnern in der Europäischen Union, der Nato und im Weltsicherheitsrat diese Demonstration mit der Geste des überzeugten Demokraten vorhalten: Seht her, ich kann nicht anders. Mein Volk will keinen Krieg, wir sind die Guten, und wir stoppen die Kriegstreiber im Weißen Haus.
Die vielen Menschen, die jetzt in Berlin und anderen Städten protestieren, meinen es ernst, nicht weniger ernst, als meine Freunde und ich es 1981 im Bonner Hofgarten gemeint haben. Damals ging es um Nato-Doppelbeschluss und Pershing-Raketen. Ich war fest davon überzeugt, dass wir in einen Atomkrieg stürzen würden, wenn die USA ein Gegengewicht zu den sowjetischen SS-20 in Deutschland installieren dürften.
Seinerzeit nutzten einige Dutzend Organisationen die allgemeine Empörung als Trittbrettfahrer aus; es wimmelte von K-Gruppen und radikalen Splitterparteien. Doch wir Friedensbewegten bildeten die Mehrheit und empfanden es als große Ungerechtigkeit, dass die konservativen Zeitungen uns hinterher vorwarfen, wir seien von Moskau ferngesteuert. Genauso ungerecht wäre es heute, den Demonstranten entgegenzuhalten, dass Interessengruppen von Verdi bis zur PKK das Berliner Spektakel als Bühne für ihre eigenen Interessen nutzten. So ist das nun einmal bei großen Protestmärschen.
Falsche Drohkulisse, echte Empörung
Einen Vorwurf jedoch hat Schröder verdient: Er hat dem Land eine falsche Drohkulisse vorgespiegelt, auf die die Menschen jetzt mit echter Empörung reagieren. Schröder prioritisiert das Thema ebenso geschickt wie im vergangenen Herbst die Flut. Damals gab die Regierung in allen verfügbaren Räumen des Kanzleramts Pressekonferenzen und wischte alle anderen Themen von der Tagesordnung. Schröder übertrieb bewusst, um von seinem Versagen abzulenken und sein Publikum merkte nicht, was wirklich geschah: Wachstumsschwäche, steigende Arbeitslosigkeit und das Scheitern von Hans Eichel als Finanzminister, der sich unter dem Schutz der Flut-Show bis zur Wahl rettete.
Ähnlich funktioniert jetzt Schröders Irak-Inszenierung. Der Kanzler tut so, als ginge es um Krieg oder Frieden, als stünde ein Aggressor namens USA vor der Invasion in ein unschuldiges Irak. Dass Menschen dagegen demonstrieren, ist ehrenhaft. Nur lautet das Thema des Konflikts eben nicht "Krieg oder Frieden", wie Schröder glauben machen will, sondern "Entwaffnung des Irak" oder "Absetzung von Saddam Hussein" - je nachdem, ob man mehr auf die Tauben oder auf die Falken in der US-Regierung hört. Das sind ganz und gar andere Ziele. Man kann sie auch ohne Krieg erreichen, allerdings nur, wenn man glaubhaft droht und wenn die Nato geschlossen auftritt. Schröder spitzt die Debatte auf einen Scheinkonflikt zu und stabilisiert damit unweigerlich Saddam Hussein, der die Demonstrationen politisch ausweiden wird - womit dem deutschen Kanzler das diplomatische Kunststück gelingt, mit denselben Fakten und in dieselbe Richtung zu argumentieren wie der Diktator in Bagdad.
Steuersenkung per Schecks
Der Kanzler hätte Besseres zu tun, als sich im Fall Irak zu verstricken. Er muss dringend die Steuern senken, um einen Kollaps der Konjunktur und des Verbrauchervertrauens abzuwenden. Die Steuersenkung kann nicht bis zum Januar warten. Sie muss im Sommer kommen, ist technisch aber nicht leicht zu organisieren. Am besten löst man sie, indem die Finanzämter bis zum Juli Schecks an die Haushalte verschicken - als Abschlag, der am Jahresende verrechnet wird. Solche Schecks, das zeigen Erfahrungen aus den USA, können Vertrauen und Konsumlust anregen. Diese Initiative sollte Schröder jetzt starten.
Mehr Aufmerksamkeit des Kanzlers braucht auch die SPD-Fraktion im Bundestag. Nach seinem Auftritt vergangene Woche hat sie ihn auf den Händen getragen. Aber ist das ein Beweis für Führungsstärke? Schröder hat der linken Fraktionsmehrheit nur nach dem Mund geredet. Mit seiner Anti-USA-Politik hat er ihr so viel gegeben, dass er leicht eine Gegenleistung hätte verlangen können - zum Beispiel die Zustimmung zur Einführung des Wahlrechts zwischen Kündigungsschutz und Abfindungsregelung bei neuen Arbeitsverträgen. Doch das hat Schröder versäumt.
Umso entschlossener muss er jetzt darangehen, jedes Mitglied der Fraktion, insbesondere die Gewerkschafter, für Reformen zu gewinnen, und sie zu bitten, ihre Blockade gegen eine Modernisierung aufzugeben. Ohne Reformbereitschaft der SPD-Abgeordneten bleibt die Regierung weiter gelähmt. Schröder und Superminister Clement sehen im Beharrungsvermögen ihrer Fraktion das größte Hindernis für erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Dieses zu überwinden muss Chefsache sein, sonst wird das Kabinett keine nennenswerte Reform durch das Parlament bringen. Der Kanzler sollte die Bühne der Weltpolitik verlassen und seine Energie besser darauf verwenden, die dringenden Reformen im eigenen Land umzusetzen.
SPIEGEL ONLINE - 17.02.2003
Guter Artikel, man könnte Bush genau das gleiche vorwerfen, und das macht es nicht besser und einfacher zu verstehen! 

.
Friedenstaumel
Von Richard Herzinger
Deutschland im Friedenstaumel - mehr als 500 000 Menschen bekundeten am Wochenende den moralischen Schulterschluss mit ihrer Regierung. Ja, richtig, die Deutschen stehen nicht allein da mit ihrer Ablehnung eines Irak-Krieges. In ganz Europa, in der ganzen Welt, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten selbst zeigten Millionen Demonstranten, dass sie der weltpolitischen Logik der Bush-Administration nicht folgen wollen.
In Deutschland aber hat diese Stimmung eine besondere Dimension. Sie markiert möglicherweise einen dramatischen Bruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte - die Abkehr von der engen Partnerschaft mit Amerika. Glaubt man der jüngsten, im "Spiegel" veröffentlichten Umfrage, sehen sich 62% der Deutschen nicht mehr zur Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern verpflichtet.
Und 53% halten die USA für die größte Gefahr für den Weltfrieden - nur 28% nennen den Irak, nur 9% Nordkorea. In dieser irrwitzigen Verkehrung aller politischen und moralischen Maßstäbe drückt sich mehr aus als nur eine "Meinungsverschiedenheit" mit den "amerikanischen Freunden", wie es die Bundesregierung beschönigend darzustellen versucht. Die wohlfeile pazifistische Rhetorik der Regierungsparteien hat dazu beigetragen, dass die Natur von Regimen wie dem in Bagdad oder Pjönjang praktisch nicht mehr wahrgenommen wird.
Die zunehmend verzweifelte Forderung der irakischen demokratischen Oppositionellen, Saddam Hussein endlich zu beseitigen, verhallt weitgehend ungehört. Die Erinnerung an den 11.September ist weitgehend aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden.
Irak erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung mehr und mehr als unschuldiges Opfer der Fantasmen eines größenwahnsinnigen Präsidenten - wobei sich die Einpeitscher der Dämonisierung George W. Bushs nicht recht einig werden können, ob er ein von religiösem Wahn getriebener "Kreuzzügler" sei oder es nur auf die irakischen Ölquellen abgesehen habe. Worum es sich bei dem Regime der Baath-Partei Saddam Husseins im Irak jedoch tatsächlich handelt, davon konnte man am vergangenen Wochenende eine kleine Ahnung bekommen.
Nachdem der irakische Außenminister Tariq Asis vom Papst empfangen und mit inständigen Friedenwünschen verabschiedet worden war, gab er in Rom eine internationale Pressekonferenz. Mit eiskalter Verachtung weigerte er sich dort, Fragen von israelischen Journalisten zu beantworten.
Die Baath-Partei knechtet und massakriert nicht nur die eigene Bevölkerung mit Methoden, die sowohl an den Stalinismus als auch an den deutschen Nationalsozialismus erinnern. Sie folgt auch einer radikal antisemtischen Ideologie und hat die Vernichtung Israels auf ihre Fahnen geschrieben. Ist uns unsere Geschichte tatsächlich schon so weit entrückt, dass dies hierzulande keine mit der Entrüstung über Bush, Rumsfeld und Co. annähernd vergleichbare Empörung auslöst?
Gegen die Beseitigung eines solchen Regimes durch einen Krieg zu sein, dafür gibt es viele gute, rationale Gründe - doch maßgebliche Teile der deutschen Öffentlichkeit steigern sich derzeit in einen Rausch der Selbstgerechtigkeit und Ignoranz hinein, der nicht ohne schlimme Folgen bleiben kann.
In diesem moralistischen Höhenflug geht nicht zuletzt die Tatsache unter, dass die Antikriegshaltung der Bundesregierung keineswegs so konsequent und konsistent ist, wie sie behauptet. Sie verspricht, sie wolle alles für eine "friedliche Entwaffnung" des Irak durch "die UNO-Inspektoren" tun.
Zur Entwaffnung des Irak beizutragen, hat sie sich in der Tat längst verpflichtet, indem sie der Sicherheitsresolution 14/41 zustimmte. Wie aber soll diese Entwaffnung friedlich von statten gehen, wenn dem Regime in Bagdad als Alternative nicht der Krieg angedroht wird? Denn dieses Regime behauptet unbeirrt, überhaupt keine verbotenen Massenvernichtungswaffen zu besitzen.
Das aber scheinen Schröder und Fischer ihm nicht zu glauben, sonst würde ihre Zielsetzung "Entwaffnung" ja keinen Sinn ergeben. Glaubt sie aber allen Ernstes, das Regime werde die UNO-Inspektoren aus innerer Einsicht zu den Waffen führen, die angeblich gar nicht existieren?
Man kann die Frist für UNO-Inspektionen noch um Wochen oder Monate verlängern, irgendwann aber wird der Zeitpunkt kommen, an dem die UNO ihre Androhung "ernster Konsequenzen" notfalls wahr machen - oder sich der Lächerlichkeit preisgeben muss. Spätestens dann wird die Schröder-Regierung mit ihrer lange Zeit aufrecht erhaltenen Linie, militärische Mittel unter allen Umständen auszuschließen, gescheitert sein.
Auf ihre Alliierten Frankreich, Russland und China wird sie sich dann jedenfalls nicht mehr verlassen können. Denn keine dieser Regierungen hat sich, wie die deutsche, jemals auf ein definitives Nein zum Krieg festgelegt. Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung das Land argumentativ auf diesen Moment vorbereitet. Und klare Worte findet, die das Zerrbild von der Weltfriedensgefahr USA korrigiert.
Denn bessere Verbündete als die Amerikaner sind, bei aller Kritik an Strategie und Stil der gegenwärtigen US-Administration, für Deutschland nicht zu haben. Die Partner, die sich Gerhard Schröder neben Frankreich für seine Achse des Friedens ausgesucht hat, sind es jedenfalls gewiss nicht. Während Wladimir Putin als Lichtgestalt und willkommener Helfer im deutsch-französischen Friedenskampf gegen die USA in Berlin empfangen wurde, ging der mit äußerster Grausamkeit geführte Krieg seiner Armee gegen die Bevölkerung Tschetscheniens unvermindert weiter. Ganze 150 Menschen hatten sich eingefunden, um ihren Protest gegen diesen, im Unterschied zum Irak-Krieg bereits real existierenden Krieg zum Ausdruck zu bringen. In Berlin, der Hauptstadt des Friedens.
.
Friedenstaumel
Von Richard Herzinger
Deutschland im Friedenstaumel - mehr als 500 000 Menschen bekundeten am Wochenende den moralischen Schulterschluss mit ihrer Regierung. Ja, richtig, die Deutschen stehen nicht allein da mit ihrer Ablehnung eines Irak-Krieges. In ganz Europa, in der ganzen Welt, nicht zuletzt in den Vereinigten Staaten selbst zeigten Millionen Demonstranten, dass sie der weltpolitischen Logik der Bush-Administration nicht folgen wollen.
In Deutschland aber hat diese Stimmung eine besondere Dimension. Sie markiert möglicherweise einen dramatischen Bruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte - die Abkehr von der engen Partnerschaft mit Amerika. Glaubt man der jüngsten, im "Spiegel" veröffentlichten Umfrage, sehen sich 62% der Deutschen nicht mehr zur Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern verpflichtet.
Und 53% halten die USA für die größte Gefahr für den Weltfrieden - nur 28% nennen den Irak, nur 9% Nordkorea. In dieser irrwitzigen Verkehrung aller politischen und moralischen Maßstäbe drückt sich mehr aus als nur eine "Meinungsverschiedenheit" mit den "amerikanischen Freunden", wie es die Bundesregierung beschönigend darzustellen versucht. Die wohlfeile pazifistische Rhetorik der Regierungsparteien hat dazu beigetragen, dass die Natur von Regimen wie dem in Bagdad oder Pjönjang praktisch nicht mehr wahrgenommen wird.
Die zunehmend verzweifelte Forderung der irakischen demokratischen Oppositionellen, Saddam Hussein endlich zu beseitigen, verhallt weitgehend ungehört. Die Erinnerung an den 11.September ist weitgehend aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden.
Irak erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung mehr und mehr als unschuldiges Opfer der Fantasmen eines größenwahnsinnigen Präsidenten - wobei sich die Einpeitscher der Dämonisierung George W. Bushs nicht recht einig werden können, ob er ein von religiösem Wahn getriebener "Kreuzzügler" sei oder es nur auf die irakischen Ölquellen abgesehen habe. Worum es sich bei dem Regime der Baath-Partei Saddam Husseins im Irak jedoch tatsächlich handelt, davon konnte man am vergangenen Wochenende eine kleine Ahnung bekommen.
Nachdem der irakische Außenminister Tariq Asis vom Papst empfangen und mit inständigen Friedenwünschen verabschiedet worden war, gab er in Rom eine internationale Pressekonferenz. Mit eiskalter Verachtung weigerte er sich dort, Fragen von israelischen Journalisten zu beantworten.
Die Baath-Partei knechtet und massakriert nicht nur die eigene Bevölkerung mit Methoden, die sowohl an den Stalinismus als auch an den deutschen Nationalsozialismus erinnern. Sie folgt auch einer radikal antisemtischen Ideologie und hat die Vernichtung Israels auf ihre Fahnen geschrieben. Ist uns unsere Geschichte tatsächlich schon so weit entrückt, dass dies hierzulande keine mit der Entrüstung über Bush, Rumsfeld und Co. annähernd vergleichbare Empörung auslöst?
Gegen die Beseitigung eines solchen Regimes durch einen Krieg zu sein, dafür gibt es viele gute, rationale Gründe - doch maßgebliche Teile der deutschen Öffentlichkeit steigern sich derzeit in einen Rausch der Selbstgerechtigkeit und Ignoranz hinein, der nicht ohne schlimme Folgen bleiben kann.
In diesem moralistischen Höhenflug geht nicht zuletzt die Tatsache unter, dass die Antikriegshaltung der Bundesregierung keineswegs so konsequent und konsistent ist, wie sie behauptet. Sie verspricht, sie wolle alles für eine "friedliche Entwaffnung" des Irak durch "die UNO-Inspektoren" tun.
Zur Entwaffnung des Irak beizutragen, hat sie sich in der Tat längst verpflichtet, indem sie der Sicherheitsresolution 14/41 zustimmte. Wie aber soll diese Entwaffnung friedlich von statten gehen, wenn dem Regime in Bagdad als Alternative nicht der Krieg angedroht wird? Denn dieses Regime behauptet unbeirrt, überhaupt keine verbotenen Massenvernichtungswaffen zu besitzen.
Das aber scheinen Schröder und Fischer ihm nicht zu glauben, sonst würde ihre Zielsetzung "Entwaffnung" ja keinen Sinn ergeben. Glaubt sie aber allen Ernstes, das Regime werde die UNO-Inspektoren aus innerer Einsicht zu den Waffen führen, die angeblich gar nicht existieren?
Man kann die Frist für UNO-Inspektionen noch um Wochen oder Monate verlängern, irgendwann aber wird der Zeitpunkt kommen, an dem die UNO ihre Androhung "ernster Konsequenzen" notfalls wahr machen - oder sich der Lächerlichkeit preisgeben muss. Spätestens dann wird die Schröder-Regierung mit ihrer lange Zeit aufrecht erhaltenen Linie, militärische Mittel unter allen Umständen auszuschließen, gescheitert sein.
Auf ihre Alliierten Frankreich, Russland und China wird sie sich dann jedenfalls nicht mehr verlassen können. Denn keine dieser Regierungen hat sich, wie die deutsche, jemals auf ein definitives Nein zum Krieg festgelegt. Es wird höchste Zeit, dass die Bundesregierung das Land argumentativ auf diesen Moment vorbereitet. Und klare Worte findet, die das Zerrbild von der Weltfriedensgefahr USA korrigiert.
Denn bessere Verbündete als die Amerikaner sind, bei aller Kritik an Strategie und Stil der gegenwärtigen US-Administration, für Deutschland nicht zu haben. Die Partner, die sich Gerhard Schröder neben Frankreich für seine Achse des Friedens ausgesucht hat, sind es jedenfalls gewiss nicht. Während Wladimir Putin als Lichtgestalt und willkommener Helfer im deutsch-französischen Friedenskampf gegen die USA in Berlin empfangen wurde, ging der mit äußerster Grausamkeit geführte Krieg seiner Armee gegen die Bevölkerung Tschetscheniens unvermindert weiter. Ganze 150 Menschen hatten sich eingefunden, um ihren Protest gegen diesen, im Unterschied zum Irak-Krieg bereits real existierenden Krieg zum Ausdruck zu bringen. In Berlin, der Hauptstadt des Friedens.
.
.
"Ein unheimlich schönes Gefühl"
Beckmann, Wecker und Drewermann
Von Henryk M. Broder
Frieden, Liebe und Sonnenschein herrschten in Reinhold Beckmanns Fernsehstudio, als Konstantin Wecker und Eugen Drewermann von gewaltlosem Widerstand und der unblutigen Zerschlagung von Diktaturen träumten. Der eindrucksvolle Auftritt eines exilirakischen Künstlerpaares dämpfte die Stimmung dann jedoch gewaltig.
Gestern war ein großer Tag in Eggenfelden. Daniel kehrte in seine Heimatstadt zurück, Hunderte von Teenagern warteten kreischend auf den "Superstar" und der Bürgermeister bat ihn, sich in das Goldene Buch der Gemeinde einzutragen. Daniel genoss den Rummel um seine Person, warf Küsschen in die Menge und gab Autogramme. "Sie lieben ihn, und er liebt sie gnadenlos zurück", sagte der RTL-Reporter vor Ort.
Zwei Tage vorher, bei der großen Friedensdemo in Berlin, machte Konstantin Wecker die gleiche Erfahrung: "Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, sich an so einem Tag emotional fallen lassen zu können", gestand er dem Reporter der 3sat-Sendung "kulturzeit". Das Fernsehen, diese wunderbare Zeitmaschine, verkürzte den Abstand zwischen Daniel und Konstantin auf ein paar Minuten, alles übrige wurde nivelliert. Bald wird auch Daniel, wenn es seine PR-Berater so wollen, "Krieg ist doof!" rufen, und Konstantin wird auf eine große Tournee gehen, die er eigentlich schon mit seiner gut getimten Reise nach Bagdad begonnen hat. Zwei Superstars auf dem Weg in die Charts.
So wäre es mehr als spannend gewesen, die beiden zusammen bei "Beckmann" zu erleben. Weil Daniel aber verhindert war, lud Beckmann den Theologen, Psychoanalytiker und Hellseher Eugen Drewermann aus Paderborn ein. Der gilt als "kritisch" und "unangepasst", weil er sich mit seiner Kirche verkracht hat, obwohl er selbst ein Dogmatiker ist; man könnte sagen, Drewermann hat sich selbständig gemacht, als moralische Ich-AG, Autor von Traktaten und Ratgeber für alle, die ein Problem mit Gott haben. Da saß er nun in jakobinischer Strenge dem wie immer super lockeren Beckmann gegenüber und sagte Sätze von grundsätzlicher Bedeutung: "Wir wollen überhaupt keinen Krieg mehr. Wir tun das, ohne direkt betroffen zu sein. Nie wieder Krieg!"
Beckmann, der diesmal etwas besser vorbereitet zu sein schien, als bei seinem daneben gegangenen Versuch, Jürgen Möllemann vorzuführen, fragte nach: Wie das denn so sei mit dem Terror-System von Saddam und mit den Menschenrechten im Irak. Und da bewies Drewermann, dass er in der Tat ein begabter Dialektiker ist, der jeden Gedanken in sein Gegenteil verwandeln kann. Es müsse "gleiche Inspektionen für den Irak und die USA" geben, Saddam sei ein brutaler Diktator, aber auch in den USA sei ein Präsident an der Macht, "der 130 Menschen ermorden ließ", deswegen "brauchen wir ein Regime im Westen wie im Irak, das sich für die Menschen interessiert".
Damit stellte er jene "Äquidistanz" her, die derzeit auch in den Umfragen zum Ausdruck kommt: 38 Prozent der Deutschen halten George W. Bush für eine größere Gefahr für den Weltfrieden als Saddam Hussein, 37 Prozent meinen, es sei umgekehrt. Damit liefern sich Bush und Saddam zumindest in Deutschland ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit vorerst ungewissem Ausgang. Für die wenigen stillen Dissidenten, die es noch im Irak gibt, dürfte es freilich ein großer Trost sein, dass in Texas die Todesstrafe angewandt wird und im übrigen Westen Parksünder gnadenlos verfolgt werden, ohne dass die Uno ihre Inspektoren losschicken.
Ob er sich denn nicht vom Regime auf seiner Reise nach Bagdad "instrumentalisiert" gefühlt habe, wollte Beckmann von Wecker wissen. Davon könne keine Rede sein, antwortete der Liedermacher, mit eigenen Händen habe er ein Saddam-Bild, unter dem er spielen sollte, abgehängt. Da waren alle kurz sprachlos und Wecker nannte ein weiteres Beispiel für gewaltlosen Widerstand, die Wiedervereinigung: "Eine Diktatur kann unblutig zu Ende gehen", die Iraker hätten Saddam "satt". Wie er das erfahren habe, setzte Beckmann nach. Man müsse es zwischen den Worten "rauslesen", präzisierte Wecker. Ach so.
Und so machten sich Frieden, Liebe und Sonnenschein im Studio breit, bis Beckmann ein irakisches Ehepaar, Inaam und Najem Wali, an den Tisch bat, keine Helden und keine Widerstandskämpfer, nur eine Schauspielerin und ein Journalist, die das Land verlassen hatten, weil sie nicht in einer Diktatur leben wollten. Anders als Drewermann und Wecker hatten die beiden praktische Erfahrungen mit dem System gemacht und sich deswegen einen Sinn für Relationen bewahrt. Inaam, die Schauspielerin, fühlte sich "an Demonstrationen im Irak" erinnert, "organisiert für die Regierung", und ihr Mann Najem stellte fest: "Saddam hat die Demo für sich verbucht, die Friedensbewegung wird instrumentalisiert." Er habe im Irak ständig unter Beobachtung gelebt, wurde verhaftet ("Gefängnis wäre dafür ein schönes Wort" ) und an die irakisch-iranische Front geschickt.
"Sind Sie für den Krieg gegen den Irak?" fragte Beckmann in ungewohnter Klarheit. "Ich bin gegen jeden Krieg", antwortete der Exil-Iraki, "aber was sage ich der Mutter, die ein krankes Kind hat und hofft, dass die Amerikaner kommen und sie befreien?" Man dürfe nicht "die Fronten verwechseln", er habe die Hälfte seiner Familie durch Saddam verloren, der sei "ein Diktator und Despot, der die ganze Welt seit 20 Jahren herausfordert", während die Iraker in die Welt schreien: "Befreien Sie uns!"
Drewermann und Wecker hatten den Schrei noch nicht vernommen und der ganz zum Schluss dazu gekommene Schauspieler und Unicef-Botschafter Dieter Pfaff befand, "Wandel durch Annäherung" wäre auch dem Irak gegenüber die richtige Strategie. "Das muss gehen." Im Übrigen: kommt Zeit, kommt Abhilfe. "Es muss eine Kraft im Irak wachsen, die dieses Schwein hinwegfegt." Ganz so weit mochte der kritische Theologe Drewermann nicht gehen. Er wünschte sich nur, dass "die Diktatur im Irak durch Kontrollen abgeschwächt" wird. Wenig später stand er auf und verließ das Studio, denn er hatte an diesem Abend noch wichtige Termine wahrzunehmen. Seine letzten Worte waren: "Ich wünsche mir, dass die Sendung zum Frieden beiträgt." Ein bisschen Frieden tut immer gut.
.
"Ein unheimlich schönes Gefühl"
Beckmann, Wecker und Drewermann
Von Henryk M. Broder
Frieden, Liebe und Sonnenschein herrschten in Reinhold Beckmanns Fernsehstudio, als Konstantin Wecker und Eugen Drewermann von gewaltlosem Widerstand und der unblutigen Zerschlagung von Diktaturen träumten. Der eindrucksvolle Auftritt eines exilirakischen Künstlerpaares dämpfte die Stimmung dann jedoch gewaltig.
Gestern war ein großer Tag in Eggenfelden. Daniel kehrte in seine Heimatstadt zurück, Hunderte von Teenagern warteten kreischend auf den "Superstar" und der Bürgermeister bat ihn, sich in das Goldene Buch der Gemeinde einzutragen. Daniel genoss den Rummel um seine Person, warf Küsschen in die Menge und gab Autogramme. "Sie lieben ihn, und er liebt sie gnadenlos zurück", sagte der RTL-Reporter vor Ort.
Zwei Tage vorher, bei der großen Friedensdemo in Berlin, machte Konstantin Wecker die gleiche Erfahrung: "Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, sich an so einem Tag emotional fallen lassen zu können", gestand er dem Reporter der 3sat-Sendung "kulturzeit". Das Fernsehen, diese wunderbare Zeitmaschine, verkürzte den Abstand zwischen Daniel und Konstantin auf ein paar Minuten, alles übrige wurde nivelliert. Bald wird auch Daniel, wenn es seine PR-Berater so wollen, "Krieg ist doof!" rufen, und Konstantin wird auf eine große Tournee gehen, die er eigentlich schon mit seiner gut getimten Reise nach Bagdad begonnen hat. Zwei Superstars auf dem Weg in die Charts.
So wäre es mehr als spannend gewesen, die beiden zusammen bei "Beckmann" zu erleben. Weil Daniel aber verhindert war, lud Beckmann den Theologen, Psychoanalytiker und Hellseher Eugen Drewermann aus Paderborn ein. Der gilt als "kritisch" und "unangepasst", weil er sich mit seiner Kirche verkracht hat, obwohl er selbst ein Dogmatiker ist; man könnte sagen, Drewermann hat sich selbständig gemacht, als moralische Ich-AG, Autor von Traktaten und Ratgeber für alle, die ein Problem mit Gott haben. Da saß er nun in jakobinischer Strenge dem wie immer super lockeren Beckmann gegenüber und sagte Sätze von grundsätzlicher Bedeutung: "Wir wollen überhaupt keinen Krieg mehr. Wir tun das, ohne direkt betroffen zu sein. Nie wieder Krieg!"
Beckmann, der diesmal etwas besser vorbereitet zu sein schien, als bei seinem daneben gegangenen Versuch, Jürgen Möllemann vorzuführen, fragte nach: Wie das denn so sei mit dem Terror-System von Saddam und mit den Menschenrechten im Irak. Und da bewies Drewermann, dass er in der Tat ein begabter Dialektiker ist, der jeden Gedanken in sein Gegenteil verwandeln kann. Es müsse "gleiche Inspektionen für den Irak und die USA" geben, Saddam sei ein brutaler Diktator, aber auch in den USA sei ein Präsident an der Macht, "der 130 Menschen ermorden ließ", deswegen "brauchen wir ein Regime im Westen wie im Irak, das sich für die Menschen interessiert".
Damit stellte er jene "Äquidistanz" her, die derzeit auch in den Umfragen zum Ausdruck kommt: 38 Prozent der Deutschen halten George W. Bush für eine größere Gefahr für den Weltfrieden als Saddam Hussein, 37 Prozent meinen, es sei umgekehrt. Damit liefern sich Bush und Saddam zumindest in Deutschland ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit vorerst ungewissem Ausgang. Für die wenigen stillen Dissidenten, die es noch im Irak gibt, dürfte es freilich ein großer Trost sein, dass in Texas die Todesstrafe angewandt wird und im übrigen Westen Parksünder gnadenlos verfolgt werden, ohne dass die Uno ihre Inspektoren losschicken.
Ob er sich denn nicht vom Regime auf seiner Reise nach Bagdad "instrumentalisiert" gefühlt habe, wollte Beckmann von Wecker wissen. Davon könne keine Rede sein, antwortete der Liedermacher, mit eigenen Händen habe er ein Saddam-Bild, unter dem er spielen sollte, abgehängt. Da waren alle kurz sprachlos und Wecker nannte ein weiteres Beispiel für gewaltlosen Widerstand, die Wiedervereinigung: "Eine Diktatur kann unblutig zu Ende gehen", die Iraker hätten Saddam "satt". Wie er das erfahren habe, setzte Beckmann nach. Man müsse es zwischen den Worten "rauslesen", präzisierte Wecker. Ach so.
Und so machten sich Frieden, Liebe und Sonnenschein im Studio breit, bis Beckmann ein irakisches Ehepaar, Inaam und Najem Wali, an den Tisch bat, keine Helden und keine Widerstandskämpfer, nur eine Schauspielerin und ein Journalist, die das Land verlassen hatten, weil sie nicht in einer Diktatur leben wollten. Anders als Drewermann und Wecker hatten die beiden praktische Erfahrungen mit dem System gemacht und sich deswegen einen Sinn für Relationen bewahrt. Inaam, die Schauspielerin, fühlte sich "an Demonstrationen im Irak" erinnert, "organisiert für die Regierung", und ihr Mann Najem stellte fest: "Saddam hat die Demo für sich verbucht, die Friedensbewegung wird instrumentalisiert." Er habe im Irak ständig unter Beobachtung gelebt, wurde verhaftet ("Gefängnis wäre dafür ein schönes Wort" ) und an die irakisch-iranische Front geschickt.
"Sind Sie für den Krieg gegen den Irak?" fragte Beckmann in ungewohnter Klarheit. "Ich bin gegen jeden Krieg", antwortete der Exil-Iraki, "aber was sage ich der Mutter, die ein krankes Kind hat und hofft, dass die Amerikaner kommen und sie befreien?" Man dürfe nicht "die Fronten verwechseln", er habe die Hälfte seiner Familie durch Saddam verloren, der sei "ein Diktator und Despot, der die ganze Welt seit 20 Jahren herausfordert", während die Iraker in die Welt schreien: "Befreien Sie uns!"
Drewermann und Wecker hatten den Schrei noch nicht vernommen und der ganz zum Schluss dazu gekommene Schauspieler und Unicef-Botschafter Dieter Pfaff befand, "Wandel durch Annäherung" wäre auch dem Irak gegenüber die richtige Strategie. "Das muss gehen." Im Übrigen: kommt Zeit, kommt Abhilfe. "Es muss eine Kraft im Irak wachsen, die dieses Schwein hinwegfegt." Ganz so weit mochte der kritische Theologe Drewermann nicht gehen. Er wünschte sich nur, dass "die Diktatur im Irak durch Kontrollen abgeschwächt" wird. Wenig später stand er auf und verließ das Studio, denn er hatte an diesem Abend noch wichtige Termine wahrzunehmen. Seine letzten Worte waren: "Ich wünsche mir, dass die Sendung zum Frieden beiträgt." Ein bisschen Frieden tut immer gut.
.
Bundesrepublik Deutschland: Souveräner Staat oder noch immer mit Besatzungsrecht?
http://www.hackemesser.de/thietz1.html
http://www.hackemesser.de/thietz1.html




@ bluemoons / Beitrag # 238
Der Autor Deines Essays, Hans-Peter Thietz entstammt der rechtsradikalen Szene.
(NDO - Notverwaltung des Deutschen Ostens) Informationen dazu unter :
http://www.idgr.de/lexikon/stich/n/ndo/ndo.html
Welch Geistes Kind dieser Mann ist, kann man aber auch dieser website entnehmen:
http://www.efodon.de/html/archiv/sonstiges/thietz/th-ufo.htm
Wenn Du noch mal Deinen Mist hier verbreitest, werde ich ernsthaft sauer.
Ich hoffe, wir haben uns verstanden ?
Konradi
Der Autor Deines Essays, Hans-Peter Thietz entstammt der rechtsradikalen Szene.
(NDO - Notverwaltung des Deutschen Ostens) Informationen dazu unter :
http://www.idgr.de/lexikon/stich/n/ndo/ndo.html
Welch Geistes Kind dieser Mann ist, kann man aber auch dieser website entnehmen:
http://www.efodon.de/html/archiv/sonstiges/thietz/th-ufo.htm
Wenn Du noch mal Deinen Mist hier verbreitest, werde ich ernsthaft sauer.
Ich hoffe, wir haben uns verstanden ?
Konradi
Was soll man dazu sagen?
Autor: Dr. Bruno Bandulet (Herausgeber des Goldbriefes: G & M). ... ist auch auf der Seite aufgeführt.

http://www.idgr.de/lexikon/stich/n/ndo/ndo.html
und danke für den Hinweis
Autor: Dr. Bruno Bandulet (Herausgeber des Goldbriefes: G & M). ... ist auch auf der Seite aufgeführt.


http://www.idgr.de/lexikon/stich/n/ndo/ndo.html
und danke für den Hinweis
@Konradi
Gelten die Bestimmungen des Überleitungsvertrages nicht mehr , weil es ein bestimmter Herr Hans-Peter Thietz in seinem Bericht erwähnt hat?
Die Artikel stammen nicht von diesem Herrn, sondern sind geltende Verträge.
Darüber solte man seine Gedanken machen.
Wenn eines Tages Deutschland auch zum "Achsen des Bösen" gelten sollte, wird dieser Artikel
"(1) Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, das beschlagnahmt worden ist für Zwecke der Reparation oder Restitution oder auf Grund des Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, die die Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben oder schließen werden. "
"(3) Ansprüche und Klagen gegen Personen, die aufgrund der in Absatz (1) und (2) dieses Artikels bezeichneten Maßnahmen Eigentum erworben oder übertragen haben, sowie Ansprüche und Klagen gegen internationale Organisationen, ausländische Regierungen oder Personen, die auf Anweisung dieser Organisationen oder Regierungen gehandelt haben, werden nicht zugelassen. "
von "schöner" Bedeutung sein.

Gelten die Bestimmungen des Überleitungsvertrages nicht mehr , weil es ein bestimmter Herr Hans-Peter Thietz in seinem Bericht erwähnt hat?
Die Artikel stammen nicht von diesem Herrn, sondern sind geltende Verträge.
Darüber solte man seine Gedanken machen.
Wenn eines Tages Deutschland auch zum "Achsen des Bösen" gelten sollte, wird dieser Artikel
"(1) Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, das beschlagnahmt worden ist für Zwecke der Reparation oder Restitution oder auf Grund des Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, die die Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben oder schließen werden. "
"(3) Ansprüche und Klagen gegen Personen, die aufgrund der in Absatz (1) und (2) dieses Artikels bezeichneten Maßnahmen Eigentum erworben oder übertragen haben, sowie Ansprüche und Klagen gegen internationale Organisationen, ausländische Regierungen oder Personen, die auf Anweisung dieser Organisationen oder Regierungen gehandelt haben, werden nicht zugelassen. "
von "schöner" Bedeutung sein.

.
Der kommende Krieg -
Europa ist machtlos. Washingtons Rückzug findet nicht statt
Von Michael Naumann
Europas Bürger wollen keinen Krieg, doch der Krieg gegen Saddam Husseins Regime ist nur verschoben. Aufgehoben ist er nicht. Er wäre falsch, weil seine Menschenopfer unvermeidbar, seine Folgen unabsehbar, seine Kosten unabschätzbar, und sein Verstoß gegen das Völkerrecht unbestreitbar wären. Nur eines wäre er nicht – ein absolutes moralisches Desaster. Das ist Saddam Hussein selbst.
Grundlos dürfte die Hoffnung von Millionen Demonstranten sein, der Despot werde in letzter Minute sein heimliches Waffenarsenal offen legen. Nicht minder optimistisch schien die Annahme Gerhard Schröders, der amerikanische Präsident werde unter politischem Druck den Aufmarsch seiner Streitkräfte abbrechen. Am Montagabend reihte er sich in die Realo-Front seiner europäischen Amtskollegen ein: „Gewalt als letztes Mittel“ schließt die Bundesregierung im Irak-Konflikt nun nicht mehr aus. Und Gewalt wird es gewiss geben.
Saddams Tod wäre die Rettung
Ein Rückzug wäre ja ohne Beispiel in der amerikanischen Militärgeschichte, wenngleich er George W. Bush den Friedensnobelpreis einbringen könnte – wie einst Henry Kissinger. Der hatte den Abzug Amerikas aus Vietnam vor drei Jahrzehnten diplomatisch organisiert. Aber damals war die politisch gefesselte US-Armee bereits geschlagen. Ein ähnliches Debakel wird George W. Bush mit seinem eigenen Namen nicht verknüpfen wollen. Die Befehlshoheit über seine Armee liegt bei ihm. Er wird sie wahrnehmen; denn er will als Sieger wiedergewählt werden. Seit den Tagen Teddy Roosevelts schätzen Amerikas Wähler nichts mehr als Heldentum im Ausland.
Und Saddam? Jeder Deutsche ahnt, dass Hitler, wäre er 1945 im Besitz der Atombombe gewesen, sie auch über London oder Moskau abgeworfen hätte, um seine armselige Existenz im Berliner Bunker zu verlängern. Anthrax, Botulin-Toxine und vielleicht auch Pockenviren sind Husseins einziges verbliebenes Horror-Instrument zur eigenen Machtsicherung, vergleichbar dem nuklearen Abschreckungspotenzial Nordkoreas. Gäbe er es preis, wären seine Tage in Bagdad noch schneller gezählt. Mehr noch, inzwischen ist er aufgrund seiner militärischen Notlage gezwungen, so zu tun, als besäße er jene international verbotenen Waffen – selbst wenn er sie in Wirklichkeit nicht hat. Sie sind sein letzter Schutz. In einem Satz: Saddam Husseins Regime ist ein Übel, das erst mit seinem Tod aus der Welt verschwände.
Es mag die Rechtschaffenen der moralischen Friedensdebatte unserer Tage irritieren, daran zu erinnern, dass auch dieser Diktator, der seit zwanzig Jahren an der Herstellung von Massenvernichtungsmitteln arbeitet, unter anderem von vier Veto-Mächten des UN-Sicherheitsrats, von den USA, von Frankreich, England und der Sowjetunion, rüstungstechnisch ausgestattet und in seinem Feldzug gegen den Iran militärisch versorgt worden ist. Zehntausende iranische Giftgastote, alle Opfer der geächteten chemischen Kriegsführung, nahm Europa nach 1981 ohne spürbare Empörung zur Kenntnis. US-Satelliten lieferten Saddam Hussein die Fotografien des iranischen Frontverlaufs. Damals gab es keine Aufmärsche von Millionen besorgter Deutscher, Briten oder Italiener.
Erst nach Saddam Husseins fehlgeschlagener Kuwait-Invasion zehn Jahre später verhängten die Vereinten Nationen ein begrenztes Öl-Embargo über den Irak. Es wurde im großen Stil mithilfe des Nato-Mitglieds Türkei, Jordaniens und Syriens gebrochen. Der irakische Ölschmuggelring (Jahresumsatz etwa fünf Milliarden Dollar) ist im Besitz der Familie des Diktators. Dass die Gewinne auf irakischen Konten deponiert werden, ist unwahrscheinlich. Eher dürften sie in den westlichen Bank-Zentren, von der Karibik über die Schweiz und Luxemburg bis hin zur Londoner City, hinterlegt worden sein – spurlos, versteht sich. Bei der Ursachenforschung zur Herkunft des kommenden Krieges wird sich der Rest der Welt keine Unschuldsmienen leisten können – auch nicht einige deutsche Geschäftsleute, die dem Massenmörder Hussein technische Anlagen oder chemische Substanzen geliefert haben. Der Bundesnachrichtendienst wird die Empfangsquittungen kennen.
Der erste politische Kollateralschaden vor Kriegsausbruch ist das deutsch-amerikanische Verhältnis. Daran ändert auch Schröders diplomatische Volte im Kreis der europäischen Regierungschefs wenig. Paris wird womöglich in letzter Minute mit begnadetem Opportunismus seinen Weg zurück in den good will Washingtons finden. Doch die beachtliche Liste der handwerklichen Vorwürfe, die dem Bundeskanzler im Verfolg seiner Friedenspolitik gemacht werden können, ist nicht länger als diejenige, die der unilateralistischen Regierung Bush seit ihrem Dienstantritt vorzuhalten ist – Stichwort Kyoto-Protokoll, ABM-Vertrag, Biowaffen-Konvention und Internationaler Strafgerichtshof. Der fast zynische Abschied Washingtons aus dem schwerfälligen atlantischen Diskurs kündigte sich frühzeitig an.
Amerika – eine Nation der Tat
Während der Bundeskanzler vielleicht zum ersten Mal in seiner pragmatisch gestalteten Politikerlaufbahn die Gewissheit genießt, mit der moralischen Gemütslage der ganzen Nation, ja, Europas in Harmonie zu leben, fühlt sich der amerikanische Präsident als Vollstrecker der geschichtlichen Bestimmung seiner Republik. Der eine folgt dem Volk, der andere führt es – in den Krieg.
Genau hier liegt der kaum zu kittende Riss zwischen dem „alten Europa“ und der Neuen Welt. Das friedensverwöhnte Europa meinte, den Schlüssel zur künftigen Weltordnung zu kennen: kompromissbereite Verhandlung mit dem politischen Gegner bis hin zur neu-europäischen Problemlösung durch „Liegenlassen“.
Die Regierung Bush hingegen, aufgestört durch Terrorismus, versteht sich als Repräsentant einer Nation der Tat – hatte sie nicht Europa von den Folgen des Appeasements, also vom Naziterror befreit? Die Berater des Präsidenten, die sich verächtlich von einem kriegsunwilligen Europa abwenden, übertragen gleichwohl die Lehren seiner Vergangenheit auf Amerikas Gegenwart – ob sie passen oder nicht.
Die Politiker der Vereinigten Staaten haben ihre militärisch außerordentliche Vormachtstellung spätestens seit der Balkan-Krise erkannt und auf einen geostrategisch hochfahrenden Begriff gebracht. „Amerika besitzt eine militärische Macht, die von niemandem mehr herausgefordert werden kann“, sagt George W. Bush, „und die wir aufrechterhalten werden.“ Entsprechend monumental ist das Pentagon-Budget. Es ist schneller gewachsen als die Einsicht Europas in die neuen globalen Kräfteverhältnisse.
Im selbst gestellten Auftrag einer amerikanischen mission civilisatrice beansprucht das Weiße Haus seit dem 11. September 2001 das Recht auf Präventivkriege gegen „Schurkenstaaten“. Derlei Entscheidungsmacht über Krieg und Frieden in aller Welt flösse damit aus einer rechtlich geordneten Staatengemeinschaft ab auf den neuen Welt-Souverän in Washington. Das Völkerrecht wäre amerikanisiert.
Der Irak ist das erste Experimentierfeld dieser neuen Sicherheitsdoktrin. Das „alte Europa“ mit seinem melancholisch-moralischen Geschichtsbewusstsein steht ihr im Wege. Mögen seine Bürger hoffen mit Schröder, Fischer und Chirac, mögen sie beten mit dem Papst – Rückzug, diese elegante Variante unblutiger europäischer Kabinettskriege, ist Amerikas Stärke nie gewesen.
Der falsche Krieg droht in die Welt zurückzukehren. Europa kann ihn nicht mehr verhindern.
DIE ZEIT 09/2003
"Wenn nichts hilft, bleibt nur Krieg"
Lea Rosh über die Kritik an den Friedensdemonstrationen
In überraschender Schärfe hat das "Bündnis gegen Antisemitismus" Vorwürfe gegen die Friedensdemonstranten vom Wochenende erhoben, sie seien antiamerikanisch und politisch naiv. Zu den Unterzeichnern des Briefes zählt die Journalistin Lea Rosh, die 1936 in Berlin geboren wurde. Sie ist Initiatorin des geplanten "Denkmals für die ermordeten Juden Europas". Mit Lea Rosh sprach der Berliner FR-Korrespondent Pitt von Bebenburg.
Frankfurter Rundschau: Die Friedensdemonstranten vom Wochenende kamen aus einem politischen Spektrum, das Völkerrecht und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Fühlen Sie sich dieser Bewegung eigentlich verbunden?
Lea Rosh: Dreimal Ja. Aber auch dreimal Aber. Wer ist nicht für den Frieden, und wer ist nicht gegen den Krieg? Aber was bei der Demonstration in Berlin auffällt: Sie hatte keinen Protest gegen Saddam Hussein angemeldet. Ich habe jedenfalls keine überzeugenden Plakate dagegen gesehen, dass er seine eigene Bevölkerung mit Giftgas ermordet hat. Wo bleiben die Proteste gegen die Ermordung der Kurden, gegen die Ermordung der Schiiten?
Wir haben viele Plakate mit Protesten gegen Saddam gesehen.
Aber nicht in der gleichen Weise wie gegen US-Präsident George Bush! Bush ist hier als der willige Massenmörder hingestellt worden, der nichts weiter im Sinn hat, als Frauen und Kinder zu bombardieren. Das geht nicht. Der Verursacher der Krise ist Saddam Hussein. Der noch 20 000 Dollar den Familien verspricht, die ihre Kinder als Selbstmordattentäter losschicken. Und wo war etwas von Solidarität mit Israel zu lesen?
Viele Friedensgruppen, die mit demonstriert haben, haben seit Jahren auf den Terror von Saddam hingewiesen - ohne allzu viel Resonanz.
Wir reden von der Demonstration am Sonnabend. Und ich sage: Diese Demonstration war einseitig. Sie war gegen Amerika, gegen Bush und gegen einen eventuellen Krieg gerichtet. Natürlich sind wir gegen den Krieg. Aber was machen wir denn, wenn Saddam Hussein die Waffen versteckt hält? Der lässt die Inspektoren im Land noch lange herumirren.
Die Inspektoren haben offenbar den Eindruck, dass eine längere Dauer ihrer Inspektionen hilfreich sein könnte.
Ja, das muss man ausprobieren. Aber wenn dies alles nichts hilft, dann bleibt doch gar nichts anderes übrig als militärisches Vorgehen. Ich sage: Die Appeasement-Politik in den 30er Jahren hat 60 Millionen Tote gekostet.
Ist es nach Ihrer Ansicht antiamerikanisch, wenn man sich gegen die Politik von George Bush wendet?
Hören Sie doch auf, das ist viel zu verkürzt. Natürlich können wir uns mit der US-Friedensbewegung solidarisch erklären. Natürlich finde ich die Friedensbewegung per se gut. Ich muss doch nicht erklären, auf welcher Seite ich stehe. Nur: Ich habe die Geschichte nicht vergessen. Ich vergesse auch nicht, dass die Amerikaner die Landung in der Normandie mit einem ungeheuren Blutzoll bezahlt haben, für uns. Den Amerikanern sozusagen Menschenfresserei zu unterstellen, ist einfach unhistorisch.
Führende Politiker von SPD und Grünen sind in Berlin mitgelaufen. Halten sie die deutsche Regierung für antiamerikanisch?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich fand aber nicht in Ordnung, dass Gerhard Schröder nach dem 11. September die "uneingeschränkte Solidarität" erklärt hat, und hinterher heißt es: Selbst bei einer zweiten UN-Resolution machen wir nicht mit. So kann man Politik nicht machen. Jacques Chirac zeigt doch, wie man sowas macht.
Frankfurter Rundschau 20.02.2003
Der kommende Krieg -
Europa ist machtlos. Washingtons Rückzug findet nicht statt
Von Michael Naumann
Europas Bürger wollen keinen Krieg, doch der Krieg gegen Saddam Husseins Regime ist nur verschoben. Aufgehoben ist er nicht. Er wäre falsch, weil seine Menschenopfer unvermeidbar, seine Folgen unabsehbar, seine Kosten unabschätzbar, und sein Verstoß gegen das Völkerrecht unbestreitbar wären. Nur eines wäre er nicht – ein absolutes moralisches Desaster. Das ist Saddam Hussein selbst.
Grundlos dürfte die Hoffnung von Millionen Demonstranten sein, der Despot werde in letzter Minute sein heimliches Waffenarsenal offen legen. Nicht minder optimistisch schien die Annahme Gerhard Schröders, der amerikanische Präsident werde unter politischem Druck den Aufmarsch seiner Streitkräfte abbrechen. Am Montagabend reihte er sich in die Realo-Front seiner europäischen Amtskollegen ein: „Gewalt als letztes Mittel“ schließt die Bundesregierung im Irak-Konflikt nun nicht mehr aus. Und Gewalt wird es gewiss geben.
Saddams Tod wäre die Rettung
Ein Rückzug wäre ja ohne Beispiel in der amerikanischen Militärgeschichte, wenngleich er George W. Bush den Friedensnobelpreis einbringen könnte – wie einst Henry Kissinger. Der hatte den Abzug Amerikas aus Vietnam vor drei Jahrzehnten diplomatisch organisiert. Aber damals war die politisch gefesselte US-Armee bereits geschlagen. Ein ähnliches Debakel wird George W. Bush mit seinem eigenen Namen nicht verknüpfen wollen. Die Befehlshoheit über seine Armee liegt bei ihm. Er wird sie wahrnehmen; denn er will als Sieger wiedergewählt werden. Seit den Tagen Teddy Roosevelts schätzen Amerikas Wähler nichts mehr als Heldentum im Ausland.
Und Saddam? Jeder Deutsche ahnt, dass Hitler, wäre er 1945 im Besitz der Atombombe gewesen, sie auch über London oder Moskau abgeworfen hätte, um seine armselige Existenz im Berliner Bunker zu verlängern. Anthrax, Botulin-Toxine und vielleicht auch Pockenviren sind Husseins einziges verbliebenes Horror-Instrument zur eigenen Machtsicherung, vergleichbar dem nuklearen Abschreckungspotenzial Nordkoreas. Gäbe er es preis, wären seine Tage in Bagdad noch schneller gezählt. Mehr noch, inzwischen ist er aufgrund seiner militärischen Notlage gezwungen, so zu tun, als besäße er jene international verbotenen Waffen – selbst wenn er sie in Wirklichkeit nicht hat. Sie sind sein letzter Schutz. In einem Satz: Saddam Husseins Regime ist ein Übel, das erst mit seinem Tod aus der Welt verschwände.
Es mag die Rechtschaffenen der moralischen Friedensdebatte unserer Tage irritieren, daran zu erinnern, dass auch dieser Diktator, der seit zwanzig Jahren an der Herstellung von Massenvernichtungsmitteln arbeitet, unter anderem von vier Veto-Mächten des UN-Sicherheitsrats, von den USA, von Frankreich, England und der Sowjetunion, rüstungstechnisch ausgestattet und in seinem Feldzug gegen den Iran militärisch versorgt worden ist. Zehntausende iranische Giftgastote, alle Opfer der geächteten chemischen Kriegsführung, nahm Europa nach 1981 ohne spürbare Empörung zur Kenntnis. US-Satelliten lieferten Saddam Hussein die Fotografien des iranischen Frontverlaufs. Damals gab es keine Aufmärsche von Millionen besorgter Deutscher, Briten oder Italiener.
Erst nach Saddam Husseins fehlgeschlagener Kuwait-Invasion zehn Jahre später verhängten die Vereinten Nationen ein begrenztes Öl-Embargo über den Irak. Es wurde im großen Stil mithilfe des Nato-Mitglieds Türkei, Jordaniens und Syriens gebrochen. Der irakische Ölschmuggelring (Jahresumsatz etwa fünf Milliarden Dollar) ist im Besitz der Familie des Diktators. Dass die Gewinne auf irakischen Konten deponiert werden, ist unwahrscheinlich. Eher dürften sie in den westlichen Bank-Zentren, von der Karibik über die Schweiz und Luxemburg bis hin zur Londoner City, hinterlegt worden sein – spurlos, versteht sich. Bei der Ursachenforschung zur Herkunft des kommenden Krieges wird sich der Rest der Welt keine Unschuldsmienen leisten können – auch nicht einige deutsche Geschäftsleute, die dem Massenmörder Hussein technische Anlagen oder chemische Substanzen geliefert haben. Der Bundesnachrichtendienst wird die Empfangsquittungen kennen.
Der erste politische Kollateralschaden vor Kriegsausbruch ist das deutsch-amerikanische Verhältnis. Daran ändert auch Schröders diplomatische Volte im Kreis der europäischen Regierungschefs wenig. Paris wird womöglich in letzter Minute mit begnadetem Opportunismus seinen Weg zurück in den good will Washingtons finden. Doch die beachtliche Liste der handwerklichen Vorwürfe, die dem Bundeskanzler im Verfolg seiner Friedenspolitik gemacht werden können, ist nicht länger als diejenige, die der unilateralistischen Regierung Bush seit ihrem Dienstantritt vorzuhalten ist – Stichwort Kyoto-Protokoll, ABM-Vertrag, Biowaffen-Konvention und Internationaler Strafgerichtshof. Der fast zynische Abschied Washingtons aus dem schwerfälligen atlantischen Diskurs kündigte sich frühzeitig an.
Amerika – eine Nation der Tat
Während der Bundeskanzler vielleicht zum ersten Mal in seiner pragmatisch gestalteten Politikerlaufbahn die Gewissheit genießt, mit der moralischen Gemütslage der ganzen Nation, ja, Europas in Harmonie zu leben, fühlt sich der amerikanische Präsident als Vollstrecker der geschichtlichen Bestimmung seiner Republik. Der eine folgt dem Volk, der andere führt es – in den Krieg.
Genau hier liegt der kaum zu kittende Riss zwischen dem „alten Europa“ und der Neuen Welt. Das friedensverwöhnte Europa meinte, den Schlüssel zur künftigen Weltordnung zu kennen: kompromissbereite Verhandlung mit dem politischen Gegner bis hin zur neu-europäischen Problemlösung durch „Liegenlassen“.
Die Regierung Bush hingegen, aufgestört durch Terrorismus, versteht sich als Repräsentant einer Nation der Tat – hatte sie nicht Europa von den Folgen des Appeasements, also vom Naziterror befreit? Die Berater des Präsidenten, die sich verächtlich von einem kriegsunwilligen Europa abwenden, übertragen gleichwohl die Lehren seiner Vergangenheit auf Amerikas Gegenwart – ob sie passen oder nicht.
Die Politiker der Vereinigten Staaten haben ihre militärisch außerordentliche Vormachtstellung spätestens seit der Balkan-Krise erkannt und auf einen geostrategisch hochfahrenden Begriff gebracht. „Amerika besitzt eine militärische Macht, die von niemandem mehr herausgefordert werden kann“, sagt George W. Bush, „und die wir aufrechterhalten werden.“ Entsprechend monumental ist das Pentagon-Budget. Es ist schneller gewachsen als die Einsicht Europas in die neuen globalen Kräfteverhältnisse.
Im selbst gestellten Auftrag einer amerikanischen mission civilisatrice beansprucht das Weiße Haus seit dem 11. September 2001 das Recht auf Präventivkriege gegen „Schurkenstaaten“. Derlei Entscheidungsmacht über Krieg und Frieden in aller Welt flösse damit aus einer rechtlich geordneten Staatengemeinschaft ab auf den neuen Welt-Souverän in Washington. Das Völkerrecht wäre amerikanisiert.
Der Irak ist das erste Experimentierfeld dieser neuen Sicherheitsdoktrin. Das „alte Europa“ mit seinem melancholisch-moralischen Geschichtsbewusstsein steht ihr im Wege. Mögen seine Bürger hoffen mit Schröder, Fischer und Chirac, mögen sie beten mit dem Papst – Rückzug, diese elegante Variante unblutiger europäischer Kabinettskriege, ist Amerikas Stärke nie gewesen.
Der falsche Krieg droht in die Welt zurückzukehren. Europa kann ihn nicht mehr verhindern.
DIE ZEIT 09/2003
"Wenn nichts hilft, bleibt nur Krieg"
Lea Rosh über die Kritik an den Friedensdemonstrationen
In überraschender Schärfe hat das "Bündnis gegen Antisemitismus" Vorwürfe gegen die Friedensdemonstranten vom Wochenende erhoben, sie seien antiamerikanisch und politisch naiv. Zu den Unterzeichnern des Briefes zählt die Journalistin Lea Rosh, die 1936 in Berlin geboren wurde. Sie ist Initiatorin des geplanten "Denkmals für die ermordeten Juden Europas". Mit Lea Rosh sprach der Berliner FR-Korrespondent Pitt von Bebenburg.
Frankfurter Rundschau: Die Friedensdemonstranten vom Wochenende kamen aus einem politischen Spektrum, das Völkerrecht und Menschenrechte in den Mittelpunkt stellt. Fühlen Sie sich dieser Bewegung eigentlich verbunden?
Lea Rosh: Dreimal Ja. Aber auch dreimal Aber. Wer ist nicht für den Frieden, und wer ist nicht gegen den Krieg? Aber was bei der Demonstration in Berlin auffällt: Sie hatte keinen Protest gegen Saddam Hussein angemeldet. Ich habe jedenfalls keine überzeugenden Plakate dagegen gesehen, dass er seine eigene Bevölkerung mit Giftgas ermordet hat. Wo bleiben die Proteste gegen die Ermordung der Kurden, gegen die Ermordung der Schiiten?
Wir haben viele Plakate mit Protesten gegen Saddam gesehen.
Aber nicht in der gleichen Weise wie gegen US-Präsident George Bush! Bush ist hier als der willige Massenmörder hingestellt worden, der nichts weiter im Sinn hat, als Frauen und Kinder zu bombardieren. Das geht nicht. Der Verursacher der Krise ist Saddam Hussein. Der noch 20 000 Dollar den Familien verspricht, die ihre Kinder als Selbstmordattentäter losschicken. Und wo war etwas von Solidarität mit Israel zu lesen?
Viele Friedensgruppen, die mit demonstriert haben, haben seit Jahren auf den Terror von Saddam hingewiesen - ohne allzu viel Resonanz.
Wir reden von der Demonstration am Sonnabend. Und ich sage: Diese Demonstration war einseitig. Sie war gegen Amerika, gegen Bush und gegen einen eventuellen Krieg gerichtet. Natürlich sind wir gegen den Krieg. Aber was machen wir denn, wenn Saddam Hussein die Waffen versteckt hält? Der lässt die Inspektoren im Land noch lange herumirren.
Die Inspektoren haben offenbar den Eindruck, dass eine längere Dauer ihrer Inspektionen hilfreich sein könnte.
Ja, das muss man ausprobieren. Aber wenn dies alles nichts hilft, dann bleibt doch gar nichts anderes übrig als militärisches Vorgehen. Ich sage: Die Appeasement-Politik in den 30er Jahren hat 60 Millionen Tote gekostet.
Ist es nach Ihrer Ansicht antiamerikanisch, wenn man sich gegen die Politik von George Bush wendet?
Hören Sie doch auf, das ist viel zu verkürzt. Natürlich können wir uns mit der US-Friedensbewegung solidarisch erklären. Natürlich finde ich die Friedensbewegung per se gut. Ich muss doch nicht erklären, auf welcher Seite ich stehe. Nur: Ich habe die Geschichte nicht vergessen. Ich vergesse auch nicht, dass die Amerikaner die Landung in der Normandie mit einem ungeheuren Blutzoll bezahlt haben, für uns. Den Amerikanern sozusagen Menschenfresserei zu unterstellen, ist einfach unhistorisch.
Führende Politiker von SPD und Grünen sind in Berlin mitgelaufen. Halten sie die deutsche Regierung für antiamerikanisch?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich fand aber nicht in Ordnung, dass Gerhard Schröder nach dem 11. September die "uneingeschränkte Solidarität" erklärt hat, und hinterher heißt es: Selbst bei einer zweiten UN-Resolution machen wir nicht mit. So kann man Politik nicht machen. Jacques Chirac zeigt doch, wie man sowas macht.
Frankfurter Rundschau 20.02.2003
.
Ballade vom deutschen Ingenieur in schwerer Zeit
Morgen läuft der legendäre „WDR-Computerclub“ zum letzten Mal. Als der PC vielen Deutschen Teufelszeug war, hielten seine Moderatoren ihre Lötkolben mutig in die Kamera
von Ulrich Clauss
Wir schreiben das Jahr 1981. Fast ganz Deutschland nördlich der Mainlinie ist auf dem Weg in den Schatten eines schiefen Turms: Pisa wird das deutsche Defizit 20 Jahre später heißen. Ganz Deutschland? Sicher, die 68er-Generation hat den deutschen Nordwesten ziemlich flächendeckend mit ihrer dogmatischen Fortschrittskritik infiziert – aber es gibt eine Insel des Widerstands. Zwei wackere Kerle, zwei Fernsehredakteure, zwei lötstarke Männer in ihrer flimmernden Kiste nutzen die Gunst der Stunde und halten ihre Lötkolben ganz hoch, als für Sonntagnachmittag eine Erweiterung der Sendezeit beim Westdeutschen Rundfunk in Köln zur Debatte steht.
Das Dritte des WDR ist auf dem Weg zum Vollprogramm – nicht mehr lange wird man nachmittags noch das Testbild senden. Und tatsächlich dürfen Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph, so heißen unsere Helden, nun einmal in der Woche im Fernsehstudio das tun, was bis dahin in der Einsamkeit ihres eigenen wie Tausender anderer Hobbykeller geschah: Schaltungen löten, Chips verdrahten, Flip-Flops blinken lassen, sich freuen, dass die neue digitale Technik funktioniert – und das alles jetzt obendrein stolz wie Oskar in die Kamera halten. Der „WDR-Computerclub“ war geboren.
Man muss sich die grellen Selbstblockaden jener Zeit vor Augen führen, will man das revolutionäre (oder doch eher konterrevolutionäre?) Potenzial jener so schlichten wie die technikliebenden Massen ergreifenden Programmidee heute nachvollziehen. Komische Zeiten waren das: Unter dem adornitischen Triumphgeheul der Sozialwissenschaften werden die Lehrpläne entkanonisiert, werden Technikwissen und Naturwissenschaft aus dem Klassenzimmer gejagt. Die Töchter und Söhne der Täter rechnen mit einer Figur ab, die ihnen als Inkarnation des Bösen erscheint – dem deutschen Ingenieur. Hat er nicht Auschwitz gebaut? Ist nicht die technische Lösung die böseste aller denkbaren? Unter diesem Verdacht wird wegkämpft, was auch der alten, konservativen Pädagogenschaft nie ganz geheuer wurde. Linke Entfremdungsrhetorik und altbackener Philologendünkel gegenüber der neuen Medienwelt lassen ein ganzes Land den Epochenwandel verträumen.
Derweil schwappt in hohen Wellen die Medienrevolution unaufhaltsam über den großen Teich, in Gestalt digitaler Mikroelektronik und Kabelkanalvielfalt. Vereinzelt wird schon auf Apple-Computern getippt, 1983 kommt der IBM-Standard-PC heraus. Ein Kulturkampf tobt. „Anti-Kabel-Gruppen“ agitieren in den Großstädten gegen den „verkabelten Menschen“. Und das Privatfernsehen gilt als Counter Intelligence der „verkohlten“ Republik. Unscharfe Ahnungen von der Mächtigkeit der neuen Technologien schüren Ängste vor immer noch größeren Brüdern. Man liest viel George Orwell und Aldous Huxley. Kapital braucht Technik, Technik macht Krieg – so schnitzt sich der Zeitgeist seine hölzernen Gewissheiten zurecht.
Unsere beiden Helden dagegen setzen auf ein ganz anderes Element: Silizium, der Stoff, aus dem die neuen Zauberkästen gebacken werden. Und wenn sich die Computerclubler am Samstag zum letzten Mal über ihre Schaltplatine beugen, geht auch ein Kapitel Technikgeschichte zu Ende. Was haben die nicht alles zusammengefummelt. Als Daten noch mit unförmigen, über Telefonhörer gestülpten „Akkustik-Kopplern“ übertragen wurden, sendeten sie Software über den Fernsehlautsprecher in die „Datasetten“-Rekorder des Publikums. „Hard-Bit-Rock“ nennen sie das minutenlange, wilde Gepiepse – eine technische Weltpremiere. Später klauen sie sogar dem Fernsehbild ein paar Zeilen für ihre Software-Botschaften – ein Sakrileg für jeden öffentlich-rechtlichen Sendetechniker.
Eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen nimmt ihren Lauf, es wird die älteste und erfolgreichste Computershow der Fernsehgeschichte weltweit. Im Kumpelton eines Jugendwarts reportieren Wolfgang & Wolfgang für ihren vieltausendköpfigen Transistorsportclub aus der neuen Welt der Bits und Bytes. Wer je auf Modelleisenbahnreise ging ins Jungentraumwandlerland der Elektrotechnik, wer je das Ohr in den Äther reckte mit dem ersten selbst gebastelten Radio – der „WDR-Computerclub“ holt sie alle ab und sorgt für Anschluss an die digitale Moderne.
Die beiden Wolfgangs mit ihren Lötorgien sind in ihrer herzlich unschuldigen Neugier nie theoriefähig gewesen, sondern lebende Legenden der experimentellen Informatik, mit bis an die Unsinnsgrenze verstiegenen Basteleien. Sie waren sich in einer einzigen Botschaft selbst genug: Alles, was funktioniert, macht Spaß. Weiterführende Schaltpläne juckten sie nicht. Hätten die doch auf gedankliche Felder geführt, die besetzt waren von der politisierten Intelligenz jener Zeit und ihrer modernitätsverweigernden Deutungshoheit. Heute hadern eben diese Emanzipationspädagogen mit den Defiziten ihrer Lebensleistung, dem „digital divide“. So wird der gesellschaftliche Riss genannt zwischen denen, die Netzzugang haben, und jenen, die ihn sich haben versperren oder ausreden lassen.
Aus der Gruselgeschichte vom „verkabelten Menschen“ und dem abgründigen Misstrauen gegen technische Lösungen ist längst die Erweckungssaga vom „Netz-Bürger“ in der schönen digitalen Welt geworden. Selten genug spiegeln sich die Irrtümer einer Gesellschaft so kristallklar in der Umdeutung ihrer Sprachbilder.
Die riesige Zuschauerfamilie des „WDR-Computerclubs“ reagiert mit Wehmut auf den (unfreiwilligen) Abtritt der verdienten Datentrapper. Vielen bricht ein Stück Fernsehheimat weg. Denn der Club bediente bei Jung und Alt ein futuristisches Fernweh, wie es besonders Kurzwellenamateurfunker gut kennen. Er bot Zukunftstechnik als Buddelschiff hinterm TV-Mattscheibenglas.
Kann sein, dass die beiden moderierenden Lötkolben zusammen mit ihrem Publikum immer älter und schließlich für zielgruppenorientiertes Programmdesign zu alt geworden sind. Sicher haben die explodierten Auflagen der Computerfachzeitschriften solche Bastelsendungen überflüssig gemacht. So frisst nun die Computerrevolution ihre guten Onkels. Sie haben ausgedient als Fortschrittsbegleiter mit ihren chipgesteuerten Leuchtdioden, die Orientierung boten in dunkler Zeit, als die „German Angst“ im Schulhaus, im grünen Wald und auf der Heide den Totalitarismusvorbehalt gegen all die mikroprozessorgesteuerte „Großtechnologie“ in Stellung brachte.
Good bye „Computerclub“, du Asyl all der verlachten „Technik-Freaks“, als die sich junge Ingenieursbegabungen lange tarnen mussten, wollten sie nicht als „Fachidioten“ gelten, bloß weil sie eine serielle Schnittstelle programmieren konnten – im Unterschied zu ihren dummen Kritikern.
Und dass es in diesem Asylum bis zum letzten Tag zuging wie im Taubenschlag, beweist doch, dass – auch wenn jede Form ihre begrenzte Zeit hat – dem „WDR-Computerclub“ ein generationenübergreifender Medienstreich gelang, eine List der Technikgeschichte: die öffentlich-heimliche Selbsterzählung des technischen Fortschritts am elektronischen
Lagerfeuer.
DIE WELT 21.02.2003
Ballade vom deutschen Ingenieur in schwerer Zeit
Morgen läuft der legendäre „WDR-Computerclub“ zum letzten Mal. Als der PC vielen Deutschen Teufelszeug war, hielten seine Moderatoren ihre Lötkolben mutig in die Kamera
von Ulrich Clauss
Wir schreiben das Jahr 1981. Fast ganz Deutschland nördlich der Mainlinie ist auf dem Weg in den Schatten eines schiefen Turms: Pisa wird das deutsche Defizit 20 Jahre später heißen. Ganz Deutschland? Sicher, die 68er-Generation hat den deutschen Nordwesten ziemlich flächendeckend mit ihrer dogmatischen Fortschrittskritik infiziert – aber es gibt eine Insel des Widerstands. Zwei wackere Kerle, zwei Fernsehredakteure, zwei lötstarke Männer in ihrer flimmernden Kiste nutzen die Gunst der Stunde und halten ihre Lötkolben ganz hoch, als für Sonntagnachmittag eine Erweiterung der Sendezeit beim Westdeutschen Rundfunk in Köln zur Debatte steht.
Das Dritte des WDR ist auf dem Weg zum Vollprogramm – nicht mehr lange wird man nachmittags noch das Testbild senden. Und tatsächlich dürfen Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph, so heißen unsere Helden, nun einmal in der Woche im Fernsehstudio das tun, was bis dahin in der Einsamkeit ihres eigenen wie Tausender anderer Hobbykeller geschah: Schaltungen löten, Chips verdrahten, Flip-Flops blinken lassen, sich freuen, dass die neue digitale Technik funktioniert – und das alles jetzt obendrein stolz wie Oskar in die Kamera halten. Der „WDR-Computerclub“ war geboren.
Man muss sich die grellen Selbstblockaden jener Zeit vor Augen führen, will man das revolutionäre (oder doch eher konterrevolutionäre?) Potenzial jener so schlichten wie die technikliebenden Massen ergreifenden Programmidee heute nachvollziehen. Komische Zeiten waren das: Unter dem adornitischen Triumphgeheul der Sozialwissenschaften werden die Lehrpläne entkanonisiert, werden Technikwissen und Naturwissenschaft aus dem Klassenzimmer gejagt. Die Töchter und Söhne der Täter rechnen mit einer Figur ab, die ihnen als Inkarnation des Bösen erscheint – dem deutschen Ingenieur. Hat er nicht Auschwitz gebaut? Ist nicht die technische Lösung die böseste aller denkbaren? Unter diesem Verdacht wird wegkämpft, was auch der alten, konservativen Pädagogenschaft nie ganz geheuer wurde. Linke Entfremdungsrhetorik und altbackener Philologendünkel gegenüber der neuen Medienwelt lassen ein ganzes Land den Epochenwandel verträumen.
Derweil schwappt in hohen Wellen die Medienrevolution unaufhaltsam über den großen Teich, in Gestalt digitaler Mikroelektronik und Kabelkanalvielfalt. Vereinzelt wird schon auf Apple-Computern getippt, 1983 kommt der IBM-Standard-PC heraus. Ein Kulturkampf tobt. „Anti-Kabel-Gruppen“ agitieren in den Großstädten gegen den „verkabelten Menschen“. Und das Privatfernsehen gilt als Counter Intelligence der „verkohlten“ Republik. Unscharfe Ahnungen von der Mächtigkeit der neuen Technologien schüren Ängste vor immer noch größeren Brüdern. Man liest viel George Orwell und Aldous Huxley. Kapital braucht Technik, Technik macht Krieg – so schnitzt sich der Zeitgeist seine hölzernen Gewissheiten zurecht.
Unsere beiden Helden dagegen setzen auf ein ganz anderes Element: Silizium, der Stoff, aus dem die neuen Zauberkästen gebacken werden. Und wenn sich die Computerclubler am Samstag zum letzten Mal über ihre Schaltplatine beugen, geht auch ein Kapitel Technikgeschichte zu Ende. Was haben die nicht alles zusammengefummelt. Als Daten noch mit unförmigen, über Telefonhörer gestülpten „Akkustik-Kopplern“ übertragen wurden, sendeten sie Software über den Fernsehlautsprecher in die „Datasetten“-Rekorder des Publikums. „Hard-Bit-Rock“ nennen sie das minutenlange, wilde Gepiepse – eine technische Weltpremiere. Später klauen sie sogar dem Fernsehbild ein paar Zeilen für ihre Software-Botschaften – ein Sakrileg für jeden öffentlich-rechtlichen Sendetechniker.
Eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen nimmt ihren Lauf, es wird die älteste und erfolgreichste Computershow der Fernsehgeschichte weltweit. Im Kumpelton eines Jugendwarts reportieren Wolfgang & Wolfgang für ihren vieltausendköpfigen Transistorsportclub aus der neuen Welt der Bits und Bytes. Wer je auf Modelleisenbahnreise ging ins Jungentraumwandlerland der Elektrotechnik, wer je das Ohr in den Äther reckte mit dem ersten selbst gebastelten Radio – der „WDR-Computerclub“ holt sie alle ab und sorgt für Anschluss an die digitale Moderne.
Die beiden Wolfgangs mit ihren Lötorgien sind in ihrer herzlich unschuldigen Neugier nie theoriefähig gewesen, sondern lebende Legenden der experimentellen Informatik, mit bis an die Unsinnsgrenze verstiegenen Basteleien. Sie waren sich in einer einzigen Botschaft selbst genug: Alles, was funktioniert, macht Spaß. Weiterführende Schaltpläne juckten sie nicht. Hätten die doch auf gedankliche Felder geführt, die besetzt waren von der politisierten Intelligenz jener Zeit und ihrer modernitätsverweigernden Deutungshoheit. Heute hadern eben diese Emanzipationspädagogen mit den Defiziten ihrer Lebensleistung, dem „digital divide“. So wird der gesellschaftliche Riss genannt zwischen denen, die Netzzugang haben, und jenen, die ihn sich haben versperren oder ausreden lassen.
Aus der Gruselgeschichte vom „verkabelten Menschen“ und dem abgründigen Misstrauen gegen technische Lösungen ist längst die Erweckungssaga vom „Netz-Bürger“ in der schönen digitalen Welt geworden. Selten genug spiegeln sich die Irrtümer einer Gesellschaft so kristallklar in der Umdeutung ihrer Sprachbilder.
Die riesige Zuschauerfamilie des „WDR-Computerclubs“ reagiert mit Wehmut auf den (unfreiwilligen) Abtritt der verdienten Datentrapper. Vielen bricht ein Stück Fernsehheimat weg. Denn der Club bediente bei Jung und Alt ein futuristisches Fernweh, wie es besonders Kurzwellenamateurfunker gut kennen. Er bot Zukunftstechnik als Buddelschiff hinterm TV-Mattscheibenglas.
Kann sein, dass die beiden moderierenden Lötkolben zusammen mit ihrem Publikum immer älter und schließlich für zielgruppenorientiertes Programmdesign zu alt geworden sind. Sicher haben die explodierten Auflagen der Computerfachzeitschriften solche Bastelsendungen überflüssig gemacht. So frisst nun die Computerrevolution ihre guten Onkels. Sie haben ausgedient als Fortschrittsbegleiter mit ihren chipgesteuerten Leuchtdioden, die Orientierung boten in dunkler Zeit, als die „German Angst“ im Schulhaus, im grünen Wald und auf der Heide den Totalitarismusvorbehalt gegen all die mikroprozessorgesteuerte „Großtechnologie“ in Stellung brachte.
Good bye „Computerclub“, du Asyl all der verlachten „Technik-Freaks“, als die sich junge Ingenieursbegabungen lange tarnen mussten, wollten sie nicht als „Fachidioten“ gelten, bloß weil sie eine serielle Schnittstelle programmieren konnten – im Unterschied zu ihren dummen Kritikern.
Und dass es in diesem Asylum bis zum letzten Tag zuging wie im Taubenschlag, beweist doch, dass – auch wenn jede Form ihre begrenzte Zeit hat – dem „WDR-Computerclub“ ein generationenübergreifender Medienstreich gelang, eine List der Technikgeschichte: die öffentlich-heimliche Selbsterzählung des technischen Fortschritts am elektronischen
Lagerfeuer.
DIE WELT 21.02.2003
# 243 / Lea Rosh über die Kritik an den Friedensdemonstrationen
Lieber Konradi,
wie in aller Welt schaffst Du es, immer wieder auf´s neue, so durchsichtig pro-semitische Beiträge aufzutreiben ?
„In überraschender Schärfe hat das "Bündnis gegen Antisemitismus" Vorwürfe gegen die Friedensdemonstranten vom Wochenende erhoben ...
... Und wo war etwas von Solidarität mit Israel zu lesen? ...“
Was hatten die Friedensdemonstrationen mit den Israelis zu tun, daß sie sich wieder angesprochen, oder hier, sich ausgelassen fühlen???
Irgendwo gehen die mir mit ihrem ewigen, sich selbst in den Mittelpunkt stellen wollen, ganz gehörig auf den Zeiger!
„... Jacques Chirac zeigt doch, wie man sowas macht ... „
Gestern hatte ich beruflich mit der Delegation eines unserer französischen Kunden Besprechungen.
Allgegenwärtiges Thema am Rande: natürlich der Irak-Konflikt.
Ich hatte schon häufiger, auch zu anderen deutsch-französischen „Freundschafts-Zeiten“ mit ihnen zu tun. Allerdings, niemals vorher wurde eine so ausgeprägt pro-Deutsche Meinung von ihnen gegenüber dem Verhalten der Deutschen insgesamt , oder irgendeinem deutschen Politiker gegenüber geäußert, wie gestern einhellig über das Verhalten von Fischer und Schröder!
Ja, richtiger Stolz und Freude klang durch, ihr Präsident, ja ganz Frankreich, mit den Deutschen, nicht gegeneinander, nein, endlich mal in einer gemeinschaftlichen Auffassung mit der Mehrzahl der Deutschen, in einhelligem Verständnis mit der deutschen Regierung, zusammen mit dem Bundeskanzler!
Das Verhalten und die Meinung der Franzosen sollte uns zu denken geben! Es sind schließlich unsere direkten Nachbarn, die lange Jahre Mühe hatten den Deutschen zu verstehen, und die zum Schutze der Handlungsfreiheit und Gleichberechtigung Europas schon ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben!
Daher, nicht ausschließlich auf die Meinung der allzu stark von jüdischen Interessen gegängelten Amerikaner schielen! Die Interessen der Europäer sind für uns allemale wichtiger!
Der Ami ist nämlich Wort-wörtlich gesehen: weitab vom Schuss.
Steine werfen von da drüben, aus 10 km Höhe jemanden mit Bomben bepflastern, das trifft ihn nicht persönlich,
aber uns hier in „West-Asien“ viel eher!
Grüße
Magor
Lieber Konradi,
wie in aller Welt schaffst Du es, immer wieder auf´s neue, so durchsichtig pro-semitische Beiträge aufzutreiben ?
„In überraschender Schärfe hat das "Bündnis gegen Antisemitismus" Vorwürfe gegen die Friedensdemonstranten vom Wochenende erhoben ...
... Und wo war etwas von Solidarität mit Israel zu lesen? ...“
Was hatten die Friedensdemonstrationen mit den Israelis zu tun, daß sie sich wieder angesprochen, oder hier, sich ausgelassen fühlen???
Irgendwo gehen die mir mit ihrem ewigen, sich selbst in den Mittelpunkt stellen wollen, ganz gehörig auf den Zeiger!
„... Jacques Chirac zeigt doch, wie man sowas macht ... „
Gestern hatte ich beruflich mit der Delegation eines unserer französischen Kunden Besprechungen.
Allgegenwärtiges Thema am Rande: natürlich der Irak-Konflikt.
Ich hatte schon häufiger, auch zu anderen deutsch-französischen „Freundschafts-Zeiten“ mit ihnen zu tun. Allerdings, niemals vorher wurde eine so ausgeprägt pro-Deutsche Meinung von ihnen gegenüber dem Verhalten der Deutschen insgesamt , oder irgendeinem deutschen Politiker gegenüber geäußert, wie gestern einhellig über das Verhalten von Fischer und Schröder!
Ja, richtiger Stolz und Freude klang durch, ihr Präsident, ja ganz Frankreich, mit den Deutschen, nicht gegeneinander, nein, endlich mal in einer gemeinschaftlichen Auffassung mit der Mehrzahl der Deutschen, in einhelligem Verständnis mit der deutschen Regierung, zusammen mit dem Bundeskanzler!
Das Verhalten und die Meinung der Franzosen sollte uns zu denken geben! Es sind schließlich unsere direkten Nachbarn, die lange Jahre Mühe hatten den Deutschen zu verstehen, und die zum Schutze der Handlungsfreiheit und Gleichberechtigung Europas schon ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben!
Daher, nicht ausschließlich auf die Meinung der allzu stark von jüdischen Interessen gegängelten Amerikaner schielen! Die Interessen der Europäer sind für uns allemale wichtiger!
Der Ami ist nämlich Wort-wörtlich gesehen: weitab vom Schuss.
Steine werfen von da drüben, aus 10 km Höhe jemanden mit Bomben bepflastern, das trifft ihn nicht persönlich,
aber uns hier in „West-Asien“ viel eher!
Grüße
Magor
Ich muß mich eben selbst korrigieren!
Denn, gegen pro-semitische Beiträge hätte ich ja an und für sich garnichts einzuwenden.
Jedem das Seine.
Ich wollte eigentlich schreiben:
Semitisch-konzentrische Beiträge,
wo sie in den Mittelpunkt gestellt werden, als ob sie den Nabel der Welt bedeuten würden ...
und das finde ich bei allem Respekt irgendwie übertrieben!
Grüße
Magor
Denn, gegen pro-semitische Beiträge hätte ich ja an und für sich garnichts einzuwenden.
Jedem das Seine.
Ich wollte eigentlich schreiben:
Semitisch-konzentrische Beiträge,
wo sie in den Mittelpunkt gestellt werden, als ob sie den Nabel der Welt bedeuten würden ...
und das finde ich bei allem Respekt irgendwie übertrieben!
Grüße
Magor
.
Was hatten die Friedensdemonstrationen mit den Israelis zu tun, daß sie sich wieder angesprochen, oder hier, sich ausgelassen fühlen???
Hallo Magor
Vielleicht informierst Du Dich mal ein wenig über die Ereignisse im Golfkrieg von 1991:
http://www.nai-israel.com/israel/artikel/default.asp?CatID=1…) – und
http://www.nai-israel.com/aktuelles/headlines.asp?CatID=1&Ar…
Haschemi Rafsandschani, Ex-Präsident des Iran und einer der sogenannten "moderaten Kräfte", hat bereits erklärt, sollte ein islamisches Land die Atombombe besitzen, wäre die israelische Frage ein für alle Mal erledigt.
Für die Menschen in Tel Aviv und Jerusalem ist die Gefahr eines irakischen Raketenangriffs mit biologischen Gefechtsköpfen absolut real und ich denke die Israelis, bzw. die sie unterstützende Diaspora in Deutschland hat ein gutes Recht, immer wieder auf diesen Umstand hinzuweisen.
Soweit ich es sehe bin ich der Einzige hier im Goldforum, der nicht mit den Wölfen heult.
Die Wölfe sind in diesem Fall die guten Menschen vor dem Brandenburger Tor, für die George Bush ein Massenmörder und Saddam lediglich das kleinere Übel ist.
Ich behaupte mal, die "Friedensbewegung" wird in Berlin nicht einmal 10.000 Menschen zusammentrommeln können, die sich in einer Demonstration gegen Saddam Husseins Verbrecherregime engagieren.
Ich will hier niemand missionieren, aber solange mir WO diesen Thread nicht sperrt, oder mich Gestörte wie "goldonly" nicht unter Dauerbeschuß nehmen werde ich hier auch künftig Essays posten, die nicht nicht ganz zum "friedensbewegten mainstream" passen.
Für´s Erste empfehle ich Dir dazu die Lektüre des Essays von Hussain Al-Mozany im Beitrag #231
Gruß Konradi
---
Vor einer Niederlage des Völkerrechts
Wer siegt im Irak-Konflikt: Die Stärke des Rechts – oder das Recht des Stärkeren?
Von Robert Leicht
Wenn am Freitag der Weltsicherheitsrat zusammentritt, geht es nicht nur um den Irak, sondern um die Weltordnung insgesamt. Wird das westliche Bündnis diesen Tag überleben? Wird Europa zerfallen? Zur gewohnten Weltordnung gehören aber nicht nur die Bündnisse, dazu zählt auch das Völkerrecht. Und das Völkerrecht droht ebenfalls am Irak-Konflikt zu zerschellen. Sollten nämlich die USA, verbittert über eine „Blockade“ ihrer Politik im Sicherheitsrat, die Vereinten Nationen für irrelevant erklären und an ihnen vorbei den Krieg gegen den Irak eröffnen, wäre das kollektive Völkerrecht nicht weniger beschädigt als die Einheit des Westens.
Wer also wird am Freitag – falls es dann schon zur Abstimmung kommt – siegen: die Stärke des Rechts oder das Recht des Stärkeren? Die Frage ist nicht so naiv, wie sie klingt. Wer vorschnell antwortet: „Aber natürlich, wie immer, das Recht des Stärkeren!“, der hat nämlich ebenso schnell jeden Gedanken an ein allgemeinverbindliches Recht aus den Beziehungen zwischen den Mächten beseitigt. Dann wäre der Schwächere doppelt geschädigt, weil er künftig weder die Macht noch das Recht auf seiner Seite hätte. Aber was nützt ein Recht, das sich nicht durchsetzen lässt, weder gegen eine Supermacht noch gegen einen Schurkenstaat?
Die Stärke des Rechts oder das Recht des Stärkeren – dieser ungleiche Kampf zwischen dem hehren Prinzip und der harten Praxis durchzieht die Geschichte des Völkerrechts von ihrem Anfang an bis zum Ende dieser Woche. Gewiss ist der Schurkenstaat Irak im Unrecht – aber hat deshalb schon die Supermacht USA das Recht ganz auf ihrer Seite? Was hat das Völkerrecht noch zu sagen? Und was sagt es zum Konflikt mit dem Irak?
Das moderne Völkerrecht
- hat zwar die Lehre vom „gerechten Krieg“ überwunden – aber nicht den Krieg. Nota bene: Die verschiedenen Denkfiguren des „gerechten Krieges“ waren stets nur moralische Spekulationen der Theologen und Philosophen geblieben. Ob Friedrich der Große oder Napoleon oder Bismarck – sie alle führten ihre Kriege um der Macht willen. Angestoßen von Henri Dunant entwickelte sich an der Wende zum 20. Jahrhundert zaghaft ein Recht im Kriege (ius in bello), das heute in den Genfer und Haager Konventionen schwächelnd fortlebt. Das wie selbstverständlich beanspruchte Recht zum Kriege (ius ad bellum) blieb davon unberührt. Bis 1938 – denn damals ächtete der Kellog-Pakt erstmals jede Form des Angriffskrieges, freilich ohne Sanktionen gegen Angreifer vorzusehen.
Die Charta der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1945, von der heute jede Darstellung ausgehen muss, versucht nun einen realistischen Ausgleich. Sie enthält einerseits ein umfassendes Kriegsverbot und legt andererseits Regeln fest, nach denen einer Friedensstörung entgegenzutreten ist. Als Leitsatz gilt ein generelles Gewaltverbot: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ (Artikel 2 der UN-Charta)
Vom Gewaltverbot gibt es nur zwei Ausnahmen:
Die erste Ausnahme betrifft, im Fall eines bewaffneten Angriffs von außen, „das naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung“. Was immer man vom Regime Saddam Husseins halten mag – von einem bewaffneten Angriff auf die USA kann derzeit nicht die Rede sein. Also ein Präventivkrieg gegen den Irak – zur vorbeugenden Selbstverteidigung? Dafür gibt das Völkerrecht keine Handhabe, weil die äußerst engen Kriterien einen unmittelbar bevorstehenden Angriff voraussetzen, der schlechterdings keine andere Abwehr denkbar macht. (Deshalb hatte der Sicherheitsrat mit den Stimmen der USA im Jahr 1981 Israel für seine präventive Bombardierung eines irakischen Nuklearreaktors verurteilt, obwohl es damals – anders als heute – immerhin schon einen im Bau befindlichen Reaktor im Irak gab; der Irak stand freilich seinerzeit aus westlicher Sicht auf der „richtigen“ Seite im Kampf gegen den Iran.) Erst recht nicht reicht das Völkerrecht seine Hand zu einem Präemptivkrieg, mit dem auch nur das Aufkommen einer künftigen Gefahr verhindert werden soll. Und ganz gewiss untersagt es einen Angriffskrieg allein zum Zweck eines Regimewechsels; ein solcher Schlag verstieße gegen den ersten Hauptsatz des Völkerrechts, nämlich gegen die gleiche Souveränität und die territoriale Unversehrtheit aller Staaten. Dieser Satz schützt nun einmal alle Staaten (und dadurch die Ordnung zwischen ihnen), auch wenn einem die Ordnung in ihnen keineswegs gefällt.
Folglich kann es im Irak-Konflikt ausschließlich um die zweite Ausnahme vom umfassenden Gewaltverbot der UN-Charta gehen, um die Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta, die vom Sicherheitsrat – aber eben nur von diesem Gremium! – ergriffen werden können, wenn ein Staat „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit“ gefährdet. Für solche Zwangsmaßnahmen muss sich erstens im gesamten Sicherheitsrat (also unter seinen ständigen wie nichtständigen Mitgliedern) eine Mehrheit finden; außerdem darf, zweitens, keines der fünf ständigen Mitglieder gegen den Beschluss sein Veto einlegen. Gibt es keine Mehrheit oder doch ein Veto, dann gibt es keinen völkerrechtlich gültigen Rechtstitel für kollektive Zwangsmaßnahmen, auch nicht gegen den Irak. So einfach ist das und doch so kompliziert!
Patt im Sicherheitsrat:
Für diesen Fall haben die USA bereits angekündigt (und auch Tony Blair hat dies getan), dass sie sich vom Sicherheitsrat nicht an einem Angriff auf den Irak hindern lassen, wenn Saddam Hussein nicht das tut, was sie von ihm erwarten. Das wäre dann der Ernstfall – und im Grunde das Ende – für das kollektive Völkerrecht. Aber nun gibt es eine Reihe von Komplikationen, die diesen Befund wieder ins Zwielicht rücken.
Komplikation Nummer 1: Der Sicherheitsrat ist kein unabhängiges Gericht gleicher Richter, sondern ein politisches Organ mit fünf privilegierten Veto-Mächten. Seine Beschlüsse bewirken zwar formell gültiges Völkerrecht, aber keineswegs immer materielle Gerechtigkeit. Manches Veto kommt allein aus machtpolitischen Gründen zustande.
Komplikation Nummer 2: Aus diesem Grunde hat die Völkergemeinschaft bereits im Kosovo ohne UN-Mandat interveniert. Ein Mandat scheiterte damals an zwei Gründen: Der Kosovo war völkerrechtlich ein integraler Bestandteil des Staates Serbien – also galt ein striktes Interventionsverbot. Überdies drohte ein russisches Veto. Angesichts der Alternative „hilflos zusehen oder rechtlos helfen“ trat die Nato damals dem völkermörderischen Gemetzel jenseits des formellen Völkerrechts entgegen. Zwar ist die Abwehr eines akuten Genozids noch immer etwas anderes als die Entwaffnung eines potenziellen Gegners auf Verdacht. Aber es gibt eben auch den Extremfall, in dem sich die Frage stellt: Was tun, wenn der Sicherheitsrat nichts tun will?
Komplikation Nummer 3: Zwei Fragen sind zu unterscheiden – die eine betrifft den Tatbestand, die andere die Rechtsfolge. Erste Frage: Hält sich der Irak an die UN-Resolutionen, hat er abgerüstet? Hier liegt die Beweislast beim Irak, nicht bei den Vereinten Nationen. Der Irak hat 1991 einen Krieg verloren, der Waffenstillstand ließ ihn bis heute im Zustand eingeschränkter Souveränität zurück; er ist zur Abrüstung und zum Nachweis der Abrüstung verpflichtet. Dass Saddam Hussein dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist – dieser Tatbestand lässt sich mit guten Gründen feststellen. Aber die zweite Frage gilt den Folgen und Sanktionen – und dies ist nicht nur eine Frage des Rechts, sondern ebenso eine der politischen Opportunität und der Stabilität in der Region, auch nach einem Krieg.
An der Grenze des Völkerrechts:
Die Frage nach den Kriegsfolgen ist gemäß der UN-Charta allein im Sicherheitsrat zu beantworten. Aber die Antwort findet sich nicht im Lehrbuch des Völkerrechts, obwohl auch sie über die Legitimität eines Krieges entscheidet, zumindest nachträglich. Hier jedenfalls gilt das Diktum des jungen Bismarck: Wer einen Krieg beginnen will, sehe sich nach Gründen um, die auch nach dem Krieg noch Bestand haben. Solche Prognosen sind so problematisch, dass man sie nur im akutesten Notfall, also nie rein präventiv und schon gar nicht ohne Schulterschluss der Völkergemeinschaft treffen sollte. Was wäre auf Dauer gewonnen mit einem Sieg über den Irak – und einer Niederlage des Völkerrechts?
DIE ZEIT - 8 / 2003
Was hatten die Friedensdemonstrationen mit den Israelis zu tun, daß sie sich wieder angesprochen, oder hier, sich ausgelassen fühlen???
Hallo Magor
Vielleicht informierst Du Dich mal ein wenig über die Ereignisse im Golfkrieg von 1991:
http://www.nai-israel.com/israel/artikel/default.asp?CatID=1…) – und
http://www.nai-israel.com/aktuelles/headlines.asp?CatID=1&Ar…
Haschemi Rafsandschani, Ex-Präsident des Iran und einer der sogenannten "moderaten Kräfte", hat bereits erklärt, sollte ein islamisches Land die Atombombe besitzen, wäre die israelische Frage ein für alle Mal erledigt.
Für die Menschen in Tel Aviv und Jerusalem ist die Gefahr eines irakischen Raketenangriffs mit biologischen Gefechtsköpfen absolut real und ich denke die Israelis, bzw. die sie unterstützende Diaspora in Deutschland hat ein gutes Recht, immer wieder auf diesen Umstand hinzuweisen.
Soweit ich es sehe bin ich der Einzige hier im Goldforum, der nicht mit den Wölfen heult.
Die Wölfe sind in diesem Fall die guten Menschen vor dem Brandenburger Tor, für die George Bush ein Massenmörder und Saddam lediglich das kleinere Übel ist.
Ich behaupte mal, die "Friedensbewegung" wird in Berlin nicht einmal 10.000 Menschen zusammentrommeln können, die sich in einer Demonstration gegen Saddam Husseins Verbrecherregime engagieren.
Ich will hier niemand missionieren, aber solange mir WO diesen Thread nicht sperrt, oder mich Gestörte wie "goldonly" nicht unter Dauerbeschuß nehmen werde ich hier auch künftig Essays posten, die nicht nicht ganz zum "friedensbewegten mainstream" passen.
Für´s Erste empfehle ich Dir dazu die Lektüre des Essays von Hussain Al-Mozany im Beitrag #231
Gruß Konradi
---
Vor einer Niederlage des Völkerrechts
Wer siegt im Irak-Konflikt: Die Stärke des Rechts – oder das Recht des Stärkeren?
Von Robert Leicht
Wenn am Freitag der Weltsicherheitsrat zusammentritt, geht es nicht nur um den Irak, sondern um die Weltordnung insgesamt. Wird das westliche Bündnis diesen Tag überleben? Wird Europa zerfallen? Zur gewohnten Weltordnung gehören aber nicht nur die Bündnisse, dazu zählt auch das Völkerrecht. Und das Völkerrecht droht ebenfalls am Irak-Konflikt zu zerschellen. Sollten nämlich die USA, verbittert über eine „Blockade“ ihrer Politik im Sicherheitsrat, die Vereinten Nationen für irrelevant erklären und an ihnen vorbei den Krieg gegen den Irak eröffnen, wäre das kollektive Völkerrecht nicht weniger beschädigt als die Einheit des Westens.
Wer also wird am Freitag – falls es dann schon zur Abstimmung kommt – siegen: die Stärke des Rechts oder das Recht des Stärkeren? Die Frage ist nicht so naiv, wie sie klingt. Wer vorschnell antwortet: „Aber natürlich, wie immer, das Recht des Stärkeren!“, der hat nämlich ebenso schnell jeden Gedanken an ein allgemeinverbindliches Recht aus den Beziehungen zwischen den Mächten beseitigt. Dann wäre der Schwächere doppelt geschädigt, weil er künftig weder die Macht noch das Recht auf seiner Seite hätte. Aber was nützt ein Recht, das sich nicht durchsetzen lässt, weder gegen eine Supermacht noch gegen einen Schurkenstaat?
Die Stärke des Rechts oder das Recht des Stärkeren – dieser ungleiche Kampf zwischen dem hehren Prinzip und der harten Praxis durchzieht die Geschichte des Völkerrechts von ihrem Anfang an bis zum Ende dieser Woche. Gewiss ist der Schurkenstaat Irak im Unrecht – aber hat deshalb schon die Supermacht USA das Recht ganz auf ihrer Seite? Was hat das Völkerrecht noch zu sagen? Und was sagt es zum Konflikt mit dem Irak?
Das moderne Völkerrecht
- hat zwar die Lehre vom „gerechten Krieg“ überwunden – aber nicht den Krieg. Nota bene: Die verschiedenen Denkfiguren des „gerechten Krieges“ waren stets nur moralische Spekulationen der Theologen und Philosophen geblieben. Ob Friedrich der Große oder Napoleon oder Bismarck – sie alle führten ihre Kriege um der Macht willen. Angestoßen von Henri Dunant entwickelte sich an der Wende zum 20. Jahrhundert zaghaft ein Recht im Kriege (ius in bello), das heute in den Genfer und Haager Konventionen schwächelnd fortlebt. Das wie selbstverständlich beanspruchte Recht zum Kriege (ius ad bellum) blieb davon unberührt. Bis 1938 – denn damals ächtete der Kellog-Pakt erstmals jede Form des Angriffskrieges, freilich ohne Sanktionen gegen Angreifer vorzusehen.
Die Charta der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1945, von der heute jede Darstellung ausgehen muss, versucht nun einen realistischen Ausgleich. Sie enthält einerseits ein umfassendes Kriegsverbot und legt andererseits Regeln fest, nach denen einer Friedensstörung entgegenzutreten ist. Als Leitsatz gilt ein generelles Gewaltverbot: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ (Artikel 2 der UN-Charta)
Vom Gewaltverbot gibt es nur zwei Ausnahmen:
Die erste Ausnahme betrifft, im Fall eines bewaffneten Angriffs von außen, „das naturgegebene Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung“. Was immer man vom Regime Saddam Husseins halten mag – von einem bewaffneten Angriff auf die USA kann derzeit nicht die Rede sein. Also ein Präventivkrieg gegen den Irak – zur vorbeugenden Selbstverteidigung? Dafür gibt das Völkerrecht keine Handhabe, weil die äußerst engen Kriterien einen unmittelbar bevorstehenden Angriff voraussetzen, der schlechterdings keine andere Abwehr denkbar macht. (Deshalb hatte der Sicherheitsrat mit den Stimmen der USA im Jahr 1981 Israel für seine präventive Bombardierung eines irakischen Nuklearreaktors verurteilt, obwohl es damals – anders als heute – immerhin schon einen im Bau befindlichen Reaktor im Irak gab; der Irak stand freilich seinerzeit aus westlicher Sicht auf der „richtigen“ Seite im Kampf gegen den Iran.) Erst recht nicht reicht das Völkerrecht seine Hand zu einem Präemptivkrieg, mit dem auch nur das Aufkommen einer künftigen Gefahr verhindert werden soll. Und ganz gewiss untersagt es einen Angriffskrieg allein zum Zweck eines Regimewechsels; ein solcher Schlag verstieße gegen den ersten Hauptsatz des Völkerrechts, nämlich gegen die gleiche Souveränität und die territoriale Unversehrtheit aller Staaten. Dieser Satz schützt nun einmal alle Staaten (und dadurch die Ordnung zwischen ihnen), auch wenn einem die Ordnung in ihnen keineswegs gefällt.
Folglich kann es im Irak-Konflikt ausschließlich um die zweite Ausnahme vom umfassenden Gewaltverbot der UN-Charta gehen, um die Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta, die vom Sicherheitsrat – aber eben nur von diesem Gremium! – ergriffen werden können, wenn ein Staat „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit“ gefährdet. Für solche Zwangsmaßnahmen muss sich erstens im gesamten Sicherheitsrat (also unter seinen ständigen wie nichtständigen Mitgliedern) eine Mehrheit finden; außerdem darf, zweitens, keines der fünf ständigen Mitglieder gegen den Beschluss sein Veto einlegen. Gibt es keine Mehrheit oder doch ein Veto, dann gibt es keinen völkerrechtlich gültigen Rechtstitel für kollektive Zwangsmaßnahmen, auch nicht gegen den Irak. So einfach ist das und doch so kompliziert!
Patt im Sicherheitsrat:
Für diesen Fall haben die USA bereits angekündigt (und auch Tony Blair hat dies getan), dass sie sich vom Sicherheitsrat nicht an einem Angriff auf den Irak hindern lassen, wenn Saddam Hussein nicht das tut, was sie von ihm erwarten. Das wäre dann der Ernstfall – und im Grunde das Ende – für das kollektive Völkerrecht. Aber nun gibt es eine Reihe von Komplikationen, die diesen Befund wieder ins Zwielicht rücken.
Komplikation Nummer 1: Der Sicherheitsrat ist kein unabhängiges Gericht gleicher Richter, sondern ein politisches Organ mit fünf privilegierten Veto-Mächten. Seine Beschlüsse bewirken zwar formell gültiges Völkerrecht, aber keineswegs immer materielle Gerechtigkeit. Manches Veto kommt allein aus machtpolitischen Gründen zustande.
Komplikation Nummer 2: Aus diesem Grunde hat die Völkergemeinschaft bereits im Kosovo ohne UN-Mandat interveniert. Ein Mandat scheiterte damals an zwei Gründen: Der Kosovo war völkerrechtlich ein integraler Bestandteil des Staates Serbien – also galt ein striktes Interventionsverbot. Überdies drohte ein russisches Veto. Angesichts der Alternative „hilflos zusehen oder rechtlos helfen“ trat die Nato damals dem völkermörderischen Gemetzel jenseits des formellen Völkerrechts entgegen. Zwar ist die Abwehr eines akuten Genozids noch immer etwas anderes als die Entwaffnung eines potenziellen Gegners auf Verdacht. Aber es gibt eben auch den Extremfall, in dem sich die Frage stellt: Was tun, wenn der Sicherheitsrat nichts tun will?
Komplikation Nummer 3: Zwei Fragen sind zu unterscheiden – die eine betrifft den Tatbestand, die andere die Rechtsfolge. Erste Frage: Hält sich der Irak an die UN-Resolutionen, hat er abgerüstet? Hier liegt die Beweislast beim Irak, nicht bei den Vereinten Nationen. Der Irak hat 1991 einen Krieg verloren, der Waffenstillstand ließ ihn bis heute im Zustand eingeschränkter Souveränität zurück; er ist zur Abrüstung und zum Nachweis der Abrüstung verpflichtet. Dass Saddam Hussein dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist – dieser Tatbestand lässt sich mit guten Gründen feststellen. Aber die zweite Frage gilt den Folgen und Sanktionen – und dies ist nicht nur eine Frage des Rechts, sondern ebenso eine der politischen Opportunität und der Stabilität in der Region, auch nach einem Krieg.
An der Grenze des Völkerrechts:
Die Frage nach den Kriegsfolgen ist gemäß der UN-Charta allein im Sicherheitsrat zu beantworten. Aber die Antwort findet sich nicht im Lehrbuch des Völkerrechts, obwohl auch sie über die Legitimität eines Krieges entscheidet, zumindest nachträglich. Hier jedenfalls gilt das Diktum des jungen Bismarck: Wer einen Krieg beginnen will, sehe sich nach Gründen um, die auch nach dem Krieg noch Bestand haben. Solche Prognosen sind so problematisch, dass man sie nur im akutesten Notfall, also nie rein präventiv und schon gar nicht ohne Schulterschluss der Völkergemeinschaft treffen sollte. Was wäre auf Dauer gewonnen mit einem Sieg über den Irak – und einer Niederlage des Völkerrechts?
DIE ZEIT - 8 / 2003
konradi: Ich bewunder ja deine Tapferkeit auf wie ich meine verlorenem Posten! 
Schaut du mal hier Thread: Daran, wie man im eigenen Land die Menschen behandelt, kann man sie erkennen!
Im Geiste meiner roten Brüder vewahre ich mich dagegen, irgendeine Transmission US- amerikanischen Denkens als Weltdoktrin zu akzeptieren!
Zu viel Blut klebt am Geld!

Schaut du mal hier Thread: Daran, wie man im eigenen Land die Menschen behandelt, kann man sie erkennen!
Im Geiste meiner roten Brüder vewahre ich mich dagegen, irgendeine Transmission US- amerikanischen Denkens als Weltdoktrin zu akzeptieren!
Zu viel Blut klebt am Geld!

.
Irak-Krise :
BND wusste von mobilen Gift-Laboren
Bereits vor Beginn der aktuellen Krise hat der Bundesnachrichtendienst (BND) Hinweise auf die Existenz rollender Labore für die Produktion von Biowaffen im Irak erhalten. Nach den als zuverlässig eingestuften Angaben habe Saddam Hussein spätestens um das Jahr 2000 herum begonnen, solche mobile Anlagen bauen zu lassen.
Hamburg - Der BND unterrichtete schon vor Monaten sowohl das Kanzleramt als auch den Auswärtigen Ausschuss des Bundestags über den Verdacht. US-Außenminister Colin Powell hatte vor drei Wochen dem Weltsicherheitsrat Zeichnungen solcher rollenden Labore vorgelegt.
Für extrem unwahrscheinlich hält das Kanzleramt dagegen Meldungen, bei den mutmaßlichen Giftküchen handle es sich um jene Iveco- Lastwagen mit toxikologischen Laboren aus Deutschland, die in den achtziger Jahren mit offizieller Genehmigung der Bundesregierung in den Irak geliefert worden waren. Obwohl die Ausstattung der Labore ausgerechnet eine hessische Firma besorgte, die später in Verdacht geriet, die irakische Giftgasproduktion mit aufgebaut zu haben, gelten die Anlagen als völlig ungeeignet für die Produktion.
Die deutschen Lkw sollten nach Giftgaseinsätzen der irakischen Armee überprüfen, ob Saddams Truppen gefahrlos vorrücken können.
DER SPIEGEL 24.02.2003
Irak-Krise :
BND wusste von mobilen Gift-Laboren
Bereits vor Beginn der aktuellen Krise hat der Bundesnachrichtendienst (BND) Hinweise auf die Existenz rollender Labore für die Produktion von Biowaffen im Irak erhalten. Nach den als zuverlässig eingestuften Angaben habe Saddam Hussein spätestens um das Jahr 2000 herum begonnen, solche mobile Anlagen bauen zu lassen.
Hamburg - Der BND unterrichtete schon vor Monaten sowohl das Kanzleramt als auch den Auswärtigen Ausschuss des Bundestags über den Verdacht. US-Außenminister Colin Powell hatte vor drei Wochen dem Weltsicherheitsrat Zeichnungen solcher rollenden Labore vorgelegt.
Für extrem unwahrscheinlich hält das Kanzleramt dagegen Meldungen, bei den mutmaßlichen Giftküchen handle es sich um jene Iveco- Lastwagen mit toxikologischen Laboren aus Deutschland, die in den achtziger Jahren mit offizieller Genehmigung der Bundesregierung in den Irak geliefert worden waren. Obwohl die Ausstattung der Labore ausgerechnet eine hessische Firma besorgte, die später in Verdacht geriet, die irakische Giftgasproduktion mit aufgebaut zu haben, gelten die Anlagen als völlig ungeeignet für die Produktion.
Die deutschen Lkw sollten nach Giftgaseinsätzen der irakischen Armee überprüfen, ob Saddams Truppen gefahrlos vorrücken können.
DER SPIEGEL 24.02.2003
Hallo Konradi!
War ich irgendwie missverständlich?
Besorgte Menschen demonstrieren für den Erhalt des Friedens, was einem erst recht gefährdeten Israel ebenso zugute käme und eine Lea Rosh beschwert sich, daß die Menschen nur allgemein protestierten und nicht mit pro-Israel Plakaten durch die Gegend zogen : - ((
Die Dame hat ´nen leichten Hau, meine ich!
Was ´91 am Golf geschah, das brauch ich nicht nachzulesen in konterkarierten Erzählungen! Geschichte schreibt bzw. diktiert immer nur der Sieger! Ich war bis kurz vor´m „Desert Storm“ für mehrere Monate in der Region Ahwas und Bandar Imam in Persien, nahe an der Grenze zum Irak und bin ausreichend gut unterrichtet darüber, was da ablief, wer wen wann und gegen wen aufgewiegelt und aufgerüstet hatte!
Wir brauchen nicht zu diskutieren darüber, ob Hussein ein grausamer Diktator ist oder nicht, und ob gegen ihn demonstriert werden müsste. Allerdings solltest Du Dir die Frage stellen, wer ihn wohl brauchte, und warum er beim Desert Storm nicht einfach weggepustet wurde!
Kurz vor Vollendung wird abgedreht ... Kintopp!
Und Hussein, wie Milosevics festzunehmen und nach den Haag vors Gericht zu stellen, wie Al-Mozany es sich wünscht, dem es egal erscheint, seine eigenen Landsleute bombardiert zu wissen, fände ich eine reine Geldverschwendung! Erstens wird ein Milosevics in zehn Jahren nicht verurteilt sein, wenn sie das überhaupt ernstlich wollen (er könnte ja die Schnauze aufmachen und singen), zweitens ist eine Kugel billiger und die Vollstreckung dann auch sicherer.
Anstatt einen Krieg vom Zaum zu brechen, 500 mio USD für den oder die, die Hussein beseitigen ... dead or alive ...
Wetten, daß das klappte?
Ok, 1 mrd eben, oder zwei, alles kalkulierbar, der Krieg jedoch nicht! Und warum nicht so?
Warum nicht?
Weil es garnicht um Hussein geht !!!
Hussein ist nur die Marionette, die Legitimation!
Konradi, stelle Dir die Gesichter der Amis vor, wenn jemand Hussein morgen abnippeln würde ... der ganze schöne Krieg futsch???
Das hoch aufgerüstete Israel ist ein gewaltsam hineingestochener und immer wieder rabiat wühlender Dorn im Fleisch der gesamten arabischen Welt! Und das unter dem Schutz der Amerikaner, die jegliche Resolution gegen die Schweinereien der Israeli mit ihrem Veto immer wieder verhindern. Israel wird nicht nur vom Irak als der Scharfmacher Amerikas mit weitreichendem Einfluss dort und Machtinteressen im arabischen Raum angesehen. Wäre es also verwunderlich, daß sie Ziel eines möglichen Angriffes wären?
Die Sorge der Frau Rosh verstehe ich daher sehr wohl, dann sollte sie allerdings lieber auch für den Friedenserhalt appelieren und kämpfen, anstatt die Demonstranten zu kritisieren, Bush zu rechtfertigen und der Welt weinerlich den immer geprügelten armen Juden vorzuführen, der mit seinem Machteinfluss so unschuldig and der Situation nunmal nicht ist.
Grüße
Magor
War ich irgendwie missverständlich?
Besorgte Menschen demonstrieren für den Erhalt des Friedens, was einem erst recht gefährdeten Israel ebenso zugute käme und eine Lea Rosh beschwert sich, daß die Menschen nur allgemein protestierten und nicht mit pro-Israel Plakaten durch die Gegend zogen : - ((
Die Dame hat ´nen leichten Hau, meine ich!
Was ´91 am Golf geschah, das brauch ich nicht nachzulesen in konterkarierten Erzählungen! Geschichte schreibt bzw. diktiert immer nur der Sieger! Ich war bis kurz vor´m „Desert Storm“ für mehrere Monate in der Region Ahwas und Bandar Imam in Persien, nahe an der Grenze zum Irak und bin ausreichend gut unterrichtet darüber, was da ablief, wer wen wann und gegen wen aufgewiegelt und aufgerüstet hatte!
Wir brauchen nicht zu diskutieren darüber, ob Hussein ein grausamer Diktator ist oder nicht, und ob gegen ihn demonstriert werden müsste. Allerdings solltest Du Dir die Frage stellen, wer ihn wohl brauchte, und warum er beim Desert Storm nicht einfach weggepustet wurde!
Kurz vor Vollendung wird abgedreht ... Kintopp!
Und Hussein, wie Milosevics festzunehmen und nach den Haag vors Gericht zu stellen, wie Al-Mozany es sich wünscht, dem es egal erscheint, seine eigenen Landsleute bombardiert zu wissen, fände ich eine reine Geldverschwendung! Erstens wird ein Milosevics in zehn Jahren nicht verurteilt sein, wenn sie das überhaupt ernstlich wollen (er könnte ja die Schnauze aufmachen und singen), zweitens ist eine Kugel billiger und die Vollstreckung dann auch sicherer.
Anstatt einen Krieg vom Zaum zu brechen, 500 mio USD für den oder die, die Hussein beseitigen ... dead or alive ...
Wetten, daß das klappte?
Ok, 1 mrd eben, oder zwei, alles kalkulierbar, der Krieg jedoch nicht! Und warum nicht so?
Warum nicht?
Weil es garnicht um Hussein geht !!!
Hussein ist nur die Marionette, die Legitimation!
Konradi, stelle Dir die Gesichter der Amis vor, wenn jemand Hussein morgen abnippeln würde ... der ganze schöne Krieg futsch???
Das hoch aufgerüstete Israel ist ein gewaltsam hineingestochener und immer wieder rabiat wühlender Dorn im Fleisch der gesamten arabischen Welt! Und das unter dem Schutz der Amerikaner, die jegliche Resolution gegen die Schweinereien der Israeli mit ihrem Veto immer wieder verhindern. Israel wird nicht nur vom Irak als der Scharfmacher Amerikas mit weitreichendem Einfluss dort und Machtinteressen im arabischen Raum angesehen. Wäre es also verwunderlich, daß sie Ziel eines möglichen Angriffes wären?
Die Sorge der Frau Rosh verstehe ich daher sehr wohl, dann sollte sie allerdings lieber auch für den Friedenserhalt appelieren und kämpfen, anstatt die Demonstranten zu kritisieren, Bush zu rechtfertigen und der Welt weinerlich den immer geprügelten armen Juden vorzuführen, der mit seinem Machteinfluss so unschuldig and der Situation nunmal nicht ist.
Grüße
Magor
Hallo Magor,
meine volle Unterstützung, bzw Zustimmung: siehe #227
ziemlich am Ende des Postings.
Grüße aus Hamburg&
Schönes Wocnenende
meine volle Unterstützung, bzw Zustimmung: siehe #227
ziemlich am Ende des Postings.
Grüße aus Hamburg&
Schönes Wocnenende
.
Hallo Magor, Du schreibst:
(...) und eine Lea Rosh beschwert sich, daß die Menschen nur allgemein protestierten und nicht mit pro-Israel Plakaten durch die Gegend zogen : - ((
Lea Rosh sagte nur:
(...) Aber was bei der Demonstration in Berlin auffällt: Sie hatte keinen Protest gegen Saddam Hussein angemeldet. Ich habe jedenfalls keine überzeugenden Plakate dagegen gesehen, dass er seine eigene Bevölkerung mit Giftgas ermordet hat. Wo bleiben die Proteste gegen die Ermordung der Kurden, gegen die Ermordung der Schiiten? (...) Diese Demonstration war einseitig. Sie war gegen Amerika, gegen Bush und gegen einen eventuellen Krieg gerichtet.
Du schreibst:
Wir brauchen nicht zu diskutieren darüber, ob Hussein ein grausamer Diktator ist oder nicht, und ob gegen ihn demonstriert werden müsste. Allerdings solltest Du Dir die Frage stellen, wer ihn wohl brauchte, und warum er beim Desert Storm nicht einfach weggepustet wurde! Kurz vor Vollendung wird abgedreht ... Kintopp!
Ich denke schon, daß man über einen Mann "diskutieren" muß, der 2 Millionen Menschen umgebracht hat:
Jeder Deutsche ahnt, dass Hitler, wäre er 1945 im Besitz der Atombombe gewesen, sie auch über London oder Moskau abgeworfen hätte, um seine armselige Existenz im Berliner Bunker zu verlängern.( Michael Naumann)
Hätten Großbritannien und Frankreich 1938 im Münchner Abkommen nicht aus Furcht vor einem Krieg stillschweigend Hitlers Einmarsch in Österreich und die Tschechoslowakei hingenommen, wäre der Welt die Naziokkupation erspart geblieben, es hätte keinen Holocaust gegeben und 10 Millionen Deutsche wären nicht vertrieben worden. Saddam Hussein hat die Kurden im Irak schlechter behandelt als Hitler die Juden im Jahr 1936. Er griff zwei Länder an – den Iran und Kuwait – und beschoss zwei andere mit Raketen – Israel und Saudiarabien. Und er setzte gegen innere und äußere Feinde Giftgas ein. Fazit: Sein Regime ist repressiver als das Nazideutschland von 1936.
Paul Spiegel:Doch klar ist, dass Saddam Hussein sowohl für sein Volk wie auch für die gesamte Region eine große Gefahr darstellt.
Die Frage heißt also, können und wollen wir mit dieser Gefahr leben oder nicht? Wenn wir das nicht wollen, ist ein Angriff auf ihn möglicherweise ein Verteidigungskrieg. Wenn wir uns vorstellen, dass Saddam Hussein in der Lage wäre, chemische oder atomare Waffen über große Entfernungen zu befördern, was tun wir dagegen – wenn wir überhaupt noch dazu in der Lage sind?
Deswegen ist die Frage nicht so einfach aus abstrakt moralisch-ethischen Gründen zu beantworten. Klar ist auch, dass wir nicht immer Amerika als Weltpolizisten allein lassen und uns bequem zurücklehnen können.
Der Grund für Saddams "Überleben" im "Desert Storm" 1991 sollte bekannt sein:
- Zum einen gab es für Saddams Sturz kein UN-Mandat und zudem machten die arabischen Nachbarn deutlich, dass sie dabei nicht mitziehen würden.
- Zum anderen war den Amerikanern auch schon damals das Risiko zu groß, in blutige Häuserkämpfe um Bagdad verwickelt zu werden.
- Und schließlich gab es kein Konzept für einen Irak nach Saddam Hussein. Den Zerfall des Staates konnte Washington ebenso wenig wollen wie eine längere Besatzung des Landes durch US-Truppen.
Du schreibst:
Anstatt einen Krieg vom Zaum zu brechen, 500 mio USD für den oder die, die Hussein beseitigen ... dead or alive ... Wetten, daß das klappte? Ok, 1 mrd eben, oder zwei, alles kalkulierbar, der Krieg jedoch nicht! Und warum nicht so? Warum nicht? Weil es garnicht um Hussein geht !!!
Da hast Du schon recht, - allerdings nur im Rückblick auf die Zeit vor dem "Desert Storm" 1991:
Saddam rechnete damit, die USA würden ihm seine Aggression gegen Kuwait durchgehen lassen. Seit dem Krieg gegen den Iran im Jahr 1980 unterstützte Washington den Irak wirtschaftlich und militärisch und ignorierte dabei die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Es war ein von zynischer Realpolitik geprägtes Zweckbündnis: Amerika wurde zu einem der besten Kunden für irakisches Öl und half so, die Kriegskasse Saddams aufzufüllen. Geoffrey Kemp, Mittelostexperte der Regierung Reagan: "Wir waren nicht naiv, wir wussten, dass Saddam ein Schurke war, aber er war unser Schurke."
Allerdings hatte sich Saddam verrechnet, als er davon ausging, die USA würden ihm gestatten, sich das Scheichtum Kuweit einfach einzuverleiben und damit die Kontrolle über 20 Prozent der weltweiten Ölvorräte zu gewinnen. Ich erwähne das hier nur, damit Du mir nicht unterstellst, ich sei naiv.
Sowohl der Irak wie auch der Iran wurden seit Beginn der siebziger Jahre aufgerüstet -zunächst von den USA, dann von den westeuropäischen Verbündeten, von der UDSSR wie auch den osteuropäischen Verbündeten, - von China und von Nordkorea.
Und für uns friedensbewegte Deutsche möchte ich nur in aller Bescheidenheit anmerken: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen ..."
Erst das sogenannte genannte "dual containment-Konzept" von Bill Clinton 1993 hatte zum Ziel, dass der Irak und der Iran nicht mehr gegeneinander ausgespielt, sondern so geschwächt werden, dass sie keine Gefahr für die Verbündeten der USA in der Golfregion darstellten. Es hat - wie man nun sieht - damit nicht so ganz geklappt ...
Ich bin mir aber sicher, daß die gehätschelte Gleichung: "Blut für Öl" falsch ist. Neben der militärisch-terroristischen Bedrohung geht es geht immer auch um Öl, völlig klar, - schließlich kann man diesen Krieg gar nicht ohne das Thema Öl denken.
Im Kern des Konflikts steht aber die terroristische wie wirtschaftliche Erpressbarkeit der gesamten westlichen Welt
- oder etwas verständlicher: es geht genau um meinen und Deinen verdammten Arsch !
Wer als Argument nur die spritfressenden Sports Utility Vehicles durchgekallter amerikanischer Konsumidioten heranzieht macht es sich nicht nur leicht, sondern lügt sich auch selbstgefällig in die Tasche:
Eine Umfrage zum Irakkonflikt ergab: 53% halten die USA für die größte Gefahr für den Weltfrieden – nur 28% nennen den Irak, und nur 9% Nordkorea ! - Die Pisageneration demonstriert ihre beeindruckenden Geschichtskenntnisse...
Die UNO bot im Bosnienkonflikt ein Bild der Hilflosigkeit, Jugoslawien wäre ohne militärische Intervention von außen heute ein blutgetränktes Großserbien, und kein Kosovoalbaner hätte Milosevics Genozid überlebt. - Afghanistan wäre heute noch eine Hochburg des Terrorismus, wenn die USA dem Taliban-Regime nicht ein Ende bereitet hätten. Europäisches Nörgeln gegen den amerikanischen Unilateralismus ist schon allein deshalb lächerlich weil auf dem alten Kontinent alle Voraussetzungen gefehlt hätten, den Terrorismus in seinem Organisationszentrum zu bekämpfen.
Die Tötung Osama bin Ladens ist in den neunziger Jahren daran gescheitert weil Präsident Ford eine Direktive erteilt hatte, die die Ermordung ausländischer Despoten für den CIA untersagte. Dies wurde von den Administrationen Clinton und Bush bis zum 11. September 2001 strikt beachtet, denn Gelegenheiten, bin Laden endgültig aus dem Verkehr zu ziehen, gab es genug.
Mit Saddam Hussein scheint es nicht so einfach zu sein ...
- ach, noch etwas, Magor:
Das hoch aufgerüstete Israel ist ein gewaltsam hineingestochener und immer wieder rabiat wühlender Dorn im Fleisch der gesamten arabischen Welt!
Möchtest Du nicht vielleicht auch noch das Wort arabischen streichen ?
- Sorry, aber da bleibt mir nur Zynismus: Dann mach doch einfach mal einen Vorschlag für die "Endlösung" !
Konradi
.
Hallo Magor, Du schreibst:
(...) und eine Lea Rosh beschwert sich, daß die Menschen nur allgemein protestierten und nicht mit pro-Israel Plakaten durch die Gegend zogen : - ((
Lea Rosh sagte nur:
(...) Aber was bei der Demonstration in Berlin auffällt: Sie hatte keinen Protest gegen Saddam Hussein angemeldet. Ich habe jedenfalls keine überzeugenden Plakate dagegen gesehen, dass er seine eigene Bevölkerung mit Giftgas ermordet hat. Wo bleiben die Proteste gegen die Ermordung der Kurden, gegen die Ermordung der Schiiten? (...) Diese Demonstration war einseitig. Sie war gegen Amerika, gegen Bush und gegen einen eventuellen Krieg gerichtet.
Du schreibst:
Wir brauchen nicht zu diskutieren darüber, ob Hussein ein grausamer Diktator ist oder nicht, und ob gegen ihn demonstriert werden müsste. Allerdings solltest Du Dir die Frage stellen, wer ihn wohl brauchte, und warum er beim Desert Storm nicht einfach weggepustet wurde! Kurz vor Vollendung wird abgedreht ... Kintopp!
Ich denke schon, daß man über einen Mann "diskutieren" muß, der 2 Millionen Menschen umgebracht hat:
Jeder Deutsche ahnt, dass Hitler, wäre er 1945 im Besitz der Atombombe gewesen, sie auch über London oder Moskau abgeworfen hätte, um seine armselige Existenz im Berliner Bunker zu verlängern.( Michael Naumann)
Hätten Großbritannien und Frankreich 1938 im Münchner Abkommen nicht aus Furcht vor einem Krieg stillschweigend Hitlers Einmarsch in Österreich und die Tschechoslowakei hingenommen, wäre der Welt die Naziokkupation erspart geblieben, es hätte keinen Holocaust gegeben und 10 Millionen Deutsche wären nicht vertrieben worden. Saddam Hussein hat die Kurden im Irak schlechter behandelt als Hitler die Juden im Jahr 1936. Er griff zwei Länder an – den Iran und Kuwait – und beschoss zwei andere mit Raketen – Israel und Saudiarabien. Und er setzte gegen innere und äußere Feinde Giftgas ein. Fazit: Sein Regime ist repressiver als das Nazideutschland von 1936.
Paul Spiegel:Doch klar ist, dass Saddam Hussein sowohl für sein Volk wie auch für die gesamte Region eine große Gefahr darstellt.
Die Frage heißt also, können und wollen wir mit dieser Gefahr leben oder nicht? Wenn wir das nicht wollen, ist ein Angriff auf ihn möglicherweise ein Verteidigungskrieg. Wenn wir uns vorstellen, dass Saddam Hussein in der Lage wäre, chemische oder atomare Waffen über große Entfernungen zu befördern, was tun wir dagegen – wenn wir überhaupt noch dazu in der Lage sind?
Deswegen ist die Frage nicht so einfach aus abstrakt moralisch-ethischen Gründen zu beantworten. Klar ist auch, dass wir nicht immer Amerika als Weltpolizisten allein lassen und uns bequem zurücklehnen können.
Der Grund für Saddams "Überleben" im "Desert Storm" 1991 sollte bekannt sein:
- Zum einen gab es für Saddams Sturz kein UN-Mandat und zudem machten die arabischen Nachbarn deutlich, dass sie dabei nicht mitziehen würden.
- Zum anderen war den Amerikanern auch schon damals das Risiko zu groß, in blutige Häuserkämpfe um Bagdad verwickelt zu werden.
- Und schließlich gab es kein Konzept für einen Irak nach Saddam Hussein. Den Zerfall des Staates konnte Washington ebenso wenig wollen wie eine längere Besatzung des Landes durch US-Truppen.
Du schreibst:
Anstatt einen Krieg vom Zaum zu brechen, 500 mio USD für den oder die, die Hussein beseitigen ... dead or alive ... Wetten, daß das klappte? Ok, 1 mrd eben, oder zwei, alles kalkulierbar, der Krieg jedoch nicht! Und warum nicht so? Warum nicht? Weil es garnicht um Hussein geht !!!
Da hast Du schon recht, - allerdings nur im Rückblick auf die Zeit vor dem "Desert Storm" 1991:
Saddam rechnete damit, die USA würden ihm seine Aggression gegen Kuwait durchgehen lassen. Seit dem Krieg gegen den Iran im Jahr 1980 unterstützte Washington den Irak wirtschaftlich und militärisch und ignorierte dabei die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Es war ein von zynischer Realpolitik geprägtes Zweckbündnis: Amerika wurde zu einem der besten Kunden für irakisches Öl und half so, die Kriegskasse Saddams aufzufüllen. Geoffrey Kemp, Mittelostexperte der Regierung Reagan: "Wir waren nicht naiv, wir wussten, dass Saddam ein Schurke war, aber er war unser Schurke."
Allerdings hatte sich Saddam verrechnet, als er davon ausging, die USA würden ihm gestatten, sich das Scheichtum Kuweit einfach einzuverleiben und damit die Kontrolle über 20 Prozent der weltweiten Ölvorräte zu gewinnen. Ich erwähne das hier nur, damit Du mir nicht unterstellst, ich sei naiv.
Sowohl der Irak wie auch der Iran wurden seit Beginn der siebziger Jahre aufgerüstet -zunächst von den USA, dann von den westeuropäischen Verbündeten, von der UDSSR wie auch den osteuropäischen Verbündeten, - von China und von Nordkorea.
Und für uns friedensbewegte Deutsche möchte ich nur in aller Bescheidenheit anmerken: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen ..."
Erst das sogenannte genannte "dual containment-Konzept" von Bill Clinton 1993 hatte zum Ziel, dass der Irak und der Iran nicht mehr gegeneinander ausgespielt, sondern so geschwächt werden, dass sie keine Gefahr für die Verbündeten der USA in der Golfregion darstellten. Es hat - wie man nun sieht - damit nicht so ganz geklappt ...
Ich bin mir aber sicher, daß die gehätschelte Gleichung: "Blut für Öl" falsch ist. Neben der militärisch-terroristischen Bedrohung geht es geht immer auch um Öl, völlig klar, - schließlich kann man diesen Krieg gar nicht ohne das Thema Öl denken.
Im Kern des Konflikts steht aber die terroristische wie wirtschaftliche Erpressbarkeit der gesamten westlichen Welt
- oder etwas verständlicher: es geht genau um meinen und Deinen verdammten Arsch !
Wer als Argument nur die spritfressenden Sports Utility Vehicles durchgekallter amerikanischer Konsumidioten heranzieht macht es sich nicht nur leicht, sondern lügt sich auch selbstgefällig in die Tasche:
Eine Umfrage zum Irakkonflikt ergab: 53% halten die USA für die größte Gefahr für den Weltfrieden – nur 28% nennen den Irak, und nur 9% Nordkorea ! - Die Pisageneration demonstriert ihre beeindruckenden Geschichtskenntnisse...
Die UNO bot im Bosnienkonflikt ein Bild der Hilflosigkeit, Jugoslawien wäre ohne militärische Intervention von außen heute ein blutgetränktes Großserbien, und kein Kosovoalbaner hätte Milosevics Genozid überlebt. - Afghanistan wäre heute noch eine Hochburg des Terrorismus, wenn die USA dem Taliban-Regime nicht ein Ende bereitet hätten. Europäisches Nörgeln gegen den amerikanischen Unilateralismus ist schon allein deshalb lächerlich weil auf dem alten Kontinent alle Voraussetzungen gefehlt hätten, den Terrorismus in seinem Organisationszentrum zu bekämpfen.
Die Tötung Osama bin Ladens ist in den neunziger Jahren daran gescheitert weil Präsident Ford eine Direktive erteilt hatte, die die Ermordung ausländischer Despoten für den CIA untersagte. Dies wurde von den Administrationen Clinton und Bush bis zum 11. September 2001 strikt beachtet, denn Gelegenheiten, bin Laden endgültig aus dem Verkehr zu ziehen, gab es genug.
Mit Saddam Hussein scheint es nicht so einfach zu sein ...
- ach, noch etwas, Magor:
Das hoch aufgerüstete Israel ist ein gewaltsam hineingestochener und immer wieder rabiat wühlender Dorn im Fleisch der gesamten arabischen Welt!
Möchtest Du nicht vielleicht auch noch das Wort arabischen streichen ?
- Sorry, aber da bleibt mir nur Zynismus: Dann mach doch einfach mal einen Vorschlag für die "Endlösung" !
Konradi
.
@ All Black,
Deinen Aufsatz 223 habe ich seinerzeit registriert und auch für sehr fundiert gefunden! Bei diesem Thema ist es leider so arg schwer zu vermeiden sich lapidaren Anschuldigungen bezüglich Antisemitismus auszusetzen. Beim erneuten durchlesen Deiner Argumente ist mir aufgefallen, dass ich denselben Gedanken aufgegriffen hatte, Du als Stachel, ich als Dorn. Irgendwo las ich von Dir auch mal einen HJ Vergleich der mir schon ein Schmunzeln abgenötigt hatte : - ),
wollte aber nicht in der Wunde bohren … Grüße zurück nach Hamburg!
@ Konradi,
über die Lea ziehe ich jetzt nicht mehr her, sie steht Dir anscheinend doch zu nahe ..
Das mit dem Hau nehme ich also zurück … vielleicht hat sie einfach nur zuwenig Fantasie.
Du erwähnst ausgerechnet die richtigen Beispiele Konradi: Jugoslawien, Bosnien, Serbien ..
Hast Du Dich mal damit beschäftigt, wer die Ladung für diese Explosion gelegt hatte? Wer wofür 1920 ein tausendjähriges Ungarn zerschlagen und 70 % des Landes und 60 % ihrer Bevölkerung in westliche und östliche Interessensphären aufgeteilt hat? Wer die unnatürlichen, künstlichen Gebilde aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kreierte, wie z.B. Siebenbürgen zugeschlagen an Rumänien, alleine zur leichteren Ausbeutbarkeit der dortigen Bodenschätze, insbesondere von Gold, der kann die Verantwortung für das geschaffene Elend und Leid nicht von sich weisen! Der Verantwortung muß er sich irgendwann stellen und dafür auch geradestehen! So geschaffene Staaten mit ihren Marionettenregimes sind nur solange zusammenzuhalten, solange diktatorische Zwänge aufrechterhalten werden können. Dies wurde in Europa ebenso aus Raffgier verursacht und gesteuert wie es auch mit dem ehemaligen osmanischen Reich und den meisten zentral- und westafrikanischen Ländern der Fall war …
aber, das Thema hatten wir ja schon mal.
Zynisch sind Deine nur auf eine bestimmte Art der Endlösung fixierten Gedanken Konradi!
Zynisch ist es nur, wenn Deine Fantasie nur die eine einzige Endlösung hergibt!
Warum eigentlich Endlösung?
Eine Lösung der bestehenden Probleme kann einen Anfang, nicht das Ende bedeuten!
„Im Kern des Konflikts steht aber die terroristische wie wirtschaftliche Erpressbarkeit der gesamten westlichen Welt
- oder etwas verständlicher: es geht genau um meinen und Deinen verdammten Arsch ! „
Das sehe ich, lieber Konradi, ganz anders!
Es wird zwar leichtfertig Dein und um mein Arsch gefährdet, allerdings viel weniger für Deine persönlichen Interessen, sondern insbesondere um die Macht- und Finanzinteressen der Multis!
Die Welt terroristisch erpressen und aussaugen tun seit Jahrhunderten die davon in Saus und Braus lebenden Fürsten- und Herrenhäuser, sowie die Großmultis! Hierbei meine ich gar nicht nur das Ausbeuten der 3. Welt, nein, sie scheuen sich genauso wenig Dich und mich für ihre Eigeninteressen auszulutschen! Ich gebe zu, durch glücklichen Umstand in Mitteleuropa lebend in gewissem Maße von diesem Ausnutzen der anderen durch ein besseres eigenes leben selbst auch zu profitieren, zumindest verglichen mit den armen Schweinen woanders. Das war aber auch bei uns bis vor einigen Jahrzehnten nicht freiwillig angeboten! Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften mussten sich die geringste Partizipation des Malochers am Wohlstand gegen allerschärfsten Widerstand erkämpfen! Ein freiwilliges miteinander, ein gut leben und die anderen auch irgendwie noch leben lassen, das Angebot kam niemals freiwillig herüber!
Ein Teil dieser 3. Welt hat dies nun auch begriffen. Sie verlangt ihren Anteil. Sie misstraut mittlerweile ihren von der westlichen Welt gegängelten Marionetten und begreift, dass freiwillig sich niemals etwas ändern würde. Sie sehen es mittlerweile klarer, daß sie sich durch gezieltes gegeneinander aufwiegeln und aufrüsten bisher nur ausnehmen liessen.
Die islamische Glaubensgemeinschaft sieht die (Wieder-) Herstellung ihrer Gleichberechtigung als ihre Aufgabe an, sie propagieren, ihre Glaubensbrüder im Widerstand gegen diesen, zwecks ihrer weiteren Ausbeutung arrangierten Kreuzzug der Nichtgläubigen zusammenzuführen.
In gewissem Maße doch recht nachvollziehbare Gründe!
Erst recht aufmarschieren, aus Angst um Deinen Arsch?
Hast Du bedacht, welche Gefahren das in sich birgt und ob mit einer Bombardierung Iraks und dem Einsetzen einer neuen Marionette der westlichen Neokolonialisten das Problem eliminiert wäre?
Nun wärst Du an der Reihe, hier eine Endlösung zu umreissen, denn mit diesen Methoden sehe ich wirklich nur die Möglichkeit vor uns:
Entweder wir schaffen sie, oder sie schaffen uns!
Um ein friedliches Nebeneinander geht’s denen jetzt nicht, und danach geht es definitiv nimmer mehr!
Dem ich meinen Nick entlieh, den betrachtet man als einen Visionär.
Ich könnte mich ja mal bemühen, seinem Namen gerecht zu werden,
zu fantasieren, und Dir meine Vision zu skizzieren und sie Dir vorzustellen.
Meine Vision ist allerdings anders, als Du mit Deiner Endlösung ihn Dir vorstellen kannst.
Er gründet sich auf die Lehre aus der Geschichte, und mündet in der Erkenntnis, dass nur ein freiwilliges, partnerschaftliches und gleichberechtigtes, weltumspannendes miteinander die Lösung solcher gegenwärtigen Spannungen sein kann.
Kein übergestülpter Globalismus, nein, autarke anerkannte Staaten in freiwilliger Bindung zueinander!
Ein leben und leben lassen sozusagen!
Nicht gewaltfrei, nein, wo denkst Du hin, nötigenfalls erzwungen!
Allerdings, ein ausgeübter Zwang nicht wegen durchsichtiger Öl-Interessen oder sonstigen fadenscheinigen Begründungen, sondern durch eine UN – gesteuerte „Weltmacht“ im gemeinsamen Interesse der Nationen, und im Interesse aller Bevölkerungsschichten, nicht nur des Großkapitals!
Dann mal der Reihe nach:
Was war?
Feudalismus,
Kapitalismus,
Kommunismus …
Fast egal, ob demokratisch oder diktatorisch verabreicht,
alle Systeme hatten nicht ausschließlich schlechte Grundgedanken, sie scheiterten allesamt an der menschlichen Macht- und Raffgier und mangelnder Kontrolle der Machthaber.
Der Kommunismus ... die Menschen waren zu weich ihn durchzusetzen, die, die Durchsetzungskraft hatten, nutzten ihn zu ihrem eigenen Vorteil, d.h. Kapitalismus im Kommunismus.
Der Kapitalismus funktioniert in der Art, wie es betrieben wird und wurde, nur solange, solange Ausbeutung eines Schwächeren, sei es Kolonialismus durch Gewalt oder Kolonialismus durch die Macht des Geldes gewährleistet werden kann!
Was erkanntermaßen fehlte: Regel und Ordnung, und dies nicht nur für den Plebs!
Regel und Ordnung in der Beziehung der Staaten zueinander und Regelung der Macht und dem zulässigen Einfluss des Kapitals.
Was ist?
Eine sich ausgenutzt fühlendes und sich gegen weitere Ausbeutung zur Wehr setzende 3. Welt, welche die Machtdemonstration einer vom Großkapital gesteuerten Armeen sicherlich nicht als einen „Kampf um das Gemeinwohl“ anerkennt.
Ein aus eben denselben Gründen uneinige „Alte Welt“, die moralisch sich mit diesen durchsichtigen und fadenscheinigen Angriffsgründen schlecht identifizieren mag. Eine Welt, die alle von ihr vertretenen Moralvorstellungen mit dem zulassen von neuem, offensichtlichem Raub-Kolonialismus in den Staub treten würde.
Was könnte?
Gute, brauchbare Ansätze sind vorhanden, neue Gesetze müssten kaum welche her.
Vorzugehen also, wie bei einer Anlage:
Die guten Entwicklungen verstärken, die erkannt negativen radikal abschneiden.
Ad hoc Maßnahmen:
- Sofortige Übertragung der Befehlsgewalt über die Truppen am Golf auf die UN und Ausstattung dieser mit allen dafür notwendigen Vollmachten und geeignetem Führungs- und Kontrollpersonal nach einem Länderschlüssel.
- Übertragung der Oberbefehlsgewalt über die Streitkräfte aller Mitgliedsländer an die UN
- Länderschlüssel für Mitspracherecht nach Bevölkerungszahl multipliziert mit Faktor für Pisa-gemessenem Bildungsgrad
- Abschaffung des Vetorechtes, Entscheid ausschließlich über Mehrheit nach Länderschlüssel
- Installation von bis auf die Zähne modernst bewaffneter Blauhelme-Friedenstruppen in zig millionen-Stärke im Irak, Iran, Israel, Palästina, Lybien, Nigeria, Rhodesien, ja, auch z.B. in Rumänien mit dem erklärten Ziel einer Entwaffnung, bzw. Durchsetzung und Sicherstellung der Menscherechte
Deckung des zus. Finanzbedarfes:
Nach dem Grundprinzip für die Produktenhaftung Aufteilung der Kosten auf alle ermittelbaren Waffenlieferanten, ihren Finanziers und die Lieferung ermöglichenden Organe
Maßnahmen á lá long:
-Überprüfung und Neubewertung aller bisherigen, per Vetorecht abgeschmetterten UN – Resolutionsanträge
- Durchsetzung der verabschiedeten Resolutionen.
- Durchsetzung und Festigung der Gewalten-Dreiteilung mit einer zusätzlich einzuführender 4. Gewalt, einer die judikative, legislative und exekutive Staatsgewalt überwachende Kontroll-Instanz, die korruptionsfreie Parteienlandschaften und einen zweckgebundenen wirtschaftlichen Einsatz der Staatsfinanzen sicherzustellen hätte. Diese Kontrollinstanz wäre auch zuständig für eine Aufsicht über allen Schlüsselindustrien und deren Produktenhaftung auch nach Gesichtpunkten einer möglichen Beeinträchtigung der Menschenrechte, sowie Prüfung und Zulassung ihrer Absatzmärkte
- Einbindung der Universitäten in die Staatslenkung, Staats- und Bevölkerungsentwicklung, sei es für Bildung, Sozialwesen, Politologie, Planung und Entwicklung zukünftiger Vorhaben, und Ausstattung dieser Unis mit Richtlinienkompetenz,
zum finanziellen Ausgleich könnte in Deutschland z.B. die Hälfte der Bundestagsabgeordneten nachhause geschickt werden
und wenn ich schonmal dabei bin:
- Altersgrenze für Abgeordnete und Verantwortungsträger in der Staatslenkung: 65 Jahre
- Durchschnittsalter dieser Personengruppe: maximal 40 Jahre
- Festsetzung von regionalen Mindestlöhnen und regionalen Tarifsätzen, zu deren Unterwanderung weder 320 Euro Verträge noch Erntehilfskräfte usw. zulässig wären
- Überleitung des Besteuerungssystems von der herkömmlichen Einkommen- und Lohnsteuer, Gewerbe …- Steuer, zu Produktensteuer einzuhalten direkt an der Kasse, wie heute die Mehrwertsteuer.
- Abschaffung aller Subventionen für jegliche Art Produkte und Dienstleistungen.
Subventionen dürfen zukünftig nur ausschließlich zugeteilt werden bei notwendigen Auffangaktionen unverschuldeter Notsituationen, wie Naturkatastrophen usw.
- Entmachtung und Entrümpelung der EU- Bürokratie mit Ziel einer Auflösung der EU und Überleitung in eine UN-überwachte, weltumgreifende Sicherheits-, Bevölkerungs- Gesundheits-, Migrations-, Ernährungs- und Agrarplanung.
Puh, für heute habe ich genügend Systemänderungen er-fantasiert, wenn Dir noch welche einfallen sollten, kannst Dich gerne dran beteiligen, sie können noch gerne mit aufgenommen werden.
Dann brauchten sie nur noch ratifiziert und irgendwie umgesetzt zu werden …
Grüße
Magor
Deinen Aufsatz 223 habe ich seinerzeit registriert und auch für sehr fundiert gefunden! Bei diesem Thema ist es leider so arg schwer zu vermeiden sich lapidaren Anschuldigungen bezüglich Antisemitismus auszusetzen. Beim erneuten durchlesen Deiner Argumente ist mir aufgefallen, dass ich denselben Gedanken aufgegriffen hatte, Du als Stachel, ich als Dorn. Irgendwo las ich von Dir auch mal einen HJ Vergleich der mir schon ein Schmunzeln abgenötigt hatte : - ),
wollte aber nicht in der Wunde bohren … Grüße zurück nach Hamburg!
@ Konradi,
über die Lea ziehe ich jetzt nicht mehr her, sie steht Dir anscheinend doch zu nahe ..
Das mit dem Hau nehme ich also zurück … vielleicht hat sie einfach nur zuwenig Fantasie.
Du erwähnst ausgerechnet die richtigen Beispiele Konradi: Jugoslawien, Bosnien, Serbien ..
Hast Du Dich mal damit beschäftigt, wer die Ladung für diese Explosion gelegt hatte? Wer wofür 1920 ein tausendjähriges Ungarn zerschlagen und 70 % des Landes und 60 % ihrer Bevölkerung in westliche und östliche Interessensphären aufgeteilt hat? Wer die unnatürlichen, künstlichen Gebilde aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen kreierte, wie z.B. Siebenbürgen zugeschlagen an Rumänien, alleine zur leichteren Ausbeutbarkeit der dortigen Bodenschätze, insbesondere von Gold, der kann die Verantwortung für das geschaffene Elend und Leid nicht von sich weisen! Der Verantwortung muß er sich irgendwann stellen und dafür auch geradestehen! So geschaffene Staaten mit ihren Marionettenregimes sind nur solange zusammenzuhalten, solange diktatorische Zwänge aufrechterhalten werden können. Dies wurde in Europa ebenso aus Raffgier verursacht und gesteuert wie es auch mit dem ehemaligen osmanischen Reich und den meisten zentral- und westafrikanischen Ländern der Fall war …
aber, das Thema hatten wir ja schon mal.
Zynisch sind Deine nur auf eine bestimmte Art der Endlösung fixierten Gedanken Konradi!
Zynisch ist es nur, wenn Deine Fantasie nur die eine einzige Endlösung hergibt!
Warum eigentlich Endlösung?
Eine Lösung der bestehenden Probleme kann einen Anfang, nicht das Ende bedeuten!
„Im Kern des Konflikts steht aber die terroristische wie wirtschaftliche Erpressbarkeit der gesamten westlichen Welt
- oder etwas verständlicher: es geht genau um meinen und Deinen verdammten Arsch ! „
Das sehe ich, lieber Konradi, ganz anders!
Es wird zwar leichtfertig Dein und um mein Arsch gefährdet, allerdings viel weniger für Deine persönlichen Interessen, sondern insbesondere um die Macht- und Finanzinteressen der Multis!
Die Welt terroristisch erpressen und aussaugen tun seit Jahrhunderten die davon in Saus und Braus lebenden Fürsten- und Herrenhäuser, sowie die Großmultis! Hierbei meine ich gar nicht nur das Ausbeuten der 3. Welt, nein, sie scheuen sich genauso wenig Dich und mich für ihre Eigeninteressen auszulutschen! Ich gebe zu, durch glücklichen Umstand in Mitteleuropa lebend in gewissem Maße von diesem Ausnutzen der anderen durch ein besseres eigenes leben selbst auch zu profitieren, zumindest verglichen mit den armen Schweinen woanders. Das war aber auch bei uns bis vor einigen Jahrzehnten nicht freiwillig angeboten! Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften mussten sich die geringste Partizipation des Malochers am Wohlstand gegen allerschärfsten Widerstand erkämpfen! Ein freiwilliges miteinander, ein gut leben und die anderen auch irgendwie noch leben lassen, das Angebot kam niemals freiwillig herüber!
Ein Teil dieser 3. Welt hat dies nun auch begriffen. Sie verlangt ihren Anteil. Sie misstraut mittlerweile ihren von der westlichen Welt gegängelten Marionetten und begreift, dass freiwillig sich niemals etwas ändern würde. Sie sehen es mittlerweile klarer, daß sie sich durch gezieltes gegeneinander aufwiegeln und aufrüsten bisher nur ausnehmen liessen.
Die islamische Glaubensgemeinschaft sieht die (Wieder-) Herstellung ihrer Gleichberechtigung als ihre Aufgabe an, sie propagieren, ihre Glaubensbrüder im Widerstand gegen diesen, zwecks ihrer weiteren Ausbeutung arrangierten Kreuzzug der Nichtgläubigen zusammenzuführen.
In gewissem Maße doch recht nachvollziehbare Gründe!
Erst recht aufmarschieren, aus Angst um Deinen Arsch?
Hast Du bedacht, welche Gefahren das in sich birgt und ob mit einer Bombardierung Iraks und dem Einsetzen einer neuen Marionette der westlichen Neokolonialisten das Problem eliminiert wäre?
Nun wärst Du an der Reihe, hier eine Endlösung zu umreissen, denn mit diesen Methoden sehe ich wirklich nur die Möglichkeit vor uns:
Entweder wir schaffen sie, oder sie schaffen uns!
Um ein friedliches Nebeneinander geht’s denen jetzt nicht, und danach geht es definitiv nimmer mehr!
Dem ich meinen Nick entlieh, den betrachtet man als einen Visionär.
Ich könnte mich ja mal bemühen, seinem Namen gerecht zu werden,
zu fantasieren, und Dir meine Vision zu skizzieren und sie Dir vorzustellen.
Meine Vision ist allerdings anders, als Du mit Deiner Endlösung ihn Dir vorstellen kannst.
Er gründet sich auf die Lehre aus der Geschichte, und mündet in der Erkenntnis, dass nur ein freiwilliges, partnerschaftliches und gleichberechtigtes, weltumspannendes miteinander die Lösung solcher gegenwärtigen Spannungen sein kann.
Kein übergestülpter Globalismus, nein, autarke anerkannte Staaten in freiwilliger Bindung zueinander!
Ein leben und leben lassen sozusagen!
Nicht gewaltfrei, nein, wo denkst Du hin, nötigenfalls erzwungen!
Allerdings, ein ausgeübter Zwang nicht wegen durchsichtiger Öl-Interessen oder sonstigen fadenscheinigen Begründungen, sondern durch eine UN – gesteuerte „Weltmacht“ im gemeinsamen Interesse der Nationen, und im Interesse aller Bevölkerungsschichten, nicht nur des Großkapitals!
Dann mal der Reihe nach:
Was war?
Feudalismus,
Kapitalismus,
Kommunismus …
Fast egal, ob demokratisch oder diktatorisch verabreicht,
alle Systeme hatten nicht ausschließlich schlechte Grundgedanken, sie scheiterten allesamt an der menschlichen Macht- und Raffgier und mangelnder Kontrolle der Machthaber.
Der Kommunismus ... die Menschen waren zu weich ihn durchzusetzen, die, die Durchsetzungskraft hatten, nutzten ihn zu ihrem eigenen Vorteil, d.h. Kapitalismus im Kommunismus.
Der Kapitalismus funktioniert in der Art, wie es betrieben wird und wurde, nur solange, solange Ausbeutung eines Schwächeren, sei es Kolonialismus durch Gewalt oder Kolonialismus durch die Macht des Geldes gewährleistet werden kann!
Was erkanntermaßen fehlte: Regel und Ordnung, und dies nicht nur für den Plebs!
Regel und Ordnung in der Beziehung der Staaten zueinander und Regelung der Macht und dem zulässigen Einfluss des Kapitals.
Was ist?
Eine sich ausgenutzt fühlendes und sich gegen weitere Ausbeutung zur Wehr setzende 3. Welt, welche die Machtdemonstration einer vom Großkapital gesteuerten Armeen sicherlich nicht als einen „Kampf um das Gemeinwohl“ anerkennt.
Ein aus eben denselben Gründen uneinige „Alte Welt“, die moralisch sich mit diesen durchsichtigen und fadenscheinigen Angriffsgründen schlecht identifizieren mag. Eine Welt, die alle von ihr vertretenen Moralvorstellungen mit dem zulassen von neuem, offensichtlichem Raub-Kolonialismus in den Staub treten würde.
Was könnte?
Gute, brauchbare Ansätze sind vorhanden, neue Gesetze müssten kaum welche her.
Vorzugehen also, wie bei einer Anlage:
Die guten Entwicklungen verstärken, die erkannt negativen radikal abschneiden.
Ad hoc Maßnahmen:
- Sofortige Übertragung der Befehlsgewalt über die Truppen am Golf auf die UN und Ausstattung dieser mit allen dafür notwendigen Vollmachten und geeignetem Führungs- und Kontrollpersonal nach einem Länderschlüssel.
- Übertragung der Oberbefehlsgewalt über die Streitkräfte aller Mitgliedsländer an die UN
- Länderschlüssel für Mitspracherecht nach Bevölkerungszahl multipliziert mit Faktor für Pisa-gemessenem Bildungsgrad
- Abschaffung des Vetorechtes, Entscheid ausschließlich über Mehrheit nach Länderschlüssel
- Installation von bis auf die Zähne modernst bewaffneter Blauhelme-Friedenstruppen in zig millionen-Stärke im Irak, Iran, Israel, Palästina, Lybien, Nigeria, Rhodesien, ja, auch z.B. in Rumänien mit dem erklärten Ziel einer Entwaffnung, bzw. Durchsetzung und Sicherstellung der Menscherechte
Deckung des zus. Finanzbedarfes:
Nach dem Grundprinzip für die Produktenhaftung Aufteilung der Kosten auf alle ermittelbaren Waffenlieferanten, ihren Finanziers und die Lieferung ermöglichenden Organe
Maßnahmen á lá long:
-Überprüfung und Neubewertung aller bisherigen, per Vetorecht abgeschmetterten UN – Resolutionsanträge
- Durchsetzung der verabschiedeten Resolutionen.
- Durchsetzung und Festigung der Gewalten-Dreiteilung mit einer zusätzlich einzuführender 4. Gewalt, einer die judikative, legislative und exekutive Staatsgewalt überwachende Kontroll-Instanz, die korruptionsfreie Parteienlandschaften und einen zweckgebundenen wirtschaftlichen Einsatz der Staatsfinanzen sicherzustellen hätte. Diese Kontrollinstanz wäre auch zuständig für eine Aufsicht über allen Schlüsselindustrien und deren Produktenhaftung auch nach Gesichtpunkten einer möglichen Beeinträchtigung der Menschenrechte, sowie Prüfung und Zulassung ihrer Absatzmärkte
- Einbindung der Universitäten in die Staatslenkung, Staats- und Bevölkerungsentwicklung, sei es für Bildung, Sozialwesen, Politologie, Planung und Entwicklung zukünftiger Vorhaben, und Ausstattung dieser Unis mit Richtlinienkompetenz,
zum finanziellen Ausgleich könnte in Deutschland z.B. die Hälfte der Bundestagsabgeordneten nachhause geschickt werden
und wenn ich schonmal dabei bin:
- Altersgrenze für Abgeordnete und Verantwortungsträger in der Staatslenkung: 65 Jahre
- Durchschnittsalter dieser Personengruppe: maximal 40 Jahre
- Festsetzung von regionalen Mindestlöhnen und regionalen Tarifsätzen, zu deren Unterwanderung weder 320 Euro Verträge noch Erntehilfskräfte usw. zulässig wären
- Überleitung des Besteuerungssystems von der herkömmlichen Einkommen- und Lohnsteuer, Gewerbe …- Steuer, zu Produktensteuer einzuhalten direkt an der Kasse, wie heute die Mehrwertsteuer.
- Abschaffung aller Subventionen für jegliche Art Produkte und Dienstleistungen.
Subventionen dürfen zukünftig nur ausschließlich zugeteilt werden bei notwendigen Auffangaktionen unverschuldeter Notsituationen, wie Naturkatastrophen usw.
- Entmachtung und Entrümpelung der EU- Bürokratie mit Ziel einer Auflösung der EU und Überleitung in eine UN-überwachte, weltumgreifende Sicherheits-, Bevölkerungs- Gesundheits-, Migrations-, Ernährungs- und Agrarplanung.
Puh, für heute habe ich genügend Systemänderungen er-fantasiert, wenn Dir noch welche einfallen sollten, kannst Dich gerne dran beteiligen, sie können noch gerne mit aufgenommen werden.
Dann brauchten sie nur noch ratifiziert und irgendwie umgesetzt zu werden …
Grüße
Magor
.
Tja, Magor -
dann ändere mal das Schweinesystem ! Ich gehör ja schon zu den alten Säcken,
die das Durchschnittsalter Deiner oligarchischen Weltordnung erreicht hat
Was glaubst Du wohl wo Du mich am 22. Oktober 1983 getroffen hättest ?
Stell Dir vor, ihr wollt das System verändern und wir verfetteten Frührentner wollen einfach nur mal richtig ausschlafen und abends bei einem Bier Thomas Gottschalk gucken ?
Entsetzlich, nicht wahr ? – Hinter meiner Eßzimmergarnitur stirbt gerade der brasilianische Regenwald und an meinen Goldminendividenden klebt noch das Blut von Soweto !
Ich bin also ein Zyniker und Du willst "ad hoc" die Endlösung für das "Großkapital"?
– Oder hast Du da vielleicht nur ein ziemlich dummes Eigentor geschossen ?
- Schön so ein Rundumschlag von Dir: alle Probleme gelöst, die Herzen wieder rein !
Grundsatzdiskussionen werde ich hier nicht führen. Nur soviel zur UNO :
Seit der Unterzeichnung der Uno-Charta 1945 sind viele Konflikte ausgefochten worden, die Millionen von Opfern gekostet haben, ohne dass sich der Sicherheitsrat jeweils im Voraus mit ihnen beschäftigt hätte.
Der Artikel II der Charta regelt die Rechte und Pflichten der Mitglieder. In ihm wird der Staatensouveränität die primäre Rolle in den internationalen Beziehungen zuerkannt, aber gleichzeitig festgelegt, dass die Staaten ihre Streitigkeiten nur "mit friedlichen Mitteln" zu regeln haben. In Abs.4 wird ein allgemeines Gewaltverbot ausgesprochen: Die Mitglieder verzichten "auf Androhung oder Anwendung von Gewalt" - hehre Grundsätze, die nie eingehalten wurden !
Für die Russen war die UNO 40 Jahre lang sowieso nur eine Propagandabühne: mit seinem legendären Veto-"Njet" hatte Andrej Gromyko stets dafür gesorgt, daß sich die Beschlüsse der Völkergemeinschaft der Nationalstaatssouveränität unterordnen mußten.
Während des "Kalten Kriegs" war der Sicherheitsrat also meistens durch die Konfrontation zwischen Ost und West lahmgelegt, im Koreakrieg kam die Uno-Aktion nur dank der Abwesenheit der Sowjetunion zustande.
Auch heute ist die Zusammensetzung des Rates nur ein Abbild der politischer Kräfteverhältnisse und dient eher den Interessen der einzelnen Mitglieder und Regierungen als dem globalen Allgemeinwohl wie der Forcierung des Klimaschutzes oder wie Maßnahmen gegen die drohende Weltwirtschaftskrise.
Schon in der Zeit der Indochinakriege haben die UdSSR, China und Indien gezeigt, daß eine UN-Weltregierung pure Wunschvorstellung war.
Als im Juli 1995 Srebrenica von serbischen Truppen unter dem Kommando von Ratko Mladic eingenommen wurde leisteten die sogenannten UNO-Schutztruppen nicht den geringsten Widerstand. Auf die Besetzung der Stadt folgte eines der schwersten Massaker des Bosnienkrieges, bei dem schätzungsweise 8000 muslimische Bosnier ermordet wurden.
Und Saddam Hussein ?
Erst zehn Jahre nach der fehlgeschlagenen Kuwait-Invasion verhängten die Vereinten Nationen ein begrenztes Öl-Embargo über den Irak. Es wurde im großen Stil mithilfe des Nato-Mitglieds Türkei, Jordaniens und Syriens gebrochen.
Die UNO also als letzte Instanz der zivilisierten Welt ?
- Eine schöne Idee, aber leider Illusion !
Müssen wir die Amerikanisierung des Völkerrechts akzepzieren ?
Vermutlich ja !
- Was haben wir denn anzubieten ? - Haben wir Europäer bewiesen, daß wir die besseren "Weltpolizisten" sind ?
- Oder etwa die Russen ?
- Oder gar die Chinesen ?
- Oder qualifiziert uns etwa eine Demo mit 500.000 Friedensbewegten vor dem Brandenburger Tor für die Durchsetzung der 16 von Hussein mißachteten UN-Resolutionen ?
Der derzeit heiß diskutierte amerikanische Politologe Robert Kagan meint: "Die Wahrheit ist, dass die wohlwollende Hegemonie der Vereinigten Staaten für weite Teile der Weltbevölkerung gut ist. Sie ist ohne Zweifel ein besseres internationales Arrangement als alle realistischen Alternativen"
Da kann man ja zumindest mal drüber nachdenken ...!
Für Carl v. Clausewitz, der im Krieg die "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sah, kann es Frieden nur geben, wenn ein Kräftegleichgewicht zwischen den Großmächten besteht, die den kleineren Staaten gegenüber als "Ordnungsmächte" auftreten. Er hatte recht: Das atomare "Gleichgewichts des Schreckens" (wer zuerst schießt, stirbt als zweiter) hat letztlich auch die kleineren Länder diszipliniert, - Beweis :
Seit der Genfer Konferenz 1955 fanden alle wesentlichen Auseinandersetzungen in der südlichen Hemnisphäre statt und entwickelten sich dort häufig zu "Stellvertreterkriegen". Die USA sahen überall den Kommunismus am Werk und die Sowjets versuchten alles, um ihrem eigentlichen Gegener USA zu schaden. Das sind bzw. waren die steuernden Kräfte der Weltpolitik, Magor, und nicht der imperiale Raubzug Amerikas, wie Dein von Zweifeln freies Weltbild unermüdlich insinuiert !
Nach dem amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington wird in Zukunft ein Zusammenprall der Kulturen ("clash of civilization" ) die Weltpolitik beherrschen. Beteiligt daran sind die westliche, die konfuzianische, die japanische, die islamische, die hinduistische, die slawisch-orthodoxe, die lateinamerikanische und möglicherweise die afrikanische Kultur. Nach Huntingtons Auffassung besteht bei uns im Westen ein Mangel an Einfühlungsvermögen für die "konkurrierenden" Kulturen: Mit unseren Wertvorstellungen von einer liberalen Demokratie und unserem "Menschenrechtsimperialismus" stoßen wir z.B. weder bei den rassistischen Japanern noch im fundamentalistischen Islam auf Verständnis.
Und damit sind wir wieder bei einem der Grundwidersprüche der UNO: Um eine "Weltregierung" zu schaffen, müßten die Nationalstaaten der UNO ein Gewaltmonopol einräumen. Dies wird aber nie passieren, da unsere laizistisch geprägten Rechtsnormen in einer radikalislamischen Welt kein Gehör finden ! Saddam und bin Laden treffen sich zumindest in der Auffassung daß die westliche Kultur dekadent und verweichlicht ist !
Wenn nach den Statuten nur die Vertreter von 5 Atom-Mächten im UN-Sicherheitsrat als ständige Mitglieder geduldet werden, haben die übrigen Mitglieder dieser Organisation mit ihrer Statistenrolle kaum ein Interesse daran, der von Dir geforderten "Übertragung der Oberbefehlsgewalt mit Länderschlüssel für Mitspracherecht nach Bevölkerungszahl multipliziert mit Faktor für Pisa-gemessenem Bildungsgrad" Folge zu leisten.
Europas Bürger wollen keinen Krieg - schreibt Michael Naumann, - - er wäre falsch, weil seine Menschenopfer unvermeidbar, seine Folgen unabsehbar, seine Kosten unabschätzbar, und sein Verstoß gegen das Völkerrecht unbestreitbar wären.
Nur eines wäre er nicht – ein absolutes moralisches Desaster. Das ist Saddam Hussein selbst.
Gruß Konradi
.
Tja, Magor -
dann ändere mal das Schweinesystem ! Ich gehör ja schon zu den alten Säcken,
die das Durchschnittsalter Deiner oligarchischen Weltordnung erreicht hat

Was glaubst Du wohl wo Du mich am 22. Oktober 1983 getroffen hättest ?
Stell Dir vor, ihr wollt das System verändern und wir verfetteten Frührentner wollen einfach nur mal richtig ausschlafen und abends bei einem Bier Thomas Gottschalk gucken ?
Entsetzlich, nicht wahr ? – Hinter meiner Eßzimmergarnitur stirbt gerade der brasilianische Regenwald und an meinen Goldminendividenden klebt noch das Blut von Soweto !
Ich bin also ein Zyniker und Du willst "ad hoc" die Endlösung für das "Großkapital"?
– Oder hast Du da vielleicht nur ein ziemlich dummes Eigentor geschossen ?
- Schön so ein Rundumschlag von Dir: alle Probleme gelöst, die Herzen wieder rein !
Grundsatzdiskussionen werde ich hier nicht führen. Nur soviel zur UNO :
Seit der Unterzeichnung der Uno-Charta 1945 sind viele Konflikte ausgefochten worden, die Millionen von Opfern gekostet haben, ohne dass sich der Sicherheitsrat jeweils im Voraus mit ihnen beschäftigt hätte.
Der Artikel II der Charta regelt die Rechte und Pflichten der Mitglieder. In ihm wird der Staatensouveränität die primäre Rolle in den internationalen Beziehungen zuerkannt, aber gleichzeitig festgelegt, dass die Staaten ihre Streitigkeiten nur "mit friedlichen Mitteln" zu regeln haben. In Abs.4 wird ein allgemeines Gewaltverbot ausgesprochen: Die Mitglieder verzichten "auf Androhung oder Anwendung von Gewalt" - hehre Grundsätze, die nie eingehalten wurden !
Für die Russen war die UNO 40 Jahre lang sowieso nur eine Propagandabühne: mit seinem legendären Veto-"Njet" hatte Andrej Gromyko stets dafür gesorgt, daß sich die Beschlüsse der Völkergemeinschaft der Nationalstaatssouveränität unterordnen mußten.
Während des "Kalten Kriegs" war der Sicherheitsrat also meistens durch die Konfrontation zwischen Ost und West lahmgelegt, im Koreakrieg kam die Uno-Aktion nur dank der Abwesenheit der Sowjetunion zustande.
Auch heute ist die Zusammensetzung des Rates nur ein Abbild der politischer Kräfteverhältnisse und dient eher den Interessen der einzelnen Mitglieder und Regierungen als dem globalen Allgemeinwohl wie der Forcierung des Klimaschutzes oder wie Maßnahmen gegen die drohende Weltwirtschaftskrise.
Schon in der Zeit der Indochinakriege haben die UdSSR, China und Indien gezeigt, daß eine UN-Weltregierung pure Wunschvorstellung war.
Als im Juli 1995 Srebrenica von serbischen Truppen unter dem Kommando von Ratko Mladic eingenommen wurde leisteten die sogenannten UNO-Schutztruppen nicht den geringsten Widerstand. Auf die Besetzung der Stadt folgte eines der schwersten Massaker des Bosnienkrieges, bei dem schätzungsweise 8000 muslimische Bosnier ermordet wurden.
Und Saddam Hussein ?
Erst zehn Jahre nach der fehlgeschlagenen Kuwait-Invasion verhängten die Vereinten Nationen ein begrenztes Öl-Embargo über den Irak. Es wurde im großen Stil mithilfe des Nato-Mitglieds Türkei, Jordaniens und Syriens gebrochen.
Die UNO also als letzte Instanz der zivilisierten Welt ?
- Eine schöne Idee, aber leider Illusion !
Müssen wir die Amerikanisierung des Völkerrechts akzepzieren ?
Vermutlich ja !
- Was haben wir denn anzubieten ? - Haben wir Europäer bewiesen, daß wir die besseren "Weltpolizisten" sind ?
- Oder etwa die Russen ?
- Oder gar die Chinesen ?
- Oder qualifiziert uns etwa eine Demo mit 500.000 Friedensbewegten vor dem Brandenburger Tor für die Durchsetzung der 16 von Hussein mißachteten UN-Resolutionen ?
Der derzeit heiß diskutierte amerikanische Politologe Robert Kagan meint: "Die Wahrheit ist, dass die wohlwollende Hegemonie der Vereinigten Staaten für weite Teile der Weltbevölkerung gut ist. Sie ist ohne Zweifel ein besseres internationales Arrangement als alle realistischen Alternativen"
Da kann man ja zumindest mal drüber nachdenken ...!
Für Carl v. Clausewitz, der im Krieg die "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sah, kann es Frieden nur geben, wenn ein Kräftegleichgewicht zwischen den Großmächten besteht, die den kleineren Staaten gegenüber als "Ordnungsmächte" auftreten. Er hatte recht: Das atomare "Gleichgewichts des Schreckens" (wer zuerst schießt, stirbt als zweiter) hat letztlich auch die kleineren Länder diszipliniert, - Beweis :
Seit der Genfer Konferenz 1955 fanden alle wesentlichen Auseinandersetzungen in der südlichen Hemnisphäre statt und entwickelten sich dort häufig zu "Stellvertreterkriegen". Die USA sahen überall den Kommunismus am Werk und die Sowjets versuchten alles, um ihrem eigentlichen Gegener USA zu schaden. Das sind bzw. waren die steuernden Kräfte der Weltpolitik, Magor, und nicht der imperiale Raubzug Amerikas, wie Dein von Zweifeln freies Weltbild unermüdlich insinuiert !
Nach dem amerikanischen Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington wird in Zukunft ein Zusammenprall der Kulturen ("clash of civilization" ) die Weltpolitik beherrschen. Beteiligt daran sind die westliche, die konfuzianische, die japanische, die islamische, die hinduistische, die slawisch-orthodoxe, die lateinamerikanische und möglicherweise die afrikanische Kultur. Nach Huntingtons Auffassung besteht bei uns im Westen ein Mangel an Einfühlungsvermögen für die "konkurrierenden" Kulturen: Mit unseren Wertvorstellungen von einer liberalen Demokratie und unserem "Menschenrechtsimperialismus" stoßen wir z.B. weder bei den rassistischen Japanern noch im fundamentalistischen Islam auf Verständnis.
Und damit sind wir wieder bei einem der Grundwidersprüche der UNO: Um eine "Weltregierung" zu schaffen, müßten die Nationalstaaten der UNO ein Gewaltmonopol einräumen. Dies wird aber nie passieren, da unsere laizistisch geprägten Rechtsnormen in einer radikalislamischen Welt kein Gehör finden ! Saddam und bin Laden treffen sich zumindest in der Auffassung daß die westliche Kultur dekadent und verweichlicht ist !
Wenn nach den Statuten nur die Vertreter von 5 Atom-Mächten im UN-Sicherheitsrat als ständige Mitglieder geduldet werden, haben die übrigen Mitglieder dieser Organisation mit ihrer Statistenrolle kaum ein Interesse daran, der von Dir geforderten "Übertragung der Oberbefehlsgewalt mit Länderschlüssel für Mitspracherecht nach Bevölkerungszahl multipliziert mit Faktor für Pisa-gemessenem Bildungsgrad" Folge zu leisten.
Europas Bürger wollen keinen Krieg - schreibt Michael Naumann, - - er wäre falsch, weil seine Menschenopfer unvermeidbar, seine Folgen unabsehbar, seine Kosten unabschätzbar, und sein Verstoß gegen das Völkerrecht unbestreitbar wären.
Nur eines wäre er nicht – ein absolutes moralisches Desaster. Das ist Saddam Hussein selbst.
Gruß Konradi
.
.
Die Märkte rechnen mit Krieg
Die US-Verbraucher verlieren das Vertrauen. Die Märkte glauben nicht mehr an eine friedliche Lösung des Irak-Konflikts. Dax und Wall Street stehen auch am Abend enorm unter Druck. Versicherungswerte brechen ein. Die Aktie von Bayer fällt auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren.
In Erwartung eines nahen US-Angriffs auf den Irak haben Kursverluste bei den deutschen Standardwerten den Dax am Dienstag kräftig unter Druck gesetzt. Das Börsenbarometer geriet mit 2448 Punkten zeitweise auf ein Siebenjahres-Tief, nachdem am Nachmittag die monatliche Statistik zum US-Verbrauchervertrauen einen überraschend deutlichen Rückgang aufgewiesen hatte.
Die Wall Street präsentierte sich am Dienstag schwach und konnte sich auch gegen Abend nicht aus dem Stimmungstief befreien. Gegen 18.19 Uhr verlor der Dow Jones 1,5 Prozent auf 7737 Zähler. Der Nasdaq Composite rutschte um 1,9 Prozent auf 1297 Punkte ab. Der Dax notierte mit 4,6 Prozent auf 2454 Zähler in der Verlustzone.
Das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board ist auf 64 Punkte und damit deutlich stärker eingebrochen als erwartet. Der Indikator hat das niedrigste Niveau seit Oktober 1993 erreicht. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 77 gerechnet. Das Conference Board sieht keine Erholungszeichen.
Neben dem schwachen US-Verbrauchervertrauen begründeten Analysten die Kursabschläge mit einer weiteren Verunsicherung der Anleger angesichts des Raketentests in Nordkorea. Auch der sich zuspitzende Irak-Konflikt laste auf der Stimmung.
Märkte bereiten sich auf Irak-Krieg vor
"Der Markt bereitet sich nun ernstlich auf einen Krieg im Irak vor", sagte ein Aktienhändler in Düsseldorf. Ein Händler auf dem Frankfurter Börsenparkett zeigte sich angesichts der herrschenden Nervosität kaum überrascht, dass die geringe Zuversicht der US-Verbraucher die Kunden in Scharen ihre Aktien verkaufen ließ. "Es gehen einem ja die Argumente aus, warum man sich auf die Käuferseite stellen sollte." Auch in den kommenden Tagen rechne er mit weiter sinkenden Kursen. "Das wäre anders, wenn Saddam Hussein morgen das Land verließe, aber vorher nicht."
"Ich würde keinen Cent auf eine friedliche Lösung in Irak setzen, und der Markt macht dies auch nicht", erklärte auch Aktienstratege Matthias Jörss von Sal. Oppenheim die schlechte Stimmung an der Börse. Die USA und Großbritannien hatten am Montagabend ihren Entwurf für eine zweite Irak-Resolution im Sicherheitsrat eingebracht. Irak habe die letzte Chance zur Abrüstung verpasst, heißt es in dem Entwurf, den Anleger als Kriegserklärung interpretierten.
Saddam Hussein habe indes dem US-Sender CBS gesagt, er lehne die Forderung der UN-Waffeninspekteure ab, bestimmte Raketen zu vernichten. Damit sei ein Krieg gegen den Irak erneut näher gerückt, hieß es am Dienstag.
Kriegsbeginn im März?
Zwar hatten sich Frankreich und Deutschland offen gegen den Entwurf der USA gestellt und eine Fortsetzung der UNO-Waffeninspektionen im Irak um weitere vier Monate gefordert. Auch Russland unterstützt dieses informelle Memorandum. Doch am Markt wird nicht mehr damit gerechnet, dass sich dieser Entwurf durchsetzt. Immer mehr Beobachter rechnen nun mit einem Kriegsbeginn im März.
"Abwärtsspirale nährt sich selbst"
Frankfurter Händler meinten, der Fall unter das Oktober-Tief bei 2519 sei mit einem Dammbruch vergleichbar. An dieser Marke hätten zahlreiche Marktteilnehmer so genannte Stop-Loss-Orders platziert gehabt, also Verkaufsaufträge zur Verlustbegrenzung. Das Auslösen der Aufträge habe den Dax-Abschwung noch einmal beschleunigt.
"Keine Unterstützungslinien mehr für den Dax"
Skeptisch äußerte sich auch der charttechnische Analyst Holger Galuschke von der SEB: "Im Grunde gibt es jetzt keine wirklichen Unterstützungen mehr für den Dax. Es macht keinen Sinn, solche aus den 90er Jahren herzuleiten, damals waren die Rahmenbedingungen ganz andere."
Eine nachhaltige Trendwende an der Börse verhindern nach der Einschätzung von Händlern noch immer die Ängste der Anleger vor den konjunkturschädigenden Wirkungen eines Irak-Krieges. "Dazu kommen jetzt auch noch Sorgen vor den Folgen einer politischen Spaltung der wichtigsten Industrieländer", sagte ein Händler. Angesichts der Unstimmigkeiten im Uno-Sicherheitsrat um die US-Pläne für eine neue Irak-Resolution hatten die Börsen bereits am Montag weltweit nachgegeben.
Ölpreis steigt auf höchsten Stand sei 27 Monaten
Dagegen trieben die Kriegsängste die Anleger weiterhin in sichere Anlagen wie Renten und Gold. So stieg der Bund-Future 33 Ticks auf 116,83 Punkte. An den Ölmärkten legte der Preis der Nordseesorte Brent um 0,30 Dollar auf 33,45 Dollar je Barrel zu und stieg zeitweise sogar auf den höchsten Stand seit 27 Monaten.
Allianz bricht ein - T-Aktie nahe zehn Euro
Besonders die Finanzwerte zählten zu den Verlierern. Die Aktie der Allianz notierte am Abend 5,70 Prozent leichter auf 64,69 Euro. Das Papier des Rückversicherers Münchener Rück gab rund sechs Prozent auf 80 Euro ab. Die Verluste an den Börsen betreffen die Finanzkonzerne besonders empfindlich, da sie große Beteiligungspakete halten. "Fällt der Dax, fällt die Allianz erst recht", sagte ein Händler - doch dies gelte auch umgekehrt bei einer Aufwärtsbewegung.
Bei den Technologiewerten sah es auch nicht erfreulich aus. Die Aktie der Deutschen Telekom drohte unter die Marke von zehn Euro zu fallen. Das ARD-Magazin "Report" hatte berichtet, dass der damalige Finanzvorstand Joachim Kröske vor einem dritten Börsengang gewarnt und Monate vor Platzierung der dritten Tranche im Jahr 2000 auf die verschlechterte Ertragskraft hingewiesen habe. Der Chiphersteller Infineon hat den Sturz unter die Sechs-Euro-Marke bereits vollzogen.
Bayer wird weiter zerrupft
Die Bayer -Aktie brach nach Berichten um möglicherweise noch höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Lipobay-Skandal um 14 Prozent auf 12,28 Euro ein und war damit so billig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Bislang wurde die Schadenssumme der Affäre auf schlimmstenfalls 1,6 Milliarden Euro geschätzt. "Von den schlechten Nachrichten profitierten andere Pharmawerte, weil die Anleger wechselten", sagte der Händler. So gewannen Altana 0,17 Prozent auf 36,24 Euro, während im MDax Stada um rund 0,70 Prozent auf 43,65 Euro kletterten.
Positive Nachrichten komplett ignoriert
"Positive Nachrichten werden derzeit komplett ignoriert", kommentierte ein Händler. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Westdeutschland ist zwar auf 88,9 Zähler von 87,4 Zählern im Januar gestiegen und hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Im Januar war der Index das erste Mal seit acht Monaten wieder etwas gestiegen.
HVB peilt schwarze Null an – Credit Suisse weiter vorsichtig
Da wirkte es schon wie Zweckoptimismus, wenn der Chef der HypoVereinsbank Dieter Rampl in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung von einer "schwarzen Null" bis Jahresende spricht. Bei einem lang anhaltenden Irak-Krieg sähe die Situation jedoch anders aus, schränkte Rampl ein.
Auch die Credit Suisse Group ist angesichts der Schwierigkeiten im Finanzsektor weiter vorsichtig. Auch sie erwartet für 2003 eine Rückkehr zur Profitabilität. Dennoch sei es auf Grund der weltweiten Unsicherheiten kaum möglich, einen Ausblick auf das Jahr 2003 zu geben, teilte die CS Group bei Vorlage ihrer Ergebnisse für das vierte Quartal 2002 und das Gesamtjahr mit.
(...)
manager-magazin.de, 25.02.2003
Die Märkte rechnen mit Krieg
Die US-Verbraucher verlieren das Vertrauen. Die Märkte glauben nicht mehr an eine friedliche Lösung des Irak-Konflikts. Dax und Wall Street stehen auch am Abend enorm unter Druck. Versicherungswerte brechen ein. Die Aktie von Bayer fällt auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren.
In Erwartung eines nahen US-Angriffs auf den Irak haben Kursverluste bei den deutschen Standardwerten den Dax am Dienstag kräftig unter Druck gesetzt. Das Börsenbarometer geriet mit 2448 Punkten zeitweise auf ein Siebenjahres-Tief, nachdem am Nachmittag die monatliche Statistik zum US-Verbrauchervertrauen einen überraschend deutlichen Rückgang aufgewiesen hatte.
Die Wall Street präsentierte sich am Dienstag schwach und konnte sich auch gegen Abend nicht aus dem Stimmungstief befreien. Gegen 18.19 Uhr verlor der Dow Jones 1,5 Prozent auf 7737 Zähler. Der Nasdaq Composite rutschte um 1,9 Prozent auf 1297 Punkte ab. Der Dax notierte mit 4,6 Prozent auf 2454 Zähler in der Verlustzone.
Das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board ist auf 64 Punkte und damit deutlich stärker eingebrochen als erwartet. Der Indikator hat das niedrigste Niveau seit Oktober 1993 erreicht. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 77 gerechnet. Das Conference Board sieht keine Erholungszeichen.
Neben dem schwachen US-Verbrauchervertrauen begründeten Analysten die Kursabschläge mit einer weiteren Verunsicherung der Anleger angesichts des Raketentests in Nordkorea. Auch der sich zuspitzende Irak-Konflikt laste auf der Stimmung.
Märkte bereiten sich auf Irak-Krieg vor
"Der Markt bereitet sich nun ernstlich auf einen Krieg im Irak vor", sagte ein Aktienhändler in Düsseldorf. Ein Händler auf dem Frankfurter Börsenparkett zeigte sich angesichts der herrschenden Nervosität kaum überrascht, dass die geringe Zuversicht der US-Verbraucher die Kunden in Scharen ihre Aktien verkaufen ließ. "Es gehen einem ja die Argumente aus, warum man sich auf die Käuferseite stellen sollte." Auch in den kommenden Tagen rechne er mit weiter sinkenden Kursen. "Das wäre anders, wenn Saddam Hussein morgen das Land verließe, aber vorher nicht."
"Ich würde keinen Cent auf eine friedliche Lösung in Irak setzen, und der Markt macht dies auch nicht", erklärte auch Aktienstratege Matthias Jörss von Sal. Oppenheim die schlechte Stimmung an der Börse. Die USA und Großbritannien hatten am Montagabend ihren Entwurf für eine zweite Irak-Resolution im Sicherheitsrat eingebracht. Irak habe die letzte Chance zur Abrüstung verpasst, heißt es in dem Entwurf, den Anleger als Kriegserklärung interpretierten.
Saddam Hussein habe indes dem US-Sender CBS gesagt, er lehne die Forderung der UN-Waffeninspekteure ab, bestimmte Raketen zu vernichten. Damit sei ein Krieg gegen den Irak erneut näher gerückt, hieß es am Dienstag.
Kriegsbeginn im März?
Zwar hatten sich Frankreich und Deutschland offen gegen den Entwurf der USA gestellt und eine Fortsetzung der UNO-Waffeninspektionen im Irak um weitere vier Monate gefordert. Auch Russland unterstützt dieses informelle Memorandum. Doch am Markt wird nicht mehr damit gerechnet, dass sich dieser Entwurf durchsetzt. Immer mehr Beobachter rechnen nun mit einem Kriegsbeginn im März.
"Abwärtsspirale nährt sich selbst"
Frankfurter Händler meinten, der Fall unter das Oktober-Tief bei 2519 sei mit einem Dammbruch vergleichbar. An dieser Marke hätten zahlreiche Marktteilnehmer so genannte Stop-Loss-Orders platziert gehabt, also Verkaufsaufträge zur Verlustbegrenzung. Das Auslösen der Aufträge habe den Dax-Abschwung noch einmal beschleunigt.
"Keine Unterstützungslinien mehr für den Dax"
Skeptisch äußerte sich auch der charttechnische Analyst Holger Galuschke von der SEB: "Im Grunde gibt es jetzt keine wirklichen Unterstützungen mehr für den Dax. Es macht keinen Sinn, solche aus den 90er Jahren herzuleiten, damals waren die Rahmenbedingungen ganz andere."
Eine nachhaltige Trendwende an der Börse verhindern nach der Einschätzung von Händlern noch immer die Ängste der Anleger vor den konjunkturschädigenden Wirkungen eines Irak-Krieges. "Dazu kommen jetzt auch noch Sorgen vor den Folgen einer politischen Spaltung der wichtigsten Industrieländer", sagte ein Händler. Angesichts der Unstimmigkeiten im Uno-Sicherheitsrat um die US-Pläne für eine neue Irak-Resolution hatten die Börsen bereits am Montag weltweit nachgegeben.
Ölpreis steigt auf höchsten Stand sei 27 Monaten
Dagegen trieben die Kriegsängste die Anleger weiterhin in sichere Anlagen wie Renten und Gold. So stieg der Bund-Future 33 Ticks auf 116,83 Punkte. An den Ölmärkten legte der Preis der Nordseesorte Brent um 0,30 Dollar auf 33,45 Dollar je Barrel zu und stieg zeitweise sogar auf den höchsten Stand seit 27 Monaten.
Allianz bricht ein - T-Aktie nahe zehn Euro
Besonders die Finanzwerte zählten zu den Verlierern. Die Aktie der Allianz notierte am Abend 5,70 Prozent leichter auf 64,69 Euro. Das Papier des Rückversicherers Münchener Rück gab rund sechs Prozent auf 80 Euro ab. Die Verluste an den Börsen betreffen die Finanzkonzerne besonders empfindlich, da sie große Beteiligungspakete halten. "Fällt der Dax, fällt die Allianz erst recht", sagte ein Händler - doch dies gelte auch umgekehrt bei einer Aufwärtsbewegung.
Bei den Technologiewerten sah es auch nicht erfreulich aus. Die Aktie der Deutschen Telekom drohte unter die Marke von zehn Euro zu fallen. Das ARD-Magazin "Report" hatte berichtet, dass der damalige Finanzvorstand Joachim Kröske vor einem dritten Börsengang gewarnt und Monate vor Platzierung der dritten Tranche im Jahr 2000 auf die verschlechterte Ertragskraft hingewiesen habe. Der Chiphersteller Infineon hat den Sturz unter die Sechs-Euro-Marke bereits vollzogen.
Bayer wird weiter zerrupft
Die Bayer -Aktie brach nach Berichten um möglicherweise noch höhere Kosten im Zusammenhang mit dem Lipobay-Skandal um 14 Prozent auf 12,28 Euro ein und war damit so billig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Bislang wurde die Schadenssumme der Affäre auf schlimmstenfalls 1,6 Milliarden Euro geschätzt. "Von den schlechten Nachrichten profitierten andere Pharmawerte, weil die Anleger wechselten", sagte der Händler. So gewannen Altana 0,17 Prozent auf 36,24 Euro, während im MDax Stada um rund 0,70 Prozent auf 43,65 Euro kletterten.
Positive Nachrichten komplett ignoriert
"Positive Nachrichten werden derzeit komplett ignoriert", kommentierte ein Händler. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Westdeutschland ist zwar auf 88,9 Zähler von 87,4 Zählern im Januar gestiegen und hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Im Januar war der Index das erste Mal seit acht Monaten wieder etwas gestiegen.
HVB peilt schwarze Null an – Credit Suisse weiter vorsichtig
Da wirkte es schon wie Zweckoptimismus, wenn der Chef der HypoVereinsbank Dieter Rampl in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung von einer "schwarzen Null" bis Jahresende spricht. Bei einem lang anhaltenden Irak-Krieg sähe die Situation jedoch anders aus, schränkte Rampl ein.
Auch die Credit Suisse Group ist angesichts der Schwierigkeiten im Finanzsektor weiter vorsichtig. Auch sie erwartet für 2003 eine Rückkehr zur Profitabilität. Dennoch sei es auf Grund der weltweiten Unsicherheiten kaum möglich, einen Ausblick auf das Jahr 2003 zu geben, teilte die CS Group bei Vorlage ihrer Ergebnisse für das vierte Quartal 2002 und das Gesamtjahr mit.
(...)
manager-magazin.de, 25.02.2003
Wo ich Dich am 22. Oktober 1983 getroffen hätte Konradi?
Das weiß ich ganz genau, ausschliesslich im Rohbau meines seinerzeit im bau befindlichen Hauses, d.h., natürlich nur, wenn Du vorbeigekommen wärest … zu dieser Zeit war ich sozusagen Tag und Nacht dort ...
Vielleicht vertust Du Dich ein wenig mit meinem Alter, weil ich frischere, dynamischere, d.h. auch flexiblere Staatslenkende mir wünsche. Wenn eine ernsthafte Operation ansteht, lege ich zwar Wert auf die Meinung und die Fachkompetenz des 70 jährigen Chefarztes, das an mir herumschnibbeln, nee, mit seinen zittrigen Fingern? Das sollte dann doch lieber der im Saft stehende und über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten meist viel besser informierte Oberarzt machen!
Nicht auszudenken die zittrigen Finger des Chruschtschow, herumeiernd am roten Knopf .. , daß die Situation damals überhaupt noch gut ausging, war ein Wunder …
das kannst Du aber nicht mitbekommen haben, damals, mit Deinen jungen Jahren : - ))
Du erliest aus meinen Zeilen eine proklamierte Endlösung für das Kapital?
Ja, das wäre sie schon, ich glaube, es wäre kein Eigentor.
Als Realist sehe ich als einzig gangbaren Weg:
Kontrolle der Politiker, Kontrolle der Wirtschaft und insbesondere Kontrolle der Schlüsselindustrie! Das Kapital, die gewohntermaßen ihr Umfeld durch Vorteilnahme per Bestechung beherrscht ist nur dadurch trockenzulegen!
Mißverstehe mich nicht, ich will das Kapital nicht eliminieren, wer unternimmt, Arbeitsplätze schafft, sein Geld investiert soll ja auch sein Geld verdienen! Allerdings, ausschließlich nach dem Grundprinzip: Leben und leben lassen!
Gegen eine anständige Gewinnmarge habe ich garnichts einzuwenden, nur dagegen, wenn die Herren am Tische den fetten Schmaus, derjenige, der die eigentliche Arbeit macht nur widerwillig und noch getreten die herabfallenden Krümel bekommt! Das gehört geregelt! Und, welche Mittel zur Mehrung des Kapitals recht sind, auch das gilt es zu reglementieren!
Daß die UNO nicht das ist, was sie sein könnte oder gar sein müsste, das ist mir auch bekannt.
Daß man unter zivilisierten Menschen die UNO dazu machen könnte, wofür sie eigentlich gedacht war, das ist aber sicherlich auch Dir bekannt.
Du hattest nach einem Vorschlag für eine „Endlösung“ gefragt, und ich habe Dir aufskizziert, wie so etwas aussehen könnte, oder gar müsste!
Bin ich zuwenig auf die Endlösung für die Juden eingegangen, bei denen Du mir implementierst, dass ich sie nicht nur aus der arabischen Welt weghaben wollte?
Ok, zugegeben, es gibt noch die eine oder andere Stelle, wo mich insbesondere ihre Organisationen gedanklich arg stören …
Allerdings, ganz weghaben wollen, nein, das möchtest Du zwar herauslesen, da hast Du wirklich etwas übertriebene Fantasie! Ich habe bisher mit Menschen unterschiedlichster Couleur, darunter auch nicht wenigen Levantinern friedlich zusammen gearbeitet und räumlich auch zusammen gelebt, ich muß Dich enttäuschen, ich wüsste nicht, warum ich diesen Wunsch hegen sollte.
Mit Betreuung kennst Du Dich ja aus, dann schreibe ich es Dir verbildlicht,
vielleicht kommt dann besser an, was ich ausdrücken möchte:
Unterstellen wir, weil Du durch verschiedene Geschäfte mit ihm verquickt bist, ermöglichst Du einem, gerade eben wegen seinem Geschäftsgebaren ungeliebten 17-jährigen sich in einem Schulheim im 8-Bett Zimmer von 12-Jährigen ausreichend Platz zu verschaffen.
Damit er sich durchsetzen kann, bestückst Du ihn mit Rechten, welche die anderen nicht haben, sowie mit Messer, Pistole und was auch immer er vermeintlich bedarf.
Bei den zwangsläufigen Streitigkeiten hilfst Du ausgiebig und ausschliesslich Deinem protegiertem, die unüberhörbaren Hilfeschreie der beiseitegeräumten und in die Ecke gedrängten ignorierst Du geflissentlich. Auch verschließt Du Deine Augen vor all seine Missetaten und unterbindest Du mit all Deinen Möglichkeiten Hilfe für die 12-Jährigen aus den Nachbarzimmern.
Das ist die von den Engländern geschaffene und von den Amerikanern gegen jede Kritik aufrecherhaltene Situation.
Ist es ein Wunder, dass sich heute beide intensivst sich in vorderster Linie drängeln?
Behebung?
Wenn schon der einmal gemachte Fehler nicht behebbar sein sollte, dann musst Du als Erwachsener Dich als Puffer dazwischensetzen, allen Beteiligten, auch Deinem Schützling ihr Waffenarsenal, samt Zahnstocher konfiszieren, und in absoluter Gleichbehandlung solange Gemeinsamkeiten schaffen, bis die Feindlichkeiten abgebaut sind und eine Koexistenz gesichert ist.
Im richtigen Leben mit Staaten kann man so etwas nur mit unparteiischen Truppen / Blauhelmen erreichen, wenn´s sein muß über einen Zeitraum von Generationen!
Dein zitiertes Jugoslawien zeigt allerdings, dass auch später noch auseinander bricht, was nicht zusammen gehört. Aus dieser Erkenntnis und Angst vor der eines Tages ihn gewiss einholenden Realität betreibt auch der Rumäne seit Jahrzehnten unter wohlwollendem Schutz der Russen und Franzosen eine sogenannte „Zwangsrumänisierung“ mit Umbenennung der Städtenamen, Familiennamen, Verbot des Sprachgebrauchs der „Minderheiten“ und Verfolgung aller, die eine andere als ausschliesslich die rumänische Volkszugehörigkeit unterstützende politische Tätigkeit ausüben! In Serbien und in der Slowakei verhält es sich ähnlich.
Kämst Du auf eine Endlösung Konradi?
Wäre nicht sinnvoll, diese unnatürlich, zwangsweise zusammengepferchten Jugendlichen wieder zu trennen, den mutwillig hineingestochenen Dorn, den ich erwähnte, aus der Wunde zu entfernen, anstatt das Umfeld nur zu kühlen und mit irgendwelchen Mittelchen zu betäuben.
Die ideale Endlösung aus der Sicht des 17-jährigen oder auch aus Sicht so mancher der Israelis ist uns beiden doch bekannt, dafür marschieren wahrscheinlich gerade 250 tsd Mann doch auf!
Könntest Du Dir eine friedliche Alternative vorstellen?
Ich schon!
Ausreichend Platz wäre auf dem Star spangled Banner noch zu finden für einen zusätzlichen Stern (vielleicht könnten die anderen 51 Sterne im Design etwas angepasst werden)
Und soviel zusammenrücken müsste wegen der paar mio zusätzlicher Bevölkerung im riesigen Amerika keiner. Allerdings, diese Einladung haben die in Amerika lebenden Brüder und Schwestern bisher nicht ausgesprochen … sind vielleicht nicht erpicht auf ihre eigene Verwandtschaft, denn, finanziell dürfte das dieser, insbesondere in den USA lebenden, zumeist wohlhabenden Schicht, kein unlösbares Problem bedeuten!
Stellte sich die Frage nach vielleicht doch tieferen Gründen, warum das bisher wohl nicht geschah …
da komme ich doch wieder mal nur auf Gebiets- und Öl- Interessen in der Nah-Ost Region, die nun endlich erfüllt werden könnten.
Die Verdrängung und Niederschlagung der dorthin gehörenden Nationen ist demnach schon längst besiegelte Sache.
Und es soll manche in Deutschland geben, die reissen sich drum, an dieser Vertreibung teilzuhaben und werfen mit Steinen nach denen, die vor soviel Dreckigkeit Hemmungen haben.
Grüße
Magor
Das weiß ich ganz genau, ausschliesslich im Rohbau meines seinerzeit im bau befindlichen Hauses, d.h., natürlich nur, wenn Du vorbeigekommen wärest … zu dieser Zeit war ich sozusagen Tag und Nacht dort ...
Vielleicht vertust Du Dich ein wenig mit meinem Alter, weil ich frischere, dynamischere, d.h. auch flexiblere Staatslenkende mir wünsche. Wenn eine ernsthafte Operation ansteht, lege ich zwar Wert auf die Meinung und die Fachkompetenz des 70 jährigen Chefarztes, das an mir herumschnibbeln, nee, mit seinen zittrigen Fingern? Das sollte dann doch lieber der im Saft stehende und über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten meist viel besser informierte Oberarzt machen!
Nicht auszudenken die zittrigen Finger des Chruschtschow, herumeiernd am roten Knopf .. , daß die Situation damals überhaupt noch gut ausging, war ein Wunder …
das kannst Du aber nicht mitbekommen haben, damals, mit Deinen jungen Jahren : - ))
Du erliest aus meinen Zeilen eine proklamierte Endlösung für das Kapital?
Ja, das wäre sie schon, ich glaube, es wäre kein Eigentor.
Als Realist sehe ich als einzig gangbaren Weg:
Kontrolle der Politiker, Kontrolle der Wirtschaft und insbesondere Kontrolle der Schlüsselindustrie! Das Kapital, die gewohntermaßen ihr Umfeld durch Vorteilnahme per Bestechung beherrscht ist nur dadurch trockenzulegen!
Mißverstehe mich nicht, ich will das Kapital nicht eliminieren, wer unternimmt, Arbeitsplätze schafft, sein Geld investiert soll ja auch sein Geld verdienen! Allerdings, ausschließlich nach dem Grundprinzip: Leben und leben lassen!
Gegen eine anständige Gewinnmarge habe ich garnichts einzuwenden, nur dagegen, wenn die Herren am Tische den fetten Schmaus, derjenige, der die eigentliche Arbeit macht nur widerwillig und noch getreten die herabfallenden Krümel bekommt! Das gehört geregelt! Und, welche Mittel zur Mehrung des Kapitals recht sind, auch das gilt es zu reglementieren!
Daß die UNO nicht das ist, was sie sein könnte oder gar sein müsste, das ist mir auch bekannt.
Daß man unter zivilisierten Menschen die UNO dazu machen könnte, wofür sie eigentlich gedacht war, das ist aber sicherlich auch Dir bekannt.
Du hattest nach einem Vorschlag für eine „Endlösung“ gefragt, und ich habe Dir aufskizziert, wie so etwas aussehen könnte, oder gar müsste!
Bin ich zuwenig auf die Endlösung für die Juden eingegangen, bei denen Du mir implementierst, dass ich sie nicht nur aus der arabischen Welt weghaben wollte?
Ok, zugegeben, es gibt noch die eine oder andere Stelle, wo mich insbesondere ihre Organisationen gedanklich arg stören …
Allerdings, ganz weghaben wollen, nein, das möchtest Du zwar herauslesen, da hast Du wirklich etwas übertriebene Fantasie! Ich habe bisher mit Menschen unterschiedlichster Couleur, darunter auch nicht wenigen Levantinern friedlich zusammen gearbeitet und räumlich auch zusammen gelebt, ich muß Dich enttäuschen, ich wüsste nicht, warum ich diesen Wunsch hegen sollte.
Mit Betreuung kennst Du Dich ja aus, dann schreibe ich es Dir verbildlicht,
vielleicht kommt dann besser an, was ich ausdrücken möchte:
Unterstellen wir, weil Du durch verschiedene Geschäfte mit ihm verquickt bist, ermöglichst Du einem, gerade eben wegen seinem Geschäftsgebaren ungeliebten 17-jährigen sich in einem Schulheim im 8-Bett Zimmer von 12-Jährigen ausreichend Platz zu verschaffen.
Damit er sich durchsetzen kann, bestückst Du ihn mit Rechten, welche die anderen nicht haben, sowie mit Messer, Pistole und was auch immer er vermeintlich bedarf.
Bei den zwangsläufigen Streitigkeiten hilfst Du ausgiebig und ausschliesslich Deinem protegiertem, die unüberhörbaren Hilfeschreie der beiseitegeräumten und in die Ecke gedrängten ignorierst Du geflissentlich. Auch verschließt Du Deine Augen vor all seine Missetaten und unterbindest Du mit all Deinen Möglichkeiten Hilfe für die 12-Jährigen aus den Nachbarzimmern.
Das ist die von den Engländern geschaffene und von den Amerikanern gegen jede Kritik aufrecherhaltene Situation.
Ist es ein Wunder, dass sich heute beide intensivst sich in vorderster Linie drängeln?
Behebung?
Wenn schon der einmal gemachte Fehler nicht behebbar sein sollte, dann musst Du als Erwachsener Dich als Puffer dazwischensetzen, allen Beteiligten, auch Deinem Schützling ihr Waffenarsenal, samt Zahnstocher konfiszieren, und in absoluter Gleichbehandlung solange Gemeinsamkeiten schaffen, bis die Feindlichkeiten abgebaut sind und eine Koexistenz gesichert ist.
Im richtigen Leben mit Staaten kann man so etwas nur mit unparteiischen Truppen / Blauhelmen erreichen, wenn´s sein muß über einen Zeitraum von Generationen!
Dein zitiertes Jugoslawien zeigt allerdings, dass auch später noch auseinander bricht, was nicht zusammen gehört. Aus dieser Erkenntnis und Angst vor der eines Tages ihn gewiss einholenden Realität betreibt auch der Rumäne seit Jahrzehnten unter wohlwollendem Schutz der Russen und Franzosen eine sogenannte „Zwangsrumänisierung“ mit Umbenennung der Städtenamen, Familiennamen, Verbot des Sprachgebrauchs der „Minderheiten“ und Verfolgung aller, die eine andere als ausschliesslich die rumänische Volkszugehörigkeit unterstützende politische Tätigkeit ausüben! In Serbien und in der Slowakei verhält es sich ähnlich.
Kämst Du auf eine Endlösung Konradi?
Wäre nicht sinnvoll, diese unnatürlich, zwangsweise zusammengepferchten Jugendlichen wieder zu trennen, den mutwillig hineingestochenen Dorn, den ich erwähnte, aus der Wunde zu entfernen, anstatt das Umfeld nur zu kühlen und mit irgendwelchen Mittelchen zu betäuben.
Die ideale Endlösung aus der Sicht des 17-jährigen oder auch aus Sicht so mancher der Israelis ist uns beiden doch bekannt, dafür marschieren wahrscheinlich gerade 250 tsd Mann doch auf!
Könntest Du Dir eine friedliche Alternative vorstellen?
Ich schon!
Ausreichend Platz wäre auf dem Star spangled Banner noch zu finden für einen zusätzlichen Stern (vielleicht könnten die anderen 51 Sterne im Design etwas angepasst werden)
Und soviel zusammenrücken müsste wegen der paar mio zusätzlicher Bevölkerung im riesigen Amerika keiner. Allerdings, diese Einladung haben die in Amerika lebenden Brüder und Schwestern bisher nicht ausgesprochen … sind vielleicht nicht erpicht auf ihre eigene Verwandtschaft, denn, finanziell dürfte das dieser, insbesondere in den USA lebenden, zumeist wohlhabenden Schicht, kein unlösbares Problem bedeuten!
Stellte sich die Frage nach vielleicht doch tieferen Gründen, warum das bisher wohl nicht geschah …
da komme ich doch wieder mal nur auf Gebiets- und Öl- Interessen in der Nah-Ost Region, die nun endlich erfüllt werden könnten.
Die Verdrängung und Niederschlagung der dorthin gehörenden Nationen ist demnach schon längst besiegelte Sache.
Und es soll manche in Deutschland geben, die reissen sich drum, an dieser Vertreibung teilzuhaben und werfen mit Steinen nach denen, die vor soviel Dreckigkeit Hemmungen haben.
Grüße
Magor
Fast hatten wir uns getroffen Konradi, wir haben uns gestern gerade mal um 11 Sekunden verpasst : - ))
Ich glaube, zur Entkrampfung des Themas müsste ein gutes Gericht wieder her ...
Weißkohl-Pfannekuchen bekomme ich gleich ...
Schreibe ich morgen mal nieder, wenn´s interessiert ...
@All Black
ich hatte mich verschrieben, meinte natürlich Dein Posting 227
Grüße
Magor
Ich glaube, zur Entkrampfung des Themas müsste ein gutes Gericht wieder her ...
Weißkohl-Pfannekuchen bekomme ich gleich ...
Schreibe ich morgen mal nieder, wenn´s interessiert ...
@All Black
ich hatte mich verschrieben, meinte natürlich Dein Posting 227
Grüße
Magor
Hallo Magor,
Kompliment, nach Deinen Äußerungen hatte ich Dich wesentlich jünger eingeschätzt ...
Deine Einlassungen zur Politik Israels bzw. zur jüdischen Diaspora möchte ich nicht weiter kommentieren, ich denke wir sind da gedanklich so weit auseinander, daß dazu ein längere Diskussion erforderlich wäre, welche hier zu führen mir zu zeitintensiv und zu anstrenngend erscheint.
Ich habe Dir aber einen Essay herausgesucht, der in etwa meiner Position beinhaltet:
Sprachlos am Zaun
Israels Existenz hat drei Begründungen. Nur eine kann das Überleben des jüdischen Staates sichern
von Dan Diner
Es war irgendwann in den späteren 1950er Jahren. In der bescheidenen Residenz des israelischen Ministerpräsidenten in Jerusalem führten David Ben Gurion und Nahum Goldmann bis in die frühen Morgenstunden ein Gespräch. Zwei Persönlichkeiten saßen da zusammen, die ungeachtet ihrer gemeinsamen zionistischen Überzeugungen von Grund auf verschieden waren: auf der einen Seite Goldmann, der große Diplomat und Fürsprecher der Juden in aller Welt, ein ironischer Skeptiker in der Tradition der Diaspora. Auf der anderen der von einer Aura prophetischer Gewissheit umgebene Ben Gurion, ein Mann der Tat, der sich des Instrumentariums der Macht ohne Zaudern zu bedienen wusste - nach innen wie nach außen.
In diesem Gespräch äußerte Ben Gurion einen überraschend düsteren Gedanken. Er glaube schon, dass man ihn, den fast 70-Jährigen, noch in israelischer Erde begraben werde, seinen Sohn Amos aber wohl kaum noch. Erschrocken fragte Goldmann nach den Gründen für einen derartig überbordenden Pessimismus. Nach einigem Zögern gab Ben Gurion seine tiefsten Zweifel preis: Die Araber würden Israel niemals akzeptieren. Ja, sicher, Gott habe das Land dem Volke Israel versprochen. Aber, fuhr Ben Gurion fort, dieser Gott ist unser Gott. Für die Araber hat das keine Verbindlichkeit. Die Vernichtung der europäischen Juden, der Holocaust? Da sei es doch eher an den Deutschen, das Rheinland zu räumen, um Platz für die Errichtung eines jüdischen Staates zu machen. Was aber hätten die Araber damit zu tun? Nach längerem nachdenklichen Schweigen gab Goldmann mit der ihm eigenen Ironie zurück: Er hoffe, die Araber dächten nicht wie Ben Gurion.
Das nächtliche Gespräch zwischen Nahum Goldmann und Ben Gurion berührte den Kern des Konflikts zwischen Arabern und Juden: die Frage der Legitimität. Das heißt: Wie rechtfertigen Juden und palästinensische Araber gegenseitig ihren Anspruch auf das Land? Beider Selbstverständnis ist eng mit einer religiösen und kulturellen Deutung der Geschichte verbunden. Dieses jeweils eigene kollektive "Narrativ" versuchen sie sich gegenseitig, nötigenfalls mit Gewalt, aufzuzwingen.
Was Israel betrifft: Seine Legitimität ist nicht eindeutig, sondern teilt sich in drei Begründungsvarianten. Die von Ben Gurion referierte göttliche Zusage könnte man die einseitige, die unilaterale Legitimitätsbegründung nennen. Ein solcher Anspruch freilich kann andere nicht verpflichten, schon gar nicht die unmittelbaren Kontrahenten im Konflikt, die Araber. So muss dieses Argument gleichsam physisch durchgesetzt werden - in Form fortgesetzter Besiedelung des unter Berufung auf die Bibel als "Judäa und Samaria" vereinnahmten Gebiets. Die Besiedlungspolitik ist also ein im Wortsinne durchschlagendes Argument, ein Projektil im Diskurs unilateraler Legitimität. Die legitimatorisch in Anspruch genommene göttliche Verheißung des biblischen Landes bindet in säkularer Verdünnung auch jene Israelis, die aus pragmatischen Gründen - vor allem eines erstrebten Ausgleichs mit den Palästinensern wegen - zu den seit 1967 besetzten Gebieten Abstand halten. Im innerisraelischen Diskurs über Legitimität aber erliegen sie dem Zwang der unilateralen Argumentation. Denn diese bedient sich in suggestiver Weise der Vorgeschichte des Staates Israel, um eine über die Grenzen von 1948 hinausgehende Besiedelung zu rechtfertigen. Wer sich Hebron verweigere, heißt es da, verwirke den Anspruch auf Tel Aviv. So lässt sich die - durch die jüngste Eskalation des Konflikts in ihrer Widerstandskraft geschwächte - pragmatische Mehrheit von den Siedlern und ihren Parteigängern argumentativ zur Geisel nehmen.
Dabei böte sich den Gegnern einer fortgesetzten Besiedlung über die "grüne Linie" hinaus so manch gutes Argument. Die Grenzlinien von 1948 sind nämlich gewissermaßen sakrosankt - in beide Richtungen. Immerhin handelt es sich dabei um die "Grenzen von Auschwitz". So nannte sie der damalige israelische Außenminister Abba Eban nach dem überwältigenden militärischen Sieg von 1967. Er wollte damit allerdings ausdrücken, dass ein Rückzug auf die Grenzen von 1948 wegen ihrer prekären militärischen Tiefe nicht infrage komme. So prägte Abba Ebban das Wort von den "Grenzen von Auschwitz" in abwertender Absicht. In einem ganz anderen Sinne könnte dieses Bild aber eine Legitimität begründen, die aus der Ungeheuerlichkeit des Holocaust schöpft. So ist das Jahr der Staatsgründung Israels auf das engste mit der Zeitikone 1945 und des ihr vorausgegangenen wie nachfolgenden Geschehens verbunden. Schließlich ist der Staat Israel 1948 ja auch tatsächlich, wenn nicht sogar kausal, so doch auf alle Fälle aus dem Kontext des Zweiten Weltkriegs, mit dem Holocaust als seinem Kern, hervorgegangen. So leitet Israel aus der an den Juden exekutierten ultimativen Vernichtung auch das ultimative Recht ab, die "Grenzen von Auschwitz" mit der Androhung der ultimativen Vernichtung durch nukleare Waffen zu verteidigen. Über diese Grenzen hinaus hat eine so begründete Legitimität freilich keine Geltung.
Die Legitimität der Grenzen von Auschwitz, Israels Grenzen von 1948 bis 1967, ist nur teiluniversal. Kategorisch verpflichtet der Holocaust nämlich nur die westliche Welt. Schließlich war der Holocaust mit dem Antisemitismus auf das engste verbunden, und der wiederum steht in einer negativen Tradition der Christenheit. Nur wenn sich der Antisemitismus seinerseits über den Westen, also über die säkularisierte Christenheit hinaus, "universalisieren" sollte, könnte auch die an die Erfahrung des Antisemitismus anknüpfende Existenzbegründung des jüdischen Staates universale Geltung beanspruchen. Das wäre etwa der Fall, wenn die am Konflikt beteiligten Araber und Muslime sich die paranoide Weltdeutung des Antisemitismus zu Eigen machten und Israel nicht allein aus Gründen des Konflikts um die Besatzung heraus bekämpften, sondern allein deshalb, weil es existiert. Bislang fühlten sie sich jedoch frei von dieser Art des Antisemitismus und wiesen alle symbolischen Ansinnen zurück, sich dafür Verantwortung auferlegen zu lassen. Noch Mitte der neunziger Jahre verweigerte der damalige ägyptische Außenminister Amr Musa den bei Staatsvisiten in Israel sonst obligaten Besuch in der Gedenkstätte für die Holocaustopfer in Jad Vaschem - ganz im Sinne jener nächtlichen Aussage Ben Gurions, die Araber seien nicht auf den Holocaust zu verpflichten.
Neben der unilateralen Legitimität des göttlichen Versprechens und der teiluniversalen Legitimität der Grenzen von Auschwitz gilt noch eine weitere mögliche Seinsbegründung Israels. Sie ist ebenso einfach wie komplex: Israel habe ein unumstößliches Anrecht auf Existenz allein schon deshalb, weil es existiert. Solch scheinbare Tautologie bloßer Faktizität ist naturrechtlich begründet - und damit universell. Und genau das macht diese Variante der Legitimität auch zu der einzigen realpolitisch tauglichen. Seitens der Araber bedürfte es allein der Anerkennung der Faktizität Israels - und das unabhängig von allen innerisraelischen Selbstbegründungen, ob sie sich nun auf die Bibel oder auf Auschwitz beziehen. Und in Israel selbst? Zur Geschichte der Landnahme, die zur Staatsgründung Israels führte, könnte sich eine derartige Begründung durchaus gleichgültig verhalten. Schließlich ist nur derjenige zur Rechtfertigung der Vergangenheit aufgerufen, der auch beabsichtigt, sie in die Zukunft hinein zu verlängern. An eine Anerkennung des Faktischen, an eine Anerkennung pur et simple, mochte im Übrigen auch Nahum Goldmann gedacht haben, als er Ben Gurions raisonnement über Legitimität mit der ironischen Bemerkung konterte, er hoffe, die Araber dächten nicht wie der israelische Ministerpräsident.
Die drei Arten der Legitimität - die israelisch-zionistische, die israelisch-jüdische und die "israelisch-israelische" - treten freilich nicht in Reinform auf, sondern in unterschiedlich gelagerten, zuweilen gegenläufigen Vermischungen. Welche Variante in jeweiliger Legierung dominiert, folgt politischen Konjunkturen und ideologischen Konstellationen, die nicht zuletzt auch von den arabischen Gegnern Israels mit beeinflusst werden. Auffälligerweise bleiben sie jedoch unausgesprochen. Umso nachhaltiger bestimmen ihre Codes und Zeichen untergründig die politische Agenda; ja, sie dringen tief in die Poren politischen Handelns ein. So kann auch der gegenwärtig zwischen Israel und den besetzten Gebieten entlang der Linie von 1948 gezogene Zaun als Ausdruck eines verschobenen Diskurses, als Ersatzhandlung für die gemiedene innerisraelische Kontroverse um das eigene nationale Selbstverständnis aufgefasst werden. Zwar wird der Zaun ebenso mit Argumenten der Sicherheit vor arabischen Anschlägen und Attentaten gerechtfertigt, wie sich früher (und mit umgekehrter Stoßrichtung) die ideologisch motivierte Anlage von Siedlungen in den besetzten Gebieten einer sicherheitspolitischen Begründung bediente. Doch der Zaun ist nicht nur eine Sicherheitsvorkehrung. Er zieht vor allen Dingen eine Linie zwischen zwei wesentlichen Rechtfertigungsdiskursen des jüdischen Staates - zwischen der unilateralen Legitimität, wie sie von den Siedlern und ihren Parteigängern reklamiert wird, und der teiluniversalen Legitimität, die sich auf das alte Israel von 1948 und damit auf die Grenzen von Auschwitz beruft. Statt die Rangordnung jener Legitimitäten in der innerisraelischen Debatte politisch auszufechten, wird diese Auseinandersetzung mittels des Zauns in den Bereich einer Sicherheitsdebatte verschoben. Dabei werden unterschiedliche Ränge von Sicherheit markiert - eine höherwertige Sicherheit der Israelis im Kernland und eine minderwertige Sicherheit der Siedler in den besetzten Gebieten.
Wer nicht wie Ben Gurion dachte - oder vielmehr: nicht so denken durfte, waren die 1993 in Oslo verhandelnden israelischen und palästinensischen Gesandten. Ihnen war recht schnell deutlich geworden, dass ein Reden über historische Legitimität und damit über Vergangenheit nur zu einem Zusammenprall der jeweiligen Selbstbilder und zum Abbruch der Gespräche führen musste. Schließlich ist die Vergangenheit eine virtuelle Zeit, im Grunde nur ein Text, der im Sinne der jeweiligen Selbstrechtfertigung unterschiedlich gelesen und interpretiert werden kann. Nur in der Gegenwart aber können sich kompromisswillige Israelis und Palästinenser begegnen. Um zu einem Friedensschluss zu gelangen, galt es, die Vergangenheit zu neutralisieren. Dies geschah, indem sich beide Seiten eine vorübergehende Amnesie auferlegten. Letzte Fragen des Konflikts - das Problem Jerusalems und des Tempelbergs sowie das Problem des palästinensischen "Rechts auf Rückkehr" - wollte man um den Preis des Scheiterns aufschieben. Und zwar möglichst lange - sodass beide Völker von den Segnungen des sich Zug um Zug einstellenden Friedens besänftigt werden könnten. Nach und nach, so hoffte man, würden der Politik damit die symbolischen und wenig kompromissfähigen Kerngehalte des Konflikts entzogen werden.
Dieses Kalkül ging nicht auf. Es wurde von Gegnern des israelisch-palästinensischen Ausgleichs auf beiden Seiten durchkreuzt. Die Anschläge von Hamas und dem Islamischen Dschihad zerstörten in Israel Illusionen. Auf der anderen Seite sorgte die fortgesetzte Siedlungspolitik dafür, dass die Palästinenser immer wieder an die Ursprünge des Konflikts erinnert wurden.
Ehud Barak, ein ausgewiesener Gegner der in Oslo eingeschlagenen Verhandlungsstrategie, legte es deshalb in Camp David im Sommer 2000 auf eine umfassende, auf eine endgültige Lösung des Konflikts an. Ein solches Vorhaben musste aber die Erinnerung an alle historischen Phasen des israelisch-palästinensischen Gegensatzes wachrufen. Die Verhandlungen endeten so in der Sackgasse existenzieller und im Prinzip miteinander nicht vereinbarer "letzter Fragen" von Zugehörigkeit und Legitimität. Camp David scheiterte an der Frage Jerusalems, namentlich an der Souveränität am Tempelberg, ebenso wie an der Frage der arabischen Flüchtlinge von 1948 - genauer gesagt am palästinensisch reklamierten "Recht auf Rückkehr". Dabei handelt es sich um Kernfragen der Legitimität - für beide Seiten.
Mit der Frage Jerusalems beziehungsweise der Souveränität am Tempelberg verbindet sich die biblische, die unilaterale Legitimität Israels. Das war nicht immer so. Frühe Zionisten, sogar der wenig zimperliche Staatsgründer Ben Gurion, waren über Jahrzehnte hinweg bestrebt gewesen, von den heiligen Stätten Abstand zu halten. Sie kannten die apokalyptischen Gefahren, die von ihnen ausgehen können. Mit dem Juni-Krieg 1967 aber hatte sich der Legitimitätsdiskurs in Israel verschoben. Jetzt wurde der Tempelberg zu einer Ikone des politischen Selbstverständnisses - und das, obwohl alle israelischen Regierungen aus wohlüberlegten Erwägungen heraus den Status quo an diesem Heiligtum unangetastet in der Obhut der Muslime belassen hatten. Die mit Baraks Verhandlungsstrategie der endgültigen Lösung des Konflikts aufgeworfene Souveränitätsfrage am Tempelberg machte eine Entscheidung unausweichlich. Die Folgen waren dramatisch.
Dramatisch wirkte sich auch die palästinensische Forderung nach einer israelischen Anerkennung des "Rechts auf Rückkehr" für die arabischen Flüchtlinge des Krieges von 1948 aus - immerhin ein Kernstück des palästinensischen Selbstverständnisses. Über die Aufnahme einer auszuhandelnden Anzahl von arabischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen nach Israel hinaus käme ein solches Zugeständnis einer israelischen Schuldanerkenntnis für Flucht und Vertreibung der Araber Palästinas gleich. Dies wiederum würde am Selbstverständnis der überwiegenden Mehrheit auch jener Israelis rühren, die sich mit den Grenzen von 1948, den Grenzen von Auschwitz, abzufinden bereit wären. Das palästinensische "Recht auf Rückkehr" aber würde das jüdische Gemeinwesen womöglich um seine demografischen Voraussetzungen bringen.
In Camp David waren vor zwei Jahren Fragen der Zugehörigkeit und Legitimität zum Gegenstand von Verhandlungen geworden. Beiden Verhandlungsführern - Arafat und Barak - drohte im Falle des Nachgebens in den Kernpunkten des jeweiligen kollektiven Selbstverständnisses der Bürgerkrieg. Den wünschten sie sich freilich nur beim jeweils anderen. Die Alternative zum potenziellen Bürgerkrieg im Inneren aber ist der Krieg nach außen.
Dan Diner im Interview:
Frage: Seit Jahrzehnten wird in Israel von einem Friedensprozess gesprochen. Gibt es den überhaupt noch, oder ist er zur Worthülse verkommen?
Solange beide Konfliktparteien noch von einem Friedensprozess reden, demonstrieren sie nach Außen, dass sie weiterhin an einem Ausgleich interessiert sind. Keiner möchte die Verantwortung dafür übernehmen, den Friedensprozess für tot erklärt zu haben. Dieser Begriff ist zudem wichtig, weil darin auch die gegenseitige Anerkennung symbolisiert wird.
Hat Barak einen Fehler gemacht, als er die Jerusalemfrage aufwarf?
Barak hat die letzte aller Fragen, die Jerusalem-Frage und damit den Endstatus, unmittelbar auf die Tagesordnung gesetzt. Das war im hohen Maße problematisch, wenn davon ausgegangen werden konnte, man habe es hier mit einem politischen Sprengsatz zu tun. Mit der Frage nach dem Status des Tempelberges waren alle Register des historischen Konfliktes gezogen.
Insofern hat die Auseinandersetzung eine neue Dimension, eine religiöse Komponente, hinzugewonnen?
Der Konflikt, der nunmehr explodiert ist, geht um den Tempelberg. Die Palästinenser fordern die volle Souveränität über das Heiligtum. Israel will das nicht zugestehen. Der Heiligkeit des Streitgegenstandes wegen wird der Konflikt allgegenwärtig. Religiöse Konflikte sind im Unterschied zu territorialen nicht eingrenzbar. Damit hat sich die Kompromissfähigkeit der Kontrahenten erheblich reduziert. Man könnte fast sagen: ein geteiltes Heiligtum wäre kein Heiligtum mehr.
Ist dieser Konflikt dann überhaupt lösbar?
Die Lage ist in der Tat sehr komplex. Es gehen mehrere Schichten ineinander über, verstärken sich gegenseitig und erwecken den Anschein, der Konflikt wäre unlösbar. Zum Beispiel im Hinblick auf die Gleichbehandlungsansprüche der arabischen Bevölkerung in Israel. Will man ihnen nachkommen, müsste sich Israel als Staat neu definieren: nicht mehr als jüdischer Staat, sondern als binationales Gemeinwesen. Die Palästinenser in den besetzten Gebieten sind nicht nur Palästinenser, sie sind auch Teil der arabischen und der muslimischen Welt - das ist eine gewaltige Zahl von Menschen. Insofern ist Israel in einer offensichtlichen Minderheitensituation. Philosophisch ausgedrückt: Die Israelis sind zwar aktuell stark, jedoch historisch schwach. Die Palästinenser aktuell schwach, historisch aber stark.
Was bedeutet die Abtretung von Land für die jüdische Bevölkerung?
Das israelische Selbstverständnis hat sich spätestens seit dem 67er Krieg gewandelt, als das biblische Kernland an Israel fiel. Zuvor war es bei weitem säkularer. Die biblischen Landschaften haben es theologisiert. Zudem ist der Konflikt nicht symmetrisch. Beide Partner berufen sich auf verschiedene Legitimationen und verschiedene historische Zeiten, um ihren Standpunkt zu rechtfertigen. Das war den Verhandlungsführern in Oslo 1993 bewusst. Deshalb vereinbarten sie, über alles zu reden, nur nicht über die Vergangenheit. Denn redet man über die Vergangenheit, so hebt jede Seite an, ihr Geschichtsbild absolut zu setzen und Identitäten zu definieren. Da kann es freilich keinen Kompromiss geben. Nur in der Gegenwart ist ein Ausgleich möglich.
Wie sieht eine Lösung aus, bei der beide Seiten ihre Essentials wahren können?
Beide Parteien müssen lernen, die Vergangenheit des Konfliktes zu vergessen, ihn nur unter den gegenwärtigen Bedingungen zu betrachten. So gesehen, gibt es zwei Parteien, die mit jeweils etwa fünf Millionen Menschen demographisch ungefähr gleich stark sind. Auf der Grundlage nationalstaatlicher Überlegungen müssen sie versuchen, in zwei Territorien miteinander zu leben. Angesichts der vorausgegangenen Analyse mag dies zwar eine Fiktion sein. Aber diese Fiktion ist die einzige Hoffnung. Was theoretisch in der Analyse des asymmetrischen Konflikts richtig ist, kann praktisch falsch sein. Denn oftmals sind Amnesien die einzige Möglichkeit, sich zu einigen.
Dokumentiert in Auszügen aus AUFBAU, New York, vom 23.11. 2000
Prof. Dr. Dan Diner , geb. 1946, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig und an der Universität Tel Aviv, dort seit 1994 Leiter des Instituts für Deutsche Geschichte; seit 1999 Direktor des Simon Dubnow Instituts für Jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig. Herausgeber des "Tel Aviver Jahrbuchs für deutsche Geschichte" und Co-Editor von "History and Memory. Studies in Representation of the Past" sowie "Babylon. Zeitschrift für jüdische Gegenwart"; zahlreiche Publikationen zur Geschichte Israels und des Vorderen Orients, zum Nationalsozialismus und zur Geschichte des Völkerrechts, darunter "Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz", Hg., 1989, "Der Krieg der Erinnerungen und die Ordnung der Welt", 1991, "Kreisläufe. Nationalsozialismus und Gedächtnis", 1995, "Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung", 1999.
Kompliment, nach Deinen Äußerungen hatte ich Dich wesentlich jünger eingeschätzt ...

Deine Einlassungen zur Politik Israels bzw. zur jüdischen Diaspora möchte ich nicht weiter kommentieren, ich denke wir sind da gedanklich so weit auseinander, daß dazu ein längere Diskussion erforderlich wäre, welche hier zu führen mir zu zeitintensiv und zu anstrenngend erscheint.
Ich habe Dir aber einen Essay herausgesucht, der in etwa meiner Position beinhaltet:
Sprachlos am Zaun
Israels Existenz hat drei Begründungen. Nur eine kann das Überleben des jüdischen Staates sichern
von Dan Diner
Es war irgendwann in den späteren 1950er Jahren. In der bescheidenen Residenz des israelischen Ministerpräsidenten in Jerusalem führten David Ben Gurion und Nahum Goldmann bis in die frühen Morgenstunden ein Gespräch. Zwei Persönlichkeiten saßen da zusammen, die ungeachtet ihrer gemeinsamen zionistischen Überzeugungen von Grund auf verschieden waren: auf der einen Seite Goldmann, der große Diplomat und Fürsprecher der Juden in aller Welt, ein ironischer Skeptiker in der Tradition der Diaspora. Auf der anderen der von einer Aura prophetischer Gewissheit umgebene Ben Gurion, ein Mann der Tat, der sich des Instrumentariums der Macht ohne Zaudern zu bedienen wusste - nach innen wie nach außen.
In diesem Gespräch äußerte Ben Gurion einen überraschend düsteren Gedanken. Er glaube schon, dass man ihn, den fast 70-Jährigen, noch in israelischer Erde begraben werde, seinen Sohn Amos aber wohl kaum noch. Erschrocken fragte Goldmann nach den Gründen für einen derartig überbordenden Pessimismus. Nach einigem Zögern gab Ben Gurion seine tiefsten Zweifel preis: Die Araber würden Israel niemals akzeptieren. Ja, sicher, Gott habe das Land dem Volke Israel versprochen. Aber, fuhr Ben Gurion fort, dieser Gott ist unser Gott. Für die Araber hat das keine Verbindlichkeit. Die Vernichtung der europäischen Juden, der Holocaust? Da sei es doch eher an den Deutschen, das Rheinland zu räumen, um Platz für die Errichtung eines jüdischen Staates zu machen. Was aber hätten die Araber damit zu tun? Nach längerem nachdenklichen Schweigen gab Goldmann mit der ihm eigenen Ironie zurück: Er hoffe, die Araber dächten nicht wie Ben Gurion.
Das nächtliche Gespräch zwischen Nahum Goldmann und Ben Gurion berührte den Kern des Konflikts zwischen Arabern und Juden: die Frage der Legitimität. Das heißt: Wie rechtfertigen Juden und palästinensische Araber gegenseitig ihren Anspruch auf das Land? Beider Selbstverständnis ist eng mit einer religiösen und kulturellen Deutung der Geschichte verbunden. Dieses jeweils eigene kollektive "Narrativ" versuchen sie sich gegenseitig, nötigenfalls mit Gewalt, aufzuzwingen.
Was Israel betrifft: Seine Legitimität ist nicht eindeutig, sondern teilt sich in drei Begründungsvarianten. Die von Ben Gurion referierte göttliche Zusage könnte man die einseitige, die unilaterale Legitimitätsbegründung nennen. Ein solcher Anspruch freilich kann andere nicht verpflichten, schon gar nicht die unmittelbaren Kontrahenten im Konflikt, die Araber. So muss dieses Argument gleichsam physisch durchgesetzt werden - in Form fortgesetzter Besiedelung des unter Berufung auf die Bibel als "Judäa und Samaria" vereinnahmten Gebiets. Die Besiedlungspolitik ist also ein im Wortsinne durchschlagendes Argument, ein Projektil im Diskurs unilateraler Legitimität. Die legitimatorisch in Anspruch genommene göttliche Verheißung des biblischen Landes bindet in säkularer Verdünnung auch jene Israelis, die aus pragmatischen Gründen - vor allem eines erstrebten Ausgleichs mit den Palästinensern wegen - zu den seit 1967 besetzten Gebieten Abstand halten. Im innerisraelischen Diskurs über Legitimität aber erliegen sie dem Zwang der unilateralen Argumentation. Denn diese bedient sich in suggestiver Weise der Vorgeschichte des Staates Israel, um eine über die Grenzen von 1948 hinausgehende Besiedelung zu rechtfertigen. Wer sich Hebron verweigere, heißt es da, verwirke den Anspruch auf Tel Aviv. So lässt sich die - durch die jüngste Eskalation des Konflikts in ihrer Widerstandskraft geschwächte - pragmatische Mehrheit von den Siedlern und ihren Parteigängern argumentativ zur Geisel nehmen.
Dabei böte sich den Gegnern einer fortgesetzten Besiedlung über die "grüne Linie" hinaus so manch gutes Argument. Die Grenzlinien von 1948 sind nämlich gewissermaßen sakrosankt - in beide Richtungen. Immerhin handelt es sich dabei um die "Grenzen von Auschwitz". So nannte sie der damalige israelische Außenminister Abba Eban nach dem überwältigenden militärischen Sieg von 1967. Er wollte damit allerdings ausdrücken, dass ein Rückzug auf die Grenzen von 1948 wegen ihrer prekären militärischen Tiefe nicht infrage komme. So prägte Abba Ebban das Wort von den "Grenzen von Auschwitz" in abwertender Absicht. In einem ganz anderen Sinne könnte dieses Bild aber eine Legitimität begründen, die aus der Ungeheuerlichkeit des Holocaust schöpft. So ist das Jahr der Staatsgründung Israels auf das engste mit der Zeitikone 1945 und des ihr vorausgegangenen wie nachfolgenden Geschehens verbunden. Schließlich ist der Staat Israel 1948 ja auch tatsächlich, wenn nicht sogar kausal, so doch auf alle Fälle aus dem Kontext des Zweiten Weltkriegs, mit dem Holocaust als seinem Kern, hervorgegangen. So leitet Israel aus der an den Juden exekutierten ultimativen Vernichtung auch das ultimative Recht ab, die "Grenzen von Auschwitz" mit der Androhung der ultimativen Vernichtung durch nukleare Waffen zu verteidigen. Über diese Grenzen hinaus hat eine so begründete Legitimität freilich keine Geltung.
Die Legitimität der Grenzen von Auschwitz, Israels Grenzen von 1948 bis 1967, ist nur teiluniversal. Kategorisch verpflichtet der Holocaust nämlich nur die westliche Welt. Schließlich war der Holocaust mit dem Antisemitismus auf das engste verbunden, und der wiederum steht in einer negativen Tradition der Christenheit. Nur wenn sich der Antisemitismus seinerseits über den Westen, also über die säkularisierte Christenheit hinaus, "universalisieren" sollte, könnte auch die an die Erfahrung des Antisemitismus anknüpfende Existenzbegründung des jüdischen Staates universale Geltung beanspruchen. Das wäre etwa der Fall, wenn die am Konflikt beteiligten Araber und Muslime sich die paranoide Weltdeutung des Antisemitismus zu Eigen machten und Israel nicht allein aus Gründen des Konflikts um die Besatzung heraus bekämpften, sondern allein deshalb, weil es existiert. Bislang fühlten sie sich jedoch frei von dieser Art des Antisemitismus und wiesen alle symbolischen Ansinnen zurück, sich dafür Verantwortung auferlegen zu lassen. Noch Mitte der neunziger Jahre verweigerte der damalige ägyptische Außenminister Amr Musa den bei Staatsvisiten in Israel sonst obligaten Besuch in der Gedenkstätte für die Holocaustopfer in Jad Vaschem - ganz im Sinne jener nächtlichen Aussage Ben Gurions, die Araber seien nicht auf den Holocaust zu verpflichten.
Neben der unilateralen Legitimität des göttlichen Versprechens und der teiluniversalen Legitimität der Grenzen von Auschwitz gilt noch eine weitere mögliche Seinsbegründung Israels. Sie ist ebenso einfach wie komplex: Israel habe ein unumstößliches Anrecht auf Existenz allein schon deshalb, weil es existiert. Solch scheinbare Tautologie bloßer Faktizität ist naturrechtlich begründet - und damit universell. Und genau das macht diese Variante der Legitimität auch zu der einzigen realpolitisch tauglichen. Seitens der Araber bedürfte es allein der Anerkennung der Faktizität Israels - und das unabhängig von allen innerisraelischen Selbstbegründungen, ob sie sich nun auf die Bibel oder auf Auschwitz beziehen. Und in Israel selbst? Zur Geschichte der Landnahme, die zur Staatsgründung Israels führte, könnte sich eine derartige Begründung durchaus gleichgültig verhalten. Schließlich ist nur derjenige zur Rechtfertigung der Vergangenheit aufgerufen, der auch beabsichtigt, sie in die Zukunft hinein zu verlängern. An eine Anerkennung des Faktischen, an eine Anerkennung pur et simple, mochte im Übrigen auch Nahum Goldmann gedacht haben, als er Ben Gurions raisonnement über Legitimität mit der ironischen Bemerkung konterte, er hoffe, die Araber dächten nicht wie der israelische Ministerpräsident.
Die drei Arten der Legitimität - die israelisch-zionistische, die israelisch-jüdische und die "israelisch-israelische" - treten freilich nicht in Reinform auf, sondern in unterschiedlich gelagerten, zuweilen gegenläufigen Vermischungen. Welche Variante in jeweiliger Legierung dominiert, folgt politischen Konjunkturen und ideologischen Konstellationen, die nicht zuletzt auch von den arabischen Gegnern Israels mit beeinflusst werden. Auffälligerweise bleiben sie jedoch unausgesprochen. Umso nachhaltiger bestimmen ihre Codes und Zeichen untergründig die politische Agenda; ja, sie dringen tief in die Poren politischen Handelns ein. So kann auch der gegenwärtig zwischen Israel und den besetzten Gebieten entlang der Linie von 1948 gezogene Zaun als Ausdruck eines verschobenen Diskurses, als Ersatzhandlung für die gemiedene innerisraelische Kontroverse um das eigene nationale Selbstverständnis aufgefasst werden. Zwar wird der Zaun ebenso mit Argumenten der Sicherheit vor arabischen Anschlägen und Attentaten gerechtfertigt, wie sich früher (und mit umgekehrter Stoßrichtung) die ideologisch motivierte Anlage von Siedlungen in den besetzten Gebieten einer sicherheitspolitischen Begründung bediente. Doch der Zaun ist nicht nur eine Sicherheitsvorkehrung. Er zieht vor allen Dingen eine Linie zwischen zwei wesentlichen Rechtfertigungsdiskursen des jüdischen Staates - zwischen der unilateralen Legitimität, wie sie von den Siedlern und ihren Parteigängern reklamiert wird, und der teiluniversalen Legitimität, die sich auf das alte Israel von 1948 und damit auf die Grenzen von Auschwitz beruft. Statt die Rangordnung jener Legitimitäten in der innerisraelischen Debatte politisch auszufechten, wird diese Auseinandersetzung mittels des Zauns in den Bereich einer Sicherheitsdebatte verschoben. Dabei werden unterschiedliche Ränge von Sicherheit markiert - eine höherwertige Sicherheit der Israelis im Kernland und eine minderwertige Sicherheit der Siedler in den besetzten Gebieten.
Wer nicht wie Ben Gurion dachte - oder vielmehr: nicht so denken durfte, waren die 1993 in Oslo verhandelnden israelischen und palästinensischen Gesandten. Ihnen war recht schnell deutlich geworden, dass ein Reden über historische Legitimität und damit über Vergangenheit nur zu einem Zusammenprall der jeweiligen Selbstbilder und zum Abbruch der Gespräche führen musste. Schließlich ist die Vergangenheit eine virtuelle Zeit, im Grunde nur ein Text, der im Sinne der jeweiligen Selbstrechtfertigung unterschiedlich gelesen und interpretiert werden kann. Nur in der Gegenwart aber können sich kompromisswillige Israelis und Palästinenser begegnen. Um zu einem Friedensschluss zu gelangen, galt es, die Vergangenheit zu neutralisieren. Dies geschah, indem sich beide Seiten eine vorübergehende Amnesie auferlegten. Letzte Fragen des Konflikts - das Problem Jerusalems und des Tempelbergs sowie das Problem des palästinensischen "Rechts auf Rückkehr" - wollte man um den Preis des Scheiterns aufschieben. Und zwar möglichst lange - sodass beide Völker von den Segnungen des sich Zug um Zug einstellenden Friedens besänftigt werden könnten. Nach und nach, so hoffte man, würden der Politik damit die symbolischen und wenig kompromissfähigen Kerngehalte des Konflikts entzogen werden.
Dieses Kalkül ging nicht auf. Es wurde von Gegnern des israelisch-palästinensischen Ausgleichs auf beiden Seiten durchkreuzt. Die Anschläge von Hamas und dem Islamischen Dschihad zerstörten in Israel Illusionen. Auf der anderen Seite sorgte die fortgesetzte Siedlungspolitik dafür, dass die Palästinenser immer wieder an die Ursprünge des Konflikts erinnert wurden.
Ehud Barak, ein ausgewiesener Gegner der in Oslo eingeschlagenen Verhandlungsstrategie, legte es deshalb in Camp David im Sommer 2000 auf eine umfassende, auf eine endgültige Lösung des Konflikts an. Ein solches Vorhaben musste aber die Erinnerung an alle historischen Phasen des israelisch-palästinensischen Gegensatzes wachrufen. Die Verhandlungen endeten so in der Sackgasse existenzieller und im Prinzip miteinander nicht vereinbarer "letzter Fragen" von Zugehörigkeit und Legitimität. Camp David scheiterte an der Frage Jerusalems, namentlich an der Souveränität am Tempelberg, ebenso wie an der Frage der arabischen Flüchtlinge von 1948 - genauer gesagt am palästinensisch reklamierten "Recht auf Rückkehr". Dabei handelt es sich um Kernfragen der Legitimität - für beide Seiten.
Mit der Frage Jerusalems beziehungsweise der Souveränität am Tempelberg verbindet sich die biblische, die unilaterale Legitimität Israels. Das war nicht immer so. Frühe Zionisten, sogar der wenig zimperliche Staatsgründer Ben Gurion, waren über Jahrzehnte hinweg bestrebt gewesen, von den heiligen Stätten Abstand zu halten. Sie kannten die apokalyptischen Gefahren, die von ihnen ausgehen können. Mit dem Juni-Krieg 1967 aber hatte sich der Legitimitätsdiskurs in Israel verschoben. Jetzt wurde der Tempelberg zu einer Ikone des politischen Selbstverständnisses - und das, obwohl alle israelischen Regierungen aus wohlüberlegten Erwägungen heraus den Status quo an diesem Heiligtum unangetastet in der Obhut der Muslime belassen hatten. Die mit Baraks Verhandlungsstrategie der endgültigen Lösung des Konflikts aufgeworfene Souveränitätsfrage am Tempelberg machte eine Entscheidung unausweichlich. Die Folgen waren dramatisch.
Dramatisch wirkte sich auch die palästinensische Forderung nach einer israelischen Anerkennung des "Rechts auf Rückkehr" für die arabischen Flüchtlinge des Krieges von 1948 aus - immerhin ein Kernstück des palästinensischen Selbstverständnisses. Über die Aufnahme einer auszuhandelnden Anzahl von arabischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen nach Israel hinaus käme ein solches Zugeständnis einer israelischen Schuldanerkenntnis für Flucht und Vertreibung der Araber Palästinas gleich. Dies wiederum würde am Selbstverständnis der überwiegenden Mehrheit auch jener Israelis rühren, die sich mit den Grenzen von 1948, den Grenzen von Auschwitz, abzufinden bereit wären. Das palästinensische "Recht auf Rückkehr" aber würde das jüdische Gemeinwesen womöglich um seine demografischen Voraussetzungen bringen.
In Camp David waren vor zwei Jahren Fragen der Zugehörigkeit und Legitimität zum Gegenstand von Verhandlungen geworden. Beiden Verhandlungsführern - Arafat und Barak - drohte im Falle des Nachgebens in den Kernpunkten des jeweiligen kollektiven Selbstverständnisses der Bürgerkrieg. Den wünschten sie sich freilich nur beim jeweils anderen. Die Alternative zum potenziellen Bürgerkrieg im Inneren aber ist der Krieg nach außen.
Dan Diner im Interview:
Frage: Seit Jahrzehnten wird in Israel von einem Friedensprozess gesprochen. Gibt es den überhaupt noch, oder ist er zur Worthülse verkommen?
Solange beide Konfliktparteien noch von einem Friedensprozess reden, demonstrieren sie nach Außen, dass sie weiterhin an einem Ausgleich interessiert sind. Keiner möchte die Verantwortung dafür übernehmen, den Friedensprozess für tot erklärt zu haben. Dieser Begriff ist zudem wichtig, weil darin auch die gegenseitige Anerkennung symbolisiert wird.
Hat Barak einen Fehler gemacht, als er die Jerusalemfrage aufwarf?
Barak hat die letzte aller Fragen, die Jerusalem-Frage und damit den Endstatus, unmittelbar auf die Tagesordnung gesetzt. Das war im hohen Maße problematisch, wenn davon ausgegangen werden konnte, man habe es hier mit einem politischen Sprengsatz zu tun. Mit der Frage nach dem Status des Tempelberges waren alle Register des historischen Konfliktes gezogen.
Insofern hat die Auseinandersetzung eine neue Dimension, eine religiöse Komponente, hinzugewonnen?
Der Konflikt, der nunmehr explodiert ist, geht um den Tempelberg. Die Palästinenser fordern die volle Souveränität über das Heiligtum. Israel will das nicht zugestehen. Der Heiligkeit des Streitgegenstandes wegen wird der Konflikt allgegenwärtig. Religiöse Konflikte sind im Unterschied zu territorialen nicht eingrenzbar. Damit hat sich die Kompromissfähigkeit der Kontrahenten erheblich reduziert. Man könnte fast sagen: ein geteiltes Heiligtum wäre kein Heiligtum mehr.
Ist dieser Konflikt dann überhaupt lösbar?
Die Lage ist in der Tat sehr komplex. Es gehen mehrere Schichten ineinander über, verstärken sich gegenseitig und erwecken den Anschein, der Konflikt wäre unlösbar. Zum Beispiel im Hinblick auf die Gleichbehandlungsansprüche der arabischen Bevölkerung in Israel. Will man ihnen nachkommen, müsste sich Israel als Staat neu definieren: nicht mehr als jüdischer Staat, sondern als binationales Gemeinwesen. Die Palästinenser in den besetzten Gebieten sind nicht nur Palästinenser, sie sind auch Teil der arabischen und der muslimischen Welt - das ist eine gewaltige Zahl von Menschen. Insofern ist Israel in einer offensichtlichen Minderheitensituation. Philosophisch ausgedrückt: Die Israelis sind zwar aktuell stark, jedoch historisch schwach. Die Palästinenser aktuell schwach, historisch aber stark.
Was bedeutet die Abtretung von Land für die jüdische Bevölkerung?
Das israelische Selbstverständnis hat sich spätestens seit dem 67er Krieg gewandelt, als das biblische Kernland an Israel fiel. Zuvor war es bei weitem säkularer. Die biblischen Landschaften haben es theologisiert. Zudem ist der Konflikt nicht symmetrisch. Beide Partner berufen sich auf verschiedene Legitimationen und verschiedene historische Zeiten, um ihren Standpunkt zu rechtfertigen. Das war den Verhandlungsführern in Oslo 1993 bewusst. Deshalb vereinbarten sie, über alles zu reden, nur nicht über die Vergangenheit. Denn redet man über die Vergangenheit, so hebt jede Seite an, ihr Geschichtsbild absolut zu setzen und Identitäten zu definieren. Da kann es freilich keinen Kompromiss geben. Nur in der Gegenwart ist ein Ausgleich möglich.
Wie sieht eine Lösung aus, bei der beide Seiten ihre Essentials wahren können?
Beide Parteien müssen lernen, die Vergangenheit des Konfliktes zu vergessen, ihn nur unter den gegenwärtigen Bedingungen zu betrachten. So gesehen, gibt es zwei Parteien, die mit jeweils etwa fünf Millionen Menschen demographisch ungefähr gleich stark sind. Auf der Grundlage nationalstaatlicher Überlegungen müssen sie versuchen, in zwei Territorien miteinander zu leben. Angesichts der vorausgegangenen Analyse mag dies zwar eine Fiktion sein. Aber diese Fiktion ist die einzige Hoffnung. Was theoretisch in der Analyse des asymmetrischen Konflikts richtig ist, kann praktisch falsch sein. Denn oftmals sind Amnesien die einzige Möglichkeit, sich zu einigen.
Dokumentiert in Auszügen aus AUFBAU, New York, vom 23.11. 2000
Prof. Dr. Dan Diner , geb. 1946, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig und an der Universität Tel Aviv, dort seit 1994 Leiter des Instituts für Deutsche Geschichte; seit 1999 Direktor des Simon Dubnow Instituts für Jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig. Herausgeber des "Tel Aviver Jahrbuchs für deutsche Geschichte" und Co-Editor von "History and Memory. Studies in Representation of the Past" sowie "Babylon. Zeitschrift für jüdische Gegenwart"; zahlreiche Publikationen zur Geschichte Israels und des Vorderen Orients, zum Nationalsozialismus und zur Geschichte des Völkerrechts, darunter "Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz", Hg., 1989, "Der Krieg der Erinnerungen und die Ordnung der Welt", 1991, "Kreisläufe. Nationalsozialismus und Gedächtnis", 1995, "Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung", 1999.
.
Wir sind alle Amerikaner
Cordt Schnibben über Friedenskritik und Kriegsblinde
Dank schulden wir den Amerikanern, weil sie uns von den Nazis befreiten; Dank schulden wir ihnen, weil sie die Sowjetunion zu Tode rüsteten und die DDR befreiten; und aus lauter Dankbarkeit sollen wir für den Krieg gegen Saddam Hussein sein - legen uns George W. Bush, Angela Merkel und nun auch Wolf Biermann nahe, uns, den Friedensmemmen und Antiamerikanern, uns, den Kindern der Nazi-Täter, die "reflexartig und prinzipiell gegen jeden Krieg" sind.
Ja, mein Vater war Nazi, er schleppte mich zu Geländespielen der "Wiking Jugend", ja, er hasste die Amerikaner und erzählte Juden-Witze. Glücklicherweise entdeckte ich eines Tages einen Karton mit Jerry-Cotton-Romanen auf unserem Dachboden, zurückgelassen von einem ausgezogenen Mieter. Mit dem FBI-Agenten hetzte ich nun im Jaguar durch New York, den Bronx River Parkway hoch, jagte durch Harlem und Chinatown, lief durch den Central Park, hielt morgens die druckfrische "New York Times" in der Hand, wollte von meiner Mutter knusprig gebratenen Schinken, Spiegelei und frisch gerösteten Toast zum Frühstück, spielte mit meiner 38er und stellte mir vor, wie eisgekühlter Bourbon schmeckt.
Abends hörte ich unter der Bettdecke den Piratensender "Radio Caroline", und am Wochenende spielten die "Shakespeares" im Saal der Kirchengemeinde "Fa, fa, fa, fa, fa" von Otis Redding, "Land of 1000 Dances" von Wilson Pickett, "What Is Soul?" von Ben E. King.
Wann ich das erste Mal das Wort "Vietnam" hörte, weiß ich nicht mehr, aber alles, was ich hörte, hielt ich für Gräuelmärchen der Russen. Erst als der Pastor im Konfirmandenunterricht über den Krieg im Dschungel sprach, dämmerte mir langsam, dass die Amerikaner da in irgendwas verwickelt waren, was nichts mit meinem Amerika zu tun haben konnte.
Mein erstes Flugblatt tippte ich heimlich im Arbeitszimmer meines Vaters auf einer Matrize und forderte "Freiheit für Angela Davis", Freiheit für eine schwarze Amerikanerin, der in den USA der Prozess gemacht wurde wegen irgendeiner rassistischen Sauerei. Da steckten ich und meine Mitschüler schon mittendrin in der Erforschung meines Märchenlandes, entdeckten Malcolm X und Cassius Clay, staunten über die Invasion in der Schweinebucht, die Operation "Powerpack" in der Dominikanischen Republik, über den langen Arm der CIA in Indonesien und Griechenland, sammelten alles, was wir über den Vietnam-Krieg in die Finger kriegen konnten: Tonking-Zwischenfall, Massaker von My Lai, Pentagon Papers.
Ja, wir haben uns unseren Antiamerikanismus hart erarbeitet.
Viel später konnten wir aus der Biografie von Robert S. McNamara erfahren, dem US-Verteidigungsminister jener Zeit, dass der Vietnam-Krieg, der uns vorgekommen war wie ein kalt geplanter Völkermord im Dienste der Freiheit, nicht mehr war als das über ein Jahrzehnt anhaltende Irren eines Haufens wild um sich schießender Militärs und Minister. "Töricht" sei dieser Feldzug gegen das Böse gewesen, der über zwei Millionen Amerikaner und Vietnamesen das Leben kostete, gestand der Rumsfeld jener Jahre; die Regierenden seien von "verzweifelter Tatkraft" beseelt gewesen und von der "Entschlossenheit, irgendetwas gegen die weitere Ausbreitung des Kommunismus zu unternehmen".
Das Überleben und den Erfolg der Freiheit hatte John F. Kennedy 1961 bei seinem Amtsantritt der Welt und uns versprochen, "alle Nationen sollen wissen, egal ob sie uns wohlgesinnt sind oder nicht, dass wir bereit sind, jeden Preis zu zahlen". Die "Dominotheorie" beherrschte sein Denken und das seiner Regierung: Wenn eines der Länder in Südostasien in die Hände der Kommunisten falle, würden alle Staaten der Region wie umstürzende Dominosteine bald ebenfalls dem Reich des Bösen zufallen.
In Vietnam wollte Kennedy zeigen, wie ernst es den USA war mit ihrem Versprechen, die Welt zu befreien und die USA zur politischen, militärischen und moralischen Führungsmacht zu machen, und seine Nachfolger Johnson und Nixon eiferten ihm nach. Immer mehr amerikanische Bomben, Panzer und Soldaten wurden nach Vietnam verschickt, immer mehr Verbündete mussten die USA unterstützen.
Auch die Deutschen ließ der Krieg kämpfen: Die Freiheit Berlins werde in Saigon verteidigt, sagten die einen; sie wollten deutsche Soldaten hinüberjagen und Kampfhubschrauber, aber dann begnügten sie sich damit, den südvietnamesischen Soldaten Schäferhunde zu schicken und den Witwen amerikanischer Soldaten kleine Kopien der Berliner Freiheitsglocke. Die Würde aller Menschen werde in Vietnam zertreten, sagten die anderen; sie veranstalteten Protestmärsche und Tribunale, sie ließen Scheiben klirren und Molotowcocktails fliegen, und sie verbrannten Sternenbanner.
Der Vietnam-Krieg veränderte Deutschland: Er schürte Zweifel am American Way of Life und an dem, was von vielen Empörten nun "Weltimperialismus" genannt wurde; er politisierte Schriftsteller, Künstler und Filmemacher; er machte aus einem bis dahin bloß antiautoritären Generationenaufstand eine Revolte; und er ließ eine kleine radikale Minderheit den ersten Terrorakt begehen. Andreas Baader und seine Freunde steckten ein Frankfurter Kaufhaus in Brand, "aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen" - um später selbst zu Mördern zu werden.
Aus dem Dschungelkrieg gegen eine Ameisenarmee wurde ein globaler Krieg um Köpfe. Die Fernsehnachrichten trugen die Gewalt so lange in die Wohnzimmer der Welt, bis die Front gegen die USA den Erdball umspannte und es in den Straßen mancher Metropole zuging wie in Saigon während der Tet-Offensive.
Als die USA 1975 Vietnam verließen, war die Führungsmacht des Westens nicht nur militärisch geschlagen, sondern vor allem moralisch erledigt. In den siebziger und achtziger Jahren begleiteten die westlichen Völker das politische Gebaren ihrer Führungsmacht mit antiamerikanischem Misstrauen; Militäraktionen in Iran, auf Grenada, in Libyen, in Panama schürten die Skepsis. Seit dem Golfkrieg 1991 allerdings gewann die USA wieder an Ansehen, auch die Militäreinsätze in Somalia, Bosnien und Kroatien, im Kosovo ließen die Hoffnung wachsen, die größte Militärmacht der Welt werde nun als Militärpolizist der United Nations die Drecksarbeit machen und überall dort eingreifen, wo Schurken und Verrückte den Weltfrieden bedrohen.
Deshalb war nach den Anschlägen des 11. September die weltweite Solidarität mit den USA nicht nur eine menschliche Geste, sondern eine politische Demonstration: Wir müssen den USA beistehen, weil sie uns schützen. Die Attentate zerstörten nicht nur das World Trade Center, sondern auch das weit verbreitete antiamerikanische Klischee, die Bedrohung der Welt durch islamistische Terroristen sei eine Erfindung der CIA. Das Netzwerk Osama Bin Ladens, jahrelang ignoriert oder unterschätzt, wurde als lebensbedrohlich wahrgenommen, und deshalb waren die Völker der westlichen Welt wohl nie so sehr Amerikaner wie in den Monaten nach dem 11. September und in den Wochen des Afghanistan-Kriegs.
Seit der Irak ins Fadenkreuz der amerikanischen Regierung geriet, fällt diese Wirsind-alle-Amerikaner-Front auseinander, und das liegt nicht - lieber Herr Biermann, Frau Merkel, Mr. Bush - an fehlender Dankbarkeit, an pazifistischer Ängstlichkeit, an weltfremder Blindheit oder an antiamerikanischer Traditionspflege. Das liegt daran, dass der amerikanische Präsident sich im September 2002 in einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie das Recht eingeräumt hat, Präventivkriege gegen potenzielle Angreifer führen zu dürfen, und dass er von der Uno und der Nato und den amerikanischen Verbündeten erwartet, den ersten dieser Kriege gegen Saddam Hussein zu unterstützen - ohne sie zu fragen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie denn der Nahe Osten und der Rest der Welt am Ende dieser "globalen Unternehmung von ungewisser Dauer" aussehen sollen.
Was dem Fernsehzuschauer und Tageszeitungsleser erscheint wie der surreale Streit zwischen Diplomaten, Waffeninspektoren, Präsidentenberatern und Verteidigungsministern über Resolutionen, Satellitenbilder, Raketenreichweiten und Inspektionsfristen, ist tatsächlich der Streit zwischen den USA und Frankreich, Russland, China, Deutschland und vielen anderen Staaten der Uno darüber, wie unumschränkt die Macht der letzten und einzigen Weltmacht sein darf und wie wenig die früheren Weltmächte noch zu sagen haben. Der Irak-Konflikt verschärft wie ein Katalysator all die Probleme, die seit dem Ende des Kalten Krieges gären: Wie soll die Uno Diktatoren zur Rechenschaft ziehen, muss das Völkerrecht verschärft werden? Welche Aufgabe hat die Nato noch, müssen die Staaten der EU aufrüsten, um militärisch nicht mehr vom Schutz der USA abhängig zu sein?
Alle Staatsmänner reden in diesem Konflikt, wie die Indianer sagen, mit gespaltener Zunge, und darum sagt Fischer in München auf der Sicherheitskonferenz nicht: "Mr. Rumsfeld, wir beide wissen doch, dass bei Ihnen 60 Staaten unter Terrorismusverdacht stehen, diese Liste hat mir Ihr Stellvertreter unter die Nase gehalten, aber wir wissen nicht, gegen wie viele Länder Sie Krieg führen wollen, darum stellen wir lieber gleich beim ersten Krieg klar: Nicht mit uns!" Das sagt er nicht, sondern er sagt: "I am sorry, but I am not convinced!" Und Gerhard Schröder ruft den Wählern in Goslar nicht zu: "Also Leute, ich sag euch, der Bush, der hat jetzt so `ne neue Strategie, die hat er mit mir nicht besprochen und mit Chirac auch nicht, aber wir sollen seinen Krieg bezahlen - ich bin doch nicht blöd." Das sagt er nicht, er sagt: "Rechnet nicht damit, dass Deutschland einer den Krieg legitimierenden Resolution zustimmen wird." Und im Bundestag sagt der Kanzler: "Es geht darum, ob Willensbildung multilateral bleibt."
Ein Junge, der von seinem größeren Bruder ignoriert wird, fängt an, trotzig mit Kieselsteinen zu werfen, und ungefähr so hat Schröder dem Präsidenten auf der anderen Seite des großen Teichs während des Bundestagswahlkampfs zu verstehen gegeben, dass er gefragt werden möchte, wenn die USA den Nahen Osten umzubauen gedenken und dabei auf seine Unterstützung zählen.
Dominosteine sollen wieder fallen, diesmal in die andere Richtung, erst der Irak, dann Iran, dann Syrien; Diktatoren sollen mit Gewalt durch demokratische Regime abgelöst werden, damit Schurken in Präsidentensesseln islamistische Terroristen nicht mit Massenvernichtungswaffen versorgen können; die USA "werden die Gunst der Stunde nutzen", hat Bush in seiner Sicherheitsstrategie formuliert, um die "Vorzüge der Freiheit in der ganzen Welt zu verbreiten", und er will sich dafür einsetzen, "die Hoffnung auf Demokratie und freien Handel in jeden Winkel der Erde zu tragen".
Nicht nur Schröder und Fischer wurden durch die Proteste gegen den Vietnam-Krieg politisiert, auch viele der vielen Außenminister und Botschafter, die sich in den letzten Wochen in der Uno gegen den Irak-Krieg ausgesprochen haben, gehören zur Generation der Vietnam-Kriegs-Gegner und reagieren skeptisch auf die Neuauflage dieser Reißbrettpolitik, die wieder, wie damals, Demokratie auf Bombenteppichen abwerfen möchte.
Da ist ein US-Präsident mit seinem Kampfauftrag, ein Präsident, der stolz darauf ist, "aus dem Bauch heraus" zu handeln. Da sind Pentagon-Berater, die ihm schon seit September 2001 raten, das Irak-Problem militärisch zu lösen. Da ist ein US-Senat, den das dienstälteste Kongressmitglied kritisiert, in diesem Parlament herrsche "unheilvolles, beklemmendes Schweigen", es gebe "keine Debatten, keinen Versuch, der Nation das Für und Wider dieses Krieges darzulegen". Da ist die Nato, die die neue Präventivstrategie militärisch absichern soll, weil sie sonst "irrelevant" wird; da sind Frankreich und Deutschland, die sowieso alt und "irrelevant" sind; da sind die United Nations, deren Sicherheitsrat den Krieg völkerrechtlich absegnen soll, weil er sonst "irrelevant" wird.
Diese Art von Kriegspropaganda hat die USA in der Uno isoliert und über sechs Millionen Menschen rund um den Erdball auf die Straße getrieben. Stadträte von über 90 amerikanischen Kommunen, auch in Chicago, Washington, Austin, Philadelphia, stimmten in Entschließungen gegen den Krieg. Und dem Nato-Verbündeten Türkei soll die militärische Solidarität mit mindestens 15 Milliarden Dollar abgerungen werden.
Das Kriegsmarketing der USA leidet unter einem Problem: Die Diplomaten, die Regierungen, die Verbündeten, die Leute auf der Straße sind nicht überzeugt davon, dass alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sind, den Diktator zu entwaffnen. Sie glauben nicht, dass die Bedrohung durch ihn noch so groß und so aktuell ist, um einen Präventivkrieg zu rechtfertigen. Vieles von dem, was Außenminister Powell der Welt im Sicherheitsrat an Beweisen präsentierte, hielt der Überprüfung durch die Waffeninspektoren nicht stand ("Müll") und reicht den meisten Regierungschefs nicht, um das Risiko eines Krieges einzugehen; zumal Powell noch im August letzten Jahres seinen Präsidenten vor dem "Hexenkessel" gewarnt hat, in den der Nahe Osten durch die Invasion verwandelt werde (SPIEGEL 8/2003).
Militärisch sei der Irak-Krieg kein Risiko, meinen Powell und Bush, ein zweites Vietnam sei nicht zu erwarten, der Irak sei schnell zu besiegen. Man wünscht, dass sie Recht behalten, aber wie, Mr. Bush, wollen Sie nach einem schnellen, sauberen Sieg (mit Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden toten Irakern) der Welt erklären, warum Husseins chemische und biologische Waffen vom Erdboden verschwunden geblieben sind? Waren sie nicht einsatzfähig? Oder hat es sie gar nicht gegeben?
Militärisch haben die USA dann gesiegt, aber als Führungsmacht der Welt sind sie geschwächt - wie nach dem Vietnam-Krieg. Dabei braucht die Welt, bedroht von Terroristen und Schurken, noch ungeordnet nach dem Ende des Kalten Krieges, nichts mehr als eine Supermacht, die ihre militärische Stärke diplomatisch einsetzt. Sie haben Recht, Mr. Bush, Frau Merkel, Herr Biermann, ohne den Truppenaufmarsch an seinen Grenzen hätte Hussein keine Inspektoren ins Land gelassen. Und sicher ist auch, dass in dieser Welt Pazifismus als Weltanschauung nicht viel weiterhilft, es werden noch Kriege geführt werden müssen. Aber Herr Bush, wenn Sie "die Chance ergreifen" wollen, "Großes zu verwirklichen", warum agieren Sie dann wie ein Jerry Cotton und zwingen mit Drohungen, Beschimpfungen und Dollar-Schecks eine Koalition der Unwilligen zusammen, statt mit Geduld und Geschick die große Koalition gegen den Terrorismus zusammenzuhalten? Glauben Sie wirklich, Sie können aus der Uno ein ernst zu nehmendes Parlament der Völker machen, indem Sie dem Sicherheitsrat drohen, er mache sich unglaubwürdig, wenn er nicht Ihrer Meinung sei?
Und, Frau Merkel, meinen Sie, deutsche und europäische Interessen lassen sich nur vertreten, wenn man im Windschatten der Dankbarkeit auf Knien durch Washington rutscht? Ja, wir sind mehr Amerikaner, als wir Franzosen, Russen oder Chinesen sind, aber deshalb müssen wir uns das Recht nehmen, diesen Präsidenten allein laufen zu lassen, wenn er uns ins angekündigte Desaster führen will.
Und, Mr. Bierman, es wird Zeit, dass Sie abrüsten. Der Kalte Krieg ist vorbei, vernichten Sie Ihre Massenvernichtungswaffen, hören Sie auf, mit Senfgassätzchen auf ein paar Millionen Demonstranten zu feuern. Woher die Wut? Was stört Sie an Leuten, die "Völkerrecht - can you spell it?" auf ein Pappschild malen und durch die Straßen ziehen? Merken Sie nicht, dass die nicht Reflexen folgen, sondern Zweifeln? Warum sind für Sie Hunderttausende Berliner Friedensdemonstranten so verachtenswert wie "hakenkreuzbrave Deutsche", die im Berliner Sportpalast den totalen Krieg herbeibrüllten? Und warum glauben Sie, diese 20-, 30 -, 40-Jährigen seien gegen den Irak-Krieg, weil sie "den Vereinigten Staaten offenbar niemals verzeihen", das Land von den Nazis befreit zu haben?
Willkommen im Verein der Kriegsblinden!
---
Brachiale Friedensliebe
Wolf Biermann über Nationalpazifisten und den Irak-Krieg
Wann ist denn endlich Frieden
In dieser irren Zeit
Das große Waffenschmieden
Bringt nichts als großes Leid.
Die Welt ist so zerrissen
Und ist im Grund so klein
Wir werden sterben müssen
Dann kann wohl Friede sein
So subversiv und kindlich zugleich sang ich als junger Kerl im militaristischen Friedensstaat DDR 1967, also mitten im Kalten Krieg. Laut sang ich in Ost-Berlin wie ein Menschenkind im dunklen Waffenwald. Unsere stalinistische Obrigkeit verteidigte aggressiv ihr Monopol auf Friedensliebe, auf Friedenspolitik und Friedenskampf. Und dabei logen sie mal wieder die Wahrheit: Alle Menschen wollen Frieden.
Und zu denen gehören eben auch die totalitären Schweinehunde, die ja im Grunde nichts weiter wollen, als ihren idealen Friedhofsfrieden hinter Stacheldraht. Und trotzdem sehne ich mich nach Frieden und hoffe wider bessres Wissen, dass der Kelch eines Krieges an uns allen vorübergehen möge. Vielleicht reicht nur meine Phantasie mal wieder nicht aus, um mir einen Ausweg aus dem Dilemma vorzustellen. In ein paar Wochen oder Monaten werden wir alle klüger sein und womöglich noch ratloser.
Als die Chancen auf einen Heil-Hitler-Frieden in Europa verloren waren, schrie Goebbels im Berliner Sportpalast: Wollt ihr den totalen Krieg? Und die hakenkreuzbraven Deutschen brüllten begeistert: Jaaaaaa!!!! Und nun? - Nur 60 Jahre später fragt in der Berliner Republik die gewählte Obrigkeit: Wollt ihr den totalen Frieden? - und die geläuterten Deutschen sagen von ganzem Herzen abermals: Jaaaaaa!
Beim gaddafistischen Friedensforscher Mechtersheimer fand ich eine grauenhaft positiv gemeinte Wortschöpfung: Nationalpazifisten. Die dazu passenden Menschen wachsen diesem Begriff jetzt massenhaft zu. Die Losungen dieser antiamerikanischen Nationalpazifisten sind auf Pappschildern und Transparenten zu lesen: "Nie wieder Krieg! Krieg ist keine Antwort! Hände weg vom Irak! Humane Staaten führen keine Kriege! Nicht Saddam - Bush ist unser Feind! Jeder Krieg ist ein Verbrechen!" Oder mit tautologischem Pathos: "Krieg ist Krieg!" oder mehr sozialpoetisch: "Brot statt Bomben!" oder auch mehr pisa-panisch: "Bildung statt Bomben!"
Alle Welt weiß, dass wir Deutschen unsere Befreiung vom Hitler-Regime nicht uns selber, sondern ausschließlich den Armeen der Alliierten verdanken. Millionen russische, amerikanische und englische Soldaten sind auch für meine Befreiung gefallen. Was viele Frieden-um-jeden-Preis-Woller in Deutschland aber offenbar nicht auf der Rechnung haben: Wir verdanken auf eine indirekte Weise ja auch die Entlassung der DDR aus dem sowjetischen Völkergefängnis niemandem so sehr wie diesen waffengeilen Amerikanern.
Ohne deren Nachrüstung im Rüstungswettlauf mit dem Ostblock wäre die Sowjetunion und ihr Satellitenreich nicht so sang- und klanglos in sich zusammengebrochen. Michail Gorbatschow, jener parteifromme Ketzer aus der sowjetischen Nomenklatura, hat uns nach dem Fall der Mauer und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ohne diplomatische Metaphorik die prosaischen Hintergründe von Glasnost und Perestroika verraten.
Und diese Wahrheit zwang auch mich zu einer peinlich späten Einsicht: Ausgerechnet die von uns immer so angeprangerte Rüstungsspirale hatte in den letzten Jahren des Ost-West-Konflikts das chronisch sieche sowjetische System ökonomisch dermaßen überfordert und ruiniert, dass die stalinistischen Machthaber in ihrer Bredouille einem unkonventionellen Funktionär aus der Provinz, einem scheinbar blauäugigen Kommunismusretter wie dem Genossen Gorbatschow überhaupt eine Chance gaben.
Die Menschheit hatte Glück mit diesem Mann, denn seine systemerhaltenden Rettungsversuche sind ihm im allerbesten Sinne missglückt: Die Reformen kippten über in eine Revolution. Anders als mein Freund Robert Havemann und ich jahrelang gehofft hatten: Der totalitäre Koloss war eben nicht reformierbar. Wir hatten Hannah Arendt nicht begriffen, die mit einem neuen Schlagwort das Problem scharf auf den Begriff gebracht hatte: Ein "totalitäres" Regime herrscht eben total oder gar nicht. Aus diesem Grunde war das wunderbare Ende des Kalten Krieges und war auch die friedliche Wiedervereinigung der Deutschen eine dialektische Frucht am Baume des wahnsinnigen Wettrüstens der beiden Weltmächte.
Hätte ich diese geschichtlichen Wechselwirkungen damals schon durchschaut, wäre ich vielleicht nicht so alternaiv nach Mutlangen gefahren zur Sitzblockade vor dem Camp der U. S. Army. Und dabei weiß ich noch gut, wie gut ich mich fühlte als einer von den Allergutesten. Man sieht im eigenen Spiegelbild lieber das Menschenantlitz eines Friedfertigen als die Fratze eines Kriegstreibers.
Dass die wiedervereinigten Deutschen heute in mancher Hinsicht noch zerrissener sind als vor dem Fall der Mauer, ist leider wahr. Doch nun sieht es so aus, als ob ausgerechnet der drohende Krieg gegen den Irak die schwierige Einheit der Deutschen auf eine makabre Weise befördert. Es wabert und brodelt inzwischen ein geradezu wütender Wille zur Machtlosigkeit gegenüber solchen hochgerüsteten Menschheitsfeinden wie Saddam Hussein. Die Angst vor dem Krieg stiftet unter den tief zerrissenen Deutschen eine feste Volksgemeinschaft.
Da verbünden sich aufrichtige Pazifisten, die ich immer respektieren und achten werde, mit verrentnerten Kadern der heuchlerischen DDR-Nomenklatura und mit militanten Alt-68ern. Stramme SPD-Genossen und stramme Christdemokraten kennen keine Parteien mehr, sondern nur noch deutsche Friedensfreunde. Sogar Punks und Skins reihen sich ein. Es ist nun offenbar "in echt" zusammengewachsen, was im schlechtesten Sinn schon immer zusammengehörte. Konstantin Wecker überbringt den Berliner Friedenskämpfern unter der Siegessäule die solidarischen Kampfesgrüße der falschen Friedensbewegung in Bagdad. Die entpolitisierten Kids der Spaßgesellschaft finden Frieden irgendwie geiler als Krieg. Und obendrein bläst auch Gottes Bodenpersonal beider Konfessionen todesmutig in die Anti-Bush-Trompete. Wir wurden in diesen Tagen ein einig Volk von Hurra-Pazifisten.
Nimm nur die populärste Losung schon seit dem letzten Golfkrieg: "Kein Blut für Öl!" - wenn ausgewachsene Menschenexemplare, auf deren Bildung man einst einige Mühe verwandt hat, heute diesen Unsinn nachplappern, es gehe den kapitalistischen USA ums Öl, zeigt es mir, dass sie vor lauter Friedensliebe sogar das Groschenzählen vergessen haben. Ginge es den Amerikanern um Profite und um Öl-Lieferungen, dann würden sie den begehrten Stoff lieber bequem und billiger wie bisher auf dem Weltmarkt kaufen. Auch nach einem Sieg über Saddam Hussein werden die westlichen Industriestaaten das Erdöl so oder so zu Weltmarktpreisen erwerben müssen, so wie sie das Öl Russlands, das Öl Kuweits, der Saudis und Venezuelas und Norwegens bezahlen. Allein schon die Kriegserwartung treibt die Öl-Preise hoch und drückt die Kurse an der Börse in den Keller. Ein Krieg wird den Preis für einen Liter Benzin wahrscheinlich weit über die Zwei-Euro-Marke treiben. Jeder Tankstellenwart scheint da realistischer zu rechnen als unsere akademisch verbildeten Murx-Marxisten.
In einem ganz anderen Sinn geht es in diesem Krieg allerdings um das Öl: Weder die wenigen demokratischen noch die vielen diktatorisch regierten Staaten in der Uno sollten es hinnehmen, dass ein praktizierender Völkermörder wie Saddam mit seinen Öl-Milliarden systematisch eine A-, B- und C- Militärmacht aufbaut, die es ihm ermöglicht, alle arabischen Bruderländer aus ihrer vergleichsweise kommoden Knechtschaft zu befreien, um sie dann selber vollends zu knechten und mit dieser panarabischen Machtvollkommenheit den Rest der Welt noch brutaler zu erpressen.
Ich rechne damit, dass die wohlfeile Wut auf Amerika uns alle noch teuer zu stehen kommen wird. Ohne den Truppenaufmarsch der USA könnte kein einziger Waffeninspektor überhaupt irakischen Boden betreten. Alle wissen es, und wenige wollen es wahrhaben. Manchmal kommt mir der dummschlaue Verdacht: Vielleicht spielen ja Europa und die USA dasselbe Spiel nur in zwei entgegengesetzten Rollen, um Saddam besser in die Zange nehmen zu können. Aber der ist weder naiv noch ängstlich.
Die demokratischen Staaten können leider nicht mit einer Gewalt erfolgreich drohen, die nicht ernst gemeint ist. Der vulgäre Hass auf den Propaganda-Popanz eines schießwütigen Cowboys im Weißen Haus hat schon was von einer simulierten Paranoia. Ganz Europa verdankt den USA seine Freiheit. Ihre Befreiung werden allerhand geschichtsvergessene Menschen in Deutschland und Frankreich den Vereinigten Staaten offenbar niemals verzeihen. Offensichtlich ärgert es das "alte Europa" zusätzlich, dass der Präsident im Weißen Haus gelegentlich so altmodisch im pathetischen Jargon der Bibel redet.
Nun wird also die Weltmacht USA als Feind der islamischen Welt hingestellt. Auch das halte ich für eine besonders schäbige Lüge. Gerade eben haben die Soldaten der Vereinigten Staaten auf dem Hinterhof Europas im Kosovo die Moslembevölkerung gegen die serbischen Völkermörder gerettet. Und wir Europäer saßen dabei auf dem Sofa und begutachteten vor der Glotze diesen Rettungsversuch. Ohne den Militäreinsatz der USA aber säße Milosevic heute machtvollkommen in Belgrad und nicht als Kriegsverbrecher vor dem Tribunal in Den Haag.
Auch treffende Argumente sind in den Wind gesprochen, wenn die Ohren verstopft sind und die Herzen ohne Mitleid. Und so weht der falsche Friedenswind unsereins scharf und eisig ins Gesicht. Ich spüre, wie sehr meinesgleichen mal wieder in den ehrenvollen Status der Minderheit geraten sind. Und wir kommen da nicht lässig raus. Von Manès Sperber kann man lernen: Auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Aber es kostet nicht mehr die Freiheit, nicht das Leben - und mich in unserer soliden Demokratie nicht mal das Wohlleben.
Immer war ich ein Furchtsamer. Dennoch hatte mich nie die Angst vorm Schlimmsten: vor dem Krieg. Diese Gemütsbewegung ist in mir, scheint`s, abgetötet worden, bevor ich das Wort Krieg hätte ganz erfassen können. Das war im Sommer 1943, als meine Mutter mit mir unter dem Bombenhimmel der amerikanischen und britischen Fliegenden Festungen mitten im Hamburger Feuersturm in der Hammerbrookstraße aus dem Inferno kroch. Die Alliierten hatten sich damals schon - zu unserem Glück - die Lufthoheit über Nazi-Deutschland erkämpft. Ich war in diesen branderhellten Nächten und rauchverfinsterten Tagen sechs Jahre alt.
Schon in jenem Kriegssommer, mein Vater war gerade ein halbes Jahr vorher in Auschwitz ermordet worden, erklärte mir meine Mama, so simpel, wie ich es als kleiner Junge verstehen konnte, dass diese schlimmen schlimmen Bombenflugzeuge uns befreien sollen, von den bösen bösen Leuten, die uns unseren lieben lieben Papa weggenommen haben. Es war nur so unpraktisch, dass uns die Bomben unserer Lebensretter selber auf den Kopf fielen.
Deshalb schrieb ich in meiner "Ballade von Jan Gat unterm Himmel in Rotterdam" den Vers, der manchen Deutschen irritiert oder gar entrüstet hat:
Und weil ich unter dem gelben Stern
In Deutschland geboren bin
Drum nahmen wir die englischen Bomben
Wie Himmelsgeschenke hin.
Auch das unterscheidet mich von den meisten, die in Deutschland jetzt die Lufthoheit im Meinungskrieg über den Luftkrieg der Alliierten erobert haben.
Mir fällt allerdings ein beachtenswerter Gegensatz auf: Die meisten Kinder und Kindeskinder der Nazi-Täter-Generation sind reflexartig und prinzipiell gegen jeden Krieg. Die meisten Nachkommen des Heil-Hitler-Volks, das den Krieg und die Massenmorde so willfährig mitgemacht hatte, wollen sich auch in notwendige Kriege, die eine Not wenden könnten, nicht reinreißen lassen. Auch wenn sie kaum Immanuel Kant gelesen haben, spüren sie, dass jeder Krieg, sogar der gerechte, ein grauenhaftes, ein "trauriges Notmittel" ist.
Mit sauberen Händen kommt keiner aus dem blutigen Gemetzel wieder nach Haus. Also wollen sie fortan lieber Unrecht erleiden, als selber Unrecht tun. Niemals wieder! wollen die Nachgeborenen der Nazis werden wie ihre verdorbenen Väter und Mütter: Täter. Das ist verständlich und mir zudem sympathisch. Die allermeisten Menschen ziehen nun mal geschichtliche Lehren mehr aus der Familienerfahrung als aus dem Studium der Geschichte. Aber genau das gilt eben auch für die Nachgeborenen der damaligen Opfer: Leute wie ich wollen dies und das sein, aber niemals wieder Opfer. Also sind meinesgleichen eher für einen Krieg zum Sturze solch eines menschenverachtenden Regimes, dessen erklärtes und vornehmstes Ziel es ist, Israel zu vernichten. Dass Saddam Hussein ganz nebenbei sein eigenes Volk von Anbeginn seiner Putschherrschaft vernichtet: es foltert, erpresst, verblödet, ängstigt und fanatisiert, das wird dabei von vielen einfühlsamen Friedenskämpfern in der westlichen Welt mitleidlos ignoriert. Deutsches Sprichwort: Fremdes Leid trägt sich leicht.
Die Regierenden in Berlin täuschen ihr Volk in jeder "Tagesschau" mit der korrekten Neuigkeit: Die Uno-Waffeninspektoren finden nichts Neues. Es gebe also keinen Grund für einen Krieg gegen das Regime in Bagdad. Dabei wissen absolut alle, Freunde wie Feinde, dass diese A- oder B- oder C- Waffen in irgendwelchen nicht auffindbaren Bunkersystemen oder, paar Kilometerchen jenseits der syrischen Grenze beim hilfsbereiten Nachbarn, in aller Ruhe professionell versteckt worden sind und auf ihren Einsatz warten.
Ein präventiver Krieg sei, so reden viele unserer offiziösen Mahner, unbegründet und außerdem ein Bruch des Völkerrechts und also selber ein Kriegsverbrechen. Im selben Moment aber teilte die Gesundheitsministerin den Deutschen mit, dass unser Staat beschlossen hat, ab sofort einhundert Millionen Einheiten Impfstoff gegen Pocken bereitzuhalten, also für die gesamte Bevölkerung. Das sind die Tranquilizer fürs Volk, verabreicht von provinziellen Quacksalbern, die kaum Besseres mit sich und dem Vaterland vorhaben, als die nächste Landtagswahl in einem Bundesland zu gewinnen.
Mich lässt eine apokalyptische Vision nicht los in diesen Tagen: Nehmen wir an, dieser gelernte Putschist, Oppositionskiller, Giftgaskriegsheld, Kurdenausrotter, dieser gelernte Ölquellen-in-Brand-Setzer und gescheiterte Aggressor hat spätestens im ersten Golfkrieg vor zwölf Jahren kapiert, dass er gegen einen zur Verteidigung entschlossenen Westen nicht ankommt. Frankreich hatte ihm zwar Mirage-F-1-Bomber verkauft. Die USA, diese weltpolitischen Dilettanten, hatten ihn grauenhaft kurzsichtig im Eroberungskrieg gegen den gefürchteten Chomeini-Iran unterstützt.
Arbeitslose Kernphysiker sind seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bereit, jedem dreckigen Diktator gegen Gage seine "dreckige Atombombe" zu basteln. Deutsche Firmen lieferten aus sauberster Profitgier dem Irak alles, was man zur Giftgasproduktion und zur Vervollkommnung primitiver Raketen braucht. Aber es existiert längst eine spottbillige und supermoderne Trägerrakete, die solch ein Regime weder heimlich bauen, noch umständlich verstecken muss und mit deren Hilfe Kleinterroristen wie Bin Laden oder solche Großterroristen wie Saddam Hussein atomare oder chemische oder bakteriologische Massenvernichtungswaffen leicht ins Ziel bringen können: die Demokratie. Sie funktioniert todsicher in allen weltoffenen zivilen Gesellschaften.
In jeder westlichen Großstadt kann man mit dem nötigen Kleingeld jeden Tag auf dem freien Immobilienmarkt hundert geeignete Immobilien kaufen. Insbesondere private Einzelhäuser werden so gut wie niemals von irgendwelchen Polizei- oder Sicherheitskräften beachtet, geschweige denn kontrolliert. Es wäre ein Klacks, in solch einem Haus eine funktionierende Massenmordmaschine Stück für Stück im Laufe der Jahre zusammenzubauen.
Jede Firma liefert alles. Lästige Handelsembargos für kriegsgeeignete Spezialtechnik spielen im Inland keine Rolle. Und wenn dann ein getürkter Tanklaster einer Ölfirma gelegentlich vorfährt, kann der genauso gut eine Giftbrühe oder eine mit Krankheitserregern präparierte Nährflüssigkeit für tödliche Epidemien in den zweckentfremdeten Heizöltank pumpen. Die Explosion kann dann im richtigen Timing ausgelöst werden, durch ein Signal, ein Code-Wort von sonst woher mit einem Mobiltelefon. Alle Metropolen der westlichen Welt sind geeignete Schauplätze zur Aufführung einer solchen Tragödie, für die der 11. September in New York nur ein Vorspiel war.
Und was wird mit Israel? Ein paar mit deutscher Technik aufgemöbelte Raketen, die Nordkorea an den Irak geliefert hat, funktionieren wie im letzten Golfkrieg gut genug, um die kurze Distanz in Richtung Israel zu bewältigen, so dass der winzige Judenstaat sich mit einem Schlag in eine riesige Gaskammer verwandelt. Das wäre dann die panarabische Endlösung der Judenfrage. Ich sah heute ein Foto in der Zeitung: Junge Israelis in einer Schulklasse üben mit den Gasmasken. Das ist der historische Fortschritt: Immerhin haben seit dem Trick mit den falschen Duschräumen in Auschwitz diese Menschen inzwischen echte Gasmasken auf der Nase.
Schlau, wie die Juden nach Meinung der Antisemiten allerdings sind, werden die Israelis bei einem Raketenangriff auf ihr Land in luftdicht abgeklebten Kellern unter den Wohnhäusern sitzen. Und dann teilen sie sich die präparierten Wasservorräte und das Essen ein. Aber wer in solcher Welt auch nur einen Monat in einem Bunker überlebt, der wird die schon verwesenden Leichen auf der Straße beneiden.
Male ich den Teufel an die Wand? Liefere ich dem toll gewordenen Mörderpack etwa noch tollere Ideen mit solchem Horrorszenario? Egal wie es kommt, eines ist sicher: Alle Kontrahenten werden, wenn sie im Untergang überhaupt noch was sagen können und falls überhaupt noch ein Lebendiger zuhört, röcheln: "Siehste!" - soll heißen: Alle werden sich bestätigt fühlen, alle werden noch im Sterben die eitle Genugtuung genießen, Recht behalten zu haben. Auch ich.
Die Haltung unserer Regierung provoziert eine Chance, und die wird jeden fundamentalistischen Friedenskämpfer entzücken: Wenn wir kriegserfahrenen Deutschen nun also dermaßen den Krieg als letztes Mittel der Politik ächten, sollten wir diese brachiale Friedensliebe auch furchtlos ausleben. Dann sollte unser Land konsequenterweise seine Armee auf der Stelle abschaffen. Die Steuermilliarden für den Wehretat könnten wir sparen. Eine totale Abrüstung wäre ein Segen für die bankrotten Kommunen. Der Staatshaushalt wäre mit einem Schlage saniert! Die Renten wären sicher! Neue, ökologisch nachhaltige Arbeitsplätze könnten geschaffen werden! Eltern und ihre Kinder, die es brauchen, könnten einen Kindergartenplatz finden. Mehr und besser ausgebildete Lehrer fänden einen Job.
Wenn nämlich das reiche und starke Deutschland so gar keine Feinde auf Leben und Tod mehr hat auf dieser Welt, Mensch! dann sollte es getrost sein Schwert an den Ufern von Babylon niederlegen und baden gehen. Ich meinte diese Idee ursprünglich mephistophelisch boshaft.
Aber nun überlege ich ohne Häme: Warum eigentlich nicht - womöglich hat sich der Hegelsche Weltgeist unseren ursprünglich falschen Friedenskanzler Schröder und seinen wandelbaren Außenminister als echt blind wirkende Prototypen einer Welt ohne Waffen ausgewählt. Wir erleben - das könnte doch sein! - das Wirken der Hegelschen Geschichtsdialektik. Und können womöglich später einmal mit stillem Pathos sagen: Wir sind dabei gewesen! Wer weiß - ausgerechnet diese geschichtsdummen Deutschen könnten nun durch eine Abschaffung der Armee den kindlich-klugen Dreh gefunden haben, mit dem der uralte Circulus vitiosus von Krieg und Frieden, von Gewalt und Gegengewalt ein für alle Mal durchbrochen wird: einseitige Abrüstung! Die Deutschen haben im letzten Jahrhundert der Welt die zwei Weltkriege beschert - jetzt könnte es vom überlegenen Witz des Weltgeistes zeugen, wenn ausgerechnet Germania durch seine totale Selbstentwaffnung die Epoche eines Ewigen Friedens einläutet. So würde - diesmal in echt - am Deutschen Wesen doch noch die Welt genesen. Aber ich habe da - pardon - meine Zweifel.
Wir sind alle Amerikaner
Cordt Schnibben über Friedenskritik und Kriegsblinde
Dank schulden wir den Amerikanern, weil sie uns von den Nazis befreiten; Dank schulden wir ihnen, weil sie die Sowjetunion zu Tode rüsteten und die DDR befreiten; und aus lauter Dankbarkeit sollen wir für den Krieg gegen Saddam Hussein sein - legen uns George W. Bush, Angela Merkel und nun auch Wolf Biermann nahe, uns, den Friedensmemmen und Antiamerikanern, uns, den Kindern der Nazi-Täter, die "reflexartig und prinzipiell gegen jeden Krieg" sind.
Ja, mein Vater war Nazi, er schleppte mich zu Geländespielen der "Wiking Jugend", ja, er hasste die Amerikaner und erzählte Juden-Witze. Glücklicherweise entdeckte ich eines Tages einen Karton mit Jerry-Cotton-Romanen auf unserem Dachboden, zurückgelassen von einem ausgezogenen Mieter. Mit dem FBI-Agenten hetzte ich nun im Jaguar durch New York, den Bronx River Parkway hoch, jagte durch Harlem und Chinatown, lief durch den Central Park, hielt morgens die druckfrische "New York Times" in der Hand, wollte von meiner Mutter knusprig gebratenen Schinken, Spiegelei und frisch gerösteten Toast zum Frühstück, spielte mit meiner 38er und stellte mir vor, wie eisgekühlter Bourbon schmeckt.
Abends hörte ich unter der Bettdecke den Piratensender "Radio Caroline", und am Wochenende spielten die "Shakespeares" im Saal der Kirchengemeinde "Fa, fa, fa, fa, fa" von Otis Redding, "Land of 1000 Dances" von Wilson Pickett, "What Is Soul?" von Ben E. King.
Wann ich das erste Mal das Wort "Vietnam" hörte, weiß ich nicht mehr, aber alles, was ich hörte, hielt ich für Gräuelmärchen der Russen. Erst als der Pastor im Konfirmandenunterricht über den Krieg im Dschungel sprach, dämmerte mir langsam, dass die Amerikaner da in irgendwas verwickelt waren, was nichts mit meinem Amerika zu tun haben konnte.
Mein erstes Flugblatt tippte ich heimlich im Arbeitszimmer meines Vaters auf einer Matrize und forderte "Freiheit für Angela Davis", Freiheit für eine schwarze Amerikanerin, der in den USA der Prozess gemacht wurde wegen irgendeiner rassistischen Sauerei. Da steckten ich und meine Mitschüler schon mittendrin in der Erforschung meines Märchenlandes, entdeckten Malcolm X und Cassius Clay, staunten über die Invasion in der Schweinebucht, die Operation "Powerpack" in der Dominikanischen Republik, über den langen Arm der CIA in Indonesien und Griechenland, sammelten alles, was wir über den Vietnam-Krieg in die Finger kriegen konnten: Tonking-Zwischenfall, Massaker von My Lai, Pentagon Papers.
Ja, wir haben uns unseren Antiamerikanismus hart erarbeitet.
Viel später konnten wir aus der Biografie von Robert S. McNamara erfahren, dem US-Verteidigungsminister jener Zeit, dass der Vietnam-Krieg, der uns vorgekommen war wie ein kalt geplanter Völkermord im Dienste der Freiheit, nicht mehr war als das über ein Jahrzehnt anhaltende Irren eines Haufens wild um sich schießender Militärs und Minister. "Töricht" sei dieser Feldzug gegen das Böse gewesen, der über zwei Millionen Amerikaner und Vietnamesen das Leben kostete, gestand der Rumsfeld jener Jahre; die Regierenden seien von "verzweifelter Tatkraft" beseelt gewesen und von der "Entschlossenheit, irgendetwas gegen die weitere Ausbreitung des Kommunismus zu unternehmen".
Das Überleben und den Erfolg der Freiheit hatte John F. Kennedy 1961 bei seinem Amtsantritt der Welt und uns versprochen, "alle Nationen sollen wissen, egal ob sie uns wohlgesinnt sind oder nicht, dass wir bereit sind, jeden Preis zu zahlen". Die "Dominotheorie" beherrschte sein Denken und das seiner Regierung: Wenn eines der Länder in Südostasien in die Hände der Kommunisten falle, würden alle Staaten der Region wie umstürzende Dominosteine bald ebenfalls dem Reich des Bösen zufallen.
In Vietnam wollte Kennedy zeigen, wie ernst es den USA war mit ihrem Versprechen, die Welt zu befreien und die USA zur politischen, militärischen und moralischen Führungsmacht zu machen, und seine Nachfolger Johnson und Nixon eiferten ihm nach. Immer mehr amerikanische Bomben, Panzer und Soldaten wurden nach Vietnam verschickt, immer mehr Verbündete mussten die USA unterstützen.
Auch die Deutschen ließ der Krieg kämpfen: Die Freiheit Berlins werde in Saigon verteidigt, sagten die einen; sie wollten deutsche Soldaten hinüberjagen und Kampfhubschrauber, aber dann begnügten sie sich damit, den südvietnamesischen Soldaten Schäferhunde zu schicken und den Witwen amerikanischer Soldaten kleine Kopien der Berliner Freiheitsglocke. Die Würde aller Menschen werde in Vietnam zertreten, sagten die anderen; sie veranstalteten Protestmärsche und Tribunale, sie ließen Scheiben klirren und Molotowcocktails fliegen, und sie verbrannten Sternenbanner.
Der Vietnam-Krieg veränderte Deutschland: Er schürte Zweifel am American Way of Life und an dem, was von vielen Empörten nun "Weltimperialismus" genannt wurde; er politisierte Schriftsteller, Künstler und Filmemacher; er machte aus einem bis dahin bloß antiautoritären Generationenaufstand eine Revolte; und er ließ eine kleine radikale Minderheit den ersten Terrorakt begehen. Andreas Baader und seine Freunde steckten ein Frankfurter Kaufhaus in Brand, "aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen" - um später selbst zu Mördern zu werden.
Aus dem Dschungelkrieg gegen eine Ameisenarmee wurde ein globaler Krieg um Köpfe. Die Fernsehnachrichten trugen die Gewalt so lange in die Wohnzimmer der Welt, bis die Front gegen die USA den Erdball umspannte und es in den Straßen mancher Metropole zuging wie in Saigon während der Tet-Offensive.
Als die USA 1975 Vietnam verließen, war die Führungsmacht des Westens nicht nur militärisch geschlagen, sondern vor allem moralisch erledigt. In den siebziger und achtziger Jahren begleiteten die westlichen Völker das politische Gebaren ihrer Führungsmacht mit antiamerikanischem Misstrauen; Militäraktionen in Iran, auf Grenada, in Libyen, in Panama schürten die Skepsis. Seit dem Golfkrieg 1991 allerdings gewann die USA wieder an Ansehen, auch die Militäreinsätze in Somalia, Bosnien und Kroatien, im Kosovo ließen die Hoffnung wachsen, die größte Militärmacht der Welt werde nun als Militärpolizist der United Nations die Drecksarbeit machen und überall dort eingreifen, wo Schurken und Verrückte den Weltfrieden bedrohen.
Deshalb war nach den Anschlägen des 11. September die weltweite Solidarität mit den USA nicht nur eine menschliche Geste, sondern eine politische Demonstration: Wir müssen den USA beistehen, weil sie uns schützen. Die Attentate zerstörten nicht nur das World Trade Center, sondern auch das weit verbreitete antiamerikanische Klischee, die Bedrohung der Welt durch islamistische Terroristen sei eine Erfindung der CIA. Das Netzwerk Osama Bin Ladens, jahrelang ignoriert oder unterschätzt, wurde als lebensbedrohlich wahrgenommen, und deshalb waren die Völker der westlichen Welt wohl nie so sehr Amerikaner wie in den Monaten nach dem 11. September und in den Wochen des Afghanistan-Kriegs.
Seit der Irak ins Fadenkreuz der amerikanischen Regierung geriet, fällt diese Wirsind-alle-Amerikaner-Front auseinander, und das liegt nicht - lieber Herr Biermann, Frau Merkel, Mr. Bush - an fehlender Dankbarkeit, an pazifistischer Ängstlichkeit, an weltfremder Blindheit oder an antiamerikanischer Traditionspflege. Das liegt daran, dass der amerikanische Präsident sich im September 2002 in einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie das Recht eingeräumt hat, Präventivkriege gegen potenzielle Angreifer führen zu dürfen, und dass er von der Uno und der Nato und den amerikanischen Verbündeten erwartet, den ersten dieser Kriege gegen Saddam Hussein zu unterstützen - ohne sie zu fragen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie denn der Nahe Osten und der Rest der Welt am Ende dieser "globalen Unternehmung von ungewisser Dauer" aussehen sollen.
Was dem Fernsehzuschauer und Tageszeitungsleser erscheint wie der surreale Streit zwischen Diplomaten, Waffeninspektoren, Präsidentenberatern und Verteidigungsministern über Resolutionen, Satellitenbilder, Raketenreichweiten und Inspektionsfristen, ist tatsächlich der Streit zwischen den USA und Frankreich, Russland, China, Deutschland und vielen anderen Staaten der Uno darüber, wie unumschränkt die Macht der letzten und einzigen Weltmacht sein darf und wie wenig die früheren Weltmächte noch zu sagen haben. Der Irak-Konflikt verschärft wie ein Katalysator all die Probleme, die seit dem Ende des Kalten Krieges gären: Wie soll die Uno Diktatoren zur Rechenschaft ziehen, muss das Völkerrecht verschärft werden? Welche Aufgabe hat die Nato noch, müssen die Staaten der EU aufrüsten, um militärisch nicht mehr vom Schutz der USA abhängig zu sein?
Alle Staatsmänner reden in diesem Konflikt, wie die Indianer sagen, mit gespaltener Zunge, und darum sagt Fischer in München auf der Sicherheitskonferenz nicht: "Mr. Rumsfeld, wir beide wissen doch, dass bei Ihnen 60 Staaten unter Terrorismusverdacht stehen, diese Liste hat mir Ihr Stellvertreter unter die Nase gehalten, aber wir wissen nicht, gegen wie viele Länder Sie Krieg führen wollen, darum stellen wir lieber gleich beim ersten Krieg klar: Nicht mit uns!" Das sagt er nicht, sondern er sagt: "I am sorry, but I am not convinced!" Und Gerhard Schröder ruft den Wählern in Goslar nicht zu: "Also Leute, ich sag euch, der Bush, der hat jetzt so `ne neue Strategie, die hat er mit mir nicht besprochen und mit Chirac auch nicht, aber wir sollen seinen Krieg bezahlen - ich bin doch nicht blöd." Das sagt er nicht, er sagt: "Rechnet nicht damit, dass Deutschland einer den Krieg legitimierenden Resolution zustimmen wird." Und im Bundestag sagt der Kanzler: "Es geht darum, ob Willensbildung multilateral bleibt."
Ein Junge, der von seinem größeren Bruder ignoriert wird, fängt an, trotzig mit Kieselsteinen zu werfen, und ungefähr so hat Schröder dem Präsidenten auf der anderen Seite des großen Teichs während des Bundestagswahlkampfs zu verstehen gegeben, dass er gefragt werden möchte, wenn die USA den Nahen Osten umzubauen gedenken und dabei auf seine Unterstützung zählen.
Dominosteine sollen wieder fallen, diesmal in die andere Richtung, erst der Irak, dann Iran, dann Syrien; Diktatoren sollen mit Gewalt durch demokratische Regime abgelöst werden, damit Schurken in Präsidentensesseln islamistische Terroristen nicht mit Massenvernichtungswaffen versorgen können; die USA "werden die Gunst der Stunde nutzen", hat Bush in seiner Sicherheitsstrategie formuliert, um die "Vorzüge der Freiheit in der ganzen Welt zu verbreiten", und er will sich dafür einsetzen, "die Hoffnung auf Demokratie und freien Handel in jeden Winkel der Erde zu tragen".
Nicht nur Schröder und Fischer wurden durch die Proteste gegen den Vietnam-Krieg politisiert, auch viele der vielen Außenminister und Botschafter, die sich in den letzten Wochen in der Uno gegen den Irak-Krieg ausgesprochen haben, gehören zur Generation der Vietnam-Kriegs-Gegner und reagieren skeptisch auf die Neuauflage dieser Reißbrettpolitik, die wieder, wie damals, Demokratie auf Bombenteppichen abwerfen möchte.
Da ist ein US-Präsident mit seinem Kampfauftrag, ein Präsident, der stolz darauf ist, "aus dem Bauch heraus" zu handeln. Da sind Pentagon-Berater, die ihm schon seit September 2001 raten, das Irak-Problem militärisch zu lösen. Da ist ein US-Senat, den das dienstälteste Kongressmitglied kritisiert, in diesem Parlament herrsche "unheilvolles, beklemmendes Schweigen", es gebe "keine Debatten, keinen Versuch, der Nation das Für und Wider dieses Krieges darzulegen". Da ist die Nato, die die neue Präventivstrategie militärisch absichern soll, weil sie sonst "irrelevant" wird; da sind Frankreich und Deutschland, die sowieso alt und "irrelevant" sind; da sind die United Nations, deren Sicherheitsrat den Krieg völkerrechtlich absegnen soll, weil er sonst "irrelevant" wird.
Diese Art von Kriegspropaganda hat die USA in der Uno isoliert und über sechs Millionen Menschen rund um den Erdball auf die Straße getrieben. Stadträte von über 90 amerikanischen Kommunen, auch in Chicago, Washington, Austin, Philadelphia, stimmten in Entschließungen gegen den Krieg. Und dem Nato-Verbündeten Türkei soll die militärische Solidarität mit mindestens 15 Milliarden Dollar abgerungen werden.
Das Kriegsmarketing der USA leidet unter einem Problem: Die Diplomaten, die Regierungen, die Verbündeten, die Leute auf der Straße sind nicht überzeugt davon, dass alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sind, den Diktator zu entwaffnen. Sie glauben nicht, dass die Bedrohung durch ihn noch so groß und so aktuell ist, um einen Präventivkrieg zu rechtfertigen. Vieles von dem, was Außenminister Powell der Welt im Sicherheitsrat an Beweisen präsentierte, hielt der Überprüfung durch die Waffeninspektoren nicht stand ("Müll") und reicht den meisten Regierungschefs nicht, um das Risiko eines Krieges einzugehen; zumal Powell noch im August letzten Jahres seinen Präsidenten vor dem "Hexenkessel" gewarnt hat, in den der Nahe Osten durch die Invasion verwandelt werde (SPIEGEL 8/2003).
Militärisch sei der Irak-Krieg kein Risiko, meinen Powell und Bush, ein zweites Vietnam sei nicht zu erwarten, der Irak sei schnell zu besiegen. Man wünscht, dass sie Recht behalten, aber wie, Mr. Bush, wollen Sie nach einem schnellen, sauberen Sieg (mit Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden toten Irakern) der Welt erklären, warum Husseins chemische und biologische Waffen vom Erdboden verschwunden geblieben sind? Waren sie nicht einsatzfähig? Oder hat es sie gar nicht gegeben?
Militärisch haben die USA dann gesiegt, aber als Führungsmacht der Welt sind sie geschwächt - wie nach dem Vietnam-Krieg. Dabei braucht die Welt, bedroht von Terroristen und Schurken, noch ungeordnet nach dem Ende des Kalten Krieges, nichts mehr als eine Supermacht, die ihre militärische Stärke diplomatisch einsetzt. Sie haben Recht, Mr. Bush, Frau Merkel, Herr Biermann, ohne den Truppenaufmarsch an seinen Grenzen hätte Hussein keine Inspektoren ins Land gelassen. Und sicher ist auch, dass in dieser Welt Pazifismus als Weltanschauung nicht viel weiterhilft, es werden noch Kriege geführt werden müssen. Aber Herr Bush, wenn Sie "die Chance ergreifen" wollen, "Großes zu verwirklichen", warum agieren Sie dann wie ein Jerry Cotton und zwingen mit Drohungen, Beschimpfungen und Dollar-Schecks eine Koalition der Unwilligen zusammen, statt mit Geduld und Geschick die große Koalition gegen den Terrorismus zusammenzuhalten? Glauben Sie wirklich, Sie können aus der Uno ein ernst zu nehmendes Parlament der Völker machen, indem Sie dem Sicherheitsrat drohen, er mache sich unglaubwürdig, wenn er nicht Ihrer Meinung sei?
Und, Frau Merkel, meinen Sie, deutsche und europäische Interessen lassen sich nur vertreten, wenn man im Windschatten der Dankbarkeit auf Knien durch Washington rutscht? Ja, wir sind mehr Amerikaner, als wir Franzosen, Russen oder Chinesen sind, aber deshalb müssen wir uns das Recht nehmen, diesen Präsidenten allein laufen zu lassen, wenn er uns ins angekündigte Desaster führen will.
Und, Mr. Bierman, es wird Zeit, dass Sie abrüsten. Der Kalte Krieg ist vorbei, vernichten Sie Ihre Massenvernichtungswaffen, hören Sie auf, mit Senfgassätzchen auf ein paar Millionen Demonstranten zu feuern. Woher die Wut? Was stört Sie an Leuten, die "Völkerrecht - can you spell it?" auf ein Pappschild malen und durch die Straßen ziehen? Merken Sie nicht, dass die nicht Reflexen folgen, sondern Zweifeln? Warum sind für Sie Hunderttausende Berliner Friedensdemonstranten so verachtenswert wie "hakenkreuzbrave Deutsche", die im Berliner Sportpalast den totalen Krieg herbeibrüllten? Und warum glauben Sie, diese 20-, 30 -, 40-Jährigen seien gegen den Irak-Krieg, weil sie "den Vereinigten Staaten offenbar niemals verzeihen", das Land von den Nazis befreit zu haben?
Willkommen im Verein der Kriegsblinden!
---
Brachiale Friedensliebe
Wolf Biermann über Nationalpazifisten und den Irak-Krieg
Wann ist denn endlich Frieden
In dieser irren Zeit
Das große Waffenschmieden
Bringt nichts als großes Leid.
Die Welt ist so zerrissen
Und ist im Grund so klein
Wir werden sterben müssen
Dann kann wohl Friede sein
So subversiv und kindlich zugleich sang ich als junger Kerl im militaristischen Friedensstaat DDR 1967, also mitten im Kalten Krieg. Laut sang ich in Ost-Berlin wie ein Menschenkind im dunklen Waffenwald. Unsere stalinistische Obrigkeit verteidigte aggressiv ihr Monopol auf Friedensliebe, auf Friedenspolitik und Friedenskampf. Und dabei logen sie mal wieder die Wahrheit: Alle Menschen wollen Frieden.
Und zu denen gehören eben auch die totalitären Schweinehunde, die ja im Grunde nichts weiter wollen, als ihren idealen Friedhofsfrieden hinter Stacheldraht. Und trotzdem sehne ich mich nach Frieden und hoffe wider bessres Wissen, dass der Kelch eines Krieges an uns allen vorübergehen möge. Vielleicht reicht nur meine Phantasie mal wieder nicht aus, um mir einen Ausweg aus dem Dilemma vorzustellen. In ein paar Wochen oder Monaten werden wir alle klüger sein und womöglich noch ratloser.
Als die Chancen auf einen Heil-Hitler-Frieden in Europa verloren waren, schrie Goebbels im Berliner Sportpalast: Wollt ihr den totalen Krieg? Und die hakenkreuzbraven Deutschen brüllten begeistert: Jaaaaaa!!!! Und nun? - Nur 60 Jahre später fragt in der Berliner Republik die gewählte Obrigkeit: Wollt ihr den totalen Frieden? - und die geläuterten Deutschen sagen von ganzem Herzen abermals: Jaaaaaa!
Beim gaddafistischen Friedensforscher Mechtersheimer fand ich eine grauenhaft positiv gemeinte Wortschöpfung: Nationalpazifisten. Die dazu passenden Menschen wachsen diesem Begriff jetzt massenhaft zu. Die Losungen dieser antiamerikanischen Nationalpazifisten sind auf Pappschildern und Transparenten zu lesen: "Nie wieder Krieg! Krieg ist keine Antwort! Hände weg vom Irak! Humane Staaten führen keine Kriege! Nicht Saddam - Bush ist unser Feind! Jeder Krieg ist ein Verbrechen!" Oder mit tautologischem Pathos: "Krieg ist Krieg!" oder mehr sozialpoetisch: "Brot statt Bomben!" oder auch mehr pisa-panisch: "Bildung statt Bomben!"
Alle Welt weiß, dass wir Deutschen unsere Befreiung vom Hitler-Regime nicht uns selber, sondern ausschließlich den Armeen der Alliierten verdanken. Millionen russische, amerikanische und englische Soldaten sind auch für meine Befreiung gefallen. Was viele Frieden-um-jeden-Preis-Woller in Deutschland aber offenbar nicht auf der Rechnung haben: Wir verdanken auf eine indirekte Weise ja auch die Entlassung der DDR aus dem sowjetischen Völkergefängnis niemandem so sehr wie diesen waffengeilen Amerikanern.
Ohne deren Nachrüstung im Rüstungswettlauf mit dem Ostblock wäre die Sowjetunion und ihr Satellitenreich nicht so sang- und klanglos in sich zusammengebrochen. Michail Gorbatschow, jener parteifromme Ketzer aus der sowjetischen Nomenklatura, hat uns nach dem Fall der Mauer und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ohne diplomatische Metaphorik die prosaischen Hintergründe von Glasnost und Perestroika verraten.
Und diese Wahrheit zwang auch mich zu einer peinlich späten Einsicht: Ausgerechnet die von uns immer so angeprangerte Rüstungsspirale hatte in den letzten Jahren des Ost-West-Konflikts das chronisch sieche sowjetische System ökonomisch dermaßen überfordert und ruiniert, dass die stalinistischen Machthaber in ihrer Bredouille einem unkonventionellen Funktionär aus der Provinz, einem scheinbar blauäugigen Kommunismusretter wie dem Genossen Gorbatschow überhaupt eine Chance gaben.
Die Menschheit hatte Glück mit diesem Mann, denn seine systemerhaltenden Rettungsversuche sind ihm im allerbesten Sinne missglückt: Die Reformen kippten über in eine Revolution. Anders als mein Freund Robert Havemann und ich jahrelang gehofft hatten: Der totalitäre Koloss war eben nicht reformierbar. Wir hatten Hannah Arendt nicht begriffen, die mit einem neuen Schlagwort das Problem scharf auf den Begriff gebracht hatte: Ein "totalitäres" Regime herrscht eben total oder gar nicht. Aus diesem Grunde war das wunderbare Ende des Kalten Krieges und war auch die friedliche Wiedervereinigung der Deutschen eine dialektische Frucht am Baume des wahnsinnigen Wettrüstens der beiden Weltmächte.
Hätte ich diese geschichtlichen Wechselwirkungen damals schon durchschaut, wäre ich vielleicht nicht so alternaiv nach Mutlangen gefahren zur Sitzblockade vor dem Camp der U. S. Army. Und dabei weiß ich noch gut, wie gut ich mich fühlte als einer von den Allergutesten. Man sieht im eigenen Spiegelbild lieber das Menschenantlitz eines Friedfertigen als die Fratze eines Kriegstreibers.
Dass die wiedervereinigten Deutschen heute in mancher Hinsicht noch zerrissener sind als vor dem Fall der Mauer, ist leider wahr. Doch nun sieht es so aus, als ob ausgerechnet der drohende Krieg gegen den Irak die schwierige Einheit der Deutschen auf eine makabre Weise befördert. Es wabert und brodelt inzwischen ein geradezu wütender Wille zur Machtlosigkeit gegenüber solchen hochgerüsteten Menschheitsfeinden wie Saddam Hussein. Die Angst vor dem Krieg stiftet unter den tief zerrissenen Deutschen eine feste Volksgemeinschaft.
Da verbünden sich aufrichtige Pazifisten, die ich immer respektieren und achten werde, mit verrentnerten Kadern der heuchlerischen DDR-Nomenklatura und mit militanten Alt-68ern. Stramme SPD-Genossen und stramme Christdemokraten kennen keine Parteien mehr, sondern nur noch deutsche Friedensfreunde. Sogar Punks und Skins reihen sich ein. Es ist nun offenbar "in echt" zusammengewachsen, was im schlechtesten Sinn schon immer zusammengehörte. Konstantin Wecker überbringt den Berliner Friedenskämpfern unter der Siegessäule die solidarischen Kampfesgrüße der falschen Friedensbewegung in Bagdad. Die entpolitisierten Kids der Spaßgesellschaft finden Frieden irgendwie geiler als Krieg. Und obendrein bläst auch Gottes Bodenpersonal beider Konfessionen todesmutig in die Anti-Bush-Trompete. Wir wurden in diesen Tagen ein einig Volk von Hurra-Pazifisten.
Nimm nur die populärste Losung schon seit dem letzten Golfkrieg: "Kein Blut für Öl!" - wenn ausgewachsene Menschenexemplare, auf deren Bildung man einst einige Mühe verwandt hat, heute diesen Unsinn nachplappern, es gehe den kapitalistischen USA ums Öl, zeigt es mir, dass sie vor lauter Friedensliebe sogar das Groschenzählen vergessen haben. Ginge es den Amerikanern um Profite und um Öl-Lieferungen, dann würden sie den begehrten Stoff lieber bequem und billiger wie bisher auf dem Weltmarkt kaufen. Auch nach einem Sieg über Saddam Hussein werden die westlichen Industriestaaten das Erdöl so oder so zu Weltmarktpreisen erwerben müssen, so wie sie das Öl Russlands, das Öl Kuweits, der Saudis und Venezuelas und Norwegens bezahlen. Allein schon die Kriegserwartung treibt die Öl-Preise hoch und drückt die Kurse an der Börse in den Keller. Ein Krieg wird den Preis für einen Liter Benzin wahrscheinlich weit über die Zwei-Euro-Marke treiben. Jeder Tankstellenwart scheint da realistischer zu rechnen als unsere akademisch verbildeten Murx-Marxisten.
In einem ganz anderen Sinn geht es in diesem Krieg allerdings um das Öl: Weder die wenigen demokratischen noch die vielen diktatorisch regierten Staaten in der Uno sollten es hinnehmen, dass ein praktizierender Völkermörder wie Saddam mit seinen Öl-Milliarden systematisch eine A-, B- und C- Militärmacht aufbaut, die es ihm ermöglicht, alle arabischen Bruderländer aus ihrer vergleichsweise kommoden Knechtschaft zu befreien, um sie dann selber vollends zu knechten und mit dieser panarabischen Machtvollkommenheit den Rest der Welt noch brutaler zu erpressen.
Ich rechne damit, dass die wohlfeile Wut auf Amerika uns alle noch teuer zu stehen kommen wird. Ohne den Truppenaufmarsch der USA könnte kein einziger Waffeninspektor überhaupt irakischen Boden betreten. Alle wissen es, und wenige wollen es wahrhaben. Manchmal kommt mir der dummschlaue Verdacht: Vielleicht spielen ja Europa und die USA dasselbe Spiel nur in zwei entgegengesetzten Rollen, um Saddam besser in die Zange nehmen zu können. Aber der ist weder naiv noch ängstlich.
Die demokratischen Staaten können leider nicht mit einer Gewalt erfolgreich drohen, die nicht ernst gemeint ist. Der vulgäre Hass auf den Propaganda-Popanz eines schießwütigen Cowboys im Weißen Haus hat schon was von einer simulierten Paranoia. Ganz Europa verdankt den USA seine Freiheit. Ihre Befreiung werden allerhand geschichtsvergessene Menschen in Deutschland und Frankreich den Vereinigten Staaten offenbar niemals verzeihen. Offensichtlich ärgert es das "alte Europa" zusätzlich, dass der Präsident im Weißen Haus gelegentlich so altmodisch im pathetischen Jargon der Bibel redet.
Nun wird also die Weltmacht USA als Feind der islamischen Welt hingestellt. Auch das halte ich für eine besonders schäbige Lüge. Gerade eben haben die Soldaten der Vereinigten Staaten auf dem Hinterhof Europas im Kosovo die Moslembevölkerung gegen die serbischen Völkermörder gerettet. Und wir Europäer saßen dabei auf dem Sofa und begutachteten vor der Glotze diesen Rettungsversuch. Ohne den Militäreinsatz der USA aber säße Milosevic heute machtvollkommen in Belgrad und nicht als Kriegsverbrecher vor dem Tribunal in Den Haag.
Auch treffende Argumente sind in den Wind gesprochen, wenn die Ohren verstopft sind und die Herzen ohne Mitleid. Und so weht der falsche Friedenswind unsereins scharf und eisig ins Gesicht. Ich spüre, wie sehr meinesgleichen mal wieder in den ehrenvollen Status der Minderheit geraten sind. Und wir kommen da nicht lässig raus. Von Manès Sperber kann man lernen: Auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Aber es kostet nicht mehr die Freiheit, nicht das Leben - und mich in unserer soliden Demokratie nicht mal das Wohlleben.
Immer war ich ein Furchtsamer. Dennoch hatte mich nie die Angst vorm Schlimmsten: vor dem Krieg. Diese Gemütsbewegung ist in mir, scheint`s, abgetötet worden, bevor ich das Wort Krieg hätte ganz erfassen können. Das war im Sommer 1943, als meine Mutter mit mir unter dem Bombenhimmel der amerikanischen und britischen Fliegenden Festungen mitten im Hamburger Feuersturm in der Hammerbrookstraße aus dem Inferno kroch. Die Alliierten hatten sich damals schon - zu unserem Glück - die Lufthoheit über Nazi-Deutschland erkämpft. Ich war in diesen branderhellten Nächten und rauchverfinsterten Tagen sechs Jahre alt.
Schon in jenem Kriegssommer, mein Vater war gerade ein halbes Jahr vorher in Auschwitz ermordet worden, erklärte mir meine Mama, so simpel, wie ich es als kleiner Junge verstehen konnte, dass diese schlimmen schlimmen Bombenflugzeuge uns befreien sollen, von den bösen bösen Leuten, die uns unseren lieben lieben Papa weggenommen haben. Es war nur so unpraktisch, dass uns die Bomben unserer Lebensretter selber auf den Kopf fielen.
Deshalb schrieb ich in meiner "Ballade von Jan Gat unterm Himmel in Rotterdam" den Vers, der manchen Deutschen irritiert oder gar entrüstet hat:
Und weil ich unter dem gelben Stern
In Deutschland geboren bin
Drum nahmen wir die englischen Bomben
Wie Himmelsgeschenke hin.
Auch das unterscheidet mich von den meisten, die in Deutschland jetzt die Lufthoheit im Meinungskrieg über den Luftkrieg der Alliierten erobert haben.
Mir fällt allerdings ein beachtenswerter Gegensatz auf: Die meisten Kinder und Kindeskinder der Nazi-Täter-Generation sind reflexartig und prinzipiell gegen jeden Krieg. Die meisten Nachkommen des Heil-Hitler-Volks, das den Krieg und die Massenmorde so willfährig mitgemacht hatte, wollen sich auch in notwendige Kriege, die eine Not wenden könnten, nicht reinreißen lassen. Auch wenn sie kaum Immanuel Kant gelesen haben, spüren sie, dass jeder Krieg, sogar der gerechte, ein grauenhaftes, ein "trauriges Notmittel" ist.
Mit sauberen Händen kommt keiner aus dem blutigen Gemetzel wieder nach Haus. Also wollen sie fortan lieber Unrecht erleiden, als selber Unrecht tun. Niemals wieder! wollen die Nachgeborenen der Nazis werden wie ihre verdorbenen Väter und Mütter: Täter. Das ist verständlich und mir zudem sympathisch. Die allermeisten Menschen ziehen nun mal geschichtliche Lehren mehr aus der Familienerfahrung als aus dem Studium der Geschichte. Aber genau das gilt eben auch für die Nachgeborenen der damaligen Opfer: Leute wie ich wollen dies und das sein, aber niemals wieder Opfer. Also sind meinesgleichen eher für einen Krieg zum Sturze solch eines menschenverachtenden Regimes, dessen erklärtes und vornehmstes Ziel es ist, Israel zu vernichten. Dass Saddam Hussein ganz nebenbei sein eigenes Volk von Anbeginn seiner Putschherrschaft vernichtet: es foltert, erpresst, verblödet, ängstigt und fanatisiert, das wird dabei von vielen einfühlsamen Friedenskämpfern in der westlichen Welt mitleidlos ignoriert. Deutsches Sprichwort: Fremdes Leid trägt sich leicht.
Die Regierenden in Berlin täuschen ihr Volk in jeder "Tagesschau" mit der korrekten Neuigkeit: Die Uno-Waffeninspektoren finden nichts Neues. Es gebe also keinen Grund für einen Krieg gegen das Regime in Bagdad. Dabei wissen absolut alle, Freunde wie Feinde, dass diese A- oder B- oder C- Waffen in irgendwelchen nicht auffindbaren Bunkersystemen oder, paar Kilometerchen jenseits der syrischen Grenze beim hilfsbereiten Nachbarn, in aller Ruhe professionell versteckt worden sind und auf ihren Einsatz warten.
Ein präventiver Krieg sei, so reden viele unserer offiziösen Mahner, unbegründet und außerdem ein Bruch des Völkerrechts und also selber ein Kriegsverbrechen. Im selben Moment aber teilte die Gesundheitsministerin den Deutschen mit, dass unser Staat beschlossen hat, ab sofort einhundert Millionen Einheiten Impfstoff gegen Pocken bereitzuhalten, also für die gesamte Bevölkerung. Das sind die Tranquilizer fürs Volk, verabreicht von provinziellen Quacksalbern, die kaum Besseres mit sich und dem Vaterland vorhaben, als die nächste Landtagswahl in einem Bundesland zu gewinnen.
Mich lässt eine apokalyptische Vision nicht los in diesen Tagen: Nehmen wir an, dieser gelernte Putschist, Oppositionskiller, Giftgaskriegsheld, Kurdenausrotter, dieser gelernte Ölquellen-in-Brand-Setzer und gescheiterte Aggressor hat spätestens im ersten Golfkrieg vor zwölf Jahren kapiert, dass er gegen einen zur Verteidigung entschlossenen Westen nicht ankommt. Frankreich hatte ihm zwar Mirage-F-1-Bomber verkauft. Die USA, diese weltpolitischen Dilettanten, hatten ihn grauenhaft kurzsichtig im Eroberungskrieg gegen den gefürchteten Chomeini-Iran unterstützt.
Arbeitslose Kernphysiker sind seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bereit, jedem dreckigen Diktator gegen Gage seine "dreckige Atombombe" zu basteln. Deutsche Firmen lieferten aus sauberster Profitgier dem Irak alles, was man zur Giftgasproduktion und zur Vervollkommnung primitiver Raketen braucht. Aber es existiert längst eine spottbillige und supermoderne Trägerrakete, die solch ein Regime weder heimlich bauen, noch umständlich verstecken muss und mit deren Hilfe Kleinterroristen wie Bin Laden oder solche Großterroristen wie Saddam Hussein atomare oder chemische oder bakteriologische Massenvernichtungswaffen leicht ins Ziel bringen können: die Demokratie. Sie funktioniert todsicher in allen weltoffenen zivilen Gesellschaften.
In jeder westlichen Großstadt kann man mit dem nötigen Kleingeld jeden Tag auf dem freien Immobilienmarkt hundert geeignete Immobilien kaufen. Insbesondere private Einzelhäuser werden so gut wie niemals von irgendwelchen Polizei- oder Sicherheitskräften beachtet, geschweige denn kontrolliert. Es wäre ein Klacks, in solch einem Haus eine funktionierende Massenmordmaschine Stück für Stück im Laufe der Jahre zusammenzubauen.
Jede Firma liefert alles. Lästige Handelsembargos für kriegsgeeignete Spezialtechnik spielen im Inland keine Rolle. Und wenn dann ein getürkter Tanklaster einer Ölfirma gelegentlich vorfährt, kann der genauso gut eine Giftbrühe oder eine mit Krankheitserregern präparierte Nährflüssigkeit für tödliche Epidemien in den zweckentfremdeten Heizöltank pumpen. Die Explosion kann dann im richtigen Timing ausgelöst werden, durch ein Signal, ein Code-Wort von sonst woher mit einem Mobiltelefon. Alle Metropolen der westlichen Welt sind geeignete Schauplätze zur Aufführung einer solchen Tragödie, für die der 11. September in New York nur ein Vorspiel war.
Und was wird mit Israel? Ein paar mit deutscher Technik aufgemöbelte Raketen, die Nordkorea an den Irak geliefert hat, funktionieren wie im letzten Golfkrieg gut genug, um die kurze Distanz in Richtung Israel zu bewältigen, so dass der winzige Judenstaat sich mit einem Schlag in eine riesige Gaskammer verwandelt. Das wäre dann die panarabische Endlösung der Judenfrage. Ich sah heute ein Foto in der Zeitung: Junge Israelis in einer Schulklasse üben mit den Gasmasken. Das ist der historische Fortschritt: Immerhin haben seit dem Trick mit den falschen Duschräumen in Auschwitz diese Menschen inzwischen echte Gasmasken auf der Nase.
Schlau, wie die Juden nach Meinung der Antisemiten allerdings sind, werden die Israelis bei einem Raketenangriff auf ihr Land in luftdicht abgeklebten Kellern unter den Wohnhäusern sitzen. Und dann teilen sie sich die präparierten Wasservorräte und das Essen ein. Aber wer in solcher Welt auch nur einen Monat in einem Bunker überlebt, der wird die schon verwesenden Leichen auf der Straße beneiden.
Male ich den Teufel an die Wand? Liefere ich dem toll gewordenen Mörderpack etwa noch tollere Ideen mit solchem Horrorszenario? Egal wie es kommt, eines ist sicher: Alle Kontrahenten werden, wenn sie im Untergang überhaupt noch was sagen können und falls überhaupt noch ein Lebendiger zuhört, röcheln: "Siehste!" - soll heißen: Alle werden sich bestätigt fühlen, alle werden noch im Sterben die eitle Genugtuung genießen, Recht behalten zu haben. Auch ich.
Die Haltung unserer Regierung provoziert eine Chance, und die wird jeden fundamentalistischen Friedenskämpfer entzücken: Wenn wir kriegserfahrenen Deutschen nun also dermaßen den Krieg als letztes Mittel der Politik ächten, sollten wir diese brachiale Friedensliebe auch furchtlos ausleben. Dann sollte unser Land konsequenterweise seine Armee auf der Stelle abschaffen. Die Steuermilliarden für den Wehretat könnten wir sparen. Eine totale Abrüstung wäre ein Segen für die bankrotten Kommunen. Der Staatshaushalt wäre mit einem Schlage saniert! Die Renten wären sicher! Neue, ökologisch nachhaltige Arbeitsplätze könnten geschaffen werden! Eltern und ihre Kinder, die es brauchen, könnten einen Kindergartenplatz finden. Mehr und besser ausgebildete Lehrer fänden einen Job.
Wenn nämlich das reiche und starke Deutschland so gar keine Feinde auf Leben und Tod mehr hat auf dieser Welt, Mensch! dann sollte es getrost sein Schwert an den Ufern von Babylon niederlegen und baden gehen. Ich meinte diese Idee ursprünglich mephistophelisch boshaft.
Aber nun überlege ich ohne Häme: Warum eigentlich nicht - womöglich hat sich der Hegelsche Weltgeist unseren ursprünglich falschen Friedenskanzler Schröder und seinen wandelbaren Außenminister als echt blind wirkende Prototypen einer Welt ohne Waffen ausgewählt. Wir erleben - das könnte doch sein! - das Wirken der Hegelschen Geschichtsdialektik. Und können womöglich später einmal mit stillem Pathos sagen: Wir sind dabei gewesen! Wer weiß - ausgerechnet diese geschichtsdummen Deutschen könnten nun durch eine Abschaffung der Armee den kindlich-klugen Dreh gefunden haben, mit dem der uralte Circulus vitiosus von Krieg und Frieden, von Gewalt und Gegengewalt ein für alle Mal durchbrochen wird: einseitige Abrüstung! Die Deutschen haben im letzten Jahrhundert der Welt die zwei Weltkriege beschert - jetzt könnte es vom überlegenen Witz des Weltgeistes zeugen, wenn ausgerechnet Germania durch seine totale Selbstentwaffnung die Epoche eines Ewigen Friedens einläutet. So würde - diesmal in echt - am Deutschen Wesen doch noch die Welt genesen. Aber ich habe da - pardon - meine Zweifel.
Eugen Drewermann Stuttgart, 4.2.2003
Ich danke Ihnen für das Engagement, mit dem wir zeigen wollen, dass wir gegen diesen Krieg sind, den die Bush Administration seit August vorigen Jahres als fertigen Plan beschlossen zu haben scheint und dass wir gegen jeden Krieg sind.
Wir sind gegen diesen Krieg, weil Edward Kennedy Recht hat, wenn er sagt, „das ist der falsche Krieg zum falschen Zeitpunkt“.
Noch nie in der Vergangenheit hat man erlebt, dass, wie die Katze langsam sich ans Mauseloch heranschleicht, eine Großmacht förmlich ringt um Gründe und Vorwände zu finden oder vorzutäuschen, um endlich denn doch mit schwankenden Zustimmungen in der Weltbevölkerung ein Land der dritten Welt in die Steinzeit zurückzubombardieren.
Man erzählt uns, dass dieser Krieg unvermeidbar sei, und angelangt bei der Nichtigkeit aller vorgegebenen Begründungen, liest man in den letzten Tagen immer wieder, dass George W. Bush überhaupt nicht mehr zurückkönne nach dem Aufmarsch von über 100.000 amerikanischen Soldaten, denn er verlöre dann sein Gesicht.
Ich frage allen Ernstes, wann ein Mensch sein Gesicht verliert: wenn er sich die Fratze mit Blut beschmiert oder wenn er endlich darauf sinnt, wie er reden kann, um Kriege zu vermeiden.
Was eigentlich halten wir für „groß“ in der menschlichen Geschichte?
Denjenigen, der sich immer noch damit brüstet, dass er als Repräsentant der einzig verbliebenen Weltmacht dieser Erde über eine Tötungskapazität verfügt, wie sie in der Geschichte der Menschheit niemals angehäuft wurde? Oder nennen wir groß jemanden, der im Stile Mahatma Gandhis rundum erklärt: „Friede ist niemals das Resultat von irgendetwas – es ist allein der Weg. Und wer nicht mit dem Frieden anfängt, kann nicht beim Frieden endigen“.
In Folge dessen müssen wir uns verwahren gegen einen ganzen Sack voll Lügen, aus dem man offensichtlich immer noch glaubt, am Ende die Wahrheit destillieren zu können. Es ist eine Lüge, wenn wir reden hören von einem Militärschlag gegen den Irak. Krieg ist kein Militärschlag –etwas, das man eben mal austeilt, wie eine Lektion, die jetzt Bagdad erteilt werden soll.
Diese Sprache ist echt amerikanisch seit 1945. Am Abend des 6. August, nachdem Hiroshima mit über hunderttausenden Toten zurückgelassen worden war, konnte Harry Truman auf dem Flugzeugträger seinen Boys verkünden: „Jungs, wir haben ihnen einen Ziegelstein auf den Kopf geschmissen“ und der Weltöffentlichkeit wurde erklärt, dass man den Japsen eine Lektion erteilt habe.
Auch Bush Senior wollte Saddam eine Lektion erteilen mit dem zweiten Golfkrieg. Und nun sind wir wieder dabei, eine dritte Lektion zu erteilen.
Der Massenmord von hunderttausenden von Menschen ist für jedes denkende Gemüt die falsche Lektion – zu jeder Zeit und zu aller Zeit.
Man erklärt uns, dass der Aufmarsch am Golf jetzt dazu diene, Hussein eine letzte Chance zu geben oder den Druck auf ihn zu erhöhen. Wenn das so wäre, hätte Blix vollkommen Recht: der CIA hätte längst die genügenden Informationen zum Nachprüfen liefern müssen, damit eine faire Chance bestünde. Saddam Hussein hat vor etwa drei Wochen aufgefordert, dass die CIA sich selbst im Irak bedienen könne, sie könne alles was sie vermute selbst kontrollieren. Natürlich ist das Angebot nicht angenommen worden. Es soll überhaupt keine Chance geben – nicht für das Regime von Saddam Hussein.
Die Gründe dafür aber sind mehr als an den Haaren herbeigeholt. Der Vollständigkeit wegen müssen wir sie nur rekapitulieren:
Saddam Hussein ist dicht dabei eine Atombombe zu bauen oder schon im Besitz einer Atombombe oder bei der Verfügung über spaltbares Material in einem halben Jahr, so Donald Rumsfeld, imstande eine Atombombe zu bauen.
Condolezza Rice konnte letztes Jahr erklären in der Sprache, die sich George W. dann zu eigen machte: „Wenn wir den Atompilz sehen, ist es zu spät zu beweisen, dass Saddam Hussein eine Bombe gebaut hat, wir müssen ihm zuvorkommen.“
Das alles ist erkennbar Unfug und wird selbst in der Propaganda der USA nicht mehr verwandt. Es gibt keine Atombomben im Irak und es hätte nicht einmal 1991 die Fähigkeit bestanden, Atombomben zu bauen, nachdem die Meiler von den Israelis früh genug bombardiert wurden.
Bleiben biologische und chemische Massenvernichtungswaffen. Scott Ritter, der von 1991-98 die Inspektionen geleitet hat, erklärt definitiv: „dass man an chemischen Waffen vernichtet hat in den Fabriken, alles was vorhanden war, und dass eine Kapazität zum Nachrüsten unbemerkt nicht bestehen kann“. Sein Hauptargument: „Es gibt keine geheimen Lagerungen mehr von Sarin, von Tabun und VX.“ Das simple Argument: „Länger als fünf Jahre lagern sich chemische Waffen dieser Art nicht.“ Es ist im Übrigen zu diskutieren, ob VX jemals von den Irakis stabilisiert werden konnte. Bei den chemischen Waffen ist noch deutlicher, dass der Irak aus eigenen Mitteln nicht herstellen könnte, was an seinen Rändern allerdings in den Händen fast allen Staaten angetroffen wird. Manch einer wird sich noch an den Flugzeugabsturz einer El-Al Maschine über Amsterdam erinnern, mit den Folgen vieler ungeklärter Todesfälle. Mit Sicherheit ist davon auszugehen, dass an Bord dieses Zivilflugzeuges die Komponenten für das Giftgas Sarin nach Israel gebracht wurden. Das geht durch seit Jahrzehnten, es soll aber ein Kriegsgrund werden gegen den Irak von Saddam Hussein.
Die biologischen Waffen sind auf geradewegs zynischem Weg in den Irak gekommen. Man macht sich heute Sorgen über Anthrax, über Milzbrandbazillen. Wenige wissen vielleicht, dass 1945 Churchill dabei war, zu diskutieren, ob man Milzbrand nicht gegen Nazi-Deutschland einsetzen könnte. Fakt ist, dass im Dezember ´83 kein Geringerer als Donald Rumsfeld im Gespräch mit Saddam Hussein dafür gesorgt hat, dass der Irak Anthrax bekommt. Er stand damals als Kettenhund der Amerikaner im Kampf gegen die Ajatollahs, in einem Krieg, der in acht Jahren etwa fünfhunderttausend Menschen auf Iranischer und Irakischer Seite das Leben gekostet hat. Man wirft heute Saddam Hussein vor, dass er Giftgas benutzt hat. Was man nicht sagt ist, dass das Giftgas zum Teil geliefert wurde aus dem Westen und dass es die Unterstützung der Amerikaner fand im Krieg gegen den Iran bei der Rückgewinnung der Insel Phau im Persischen Golf, genau dieses Giftgas in Mengen gegen die Iraker einzusetzen. Die Inspektoren später konnten es finden, wie man Atropin zur Stützung des Kreislaufs der eigenen Soldaten eingesetzt hat. 1988 war es, dass Saddam Hussein das Giftgas einsetzte gegen die Kurden, bei Halabja, mit der Folge von etwa 5000 Toten. Alles was wir heute sagen, ist alles andere als eine Rechtfertigung der Morde die der Irakische Diktator im Irak zum Leiden seiner Bevölkerung heraufbeschworen hat und die den Straftatbestand von Kriegsverbrechen allemal erfüllen.
Aber die Parteilichkeit, mit der wir, je nach Laune, wenn die Kriegsverbrechen den USA nützen, für richtig und notwendig finden, und wenn am Ende der Krieg vorbei ist, wir erklären, dass wir sie zu rächen oder sie zu beseitigen hätten, ist eine janusköpfige Moral der Verlogenheit. Entweder ist das Morden von Menschen mit Giftgas – das Ausrotten von Menschen mit Volksseuchen in sich selber - ein Übel, dann aber stehen alle Staaten in der Pflicht, sich dieser Mittel zu entledigen, angefangen bei denen, die davon am meisten haben.
Im amerikanischen Senat konnte Richard Pearle, den manche Amerikaner den Fürsten der Finsternis nennen, aber der als Sicherheitsberater eine Menge zu sagen hat, erklären, dass der Irak über Waffen verfügt, deren Schrecklichkeit wir uns überhaupt nicht vorstellen können.
Lieber Herr Pearle, wenn Sie etwas von Sicherheit und von Rüstung verstehen, wäre es das Allereinfachste, Sie ließen sich einladen ins Pentagon oder Sie bestellten mindestens den Waffenkatalog für die internationalen Waffenhändler, die in den USA zum Verkauf anstehen und Sie wüssten, was für unvorstellbar scheußliche Mittel die Vereinigten Staaten von Amerika produzieren und im ganzen 20. Jahrhundert in keiner Sekunde gezögert haben anzuwenden.
Fast möchte man denken mit Nelson Mandela, der für die Aussöhnung zwischen Schwarz und Weiß den Friedensnobelpreis bekommen hat:
„Die USA haben die schlimmsten Kriegsverbrechen in der Geschichte der Menschheit verübt und es missfällt mir, dass ein Mann, der nicht richtig denken kann, dabei ist, die mächtigste Macht der Welt in den Abgrund zu führen.“
Es bleibt das Argument, dass wir vermutlich morgen durch Abhören von irgendwelchen Telefonaten aufgetischt bekommen werden, dass der Irak Saddam Husseins Kontakt habe zu Al-Quaida. Alle, die von der Lage im Nahen und Mittleren Osten etwas wissen, können diese Argumentation nur absurd finden. Die Bath-Partei Saddam Husseins ist eine völlig säkulare Gruppe. Sie hat sich an die Macht gebombt und gemordet, durch Unterdrückung und Ausrottung gerade der fundamentalistischen Kräfte des Islam im Irak. In den Augen von Leuten wie Osama Bin Laden stünde der irakische Präsident und Diktator ganz in der Nähe des absolut Bösen - eben deswegen. Wahabitische Koraninterpretation wird nicht geduldet im Irak. Wenn es darum ginge, wäre und ist der Verbündete der Amerikaner Saudi Arabien wesentlich gefährlicher als der Irak.
Gründe dieser Art können es nicht sein. Zu vermuten steht deswegen, dass man wieder mit Lügen Motive schaffen möchte, für die natürlicherweise keine vorhanden sind, und das hat eine lange Geschichte:
Eintritt in den Vietnam Krieg – erfunden wurde der Tonking Zwischenfall unter Gerald Ford.
Eintritt in den ersten und zweiten Golfkrieg – das Versprechen an Saddam Hussein, das Ajatollah Regime würde zusammenbrechen beim ersten Stoß auf den tönernen Götzen der islamischen Revolution.
Dann aber, 1991, wirklich übel: die Friedensbewegung stand zu Tausenden in den deutschen Städten im Vorlauf zu dem Krieg. Sie wurde beinahe neutralisiert mit einer Propagandalüge, die man mit 15 Millionen Dollar in London gekauft hatte, dem amerikanischen Senat vorspielte und von Bush Senior in 40 Reden und über CNN weltweit immer wieder als Argument verwandt wurde: Irakische Soldaten in Kuwait reißen aus den Brutkästen Kinder, werfen sie auf die Erde und ermorden sie. Sagen Sie selber: muss man gegen Menschen, die Kinder morden, nicht einschreiten mit allen Mitteln? Darf man dem Teufel auf Erden freie Hand lassen? Dagegen muss man notfalls militärisch angehen. Der Notfall ist eingetreten und also werden wir dagegen angehen.
In der Friedensbewegung waren wir wie gelähmt, denn eine gewisse Logik liegt in dieser Beweisführung. Wenn Männer in den Krieg gehen, hochmotiviert, dient es fast immer dem Schutz von Unschuldigen, dem Schutz von Frauen und Kindern. Man muß dieses Motiv, weil es archaisch genug ist in der Geschichte der Menschheit, wirklich erst nehmen.
Die Wahrheit aber ist, wir schützen nicht Frauen und Kinder, wenn wir in der modernen Kriegsführung genau das tun. Wir ermorden Frauen und Kinder. Das, was eben gesagt wurde, eine Embargopolitik seit 1991 bis jetzt, die nach unabhängigen UNO-Schätzungen und nach dem Votum von Sponek, dem Leiter der Aktion „Food for Oil“ bis vor zwei Jahren, monatlich im Irak an Folgen der Embargopolitik etwa 3000 bis 5000 Menschen unschuldig dahinrafft, ergibt die unglaubliche Zahl, bis heute, von mehr als einer Million Toten, vornehmlich Frauen und Kinder - Marginal ein nie beendeter Krieg. Auf solche Weise schützt man nicht Frauen und Kinder, auf solche Weise mordet man Frauen und Kinder. Man verhindert nichts Böses, man tut es in der schlimmsten nur denkbar ausgeprägten Form.
Fragen müssen wir aber, was das denn für ein Embargo ist, bei dem mehr als eine Million Menschen elendiglich krepieren, das aber unfähig sein soll, Waffenkomponenten für Giftgas, für Chemikalien und Ersatzteillager für Raketen über die Reichweite von 150km in den Irak zu schmuggeln.
Richard Pearle ist es, der sagen konnte, noch vor einem halben Jahr: „Alles, was sich auf Erden bewegt, können wir sehen und alles , was wir sehen können, können wir zerstören.“
Es gibt kein Land der Erde, das seit zwölf Jahren so gründlich nicht überwacht würde, wie der Irak – mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Es gibt keine Armee mehr, die auch nur annähernd die Stärke der irakischen Militärmaschinerie von 1991 aufwiese. Alles was man uns vor Augen stellt, ist die Erwartung geradewegs des Pentagon, einen kurzen Krieg zu führen. Wenige Wochen – lang darf er nicht dauern. Aber genau indem man das sagt, erklärt man doch, dass der Gegner außerordentlich schwach ist und beides geht nun nicht in eins: der Welt zu suggerieren, dass sie von einem furchtbaren Gegner bedroht wird, der unendliche Möglichkeiten zum Bösen hat, den Zwergen also zum Riesen zu erklären, nur um endlich draufschlagen zu können. Es gibt die Idee von Paul Wolfowitz, dem Mann der militärisch hinter den meisten Plänen steckt, die jetzt ausgeheckt werden. Seine Vision lautet, verkündet durch George W. Bush, dass der kommende Krieg im Nahen Osten Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und Demokratie tragen wird. Genau das wird nicht sein, Herr Wolfowitz.
Erstens: die Demokratie – wenn sie wäre – Freie Wahlen im Irak würde sie dahin führen, dass die Schiiten an die Macht kämen. Es gäbe eine Fusion des Iraks mit dem Iran. Keine Bush-Administration könnte sich das Szenario in dieser Zukunft wünschen: Die Erdölfelder im Nahen Osten in den Händen islamischer Fundamentalisten – es wäre die erste Folge einer demokratischen Wahl im Irak.
23 Prozent der Bevölkerung im Irak gehören den Kurden an. Eine demokratische Wahl liefe darauf hinaus sie endlich selbständig zu machen. Was ist das für eine Politik, die einem Volk von 17 Millionen Menschen und 3000 Jahren Kulturgeschichte, den Kurden, bis heute die Selbständigkeit verweigert, verstreut in drei Ländern, darunter dem NATO-Staat Türkei ?
Was bleibt, sind die etwa 17 Prozent sunnitischer Bevölkerung. Die haben die Macht im Irak errungen mit diktatorischen Mitteln – freie Wahlen hat es nie gegeben und eine Regierbarkeit des Irak unter den Bedingungen der Grenzziehungen der Kolonialzeit ist sehr schwer vorstellbar.
Wollten wir einen Weg zur Demokratie, müsste er langsam verlaufen, er würde damit beginnen, das wir das irakische Volk, 20 Millionen Menschen, aufhören mit einem Einzelnen zu verwechseln. Das irakische Volk hungert, das irakische Volk leidet, das irakische Volk möchte nichts anderes als Menschen sonst auch: in Frieden leben – und dafür könnten wir sorgen.
Diktatoren herrschen durch die Angst und würden wir sie auflockern, hätte Saddam Hussein weit weniger Macht, als er heute besitzt. Es ist aberwitzig, mit Angst von außen zu glauben ein Volk in die Opposition treiben zu können. Vielleicht hätten wir in Deutschland an dieser Stelle wirklich ein wenig Erfahrung den Amerikanern zu bieten. Die Deutschen waren, ob Nazis oder nicht, in keiner Zeit des sogenannten zweiten Weltkriegs dichter um den Führer geschart als bei den Massenbombardements gegen die Großstädte Deutschlands. Wenn das Leiden ein bestimmtes Maß überschreitet, werden Menschen sich verhalten wie eine Rinderherde: sie werden zusammengehen und sich um den Stärksten scharen. Der Effekt hat durchaus eine Parallele: bis zum 11. September gab es viele Gazetten, die meinten, George W. Bush sei jemand, der noch bis 1991 die Taliban verwechselt hätte mit irgendeiner Rockgruppe, oder dem nicht ganz klar war, dass sogar in Brasilien Neger existieren, fast so viele wie in den USA. Man zweifelte daran, ob George W. Bush, jenseits von Texas mit Bewusstsein irgendetwas aufgenommen hätte. Seit dem 11. September sind die Dinge klar: man schart sich um den Führer – 90 Prozent der Zustimmung zum Krieg, so wird in den Medien zumindest behauptet. Würde man dem irakischen Volk Möglichkeiten zu seiner Regeneration wirtschaftlich, kulturell – politisch vor allem – geben, würde man das Land aus seiner Isolation herausführen, verlöre Saddam Hussein von alleine die Macht und es wäre langsam, vielleicht im Verlauf von vielen Jahren, ein ernstzunehmender Demokratisierungsprozess in dieser Region einzuleiten. Stattdessen glaubt uns kein Mensch den Demokratiewillen, wenn wir anachronistische Regime wie in Kuweit, wie in Al Quatar, wie in Saudi Arabien unterstützen bloß um dort die Machtbasen des US-Imperialismus aufzubauen.
Sagen wir es offen, jenseits allen Propagandarummels: dieser Krieg wird geführt einzig für Öl. Drei Fünftel des Erdöls liegt am Persischen Golf und darum geht es. Wie Putin sich verhalten wird, mit dem man gerade über Murmansk neue Erdölgeschäfte abzuschließen gedenkt, auf Seiten der Amerikaner. Vielleicht ist Erdöl das, was die Welt im Ganzen regiert, nicht mehr Verstand, nicht mehr Menschlichkeit. Vielleicht ist es richtig, daran zu erinnern, dass mit Harry Truman 1948 bereits sich ein Denken verbunden hat, das George Kennan damals, als Vordenker der USA, auf den Begriff brachte. Die amerikanische Bevölkerung vertritt 6 Prozent der Welt, hat aber den Besitz von 50 Prozent des Reichtums der Welt. Daraus geht natürlicherweise hervor, dass man auf uns neidisch ist und uns vielerorts hasst.
In dieser Situation müssen wir danach trachten, den Zustand zu bewahren, mit Rücksicht auf unsere eigenen Sicherheitsinteressen. Von daher können wir uns den Luxus gut gemeinter humanitärer Ideen wie Demokratisierung, wie Wohlstand, die Humanität im Ganzen und die Menschenrechte nicht länger leisten. Wir werden uns bemühen müssen, möglichst klar und zweckrational unsere Interessen international zu vertreten. Das allerdings geschieht – seit jetzt 50 Jahren. Nur sollten wir klar und deutlich sagen: Menschenblut ist zu schade für das Geschmier aus Öl. Immer noch sind Menschen wichtiger als die schmutzigen Hände von 6 Erölkonzernen.
Es wäre auch nicht ganz schlecht, Herrn Aznar in Spanien zu sagen, der jetzt sich so begeistert gibt für den Krieg der USA am Golf, dass er sich um das Erdöl vor der Galizischen Küste mehr kümmern sollte, als um das am Golf.
Leider sind wir in Europa noch nicht soweit, dass wir eine einheitliche Stimme aus der einheitlichen Erfahrung hätten. Es sind Völkerrechtler, die uns heute sagen: die Auslösung eines Präventivkriegs durch die vermeintlich einzige zurückgebliebene Weltmacht der Erde lässt uns zurückfallen in einen Rechtszustand am Ende des 30-jährigen Kriegs von 1648:
Das Einmischungsrecht in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates - null und nichtig, anerkannte Verträge - null und nichtig. Desillusionierung und Hypnotisierung durch vermeintliche Gegner, deren Waffenbesitz nicht einmal nachgewiesen ist, den man aber töten muß, weil sie uns gefährlich werden könnten. Ja sollen wir denn in der Welt jedem Paranoiker jetzt erlauben, seinen Nachbarn zu ermorden, weil er von denen ermordet werden könnte? Wann denn hört die Spirale der Angst und des Terrors auf?
Gott sei Dank, dass sich zum erstenmal eigentlich seit 1945 sogar die Kirchen, sogar die katholische Kirche klar gegen einen Krieg ausspricht.
Es war Johannes XXIII., der angesichts des Wettrüstens die Menschheit beschwor, sie möchte diesen Wahnsinn sich endlos in immer schrecklichere Todeskapazitäten hineinzurüsten, aufgeben, indem sie es lerne, statt der Angst der Liebe zu folgen. Das sind Botschaften, die über 40 Jahre alt sind.
Im Grunde gibt es zu keinem einzigen Punkt, der eine Rettung sein könnte, wirklich Neues zu sagen. Wörtlich steht das alles in der Bergpredigt.
Aber schildern wir lediglich, warum wir nicht nur gegen diesen Krieg am Golf sondern gegen jeden Krieg sind. Dann gibt es ein paar Punkte, auf die wir vor allem psychologisch hinweisen müssen:
Ins Gespräch kam der Bunker von Al-Merija mit über 450 Toten. Schildern wir die Geschichte nur so, wie sie sich abgespielt hat:
Irgendjemand auf einem amerikanischen Flugzeugträger am Golf lässt seine Finger über einen Computer gleiten und programmiert damit eine Tomahawk-Rakete – um genau zu sein zwei Tomahawk-Raketen mit dem Zielangabe Al-Merija. Davon soll die erste Rakete den Eingang blockieren und die zweite Rakete durch die Betondecke sich hineinbohren, so dass niemand aus dem Bunker, gleich wer darin ist, entkommen kann.
Stellen Sie sich vor, dass solch eine Handlung möglich ist, weil wir sie vollkommen emotionslos fertig bringen. Wir haben nicht die mindeste Vorstellung über die Wirkung dessen, was wir zum Programm erheben.
In etwa 500 Meilen Entfernung wird irgendetwas passieren, dass unsere Augen eigentlich gar nicht zu sehen bekommen.
Dies ist die Möglichkeit überhaupt, meinte vor 35 Jahren der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, dass wir diesen Wahnsinn, den wir Krieg nennen, überhaupt durchführen können.
Würden wir wirklich sehen, was wir anrichten, wir würden vor lauter Entsetzen nicht mehr imstande sein, das was die Militärs uns auftragen auszuführen.
Setzten Sie nur die Bedingung, wie sie vis-a-vis erfolgen würde. Wir würden irgendeinem amerikanischen GI sagen: „Nimm Deine Maschinenpistole, geh auf den Bunker in Bagdad los, schieß da hinein und laß niemanden entkommen. Du bist dafür verantwortlich, dass niemand entkommen wird.“
Jemand, der imstande ist, vis-a-vis aus seiner Maschinenpistole 450 wehrlose Menschen zu ermorden, hätte aller Wahrscheinlichkeit nach die Psychologie eines Massenmörders und gehörte ganz sicher nicht in irgendeine Armee hinein. Aber genau diese Massenmorde können wir vollkommen skrupellos vollbringen, weil wir überhaupt nicht sehen, was wir tun. Daran liegt es, dass man uns CNN Spiele vorführt, um die Augen und Ohren als erstes zu täuschen und die Nerven, die Rezeptoren des Elends zu betäuben. Wir sollen überhaupt nicht wissen, was gemacht wird. Wir sollen hinterher die Fahne schwenken, wie nach dem zweiten Golfkrieg 1991 – mit 60 Millionen Dollar gesponsert schon wieder von der Waffenindustrie.
Die Lehre des Vietnamkriegs war, dass normale Zivilisten einen Krieg nicht länger dulden, wenn sie jeden Abend sehen, wie unsere Jungs und unsere Panzer durch brennende Bambusdörfer rollen, wie bei einem Napalmangriff bei 1200 Grad Celsius Menschen wie lebende Fackeln verbrennen auf der Straße nach Plei-Qu, Kinder da sind, die ihre Kleider verloren haben und ihre Eltern nicht mehr finden. Irgendwann wird ein Mensch, soweit er fähig ist zu fühlen, laut schreien und sein Schrei wird lauten: „NEIN“. Und dann allerdings wird man wissen, dass man all dies nie hätte beginnen sollen.
Wir brauchten eine Intelligenz, die sich selber reflexiv ist, hat Konstantin Wecker gesagt – vollkommen richtig. Wir müssten aber die Reflexion verknüpfen mit der Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen, denn die schlimmsten Verbrechen im 20. Jahrhundert – und ich fürchte im 21. – sind möglich, weil man einen Verstand trainiert, dem man das Fühlen abgewöhnt.
Was ich da sage, ist keine Nebensache. 1945 fanden amerikanische Militärpsychologen, dass es den GI’s normalerweise schwer fiel, beim Anblick des Weißen im Auge des Gegners augenblicklich durchzuziehen um ihn zu töten.
15 Prozent der GI’s taten das ohne jeden Skrupel. Alle anderen aber zögerten und die wenigen Bruchteile der Sekunden des Zögerns konnten entscheiden über Leben und Tod. Also musste man die Sache verbessern.
Im Koreakrieg 1952 stand man bereits bei über 50 Prozent, beim zweiten Golfkrieg 1991 garantierte die Admiralität für 90 Prozent voll verwendungsfähiger GI’s. Sie legen Typen um, sie neutralisieren, eliminieren, sie töten überhaupt nicht mehr, sie schalten ab. Nur auf diese Weise ist der Zynismus möglich, dass man am Ende mit dem „Red Star“ Leute auszeichnet, die mit gepanzerten Bulldozern sich die Arbeit des Tötens gleich ersparen und zum Beerdigen übergehen.
Über 8 Kilometer Länge zum Beispiel – Ramsey Clark listet das auf in seinem Buch „Wüstensturm“ - werden irakische Soldaten begraben bei lebendigem Leibe. Ausgezeichnete Handlungen amerikanischer GI’s!
Gefühle oder Skrupel sind unerwünscht, um so etwas tun zu können. Und noch viel schlimmer. Man trainiert unsere Jungs, 18 Jährige, ganz normale Bürger, die gerade aus der Schule kommen, rund um den Globus, bei jeder Soldateska in jedem Militär dazu, auf Befehle zu reagieren, wie wenn es Pavlowsche Hunde bei einem Reflex wären. Auf Befehl ist zu tun, was gesagt wurde.
Das schlimmste Beispiel, das mir in Erinnerung ist, stammt aus dem Jahre 1995, auf RTL. Damals befragt Günter Jauch im Abstand von 50 Jahren den Bomberpiloten über Nagasaki, Major Sweeney, was er sich gedacht habe seit dem 9. August. Er hat, zusammen mit Major Tibitts, mehr Menschen getötet, als in der ganzen Geschichte der Menschheit sonst: 80.000, 100.000 Menschen in wenigen Sekunden. Drei Generationen später immer noch werden Frauen Kinder zur Welt bringen, die nichts weiter sein werden, als schmerzempfindendes Fleisch ohne Bewusstsein.
Zwölf Jahre danach noch werden Menschen an Strahlenkrankheiten, Leukämie, Krebs zugrunde gehen, elend.
„Was, Major Sweeney, haben Sie sich gedacht in all den letzten 50 Jahren – Sie waren damals noch nicht einmal 25 Jahre alt?“
Major Sweeney antwortete sinngemäß und in der Betonung korrekt wiedergegeben: „Was Sie da fragen – Befehl ist Befehl – jeder Soldat der Welt hätte genau dasselbe getan, außerdem war der verdammte Krieg wohl dann zu Ende“.
Erstens Lüge, Major Sweeney, der Krieg war zu Ende. Die Amerikaner wollten nicht mehr die Japsen besiegen, sie wollten den Sowjets zeigen, dass sie das Nachfolgeimperium der Japaner im Pazifik antreten würden.
Aber das viel Schlimmere: in gewissem Sinne hat der amerikanische Soldat Recht – jeder Soldat der Welt würde genauso handeln.
„Befehl ist Befehl“ –was man ihm nicht beigebracht hat, ist, dass man 1945 in Nürnberg – gerade die Amerikaner – den Nazigrößen gerade diesen Satz zum Vorwurf machten.
„Befehl ist Befehl“ – genügt das eigentlich, sich als Soldat einen Stahlhelm über das Gehirn zu schieben und das Denken einzustellen, eine Uniform sich überzuziehen um dann in den Walhallsaal der Geschichte einzutreten?
Und man gibt dabei das persönliche Gewissen an der Garderobe ab um funktionsfähig zu werden.
„Was wart Ihr denn für Menschen?“ wollte man in Nürnberg wissen, als Ihr Euch als Person völlig ausgeschaltet habt. Ihr wolltet nur noch zuständig sein für die Ausführung des Befehls, für den Inhalt überhaupt nicht.
Brennende russische Dörfer – am Ende 25 Millionen Tote allein auf der Seite der sogenannten Slawischen Untermenschen.
„Was habt Ihr Euch gedacht?“ – Das wollte man wissen. Aber die Frage kehrt zurück an jeden, der Krieg führt und mitmacht. Das Töten von Menschen ist kein Job, man bringt das nicht hinter sich. Die Frage, die aus den Büchern jetzt hervorgeht – von Jörg Friedrich „Der Brand“ – ist eigentlich nur die Umkehrung derselben Frage: „Darf man das: Ganze Städte in Feuersäulen verwandeln?“ Man muss sich das Ganze nur vorstellen aus der Perspektive der Betroffenen. Was passiert, wenn der Beton eines Bunkers wie glühender Stahl in einem Ofen wird? Soll man in Erinnnerung rufen, 27. Juni 1943, als Admiral Harris das „round the clock bombing“ für die Operation Gomorrah über die Hansestadt Hamburg einleitete – ein biblisches Gericht. 43.000 Tote in einer Nacht in Hammerbrook – das war nicht genug. Dieser Tage konnten Sie einen britischen Bomberpiloten sehen, alt geworden, Mace mit Namen: „ Ich werde diese Bilder nicht vergessen, diese Dante’sche Hölle, die wir bereitet haben. Es lag unter uns wie schwarzer Sand, bedeckt mit Diademen von Feuer. In dieser Nacht wurde ich Pazifist.“
Was eigentlich darf man tun mit Menschen? Über wie viel Leichen glaubt man eigentlich klettern zu müssen, um dem Leben zu dienen? Durch wieviel Blut vermeint man waten zu müssen, um die Friedenstaube am Ende herbeizurufen?
Die Idee, dass man auf manichäische Weise die Welt einteilen könnte in das radikal Gute und das radikal Böse, ist ein Fundamentalismus aus dem alten Persien. Man kann Mythen weise übersetzen, aber dann muss man aufhören, sie geschichtlich aufführen zu wollen, sonst holt man den Kampf zwischen Michael und dem Satan auf die Erde und man hat die Hölle auf Erden.
Man bekämpft ja nicht das Böse auf diese Weise, zum Zwecke es zu überwinden. Man hält sich im Vorlauf der Rüstung für fähig, jedes denkbare Grauen in die eigene Praktik zu übernehmen. Der andere könnte Giftgas entwickeln, also stehen wir in der Pflicht, es selber zu entwickeln. Der andere könnte Atombomben entwickeln, also werden wir in der Pflicht sein, die schlimmeren Atombomben zu haben, Wasserstoffbomben zu haben, Neutronenbomben zu haben, Star-Wars Programme zu starten. Wir können niemals teuflisch und scheußlich genug sein um jeden möglichen Fiesling und Scheußling selber in die Knie zu zwingen.
Alles Böse, das wir dem anderen zutrauen, müssen wir im Vorlauf moralisch genehmigt, militärisch organisiert und praktisch trainiert haben. Und genau das geschieht auf den Kasernenhöfen aller Welt. Daran liegt es, dass solange es das Militär gibt, und den Handelnden der Krieg vorkommt als eine Option ihres Pragmatismus, der Wahn des Kriegs wie eine Hydra die Kultur umklammert und leersaugt wie ein Vampir. Es kann einen kulturellen Fortschritt solange nicht geben, als wir immer noch die 18 Jährigen daran gewöhnen, dass es die Normalität sei, auf diese abscheuliche Weise für ihr Vaterland die Pflicht zu tun: Krieg sei der Ernstfall – genau das ist er nicht! Er ist immer noch scheinbar ein Spaßvergnügen für alte Herren im Pentagon.
Kein Mensch hätte von Donald Rumsfeld, dem 70-Jährigen, geglaubt, dass er in der Politik noch mal eine Rolle spielt. Das Einzige, was er zu sagen hat ist Krieg - mit vollem Zynismus.
Der Ernstfall wäre der Frieden, aber wann ist von ihm die Rede? Der Weg zum Frieden stünde uns scheunentorweit offen. Ein paar Wege wären zu gehen. Natürlich stehen wir hier auch um unserem Bundeskanzler Schröder dabei den Rücken zu stärken, dass er erklärt: „Krieg darf nie mehr als eine fast normale Handlungsweise der Politik erscheinen“. Genau das scheint man in der Vereinigten Staaten zu glauben. Es ist sogar die Frage, ob der Krieg als äußerste Möglichkeit geduldet werden könnte.
Seit wann ist das Totschlagen von Menschen mit den Gesetzen der Zivilisation in Übereinstimmung zu bringen?
Nehmen wir einen absurden Parallelfall: Krieg ist, sobald sich der Name ausspricht, ein Rückfall in die Steinzeit um Jahrtausende zurück, parallel zu den Praktiken des Kannibalismus. Selbst wer sagt, Krieg ist als äußerste Notwendigkeit denn doch noch vorzubereiten, noch nicht ganz in unserer Geschichte auszuschließen, bewegt ein solcher sich nicht auf einer Logik, die etwa so lauten würde: Weil sich die Hungersnot global nicht total ausschließen lässt, weil sie immer noch möglich ist, müssen wir für den äußersten Ernstfall des Verhungerns großer Menschengruppen den Kannibalismus organisieren und vorbereiten, ist das mit irgendeiner zivilen Logik in irgendeinem vernünftigen Staat zu machen?
Aber wenn es den Notfall gibt, müssen wir wie eine archaische Horde immer noch Krieg führen und den Wahn übriglassen, dass auf unserer Seite das absolut Gute stehe, auf der Gegenseite aber das absolut Böse?
Eine banale Logik reiner Projektionen.
Wie wir das Böse auf der Welt eindämmen könnten, dafür gäbe es sehr probate Mittel. An der Spitze nenne ich einen einzigen: stellen Sie sich vor, dass wir im Kampf gegen die Schurkenstaaten Nordkorea, Irak, dass wir im Kampf gegen das Elend von 50 Millionen verhungerten Menschen jedes Jahr, von über 25 Millionen AIDS-Kranken allein in Afrika, gerade heute in der Zeitung erfahren müssen, dass die Amerikaner ihre etwa 3 Milliarden Dollar Auslandshilfe nicht länger tragen können, sie reduzieren sie auf etwa 1,7 Milliarden Dollar im Jahr.
Dieselben USA stehen nicht an, an einem einzigen Tag, wenn heute Nacht die Sonne auf 12 Uhr geht, wieder ausgegeben zu haben eine Milliarde Dollar im Jahr, mehr als 370 Milliarden davon, tausend Millionen.
Selbst wenn wir in den christlichen Kirchen für Brot für die Welt, für Adveniat alles Mögliche sammeln und kämen dabei auf eine Zahl von ungefähr 50 Millionen Euro, müssten wir sagen, dass wir vergleichsweise beinahe 800 bis 1000 Jahre in Deutschland sammeln müssten, um den Wehrhaushalt der Bundesrepublik aufzubringen.
Das sechsfache, siebenfache davon leistet sich die US-Armee. Mehr als die Hälfte der ganzen Menschheit rüsten die Vereinigten Staaten von Amerika. Kein Wunder, dass sie militärisch unschlagbar sind. Sie haben alles, können alles, aber dürfen sie auch deshalb alles machen?
Was wäre zu machen bei dem Schurkenstaat Nordkorea zum Beispiel? Etwa eine Million Menschen soll vor zwei Jahren dort verhungert sein. Setzen Sie rein numerisch, dass wir als Salär eines einzigen Tages für das Pentagon jedem Verhungernden in Nordkorea 1000 Dollar in die Hand geben könnten, mehr als er in zwei Jahren regulär verdienen wird. Wir würden ein einziges Mal uns für das Elend der Menschen interessieren und glauben Sie, dass Nordkorea noch ein Schurkenstaat wäre, uns verfeindet?
Und wir könnten geradewegs so weitermachen: ein Dreihundertfünfundsechzigstel ist wirklich nicht zuviel verlangt. George Bernhard Shaw konnte vor 70 Jahren einmal sagen: „Ich höre immer wieder, dass mit der Bergpredigt keine Politik zu machen ist, aber versucht es doch wenigstens ein einziges Mal.“
Ein Dreihunderfünfundsechzigstel für ein Experiment!
Es war der Dalai Lama, der am 13. September vor zwei Jahren sagen konnte: Was da passiert ist, in New York und in Washington, ist eine große Chance für die Nichtgewalttätigkeit – „a big chance for non-violence“.
Er wollte sagen: wenn wir aus dem Grauen jetzt von mehreren tausend Toten die Weltgeschichte einmal umschreiben, wir treten aus dem Schlachthof heraus, wir weigern uns, die Blutmühle weiterzudrehen, wir setzen auf die Zusammengehörigkeit aller Menschen, dann müssten wir nur den nächsten buddhistischen Satz noch hinzufügen und christlich interpretieren - dass man den Dalai Lama vertrieb aus Tibet, ein Kind noch damals, gab man ihm mit auf den Weg: „Wohl Eure Heiligkeit gibt es Gutes und Böses“. Aber beides hat seine Ursachen.
Wäre es möglich, wir würden begreifen, dass wir zusammengehören? Wir würden plötzlich die riesigen Mittel, die wir zur Verfügung haben konvertieren im Kampf gegen die Ursachen des Krieges. Mein wirklicher Traum ist nicht, dass Herr Schröder jetzt zu diesem Krieg nein sagt. Ich betrachte das als einen schweren Fehler, dass man uns mit weiteren Lügen, wie zum Beispiel den Hufeisenplan durch Scharping und Fischer in den Krieg gegen Serbien und das Bombardement von Belgrad hineingeredet hat, dass man uns die Idiotie hat glauben lassen, wir müssten die Taliban exekutieren um am Ende die Frauen von dem Schleier endlich zu erlösen und die Männer von den Bärten.
Ein Jahr später ist von alldem nicht die Rede. Aber vielleicht können wir uns erinnern, wie man in Afghanistan die Menschen dort befreit hat. Eine kleine Episode, die im deutschen Fernsehen gezeigt wurde – Jamie Doren, ein Ire, hat sie mühsamst genug recherchiert – sie hat nie eine Diskussion ausgelöst, ich möchte aber, weil es den Krieg zeigt, wie er immer ist, ins Bewusstsein heben die Vorgänge von Dashti Laili. Man hatte die Nordallianz mobilisiert gegen die Taliban. Eine der Handlungen war, dass man über 3000 gefangene Taliban verladen hat in überhitzten Autos und sie zusammengeschossen hat durch die Wände – unter den aufsehenden Augen des US Militärs. Mehr als 3000 Gefangene einfach mal so getötet.
Dann müssen Sie Herrn Rumsfeld hören, Donald Rumsfeld, wenn er erklärt, auf Guantanamo, diese haben keine Rechte - das ist seit zwei Jahren.
Darunter ist zu verstehen, dass man Menschen seitdem an Händen und Füssen gefangen hält. Vor etwa fünf Monaten ging durch die Zeitungen, dass es eine Hafterleichterung gäbe: fünf Minuten dürften sie die Hände frei bewegen – fünf Minuten in der Woche wohlgemerkt. Das bedeutet, wenn Sie etwas Phantasie haben, dass sie sich einmal am Tage wenigstens den Hintern mit den eigenen Händen abputzen dürfen. So etwas nennt man Folter und natürlich gibt es keinerlei Kontrolle über die Haftbedingungen von gefangenen Taliban in Guantanamo. Ich vermute, dass man uns morgen als Beweise auftischen wird Folterprotokolle, die bei keinem Gericht durchgingen, aber die man uns als Wahrheit dann erklären wird, wie doch ausgesagt wurde: Verbindungen zwischen Al Quaida und Saddam Hussein.
Wenn das Gute, das wir uns einbilden zu verkörpern, uns vollkommen blind macht für das Elend, das wir den anderen zufügen, verhindern wir nicht das Böse, sondern wir werden selber die Bösen. Zum Krieg gehört der blinde Gruppenegoismus. Um Krieg zu führen müssen Sie sämtliche Begriffe der Menschlichkeit absolut setzen und gleichzeitig fragmentieren. Jenseits der Grenzen wohnt der Teufel, der zweite Hitler, ein Wahnsinniger, ein Unmensch und im Kampf gegen ihn ist alles, jedes Mittel richtig. Und er hat zu verantworten, das es gegen ihn eingesetzt wird. Wenn es so steht, werden die besten Absichten von Menschen korrumpiert zum Verbrecherischen. Man will und kann dann nicht mehr sehen, was man dabei anrichtet. Auf der einen Seite sagten wir eben, wir dürfen es gar nicht sehen, sonst könnten wir es nicht machen, auf der anderen Seite hängt man uns ein moralisches Schutzkleid über, das uns unempfindlich macht.
Vor einer Weile konnte man hören, wie ein russischer General erklärt: „Chechenische Kinder weinen ja wie die russischen!“ Ja, lieber Herr General, Kinder überall auf der Welt weinen ganz genauso. Überall auf der Welt werden Kinder von Müttern geboren, überall auf der Welt gibt es Menschen, die wissen, was Hunger ist, was Krankheit ist und was Elend ist und was Durst ist und was Erniedrigung ist. Und die Frage ist jetzt lediglich, ob wir die Verletzbarkeit unserer Seele und unseres Körpers, angesichts des möglichen Todes, benützen können, uns über den Gräbern hinweg die Hände zu reichen und den einzigen Feind zu bekämpfen, den wir alle haben: eben die Sterblichkeit - im Kampf fürs Leben, oder ob wir den Zynismus aufbringen, geduckte Sklaven der Angst, die wir dann sind, den Tod zu handhaben als Waffe gegen den anderen.
Wollen wir wirklich überleben als die effizientesten Killer auf den Schlachtfeldern? Soll das die Zukunft sein? Der Darwinismus in der schrecklichsten Form als Geschichtsphilosophie des 21. Jahrhunderts? Will man uns immer wieder verkaufen, dass wir überhaupt nur ein Recht hätten zu leben, wenn wir besser morden können, als jeder an unserer Seite? Will man uns dahin bestellen, dass Kain und Abel das Dauerschicksal der Menschheit sei? Dann hört man den Meistererklärer der islamischen Kultur, Peter Scholl-Latour, dass das Christentum selber lehrt, dass es die Erbsünde gibt und also weiß er für keinen Konflikt eine andere Lösung als den Krieg und die größere Aufrüstung und die Furchtbarkeit von allem, was geplant und begangen werden könnte.
Das Christentum, Herr Scholl-Latour, lehrt die Erlösung von der Erbsünde und es lehrt ihm Lehren von der Erbsünde: dass man Menschen ins Herz schauen muss, was in ihnen vorgeht, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie am Boden liegen, wenn sie nicht mehr weiter wissen; dann allerdings könnte jeder zeigen, dass selbst eine Ratte, die man in die Ecke drückt, der Katze in das Gebiss springen wird, um sich zu wehren.
Vermutlich wird es das sein, was wir Anfang März erleben werden und dann werden diejenigen, die sich wehren, als Verzweifelte für Kriegsverbrecher abgeurteilt werden, auch das steht schon in Aussicht.
Aber kann man die Waage von Gut und Böse so ungerecht handhaben?
Wäre es nicht an der einzig verbliebenen Weltmacht der Erde, abzurüsten als erste und zu sagen, es gibt ein Haufen von Dingen, die wir nie hätten erfinden dürfen, nie hätten herstellen dürfen, nie hätten lagern dürfen, nie hätten planen dürfen sie jemals anzuwenden?
Und dann stellen Sie sich vor, was wir allein in Deutschland hätten machen können, wenn wir 1989 auf Gorbatschows gehört hätten: Wiedervereinigung Deutschlands um den Preis des Austritts aus der NATO.
Nicht geduldet damals, wie üblich, von George Bush Senior und natürlich nicht akzeptiert von dem damaligen deutschen Kanzler. Den Plan gab es schon 1958 unter Rapatzki, dem polischen Außenminister, ein militärisches Disengagement in ganz Europa, zumindest von Polen, Ungarn, Tschechien bis hinüber zu den Beneluxstaaten, oder, wenn Frankreich mitmacht, gleich bis zum Atlantik.
Wie viele Ressourcen hätten wir im 20. Jahrhundert aufbringen können im Kampf gegen die Gründe, aus denen Kriege stammen. Seit 1989 30 Milliarden Euro jedes Jahr für einen absurden Spuk: für Transportflugzeuge, für Einsatzgeräte möglichst vom Nordkap bis in die Kalahari, der deutsche Soldat als Mann der Stunde zu jeder Winter- und Jahreszeit, allround verwendbar, wenn der amerikanische Verbündete uns ruft. Was hätten wir tun können seither?
Wir hätten ungefähr das Jahressalär der US-Armee, über 350 Milliarden Euro, beieinander. Mit einem Wort: wir hätten keine Staatsverschuldung mehr, wir brauchten nicht ein Drittel des gesamten Budgets im Bundestag für die Zinsenregulation der Altschulden aufzuwenden, wir hätten den Aufbau Ost und wir hätten endlich die Frontstellung den Ländern der Dritten Welt wirksam zu helfen.
Dazu würde gehören, dass wir eine Logik betreiben, die in Zukunft die einzige ist, unter welcher menschliche Geschichte vorstellbar ist: wir haben das Gewaltmonopol des Staates zur Befriedung der Bürger in gesicherten Grenzen, Abrüstung für jeden Einzelnen in geordneten Grenzen. Auf diese Weise haben wir vom alten Sumer bis in die Gegenwart, zumindest innenpolitisch, friedfertige Bürger geschaffen. Außenpolitisch haben wir an der Peripherie der immer größer organisierten Gruppen schlimmere Waffen noch gelagert und gehortet und damit die objektive Aggressivität immer noch gesteigert. Die weitere Entwicklung kann nur die einer Weltinnenpolitik sein und das bedeutet, wir müssen uns wehren dagegen, dass die USA nicht zögern, die mögliche Weltversammlung der UNO zu nichts weiter als zu der Maskeradenbühne ihrer Rechthaberer und Machtdurchsetzung zu erklären.
Die zukünftige Entwicklung kann nur so sein, dass wir beschließen, alle Einzelstaaten abzurüsten und eine Weltregierung zu schaffen, die internationale Konflikte dann gemeinsam reguliert – nicht fünf Nachfolgestaaten aus der Zeit des zweiten Weltkriegs dann säßen, als Zünglein an der Waage im Weltsicherheitsrat, sondern eine wirkliche Versammlung der Bevölkerung der Menschheit. Die alleine hätte internationale Konflikte zu entscheiden als Appellationsinstanz. Abrüstung aber von allen, bei den größten am ehesten begonnen.
Wollen wir der Menschheit Frieden, Freiheit und Wohlstand bringen, müssten wir umdenken im Ganzen – kein nationaler Egoismus mehr ist verträglich in einer weltinnenpolitischen Grundsituation von morgen mit Frieden, Wohlstand und Freiheit. Es ist das Ende, dass wir einen einzigen Staat imperialistisch die Hände auf den Globus ausstrecken sehen und wir sollten ihm moralisch auf die Finger hauen, indem wir deutlich erklären: nicht in unserem Namen – not in our name, Mr. Bush!
Dass es blauäugig sei, die Konversion der militärischen Stärke in friedfertige, dem Wohlstand der Menschen dienende Projekte umzuformen, sehe ich absolut nicht. Wenn es irgendeine Realität beschrieben gibt, ist es die der Bergpredigt. Gemeinsam die Güter der Welt zu teilen, Gewalt zu vermeiden durch offene Dialoge, und sich endlich zu fragen, was menschliche Größe sei – 10. Kapitel im Markusevangelium.
Die Mächtigen der Welt, sagt Jesus da, regieren herunter auf ihre Untertanen. Bei Euch sei das nicht so. Er will sagen, wenn Du Dich fragst, mitten im Leben, oder am Ende Deines Lebens, wozu es gut war, dass es Dich gegeben hat, werden Dir einzig einfallen die paar Momente, in denen Du die Hände ausgestreckt hast, den Hilflosen und Wehrlosen gegenüber.
Dies ist ein wirklicher Wahn zu hören, wie George W. Bush erklärt, mit religiöser Rhetorik, dass wir die ganze Macht der Vereinigten Staaten von Amerika aufbieten werden – „and in name of peace I say: we will win“.
„In name of peace“, kann ich nur sagen: wir werden alles verlieren, wenn wir Krieg führen. Das ist die Wahrheit. Es gibt keinen Krieg für den Frieden. Krieg ist Krieg.
Ich möchte endigen mit einem Manifest von 1930, unterschrieben von Albert Einstein, er konnte 1951 noch sagen: „Für mich ist das Töten im Krieg durch nichts verschieden vom ganz gemeinen Morden.“
Unterschrieben von Siegmund Freud, er konnte 1915 sagen: „Jetzt im Weltkrieg zeigt sich erst, dass die Staaten der Welt Mord, Verrat, Spionage, Hinterhältigkeit, Gemeinheit dem einzelnen Bürger nicht verbieten, um die Verbrechen aus der Welt zu bringen, sondern um ein Monopol darauf zu erheben, wie auf Zucker und auf Tabak.“
Unterschreiben von Bertrand Russel, der 1968 die Anklage gegen USA im Vietnamkrieg startete. Unterschrieben von Stefan Zweig, der sich das Leben nahm in Brasilien, weil er nicht mehr erleben wollte, dass man die Fahnen schwenkt über Millionen von Toten und sich noch getraut sich als Sieger vorzukommen.
Die ganze Tragödie des 20. Jahrhunderts nach dem ersten Weltkrieg bis hin zu Adolf Hitler wäre vermeidbar gewesen, hätte man wenigstens damals gesagt, als es erst 10 Millionen Tote waren, bei Ypern, bei Cambraix bei Verdun, als wir hunderttausende unserer jungen Leute in das Giftgas, in die Bajonette in die Sperrfeuerangriffe trieben, ein Massaker nach dem anderen haben wir alle in der industrialisierten Form des Sadismus unsere Menschlichkeit verloren, es gibt keine Sieger mehr, wir hätten eine endgültige Weichenstellung erreicht – das Manifest damals lautete:
„Die Wehrpflicht liefert die Einzelpersönlichkeit dem Militarismus aus, sie ist eine Form der Knechtschaft. Das die Völker sie gewohnheitsmäßig dulden, ist nur ein Beweis mehr für ihren abstumpfenden Einfluss. Militärische Ausbildung, Schulung von Körper und Geist in der Kunst des Tötens, militärische Ausbildung ist Erziehung zum Kriege, sie ist die Verewigung des Kriegsgeistes, sie verhindert die Entwicklung des Willens zum Frieden.“
Darum endige ich mit dem Testament von Wolfgang Borchert, sterbend in Basel, lungenkrank Zeuge dessen, was der Zweite Weltkrieg hieß: „Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und Dir sagen, Du sollst die Waffen segnen und den Krieg rechtfertigen, Pfarrer auf der Kanzel, sag nein.
Mutter, wenn sie wiederkommen und Dir sagen, Du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen als Krankenschwestern für die Hospitäler, Mütter der Welt, sagt nein.
Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und Dir sagen, Du sollst statt Rohrleitungen Kochgeschirre, Stahlhelme und Kanonenrohre ziehen, Mann an der Werkbank, sag nein, denn wenn Ihr nicht nein sagt, wird alles wiederkommen.“
Wir sagen heute zu diesem Kriege nein und zu jedem Kriege nein – not in our name!
Ich muss, obwohl es nicht dahingehört, einen Satz hinzufügen und das Anliegen erweitern:
Es gibt kein Tabun, kein Sarin, kein VX, es gibt keine Quälerei mit Dum-dum Geschossen und high-speed Guns, das man nicht hunderttausendfach, millionenfach erprobt hätte an den unschuldigen Körpern krankgemachter Tiere. Es gibt kein Übel, das man den Menschen auf den Schlachtfeldern zufügt, außer man hätte es losgelassen an Tieren, die mit dem Wahnsinn der Menschen nichts zu tun haben. Darüber redet niemand. Kein Mensch kontrolliert die unglaublichen Versuche, die das Militär mit Tieren durchführt. Wir können über Tierversuche für die Pharmaindustrie vielleicht noch diskutieren und Argumente dafür und dagegen abwägen, beim Militär kann man nur sagen, man will nicht länger sehen, wie man Tiere quält, damit man noch viel effizienter Menschen quälen kann. Im Übrigen hat Tolstoi recht: Solange wir Schlachthöfe haben, solange wird es auch Schlachtfelder geben. Mitleid ist unteilbar.
http://konstantin.wecker.bei.t-online.de/drewermann%20rede%2…
Ich danke Ihnen für das Engagement, mit dem wir zeigen wollen, dass wir gegen diesen Krieg sind, den die Bush Administration seit August vorigen Jahres als fertigen Plan beschlossen zu haben scheint und dass wir gegen jeden Krieg sind.
Wir sind gegen diesen Krieg, weil Edward Kennedy Recht hat, wenn er sagt, „das ist der falsche Krieg zum falschen Zeitpunkt“.
Noch nie in der Vergangenheit hat man erlebt, dass, wie die Katze langsam sich ans Mauseloch heranschleicht, eine Großmacht förmlich ringt um Gründe und Vorwände zu finden oder vorzutäuschen, um endlich denn doch mit schwankenden Zustimmungen in der Weltbevölkerung ein Land der dritten Welt in die Steinzeit zurückzubombardieren.
Man erzählt uns, dass dieser Krieg unvermeidbar sei, und angelangt bei der Nichtigkeit aller vorgegebenen Begründungen, liest man in den letzten Tagen immer wieder, dass George W. Bush überhaupt nicht mehr zurückkönne nach dem Aufmarsch von über 100.000 amerikanischen Soldaten, denn er verlöre dann sein Gesicht.
Ich frage allen Ernstes, wann ein Mensch sein Gesicht verliert: wenn er sich die Fratze mit Blut beschmiert oder wenn er endlich darauf sinnt, wie er reden kann, um Kriege zu vermeiden.
Was eigentlich halten wir für „groß“ in der menschlichen Geschichte?
Denjenigen, der sich immer noch damit brüstet, dass er als Repräsentant der einzig verbliebenen Weltmacht dieser Erde über eine Tötungskapazität verfügt, wie sie in der Geschichte der Menschheit niemals angehäuft wurde? Oder nennen wir groß jemanden, der im Stile Mahatma Gandhis rundum erklärt: „Friede ist niemals das Resultat von irgendetwas – es ist allein der Weg. Und wer nicht mit dem Frieden anfängt, kann nicht beim Frieden endigen“.
In Folge dessen müssen wir uns verwahren gegen einen ganzen Sack voll Lügen, aus dem man offensichtlich immer noch glaubt, am Ende die Wahrheit destillieren zu können. Es ist eine Lüge, wenn wir reden hören von einem Militärschlag gegen den Irak. Krieg ist kein Militärschlag –etwas, das man eben mal austeilt, wie eine Lektion, die jetzt Bagdad erteilt werden soll.
Diese Sprache ist echt amerikanisch seit 1945. Am Abend des 6. August, nachdem Hiroshima mit über hunderttausenden Toten zurückgelassen worden war, konnte Harry Truman auf dem Flugzeugträger seinen Boys verkünden: „Jungs, wir haben ihnen einen Ziegelstein auf den Kopf geschmissen“ und der Weltöffentlichkeit wurde erklärt, dass man den Japsen eine Lektion erteilt habe.
Auch Bush Senior wollte Saddam eine Lektion erteilen mit dem zweiten Golfkrieg. Und nun sind wir wieder dabei, eine dritte Lektion zu erteilen.
Der Massenmord von hunderttausenden von Menschen ist für jedes denkende Gemüt die falsche Lektion – zu jeder Zeit und zu aller Zeit.
Man erklärt uns, dass der Aufmarsch am Golf jetzt dazu diene, Hussein eine letzte Chance zu geben oder den Druck auf ihn zu erhöhen. Wenn das so wäre, hätte Blix vollkommen Recht: der CIA hätte längst die genügenden Informationen zum Nachprüfen liefern müssen, damit eine faire Chance bestünde. Saddam Hussein hat vor etwa drei Wochen aufgefordert, dass die CIA sich selbst im Irak bedienen könne, sie könne alles was sie vermute selbst kontrollieren. Natürlich ist das Angebot nicht angenommen worden. Es soll überhaupt keine Chance geben – nicht für das Regime von Saddam Hussein.
Die Gründe dafür aber sind mehr als an den Haaren herbeigeholt. Der Vollständigkeit wegen müssen wir sie nur rekapitulieren:
Saddam Hussein ist dicht dabei eine Atombombe zu bauen oder schon im Besitz einer Atombombe oder bei der Verfügung über spaltbares Material in einem halben Jahr, so Donald Rumsfeld, imstande eine Atombombe zu bauen.
Condolezza Rice konnte letztes Jahr erklären in der Sprache, die sich George W. dann zu eigen machte: „Wenn wir den Atompilz sehen, ist es zu spät zu beweisen, dass Saddam Hussein eine Bombe gebaut hat, wir müssen ihm zuvorkommen.“
Das alles ist erkennbar Unfug und wird selbst in der Propaganda der USA nicht mehr verwandt. Es gibt keine Atombomben im Irak und es hätte nicht einmal 1991 die Fähigkeit bestanden, Atombomben zu bauen, nachdem die Meiler von den Israelis früh genug bombardiert wurden.
Bleiben biologische und chemische Massenvernichtungswaffen. Scott Ritter, der von 1991-98 die Inspektionen geleitet hat, erklärt definitiv: „dass man an chemischen Waffen vernichtet hat in den Fabriken, alles was vorhanden war, und dass eine Kapazität zum Nachrüsten unbemerkt nicht bestehen kann“. Sein Hauptargument: „Es gibt keine geheimen Lagerungen mehr von Sarin, von Tabun und VX.“ Das simple Argument: „Länger als fünf Jahre lagern sich chemische Waffen dieser Art nicht.“ Es ist im Übrigen zu diskutieren, ob VX jemals von den Irakis stabilisiert werden konnte. Bei den chemischen Waffen ist noch deutlicher, dass der Irak aus eigenen Mitteln nicht herstellen könnte, was an seinen Rändern allerdings in den Händen fast allen Staaten angetroffen wird. Manch einer wird sich noch an den Flugzeugabsturz einer El-Al Maschine über Amsterdam erinnern, mit den Folgen vieler ungeklärter Todesfälle. Mit Sicherheit ist davon auszugehen, dass an Bord dieses Zivilflugzeuges die Komponenten für das Giftgas Sarin nach Israel gebracht wurden. Das geht durch seit Jahrzehnten, es soll aber ein Kriegsgrund werden gegen den Irak von Saddam Hussein.
Die biologischen Waffen sind auf geradewegs zynischem Weg in den Irak gekommen. Man macht sich heute Sorgen über Anthrax, über Milzbrandbazillen. Wenige wissen vielleicht, dass 1945 Churchill dabei war, zu diskutieren, ob man Milzbrand nicht gegen Nazi-Deutschland einsetzen könnte. Fakt ist, dass im Dezember ´83 kein Geringerer als Donald Rumsfeld im Gespräch mit Saddam Hussein dafür gesorgt hat, dass der Irak Anthrax bekommt. Er stand damals als Kettenhund der Amerikaner im Kampf gegen die Ajatollahs, in einem Krieg, der in acht Jahren etwa fünfhunderttausend Menschen auf Iranischer und Irakischer Seite das Leben gekostet hat. Man wirft heute Saddam Hussein vor, dass er Giftgas benutzt hat. Was man nicht sagt ist, dass das Giftgas zum Teil geliefert wurde aus dem Westen und dass es die Unterstützung der Amerikaner fand im Krieg gegen den Iran bei der Rückgewinnung der Insel Phau im Persischen Golf, genau dieses Giftgas in Mengen gegen die Iraker einzusetzen. Die Inspektoren später konnten es finden, wie man Atropin zur Stützung des Kreislaufs der eigenen Soldaten eingesetzt hat. 1988 war es, dass Saddam Hussein das Giftgas einsetzte gegen die Kurden, bei Halabja, mit der Folge von etwa 5000 Toten. Alles was wir heute sagen, ist alles andere als eine Rechtfertigung der Morde die der Irakische Diktator im Irak zum Leiden seiner Bevölkerung heraufbeschworen hat und die den Straftatbestand von Kriegsverbrechen allemal erfüllen.
Aber die Parteilichkeit, mit der wir, je nach Laune, wenn die Kriegsverbrechen den USA nützen, für richtig und notwendig finden, und wenn am Ende der Krieg vorbei ist, wir erklären, dass wir sie zu rächen oder sie zu beseitigen hätten, ist eine janusköpfige Moral der Verlogenheit. Entweder ist das Morden von Menschen mit Giftgas – das Ausrotten von Menschen mit Volksseuchen in sich selber - ein Übel, dann aber stehen alle Staaten in der Pflicht, sich dieser Mittel zu entledigen, angefangen bei denen, die davon am meisten haben.
Im amerikanischen Senat konnte Richard Pearle, den manche Amerikaner den Fürsten der Finsternis nennen, aber der als Sicherheitsberater eine Menge zu sagen hat, erklären, dass der Irak über Waffen verfügt, deren Schrecklichkeit wir uns überhaupt nicht vorstellen können.
Lieber Herr Pearle, wenn Sie etwas von Sicherheit und von Rüstung verstehen, wäre es das Allereinfachste, Sie ließen sich einladen ins Pentagon oder Sie bestellten mindestens den Waffenkatalog für die internationalen Waffenhändler, die in den USA zum Verkauf anstehen und Sie wüssten, was für unvorstellbar scheußliche Mittel die Vereinigten Staaten von Amerika produzieren und im ganzen 20. Jahrhundert in keiner Sekunde gezögert haben anzuwenden.
Fast möchte man denken mit Nelson Mandela, der für die Aussöhnung zwischen Schwarz und Weiß den Friedensnobelpreis bekommen hat:
„Die USA haben die schlimmsten Kriegsverbrechen in der Geschichte der Menschheit verübt und es missfällt mir, dass ein Mann, der nicht richtig denken kann, dabei ist, die mächtigste Macht der Welt in den Abgrund zu führen.“
Es bleibt das Argument, dass wir vermutlich morgen durch Abhören von irgendwelchen Telefonaten aufgetischt bekommen werden, dass der Irak Saddam Husseins Kontakt habe zu Al-Quaida. Alle, die von der Lage im Nahen und Mittleren Osten etwas wissen, können diese Argumentation nur absurd finden. Die Bath-Partei Saddam Husseins ist eine völlig säkulare Gruppe. Sie hat sich an die Macht gebombt und gemordet, durch Unterdrückung und Ausrottung gerade der fundamentalistischen Kräfte des Islam im Irak. In den Augen von Leuten wie Osama Bin Laden stünde der irakische Präsident und Diktator ganz in der Nähe des absolut Bösen - eben deswegen. Wahabitische Koraninterpretation wird nicht geduldet im Irak. Wenn es darum ginge, wäre und ist der Verbündete der Amerikaner Saudi Arabien wesentlich gefährlicher als der Irak.
Gründe dieser Art können es nicht sein. Zu vermuten steht deswegen, dass man wieder mit Lügen Motive schaffen möchte, für die natürlicherweise keine vorhanden sind, und das hat eine lange Geschichte:
Eintritt in den Vietnam Krieg – erfunden wurde der Tonking Zwischenfall unter Gerald Ford.
Eintritt in den ersten und zweiten Golfkrieg – das Versprechen an Saddam Hussein, das Ajatollah Regime würde zusammenbrechen beim ersten Stoß auf den tönernen Götzen der islamischen Revolution.
Dann aber, 1991, wirklich übel: die Friedensbewegung stand zu Tausenden in den deutschen Städten im Vorlauf zu dem Krieg. Sie wurde beinahe neutralisiert mit einer Propagandalüge, die man mit 15 Millionen Dollar in London gekauft hatte, dem amerikanischen Senat vorspielte und von Bush Senior in 40 Reden und über CNN weltweit immer wieder als Argument verwandt wurde: Irakische Soldaten in Kuwait reißen aus den Brutkästen Kinder, werfen sie auf die Erde und ermorden sie. Sagen Sie selber: muss man gegen Menschen, die Kinder morden, nicht einschreiten mit allen Mitteln? Darf man dem Teufel auf Erden freie Hand lassen? Dagegen muss man notfalls militärisch angehen. Der Notfall ist eingetreten und also werden wir dagegen angehen.
In der Friedensbewegung waren wir wie gelähmt, denn eine gewisse Logik liegt in dieser Beweisführung. Wenn Männer in den Krieg gehen, hochmotiviert, dient es fast immer dem Schutz von Unschuldigen, dem Schutz von Frauen und Kindern. Man muß dieses Motiv, weil es archaisch genug ist in der Geschichte der Menschheit, wirklich erst nehmen.
Die Wahrheit aber ist, wir schützen nicht Frauen und Kinder, wenn wir in der modernen Kriegsführung genau das tun. Wir ermorden Frauen und Kinder. Das, was eben gesagt wurde, eine Embargopolitik seit 1991 bis jetzt, die nach unabhängigen UNO-Schätzungen und nach dem Votum von Sponek, dem Leiter der Aktion „Food for Oil“ bis vor zwei Jahren, monatlich im Irak an Folgen der Embargopolitik etwa 3000 bis 5000 Menschen unschuldig dahinrafft, ergibt die unglaubliche Zahl, bis heute, von mehr als einer Million Toten, vornehmlich Frauen und Kinder - Marginal ein nie beendeter Krieg. Auf solche Weise schützt man nicht Frauen und Kinder, auf solche Weise mordet man Frauen und Kinder. Man verhindert nichts Böses, man tut es in der schlimmsten nur denkbar ausgeprägten Form.
Fragen müssen wir aber, was das denn für ein Embargo ist, bei dem mehr als eine Million Menschen elendiglich krepieren, das aber unfähig sein soll, Waffenkomponenten für Giftgas, für Chemikalien und Ersatzteillager für Raketen über die Reichweite von 150km in den Irak zu schmuggeln.
Richard Pearle ist es, der sagen konnte, noch vor einem halben Jahr: „Alles, was sich auf Erden bewegt, können wir sehen und alles , was wir sehen können, können wir zerstören.“
Es gibt kein Land der Erde, das seit zwölf Jahren so gründlich nicht überwacht würde, wie der Irak – mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Es gibt keine Armee mehr, die auch nur annähernd die Stärke der irakischen Militärmaschinerie von 1991 aufwiese. Alles was man uns vor Augen stellt, ist die Erwartung geradewegs des Pentagon, einen kurzen Krieg zu führen. Wenige Wochen – lang darf er nicht dauern. Aber genau indem man das sagt, erklärt man doch, dass der Gegner außerordentlich schwach ist und beides geht nun nicht in eins: der Welt zu suggerieren, dass sie von einem furchtbaren Gegner bedroht wird, der unendliche Möglichkeiten zum Bösen hat, den Zwergen also zum Riesen zu erklären, nur um endlich draufschlagen zu können. Es gibt die Idee von Paul Wolfowitz, dem Mann der militärisch hinter den meisten Plänen steckt, die jetzt ausgeheckt werden. Seine Vision lautet, verkündet durch George W. Bush, dass der kommende Krieg im Nahen Osten Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und Demokratie tragen wird. Genau das wird nicht sein, Herr Wolfowitz.
Erstens: die Demokratie – wenn sie wäre – Freie Wahlen im Irak würde sie dahin führen, dass die Schiiten an die Macht kämen. Es gäbe eine Fusion des Iraks mit dem Iran. Keine Bush-Administration könnte sich das Szenario in dieser Zukunft wünschen: Die Erdölfelder im Nahen Osten in den Händen islamischer Fundamentalisten – es wäre die erste Folge einer demokratischen Wahl im Irak.
23 Prozent der Bevölkerung im Irak gehören den Kurden an. Eine demokratische Wahl liefe darauf hinaus sie endlich selbständig zu machen. Was ist das für eine Politik, die einem Volk von 17 Millionen Menschen und 3000 Jahren Kulturgeschichte, den Kurden, bis heute die Selbständigkeit verweigert, verstreut in drei Ländern, darunter dem NATO-Staat Türkei ?
Was bleibt, sind die etwa 17 Prozent sunnitischer Bevölkerung. Die haben die Macht im Irak errungen mit diktatorischen Mitteln – freie Wahlen hat es nie gegeben und eine Regierbarkeit des Irak unter den Bedingungen der Grenzziehungen der Kolonialzeit ist sehr schwer vorstellbar.
Wollten wir einen Weg zur Demokratie, müsste er langsam verlaufen, er würde damit beginnen, das wir das irakische Volk, 20 Millionen Menschen, aufhören mit einem Einzelnen zu verwechseln. Das irakische Volk hungert, das irakische Volk leidet, das irakische Volk möchte nichts anderes als Menschen sonst auch: in Frieden leben – und dafür könnten wir sorgen.
Diktatoren herrschen durch die Angst und würden wir sie auflockern, hätte Saddam Hussein weit weniger Macht, als er heute besitzt. Es ist aberwitzig, mit Angst von außen zu glauben ein Volk in die Opposition treiben zu können. Vielleicht hätten wir in Deutschland an dieser Stelle wirklich ein wenig Erfahrung den Amerikanern zu bieten. Die Deutschen waren, ob Nazis oder nicht, in keiner Zeit des sogenannten zweiten Weltkriegs dichter um den Führer geschart als bei den Massenbombardements gegen die Großstädte Deutschlands. Wenn das Leiden ein bestimmtes Maß überschreitet, werden Menschen sich verhalten wie eine Rinderherde: sie werden zusammengehen und sich um den Stärksten scharen. Der Effekt hat durchaus eine Parallele: bis zum 11. September gab es viele Gazetten, die meinten, George W. Bush sei jemand, der noch bis 1991 die Taliban verwechselt hätte mit irgendeiner Rockgruppe, oder dem nicht ganz klar war, dass sogar in Brasilien Neger existieren, fast so viele wie in den USA. Man zweifelte daran, ob George W. Bush, jenseits von Texas mit Bewusstsein irgendetwas aufgenommen hätte. Seit dem 11. September sind die Dinge klar: man schart sich um den Führer – 90 Prozent der Zustimmung zum Krieg, so wird in den Medien zumindest behauptet. Würde man dem irakischen Volk Möglichkeiten zu seiner Regeneration wirtschaftlich, kulturell – politisch vor allem – geben, würde man das Land aus seiner Isolation herausführen, verlöre Saddam Hussein von alleine die Macht und es wäre langsam, vielleicht im Verlauf von vielen Jahren, ein ernstzunehmender Demokratisierungsprozess in dieser Region einzuleiten. Stattdessen glaubt uns kein Mensch den Demokratiewillen, wenn wir anachronistische Regime wie in Kuweit, wie in Al Quatar, wie in Saudi Arabien unterstützen bloß um dort die Machtbasen des US-Imperialismus aufzubauen.
Sagen wir es offen, jenseits allen Propagandarummels: dieser Krieg wird geführt einzig für Öl. Drei Fünftel des Erdöls liegt am Persischen Golf und darum geht es. Wie Putin sich verhalten wird, mit dem man gerade über Murmansk neue Erdölgeschäfte abzuschließen gedenkt, auf Seiten der Amerikaner. Vielleicht ist Erdöl das, was die Welt im Ganzen regiert, nicht mehr Verstand, nicht mehr Menschlichkeit. Vielleicht ist es richtig, daran zu erinnern, dass mit Harry Truman 1948 bereits sich ein Denken verbunden hat, das George Kennan damals, als Vordenker der USA, auf den Begriff brachte. Die amerikanische Bevölkerung vertritt 6 Prozent der Welt, hat aber den Besitz von 50 Prozent des Reichtums der Welt. Daraus geht natürlicherweise hervor, dass man auf uns neidisch ist und uns vielerorts hasst.
In dieser Situation müssen wir danach trachten, den Zustand zu bewahren, mit Rücksicht auf unsere eigenen Sicherheitsinteressen. Von daher können wir uns den Luxus gut gemeinter humanitärer Ideen wie Demokratisierung, wie Wohlstand, die Humanität im Ganzen und die Menschenrechte nicht länger leisten. Wir werden uns bemühen müssen, möglichst klar und zweckrational unsere Interessen international zu vertreten. Das allerdings geschieht – seit jetzt 50 Jahren. Nur sollten wir klar und deutlich sagen: Menschenblut ist zu schade für das Geschmier aus Öl. Immer noch sind Menschen wichtiger als die schmutzigen Hände von 6 Erölkonzernen.
Es wäre auch nicht ganz schlecht, Herrn Aznar in Spanien zu sagen, der jetzt sich so begeistert gibt für den Krieg der USA am Golf, dass er sich um das Erdöl vor der Galizischen Küste mehr kümmern sollte, als um das am Golf.
Leider sind wir in Europa noch nicht soweit, dass wir eine einheitliche Stimme aus der einheitlichen Erfahrung hätten. Es sind Völkerrechtler, die uns heute sagen: die Auslösung eines Präventivkriegs durch die vermeintlich einzige zurückgebliebene Weltmacht der Erde lässt uns zurückfallen in einen Rechtszustand am Ende des 30-jährigen Kriegs von 1648:
Das Einmischungsrecht in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates - null und nichtig, anerkannte Verträge - null und nichtig. Desillusionierung und Hypnotisierung durch vermeintliche Gegner, deren Waffenbesitz nicht einmal nachgewiesen ist, den man aber töten muß, weil sie uns gefährlich werden könnten. Ja sollen wir denn in der Welt jedem Paranoiker jetzt erlauben, seinen Nachbarn zu ermorden, weil er von denen ermordet werden könnte? Wann denn hört die Spirale der Angst und des Terrors auf?
Gott sei Dank, dass sich zum erstenmal eigentlich seit 1945 sogar die Kirchen, sogar die katholische Kirche klar gegen einen Krieg ausspricht.
Es war Johannes XXIII., der angesichts des Wettrüstens die Menschheit beschwor, sie möchte diesen Wahnsinn sich endlos in immer schrecklichere Todeskapazitäten hineinzurüsten, aufgeben, indem sie es lerne, statt der Angst der Liebe zu folgen. Das sind Botschaften, die über 40 Jahre alt sind.
Im Grunde gibt es zu keinem einzigen Punkt, der eine Rettung sein könnte, wirklich Neues zu sagen. Wörtlich steht das alles in der Bergpredigt.
Aber schildern wir lediglich, warum wir nicht nur gegen diesen Krieg am Golf sondern gegen jeden Krieg sind. Dann gibt es ein paar Punkte, auf die wir vor allem psychologisch hinweisen müssen:
Ins Gespräch kam der Bunker von Al-Merija mit über 450 Toten. Schildern wir die Geschichte nur so, wie sie sich abgespielt hat:
Irgendjemand auf einem amerikanischen Flugzeugträger am Golf lässt seine Finger über einen Computer gleiten und programmiert damit eine Tomahawk-Rakete – um genau zu sein zwei Tomahawk-Raketen mit dem Zielangabe Al-Merija. Davon soll die erste Rakete den Eingang blockieren und die zweite Rakete durch die Betondecke sich hineinbohren, so dass niemand aus dem Bunker, gleich wer darin ist, entkommen kann.
Stellen Sie sich vor, dass solch eine Handlung möglich ist, weil wir sie vollkommen emotionslos fertig bringen. Wir haben nicht die mindeste Vorstellung über die Wirkung dessen, was wir zum Programm erheben.
In etwa 500 Meilen Entfernung wird irgendetwas passieren, dass unsere Augen eigentlich gar nicht zu sehen bekommen.
Dies ist die Möglichkeit überhaupt, meinte vor 35 Jahren der Verhaltensforscher Konrad Lorenz, dass wir diesen Wahnsinn, den wir Krieg nennen, überhaupt durchführen können.
Würden wir wirklich sehen, was wir anrichten, wir würden vor lauter Entsetzen nicht mehr imstande sein, das was die Militärs uns auftragen auszuführen.
Setzten Sie nur die Bedingung, wie sie vis-a-vis erfolgen würde. Wir würden irgendeinem amerikanischen GI sagen: „Nimm Deine Maschinenpistole, geh auf den Bunker in Bagdad los, schieß da hinein und laß niemanden entkommen. Du bist dafür verantwortlich, dass niemand entkommen wird.“
Jemand, der imstande ist, vis-a-vis aus seiner Maschinenpistole 450 wehrlose Menschen zu ermorden, hätte aller Wahrscheinlichkeit nach die Psychologie eines Massenmörders und gehörte ganz sicher nicht in irgendeine Armee hinein. Aber genau diese Massenmorde können wir vollkommen skrupellos vollbringen, weil wir überhaupt nicht sehen, was wir tun. Daran liegt es, dass man uns CNN Spiele vorführt, um die Augen und Ohren als erstes zu täuschen und die Nerven, die Rezeptoren des Elends zu betäuben. Wir sollen überhaupt nicht wissen, was gemacht wird. Wir sollen hinterher die Fahne schwenken, wie nach dem zweiten Golfkrieg 1991 – mit 60 Millionen Dollar gesponsert schon wieder von der Waffenindustrie.
Die Lehre des Vietnamkriegs war, dass normale Zivilisten einen Krieg nicht länger dulden, wenn sie jeden Abend sehen, wie unsere Jungs und unsere Panzer durch brennende Bambusdörfer rollen, wie bei einem Napalmangriff bei 1200 Grad Celsius Menschen wie lebende Fackeln verbrennen auf der Straße nach Plei-Qu, Kinder da sind, die ihre Kleider verloren haben und ihre Eltern nicht mehr finden. Irgendwann wird ein Mensch, soweit er fähig ist zu fühlen, laut schreien und sein Schrei wird lauten: „NEIN“. Und dann allerdings wird man wissen, dass man all dies nie hätte beginnen sollen.
Wir brauchten eine Intelligenz, die sich selber reflexiv ist, hat Konstantin Wecker gesagt – vollkommen richtig. Wir müssten aber die Reflexion verknüpfen mit der Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen, denn die schlimmsten Verbrechen im 20. Jahrhundert – und ich fürchte im 21. – sind möglich, weil man einen Verstand trainiert, dem man das Fühlen abgewöhnt.
Was ich da sage, ist keine Nebensache. 1945 fanden amerikanische Militärpsychologen, dass es den GI’s normalerweise schwer fiel, beim Anblick des Weißen im Auge des Gegners augenblicklich durchzuziehen um ihn zu töten.
15 Prozent der GI’s taten das ohne jeden Skrupel. Alle anderen aber zögerten und die wenigen Bruchteile der Sekunden des Zögerns konnten entscheiden über Leben und Tod. Also musste man die Sache verbessern.
Im Koreakrieg 1952 stand man bereits bei über 50 Prozent, beim zweiten Golfkrieg 1991 garantierte die Admiralität für 90 Prozent voll verwendungsfähiger GI’s. Sie legen Typen um, sie neutralisieren, eliminieren, sie töten überhaupt nicht mehr, sie schalten ab. Nur auf diese Weise ist der Zynismus möglich, dass man am Ende mit dem „Red Star“ Leute auszeichnet, die mit gepanzerten Bulldozern sich die Arbeit des Tötens gleich ersparen und zum Beerdigen übergehen.
Über 8 Kilometer Länge zum Beispiel – Ramsey Clark listet das auf in seinem Buch „Wüstensturm“ - werden irakische Soldaten begraben bei lebendigem Leibe. Ausgezeichnete Handlungen amerikanischer GI’s!
Gefühle oder Skrupel sind unerwünscht, um so etwas tun zu können. Und noch viel schlimmer. Man trainiert unsere Jungs, 18 Jährige, ganz normale Bürger, die gerade aus der Schule kommen, rund um den Globus, bei jeder Soldateska in jedem Militär dazu, auf Befehle zu reagieren, wie wenn es Pavlowsche Hunde bei einem Reflex wären. Auf Befehl ist zu tun, was gesagt wurde.
Das schlimmste Beispiel, das mir in Erinnerung ist, stammt aus dem Jahre 1995, auf RTL. Damals befragt Günter Jauch im Abstand von 50 Jahren den Bomberpiloten über Nagasaki, Major Sweeney, was er sich gedacht habe seit dem 9. August. Er hat, zusammen mit Major Tibitts, mehr Menschen getötet, als in der ganzen Geschichte der Menschheit sonst: 80.000, 100.000 Menschen in wenigen Sekunden. Drei Generationen später immer noch werden Frauen Kinder zur Welt bringen, die nichts weiter sein werden, als schmerzempfindendes Fleisch ohne Bewusstsein.
Zwölf Jahre danach noch werden Menschen an Strahlenkrankheiten, Leukämie, Krebs zugrunde gehen, elend.
„Was, Major Sweeney, haben Sie sich gedacht in all den letzten 50 Jahren – Sie waren damals noch nicht einmal 25 Jahre alt?“
Major Sweeney antwortete sinngemäß und in der Betonung korrekt wiedergegeben: „Was Sie da fragen – Befehl ist Befehl – jeder Soldat der Welt hätte genau dasselbe getan, außerdem war der verdammte Krieg wohl dann zu Ende“.
Erstens Lüge, Major Sweeney, der Krieg war zu Ende. Die Amerikaner wollten nicht mehr die Japsen besiegen, sie wollten den Sowjets zeigen, dass sie das Nachfolgeimperium der Japaner im Pazifik antreten würden.
Aber das viel Schlimmere: in gewissem Sinne hat der amerikanische Soldat Recht – jeder Soldat der Welt würde genauso handeln.
„Befehl ist Befehl“ –was man ihm nicht beigebracht hat, ist, dass man 1945 in Nürnberg – gerade die Amerikaner – den Nazigrößen gerade diesen Satz zum Vorwurf machten.
„Befehl ist Befehl“ – genügt das eigentlich, sich als Soldat einen Stahlhelm über das Gehirn zu schieben und das Denken einzustellen, eine Uniform sich überzuziehen um dann in den Walhallsaal der Geschichte einzutreten?
Und man gibt dabei das persönliche Gewissen an der Garderobe ab um funktionsfähig zu werden.
„Was wart Ihr denn für Menschen?“ wollte man in Nürnberg wissen, als Ihr Euch als Person völlig ausgeschaltet habt. Ihr wolltet nur noch zuständig sein für die Ausführung des Befehls, für den Inhalt überhaupt nicht.
Brennende russische Dörfer – am Ende 25 Millionen Tote allein auf der Seite der sogenannten Slawischen Untermenschen.
„Was habt Ihr Euch gedacht?“ – Das wollte man wissen. Aber die Frage kehrt zurück an jeden, der Krieg führt und mitmacht. Das Töten von Menschen ist kein Job, man bringt das nicht hinter sich. Die Frage, die aus den Büchern jetzt hervorgeht – von Jörg Friedrich „Der Brand“ – ist eigentlich nur die Umkehrung derselben Frage: „Darf man das: Ganze Städte in Feuersäulen verwandeln?“ Man muss sich das Ganze nur vorstellen aus der Perspektive der Betroffenen. Was passiert, wenn der Beton eines Bunkers wie glühender Stahl in einem Ofen wird? Soll man in Erinnnerung rufen, 27. Juni 1943, als Admiral Harris das „round the clock bombing“ für die Operation Gomorrah über die Hansestadt Hamburg einleitete – ein biblisches Gericht. 43.000 Tote in einer Nacht in Hammerbrook – das war nicht genug. Dieser Tage konnten Sie einen britischen Bomberpiloten sehen, alt geworden, Mace mit Namen: „ Ich werde diese Bilder nicht vergessen, diese Dante’sche Hölle, die wir bereitet haben. Es lag unter uns wie schwarzer Sand, bedeckt mit Diademen von Feuer. In dieser Nacht wurde ich Pazifist.“
Was eigentlich darf man tun mit Menschen? Über wie viel Leichen glaubt man eigentlich klettern zu müssen, um dem Leben zu dienen? Durch wieviel Blut vermeint man waten zu müssen, um die Friedenstaube am Ende herbeizurufen?
Die Idee, dass man auf manichäische Weise die Welt einteilen könnte in das radikal Gute und das radikal Böse, ist ein Fundamentalismus aus dem alten Persien. Man kann Mythen weise übersetzen, aber dann muss man aufhören, sie geschichtlich aufführen zu wollen, sonst holt man den Kampf zwischen Michael und dem Satan auf die Erde und man hat die Hölle auf Erden.
Man bekämpft ja nicht das Böse auf diese Weise, zum Zwecke es zu überwinden. Man hält sich im Vorlauf der Rüstung für fähig, jedes denkbare Grauen in die eigene Praktik zu übernehmen. Der andere könnte Giftgas entwickeln, also stehen wir in der Pflicht, es selber zu entwickeln. Der andere könnte Atombomben entwickeln, also werden wir in der Pflicht sein, die schlimmeren Atombomben zu haben, Wasserstoffbomben zu haben, Neutronenbomben zu haben, Star-Wars Programme zu starten. Wir können niemals teuflisch und scheußlich genug sein um jeden möglichen Fiesling und Scheußling selber in die Knie zu zwingen.
Alles Böse, das wir dem anderen zutrauen, müssen wir im Vorlauf moralisch genehmigt, militärisch organisiert und praktisch trainiert haben. Und genau das geschieht auf den Kasernenhöfen aller Welt. Daran liegt es, dass solange es das Militär gibt, und den Handelnden der Krieg vorkommt als eine Option ihres Pragmatismus, der Wahn des Kriegs wie eine Hydra die Kultur umklammert und leersaugt wie ein Vampir. Es kann einen kulturellen Fortschritt solange nicht geben, als wir immer noch die 18 Jährigen daran gewöhnen, dass es die Normalität sei, auf diese abscheuliche Weise für ihr Vaterland die Pflicht zu tun: Krieg sei der Ernstfall – genau das ist er nicht! Er ist immer noch scheinbar ein Spaßvergnügen für alte Herren im Pentagon.
Kein Mensch hätte von Donald Rumsfeld, dem 70-Jährigen, geglaubt, dass er in der Politik noch mal eine Rolle spielt. Das Einzige, was er zu sagen hat ist Krieg - mit vollem Zynismus.
Der Ernstfall wäre der Frieden, aber wann ist von ihm die Rede? Der Weg zum Frieden stünde uns scheunentorweit offen. Ein paar Wege wären zu gehen. Natürlich stehen wir hier auch um unserem Bundeskanzler Schröder dabei den Rücken zu stärken, dass er erklärt: „Krieg darf nie mehr als eine fast normale Handlungsweise der Politik erscheinen“. Genau das scheint man in der Vereinigten Staaten zu glauben. Es ist sogar die Frage, ob der Krieg als äußerste Möglichkeit geduldet werden könnte.
Seit wann ist das Totschlagen von Menschen mit den Gesetzen der Zivilisation in Übereinstimmung zu bringen?
Nehmen wir einen absurden Parallelfall: Krieg ist, sobald sich der Name ausspricht, ein Rückfall in die Steinzeit um Jahrtausende zurück, parallel zu den Praktiken des Kannibalismus. Selbst wer sagt, Krieg ist als äußerste Notwendigkeit denn doch noch vorzubereiten, noch nicht ganz in unserer Geschichte auszuschließen, bewegt ein solcher sich nicht auf einer Logik, die etwa so lauten würde: Weil sich die Hungersnot global nicht total ausschließen lässt, weil sie immer noch möglich ist, müssen wir für den äußersten Ernstfall des Verhungerns großer Menschengruppen den Kannibalismus organisieren und vorbereiten, ist das mit irgendeiner zivilen Logik in irgendeinem vernünftigen Staat zu machen?
Aber wenn es den Notfall gibt, müssen wir wie eine archaische Horde immer noch Krieg führen und den Wahn übriglassen, dass auf unserer Seite das absolut Gute stehe, auf der Gegenseite aber das absolut Böse?
Eine banale Logik reiner Projektionen.
Wie wir das Böse auf der Welt eindämmen könnten, dafür gäbe es sehr probate Mittel. An der Spitze nenne ich einen einzigen: stellen Sie sich vor, dass wir im Kampf gegen die Schurkenstaaten Nordkorea, Irak, dass wir im Kampf gegen das Elend von 50 Millionen verhungerten Menschen jedes Jahr, von über 25 Millionen AIDS-Kranken allein in Afrika, gerade heute in der Zeitung erfahren müssen, dass die Amerikaner ihre etwa 3 Milliarden Dollar Auslandshilfe nicht länger tragen können, sie reduzieren sie auf etwa 1,7 Milliarden Dollar im Jahr.
Dieselben USA stehen nicht an, an einem einzigen Tag, wenn heute Nacht die Sonne auf 12 Uhr geht, wieder ausgegeben zu haben eine Milliarde Dollar im Jahr, mehr als 370 Milliarden davon, tausend Millionen.
Selbst wenn wir in den christlichen Kirchen für Brot für die Welt, für Adveniat alles Mögliche sammeln und kämen dabei auf eine Zahl von ungefähr 50 Millionen Euro, müssten wir sagen, dass wir vergleichsweise beinahe 800 bis 1000 Jahre in Deutschland sammeln müssten, um den Wehrhaushalt der Bundesrepublik aufzubringen.
Das sechsfache, siebenfache davon leistet sich die US-Armee. Mehr als die Hälfte der ganzen Menschheit rüsten die Vereinigten Staaten von Amerika. Kein Wunder, dass sie militärisch unschlagbar sind. Sie haben alles, können alles, aber dürfen sie auch deshalb alles machen?
Was wäre zu machen bei dem Schurkenstaat Nordkorea zum Beispiel? Etwa eine Million Menschen soll vor zwei Jahren dort verhungert sein. Setzen Sie rein numerisch, dass wir als Salär eines einzigen Tages für das Pentagon jedem Verhungernden in Nordkorea 1000 Dollar in die Hand geben könnten, mehr als er in zwei Jahren regulär verdienen wird. Wir würden ein einziges Mal uns für das Elend der Menschen interessieren und glauben Sie, dass Nordkorea noch ein Schurkenstaat wäre, uns verfeindet?
Und wir könnten geradewegs so weitermachen: ein Dreihundertfünfundsechzigstel ist wirklich nicht zuviel verlangt. George Bernhard Shaw konnte vor 70 Jahren einmal sagen: „Ich höre immer wieder, dass mit der Bergpredigt keine Politik zu machen ist, aber versucht es doch wenigstens ein einziges Mal.“
Ein Dreihunderfünfundsechzigstel für ein Experiment!
Es war der Dalai Lama, der am 13. September vor zwei Jahren sagen konnte: Was da passiert ist, in New York und in Washington, ist eine große Chance für die Nichtgewalttätigkeit – „a big chance for non-violence“.
Er wollte sagen: wenn wir aus dem Grauen jetzt von mehreren tausend Toten die Weltgeschichte einmal umschreiben, wir treten aus dem Schlachthof heraus, wir weigern uns, die Blutmühle weiterzudrehen, wir setzen auf die Zusammengehörigkeit aller Menschen, dann müssten wir nur den nächsten buddhistischen Satz noch hinzufügen und christlich interpretieren - dass man den Dalai Lama vertrieb aus Tibet, ein Kind noch damals, gab man ihm mit auf den Weg: „Wohl Eure Heiligkeit gibt es Gutes und Böses“. Aber beides hat seine Ursachen.
Wäre es möglich, wir würden begreifen, dass wir zusammengehören? Wir würden plötzlich die riesigen Mittel, die wir zur Verfügung haben konvertieren im Kampf gegen die Ursachen des Krieges. Mein wirklicher Traum ist nicht, dass Herr Schröder jetzt zu diesem Krieg nein sagt. Ich betrachte das als einen schweren Fehler, dass man uns mit weiteren Lügen, wie zum Beispiel den Hufeisenplan durch Scharping und Fischer in den Krieg gegen Serbien und das Bombardement von Belgrad hineingeredet hat, dass man uns die Idiotie hat glauben lassen, wir müssten die Taliban exekutieren um am Ende die Frauen von dem Schleier endlich zu erlösen und die Männer von den Bärten.
Ein Jahr später ist von alldem nicht die Rede. Aber vielleicht können wir uns erinnern, wie man in Afghanistan die Menschen dort befreit hat. Eine kleine Episode, die im deutschen Fernsehen gezeigt wurde – Jamie Doren, ein Ire, hat sie mühsamst genug recherchiert – sie hat nie eine Diskussion ausgelöst, ich möchte aber, weil es den Krieg zeigt, wie er immer ist, ins Bewusstsein heben die Vorgänge von Dashti Laili. Man hatte die Nordallianz mobilisiert gegen die Taliban. Eine der Handlungen war, dass man über 3000 gefangene Taliban verladen hat in überhitzten Autos und sie zusammengeschossen hat durch die Wände – unter den aufsehenden Augen des US Militärs. Mehr als 3000 Gefangene einfach mal so getötet.
Dann müssen Sie Herrn Rumsfeld hören, Donald Rumsfeld, wenn er erklärt, auf Guantanamo, diese haben keine Rechte - das ist seit zwei Jahren.
Darunter ist zu verstehen, dass man Menschen seitdem an Händen und Füssen gefangen hält. Vor etwa fünf Monaten ging durch die Zeitungen, dass es eine Hafterleichterung gäbe: fünf Minuten dürften sie die Hände frei bewegen – fünf Minuten in der Woche wohlgemerkt. Das bedeutet, wenn Sie etwas Phantasie haben, dass sie sich einmal am Tage wenigstens den Hintern mit den eigenen Händen abputzen dürfen. So etwas nennt man Folter und natürlich gibt es keinerlei Kontrolle über die Haftbedingungen von gefangenen Taliban in Guantanamo. Ich vermute, dass man uns morgen als Beweise auftischen wird Folterprotokolle, die bei keinem Gericht durchgingen, aber die man uns als Wahrheit dann erklären wird, wie doch ausgesagt wurde: Verbindungen zwischen Al Quaida und Saddam Hussein.
Wenn das Gute, das wir uns einbilden zu verkörpern, uns vollkommen blind macht für das Elend, das wir den anderen zufügen, verhindern wir nicht das Böse, sondern wir werden selber die Bösen. Zum Krieg gehört der blinde Gruppenegoismus. Um Krieg zu führen müssen Sie sämtliche Begriffe der Menschlichkeit absolut setzen und gleichzeitig fragmentieren. Jenseits der Grenzen wohnt der Teufel, der zweite Hitler, ein Wahnsinniger, ein Unmensch und im Kampf gegen ihn ist alles, jedes Mittel richtig. Und er hat zu verantworten, das es gegen ihn eingesetzt wird. Wenn es so steht, werden die besten Absichten von Menschen korrumpiert zum Verbrecherischen. Man will und kann dann nicht mehr sehen, was man dabei anrichtet. Auf der einen Seite sagten wir eben, wir dürfen es gar nicht sehen, sonst könnten wir es nicht machen, auf der anderen Seite hängt man uns ein moralisches Schutzkleid über, das uns unempfindlich macht.
Vor einer Weile konnte man hören, wie ein russischer General erklärt: „Chechenische Kinder weinen ja wie die russischen!“ Ja, lieber Herr General, Kinder überall auf der Welt weinen ganz genauso. Überall auf der Welt werden Kinder von Müttern geboren, überall auf der Welt gibt es Menschen, die wissen, was Hunger ist, was Krankheit ist und was Elend ist und was Durst ist und was Erniedrigung ist. Und die Frage ist jetzt lediglich, ob wir die Verletzbarkeit unserer Seele und unseres Körpers, angesichts des möglichen Todes, benützen können, uns über den Gräbern hinweg die Hände zu reichen und den einzigen Feind zu bekämpfen, den wir alle haben: eben die Sterblichkeit - im Kampf fürs Leben, oder ob wir den Zynismus aufbringen, geduckte Sklaven der Angst, die wir dann sind, den Tod zu handhaben als Waffe gegen den anderen.
Wollen wir wirklich überleben als die effizientesten Killer auf den Schlachtfeldern? Soll das die Zukunft sein? Der Darwinismus in der schrecklichsten Form als Geschichtsphilosophie des 21. Jahrhunderts? Will man uns immer wieder verkaufen, dass wir überhaupt nur ein Recht hätten zu leben, wenn wir besser morden können, als jeder an unserer Seite? Will man uns dahin bestellen, dass Kain und Abel das Dauerschicksal der Menschheit sei? Dann hört man den Meistererklärer der islamischen Kultur, Peter Scholl-Latour, dass das Christentum selber lehrt, dass es die Erbsünde gibt und also weiß er für keinen Konflikt eine andere Lösung als den Krieg und die größere Aufrüstung und die Furchtbarkeit von allem, was geplant und begangen werden könnte.
Das Christentum, Herr Scholl-Latour, lehrt die Erlösung von der Erbsünde und es lehrt ihm Lehren von der Erbsünde: dass man Menschen ins Herz schauen muss, was in ihnen vorgeht, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie am Boden liegen, wenn sie nicht mehr weiter wissen; dann allerdings könnte jeder zeigen, dass selbst eine Ratte, die man in die Ecke drückt, der Katze in das Gebiss springen wird, um sich zu wehren.
Vermutlich wird es das sein, was wir Anfang März erleben werden und dann werden diejenigen, die sich wehren, als Verzweifelte für Kriegsverbrecher abgeurteilt werden, auch das steht schon in Aussicht.
Aber kann man die Waage von Gut und Böse so ungerecht handhaben?
Wäre es nicht an der einzig verbliebenen Weltmacht der Erde, abzurüsten als erste und zu sagen, es gibt ein Haufen von Dingen, die wir nie hätten erfinden dürfen, nie hätten herstellen dürfen, nie hätten lagern dürfen, nie hätten planen dürfen sie jemals anzuwenden?
Und dann stellen Sie sich vor, was wir allein in Deutschland hätten machen können, wenn wir 1989 auf Gorbatschows gehört hätten: Wiedervereinigung Deutschlands um den Preis des Austritts aus der NATO.
Nicht geduldet damals, wie üblich, von George Bush Senior und natürlich nicht akzeptiert von dem damaligen deutschen Kanzler. Den Plan gab es schon 1958 unter Rapatzki, dem polischen Außenminister, ein militärisches Disengagement in ganz Europa, zumindest von Polen, Ungarn, Tschechien bis hinüber zu den Beneluxstaaten, oder, wenn Frankreich mitmacht, gleich bis zum Atlantik.
Wie viele Ressourcen hätten wir im 20. Jahrhundert aufbringen können im Kampf gegen die Gründe, aus denen Kriege stammen. Seit 1989 30 Milliarden Euro jedes Jahr für einen absurden Spuk: für Transportflugzeuge, für Einsatzgeräte möglichst vom Nordkap bis in die Kalahari, der deutsche Soldat als Mann der Stunde zu jeder Winter- und Jahreszeit, allround verwendbar, wenn der amerikanische Verbündete uns ruft. Was hätten wir tun können seither?
Wir hätten ungefähr das Jahressalär der US-Armee, über 350 Milliarden Euro, beieinander. Mit einem Wort: wir hätten keine Staatsverschuldung mehr, wir brauchten nicht ein Drittel des gesamten Budgets im Bundestag für die Zinsenregulation der Altschulden aufzuwenden, wir hätten den Aufbau Ost und wir hätten endlich die Frontstellung den Ländern der Dritten Welt wirksam zu helfen.
Dazu würde gehören, dass wir eine Logik betreiben, die in Zukunft die einzige ist, unter welcher menschliche Geschichte vorstellbar ist: wir haben das Gewaltmonopol des Staates zur Befriedung der Bürger in gesicherten Grenzen, Abrüstung für jeden Einzelnen in geordneten Grenzen. Auf diese Weise haben wir vom alten Sumer bis in die Gegenwart, zumindest innenpolitisch, friedfertige Bürger geschaffen. Außenpolitisch haben wir an der Peripherie der immer größer organisierten Gruppen schlimmere Waffen noch gelagert und gehortet und damit die objektive Aggressivität immer noch gesteigert. Die weitere Entwicklung kann nur die einer Weltinnenpolitik sein und das bedeutet, wir müssen uns wehren dagegen, dass die USA nicht zögern, die mögliche Weltversammlung der UNO zu nichts weiter als zu der Maskeradenbühne ihrer Rechthaberer und Machtdurchsetzung zu erklären.
Die zukünftige Entwicklung kann nur so sein, dass wir beschließen, alle Einzelstaaten abzurüsten und eine Weltregierung zu schaffen, die internationale Konflikte dann gemeinsam reguliert – nicht fünf Nachfolgestaaten aus der Zeit des zweiten Weltkriegs dann säßen, als Zünglein an der Waage im Weltsicherheitsrat, sondern eine wirkliche Versammlung der Bevölkerung der Menschheit. Die alleine hätte internationale Konflikte zu entscheiden als Appellationsinstanz. Abrüstung aber von allen, bei den größten am ehesten begonnen.
Wollen wir der Menschheit Frieden, Freiheit und Wohlstand bringen, müssten wir umdenken im Ganzen – kein nationaler Egoismus mehr ist verträglich in einer weltinnenpolitischen Grundsituation von morgen mit Frieden, Wohlstand und Freiheit. Es ist das Ende, dass wir einen einzigen Staat imperialistisch die Hände auf den Globus ausstrecken sehen und wir sollten ihm moralisch auf die Finger hauen, indem wir deutlich erklären: nicht in unserem Namen – not in our name, Mr. Bush!
Dass es blauäugig sei, die Konversion der militärischen Stärke in friedfertige, dem Wohlstand der Menschen dienende Projekte umzuformen, sehe ich absolut nicht. Wenn es irgendeine Realität beschrieben gibt, ist es die der Bergpredigt. Gemeinsam die Güter der Welt zu teilen, Gewalt zu vermeiden durch offene Dialoge, und sich endlich zu fragen, was menschliche Größe sei – 10. Kapitel im Markusevangelium.
Die Mächtigen der Welt, sagt Jesus da, regieren herunter auf ihre Untertanen. Bei Euch sei das nicht so. Er will sagen, wenn Du Dich fragst, mitten im Leben, oder am Ende Deines Lebens, wozu es gut war, dass es Dich gegeben hat, werden Dir einzig einfallen die paar Momente, in denen Du die Hände ausgestreckt hast, den Hilflosen und Wehrlosen gegenüber.
Dies ist ein wirklicher Wahn zu hören, wie George W. Bush erklärt, mit religiöser Rhetorik, dass wir die ganze Macht der Vereinigten Staaten von Amerika aufbieten werden – „and in name of peace I say: we will win“.
„In name of peace“, kann ich nur sagen: wir werden alles verlieren, wenn wir Krieg führen. Das ist die Wahrheit. Es gibt keinen Krieg für den Frieden. Krieg ist Krieg.
Ich möchte endigen mit einem Manifest von 1930, unterschrieben von Albert Einstein, er konnte 1951 noch sagen: „Für mich ist das Töten im Krieg durch nichts verschieden vom ganz gemeinen Morden.“
Unterschrieben von Siegmund Freud, er konnte 1915 sagen: „Jetzt im Weltkrieg zeigt sich erst, dass die Staaten der Welt Mord, Verrat, Spionage, Hinterhältigkeit, Gemeinheit dem einzelnen Bürger nicht verbieten, um die Verbrechen aus der Welt zu bringen, sondern um ein Monopol darauf zu erheben, wie auf Zucker und auf Tabak.“
Unterschreiben von Bertrand Russel, der 1968 die Anklage gegen USA im Vietnamkrieg startete. Unterschrieben von Stefan Zweig, der sich das Leben nahm in Brasilien, weil er nicht mehr erleben wollte, dass man die Fahnen schwenkt über Millionen von Toten und sich noch getraut sich als Sieger vorzukommen.
Die ganze Tragödie des 20. Jahrhunderts nach dem ersten Weltkrieg bis hin zu Adolf Hitler wäre vermeidbar gewesen, hätte man wenigstens damals gesagt, als es erst 10 Millionen Tote waren, bei Ypern, bei Cambraix bei Verdun, als wir hunderttausende unserer jungen Leute in das Giftgas, in die Bajonette in die Sperrfeuerangriffe trieben, ein Massaker nach dem anderen haben wir alle in der industrialisierten Form des Sadismus unsere Menschlichkeit verloren, es gibt keine Sieger mehr, wir hätten eine endgültige Weichenstellung erreicht – das Manifest damals lautete:
„Die Wehrpflicht liefert die Einzelpersönlichkeit dem Militarismus aus, sie ist eine Form der Knechtschaft. Das die Völker sie gewohnheitsmäßig dulden, ist nur ein Beweis mehr für ihren abstumpfenden Einfluss. Militärische Ausbildung, Schulung von Körper und Geist in der Kunst des Tötens, militärische Ausbildung ist Erziehung zum Kriege, sie ist die Verewigung des Kriegsgeistes, sie verhindert die Entwicklung des Willens zum Frieden.“
Darum endige ich mit dem Testament von Wolfgang Borchert, sterbend in Basel, lungenkrank Zeuge dessen, was der Zweite Weltkrieg hieß: „Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und Dir sagen, Du sollst die Waffen segnen und den Krieg rechtfertigen, Pfarrer auf der Kanzel, sag nein.
Mutter, wenn sie wiederkommen und Dir sagen, Du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen als Krankenschwestern für die Hospitäler, Mütter der Welt, sagt nein.
Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und Dir sagen, Du sollst statt Rohrleitungen Kochgeschirre, Stahlhelme und Kanonenrohre ziehen, Mann an der Werkbank, sag nein, denn wenn Ihr nicht nein sagt, wird alles wiederkommen.“
Wir sagen heute zu diesem Kriege nein und zu jedem Kriege nein – not in our name!
Ich muss, obwohl es nicht dahingehört, einen Satz hinzufügen und das Anliegen erweitern:
Es gibt kein Tabun, kein Sarin, kein VX, es gibt keine Quälerei mit Dum-dum Geschossen und high-speed Guns, das man nicht hunderttausendfach, millionenfach erprobt hätte an den unschuldigen Körpern krankgemachter Tiere. Es gibt kein Übel, das man den Menschen auf den Schlachtfeldern zufügt, außer man hätte es losgelassen an Tieren, die mit dem Wahnsinn der Menschen nichts zu tun haben. Darüber redet niemand. Kein Mensch kontrolliert die unglaublichen Versuche, die das Militär mit Tieren durchführt. Wir können über Tierversuche für die Pharmaindustrie vielleicht noch diskutieren und Argumente dafür und dagegen abwägen, beim Militär kann man nur sagen, man will nicht länger sehen, wie man Tiere quält, damit man noch viel effizienter Menschen quälen kann. Im Übrigen hat Tolstoi recht: Solange wir Schlachthöfe haben, solange wird es auch Schlachtfelder geben. Mitleid ist unteilbar.
http://konstantin.wecker.bei.t-online.de/drewermann%20rede%2…
Langer Rede, kurzer Sinn:
Sie Amerikaner sind einfach Scheiße !!
STRONG ANTIAMERIKANISCH
Sie Amerikaner sind einfach Scheiße !!
STRONG ANTIAMERIKANISCH

NYT - 06.03.2003
China Steps Up Its Output of Metals
By BERNARD SIMON
TORONTO, March 5 — To many Western companies, China is the future, either as a huge potential customer or a looming low-cost competitor. But in the world`s metal markets, that future has already arrived, and Noranda, the Canadian mining group, has the bruises to prove it.
Noranda, a unit of Brascan, and its partners spent years and 733 million Canadian dollars ($496 million) to build the world`s biggest magnesium smelting plant, at Danville, Quebec, and planned to have it go into commercial production around now. Instead, it is being mothballed, and Noranda has written off its 80 percent stake in the plant.
Noranda says that the plant cannot be run economically now chiefly because so much magnesium, a lightweight metal used mainly in the electronics, auto and aviation industries, is pouring out of China. From hardly any production a decade ago, China has shot up to become the world`s biggest exporter. According to Richard Opatick, director of the International Magnesium Association in Washington, magnesium prices have fallen by half in the last three years, as Noranda`s plant was being completed.
China "is the subject on everyone`s mind," said David Humphreys, chief economist with Rio Tinto, the mining giant. "It is very big indeed, and growing bigger by the month."
And not just on the supply side. Inco, the West`s biggest nickel producer, told analysts last month that demand in China for stainless steel, which is made with nickel, expanded so fast last year that the growth alone was equal to more than half of total consumption in the United States or Japan.
In the presentation to analysts, much of which was devoted to China`s impact, Peter Goudie, Inco`s executive vice president for marketing, said, "It is easy to understand why China has become such a dominant influence in nickel and across the full range of metals."
China`s fast-growing economy is one of the world`s few bright spots for some industrial commodities that China imports. But for others, the combination of government subsidies, cheap credit, cheap electricity and lax environmental controls has fueled huge increases in production, far in excess of domestic demand.
"The Chinese business model is based on creating a critical mass and then finding the market," said Simon Hunt, a British consultant who specializes in China and spends several months a year there. According to Mr. Humphreys at Rio Tinto, "Rapid growth of China`s exports has hit prices and put huge pressure on producers elsewhere in the world."
China is becoming the most important actor in the market for one metal after another.
Copper is one example. Bloomsbury Minerals Economics, a London consulting firm, estimates that China`s use of refined copper grew 21 percent in 2001 and 13 percent last year, moving it ahead of the United States as the world`s biggest consumer.
Bloomsbury forecasts a further 10 percent rise in 2003, reflecting the rapid expansion of China`s electric power grid and rapidly growing demand for domestic appliances. By contrast, copper consumption in the United States is expected to inch up by just 1.4 percent.
China also accounted for two-thirds of the increase in global demand for nickel in 2002. Its purchases of alumina, the raw material used for aluminum, have helped almost double world prices in the last year.
China is now the world`s second-biggest importer of iron ore and of lead, and has become the top producer of steel, aluminum and tungsten. Its exports of tin, coal and a number of industrial minerals are rising fast.
These trends generate both excitement and worry among metals executives in the West. Copper producers, for example, are delighted, because little high-grade ore has been discovered in China and the country must import refined metal to meet its needs — a rare source of strength in a largely depressed industry. Bloomsbury calculates that Chinese imports have surged by an average of 37 percent a year since 1999, and are probably still growing at that pace.
"There is certainly no sign of a reversal just yet, with booming domestic consumer spending rather than exports driving the market," the consulting company reported in February. "China, yet again, appears to be the savior of the copper market."
But China sends shivers through other markets. The United States and the European Union have moved to impose duties on Chinese magnesium, saying that China is dumping the metal on the market at prices below the cost of production. In addition to the Noranda plant in Quebec, the slump in prices has recently forced the closings of the last two primary magnesium producers in Europe, one in France and one in Norway.
Mr. Humphreys of Rio Tinto said that aluminum was "potentially another magnesium situation." China has gone from importing 132,000 tons of aluminum in 2001 to exporting about 220,000 tons last year. China has a substantial advantage, according to Carmine Nappi, director of industry analysis at Alcan, a major producer based in Montreal. "They can build a smelter in less time than us, and the cost is half that in the Western world," Mr. Nappi said.
Mr. Nappi, however, expects that surge in Chinese exports to be short-lived. The sharp rise in world alumina prices over the last year is likely to encourage Chinese producers to shut down old, inefficient plants and limit their output to domestic needs, which are expanding because of a boom in construction, in car production and in erection of power lines, he said.
Doing business with China can be a headache for Western producers because of uncertainties about government policies and the legal system there. Peter Hollands, head of research at Bloomsbury Minerals, said that while Western producers and buyers of metals commonly sign long-term contracts, most business with China is conducted on spot markets through trading companies.
Still, Western analysts said that China`s recent entry into the World Trade Organization and the country`s growing contacts with foreign companies have helped promote mutual understanding.
"You`ve seen a wholesale change in attitude, both in the state-owned companies and the private sector," Mr. Hunt, the consultant, said of China.
The Chinese government is taking steps to modernize the industry and its practices. Kaihui Yang, a University of Toronto research geologist, said in an e-mail interview from Yunnan in southwest China that more than 150,000 small mines in the country have been closed for environmental or safety reasons since 1998. According to Dr. Yang, subsidies for small or unprofitable mines and processing plants have been "largely removed."
A new mining law, due to take effect this month, "will be more favorable for foreign investments," Dr. Yang said.
According to Mr. Humphreys, the Chinese government "has become increasingly aware that uncontrolled selling has damaged its own interests, suppressing world prices and encouraging the over-rapid depletion of its domestic resources."
China`s shifting role in the zinc market may offer lessons for other metals. A burst of zinc shipments from China severely disrupted world markets in the late 1990`s and 2000. But, according to the International Lead and Zinc Study Group in London, mine closings since then have resulted in the first drop in Chinese refined zinc output in almost two decades. Last year, China became one of the biggest customers for Western zinc producers.
China Steps Up Its Output of Metals
By BERNARD SIMON
TORONTO, March 5 — To many Western companies, China is the future, either as a huge potential customer or a looming low-cost competitor. But in the world`s metal markets, that future has already arrived, and Noranda, the Canadian mining group, has the bruises to prove it.
Noranda, a unit of Brascan, and its partners spent years and 733 million Canadian dollars ($496 million) to build the world`s biggest magnesium smelting plant, at Danville, Quebec, and planned to have it go into commercial production around now. Instead, it is being mothballed, and Noranda has written off its 80 percent stake in the plant.
Noranda says that the plant cannot be run economically now chiefly because so much magnesium, a lightweight metal used mainly in the electronics, auto and aviation industries, is pouring out of China. From hardly any production a decade ago, China has shot up to become the world`s biggest exporter. According to Richard Opatick, director of the International Magnesium Association in Washington, magnesium prices have fallen by half in the last three years, as Noranda`s plant was being completed.
China "is the subject on everyone`s mind," said David Humphreys, chief economist with Rio Tinto, the mining giant. "It is very big indeed, and growing bigger by the month."
And not just on the supply side. Inco, the West`s biggest nickel producer, told analysts last month that demand in China for stainless steel, which is made with nickel, expanded so fast last year that the growth alone was equal to more than half of total consumption in the United States or Japan.
In the presentation to analysts, much of which was devoted to China`s impact, Peter Goudie, Inco`s executive vice president for marketing, said, "It is easy to understand why China has become such a dominant influence in nickel and across the full range of metals."
China`s fast-growing economy is one of the world`s few bright spots for some industrial commodities that China imports. But for others, the combination of government subsidies, cheap credit, cheap electricity and lax environmental controls has fueled huge increases in production, far in excess of domestic demand.
"The Chinese business model is based on creating a critical mass and then finding the market," said Simon Hunt, a British consultant who specializes in China and spends several months a year there. According to Mr. Humphreys at Rio Tinto, "Rapid growth of China`s exports has hit prices and put huge pressure on producers elsewhere in the world."
China is becoming the most important actor in the market for one metal after another.
Copper is one example. Bloomsbury Minerals Economics, a London consulting firm, estimates that China`s use of refined copper grew 21 percent in 2001 and 13 percent last year, moving it ahead of the United States as the world`s biggest consumer.
Bloomsbury forecasts a further 10 percent rise in 2003, reflecting the rapid expansion of China`s electric power grid and rapidly growing demand for domestic appliances. By contrast, copper consumption in the United States is expected to inch up by just 1.4 percent.
China also accounted for two-thirds of the increase in global demand for nickel in 2002. Its purchases of alumina, the raw material used for aluminum, have helped almost double world prices in the last year.
China is now the world`s second-biggest importer of iron ore and of lead, and has become the top producer of steel, aluminum and tungsten. Its exports of tin, coal and a number of industrial minerals are rising fast.
These trends generate both excitement and worry among metals executives in the West. Copper producers, for example, are delighted, because little high-grade ore has been discovered in China and the country must import refined metal to meet its needs — a rare source of strength in a largely depressed industry. Bloomsbury calculates that Chinese imports have surged by an average of 37 percent a year since 1999, and are probably still growing at that pace.
"There is certainly no sign of a reversal just yet, with booming domestic consumer spending rather than exports driving the market," the consulting company reported in February. "China, yet again, appears to be the savior of the copper market."
But China sends shivers through other markets. The United States and the European Union have moved to impose duties on Chinese magnesium, saying that China is dumping the metal on the market at prices below the cost of production. In addition to the Noranda plant in Quebec, the slump in prices has recently forced the closings of the last two primary magnesium producers in Europe, one in France and one in Norway.
Mr. Humphreys of Rio Tinto said that aluminum was "potentially another magnesium situation." China has gone from importing 132,000 tons of aluminum in 2001 to exporting about 220,000 tons last year. China has a substantial advantage, according to Carmine Nappi, director of industry analysis at Alcan, a major producer based in Montreal. "They can build a smelter in less time than us, and the cost is half that in the Western world," Mr. Nappi said.
Mr. Nappi, however, expects that surge in Chinese exports to be short-lived. The sharp rise in world alumina prices over the last year is likely to encourage Chinese producers to shut down old, inefficient plants and limit their output to domestic needs, which are expanding because of a boom in construction, in car production and in erection of power lines, he said.
Doing business with China can be a headache for Western producers because of uncertainties about government policies and the legal system there. Peter Hollands, head of research at Bloomsbury Minerals, said that while Western producers and buyers of metals commonly sign long-term contracts, most business with China is conducted on spot markets through trading companies.
Still, Western analysts said that China`s recent entry into the World Trade Organization and the country`s growing contacts with foreign companies have helped promote mutual understanding.
"You`ve seen a wholesale change in attitude, both in the state-owned companies and the private sector," Mr. Hunt, the consultant, said of China.
The Chinese government is taking steps to modernize the industry and its practices. Kaihui Yang, a University of Toronto research geologist, said in an e-mail interview from Yunnan in southwest China that more than 150,000 small mines in the country have been closed for environmental or safety reasons since 1998. According to Dr. Yang, subsidies for small or unprofitable mines and processing plants have been "largely removed."
A new mining law, due to take effect this month, "will be more favorable for foreign investments," Dr. Yang said.
According to Mr. Humphreys, the Chinese government "has become increasingly aware that uncontrolled selling has damaged its own interests, suppressing world prices and encouraging the over-rapid depletion of its domestic resources."
China`s shifting role in the zinc market may offer lessons for other metals. A burst of zinc shipments from China severely disrupted world markets in the late 1990`s and 2000. But, according to the International Lead and Zinc Study Group in London, mine closings since then have resulted in the first drop in Chinese refined zinc output in almost two decades. Last year, China became one of the biggest customers for Western zinc producers.
NYT - 02.03.2003
Gold Is on the Rise, So What`s Bugging Barrick?
By Kurt Eichenwald
The economy is in the doldrums. The stock market is a mess. War looms. Terror threatens. In other words, it should be time to celebrate at companies in the business of mining gold, long a haven in periods of investor anxiety.
But one of the industry`s largest players, Barrick Gold of Toronto, hasn`t been popping any Champagne corks of late.
After years of top performance, Barrick`s stock price has slid, falling nearly 11 percent over the last year, as prices for gold have soared nearly 18 percent. Randall Oliphant was recently shown the door as chief executive and replaced by another longtime Barrick executive, Gregory C. Wilkins. Now, Barrick has been sued by a gold dealer and gold investors who say its success of the last decade relied on manipulating gold prices.
At the foundation of many of its troubles is a wide perception among investors that Barrick is not set up to take advantage of a rising market because of its strategy of locking in prices for future gold production. That strategy — known as taking a hedge position — has been used by Barrick for some 15 years, and company executives credit it with bringing in some $2.2 billion of additional profit during that time.
As the industry`s glitter returns, investors fret that the hedging strategy might turn Barrick`s gold into dross. "By far the biggest imputed liability to the stock price we estimate is related to concerns about the hedge book," said Chad Williams, a mining analyst at Westwind Partners, an independent institutional brokerage firm in Toronto.
Indeed, in a recent conference call, Mr. Wilkins acknowledged that Barrick`s hedge had become something of a "lightning rod" among investors. But company records, as well as interviews with mining and finance experts, suggest that the strategy will not have the negative impact on Barrick`s near-term financial performance that investors fear. Ultimately, Barrick`s largest risks come from the legal challenge it faces and from issues like production, lease rates for gold and whether it will miss out on a higher price a decade into the future.
Barrick is cutting back the size of its hedge position. It now has about 20 percent of its 86.9 million ounces of gold reserves committed to hedges, down from about 26 percent last June, according to Jamie C. Sokalsky, its chief financial officer.
Still, for gold bugs, who approach investment in gold with a fervor bordering on religiosity, the use of any such hedges, which entail the sale of borrowed gold into the spot market, is a heresy that damages the marketplace. Hedgers, led by Barrick, have warred with nonhedgers for years.
Recent events have only fueled the debate. With a strategy described in exotic terms like "off-balance sheet position" and "fixed-forward contracts," the hedge program sounds the way the kind of toxic ploys used by Enron did. For conservative gold investors, they are the equivalent of the investment bogyman.
"As a percentage of Barrick`s total assets, its off-balance-sheet assets make Enron look like a champion of full disclosure," said Donald W. Doyle Jr., chief executive of Blanchard & Company, a gold dealer in New Orleans that is the lead plaintiff in the suit against Barrick in Federal District Court there.
Barrick insists — and numerous analysts agree — that its strategy is far simpler and more adaptive to market conditions than investors seem to believe. It begins with a contract between Barrick and a large bullion dealer, like Citigroup or J. P. Morgan Chase. Under the terms of the contract, Barrick is required to deliver gold at some future date. The contract, known as spot deferred, allows Barrick to postpone delivery, however, for up to 15 years.
With the contract in place, the bullion dealer then leases that same amount of gold from a central bank, selling it in the spot market. The dealer then effectively places the cash from the sale on deposit, where it earns interest. During the contract`s life, the dealer pays interest to the central bank as a fee for borrowing the gold. Once Barrick delivers the gold, it receives the cash from the spot sale and the accumulated interest, less the lease rate and certain fees paid to the dealer.
That can give Barrick strong protection against a falling market. If the spot price is $300, for example, the hedge strategy could lock in a price five years in the future of about $345. If the spot market is higher than that price, Barrick can sell its gold there and defer the delivery against the contract. As a result, Barrick, on average, has made about $65 an ounce above spot market prices on gold sales the last 15 years, the company said.
Barrick, which analysts say has the mining industry`s highest credit rating, has been able to gain particular advantages in its deals with bullion dealers. It is allowed to deliver gold against its hedging contracts at virtually any point, whether in 2 days or 15 years. In addition, if the dealer agrees, Barrick can "reset" the time limit every year, starting the clock over on the 15-year deadline. If the dealer refuses, which Barrick says has never happened, delivery would be required 14 years later. Most important, Barrick does not have to post cash — known as margin — if the price of gold rises significantly.
It is those features that make Barrick`s program far different from hedging efforts that have hobbled other gold producers. For example, in 1999, when gold prices spiked unexpectedly, margin calls and other immediate financial consequences brought Ashanti Goldfields of Ghana and Cambior of Canada close to ruin — troubles that the Barrick program is structured to avoid.
None of this is free of risk. If gold`s spot price rises above the hedge price for more than a decade, Barrick would be forced to sell its gold for less than its nonhedged competitors would receive. Moreover, the bullion dealers could demand delivery if Barrick violated certain financial and performance requirements — for example, if a disaster occurred at its production facilities that impeded its ability to deliver gold.
The hedging strategy also now faces a legal challenge. In the federal lawsuit filed late last year, Blanchard and the other plaintiffs accused Barrick of using its hedge program to manipulate gold prices in violation of federal antitrust laws.
In essence, the lawsuit says Barrick and J. P. Morgan Chase, which has participated in the hedge program for years, used the strategy to force down prices, allowing them to profit at the expense of other market participants.
"If you look over the past six years, you will see that when Barrack`s hedge position has gone way up, the price of gold has gone way down and vice versa," said Mr. Doyle of Blanchard. "Barrick created an anticompetitive environment through the manipulation of the price of gold, and they did it with the knowledge and assistance of J. P. Morgan and perhaps some of the other bullion banks."
With the hedge program bringing future sales of gold into the immediate spot market, Mr. Doyle said, Barrick had the ability to cripple any rally in the price of the commodity. Because the program also allowed it to profit in markets that left competitors in poor shape, he said, Barrick was able to use its competitive advantage to acquire other companies, fueling huge growth.
So while he is no fan of Barrick, Mr. Doyle says investor concerns about the hedge program`s impact on the company are misplaced — a conclusion largely based on his belief that Barrick still has the power to manipulate prices. "The risk to the company from the price of gold going up is not all that great. so long as Barrick still has the ability to push the price back down again," he said.
A spokesman for J. P. Morgan Chase declined to comment.
Barrick, which has formally notified Mr. Doyle that it intends to file a slander suit against him and Blanchard, dismissed the accusations in the suit as nonsense. "Eighty percent of our gold is not subjected to any hedge, so we are delighted with gold prices rising," said Mr. Sokalsky, Barrick`s finance chief. "For us to hope against the value of our commodity going up would be crazy."
Moreover, antitrust experts who reviewed the Blanchard complaint said that they did not hold out any expectation that the suit would be successful, primarily because it misapplies antitrust laws.
"The antitrust laws are here to protect competition, not competitors," said James Mutchnik, a partner at Kirkland & Ellis in Chicago and a former prosecutor with the antitrust division of the Justice Department. The plaintiffs "are complaining of lower prices in the market, and that is exactly what the antitrust laws are trying to accomplish, which is to benefit consumers rather than gold retailers." he said.
Mr. Doyle said the antitrust claim was also based on what he described as Barrick`s ability to use the hedge program to drive up prices at particular times, essentially by announcing its intention to suspend its use. "With their spot-deferred contracts, they were in the position to push up the prices periodically," he said.
But some analysts said that proving that Barrick`s hedge program significantly affected gold prices long term would be challenging because of the many factors underlying them. "Anyone with a legitimate understanding of how the U.S. dollar-denominated gold price is derived would not target any producer or any central bank for manipulating it," said Mr. Williams of Westwind Partners, which receives no banking fees from Barrick. The price, he said, "moves mostly on the U.S. economy, interest rates and inflation."
Indeed, it was signals from such economic indicators that led Barrick to cut back its hedge position, according to Mr. Sokalsky. Hedging "is a tool as opposed to a religion for Barrick," he said. "And we have been adjusting it to reflect changing economic and financial situations. And with the gold price going up, the reduction of our position has been a good decision, in hindsight."
Gold Is on the Rise, So What`s Bugging Barrick?
By Kurt Eichenwald
The economy is in the doldrums. The stock market is a mess. War looms. Terror threatens. In other words, it should be time to celebrate at companies in the business of mining gold, long a haven in periods of investor anxiety.
But one of the industry`s largest players, Barrick Gold of Toronto, hasn`t been popping any Champagne corks of late.
After years of top performance, Barrick`s stock price has slid, falling nearly 11 percent over the last year, as prices for gold have soared nearly 18 percent. Randall Oliphant was recently shown the door as chief executive and replaced by another longtime Barrick executive, Gregory C. Wilkins. Now, Barrick has been sued by a gold dealer and gold investors who say its success of the last decade relied on manipulating gold prices.
At the foundation of many of its troubles is a wide perception among investors that Barrick is not set up to take advantage of a rising market because of its strategy of locking in prices for future gold production. That strategy — known as taking a hedge position — has been used by Barrick for some 15 years, and company executives credit it with bringing in some $2.2 billion of additional profit during that time.
As the industry`s glitter returns, investors fret that the hedging strategy might turn Barrick`s gold into dross. "By far the biggest imputed liability to the stock price we estimate is related to concerns about the hedge book," said Chad Williams, a mining analyst at Westwind Partners, an independent institutional brokerage firm in Toronto.
Indeed, in a recent conference call, Mr. Wilkins acknowledged that Barrick`s hedge had become something of a "lightning rod" among investors. But company records, as well as interviews with mining and finance experts, suggest that the strategy will not have the negative impact on Barrick`s near-term financial performance that investors fear. Ultimately, Barrick`s largest risks come from the legal challenge it faces and from issues like production, lease rates for gold and whether it will miss out on a higher price a decade into the future.
Barrick is cutting back the size of its hedge position. It now has about 20 percent of its 86.9 million ounces of gold reserves committed to hedges, down from about 26 percent last June, according to Jamie C. Sokalsky, its chief financial officer.
Still, for gold bugs, who approach investment in gold with a fervor bordering on religiosity, the use of any such hedges, which entail the sale of borrowed gold into the spot market, is a heresy that damages the marketplace. Hedgers, led by Barrick, have warred with nonhedgers for years.

Recent events have only fueled the debate. With a strategy described in exotic terms like "off-balance sheet position" and "fixed-forward contracts," the hedge program sounds the way the kind of toxic ploys used by Enron did. For conservative gold investors, they are the equivalent of the investment bogyman.
"As a percentage of Barrick`s total assets, its off-balance-sheet assets make Enron look like a champion of full disclosure," said Donald W. Doyle Jr., chief executive of Blanchard & Company, a gold dealer in New Orleans that is the lead plaintiff in the suit against Barrick in Federal District Court there.
Barrick insists — and numerous analysts agree — that its strategy is far simpler and more adaptive to market conditions than investors seem to believe. It begins with a contract between Barrick and a large bullion dealer, like Citigroup or J. P. Morgan Chase. Under the terms of the contract, Barrick is required to deliver gold at some future date. The contract, known as spot deferred, allows Barrick to postpone delivery, however, for up to 15 years.
With the contract in place, the bullion dealer then leases that same amount of gold from a central bank, selling it in the spot market. The dealer then effectively places the cash from the sale on deposit, where it earns interest. During the contract`s life, the dealer pays interest to the central bank as a fee for borrowing the gold. Once Barrick delivers the gold, it receives the cash from the spot sale and the accumulated interest, less the lease rate and certain fees paid to the dealer.
That can give Barrick strong protection against a falling market. If the spot price is $300, for example, the hedge strategy could lock in a price five years in the future of about $345. If the spot market is higher than that price, Barrick can sell its gold there and defer the delivery against the contract. As a result, Barrick, on average, has made about $65 an ounce above spot market prices on gold sales the last 15 years, the company said.
Barrick, which analysts say has the mining industry`s highest credit rating, has been able to gain particular advantages in its deals with bullion dealers. It is allowed to deliver gold against its hedging contracts at virtually any point, whether in 2 days or 15 years. In addition, if the dealer agrees, Barrick can "reset" the time limit every year, starting the clock over on the 15-year deadline. If the dealer refuses, which Barrick says has never happened, delivery would be required 14 years later. Most important, Barrick does not have to post cash — known as margin — if the price of gold rises significantly.
It is those features that make Barrick`s program far different from hedging efforts that have hobbled other gold producers. For example, in 1999, when gold prices spiked unexpectedly, margin calls and other immediate financial consequences brought Ashanti Goldfields of Ghana and Cambior of Canada close to ruin — troubles that the Barrick program is structured to avoid.
None of this is free of risk. If gold`s spot price rises above the hedge price for more than a decade, Barrick would be forced to sell its gold for less than its nonhedged competitors would receive. Moreover, the bullion dealers could demand delivery if Barrick violated certain financial and performance requirements — for example, if a disaster occurred at its production facilities that impeded its ability to deliver gold.
The hedging strategy also now faces a legal challenge. In the federal lawsuit filed late last year, Blanchard and the other plaintiffs accused Barrick of using its hedge program to manipulate gold prices in violation of federal antitrust laws.
In essence, the lawsuit says Barrick and J. P. Morgan Chase, which has participated in the hedge program for years, used the strategy to force down prices, allowing them to profit at the expense of other market participants.
"If you look over the past six years, you will see that when Barrack`s hedge position has gone way up, the price of gold has gone way down and vice versa," said Mr. Doyle of Blanchard. "Barrick created an anticompetitive environment through the manipulation of the price of gold, and they did it with the knowledge and assistance of J. P. Morgan and perhaps some of the other bullion banks."
With the hedge program bringing future sales of gold into the immediate spot market, Mr. Doyle said, Barrick had the ability to cripple any rally in the price of the commodity. Because the program also allowed it to profit in markets that left competitors in poor shape, he said, Barrick was able to use its competitive advantage to acquire other companies, fueling huge growth.
So while he is no fan of Barrick, Mr. Doyle says investor concerns about the hedge program`s impact on the company are misplaced — a conclusion largely based on his belief that Barrick still has the power to manipulate prices. "The risk to the company from the price of gold going up is not all that great. so long as Barrick still has the ability to push the price back down again," he said.
A spokesman for J. P. Morgan Chase declined to comment.
Barrick, which has formally notified Mr. Doyle that it intends to file a slander suit against him and Blanchard, dismissed the accusations in the suit as nonsense. "Eighty percent of our gold is not subjected to any hedge, so we are delighted with gold prices rising," said Mr. Sokalsky, Barrick`s finance chief. "For us to hope against the value of our commodity going up would be crazy."
Moreover, antitrust experts who reviewed the Blanchard complaint said that they did not hold out any expectation that the suit would be successful, primarily because it misapplies antitrust laws.
"The antitrust laws are here to protect competition, not competitors," said James Mutchnik, a partner at Kirkland & Ellis in Chicago and a former prosecutor with the antitrust division of the Justice Department. The plaintiffs "are complaining of lower prices in the market, and that is exactly what the antitrust laws are trying to accomplish, which is to benefit consumers rather than gold retailers." he said.
Mr. Doyle said the antitrust claim was also based on what he described as Barrick`s ability to use the hedge program to drive up prices at particular times, essentially by announcing its intention to suspend its use. "With their spot-deferred contracts, they were in the position to push up the prices periodically," he said.
But some analysts said that proving that Barrick`s hedge program significantly affected gold prices long term would be challenging because of the many factors underlying them. "Anyone with a legitimate understanding of how the U.S. dollar-denominated gold price is derived would not target any producer or any central bank for manipulating it," said Mr. Williams of Westwind Partners, which receives no banking fees from Barrick. The price, he said, "moves mostly on the U.S. economy, interest rates and inflation."
Indeed, it was signals from such economic indicators that led Barrick to cut back its hedge position, according to Mr. Sokalsky. Hedging "is a tool as opposed to a religion for Barrick," he said. "And we have been adjusting it to reflect changing economic and financial situations. And with the gold price going up, the reduction of our position has been a good decision, in hindsight."
.
Die H2O-Geschäfte
Ob Wasser als ganz besonderes Gut dem Kommerz überlassen werden darf, ist umstritten. Doch der Kampf um den Milliardenmarkt hat längst begonnen
Von Fritz Vorholz
Die wichtigen Dinge im Leben wissen viele Menschen erst zu schätzen, wenn sie fehlen. Wasser ist so ein Ding. Manche sagen, es sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Andere behaupten, es sei wertvoller als Gold.
Wasser ist jedenfalls vielerorts schon knapp – so knapp, dass die Vereinten Nationen in einem gerade erschienen Bericht von einer „ernsthaften Wasserkrise“ sprechen. Verursacht sei die Not „im Wesentlichen durch unsere falsche Bewirtschaftung von Wasser“, heißt es in dem Report. Im Klartext: Misswirtschaft kennzeichnet den Umgang mit Wasser, dem Lebensmittel Nummer eins.
Der Vorwurf trifft mehr als 100 Staaten und Hunderttausende Kommunen; schließlich wird Wasser weltweit von öffentlichen Betrieben bewirtschaftet. Mehr schlecht als recht: In vielen Leitungen klaffen Löcher, mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu einer ordentlichen Wasserversorgung, das Abwasser von 2,4 Milliarden wird nicht angemessen entsorgt, 95 Prozent aller Großstädte leiten ihr Schmutzwasser ungereinigt in Flüsse, Seen und ins Meer.
Das Wasser und die Wassernöte beflügeln deshalb längst die Fantasie vieler Unternehmen. Geschäfte mit Wasser gelten sogar als der Megatrend des neuen Jahrhunderts. Der Essener Stromriese RWE hat sich durch den Kauf des britischen Versorgers Thames Water und der American Water Works bereits zur Nummer drei auf dem Weltwassermarkt emporgearbeitet. „Wir erwarten, dass Wasser der profitabelste Bereich im Konzern wird“, sagt Klaus Sturany, Finanzchef der RWE-Holding.
Wasser bewegt immense Dollar-Summen. Nach der vorsichtigen Schätzung des Tübinger Unternehmensberaters Helmut Kaiser belief sich der weltweite Umsatz mit Trinkwasser aus der Leitung im vergangenen Jahr auf 86 Milliarden Dollar. Bis zum Jahr 2010, glaubt Kaiser, werden daraus mehr als 150 Milliarden Dollar. Hinzu kommen weitere Milliardensummen aus dem Abwassergeschäft.
Gehört Wasser ins Rathaus – oder an die Börse?
Das Wirtschaftsmagazin Fortune riet seinen Lesern schon vor zwei Jahren: „Wenn Sie nach einer sicheren Aktienanlage suchen, die dauerhafte Renditen verspricht, versuchen Sie es mit der ultimativen Alternative zum Internet: Wasser.“ Angesichts solch glänzender Aussichten für Anleger schwant Nik Geiler, dem Wasserexperten beim Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), nichts Gutes: Demnächst, meint er, regiere der Shareholder-Value sogar in der Küche und auf dem Klo.
Na und? Nur wenn Wasser eine Ware wird, gehen die Menschen auch pfleglich damit um, meinen die einen. Wasser, sagen die anderen, ist Menschenrecht, ein ganz besonderes Gut, das dem Kommerz nicht preisgegeben werden darf. Es gehöre ins Rathaus – nicht an die Börse.
Der Griff der Konzerne nach dem lebensnotwendigen Nass ist bereits zum Top-Thema der Globalisierungskritiker avanciert. In diesen Tagen erscheint auf dem deutschen Markt das Buch Blaues Gold; es hat das Zeug, zur neuen Bibel aller Privatisierungs- und Freihandelskritiker zu werden. Das globale Geschäft mit dem Wasser führt nach Ansicht der beiden kanadischen Autoren direkt ins Fiasko: „Allen, die nicht zahlen können, wird der Hahn zugedreht. Bei den Konzernen freilich sprudeln die Gewinne.“
Noch sprudeln sie nur spärlich. Noch dreht die private Wirtschaft nicht das ganz große Rad. Bisher hat sie sich kaum zehn Prozent des globalen Wassermarktes sichern können. Die drei größten Konzerne – Suez, Vivendi Water und RWE – bringen es nicht einmal auf 300 Millionen Kunden. 300 Millionen von mehr als 6 Milliarden Menschen.
Der Grund: Als die Städte im 19. Jahrhundert rasch wuchsen, war die private Wirtschaft nicht zur Stelle. Es waren die Kommunen, die für den Bau und den Betrieb der Wasserinfrastruktur sorgten. So ist es bis heute geblieben. Rund 90 Prozent des weltweiten Wassergeschäftes werden unter öffentlicher Regie abgewickelt: von kommunalen Eigenbetrieben, Zweckverbänden oder auch von Aktiengesellschaften in öffentlichem Eigentum. Denen muss die Privatwirtschaft die Kundschaft erst einmal abjagen. Je erfolgreicher sie dabei auf ihren Heimatmärkten ist, desto besser sind die Aussichten auf dem weltweiten Markt. Um aus Wasser Geld zu machen, ist viel Kapital vonnöten – viel mehr, als das Gros der kleinen Wasserunternehmen hat.
In den Vereinigten Staaten, dem weltweit größten Wassermarkt, tummeln sich mehr als 50000 kleiner und kleinster Betriebe. Hierzulande sind es fast 7000, darunter einige Riesen wie die Hamburger Wasserwerke mit zwei Millionen Kunden und viele Zwerge wie der Wasserbeschaffungsverband Lichtringhausen. Er versorgt in einem Ortsteil des sauerländischen Städtchens Attendorn gerade einmal 500 Menschen.
Leitungswasser ist in Deutschland zwar teurer als anderswo – in Frankreich kostet der Liter 0,11 Cent, in England 0,12 und hierzulande 0,18 Cent. Indes sollte sich „kein Verbraucher beschweren“, meinen die Beobachter der Beratungsfirma National Utility Service (NUS), die seit langem Wasserpreise international vergleicht. Schließlich weise in Deutschland die Qualität „weltweit den höchsten Standard“ auf.
Dennoch ist die hiesige Wasserwirtschaft in die Kritik geraten. Ausgelöst hat die Debatte eine Expertengruppe der Weltbank, die 1994 die Branche begutachtete. Das Zeugnis: Das technische Niveau sei zwar hoch – aber die Effizienz zu gering.
Kein Wunder. Jedes Wasserwerk, ob klein oder groß, verfügt über ein veritables Monopol: über das exklusive Recht, Letztverbraucher mit Trinkwasser zu versorgen. Abgesichert ist es in Paragraf 103 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Nachdem der Strommarkt von den Monopolfesseln befreit war, dachte die rot-grüne Regierung auch über Wettbewerb in der Wasserwirtschaft nach. Der frühere Wirtschaftsminister Werner Müller ließ Gutachter die Möglichkeiten dafür eruieren. Zur Debatte standen zwei Modelle: Wettbewerb im Markt käme zustande, wenn mehrere Anbieter, wie beim Strom, ein und dieselbe Leitung benutzen würden. Wettbewerb um den Markt würde geschaffen, wenn verschiedene Anbieter um das zeitlich befristete Recht zur Wasserversorgung konkurrieren würden.
Die deutsche Wasserwirtschaft gilt als „Bremsklotz im Weltmarkt“
Obwohl Müllers Gutachter durchaus guter Dinge waren, bewirkte ihre Expertise bisher wenig – außer einen Sturm der Entrüstung. Gegengutachter, beispielsweise des Umweltbundesamtes, gaben „schwerwiegende Bedenken“ gegen die Pläne zur Wasserliberalisierung zu Protokoll. Und es meldete sich eine große politische Koalition zu Wort: Verbraucheranwälte, Umweltschützer, Kommunalpolitiker, dazu Grüne, Sozialdemokraten und Unionschristen. „Wenn die Wasserversorgung dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen wird“, wetterte beispielsweise der bayerische Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Reinhold Bocklet (CSU), seien Versorgungssicherheit und akzeptable Preise gefährdet. Der Bundestag wies alle Liberalisierungspläne als „Experiment mit ungewissen Folgen“ zurück.
Gleichwohl, die jahrelange Debatte hinterließ Spuren. An der hiesigen Wasserwirtschaft blieb der Makel der Rückständigkeit kleben, sie galt fortan, wie es in einer Studie der Deutschen Bank heißt, als „Bremsklotz im Weltmarkt“. Auch die eigentlich wettbewerbsunwilligen rot-grünen Parlamentarier sahen in ihrem Bundestagsbeschluss immerhin Bedarf für eine „Modernisierungsstrategie“. Ziel: „größere Betriebseinheiten“ und so genannte Public-Private Partnerships, die Zusammenarbeit von Kommunen und privaten Unternehmen. Nur dann könnten die „erheblichen Chancen“ genutzt werden, die sich auf den internationalen Märkten böten.
Bisher erzwingt zwar kein einziges neues Gesetz den Einstieg privater Unternehmen in die kommunale Wasserwirtschaft; gleichwohl erobern die Wassermultis Schritt für Schritt den deutschen Markt. Des Rätsels Lösung: „Wachsende Finanzknappheit“, so Ulrich Oehmichen vom Branchenverband BGW, treibe Stadtwerke und kommunale Wasserversorger scharenweise in die Arme der Privatwirtschaft. Der spektakulärste Coup gelang den Konkurrenten RWE und Vivendi gemeinsam: Für rund 1,7 Milliarden Euro kauften die beiden Global Player der hoch verschuldeten Hauptstadt Berlin 49,9 Prozent ihres Wasserwerks ab.
Die Konzerne pflegen indes auch die Provinz – oft mit erstaunlichen Ergebnissen. Der Vivendi-Water-Ableger Midewa bescherte dem südlichen Sachsen-Anhalt sinkende Wasserpreise. Und im sächsischen Döbeln gelang es Vivendi, binnen kurzem die immensen Leitungsverluste von bis zu 40 Prozent um rund zwei Drittel zu senken. Vivendi besitzt eben die teuren Spezialgeräte zum Aufspüren und Reparieren von Leitungslecks – der Wasserverband Döbeln-Oschatz nicht.
Was aber ist Döbeln gegen eine Metropole wie Peking? Gegen Lagos, Istanbul oder Kathmandu? Ebenso wie viele Städte und Gemeinden in Deutschland versuchten Kommunen weltweit, „über die Privatisierung des Wassersektors ihr allgemeines Haushaltsdefizit zu mindern“, stellte eine Enquete-Kommission des Bundestages im vergangenen Jahr fest.
Das Ergebnis dieser Bemühungen listet das Fachblatt Global Water Intelligence jeden Monat akribisch auf: Es informiert, wo sich den Wasserversorgern gerade Chancen bieten. Die Geschäftsprinzipien: Entweder beteiligen sich die Privaten direkt an den öffentlichen Betrieben – oder sie erwerben für eine mehr oder weniger saftige Gebühr das Recht zur Wasserversorgung, meist für 20 Jahre oder mehr und mit Auflagen versehen. Günstige Kredite, beispielsweise der Weltbank, helfen den Multis anschließend oft beim Investieren. Besonders interessiert die Konzerne das so genannte non revenue water – jenes Wasser, das bisher nicht zu Geld wurde, weil es durch Leitungslecks entfleuchte oder weil die Gebühren dafür nicht konsequent eingetrieben wurden. In Brasilien, kein untypischer Fall, bleiben so 45 Prozent des kostbaren Nasses unbezahlt. Solche Verluste zu vermindern sei „eine attraktive Geschäftsgelegenheit“, heißt es in einem Report über den Markt des größten südamerikanischen Landes.
Die Nase vorn haben regelmäßig zwei französische Infrastrukturkonzerne: Vivendi Water und Suez, dessen Wassertochter Ondeo in 130 Ländern präsent ist und weltweit mehr als 60000 Menschen beschäftigt. Weil der französische Staat bereits im 19. Jahrhundert die Wasserdienste privaten Anbietern überließ, konnten Suez und Vivendi in ihrem Heimatmarkt groß genug werden, um nun im internationalen Geschäft die erste Geige spielen zu können. „Schon heute übersteigt die Nachfrage von Städten, die mit Profis wie uns zusammenarbeiten wollen, unsere Möglichkeiten“, sagt Olivier Barbaroux, der Präsident von Vivendi Water.
Der Konzern versorgt bereits Kalkutta mit Wasser, des Weiteren Tanger und Tetouan, dazu Nairobi und Prag. Im vergangenen Jahr kamen 550000 Einwohner der chinesischen Megametropole Shanghai dazu. Ondeo sicherte sich Tschungking, Chinas viertgrößte Stadt. Manila, Jakarta und Buenos Aires führt Ondeo ebenfalls auf der Kundenliste. Unter anderen.
Lediglich einige britische Versorger konnten bis vor kurzem den französischen Multis das Wasser reichen. Die damalige Premierministerin Margaret Thatcher hatte sie 1989 privatisiert. Den größten Betrieb, Thames Water, kaufte RWE – und machte ihn zur Führungsgesellschaft seiner Wassersparte. Damit verschafften sich die Essener die Eintrittskarte für den globalen Markt. Mittlerweile ist auch RWE in aller Welt vor Ort – in Hongkong, in Adelaide und auch in Shanghai.
Doch wer mit Wasser handelt, handelt sich auch Ärger ein. Die Privatisierung der englischen Wasserbehörden wurde sogar zu einem Politikum. Es stiegen nicht nur die Preise, sondern auch die Dividendenzahlungen, die Managergehälter und die Gewinne der privaten Wassermonopole. Die Aufsichtsbehörde OFWAT verordnete deshalb bereits einmal eine zwölfprozentige Wasserpreissenkung – während der britische Umweltminister sich despektierlich über die Leistungen von Thames Water ausließ: Sie gäben „Anlass zu großer Sorge“.
Werner Böttcher, der im Vorstand von Thames Water sitzt, macht keinen Hehl daraus, dass private Wasserversorger keine Wohltätigkeitsorganisationen sind: „Ein Gewinn muss unten rauskommen“, sagt er. Ganz klar. Zuweilen nimmt das Gewinnstreben aber unanständige Ausmaße an – und bringt die Wassermultis in Verruf.
Der jüngste Fall: Ende Januar beendeten United Water, ein Ableger von Suez, und die amerikanische Stadt Atlanta ihre eigentlich auf 20 Jahre angelegte Zusammenarbeit vorzeitig. Eine weitere Kooperation sei „nicht im besten Interesse der Stadt und ihrer Wasserkunden“, ließ die Bürgermeisterin Shirley Franklin wissen. Die in einer weltweiten Allianz namens Water for all vereinten Privatisierungsgegner feierten das Scheitern als großen Sieg.
Ob in Atlanta oder anderswo – die privaten Versorger, die sich, wie Vivendi Water, der „vollkommenen Beherrschung des Wasserkreislaufs“ rühmen, machen es tatsächlich nicht zwangsläufig besser als die öffentlichen Betriebe, unter deren Regie der Wassernotstand wachsen konnte. Zu traurigem Ruhm brachte es der „Wasserkrieg“ im bolivianischen Cochabamba. Auf Drängen der Weltbank überließen die Behörden dort vor vier Jahren einem internationalen Konsortium die Wasserwerke. Als die Preise stiegen, protestierten die Bewohner. Die Polizei hielt die Demonstranten mit Tränengas in Schach, später wurde scharf geschossen. Am 8.April 2000 traf eine Kugel den 17-jährigen Victor Hugo Daza Argadoña in den Kopf. Erst danach wurde der Vertrag mit dem Wasserkonsortium aufgelöst. Die Geschichte von Cochabamba, heißt es in einem Report der Greenwich-Universität, sei „nicht nur eine bolivianische Geschichte“.
Tatsächlich sind laut Bericht der Globalisierungs-Enquete-Kommission des Bundestages die Erfahrungen mit der Wasserprivatisierung durchaus zwiespältig. „Schlechtes privates Management“ sei zwar nicht die Regel, aber auch „keine Seltenheit“.
Gleichwohl ist der Privatisierungsprozess kaum zu stoppen. Womöglich sorgt dafür demnächst sogar mehr als nur die weltweite Finanznot der Kommunen. Wie aus geheimen, nur durch Indiskretion bekannt gewordenen Dokumenten hervorgeht, will die EU im Rahmen der Welthandelsrunde mit mehr als 70 Ländern auch über ein so sensibles Thema wie die Trinkwasserversorgung verhandeln. Es drohe, so Thomas Fritz vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac, „ein Dammbruch, ein Frontalangriff auf die staatliche Daseinsvorsorge“.
Wer am ärgsten unter Wassernot leidet, hat vom freien Wassermarkt übrigens am wenigsten zu erwarten. Das Gros jener 1,1 Milliarden Menschen ohne Wasser lebt in den Dörfern der Entwicklungsländer. An deren Versorgung aber ist das H2O-Business gar nicht interessiert.
Die H2O-Geschäfte
Ob Wasser als ganz besonderes Gut dem Kommerz überlassen werden darf, ist umstritten. Doch der Kampf um den Milliardenmarkt hat längst begonnen
Von Fritz Vorholz
Die wichtigen Dinge im Leben wissen viele Menschen erst zu schätzen, wenn sie fehlen. Wasser ist so ein Ding. Manche sagen, es sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Andere behaupten, es sei wertvoller als Gold.
Wasser ist jedenfalls vielerorts schon knapp – so knapp, dass die Vereinten Nationen in einem gerade erschienen Bericht von einer „ernsthaften Wasserkrise“ sprechen. Verursacht sei die Not „im Wesentlichen durch unsere falsche Bewirtschaftung von Wasser“, heißt es in dem Report. Im Klartext: Misswirtschaft kennzeichnet den Umgang mit Wasser, dem Lebensmittel Nummer eins.
Der Vorwurf trifft mehr als 100 Staaten und Hunderttausende Kommunen; schließlich wird Wasser weltweit von öffentlichen Betrieben bewirtschaftet. Mehr schlecht als recht: In vielen Leitungen klaffen Löcher, mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu einer ordentlichen Wasserversorgung, das Abwasser von 2,4 Milliarden wird nicht angemessen entsorgt, 95 Prozent aller Großstädte leiten ihr Schmutzwasser ungereinigt in Flüsse, Seen und ins Meer.
Das Wasser und die Wassernöte beflügeln deshalb längst die Fantasie vieler Unternehmen. Geschäfte mit Wasser gelten sogar als der Megatrend des neuen Jahrhunderts. Der Essener Stromriese RWE hat sich durch den Kauf des britischen Versorgers Thames Water und der American Water Works bereits zur Nummer drei auf dem Weltwassermarkt emporgearbeitet. „Wir erwarten, dass Wasser der profitabelste Bereich im Konzern wird“, sagt Klaus Sturany, Finanzchef der RWE-Holding.
Wasser bewegt immense Dollar-Summen. Nach der vorsichtigen Schätzung des Tübinger Unternehmensberaters Helmut Kaiser belief sich der weltweite Umsatz mit Trinkwasser aus der Leitung im vergangenen Jahr auf 86 Milliarden Dollar. Bis zum Jahr 2010, glaubt Kaiser, werden daraus mehr als 150 Milliarden Dollar. Hinzu kommen weitere Milliardensummen aus dem Abwassergeschäft.
Gehört Wasser ins Rathaus – oder an die Börse?
Das Wirtschaftsmagazin Fortune riet seinen Lesern schon vor zwei Jahren: „Wenn Sie nach einer sicheren Aktienanlage suchen, die dauerhafte Renditen verspricht, versuchen Sie es mit der ultimativen Alternative zum Internet: Wasser.“ Angesichts solch glänzender Aussichten für Anleger schwant Nik Geiler, dem Wasserexperten beim Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), nichts Gutes: Demnächst, meint er, regiere der Shareholder-Value sogar in der Küche und auf dem Klo.
Na und? Nur wenn Wasser eine Ware wird, gehen die Menschen auch pfleglich damit um, meinen die einen. Wasser, sagen die anderen, ist Menschenrecht, ein ganz besonderes Gut, das dem Kommerz nicht preisgegeben werden darf. Es gehöre ins Rathaus – nicht an die Börse.
Der Griff der Konzerne nach dem lebensnotwendigen Nass ist bereits zum Top-Thema der Globalisierungskritiker avanciert. In diesen Tagen erscheint auf dem deutschen Markt das Buch Blaues Gold; es hat das Zeug, zur neuen Bibel aller Privatisierungs- und Freihandelskritiker zu werden. Das globale Geschäft mit dem Wasser führt nach Ansicht der beiden kanadischen Autoren direkt ins Fiasko: „Allen, die nicht zahlen können, wird der Hahn zugedreht. Bei den Konzernen freilich sprudeln die Gewinne.“
Noch sprudeln sie nur spärlich. Noch dreht die private Wirtschaft nicht das ganz große Rad. Bisher hat sie sich kaum zehn Prozent des globalen Wassermarktes sichern können. Die drei größten Konzerne – Suez, Vivendi Water und RWE – bringen es nicht einmal auf 300 Millionen Kunden. 300 Millionen von mehr als 6 Milliarden Menschen.
Der Grund: Als die Städte im 19. Jahrhundert rasch wuchsen, war die private Wirtschaft nicht zur Stelle. Es waren die Kommunen, die für den Bau und den Betrieb der Wasserinfrastruktur sorgten. So ist es bis heute geblieben. Rund 90 Prozent des weltweiten Wassergeschäftes werden unter öffentlicher Regie abgewickelt: von kommunalen Eigenbetrieben, Zweckverbänden oder auch von Aktiengesellschaften in öffentlichem Eigentum. Denen muss die Privatwirtschaft die Kundschaft erst einmal abjagen. Je erfolgreicher sie dabei auf ihren Heimatmärkten ist, desto besser sind die Aussichten auf dem weltweiten Markt. Um aus Wasser Geld zu machen, ist viel Kapital vonnöten – viel mehr, als das Gros der kleinen Wasserunternehmen hat.
In den Vereinigten Staaten, dem weltweit größten Wassermarkt, tummeln sich mehr als 50000 kleiner und kleinster Betriebe. Hierzulande sind es fast 7000, darunter einige Riesen wie die Hamburger Wasserwerke mit zwei Millionen Kunden und viele Zwerge wie der Wasserbeschaffungsverband Lichtringhausen. Er versorgt in einem Ortsteil des sauerländischen Städtchens Attendorn gerade einmal 500 Menschen.
Leitungswasser ist in Deutschland zwar teurer als anderswo – in Frankreich kostet der Liter 0,11 Cent, in England 0,12 und hierzulande 0,18 Cent. Indes sollte sich „kein Verbraucher beschweren“, meinen die Beobachter der Beratungsfirma National Utility Service (NUS), die seit langem Wasserpreise international vergleicht. Schließlich weise in Deutschland die Qualität „weltweit den höchsten Standard“ auf.
Dennoch ist die hiesige Wasserwirtschaft in die Kritik geraten. Ausgelöst hat die Debatte eine Expertengruppe der Weltbank, die 1994 die Branche begutachtete. Das Zeugnis: Das technische Niveau sei zwar hoch – aber die Effizienz zu gering.
Kein Wunder. Jedes Wasserwerk, ob klein oder groß, verfügt über ein veritables Monopol: über das exklusive Recht, Letztverbraucher mit Trinkwasser zu versorgen. Abgesichert ist es in Paragraf 103 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Nachdem der Strommarkt von den Monopolfesseln befreit war, dachte die rot-grüne Regierung auch über Wettbewerb in der Wasserwirtschaft nach. Der frühere Wirtschaftsminister Werner Müller ließ Gutachter die Möglichkeiten dafür eruieren. Zur Debatte standen zwei Modelle: Wettbewerb im Markt käme zustande, wenn mehrere Anbieter, wie beim Strom, ein und dieselbe Leitung benutzen würden. Wettbewerb um den Markt würde geschaffen, wenn verschiedene Anbieter um das zeitlich befristete Recht zur Wasserversorgung konkurrieren würden.
Die deutsche Wasserwirtschaft gilt als „Bremsklotz im Weltmarkt“
Obwohl Müllers Gutachter durchaus guter Dinge waren, bewirkte ihre Expertise bisher wenig – außer einen Sturm der Entrüstung. Gegengutachter, beispielsweise des Umweltbundesamtes, gaben „schwerwiegende Bedenken“ gegen die Pläne zur Wasserliberalisierung zu Protokoll. Und es meldete sich eine große politische Koalition zu Wort: Verbraucheranwälte, Umweltschützer, Kommunalpolitiker, dazu Grüne, Sozialdemokraten und Unionschristen. „Wenn die Wasserversorgung dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen wird“, wetterte beispielsweise der bayerische Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Reinhold Bocklet (CSU), seien Versorgungssicherheit und akzeptable Preise gefährdet. Der Bundestag wies alle Liberalisierungspläne als „Experiment mit ungewissen Folgen“ zurück.
Gleichwohl, die jahrelange Debatte hinterließ Spuren. An der hiesigen Wasserwirtschaft blieb der Makel der Rückständigkeit kleben, sie galt fortan, wie es in einer Studie der Deutschen Bank heißt, als „Bremsklotz im Weltmarkt“. Auch die eigentlich wettbewerbsunwilligen rot-grünen Parlamentarier sahen in ihrem Bundestagsbeschluss immerhin Bedarf für eine „Modernisierungsstrategie“. Ziel: „größere Betriebseinheiten“ und so genannte Public-Private Partnerships, die Zusammenarbeit von Kommunen und privaten Unternehmen. Nur dann könnten die „erheblichen Chancen“ genutzt werden, die sich auf den internationalen Märkten böten.
Bisher erzwingt zwar kein einziges neues Gesetz den Einstieg privater Unternehmen in die kommunale Wasserwirtschaft; gleichwohl erobern die Wassermultis Schritt für Schritt den deutschen Markt. Des Rätsels Lösung: „Wachsende Finanzknappheit“, so Ulrich Oehmichen vom Branchenverband BGW, treibe Stadtwerke und kommunale Wasserversorger scharenweise in die Arme der Privatwirtschaft. Der spektakulärste Coup gelang den Konkurrenten RWE und Vivendi gemeinsam: Für rund 1,7 Milliarden Euro kauften die beiden Global Player der hoch verschuldeten Hauptstadt Berlin 49,9 Prozent ihres Wasserwerks ab.
Die Konzerne pflegen indes auch die Provinz – oft mit erstaunlichen Ergebnissen. Der Vivendi-Water-Ableger Midewa bescherte dem südlichen Sachsen-Anhalt sinkende Wasserpreise. Und im sächsischen Döbeln gelang es Vivendi, binnen kurzem die immensen Leitungsverluste von bis zu 40 Prozent um rund zwei Drittel zu senken. Vivendi besitzt eben die teuren Spezialgeräte zum Aufspüren und Reparieren von Leitungslecks – der Wasserverband Döbeln-Oschatz nicht.
Was aber ist Döbeln gegen eine Metropole wie Peking? Gegen Lagos, Istanbul oder Kathmandu? Ebenso wie viele Städte und Gemeinden in Deutschland versuchten Kommunen weltweit, „über die Privatisierung des Wassersektors ihr allgemeines Haushaltsdefizit zu mindern“, stellte eine Enquete-Kommission des Bundestages im vergangenen Jahr fest.
Das Ergebnis dieser Bemühungen listet das Fachblatt Global Water Intelligence jeden Monat akribisch auf: Es informiert, wo sich den Wasserversorgern gerade Chancen bieten. Die Geschäftsprinzipien: Entweder beteiligen sich die Privaten direkt an den öffentlichen Betrieben – oder sie erwerben für eine mehr oder weniger saftige Gebühr das Recht zur Wasserversorgung, meist für 20 Jahre oder mehr und mit Auflagen versehen. Günstige Kredite, beispielsweise der Weltbank, helfen den Multis anschließend oft beim Investieren. Besonders interessiert die Konzerne das so genannte non revenue water – jenes Wasser, das bisher nicht zu Geld wurde, weil es durch Leitungslecks entfleuchte oder weil die Gebühren dafür nicht konsequent eingetrieben wurden. In Brasilien, kein untypischer Fall, bleiben so 45 Prozent des kostbaren Nasses unbezahlt. Solche Verluste zu vermindern sei „eine attraktive Geschäftsgelegenheit“, heißt es in einem Report über den Markt des größten südamerikanischen Landes.
Die Nase vorn haben regelmäßig zwei französische Infrastrukturkonzerne: Vivendi Water und Suez, dessen Wassertochter Ondeo in 130 Ländern präsent ist und weltweit mehr als 60000 Menschen beschäftigt. Weil der französische Staat bereits im 19. Jahrhundert die Wasserdienste privaten Anbietern überließ, konnten Suez und Vivendi in ihrem Heimatmarkt groß genug werden, um nun im internationalen Geschäft die erste Geige spielen zu können. „Schon heute übersteigt die Nachfrage von Städten, die mit Profis wie uns zusammenarbeiten wollen, unsere Möglichkeiten“, sagt Olivier Barbaroux, der Präsident von Vivendi Water.
Der Konzern versorgt bereits Kalkutta mit Wasser, des Weiteren Tanger und Tetouan, dazu Nairobi und Prag. Im vergangenen Jahr kamen 550000 Einwohner der chinesischen Megametropole Shanghai dazu. Ondeo sicherte sich Tschungking, Chinas viertgrößte Stadt. Manila, Jakarta und Buenos Aires führt Ondeo ebenfalls auf der Kundenliste. Unter anderen.
Lediglich einige britische Versorger konnten bis vor kurzem den französischen Multis das Wasser reichen. Die damalige Premierministerin Margaret Thatcher hatte sie 1989 privatisiert. Den größten Betrieb, Thames Water, kaufte RWE – und machte ihn zur Führungsgesellschaft seiner Wassersparte. Damit verschafften sich die Essener die Eintrittskarte für den globalen Markt. Mittlerweile ist auch RWE in aller Welt vor Ort – in Hongkong, in Adelaide und auch in Shanghai.
Doch wer mit Wasser handelt, handelt sich auch Ärger ein. Die Privatisierung der englischen Wasserbehörden wurde sogar zu einem Politikum. Es stiegen nicht nur die Preise, sondern auch die Dividendenzahlungen, die Managergehälter und die Gewinne der privaten Wassermonopole. Die Aufsichtsbehörde OFWAT verordnete deshalb bereits einmal eine zwölfprozentige Wasserpreissenkung – während der britische Umweltminister sich despektierlich über die Leistungen von Thames Water ausließ: Sie gäben „Anlass zu großer Sorge“.
Werner Böttcher, der im Vorstand von Thames Water sitzt, macht keinen Hehl daraus, dass private Wasserversorger keine Wohltätigkeitsorganisationen sind: „Ein Gewinn muss unten rauskommen“, sagt er. Ganz klar. Zuweilen nimmt das Gewinnstreben aber unanständige Ausmaße an – und bringt die Wassermultis in Verruf.
Der jüngste Fall: Ende Januar beendeten United Water, ein Ableger von Suez, und die amerikanische Stadt Atlanta ihre eigentlich auf 20 Jahre angelegte Zusammenarbeit vorzeitig. Eine weitere Kooperation sei „nicht im besten Interesse der Stadt und ihrer Wasserkunden“, ließ die Bürgermeisterin Shirley Franklin wissen. Die in einer weltweiten Allianz namens Water for all vereinten Privatisierungsgegner feierten das Scheitern als großen Sieg.
Ob in Atlanta oder anderswo – die privaten Versorger, die sich, wie Vivendi Water, der „vollkommenen Beherrschung des Wasserkreislaufs“ rühmen, machen es tatsächlich nicht zwangsläufig besser als die öffentlichen Betriebe, unter deren Regie der Wassernotstand wachsen konnte. Zu traurigem Ruhm brachte es der „Wasserkrieg“ im bolivianischen Cochabamba. Auf Drängen der Weltbank überließen die Behörden dort vor vier Jahren einem internationalen Konsortium die Wasserwerke. Als die Preise stiegen, protestierten die Bewohner. Die Polizei hielt die Demonstranten mit Tränengas in Schach, später wurde scharf geschossen. Am 8.April 2000 traf eine Kugel den 17-jährigen Victor Hugo Daza Argadoña in den Kopf. Erst danach wurde der Vertrag mit dem Wasserkonsortium aufgelöst. Die Geschichte von Cochabamba, heißt es in einem Report der Greenwich-Universität, sei „nicht nur eine bolivianische Geschichte“.
Tatsächlich sind laut Bericht der Globalisierungs-Enquete-Kommission des Bundestages die Erfahrungen mit der Wasserprivatisierung durchaus zwiespältig. „Schlechtes privates Management“ sei zwar nicht die Regel, aber auch „keine Seltenheit“.
Gleichwohl ist der Privatisierungsprozess kaum zu stoppen. Womöglich sorgt dafür demnächst sogar mehr als nur die weltweite Finanznot der Kommunen. Wie aus geheimen, nur durch Indiskretion bekannt gewordenen Dokumenten hervorgeht, will die EU im Rahmen der Welthandelsrunde mit mehr als 70 Ländern auch über ein so sensibles Thema wie die Trinkwasserversorgung verhandeln. Es drohe, so Thomas Fritz vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac, „ein Dammbruch, ein Frontalangriff auf die staatliche Daseinsvorsorge“.
Wer am ärgsten unter Wassernot leidet, hat vom freien Wassermarkt übrigens am wenigsten zu erwarten. Das Gros jener 1,1 Milliarden Menschen ohne Wasser lebt in den Dörfern der Entwicklungsländer. An deren Versorgung aber ist das H2O-Business gar nicht interessiert.
.
Ohne Motor, ohne Treibstoff
Aufschwung nach dem Irak-Krieg?
Kaum: In Amerika, Deutschland und Japan bleibt die Wirtschaft gelähmt
von Robert von Heusinger, Christian Tenbrock und Wolfgang Uchatius
Ökonomen sind Zyniker. Die halbe Welt hat Angst vor einem Krieg im Irak, Konjunkturforscher und Aktienanalysten aber hoffen auf die Kraft der Bomben. Eine kurze und erfolgreiche Schlacht am Golf, so das Kalkül, ließe die Ölpreise fallen, die Aktienkurse steigen und die Wirtschaft endlich wieder wachsen. In Deutschland nähme die Arbeitslosigkeit ab, und Finanzminister Hans Eichel hätte wieder mehr Geld in der Kasse. Die Welt wäre eine bessere, zumindest materiell gesehen.
Ökonomen sind Menschenkenner. Seit Monaten, sagen sie, seien Anleger, Verbraucher und Unternehmer von einem Gefühl tiefer Unsicherheit erfüllt. Die Angst vor dem Krieg habe die Aktienkurse um etwa 20 Prozent gedrückt, schätzt der Vermögensverwalter Gottfried Heller. Sie sei mit schuld, dass die Deutschen derzeit so wenig einkaufen, analysiert das Marktforschungsinstitut GfK. Sie nehme manchen Unternehmen die Lust zu investieren, meint Norbert Walter, Chefökonom der Deutschen Bank in Frankfurt.
Ein kurzer, schneller Krieg – und die Unsicherheit wäre beseitigt. Meinen jedenfalls Optimisten wie Alan Greenspan, Chef der amerikanischen Notenbank. Rund um den Globus würde die Wirtschaft wieder in Gang kommen, prognostiziert auch das Center for Strategic and International Studies in Washington. Der ersehnte Aufschwung könnte beginnen – in Amerika, in Europa, in Deutschland.
Diese Hoffnung trügt.
Zwar wäre eine kurze Schlacht in jeder Hinsicht besser als ein langwieriger Feldzug. „Aber es ist verfehlt zu glauben, dann würde sich ein nachhaltiger Aufschwung einstellen“, warnt Thomas Mayer, Europa-Chefvolkswirt der Deutschen Bank in London.
Ob Krieg oder Frieden, schneller oder blutiger Sieg – auch nach dem Ende des Konflikts am Golf wird sich die Wirtschaft so schnell nicht erholen. Amerika, Deutschland und Japan stehen keineswegs vor einem neuen Boom – ihnen droht weitere Stagnation oder sogar ein erneuter Einbruch. Was mit dem Absturz der New-Economy-Aktien begann und zunächst nach einer kurzen Konjunkturflaute aussah, hat sich zur längsten Wirtschaftskrise seit 20 Jahren entwickelt.
Zu einer Krise „von neuer Qualität“, sagt Gustav Horn, Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW). Eine Krise, die nicht dem bekannten Muster folgt, weil sich Unternehmer, Anleger und Konsumenten auf beiden Seiten des Atlantiks anders verhalten als früher.
Die Vorgeschichte
So wie die Amerikaner in diesen Tagen der ganzen Welt ihre militärische Potenz vorführen, so trieben sie Ende der neunziger Jahre die globale Ökonomie voran. Zwischen 1995 und 2000 erzeugten die USA 40 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums. 280 Millionen Amerikaner – fünf Prozent der Weltbevölkerung – nahmen 25 Prozent der weltweit produzierten Güter und Dienstleistungen ab. Angetrieben vom amerikanischen Boom verzeichnete auch Deutschland im Jahr 2000 ein Wirtschaftswachstum von rund drei Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen sank auf 3,7 Millionen. Amerika war der Motor der Weltwirtschaft, sein Treibstoff war der Glaube an die New Economy. Dieses Wirtschaftswunder aber, sagt Gail Fosler, Chefökonomin des Forschungsinstituts Conference Board in New York, „ist Vergangenheit“. Die Gegenwart sind überschuldete Konsumenten, nicht ausgelastete Fabriken und riesige Defizite in der Handels- und Leistungsbilanz. Der Motor der Welt ist ins Stocken geraten.
Die Amerikaner
In der Internet-Euphorie investierten Manager aus den USA, als ob es nie wieder einen Abschwung gäbe. Weshalb jetzt, in der Krise, eines der klassischen ökonomischen Aufputschmittel nicht wirkt: billiges Geld. Ein ums andere Mal hat Zentralbankchef Alan Greenspan die Zinsen gesenkt. Doch immer noch stehen in zu vielen Unternehmen zu viele Computer und Maschinen in zu großen Büros und Fabriken. Die Kapazitäten der US-Industrie sind nur zu 75 Prozent ausgelastet. Neue Investitionen? Kein Bedarf – egal, wie günstig die Kredite sind.
Die amerikanischen Verbraucher dagegen haben sich bisher von niedrigen Aktienkursen und schwachen Wachstumsraten kaum schrecken lassen. Anders als in bisherigen Wirtschaftskrisen sind sie weiter einkaufen gegangen und verhinderten so das Abrutschen in eine tiefe Rezession. Aber wie lange noch? Seit Anfang 2001 gingen in Amerika 2,2 Millionen Jobs verloren. Das Verbrauchervertrauen ist auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Statt zu steigen und einen neuen Aufschwung zu generieren, dürfte der private Konsum in den kommenden Monaten eher sinken – und die Krise weiter verschlimmern.
Der Dollar
Einen Großteil ihres Konsum- und Investitionsbooms finanzierten die USA mit Krediten. So wuchs das Leistungsbilanzdefizit, das entsteht, wenn ein Land mehr Geld ausgibt, als es erwirtschaftet. Im Jahr 2002 lag es bei 500 Milliarden Dollar, so hoch wie nie zuvor. In der Hoffnung auf dicke Renditen haben deutsche Konzerne, japanische Banken oder englische Investmentfonds dieses Defizit jahrelang finanziert. Aber schon jetzt schicken ausländische Anleger weniger Geld nach Amerika. Der Trend könnte sich verstärken, wenn Amerikas Börse und Wirtschaft weiter schwächeln.
Den Zahlen nach ist die amerikanische Ökonomie auch 2002 stärker gewachsen als die Wirtschaft in Euroland – aber nur, weil George Bushs Regierung sich mächtig verschuldet und den Bürgern durch Steuersenkungen zusätzliches Geld vermacht habe, sagt Martin Hüfner, Chefökonom der HypoVereinsbank. Rechne man diesen Effekt heraus, sei das Wachstum in Amerika schwächer gewesen als in Europa.
Mit Bushs Schuldenpolitik nähert sich das jährliche Haushaltsminus der USA schon jetzt der Marke von 300 Milliarden Dollar – ohne die Kosten eines Irak-Krieges. Die Defizite in Amerikas interner und externer Bilanz aber könnten internationalen Anlegern endgültig den Spaß an Wertpapieren aus den USA verderben – „und eine weitere Abwertung des Dollar in Gang setzen“, fürchtet Laura D’Andrea Tyson, Leiterin der London Business School. Nicht langsam wie bisher, sondern schnell und nachhaltig.
Ein abrupter Verfall des Dollar-Kurses und die damit verbundene Aufwertung anderer Währungen hätte gravierende Folgen für Börsen und Volkswirtschaften rund um die Erde. Sie würde die globale Ökonomie zudem „in einer Phase treffen, in der keine Region zum Wachstumsmotor taugt“, sagt Robert Hormats, Vizepräsident der New Yorker Investmentbank Goldman Sachs. Das unterscheidet die Situation heute von der Zeit vor dem Golfkrieg 1991, als alle großen Volkswirtschaften auf Hochtouren liefen. Heute steckt Japan in der Dauerkrise, Europa kämpft mit einer tiefen Wachstumsschwäche, Lateinamerika und Asien leben von ihren Exporten nach Amerika. Noch.
Die Deutschen
Während die Amerikaner in den Neunzigern weltweit einkaufen gingen, spielten die Deutschen ihre traditionelle Rolle des globalen Lieferanten. 2002 stiegen die deutschen Exporte fast viermal so stark wie der EU-Durchschnitt. Doch anders als in früheren Krisen brachte der starke Export die hiesige Wirtschaft nicht in Schwung.Der Grund, so Hypovereinsbank-Ökonom Hüfner: „Die Binnennachfrage ist tot wie ein Hund.“
Die deutschen Firmen investieren nicht.
Der Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer fand heraus, dass weit über die Hälfte aller Maschinenbauunternehmen in den nächsten drei Jahren ihre Investitionen kürzen wollen – egal, wie der Krieg im Irak verläuft. Ähnlich negativ ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 25000 Mitgliedsfirmen. Und die deutschen Verbraucher konsumieren nicht. 2002 ist der private Verbrauch zum ersten Mal seit 20 Jahren gesunken. „Das unterscheidet uns von anderen Ländern“, sagt DIW-Forscher Gustav Horn.
Vor allem unterscheidet es die jetzige von früheren Krisen. Die Rezessionen der Sechziger, Siebziger und Neunziger folgten alle einem ähnlichen Muster: Die Wirtschaft brach ein, die Wachstumszahlen rutschten kurz ins Minus, aber der Verbrauch stieg weiter. Nicht gewaltig, denn die Deutschen waren immer sparsam, aber stark genug, dass wenig später ein neuer Aufschwung begann.
Die Regierung
Diesmal ist alles anders. "Deutschland befindet sich in einer stagnativen Phase", sagt udo Ludwig, Konjunkturexperte vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Soll heißen: Die Ökonomie schrumpft zwar nicht, aber sie kommt auch nicht in Gang. Erklärungen für die Lähmung gibt es viele: die Schwäche des deutschen Ostens, die hohe Arbeitslosigkeit, eine Bankenkrise, die die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen bremst, und eine Regierung, die ihre Bürger darüber im Unklaren lässt, ob und wie viel Geld sie für Alter und Krankheit beiseite legen müssen. Die quälende und bislang ergebnislose Reformdebatte belastet Verbraucher wie Unternehmen offenbar ungleich mehr als ein möglicher Krieg: Konsum und Investitionen waren schon schwach, bevor die amerikanischen Soldaten ihre Kasernen verließen.
Auf fast 50 Prozent beziffert Konjunkturforscher Ludwig inzwischen die Möglichkeit, dass es der noch immer drittstärksten Ökonomie der Welt, Deutschland, so ergeht wie der noch immer zweitstärksten: Japan. Dort stagniert die Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren. Die Aktienkurse bewegen sich zur Seite, die Arbeitslosigkeit steigt, die Verbraucher kaufen wenig ein. Alles wie in Deutschland. Trotzdem hält Rot-Grün an dem alten Verständnis von Wirtschaftskrisen fest, wonach jedem Abschwung ein Aufschwung folgt. „Die Dauer der Krise wird völlig
Ohne Motor, ohne Treibstoff
Aufschwung nach dem Irak-Krieg?
Kaum: In Amerika, Deutschland und Japan bleibt die Wirtschaft gelähmt
von Robert von Heusinger, Christian Tenbrock und Wolfgang Uchatius
Ökonomen sind Zyniker. Die halbe Welt hat Angst vor einem Krieg im Irak, Konjunkturforscher und Aktienanalysten aber hoffen auf die Kraft der Bomben. Eine kurze und erfolgreiche Schlacht am Golf, so das Kalkül, ließe die Ölpreise fallen, die Aktienkurse steigen und die Wirtschaft endlich wieder wachsen. In Deutschland nähme die Arbeitslosigkeit ab, und Finanzminister Hans Eichel hätte wieder mehr Geld in der Kasse. Die Welt wäre eine bessere, zumindest materiell gesehen.
Ökonomen sind Menschenkenner. Seit Monaten, sagen sie, seien Anleger, Verbraucher und Unternehmer von einem Gefühl tiefer Unsicherheit erfüllt. Die Angst vor dem Krieg habe die Aktienkurse um etwa 20 Prozent gedrückt, schätzt der Vermögensverwalter Gottfried Heller. Sie sei mit schuld, dass die Deutschen derzeit so wenig einkaufen, analysiert das Marktforschungsinstitut GfK. Sie nehme manchen Unternehmen die Lust zu investieren, meint Norbert Walter, Chefökonom der Deutschen Bank in Frankfurt.
Ein kurzer, schneller Krieg – und die Unsicherheit wäre beseitigt. Meinen jedenfalls Optimisten wie Alan Greenspan, Chef der amerikanischen Notenbank. Rund um den Globus würde die Wirtschaft wieder in Gang kommen, prognostiziert auch das Center for Strategic and International Studies in Washington. Der ersehnte Aufschwung könnte beginnen – in Amerika, in Europa, in Deutschland.
Diese Hoffnung trügt.
Zwar wäre eine kurze Schlacht in jeder Hinsicht besser als ein langwieriger Feldzug. „Aber es ist verfehlt zu glauben, dann würde sich ein nachhaltiger Aufschwung einstellen“, warnt Thomas Mayer, Europa-Chefvolkswirt der Deutschen Bank in London.
Ob Krieg oder Frieden, schneller oder blutiger Sieg – auch nach dem Ende des Konflikts am Golf wird sich die Wirtschaft so schnell nicht erholen. Amerika, Deutschland und Japan stehen keineswegs vor einem neuen Boom – ihnen droht weitere Stagnation oder sogar ein erneuter Einbruch. Was mit dem Absturz der New-Economy-Aktien begann und zunächst nach einer kurzen Konjunkturflaute aussah, hat sich zur längsten Wirtschaftskrise seit 20 Jahren entwickelt.
Zu einer Krise „von neuer Qualität“, sagt Gustav Horn, Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW). Eine Krise, die nicht dem bekannten Muster folgt, weil sich Unternehmer, Anleger und Konsumenten auf beiden Seiten des Atlantiks anders verhalten als früher.
Die Vorgeschichte
So wie die Amerikaner in diesen Tagen der ganzen Welt ihre militärische Potenz vorführen, so trieben sie Ende der neunziger Jahre die globale Ökonomie voran. Zwischen 1995 und 2000 erzeugten die USA 40 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums. 280 Millionen Amerikaner – fünf Prozent der Weltbevölkerung – nahmen 25 Prozent der weltweit produzierten Güter und Dienstleistungen ab. Angetrieben vom amerikanischen Boom verzeichnete auch Deutschland im Jahr 2000 ein Wirtschaftswachstum von rund drei Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen sank auf 3,7 Millionen. Amerika war der Motor der Weltwirtschaft, sein Treibstoff war der Glaube an die New Economy. Dieses Wirtschaftswunder aber, sagt Gail Fosler, Chefökonomin des Forschungsinstituts Conference Board in New York, „ist Vergangenheit“. Die Gegenwart sind überschuldete Konsumenten, nicht ausgelastete Fabriken und riesige Defizite in der Handels- und Leistungsbilanz. Der Motor der Welt ist ins Stocken geraten.
Die Amerikaner
In der Internet-Euphorie investierten Manager aus den USA, als ob es nie wieder einen Abschwung gäbe. Weshalb jetzt, in der Krise, eines der klassischen ökonomischen Aufputschmittel nicht wirkt: billiges Geld. Ein ums andere Mal hat Zentralbankchef Alan Greenspan die Zinsen gesenkt. Doch immer noch stehen in zu vielen Unternehmen zu viele Computer und Maschinen in zu großen Büros und Fabriken. Die Kapazitäten der US-Industrie sind nur zu 75 Prozent ausgelastet. Neue Investitionen? Kein Bedarf – egal, wie günstig die Kredite sind.
Die amerikanischen Verbraucher dagegen haben sich bisher von niedrigen Aktienkursen und schwachen Wachstumsraten kaum schrecken lassen. Anders als in bisherigen Wirtschaftskrisen sind sie weiter einkaufen gegangen und verhinderten so das Abrutschen in eine tiefe Rezession. Aber wie lange noch? Seit Anfang 2001 gingen in Amerika 2,2 Millionen Jobs verloren. Das Verbrauchervertrauen ist auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Statt zu steigen und einen neuen Aufschwung zu generieren, dürfte der private Konsum in den kommenden Monaten eher sinken – und die Krise weiter verschlimmern.
Der Dollar
Einen Großteil ihres Konsum- und Investitionsbooms finanzierten die USA mit Krediten. So wuchs das Leistungsbilanzdefizit, das entsteht, wenn ein Land mehr Geld ausgibt, als es erwirtschaftet. Im Jahr 2002 lag es bei 500 Milliarden Dollar, so hoch wie nie zuvor. In der Hoffnung auf dicke Renditen haben deutsche Konzerne, japanische Banken oder englische Investmentfonds dieses Defizit jahrelang finanziert. Aber schon jetzt schicken ausländische Anleger weniger Geld nach Amerika. Der Trend könnte sich verstärken, wenn Amerikas Börse und Wirtschaft weiter schwächeln.
Den Zahlen nach ist die amerikanische Ökonomie auch 2002 stärker gewachsen als die Wirtschaft in Euroland – aber nur, weil George Bushs Regierung sich mächtig verschuldet und den Bürgern durch Steuersenkungen zusätzliches Geld vermacht habe, sagt Martin Hüfner, Chefökonom der HypoVereinsbank. Rechne man diesen Effekt heraus, sei das Wachstum in Amerika schwächer gewesen als in Europa.
Mit Bushs Schuldenpolitik nähert sich das jährliche Haushaltsminus der USA schon jetzt der Marke von 300 Milliarden Dollar – ohne die Kosten eines Irak-Krieges. Die Defizite in Amerikas interner und externer Bilanz aber könnten internationalen Anlegern endgültig den Spaß an Wertpapieren aus den USA verderben – „und eine weitere Abwertung des Dollar in Gang setzen“, fürchtet Laura D’Andrea Tyson, Leiterin der London Business School. Nicht langsam wie bisher, sondern schnell und nachhaltig.
Ein abrupter Verfall des Dollar-Kurses und die damit verbundene Aufwertung anderer Währungen hätte gravierende Folgen für Börsen und Volkswirtschaften rund um die Erde. Sie würde die globale Ökonomie zudem „in einer Phase treffen, in der keine Region zum Wachstumsmotor taugt“, sagt Robert Hormats, Vizepräsident der New Yorker Investmentbank Goldman Sachs. Das unterscheidet die Situation heute von der Zeit vor dem Golfkrieg 1991, als alle großen Volkswirtschaften auf Hochtouren liefen. Heute steckt Japan in der Dauerkrise, Europa kämpft mit einer tiefen Wachstumsschwäche, Lateinamerika und Asien leben von ihren Exporten nach Amerika. Noch.
Die Deutschen
Während die Amerikaner in den Neunzigern weltweit einkaufen gingen, spielten die Deutschen ihre traditionelle Rolle des globalen Lieferanten. 2002 stiegen die deutschen Exporte fast viermal so stark wie der EU-Durchschnitt. Doch anders als in früheren Krisen brachte der starke Export die hiesige Wirtschaft nicht in Schwung.Der Grund, so Hypovereinsbank-Ökonom Hüfner: „Die Binnennachfrage ist tot wie ein Hund.“
Die deutschen Firmen investieren nicht.
Der Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer fand heraus, dass weit über die Hälfte aller Maschinenbauunternehmen in den nächsten drei Jahren ihre Investitionen kürzen wollen – egal, wie der Krieg im Irak verläuft. Ähnlich negativ ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 25000 Mitgliedsfirmen. Und die deutschen Verbraucher konsumieren nicht. 2002 ist der private Verbrauch zum ersten Mal seit 20 Jahren gesunken. „Das unterscheidet uns von anderen Ländern“, sagt DIW-Forscher Gustav Horn.
Vor allem unterscheidet es die jetzige von früheren Krisen. Die Rezessionen der Sechziger, Siebziger und Neunziger folgten alle einem ähnlichen Muster: Die Wirtschaft brach ein, die Wachstumszahlen rutschten kurz ins Minus, aber der Verbrauch stieg weiter. Nicht gewaltig, denn die Deutschen waren immer sparsam, aber stark genug, dass wenig später ein neuer Aufschwung begann.
Die Regierung
Diesmal ist alles anders. "Deutschland befindet sich in einer stagnativen Phase", sagt udo Ludwig, Konjunkturexperte vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Soll heißen: Die Ökonomie schrumpft zwar nicht, aber sie kommt auch nicht in Gang. Erklärungen für die Lähmung gibt es viele: die Schwäche des deutschen Ostens, die hohe Arbeitslosigkeit, eine Bankenkrise, die die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen bremst, und eine Regierung, die ihre Bürger darüber im Unklaren lässt, ob und wie viel Geld sie für Alter und Krankheit beiseite legen müssen. Die quälende und bislang ergebnislose Reformdebatte belastet Verbraucher wie Unternehmen offenbar ungleich mehr als ein möglicher Krieg: Konsum und Investitionen waren schon schwach, bevor die amerikanischen Soldaten ihre Kasernen verließen.
Auf fast 50 Prozent beziffert Konjunkturforscher Ludwig inzwischen die Möglichkeit, dass es der noch immer drittstärksten Ökonomie der Welt, Deutschland, so ergeht wie der noch immer zweitstärksten: Japan. Dort stagniert die Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren. Die Aktienkurse bewegen sich zur Seite, die Arbeitslosigkeit steigt, die Verbraucher kaufen wenig ein. Alles wie in Deutschland. Trotzdem hält Rot-Grün an dem alten Verständnis von Wirtschaftskrisen fest, wonach jedem Abschwung ein Aufschwung folgt. „Die Dauer der Krise wird völlig
Nachhilfe für die Pisageneration ? 
Quiz für rote Socken

Wer wird Revolutionär?
Von Jochen Leffers
Im Dezember 2001 starteten linke Kölner Studenten das Web-Quiz "Wer wird Revolutionär?". Und feierten mit ihrer Schnapsidee einen fulminanten Klick-Erfolg. Deshalb ist die schräge Antwort auf Günter Jauch jetzt auch als Buch erschienen - mit 225 brandneuen Fragen. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie Ihre linke Gehirnhälfte schon mal warmlaufen lassen.
Günther Jauch ist der Traumkanzler der Jungwähler. Das jedenfalls ermittelten Bremer Psychologen kurz vor den letzten Bundestagswahlen bei einer Umfrage unter Jugendlichen: Bei den Schülern zwischen 18 und 22 Jahren lag Jauch klar vorn. Amtsinhaber Gerhard Schröder landete immerhin noch auf Platz 2, Edmund Stoiber indes auf dem letzten Platz und weit abgeschlagen zum Beispiel hinter Joschka Fischer, Rudi Völler, Campino oder Stefan Raab.
Schockierend? Deutschlands erfolgreichster Quizmaster punktete mit allen Eigenschaften, die den Jungwählern besonders wichtig sind - Lebensnähe, Lockerheit, Kompetenz, Glaubwürdigkeit. Die Alternative Liste an der Universität Köln ließ sich ebenfalls von der erfolgreichen Show inspirieren und startete ein Polit-Quiz im Internet.
Was als Kneipen-Idee geboren wurde und "mächtig Spaß gemacht hat", so der Kölner Doktorand Olaf Bartz, entwickelte sich schnell zum Magneten: In gut einem Jahr spielten rund 130.000 Besucher bei "Wer wird Revolutionär?" mit, insgesamt verzeichnen die Macher über 15 Millionen Seitenaufrufe.
Jetzt ist das "erste Quiz für rote Socken" auch in Buchform beim Eichborn-Verlag erschienen. Die 19 Autoren empfehlen es als "Geburtstagsgeschenk für die junge Globalisierungsgegnerin oder auch für den strammen Konservativen". Das Verhältnis der klassischen Linken zum populären Millionenquiz sei höchst ambivalent, schreiben sie: "Alles besser wissen, schön und gut, aber wohin mit den Millionen?"
Diese Frage müssen die Leser nicht beantworten, denn zu gewinnen gibt es selbst für linke Insider nichts außer dem Grübelspaß. Auch auf Joker müssen sie, anders als beim Web-Quiz, verzichten. Dafür locken über 200 brandneue Fragen - und im umfangreichen Anhang aufschlussreiche Antworten, mal ernst und mal verspielt.
So erfährt man im Buch, woher der Ausdruck "Leberwurst-Taktik" kommt, was es mit der Parole "Unter dem Pflaster liegt der Strand" auf sich hat oder wie Daisy Duck einmal eine Revolution anzettelte. Das kann Günther Jauch nicht bieten. Und es ist fast durchweg recht vergnüglich.
Frage 1:
Wovor schützt Sonnencreme?
A: vor freien Demokraten
B: vor der freien deutschen Jugend
C: vor freien Kameradschaften
D: vor freien Radikalen
Frage 2:
Frauenrechtlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nannten sich:
A: Scheibletten
B: Schogetten
C: Kroketten
D: Suffraggetten
Frage 3:
Wofür steht das "S" in SPD?
A: sozialistisch
B: sozialdemokratisch
C: schwachsinnig
D: Schröders
Frage 4:
Der legendäre Nicaragua-Kaffee heißt:
A: Sandino Dröhnung
B: Che Kracher
C: Mao Haumichum
D: Fidel Kawumm
Frage 5:
Warum hätte Ulrich Wickert im Herbst 2001 um ein Haar die Kündigung als Nachrichtensprecher erhalten?
A: Er hatte Gerhard Schröder in einem Live-Interview heftig in die Enge getrieben
B: Er hatte in einer Kolumne eine indische Schriftstellerin zitiert
C: Er hatte sich geweigert, am Betriebsausflug teilzunehmen
D: Er hatte in einem privaten Statement zugegeben, persönlich das Programm von RTL und Sat.1 zu bevorzugen
Frage 6:
Wo gibt es laut Adorno kein richtiges Leben?
A: im Diesseits
B: im falschen
C: im Kapitalismus
D: im Wiesengrund
Frage 7:
Von wem stammt das Zitat "Wer noch einmal das Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen"?:
A: Gerd Bastian
B: Daniel Cohn-Bendit
C: Otto Graf Lambsdorff
D: Franz Josef Strauß
Frage 8:
Polizeiuniformen hatten in der BRD bis 1975 die Farbe:
A: blau
B: braun
C: grau
D: schwarz
Frage 9:
Der Musterkapitalist in der Satire "Eins, zwei, drei" von Billy Wilder produziert:
A: Coca-Cola
B: Hamburger
C: Kaugummi
D: Nylonstrümpfe
Frage 10:
Welches Lebensmittel verkostete der bayerische Umweltminister Alfred Dick mit den Worten "Dös schadt mir goa nix"?:
A: Rinderhirn
B: Wein mit Frostschutzmittel
C: verstrahlte Molke
D: dioxinbelasteten Kohl
Frage 11:
Eine sozialkritische Rundfunk-Sendereihe der siebziger Jahre hieß "Papa, ... hat gesagt":
A: Charly
B: Freddy
C: Winnie
D: Teddy
Frage 12:
Welchen Vergleich fand Helmut Schmidt für die UdSSR?
A: Made im Speck
B: Obervolta mit Waffen
C: rotlackierte USA
D: Raum ohne Volk
Frage 13:
Kurt Tucholsky bezeichnete das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am "Deutschen Eck" in Koblenz einmal als:
A: erstarrten Dreck
B: gefrorenen Mist
C: versteinerte Scheiße
D: getrockneten Schlamm
Frage 14:
Welche weibliche "Star Trek"-Hauptfigur küsste als erste in der Serie eine andere Frau?
A: Nyota Uhura
B: Dr. Berverly Crusher
C: Jadzia Dax
D: B`Elanna Torres
Frage 15:
Mit welchem Accessoire ließ sich Alexander von Stahl, ehemaliger Generalbundesanwalt, für die "Ahnengalerie" seiner Behörde malen?
A: Doktorhut
B: Golfschläger
C: Grundgesetz
D: SPIEGEL-Heft
.
.
.
.
.
.
.
Antwort 1:
Leider nur vor freien Radikalen.
Antwort 2:
Der Begriff "Suffragetten" stammt von dem französischen Wort "suffrage" (Wahl) ab. Das Frauenwahlrecht war die Hauptforderung.
Antwort 3:
Dann doch B. Obwohl momentan Zweifel erlaubt sind.
Antwort 4:
Die gute Sandino Dröhnung.
Antwort 5:
Wickert zitierte in einer Kolumne für die Zeitschrift "Max" die indische Schriftstellerin Arundhati Roy, die den amerikanischen Präsidenten George W. Bush mit Osama Bin Laden verglichen hatte. Erst nachdem er sich öffentlich in den "Tagesthemen" entschuldigt hatte, beendeten die ARD-Verantwortlichen die Diskussion um seine Entlassung.
Antwort 6:
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen" (Theodor Wiesengrund Adorno).
Antwort 7:
Erstaunlich, aber das war Franz-Josef Strauß 1949 - sieben Jahre vor seiner Ernennung zum Verteidigungsminister.
Antwort 8:
Antwort A. Nur damit ergibt diese Zeile von Ton Steine Scherben Sinn: "Der Mariannenplatz war blau, so viel Bullen waren da..."
Antwort 9:
Coca-Cola.
Antwort 10:
Verstrahlte Molke.
Antwort 11:
Inhalt der Reihe: Ein namenloser achtjähriger Sohn eines wohlsituierten Beamten hat Charly, den Arbeiterjungen, zum Freund. Was er in dessen Haushalt hört, wird Thema der Gespräche zwischen Vater und Sohn.
Antwort 12:
"Obervolta mit Waffen" nannte Schmidt die Sowjetunion.
Antwort 13:
Als "gefrorenen Mist".
Antwort 14:
Jadzia Dax vom Volke der Trill in einer Folge von "Deep Space Nine". Es blieb bei eine kurzen, aber heftigen Affäre, weil bei den Trill solche so genannten "Wiedervereinigungen" geschlechtsunabhängig streng verboten sind.
Antwort 15:
Er posierte mit einem SPIEGEL-Heft.

Quiz für rote Socken

Wer wird Revolutionär?
Von Jochen Leffers
Im Dezember 2001 starteten linke Kölner Studenten das Web-Quiz "Wer wird Revolutionär?". Und feierten mit ihrer Schnapsidee einen fulminanten Klick-Erfolg. Deshalb ist die schräge Antwort auf Günter Jauch jetzt auch als Buch erschienen - mit 225 brandneuen Fragen. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie Ihre linke Gehirnhälfte schon mal warmlaufen lassen.
Günther Jauch ist der Traumkanzler der Jungwähler. Das jedenfalls ermittelten Bremer Psychologen kurz vor den letzten Bundestagswahlen bei einer Umfrage unter Jugendlichen: Bei den Schülern zwischen 18 und 22 Jahren lag Jauch klar vorn. Amtsinhaber Gerhard Schröder landete immerhin noch auf Platz 2, Edmund Stoiber indes auf dem letzten Platz und weit abgeschlagen zum Beispiel hinter Joschka Fischer, Rudi Völler, Campino oder Stefan Raab.
Schockierend? Deutschlands erfolgreichster Quizmaster punktete mit allen Eigenschaften, die den Jungwählern besonders wichtig sind - Lebensnähe, Lockerheit, Kompetenz, Glaubwürdigkeit. Die Alternative Liste an der Universität Köln ließ sich ebenfalls von der erfolgreichen Show inspirieren und startete ein Polit-Quiz im Internet.
Was als Kneipen-Idee geboren wurde und "mächtig Spaß gemacht hat", so der Kölner Doktorand Olaf Bartz, entwickelte sich schnell zum Magneten: In gut einem Jahr spielten rund 130.000 Besucher bei "Wer wird Revolutionär?" mit, insgesamt verzeichnen die Macher über 15 Millionen Seitenaufrufe.
Jetzt ist das "erste Quiz für rote Socken" auch in Buchform beim Eichborn-Verlag erschienen. Die 19 Autoren empfehlen es als "Geburtstagsgeschenk für die junge Globalisierungsgegnerin oder auch für den strammen Konservativen". Das Verhältnis der klassischen Linken zum populären Millionenquiz sei höchst ambivalent, schreiben sie: "Alles besser wissen, schön und gut, aber wohin mit den Millionen?"
Diese Frage müssen die Leser nicht beantworten, denn zu gewinnen gibt es selbst für linke Insider nichts außer dem Grübelspaß. Auch auf Joker müssen sie, anders als beim Web-Quiz, verzichten. Dafür locken über 200 brandneue Fragen - und im umfangreichen Anhang aufschlussreiche Antworten, mal ernst und mal verspielt.
So erfährt man im Buch, woher der Ausdruck "Leberwurst-Taktik" kommt, was es mit der Parole "Unter dem Pflaster liegt der Strand" auf sich hat oder wie Daisy Duck einmal eine Revolution anzettelte. Das kann Günther Jauch nicht bieten. Und es ist fast durchweg recht vergnüglich.
Frage 1:
Wovor schützt Sonnencreme?
A: vor freien Demokraten
B: vor der freien deutschen Jugend
C: vor freien Kameradschaften
D: vor freien Radikalen
Frage 2:
Frauenrechtlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nannten sich:
A: Scheibletten
B: Schogetten
C: Kroketten
D: Suffraggetten
Frage 3:
Wofür steht das "S" in SPD?
A: sozialistisch
B: sozialdemokratisch
C: schwachsinnig
D: Schröders
Frage 4:
Der legendäre Nicaragua-Kaffee heißt:
A: Sandino Dröhnung
B: Che Kracher
C: Mao Haumichum
D: Fidel Kawumm
Frage 5:
Warum hätte Ulrich Wickert im Herbst 2001 um ein Haar die Kündigung als Nachrichtensprecher erhalten?
A: Er hatte Gerhard Schröder in einem Live-Interview heftig in die Enge getrieben
B: Er hatte in einer Kolumne eine indische Schriftstellerin zitiert
C: Er hatte sich geweigert, am Betriebsausflug teilzunehmen
D: Er hatte in einem privaten Statement zugegeben, persönlich das Programm von RTL und Sat.1 zu bevorzugen
Frage 6:
Wo gibt es laut Adorno kein richtiges Leben?
A: im Diesseits
B: im falschen
C: im Kapitalismus
D: im Wiesengrund
Frage 7:
Von wem stammt das Zitat "Wer noch einmal das Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen"?:
A: Gerd Bastian
B: Daniel Cohn-Bendit
C: Otto Graf Lambsdorff
D: Franz Josef Strauß
Frage 8:
Polizeiuniformen hatten in der BRD bis 1975 die Farbe:
A: blau
B: braun
C: grau
D: schwarz
Frage 9:
Der Musterkapitalist in der Satire "Eins, zwei, drei" von Billy Wilder produziert:
A: Coca-Cola
B: Hamburger
C: Kaugummi
D: Nylonstrümpfe
Frage 10:
Welches Lebensmittel verkostete der bayerische Umweltminister Alfred Dick mit den Worten "Dös schadt mir goa nix"?:
A: Rinderhirn
B: Wein mit Frostschutzmittel
C: verstrahlte Molke
D: dioxinbelasteten Kohl
Frage 11:
Eine sozialkritische Rundfunk-Sendereihe der siebziger Jahre hieß "Papa, ... hat gesagt":
A: Charly
B: Freddy
C: Winnie
D: Teddy
Frage 12:
Welchen Vergleich fand Helmut Schmidt für die UdSSR?
A: Made im Speck
B: Obervolta mit Waffen
C: rotlackierte USA
D: Raum ohne Volk
Frage 13:
Kurt Tucholsky bezeichnete das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am "Deutschen Eck" in Koblenz einmal als:
A: erstarrten Dreck
B: gefrorenen Mist
C: versteinerte Scheiße
D: getrockneten Schlamm
Frage 14:
Welche weibliche "Star Trek"-Hauptfigur küsste als erste in der Serie eine andere Frau?
A: Nyota Uhura
B: Dr. Berverly Crusher
C: Jadzia Dax
D: B`Elanna Torres
Frage 15:
Mit welchem Accessoire ließ sich Alexander von Stahl, ehemaliger Generalbundesanwalt, für die "Ahnengalerie" seiner Behörde malen?
A: Doktorhut
B: Golfschläger
C: Grundgesetz
D: SPIEGEL-Heft
.
.
.
.
.
.
.
Antwort 1:
Leider nur vor freien Radikalen.
Antwort 2:
Der Begriff "Suffragetten" stammt von dem französischen Wort "suffrage" (Wahl) ab. Das Frauenwahlrecht war die Hauptforderung.
Antwort 3:
Dann doch B. Obwohl momentan Zweifel erlaubt sind.
Antwort 4:
Die gute Sandino Dröhnung.
Antwort 5:
Wickert zitierte in einer Kolumne für die Zeitschrift "Max" die indische Schriftstellerin Arundhati Roy, die den amerikanischen Präsidenten George W. Bush mit Osama Bin Laden verglichen hatte. Erst nachdem er sich öffentlich in den "Tagesthemen" entschuldigt hatte, beendeten die ARD-Verantwortlichen die Diskussion um seine Entlassung.
Antwort 6:
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen" (Theodor Wiesengrund Adorno).
Antwort 7:
Erstaunlich, aber das war Franz-Josef Strauß 1949 - sieben Jahre vor seiner Ernennung zum Verteidigungsminister.
Antwort 8:
Antwort A. Nur damit ergibt diese Zeile von Ton Steine Scherben Sinn: "Der Mariannenplatz war blau, so viel Bullen waren da..."
Antwort 9:
Coca-Cola.
Antwort 10:
Verstrahlte Molke.
Antwort 11:
Inhalt der Reihe: Ein namenloser achtjähriger Sohn eines wohlsituierten Beamten hat Charly, den Arbeiterjungen, zum Freund. Was er in dessen Haushalt hört, wird Thema der Gespräche zwischen Vater und Sohn.
Antwort 12:
"Obervolta mit Waffen" nannte Schmidt die Sowjetunion.
Antwort 13:
Als "gefrorenen Mist".
Antwort 14:
Jadzia Dax vom Volke der Trill in einer Folge von "Deep Space Nine". Es blieb bei eine kurzen, aber heftigen Affäre, weil bei den Trill solche so genannten "Wiedervereinigungen" geschlechtsunabhängig streng verboten sind.
Antwort 15:
Er posierte mit einem SPIEGEL-Heft.
.
antideutscher "Rassismus" im Goldaktienforum ...
"Deutschland stinkt"
Von Frank Patalong
Man stelle sich das vor: Die Vereinigten Staaten wollen den Krieg, und Deutschland und Frankreich gehen einfach nicht hin. Undankbar finden das viele Amerikaner, und so mehren sich die Rufe nach einem Boykott von Importwaren - verbreitet über Hetzseiten wie "germanystinks.com".

http://www.germanystinks.com/
"Welcome to Germanystinks.com!", steht beim Aufruf der Webseite im Browserkopf, "USA uber (sic!) alles!".
Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt: Germanystinks ist kein Web-Angebot, das werbend auf die Schönheiten der Lüneburger Heide verweist, auf die Qualität deutscher Esswaren, die Existenz von Umlauten oder den angeblichen technischen Vorsprung teutonischer Autos. Das aber wiederum heißt nicht, dass man nicht ganz verblüffend viel lernen könnte über all die Angebote, die deutsche Handels- und Dienstleistungsfirmen in den Vereinigten Staaten machen. Denn natürlich muss man die erfassen und öffentlich machen, wenn man zu ihrem Boykott aufrufen will.
Genau das scheint das vornehmliche Ziel des seltsamen Webangebotes zu sein: Die undankbare "Achse der Wiesel" abzustrafen. Und die verläuft bekanntlich von Berlin nach Paris, weswegen auch unserem uns freundschaftlich verbundenen Nachbarland eine Webseite gewidmet ist, die über ihren Namen darauf verweist, dass es in Frankreich angeblich weniger gut rieche als im Mutterland der Toleranz und Meinungsfreiheit.
Die will Amerika gerade mit Panzern in den Irak transportieren, womit undankbare Regierungen wie die von Frankreich und vor allem Deutschland nicht so ganz einverstanden sind. Genau das meint "Yankee Doodle", der Betreiber der Seite, wenn er von "Gestank" redet: "Es ist der Mief von Kollaboration und Feigheit, den Berlin und Bonn verströmen, während ein ehemals sozialistischer, krimineller Außenminister und ein `Ich-muss-um-jeden-Preis-gewinnen`, Anti-Amerikanismus-schürender Premierminister das Volk, das wir aus der Asche des Faschismus wieder aufbauten, unserer Freundschaft und Verzeihung weiter und weiter entziehen".
Das ist zwar etwas unleserlich, aber ansonsten schon recht klar: Hier redet einer mit festen Überzeugungen, die sich auf einige wenige, gut wiederholte Fakten stützen.
Semi-satirisch wird da auf deutschen Essgewohnheiten wie "matschige Bretzeln" und "überkochtes Sauerkraut" herumgehackt (sowas bekommt man angeblich auf den bayrischen Oktoberfesten im amerikanischen Mittelwesten serviert), an alle denkbaren Ressentiments erinnert, Vorurteile aufgefrischt und auch auf die Seite mit den deutschen Witzen wird nicht verzichtet. Die brauchen wir Deutschen allerdings nicht lesen, weil wir sie sowieso nicht verstehen würden: Deutsche haben, wie dem Seitenbetreiber Hunderte von E-Mails beweisen, bekanntlich keinen Humor. Sonst würden sie ja auch begriffen, dass es keine Ignoranz seinerseits, sondern eben ein Witz ist, dass der einzig eingesetzte Artikel immer "das" lautet: "Das News", "Das Photos", "Das Jokes".

Das ist politische Protestkultur: Demo per Klo
Herzstück der Hetzseite ist ein Boykottaufruf gegen Produkte "Made in Germany": Weine, Autos, Versicherungen etc. Germanystinks, respektive Francestinks organisierten darum die "Great American `Tea` Party 2003".
Am 4. März, berichtet Germanystinks, sollen angeblich rund 34 Prozent der amerikanischen Haushalte im Protest gegen die feige, undankbare Haltung von Deutschland und Frankreich gegen Mitternacht ihre Klospülung betätigt haben. Mit in den Orkus gingen dabei - dem Aufruf zufolge - deutsche respektive französische Konsumgüter. Die exorbitant hohe Zahl der Haushalte, die an dem Event (der von den US-Medien aus ungeklärten Gründen nicht bemerkt wurde) teilnahmen - der Prozentsatz entspricht etwa dem der vehementen Kriegsbefürworter in den USA - wurde angeblich durch die Beobachtung von Druckschwankungen durch die Wasserversorger gemessen.
Zu denen gehört auch das RWE, das gerade erst für 4,6 Milliarden Dollar American Water Works Co. erstand. Gegen diesen Deal, berichtete Anfang der Woche die "Businessweek", gab es kaum Widerstand, bis in der Endphase der Verhandlungen plötzlich Umweltschutz- und Verbraucherverbände überraschenden Zulauf erlebten.
Der Gegenwind, mutmaßt das Wirtschaftsblatt, könnte durch gezielt platzierte Statements zahlreicher US-Politiker der zweiten Reihe befruchtet worden sein. Deren Botschaft ist immer dieselbe: Boykottiert Frankreich und Deutschland und alle mit ihnen verbundenen Firmen.
Das, analysiert die "Businessweek" treffend, sei zwar kompletter "Balderdash" - völliger Blödsinn also -, in seinen Effekten inzwischen aber spürbar: Nicht nur RWE habe in den letzten Wochen einiges an Gegenwind erlebt, sondern etwa auch der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann, dessen Auftragsvolumen durch das US-Verteidigungsministerium ganz unvermittelt geschrumpft sei.
Doch all das gefährde weniger das Exportvolumen der europäischen "Wiesel-Staaten", als vielmehr die US-Ökonomie: 4,9 Millionen Arbeitsplätze, rechnet die "Businessweek" vor, hängen direkt vom Engagement französischer und deutscher Firmen ab. Von nationalen Konzernen und Produkten zu reden, sei sowieso Blödsinn: Die Vernetzung amerikanischer mit deutschen und französischen Konzernen sei so hoch, dass man für einen vollständigen Boykott 25 Prozent der US-Ökonomie lahm legen müsste.
Rechte Perspektive
Aber Seiten wie Germanystinks geht es ja auch nicht wirklich um Argumente, sondern ums Prinzip. Der anonyme Betreiber, der vorgibt, ein Privatmann zu sein, steht auch hinter "Big Boots". Die penetrant patriotisch gefärbte Seite operiert wie die "Stink"-Seiten argumentativ ganz hart am rechten Rand des politischen Spektrums in den USA. Höhepunkt der Seite ist die Übersicht "Bad Guys", die Steckbriefe diverser "Vaterlandsverräter" und angeblicher Nestbeschmutzer bietet. Derzeit unter anderem "Wanted": Susan Sarandon, George Clooney, Barbara Streisand, Julia Roberts und natürlich Sean Penn.
Die als "liberal" geltenden Hollywood-Größen sind Vollblut-Patrioten ein Dorn im Auge. Rund 60.000 Internet-Nutzer unterzeichneten bisher die Online-Petition "Citizens against Celebrity Pundits", die den renitenten Schauspielern am liebsten das Maul stopfen würde. Die in trocken-sachlichem Design daherkommende Seite pflegt eine direkte Sprache: Die Online-Demonstration gegen einen drohenden Irak-Krieg vom letzten Mittwoch wird da zur "virtuellen Attacke auf Amerika", jeder Prominente, der es wagt, Kritik zu äußern, wird zum "Leftist" stilisiert.
So intolerant das alles wirkt - man sollte germanystinks.com und Co. nicht überzubewerten: Ja, da gibt es noch die Kampagne "Boykottiert das feige Frankreich" und die Website "Axis of Weasels" - doch das war es auch schon fast. Die Betreiber der Seiten verbleiben im Anonymen, und im Web haben es ihre Ideen offenbar schwer, Fuß zu fassen. Selbst ihre Linkverzeichnisse schaffen es kaum, Quellen mit ähnlichen Perspektiven zusammen zu tragen.
http://www.axisofweasels.com/saddams.best.buddies.html
Die Gegenseite zeigt Flagge
Das sieht auf der Gegenseite ganz anders aus: Wer sich bei der Kampagne "Not in our Name" umsieht, findet nicht nur ein "FAQ" zu Enstehung und Inhalten, sondern auch eine Übersicht mit den Namen der Initiatoren. Auch diese Petition kann auf rund 55.000 Unterzeichner verweisen, und der zeitweilige Zusammenbruch der Telekommunikationsmedien im Weißen Haus und im Senat in der letzten Woche hat bereits Web-Protestgeschichte geschrieben. Auch das "Artist Network" hat keinerlei Probleme, auf positive Berichte, Solidaradressen und verwandte Quellen zu verweisen.
Germanystinks.com reduziert derlei zu einer Web-Skurrilität. Ohne Effekt bleibt das Gedankengut der stramm patriotischen Amerikaner jedoch nicht: Dem sächsischen Lederwaren-Zulieferer Lederett flatterte als erstem deutschen Unternehmen eine ganz offen politisch begründete Vertragskündigung ins Haus. "Wir waren sehr zufrieden mit der Qualität, dem Service und den Preisen", hieß es darin wörtlich. Grund für den Abbruch der Handelsbeziehungen sei "die fehlende Unterstützung der USA durch die Bundesrepublik Deutschland".
SPIEGEL ONLINE - 07. März 2003
antideutscher "Rassismus" im Goldaktienforum ...

"Deutschland stinkt"
Von Frank Patalong
Man stelle sich das vor: Die Vereinigten Staaten wollen den Krieg, und Deutschland und Frankreich gehen einfach nicht hin. Undankbar finden das viele Amerikaner, und so mehren sich die Rufe nach einem Boykott von Importwaren - verbreitet über Hetzseiten wie "germanystinks.com".

http://www.germanystinks.com/
"Welcome to Germanystinks.com!", steht beim Aufruf der Webseite im Browserkopf, "USA uber (sic!) alles!".
Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt: Germanystinks ist kein Web-Angebot, das werbend auf die Schönheiten der Lüneburger Heide verweist, auf die Qualität deutscher Esswaren, die Existenz von Umlauten oder den angeblichen technischen Vorsprung teutonischer Autos. Das aber wiederum heißt nicht, dass man nicht ganz verblüffend viel lernen könnte über all die Angebote, die deutsche Handels- und Dienstleistungsfirmen in den Vereinigten Staaten machen. Denn natürlich muss man die erfassen und öffentlich machen, wenn man zu ihrem Boykott aufrufen will.
Genau das scheint das vornehmliche Ziel des seltsamen Webangebotes zu sein: Die undankbare "Achse der Wiesel" abzustrafen. Und die verläuft bekanntlich von Berlin nach Paris, weswegen auch unserem uns freundschaftlich verbundenen Nachbarland eine Webseite gewidmet ist, die über ihren Namen darauf verweist, dass es in Frankreich angeblich weniger gut rieche als im Mutterland der Toleranz und Meinungsfreiheit.
Die will Amerika gerade mit Panzern in den Irak transportieren, womit undankbare Regierungen wie die von Frankreich und vor allem Deutschland nicht so ganz einverstanden sind. Genau das meint "Yankee Doodle", der Betreiber der Seite, wenn er von "Gestank" redet: "Es ist der Mief von Kollaboration und Feigheit, den Berlin und Bonn verströmen, während ein ehemals sozialistischer, krimineller Außenminister und ein `Ich-muss-um-jeden-Preis-gewinnen`, Anti-Amerikanismus-schürender Premierminister das Volk, das wir aus der Asche des Faschismus wieder aufbauten, unserer Freundschaft und Verzeihung weiter und weiter entziehen".
Das ist zwar etwas unleserlich, aber ansonsten schon recht klar: Hier redet einer mit festen Überzeugungen, die sich auf einige wenige, gut wiederholte Fakten stützen.
Semi-satirisch wird da auf deutschen Essgewohnheiten wie "matschige Bretzeln" und "überkochtes Sauerkraut" herumgehackt (sowas bekommt man angeblich auf den bayrischen Oktoberfesten im amerikanischen Mittelwesten serviert), an alle denkbaren Ressentiments erinnert, Vorurteile aufgefrischt und auch auf die Seite mit den deutschen Witzen wird nicht verzichtet. Die brauchen wir Deutschen allerdings nicht lesen, weil wir sie sowieso nicht verstehen würden: Deutsche haben, wie dem Seitenbetreiber Hunderte von E-Mails beweisen, bekanntlich keinen Humor. Sonst würden sie ja auch begriffen, dass es keine Ignoranz seinerseits, sondern eben ein Witz ist, dass der einzig eingesetzte Artikel immer "das" lautet: "Das News", "Das Photos", "Das Jokes".

Das ist politische Protestkultur: Demo per Klo
Herzstück der Hetzseite ist ein Boykottaufruf gegen Produkte "Made in Germany": Weine, Autos, Versicherungen etc. Germanystinks, respektive Francestinks organisierten darum die "Great American `Tea` Party 2003".
Am 4. März, berichtet Germanystinks, sollen angeblich rund 34 Prozent der amerikanischen Haushalte im Protest gegen die feige, undankbare Haltung von Deutschland und Frankreich gegen Mitternacht ihre Klospülung betätigt haben. Mit in den Orkus gingen dabei - dem Aufruf zufolge - deutsche respektive französische Konsumgüter. Die exorbitant hohe Zahl der Haushalte, die an dem Event (der von den US-Medien aus ungeklärten Gründen nicht bemerkt wurde) teilnahmen - der Prozentsatz entspricht etwa dem der vehementen Kriegsbefürworter in den USA - wurde angeblich durch die Beobachtung von Druckschwankungen durch die Wasserversorger gemessen.
Zu denen gehört auch das RWE, das gerade erst für 4,6 Milliarden Dollar American Water Works Co. erstand. Gegen diesen Deal, berichtete Anfang der Woche die "Businessweek", gab es kaum Widerstand, bis in der Endphase der Verhandlungen plötzlich Umweltschutz- und Verbraucherverbände überraschenden Zulauf erlebten.
Der Gegenwind, mutmaßt das Wirtschaftsblatt, könnte durch gezielt platzierte Statements zahlreicher US-Politiker der zweiten Reihe befruchtet worden sein. Deren Botschaft ist immer dieselbe: Boykottiert Frankreich und Deutschland und alle mit ihnen verbundenen Firmen.
Das, analysiert die "Businessweek" treffend, sei zwar kompletter "Balderdash" - völliger Blödsinn also -, in seinen Effekten inzwischen aber spürbar: Nicht nur RWE habe in den letzten Wochen einiges an Gegenwind erlebt, sondern etwa auch der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann, dessen Auftragsvolumen durch das US-Verteidigungsministerium ganz unvermittelt geschrumpft sei.
Doch all das gefährde weniger das Exportvolumen der europäischen "Wiesel-Staaten", als vielmehr die US-Ökonomie: 4,9 Millionen Arbeitsplätze, rechnet die "Businessweek" vor, hängen direkt vom Engagement französischer und deutscher Firmen ab. Von nationalen Konzernen und Produkten zu reden, sei sowieso Blödsinn: Die Vernetzung amerikanischer mit deutschen und französischen Konzernen sei so hoch, dass man für einen vollständigen Boykott 25 Prozent der US-Ökonomie lahm legen müsste.
Rechte Perspektive
Aber Seiten wie Germanystinks geht es ja auch nicht wirklich um Argumente, sondern ums Prinzip. Der anonyme Betreiber, der vorgibt, ein Privatmann zu sein, steht auch hinter "Big Boots". Die penetrant patriotisch gefärbte Seite operiert wie die "Stink"-Seiten argumentativ ganz hart am rechten Rand des politischen Spektrums in den USA. Höhepunkt der Seite ist die Übersicht "Bad Guys", die Steckbriefe diverser "Vaterlandsverräter" und angeblicher Nestbeschmutzer bietet. Derzeit unter anderem "Wanted": Susan Sarandon, George Clooney, Barbara Streisand, Julia Roberts und natürlich Sean Penn.
Die als "liberal" geltenden Hollywood-Größen sind Vollblut-Patrioten ein Dorn im Auge. Rund 60.000 Internet-Nutzer unterzeichneten bisher die Online-Petition "Citizens against Celebrity Pundits", die den renitenten Schauspielern am liebsten das Maul stopfen würde. Die in trocken-sachlichem Design daherkommende Seite pflegt eine direkte Sprache: Die Online-Demonstration gegen einen drohenden Irak-Krieg vom letzten Mittwoch wird da zur "virtuellen Attacke auf Amerika", jeder Prominente, der es wagt, Kritik zu äußern, wird zum "Leftist" stilisiert.
So intolerant das alles wirkt - man sollte germanystinks.com und Co. nicht überzubewerten: Ja, da gibt es noch die Kampagne "Boykottiert das feige Frankreich" und die Website "Axis of Weasels" - doch das war es auch schon fast. Die Betreiber der Seiten verbleiben im Anonymen, und im Web haben es ihre Ideen offenbar schwer, Fuß zu fassen. Selbst ihre Linkverzeichnisse schaffen es kaum, Quellen mit ähnlichen Perspektiven zusammen zu tragen.
http://www.axisofweasels.com/saddams.best.buddies.html
Die Gegenseite zeigt Flagge
Das sieht auf der Gegenseite ganz anders aus: Wer sich bei der Kampagne "Not in our Name" umsieht, findet nicht nur ein "FAQ" zu Enstehung und Inhalten, sondern auch eine Übersicht mit den Namen der Initiatoren. Auch diese Petition kann auf rund 55.000 Unterzeichner verweisen, und der zeitweilige Zusammenbruch der Telekommunikationsmedien im Weißen Haus und im Senat in der letzten Woche hat bereits Web-Protestgeschichte geschrieben. Auch das "Artist Network" hat keinerlei Probleme, auf positive Berichte, Solidaradressen und verwandte Quellen zu verweisen.
Germanystinks.com reduziert derlei zu einer Web-Skurrilität. Ohne Effekt bleibt das Gedankengut der stramm patriotischen Amerikaner jedoch nicht: Dem sächsischen Lederwaren-Zulieferer Lederett flatterte als erstem deutschen Unternehmen eine ganz offen politisch begründete Vertragskündigung ins Haus. "Wir waren sehr zufrieden mit der Qualität, dem Service und den Preisen", hieß es darin wörtlich. Grund für den Abbruch der Handelsbeziehungen sei "die fehlende Unterstützung der USA durch die Bundesrepublik Deutschland".
SPIEGEL ONLINE - 07. März 2003
Hallo Konradi,
sorry, ich war einige Tage beruflich unterwegs und hatte eine Auszeit nehmen müssen.
Wirst Du etwa langsam vergesslich?
Hattest Du mich nicht vor einiger Zeit der 68-er Gesinnung bezichtigt in dem Thread, in welchem wir uns vorher beharkten ?
Deiner Unterstellung hatte ich damals nicht widersprochen, weder betreffend dem damit unterstelltem Alter, da ich froh bin die Zeit der „68-er“ bewusst miterlebt zu haben, noch betreffend der Gesinnung, welche von Idealen und Idolen mit (noch) ehrenwerten und ehrlichen Grundsätzen geprägt wurde.
Mißverstehe mich nicht, ich will Dich ja gar nicht von Deinen Ansichten abbringen, noch Dich eines (von mir angenommenen) Besseren belehren. Weder hier in diesem Falle betereffend dem Semitismus, noch im anderen Falle betreffend Deiner Einstellung gegenüber der heutigen politischen Landschaft und deren Personen. Wenn ich damit auch nicht viel ändern kann, dennoch mag ich manchmal einseitige Betrachtungsweisen in Beiträgen, die mir mit meinem Weltbild doch zu störend erscheinen, nicht unwidersprochen lassen. Insbesondere dann nicht, wenn ich meine, dass diese von ansonsten recht vernünftig denkenden Personen eingebracht werden.
Wochenende ist da, vielleicht magst Du ja etwas bruzzeln.
Auf das versprochene Rezept für den Weißkohl-Pfannekuchen oder auch Kraut-Palatschinken nennbar wollte ich dann eben zurückkommen:
1 kg fein gehobelten Weißkohl in einer Schüssel mit ca. 2 Kaffeelöffel Salz durchmischen und unter gelegentlich erneutem durchmischen ½ Std. zugedeckt ziehen lassen
Fünf tellergroße relativ dünne Pfannekuchen aus nicht allzu süßem Mehl/Milch-Teig herstellen.
In einer Pfanne 1 Esslöffel Schweineschmalz mit ¼ Kaffeelöffel Salz, einer guten Prise weissem Pfeffer und 2 Kaffeelöffel Zucker erhitzen und den Zucker unter ständigem rühren etwas kandieren lassen.
2 mittelgroße Zwiebel in dünne Längsstreifen geschnitten hinzugeben und goldbraun braten.
Den Weißkohl kräftig ausdrücken und dazugeben.
Bei starker Hitze unter ständigem rühren das Kohl braunbraten, und dabei mit Zucker, Pfeffer und Salz nach Belieben abschmecken.
Etwas abkühlen lassen und als Füllung in die Pfannekuchen fest einrollen, die Enden dabei nach innen einschieben (verschliessen).
In der Pfanne die vorsichtig eingelegten Pfannekuchen in Schmalz von beiden Seiten etwas braun anbraten, heiß, mit Puderzucker überstreut servieren …
Vielleicht eine leckere Suppe, z.B. eine klare Erbsensuppe davor genossen …
und ein-zwei-drei Gläser halbtrockenen Weißwein, einen Grauen Mönch, oder einen Furmint dabei …
das wären so die idealen Rahmenbedingungen …
Grüße
Magor
sorry, ich war einige Tage beruflich unterwegs und hatte eine Auszeit nehmen müssen.
Wirst Du etwa langsam vergesslich?
Hattest Du mich nicht vor einiger Zeit der 68-er Gesinnung bezichtigt in dem Thread, in welchem wir uns vorher beharkten ?
Deiner Unterstellung hatte ich damals nicht widersprochen, weder betreffend dem damit unterstelltem Alter, da ich froh bin die Zeit der „68-er“ bewusst miterlebt zu haben, noch betreffend der Gesinnung, welche von Idealen und Idolen mit (noch) ehrenwerten und ehrlichen Grundsätzen geprägt wurde.
Mißverstehe mich nicht, ich will Dich ja gar nicht von Deinen Ansichten abbringen, noch Dich eines (von mir angenommenen) Besseren belehren. Weder hier in diesem Falle betereffend dem Semitismus, noch im anderen Falle betreffend Deiner Einstellung gegenüber der heutigen politischen Landschaft und deren Personen. Wenn ich damit auch nicht viel ändern kann, dennoch mag ich manchmal einseitige Betrachtungsweisen in Beiträgen, die mir mit meinem Weltbild doch zu störend erscheinen, nicht unwidersprochen lassen. Insbesondere dann nicht, wenn ich meine, dass diese von ansonsten recht vernünftig denkenden Personen eingebracht werden.
Wochenende ist da, vielleicht magst Du ja etwas bruzzeln.
Auf das versprochene Rezept für den Weißkohl-Pfannekuchen oder auch Kraut-Palatschinken nennbar wollte ich dann eben zurückkommen:
1 kg fein gehobelten Weißkohl in einer Schüssel mit ca. 2 Kaffeelöffel Salz durchmischen und unter gelegentlich erneutem durchmischen ½ Std. zugedeckt ziehen lassen
Fünf tellergroße relativ dünne Pfannekuchen aus nicht allzu süßem Mehl/Milch-Teig herstellen.
In einer Pfanne 1 Esslöffel Schweineschmalz mit ¼ Kaffeelöffel Salz, einer guten Prise weissem Pfeffer und 2 Kaffeelöffel Zucker erhitzen und den Zucker unter ständigem rühren etwas kandieren lassen.
2 mittelgroße Zwiebel in dünne Längsstreifen geschnitten hinzugeben und goldbraun braten.
Den Weißkohl kräftig ausdrücken und dazugeben.
Bei starker Hitze unter ständigem rühren das Kohl braunbraten, und dabei mit Zucker, Pfeffer und Salz nach Belieben abschmecken.
Etwas abkühlen lassen und als Füllung in die Pfannekuchen fest einrollen, die Enden dabei nach innen einschieben (verschliessen).
In der Pfanne die vorsichtig eingelegten Pfannekuchen in Schmalz von beiden Seiten etwas braun anbraten, heiß, mit Puderzucker überstreut servieren …
Vielleicht eine leckere Suppe, z.B. eine klare Erbsensuppe davor genossen …
und ein-zwei-drei Gläser halbtrockenen Weißwein, einen Grauen Mönch, oder einen Furmint dabei …
das wären so die idealen Rahmenbedingungen …
Grüße
Magor
Hallo Magor -
kann schon sein, daß ich langsam vergeßlich werde – mir schwirrt derzeit – auch privat - soviel durch den Kopf, daß ich ein wenig den Überblick verliere. Ich bin auch noch in einem anderen Onlineforum aktiv und habe einfach nicht die Zeit auch hier noch längere Beiträge zu verfassen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen muß "Cut & Paste" genügen Wem das zu wenig ist, soll es besser machen, bzw. diesen Thread meiden.
– mir schwirrt derzeit – auch privat - soviel durch den Kopf, daß ich ein wenig den Überblick verliere. Ich bin auch noch in einem anderen Onlineforum aktiv und habe einfach nicht die Zeit auch hier noch längere Beiträge zu verfassen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen muß "Cut & Paste" genügen Wem das zu wenig ist, soll es besser machen, bzw. diesen Thread meiden.
Immerhin ist es erfreulich, daß wir uns beide auf den Grundsatz gegenseitiger Akzeptanz einigen können.
Zu unterscheiden gilt aber "kontrovers" und "konstruktiv":
Die Diskussion, die wir hier führen ist zunächst mal kontrovers, sie dient der Information über den eigenen Standpunkt. Und der ist logischerweise immer "einseitig".
Insofern kann ich Deinen Vorwurf auch nur bedingt akzeptieren. Säßen wir gemeinsam in einem Ausschuß - z.B um Vorschläge zur Lösung des Nahostkonflikts zu erörtern – müßten wir uns natürlich auf eine gemeinsame Bewertung der kontroversen Argumente einigern. Diese Form der Diskussion wäre natürlich diplomatisch-konziliant, wir hätten ja eine gemeinsame Zielvorgabe.
Ein Internetforum ist aber wohl doch eher die Bühne, auf der gestritten und die Mitleser von der Richtigkeit der eigenen Position überzeugt werden sollen, vergleichbar vielleicht einer Parlamentsdebatte.
Zum Weißkohlpfannekuchen später ...
Gruß Konradi
kann schon sein, daß ich langsam vergeßlich werde
 – mir schwirrt derzeit – auch privat - soviel durch den Kopf, daß ich ein wenig den Überblick verliere. Ich bin auch noch in einem anderen Onlineforum aktiv und habe einfach nicht die Zeit auch hier noch längere Beiträge zu verfassen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen muß "Cut & Paste" genügen Wem das zu wenig ist, soll es besser machen, bzw. diesen Thread meiden.
– mir schwirrt derzeit – auch privat - soviel durch den Kopf, daß ich ein wenig den Überblick verliere. Ich bin auch noch in einem anderen Onlineforum aktiv und habe einfach nicht die Zeit auch hier noch längere Beiträge zu verfassen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen muß "Cut & Paste" genügen Wem das zu wenig ist, soll es besser machen, bzw. diesen Thread meiden.Immerhin ist es erfreulich, daß wir uns beide auf den Grundsatz gegenseitiger Akzeptanz einigen können.
Zu unterscheiden gilt aber "kontrovers" und "konstruktiv":
Die Diskussion, die wir hier führen ist zunächst mal kontrovers, sie dient der Information über den eigenen Standpunkt. Und der ist logischerweise immer "einseitig".
Insofern kann ich Deinen Vorwurf auch nur bedingt akzeptieren. Säßen wir gemeinsam in einem Ausschuß - z.B um Vorschläge zur Lösung des Nahostkonflikts zu erörtern – müßten wir uns natürlich auf eine gemeinsame Bewertung der kontroversen Argumente einigern. Diese Form der Diskussion wäre natürlich diplomatisch-konziliant, wir hätten ja eine gemeinsame Zielvorgabe.
Ein Internetforum ist aber wohl doch eher die Bühne, auf der gestritten und die Mitleser von der Richtigkeit der eigenen Position überzeugt werden sollen, vergleichbar vielleicht einer Parlamentsdebatte.
Zum Weißkohlpfannekuchen später ...

Gruß Konradi
.
Ronald D. Asmus
Der bewaffnete Fortschritt
Amerika muss den Nahen Osten demokratisieren.
Und sei es mit militärischer Gewalt
Das amerikanische Nachdenken über den Nahen Osten unterliegt derzeit einem kompletten Wandel. Seit dem 11. September 2001 diskutiert Amerika darüber, wie die Modernisierung und Demokratisierung dieser Region zum tragenden Pfeiler einer langfristigen amerikanischen Strategie im Kampf gegen den Terrorismus gemacht werden könnte. Wir erleben einen in seinem Umfang, seiner Ambition und seinen möglichen Auswirkungen geradezu atemberaubenden Paradigmenwechsel.
Immer mehr amerikanische Rechte und Linke in den Vereinigten Staaten befürworten diesen Umbruch. Für Neokonservative in Amerika ist es ohnehin ein Glaubenssatz, dass auf die Befreiung von Bagdad eine gemeinschaftliche Anstrengung folgen müsse, den Irak zur ersten funktionierenden Demokratie der arabischen Region umzuwandeln. Am Irak wollen sie vorführen, was aus der arabischen Welt werden kann, wenn Amerika seine Macht einsetzt.
Aber auch von führenden Vertretern der Demokratischen Partei in Amerika sind ähnliche Plädoyers zu hören. Sie meinen, seit dem 11. September dürfe Washington keine autokratischen und theokratischen Regime in der Region mehr unterstützen. Stattdessen sollten die Vereinigten Staaten dort zu Wandel und Reform beitragen und damit antiamerikanischen Ressentiments dauerhaft den Boden entziehen.
Viele Demokraten knüpfen ihre Zustimmung zur Invasion des Irak an die Bedingung, dass die Vereinigten Staaten sich verpflichten, nach dem Krieg einen demokratischen Irak aufzubauen. Mit den Senatoren John Edwards, John Kerry und Joe Lieberman haben sich drei führende Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei in ihren Wahlprogrammen ausdrücklich zu dieser Perspektive für den Nahen und Mittleren Ostens bekannt.
Dem Appell, die Macht der Vereinigten Staaten für eine neue säkulare und moderne Ordnung in der arabischen Welt einzusetzen, haben sich neben dem namhaften arabischen Politikwissenschaftler Fouad Ajami auch einige der renommiertesten amerikanischen Arabienexperten angeschlossen. So ist Bernard Lewis dem Komitee zur Befreiung des Irak beigetreten, einer jüngst gegründeten Unterstützergruppe von Republikanern und Demokraten, die sich diesem Ziel verpflichtet fühlen.
Regierungen geben nur selten Fehler zu. Doch im vergangenen Dezember machte die Bush-Regierung einen Schritt, der einem „Mea Culpa“ sehr nahe kam. In einer Rede vor dem Council on Foreign Relations gab Richard Haass, Leiter des politischen Planungsstabes im Außenministerium, zu, dass die Vereinigten Staaten einen strategischen Fehler begangen hätten, als sie der Demokratisierung der muslimischen Welt keine angemessene Priorität gaben. Kurz darauf ging Außenminister Colin Powell noch weiter. Er entwarf einen neuen Ansatz zur Förderung der Demokratie in der Region. Präsident Bush hat sich inzwischen ebenfalls für den Aufbau einer demokratischen Ordnung im Irak ausgesprochen.
Natürlich gibt es noch immer viele Kritiker der „Demokratisierungslinie“. Die so genannte Realpolitik ist nicht tot, und viele konservative Republikaner würden sich am liebsten damit begnügen, Saddam Hussein zu stürzen, das Land irgendeinem „anständigen“ General anzuvertrauen und so schnell wie möglich wieder das Weite zu suchen.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums treibt linksliberale Demokraten die Sorge um, der Kreuzzug für die Demokratie könnte in einem zweiten Vietnam enden. Wieder andere fragen, ob Amerika überhaupt das Durchhaltevermögen besitze, eine derartige Aufgabe zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dennoch: Amerika betrachtet die arabische Welt zunehmend mit anderen Augen; das Umdenken hat begonnen.
Der Grund ist: Die Ereignisse des 11. September 2001 haben uns klargemacht, wie verletzlich wir angesichts der neuen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts sind. Osama bin Laden hätte am 11. September zweifellos Massenvernichtungswaffen eingesetzt, wäre er in ihrem Besitz gewesen. Niemand zweifelt daran, dass terroristische Gruppen und „Schurkenstaaten“ früher oder später über solche Waffen verfügen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Waffen gegen unsere Gesellschaften eingesetzt werden, ist heute sogar höher als zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Kubakrise.
Diese Bedrohung kommt vor allem aus dem Nahen und Mittleren Osten. Von hier aus werden antiwestliche Ideologien in Umlauf gebracht, hier werden die künftigen Terroristen rekrutiert, von hier stammt das Geld zur Finanzierung künftiger Anschläge.
Diese Region ist ein geopolitisches Pulverfass.
Ein Bericht, den arabische Wissenschaftler jüngst für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) angefertigt haben, belegt, dass die dortigen Staaten mit den Herausforderungen der Modernisierung und Globalisierung nicht fertig werden. Ihre Regime verpassen den Anschluss an die internationale Entwicklung. Nicht einmal in den Ländern mit riesigen Erlösen aus dem Erdölexport gelingt der Aufbau eines Wirtschaftssystems, das den Bürgern Wohlstand und Würde bringen könnte.
Die maroden Bildungssysteme lassen eine schlecht ausgebildete Jugend mit begrenzten Berufsaussichten zurück. Diese wird zur leichten Beute für die Propagandisten von Hass und Terror. Zugleich kommen die modernen Kommunikationsmittel vor allem denen zugute, die das Scheitern und die Rückständigkeit der arabischen Staaten als Ergebnis finsterer Machenschaften des Westens darstellen.
Nicht alle Bedrohungen, die aus dieser Region hervorgehen, haben ihre Ursache in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Stagnation. Aber allgemeine Rückständigkeit verschärft die Probleme. Der arabisch-israelische Konflikt hat zwar andere Wurzeln, doch heute sind es strukturelle Defekte, die ihn nähren und radikalisieren. Selbst Saddam Hussein wäre in einer stabilen Region eine weitaus geringere Bedrohung für den Westen, als er es heute ist.
Im 20. Jahrhundert ging die größte Bedrohung des Weltfriedens von Europa aus, heute sind der Nahe und Mittlere Osten das Hauptproblem. Um aus der strategischen Sackgasse herauszukommen, in der wir uns gegenwärtig befinden, müssen wir die Grundlagen unserer Politik neu durchdenken.
Im Namen der Stabilität haben die Vereinigten Staaten allzu oft reaktionäre Kräfte unterstützt und geholfen, einen ungerechten Status quo festzuschreiben. Das hat die Wut ausgelöst, der sich Amerika heute weithin ausgesetzt sieht. Der einzige Weg aus diesem Dilemma: Wir müssen den amerikanischen Einfluss künftig nutzen, um soziale Veränderungen in Richtung Demokratie und Modernisierung zu fördern. Das muss Bestandteil der Strategie im Kampf gegen den Terrorismus werden.
Eine erfolgversprechende Strategie gegen den Terrorismus muss über militärische Prävention hinausgehen und politische Vorbeugung betreiben. Den Krieg gegen den Terrorismus müssen wir militärisch führen. Aber ebenso intensiv müssen wir uns um den Wandel im Nahen und Mittleren Osten kümmern. Wir müssen dazu beitragen, dass politische und gesellschaftliche Systeme entstehen, die eine Teilhabe ihrer Bürger ermöglichen und die politische Verantwortlichkeit der Regierenden sicherstellen.
Das wird, gelinde gesagt, alles andere als einfach werden. Die Vereinigten Staaten haben noch nicht alle Antworten auf die Frage parat, wie der erforderliche Wandel bewerkstelligt werden könnte.
Nicht einmal die einzige verbliebene Supermacht kann den Zauberstab schwingen und über Nacht Demokratien erschaffen. Sie werden Schritt für Schritt über Jahre hinweg entstehen müssen.
Ob das gelingt, wird davon abhängen, ob eine neue arabische Führungsschicht entsteht, die mit uns zusammenarbeitet. Welche Rolle können dabei die Vereinigten Staaten und der Westen insgesamt spielen? „Letztlich ist der Kampf um eine moderne und säkulare Ordnung in der arabischen Welt eine Angelegenheit der Araber selbst“, hat Fouad Ajami in Foreign Affairs geschrieben. „Aber der Wille und das Prestige einer großen Macht können mithelfen, die Gewichte zugunsten von Modernität und Wandel zu verschieben.“
Ein Projekt von dieser enormen Dimension macht es notwendig, dass Amerika und Europa ihre konzeptionellen Fähigkeiten ebenso wie ihre weichen und harten Machtmittel gemeinsam zur Anwendung bringen.
Die Europäer haben stets das Fehlen einer langfristigen Strategie beklagt, die den Terrorismus an der Wurzel packt. Gerade sie müssten die neue machtpolitische Orientierung der Vereinigten Staaten deshalb eigentlich begrüßen. Doch bislang haben die Europäer darauf nur mit Skepsis, wenn nicht gar mit Feindseligkeit reagiert.
Die europäischen Vorbehalte betreffen drei Punkte. Erstens sei die arabische Welt weder reif für die Demokratie, noch hätte sie eine Idee davon. Wenn die Amerikaner auf demokratischen Wandel drängten, so sei dies idealistisch, naiv und ahistorisch. Nun stimmt es zwar, dass die demokratische Revolution, die in den vergangenen Jahrzehnten viele Länder der Welt erfasst hat, am Nahen und Mittleren Osten weitgehend vorbeigegangen ist. Doch es zeugt nicht nur von Arroganz und Determinismus, die Völker einer ganzen Weltgegend für die Demokratie als kulturell ungeeignet abzustempeln – diese These ist auch bereits historisch widerlegt. Vor der indischen Unabhängigkeit hatten die Briten behauptet, Inder könnten unmöglich zu Demokraten werden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ansicht verbreitet, die Deutschen hätten einen genetisch bedingten Hang zur Diktatur. Ähnliches wurde über die japanische Gesellschaft und andere asiatische Völker behauptet. Und es ist noch nicht lange her, dass weiße Südafrikaner auf der Suche nach einer Rechtfertigung für ihr System der Apartheid das Argument bemühten, ihre schwarzen Landsleute wüssten mit Demokratie nun einmal nichts anzufangen.
Der Ruf nach mehr Demokratie in der arabischen Welt kommt nicht nur aus dem Westen. Eine wachsende Anzahl von Arabern erhebt dieselbe Forderung, an erster Stelle freie Iraker außerhalb des Machtbereichs von Saddam Hussein. Klarheit sollte freilich über den Vergleichsmaßstab bestehen, der gelten muss, wenn demnächst im Irak das Experiment der Demokratie unternommen werden sollte.
Es wird dann nicht darum gehen, den Irak in ein zweites Irland zu verwandeln oder Saudi-Arabien in ein zweites Schweden. Unser Ziel ist es, einem irakischen Regime nach Saddam Hussein beim Aufbau einer Ordnung etwa auf dem Niveau der Türkei zu helfen.
Betrachtet man die gesellschaftlichen Indikatoren, die Wissenschaftler als Kriterien für die Fähigkeit zur Demokratisierung nennen, dann dürfen der Irak und verschiedene andere Staaten im Nahen und Mittleren Osten mit Sicherheit als Anwärter auf eine solche Entwicklung gelten.
Der zweite europäische Einwand lautet, Demokratie könne nicht mithilfe militärischer Gewalt aufgebaut werden. Doch auch in dieser Hinsicht sind Deutschland und Japan Gegenbeispiele: Die Demokratie begann hier erst Wurzeln zu schlagen, nachdem eine militärische Invasion der Vereinigten Staaten die dort herrschenden totalitären Regime zu Fall gebracht und die Bedingungen für eine demokratische Erneuerung geschaffen hatte.
Ob die Amerikaner in einem künftigen Irak ohne Saddam Hussein willkommen sein werden, können wir freilich erst sicher wissen, wenn es so weit ist. In einem aktuellen Bericht der International Crises Group (ICG) wird zwar jede militärische Intervention strikt abgelehnt. Doch die Berichterstatter stellen zugleich fest, dass das irakische Volk eine langfristige internationale Präsenz im Irak und den Wiederaufbau des Landes unter amerikanischer Führung sehr wahrscheinlich begrüßen würde.
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Das Auftreten der Vereinigten Staaten als glaubwürdige Verfechter der Demokratie in der Region setzt eine andere amerikanische Politik voraus. Im arabisch- israelischen Konflikt müssen die Vereinigten Staaten wieder die Rolle eines aktiven und für beide Seiten vertrauenswürdigen Vermittlers spielen.
Washington muss die eigenen Ziele konsequent und unbeirrbar vertreten – nicht nur gegenüber seinen Gegnern und Feinden, sondern auch gegenüber seinen Freunden. Tatsächlich könnte es sich als das schwierigste politische Problem überhaupt erweisen, Verbündete wie Saudi-Arabien und Ägypten auf den Pfad demokratischer Tugend zu bringen. Eine unterschwellige Debatte darüber, wie die Transformation dieser Staaten unterstützt werden könnte, hat bereits begonnen. Einige Beobachter meinen, es könne durchaus sein, dass im Irak und im Iran heute bessere Voraussetzungen für Demokratie bestehen und ein größeres proamerikanisches Potenzial vorhanden ist als in anderen Staaten der Region.
Drittens wird die Frage gestellt, ob die Vereinigten Staaten das Durchhaltevermögen besitzen, eine Strategie der Demokratisierung in die Tat umzusetzen.
Ich glaube, dass dies der Fall ist. Letztlich werden die Vereinigten Staaten – und Europa – gar keine andere Wahl haben, als alles daranzusetzen, die demokratische Transformation des Nahen und Mittleren Ostens zum Erfolg zu führen. In die Probleme und Konflikte dieser Region werden wir hineingezogen, ob wir dies wollen oder nicht. Offen ist allein die Frage, ob wir die Weitsicht besitzen, schon im Voraus eine Strategie zu entwickeln – oder ob wir tatenlos abwarten, bis der nächste Krieg und der nächste terroristische Angriff uns direkt betreffen.
Im vergangenen Jahrhundert waren zwei Weltkriege nötig, bis die Amerikaner verstanden haben, dass es dauerhaften Frieden in Europa ohne ihren langfristigen Einsatz für die Demokratisierung und den Zusammenschluss des Kontinents nicht geben werde. Hoffentlich lernen wir diesmal schneller.
Aus dem Englischen von Tobias Dürr
Ronald D. Asmus arbeitet für das "Council on Foreign Relations", einem Politikberatungsinstitut in Washington. Asmus war in Clintons Amtszeit führender Mitarbeiter im Außenministerium
siehe auch Frankfurter Rundschau :
http://www.fr-aktuell.de/uebersicht/alle_dossiers/politik_au…
---
"Weg ins Desaster"
Harvard-Professor Stanley Hoffmann kritisiert die Irak-Politik der amerikanischen Regierung
ZEIT-Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff
die zeit: Professor Hoffmann, ist die Demokratisierung des Nahen Ostens Voraussetzung eines erfolgreichen Kampfes gegen den Terrorismus?
Stanley Hoffmann: Nein, denn Demokratie liegt nicht im Interesse der nahöstlichen Staaten. Die müssen sich zwar gegen Terrorismus wehren, brauchen dazu aber keine Demokratie. Die Invasion eines arabischen Landes, selbst wenn sie sich gegen Saddam Hussein richtet, züchtet bloß Anti-Amerikanismus. Die Vorstellung, die Demokratie werde sich vom Irak aus über den Nahen Osten verbreiten, ist eine Fantasie. Allerdings eine sehr attraktive für Amerikaner, die sich immer gern als Verbreiter der Demokratie sehen.
zeit: Ist die Annahme, Araber seien ungeeignet für die Demokratie, nicht kulturalistisch?
Hoffmann: Demokratie kann auf lange Sicht nicht von außen aufgezwungen werden – ein Argument, das schon der englische Philosoph John Stuart Mill im 19. Jahrhundert angeführt hat.
zeit: Es ist aber schon erfolgreich versucht worden.
Hoffmann: Ja, unter ganz ungewöhnlichen Bedingungen.
zeit: Was ist jetzt anders?
Hoffmann: Deutschland hatte eine einigermaßen lebendige liberale Tradition. Trotzdem dauerte es Jahrzehnte, bis sich Demokratie entwickelt hat. Selbst wenn es im Irak genauso gelänge, bleibt es unwahrscheinlich, dass sich die Demokratie wie eine Epidemie über die Region verbreitet. Die anderen arabischen Regime werden alles tun, das zu verhindern. Worin sollte der Reiz liegen, sich selbst zu stürzen?
zeit: George Bush sagte vergangene Woche, Amerika habe nach Interventionen keine Soldaten zurückgelassen, sondern Verfassungen und Parlamente. Was ist daran so schlimm?
Hoffmann: Ein schöner Traum, nicht?
zeit: Er meinte das als historisches Faktum.
Hoffmann: Es stimmt in Japan und Deutschland. Aber ansonsten kann man als Amerikaner nicht besonders stolz sein. Denken Sie an Mittelamerika.
zeit: Die Regierung Bush meint, dass Eindämmung und Abschreckung nicht mehr funktionieren, wenn Tyrannen Massenvernichtungswaffen benutzen oder weitergeben könnten.
Hoffmann: Das bestreite ich. Tatsächlich funktioniert Abschreckung gegen transnationale Terror-banden wie al-Qaida nicht. Anders ist das bei Staaten. Lässt man Tyrannen wissen, dass Amerika jede Nutzung ahndet, werden diese Leute ihre Waffen nicht einsetzen.
zeit: Was, wenn sie die Waffen weitergeben?
Hoffmann: Da muss man jeden Fall einzeln anschauen. Saddam Hussein tut das nicht – solange er nicht angegriffen wird. Die Nordkoreaner scheinen verhandeln zu wollen. Selbst wenn wir diese Waffen beseitigten, könnte das am Ende deren Verbreitung beschleunigen. Andere Staaten werden sagen: „Wir wollen nicht wie der Irak behandelt werden.“
zeit: Ist es so unwahrscheinlich, dass solche Waffen weitergegeben werden?
Hoffmann: Bisher ja.
zeit: Soll man im Zeitalter des katastrophischen Terrorismus nicht für den Notfall vorbeugen?
Hoffmann: Wie denn? In dem man alle Regime beseitigt, die wir nicht mögen und die Massenvernichtungswaffen haben? Das sind verflucht viele.
zeit: Kann ein Präventivschlag je gerechtfertigt sein?
Hoffmann: Nur wenn wir überzeugt sind, dass wir nicht abwarten dürfen, weil sonst wir angegriffen würden.
zeit: Genau das behauptet im Moment die Regierung Bush.
Hoffmann: Die Bedrohung ist nicht so offensichtlich wie beim Sechstagekrieg 1967 in Israel. Unsere Regierung will mehr. Und das erzeugt nur zusätzliche Instabilität in der Welt.
zeit: Wir sehen in diesen Tagen das Auftauchen der Weltmeinung als zweiter Supermacht. Ist das ein Aufstand gegen amerikanische Hegemonie?
Hoffmann: Das Problem mit der Weltmeinung ist, dass sie flüchtig ist. Da ist spontan eine eindrucksvolle Bewegung aus Gründen entstanden, die in jedem Land einzeln zu suchen sind.
zeit: Aber die Gründe scheinen ebenso viel mit dem Irak zu tun zu haben wie mit Amerika.
Hoffmann: Es besteht tatsächlich die Sorge, dass die Vereinigten Staaten – mögen die Absichten auch ehrenhaft sein – zu Mitteln greifen, die nicht ohne internationale Legitimierung eingesetzt werden sollten. Ist es legitim für ein einzelnes Land zu behaupten: Wir repräsentieren die Weltordnung? Nein, das ist das Gesetz des Dschungels!
zeit: Was ist die Zukunft des UN-Sicherheitsrates, wenn er in einer so gravierenden Frage nicht handlungsfähig bleibt?
Hoffmann: Die Art, wie diese amerikanische Regierung mit dem Irak-Problem umgeht und seit ihrem Amtsantritt auch mit der Uno, stellt eine Gefahr für das internationale Recht, für die Uno und für alle Alliierten dar. Das trägt dazu bei, die EU zu spalten, die immerhin eine der wenigen Errungenschaften des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Und alles wegen eines Iraks, der es nicht wert ist. Wenn der Sicherheitsrat am Ende paralysiert ist, wird diese US-Regierung ihn links liegen lassen.
zeit: Wäre damit die Uno am Ende?
Hoffmann: Eine Weltorganisation, die sich um globale Sicherheitsfragen kümmert, wäre ohne die Vereinigten Staaten nicht viel wert. Sofern man sich eine halbwegs geordnete Welt wünscht, führt der Weg, auf dem wir uns gerade befinden, ins Desaster.
zeit: Wozu soll amerikanische Macht in der Welt nach dem 11. September gut sein?
Hoffmann: Die Koalition gegen den Terror anzuführen. Auch müsste Amerika eingreifen, wenn die gemeinsame Sicherheit gefährdet ist und Menschenrechte massiv durch einen Tyrannen bedroht sind.
zeit: Könnten Sie mit diesem Programm in Amerika gewählt werden?
Hoffmann: Ja sicher, denn es verheißt Ordnung. Es bedeutet, dass wir weiter tun, was wir ziemlich erfolgreich zwischen 1945 und 2000 gemacht haben: in eine allgemein akzeptierte Richtung zu führen, ohne andere zu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht mögen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Führung und Diktat.
zeit: Ist Amerika jetzt ein Imperium?
Hoffmann: Es gibt in Washington Leute, die sich an dieser Idee berauschen. Sie meinen, die Alternative zum Imperium sei Chaos. Da Amerika für seine guten Absichten und wegen seiner Demokratie bekannt ist, fragen sie: Was spricht gegen ein Imperium der Wohlwollenden? Das Problem ist, dass unkontrollierte Imperien labil sind.
zeit: Einige haben ganz schön lange gehalten.
Hoffmann: Aber nur durch den Einsatz von Gewalt im Innern. Dazu hätte die amerikanische Bevölkerung nicht den Durchhaltewillen.
zeit: Teile Europas liegen mit Amerika im Streit. Sehen wir gerade das Ende des Westens? Oder geht das vorbei wie ein böser Traum?
Hoffmann: Es ginge vorbei, wenn die amerikanische Regierung es zuließe. Es ist doch nicht die Absicht der Franzosen oder der Deutschen, einen dauerhaften Bruch mit Washington zu riskieren.
zeit: Ist es noch wichtig, was Frankreich und Deutschland wollen, wenn Teile der amerikanischen Regierung die Idee verfolgen, ein gespaltenes und schwaches Europa nütze Amerika?
Hoffmann: Es hängt alles davon ab, wie kurzsichtig die amerikanische Regierung vorgeht. Sie kann eigentlich kein Interesse daran haben, die eigenen Allianzen zu spalten. Wenn die USA nicht das diplomatische Geschick haben, Streit zu schlichten, könnten wir erleben, was bisher vermieden wurde: dass sich andere Staaten gegen die dominierende Macht zusammen tun.
zeit: Was müsste getan werden, um die transatlantischen Wunden zu heilen?
Hoffmann: Erstens: Herrn Rumsfeld nicht mehr nach Deutschland schicken. Zweitens: eine Kompromiss-Resolution im Sicherheitsrat suchen.
zeit: Und was wäre nach dem Ende des Irak-Krieges zu tun?
Hoffmann: Gemeinsam versuchen, den Nahostkonflikt zu lösen.
Ronald D. Asmus
Der bewaffnete Fortschritt
Amerika muss den Nahen Osten demokratisieren.
Und sei es mit militärischer Gewalt
Das amerikanische Nachdenken über den Nahen Osten unterliegt derzeit einem kompletten Wandel. Seit dem 11. September 2001 diskutiert Amerika darüber, wie die Modernisierung und Demokratisierung dieser Region zum tragenden Pfeiler einer langfristigen amerikanischen Strategie im Kampf gegen den Terrorismus gemacht werden könnte. Wir erleben einen in seinem Umfang, seiner Ambition und seinen möglichen Auswirkungen geradezu atemberaubenden Paradigmenwechsel.
Immer mehr amerikanische Rechte und Linke in den Vereinigten Staaten befürworten diesen Umbruch. Für Neokonservative in Amerika ist es ohnehin ein Glaubenssatz, dass auf die Befreiung von Bagdad eine gemeinschaftliche Anstrengung folgen müsse, den Irak zur ersten funktionierenden Demokratie der arabischen Region umzuwandeln. Am Irak wollen sie vorführen, was aus der arabischen Welt werden kann, wenn Amerika seine Macht einsetzt.
Aber auch von führenden Vertretern der Demokratischen Partei in Amerika sind ähnliche Plädoyers zu hören. Sie meinen, seit dem 11. September dürfe Washington keine autokratischen und theokratischen Regime in der Region mehr unterstützen. Stattdessen sollten die Vereinigten Staaten dort zu Wandel und Reform beitragen und damit antiamerikanischen Ressentiments dauerhaft den Boden entziehen.
Viele Demokraten knüpfen ihre Zustimmung zur Invasion des Irak an die Bedingung, dass die Vereinigten Staaten sich verpflichten, nach dem Krieg einen demokratischen Irak aufzubauen. Mit den Senatoren John Edwards, John Kerry und Joe Lieberman haben sich drei führende Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei in ihren Wahlprogrammen ausdrücklich zu dieser Perspektive für den Nahen und Mittleren Ostens bekannt.
Dem Appell, die Macht der Vereinigten Staaten für eine neue säkulare und moderne Ordnung in der arabischen Welt einzusetzen, haben sich neben dem namhaften arabischen Politikwissenschaftler Fouad Ajami auch einige der renommiertesten amerikanischen Arabienexperten angeschlossen. So ist Bernard Lewis dem Komitee zur Befreiung des Irak beigetreten, einer jüngst gegründeten Unterstützergruppe von Republikanern und Demokraten, die sich diesem Ziel verpflichtet fühlen.
Regierungen geben nur selten Fehler zu. Doch im vergangenen Dezember machte die Bush-Regierung einen Schritt, der einem „Mea Culpa“ sehr nahe kam. In einer Rede vor dem Council on Foreign Relations gab Richard Haass, Leiter des politischen Planungsstabes im Außenministerium, zu, dass die Vereinigten Staaten einen strategischen Fehler begangen hätten, als sie der Demokratisierung der muslimischen Welt keine angemessene Priorität gaben. Kurz darauf ging Außenminister Colin Powell noch weiter. Er entwarf einen neuen Ansatz zur Förderung der Demokratie in der Region. Präsident Bush hat sich inzwischen ebenfalls für den Aufbau einer demokratischen Ordnung im Irak ausgesprochen.
Natürlich gibt es noch immer viele Kritiker der „Demokratisierungslinie“. Die so genannte Realpolitik ist nicht tot, und viele konservative Republikaner würden sich am liebsten damit begnügen, Saddam Hussein zu stürzen, das Land irgendeinem „anständigen“ General anzuvertrauen und so schnell wie möglich wieder das Weite zu suchen.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums treibt linksliberale Demokraten die Sorge um, der Kreuzzug für die Demokratie könnte in einem zweiten Vietnam enden. Wieder andere fragen, ob Amerika überhaupt das Durchhaltevermögen besitze, eine derartige Aufgabe zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dennoch: Amerika betrachtet die arabische Welt zunehmend mit anderen Augen; das Umdenken hat begonnen.
Der Grund ist: Die Ereignisse des 11. September 2001 haben uns klargemacht, wie verletzlich wir angesichts der neuen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts sind. Osama bin Laden hätte am 11. September zweifellos Massenvernichtungswaffen eingesetzt, wäre er in ihrem Besitz gewesen. Niemand zweifelt daran, dass terroristische Gruppen und „Schurkenstaaten“ früher oder später über solche Waffen verfügen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Waffen gegen unsere Gesellschaften eingesetzt werden, ist heute sogar höher als zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Kubakrise.
Diese Bedrohung kommt vor allem aus dem Nahen und Mittleren Osten. Von hier aus werden antiwestliche Ideologien in Umlauf gebracht, hier werden die künftigen Terroristen rekrutiert, von hier stammt das Geld zur Finanzierung künftiger Anschläge.
Diese Region ist ein geopolitisches Pulverfass.
Ein Bericht, den arabische Wissenschaftler jüngst für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) angefertigt haben, belegt, dass die dortigen Staaten mit den Herausforderungen der Modernisierung und Globalisierung nicht fertig werden. Ihre Regime verpassen den Anschluss an die internationale Entwicklung. Nicht einmal in den Ländern mit riesigen Erlösen aus dem Erdölexport gelingt der Aufbau eines Wirtschaftssystems, das den Bürgern Wohlstand und Würde bringen könnte.
Die maroden Bildungssysteme lassen eine schlecht ausgebildete Jugend mit begrenzten Berufsaussichten zurück. Diese wird zur leichten Beute für die Propagandisten von Hass und Terror. Zugleich kommen die modernen Kommunikationsmittel vor allem denen zugute, die das Scheitern und die Rückständigkeit der arabischen Staaten als Ergebnis finsterer Machenschaften des Westens darstellen.
Nicht alle Bedrohungen, die aus dieser Region hervorgehen, haben ihre Ursache in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Stagnation. Aber allgemeine Rückständigkeit verschärft die Probleme. Der arabisch-israelische Konflikt hat zwar andere Wurzeln, doch heute sind es strukturelle Defekte, die ihn nähren und radikalisieren. Selbst Saddam Hussein wäre in einer stabilen Region eine weitaus geringere Bedrohung für den Westen, als er es heute ist.
Im 20. Jahrhundert ging die größte Bedrohung des Weltfriedens von Europa aus, heute sind der Nahe und Mittlere Osten das Hauptproblem. Um aus der strategischen Sackgasse herauszukommen, in der wir uns gegenwärtig befinden, müssen wir die Grundlagen unserer Politik neu durchdenken.
Im Namen der Stabilität haben die Vereinigten Staaten allzu oft reaktionäre Kräfte unterstützt und geholfen, einen ungerechten Status quo festzuschreiben. Das hat die Wut ausgelöst, der sich Amerika heute weithin ausgesetzt sieht. Der einzige Weg aus diesem Dilemma: Wir müssen den amerikanischen Einfluss künftig nutzen, um soziale Veränderungen in Richtung Demokratie und Modernisierung zu fördern. Das muss Bestandteil der Strategie im Kampf gegen den Terrorismus werden.
Eine erfolgversprechende Strategie gegen den Terrorismus muss über militärische Prävention hinausgehen und politische Vorbeugung betreiben. Den Krieg gegen den Terrorismus müssen wir militärisch führen. Aber ebenso intensiv müssen wir uns um den Wandel im Nahen und Mittleren Osten kümmern. Wir müssen dazu beitragen, dass politische und gesellschaftliche Systeme entstehen, die eine Teilhabe ihrer Bürger ermöglichen und die politische Verantwortlichkeit der Regierenden sicherstellen.
Das wird, gelinde gesagt, alles andere als einfach werden. Die Vereinigten Staaten haben noch nicht alle Antworten auf die Frage parat, wie der erforderliche Wandel bewerkstelligt werden könnte.
Nicht einmal die einzige verbliebene Supermacht kann den Zauberstab schwingen und über Nacht Demokratien erschaffen. Sie werden Schritt für Schritt über Jahre hinweg entstehen müssen.
Ob das gelingt, wird davon abhängen, ob eine neue arabische Führungsschicht entsteht, die mit uns zusammenarbeitet. Welche Rolle können dabei die Vereinigten Staaten und der Westen insgesamt spielen? „Letztlich ist der Kampf um eine moderne und säkulare Ordnung in der arabischen Welt eine Angelegenheit der Araber selbst“, hat Fouad Ajami in Foreign Affairs geschrieben. „Aber der Wille und das Prestige einer großen Macht können mithelfen, die Gewichte zugunsten von Modernität und Wandel zu verschieben.“
Ein Projekt von dieser enormen Dimension macht es notwendig, dass Amerika und Europa ihre konzeptionellen Fähigkeiten ebenso wie ihre weichen und harten Machtmittel gemeinsam zur Anwendung bringen.
Die Europäer haben stets das Fehlen einer langfristigen Strategie beklagt, die den Terrorismus an der Wurzel packt. Gerade sie müssten die neue machtpolitische Orientierung der Vereinigten Staaten deshalb eigentlich begrüßen. Doch bislang haben die Europäer darauf nur mit Skepsis, wenn nicht gar mit Feindseligkeit reagiert.
Die europäischen Vorbehalte betreffen drei Punkte. Erstens sei die arabische Welt weder reif für die Demokratie, noch hätte sie eine Idee davon. Wenn die Amerikaner auf demokratischen Wandel drängten, so sei dies idealistisch, naiv und ahistorisch. Nun stimmt es zwar, dass die demokratische Revolution, die in den vergangenen Jahrzehnten viele Länder der Welt erfasst hat, am Nahen und Mittleren Osten weitgehend vorbeigegangen ist. Doch es zeugt nicht nur von Arroganz und Determinismus, die Völker einer ganzen Weltgegend für die Demokratie als kulturell ungeeignet abzustempeln – diese These ist auch bereits historisch widerlegt. Vor der indischen Unabhängigkeit hatten die Briten behauptet, Inder könnten unmöglich zu Demokraten werden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ansicht verbreitet, die Deutschen hätten einen genetisch bedingten Hang zur Diktatur. Ähnliches wurde über die japanische Gesellschaft und andere asiatische Völker behauptet. Und es ist noch nicht lange her, dass weiße Südafrikaner auf der Suche nach einer Rechtfertigung für ihr System der Apartheid das Argument bemühten, ihre schwarzen Landsleute wüssten mit Demokratie nun einmal nichts anzufangen.
Der Ruf nach mehr Demokratie in der arabischen Welt kommt nicht nur aus dem Westen. Eine wachsende Anzahl von Arabern erhebt dieselbe Forderung, an erster Stelle freie Iraker außerhalb des Machtbereichs von Saddam Hussein. Klarheit sollte freilich über den Vergleichsmaßstab bestehen, der gelten muss, wenn demnächst im Irak das Experiment der Demokratie unternommen werden sollte.
Es wird dann nicht darum gehen, den Irak in ein zweites Irland zu verwandeln oder Saudi-Arabien in ein zweites Schweden. Unser Ziel ist es, einem irakischen Regime nach Saddam Hussein beim Aufbau einer Ordnung etwa auf dem Niveau der Türkei zu helfen.
Betrachtet man die gesellschaftlichen Indikatoren, die Wissenschaftler als Kriterien für die Fähigkeit zur Demokratisierung nennen, dann dürfen der Irak und verschiedene andere Staaten im Nahen und Mittleren Osten mit Sicherheit als Anwärter auf eine solche Entwicklung gelten.
Der zweite europäische Einwand lautet, Demokratie könne nicht mithilfe militärischer Gewalt aufgebaut werden. Doch auch in dieser Hinsicht sind Deutschland und Japan Gegenbeispiele: Die Demokratie begann hier erst Wurzeln zu schlagen, nachdem eine militärische Invasion der Vereinigten Staaten die dort herrschenden totalitären Regime zu Fall gebracht und die Bedingungen für eine demokratische Erneuerung geschaffen hatte.
Ob die Amerikaner in einem künftigen Irak ohne Saddam Hussein willkommen sein werden, können wir freilich erst sicher wissen, wenn es so weit ist. In einem aktuellen Bericht der International Crises Group (ICG) wird zwar jede militärische Intervention strikt abgelehnt. Doch die Berichterstatter stellen zugleich fest, dass das irakische Volk eine langfristige internationale Präsenz im Irak und den Wiederaufbau des Landes unter amerikanischer Führung sehr wahrscheinlich begrüßen würde.
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Das Auftreten der Vereinigten Staaten als glaubwürdige Verfechter der Demokratie in der Region setzt eine andere amerikanische Politik voraus. Im arabisch- israelischen Konflikt müssen die Vereinigten Staaten wieder die Rolle eines aktiven und für beide Seiten vertrauenswürdigen Vermittlers spielen.
Washington muss die eigenen Ziele konsequent und unbeirrbar vertreten – nicht nur gegenüber seinen Gegnern und Feinden, sondern auch gegenüber seinen Freunden. Tatsächlich könnte es sich als das schwierigste politische Problem überhaupt erweisen, Verbündete wie Saudi-Arabien und Ägypten auf den Pfad demokratischer Tugend zu bringen. Eine unterschwellige Debatte darüber, wie die Transformation dieser Staaten unterstützt werden könnte, hat bereits begonnen. Einige Beobachter meinen, es könne durchaus sein, dass im Irak und im Iran heute bessere Voraussetzungen für Demokratie bestehen und ein größeres proamerikanisches Potenzial vorhanden ist als in anderen Staaten der Region.
Drittens wird die Frage gestellt, ob die Vereinigten Staaten das Durchhaltevermögen besitzen, eine Strategie der Demokratisierung in die Tat umzusetzen.
Ich glaube, dass dies der Fall ist. Letztlich werden die Vereinigten Staaten – und Europa – gar keine andere Wahl haben, als alles daranzusetzen, die demokratische Transformation des Nahen und Mittleren Ostens zum Erfolg zu führen. In die Probleme und Konflikte dieser Region werden wir hineingezogen, ob wir dies wollen oder nicht. Offen ist allein die Frage, ob wir die Weitsicht besitzen, schon im Voraus eine Strategie zu entwickeln – oder ob wir tatenlos abwarten, bis der nächste Krieg und der nächste terroristische Angriff uns direkt betreffen.
Im vergangenen Jahrhundert waren zwei Weltkriege nötig, bis die Amerikaner verstanden haben, dass es dauerhaften Frieden in Europa ohne ihren langfristigen Einsatz für die Demokratisierung und den Zusammenschluss des Kontinents nicht geben werde. Hoffentlich lernen wir diesmal schneller.
Aus dem Englischen von Tobias Dürr
Ronald D. Asmus arbeitet für das "Council on Foreign Relations", einem Politikberatungsinstitut in Washington. Asmus war in Clintons Amtszeit führender Mitarbeiter im Außenministerium
siehe auch Frankfurter Rundschau :
http://www.fr-aktuell.de/uebersicht/alle_dossiers/politik_au…
---
"Weg ins Desaster"
Harvard-Professor Stanley Hoffmann kritisiert die Irak-Politik der amerikanischen Regierung
ZEIT-Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff
die zeit: Professor Hoffmann, ist die Demokratisierung des Nahen Ostens Voraussetzung eines erfolgreichen Kampfes gegen den Terrorismus?
Stanley Hoffmann: Nein, denn Demokratie liegt nicht im Interesse der nahöstlichen Staaten. Die müssen sich zwar gegen Terrorismus wehren, brauchen dazu aber keine Demokratie. Die Invasion eines arabischen Landes, selbst wenn sie sich gegen Saddam Hussein richtet, züchtet bloß Anti-Amerikanismus. Die Vorstellung, die Demokratie werde sich vom Irak aus über den Nahen Osten verbreiten, ist eine Fantasie. Allerdings eine sehr attraktive für Amerikaner, die sich immer gern als Verbreiter der Demokratie sehen.
zeit: Ist die Annahme, Araber seien ungeeignet für die Demokratie, nicht kulturalistisch?
Hoffmann: Demokratie kann auf lange Sicht nicht von außen aufgezwungen werden – ein Argument, das schon der englische Philosoph John Stuart Mill im 19. Jahrhundert angeführt hat.
zeit: Es ist aber schon erfolgreich versucht worden.
Hoffmann: Ja, unter ganz ungewöhnlichen Bedingungen.
zeit: Was ist jetzt anders?
Hoffmann: Deutschland hatte eine einigermaßen lebendige liberale Tradition. Trotzdem dauerte es Jahrzehnte, bis sich Demokratie entwickelt hat. Selbst wenn es im Irak genauso gelänge, bleibt es unwahrscheinlich, dass sich die Demokratie wie eine Epidemie über die Region verbreitet. Die anderen arabischen Regime werden alles tun, das zu verhindern. Worin sollte der Reiz liegen, sich selbst zu stürzen?
zeit: George Bush sagte vergangene Woche, Amerika habe nach Interventionen keine Soldaten zurückgelassen, sondern Verfassungen und Parlamente. Was ist daran so schlimm?
Hoffmann: Ein schöner Traum, nicht?
zeit: Er meinte das als historisches Faktum.
Hoffmann: Es stimmt in Japan und Deutschland. Aber ansonsten kann man als Amerikaner nicht besonders stolz sein. Denken Sie an Mittelamerika.
zeit: Die Regierung Bush meint, dass Eindämmung und Abschreckung nicht mehr funktionieren, wenn Tyrannen Massenvernichtungswaffen benutzen oder weitergeben könnten.
Hoffmann: Das bestreite ich. Tatsächlich funktioniert Abschreckung gegen transnationale Terror-banden wie al-Qaida nicht. Anders ist das bei Staaten. Lässt man Tyrannen wissen, dass Amerika jede Nutzung ahndet, werden diese Leute ihre Waffen nicht einsetzen.
zeit: Was, wenn sie die Waffen weitergeben?
Hoffmann: Da muss man jeden Fall einzeln anschauen. Saddam Hussein tut das nicht – solange er nicht angegriffen wird. Die Nordkoreaner scheinen verhandeln zu wollen. Selbst wenn wir diese Waffen beseitigten, könnte das am Ende deren Verbreitung beschleunigen. Andere Staaten werden sagen: „Wir wollen nicht wie der Irak behandelt werden.“
zeit: Ist es so unwahrscheinlich, dass solche Waffen weitergegeben werden?
Hoffmann: Bisher ja.
zeit: Soll man im Zeitalter des katastrophischen Terrorismus nicht für den Notfall vorbeugen?
Hoffmann: Wie denn? In dem man alle Regime beseitigt, die wir nicht mögen und die Massenvernichtungswaffen haben? Das sind verflucht viele.
zeit: Kann ein Präventivschlag je gerechtfertigt sein?
Hoffmann: Nur wenn wir überzeugt sind, dass wir nicht abwarten dürfen, weil sonst wir angegriffen würden.
zeit: Genau das behauptet im Moment die Regierung Bush.
Hoffmann: Die Bedrohung ist nicht so offensichtlich wie beim Sechstagekrieg 1967 in Israel. Unsere Regierung will mehr. Und das erzeugt nur zusätzliche Instabilität in der Welt.
zeit: Wir sehen in diesen Tagen das Auftauchen der Weltmeinung als zweiter Supermacht. Ist das ein Aufstand gegen amerikanische Hegemonie?
Hoffmann: Das Problem mit der Weltmeinung ist, dass sie flüchtig ist. Da ist spontan eine eindrucksvolle Bewegung aus Gründen entstanden, die in jedem Land einzeln zu suchen sind.
zeit: Aber die Gründe scheinen ebenso viel mit dem Irak zu tun zu haben wie mit Amerika.
Hoffmann: Es besteht tatsächlich die Sorge, dass die Vereinigten Staaten – mögen die Absichten auch ehrenhaft sein – zu Mitteln greifen, die nicht ohne internationale Legitimierung eingesetzt werden sollten. Ist es legitim für ein einzelnes Land zu behaupten: Wir repräsentieren die Weltordnung? Nein, das ist das Gesetz des Dschungels!
zeit: Was ist die Zukunft des UN-Sicherheitsrates, wenn er in einer so gravierenden Frage nicht handlungsfähig bleibt?
Hoffmann: Die Art, wie diese amerikanische Regierung mit dem Irak-Problem umgeht und seit ihrem Amtsantritt auch mit der Uno, stellt eine Gefahr für das internationale Recht, für die Uno und für alle Alliierten dar. Das trägt dazu bei, die EU zu spalten, die immerhin eine der wenigen Errungenschaften des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Und alles wegen eines Iraks, der es nicht wert ist. Wenn der Sicherheitsrat am Ende paralysiert ist, wird diese US-Regierung ihn links liegen lassen.
zeit: Wäre damit die Uno am Ende?
Hoffmann: Eine Weltorganisation, die sich um globale Sicherheitsfragen kümmert, wäre ohne die Vereinigten Staaten nicht viel wert. Sofern man sich eine halbwegs geordnete Welt wünscht, führt der Weg, auf dem wir uns gerade befinden, ins Desaster.
zeit: Wozu soll amerikanische Macht in der Welt nach dem 11. September gut sein?
Hoffmann: Die Koalition gegen den Terror anzuführen. Auch müsste Amerika eingreifen, wenn die gemeinsame Sicherheit gefährdet ist und Menschenrechte massiv durch einen Tyrannen bedroht sind.
zeit: Könnten Sie mit diesem Programm in Amerika gewählt werden?
Hoffmann: Ja sicher, denn es verheißt Ordnung. Es bedeutet, dass wir weiter tun, was wir ziemlich erfolgreich zwischen 1945 und 2000 gemacht haben: in eine allgemein akzeptierte Richtung zu führen, ohne andere zu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht mögen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Führung und Diktat.
zeit: Ist Amerika jetzt ein Imperium?
Hoffmann: Es gibt in Washington Leute, die sich an dieser Idee berauschen. Sie meinen, die Alternative zum Imperium sei Chaos. Da Amerika für seine guten Absichten und wegen seiner Demokratie bekannt ist, fragen sie: Was spricht gegen ein Imperium der Wohlwollenden? Das Problem ist, dass unkontrollierte Imperien labil sind.
zeit: Einige haben ganz schön lange gehalten.
Hoffmann: Aber nur durch den Einsatz von Gewalt im Innern. Dazu hätte die amerikanische Bevölkerung nicht den Durchhaltewillen.
zeit: Teile Europas liegen mit Amerika im Streit. Sehen wir gerade das Ende des Westens? Oder geht das vorbei wie ein böser Traum?
Hoffmann: Es ginge vorbei, wenn die amerikanische Regierung es zuließe. Es ist doch nicht die Absicht der Franzosen oder der Deutschen, einen dauerhaften Bruch mit Washington zu riskieren.
zeit: Ist es noch wichtig, was Frankreich und Deutschland wollen, wenn Teile der amerikanischen Regierung die Idee verfolgen, ein gespaltenes und schwaches Europa nütze Amerika?
Hoffmann: Es hängt alles davon ab, wie kurzsichtig die amerikanische Regierung vorgeht. Sie kann eigentlich kein Interesse daran haben, die eigenen Allianzen zu spalten. Wenn die USA nicht das diplomatische Geschick haben, Streit zu schlichten, könnten wir erleben, was bisher vermieden wurde: dass sich andere Staaten gegen die dominierende Macht zusammen tun.
zeit: Was müsste getan werden, um die transatlantischen Wunden zu heilen?
Hoffmann: Erstens: Herrn Rumsfeld nicht mehr nach Deutschland schicken. Zweitens: eine Kompromiss-Resolution im Sicherheitsrat suchen.
zeit: Und was wäre nach dem Ende des Irak-Krieges zu tun?
Hoffmann: Gemeinsam versuchen, den Nahostkonflikt zu lösen.
.
Im Land der Höllenangst
Islamisten terrorisieren Gebiete der Kurden im Nordirak. Sie kommen nachts aus den Bergen und metzeln ihre Opfer nieder. Unterstützt werden sie von al-Qaida – behaupten kurdische Offiziere
Von Bruno Schirra
Am 4. Dezember 2002 im Nord-Irak, an der Grenze zum Iran, sieht ein Junge zu, wie sein gleichaltriger Freund, von Männern umringt, auf Knien um sein Leben bittet. „Mein Freund weinte und flehte: ,Im Namen Allahs, tötet mich nicht‘.“ Die Männer lachten, zapften aus einem Landrover Benzin ab, gossen es über den Freund. Dann zündeten sie ihn an. Sie sahen zu, wie er verbrannte. Schließlich schoss ihm einer eine Kugel in den Kopf.
„Hast du geweint?“
„Du hast das alles so gesehen?“
„Ja.“
Montag, in den Bergen nahe Halabdscha
Es ist kalt, die Nacht totenstill. Dyari Mohammad sitzt in seinem Unterstand aus Lehm, Steinen und Dung. Er starrt in die Dunkelheit. Sein Kopf ist mit einem schwarzen Tuch vermummt, das nur die Augen frei lässt. Sein Oberkörper steckt in einem zerschlissenen, dick wattierten Armeeparka. An seinem Gürtel baumeln zwei Handgranaten, in den Taschen stecken drei Reservemagazine. Dyari Mohammad hat Angst, Höllenangst.
Im Norden des Irak hat der Krieg längst angefangen. Kurden kämpfen gegen Islamisten, die sich in den Bergen verschanzt haben und nachts die Stellungen der kurdischen Peshmerga angreifen. Dyari ist ein kurdischer Kämpfer, ein Peshmerga-Soldat der Patriotischen Union Kurdistans (PUK). „Peshmerga bedeutet: Die den Tod nicht fürchten“, sagt er. Er hat es den Tag über schon oft gesagt. 18 Jahre ist der Junge jetzt. Er erzählt, dass er sein ganzes Leben lang davon geträumt hat, Peshmerga zu sein.
Draußen vor dem Unterstand hat der Nieselregen das Gelände in eine rutschige Schlammwüste verwandelt. Der junge Peshmerga hält sich an seiner Kalaschnikow fest, starrt hinaus und schweigt.
„Siehst du etwas?“, frage ich ihn.
Statt zu antworten, sagt er: „Ich fürchte den Tod nicht.“ Seine Stimme ist brüchig. Er zittert am ganzen Körper. Dort draußen müssen sie sein. Vermutlich nur wenige hundert Meter entfernt. Die Männer, die seinen Freund Saban bei lebendigem Leibe verbrannt haben. Die „Männer Gottes“, die Kämpfer von Ansar-e Islam.
Am Tag zuvor hatte mich der Peshmerga-Kommandant der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) im Hotel in Suleimanija angerufen und vorgeschlagen, an die Frontlinie zu kommen, wo sich Ansar-e-Islam-Kämpfer und Peshmerga-Einheiten gegenüberstehen. Voraussetzung: Man muss die PUK schriftlich von jeder Verantwortung entbinden.
Die Reise von Suleimanija nach Halabdscha, von wo der Kommandant angerufen hatte, führte eineinhalb Stunden über Schlammwege an armseligen Dörfern vorbei. Hier und da waren auf den Dächern der verlehmten Ziegelhäuser Satellitenschüsseln montiert, in Teestuben saßen Männer, rauchten und tranken Tee, neben sich alte Kalaschnikows griffbereit.
Zwanzig Kilometer vor der Stadt beharrte der Fahrer darauf, direkt hinter einem weiteren PUK-Checkpoint in einen schlammigen Lehmpfad einzubiegen. Es war der Ort, an dem am 7. Februar Ansar-Kämpfer einen General der PUK in einen Hinterhalt lockten. Der General und fünf seiner Begleiter wurden getötet. Die Täter entkamen.
Der Weg, der nur vom Militär benutzt wird, sei sicherer als die parallel laufende „Hauptstraße“, behauptete der Fahrer. Dort sei die Gefahr zu groß, unter Granaten- und Mörserbeschuss von Ansar-e-Islam-Kriegern zu geraten.
In der Kommandantur in Halabdscha zeigte Burham Said Sofi, stellvertretender Befehlshaber der Peshmerga, auf einer Militärkarte die gegnerischen Stellungen.
„Ohne die Hilfe der Amerikaner können wir Ansar-e Islam nicht vernichten. Wir kommen nicht in ihr Gebiet.“ Die Islamisten haben den einzigen Zugang in ihr Territorium mit einem dreifachen Sperrgürtel aus Minen und Sprengfallen gesperrt. „Wir brauchen amerikanische Kampfflugzeuge und Helikopter, die uns den Weg frei bomben“, sagte Said Sofi.
„Auch amerikanische Truppen?“
Er zuckte mit den Schultern: „Wir nehmen jede Hilfe, die wir bekommen.“
Die Hilfe ist schon unterwegs. Amerikanische Special Forces, Navy Seals und Delta-Force-Kommandos sind in das von Ansar-e Islam beherrschte Gebiet eingesickert. Sie bereiten den Angriff vor. Auf dem Weg nach Halabdscha war ein Humvee-Wagen mit zwei Männern zu sehen. Die Special Forces bevorzugen diese Humvees. Andere Journalisten haben leidvoll erfahren, dass die Special Forces unerkannt bleiben wollen. Einem New York Times-Reporter, der sie fotografiert hat, wurde unsanft der Chip aus der Kamera entnommen.
„Wann werden die Amerikaner Ihnen helfen gegen Ansar-e Islam?“, fragte ich.
„Bald ist das Problem gelöst. Wenn der Krieg richtig losgeht, können es sich die Amerikaner nicht leisten, in ihrem Rücken 1000 Islamisten zu haben, die chemische Kampfstoffe einsetzen können.“
Im vergangenen Jahr hat Said Sofi mehr als 350 Männer im Kampf gegen Ansar-e Islam verloren.
„Ansar-e Islam ist bestens ausgerüstet“, sagte Said Sofi. „Sie bekommen Waffen aus dem Iran und von Saddam Hussein: Kalaschnikows, Minen, Mörser und Granten bis zum Kaliber 120 Millimeter.“
Said Sofi forderte einen Trupp Peshmerga-Kämpfer an. Sie sollten den Konvoi zur Front begleiten. Dann legte sich Said Sofi fest:
„Ansar-e Islam hat das gleiche Programm wie die Taliban, und ihre Ideologie ist die von Osama bin Laden“, erklärte der Kommandant. „Ansar-e Islam ist al-Qaida.“
100 bis 150 arabische und afghanische Mudschaheddin trieben sich in der Bergregion von Ansar-e Islam herum. Vor dem 11. September 2001 und auch nachher seien sie ungehindert durch den Iran nach Kurdistan eingeschleust worden.
„Es gibt keine besseren Guerrilla-Kämpfer als Osama bin Ladens Dschihadis“, sagte Said Sofi. „Keine besseren und keine grausameren. Ihre Religion ist nicht der Islam, ihre Religion ist der Terror.“
Das hat er am Mittag erklärt, und dann sind unter lautem Hupen seine Soldaten mit uns an die Front gefahren. Jetzt ist es Nacht, und seit einer Stunde werden die Stellungen der PUK aus dreihundert Meter Entfernung beschossen. Mit schrillem Pfeifen schlagen Mörsergranaten und Kugeln aus automatischen Gewehren um die Unterstände herum ein. Die Gewehrkugeln lassen kleine Lehmklumpen aufspritzen. Die Peshmerga feuern zurück. Der Zufall schützt in dieser Nacht die Menschen auf beiden Seiten.
„Ich bin Muslim, ich glaube an Gott, werde immer an meinen Gott glauben“, sagt jetzt Dyari, der Junge, dessen Freund sie hinrichteten, „aber deren Gott ist nicht meiner, deren Religion nicht meine.“
In den Unterständen und Bunkern auf den beiden Hügeln nahe der kleinen Ortschaft Tapa Kapa kauerten in jener Nacht, der Nacht zum 4. Dezember 2002, nur wenige Peshmerga. Viele ihrer Kameraden hatten Fronturlaub. Es war der Tag vor Id al Fidr, dem Festtag am Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan, in dem es Muslimen verboten ist zu kämpfen. Der Angriff der „Krieger Gottes“ überraschte die Peshmerga im Schlaf, um 4.20 Uhr am Morgen. Nach knapp drei Stunden war er vorbei. Es war ein klarer Wintermorgen, und die Berge rund um Halabdscha glänzten im strahlenden Weiß. Die „Streiter Gottes“ trieben 24 überlebende Peshmerga an den Rand der Straße, die von Khurmal nach Halabdscha führt. Dort lagen bereits 28 im nächtlichen Kampf getötete PUK-Kämpfer nebeneinander aufgereiht. Dann begannen die Ansar-Kämpfer mit ihrer eigentlichen Arbeit. Die Streiter Allahs priesen ihren Gott, manche sangen, während sie mehreren Gefangenen die Kehle durchtrennten. Anderen schlugen sie mit Macheten den Schädel ein. Nachdem das Töten vorbei war, schnitten die „Heiligen Krieger“ ihren Opfern Ohren, Nasen und Hände ab. Es ist ein ritueller Akt – auf diese Weise soll den Opfern die Seele genommen werden.
So erzählt Dyari die Geschichte von seinem 18-jährigen Freund, der den Tod nicht fürchtete. „Seit ich gesehen habe, was Ansar macht, bete ich nicht mehr“, sagt Dyari. „Ich habe Angst, so zu sterben.“
Der Kampf an jenem 4. Dezember, das Abschlachten der Gefangenen, ihre Verstümmelung, ist von Ansar-e-Islam-Leuten selbst auf Video-Filmen dokumentiert worden. Auf ihnen ist zu sehen, dass nicht nur Kurden, sondern auch Al-Qaida-Kämpfer an dem Massaker beteiligt waren. Sie gaben Befehle auf Arabisch. Die Videos wurden von Ansar noch am selben Tag ins Internet gestellt.
Dienstag, in Suleimanija
Vor dem Palace Hotel in Suleimanija plärrt aus Lautsprechern seit Stunden Marschmusik. Hunderte von Männern strömen vor dem frisch gelb angestrichenen Gebäude zusammen. Vor dem Eingang stehen schwer bewaffnete Peshmerga. Sie lächeln freundlich. Die Kurdische Demokratische Partei (KDP) von Masoud Barzani hat zum ersten Mal eine Vertretung im Herzen des Herrschaftsgebietes von Jalal Talabanis’ PUK eröffnet. Ein deutliches Zeichen: Nun soll es vorbei sein mit dem Bruderkrieg der Kurden untereinander. Auf seinem Höhepunkt 1996 rief die KDP unter Barzani die Truppen des verhassten Saddam Hussein ins kurdische Autonomiegebiet, um den Erzrivalen Talabanis aus Erbil zu vertreiben.
„Wir haben beide katastrophale Fehler gemacht“, weiß General Simko Dizayii, Mitglied im Generalstab der PUK. „Aber jetzt müssen wir zusammenhalten, ob wir das wollen oder nicht.“ Sie wollen. Gemeinsam wollen sie den Krieg der Amerikaner unterstützen.
Vor dem Palace, einem Vier-Sterne-Hotel, ist ein Pick-up-Truck der Peshmerga vorgefahren. Aus dem aufgeschnittenen Dach ragt der Lauf eines Maschinengewehrs. Drei alte Kämpfer der PUK patrouillieren auf und ab. Show oder Notwendigkeit? Das ist schwer einzuschätzen. „Security – Sicherheit“, wirft eine kurdische Pressefrau lakonisch hin, „nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.“ Es gibt Gerüchte, Selbstmordattentäter von Ansar-e Islam seien auf dem Weg. Ihr Ziel sei unter anderem das Palace mit seinen ausländischen Gästen. „Only for your own security!“, sagt die Pressefrau noch einmal und zeigt auf die bewaffneten Männer vor der Hoteltür.
Sonst finden Kontrollen nicht statt. Journalisten registrieren verblüfft, dass es in Kurdistan nahezu keine verschlossenen Türen gibt. Die Reporter können sich ohne offizielle Begleiter frei bewegen. Bereitwillig öffnen Polizei und Sicherheitsdienst ihre Gefängnisse, auf dass die Presseleute vorbeikommen, um mit inhaftierten irakischen Geheimdienstleuten und mit Al-Qaida-Leuten zu reden oder um sich mit Dokumenten zu versorgen, die den Kurden in die Hände gefallen sind.
Die Strategie wird offen zugegeben. „Wir wollen“, sagt die um unsere Sicherheit besorgte Pressefrau, „dass ihr der Welt erzählt, wie es hier ist, dass wir seit Jahrzehnten schon in dem Krieg stehen, den Europa jetzt verhindern will. Aber nur dieser Krieg wird uns und dem irakischen Volk Frieden bringen.“
Es gibt 150 Zeitungen, Magazine, Wochenzeitungen, 20 Radiostationen, vier TV-Sender in Kurdistan. Kommunistische, nationalistische, säkulare und streng religiöse. Frei sind sie und manchmal sogar frech – auch wenn es den feudalen Führern nicht passt.
Mittwoch, im Basar von Halabdscha und am Checkpoint
Halabdscha ist eine Stadt gebeugter Männer. Nur selten sind Frauen oder Kinder in den Gassen unterwegs. Wenn man welche sieht, dann fällt der Blick zuerst auf ihre deformierten Köpfe. Es sind Kinder, bei deren Anblick man weinen möchte. Kinder, deren Mütter und Väter vor 15 Jahren dem Gasangriff ausgesetzt waren und überlebt haben. Die Erinnerung an den 16. März 1988 lässt niemanden los. Es war der Tag, an dem Saddam Hussein die ganze Stadt vergasen wollte – und 5000 Menschen starben.
Aber auch eine ganz akute Angst lähmt die Bewohner von Halabdscha. Vor knapp einer Stunde hat sich an einem Checkpoint der PUK am Stadteingang ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Die Wucht der Explosion hat den Jeep, mit dem der Mann unterwegs war, zwanzig Meter durch die Luft gewirbelt, bevor er auf allen vier Rädern wieder aufsetzte. Auf der Straße lagen die zerfetzten menschlichen Überreste von vier Kurden. Jedem ist klar, der Sprengstoff explodierte zu früh. Das Ziel des Attentäters war das belebte Zentrum von Halabdscha.
Die Ungewissheit verschließt den Männern den Mund. Vor unzähligen Teestuben stehen Menschen dicht gedrängt. Sie rauchen und trinken, grüßen und antworten auf Fragen, bis die eine gestellt wird, die Frage nach Ansar-e Islam. Wie auf Befehl verstummen die Männer und weichen zurück. Den Peshmerga-Kämpfern ist dies unangenehm. Sie schieben die Menschen zurück und drängen sie, Fragen zu beantworten. Doch die Männer von Halabdscha schütteln nur stumm ihre Köpfe.
„Gehen Sie“, sagt schließlich einer, „gehen Sie schnell weg von hier.“ Die Stadt sei in ihrer Angst vor Ansar-e Islam gefangen, raunt uns ein anderer zu. „Ansar hat überall seine Augen und Ohren, auch hier, und wenn wir mit ausländischen Journalisten reden, dann werden sie kommen und uns und unsere Frauen und Kinder töten. Sie schlachten uns. Sie hassen euch, und sie werden euch töten und uns auch.“ Er läuft schnell davon.
In ihrem Herrschaftsgebiet um Biyara an der iranischen Grenze haben die Islamisten ein System geschaffen, das wie ein Abziehbild der Taliban-Herrschaft in Afghanistan wirkt. Frauen dürfen, wenn überhaupt, nur in Begleitung ihrer Männer und in der Burka verhüllt auf die Straße, Männer müssen sich Bärte stehen lassen. Musik und Spiele sind verboten. Flüchtlinge aus dem Gebiet der Ansar-e Islam berichten, dass auf Befehl der arabischen Mudschaheddin ein weit verzweigtes Höhlensystem in die Berge getrieben worden sei. Die Menschen dort nennen es „Little Tora Bora“.
Ansar ist al-Qaida – hatte der PUK-Kommandeur Said Sofi gesagt.
Tatsächlich gibt es Verbindungen. Neben einem Handbuch zur Bombenherstellung und einer Munitionsinventarliste von al-Qaida fand ein Reporter der New York Times in einem Al-Qaida-Gästehaus in Kabul Dokumente des Netzwerkes mit dem Datum 11. August 2001. Auch sie belegen, dass Ansar-e Islam mit al-Qaida eng verbunden ist. In den Dokumenten, so die New York Times, fänden sich Namenslisten mit den Pseudonymen von Afghanistan-Kämpfern. Darunter auch die von Kurden. Ebenso ein Memorandum der „Irakischen Islamischen Kurdistan Brigade“ in Afghanistan, in dem kurdische Städte wie Biyara aufgelistet waren. Die verschiedenen islamistischen Gruppen Kurdistans wurden demnach aufgefordert, sich zu vereinen und das Land nach den Regeln der Taliban zu beherrschen.
Der Weg dorthin, zitierte die New York Times aus den Dokumenten, sei der Weg des Dschihad im Krieg gegen die „Kreuzzügler und Juden“. Er entspricht der Kriegserklärung von al-Qaida von 1998. „Verjagt diese Juden und Christen aus Kurdistan und geht den Weg des Dschihad. Beherrsche jedes Stück Land, das du beherrschst, unter der Herrschaft der islamischen Scharia.“, heißt es in dem Memorandum der irakisch-islamischen Kurdistanbrigade.
Am 1. September 2001, zehn Tage vor dem Anschlag auf die Twin Towers und das Pentagon, kam eine ganze Al-Qaida-Truppe über den Iran in das Gebiet um Biyara. Führer aus dem Kreis der 15-köpfigen Schura, dem Rat von Ansar, waren zuvor eigens zu Osama bin Laden gereist, unter ihnen die zurzeit wichtigsten Ansar-Führer in den Shinerve-Bergen. Zwei Wochen später ging aus der Jund-ul Islam, der Vereinigung verschiedener islamistischer kurdischer Gruppen, Ansar-e Islam hervor. Ihr nomineller Führer wurde Najim-al-Din Faraj Ahmad, besser bekannt unter dem Namen Mullah Krekar.
Mullah Krekar, zurzeit im norwegischen Exil, bestreitet in Interviews jede Verbindung von Ansar-e Islam zu al-Qaida. Er sei, so berichtet die New York Times, schon in den achtziger Jahren in Afghanistan und Pakistan Schüler von Abdullah Azzam, dem Gründer und Vordenker von al-Qaida gewesen. Über dessen Zögling Osama bin Laden spricht der kurdische Mullah im Exil mit Verehrung. Bin Laden sei „das Juwel in der Krone des Islam“, so Krekar im Spiegel.
Suleimanija, in Remy’s Nachtclub
Mitternacht in Suleimanija – im Remy’s Club drängen sich UN-Mitarbeiter, junge Kurden und Journalisten an die Bar. Jemand hat Geburtstag, aus dem Lautsprecher dröhnt Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Die Lautstärke ist so hoch wie der Alkoholpegel der Besucher. Es stinkt nach kaltem Zigarettenrauch, teurem Whisky und schlechtem Parfum. Remy’s Club liegt direkt neben dem örtlichen Hauptquartier der UN. Das macht Sinn. Die UN-Mitarbeiter sind die besten Kunden.
Am Mittag ist in einem zerschossenen Haus eine Ausstellung eröffnet worden.
Bevor die Panzergranaten einschlugen, hatten hier – bis 1991 – Saddam Husseins Geheimdienste ihr Hauptquartier. Hier wurde gefoltert und getötet. Dies war eine der Zentralen, in denen die Planungen für den Massenmord an den Kurden reiften. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sind rund 100000 Menschen den Gräueltaten Ende der achtziger Jahre zum Opfer gefallen. „Jede Familie in Kurdistan“, sagt der kurdische Minister für Menschenrechte Salah Rashid, „hat mindestens einen Sohn, eine Tochter oder Vater oder Mutter verloren.“ Die Kurden nennen eine Zahl von 150000 bis 200000 Toten.
Und jetzt stehen bei Schneeregen fröstelnd Hunderte Männer und Frauen, Journalisten und Politiker im Hof der ehemaligen Terrorzentrale herum und warten. Sie warten auf Ann Clwyd, eine englische Parlamentsabgeordnete. Die Labour-Politikerin hat die Ausstellung mit organisiert. Als die Abgeordnete eintrifft, setzt sich die Besucherschar schweigend in Bewegung und zieht durch die Flure der einstigen Folterwerkstatt. Vorbei an Mauern, an denen Fotos hängen. Bild um Bild – Erinnerung an das Sterben, die Flucht und die Vertreibung der Kurden durch das Regime von Saddam Hussein. Bilder von Opfern und Bilder von Tätern.
Eines zeigt drei Männer. Sie sitzen auf ihren Fersen, lächeln schelmisch. Einer schaut direkt in die Kamera, hebt die Hand zum Victory-Zeichen. In seiner anderen Hand hält er den abgeschnittenen Kopf eines kurdischen Jungen. Unter den monotonen Klängen der Klagemusik fragt jemand die Engländerin, wie sie sich hier fühle. Sie erstarrt, schaut fassungslos hoch, fängt an zu weinen, heult und heult. Später wird sie in die Mikrofone sagen: „Das einzige Mittel, dies in der Zukunft zu verhindern, ist Krieg – Krieg gegen Saddam.“
In Remy’s Bar reden sie bis spät in die Nacht mit der angestrengten Ernsthaftigkeit von Leuten, die viel getrunken haben. UN-Mitarbeiter, die für den Krieg sind, streiten mit Journalisten, die dagegen sind, und umgekehrt. Die Diskussion wogt hin und her, es geht um Inspektionen, Gas, Völkerrecht und Erstschlag.
„Wie kann man gegen diesen Krieg sein“, stöhnt ein UN-Mann, „wenn man diese Bilder gesehen hat?“ – „Aber wie kann man für diesen Krieg sein, wenn man weiß, wie viele Zivilisten verrecken werden?“, hält ein Journalist dagegen. Die Mitarbeiter der UN wissen, dass sie derzeit in diesem Teil des Irak nicht wohl gelitten sind.
Samstag, im Gefängnis von Suleimanija
Das Gefängnis der kurdischen Geheimpolizei ist ein kleiner zweistöckiger Bau. Weiß getüncht, mit Türen, die Besuchern offen stehen. Die Kurden sind stolz auf dieses Gefängnis. Ausländische Menschenrechtsorganisationen wie Medico international bescheinigen den örtlichen Behörden, dass sie die Gefangenen gut behandeln. Keine Rede von Folter. „Überzeugen Sie sich davon!“, schlägt ein Mitarbeiter des Geheimdienstes in der Lobby des Palace Hotel vor. Mit dem Ergebnis, dass die Gefangenen, ob nun islamistische al-Qaida, kurdischer Ansar-e Islam oder irakischer Geheimdienst, mittlerweile ganze Stapel an Visitenkarten ausländischer Journalisten vorweisen können, von New York Times, New Yorker, Los Angeles Times und Le Monde.
Der 33 Jahre alte Mann mit dem Decknamen Al Shamary ist einer, der im Besucherraum ruhig und ganz und gar nicht wie einstudiert seine Geschichte erzählt. Aufpasser sind nicht dabei. Auf dem Heizstrahler steht eine Kanne Tee, Al Shamary serviert. Sein richtiger Name sei Haider Al Shmari, sein Beruf: Unteroffizier des irakischen Geheimdienstes.
„Wie werden Sie hier behandelt?“
„Gut, ich kann nicht klagen“, antwortet er und schaut spöttisch, als wisse er, welche Frage jetzt kommt.
„Sind Sie gefoltert worden?“
Er lächelt. „Nein, man behandelt uns gut hier.“
Al Shamary registriert die Skepsis, er bietet Details an. Er nennt den genauen Namen und Ort seines Dienstes in Bagdad, nennt die Namen seiner Vorgesetzten und zählt detailliert die Stationen seiner Karriere als Mitglied des Geheimdienstes von Saddams Schwiegersohn Hussein Kamel auf. Dieser war bis zu seiner Flucht nach Jordanien 1995 der wichtigste Mann im chemischen und biologischen Waffenprogramm des Irak. Erst seine Flucht und seine Hinweise ermöglichten es den UN-Inspektoren, Teile von Saddam Husseins Massenvernichtungsprogramm zu finden.
Al Shamary will im Auftrag Bagdads den Waffenschmuggel zu Ansar-e Islam mitgeplant haben. Zwischen September 2001 und dem 6. Juni 2002, als er von der PUK verhaftet wurde, habe er drei Tonnen Material – Mörsergranaten, Gewehre, TNT, Minen und Munition – aus Bagdad organisiert. Auf kleinen Pick-up-Trucks verladen, seien die Waffen ins Ansar-Gebiet geschafft worden. Bei jeder Warenlieferung seien auch chemische und biologische Substanzen gewesen, die in einfachen Labors in den Bergen aufbereitet worden seien. Rizin, Anthrax, Aflatoxin.
„Wo sind diese Laboratorien?“
Al Shamary antwortet, ohne zu zögern. „In Sargat.“
„Das ist der Ort, von dem Colin Powell behauptet hat, dort befände sich eine chemische Kampfstofffabrik. Wir waren dort, viele Journalisten, Kamerateams, auch ich, und wir haben nichts gefunden.“
Al Shamary zuckt mit den Schultern. „Sie glauben tatsächlich, dass Sie alles gesehen haben? Ansar-e Islam lässt Sie dort doch nur rein, wenn sie vorher alles vorbereitet haben! Für wie dumm halten Sie die Afghanis?“
Tatsächlich war beim Pressetermin auf Ansar-e-Islam-Territorium alles streng kontrolliert. Als einige Journalisten sich abseits des Geländes, das die Ansar-Kämpfer zur Besichtigung freigegeben hatten, umschauen wollten, kippte die Stimmung. Die bärtigen Gastgeber entsicherten ihre Kalaschnikows und trieben die Journalisten zurück. Ein Bereich in Sargat, der mit Stacheldraht gesichert war, blieb tabu. An den Drahtverhauen prangten sichtbar die internationalen Gift-Warnschilder.
„Die chemischen Waffen, die Laboratorien, die Orte, an denen mit Kampfstoffen an Hunden und anderen Tieren experimentiert wird, werden alle von den arabischen Afghanistan-Mudschaheddin kontrolliert“, sagt Al Shamary. „Sie haben dort oben chemische Kampfstoffe, und sie haben sie in den vergangenen Monaten an andere Gruppen weitergegeben.“
Al Shamary antwortet geduldig auf jede Frage während des fast vierstündigen Gesprächs. Er bietet wieder Tee an, dann kommt er auf Saddam Hussein zu sprechen und dessen Verbindungen zu al-Qaida. „Natürlich haben seine Geheimdienste mit al-Qaida kooperiert. Sie haben gemeinsame Feinde: die USA, Israel, das Saudische Königreich und die kurdischen Autonomiegebiete. Zwar war Saddam Hussein nie ein religiöser Mann. Er hat im eigenen Land die Islamisten verfolgt und getötet. Das hindert ihn nicht daran, Osama bin Laden und Ansar-e Islam zu unterstützen, auszubilden und bei Bedarf zu benutzen.“
Der Häftling skizziert ein Zweckbündnis zwischen Saddam Hussein und al-Qaida. Es habe 1992 begonnen, als Aimann Zawahiri, damals Führer des ägyptischen Islamischen Dschihad, zum ersten Mal Bagdad besuchte. Die Geheimdienste Saddam Husseins hätten zwischen 1994 und 1995 mit Vertretern von al-Qaida im Sudan zusammengearbeitet, dort die Kader des Netzwerkes trainiert. Nach der Vertreibung von bin Laden aus dem Sudan seien vor allem seit 1998 in mehreren Trainingslagern im Irak Al-Qaida-Kämpfer von Spezialisten der Einheit 999, einer Elitetruppe des irakischen Diktators, ausgebildet worden. Der wichtigste Verbindungsmann Saddam Husseins zu al-Qaida sei seit 1995 ein Mann namens Abu Wael. Al Shamary beschreibt ihn als einen 65 Jahre alten Major des irakischen Geheimdienstes.
Sonntag, im Gefängnis von Suleimanija
„Reden Sie mit Kaiis Ibrahim Kadir“, hat der kurdische Geheimdienstoffizier vorgeschlagen, als er einen weiteren Besuch im Gefängnis anregte. Durch die Tür zum Besucherraum tritt ein schmächtiger junger Mann mit langem schwar-zem Bart. Er grüßt mit dem muslimischen Salam aleikum, sieht die ausgestreckte Hand:
„Sind Sie Muslim?“, fragt er.
„Nein.“
„Dann sind Sie unrein. Ich beschmutze mich nicht dadurch, dass ich Ihnen die Hand gebe.“
Ibrahim Kadir ist 27 Jahre alt, ein Kurde aus Erbil. „Sind Sie bereit, ein Märtyrer zu werden?“, will ich von ihm wissen.
Da reckt er sich auf seinem Stuhl auf, die Augen sprühen. „Ich war es, ich bin es, ich werde es immer sein!“
Ibrahim Kadir hat im April 2002 zusammen mit vier anderen Ansar-e-Islam-Kämpfern versucht, den kurdischen Premierminster Bahram Salih vor seinem Haus in Suleimanija zu töten. Der Anschlag misslang, fünf Leibwächter des Politikers und die anderen vier Angreifer starben. Auftraggeber des Anschlages war, sagt Ibrahim Kadir, ein Mann namens Qodama. Bei seinen Verhören durch den kurdischen Geheimdienst wurden ihm die Bilder mehrerer Männer vorgelegt, Kadir identifizierte Kaduma auf Anhieb. Der Mann auf dem Bild, auf das Kadir zeigte, nennt sich auch Abu Mussa Zarkawi. Er ist ein hochrangiges Al-Qaida-Mitglied.
„Zarkawi arbeitet mit dem irakischen Geheimdienst zusammen, ist er auch Al-Qaida-Mitglied?“
Ibrahim Kadir wehrt ab. „Ich bin ein Anhänger von al-Qaida, ich bin Mitglied von al-Qaida, und ich sage Ihnen, niemals würde al-Qaida mit Saddam Hussein zusammenarbeiten.“
Bevor Kaiis Ibrahim Kadir im Januar 2002 zu Ansar-e Islam in die Berge gegangen war, betätigte er sich als Kurier im Auftrag von al-Qaida. Er reiste nach Syrien, Jordanien und in den Jemen. Der Weg führte ihn auch für einige Wochen nach Bagdad.
„Was haben Sie dort gemacht, wie haben Sie das finanziert?“
Kadir lächelt sein immer gleiches, sanftes Lächeln. „Sie müssen wissen, ich bin bereit, mit Ihnen zu reden. Ich sage Ihnen vieles, aber nicht alles. Ich habe nicht mit Saddam zusammengearbeitet. Und Geld ist nie ein Problem.“ Seine Reise führt ihn weiter nach Amman zu Gesprächen mit Hamas und Vertretern des Palästinensischen Dschihad.
„Haben Sie über eine Zusammenarbeit mit beiden Gruppen gesprochen?“
Er verneint, man habe eben geredet. Dann nennt er Namen. Khaled Michal, Hamasvertreter, sowie Abu Mohammad Mekdessi.
„Wer ist das?“
Kaiis Ibrahim Kadir grinst zum ersten Mal spöttisch. „Sie müssen wirklich hinnehmen, dass ich Ihnen nicht alles sagen werde.“
„Belügen Sie mich?“
„Nein, ich sage Ihnen nicht alles, aber belügen werde ich Sie nicht.“
Es ist spät geworden, Ibrahim Kadir steht auf. Ein heiliger Krieger Gottes, sanft, ruhig, ein gebildeter Mann. Er verabschiedet sich. Die angebotene Hand übersieht er. In der Tür dreht er sich um.
„Wir sind im Krieg miteinander“, sagt er, „Ihre Welt und meine, Sie und ich.“
„Im Krieg wird getötet. Heißt das, Sie würden mich töten, wenn Sie könnten? Ich habe Ihnen nichts getan.“
„Nein, Sie haben mir nichts getan, ich habe nichts gegen Sie persönlich. Ja, ich würde Sie töten, wenn ich könnte. Sie stehen für das, was die Muslime vernichten will.“ Der Dolmetscher übersetzt, zieht die Augenbrauen hoch.
„Ich kämpfe nicht gegen Sie. Ich bin Zivilist. Ihr Glaube verbietet Ihnen doch, unschuldige Zivilisten zu töten.“
„Sie sind Teil des Systems“, fährt Kadir fort. „Auch wenn Sie Zivilist sind. Ich würde Sie als Gefangenen nehmen, um Sie gegen unsere Gefangenen auszutauschen. Wenn das nicht ginge, würde ich Sie töten.“
„Wie würden Sie mich töten, so wie ihre Brüder von Ansar-e Islam die Peshmerga-Kämpfer am 4. Dezember 2002 geschlachtet haben?“
„Sie taten dies, und wir sind stolz darauf“, sagt Kaiis Ibrahim Kadir. Er lächelt dabei milde.
Montag, in den Hügeln bei Halabdscha
Erstaunlich, was einem in diesen Tagen in den Bergen Kurdistans widerfahren kann. Man trifft dort auf Krieger Gottes, Freunde von Osama bin Laden, die einen höflich nach der Visitenkarte fragen, bevor sie die eigene überreichen. Auf der dann beispielsweise als Beruf „Consultant“ vermerkt ist. So ist es auch bei einem Mann, der Mustafa heißt. Alt und grau, aber mit einem Händedruck, der Knochen zerbrechen kann. Ein in sich ruhender Mensch, der sagt, dass er bereit sei für den Tag, an dem Mullah Ali Bapir ihm den Befehl gibt, ein Märtyrer zu werden.
„Sie würden sich in die Luft jagen?“
Der 56 Jahre alte Mustafa streicht sich bedächtig durch den schneeweißen Bart. Er nickt nur mit dem Kopf.
„Gegen wen werden Sie sich als menschliche Bombe wenden?“
Mustafa schaut auf: „Gegen die Amerikaner natürlich, wenn sie kommen, und sie werden kommen.“
Das Treffen mit Mustafa und Mullah Ali Bapir war lange geplant worden. Bewaffnete Krieger hatten hinter einem Checkpoint der PUK am Fuß der Berge auf uns gewartet. Es folgte eine schweigsame Fahrt durch das Gebiet von Mullah Ali Bapir, dem Führer und spirituellen Kopf der Islamischen Gruppe Kurdistans. Kein Peshmerga der PUK betritt das Gebiet von Mullah Bapir. Ali Bapir hat enge Beziehungen zu Ansar-e Islam. Seine bewaffneten Krieger, 2000 Mann, stehen Gewehr bei Fuß.
Ali Bapir residiert in einer Bergfestung, unweit von Khormal, einem Ort mit vielleicht 5000 Einwohnern. Dutzende schwer bewaffneter Krieger bewachen sie. Von hier aus ist das Hügelland bei Sargat, wo Ansar seine Laboratorien versteckt haben soll, mit bloßem Auge zu erkennen. Das Quartier im Berg ist bestens ausgestattet, Computer, Internet-Zugang, Satellitenanlagen.
Der 42 Jahre alte Mullah Bapir zeigt alles stolz, dann eröffnet er das Gespräch: „Die Kämpfer von Ansar-e Islam sind unsere Brüder“, sagt er, „wir haben dasselbe Ziel. Im Geiste und im Glauben.“
„Auch im Handeln?“
Der Mullah wiegt seinen Kopf hin und her. „Unsere Feinde sind dieselben, die, die den Islam verraten, und die, die ihn bekämpfen.“
„Sind das aus Ihrer Sicht die Amerikaner?“
Neben Bapir sitzt ein groß gewachsener Mann, dessen hageres Gesicht von einem pechschwarzen, kurz geschnittenen Bart umrahmt wird. Er trägt auf seinem Kopf eine schwarze Mütze, er ist es, der jetzt antwortet. „Die Amerikaner sind eingeladen, sie sollen nur kommen. Sie haben es bis heute nicht in Afghanistan geschafft, al-Qaida in den Bergen zu besiegen. Unsere Berge hier sind die gleichen wie die Berge in Afghanistan.“ Die Männer um ihn herum nicken ruhig und stolz mit den Köpfen.
„Was ist in Sargat? Haben Sie, hat Ansar-e Islam dort in Laboratorien mit chemischen und biologischen Substanzen gearbeitet?“
Mullah Ali Bapir lässt sich mit der Antwort Zeit. „Es gibt in Sargat keine Fabriken für chemische Waffen, wie das Colin Powell behauptet hat. Sie waren dort, haben Sie irgendetwas gefilmt, das wie eine Fabrik aussieht?“
„Nicht Fabrikanlagen. Haben Sie dort Labors, sind dort chemische Kampfstoffe? Etwa in dem Areal, das von Stacheldraht umzäunt ist, an dem die Warnschilder mit dem Totenkopf hängen.“
Mullah Ali Bapir steht auf. Es ist Zeit zu beten. „Gehen Sie hin, schauen Sie nach“, sagt er noch.
„Was geschieht, wenn wir das tun?“
Mullah Ali Bapir antwortet nicht mehr. Er betet nun. „Dann sind Sie tot“, sagt der „Consultant“ Mustafa und begleitet die Besucher zur Tür. Jemand drückt mir zwei CD-ROMs in die Hand. Die Krieger von Mullah Ali Bapir verabschieden sich freundlich, wünschen für den Weg Gottes Frieden.
Nacht auf Dienstag, Palace Hotel, Suleimanija
Der Computer läuft. Die CD-ROMs wurden geöffnet. Auf dem Monitor erscheinen die Bilder des Massakers am 4. Dezember, der Nacht, in der Dyari Mohammad sieht, wie sein Freund um sein Leben fleht. Auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks kniet ein Ansar-e-Islam-Kämpfer. Vor ihm auf der Straße liegen die Leiber der Geschlachteten.
Er lächelt. Es ist der groß gewachsene Mann, der neben Ali Bapir saß.
Im Land der Höllenangst
Islamisten terrorisieren Gebiete der Kurden im Nordirak. Sie kommen nachts aus den Bergen und metzeln ihre Opfer nieder. Unterstützt werden sie von al-Qaida – behaupten kurdische Offiziere
Von Bruno Schirra
Am 4. Dezember 2002 im Nord-Irak, an der Grenze zum Iran, sieht ein Junge zu, wie sein gleichaltriger Freund, von Männern umringt, auf Knien um sein Leben bittet. „Mein Freund weinte und flehte: ,Im Namen Allahs, tötet mich nicht‘.“ Die Männer lachten, zapften aus einem Landrover Benzin ab, gossen es über den Freund. Dann zündeten sie ihn an. Sie sahen zu, wie er verbrannte. Schließlich schoss ihm einer eine Kugel in den Kopf.
„Hast du geweint?“
„Du hast das alles so gesehen?“
„Ja.“
Montag, in den Bergen nahe Halabdscha
Es ist kalt, die Nacht totenstill. Dyari Mohammad sitzt in seinem Unterstand aus Lehm, Steinen und Dung. Er starrt in die Dunkelheit. Sein Kopf ist mit einem schwarzen Tuch vermummt, das nur die Augen frei lässt. Sein Oberkörper steckt in einem zerschlissenen, dick wattierten Armeeparka. An seinem Gürtel baumeln zwei Handgranaten, in den Taschen stecken drei Reservemagazine. Dyari Mohammad hat Angst, Höllenangst.
Im Norden des Irak hat der Krieg längst angefangen. Kurden kämpfen gegen Islamisten, die sich in den Bergen verschanzt haben und nachts die Stellungen der kurdischen Peshmerga angreifen. Dyari ist ein kurdischer Kämpfer, ein Peshmerga-Soldat der Patriotischen Union Kurdistans (PUK). „Peshmerga bedeutet: Die den Tod nicht fürchten“, sagt er. Er hat es den Tag über schon oft gesagt. 18 Jahre ist der Junge jetzt. Er erzählt, dass er sein ganzes Leben lang davon geträumt hat, Peshmerga zu sein.
Draußen vor dem Unterstand hat der Nieselregen das Gelände in eine rutschige Schlammwüste verwandelt. Der junge Peshmerga hält sich an seiner Kalaschnikow fest, starrt hinaus und schweigt.
„Siehst du etwas?“, frage ich ihn.
Statt zu antworten, sagt er: „Ich fürchte den Tod nicht.“ Seine Stimme ist brüchig. Er zittert am ganzen Körper. Dort draußen müssen sie sein. Vermutlich nur wenige hundert Meter entfernt. Die Männer, die seinen Freund Saban bei lebendigem Leibe verbrannt haben. Die „Männer Gottes“, die Kämpfer von Ansar-e Islam.
Am Tag zuvor hatte mich der Peshmerga-Kommandant der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) im Hotel in Suleimanija angerufen und vorgeschlagen, an die Frontlinie zu kommen, wo sich Ansar-e-Islam-Kämpfer und Peshmerga-Einheiten gegenüberstehen. Voraussetzung: Man muss die PUK schriftlich von jeder Verantwortung entbinden.
Die Reise von Suleimanija nach Halabdscha, von wo der Kommandant angerufen hatte, führte eineinhalb Stunden über Schlammwege an armseligen Dörfern vorbei. Hier und da waren auf den Dächern der verlehmten Ziegelhäuser Satellitenschüsseln montiert, in Teestuben saßen Männer, rauchten und tranken Tee, neben sich alte Kalaschnikows griffbereit.
Zwanzig Kilometer vor der Stadt beharrte der Fahrer darauf, direkt hinter einem weiteren PUK-Checkpoint in einen schlammigen Lehmpfad einzubiegen. Es war der Ort, an dem am 7. Februar Ansar-Kämpfer einen General der PUK in einen Hinterhalt lockten. Der General und fünf seiner Begleiter wurden getötet. Die Täter entkamen.
Der Weg, der nur vom Militär benutzt wird, sei sicherer als die parallel laufende „Hauptstraße“, behauptete der Fahrer. Dort sei die Gefahr zu groß, unter Granaten- und Mörserbeschuss von Ansar-e-Islam-Kriegern zu geraten.
In der Kommandantur in Halabdscha zeigte Burham Said Sofi, stellvertretender Befehlshaber der Peshmerga, auf einer Militärkarte die gegnerischen Stellungen.
„Ohne die Hilfe der Amerikaner können wir Ansar-e Islam nicht vernichten. Wir kommen nicht in ihr Gebiet.“ Die Islamisten haben den einzigen Zugang in ihr Territorium mit einem dreifachen Sperrgürtel aus Minen und Sprengfallen gesperrt. „Wir brauchen amerikanische Kampfflugzeuge und Helikopter, die uns den Weg frei bomben“, sagte Said Sofi.
„Auch amerikanische Truppen?“
Er zuckte mit den Schultern: „Wir nehmen jede Hilfe, die wir bekommen.“
Die Hilfe ist schon unterwegs. Amerikanische Special Forces, Navy Seals und Delta-Force-Kommandos sind in das von Ansar-e Islam beherrschte Gebiet eingesickert. Sie bereiten den Angriff vor. Auf dem Weg nach Halabdscha war ein Humvee-Wagen mit zwei Männern zu sehen. Die Special Forces bevorzugen diese Humvees. Andere Journalisten haben leidvoll erfahren, dass die Special Forces unerkannt bleiben wollen. Einem New York Times-Reporter, der sie fotografiert hat, wurde unsanft der Chip aus der Kamera entnommen.
„Wann werden die Amerikaner Ihnen helfen gegen Ansar-e Islam?“, fragte ich.
„Bald ist das Problem gelöst. Wenn der Krieg richtig losgeht, können es sich die Amerikaner nicht leisten, in ihrem Rücken 1000 Islamisten zu haben, die chemische Kampfstoffe einsetzen können.“
Im vergangenen Jahr hat Said Sofi mehr als 350 Männer im Kampf gegen Ansar-e Islam verloren.
„Ansar-e Islam ist bestens ausgerüstet“, sagte Said Sofi. „Sie bekommen Waffen aus dem Iran und von Saddam Hussein: Kalaschnikows, Minen, Mörser und Granten bis zum Kaliber 120 Millimeter.“
Said Sofi forderte einen Trupp Peshmerga-Kämpfer an. Sie sollten den Konvoi zur Front begleiten. Dann legte sich Said Sofi fest:
„Ansar-e Islam hat das gleiche Programm wie die Taliban, und ihre Ideologie ist die von Osama bin Laden“, erklärte der Kommandant. „Ansar-e Islam ist al-Qaida.“
100 bis 150 arabische und afghanische Mudschaheddin trieben sich in der Bergregion von Ansar-e Islam herum. Vor dem 11. September 2001 und auch nachher seien sie ungehindert durch den Iran nach Kurdistan eingeschleust worden.
„Es gibt keine besseren Guerrilla-Kämpfer als Osama bin Ladens Dschihadis“, sagte Said Sofi. „Keine besseren und keine grausameren. Ihre Religion ist nicht der Islam, ihre Religion ist der Terror.“
Das hat er am Mittag erklärt, und dann sind unter lautem Hupen seine Soldaten mit uns an die Front gefahren. Jetzt ist es Nacht, und seit einer Stunde werden die Stellungen der PUK aus dreihundert Meter Entfernung beschossen. Mit schrillem Pfeifen schlagen Mörsergranaten und Kugeln aus automatischen Gewehren um die Unterstände herum ein. Die Gewehrkugeln lassen kleine Lehmklumpen aufspritzen. Die Peshmerga feuern zurück. Der Zufall schützt in dieser Nacht die Menschen auf beiden Seiten.
„Ich bin Muslim, ich glaube an Gott, werde immer an meinen Gott glauben“, sagt jetzt Dyari, der Junge, dessen Freund sie hinrichteten, „aber deren Gott ist nicht meiner, deren Religion nicht meine.“
In den Unterständen und Bunkern auf den beiden Hügeln nahe der kleinen Ortschaft Tapa Kapa kauerten in jener Nacht, der Nacht zum 4. Dezember 2002, nur wenige Peshmerga. Viele ihrer Kameraden hatten Fronturlaub. Es war der Tag vor Id al Fidr, dem Festtag am Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan, in dem es Muslimen verboten ist zu kämpfen. Der Angriff der „Krieger Gottes“ überraschte die Peshmerga im Schlaf, um 4.20 Uhr am Morgen. Nach knapp drei Stunden war er vorbei. Es war ein klarer Wintermorgen, und die Berge rund um Halabdscha glänzten im strahlenden Weiß. Die „Streiter Gottes“ trieben 24 überlebende Peshmerga an den Rand der Straße, die von Khurmal nach Halabdscha führt. Dort lagen bereits 28 im nächtlichen Kampf getötete PUK-Kämpfer nebeneinander aufgereiht. Dann begannen die Ansar-Kämpfer mit ihrer eigentlichen Arbeit. Die Streiter Allahs priesen ihren Gott, manche sangen, während sie mehreren Gefangenen die Kehle durchtrennten. Anderen schlugen sie mit Macheten den Schädel ein. Nachdem das Töten vorbei war, schnitten die „Heiligen Krieger“ ihren Opfern Ohren, Nasen und Hände ab. Es ist ein ritueller Akt – auf diese Weise soll den Opfern die Seele genommen werden.
So erzählt Dyari die Geschichte von seinem 18-jährigen Freund, der den Tod nicht fürchtete. „Seit ich gesehen habe, was Ansar macht, bete ich nicht mehr“, sagt Dyari. „Ich habe Angst, so zu sterben.“
Der Kampf an jenem 4. Dezember, das Abschlachten der Gefangenen, ihre Verstümmelung, ist von Ansar-e-Islam-Leuten selbst auf Video-Filmen dokumentiert worden. Auf ihnen ist zu sehen, dass nicht nur Kurden, sondern auch Al-Qaida-Kämpfer an dem Massaker beteiligt waren. Sie gaben Befehle auf Arabisch. Die Videos wurden von Ansar noch am selben Tag ins Internet gestellt.
Dienstag, in Suleimanija
Vor dem Palace Hotel in Suleimanija plärrt aus Lautsprechern seit Stunden Marschmusik. Hunderte von Männern strömen vor dem frisch gelb angestrichenen Gebäude zusammen. Vor dem Eingang stehen schwer bewaffnete Peshmerga. Sie lächeln freundlich. Die Kurdische Demokratische Partei (KDP) von Masoud Barzani hat zum ersten Mal eine Vertretung im Herzen des Herrschaftsgebietes von Jalal Talabanis’ PUK eröffnet. Ein deutliches Zeichen: Nun soll es vorbei sein mit dem Bruderkrieg der Kurden untereinander. Auf seinem Höhepunkt 1996 rief die KDP unter Barzani die Truppen des verhassten Saddam Hussein ins kurdische Autonomiegebiet, um den Erzrivalen Talabanis aus Erbil zu vertreiben.
„Wir haben beide katastrophale Fehler gemacht“, weiß General Simko Dizayii, Mitglied im Generalstab der PUK. „Aber jetzt müssen wir zusammenhalten, ob wir das wollen oder nicht.“ Sie wollen. Gemeinsam wollen sie den Krieg der Amerikaner unterstützen.
Vor dem Palace, einem Vier-Sterne-Hotel, ist ein Pick-up-Truck der Peshmerga vorgefahren. Aus dem aufgeschnittenen Dach ragt der Lauf eines Maschinengewehrs. Drei alte Kämpfer der PUK patrouillieren auf und ab. Show oder Notwendigkeit? Das ist schwer einzuschätzen. „Security – Sicherheit“, wirft eine kurdische Pressefrau lakonisch hin, „nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.“ Es gibt Gerüchte, Selbstmordattentäter von Ansar-e Islam seien auf dem Weg. Ihr Ziel sei unter anderem das Palace mit seinen ausländischen Gästen. „Only for your own security!“, sagt die Pressefrau noch einmal und zeigt auf die bewaffneten Männer vor der Hoteltür.
Sonst finden Kontrollen nicht statt. Journalisten registrieren verblüfft, dass es in Kurdistan nahezu keine verschlossenen Türen gibt. Die Reporter können sich ohne offizielle Begleiter frei bewegen. Bereitwillig öffnen Polizei und Sicherheitsdienst ihre Gefängnisse, auf dass die Presseleute vorbeikommen, um mit inhaftierten irakischen Geheimdienstleuten und mit Al-Qaida-Leuten zu reden oder um sich mit Dokumenten zu versorgen, die den Kurden in die Hände gefallen sind.
Die Strategie wird offen zugegeben. „Wir wollen“, sagt die um unsere Sicherheit besorgte Pressefrau, „dass ihr der Welt erzählt, wie es hier ist, dass wir seit Jahrzehnten schon in dem Krieg stehen, den Europa jetzt verhindern will. Aber nur dieser Krieg wird uns und dem irakischen Volk Frieden bringen.“
Es gibt 150 Zeitungen, Magazine, Wochenzeitungen, 20 Radiostationen, vier TV-Sender in Kurdistan. Kommunistische, nationalistische, säkulare und streng religiöse. Frei sind sie und manchmal sogar frech – auch wenn es den feudalen Führern nicht passt.
Mittwoch, im Basar von Halabdscha und am Checkpoint
Halabdscha ist eine Stadt gebeugter Männer. Nur selten sind Frauen oder Kinder in den Gassen unterwegs. Wenn man welche sieht, dann fällt der Blick zuerst auf ihre deformierten Köpfe. Es sind Kinder, bei deren Anblick man weinen möchte. Kinder, deren Mütter und Väter vor 15 Jahren dem Gasangriff ausgesetzt waren und überlebt haben. Die Erinnerung an den 16. März 1988 lässt niemanden los. Es war der Tag, an dem Saddam Hussein die ganze Stadt vergasen wollte – und 5000 Menschen starben.
Aber auch eine ganz akute Angst lähmt die Bewohner von Halabdscha. Vor knapp einer Stunde hat sich an einem Checkpoint der PUK am Stadteingang ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Die Wucht der Explosion hat den Jeep, mit dem der Mann unterwegs war, zwanzig Meter durch die Luft gewirbelt, bevor er auf allen vier Rädern wieder aufsetzte. Auf der Straße lagen die zerfetzten menschlichen Überreste von vier Kurden. Jedem ist klar, der Sprengstoff explodierte zu früh. Das Ziel des Attentäters war das belebte Zentrum von Halabdscha.
Die Ungewissheit verschließt den Männern den Mund. Vor unzähligen Teestuben stehen Menschen dicht gedrängt. Sie rauchen und trinken, grüßen und antworten auf Fragen, bis die eine gestellt wird, die Frage nach Ansar-e Islam. Wie auf Befehl verstummen die Männer und weichen zurück. Den Peshmerga-Kämpfern ist dies unangenehm. Sie schieben die Menschen zurück und drängen sie, Fragen zu beantworten. Doch die Männer von Halabdscha schütteln nur stumm ihre Köpfe.
„Gehen Sie“, sagt schließlich einer, „gehen Sie schnell weg von hier.“ Die Stadt sei in ihrer Angst vor Ansar-e Islam gefangen, raunt uns ein anderer zu. „Ansar hat überall seine Augen und Ohren, auch hier, und wenn wir mit ausländischen Journalisten reden, dann werden sie kommen und uns und unsere Frauen und Kinder töten. Sie schlachten uns. Sie hassen euch, und sie werden euch töten und uns auch.“ Er läuft schnell davon.
In ihrem Herrschaftsgebiet um Biyara an der iranischen Grenze haben die Islamisten ein System geschaffen, das wie ein Abziehbild der Taliban-Herrschaft in Afghanistan wirkt. Frauen dürfen, wenn überhaupt, nur in Begleitung ihrer Männer und in der Burka verhüllt auf die Straße, Männer müssen sich Bärte stehen lassen. Musik und Spiele sind verboten. Flüchtlinge aus dem Gebiet der Ansar-e Islam berichten, dass auf Befehl der arabischen Mudschaheddin ein weit verzweigtes Höhlensystem in die Berge getrieben worden sei. Die Menschen dort nennen es „Little Tora Bora“.
Ansar ist al-Qaida – hatte der PUK-Kommandeur Said Sofi gesagt.
Tatsächlich gibt es Verbindungen. Neben einem Handbuch zur Bombenherstellung und einer Munitionsinventarliste von al-Qaida fand ein Reporter der New York Times in einem Al-Qaida-Gästehaus in Kabul Dokumente des Netzwerkes mit dem Datum 11. August 2001. Auch sie belegen, dass Ansar-e Islam mit al-Qaida eng verbunden ist. In den Dokumenten, so die New York Times, fänden sich Namenslisten mit den Pseudonymen von Afghanistan-Kämpfern. Darunter auch die von Kurden. Ebenso ein Memorandum der „Irakischen Islamischen Kurdistan Brigade“ in Afghanistan, in dem kurdische Städte wie Biyara aufgelistet waren. Die verschiedenen islamistischen Gruppen Kurdistans wurden demnach aufgefordert, sich zu vereinen und das Land nach den Regeln der Taliban zu beherrschen.
Der Weg dorthin, zitierte die New York Times aus den Dokumenten, sei der Weg des Dschihad im Krieg gegen die „Kreuzzügler und Juden“. Er entspricht der Kriegserklärung von al-Qaida von 1998. „Verjagt diese Juden und Christen aus Kurdistan und geht den Weg des Dschihad. Beherrsche jedes Stück Land, das du beherrschst, unter der Herrschaft der islamischen Scharia.“, heißt es in dem Memorandum der irakisch-islamischen Kurdistanbrigade.
Am 1. September 2001, zehn Tage vor dem Anschlag auf die Twin Towers und das Pentagon, kam eine ganze Al-Qaida-Truppe über den Iran in das Gebiet um Biyara. Führer aus dem Kreis der 15-köpfigen Schura, dem Rat von Ansar, waren zuvor eigens zu Osama bin Laden gereist, unter ihnen die zurzeit wichtigsten Ansar-Führer in den Shinerve-Bergen. Zwei Wochen später ging aus der Jund-ul Islam, der Vereinigung verschiedener islamistischer kurdischer Gruppen, Ansar-e Islam hervor. Ihr nomineller Führer wurde Najim-al-Din Faraj Ahmad, besser bekannt unter dem Namen Mullah Krekar.
Mullah Krekar, zurzeit im norwegischen Exil, bestreitet in Interviews jede Verbindung von Ansar-e Islam zu al-Qaida. Er sei, so berichtet die New York Times, schon in den achtziger Jahren in Afghanistan und Pakistan Schüler von Abdullah Azzam, dem Gründer und Vordenker von al-Qaida gewesen. Über dessen Zögling Osama bin Laden spricht der kurdische Mullah im Exil mit Verehrung. Bin Laden sei „das Juwel in der Krone des Islam“, so Krekar im Spiegel.
Suleimanija, in Remy’s Nachtclub
Mitternacht in Suleimanija – im Remy’s Club drängen sich UN-Mitarbeiter, junge Kurden und Journalisten an die Bar. Jemand hat Geburtstag, aus dem Lautsprecher dröhnt Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Die Lautstärke ist so hoch wie der Alkoholpegel der Besucher. Es stinkt nach kaltem Zigarettenrauch, teurem Whisky und schlechtem Parfum. Remy’s Club liegt direkt neben dem örtlichen Hauptquartier der UN. Das macht Sinn. Die UN-Mitarbeiter sind die besten Kunden.
Am Mittag ist in einem zerschossenen Haus eine Ausstellung eröffnet worden.
Bevor die Panzergranaten einschlugen, hatten hier – bis 1991 – Saddam Husseins Geheimdienste ihr Hauptquartier. Hier wurde gefoltert und getötet. Dies war eine der Zentralen, in denen die Planungen für den Massenmord an den Kurden reiften. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sind rund 100000 Menschen den Gräueltaten Ende der achtziger Jahre zum Opfer gefallen. „Jede Familie in Kurdistan“, sagt der kurdische Minister für Menschenrechte Salah Rashid, „hat mindestens einen Sohn, eine Tochter oder Vater oder Mutter verloren.“ Die Kurden nennen eine Zahl von 150000 bis 200000 Toten.
Und jetzt stehen bei Schneeregen fröstelnd Hunderte Männer und Frauen, Journalisten und Politiker im Hof der ehemaligen Terrorzentrale herum und warten. Sie warten auf Ann Clwyd, eine englische Parlamentsabgeordnete. Die Labour-Politikerin hat die Ausstellung mit organisiert. Als die Abgeordnete eintrifft, setzt sich die Besucherschar schweigend in Bewegung und zieht durch die Flure der einstigen Folterwerkstatt. Vorbei an Mauern, an denen Fotos hängen. Bild um Bild – Erinnerung an das Sterben, die Flucht und die Vertreibung der Kurden durch das Regime von Saddam Hussein. Bilder von Opfern und Bilder von Tätern.
Eines zeigt drei Männer. Sie sitzen auf ihren Fersen, lächeln schelmisch. Einer schaut direkt in die Kamera, hebt die Hand zum Victory-Zeichen. In seiner anderen Hand hält er den abgeschnittenen Kopf eines kurdischen Jungen. Unter den monotonen Klängen der Klagemusik fragt jemand die Engländerin, wie sie sich hier fühle. Sie erstarrt, schaut fassungslos hoch, fängt an zu weinen, heult und heult. Später wird sie in die Mikrofone sagen: „Das einzige Mittel, dies in der Zukunft zu verhindern, ist Krieg – Krieg gegen Saddam.“
In Remy’s Bar reden sie bis spät in die Nacht mit der angestrengten Ernsthaftigkeit von Leuten, die viel getrunken haben. UN-Mitarbeiter, die für den Krieg sind, streiten mit Journalisten, die dagegen sind, und umgekehrt. Die Diskussion wogt hin und her, es geht um Inspektionen, Gas, Völkerrecht und Erstschlag.
„Wie kann man gegen diesen Krieg sein“, stöhnt ein UN-Mann, „wenn man diese Bilder gesehen hat?“ – „Aber wie kann man für diesen Krieg sein, wenn man weiß, wie viele Zivilisten verrecken werden?“, hält ein Journalist dagegen. Die Mitarbeiter der UN wissen, dass sie derzeit in diesem Teil des Irak nicht wohl gelitten sind.
Samstag, im Gefängnis von Suleimanija
Das Gefängnis der kurdischen Geheimpolizei ist ein kleiner zweistöckiger Bau. Weiß getüncht, mit Türen, die Besuchern offen stehen. Die Kurden sind stolz auf dieses Gefängnis. Ausländische Menschenrechtsorganisationen wie Medico international bescheinigen den örtlichen Behörden, dass sie die Gefangenen gut behandeln. Keine Rede von Folter. „Überzeugen Sie sich davon!“, schlägt ein Mitarbeiter des Geheimdienstes in der Lobby des Palace Hotel vor. Mit dem Ergebnis, dass die Gefangenen, ob nun islamistische al-Qaida, kurdischer Ansar-e Islam oder irakischer Geheimdienst, mittlerweile ganze Stapel an Visitenkarten ausländischer Journalisten vorweisen können, von New York Times, New Yorker, Los Angeles Times und Le Monde.
Der 33 Jahre alte Mann mit dem Decknamen Al Shamary ist einer, der im Besucherraum ruhig und ganz und gar nicht wie einstudiert seine Geschichte erzählt. Aufpasser sind nicht dabei. Auf dem Heizstrahler steht eine Kanne Tee, Al Shamary serviert. Sein richtiger Name sei Haider Al Shmari, sein Beruf: Unteroffizier des irakischen Geheimdienstes.
„Wie werden Sie hier behandelt?“
„Gut, ich kann nicht klagen“, antwortet er und schaut spöttisch, als wisse er, welche Frage jetzt kommt.
„Sind Sie gefoltert worden?“
Er lächelt. „Nein, man behandelt uns gut hier.“
Al Shamary registriert die Skepsis, er bietet Details an. Er nennt den genauen Namen und Ort seines Dienstes in Bagdad, nennt die Namen seiner Vorgesetzten und zählt detailliert die Stationen seiner Karriere als Mitglied des Geheimdienstes von Saddams Schwiegersohn Hussein Kamel auf. Dieser war bis zu seiner Flucht nach Jordanien 1995 der wichtigste Mann im chemischen und biologischen Waffenprogramm des Irak. Erst seine Flucht und seine Hinweise ermöglichten es den UN-Inspektoren, Teile von Saddam Husseins Massenvernichtungsprogramm zu finden.
Al Shamary will im Auftrag Bagdads den Waffenschmuggel zu Ansar-e Islam mitgeplant haben. Zwischen September 2001 und dem 6. Juni 2002, als er von der PUK verhaftet wurde, habe er drei Tonnen Material – Mörsergranaten, Gewehre, TNT, Minen und Munition – aus Bagdad organisiert. Auf kleinen Pick-up-Trucks verladen, seien die Waffen ins Ansar-Gebiet geschafft worden. Bei jeder Warenlieferung seien auch chemische und biologische Substanzen gewesen, die in einfachen Labors in den Bergen aufbereitet worden seien. Rizin, Anthrax, Aflatoxin.
„Wo sind diese Laboratorien?“
Al Shamary antwortet, ohne zu zögern. „In Sargat.“
„Das ist der Ort, von dem Colin Powell behauptet hat, dort befände sich eine chemische Kampfstofffabrik. Wir waren dort, viele Journalisten, Kamerateams, auch ich, und wir haben nichts gefunden.“
Al Shamary zuckt mit den Schultern. „Sie glauben tatsächlich, dass Sie alles gesehen haben? Ansar-e Islam lässt Sie dort doch nur rein, wenn sie vorher alles vorbereitet haben! Für wie dumm halten Sie die Afghanis?“
Tatsächlich war beim Pressetermin auf Ansar-e-Islam-Territorium alles streng kontrolliert. Als einige Journalisten sich abseits des Geländes, das die Ansar-Kämpfer zur Besichtigung freigegeben hatten, umschauen wollten, kippte die Stimmung. Die bärtigen Gastgeber entsicherten ihre Kalaschnikows und trieben die Journalisten zurück. Ein Bereich in Sargat, der mit Stacheldraht gesichert war, blieb tabu. An den Drahtverhauen prangten sichtbar die internationalen Gift-Warnschilder.
„Die chemischen Waffen, die Laboratorien, die Orte, an denen mit Kampfstoffen an Hunden und anderen Tieren experimentiert wird, werden alle von den arabischen Afghanistan-Mudschaheddin kontrolliert“, sagt Al Shamary. „Sie haben dort oben chemische Kampfstoffe, und sie haben sie in den vergangenen Monaten an andere Gruppen weitergegeben.“
Al Shamary antwortet geduldig auf jede Frage während des fast vierstündigen Gesprächs. Er bietet wieder Tee an, dann kommt er auf Saddam Hussein zu sprechen und dessen Verbindungen zu al-Qaida. „Natürlich haben seine Geheimdienste mit al-Qaida kooperiert. Sie haben gemeinsame Feinde: die USA, Israel, das Saudische Königreich und die kurdischen Autonomiegebiete. Zwar war Saddam Hussein nie ein religiöser Mann. Er hat im eigenen Land die Islamisten verfolgt und getötet. Das hindert ihn nicht daran, Osama bin Laden und Ansar-e Islam zu unterstützen, auszubilden und bei Bedarf zu benutzen.“
Der Häftling skizziert ein Zweckbündnis zwischen Saddam Hussein und al-Qaida. Es habe 1992 begonnen, als Aimann Zawahiri, damals Führer des ägyptischen Islamischen Dschihad, zum ersten Mal Bagdad besuchte. Die Geheimdienste Saddam Husseins hätten zwischen 1994 und 1995 mit Vertretern von al-Qaida im Sudan zusammengearbeitet, dort die Kader des Netzwerkes trainiert. Nach der Vertreibung von bin Laden aus dem Sudan seien vor allem seit 1998 in mehreren Trainingslagern im Irak Al-Qaida-Kämpfer von Spezialisten der Einheit 999, einer Elitetruppe des irakischen Diktators, ausgebildet worden. Der wichtigste Verbindungsmann Saddam Husseins zu al-Qaida sei seit 1995 ein Mann namens Abu Wael. Al Shamary beschreibt ihn als einen 65 Jahre alten Major des irakischen Geheimdienstes.
Sonntag, im Gefängnis von Suleimanija
„Reden Sie mit Kaiis Ibrahim Kadir“, hat der kurdische Geheimdienstoffizier vorgeschlagen, als er einen weiteren Besuch im Gefängnis anregte. Durch die Tür zum Besucherraum tritt ein schmächtiger junger Mann mit langem schwar-zem Bart. Er grüßt mit dem muslimischen Salam aleikum, sieht die ausgestreckte Hand:
„Sind Sie Muslim?“, fragt er.
„Nein.“
„Dann sind Sie unrein. Ich beschmutze mich nicht dadurch, dass ich Ihnen die Hand gebe.“
Ibrahim Kadir ist 27 Jahre alt, ein Kurde aus Erbil. „Sind Sie bereit, ein Märtyrer zu werden?“, will ich von ihm wissen.
Da reckt er sich auf seinem Stuhl auf, die Augen sprühen. „Ich war es, ich bin es, ich werde es immer sein!“
Ibrahim Kadir hat im April 2002 zusammen mit vier anderen Ansar-e-Islam-Kämpfern versucht, den kurdischen Premierminster Bahram Salih vor seinem Haus in Suleimanija zu töten. Der Anschlag misslang, fünf Leibwächter des Politikers und die anderen vier Angreifer starben. Auftraggeber des Anschlages war, sagt Ibrahim Kadir, ein Mann namens Qodama. Bei seinen Verhören durch den kurdischen Geheimdienst wurden ihm die Bilder mehrerer Männer vorgelegt, Kadir identifizierte Kaduma auf Anhieb. Der Mann auf dem Bild, auf das Kadir zeigte, nennt sich auch Abu Mussa Zarkawi. Er ist ein hochrangiges Al-Qaida-Mitglied.
„Zarkawi arbeitet mit dem irakischen Geheimdienst zusammen, ist er auch Al-Qaida-Mitglied?“
Ibrahim Kadir wehrt ab. „Ich bin ein Anhänger von al-Qaida, ich bin Mitglied von al-Qaida, und ich sage Ihnen, niemals würde al-Qaida mit Saddam Hussein zusammenarbeiten.“
Bevor Kaiis Ibrahim Kadir im Januar 2002 zu Ansar-e Islam in die Berge gegangen war, betätigte er sich als Kurier im Auftrag von al-Qaida. Er reiste nach Syrien, Jordanien und in den Jemen. Der Weg führte ihn auch für einige Wochen nach Bagdad.
„Was haben Sie dort gemacht, wie haben Sie das finanziert?“
Kadir lächelt sein immer gleiches, sanftes Lächeln. „Sie müssen wissen, ich bin bereit, mit Ihnen zu reden. Ich sage Ihnen vieles, aber nicht alles. Ich habe nicht mit Saddam zusammengearbeitet. Und Geld ist nie ein Problem.“ Seine Reise führt ihn weiter nach Amman zu Gesprächen mit Hamas und Vertretern des Palästinensischen Dschihad.
„Haben Sie über eine Zusammenarbeit mit beiden Gruppen gesprochen?“
Er verneint, man habe eben geredet. Dann nennt er Namen. Khaled Michal, Hamasvertreter, sowie Abu Mohammad Mekdessi.
„Wer ist das?“
Kaiis Ibrahim Kadir grinst zum ersten Mal spöttisch. „Sie müssen wirklich hinnehmen, dass ich Ihnen nicht alles sagen werde.“
„Belügen Sie mich?“
„Nein, ich sage Ihnen nicht alles, aber belügen werde ich Sie nicht.“
Es ist spät geworden, Ibrahim Kadir steht auf. Ein heiliger Krieger Gottes, sanft, ruhig, ein gebildeter Mann. Er verabschiedet sich. Die angebotene Hand übersieht er. In der Tür dreht er sich um.
„Wir sind im Krieg miteinander“, sagt er, „Ihre Welt und meine, Sie und ich.“
„Im Krieg wird getötet. Heißt das, Sie würden mich töten, wenn Sie könnten? Ich habe Ihnen nichts getan.“
„Nein, Sie haben mir nichts getan, ich habe nichts gegen Sie persönlich. Ja, ich würde Sie töten, wenn ich könnte. Sie stehen für das, was die Muslime vernichten will.“ Der Dolmetscher übersetzt, zieht die Augenbrauen hoch.
„Ich kämpfe nicht gegen Sie. Ich bin Zivilist. Ihr Glaube verbietet Ihnen doch, unschuldige Zivilisten zu töten.“
„Sie sind Teil des Systems“, fährt Kadir fort. „Auch wenn Sie Zivilist sind. Ich würde Sie als Gefangenen nehmen, um Sie gegen unsere Gefangenen auszutauschen. Wenn das nicht ginge, würde ich Sie töten.“
„Wie würden Sie mich töten, so wie ihre Brüder von Ansar-e Islam die Peshmerga-Kämpfer am 4. Dezember 2002 geschlachtet haben?“
„Sie taten dies, und wir sind stolz darauf“, sagt Kaiis Ibrahim Kadir. Er lächelt dabei milde.
Montag, in den Hügeln bei Halabdscha
Erstaunlich, was einem in diesen Tagen in den Bergen Kurdistans widerfahren kann. Man trifft dort auf Krieger Gottes, Freunde von Osama bin Laden, die einen höflich nach der Visitenkarte fragen, bevor sie die eigene überreichen. Auf der dann beispielsweise als Beruf „Consultant“ vermerkt ist. So ist es auch bei einem Mann, der Mustafa heißt. Alt und grau, aber mit einem Händedruck, der Knochen zerbrechen kann. Ein in sich ruhender Mensch, der sagt, dass er bereit sei für den Tag, an dem Mullah Ali Bapir ihm den Befehl gibt, ein Märtyrer zu werden.
„Sie würden sich in die Luft jagen?“
Der 56 Jahre alte Mustafa streicht sich bedächtig durch den schneeweißen Bart. Er nickt nur mit dem Kopf.
„Gegen wen werden Sie sich als menschliche Bombe wenden?“
Mustafa schaut auf: „Gegen die Amerikaner natürlich, wenn sie kommen, und sie werden kommen.“
Das Treffen mit Mustafa und Mullah Ali Bapir war lange geplant worden. Bewaffnete Krieger hatten hinter einem Checkpoint der PUK am Fuß der Berge auf uns gewartet. Es folgte eine schweigsame Fahrt durch das Gebiet von Mullah Ali Bapir, dem Führer und spirituellen Kopf der Islamischen Gruppe Kurdistans. Kein Peshmerga der PUK betritt das Gebiet von Mullah Bapir. Ali Bapir hat enge Beziehungen zu Ansar-e Islam. Seine bewaffneten Krieger, 2000 Mann, stehen Gewehr bei Fuß.
Ali Bapir residiert in einer Bergfestung, unweit von Khormal, einem Ort mit vielleicht 5000 Einwohnern. Dutzende schwer bewaffneter Krieger bewachen sie. Von hier aus ist das Hügelland bei Sargat, wo Ansar seine Laboratorien versteckt haben soll, mit bloßem Auge zu erkennen. Das Quartier im Berg ist bestens ausgestattet, Computer, Internet-Zugang, Satellitenanlagen.
Der 42 Jahre alte Mullah Bapir zeigt alles stolz, dann eröffnet er das Gespräch: „Die Kämpfer von Ansar-e Islam sind unsere Brüder“, sagt er, „wir haben dasselbe Ziel. Im Geiste und im Glauben.“
„Auch im Handeln?“
Der Mullah wiegt seinen Kopf hin und her. „Unsere Feinde sind dieselben, die, die den Islam verraten, und die, die ihn bekämpfen.“
„Sind das aus Ihrer Sicht die Amerikaner?“
Neben Bapir sitzt ein groß gewachsener Mann, dessen hageres Gesicht von einem pechschwarzen, kurz geschnittenen Bart umrahmt wird. Er trägt auf seinem Kopf eine schwarze Mütze, er ist es, der jetzt antwortet. „Die Amerikaner sind eingeladen, sie sollen nur kommen. Sie haben es bis heute nicht in Afghanistan geschafft, al-Qaida in den Bergen zu besiegen. Unsere Berge hier sind die gleichen wie die Berge in Afghanistan.“ Die Männer um ihn herum nicken ruhig und stolz mit den Köpfen.
„Was ist in Sargat? Haben Sie, hat Ansar-e Islam dort in Laboratorien mit chemischen und biologischen Substanzen gearbeitet?“
Mullah Ali Bapir lässt sich mit der Antwort Zeit. „Es gibt in Sargat keine Fabriken für chemische Waffen, wie das Colin Powell behauptet hat. Sie waren dort, haben Sie irgendetwas gefilmt, das wie eine Fabrik aussieht?“
„Nicht Fabrikanlagen. Haben Sie dort Labors, sind dort chemische Kampfstoffe? Etwa in dem Areal, das von Stacheldraht umzäunt ist, an dem die Warnschilder mit dem Totenkopf hängen.“
Mullah Ali Bapir steht auf. Es ist Zeit zu beten. „Gehen Sie hin, schauen Sie nach“, sagt er noch.
„Was geschieht, wenn wir das tun?“
Mullah Ali Bapir antwortet nicht mehr. Er betet nun. „Dann sind Sie tot“, sagt der „Consultant“ Mustafa und begleitet die Besucher zur Tür. Jemand drückt mir zwei CD-ROMs in die Hand. Die Krieger von Mullah Ali Bapir verabschieden sich freundlich, wünschen für den Weg Gottes Frieden.
Nacht auf Dienstag, Palace Hotel, Suleimanija
Der Computer läuft. Die CD-ROMs wurden geöffnet. Auf dem Monitor erscheinen die Bilder des Massakers am 4. Dezember, der Nacht, in der Dyari Mohammad sieht, wie sein Freund um sein Leben fleht. Auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks kniet ein Ansar-e-Islam-Kämpfer. Vor ihm auf der Straße liegen die Leiber der Geschlachteten.
Er lächelt. Es ist der groß gewachsene Mann, der neben Ali Bapir saß.
.
Verlorene Unschuld
Blauhelme und Friedensmissionen der Vereinten Nationen verändern die Welt
- blutiges Scheitern inklusive.
von Manfred Ertel
Raus mit Applaus, wann hat es das für eine militärische Besatzungsmacht schon mal gegeben? Als die multinationale Friedenstruppe vor knapp drei Jahren aus Osttimor abrückte und die Gesamtverwaltung in die Hände der Vereinten Nationen legte, hagelte es Lob von allen Seiten.
Die Soldaten werden "immer einen Platz in unserer Geschichte haben", erklärte feierlich der spätere Präsident José Alexandre "Xanana" Gusmão. Das rührte selbst die strammsten Militärs. Der australische General Peter Cosgrove, Befehlshaber der alliierten Streitmacht, strahlte: "Eine wunderbare Sache."
Rund fünf Monate lang hatte die internationale Friedenstruppe, zu der auch 72 deutsche Soldaten gehörten, im Auftrag des Uno-Sicherheitsrats auf Osttimor die mordenden und plündernden pro-indonesischen Milizen bekämpft. Dann folgten Uno-Soldaten und zivile Uno-Verwalter. Seit knapp einem Jahr ist die einstige indonesische Provinz selbständig und unabhängig, seit kurzem auch Mitglied der Vereinten Nationen.
Der Einsatz auf der Insel im Indischen Ozean ist der vorerst jüngste Beleg für das segensreiche Wirken der Uno. Doch längst nicht alle Friedensmissionen sind so nachdrücklich als Erfolg in die Geschichte der Vereinten Nationen eingegangen.
Nach insgesamt 55 Einsätzen mit über 800 000 Blauhelmen, von denen 1803 ihr Leben verloren, ist die Bilanz durchwachsen. Korruption und Skandale kratzen am Nimbus der selbstlosen Helfer, Sexaffären und politische Misserfolge schaden dem Image der neutralen Friedenshüter, denen 1988 der Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Als Berichte aus den Bürgerkriegsgebieten in Ostafrika und auf dem Balkan über Zwangsprostitution, Frauenhandel und Kindesmissbrauch die Runde machten, standen nicht nur zivile Uno-Bedienstete am Pranger, sondern auch BlauhelmSoldaten und Uno-Polizisten. "Allein der Verdacht ist eine Katastrophe", jammerte der Däne Kai Nielsen von der Uno-Flüchtlingshilfe in Tansania.
Am meisten jedoch zehren gescheiterte Friedenseinsätze am Vertrauen in das Konfliktmanagement der Uno. Politikforscher wie Peter Schmidt von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik bezweifeln, dass ein "formalisierter und organisierter Multilateralismus", wie er die schwerfällige Institution nennt, immer zeitgemäße Antworten auf die neuen globalen Herausforderungen geben kann. Schmidt meint damit den internationalen Terrorismus und die zunehmende Zahl innerstaatlicher Konflikte, die sich zu regionalen Brandherden ausweiten.
Zu frisch ist die Erinnerung an Fehlschläge in jüngster Zeit, nicht nur auf Zypern. Dort werben Uno-Emissäre seit nunmehr fast 30 Jahren für eine friedliche Wiedervereinigung. Erst vorletzte Woche musste Generalsekretär Kofi Annan wieder unverrichteter Dinge abreisen.
Immerhin schwelt der Konflikt dort ohne Blutvergießen. Das war in Angola anders: Als die Blauhelme im Februar 1999 abzogen, weil die Vermittlung zwischen Regierung und Rebellen gescheitert war, fiel das Land zurück in den Bürgerkrieg mit Tausenden unschuldiger Opfer.
Angola oder auch der Kongo, wo unter den Augen von Blauhelmen immer noch geschossen und gemordet wird, zählen zu den jüngsten Uno-Pleiten. Ein Desaster waren die Einsätze in Ruanda, wo Uno-Einheiten zwischen 1993 und 1996 den Massenmord nicht stoppen konnten, und in Somalia, wo Blauhelme seit 1992 die Versorgung der hungernden Bevölkerung garantieren und später dann die marodierenden Warlords in die Knie zwingen sollten.
Doch als somalische Aufrührer die Leiche eines amerikanischen Soldaten vor laufenden Kameras durch die staubigen Straßen Mogadischus schleiften, gingen die USA entsetzt auf Distanz. Monate später, im März 1995, brach auch die Weltorganisation ihr Engagement Hals über Kopf ab; das Land versank im Chaos.
Wochen später, am 11. Juli, sahen im bosnischen Srebrenica 300 niederländische Blauhelme, nur leicht bewaffnet und vergebens auf Unterstützung aus der Luft wartend, tatenlos zu, wie serbische Einheiten die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt stürmten. Rund 7000 Männer wurden von ihren Frauen und Kindern getrennt und bestialisch ermordet - nach Srebrenica hatte die Uno ihre Unschuld verloren.
An solche Konfrontationen hatte wohl kaum einer der Gründungsväter gedacht, als sie den Vereinten Nationen und dem Sicherheitsrat 1945 die Aufgabe übertrugen, "den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren". Vergleichsweise beschaulich ließ sich denn auch der erste Einsatz 1956 am Suez-Kanal an.
Zwar waren kleine Gruppen von Uno-Beobachtern auch schon vorher entsandt worden, zur Überwachung des Waffenstillstands im Nahen Osten 1948 und in Kaschmir 1949. Doch die Errichtung eines militärischen "Puffers" zwischen den Kontrahenten im Suez-Konflikt gilt als der eigentliche Beginn friedenssichernder Maßnahmen. Zum ersten Mal trugen Uno-Truppen dort auch die charakteristischen blauen Helme und Baretts. Das klassische Peacekeeping war erfunden.
Neue Konfliktlagen veränderten das Anforderungsprofil schnell, vor allem durch die zunehmende Zahl innerstaatlicher Kämpfe und Kriege. Blauhelme rückten als Polizisten in Haiti (1993) oder in Bosnien (1995) ein. Sie überwachten die Entwaffnung ehemaliger Kämpfer in El Salvador (1991 bis 1995) oder Sierra Leone (1998/99) und sicherten freie Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik (1999). In Namibia (1989/90) oder Bosnien-Herzegowina (ab 1995) schützten sie den Wiederaufbau ziviler staatlicher Strukturen.
Eine völlig "neue Handlungsfähigkeit", so der Frankfurter Völkerrechtler Michael Bothe, erwuchs dem Sicherheitsrat nach Ende des Ost-West-Konflikts. Die Machtinteressen zweier feindlicher Supermächte lähmten nicht länger den Sicherheitsrat, die Uno-Charta offenbarte auf einmal größere Spielräume: 38 Missionen allein seit 1989 waren die Folge.
Der Einmarsch des Irak in Kuweit 1990 stellte die erste Bewährungsprobe dar. Ende November, fast vier Monate nach dem Überfall, ermächtigte der Sicherheitsrat mit der Resolution 678 eine Allianz aus 29 Ländern, zur Befreiung Kuweits "alle notwendigen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel" einzusetzen - auch militärische Gewalt.
Ausgerechnet der als "humanitäre Intervention" deklarierte Nato-Krieg gegen Jugoslawien 1999 bescherte der Weltorganisation eine schwere Schlappe. "Darf der Uno die Staatssouveränität wichtiger sein als der Schutz der Menschen und ihrer Rechte?", hatte Außenminister Joschka Fischer in der Debatte über eine Reform der Vereinten Nationen immer wieder gefragt und Generalsekretär Kofi Annan fast schon überzeugt. Doch im Kosovo mochte die Uno diese Frage nicht beantworten.
Da übernahm die Nato, ohne Mandat des Sicherheitsrats, das Kommando, um die muslimische Mehrheit mit militärischen Mitteln vor der Vertreibung und Ermordung zu schützen. Der Krieg im Kosovo gilt vielen Diplomaten und Völkerrechtlern als Offenbarungseid der Uno.
Es folgte Afghanistan: Als die Regierung in Washington, unter dem Schock der Terrorangriffe auf das World Trade Center, im September 2001 das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der Uno-Charta für sich reklamierte, billigte der Sicherheitsrat dies einstimmig. An der Spitze einer internationalen Streitmacht - aber eben nicht von Blauhelmen - bekämpfen US-Einheiten seitdem die Islamisten am Hindukusch.
Es erscheint geradezu als Paradox, dass nun ausgerechnet ein amerikanischer Staatschef auf bestem Wege ist, die von US-Präsident Franklin D. Roosevelt entworfene Friedensvision der Vereinten Nationen noch weiter auszuhöhlen.
Sollten die USA jetzt auch noch ohne eindeutiges Mandat des Sicherheitsrats den Irak angreifen, würde das Uno-Sicherheitssystem "bis zur Unkenntlichkeit erodieren", fürchtet der deutsche Ex-Diplomat Hans Arnold. Der langjährige Uno-Botschafter in Genf appelliert deshalb an die Weltorganisation, sich dem amerikanischen Drängen nach Krieg zu widersetzen.
"Im Zweifel" seien die Vereinten Nationen "für die Welt wichtiger als die USA".
DER SPIEGEL 11 / 2003
Verlorene Unschuld
Blauhelme und Friedensmissionen der Vereinten Nationen verändern die Welt
- blutiges Scheitern inklusive.
von Manfred Ertel
Raus mit Applaus, wann hat es das für eine militärische Besatzungsmacht schon mal gegeben? Als die multinationale Friedenstruppe vor knapp drei Jahren aus Osttimor abrückte und die Gesamtverwaltung in die Hände der Vereinten Nationen legte, hagelte es Lob von allen Seiten.
Die Soldaten werden "immer einen Platz in unserer Geschichte haben", erklärte feierlich der spätere Präsident José Alexandre "Xanana" Gusmão. Das rührte selbst die strammsten Militärs. Der australische General Peter Cosgrove, Befehlshaber der alliierten Streitmacht, strahlte: "Eine wunderbare Sache."
Rund fünf Monate lang hatte die internationale Friedenstruppe, zu der auch 72 deutsche Soldaten gehörten, im Auftrag des Uno-Sicherheitsrats auf Osttimor die mordenden und plündernden pro-indonesischen Milizen bekämpft. Dann folgten Uno-Soldaten und zivile Uno-Verwalter. Seit knapp einem Jahr ist die einstige indonesische Provinz selbständig und unabhängig, seit kurzem auch Mitglied der Vereinten Nationen.
Der Einsatz auf der Insel im Indischen Ozean ist der vorerst jüngste Beleg für das segensreiche Wirken der Uno. Doch längst nicht alle Friedensmissionen sind so nachdrücklich als Erfolg in die Geschichte der Vereinten Nationen eingegangen.
Nach insgesamt 55 Einsätzen mit über 800 000 Blauhelmen, von denen 1803 ihr Leben verloren, ist die Bilanz durchwachsen. Korruption und Skandale kratzen am Nimbus der selbstlosen Helfer, Sexaffären und politische Misserfolge schaden dem Image der neutralen Friedenshüter, denen 1988 der Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Als Berichte aus den Bürgerkriegsgebieten in Ostafrika und auf dem Balkan über Zwangsprostitution, Frauenhandel und Kindesmissbrauch die Runde machten, standen nicht nur zivile Uno-Bedienstete am Pranger, sondern auch BlauhelmSoldaten und Uno-Polizisten. "Allein der Verdacht ist eine Katastrophe", jammerte der Däne Kai Nielsen von der Uno-Flüchtlingshilfe in Tansania.
Am meisten jedoch zehren gescheiterte Friedenseinsätze am Vertrauen in das Konfliktmanagement der Uno. Politikforscher wie Peter Schmidt von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik bezweifeln, dass ein "formalisierter und organisierter Multilateralismus", wie er die schwerfällige Institution nennt, immer zeitgemäße Antworten auf die neuen globalen Herausforderungen geben kann. Schmidt meint damit den internationalen Terrorismus und die zunehmende Zahl innerstaatlicher Konflikte, die sich zu regionalen Brandherden ausweiten.
Zu frisch ist die Erinnerung an Fehlschläge in jüngster Zeit, nicht nur auf Zypern. Dort werben Uno-Emissäre seit nunmehr fast 30 Jahren für eine friedliche Wiedervereinigung. Erst vorletzte Woche musste Generalsekretär Kofi Annan wieder unverrichteter Dinge abreisen.
Immerhin schwelt der Konflikt dort ohne Blutvergießen. Das war in Angola anders: Als die Blauhelme im Februar 1999 abzogen, weil die Vermittlung zwischen Regierung und Rebellen gescheitert war, fiel das Land zurück in den Bürgerkrieg mit Tausenden unschuldiger Opfer.
Angola oder auch der Kongo, wo unter den Augen von Blauhelmen immer noch geschossen und gemordet wird, zählen zu den jüngsten Uno-Pleiten. Ein Desaster waren die Einsätze in Ruanda, wo Uno-Einheiten zwischen 1993 und 1996 den Massenmord nicht stoppen konnten, und in Somalia, wo Blauhelme seit 1992 die Versorgung der hungernden Bevölkerung garantieren und später dann die marodierenden Warlords in die Knie zwingen sollten.
Doch als somalische Aufrührer die Leiche eines amerikanischen Soldaten vor laufenden Kameras durch die staubigen Straßen Mogadischus schleiften, gingen die USA entsetzt auf Distanz. Monate später, im März 1995, brach auch die Weltorganisation ihr Engagement Hals über Kopf ab; das Land versank im Chaos.
Wochen später, am 11. Juli, sahen im bosnischen Srebrenica 300 niederländische Blauhelme, nur leicht bewaffnet und vergebens auf Unterstützung aus der Luft wartend, tatenlos zu, wie serbische Einheiten die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt stürmten. Rund 7000 Männer wurden von ihren Frauen und Kindern getrennt und bestialisch ermordet - nach Srebrenica hatte die Uno ihre Unschuld verloren.
An solche Konfrontationen hatte wohl kaum einer der Gründungsväter gedacht, als sie den Vereinten Nationen und dem Sicherheitsrat 1945 die Aufgabe übertrugen, "den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren". Vergleichsweise beschaulich ließ sich denn auch der erste Einsatz 1956 am Suez-Kanal an.
Zwar waren kleine Gruppen von Uno-Beobachtern auch schon vorher entsandt worden, zur Überwachung des Waffenstillstands im Nahen Osten 1948 und in Kaschmir 1949. Doch die Errichtung eines militärischen "Puffers" zwischen den Kontrahenten im Suez-Konflikt gilt als der eigentliche Beginn friedenssichernder Maßnahmen. Zum ersten Mal trugen Uno-Truppen dort auch die charakteristischen blauen Helme und Baretts. Das klassische Peacekeeping war erfunden.
Neue Konfliktlagen veränderten das Anforderungsprofil schnell, vor allem durch die zunehmende Zahl innerstaatlicher Kämpfe und Kriege. Blauhelme rückten als Polizisten in Haiti (1993) oder in Bosnien (1995) ein. Sie überwachten die Entwaffnung ehemaliger Kämpfer in El Salvador (1991 bis 1995) oder Sierra Leone (1998/99) und sicherten freie Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik (1999). In Namibia (1989/90) oder Bosnien-Herzegowina (ab 1995) schützten sie den Wiederaufbau ziviler staatlicher Strukturen.
Eine völlig "neue Handlungsfähigkeit", so der Frankfurter Völkerrechtler Michael Bothe, erwuchs dem Sicherheitsrat nach Ende des Ost-West-Konflikts. Die Machtinteressen zweier feindlicher Supermächte lähmten nicht länger den Sicherheitsrat, die Uno-Charta offenbarte auf einmal größere Spielräume: 38 Missionen allein seit 1989 waren die Folge.
Der Einmarsch des Irak in Kuweit 1990 stellte die erste Bewährungsprobe dar. Ende November, fast vier Monate nach dem Überfall, ermächtigte der Sicherheitsrat mit der Resolution 678 eine Allianz aus 29 Ländern, zur Befreiung Kuweits "alle notwendigen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel" einzusetzen - auch militärische Gewalt.
Ausgerechnet der als "humanitäre Intervention" deklarierte Nato-Krieg gegen Jugoslawien 1999 bescherte der Weltorganisation eine schwere Schlappe. "Darf der Uno die Staatssouveränität wichtiger sein als der Schutz der Menschen und ihrer Rechte?", hatte Außenminister Joschka Fischer in der Debatte über eine Reform der Vereinten Nationen immer wieder gefragt und Generalsekretär Kofi Annan fast schon überzeugt. Doch im Kosovo mochte die Uno diese Frage nicht beantworten.
Da übernahm die Nato, ohne Mandat des Sicherheitsrats, das Kommando, um die muslimische Mehrheit mit militärischen Mitteln vor der Vertreibung und Ermordung zu schützen. Der Krieg im Kosovo gilt vielen Diplomaten und Völkerrechtlern als Offenbarungseid der Uno.
Es folgte Afghanistan: Als die Regierung in Washington, unter dem Schock der Terrorangriffe auf das World Trade Center, im September 2001 das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der Uno-Charta für sich reklamierte, billigte der Sicherheitsrat dies einstimmig. An der Spitze einer internationalen Streitmacht - aber eben nicht von Blauhelmen - bekämpfen US-Einheiten seitdem die Islamisten am Hindukusch.
Es erscheint geradezu als Paradox, dass nun ausgerechnet ein amerikanischer Staatschef auf bestem Wege ist, die von US-Präsident Franklin D. Roosevelt entworfene Friedensvision der Vereinten Nationen noch weiter auszuhöhlen.
Sollten die USA jetzt auch noch ohne eindeutiges Mandat des Sicherheitsrats den Irak angreifen, würde das Uno-Sicherheitssystem "bis zur Unkenntlichkeit erodieren", fürchtet der deutsche Ex-Diplomat Hans Arnold. Der langjährige Uno-Botschafter in Genf appelliert deshalb an die Weltorganisation, sich dem amerikanischen Drängen nach Krieg zu widersetzen.
"Im Zweifel" seien die Vereinten Nationen "für die Welt wichtiger als die USA".
DER SPIEGEL 11 / 2003
http://www.sozialoekonomie.info/Zeitschrift_fur_Sozialokonom…
Helmut Creutz:
Wirtschaftliche Triebkräfte von Rüstung
und Krieg
"Wenn der Friede die Frucht der Gerechtigkeit ist, dann ist der Konflikt,
die kriegerische Auseinandersetzung, die Frucht der Ungerechtigkeit. Tatsächlich waren fast alle Kriege der letzten Jahrhunderte Wirtschaftskriege."
Adolf Paster
1. Einleitung
Alle Kriege, zumindest in unseren Zeiten, sind letztlich als Wahnsinn anzusehen. Das gilt in einem ganz besonderen Maße für jene auf dem Balkan, deren Voraussage in den 80er Jahren und auch noch unmittelbar nach der Wende in Mittel- und Osteuropa nur Kopfschütteln ausgelöst hätte.
Wie aber kommt es heute noch zu solchen barbarischen Auseinandersetzungen in einer sich als zivilisiert bezeichnenden Welt? Wie kann es geschehen, dass Menschen, die über Jahrzehnte friedlich zusammengelebt haben, auf einmal einander Gewalt antun? Wie kam es zu jener mehr als zehn Jahre dauernden jugoslawischen Tragödie?
Geht man diesen Fragen intensiver nach, dann stellt sich heraus, dass dieses Blutvergießen keinesfalls nur eine Folge der dortigen ethnischen Gegebenheiten war. Auch mit der wechselvollen Geschichte dieses Landes hat es nur bedingt zu tun. Vielmehr hängt es entscheidend mit bestimmten ökonomischen und monetären Gegebenheiten und Fehlentwicklungen zusammen, die auch in früheren Zeiten und an anderen Orten zu Bürgerkriegen oder grenzüberschreitenden gewaltsamen Auseinandersetzungen führten.
Bevor wir uns mit diesen speziellen Gegebenheiten in Jugoslawien näher befassen, sollen darum einige Gedanken zu den angesprochenen wirtschaftlichen Gründen für Frieden oder Krieg vorausgeschickt werden.
2. Ungerechtigkeit und Unfrieden in der Geschichte [Übersicht]
So weit wir wissen, war das Auf und Ab der Kulturen und Epochen immer wieder von Kriegen begleitet. Liest man manche Geschichtsbücher, dann scheint die Entwicklung der Menschheit oft nur aus einer Kette von Kriegen zu bestehen, von Kriegen, bei denen es vor allem um die Eroberung von Land und Bodenschätzen ging, um die Beherrschung wichtiger Handelswege und ganzer Völker. Verständlich, dass die Humanisten und Aufklärer der beginnenden Neuzeit immer wieder die große Hoffnung formulierten, dass fortan alle Menschen durch den technischen Fortschritt zu Wohlstand gelangen und im "ewigen Frieden" (Kant) miteinander leben könnten. Und die Klassiker des Liberalismus entwickelten die dazu passende Vorstellung von einem ökonomischen Interessenausgleich zwischen den Individuen auf freien Märkten. Bei ihrem Modell einer Marktwirtschaft versäumten Adam Smith und die anderen liberalen Klassiker aber darauf zu achten, dass allen Menschen der Boden und seine Schätze zu gleichen Bedingungen zugänglich werden. Und indem sie das Geld als ein bloß neutrales Tauschmittel betrachteten, übersahen sie, dass mit dem Geld auch eine strukturelle Macht verbunden ist, die auf den Märkten die Menschen immer wieder in Ärmere und Reichere spaltet.
Während sich aufgrund dieser Gegebenheiten in wenigen Händen große Geld- und Sachkapitalvermögen akkumulierten, vor allem durch die Wirkungen von Zins und Zinseszins, entstand im 19. Jahrhundert auf der anderen Seite ein armes Industrieproletariat. Trotz vielfältiger technischer Arbeitserleichterungen, die hundert Jahre vorher kaum vorstellbar waren, kam es zu keiner allgemeinen Ausbreitung des neuzeitlichen Wohlstands. Neben der wachsenden Kluft zwischen Reichtum und Armut wiederholten sich immer wieder Krisen und Konjunktureinbrüche, deren Folgen überwiegend von der Mehrheit der abhängig Beschäftigten zu tragen waren.
Zu solchen Einbrüchen kam es vor allem dann, wenn sich während der Hochkonjunkturphasen so viel Kapital gebildet hatte, dass sich infolge sinkender Zinsen seine Verwertungsmöglichkeiten verschlechterten. Die Folge waren sogenannte Reinigungs- oder Gesundschrumpfungskrisen, die zu einer partiellen oder breiteren Vernichtung von Kapital bzw. zumindest einer deutlichen Unterbrechung der Kapitalbildung führten. Damit konnten die Zinsen wieder steigen und die Konjunkturzyklen von neuem beginnen – bis zur nächsten Krise. Doch nicht nur durch die allgemeinen Wirtschaftskrisen und zivilen Kapitalvernichtungen wurde immer wieder Raum für neue Investitionen und Geldanlagen geschaffen, sondern auch durch marktfremde Güterproduktionen wie vor allem die Rüstung und noch mehr natürlich durch kriegerische Zerstörungen.
Eine andere Möglichkeit, Raum für neue Investitionen zu schaffen, war die Herrschaftsausweitung der europäischen Länder auf die übrige Welt, vor allem im Zuge kolonialer Eroberungen in Übersee, die gleichzeitig mit der Ausnutzung billiger Rohstoffquellen und Arbeitskräfte sowie der Ausweitung der Absatz- und Wachstumsmärkte verbunden war.
3. Konjunkturen – Krisen – Kriege
Kapitalbildung und Kapitalvernichtung [Übersicht ]
Für diese vorbeschriebene Kette zinsbedingter Krisenzeiten mag ein Artikel Zeugnis geben, der im Dezember 1988 von der deutschen Kundenzeitschrift "Sparkasse" veröffentlicht wurde, und zwar als Nachdruck eines Beitrags aus der gleichnamigen Zeitschrift des Sparkassenverbandes aus dem Jahre 1891(!) Dieser also vor mehr als einhundert Jahren geschriebene Artikel befasste sich mit dem Trend sinkender Zinsen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und seinen Hintergründen, die er wie folgt erklärte:
"Die Ursache für das Sinken des Zinsfußes wird vorzüglich darin gefunden, daß die besonders rentablen Kapitalanlagen großen Maßstabes heute erschöpft sind und nur Unternehmungen von geringer Ergiebigkeit übrig bleiben." Und um den damals auf drei Prozent gesunkenen Zinssatz vor einem weiteren Fall zu bewahren, müßten – so hieß es weiter – "... die neuen Länder, beispielsweise Afrika, sehr rasch durch europäische Kapitalien erschlossen werden, damit einem solchen Sinken begegnet werde." Doch da auch das die sinkende Zinsentwicklung nicht umkehren könne, schließt der Artikel aus der Sparkassenzeitung mit folgender inhaltsschwerer Aussage: "Nur ein allgemeiner europäischer Krieg könnte dieser Entwicklung Halt gebieten durch die ungeheure Kapitalzerstörung, welche er bedeutet."
Dieser Schluß scheint ungeheuerlich! Aber er ist – wie wir wissen – seit 1891 zweimal in Erfüllung gegangen: Zwei "allgemeine europäische Kriege", die man sogar weltweit ausdehnen konnte, haben dem Sinken des Zinsfußes nicht nur jeweils Halt geboten, sondern den Zinsfuß auch erneut auf lukrative Höhen angehoben!
In welchem Maße bei diesen beiden großen Kriegen und den ihnen nachfolgenden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allein für die direkten Kriegskosten Kapital vernichtet wurde, geht aus der neben- stehenden Tabelle hervor. [2]
Dabei sind in diesen Milliardenbeträgen, angeführt in Werten von 1995, die Ausgaben für den anschließenden Wiederaufbau noch nicht einmal einbezogen. Diese Wiederaufbaukosten schlagen sich dann über Jahre hinweg als positive Größen in den Sozialprodukten der Länder nieder, wobei man die zwangsläufig großen Wachstumsraten des Wiederaufbaus dann stolz als ‘Wirtschaftswunder` feiert.
Auf die Zusammenhänge zwischen Krieg und Zinshöhe hat auch der große englische Dichter George Bernhard Shaw während des Zweiten Weltkriegs aufmerksam gemacht: "Ich verabscheue den Krieg und sehe keinen Unterschied an Grauenhaftigkeit zwischen den Bombardierungen Londons, Neapels und Kölns. Sie alle sind abscheulich für mich. Damit stehe ich nicht allein. Alle Kapitalisten, die ich kenne, hassen den Krieg genau so wie ich. Anzunehmen, dass einer von uns wohlüberlegt ein angezündetes Streichholz in ein Pulvermagazin schleudern würde, damit der Zinssatz um zwei oder drei Prozent steigt, ständen in krassestem Widerspruch zur Natur des Menschen und zu den nackten Tatsachen ... Und trotzdem folgt auf zweieinhalb Prozent mit der gleichen Gewißheit Krieg, wie die Nacht dem Tag folgt." [3]
Und der schweizerische Theologe Karl Barth hat diese Beziehungen zwischen Zins, Kapital und Gewalt auf folgenden Nenner gebracht: "Wo nicht der Mensch, sondern das zinstragende Kapital der Gegenstand ist, dessen Erhaltung und Mehrung der Sinn und das Ziel der politischen Ordnung ist, da ist der Automatismus schon im Gang, der eines Tages die Menschen zum Töten und Getötetwerden auf die Jagd schicken wird." [4]
Doch trotz all dieser Erfahrungen und Warnungen blieb das zinstragende Kapital auch nach dem zweiten Weltkrieg weiterhin das `goldene Kalb`, um das sich alles Wirtschaften drehte, auch wenn man manche Rüstung durch andere letztlich fragwürdige Investitionen und Produktionen ersetzen konnte und manche kriegerischen Auseinandersetzungen alten Stils durch ein ständiges Wirtschaftswachstum, das in vielen Fällen zu einen Krieg gegen die Natur ausartete.
. . . .
Helmut Creutz:
Wirtschaftliche Triebkräfte von Rüstung
und Krieg
"Wenn der Friede die Frucht der Gerechtigkeit ist, dann ist der Konflikt,
die kriegerische Auseinandersetzung, die Frucht der Ungerechtigkeit. Tatsächlich waren fast alle Kriege der letzten Jahrhunderte Wirtschaftskriege."
Adolf Paster
1. Einleitung
Alle Kriege, zumindest in unseren Zeiten, sind letztlich als Wahnsinn anzusehen. Das gilt in einem ganz besonderen Maße für jene auf dem Balkan, deren Voraussage in den 80er Jahren und auch noch unmittelbar nach der Wende in Mittel- und Osteuropa nur Kopfschütteln ausgelöst hätte.
Wie aber kommt es heute noch zu solchen barbarischen Auseinandersetzungen in einer sich als zivilisiert bezeichnenden Welt? Wie kann es geschehen, dass Menschen, die über Jahrzehnte friedlich zusammengelebt haben, auf einmal einander Gewalt antun? Wie kam es zu jener mehr als zehn Jahre dauernden jugoslawischen Tragödie?
Geht man diesen Fragen intensiver nach, dann stellt sich heraus, dass dieses Blutvergießen keinesfalls nur eine Folge der dortigen ethnischen Gegebenheiten war. Auch mit der wechselvollen Geschichte dieses Landes hat es nur bedingt zu tun. Vielmehr hängt es entscheidend mit bestimmten ökonomischen und monetären Gegebenheiten und Fehlentwicklungen zusammen, die auch in früheren Zeiten und an anderen Orten zu Bürgerkriegen oder grenzüberschreitenden gewaltsamen Auseinandersetzungen führten.
Bevor wir uns mit diesen speziellen Gegebenheiten in Jugoslawien näher befassen, sollen darum einige Gedanken zu den angesprochenen wirtschaftlichen Gründen für Frieden oder Krieg vorausgeschickt werden.
2. Ungerechtigkeit und Unfrieden in der Geschichte [Übersicht]
So weit wir wissen, war das Auf und Ab der Kulturen und Epochen immer wieder von Kriegen begleitet. Liest man manche Geschichtsbücher, dann scheint die Entwicklung der Menschheit oft nur aus einer Kette von Kriegen zu bestehen, von Kriegen, bei denen es vor allem um die Eroberung von Land und Bodenschätzen ging, um die Beherrschung wichtiger Handelswege und ganzer Völker. Verständlich, dass die Humanisten und Aufklärer der beginnenden Neuzeit immer wieder die große Hoffnung formulierten, dass fortan alle Menschen durch den technischen Fortschritt zu Wohlstand gelangen und im "ewigen Frieden" (Kant) miteinander leben könnten. Und die Klassiker des Liberalismus entwickelten die dazu passende Vorstellung von einem ökonomischen Interessenausgleich zwischen den Individuen auf freien Märkten. Bei ihrem Modell einer Marktwirtschaft versäumten Adam Smith und die anderen liberalen Klassiker aber darauf zu achten, dass allen Menschen der Boden und seine Schätze zu gleichen Bedingungen zugänglich werden. Und indem sie das Geld als ein bloß neutrales Tauschmittel betrachteten, übersahen sie, dass mit dem Geld auch eine strukturelle Macht verbunden ist, die auf den Märkten die Menschen immer wieder in Ärmere und Reichere spaltet.
Während sich aufgrund dieser Gegebenheiten in wenigen Händen große Geld- und Sachkapitalvermögen akkumulierten, vor allem durch die Wirkungen von Zins und Zinseszins, entstand im 19. Jahrhundert auf der anderen Seite ein armes Industrieproletariat. Trotz vielfältiger technischer Arbeitserleichterungen, die hundert Jahre vorher kaum vorstellbar waren, kam es zu keiner allgemeinen Ausbreitung des neuzeitlichen Wohlstands. Neben der wachsenden Kluft zwischen Reichtum und Armut wiederholten sich immer wieder Krisen und Konjunktureinbrüche, deren Folgen überwiegend von der Mehrheit der abhängig Beschäftigten zu tragen waren.
Zu solchen Einbrüchen kam es vor allem dann, wenn sich während der Hochkonjunkturphasen so viel Kapital gebildet hatte, dass sich infolge sinkender Zinsen seine Verwertungsmöglichkeiten verschlechterten. Die Folge waren sogenannte Reinigungs- oder Gesundschrumpfungskrisen, die zu einer partiellen oder breiteren Vernichtung von Kapital bzw. zumindest einer deutlichen Unterbrechung der Kapitalbildung führten. Damit konnten die Zinsen wieder steigen und die Konjunkturzyklen von neuem beginnen – bis zur nächsten Krise. Doch nicht nur durch die allgemeinen Wirtschaftskrisen und zivilen Kapitalvernichtungen wurde immer wieder Raum für neue Investitionen und Geldanlagen geschaffen, sondern auch durch marktfremde Güterproduktionen wie vor allem die Rüstung und noch mehr natürlich durch kriegerische Zerstörungen.
Eine andere Möglichkeit, Raum für neue Investitionen zu schaffen, war die Herrschaftsausweitung der europäischen Länder auf die übrige Welt, vor allem im Zuge kolonialer Eroberungen in Übersee, die gleichzeitig mit der Ausnutzung billiger Rohstoffquellen und Arbeitskräfte sowie der Ausweitung der Absatz- und Wachstumsmärkte verbunden war.
3. Konjunkturen – Krisen – Kriege
Kapitalbildung und Kapitalvernichtung [Übersicht ]
Für diese vorbeschriebene Kette zinsbedingter Krisenzeiten mag ein Artikel Zeugnis geben, der im Dezember 1988 von der deutschen Kundenzeitschrift "Sparkasse" veröffentlicht wurde, und zwar als Nachdruck eines Beitrags aus der gleichnamigen Zeitschrift des Sparkassenverbandes aus dem Jahre 1891(!) Dieser also vor mehr als einhundert Jahren geschriebene Artikel befasste sich mit dem Trend sinkender Zinsen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und seinen Hintergründen, die er wie folgt erklärte:
"Die Ursache für das Sinken des Zinsfußes wird vorzüglich darin gefunden, daß die besonders rentablen Kapitalanlagen großen Maßstabes heute erschöpft sind und nur Unternehmungen von geringer Ergiebigkeit übrig bleiben." Und um den damals auf drei Prozent gesunkenen Zinssatz vor einem weiteren Fall zu bewahren, müßten – so hieß es weiter – "... die neuen Länder, beispielsweise Afrika, sehr rasch durch europäische Kapitalien erschlossen werden, damit einem solchen Sinken begegnet werde." Doch da auch das die sinkende Zinsentwicklung nicht umkehren könne, schließt der Artikel aus der Sparkassenzeitung mit folgender inhaltsschwerer Aussage: "Nur ein allgemeiner europäischer Krieg könnte dieser Entwicklung Halt gebieten durch die ungeheure Kapitalzerstörung, welche er bedeutet."
Dieser Schluß scheint ungeheuerlich! Aber er ist – wie wir wissen – seit 1891 zweimal in Erfüllung gegangen: Zwei "allgemeine europäische Kriege", die man sogar weltweit ausdehnen konnte, haben dem Sinken des Zinsfußes nicht nur jeweils Halt geboten, sondern den Zinsfuß auch erneut auf lukrative Höhen angehoben!
In welchem Maße bei diesen beiden großen Kriegen und den ihnen nachfolgenden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allein für die direkten Kriegskosten Kapital vernichtet wurde, geht aus der neben- stehenden Tabelle hervor. [2]
Dabei sind in diesen Milliardenbeträgen, angeführt in Werten von 1995, die Ausgaben für den anschließenden Wiederaufbau noch nicht einmal einbezogen. Diese Wiederaufbaukosten schlagen sich dann über Jahre hinweg als positive Größen in den Sozialprodukten der Länder nieder, wobei man die zwangsläufig großen Wachstumsraten des Wiederaufbaus dann stolz als ‘Wirtschaftswunder` feiert.
Auf die Zusammenhänge zwischen Krieg und Zinshöhe hat auch der große englische Dichter George Bernhard Shaw während des Zweiten Weltkriegs aufmerksam gemacht: "Ich verabscheue den Krieg und sehe keinen Unterschied an Grauenhaftigkeit zwischen den Bombardierungen Londons, Neapels und Kölns. Sie alle sind abscheulich für mich. Damit stehe ich nicht allein. Alle Kapitalisten, die ich kenne, hassen den Krieg genau so wie ich. Anzunehmen, dass einer von uns wohlüberlegt ein angezündetes Streichholz in ein Pulvermagazin schleudern würde, damit der Zinssatz um zwei oder drei Prozent steigt, ständen in krassestem Widerspruch zur Natur des Menschen und zu den nackten Tatsachen ... Und trotzdem folgt auf zweieinhalb Prozent mit der gleichen Gewißheit Krieg, wie die Nacht dem Tag folgt." [3]
Und der schweizerische Theologe Karl Barth hat diese Beziehungen zwischen Zins, Kapital und Gewalt auf folgenden Nenner gebracht: "Wo nicht der Mensch, sondern das zinstragende Kapital der Gegenstand ist, dessen Erhaltung und Mehrung der Sinn und das Ziel der politischen Ordnung ist, da ist der Automatismus schon im Gang, der eines Tages die Menschen zum Töten und Getötetwerden auf die Jagd schicken wird." [4]
Doch trotz all dieser Erfahrungen und Warnungen blieb das zinstragende Kapital auch nach dem zweiten Weltkrieg weiterhin das `goldene Kalb`, um das sich alles Wirtschaften drehte, auch wenn man manche Rüstung durch andere letztlich fragwürdige Investitionen und Produktionen ersetzen konnte und manche kriegerischen Auseinandersetzungen alten Stils durch ein ständiges Wirtschaftswachstum, das in vielen Fällen zu einen Krieg gegen die Natur ausartete.
. . . .
.
Nikkei noch immer hoch bewertet
Der Nikkei fällt unter die Marke von 8000 Punkten und notiert auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Japanische Aktien sind jedoch noch immer hoch bewertet – und die Probleme der Banken und Unternehmen nicht gelöst.
Hamburg – Anleger in Japan reagieren auf neue Tiefstände inzwischen mit Gelassenheit. Als der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Dienstag unter der Marke von 8000 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren schloss, war weder Verkaufspanik noch eine heftige Gegenreaktion derer zu spüren, die auf eine Trendumkehr setzen.
Warum auch. Seit 14 Jahren ist die Börse in Japan im intakten Abwärtstrend. Kurz nachdem die Immobilienblase in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahr 1989 geplatzt war, ging es auch im Nikkei stetig nach unten. Für Anleger in Europa und den USA, die sich nach nur drei Jahren Baisse Hoffnungen auf eine Trendumkehr machen, sind das beunruhigende Tatsachen. Japan sei ein Sonderfall, betonen sie.
Doch hier wie dort sorgen Irak-Krise und die Spannungen zwischen USA und Nordkorea für einen Käuferstreik. Trotz einer Nullzinspolitik der japanischen Notenbank und einem Konjunkturprogramm der Regierung fallen Preise und Nachfrage weiter.
Banken schieben faule Kredite vor sich her
Die größte europäische Volkswirtschaft Deutschland ist von der "japanischen Krankheit" Deflation nicht mehr weit entfernt. Auch die US-Notenbank hat nicht mehr viel Spielraum, um mit weiteren Zinssenkungen den Konsum und die Investitionen der Unternehmen zu stimulieren.
Japan wie Deutschland leiden unter einer Bankenkrise. Doch ist das Ausmaß der faulen Kredite im Land der aufgehenden Sonne deutlich größer als anderswo: Die Bankenkrise und die Zögerlichkeit, diese zu lösen, werden als Hauptgrund für den Bärenmarkt in Japan gesehen.
Die Not leidenden Kredite lasten bleischwer auf den Bilanzen der Finanzhäuser. Hinzu kommen die hohen Verluste ihrer Aktienbeteiligungen: Analysten erwarten, dass Japans Banken im Gesamtjahr Verluste verbuchen müssen.
Die Nullzinspolitik der Notenbank sorgt jedoch dafür, dass sich die Finanzhäuser weiterhin zu Dumping-Konditionen frisches Geld beschaffen können und auf diese Weise die notwendige Abschreibung fauler Kredite weiter vor sich herschieben, schreiben Experten der Investmentbank Morgan Stanley: Dies sorge unter anderem dafür, dass Überkapazitäten bestehen bleiben, die Preise weiter sinken und sich die Deflationsspirale sich weiter dreht.
Unternehmen in der Kreditklemme
Ähnlich wie in Deutschland können sich Japans Verbraucher nicht sicher sein, ob angesichts der deutlich steigenden Zahl alter Menschen ihre Altersvorsorge ausreicht, so Morgan Stanley. Sie halten sich daher mit ihren Konsumausgaben zurück: Die immer weiter fallenden Preise haben ihnen bislang Recht gegeben.
Den Firmen fällt es umso schwerer, ihre Lager frei zu bekommen, Gewinne zu generieren und ihre Kredite zu bedienen. Die Konsequenz für die Banken: Sie schränken angesichts ihrer hohen Außenstände die Vergabe neuer Kredite weiter ein. Binnen Jahresfrist ist die Kreditvergabe um 4,4 Prozent zurückgegangen. Ausländische Geldinstitute haben im Februar sogar 13,7 Prozent (Januar 16,1 Prozent) weniger Kredite vergeben.
Anstieg des Yen bereitet Sorgen
Hinzu kommt die Aufwertung des Yen gegenüber dem schwächelnden Dollar. Die japanische Regierung erwägt weitere Interventionen am Devisenmarkt, doch ist dies bislang ein stumpfes Instrument geblieben. Der Dollar hat gegenüber dem Yen während der vergangenen fünf Wochen rund fünf Prozent an Wert verloren - Gift für Japans Exportwirtschaft.
Angesichts dieser Probleme halten zahlreiche Analysten Aktien im Nikkein noch immer für überbewertet – obwohl der Index inzwischen auf 20-Jahres-Tief notiert. Da auch die Gewinne dramatisch geschrumpft sind, liegt das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der im Nikkei notierten Aktien noch bei mehr als 40. Dagegen nehmen sich Aktien aus dem Dax mit einem auf Basis der für 2003 erwarteten Gewinne errechneten KGV von unter zehn deutlich günstiger aus. Doch auch beim Deutschen Aktienindex warten Investoren vor dem Einstieg auf steigende Kur
Deutschland ist (noch) nicht Japan
Von Arne Stuhr
Seit Monaten werden Deutschlands Wirtschaft "japanische Verhältnisse" prophezeit. David Walton und Dirk Schumacher von der Investmentbank Goldman Sachs geben fürs Erste Entwarnung.
Frankfurt – Gute Nachrichten sind in diesen Tagen rar gesät. David Walton, Europa-Chefvolkswirt bei Goldman Sachs, und sein Kollege Dirk Schumacher hatten am Mittwoch trotzdem einige im Gepäck und sorgten – passend zur Präsentation im 60. Stock des Frankfurter Messeturms – für einen guten Überblick.
Walton ging es dabei nicht darum, die Situation der deutschen Volkswirtschaft zu beschönigen. "Wenn ich zurzeit mit Investoren spreche, ist es für viele nicht mehr die Frage ob, sondern wann Deutschland in die Deflation abrutscht", wurde er gleich zu Beginn seines Vortrages sehr deutlich. Er selbst hält diesen Pessimismus aber für übertrieben.
Ein schwaches Wachstum, eine niedrige Inflation und eine auf minimale Spielräume begrenzte Wirtschaftspolitik müssen seiner Meinung nach nämlich nicht zwangsläufig in die Deflation führen. Vor allem den immer wieder angestrengten Vergleich mit der Situation Japans Anfang der neunziger Jahre hält er für nicht haltbar.
Fünf Gründe, warum es Deutschland besser hat
Doch Parallelen sieht auch er: Wie Japan vor gut zehn Jahren weist auch Deutschland ein schwaches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig sinkenden Inflationsraten auf. Auch die geplatzte Börsenblase erinnert an das damalige Szenario in Fernost.
Dennoch sei die Situation nicht vergleichbar:
Erstens ist der Einbruch des Bruttoinlandsproduktes in Japan viel dramatischer ausgefallen als jetzt in Deutschland,
zweitens liegt die Inflation in Japan schon seit Jahren deutlich unterhalb der deutschen Teuerungsrate, die dazu noch wesentlich größere Schwankungen aufzeigt,
drittens spielt der gewaltige Geldtransfer von West- nach Ostdeutschland eine nicht zu unterschätzende Rolle,
viertens gibt es in Deutschland keine vergleichbare Immobilien-Blase,
fünftens ist in Deutschland trotz aktueller Bankenkrise kein "Kredit-Crunch" zu befürchten. Außerdem gebe es zumindest noch kleine geld- und steuerpolitische Spielräume.
"Vor diesem Hintergrund ist ein Gleichsetzen von Japan und Deutschland eine zu vereinfachte Darstellung", fasst Goldman-Analyst Schumacher die Datenlage zusammen.
Andere EU-Staaten werden der Konjunktur Beine machen
Über die Wachstumsaussichten Deutschlands machen sich Walton und Schumacher aber keine Illusionen. Die hiesige Volkswirtschaft werde auch weiterhin den anderen EU-Staaten hinterherhinken, der Abstand zum durchschnittlichen Wachstum dürfte dabei sogar noch ansteigen.
Das sei aber nicht so schlimm. Denn zumindest erwarten die Goldman-Sachs-Volkswirte, dass die europäischen Nachbarn Deutschland mit nach oben ziehen, statt vom EU-Schwergewicht abgebremst zu werden.
Den steigenden Außenwert des Euro fürchten sie dabei nicht. Für Deutschland sei das Wirtschaftswachstum der Handelspartner (auch der USA) doppelt so wichtig wie der Wechselkurs.
Die Vorteile eines starken Euro
Ganz im Gegenteil: Die Verunsicherung der Bevölkerung durch einen weit unter der Parität zum Dollar liegenden Euro sei sogar schlimmer gewesen als der aktuelle Wechselkurs bedingte Exportrückgang. Genauso sehe es mit der Inflation aus. "Die Deutschen geben nur bei einer sehr niedrigen Inflationsrate viel Geld aus", beschreibt Walton die Konsum-Psychologie der Deutschen.
Zu dem recht positiven Ausblick gesellt sich aus Sicht der Goldman-Sachs-Strategen auch die aktuelle Ankündigung der Regierung, notwendige Reformen wie beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt jetzt auch im Alleingang anzupacken.
Bestand habe die optimistische Einschätzung jedoch nur, wenn der für das vierte Quartal dieses Jahres und das Jahr 2004 prognostizierte weltwirtschaftliche Aufschwung auch eintritt und nicht durch einen Dauerkonflikt im Irak gefährdet wird. Ansonsten würde Deutschland nach den Berechnungen von Goldman Sachs Ende 2004 oder spätestens Anfang 2005 doch eine Deflation erleben. Aber wie gesagt, Deutschland ist (noch) nicht Japan.
manager-magazin.de - 05. u. 10.03.2003
Nikkei noch immer hoch bewertet
Der Nikkei fällt unter die Marke von 8000 Punkten und notiert auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Japanische Aktien sind jedoch noch immer hoch bewertet – und die Probleme der Banken und Unternehmen nicht gelöst.
Hamburg – Anleger in Japan reagieren auf neue Tiefstände inzwischen mit Gelassenheit. Als der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Dienstag unter der Marke von 8000 Punkten und damit auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren schloss, war weder Verkaufspanik noch eine heftige Gegenreaktion derer zu spüren, die auf eine Trendumkehr setzen.
Warum auch. Seit 14 Jahren ist die Börse in Japan im intakten Abwärtstrend. Kurz nachdem die Immobilienblase in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahr 1989 geplatzt war, ging es auch im Nikkei stetig nach unten. Für Anleger in Europa und den USA, die sich nach nur drei Jahren Baisse Hoffnungen auf eine Trendumkehr machen, sind das beunruhigende Tatsachen. Japan sei ein Sonderfall, betonen sie.
Doch hier wie dort sorgen Irak-Krise und die Spannungen zwischen USA und Nordkorea für einen Käuferstreik. Trotz einer Nullzinspolitik der japanischen Notenbank und einem Konjunkturprogramm der Regierung fallen Preise und Nachfrage weiter.
Banken schieben faule Kredite vor sich her
Die größte europäische Volkswirtschaft Deutschland ist von der "japanischen Krankheit" Deflation nicht mehr weit entfernt. Auch die US-Notenbank hat nicht mehr viel Spielraum, um mit weiteren Zinssenkungen den Konsum und die Investitionen der Unternehmen zu stimulieren.
Japan wie Deutschland leiden unter einer Bankenkrise. Doch ist das Ausmaß der faulen Kredite im Land der aufgehenden Sonne deutlich größer als anderswo: Die Bankenkrise und die Zögerlichkeit, diese zu lösen, werden als Hauptgrund für den Bärenmarkt in Japan gesehen.
Die Not leidenden Kredite lasten bleischwer auf den Bilanzen der Finanzhäuser. Hinzu kommen die hohen Verluste ihrer Aktienbeteiligungen: Analysten erwarten, dass Japans Banken im Gesamtjahr Verluste verbuchen müssen.
Die Nullzinspolitik der Notenbank sorgt jedoch dafür, dass sich die Finanzhäuser weiterhin zu Dumping-Konditionen frisches Geld beschaffen können und auf diese Weise die notwendige Abschreibung fauler Kredite weiter vor sich herschieben, schreiben Experten der Investmentbank Morgan Stanley: Dies sorge unter anderem dafür, dass Überkapazitäten bestehen bleiben, die Preise weiter sinken und sich die Deflationsspirale sich weiter dreht.
Unternehmen in der Kreditklemme
Ähnlich wie in Deutschland können sich Japans Verbraucher nicht sicher sein, ob angesichts der deutlich steigenden Zahl alter Menschen ihre Altersvorsorge ausreicht, so Morgan Stanley. Sie halten sich daher mit ihren Konsumausgaben zurück: Die immer weiter fallenden Preise haben ihnen bislang Recht gegeben.
Den Firmen fällt es umso schwerer, ihre Lager frei zu bekommen, Gewinne zu generieren und ihre Kredite zu bedienen. Die Konsequenz für die Banken: Sie schränken angesichts ihrer hohen Außenstände die Vergabe neuer Kredite weiter ein. Binnen Jahresfrist ist die Kreditvergabe um 4,4 Prozent zurückgegangen. Ausländische Geldinstitute haben im Februar sogar 13,7 Prozent (Januar 16,1 Prozent) weniger Kredite vergeben.
Anstieg des Yen bereitet Sorgen
Hinzu kommt die Aufwertung des Yen gegenüber dem schwächelnden Dollar. Die japanische Regierung erwägt weitere Interventionen am Devisenmarkt, doch ist dies bislang ein stumpfes Instrument geblieben. Der Dollar hat gegenüber dem Yen während der vergangenen fünf Wochen rund fünf Prozent an Wert verloren - Gift für Japans Exportwirtschaft.
Angesichts dieser Probleme halten zahlreiche Analysten Aktien im Nikkein noch immer für überbewertet – obwohl der Index inzwischen auf 20-Jahres-Tief notiert. Da auch die Gewinne dramatisch geschrumpft sind, liegt das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der im Nikkei notierten Aktien noch bei mehr als 40. Dagegen nehmen sich Aktien aus dem Dax mit einem auf Basis der für 2003 erwarteten Gewinne errechneten KGV von unter zehn deutlich günstiger aus. Doch auch beim Deutschen Aktienindex warten Investoren vor dem Einstieg auf steigende Kur
Deutschland ist (noch) nicht Japan
Von Arne Stuhr
Seit Monaten werden Deutschlands Wirtschaft "japanische Verhältnisse" prophezeit. David Walton und Dirk Schumacher von der Investmentbank Goldman Sachs geben fürs Erste Entwarnung.
Frankfurt – Gute Nachrichten sind in diesen Tagen rar gesät. David Walton, Europa-Chefvolkswirt bei Goldman Sachs, und sein Kollege Dirk Schumacher hatten am Mittwoch trotzdem einige im Gepäck und sorgten – passend zur Präsentation im 60. Stock des Frankfurter Messeturms – für einen guten Überblick.
Walton ging es dabei nicht darum, die Situation der deutschen Volkswirtschaft zu beschönigen. "Wenn ich zurzeit mit Investoren spreche, ist es für viele nicht mehr die Frage ob, sondern wann Deutschland in die Deflation abrutscht", wurde er gleich zu Beginn seines Vortrages sehr deutlich. Er selbst hält diesen Pessimismus aber für übertrieben.
Ein schwaches Wachstum, eine niedrige Inflation und eine auf minimale Spielräume begrenzte Wirtschaftspolitik müssen seiner Meinung nach nämlich nicht zwangsläufig in die Deflation führen. Vor allem den immer wieder angestrengten Vergleich mit der Situation Japans Anfang der neunziger Jahre hält er für nicht haltbar.
Fünf Gründe, warum es Deutschland besser hat
Doch Parallelen sieht auch er: Wie Japan vor gut zehn Jahren weist auch Deutschland ein schwaches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig sinkenden Inflationsraten auf. Auch die geplatzte Börsenblase erinnert an das damalige Szenario in Fernost.
Dennoch sei die Situation nicht vergleichbar:
Erstens ist der Einbruch des Bruttoinlandsproduktes in Japan viel dramatischer ausgefallen als jetzt in Deutschland,
zweitens liegt die Inflation in Japan schon seit Jahren deutlich unterhalb der deutschen Teuerungsrate, die dazu noch wesentlich größere Schwankungen aufzeigt,
drittens spielt der gewaltige Geldtransfer von West- nach Ostdeutschland eine nicht zu unterschätzende Rolle,
viertens gibt es in Deutschland keine vergleichbare Immobilien-Blase,
fünftens ist in Deutschland trotz aktueller Bankenkrise kein "Kredit-Crunch" zu befürchten. Außerdem gebe es zumindest noch kleine geld- und steuerpolitische Spielräume.
"Vor diesem Hintergrund ist ein Gleichsetzen von Japan und Deutschland eine zu vereinfachte Darstellung", fasst Goldman-Analyst Schumacher die Datenlage zusammen.
Andere EU-Staaten werden der Konjunktur Beine machen
Über die Wachstumsaussichten Deutschlands machen sich Walton und Schumacher aber keine Illusionen. Die hiesige Volkswirtschaft werde auch weiterhin den anderen EU-Staaten hinterherhinken, der Abstand zum durchschnittlichen Wachstum dürfte dabei sogar noch ansteigen.
Das sei aber nicht so schlimm. Denn zumindest erwarten die Goldman-Sachs-Volkswirte, dass die europäischen Nachbarn Deutschland mit nach oben ziehen, statt vom EU-Schwergewicht abgebremst zu werden.
Den steigenden Außenwert des Euro fürchten sie dabei nicht. Für Deutschland sei das Wirtschaftswachstum der Handelspartner (auch der USA) doppelt so wichtig wie der Wechselkurs.
Die Vorteile eines starken Euro
Ganz im Gegenteil: Die Verunsicherung der Bevölkerung durch einen weit unter der Parität zum Dollar liegenden Euro sei sogar schlimmer gewesen als der aktuelle Wechselkurs bedingte Exportrückgang. Genauso sehe es mit der Inflation aus. "Die Deutschen geben nur bei einer sehr niedrigen Inflationsrate viel Geld aus", beschreibt Walton die Konsum-Psychologie der Deutschen.
Zu dem recht positiven Ausblick gesellt sich aus Sicht der Goldman-Sachs-Strategen auch die aktuelle Ankündigung der Regierung, notwendige Reformen wie beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt jetzt auch im Alleingang anzupacken.
Bestand habe die optimistische Einschätzung jedoch nur, wenn der für das vierte Quartal dieses Jahres und das Jahr 2004 prognostizierte weltwirtschaftliche Aufschwung auch eintritt und nicht durch einen Dauerkonflikt im Irak gefährdet wird. Ansonsten würde Deutschland nach den Berechnungen von Goldman Sachs Ende 2004 oder spätestens Anfang 2005 doch eine Deflation erleben. Aber wie gesagt, Deutschland ist (noch) nicht Japan.
manager-magazin.de - 05. u. 10.03.2003
11.03.2003
ATOMARE AUFRÜSTUNG IM IRAN
Washington glaubt nicht an friedliche Ziele
Washington (rpo). Die amerikanische Regierung sieht ein neues Problem am Horizont: Diesmal macht Washington das iranische Atomprogramm Sorgen. Die USA glauben nicht, dass Teheran mit dem Programm friedliche Ziele verfolge, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer.
Iran versuche heimlich, eine Fabrik zur Anreicherung von Uran und eine für schweres Wasser zu bauen- letztere, um einen Reaktor zur Produktion von waffentauglichem Plutonium zu versorgen.
"Iran hat die Existenz dieser Einrichtungen erst zugegeben, als keine andere Wahl mehr bestand", betonte Fleischer. Es gebe keine wirtschaftliche Rechtfertigung für das Programm und deswegen bestehe großer Anlass zur Sorge. Weiter sagte der Sprecher, die Situation mache die Lücken bei den Bemühungen um internationale Kontrolle deutlich.
Aufrüsten, bevor die Weltmacht kommt
Schon ohne einen Irak-Krieg sieht Iran sich militärisch eingekeilt. Zur Sicherheit schafft er Nuklearwaffen an
Von Jochen Bittner
Gäbe es die Atombombe als Pokal für die misslichste geostrategische Lage auf dem Globus, Iran hätte sie verdient. Klingt absurd? Nicht aus Sicht des Iran. Das Land fühlt sich schon heute eingezwängt in einen Schraubstock amerikafreundlicher und zum Teil nuklear bewaffneter Mächte: Israel und die Türkei im Westen, Afghanistan, Pakistan und Indien im Osten. Und nun droht der „große Satan“ sich auch noch im Nachbarland Irak einzurichten.
In Teheran wächst die Angst, nach dem Feldzug gegen Saddam könne Iran der nächste Kandidat auf der amerikanischen Zielliste der Proliferationsstaaten (vulgo: „Achse des Bösen“) sein.
Das Atomprogramm der Islamischen Republik ist Washington seit langem ein Dorn im Auge. Mittlerweile kann als sicher gelten, dass es nicht nur zivilen Zwecken dient. Es wird nicht mehr lange dauern, warnen Experten, bis Iran in der Lage ist, Nuklearwaffen zu produzieren. Und ein Krieg im Irak könnte das antiwestliche Mullah-Regime zusätzlich zur Eile treiben.
„Aus der Krise in Nordkorea kann man die Lehre ziehen: Man muss sich möglichst schnell Nuklearwaffen zulegen, wenn man als Mitglied der ‚Achse des Bösen‘ nicht angegriffen werden will“, sagt William Hopkinson, ehemals Chef der Abteilung für Waffenkontrolle im britischen Verteidigungsministerium und heute Proliferationsspezialist am Londoner Royal Institute for International Affairs.
Während der Countdown zum Irak-Krieg läuft, bleibt unklar, wie Amerika mit dem immer muskulöseren „Schurken“ Iran verfahren will. Bleibt am Ende nur, die Baustellen zu bombardieren, um eine nukleare Trutzburg im Mittleren Osten zu verhindern?
Es wäre nicht der erste Angriff dieser Art in der Region: Schon 1981 zerstörten israelische Kampfflugzeuge das im Bau befindliche Kernkraftwerk Osirak im Irak.
Iran werde in den nächsten zwei Jahrzehnten eine atomare Infrastruktur mit einer Leistung von 6000 Megawatt aufbauen, verkündete der iranische Vizepräsident Gholamreza Aghazadeh im vergangenen September.
Aus Russland ergießt sich ein unkontrollierbarer Fluss von Nukleartechnik und atomarem Know-how nach Iran. In ihrer Heimat verdienen manche russische Wissenschaftler nur 50 Dollar im Monat. In Iran bekommen sie 5000.
Schon 2004 soll das erste mit russischer Hilfe gebaute Atomkraftwerk in Buschehr ans Netz gehen, fünf weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. Atomkraftwerke in einem Land, das auf Öl und Gas schwimmt – an ein Programm zur Stromerzeugung mochten Proliferationsexperten von Anfang an nicht glauben.
Atomstrom? Wohl kaum
Neue Satellitenbilder zeigen nun, dass sich hinter dem vermeintlich zivilen Großprojekt kaum etwas anderes verbergen kann als ein nuklearer Aufrüstungsversuch.
Die Aufnahmen weisen in die Wüstenregion unweit der Stadt Isfahan. Zwischen den Ortschaften Schahrida und Fulaschan, fünf Kilometer außerhalb Isfahans, erstreckt sich ein riesiges, militärisch streng gesichertes Areal. Radarsysteme vom russischen Typ Raduga SPK-75P kontrollieren den Luftraum. Abwehrgeschütze russischer Herkunft sichern vor Angriffen aus der Luft.
Das Kernstück des weitläufigen Areals ist eine Uranumwandlungsanlage. In ihr soll vom kommenden Jahr an Hexafluorid UF 6 gewonnen werden – der Grundstoff für waffenfähiges Uran. Tunnelsysteme führen zum unterirdischen Teil der Anlage. Die Atomfabrik, das zeigen die Satellitenbilder, steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Für friedliche Zwecke ist die Anlage überflüssig. Denn Moskau und Teheran vereinbarten in ihrem Atomdeal, dass Russland sämtliche Brennstäbe liefert und verbrauchte auch wieder zurücknimmt.
Schon im vergangenen August berichteten iranische Oppositionelle von zwei geheimen Atomanlagen: eine teilweise bis zu acht Meter tief unter der Erde gelegene Urananreicherungsanlage in Natanz und eine Schwerwasserfabrik bei Arak. In Natanz – von Teheran offiziell als „Projekt zur Wüstenkultivierung“ bezeichnet – könnte vom Herbst dieses Jahres an in zwei 25000 Quadratmeter großen Fabrikhallen mithilfe von Gaszentrifugen waffenfähiges Uran angereichert werden. 2,5 Meter dicke Mauern schützten das Areal.
Der Sprecher des US-Außenministeriums, Richard Boucher, spricht von „harten Beweisen“ und kommt zu dem Schluss, „dass Iran aktiv an der Entwicklung der Kapazitäten für Nuklearwaffen arbeitet“.
Nach CIA-Erkenntnissen hat Iran an mindestens 14 weiteren Standorten in den vergangenen Jahren teilweise unterirdische Atomfabriken, Laboratorien, nukleare Forschungs- und Entwicklungszentren errichtet. CIA und BND wollen schon 1998 festgestellt haben, dass am Zentrum für Laserforschung in Teheran Laserkristalle produziert werden, mit deren Hilfe besonders waffentaugliches Plutonium gewonnen werden kann.
Warnungen der CIA
Der iranische Außenamtssprecher Hamid Reza Assefi weist die Vorwürfe als „altbekannte Propaganda“ zurück. Und doch hat Teheran nun angeboten, die Atomanlagen unter die Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zu stellen. IAEO-Direktor Mohammed El-Baradei ist eingeladen, im Februar ins Land zu kommen.
„Damit will Iran die Anlagen gegen einen militärischen Angriff schützen“, glaubt Gary Samore, Proliferationsexperte am International Institute for Strategic Studies in London. Als Rüstungsexperte im Nationalen Sicherheitsrat beriet Samore von 1996 bis 2000 US-Präsident Bill Clinton. Iran, sagt Samore, habe im Weißen Haus neben dem Irak und Nordkorea schon lange zu den „Top Drei“ der Besorgnis erregenden Staaten gehört.
Das Mullah-Regime stehe Saddam Hussein im Streben nach Massenvernichtungswaffen in nichts nach. Erst vor wenigen Wochen warnte die CIA in einem Bericht an den US-Kongress, Iran treibe die Produktionsmöglichkeiten für Bio- und Chemiewaffen voran und entwickle eine neue Mittelstreckenrakete.
Werden da ein paar Routine-Untersuchungen der IAEO die Bush-Regierung beruhigen können? „Wir sollten uns im Falle Irans nicht mit Inspektionen zufrieden geben, angesichts von Anlagen, die unmittelbar für die Produktion von Nuklearwaffen benutzt werden können“, sagt Gary Samore.
Keine noch so gute internationale Aufsicht könne schließlich verhindern, dass Iran den Atomwaffensperrvertrag innerhalb von drei Monaten kündige und die Inspektoren aus dem Land werfe. Break out option, „Ausreiß-Option“ hat Washington diese Sorge getauft. Gary Samore fordert deshalb: „Wir sollten versuchen, den Bau dieser Anlagen zu stoppen.“
Dafür gibt es neben Raketenbeschuss allerdings auch eine diplomatische Option. In Iran liefern sich moderat-islamische Reformer um den gewählten Präsidenten Mohammed Chatami einen Dauermachtkampf mit den antiwestlichen Mullahs unter Führung ihres geistlichen Oberhaupts, Ajatollah Ali Chamenei.
Aus Sicht der Reformer könnte der Sturz Saddam Husseins Iran durchaus ein Argument liefern, das Atomprogramm freiwillig einzustellen; schließlich geht von dem Erzfeind im Westen und seinen Massenvernichtungswaffen die größte Bedrohung aus. Fiele sie weg, könnte auch Teheran abrüsten – und zuleich die politischen und wirtschaftlichen Beziehunge zum Westen verbessern.
Offiziell spricht sich die iranische Regierung gegen einen Krieg im Irak aus. Allerdings machte der Vorsitzende des Rates für Nationale Sicherheit, Hassan Rowhani, vergangene Woche deutlich, eine Entwaffnung des Irak sei durchaus wünschenswert: „Unter Führung der Vereinten Nationen können wir das akzeptieren.“
Offenbar machen sich einige der Reformer auch schon Gedanken über die Nachkriegsordnung im Nachbarland. Am Dienstag reisten mehrere Parteiführer der irakischen Opposition nach Teheran, um eine Konferenz für die politische Zukunft des Irak vorzubereiten – ein Vorhaben, das die Amerikaner schon seit Monaten unterstützen. „Tatsächlich tut Iran nach außen nichts, was Amerika Anlass zur Beschwerde geben könnte“, sagt der Strategie-Experte Hopkinson. „Aber es gibt wohl Kräfte in Washington, die immer noch geprägt sind von der Geiselnahme des amerikanischen Botschaftspersonals in Teheran 1980. Eine Generation also, die durchaus noch Rachegefühle haben dürfte.“
Der ehemalige Präsidentenberater Gary Samore hingegen glaubt, die oberen Beamten im Pentagon seien viel zu sehr mit dem Irak und Nordkorea beschäftigt, um sich Gedanken über den Iran zu machen. „Das Thema ist noch nicht bis nach oben durchgedrungen“, sagt er. „Dafür wird es allerdings langsam Zeit.“
DIE ZEIT 06 - 2003
ATOMARE AUFRÜSTUNG IM IRAN
Washington glaubt nicht an friedliche Ziele
Washington (rpo). Die amerikanische Regierung sieht ein neues Problem am Horizont: Diesmal macht Washington das iranische Atomprogramm Sorgen. Die USA glauben nicht, dass Teheran mit dem Programm friedliche Ziele verfolge, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer.
Iran versuche heimlich, eine Fabrik zur Anreicherung von Uran und eine für schweres Wasser zu bauen- letztere, um einen Reaktor zur Produktion von waffentauglichem Plutonium zu versorgen.
"Iran hat die Existenz dieser Einrichtungen erst zugegeben, als keine andere Wahl mehr bestand", betonte Fleischer. Es gebe keine wirtschaftliche Rechtfertigung für das Programm und deswegen bestehe großer Anlass zur Sorge. Weiter sagte der Sprecher, die Situation mache die Lücken bei den Bemühungen um internationale Kontrolle deutlich.
Aufrüsten, bevor die Weltmacht kommt
Schon ohne einen Irak-Krieg sieht Iran sich militärisch eingekeilt. Zur Sicherheit schafft er Nuklearwaffen an
Von Jochen Bittner
Gäbe es die Atombombe als Pokal für die misslichste geostrategische Lage auf dem Globus, Iran hätte sie verdient. Klingt absurd? Nicht aus Sicht des Iran. Das Land fühlt sich schon heute eingezwängt in einen Schraubstock amerikafreundlicher und zum Teil nuklear bewaffneter Mächte: Israel und die Türkei im Westen, Afghanistan, Pakistan und Indien im Osten. Und nun droht der „große Satan“ sich auch noch im Nachbarland Irak einzurichten.
In Teheran wächst die Angst, nach dem Feldzug gegen Saddam könne Iran der nächste Kandidat auf der amerikanischen Zielliste der Proliferationsstaaten (vulgo: „Achse des Bösen“) sein.
Das Atomprogramm der Islamischen Republik ist Washington seit langem ein Dorn im Auge. Mittlerweile kann als sicher gelten, dass es nicht nur zivilen Zwecken dient. Es wird nicht mehr lange dauern, warnen Experten, bis Iran in der Lage ist, Nuklearwaffen zu produzieren. Und ein Krieg im Irak könnte das antiwestliche Mullah-Regime zusätzlich zur Eile treiben.
„Aus der Krise in Nordkorea kann man die Lehre ziehen: Man muss sich möglichst schnell Nuklearwaffen zulegen, wenn man als Mitglied der ‚Achse des Bösen‘ nicht angegriffen werden will“, sagt William Hopkinson, ehemals Chef der Abteilung für Waffenkontrolle im britischen Verteidigungsministerium und heute Proliferationsspezialist am Londoner Royal Institute for International Affairs.
Während der Countdown zum Irak-Krieg läuft, bleibt unklar, wie Amerika mit dem immer muskulöseren „Schurken“ Iran verfahren will. Bleibt am Ende nur, die Baustellen zu bombardieren, um eine nukleare Trutzburg im Mittleren Osten zu verhindern?
Es wäre nicht der erste Angriff dieser Art in der Region: Schon 1981 zerstörten israelische Kampfflugzeuge das im Bau befindliche Kernkraftwerk Osirak im Irak.
Iran werde in den nächsten zwei Jahrzehnten eine atomare Infrastruktur mit einer Leistung von 6000 Megawatt aufbauen, verkündete der iranische Vizepräsident Gholamreza Aghazadeh im vergangenen September.
Aus Russland ergießt sich ein unkontrollierbarer Fluss von Nukleartechnik und atomarem Know-how nach Iran. In ihrer Heimat verdienen manche russische Wissenschaftler nur 50 Dollar im Monat. In Iran bekommen sie 5000.
Schon 2004 soll das erste mit russischer Hilfe gebaute Atomkraftwerk in Buschehr ans Netz gehen, fünf weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. Atomkraftwerke in einem Land, das auf Öl und Gas schwimmt – an ein Programm zur Stromerzeugung mochten Proliferationsexperten von Anfang an nicht glauben.
Atomstrom? Wohl kaum
Neue Satellitenbilder zeigen nun, dass sich hinter dem vermeintlich zivilen Großprojekt kaum etwas anderes verbergen kann als ein nuklearer Aufrüstungsversuch.
Die Aufnahmen weisen in die Wüstenregion unweit der Stadt Isfahan. Zwischen den Ortschaften Schahrida und Fulaschan, fünf Kilometer außerhalb Isfahans, erstreckt sich ein riesiges, militärisch streng gesichertes Areal. Radarsysteme vom russischen Typ Raduga SPK-75P kontrollieren den Luftraum. Abwehrgeschütze russischer Herkunft sichern vor Angriffen aus der Luft.
Das Kernstück des weitläufigen Areals ist eine Uranumwandlungsanlage. In ihr soll vom kommenden Jahr an Hexafluorid UF 6 gewonnen werden – der Grundstoff für waffenfähiges Uran. Tunnelsysteme führen zum unterirdischen Teil der Anlage. Die Atomfabrik, das zeigen die Satellitenbilder, steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Für friedliche Zwecke ist die Anlage überflüssig. Denn Moskau und Teheran vereinbarten in ihrem Atomdeal, dass Russland sämtliche Brennstäbe liefert und verbrauchte auch wieder zurücknimmt.
Schon im vergangenen August berichteten iranische Oppositionelle von zwei geheimen Atomanlagen: eine teilweise bis zu acht Meter tief unter der Erde gelegene Urananreicherungsanlage in Natanz und eine Schwerwasserfabrik bei Arak. In Natanz – von Teheran offiziell als „Projekt zur Wüstenkultivierung“ bezeichnet – könnte vom Herbst dieses Jahres an in zwei 25000 Quadratmeter großen Fabrikhallen mithilfe von Gaszentrifugen waffenfähiges Uran angereichert werden. 2,5 Meter dicke Mauern schützten das Areal.
Der Sprecher des US-Außenministeriums, Richard Boucher, spricht von „harten Beweisen“ und kommt zu dem Schluss, „dass Iran aktiv an der Entwicklung der Kapazitäten für Nuklearwaffen arbeitet“.
Nach CIA-Erkenntnissen hat Iran an mindestens 14 weiteren Standorten in den vergangenen Jahren teilweise unterirdische Atomfabriken, Laboratorien, nukleare Forschungs- und Entwicklungszentren errichtet. CIA und BND wollen schon 1998 festgestellt haben, dass am Zentrum für Laserforschung in Teheran Laserkristalle produziert werden, mit deren Hilfe besonders waffentaugliches Plutonium gewonnen werden kann.
Warnungen der CIA
Der iranische Außenamtssprecher Hamid Reza Assefi weist die Vorwürfe als „altbekannte Propaganda“ zurück. Und doch hat Teheran nun angeboten, die Atomanlagen unter die Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zu stellen. IAEO-Direktor Mohammed El-Baradei ist eingeladen, im Februar ins Land zu kommen.
„Damit will Iran die Anlagen gegen einen militärischen Angriff schützen“, glaubt Gary Samore, Proliferationsexperte am International Institute for Strategic Studies in London. Als Rüstungsexperte im Nationalen Sicherheitsrat beriet Samore von 1996 bis 2000 US-Präsident Bill Clinton. Iran, sagt Samore, habe im Weißen Haus neben dem Irak und Nordkorea schon lange zu den „Top Drei“ der Besorgnis erregenden Staaten gehört.
Das Mullah-Regime stehe Saddam Hussein im Streben nach Massenvernichtungswaffen in nichts nach. Erst vor wenigen Wochen warnte die CIA in einem Bericht an den US-Kongress, Iran treibe die Produktionsmöglichkeiten für Bio- und Chemiewaffen voran und entwickle eine neue Mittelstreckenrakete.
Werden da ein paar Routine-Untersuchungen der IAEO die Bush-Regierung beruhigen können? „Wir sollten uns im Falle Irans nicht mit Inspektionen zufrieden geben, angesichts von Anlagen, die unmittelbar für die Produktion von Nuklearwaffen benutzt werden können“, sagt Gary Samore.
Keine noch so gute internationale Aufsicht könne schließlich verhindern, dass Iran den Atomwaffensperrvertrag innerhalb von drei Monaten kündige und die Inspektoren aus dem Land werfe. Break out option, „Ausreiß-Option“ hat Washington diese Sorge getauft. Gary Samore fordert deshalb: „Wir sollten versuchen, den Bau dieser Anlagen zu stoppen.“
Dafür gibt es neben Raketenbeschuss allerdings auch eine diplomatische Option. In Iran liefern sich moderat-islamische Reformer um den gewählten Präsidenten Mohammed Chatami einen Dauermachtkampf mit den antiwestlichen Mullahs unter Führung ihres geistlichen Oberhaupts, Ajatollah Ali Chamenei.
Aus Sicht der Reformer könnte der Sturz Saddam Husseins Iran durchaus ein Argument liefern, das Atomprogramm freiwillig einzustellen; schließlich geht von dem Erzfeind im Westen und seinen Massenvernichtungswaffen die größte Bedrohung aus. Fiele sie weg, könnte auch Teheran abrüsten – und zuleich die politischen und wirtschaftlichen Beziehunge zum Westen verbessern.
Offiziell spricht sich die iranische Regierung gegen einen Krieg im Irak aus. Allerdings machte der Vorsitzende des Rates für Nationale Sicherheit, Hassan Rowhani, vergangene Woche deutlich, eine Entwaffnung des Irak sei durchaus wünschenswert: „Unter Führung der Vereinten Nationen können wir das akzeptieren.“
Offenbar machen sich einige der Reformer auch schon Gedanken über die Nachkriegsordnung im Nachbarland. Am Dienstag reisten mehrere Parteiführer der irakischen Opposition nach Teheran, um eine Konferenz für die politische Zukunft des Irak vorzubereiten – ein Vorhaben, das die Amerikaner schon seit Monaten unterstützen. „Tatsächlich tut Iran nach außen nichts, was Amerika Anlass zur Beschwerde geben könnte“, sagt der Strategie-Experte Hopkinson. „Aber es gibt wohl Kräfte in Washington, die immer noch geprägt sind von der Geiselnahme des amerikanischen Botschaftspersonals in Teheran 1980. Eine Generation also, die durchaus noch Rachegefühle haben dürfte.“
Der ehemalige Präsidentenberater Gary Samore hingegen glaubt, die oberen Beamten im Pentagon seien viel zu sehr mit dem Irak und Nordkorea beschäftigt, um sich Gedanken über den Iran zu machen. „Das Thema ist noch nicht bis nach oben durchgedrungen“, sagt er. „Dafür wird es allerdings langsam Zeit.“
DIE ZEIT 06 - 2003
.
Fed hat ihr Pulver fast verschossen
Von Andreas Krosta, Sebastian Sachs, Nicola Liebert
Die US-Notenbank Fed wird nach Ansicht von Strategen die Leitzinsen in den nächsten Monaten maximal noch bis auf 0,5 Prozent senken, hat aber dann keinen Spielraum mehr für weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Nach weiteren ein oder zwei Zinssenkungen dürfte die Federal Reserve (Fed) ihre Munition verschossen haben, hieß es.
Ob die Fed bereits in der nächsten Woche eine weitere Absenkung der Leitzinsen von derzeit 1,25 Prozent beschließen wird, ist unter den Experten jedoch umstritten. Eine Option, die der Zentralbank auch nach weiteren Zinssenkungen noch bleibt, ist der Erwerb von US-Staatsanleihen. Damit könnte das Zinsniveau insbesondere bei den mittleren und langen Laufzeiten noch einmal deutlich gesenkt werden. Bereits zwischen 1979 und 1982 hatte sich die Fed auf die langfristigen Zinsen konzentriert und US-Treasuries zurückgekauft.
Die Diskussion um die amerikanische Geldpolitik hatte Ende vergangener Woche nach Veröffentlichung überraschend schwacher US-Arbeitsmarktdaten neuen Schwung erhalten. "Der Bericht hat uns veranlasst, unsere Prognosen für die US-Geldpolitik zu ändern", sagte David Rosenberg, Chefvolkswirt bei Merrill Lynch in New York.
Möglicher Strategiewechsel
Er erwartet noch zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte am 18. März und 6. Mai, die den US-Leitzins auf 0,75 Prozent drücken würden. "Wir bezweifeln allerdings, dass es noch viel tiefer geht", sagte Rosenberg weiter. "Ein eventueller nächster Schritt der Notenbank könnte dann im Erwerb von Treasuries mittlerer und langer Laufzeit liegen."
Auch Jan Hatzius, Volkswirt der Investmentbank Goldman Sachs, hält einen Strategiewechsel zur Beeinflussung der langfristigen Zinsen für möglich. "Sollte die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen, die auch durch weitere Zinssenkungen nicht vermieden werden könnte, ist es ein gutes Mittel der Fed." Die Grenze liegt für Hatzius ebenfalls bei einem Zinssatz von 0,75 Prozent. "Das wäre sinnvoll. Wenn die Fed die Zinsen auf null senkt, könnte Panik an den Aktienmärkten ausbrechen. Die Akteure könnten denken, die Fed hätte ihr Pulver verschossen."
Der US-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Peter Hooper, sieht ebenfalls gute Chancen für ein geändertes Vorgehen der Notenbank. "Wir schätzen, dass die Fed bei einem Zinssatz von 0,5 oder 0,75 Prozent ihre Strategie ändern wird", sagte er. "Die Fed wird alles tun, um das Wachstum in der US-Wirtschaft zu unterstützen - wenn nötig, auch Staatsanleihen zurückkaufen", sagte Hooper weiter.
Nicht sicher ist sich Ökonom Hatzius darüber, wie hoch eventuelle Treasury-Rückkäufe sein müssten, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. "Vielleicht reicht sogar schon die Ankündigung der Fed, um die langfristigen Zinsen nach unten zu bringen", so Hatzius.
Richard Rippe, Chefvolkswirt von Prudential Securities, sieht dagegen noch keine Notwendigkeit für einen schnellen Strategiewechsel der Fed. "Solange die Leitzinsen nicht bei 0 Prozent angekommen sind, macht es keinen Unterschied, ob die Fed durch direkte Käufe von Treasuries Liquidität in den Markt pumpt", so der Experte. Denn durch ihre Offenmarktoperationen steuere die Notenbank die Zinsen bereits jetzt durch das Aufkaufen von Wertpapieren wie US-Treasuries. "Sollten die Zinsen jedoch 0 Prozent erreichen, hat die Fed in der Tat noch Alternativen", so Rippe. Neben langlaufenden US-Staatsanleihen sieht er auch den Kauf kommunaler Anleihen als Möglichkeit. "Aber so weit sind wir noch nicht", resümiert er.
11.03.2003 Financial Times Deutschland
Fed hat ihr Pulver fast verschossen
Von Andreas Krosta, Sebastian Sachs, Nicola Liebert
Die US-Notenbank Fed wird nach Ansicht von Strategen die Leitzinsen in den nächsten Monaten maximal noch bis auf 0,5 Prozent senken, hat aber dann keinen Spielraum mehr für weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Nach weiteren ein oder zwei Zinssenkungen dürfte die Federal Reserve (Fed) ihre Munition verschossen haben, hieß es.
Ob die Fed bereits in der nächsten Woche eine weitere Absenkung der Leitzinsen von derzeit 1,25 Prozent beschließen wird, ist unter den Experten jedoch umstritten. Eine Option, die der Zentralbank auch nach weiteren Zinssenkungen noch bleibt, ist der Erwerb von US-Staatsanleihen. Damit könnte das Zinsniveau insbesondere bei den mittleren und langen Laufzeiten noch einmal deutlich gesenkt werden. Bereits zwischen 1979 und 1982 hatte sich die Fed auf die langfristigen Zinsen konzentriert und US-Treasuries zurückgekauft.
Die Diskussion um die amerikanische Geldpolitik hatte Ende vergangener Woche nach Veröffentlichung überraschend schwacher US-Arbeitsmarktdaten neuen Schwung erhalten. "Der Bericht hat uns veranlasst, unsere Prognosen für die US-Geldpolitik zu ändern", sagte David Rosenberg, Chefvolkswirt bei Merrill Lynch in New York.
Möglicher Strategiewechsel
Er erwartet noch zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte am 18. März und 6. Mai, die den US-Leitzins auf 0,75 Prozent drücken würden. "Wir bezweifeln allerdings, dass es noch viel tiefer geht", sagte Rosenberg weiter. "Ein eventueller nächster Schritt der Notenbank könnte dann im Erwerb von Treasuries mittlerer und langer Laufzeit liegen."
Auch Jan Hatzius, Volkswirt der Investmentbank Goldman Sachs, hält einen Strategiewechsel zur Beeinflussung der langfristigen Zinsen für möglich. "Sollte die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen, die auch durch weitere Zinssenkungen nicht vermieden werden könnte, ist es ein gutes Mittel der Fed." Die Grenze liegt für Hatzius ebenfalls bei einem Zinssatz von 0,75 Prozent. "Das wäre sinnvoll. Wenn die Fed die Zinsen auf null senkt, könnte Panik an den Aktienmärkten ausbrechen. Die Akteure könnten denken, die Fed hätte ihr Pulver verschossen."
Der US-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Peter Hooper, sieht ebenfalls gute Chancen für ein geändertes Vorgehen der Notenbank. "Wir schätzen, dass die Fed bei einem Zinssatz von 0,5 oder 0,75 Prozent ihre Strategie ändern wird", sagte er. "Die Fed wird alles tun, um das Wachstum in der US-Wirtschaft zu unterstützen - wenn nötig, auch Staatsanleihen zurückkaufen", sagte Hooper weiter.
Nicht sicher ist sich Ökonom Hatzius darüber, wie hoch eventuelle Treasury-Rückkäufe sein müssten, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. "Vielleicht reicht sogar schon die Ankündigung der Fed, um die langfristigen Zinsen nach unten zu bringen", so Hatzius.
Richard Rippe, Chefvolkswirt von Prudential Securities, sieht dagegen noch keine Notwendigkeit für einen schnellen Strategiewechsel der Fed. "Solange die Leitzinsen nicht bei 0 Prozent angekommen sind, macht es keinen Unterschied, ob die Fed durch direkte Käufe von Treasuries Liquidität in den Markt pumpt", so der Experte. Denn durch ihre Offenmarktoperationen steuere die Notenbank die Zinsen bereits jetzt durch das Aufkaufen von Wertpapieren wie US-Treasuries. "Sollten die Zinsen jedoch 0 Prozent erreichen, hat die Fed in der Tat noch Alternativen", so Rippe. Neben langlaufenden US-Staatsanleihen sieht er auch den Kauf kommunaler Anleihen als Möglichkeit. "Aber so weit sind wir noch nicht", resümiert er.
11.03.2003 Financial Times Deutschland
.
Und was macht Warren Buffett ?
... Alles außer in Gold ...
US-Milliardär Warren Buffett präsentiert Rekordgewinn
Investment-Holding Berkshire Hathaway auf Erfolgskurs
Rückversicherer General Re profitiert von steigendem Prämien-Niveau
von Martin Halusa
New York - - Vor zwei Jahren entschuldigte sich Warren Buffett bei seinen Aktionären dafür, dass der Kurs der Investment-Holding Berkshire Hathaway so niedrig sei - die Aktie stand damals bei 40 000 Dollar. Im vergangenen Jahr leistete Buffett Abbitte, weil er die Risiken des Versicherungsgeschäfts unterschätzt hatte - 2,4 Mrd. Dollar kosteten die Firma die Anschläge des 11. September.
Doch nun müssen jene verstummen, die Buffett schon abgeschrieben hatten: Während rings herum die Unternehmen in der Bredouille stecken und die Gewinne schmelzen, erzielte Berkshire Hathaway ihren höchsten je erreichten Jahresgewinn - 4,29 Mrd. Dollar, nach 795 Mio. im Jahr davor. Der Umsatz des in Omaha (Bundesstaat Nebraska) angesiedelten Unternehmens erhöhte sich um zehn Prozent auf 42,3 Mrd. Dollar. Allein im vierten Quartal war der Gewinn von 95 Mio. (2001) auf 1,18 Mrd. Dollar gestiegen. Pro Aktie stieg der Gewinn im Gesamtjahr um 436 Prozent von 521 auf 2795 Dollar pro Aktie.
Hauptgrund für die guten Nachrichten ist zum einen das Ausbleiben von Katastrophen. Zum anderen tragen die höheren Prämien zu dem Anstieg bei, die die Versicherungen seit den Attentaten nehmen kann. Zu Berkshire gehört der Rückversicherer General Re, aber auch der Versicherungsgruppe Geico. Gerade bei General Re sei eine größere Umstrukturierung nötig gewesen, schreibt Buffett in seinem am Wochenende veröffentlichten Aktionärsbrief. General Re habe derart viele Risiken akkumuliert, dass ein politisches Attentat im Lande - "sagen wir mal: eine größere Atombombe" - für die Finanzen des Unternehmens das Aus bedeutet hätte. Zugleich kritisierte Buffett, dass General Re weiterhin zu hohe Kosten habe. Dennoch sei die Firma, einer der größten Rückversicherer der Welt, heute gut positioniert.
Auch die übrigen Beteiligungen haben zum neuerlichen Erfolg Buffetts beigetragen. "Unsere bemerkenswerten Aktien haben besser als die meisten Indices abgeschnitten", sagt Buffett. Zu Berkshire Hathaway gehören neben den Versicherern, die sich zu 100 Prozent im Besitz der Holding befinden, auch Anteile an American Express (11,3 Prozent), Coca-Cola (8,1) und Gillette (neun). Darüber hinaus ist Berkshire an der Washington Post, der Eisdielenkette Dairy Queen sowie zahlreichen Mittelständlern in Omaha beteiligt.
Vor wenigen Monaten stieg Buffett sogar bei der High-Tech-Firma Level 3 ein. Dabei war er während des Technologiebooms heftig kritisiert worden, weil er um High-Tech-Aktien einen großen Bogen machte. Doch diese Strategie hat sich ausgezahlt. Die Aktie von Berkshire, die ihr Tief mitten während des 2000er Booms hatte, notiert inzwischen bei 65 000 Dollar. Damit liegt das Papier aber deutlich unter jenen 78 500 Dollar, die es im Mai 2002 erreicht hatte.
In seinem Aktionärsbrief geht Buffett, der wegen seiner oft zweideutigen Aussagen das "Orakel von Omaha" genannt wird, scharf mit Corporate America ins Gericht. Noch immer sei die Kontrolle über die Unternehmen lax, noch immer würden Manager viel zu gut bezahlt, noch immer sei die Atmosphäre in den Aufsichtsratssitzungen zu "kuschelig". Schon vor zehn Jahren hatte Buffett vor den Exzessen gewarnt, die durch die Bezahlung der Manager drohten.
"Als die Aktien stiegen, sanken die Verhaltensnormen der Manager". Es sei nun die Pflicht der CEOs, das Vertrauen Amerikas wiederherzustellen. Dies gelinge allerdings nicht durch bedeutungslose Statements, "alberne Werbung" oder strukturelle Veränderungen in der Aufsichtsgremien. Auch die institutionellen Anleger sollten nun gemeinsam handeln, und dort die Stimmen verweigern, wo Aufsichtsräte anrüchiges Verhalten toleriert hätten.
DIE WELT - 11. März 2003
Warren Buffet greift nach Junk-Bonds
Hochzinsanleihen erleben nach langer Durststrecke einen regelrechten Boom
New York - - Investment-Guru Warren Buffett verkündete, er habe seine Bestände an Junk-Bonds verdreifacht, weil diese im Gegensatz zu Aktien attraktiv seien. Daraufhin vervierfachte sich letzte Woche der Kapitalzufluss in Junk-Bond-Fonds gegenüber Ende Februar, berichtet Trimtabs.com Investment Research. Trimtabs beobachtet die Geldströme in Investmentfonds.
Nutznießer dieses Nachfrageschubs bei "Ramschanleihen" - hoch verzinste aber bonitätschsswache Papiere - dürften Credit Suisse First Boston, dem weltgrößten Konsortialführer von Hochzinsanleihen, und Fidelity Investments, die Nummer eins bei Investmentfonds für Junk-Bonds, sein. "Wenn Warren Buffett den Junk-Bonds seinen Segen gibt, wird die Ernte für die Underwriter und Vermögensverwalter von Hochzinsanleihen gut ausfallen," erwartet Alfredo Rotemberg, Fondsmanager bei ABN Amro.
Junk-Bonds sind einer der wenigen Lichtblicke für die Investoren und die Finanzhäuser von der Wall Street. Ein Beispiel: Der Dreyfus-High-Yield-Strategies-Fund hat seinen Anlegern dieses Jahr bisher 28 Prozent eingebracht und führt damit nach den Daten von Bloomberg die Hitliste von 475 vergleichbaren Fonds an. Am Aktienmarkt dagegen hat der Standard & Poor`s-500-Index 6,6 Prozent verloren.
Der Kapitalzufluss in die Hochzinsanleihefonds erreichte in der Woche zum 5. März einen Zweiwochenrekord von 2,87 Mrd. Dollar, so der Fondsbeobachter AMG Data Services. Junk-Bond-Fonds verzeichneten zwischen dem 30. September und dem 28. Februar einen Wertzuwachs von 16,5 Prozent, so das Investment Company Institute und Trimtabs. Seit Oktober sind etwa 8,6 Mrd. Dollar in Hochzinsanleihen-Fonds geflossen.
Nach Einschätzung von Moody`s sind die Risiken bei den Junkbonds seit einem Jahr gesunken. Das größte Risiko bei einer "Schrottanleihe" besteht in einem Zahlungsausfall. Die Ausfallquote erreichte am 31. Januar 2002 den Spitzenwert von 10,7 Prozent und belief sich am 31. Januar 2003 auf 7,7 Prozent. , Fondsmanager bei Eaton Vance. "Seit langem macht es wieder Spaß." Bloomberg
DIE WELT - 11. März 2003
Warren Buffet: Derivate sind "Zeitbomben"
Großinvestor warnt in Aktionärsbrief vor komplizierten Finanzwetten - Wert des Berkshire-Portfolios gesunken
von Martin Halusa
New York - Warren Buffett - Milliardeninvestor aus Omaha (im US-Bundesstaat Nebraska), zweitreichster Mensch der Welt und Wall-Street-Schnäppchenjäger ist das Geldanlegen satt, zumindest vorerst. Trotz der seit drei Jahren anhaltenden Talfahrt, gebe es keine Aktien, die ihn derzeit interessierten, schreibt Buffett in seinem stets mit Spannung erwarteten Aktionärsbrief. Diese Einschätzung sei Ausdruck der "krankhaften Bewertungen", die es während "The Great Bubble", der Börsenblase der Jahre 1999/2000 gegeben habe. Noch immer habe der Markt an den Folgen zu leiden.
Zugleich warnt Buffett ("Das Orakel von Omaha" ) vor Derivaten. Diese Finanzkonstrukte seien "Zeitbomben", die beiden schadeten: den Parteien, die sie abschließen sowie dem volkswirtschaftlichen System. Buffett, der der jüngsten Forbes-Liste zufolge über ein Vermögen von rund 35 Mrd. Dollar verfügt, bezeichnet die Finanzderivate als "Massenvernichtungswaffen", die Gefahren in sich trügen, die potenziell tödlich seien. Die Finanzwetten seien mittlerweile derart kompliziert, dass sie niemand mehr verstehe. Weil sie "mega-katastrophen-riskant" seien, könnten Derivate ganze Volkswirtschaften vernichten.
Für Unternehmen seien die Finanzgeschäfte deshalb eine Gefahr, weil eine Firma in Schwierigkeiten geraten kann, ohne dass dies mit ihrem eigentlichen Geschäft zu tun habe. Derivate seien "wie die Hölle", schreibt Buffett: "leicht zu betreten, aber unmöglich, sie zu verlassen". Ein Problem sei zudem die Frage, wie die Derivate in den Firmenbilanzen verbucht seien. Gerade dies habe in der Vergangenheit die Tür für Betrügereien geöffnet. "Im Energiesektor haben Unternehmen Derivate und den Handel dazu genutzt, um tolle Gewinne zu berichten". Als die Firmen die Positionen in ihren Büchern in Geld umwandeln wollten, sei das Dach eingestürzt - siehe Enron.
Auch er selber habe mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway Erfahrungen mit Derivaten gesammelt, und zwar größtenteils schlechte: Als er den Rückversicherer General Re gekauft habe, habe er der Wertpapierabteilung und damit das Derivategeschäft ebenfalls übernehmen müssen. "Es zu schließen ist einfacher gesagt als getan". Er werde sich zwar von dem Geschäft trennen, dies dauere aber lange Zeit. Noch Ende vergangenen Jahre habe General Re über 14.384 Kontrakte mit 672 Vertragsparteien in der ganzen Welt verfügt. Problematisch sei auch, dass eine große Anzahl an Risiken in der Hand von wenigen Händlern liege, die zusätzlich untereinander Geschäfte machten. "Die Geschichte lehrt uns, dass eine Krise oft zu Wirkungsketten führt, von denen man in ruhigeren Kreisen nicht einmal geträumt hätte."
Der Investor betont, dass seine Holding derzeit allerdings sehr zufrieden mit ihre Beteiligungen sei; sie hätten ihre Gewinne erhöht. Allerdings räumt Buffet ein, dass die Bewertungen gesunken seien.
Berkshire Hathaway - mit einem Kurs von derzeit rund 63 000 Dollar die mit Abstand teuerste Aktie der Welt - ist an einer Reihe höchst unterschiedlicher Unternehmen beteiligt. So gehört neben dem Rückversicherer General Re der Autoversicherer Geico zu Berkshire sowie Beteiligungen an der Washington Post, Coca-Cola, American Express und Gillette. Darüber hinaus gehört die Imbißkette Dairy Queen, ein Möbelhaus und ein Juwelier in Omaha sowie die T-Shirtfirma "Fruit of the Loom" zum Imperium des Warren Buffett. Anfang Mai lädt Buffett zu seiner traditionellen Aktionärsversammlung - die Veranstaltung ("Woodstock für Kapitalisten" ) dauert insgesamt drei Tage.
DIE WELT - 5. März 2003
Und was macht Warren Buffett ?
... Alles außer in Gold ...

US-Milliardär Warren Buffett präsentiert Rekordgewinn
Investment-Holding Berkshire Hathaway auf Erfolgskurs
Rückversicherer General Re profitiert von steigendem Prämien-Niveau
von Martin Halusa
New York - - Vor zwei Jahren entschuldigte sich Warren Buffett bei seinen Aktionären dafür, dass der Kurs der Investment-Holding Berkshire Hathaway so niedrig sei - die Aktie stand damals bei 40 000 Dollar. Im vergangenen Jahr leistete Buffett Abbitte, weil er die Risiken des Versicherungsgeschäfts unterschätzt hatte - 2,4 Mrd. Dollar kosteten die Firma die Anschläge des 11. September.
Doch nun müssen jene verstummen, die Buffett schon abgeschrieben hatten: Während rings herum die Unternehmen in der Bredouille stecken und die Gewinne schmelzen, erzielte Berkshire Hathaway ihren höchsten je erreichten Jahresgewinn - 4,29 Mrd. Dollar, nach 795 Mio. im Jahr davor. Der Umsatz des in Omaha (Bundesstaat Nebraska) angesiedelten Unternehmens erhöhte sich um zehn Prozent auf 42,3 Mrd. Dollar. Allein im vierten Quartal war der Gewinn von 95 Mio. (2001) auf 1,18 Mrd. Dollar gestiegen. Pro Aktie stieg der Gewinn im Gesamtjahr um 436 Prozent von 521 auf 2795 Dollar pro Aktie.
Hauptgrund für die guten Nachrichten ist zum einen das Ausbleiben von Katastrophen. Zum anderen tragen die höheren Prämien zu dem Anstieg bei, die die Versicherungen seit den Attentaten nehmen kann. Zu Berkshire gehört der Rückversicherer General Re, aber auch der Versicherungsgruppe Geico. Gerade bei General Re sei eine größere Umstrukturierung nötig gewesen, schreibt Buffett in seinem am Wochenende veröffentlichten Aktionärsbrief. General Re habe derart viele Risiken akkumuliert, dass ein politisches Attentat im Lande - "sagen wir mal: eine größere Atombombe" - für die Finanzen des Unternehmens das Aus bedeutet hätte. Zugleich kritisierte Buffett, dass General Re weiterhin zu hohe Kosten habe. Dennoch sei die Firma, einer der größten Rückversicherer der Welt, heute gut positioniert.
Auch die übrigen Beteiligungen haben zum neuerlichen Erfolg Buffetts beigetragen. "Unsere bemerkenswerten Aktien haben besser als die meisten Indices abgeschnitten", sagt Buffett. Zu Berkshire Hathaway gehören neben den Versicherern, die sich zu 100 Prozent im Besitz der Holding befinden, auch Anteile an American Express (11,3 Prozent), Coca-Cola (8,1) und Gillette (neun). Darüber hinaus ist Berkshire an der Washington Post, der Eisdielenkette Dairy Queen sowie zahlreichen Mittelständlern in Omaha beteiligt.
Vor wenigen Monaten stieg Buffett sogar bei der High-Tech-Firma Level 3 ein. Dabei war er während des Technologiebooms heftig kritisiert worden, weil er um High-Tech-Aktien einen großen Bogen machte. Doch diese Strategie hat sich ausgezahlt. Die Aktie von Berkshire, die ihr Tief mitten während des 2000er Booms hatte, notiert inzwischen bei 65 000 Dollar. Damit liegt das Papier aber deutlich unter jenen 78 500 Dollar, die es im Mai 2002 erreicht hatte.
In seinem Aktionärsbrief geht Buffett, der wegen seiner oft zweideutigen Aussagen das "Orakel von Omaha" genannt wird, scharf mit Corporate America ins Gericht. Noch immer sei die Kontrolle über die Unternehmen lax, noch immer würden Manager viel zu gut bezahlt, noch immer sei die Atmosphäre in den Aufsichtsratssitzungen zu "kuschelig". Schon vor zehn Jahren hatte Buffett vor den Exzessen gewarnt, die durch die Bezahlung der Manager drohten.
"Als die Aktien stiegen, sanken die Verhaltensnormen der Manager". Es sei nun die Pflicht der CEOs, das Vertrauen Amerikas wiederherzustellen. Dies gelinge allerdings nicht durch bedeutungslose Statements, "alberne Werbung" oder strukturelle Veränderungen in der Aufsichtsgremien. Auch die institutionellen Anleger sollten nun gemeinsam handeln, und dort die Stimmen verweigern, wo Aufsichtsräte anrüchiges Verhalten toleriert hätten.
DIE WELT - 11. März 2003
Warren Buffet greift nach Junk-Bonds
Hochzinsanleihen erleben nach langer Durststrecke einen regelrechten Boom
New York - - Investment-Guru Warren Buffett verkündete, er habe seine Bestände an Junk-Bonds verdreifacht, weil diese im Gegensatz zu Aktien attraktiv seien. Daraufhin vervierfachte sich letzte Woche der Kapitalzufluss in Junk-Bond-Fonds gegenüber Ende Februar, berichtet Trimtabs.com Investment Research. Trimtabs beobachtet die Geldströme in Investmentfonds.
Nutznießer dieses Nachfrageschubs bei "Ramschanleihen" - hoch verzinste aber bonitätschsswache Papiere - dürften Credit Suisse First Boston, dem weltgrößten Konsortialführer von Hochzinsanleihen, und Fidelity Investments, die Nummer eins bei Investmentfonds für Junk-Bonds, sein. "Wenn Warren Buffett den Junk-Bonds seinen Segen gibt, wird die Ernte für die Underwriter und Vermögensverwalter von Hochzinsanleihen gut ausfallen," erwartet Alfredo Rotemberg, Fondsmanager bei ABN Amro.
Junk-Bonds sind einer der wenigen Lichtblicke für die Investoren und die Finanzhäuser von der Wall Street. Ein Beispiel: Der Dreyfus-High-Yield-Strategies-Fund hat seinen Anlegern dieses Jahr bisher 28 Prozent eingebracht und führt damit nach den Daten von Bloomberg die Hitliste von 475 vergleichbaren Fonds an. Am Aktienmarkt dagegen hat der Standard & Poor`s-500-Index 6,6 Prozent verloren.
Der Kapitalzufluss in die Hochzinsanleihefonds erreichte in der Woche zum 5. März einen Zweiwochenrekord von 2,87 Mrd. Dollar, so der Fondsbeobachter AMG Data Services. Junk-Bond-Fonds verzeichneten zwischen dem 30. September und dem 28. Februar einen Wertzuwachs von 16,5 Prozent, so das Investment Company Institute und Trimtabs. Seit Oktober sind etwa 8,6 Mrd. Dollar in Hochzinsanleihen-Fonds geflossen.
Nach Einschätzung von Moody`s sind die Risiken bei den Junkbonds seit einem Jahr gesunken. Das größte Risiko bei einer "Schrottanleihe" besteht in einem Zahlungsausfall. Die Ausfallquote erreichte am 31. Januar 2002 den Spitzenwert von 10,7 Prozent und belief sich am 31. Januar 2003 auf 7,7 Prozent. , Fondsmanager bei Eaton Vance. "Seit langem macht es wieder Spaß." Bloomberg
DIE WELT - 11. März 2003
Warren Buffet: Derivate sind "Zeitbomben"
Großinvestor warnt in Aktionärsbrief vor komplizierten Finanzwetten - Wert des Berkshire-Portfolios gesunken
von Martin Halusa
New York - Warren Buffett - Milliardeninvestor aus Omaha (im US-Bundesstaat Nebraska), zweitreichster Mensch der Welt und Wall-Street-Schnäppchenjäger ist das Geldanlegen satt, zumindest vorerst. Trotz der seit drei Jahren anhaltenden Talfahrt, gebe es keine Aktien, die ihn derzeit interessierten, schreibt Buffett in seinem stets mit Spannung erwarteten Aktionärsbrief. Diese Einschätzung sei Ausdruck der "krankhaften Bewertungen", die es während "The Great Bubble", der Börsenblase der Jahre 1999/2000 gegeben habe. Noch immer habe der Markt an den Folgen zu leiden.
Zugleich warnt Buffett ("Das Orakel von Omaha" ) vor Derivaten. Diese Finanzkonstrukte seien "Zeitbomben", die beiden schadeten: den Parteien, die sie abschließen sowie dem volkswirtschaftlichen System. Buffett, der der jüngsten Forbes-Liste zufolge über ein Vermögen von rund 35 Mrd. Dollar verfügt, bezeichnet die Finanzderivate als "Massenvernichtungswaffen", die Gefahren in sich trügen, die potenziell tödlich seien. Die Finanzwetten seien mittlerweile derart kompliziert, dass sie niemand mehr verstehe. Weil sie "mega-katastrophen-riskant" seien, könnten Derivate ganze Volkswirtschaften vernichten.
Für Unternehmen seien die Finanzgeschäfte deshalb eine Gefahr, weil eine Firma in Schwierigkeiten geraten kann, ohne dass dies mit ihrem eigentlichen Geschäft zu tun habe. Derivate seien "wie die Hölle", schreibt Buffett: "leicht zu betreten, aber unmöglich, sie zu verlassen". Ein Problem sei zudem die Frage, wie die Derivate in den Firmenbilanzen verbucht seien. Gerade dies habe in der Vergangenheit die Tür für Betrügereien geöffnet. "Im Energiesektor haben Unternehmen Derivate und den Handel dazu genutzt, um tolle Gewinne zu berichten". Als die Firmen die Positionen in ihren Büchern in Geld umwandeln wollten, sei das Dach eingestürzt - siehe Enron.
Auch er selber habe mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway Erfahrungen mit Derivaten gesammelt, und zwar größtenteils schlechte: Als er den Rückversicherer General Re gekauft habe, habe er der Wertpapierabteilung und damit das Derivategeschäft ebenfalls übernehmen müssen. "Es zu schließen ist einfacher gesagt als getan". Er werde sich zwar von dem Geschäft trennen, dies dauere aber lange Zeit. Noch Ende vergangenen Jahre habe General Re über 14.384 Kontrakte mit 672 Vertragsparteien in der ganzen Welt verfügt. Problematisch sei auch, dass eine große Anzahl an Risiken in der Hand von wenigen Händlern liege, die zusätzlich untereinander Geschäfte machten. "Die Geschichte lehrt uns, dass eine Krise oft zu Wirkungsketten führt, von denen man in ruhigeren Kreisen nicht einmal geträumt hätte."
Der Investor betont, dass seine Holding derzeit allerdings sehr zufrieden mit ihre Beteiligungen sei; sie hätten ihre Gewinne erhöht. Allerdings räumt Buffet ein, dass die Bewertungen gesunken seien.
Berkshire Hathaway - mit einem Kurs von derzeit rund 63 000 Dollar die mit Abstand teuerste Aktie der Welt - ist an einer Reihe höchst unterschiedlicher Unternehmen beteiligt. So gehört neben dem Rückversicherer General Re der Autoversicherer Geico zu Berkshire sowie Beteiligungen an der Washington Post, Coca-Cola, American Express und Gillette. Darüber hinaus gehört die Imbißkette Dairy Queen, ein Möbelhaus und ein Juwelier in Omaha sowie die T-Shirtfirma "Fruit of the Loom" zum Imperium des Warren Buffett. Anfang Mai lädt Buffett zu seiner traditionellen Aktionärsversammlung - die Veranstaltung ("Woodstock für Kapitalisten" ) dauert insgesamt drei Tage.
DIE WELT - 5. März 2003
.
Kaufen, wenn Aktien teurer sind
Von Kai Lange
Drei Jahre nach seinem Rekordhoch am 7. März 2000 markiert der Dax ein Siebenjahrestief und fällt weiter. Der zäheste Bärenmarkt seit der Weltwirtschaftskrise hat viele Ursachen und lehrt Zurückhaltung: Tiefkurse reizen zum Einstieg, sind aber keine Kaufkurse.
Hamburg – Ein Tag aus einer anderen Zeitrechnung, dieser 7. März. An jenem Dienstag schloss der Dax bei 8064 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf sogar die 8137 Punkte gekratzt hatte. Nichts schien den Höhenflug der Märkte zu stoppen: Allein die Aktie der Softwareschmiede SAP legte zwischen Januar und März 2000 rund 70 Prozent zu. Wer reich werden wollte, kaufte Aktien.
Heute sind die Aktionäre des Jahres 2000 zumindest reich an Erfahrung. Die zäheste Aktienbaisse seit 70 Jahren hat den Dax seitdem um rund 70 Prozent einbrechen lassen. Der "Wachstumsmarkt" Nemax 50 stürzte um 96 Prozent und in die Bedeutungslosigkeit.
Exakt drei Jahre, nachdem der Deutsche Aktienindex die 8000 Punkte im Sturm genommen hatte, stürzte er am 7. März 2003 unter die 2400 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Mittlerweile hat der deutsche Leitindex sogar die Marke von 2200 Zählern nach unten durchbrochen. Die Verluste einzelner Dax-Schwergewichte auf Dreijahressicht sind atemberaubend, doch von Einstiegskursen spricht kaum jemand. Willkommen in der neuen Zeit.
Die Daten aus drei Jahren Aktienbaisse sind nicht nur etwas für Statistiker und Masochisten. Mehr als zwölf Billionen Dollar Vermögen sind seit März 2000 weltweit verbrannt. Der Ausverkauf grenzt ebenso an Hysterie wie der Kaufrausch vor drei Jahren, sagen Analysten.
Tiefkurse sind nicht gleich Kaufkurse
Doch Tiefkurse sind nicht gleich Kaufkurse. Wer sich angesichts des dramatischen Ausverkaufs und der scheinbar günstigen Bewertung vieler Aktien wieder an den Markt traut, muss die Gründe für den Kurssturz richtig einschätzen. Die Gründe für den Absturz liegen nicht nur in dem Ende der New-Economy-Hysterie. Auf das Platzen der Hightechblase im Frühjahr 2000 folgten weitere Nackenschläge, deren Folgen die Märkte noch heute beschäftigen.
Immerhin wurden nicht alle Märkte zerzaust. In den aufstrebenden Märkten China (plus 125 Prozent) und Russland (plus 115 Prozent) haben Anleger ihr Geld seit 2000 mehr als verdoppelt. Nemax (minus 96 Prozent), Dax und die US-Technologiebörse Nasdaq (jeweils minus 70 Prozent) rangieren dagegen auf Dreijahressicht unter den fünf schwächsten Märkten weltweit. Der US-Industrieindex Dow Jones hielt sich dagegen mit einem Verlust von "nur" 32 Prozent vergleichsweise stabil.
Der Dax geriet nicht nur wegen der schwachen Konjunktur in Deutschland, sondern auch wegen der hohen Gewichtung von Technologie- und Finanztiteln zum Prügelknaben. Doch selbst mit Dax-Werten konnten Anleger zwischen März 2000 und März 2003 Gewinne einstreichen. Der Pharma- und Chemiekonzern Altana, dessen Börsenwert sich fast verdoppelte, steht mit Abstand an der Spitze der Krisengewinner im Dax 30.
Bei den Nebenwerten setzte der Kursrutsch mit Verzögerung ein. Erst als sich der Konjunkturabschwung beschleunigte, ging auch der Nebenwerteindex MDax in die Knie. Die Konsequenz: Unter den im Dax 100 versammelten Werten schafften es mit Puma , Stada , Drägerwerk , Wella , Vossloh und Schwarz Pharma sechs weitere Werte, die Performance des Dax-Gewinners Altana zu übertreffen.
Glücklich, wer die kleine Zahl der Kursgewinner im Depot hat. Für die Mehrzahl der Aktionäre ist es jedoch wichtiger, aus drei Jahren Bärenmarkt die Konsequenzen zu ziehen. Die Aktie ist auch nach drei Jahren Bärenmarkt nicht tot. Der Treppensturz seit 2000 hat verschiedene Stufen: Wenn die Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, gibt es Chancen auf Erholung.
Kehrtwende 2000: Die New-Economy-Blase platzt
Zehn Jahre lang waren die Kurse an den internationalen Aktienmärkten rasant gestiegen. Im März 2000 ging diese Mega-Hausse mit einem finalen Kaufrausch zu Ende. Die zusätzliche heiße Luft am Neuen Markt brachte den Ballon zum Platzen.
Da Werte der "New Economy" scheinbar keine Grenzen kannten, kletterten auch die im Dax notierten Werte aus Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) auf ungeahnte Fallhöhen.
Allein zwischen Januar und März 2000, in den letzten drei Monaten der zehnjährigen Börsenparty, stiegen Dax-Dickschiffe wie Siemens , T-Aktie und SAP jeweils um mehr als 50 Prozent. Auch aus diesem Grund fällt der prozentuale Kursverlust der TMT-Titel bis heute so dramatisch aus.
2001: 11. September, Terror und Rezession in den USA
Mit den Überbewertungen der hochgepushten TMT-Werte ist die dreijährige Talfahrt nicht allein zu erklären. Dass Analysten und Anleger nicht mehr nur von Wachstumshoffnungen und künftigen Umsätzen schwärmen, sondern auch wieder auf reale Geschäftszahlen schauen, rechtfertigt nicht das Ausmaß des Kurssturzes seit dem Jahr 2000.
Auch schon damals profitable Old-Economy-Unternehmen wie DaimlerChrysler oder Fresenius Medical Care haben seit März 2000 jeweils rund 50 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt, obwohl sie inzwischen deutlich höhere Gewinne erwirtschaften.
Ein Abschwung der US-Konjunktur im Jahr 2001 war nach zehn Jahren Boom für viele Beobachter noch kein Grund zur Unruhe. Gesunde Abkühlung, Abbau von Überkapazitäten, hieß es. Mit den Terroranschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 veränderte sich die Welt jedoch politisch wie ökonomisch: Das Gefühl von Sicherheit und die Friedensdividende auf Aktie waren dahin. Die Menschen zeigten sich tief verunsichert, und die US-Wirtschaft glitt in eine kurze Rezession.
2002: Enron, Worldcom und die Folgen
Die US-Konjunktur hatte sich nach dem Einbruch im Herbst 2001 bemerkenswert rasch erholt, da sorgten die Bilanzskandale bei Enron, Worldcom & Co. für einen neuen Kurssturz. Was den Terrorpiloten nicht gelang, schaffte eine Gruppe geldgieriger Manager: Das Vertrauen in Corporate America zu erschüttern. Mit schärferen Bilanzierungsregeln steuert die Finanzwelt inzwischen dagegen, doch die Skepsis bleibt groß, nicht nur wegen des jüngsten Skandals beim niederländischen Einzelhandelskonzern Ahold.
Bilanzskandale, Terrorangst und die sich zuspitzende Irak-Krise sorgten dafür, dass sich neben den Anlegern auch die Verbraucher zurück hielten und die Gewinne der Unternehmen weit hinter den Erwartungen blieben.
Der private Konsum ist jedoch die wichtigste Stütze der US-Wirtschaft: Hält sich der Konsument zurück, kommt die Konjunktur nicht in Schwung.
2003: Ölpreisschock und drohender Krieg
Die Weltwirtschaft wackelt weiter. Wegen des drohenden Krieges im Irak ist der Ölpreis im Frühjahr 2003 auf 40 Dollar pro Barrel gestiegen und notiert mehr als 15 Dollar über dem normalen Niveau.
Das ist Gift für die Börsen und für die Konjunktur: Niemand mag für Aktien oder Konsumgüter Geld ausgeben, so dass auch die Unternehmen weiterhin auf die Bremse treten.
Der stete Abwärtstrend an den Börsen zwingt Versicherungen und Pensionsfonds, ihre Aktienquoten trotz niedriger Bewertungen weiter zu reduzieren. Vor allem die angeschlagenen Finanz- und Technologiekonzerne haben sich einen eisernen Sparkurs verordnet, entlassen Mitarbeiter und schlagen Beteiligungen los. Inzwischen nährt die Baisse die Baisse.
Roach: USA droht erneute Rezession
Ölpreis-Schock und die wachsende Zurückhaltung der Konsumenten könnten dafür sorgen, dass die wichtigste Volkswirtschaft der Welt nach ihrer Mini-Rezession 2001 in diesem Jahr erneut in die Rezession abrutscht, fürchtet Stephen Roach, Chefökonom der Investmentbank Morgan Stanley. Da die USA derzeit die einzige Antriebskraft für die globale Konjunktur ist, dürfte ein neuer Rückschlag auch die anderen großen Volkswirtschaften empfindlich treffen.
Auch ein rascher militärischer Erfolg der USA im Irak wird die Schieflage der Weltwirtschaft nicht verändern. Im Jahr 1991, während des ersten Golfkrieges, erzielten neben den USA auch Europa, Japan und Ostasien deutliche Wachstumsraten. Heute ist Japan in der Deflation gefangen, und Deutschland steht kurz davor. Die globalen Indizes steigen und fallen mit den US-Märkten, sie sind im Bann des Konjunkturmotors USA.
Einsteigen, wenn Aktien wieder teurer sind
Daher ist es riskant, auch im Fall eines schnellen Sieges der US-Truppen im Irak auf eine nachhaltige Erholung an den Börsen zu setzen. Eine kurze und kräftige Rallye an den Börsen halten zwar die meisten Analysten für wahrscheinlich, sobald das Thema Krieg vom Tisch ist. "Von der Nachkriegs-Euphorie des Jahres 1991 sind wir schmerzhaft weit entfernt", sagt Roach. Statt von einer gradlinigen Erholungen gehen Beobachter auch für die kommenden Jahre von hohen Schwankungen an den Märkten aus.
Deshalb macht es durchaus Sinn, erst einzusteigen, wenn Aktien wieder teurer geworden sind. Das Rezessionsrisiko bleibt für dieses Jahr bestehen: "An Tiefständen zu kaufen ist historisch immer ein schlechter Rat gewesen", sagt Joachim Goldberg, Analyst beim Frankfurter Institut Cognitrend.
Erst wenn der Dax wieder über die Marke von 2700 steige, könne man wieder zum Einstieg raten.
Für den Anleger mag es widersinnig sein, zum Beispiel eine Aktie der Allianz erst zum Preis von 75 Euro zu kaufen, wenn man sie dieser Tage auch für 65 Euro haben kann. Die Gefahr weiterer Rückschläge ist jedoch noch immer groß. Die wenigen spekulativen Anleger, die mit mutigen Investitionen und hohem Risiko den Tiefpunkt erwischen, werden mit hohen Gewinnen belohnt werden.
Doch für das Gros dürfte sich Zurückhaltung und Gelassenheit auszahlen, auch wenn man dadurch die ersten Phase einer Erholung verpasst: Auch dies ist eine Lehre aus drei Jahren Bärenmarkt.
manager-magazin - 12.03.2003
Kaufen, wenn Aktien teurer sind
Von Kai Lange
Drei Jahre nach seinem Rekordhoch am 7. März 2000 markiert der Dax ein Siebenjahrestief und fällt weiter. Der zäheste Bärenmarkt seit der Weltwirtschaftskrise hat viele Ursachen und lehrt Zurückhaltung: Tiefkurse reizen zum Einstieg, sind aber keine Kaufkurse.
Hamburg – Ein Tag aus einer anderen Zeitrechnung, dieser 7. März. An jenem Dienstag schloss der Dax bei 8064 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf sogar die 8137 Punkte gekratzt hatte. Nichts schien den Höhenflug der Märkte zu stoppen: Allein die Aktie der Softwareschmiede SAP legte zwischen Januar und März 2000 rund 70 Prozent zu. Wer reich werden wollte, kaufte Aktien.
Heute sind die Aktionäre des Jahres 2000 zumindest reich an Erfahrung. Die zäheste Aktienbaisse seit 70 Jahren hat den Dax seitdem um rund 70 Prozent einbrechen lassen. Der "Wachstumsmarkt" Nemax 50 stürzte um 96 Prozent und in die Bedeutungslosigkeit.
Exakt drei Jahre, nachdem der Deutsche Aktienindex die 8000 Punkte im Sturm genommen hatte, stürzte er am 7. März 2003 unter die 2400 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Mittlerweile hat der deutsche Leitindex sogar die Marke von 2200 Zählern nach unten durchbrochen. Die Verluste einzelner Dax-Schwergewichte auf Dreijahressicht sind atemberaubend, doch von Einstiegskursen spricht kaum jemand. Willkommen in der neuen Zeit.
Die Daten aus drei Jahren Aktienbaisse sind nicht nur etwas für Statistiker und Masochisten. Mehr als zwölf Billionen Dollar Vermögen sind seit März 2000 weltweit verbrannt. Der Ausverkauf grenzt ebenso an Hysterie wie der Kaufrausch vor drei Jahren, sagen Analysten.
Tiefkurse sind nicht gleich Kaufkurse
Doch Tiefkurse sind nicht gleich Kaufkurse. Wer sich angesichts des dramatischen Ausverkaufs und der scheinbar günstigen Bewertung vieler Aktien wieder an den Markt traut, muss die Gründe für den Kurssturz richtig einschätzen. Die Gründe für den Absturz liegen nicht nur in dem Ende der New-Economy-Hysterie. Auf das Platzen der Hightechblase im Frühjahr 2000 folgten weitere Nackenschläge, deren Folgen die Märkte noch heute beschäftigen.
Immerhin wurden nicht alle Märkte zerzaust. In den aufstrebenden Märkten China (plus 125 Prozent) und Russland (plus 115 Prozent) haben Anleger ihr Geld seit 2000 mehr als verdoppelt. Nemax (minus 96 Prozent), Dax und die US-Technologiebörse Nasdaq (jeweils minus 70 Prozent) rangieren dagegen auf Dreijahressicht unter den fünf schwächsten Märkten weltweit. Der US-Industrieindex Dow Jones hielt sich dagegen mit einem Verlust von "nur" 32 Prozent vergleichsweise stabil.
Der Dax geriet nicht nur wegen der schwachen Konjunktur in Deutschland, sondern auch wegen der hohen Gewichtung von Technologie- und Finanztiteln zum Prügelknaben. Doch selbst mit Dax-Werten konnten Anleger zwischen März 2000 und März 2003 Gewinne einstreichen. Der Pharma- und Chemiekonzern Altana, dessen Börsenwert sich fast verdoppelte, steht mit Abstand an der Spitze der Krisengewinner im Dax 30.
Bei den Nebenwerten setzte der Kursrutsch mit Verzögerung ein. Erst als sich der Konjunkturabschwung beschleunigte, ging auch der Nebenwerteindex MDax in die Knie. Die Konsequenz: Unter den im Dax 100 versammelten Werten schafften es mit Puma , Stada , Drägerwerk , Wella , Vossloh und Schwarz Pharma sechs weitere Werte, die Performance des Dax-Gewinners Altana zu übertreffen.
Glücklich, wer die kleine Zahl der Kursgewinner im Depot hat. Für die Mehrzahl der Aktionäre ist es jedoch wichtiger, aus drei Jahren Bärenmarkt die Konsequenzen zu ziehen. Die Aktie ist auch nach drei Jahren Bärenmarkt nicht tot. Der Treppensturz seit 2000 hat verschiedene Stufen: Wenn die Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, gibt es Chancen auf Erholung.
Kehrtwende 2000: Die New-Economy-Blase platzt
Zehn Jahre lang waren die Kurse an den internationalen Aktienmärkten rasant gestiegen. Im März 2000 ging diese Mega-Hausse mit einem finalen Kaufrausch zu Ende. Die zusätzliche heiße Luft am Neuen Markt brachte den Ballon zum Platzen.
Da Werte der "New Economy" scheinbar keine Grenzen kannten, kletterten auch die im Dax notierten Werte aus Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT) auf ungeahnte Fallhöhen.
Allein zwischen Januar und März 2000, in den letzten drei Monaten der zehnjährigen Börsenparty, stiegen Dax-Dickschiffe wie Siemens , T-Aktie und SAP jeweils um mehr als 50 Prozent. Auch aus diesem Grund fällt der prozentuale Kursverlust der TMT-Titel bis heute so dramatisch aus.
2001: 11. September, Terror und Rezession in den USA
Mit den Überbewertungen der hochgepushten TMT-Werte ist die dreijährige Talfahrt nicht allein zu erklären. Dass Analysten und Anleger nicht mehr nur von Wachstumshoffnungen und künftigen Umsätzen schwärmen, sondern auch wieder auf reale Geschäftszahlen schauen, rechtfertigt nicht das Ausmaß des Kurssturzes seit dem Jahr 2000.
Auch schon damals profitable Old-Economy-Unternehmen wie DaimlerChrysler oder Fresenius Medical Care haben seit März 2000 jeweils rund 50 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt, obwohl sie inzwischen deutlich höhere Gewinne erwirtschaften.
Ein Abschwung der US-Konjunktur im Jahr 2001 war nach zehn Jahren Boom für viele Beobachter noch kein Grund zur Unruhe. Gesunde Abkühlung, Abbau von Überkapazitäten, hieß es. Mit den Terroranschlägen auf New York und Washington am 11. September 2001 veränderte sich die Welt jedoch politisch wie ökonomisch: Das Gefühl von Sicherheit und die Friedensdividende auf Aktie waren dahin. Die Menschen zeigten sich tief verunsichert, und die US-Wirtschaft glitt in eine kurze Rezession.
2002: Enron, Worldcom und die Folgen
Die US-Konjunktur hatte sich nach dem Einbruch im Herbst 2001 bemerkenswert rasch erholt, da sorgten die Bilanzskandale bei Enron, Worldcom & Co. für einen neuen Kurssturz. Was den Terrorpiloten nicht gelang, schaffte eine Gruppe geldgieriger Manager: Das Vertrauen in Corporate America zu erschüttern. Mit schärferen Bilanzierungsregeln steuert die Finanzwelt inzwischen dagegen, doch die Skepsis bleibt groß, nicht nur wegen des jüngsten Skandals beim niederländischen Einzelhandelskonzern Ahold.
Bilanzskandale, Terrorangst und die sich zuspitzende Irak-Krise sorgten dafür, dass sich neben den Anlegern auch die Verbraucher zurück hielten und die Gewinne der Unternehmen weit hinter den Erwartungen blieben.
Der private Konsum ist jedoch die wichtigste Stütze der US-Wirtschaft: Hält sich der Konsument zurück, kommt die Konjunktur nicht in Schwung.
2003: Ölpreisschock und drohender Krieg
Die Weltwirtschaft wackelt weiter. Wegen des drohenden Krieges im Irak ist der Ölpreis im Frühjahr 2003 auf 40 Dollar pro Barrel gestiegen und notiert mehr als 15 Dollar über dem normalen Niveau.
Das ist Gift für die Börsen und für die Konjunktur: Niemand mag für Aktien oder Konsumgüter Geld ausgeben, so dass auch die Unternehmen weiterhin auf die Bremse treten.
Der stete Abwärtstrend an den Börsen zwingt Versicherungen und Pensionsfonds, ihre Aktienquoten trotz niedriger Bewertungen weiter zu reduzieren. Vor allem die angeschlagenen Finanz- und Technologiekonzerne haben sich einen eisernen Sparkurs verordnet, entlassen Mitarbeiter und schlagen Beteiligungen los. Inzwischen nährt die Baisse die Baisse.
Roach: USA droht erneute Rezession
Ölpreis-Schock und die wachsende Zurückhaltung der Konsumenten könnten dafür sorgen, dass die wichtigste Volkswirtschaft der Welt nach ihrer Mini-Rezession 2001 in diesem Jahr erneut in die Rezession abrutscht, fürchtet Stephen Roach, Chefökonom der Investmentbank Morgan Stanley. Da die USA derzeit die einzige Antriebskraft für die globale Konjunktur ist, dürfte ein neuer Rückschlag auch die anderen großen Volkswirtschaften empfindlich treffen.
Auch ein rascher militärischer Erfolg der USA im Irak wird die Schieflage der Weltwirtschaft nicht verändern. Im Jahr 1991, während des ersten Golfkrieges, erzielten neben den USA auch Europa, Japan und Ostasien deutliche Wachstumsraten. Heute ist Japan in der Deflation gefangen, und Deutschland steht kurz davor. Die globalen Indizes steigen und fallen mit den US-Märkten, sie sind im Bann des Konjunkturmotors USA.
Einsteigen, wenn Aktien wieder teurer sind
Daher ist es riskant, auch im Fall eines schnellen Sieges der US-Truppen im Irak auf eine nachhaltige Erholung an den Börsen zu setzen. Eine kurze und kräftige Rallye an den Börsen halten zwar die meisten Analysten für wahrscheinlich, sobald das Thema Krieg vom Tisch ist. "Von der Nachkriegs-Euphorie des Jahres 1991 sind wir schmerzhaft weit entfernt", sagt Roach. Statt von einer gradlinigen Erholungen gehen Beobachter auch für die kommenden Jahre von hohen Schwankungen an den Märkten aus.
Deshalb macht es durchaus Sinn, erst einzusteigen, wenn Aktien wieder teurer geworden sind. Das Rezessionsrisiko bleibt für dieses Jahr bestehen: "An Tiefständen zu kaufen ist historisch immer ein schlechter Rat gewesen", sagt Joachim Goldberg, Analyst beim Frankfurter Institut Cognitrend.
Erst wenn der Dax wieder über die Marke von 2700 steige, könne man wieder zum Einstieg raten.
Für den Anleger mag es widersinnig sein, zum Beispiel eine Aktie der Allianz erst zum Preis von 75 Euro zu kaufen, wenn man sie dieser Tage auch für 65 Euro haben kann. Die Gefahr weiterer Rückschläge ist jedoch noch immer groß. Die wenigen spekulativen Anleger, die mit mutigen Investitionen und hohem Risiko den Tiefpunkt erwischen, werden mit hohen Gewinnen belohnt werden.
Doch für das Gros dürfte sich Zurückhaltung und Gelassenheit auszahlen, auch wenn man dadurch die ersten Phase einer Erholung verpasst: Auch dies ist eine Lehre aus drei Jahren Bärenmarkt.
manager-magazin - 12.03.2003
Katastrophe ? 
Beware of bubbleonians and dipsters
Fund manager Fleckenstein looks beyond gold`s decline
It`s no wonder they call William Fleckenstein a contrarian`s contrarian.
The money manager and frequent commentator, known as a global bear for much of his investing career, isn`t shorting the whole stock market right now. Yet he still believes stocks are headed for a heap of trouble, and Fleckenstein, president of Fleckenstein Capital in the Seattle area, likes prospects for gold, a metal whose spot price is sliding even as you read this article.
Next month, Fleckenstein will go one step further by speaking before the hungry gold crowd at the annual Las Vegas Precious Metals Conference. The hedge fund manager, probably one of America`s best-known short-sellers of stocks, is more than a little surprised at the thumping that gold is taking right now.
Gold in the spot market was down $10.50 to $335 an ounce Thursday morning in New York, a level more than 13 percent below the almost $390 the metal enjoyed earlier this year. Coming on the heels of a dismal past few weeks for the metal, that drop went hand in hand with a Thursday dollar rally.
Fleckenstein, a long-haired and successful hedge-fund manager, has a theory about all this :
"The gold market has gotten caught up in the geopolitical backdrop," he says. "I had this notion that the selling of gold that was going to take place when the war started has already started."
He figures most investors are mindlessly retracing the steps the markets took back in 1991, the first time America battled in Iraq. Back then, stocks soared and gold collapsed.
"A lot of people have the playbook out for the last time this happened, and the pressure has started because they say, `Oh, the war is going to start and I have to sell my gold because the invasion will be successful.`
However, war aside, "the problem is the bubble and the debt problems, and the overcapacity problems, and the consumer being overloaded," he adds.
Fleckenstein gets credit for creating an entire vocabulary of, well, Fleckisms. "Bubbleonians" are those who believe in a perpetual bull market. "Dipsters" buy mindlessly on dips.
"While we are all focused on the war,` says Fleckenstein, "most people figure, `Well, why do we need gold anyway, especially if the U.S. is going to win.` "
Fleckenstein has two toes in the precious metals market. He is a director of Pan American Silver . He also owns shares of Newmont Mining the world`s largest gold producer.
In his view, gold will replace the world`s major currencies as central banks cheapen the value of their paper assets by borrowing, printing or buying securities that inflate their economies.
"The mania that we had in the 1990s that expressed itself was an expression of complete and total confidence in things that are paper," he says. "That pendulum has swung as far as it could when gold was $800 an ounce (more than 20 years ago). That pendulum will swing back the other direction as the world looks around for a place or a store of value."
Fleckenstein says he is not a gold "bug," someone who rabidly supports the metal or believes dark forces, like central banks, are conspiring to keep gold`s price in the dumper.
"People will own gold because it is the only currency that is no one else`s liability," he says. "I really thought the loss of extreme confidence in paper would tend to push people to own some sort of hard asset in their portfolio. After all, there are no real currencies left. The euro has a lot of issues, and so do the dollar and the yen. All of these countries are willing to debase their currencies."
Like many market watchers, Fleckenstein expects some kind of huge paper rally surrounding war developments. (He says he`s shorting just one stock right now, but I neglected to ask him which one.)
(!!!]
I suspect the paper market will have a big rally on the war, but I don`t know if it will last five minutes or 90 days.
!!!
Once we get past that, we start to look at the problems of debt ($31 trillion in all sectors of the American economy, or almost three times gross domestic product), none of these currencies are worth a damn thing. Why any foreigner would want to own dollars right now, I don`t know."
Fleckenstein says investors want to see "the war stuff moving ahead, so we can see what everything looks like in a post-war environment. If they get Saddam out peacefully, the party will be that much bigger."
Will gold rally? Possibly, says Fleckenstein, gold will gain in these highly irrational markets even as the dollar makes up for lost ground (such as on Thursday morning).
That view runs against the traditional wisdom that says gold rises when the dollar falls. "But hey, gold was falling as the dollar fell. I think gold could dig in and go up in dollar terms even if the dollar rallies," he says.
If that happens, gold in other currencies would rise even more than dollar-linked gold -- a sure sign the metal`s rally is back on track.
More on the dollar
Barbara Rockefeller, a longtime currency analyst and director of Rockefeller Treasury Services, says the dollar`s sharp rally late Wednesday and into Thursday is part of a "no-war scenario." Currency traders in Japan latched onto speculation that Iraq "had experienced a coup against Saddam Hussein." Rockefeller, whose daily views of the currency market are concise and opinionated, "shows that the market is willing to rally on the actual commencement of war, since we know the outcome of the initial military thrust: the U.S. will win the first phase, no matter how you define victory."
Still, most investors should not rush to buy the dollar, or dollar-linked assets, she says. The dollar rally "is fragile and doesn`t really have a solid base. This is not for the faint of heart or the undercapitalized. Long run, we think it won`t last, anyway." See Rockefeller Treasury Services for more.
Writer sees further gains for China-gold connection
Brien Lundin is the gold analyst, newsletter writer and financier who has staked his reputation on a small Canadian company that is enjoying success in the far reaches of China. Lundin, editor of 30-year-old Gold Newsletter, has been examining mineralization reports from Southwestern Resources, which is exploring Yunnan Province. The Toronto-traded company`s shares have more than quadrupled since Lundin began recommending the company last year.
Fresh back from this week`s big Prospectors & Developers Association of Canada gold conference, Lundin says the China gold connection is getting respect among the hard-nosed, grizzled geologists who follow bullion exploration companies.
"One thing that seems apparent is that Southwestern Gold`s next few holes will knock the market`s socks off," Lundin tells me Thursday from his Louisiana headquarters. "I think an area play will develop."
Lundin says he intends to recommend shares of one recently reorganized company that is active in the same area as Southwestern Gold. As for gold overall, he says most analysts in Toronto are drumming their fingers, waiting for further dollar weakness to send investors into bullion. "There`s lots of enthusiasm, despite the pull-back in gold and the shares," he says.
CBS MarketWatch 13.03.2003

Beware of bubbleonians and dipsters
Fund manager Fleckenstein looks beyond gold`s decline
It`s no wonder they call William Fleckenstein a contrarian`s contrarian.
The money manager and frequent commentator, known as a global bear for much of his investing career, isn`t shorting the whole stock market right now. Yet he still believes stocks are headed for a heap of trouble, and Fleckenstein, president of Fleckenstein Capital in the Seattle area, likes prospects for gold, a metal whose spot price is sliding even as you read this article.
Next month, Fleckenstein will go one step further by speaking before the hungry gold crowd at the annual Las Vegas Precious Metals Conference. The hedge fund manager, probably one of America`s best-known short-sellers of stocks, is more than a little surprised at the thumping that gold is taking right now.
Gold in the spot market was down $10.50 to $335 an ounce Thursday morning in New York, a level more than 13 percent below the almost $390 the metal enjoyed earlier this year. Coming on the heels of a dismal past few weeks for the metal, that drop went hand in hand with a Thursday dollar rally.
Fleckenstein, a long-haired and successful hedge-fund manager, has a theory about all this :
"The gold market has gotten caught up in the geopolitical backdrop," he says. "I had this notion that the selling of gold that was going to take place when the war started has already started."
He figures most investors are mindlessly retracing the steps the markets took back in 1991, the first time America battled in Iraq. Back then, stocks soared and gold collapsed.
"A lot of people have the playbook out for the last time this happened, and the pressure has started because they say, `Oh, the war is going to start and I have to sell my gold because the invasion will be successful.`
However, war aside, "the problem is the bubble and the debt problems, and the overcapacity problems, and the consumer being overloaded," he adds.
Fleckenstein gets credit for creating an entire vocabulary of, well, Fleckisms. "Bubbleonians" are those who believe in a perpetual bull market. "Dipsters" buy mindlessly on dips.
"While we are all focused on the war,` says Fleckenstein, "most people figure, `Well, why do we need gold anyway, especially if the U.S. is going to win.` "
Fleckenstein has two toes in the precious metals market. He is a director of Pan American Silver . He also owns shares of Newmont Mining the world`s largest gold producer.
In his view, gold will replace the world`s major currencies as central banks cheapen the value of their paper assets by borrowing, printing or buying securities that inflate their economies.
"The mania that we had in the 1990s that expressed itself was an expression of complete and total confidence in things that are paper," he says. "That pendulum has swung as far as it could when gold was $800 an ounce (more than 20 years ago). That pendulum will swing back the other direction as the world looks around for a place or a store of value."
Fleckenstein says he is not a gold "bug," someone who rabidly supports the metal or believes dark forces, like central banks, are conspiring to keep gold`s price in the dumper.
"People will own gold because it is the only currency that is no one else`s liability," he says. "I really thought the loss of extreme confidence in paper would tend to push people to own some sort of hard asset in their portfolio. After all, there are no real currencies left. The euro has a lot of issues, and so do the dollar and the yen. All of these countries are willing to debase their currencies."
Like many market watchers, Fleckenstein expects some kind of huge paper rally surrounding war developments. (He says he`s shorting just one stock right now, but I neglected to ask him which one.)
(!!!]
I suspect the paper market will have a big rally on the war, but I don`t know if it will last five minutes or 90 days.
!!!
Once we get past that, we start to look at the problems of debt ($31 trillion in all sectors of the American economy, or almost three times gross domestic product), none of these currencies are worth a damn thing. Why any foreigner would want to own dollars right now, I don`t know."
Fleckenstein says investors want to see "the war stuff moving ahead, so we can see what everything looks like in a post-war environment. If they get Saddam out peacefully, the party will be that much bigger."
Will gold rally? Possibly, says Fleckenstein, gold will gain in these highly irrational markets even as the dollar makes up for lost ground (such as on Thursday morning).
That view runs against the traditional wisdom that says gold rises when the dollar falls. "But hey, gold was falling as the dollar fell. I think gold could dig in and go up in dollar terms even if the dollar rallies," he says.
If that happens, gold in other currencies would rise even more than dollar-linked gold -- a sure sign the metal`s rally is back on track.
More on the dollar
Barbara Rockefeller, a longtime currency analyst and director of Rockefeller Treasury Services, says the dollar`s sharp rally late Wednesday and into Thursday is part of a "no-war scenario." Currency traders in Japan latched onto speculation that Iraq "had experienced a coup against Saddam Hussein." Rockefeller, whose daily views of the currency market are concise and opinionated, "shows that the market is willing to rally on the actual commencement of war, since we know the outcome of the initial military thrust: the U.S. will win the first phase, no matter how you define victory."
Still, most investors should not rush to buy the dollar, or dollar-linked assets, she says. The dollar rally "is fragile and doesn`t really have a solid base. This is not for the faint of heart or the undercapitalized. Long run, we think it won`t last, anyway." See Rockefeller Treasury Services for more.
Writer sees further gains for China-gold connection
Brien Lundin is the gold analyst, newsletter writer and financier who has staked his reputation on a small Canadian company that is enjoying success in the far reaches of China. Lundin, editor of 30-year-old Gold Newsletter, has been examining mineralization reports from Southwestern Resources, which is exploring Yunnan Province. The Toronto-traded company`s shares have more than quadrupled since Lundin began recommending the company last year.
Fresh back from this week`s big Prospectors & Developers Association of Canada gold conference, Lundin says the China gold connection is getting respect among the hard-nosed, grizzled geologists who follow bullion exploration companies.
"One thing that seems apparent is that Southwestern Gold`s next few holes will knock the market`s socks off," Lundin tells me Thursday from his Louisiana headquarters. "I think an area play will develop."
Lundin says he intends to recommend shares of one recently reorganized company that is active in the same area as Southwestern Gold. As for gold overall, he says most analysts in Toronto are drumming their fingers, waiting for further dollar weakness to send investors into bullion. "There`s lots of enthusiasm, despite the pull-back in gold and the shares," he says.
CBS MarketWatch 13.03.2003
.
"Demokratie killt Diplomatie"
Daniel Cohn-Bendit, Europa-Visionär der Grünen, und Robert Kagan, Vordenker der US-Außenpolitik, über Krieg und Frieden und darüber, warum Amerikaner vom Mars kommen und Europäer von der Venus
SPIEGEL: Mr. Kagan, Herr Cohn-Bendit, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war die Kluft zwischen den USA und Europa so tief wie heute. Was sind die Gründe dafür?
Cohn-Bendit: Die Amerikaner haben eine Weltsicht, die ich demokratisch-bolschewistisch nennen würde: "Wir müssen die Welt verändern, und die Geschichte wird allen zeigen, dass wir Recht haben." Freiheit, multikulturelle Demokratie, Streben nach Glück, Kapitalismus - wenn diese Prinzipien überall auf der Welt gelten würden, so denkt George W. Bush, denken die Amerikaner, gäbe es keine totalitäre Versuchung, also weniger Konflikte. Europäer verstehen nach dieser Sichtweise nichts von der Welt und von der Geschichte - sie sind ängstlich.
Kagan: Ihr Bolschewismus-Argument klingt ja ganz nett, aber es führt in die Irre. Ja, die Kluft ist so groß wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Konflikt hat sich jetzt an der Irak-Frage entzündet und an der Frage, wie unterschiedlich man sich bedroht fühlt vom Terrorismus: Die Europäer haben jahrzehntelang die RAF ertragen, und sie ertragen immer noch die IRA und die Eta. Die Amerikaner sagen: Ihr habt keine Ahnung vom neuen Terrorismus, der uns am 11. September 2001 ereilte. Euer Terrorismus, das sind Autobomben und explodierende Supermärkte, für uns aber sind es einstürzende Wolkenkratzer und 3000 Tote. In Washington sind Raketenabwehrstellungen aufgebaut worden. Supermärkte machen Riesenumsätze mit Isolierband und Plastikfolien, weil die Leute sich vor Giftgas schützen wollen.
SPIEGEL: Wer hat Recht?
Kagan: Auf jeden Fall können die Europäer nicht einfach sagen: Wir sind normal, und die Amerikaner spinnen. Genau das aber ist derzeit die europäische Perspektive.
Cohn-Bendit: Und die Amerikaner sagen: Die Europäer spinnen. Beides ist falsch.
Kagan: Oder richtig. Amerika und Europa haben einen völlig anderen Blick auf diesen Konflikt - und das aus jeweils sehr nachvollziehbaren Gründen.
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, warum sind Sie gegen den Irak-Krieg?
Cohn-Bendit: Weil der Krieg gegen den Terrorismus in und außerhalb Afghanistans längst nicht abgeschlossen ist. Es gibt keine Beweise für eine Verbindung der Terroristen zum Irak. Die US-Regierung hat die Entscheidung zum Angriff unmittelbar nach dem 11. September gefällt. Und sie hat ihren Strategiewechsel nicht mit den europäischen Partnern diskutiert.
Kagan: Genau das ist einer der wesentlichen Irrtümer vieler Europäer. Es ist nicht wahr, dass die Haltung der USA gegenüber dem Irak das Ergebnis einer neokonservativen Verschwörung ist, die die Anschläge vom 11. September instrumentalisiert. Madeleine Albright hat schon 1997 vorgeschlagen, Saddam Hussein zu entfernen. 1998 hat Präsident Clinton den Irak vier Tage lang heftig bombardiert, ohne Uno-Resolution. Es geht nicht darum, dass ein paar Leute angeblich die ganze Welt manipulieren. Derzeit sind mindestens vier demokratische Präsidentschaftskandidaten für einen Angriff.
Cohn-Bendit: Das Wort "Verschwörung" habe ich nicht benutzt.
Kagan: Aber gemeint haben Sie es.
Cohn-Bendit: Nein. Ich war 1991 dafür, dass die Amerikaner Bagdad einnehmen. Ich war für eine Koalition gegen den Terror. Ich bin, wie man weiß, kein prinzipieller Pazifist. Aber manchmal muss man leider mit Diktatoren verhandeln. Die USA haben Saddam Hussein lange unterstützt, Donald Rumsfeld hat ihm sogar schon einmal die Hand gegeben.
Kagan: Zugegeben, das war kein großer Moment der amerikanischen Geschichte. Vielleicht liegen wir gar nicht so weit auseinander. Vielleicht geht es bei der Irak-Frage nur ums Timing und Prioritäten.
Cohn-Bendit: Das glaube ich nicht. Es geht um die Frage, ob Krieg ein normales Instrument der Außenpolitik wird. Es geht darum, ob eine unilaterale präventive Interventionspolitik die Welt von morgen wirklich sicherer und gerechter macht.
SPIEGEL: Herr Kagan, Sie haben geschrieben, dass Amerikaner vom Mars kommen und Europa von der Venus. Kommt auch Herr Cohn-Bendit von der Venus?
Kagan: Seine Haltung jedenfalls ist typisch europäisch. Die Europäer leben in der Illusion, dass man internationale Politik machen kann ohne Militär und Macht. Aber schon im Kosovo brauchten sie die USA und deren Know-how, um den Völkermord zu stoppen.
Cohn-Bendit: In diesem Fall haben Sie Recht: Wir Europäer hatten weder den politischen Mumm noch die militärische Macht. Es hat mich auch zutiefst beschämt, dass wir in Bosnien den vergewaltigten Frauen und erniedrigten Männern nicht helfen konnten oder wollten.
SPIEGEL: Herr Kagan, warum ist die Haltung Europas zu militärischer Macht so kompliziert?
Kagan: Jemand, der im Wald auf einen Bären trifft und nur ein Messer dabeihat, handelt anders als jemand, der ein Gewehr in der Hand hält. Der mit dem Gewehr fühlt sich stark und wird schießen, der andere weglaufen. Europa ist schwach, seine Haltung geprägt von historischen Erfahrungen: von den unseligen Kriegen und von dem Gefühl der Sorglosigkeit im Kalten Krieg, als die Amerikaner Europas Sicherheit garantierten. Nun, nach dem Ende des Kalten Krieges, glaubt es, sämtliche Konflikte mit einer Art posthistorischer, multilateraler Verhandlungspolitik lösen zu können.
SPIEGEL: Was ist die amerikanische Art?
Kagan: Amerika übt Macht aus in einer Hobbesschen Welt, in der jeder gegen jeden kämpft und auf internationale Regelungen und Völkerrecht kein Verlass ist.
SPIEGEL: Wird Europa jede Bedeutung verlieren, wenn es seine Politik fortsetzt?
Kagan: Möglicherweise. Europa streitet sich lieber über Fragen, wo welcher Käse hergestellt werden soll. Es tut so, als würde es keine Gewehrkugeln mehr geben.
Cohn-Bendit: Das nenne ich Fortschritt, ja, eine ungeheure zivilisatorische Leistung.
Kagan: Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich lebe sehr gerne in Brüssel. Europa ist heute eine Art posthistorisches Paradies, in dem Kriege unvorstellbar sind. Es hat eine Art Ideologie entwickelt, die keinen Wert mehr auf militärische Stärke legt. Das ist nachvollziehbar und doch problematisch: Wenn Europa als Weltmacht auftreten will, braucht es militärische Stärke.
Cohn-Bendit: Europa ist nun mal eine Art Kollektiv. Es hat eine Vorstellung von Solidarität und scheut sich gleichzeitig, Verantwortung zu übernehmen. Amerika dagegen hat einen neoliberalen Blick auf die Welt. Amerika macht nur das, was es will. Es ist ein sehr moralisches und generöses Land, es ist aber auch egoistisch und brutal. Es sagt: Wir sind stark und können und müssen allein die Welt neu ordnen.
Kagan: Richtig. Und dieser Unterschied zeigt sich jetzt im Irak-Konflikt wie nie zuvor. Natürlich wird es nach der Ablösung Husseins Probleme geben, und ich bin ganz bestimmt nicht derjenige, der sagt: eins, zwei, drei, kein Problem, Demokratie im Irak und dann im Rest der arabischen Welt. Das wäre dumm. Ich weiß um das Risiko, aber die Gefahr, nichts zu tun, wäre größer.
Cohn-Bendit: Mich überrascht immer wieder die Hybris der Amerikaner. Diese Haltung: Das werden wir schon schaffen. Ihr Buch, Herr Kagan, ist voll davon. Aber gerade der US-Rückzug aus Afghanistan, um den Einmarsch in den Irak zu ermöglichen, zeigt, wie gefährlich diese Strategie ist.
Kagan: Es war auch Hybris zu glauben, dass man im Zweiten Weltkrieg gleichzeitig in Europa Deutschland besiegt und in Asien Japan. Es war erst recht Hybris, zu glauben, dass man in Japan aus einer kaiserlichen Diktatur so etwas wie Demokratie machen kann und in Europa nach Jahrhunderten der Kriege einen stabilen Frieden herstellt.
Cohn-Bendit: Aber in Europa hatte man es mit zivilen Gesellschaften zu tun, die nach der Befreiung selbst den Aufbau ihrer Demokratien in die Hand nahmen.
Kagan: Das stimmt.
Cohn-Bendit: Außerdem geht es Amerika nicht nur um Moral und Demokratie. Anders als in Bosnien haben die USA im Irak ein sehr großes Eigeninteresse. Moral und Interessen haben manchmal sehr viel miteinander zu tun.
Kagan: Was ist so schlimm daran, beides zu haben?
Cohn-Bendit: Es wäre vielleicht sinnvoll, diese Position auch öffentlich zu vertreten. Ich würde mir übrigens auch wünschen, dass Europa etwas ehrlicher wäre: Wenn Millionen von Menschen auf die Straßen gehen und rufen, Kein Krieg für Öl, dann muss man ihnen sagen: Okay, also müssen unsere Gesellschaften weniger Öl verbrauchen, weil auch wir abhängig sind.
Kagan: Aber in der Minute, in der Bush den Angriff auf den Irak absagte, würde Europa zu dem Thema zurückkehren, das es am meisten interessiert: Europa.
SPIEGEL: Was hätte im Irak geschehen müssen?
Cohn-Bendit: Dass Saddam durch die Inspektoren entwaffnet wird. Dass die Uno die Verwaltung des Oil-for-Food-Programms übernimmt, um die Abhängigkeit des irakischen Volks von Saddam zu lösen, gesichert durch Truppen außerhalb des Landes.
Kagan: Mit wie viel Soldaten? 100 000? 200 000?
Cohn-Bendit: Ich will jetzt nicht General spielen. Aber warum nicht mit genauso viel Soldaten, wie sie auch nach der Eroberung von Bagdad nötig wären.
Kagan: Und falls Saddam Nein sagt?
Cohn-Bendit: Da kann ich nur in der guten alten europäischen Logik antworten: Alles eine Frage der Zeit.
Kagan: Sie würden ihn so lange fragen, bis er Ja sagt? Das würde er nie tun. Und dann wären Sie da, wo wir jetzt schon sind.
Cohn-Bendit: Vielleicht. Aber, um eines Ihrer Lieblingswörter zu benutzen: Dieses Risiko würde ich eingehen.
Kagan: Das würde Jahre dauern. Sehr kompliziert, sehr teuer.
Cohn-Bendit: Ein Krieg und die Besetzung sind weiß Gott nicht billiger.
Kagan: Was ist dran an diesem Mann, dass Sie sich all diese Probleme schaffen, anstatt reinzugehen und ihn zu holen?
Cohn-Bendit: Viele Zivilisten werden sterben.
Kagan: Die sind auch im Kosovo gestorben.
Cohn-Bendit: Der Unterschied war, dass wir es damals mit einem aggressiv-expansiven Regime zu tun hatten.
Kagan: Saddam Hussein hat Iran und Kuweit überfallen, Kurden im Nordirak getötet. Das alles ist mehr als zehn Jahre her - sollten wir ihn deswegen jetzt vom Haken lassen?
SPIEGEL: Glauben Sie, Mr. Kagan, dass Europa inzwischen mehr Angst hat vor Bush als vor Saddam?
Kagan: Europa hat keine Angst vor Saddam, und es kann auch Amerikas Furcht nicht nachvollziehen. Die Europäer treten auf wie Missionare einer posthistorischeneuropäischen Weltordnung, und sie empfinden die Amerikaner als größte Bedrohung dieses Ansatzes. Saddam mag eine Bedrohung für andere Teile der Welt sein, aber keine Gefahr für die europäische Vision.
Cohn-Bendit: Die Bedrohung Europas liegt darin, dass uns nur noch übrig bleibt, Ja und Amen zu dem zu sagen, was die Amerikaner wollen. Darauf haben die Europäer keine Lust mehr. Denken Sie an Kyoto oder an die Ausnahmestellung der USA am Internationalen Strafgerichtshof. Amerikaner scheinen nur noch Amerikanern Rechenschaft schuldig zu sein.
Kagan: Europa wird lernen müssen, mit dieser Realität umzugehen, und es kann sich dabei klug anstellen oder dumm. Im Umgang mit den Vereinigten Staaten aber merkt man nichts vom diplomatischen Geschick der Europäer. Wenn sie den Eindruck haben, dass die Amerikaner diesem internationalen Rechtssystem nicht trauen, dann muss man es einem leichter machen, sich mit dieser Sache anzufreunden.
Cohn-Bendit: Der große Irrtum Ihrer schlauen Politik besteht darin zu glauben, dass eine demokratische Regierung auf die Dauer eine solche Politik gegen das eigene Volk durchsetzen kann. Millionen von Menschen waren auf der Straße aus Protest gegen den Krieg.
Kagan: Da stimme ich zu. In diesem Fall gilt: Demokratie killt Diplomatie.
Cohn-Bendit: Politiker könnten nur dann gegen Mehrheiten handeln, wenn sie ganz von der Notwendigkeit überzeugt sind. Die deutsche Regierung hat in den vergangenen fünf Jahren dieses Land am Krieg im Kosovo und in Afghanistan teilnehmen lassen, weil sie überzeugt davon war, dass Deutschland Verantwortung übernehmen und nicht nur verantwortlich zahlen muss. Die USA müssen nun begreifen, dass die Bevölkerung hier Zeit braucht, um zu verstehen, welche Veränderungen notwendig sind, um Verantwortung zu übernehmen.
Kagan: Okay, dann haben wir es mit einer klassischen Tragödie zu tun. Beide Seiten können zurzeit nicht anders handeln, und beide haben das Gefühl, vollkommen im Recht zu sein. Amerika ist berühmt für seine Selbstgerechtigkeit, aber hier in Europa scheint das nicht anders zu sein. Es geht nicht darum, uns über den Atlantik gegenseitig anzuschreien, wie schrecklich und unmoralisch die anderen sind oder wie schwach und feige. Ich glaube, der Riss ist echt und bedeutsam.
SPIEGEL: Liegt der tiefere Grund für den Dissens darin, dass die USA immer noch versuchen, ihre Macht auszuweiten?
Kagan: Ja. Genau genommen ist dies unsere Politik seit 400 Jahren, als wir noch ein paar kleine Kolonien waren, die sich an der Atlantikküste festhielten.
Cohn-Bendit: Zum Guten oder Schlechten?
Kagan: Diese Wahl hat man nur selten. Man muss sich den Realitäten stellen. Eine internationale Ordnung kann aus amerikanischer Sicht nur ein Zentrum haben: die USA und nicht den Uno-Sicherheitsrat.
Cohn-Bendit: Mit der Ideologie konnten die USA Allende stürzen, den Vietnam-Krieg führen und viele tödliche Fehler machen.
Kagan: Das ist menschlich. Wenn man einen schönen, großen Hammer hat, sieht man plötzlich überall nur Nägel. Und manchmal haut man sich selbst auf den Daumen. Anders als Europa weiß Amerika, was es will. Europa muss sich fragen, was es heute ist und was es eines Tages sein will.
Cohn-Bendit: Genau das machen wir gerade. Wir bauen Europa. In einer multipolaren Welt müssen wir mehr Verantwortung übernehmen: für Sicherheit, Konfliktprävention, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung. Die Vereinigten Staaten von Europa.
Kagan: Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber es gibt so etwas wie Meinungsverschiedenheiten unter den europäischen Nationen. Erst wenn Europa echte Macht hat, wird sich Amerika anpassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Europäer eine multipolare Welt auf dem Verordnungsweg herbeiführen wollen.
Cohn-Bendit: Europa ist ein Zauberauto. Es hat zwei Lenkräder, an dem einen sitzt Chirac, am anderen Schröder, und hinten drin sitzen eine Menge Leute, die darüber diskutieren, wohin die beiden fahren sollen. Ich glaube trotzdem an die Vision Europa. Gemessen daran wie kurz erst die ehemaligen Ostblockstaaten souverän sind, haben wir schon einiges geschafft. Dieser Prozess dauert länger als das Leben meiner Generation, und am Ende wird es ein Verbund sein, der sich die Verantwortung mit Amerika und anderen überregionalen Bündnissen teilt.
SPIEGEL: Die Amerikaner scheinen derzeit isoliert zu sein. Versagt die US-Diplomatie?
Kagan: Ohne jeden Zweifel haben die Vereinigten Staaten in diesem Prozess Schwächen gezeigt. Aber niemand konnte voraussehen, dass die Franzosen mit einer ganz neuen Art von Kamikaze-Diplomatie ihre Vision einer internationalen Ordnung aufs Spiel setzen würden. Laut einer Umfrage der "New York Times" sind 58 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass die Uno einen schlechten Job macht. Das sind 10 Prozent mehr als vergangenen Monat.
Cohn-Bendit: Die Amerikaner sind isoliert und isolieren ihre Verbündeten, weil sie autistisch handeln.
SPIEGEL: Wie wird sich das Verhältnis zwischen Europa und Amerika entwickeln, wenn die Irak-Krise vorbei ist?
Kagan: Die Dinge, die uns verbinden - Kultur, Demokratie, liberale Prinzipien -, werden wieder an Wichtigkeit gewinnen. Natürlich braucht Washington mehr Sensibilität im Umgang mit Europa. Umgekehrt muss sich Europa an die Mentalität der Supermacht Amerika anpassen und weniger Zeit damit verbringen, sich ihr entgegenzustellen.
SPIEGEL: Kann es sein, dass die Supermacht Amerika schon so weit ist wie das britische Empire kurz vor dessen Niedergang?
Kagan: Im Jahr 2050 wird der Europäer durchschnittlich Ende vierzig sein. Der Amerikaner zehn Jahre jünger. Normalerweise ist das nicht die Demografie einer Nation, die sich im Niedergang befindet.
Cohn-Bendit: Sagen Sie doch Ihrer neuen Schmusepartnerin Frau Merkel, dass Washington mehr Einwanderung wünscht, um den Niedergang des neuen und alten Europa aufzuhalten.
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, Mr. Kagan, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Neue Welt gegen altes Europa
Robert Kagan, 44, hat 1997 den neokonservativen Think-Tank "Project for the New American Century" ins Leben gerufen. Zu den Unterzeichnern des Gründungsmanifests gehörten Dick Cheney und Donald Rumsfeld. Kagans viel diskutiertes Buch "Macht und Ohnmacht - Amerika und Europa in der neuen Weltordnung" ist im Siedler Verlag erschienen. Daniel Cohn-Bendit, 57, Abgeordneter im Europaparlament in Straßburg, war Anführer der Pariser Studentenrevolte im Mai 1968. Er ist seit 1984 Mitglied der Grünen.
DER SPIEGEL 12/2003
.
"Demokratie killt Diplomatie"
Daniel Cohn-Bendit, Europa-Visionär der Grünen, und Robert Kagan, Vordenker der US-Außenpolitik, über Krieg und Frieden und darüber, warum Amerikaner vom Mars kommen und Europäer von der Venus
SPIEGEL: Mr. Kagan, Herr Cohn-Bendit, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war die Kluft zwischen den USA und Europa so tief wie heute. Was sind die Gründe dafür?
Cohn-Bendit: Die Amerikaner haben eine Weltsicht, die ich demokratisch-bolschewistisch nennen würde: "Wir müssen die Welt verändern, und die Geschichte wird allen zeigen, dass wir Recht haben." Freiheit, multikulturelle Demokratie, Streben nach Glück, Kapitalismus - wenn diese Prinzipien überall auf der Welt gelten würden, so denkt George W. Bush, denken die Amerikaner, gäbe es keine totalitäre Versuchung, also weniger Konflikte. Europäer verstehen nach dieser Sichtweise nichts von der Welt und von der Geschichte - sie sind ängstlich.
Kagan: Ihr Bolschewismus-Argument klingt ja ganz nett, aber es führt in die Irre. Ja, die Kluft ist so groß wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Konflikt hat sich jetzt an der Irak-Frage entzündet und an der Frage, wie unterschiedlich man sich bedroht fühlt vom Terrorismus: Die Europäer haben jahrzehntelang die RAF ertragen, und sie ertragen immer noch die IRA und die Eta. Die Amerikaner sagen: Ihr habt keine Ahnung vom neuen Terrorismus, der uns am 11. September 2001 ereilte. Euer Terrorismus, das sind Autobomben und explodierende Supermärkte, für uns aber sind es einstürzende Wolkenkratzer und 3000 Tote. In Washington sind Raketenabwehrstellungen aufgebaut worden. Supermärkte machen Riesenumsätze mit Isolierband und Plastikfolien, weil die Leute sich vor Giftgas schützen wollen.
SPIEGEL: Wer hat Recht?
Kagan: Auf jeden Fall können die Europäer nicht einfach sagen: Wir sind normal, und die Amerikaner spinnen. Genau das aber ist derzeit die europäische Perspektive.
Cohn-Bendit: Und die Amerikaner sagen: Die Europäer spinnen. Beides ist falsch.
Kagan: Oder richtig. Amerika und Europa haben einen völlig anderen Blick auf diesen Konflikt - und das aus jeweils sehr nachvollziehbaren Gründen.
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, warum sind Sie gegen den Irak-Krieg?
Cohn-Bendit: Weil der Krieg gegen den Terrorismus in und außerhalb Afghanistans längst nicht abgeschlossen ist. Es gibt keine Beweise für eine Verbindung der Terroristen zum Irak. Die US-Regierung hat die Entscheidung zum Angriff unmittelbar nach dem 11. September gefällt. Und sie hat ihren Strategiewechsel nicht mit den europäischen Partnern diskutiert.
Kagan: Genau das ist einer der wesentlichen Irrtümer vieler Europäer. Es ist nicht wahr, dass die Haltung der USA gegenüber dem Irak das Ergebnis einer neokonservativen Verschwörung ist, die die Anschläge vom 11. September instrumentalisiert. Madeleine Albright hat schon 1997 vorgeschlagen, Saddam Hussein zu entfernen. 1998 hat Präsident Clinton den Irak vier Tage lang heftig bombardiert, ohne Uno-Resolution. Es geht nicht darum, dass ein paar Leute angeblich die ganze Welt manipulieren. Derzeit sind mindestens vier demokratische Präsidentschaftskandidaten für einen Angriff.
Cohn-Bendit: Das Wort "Verschwörung" habe ich nicht benutzt.
Kagan: Aber gemeint haben Sie es.
Cohn-Bendit: Nein. Ich war 1991 dafür, dass die Amerikaner Bagdad einnehmen. Ich war für eine Koalition gegen den Terror. Ich bin, wie man weiß, kein prinzipieller Pazifist. Aber manchmal muss man leider mit Diktatoren verhandeln. Die USA haben Saddam Hussein lange unterstützt, Donald Rumsfeld hat ihm sogar schon einmal die Hand gegeben.
Kagan: Zugegeben, das war kein großer Moment der amerikanischen Geschichte. Vielleicht liegen wir gar nicht so weit auseinander. Vielleicht geht es bei der Irak-Frage nur ums Timing und Prioritäten.
Cohn-Bendit: Das glaube ich nicht. Es geht um die Frage, ob Krieg ein normales Instrument der Außenpolitik wird. Es geht darum, ob eine unilaterale präventive Interventionspolitik die Welt von morgen wirklich sicherer und gerechter macht.
SPIEGEL: Herr Kagan, Sie haben geschrieben, dass Amerikaner vom Mars kommen und Europa von der Venus. Kommt auch Herr Cohn-Bendit von der Venus?
Kagan: Seine Haltung jedenfalls ist typisch europäisch. Die Europäer leben in der Illusion, dass man internationale Politik machen kann ohne Militär und Macht. Aber schon im Kosovo brauchten sie die USA und deren Know-how, um den Völkermord zu stoppen.
Cohn-Bendit: In diesem Fall haben Sie Recht: Wir Europäer hatten weder den politischen Mumm noch die militärische Macht. Es hat mich auch zutiefst beschämt, dass wir in Bosnien den vergewaltigten Frauen und erniedrigten Männern nicht helfen konnten oder wollten.
SPIEGEL: Herr Kagan, warum ist die Haltung Europas zu militärischer Macht so kompliziert?
Kagan: Jemand, der im Wald auf einen Bären trifft und nur ein Messer dabeihat, handelt anders als jemand, der ein Gewehr in der Hand hält. Der mit dem Gewehr fühlt sich stark und wird schießen, der andere weglaufen. Europa ist schwach, seine Haltung geprägt von historischen Erfahrungen: von den unseligen Kriegen und von dem Gefühl der Sorglosigkeit im Kalten Krieg, als die Amerikaner Europas Sicherheit garantierten. Nun, nach dem Ende des Kalten Krieges, glaubt es, sämtliche Konflikte mit einer Art posthistorischer, multilateraler Verhandlungspolitik lösen zu können.
SPIEGEL: Was ist die amerikanische Art?
Kagan: Amerika übt Macht aus in einer Hobbesschen Welt, in der jeder gegen jeden kämpft und auf internationale Regelungen und Völkerrecht kein Verlass ist.
SPIEGEL: Wird Europa jede Bedeutung verlieren, wenn es seine Politik fortsetzt?
Kagan: Möglicherweise. Europa streitet sich lieber über Fragen, wo welcher Käse hergestellt werden soll. Es tut so, als würde es keine Gewehrkugeln mehr geben.
Cohn-Bendit: Das nenne ich Fortschritt, ja, eine ungeheure zivilisatorische Leistung.
Kagan: Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich lebe sehr gerne in Brüssel. Europa ist heute eine Art posthistorisches Paradies, in dem Kriege unvorstellbar sind. Es hat eine Art Ideologie entwickelt, die keinen Wert mehr auf militärische Stärke legt. Das ist nachvollziehbar und doch problematisch: Wenn Europa als Weltmacht auftreten will, braucht es militärische Stärke.
Cohn-Bendit: Europa ist nun mal eine Art Kollektiv. Es hat eine Vorstellung von Solidarität und scheut sich gleichzeitig, Verantwortung zu übernehmen. Amerika dagegen hat einen neoliberalen Blick auf die Welt. Amerika macht nur das, was es will. Es ist ein sehr moralisches und generöses Land, es ist aber auch egoistisch und brutal. Es sagt: Wir sind stark und können und müssen allein die Welt neu ordnen.
Kagan: Richtig. Und dieser Unterschied zeigt sich jetzt im Irak-Konflikt wie nie zuvor. Natürlich wird es nach der Ablösung Husseins Probleme geben, und ich bin ganz bestimmt nicht derjenige, der sagt: eins, zwei, drei, kein Problem, Demokratie im Irak und dann im Rest der arabischen Welt. Das wäre dumm. Ich weiß um das Risiko, aber die Gefahr, nichts zu tun, wäre größer.
Cohn-Bendit: Mich überrascht immer wieder die Hybris der Amerikaner. Diese Haltung: Das werden wir schon schaffen. Ihr Buch, Herr Kagan, ist voll davon. Aber gerade der US-Rückzug aus Afghanistan, um den Einmarsch in den Irak zu ermöglichen, zeigt, wie gefährlich diese Strategie ist.
Kagan: Es war auch Hybris zu glauben, dass man im Zweiten Weltkrieg gleichzeitig in Europa Deutschland besiegt und in Asien Japan. Es war erst recht Hybris, zu glauben, dass man in Japan aus einer kaiserlichen Diktatur so etwas wie Demokratie machen kann und in Europa nach Jahrhunderten der Kriege einen stabilen Frieden herstellt.
Cohn-Bendit: Aber in Europa hatte man es mit zivilen Gesellschaften zu tun, die nach der Befreiung selbst den Aufbau ihrer Demokratien in die Hand nahmen.
Kagan: Das stimmt.
Cohn-Bendit: Außerdem geht es Amerika nicht nur um Moral und Demokratie. Anders als in Bosnien haben die USA im Irak ein sehr großes Eigeninteresse. Moral und Interessen haben manchmal sehr viel miteinander zu tun.
Kagan: Was ist so schlimm daran, beides zu haben?
Cohn-Bendit: Es wäre vielleicht sinnvoll, diese Position auch öffentlich zu vertreten. Ich würde mir übrigens auch wünschen, dass Europa etwas ehrlicher wäre: Wenn Millionen von Menschen auf die Straßen gehen und rufen, Kein Krieg für Öl, dann muss man ihnen sagen: Okay, also müssen unsere Gesellschaften weniger Öl verbrauchen, weil auch wir abhängig sind.
Kagan: Aber in der Minute, in der Bush den Angriff auf den Irak absagte, würde Europa zu dem Thema zurückkehren, das es am meisten interessiert: Europa.
SPIEGEL: Was hätte im Irak geschehen müssen?
Cohn-Bendit: Dass Saddam durch die Inspektoren entwaffnet wird. Dass die Uno die Verwaltung des Oil-for-Food-Programms übernimmt, um die Abhängigkeit des irakischen Volks von Saddam zu lösen, gesichert durch Truppen außerhalb des Landes.
Kagan: Mit wie viel Soldaten? 100 000? 200 000?
Cohn-Bendit: Ich will jetzt nicht General spielen. Aber warum nicht mit genauso viel Soldaten, wie sie auch nach der Eroberung von Bagdad nötig wären.
Kagan: Und falls Saddam Nein sagt?
Cohn-Bendit: Da kann ich nur in der guten alten europäischen Logik antworten: Alles eine Frage der Zeit.
Kagan: Sie würden ihn so lange fragen, bis er Ja sagt? Das würde er nie tun. Und dann wären Sie da, wo wir jetzt schon sind.
Cohn-Bendit: Vielleicht. Aber, um eines Ihrer Lieblingswörter zu benutzen: Dieses Risiko würde ich eingehen.
Kagan: Das würde Jahre dauern. Sehr kompliziert, sehr teuer.
Cohn-Bendit: Ein Krieg und die Besetzung sind weiß Gott nicht billiger.
Kagan: Was ist dran an diesem Mann, dass Sie sich all diese Probleme schaffen, anstatt reinzugehen und ihn zu holen?
Cohn-Bendit: Viele Zivilisten werden sterben.
Kagan: Die sind auch im Kosovo gestorben.
Cohn-Bendit: Der Unterschied war, dass wir es damals mit einem aggressiv-expansiven Regime zu tun hatten.
Kagan: Saddam Hussein hat Iran und Kuweit überfallen, Kurden im Nordirak getötet. Das alles ist mehr als zehn Jahre her - sollten wir ihn deswegen jetzt vom Haken lassen?
SPIEGEL: Glauben Sie, Mr. Kagan, dass Europa inzwischen mehr Angst hat vor Bush als vor Saddam?
Kagan: Europa hat keine Angst vor Saddam, und es kann auch Amerikas Furcht nicht nachvollziehen. Die Europäer treten auf wie Missionare einer posthistorischeneuropäischen Weltordnung, und sie empfinden die Amerikaner als größte Bedrohung dieses Ansatzes. Saddam mag eine Bedrohung für andere Teile der Welt sein, aber keine Gefahr für die europäische Vision.
Cohn-Bendit: Die Bedrohung Europas liegt darin, dass uns nur noch übrig bleibt, Ja und Amen zu dem zu sagen, was die Amerikaner wollen. Darauf haben die Europäer keine Lust mehr. Denken Sie an Kyoto oder an die Ausnahmestellung der USA am Internationalen Strafgerichtshof. Amerikaner scheinen nur noch Amerikanern Rechenschaft schuldig zu sein.
Kagan: Europa wird lernen müssen, mit dieser Realität umzugehen, und es kann sich dabei klug anstellen oder dumm. Im Umgang mit den Vereinigten Staaten aber merkt man nichts vom diplomatischen Geschick der Europäer. Wenn sie den Eindruck haben, dass die Amerikaner diesem internationalen Rechtssystem nicht trauen, dann muss man es einem leichter machen, sich mit dieser Sache anzufreunden.
Cohn-Bendit: Der große Irrtum Ihrer schlauen Politik besteht darin zu glauben, dass eine demokratische Regierung auf die Dauer eine solche Politik gegen das eigene Volk durchsetzen kann. Millionen von Menschen waren auf der Straße aus Protest gegen den Krieg.
Kagan: Da stimme ich zu. In diesem Fall gilt: Demokratie killt Diplomatie.
Cohn-Bendit: Politiker könnten nur dann gegen Mehrheiten handeln, wenn sie ganz von der Notwendigkeit überzeugt sind. Die deutsche Regierung hat in den vergangenen fünf Jahren dieses Land am Krieg im Kosovo und in Afghanistan teilnehmen lassen, weil sie überzeugt davon war, dass Deutschland Verantwortung übernehmen und nicht nur verantwortlich zahlen muss. Die USA müssen nun begreifen, dass die Bevölkerung hier Zeit braucht, um zu verstehen, welche Veränderungen notwendig sind, um Verantwortung zu übernehmen.
Kagan: Okay, dann haben wir es mit einer klassischen Tragödie zu tun. Beide Seiten können zurzeit nicht anders handeln, und beide haben das Gefühl, vollkommen im Recht zu sein. Amerika ist berühmt für seine Selbstgerechtigkeit, aber hier in Europa scheint das nicht anders zu sein. Es geht nicht darum, uns über den Atlantik gegenseitig anzuschreien, wie schrecklich und unmoralisch die anderen sind oder wie schwach und feige. Ich glaube, der Riss ist echt und bedeutsam.
SPIEGEL: Liegt der tiefere Grund für den Dissens darin, dass die USA immer noch versuchen, ihre Macht auszuweiten?
Kagan: Ja. Genau genommen ist dies unsere Politik seit 400 Jahren, als wir noch ein paar kleine Kolonien waren, die sich an der Atlantikküste festhielten.
Cohn-Bendit: Zum Guten oder Schlechten?
Kagan: Diese Wahl hat man nur selten. Man muss sich den Realitäten stellen. Eine internationale Ordnung kann aus amerikanischer Sicht nur ein Zentrum haben: die USA und nicht den Uno-Sicherheitsrat.
Cohn-Bendit: Mit der Ideologie konnten die USA Allende stürzen, den Vietnam-Krieg führen und viele tödliche Fehler machen.
Kagan: Das ist menschlich. Wenn man einen schönen, großen Hammer hat, sieht man plötzlich überall nur Nägel. Und manchmal haut man sich selbst auf den Daumen. Anders als Europa weiß Amerika, was es will. Europa muss sich fragen, was es heute ist und was es eines Tages sein will.
Cohn-Bendit: Genau das machen wir gerade. Wir bauen Europa. In einer multipolaren Welt müssen wir mehr Verantwortung übernehmen: für Sicherheit, Konfliktprävention, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwortung. Die Vereinigten Staaten von Europa.
Kagan: Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber es gibt so etwas wie Meinungsverschiedenheiten unter den europäischen Nationen. Erst wenn Europa echte Macht hat, wird sich Amerika anpassen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Europäer eine multipolare Welt auf dem Verordnungsweg herbeiführen wollen.
Cohn-Bendit: Europa ist ein Zauberauto. Es hat zwei Lenkräder, an dem einen sitzt Chirac, am anderen Schröder, und hinten drin sitzen eine Menge Leute, die darüber diskutieren, wohin die beiden fahren sollen. Ich glaube trotzdem an die Vision Europa. Gemessen daran wie kurz erst die ehemaligen Ostblockstaaten souverän sind, haben wir schon einiges geschafft. Dieser Prozess dauert länger als das Leben meiner Generation, und am Ende wird es ein Verbund sein, der sich die Verantwortung mit Amerika und anderen überregionalen Bündnissen teilt.
SPIEGEL: Die Amerikaner scheinen derzeit isoliert zu sein. Versagt die US-Diplomatie?
Kagan: Ohne jeden Zweifel haben die Vereinigten Staaten in diesem Prozess Schwächen gezeigt. Aber niemand konnte voraussehen, dass die Franzosen mit einer ganz neuen Art von Kamikaze-Diplomatie ihre Vision einer internationalen Ordnung aufs Spiel setzen würden. Laut einer Umfrage der "New York Times" sind 58 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass die Uno einen schlechten Job macht. Das sind 10 Prozent mehr als vergangenen Monat.
Cohn-Bendit: Die Amerikaner sind isoliert und isolieren ihre Verbündeten, weil sie autistisch handeln.
SPIEGEL: Wie wird sich das Verhältnis zwischen Europa und Amerika entwickeln, wenn die Irak-Krise vorbei ist?
Kagan: Die Dinge, die uns verbinden - Kultur, Demokratie, liberale Prinzipien -, werden wieder an Wichtigkeit gewinnen. Natürlich braucht Washington mehr Sensibilität im Umgang mit Europa. Umgekehrt muss sich Europa an die Mentalität der Supermacht Amerika anpassen und weniger Zeit damit verbringen, sich ihr entgegenzustellen.
SPIEGEL: Kann es sein, dass die Supermacht Amerika schon so weit ist wie das britische Empire kurz vor dessen Niedergang?
Kagan: Im Jahr 2050 wird der Europäer durchschnittlich Ende vierzig sein. Der Amerikaner zehn Jahre jünger. Normalerweise ist das nicht die Demografie einer Nation, die sich im Niedergang befindet.
Cohn-Bendit: Sagen Sie doch Ihrer neuen Schmusepartnerin Frau Merkel, dass Washington mehr Einwanderung wünscht, um den Niedergang des neuen und alten Europa aufzuhalten.
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, Mr. Kagan, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Neue Welt gegen altes Europa
Robert Kagan, 44, hat 1997 den neokonservativen Think-Tank "Project for the New American Century" ins Leben gerufen. Zu den Unterzeichnern des Gründungsmanifests gehörten Dick Cheney und Donald Rumsfeld. Kagans viel diskutiertes Buch "Macht und Ohnmacht - Amerika und Europa in der neuen Weltordnung" ist im Siedler Verlag erschienen. Daniel Cohn-Bendit, 57, Abgeordneter im Europaparlament in Straßburg, war Anführer der Pariser Studentenrevolte im Mai 1968. Er ist seit 1984 Mitglied der Grünen.
DER SPIEGEL 12/2003
.
.
Nichts für schwache Nerven
Von Harald Grimm und Kai Lange
Der Dax schließt mit knapp vier Prozent im Plus. Hedgefonds dominieren die Szene, sagen Analysten. Die Chancen für eine Erholung bleiben bestehen, doch sei diese "zeitlich sehr begrenzt".
Frankfurt am Main - Die Reaktion der Börse ist zynisch, doch für Marktstrategen erklärbar. Während Menschen in Bagdad Deckung suchen, wagen sich Investoren wieder hervor: "Ein schnelles Ende der Irak-Krise wird die Lähmung der Märkte beseitigen. Die Börse spekuliert bereits jetzt auf eine Erholung nach dem Krieg", sagte ein Händler am Dienstag.
Gegen Mittag hatte der Dax mit rund fünf Prozent Plus auf 2624 Punkte sein Tageshoch erreicht, musste dann aber zwischenzeitlich einen Großteil der Gewinne wieder abgeben. Mit einer festen Wall Street und einer extrem starken Bayer-Aktie ging es am Abend erneut bergauf. Der Dax schloss 3,9 Prozent fester auf 2584 Zählern. Seit Donnerstag hat Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer damit mehr als 17 Prozent gewonnen.
Der Dow Jones verbuchte zu Handelsschluss in Deutschland ein Plus von 0,5 Prozent bei 8179 Punkten. Der Nasdaq Composite pendelte um seinen Vortagesschluss bei 1391 Zählern. Die amerikanische Notenbank hat die Leitzinsen am Dienstag wie erwartet nicht verändert. Der Offenmarktausschuss beschloss, den Satz für Tagesgeld bei 1,25 Prozent zu belassen, dem niedrigsten Stand seit mehr als 40 Jahren.
Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer war um 39 Prozent auf 14,30 Euro in die Höhe geschossen. Das Unternehmen ist im ersten US-Prozess um Gesundheitsschäden durch den Blutfettsenker Lipobay freigesprochen worden. Des weiteren zählten die Aktien des Chemiekonzerns BASF , der am Morgen gute Zahlen vorgelegt hatte, sowie MAN und Henkel zu den größten Gewinnern im Dax.
Siemens schießt 36 Millionen Infineon-Titel auf den Markt
Infineon dagegen, die am Vormittag zu den stärksten Werten gezählt hatten, notierten zu Handelsschluss 10,73 Prozent leichter auf 6,57 Euro. Siemens hat 36 Millionen Infineon-Aktien über die Investmentbank Goldman Sachs am Markt platziert. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Die Beteiligung des Siemens Pension Trust e.V. an Infineon ist damit gleich null", sagte der Sprecher. Siemens halte aber weiterhin Anteile an dem Münchener Halbleiterproduzenten.
Nachdem US-Präsident George W. Bush am Montagabend Saddam Hussein ein Ultimatum gesetzt hatte, binnen 48 Stunden den Irak zu verlassen, hatten die Indizes ihre Klettertour fortgesetzt. Beobachter sprachen von einer vorgezogenen Kriegsrallye, da nun auf einen schnellen Sieg der USA spekuliert werden könne.
"Hedgefonds decken sich ein"
"Derzeit lösen Hedgefonds ihre Short-Positionen auf und decken sich mit Aktien ein, um Gewinne mitzunehmen oder bei steigenden Kurse ihre Verluste zu begrenzen", kommentierte Klaus Lüpertz, Aktienstratege bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, den deutlichen Kursanstieg im Dax.
Die Erholung im Dax sei sehr dynamisch und von großen Volumina getragen: "Da betreiben wohl einige Leerverkäufer Schadensbegrenzung", sagte Lüpertz im Gespräch mit manager-magazin.de.
"Erholung zeitlich begrenzt - sie kann bis 2800 Punkte tragen"
Der Aufschwung könne durchaus noch bis in den Bereich von 2700 oder 2800 Punkten tragen. "Doch wer jetzt bei dieser Erholung mitspielen will, sollte mit engen Stopp-Loss-Marken" arbeiten, empfiehlt der HSBC-Marktstratege. "Die makroökonomischen Daten sehen nach wie vor schlecht aus. Wie lange der Krieg dauern wird, wie es in der Region weitergeht und wie hoch die Kriegskosten ausfallen, ist offen", so Lüpertz.
Die freundliche Kursentwicklung fuße nicht darauf, dass die konjunkturellen Rahmendaten oder die Gewinnsituation der Unternehmen besser geworden sind. "Wir sind noch immer in einem langfristigen Abwärtstrend", warnt Lüpertz. Er rechne daher damit, dass die deutliche Erholung im Dax "zeitlich sehr begrenzt" sein werde.
Krieg drängt andere Probleme in den Hintergrund
"Charttechnisch haben wir noch bis etwa 2750 Punkte Platz. Doch die Luft wird dünner", bekräftigte Oliver Brockhagen, Leiter des Aktienhandels beim Bankhaus Metzler. "Wir sind in den vergangenen drei Tagen sehr schnell und deutlich nach oben gelaufen: Nicht, weil die konjunkturelle Situation Anlass zur Zuversicht gibt, sondern weil Leerverkäufer ihre Positionen geschlossen haben."
Eine solche "short-covered Rallye" könne auch schnell wieder vorbei sein, sagt Brockhagen. Solange aber der Ölpreis und der Bund-Future fallen, hätten die Aktienmärkte Phantasie. Brockhagen erinnerte daran, dass selbst nach einem schnellen Sieg der USA die konjunkturellen Probleme nicht gelöst seien. "Das Thema Krieg dient derzeit dazu, um die anderen Themen zu vergessen", so der Marktstratege. Nach Ende des Krieges würde die schwierige Lage der Weltkonjunktur umso deutlicher zutage treten.
"Das ist mehr als ein Strohfeuer"
Etwas optimistischer ist Fiduka-Depotmanager Felix Schleicher. "Das ist mehr als ein Strohfeuer", sagte der Marktexperte im Gespräch mit mm.de. Der Dax sei immer noch extrem unterbewertet und weise im internationalen Vergleich mit das größte Aufwärtspotenzial auf: "Da darf man nicht von 20 oder 25 Prozent reden, das sind ganz andere Dimensionen."
Zwar seien auf Grund der unsicheren weltpolitischen Lage noch weitere Kursverluste möglich, die Chancen würden im derzeitigen Umfeld die Risiken jedoch überwiegen. Schließlich seien die meisten Szenarien in den Kursen bereits eingepreist: "Terrorattentate, ein Flächenbrand in Nahost oder ein Ölpreis bei 50 Dollar pro Barrel – das wird zum Gutteil schon heute an der Börse gespielt", sagt Schleicher. Die niedrige Erwartungshaltung mache einen weiteren Ausverkauf an der Börse unwahrscheinlich.
Mut zum Risiko
Das derzeitige Marktumfeld bietet nach Ansicht von Schleicher gute Bedingungen zum Einstieg. Wer jetzt Mut zum Risiko beweise, könnte von der Marktverfassung profitieren. "Wer abwartet, bis alle Signale auf grün stehen und alle Risiken beseitigt sind, der muss dann 30 bis 40 Prozent höher einsteigen", warnt Schleicher. "Und entgangene Gewinne sind genauso schlimm wie Verluste."
Gute Chancen auf Kursgewinne im Dax würden derzeit die Versicherer wie die Münchener Rück oder die Allianz bieten. Das operative Geschäft laufe dort besser als im Bankenbereich und auf Grund des hohen Aktienportfolios wiesen die Titel großes Erholungspotenzial auf.
Amerika ist kein Schnäppchenmarkt
Nur wenig Potenzial traut Schleicher hingegen den US-Märkten zu. Der Dow Jones sei derzeit "vielleicht fair bewertet. Aber von einer massiven Unterbewertung wie bei uns kann keine Rede sein", so Schleicher.
manager-magazin - 18.03.2003
Nichts für schwache Nerven
Von Harald Grimm und Kai Lange
Der Dax schließt mit knapp vier Prozent im Plus. Hedgefonds dominieren die Szene, sagen Analysten. Die Chancen für eine Erholung bleiben bestehen, doch sei diese "zeitlich sehr begrenzt".
Frankfurt am Main - Die Reaktion der Börse ist zynisch, doch für Marktstrategen erklärbar. Während Menschen in Bagdad Deckung suchen, wagen sich Investoren wieder hervor: "Ein schnelles Ende der Irak-Krise wird die Lähmung der Märkte beseitigen. Die Börse spekuliert bereits jetzt auf eine Erholung nach dem Krieg", sagte ein Händler am Dienstag.
Gegen Mittag hatte der Dax mit rund fünf Prozent Plus auf 2624 Punkte sein Tageshoch erreicht, musste dann aber zwischenzeitlich einen Großteil der Gewinne wieder abgeben. Mit einer festen Wall Street und einer extrem starken Bayer-Aktie ging es am Abend erneut bergauf. Der Dax schloss 3,9 Prozent fester auf 2584 Zählern. Seit Donnerstag hat Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer damit mehr als 17 Prozent gewonnen.
Der Dow Jones verbuchte zu Handelsschluss in Deutschland ein Plus von 0,5 Prozent bei 8179 Punkten. Der Nasdaq Composite pendelte um seinen Vortagesschluss bei 1391 Zählern. Die amerikanische Notenbank hat die Leitzinsen am Dienstag wie erwartet nicht verändert. Der Offenmarktausschuss beschloss, den Satz für Tagesgeld bei 1,25 Prozent zu belassen, dem niedrigsten Stand seit mehr als 40 Jahren.
Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer war um 39 Prozent auf 14,30 Euro in die Höhe geschossen. Das Unternehmen ist im ersten US-Prozess um Gesundheitsschäden durch den Blutfettsenker Lipobay freigesprochen worden. Des weiteren zählten die Aktien des Chemiekonzerns BASF , der am Morgen gute Zahlen vorgelegt hatte, sowie MAN und Henkel zu den größten Gewinnern im Dax.
Siemens schießt 36 Millionen Infineon-Titel auf den Markt
Infineon dagegen, die am Vormittag zu den stärksten Werten gezählt hatten, notierten zu Handelsschluss 10,73 Prozent leichter auf 6,57 Euro. Siemens hat 36 Millionen Infineon-Aktien über die Investmentbank Goldman Sachs am Markt platziert. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Die Beteiligung des Siemens Pension Trust e.V. an Infineon ist damit gleich null", sagte der Sprecher. Siemens halte aber weiterhin Anteile an dem Münchener Halbleiterproduzenten.
Nachdem US-Präsident George W. Bush am Montagabend Saddam Hussein ein Ultimatum gesetzt hatte, binnen 48 Stunden den Irak zu verlassen, hatten die Indizes ihre Klettertour fortgesetzt. Beobachter sprachen von einer vorgezogenen Kriegsrallye, da nun auf einen schnellen Sieg der USA spekuliert werden könne.
"Hedgefonds decken sich ein"
"Derzeit lösen Hedgefonds ihre Short-Positionen auf und decken sich mit Aktien ein, um Gewinne mitzunehmen oder bei steigenden Kurse ihre Verluste zu begrenzen", kommentierte Klaus Lüpertz, Aktienstratege bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, den deutlichen Kursanstieg im Dax.
Die Erholung im Dax sei sehr dynamisch und von großen Volumina getragen: "Da betreiben wohl einige Leerverkäufer Schadensbegrenzung", sagte Lüpertz im Gespräch mit manager-magazin.de.
"Erholung zeitlich begrenzt - sie kann bis 2800 Punkte tragen"
Der Aufschwung könne durchaus noch bis in den Bereich von 2700 oder 2800 Punkten tragen. "Doch wer jetzt bei dieser Erholung mitspielen will, sollte mit engen Stopp-Loss-Marken" arbeiten, empfiehlt der HSBC-Marktstratege. "Die makroökonomischen Daten sehen nach wie vor schlecht aus. Wie lange der Krieg dauern wird, wie es in der Region weitergeht und wie hoch die Kriegskosten ausfallen, ist offen", so Lüpertz.
Die freundliche Kursentwicklung fuße nicht darauf, dass die konjunkturellen Rahmendaten oder die Gewinnsituation der Unternehmen besser geworden sind. "Wir sind noch immer in einem langfristigen Abwärtstrend", warnt Lüpertz. Er rechne daher damit, dass die deutliche Erholung im Dax "zeitlich sehr begrenzt" sein werde.
Krieg drängt andere Probleme in den Hintergrund
"Charttechnisch haben wir noch bis etwa 2750 Punkte Platz. Doch die Luft wird dünner", bekräftigte Oliver Brockhagen, Leiter des Aktienhandels beim Bankhaus Metzler. "Wir sind in den vergangenen drei Tagen sehr schnell und deutlich nach oben gelaufen: Nicht, weil die konjunkturelle Situation Anlass zur Zuversicht gibt, sondern weil Leerverkäufer ihre Positionen geschlossen haben."
Eine solche "short-covered Rallye" könne auch schnell wieder vorbei sein, sagt Brockhagen. Solange aber der Ölpreis und der Bund-Future fallen, hätten die Aktienmärkte Phantasie. Brockhagen erinnerte daran, dass selbst nach einem schnellen Sieg der USA die konjunkturellen Probleme nicht gelöst seien. "Das Thema Krieg dient derzeit dazu, um die anderen Themen zu vergessen", so der Marktstratege. Nach Ende des Krieges würde die schwierige Lage der Weltkonjunktur umso deutlicher zutage treten.
"Das ist mehr als ein Strohfeuer"
Etwas optimistischer ist Fiduka-Depotmanager Felix Schleicher. "Das ist mehr als ein Strohfeuer", sagte der Marktexperte im Gespräch mit mm.de. Der Dax sei immer noch extrem unterbewertet und weise im internationalen Vergleich mit das größte Aufwärtspotenzial auf: "Da darf man nicht von 20 oder 25 Prozent reden, das sind ganz andere Dimensionen."
Zwar seien auf Grund der unsicheren weltpolitischen Lage noch weitere Kursverluste möglich, die Chancen würden im derzeitigen Umfeld die Risiken jedoch überwiegen. Schließlich seien die meisten Szenarien in den Kursen bereits eingepreist: "Terrorattentate, ein Flächenbrand in Nahost oder ein Ölpreis bei 50 Dollar pro Barrel – das wird zum Gutteil schon heute an der Börse gespielt", sagt Schleicher. Die niedrige Erwartungshaltung mache einen weiteren Ausverkauf an der Börse unwahrscheinlich.
Mut zum Risiko
Das derzeitige Marktumfeld bietet nach Ansicht von Schleicher gute Bedingungen zum Einstieg. Wer jetzt Mut zum Risiko beweise, könnte von der Marktverfassung profitieren. "Wer abwartet, bis alle Signale auf grün stehen und alle Risiken beseitigt sind, der muss dann 30 bis 40 Prozent höher einsteigen", warnt Schleicher. "Und entgangene Gewinne sind genauso schlimm wie Verluste."
Gute Chancen auf Kursgewinne im Dax würden derzeit die Versicherer wie die Münchener Rück oder die Allianz bieten. Das operative Geschäft laufe dort besser als im Bankenbereich und auf Grund des hohen Aktienportfolios wiesen die Titel großes Erholungspotenzial auf.
Amerika ist kein Schnäppchenmarkt
Nur wenig Potenzial traut Schleicher hingegen den US-Märkten zu. Der Dow Jones sei derzeit "vielleicht fair bewertet. Aber von einer massiven Unterbewertung wie bei uns kann keine Rede sein", so Schleicher.
manager-magazin - 18.03.2003
.
Goldproduktion Südafrika 2002:
+ 0,4 % !
... zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel ...?
kommt wohl auf die Perspektive an ...
SA gold output rises for the first time in nine years
South African mines produced [/b]395,2 t of gold in 2002[/b], a 0,4% rise on 2001 and the first increase in nine years due to higher metal prices and a weak rand, the Chamber of Mines said yesterday.
"This is the first annual increase in production recorded since 1993 and reflects a welcome stabilisation in production levels, following nine years of falling production," Chamber of Mines economist Roger Baxter said in a statement.
The chamber represents South Africa`s major mining companies, which are among the biggest in the world. The statistics included non-chamber members.
An average gold price of $310/oz and a weaker rand exchange rate, which averaged 10,5 per dollar, resulted in total gold exports worth R39,2-billion ($4,85-billion) in 2002, up from R29,4-billion in 2001.
"In US dollar terms, the stabilisation in production and the improvement in the dollar gold price resulted in an additional $512-million in export earnings for South Africa, when 2002 is compared to 2001," Baxter said.
Gold has regained its safe-haven status for investors in the past 18 months due to global political uncertainty.
It raced to a six and a half-year high of $388,50 last month, due to fears of an impending attack on Iraq by the US. Yesterday, spot gold was trading at $343,00/4,00/oz, but analysts said its wide $342-360 range was still intact.
The rand, which lost more than 37% of its value in 2001, helped South African gold companies post record earnings in the first two quarters of last year.
But the rand has since clawed back almost all its losses, taking some of the shine off producers` earnings in recent quarters, adding to costs as miners bump up production to take advantage of the surging bullion price.
South Africa is the world`s largest producer of gold, although production has slipped from a peak of almost 1 000 t a year in the early 1970s.
Mining in South Africa, which is also the world`s largest supplier of platinum, makes up less than 10% of the country`s gross domestic product (GDP), but minerals exports account for almost 30% of its exports.
The sector is also one of the country`s largest single private employers, with 407 000 workers in 2001.
Mining Weekly - 19.03.2003
Goldproduktion Südafrika 2002:
+ 0,4 % !
... zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel ...?
kommt wohl auf die Perspektive an ...

SA gold output rises for the first time in nine years
South African mines produced [/b]395,2 t of gold in 2002[/b], a 0,4% rise on 2001 and the first increase in nine years due to higher metal prices and a weak rand, the Chamber of Mines said yesterday.
"This is the first annual increase in production recorded since 1993 and reflects a welcome stabilisation in production levels, following nine years of falling production," Chamber of Mines economist Roger Baxter said in a statement.
The chamber represents South Africa`s major mining companies, which are among the biggest in the world. The statistics included non-chamber members.
An average gold price of $310/oz and a weaker rand exchange rate, which averaged 10,5 per dollar, resulted in total gold exports worth R39,2-billion ($4,85-billion) in 2002, up from R29,4-billion in 2001.
"In US dollar terms, the stabilisation in production and the improvement in the dollar gold price resulted in an additional $512-million in export earnings for South Africa, when 2002 is compared to 2001," Baxter said.
Gold has regained its safe-haven status for investors in the past 18 months due to global political uncertainty.
It raced to a six and a half-year high of $388,50 last month, due to fears of an impending attack on Iraq by the US. Yesterday, spot gold was trading at $343,00/4,00/oz, but analysts said its wide $342-360 range was still intact.
The rand, which lost more than 37% of its value in 2001, helped South African gold companies post record earnings in the first two quarters of last year.
But the rand has since clawed back almost all its losses, taking some of the shine off producers` earnings in recent quarters, adding to costs as miners bump up production to take advantage of the surging bullion price.
South Africa is the world`s largest producer of gold, although production has slipped from a peak of almost 1 000 t a year in the early 1970s.
Mining in South Africa, which is also the world`s largest supplier of platinum, makes up less than 10% of the country`s gross domestic product (GDP), but minerals exports account for almost 30% of its exports.
The sector is also one of the country`s largest single private employers, with 407 000 workers in 2001.
Mining Weekly - 19.03.2003
.
China: Lieber rot als profitabel
Chinas Banken ziehen marode Staatsbetriebe Privatunternehmern vor. Korruption und Kreditausfälle häufen sich
Von Georg Blume
Von zeitgemäßer Synthetik in tibetischen Farben bis zu deutschen Stickereimotiven auf chinesischer Seide: Der Designershop „Das rote Pferd“ im Pekinger Shangan-Einkaufszentrum ist eine Fundgrube der Modeschöpfung. Hätte doch der Bankier von nebenan nur einmal den Laden besucht! Vielleicht wäre das rote Pferd von Liu Hongying in China heute schon so bekannt wie das grüne Krokodil von Lacoste. Weil der Bankier von nebenan nicht wollte, musste Jungunternehmerin Liu das Geld für ihre ersten drei Geschäftsfilialen in Peking von Bekannten leihen. „Das war viel einfacher, als weiter mit der Bank zu kämpfen“, sagt Liu, „ich habe das Gefühl, dass unsere staatlichen Banken gar keine Kredite an Privatfirmen vergeben wollen, weil ihnen Privatunternehmer als unzuverlässig gelten.“
So aber ergeht es nicht nur jungen Designern. Alarmierende 88 Prozent von 1700 befragten kleinen und mittelständischen Unternehmen in China bezeichnen nach einer Umfrage der Pekinger Regierung die Kreditversorgung als „eng“ oder „äußerst eng“.
Ein Hemmschuh fürs chinesische Wirtschaftswunder: 29,2 Millionen nichtstaatliche Mittelständler produzieren heute 50 Prozent des chinesischen Bruttosozialprodukts, beschäftigen 174 Millionen Arbeitnehmer – und bekommen kein Geld von den Banken. Wie aber kann die chinesische Wirtschaft ohne Kreditversorgung für Privatfirmen weiter gedeihen? Überhaupt nicht, antwortet eine immer lauter werdende Gruppe kritischer Ökonomen, die in der Reform des chinesischen Bankwesens den Schlüssel für das künftige Wachstum der Volksrepublik sehen.
„Unsere Banken unterstützen immer noch die Planwirtschaft. Sie sind gar nicht ausgerüstet, um privaten Unternehmen zu helfen!“, wettert Hu Bingliang, Wirtschaftsprofessor an der Pekinger Akademie für Sozialwissenschaften und einflussreicher Befürworter einer Bankenreform.
Finanzexperte Hu rechnet vor, dass heute immer noch 70 Prozent aller Bankkredite in China an staatliche Unternehmen fließen, die inzwischen nur noch 25 Prozent der Industrieproduktion erwirtschaften. „In den Banken regiert nach wie vor das Prinzip Verantwortungslosigkeit“, meint Hu. „Die Bankmanager denken: Gebe ich einer Privatfirma Geld, liegt das Kreditrisiko bei mir, gebe ich das Geld dagegen einer Staatsfirma, gibt es kein Risiko, weil der Kredit ohnehin abgeschrieben wird.“
Hu verweist damit auf das erste große Übel im chinesischen Bankwesen: die Kreditvergabe auf politischen Befehl ohne Rückzahlungspflicht. „Wenn der Regierungschef sagt, für den Dreischluchtendamm müssen 100 Milliarden Yuan her, dann folgt die angesprochene Bank ohne Zögern seiner Anweisung“, sagt er. Auf allen Ebenen im Staatsapparat sei das so: vom Vorstand der Landwirtschaftsbank, der dem Landwirtschaftsminister folge, über den Provinzbankchef, der dem Provinzgouverneur gehorche, bis hin zum dörflichen Filialleiter, der auf den lokalen Parteisekretär höre. In diesem System, so Hu, seien die Banken bis heute nicht für ihre Bilanzen verantwortlich. „Jede Finanzreform in China muss damit anfangen, die Beziehungen zwischen Regierung und Banken zu entflechten, sodass aus Staatsbanken irgendwann echte Privatbanken werden“, empfiehlt der Professor. Bei der Notenbank scheint man das inzwischen ähnlich zu sehen. So kündigte deren Vizechef Wu Xiaoling jüngst an, das strenge Regime zu lockern, das den Banken bisher die Zinsen für Kredite und Einlagen vorgab. „Ich denke, marktorientierte Zinsen liegen unmittelbar vor uns“, zitierten offizielle Zeitungen den Zentralbanker.
Trotzdem ist es für Chinas Banken noch ein weiter Weg. Zumal sich die Last von Chinas politischer Vergangenheit in der Bankenfrage nicht mit den üblichen neokommunistischen Zukunftsformeln überschütten lässt. Stattdessen drückt sie sich in nackten Zahlen aus: Auf bis zu 500 Milliarden Euro berechnen Hongkonger Analysten den Berg nicht rückzahlungsfähiger Kredite im chinesischen Bankwesen. Offiziellen Angaben zufolge liegt der Fehlbetrag bei etwa 250 Milliarden Euro oder 25 Prozent des chinesischen Sozialprodukts. Mindestens so viel Geld haben chinesische Bankmanager in den letzten zwei Jahrzehnten verteilt, ohne es zurückzubekommen, geschweige denn, daran Zinsen zu verdienen. Nun aber, da auch die Regierung in Peking das Problem der faulen Kredite erkannt hat und mit vier eigens gegründeten Abschreibungsgesellschaften zu bekämpfen versucht, ist der durchschnittliche chinesische Bankmanager erst recht verunsichert. Darf er nicht einmal mehr Kredit auf Anweisung vergeben?
Während sich das alte System als untauglich erweist, ohne dass bereits neue Prinzipien greifen, wächst das zweite große Übel des chinesischen Bankwesens: die Korruption.
Korruption ist überall. Man hört von ihr durch Unternehmer, die sich Kredite mit großen Gelagen erschleichen. Oder durch ausländische Bankmanager, denen plötzlich ihre Ansprechpartner auf der chinesischen Seite verloren gehen. Spätestens seit Wang Xuebing als Chef der Bank of China stürzte, weil er im Amerikageschäft Millionen veruntreute, weiß man, dass die krummen Machenschaften auch die obersten Etagen erreichen. Erst Anfang des Jahres wurde in den Vereinigten Staaten ein anderer ehemaliger Manager der Bank of China festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, 725 Millionen Euro für eigennützige Zwecke entwendet zu haben – nicht gerade ein Trinkgeld.
An den Dimensionen der Korruption misst sich die Dringlichkeit einer Reform. „Ohne dramatische Veränderungen innerhalb der nächsten fünf Jahre ist eine große Finanzkrise in China unvermeidlich“, urteilt Andy Xie, Chefökonom der US-Investmentbank Morgan Stanley Dean Witter in Hongkong.
Nun zählt gerade Xie zu den wenigen US-Analysten, welche die Entwicklung der Volksrepublik über die Asienkrise der Jahre 1997/98 hinweg stets zuversichtlich sahen und damit bislang Recht behielten. Warum also ausgerechnet jetzt so viel Pessimismus? „Von außen betrachtet, vergleicht man die chinesischen Bankenprobleme mit denen anderer Länder. Doch das ist völlig unangebracht“, sagt Xie. „China hat nie ein marktorientiertes Finanzsystem entwickelt. Seine Staatsbanken sind keine richtigen Banken. Die Kapitalzuweisung beruht auf politischer Macht.“ Nur ein transparenteres Finanzsystem „dreht der Korruption den Geldhahn zu. Eine erfolgreiche Reduzierung der Korruption würde zu mehr Beschäftigung führen und die Lasten der Bauern verringern.“
Für die Regierung in Peking sind diese Ansichten nicht neu. Jedes Jahr müssen die Chefs der vier großen Staatsbanken, die drei Viertel aller Kredite und Einlagen kontrollieren, dem Regierungschef persönlich Gewähr leisten, dass sie ihre strengen Auflagen für die Abschreibung fauler Kredite erfüllen. Der im März aus dem Amt scheidende Premierminister Zhu Rongji hat den vier Banken zudem einen umfangreichen Restrukturierungsplan auferlegt. Seitdem werden zahlreiche Filialen geschlossen, baut die führende Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ihre Mitarbeiterzahl von 520000 auf 400000 ab. „In den vier Staatsbanken herrscht heute ein ungeheurer Reformdruck“, beobachtet Michael Reichel, langjähriger China-Chef der Commerzbank in Peking. Dass sich der Druck noch verstärkt, dafür soll Premier Wen Jiaobao sorgen, der bislang unter Zhu für die Bankenaufsicht zuständig war.
Doch wie weit können die Reformen gehen? Werden auch die berühmten ICBC-Filialen auf Pferden abgeschafft, die den tibetischen Nomaden ins hohe Bergland des Himalayas hinterherziehen? Michael Reichel bezweifelt nicht nur das:
„Das chinesische Bankensystem wird niemandem um die Ohren fliegen“, widerspricht der deutsche Bankmanager allen Krisenorakeln. Reichel empfiehlt, genauer hinzuschauen: In China gebe es viele „technisch möglicherweise insolvente Banken, die in Liquidität schwimmen“. So ist das eben in der sozialistischen Marktwirtschaft: Gerade die vier großen Staatsbanken genießen trotz ihrer verheerenden Bilanzen immer noch das uneingeschränkte Vertrauen nahezu aller Chinesen. Fast 1000 Milliarden Euro privater Spareinlagen hat das Milliardenvolk auf seinen Konten geparkt. Chinas Sparquote liegt heute mit 40 Prozent mit an der Weltspitze. So schwimmen die Banken tatsächlich im Geld. Man muss nur durchs Land reisen, um das zu verstehen: Überall, wo in Europa Kirchen stehen, bauen die Chinesen Banken. Ihre Filialen sind die höchsten und glänzendsten Bauten jeder Stadt. Das wiederum erzeugt Vertrauen bei den Massen. In einer schnell wachsenden Volkswirtschaft wie der chinesischen aber gilt Vertrauen als das wichtigste Gut, um das Momentum der Entwicklung zu bewahren.
Also besser doch keine „dramatischen“ Einschnitte im Bankwesen, wie Xie sie empfiehlt? Klaus-Uwe Schaffrath, Chef von Volkswagen Financial Services in China, empfiehlt einen Mittelweg: „Die Banken müssen einerseits aus sozialen Gründen die vegetierenden Staatsbetriebe am Leben erhalten, andererseits aber lernen, gute Neugeschäfte aufzubauen.“ Wie das geht, beobachtet Schaffrath im Bericht der Autofinanzierung: „Erst vor fünf Jahren haben Chinas Banken die Autofinanzierung entdeckt. Heute sagen sie bereits: Haltet die Ausländer noch eine Weile draußen, damit sie uns nicht das Geschäft wegnehmen.“
DIE ZEIT 12/2003
China: Lieber rot als profitabel
Chinas Banken ziehen marode Staatsbetriebe Privatunternehmern vor. Korruption und Kreditausfälle häufen sich
Von Georg Blume
Von zeitgemäßer Synthetik in tibetischen Farben bis zu deutschen Stickereimotiven auf chinesischer Seide: Der Designershop „Das rote Pferd“ im Pekinger Shangan-Einkaufszentrum ist eine Fundgrube der Modeschöpfung. Hätte doch der Bankier von nebenan nur einmal den Laden besucht! Vielleicht wäre das rote Pferd von Liu Hongying in China heute schon so bekannt wie das grüne Krokodil von Lacoste. Weil der Bankier von nebenan nicht wollte, musste Jungunternehmerin Liu das Geld für ihre ersten drei Geschäftsfilialen in Peking von Bekannten leihen. „Das war viel einfacher, als weiter mit der Bank zu kämpfen“, sagt Liu, „ich habe das Gefühl, dass unsere staatlichen Banken gar keine Kredite an Privatfirmen vergeben wollen, weil ihnen Privatunternehmer als unzuverlässig gelten.“
So aber ergeht es nicht nur jungen Designern. Alarmierende 88 Prozent von 1700 befragten kleinen und mittelständischen Unternehmen in China bezeichnen nach einer Umfrage der Pekinger Regierung die Kreditversorgung als „eng“ oder „äußerst eng“.
Ein Hemmschuh fürs chinesische Wirtschaftswunder: 29,2 Millionen nichtstaatliche Mittelständler produzieren heute 50 Prozent des chinesischen Bruttosozialprodukts, beschäftigen 174 Millionen Arbeitnehmer – und bekommen kein Geld von den Banken. Wie aber kann die chinesische Wirtschaft ohne Kreditversorgung für Privatfirmen weiter gedeihen? Überhaupt nicht, antwortet eine immer lauter werdende Gruppe kritischer Ökonomen, die in der Reform des chinesischen Bankwesens den Schlüssel für das künftige Wachstum der Volksrepublik sehen.
„Unsere Banken unterstützen immer noch die Planwirtschaft. Sie sind gar nicht ausgerüstet, um privaten Unternehmen zu helfen!“, wettert Hu Bingliang, Wirtschaftsprofessor an der Pekinger Akademie für Sozialwissenschaften und einflussreicher Befürworter einer Bankenreform.
Finanzexperte Hu rechnet vor, dass heute immer noch 70 Prozent aller Bankkredite in China an staatliche Unternehmen fließen, die inzwischen nur noch 25 Prozent der Industrieproduktion erwirtschaften. „In den Banken regiert nach wie vor das Prinzip Verantwortungslosigkeit“, meint Hu. „Die Bankmanager denken: Gebe ich einer Privatfirma Geld, liegt das Kreditrisiko bei mir, gebe ich das Geld dagegen einer Staatsfirma, gibt es kein Risiko, weil der Kredit ohnehin abgeschrieben wird.“
Hu verweist damit auf das erste große Übel im chinesischen Bankwesen: die Kreditvergabe auf politischen Befehl ohne Rückzahlungspflicht. „Wenn der Regierungschef sagt, für den Dreischluchtendamm müssen 100 Milliarden Yuan her, dann folgt die angesprochene Bank ohne Zögern seiner Anweisung“, sagt er. Auf allen Ebenen im Staatsapparat sei das so: vom Vorstand der Landwirtschaftsbank, der dem Landwirtschaftsminister folge, über den Provinzbankchef, der dem Provinzgouverneur gehorche, bis hin zum dörflichen Filialleiter, der auf den lokalen Parteisekretär höre. In diesem System, so Hu, seien die Banken bis heute nicht für ihre Bilanzen verantwortlich. „Jede Finanzreform in China muss damit anfangen, die Beziehungen zwischen Regierung und Banken zu entflechten, sodass aus Staatsbanken irgendwann echte Privatbanken werden“, empfiehlt der Professor. Bei der Notenbank scheint man das inzwischen ähnlich zu sehen. So kündigte deren Vizechef Wu Xiaoling jüngst an, das strenge Regime zu lockern, das den Banken bisher die Zinsen für Kredite und Einlagen vorgab. „Ich denke, marktorientierte Zinsen liegen unmittelbar vor uns“, zitierten offizielle Zeitungen den Zentralbanker.
Trotzdem ist es für Chinas Banken noch ein weiter Weg. Zumal sich die Last von Chinas politischer Vergangenheit in der Bankenfrage nicht mit den üblichen neokommunistischen Zukunftsformeln überschütten lässt. Stattdessen drückt sie sich in nackten Zahlen aus: Auf bis zu 500 Milliarden Euro berechnen Hongkonger Analysten den Berg nicht rückzahlungsfähiger Kredite im chinesischen Bankwesen. Offiziellen Angaben zufolge liegt der Fehlbetrag bei etwa 250 Milliarden Euro oder 25 Prozent des chinesischen Sozialprodukts. Mindestens so viel Geld haben chinesische Bankmanager in den letzten zwei Jahrzehnten verteilt, ohne es zurückzubekommen, geschweige denn, daran Zinsen zu verdienen. Nun aber, da auch die Regierung in Peking das Problem der faulen Kredite erkannt hat und mit vier eigens gegründeten Abschreibungsgesellschaften zu bekämpfen versucht, ist der durchschnittliche chinesische Bankmanager erst recht verunsichert. Darf er nicht einmal mehr Kredit auf Anweisung vergeben?
Während sich das alte System als untauglich erweist, ohne dass bereits neue Prinzipien greifen, wächst das zweite große Übel des chinesischen Bankwesens: die Korruption.
Korruption ist überall. Man hört von ihr durch Unternehmer, die sich Kredite mit großen Gelagen erschleichen. Oder durch ausländische Bankmanager, denen plötzlich ihre Ansprechpartner auf der chinesischen Seite verloren gehen. Spätestens seit Wang Xuebing als Chef der Bank of China stürzte, weil er im Amerikageschäft Millionen veruntreute, weiß man, dass die krummen Machenschaften auch die obersten Etagen erreichen. Erst Anfang des Jahres wurde in den Vereinigten Staaten ein anderer ehemaliger Manager der Bank of China festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, 725 Millionen Euro für eigennützige Zwecke entwendet zu haben – nicht gerade ein Trinkgeld.
An den Dimensionen der Korruption misst sich die Dringlichkeit einer Reform. „Ohne dramatische Veränderungen innerhalb der nächsten fünf Jahre ist eine große Finanzkrise in China unvermeidlich“, urteilt Andy Xie, Chefökonom der US-Investmentbank Morgan Stanley Dean Witter in Hongkong.
Nun zählt gerade Xie zu den wenigen US-Analysten, welche die Entwicklung der Volksrepublik über die Asienkrise der Jahre 1997/98 hinweg stets zuversichtlich sahen und damit bislang Recht behielten. Warum also ausgerechnet jetzt so viel Pessimismus? „Von außen betrachtet, vergleicht man die chinesischen Bankenprobleme mit denen anderer Länder. Doch das ist völlig unangebracht“, sagt Xie. „China hat nie ein marktorientiertes Finanzsystem entwickelt. Seine Staatsbanken sind keine richtigen Banken. Die Kapitalzuweisung beruht auf politischer Macht.“ Nur ein transparenteres Finanzsystem „dreht der Korruption den Geldhahn zu. Eine erfolgreiche Reduzierung der Korruption würde zu mehr Beschäftigung führen und die Lasten der Bauern verringern.“
Für die Regierung in Peking sind diese Ansichten nicht neu. Jedes Jahr müssen die Chefs der vier großen Staatsbanken, die drei Viertel aller Kredite und Einlagen kontrollieren, dem Regierungschef persönlich Gewähr leisten, dass sie ihre strengen Auflagen für die Abschreibung fauler Kredite erfüllen. Der im März aus dem Amt scheidende Premierminister Zhu Rongji hat den vier Banken zudem einen umfangreichen Restrukturierungsplan auferlegt. Seitdem werden zahlreiche Filialen geschlossen, baut die führende Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ihre Mitarbeiterzahl von 520000 auf 400000 ab. „In den vier Staatsbanken herrscht heute ein ungeheurer Reformdruck“, beobachtet Michael Reichel, langjähriger China-Chef der Commerzbank in Peking. Dass sich der Druck noch verstärkt, dafür soll Premier Wen Jiaobao sorgen, der bislang unter Zhu für die Bankenaufsicht zuständig war.
Doch wie weit können die Reformen gehen? Werden auch die berühmten ICBC-Filialen auf Pferden abgeschafft, die den tibetischen Nomaden ins hohe Bergland des Himalayas hinterherziehen? Michael Reichel bezweifelt nicht nur das:
„Das chinesische Bankensystem wird niemandem um die Ohren fliegen“, widerspricht der deutsche Bankmanager allen Krisenorakeln. Reichel empfiehlt, genauer hinzuschauen: In China gebe es viele „technisch möglicherweise insolvente Banken, die in Liquidität schwimmen“. So ist das eben in der sozialistischen Marktwirtschaft: Gerade die vier großen Staatsbanken genießen trotz ihrer verheerenden Bilanzen immer noch das uneingeschränkte Vertrauen nahezu aller Chinesen. Fast 1000 Milliarden Euro privater Spareinlagen hat das Milliardenvolk auf seinen Konten geparkt. Chinas Sparquote liegt heute mit 40 Prozent mit an der Weltspitze. So schwimmen die Banken tatsächlich im Geld. Man muss nur durchs Land reisen, um das zu verstehen: Überall, wo in Europa Kirchen stehen, bauen die Chinesen Banken. Ihre Filialen sind die höchsten und glänzendsten Bauten jeder Stadt. Das wiederum erzeugt Vertrauen bei den Massen. In einer schnell wachsenden Volkswirtschaft wie der chinesischen aber gilt Vertrauen als das wichtigste Gut, um das Momentum der Entwicklung zu bewahren.
Also besser doch keine „dramatischen“ Einschnitte im Bankwesen, wie Xie sie empfiehlt? Klaus-Uwe Schaffrath, Chef von Volkswagen Financial Services in China, empfiehlt einen Mittelweg: „Die Banken müssen einerseits aus sozialen Gründen die vegetierenden Staatsbetriebe am Leben erhalten, andererseits aber lernen, gute Neugeschäfte aufzubauen.“ Wie das geht, beobachtet Schaffrath im Bericht der Autofinanzierung: „Erst vor fünf Jahren haben Chinas Banken die Autofinanzierung entdeckt. Heute sagen sie bereits: Haltet die Ausländer noch eine Weile draußen, damit sie uns nicht das Geschäft wegnehmen.“
DIE ZEIT 12/2003
.
Irakkonflikt:
"Die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg"
Von Jörn Sucher
Was droht der Weltwirtschaft bei einem Krieg gegen den Irak? Im Interview mit mm.de skizziert Friedemann Müller, Experte für Energiepolitik am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit, mögliche Krisenszenarien.
mm.de: Herr Müller, die Welt steht vor einem neuen Waffengang im Irak. Mit welchen Folgen für die globale Ökonomie müssen wir rechnen?
Müller: Die wirtschaftlichen Folgen eines Krieges gegen den Irak lassen sich grob in drei Szenarien einteilen. Zum einen rechne ich mit einem kurzen, siegreichen Feldzug der Amerikaner, der maximal vier Wochen dauert. Der Konflikt bleibt regional begrenzt. Die Folgen sind überschaubar.
mm.de: Wie sieht das zweite Szenario aus?
Müller: In diesem Fall wird der Feldzug der US-Streitkräfte ebenfalls schnell und siegreich sein. Allerdings sind die Folgen gravierend, weil der Irak durch einen Angriff auf die Ölförderung, beispielsweise in Saudi Arabien, den Export nachhaltig beeinträchtigen könnte. Dann wären die Auswirkungen schwerwiegend, selbst wenn die Amerikaner das Land zügig unter Kontrolle bekommen und sich der Krieg nicht ausweitet.
mm.de: Was passiert bei Szenario Nummer drei?
Müller: Dies kann man sicher als den Worst Case bezeichnen. Kurz gesagt: Der Krieg zieht sich in die Länge und/oder weitet sich aus. Vorstellbar ist zum Beispiel ein Terrorangriff auf die USA nach dem Muster des 11. September. Auch könnte es zu einer Destabilisierung Saudi-Arabiens kommen durch den massiven Druck aus der Bevölkerung. Eine dritte Variante wäre der Einsatz von biologischen und chemischen Waffen innerhalb des Iraks, wodurch sich die Verluste unter den US-Streitkräften erhöhen würden.
mm.de: Welches Szenario ist das wahrscheinlichste?
Müller: Ich gehe davon aus, dass die militärischen Aktionen innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen sein werden, zumal das amerikanische Militär stark genug zu sein scheint. Szenario eins erscheint mir das wahrscheinlichste.
mm.de: Wie wird sich der schnelle begrenzte Konflikt auf die Ökonomie auswirken?
Müller: In diesem Fall sind die Folgen gering. Ein kurzer, regionaler Krieg könnte sogar positive Impulse liefern. Die fortwährenden Kursrückgänge der vergangenen Jahre an den internationalen Börsen könnten gestoppt werden. Die lähmende Unsicherheit wäre vorbei. Die Investitionsbereitschaft würde anziehen. Der April 2003 wäre in diesem Fall der Tiefpunkt. Danach könnte es wieder aufwärts gehen.
mm.de: Auch im zweiten Szenario ist der Krieg kurz. Dennoch sagten Sie, dass die Folgen gravierend sein könnten. Warum?
Müller: Stellen Sie sich vor, dass nur 20 Prozent der Erdölmenge ausbleibt, die täglich durch die Straße von Hormuz transportiert wird, ohne dass absehbar ist, wann sich die Situation zum Besseren ändert. Dann wird es eine massive Krise der gesamten Weltwirtschaft geben. Und zwar so massiv, dass sie selbst die schwere Ölkrise in den siebziger Jahren übersteigen wird. Es wird die größte, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben.
Täglich liefert die Golfregion 22 Millionen Barrel Öl pro Tag. 40 Prozent des international gehandelten Erdöls kommen aus diesem Gebiet. In diesem Szenario bleiben also acht Prozent der Menge aus. Kein Land und keine Region kann dieses Defizit durch zusätzliche Förderungen kurzfristig ausgleichen.
mm.de: Wie könnte es zu diesem Szenario kommen?
Müller: Wenn Ölfelder, Pipelines oder Verladestationen im Krieg etwa durch irakische Boden-Boden-Raketen getroffen würden, träte diese Situation ein. Nur ein einziger Volltreffer im wichtigsten saudischen Erdölterminal reicht schon aus. Gleiches gilt für die Verseuchung durch chemische und biologische Waffen.
Neben der plötzlichen Ölknappheit wäre in diesem Fall der psychologische Effekt gravierend. Es kommt zwar nicht zum GAU am Golf. Das Betroffenheitsgefühl wäre dennoch vorhanden. Weltweit würde die Investitionsbereitschaft auch bei einem kurzen Krieg drastisch sinken. Die Auswirkungen der Energieknappheit würden sich potenzieren.
mm.de: Wie sehen die Folgen für die Weltwirtschaft im Worst Case aus?
Müller: Die im zweiten Szenario beschriebenen Folgen werden in diesem Fall weit übertroffen. Tatsächlich würden dann nicht nur 20 Prozent der Erdölexporte aus der Golfregion ausbleiben, sondern ein viel größerer Anteil. Der wichtigste Erdölexporteur Saudi-Arabien könnte komplett blockiert werden. Wenn sich das Königreich etwa durch Anschläge destabilisiert, werden die Amerikaner nicht in der Lage sein, parallel zur Intervention im Irak auch noch dort für Ruhe zu sorgen.
Möglicherweise könnten auch die Energielieferungen aus dem Iran betroffen sein. Obwohl die politische Reformbewegung dort Anlass zur Hoffnung gibt, ist das Erdöl- und Erdgasgeschäft nach wie vor noch in der Hand der konservativen Islamisten. Wenn der Iran also die Spannungen nutzt, um die USA unter Druck zu setzen, wären die Beeinträchtigungen für den Rest der Welt gewaltig.
Nehmen Sie allein Japan. Das Land bezieht 78 Prozent seiner Erdölimporte aus dem persischen Golf. Sollte die Lieferung ausbleiben, ist es schlicht unmöglich, diesen Verlust zu kompensieren. Eine der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt wäre innerhalb kürzester Zeit gelähmt. Die Krise würde sich unweigerlich auf Europa und Amerika auswirken.
mm.de: Besteht die Möglichkeit, dass eine drohende Erdölknappheit durch die dann von den USA kontrollierten Erdölfelder im Irak ausgeglichen werden könnte? Das Land verfügt mit geschätzten 15 Milliarden Tonnen über die zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt.
Müller: Diese Rechnung dürfte nicht aufgehen. Selbst bei einem kurzen und begrenzten Krieg gegen Saddam Hussein wird die irakische Erdölindustrie Jahre brauchen, um entsprechende Kapazitäten liefern zu können. Insgesamt werden etwa 40 Milliarden Dollar an Investitionen benötigt, um die derzeitige Ölproduktion zu verdoppeln. Unsicherheiten innerhalb des Landes könnten die Bereitschaft bei Unternehmen senken, sich am Aufbau zu beteiligen.
mm.de: Mit welchen Problemen ist zu rechnen?
Müller: Experten gehen davon aus, dass der Irak langfristig politisch instabil bleiben wird. Machtkämpfe, Rachefeldzüge und Auseinandersetzungen zwischen den schiitischen, sunnitischen und kurdischen Bevölkerungsgruppen werden die Sicherheit auf Jahre beeinträchtigen.
Die USA haben zwar schon angedeutet, dass sie zunächst den Antiamerikanismus im Irak eindämmen wollen. Ob das ausreicht, um den tief sitzenden Ressentiments der Bevölkerung wirksam zu begegnen, ist zweifelhaft. Nach Prognosen auf Basis der Erfahrungen in Afghanistan muss mit vielen Jahren gerechnet werden, bis das Land vollständig unter Kontrolle ist.
Die US-Pläne, die von einer politischen Stabilisierung innerhalb von zwei Jahren ausgehen, sind zu optimistisch. Es spielt keine Rolle, ob der Krieg kurz oder lang sein wird: Der Irak bleibt nach einem Sieg der Amerikaner politisch instabil und ökonomisch schwer zu erschließen.
Dr. rer. pol. Friedemann Müller forscht am "Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit". Die unabhängige Einrichtung berät unter anderem den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung. Neben Energiepolitik zählen Globalisierungsfragen, Klimapolitik und internationale Umweltpolitik zu seinen Forschungsgebieten.
Irakkonflikt:
"Die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg"
Von Jörn Sucher
Was droht der Weltwirtschaft bei einem Krieg gegen den Irak? Im Interview mit mm.de skizziert Friedemann Müller, Experte für Energiepolitik am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit, mögliche Krisenszenarien.
mm.de: Herr Müller, die Welt steht vor einem neuen Waffengang im Irak. Mit welchen Folgen für die globale Ökonomie müssen wir rechnen?
Müller: Die wirtschaftlichen Folgen eines Krieges gegen den Irak lassen sich grob in drei Szenarien einteilen. Zum einen rechne ich mit einem kurzen, siegreichen Feldzug der Amerikaner, der maximal vier Wochen dauert. Der Konflikt bleibt regional begrenzt. Die Folgen sind überschaubar.
mm.de: Wie sieht das zweite Szenario aus?
Müller: In diesem Fall wird der Feldzug der US-Streitkräfte ebenfalls schnell und siegreich sein. Allerdings sind die Folgen gravierend, weil der Irak durch einen Angriff auf die Ölförderung, beispielsweise in Saudi Arabien, den Export nachhaltig beeinträchtigen könnte. Dann wären die Auswirkungen schwerwiegend, selbst wenn die Amerikaner das Land zügig unter Kontrolle bekommen und sich der Krieg nicht ausweitet.
mm.de: Was passiert bei Szenario Nummer drei?
Müller: Dies kann man sicher als den Worst Case bezeichnen. Kurz gesagt: Der Krieg zieht sich in die Länge und/oder weitet sich aus. Vorstellbar ist zum Beispiel ein Terrorangriff auf die USA nach dem Muster des 11. September. Auch könnte es zu einer Destabilisierung Saudi-Arabiens kommen durch den massiven Druck aus der Bevölkerung. Eine dritte Variante wäre der Einsatz von biologischen und chemischen Waffen innerhalb des Iraks, wodurch sich die Verluste unter den US-Streitkräften erhöhen würden.
mm.de: Welches Szenario ist das wahrscheinlichste?
Müller: Ich gehe davon aus, dass die militärischen Aktionen innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen sein werden, zumal das amerikanische Militär stark genug zu sein scheint. Szenario eins erscheint mir das wahrscheinlichste.
mm.de: Wie wird sich der schnelle begrenzte Konflikt auf die Ökonomie auswirken?
Müller: In diesem Fall sind die Folgen gering. Ein kurzer, regionaler Krieg könnte sogar positive Impulse liefern. Die fortwährenden Kursrückgänge der vergangenen Jahre an den internationalen Börsen könnten gestoppt werden. Die lähmende Unsicherheit wäre vorbei. Die Investitionsbereitschaft würde anziehen. Der April 2003 wäre in diesem Fall der Tiefpunkt. Danach könnte es wieder aufwärts gehen.
mm.de: Auch im zweiten Szenario ist der Krieg kurz. Dennoch sagten Sie, dass die Folgen gravierend sein könnten. Warum?
Müller: Stellen Sie sich vor, dass nur 20 Prozent der Erdölmenge ausbleibt, die täglich durch die Straße von Hormuz transportiert wird, ohne dass absehbar ist, wann sich die Situation zum Besseren ändert. Dann wird es eine massive Krise der gesamten Weltwirtschaft geben. Und zwar so massiv, dass sie selbst die schwere Ölkrise in den siebziger Jahren übersteigen wird. Es wird die größte, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben.
Täglich liefert die Golfregion 22 Millionen Barrel Öl pro Tag. 40 Prozent des international gehandelten Erdöls kommen aus diesem Gebiet. In diesem Szenario bleiben also acht Prozent der Menge aus. Kein Land und keine Region kann dieses Defizit durch zusätzliche Förderungen kurzfristig ausgleichen.
mm.de: Wie könnte es zu diesem Szenario kommen?
Müller: Wenn Ölfelder, Pipelines oder Verladestationen im Krieg etwa durch irakische Boden-Boden-Raketen getroffen würden, träte diese Situation ein. Nur ein einziger Volltreffer im wichtigsten saudischen Erdölterminal reicht schon aus. Gleiches gilt für die Verseuchung durch chemische und biologische Waffen.
Neben der plötzlichen Ölknappheit wäre in diesem Fall der psychologische Effekt gravierend. Es kommt zwar nicht zum GAU am Golf. Das Betroffenheitsgefühl wäre dennoch vorhanden. Weltweit würde die Investitionsbereitschaft auch bei einem kurzen Krieg drastisch sinken. Die Auswirkungen der Energieknappheit würden sich potenzieren.
mm.de: Wie sehen die Folgen für die Weltwirtschaft im Worst Case aus?
Müller: Die im zweiten Szenario beschriebenen Folgen werden in diesem Fall weit übertroffen. Tatsächlich würden dann nicht nur 20 Prozent der Erdölexporte aus der Golfregion ausbleiben, sondern ein viel größerer Anteil. Der wichtigste Erdölexporteur Saudi-Arabien könnte komplett blockiert werden. Wenn sich das Königreich etwa durch Anschläge destabilisiert, werden die Amerikaner nicht in der Lage sein, parallel zur Intervention im Irak auch noch dort für Ruhe zu sorgen.
Möglicherweise könnten auch die Energielieferungen aus dem Iran betroffen sein. Obwohl die politische Reformbewegung dort Anlass zur Hoffnung gibt, ist das Erdöl- und Erdgasgeschäft nach wie vor noch in der Hand der konservativen Islamisten. Wenn der Iran also die Spannungen nutzt, um die USA unter Druck zu setzen, wären die Beeinträchtigungen für den Rest der Welt gewaltig.
Nehmen Sie allein Japan. Das Land bezieht 78 Prozent seiner Erdölimporte aus dem persischen Golf. Sollte die Lieferung ausbleiben, ist es schlicht unmöglich, diesen Verlust zu kompensieren. Eine der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt wäre innerhalb kürzester Zeit gelähmt. Die Krise würde sich unweigerlich auf Europa und Amerika auswirken.
mm.de: Besteht die Möglichkeit, dass eine drohende Erdölknappheit durch die dann von den USA kontrollierten Erdölfelder im Irak ausgeglichen werden könnte? Das Land verfügt mit geschätzten 15 Milliarden Tonnen über die zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt.
Müller: Diese Rechnung dürfte nicht aufgehen. Selbst bei einem kurzen und begrenzten Krieg gegen Saddam Hussein wird die irakische Erdölindustrie Jahre brauchen, um entsprechende Kapazitäten liefern zu können. Insgesamt werden etwa 40 Milliarden Dollar an Investitionen benötigt, um die derzeitige Ölproduktion zu verdoppeln. Unsicherheiten innerhalb des Landes könnten die Bereitschaft bei Unternehmen senken, sich am Aufbau zu beteiligen.
mm.de: Mit welchen Problemen ist zu rechnen?
Müller: Experten gehen davon aus, dass der Irak langfristig politisch instabil bleiben wird. Machtkämpfe, Rachefeldzüge und Auseinandersetzungen zwischen den schiitischen, sunnitischen und kurdischen Bevölkerungsgruppen werden die Sicherheit auf Jahre beeinträchtigen.
Die USA haben zwar schon angedeutet, dass sie zunächst den Antiamerikanismus im Irak eindämmen wollen. Ob das ausreicht, um den tief sitzenden Ressentiments der Bevölkerung wirksam zu begegnen, ist zweifelhaft. Nach Prognosen auf Basis der Erfahrungen in Afghanistan muss mit vielen Jahren gerechnet werden, bis das Land vollständig unter Kontrolle ist.
Die US-Pläne, die von einer politischen Stabilisierung innerhalb von zwei Jahren ausgehen, sind zu optimistisch. Es spielt keine Rolle, ob der Krieg kurz oder lang sein wird: Der Irak bleibt nach einem Sieg der Amerikaner politisch instabil und ökonomisch schwer zu erschließen.
Dr. rer. pol. Friedemann Müller forscht am "Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit". Die unabhängige Einrichtung berät unter anderem den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung. Neben Energiepolitik zählen Globalisierungsfragen, Klimapolitik und internationale Umweltpolitik zu seinen Forschungsgebieten.
.
Und nach dem Krieg?
Von Winand von Petersdorff
Letztlich steckt hinter der Entscheidung der Vereinigten Staaten, einen Krieg gegen den Irak zu führen, eine Kosten-Nutzen-Abwägung, ein ökonomisches Kalkül. Hoffentlich. Der Nutzen: Die Welt wird befreit von einem Diktator, der seine Nachbarn bedroht, seine Bevölkerung schikaniert, an Massenvernichtungswaffen arbeitet und wichtige Ressourcen kontrolliert. Und die Kosten? Was kostet es, aus dem zerstörten Irak ein lebensfähiges und liebenswertes Mitglied der Völkergemeinschaft zu machen? Und damit zu einem, wie Präsident George W. Bush wortreich wunschträumte, „Beispiel für Freiheit", das die ganze Region inspiriert.
Der Tag nach dem Krieg
Die Sieger werden mit folgender Lage konfrontiert sein: Das Regime und mit ihm die staatlichen Institutionen sind entmachtet. Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, kurz: die Infrastruktur, sind zerstört. „Entweder wir vernichten die Infrastruktur, um das Schlachtfeld zu isolieren, oder sie zerstören sie, um uns aufzuhalten", sagte ein General der US-Streitkräfte im amerikanischen Magazin „The Atlantic". Wahrscheinlich werden die Volksgruppen des Landes, Kurden im Norden und Schiiten im Südosten, das Machtvakuum zu nutzen versuchen, um sich Einfluß und - gefährlicher noch - die gewaltigen Ölquellen zu sichern. Dazu kommt, daß die Grenzen zu den Nachbarn Iran und Türkei militärisch entblößt sind. Doch am drängendsten wird das gewaltige menschliche Leid sein: Verwundete, Verletzte, Verschüttete, Verhungernde, Flüchtlinge. Das alles müssen die Sieger managen - ein gewaltiges Aufgabenpaket in einem unübersichtlichen Land mit 24 Millionen Menschen.
Die Agenda
Am Anfang stehen Nothilfe, Friedenssicherung und die Erhaltung der staatlichen Integrität. Der frühere Nato-Kommandeur im Kosovo, Wesley Clark, sieht für Phase zwei folgende Aufgaben: Aufbau einer Polizei und einer Justiz, Hilfe beim Aufbau der Infrastruktur und vor allem der Ölindustrie, Vorbereitung einer Übergangsregierung und einer neuen Verfassung. In einer nächsten Stufe müßte zunächst das Schulsystem gesichert werden, um die neben dem Öl wichtigste Ressource des Landes zu stärken: das Humankapital. In den zehn Jahren nach dem Golfkrieg ist das Bildungsniveau gesunken. Ein Drittel der jungen Kinder wird nicht mehr zur Schule geschickt. 5000 neue Schulen braucht das Land, berichteten die UN schon vor drei Jahren. 8000 Schulgebäude müßten repariert und 150 000 Lehrer bezahlt werden.
Frieden sichern
Die Entmachtung Saddams und seiner Anhänger setzt gewaltige innenpolitische Zentrifugalkräfte frei. „Und ich weiß nicht, wie die gebändigt werden sollen", sagt der Irak-Experte Andreas Wimmer, Ethnologie-Professor an der UCLA in Los Angeles. Das Symbol schlimmer „Krieg-nach-dem-Krieg-Szenarien" ist die Stadt Kirkuk. Dort werden rund 45 Prozent des irakischen Öls gefördert. Hier lebten vor allem Kurden und türkischstämmige Iraker, bis Saddam sie vertrieb. Jetzt sind rund drei Viertel der Bewohner der Region arabischstämmig. Fest steht, daß die kurdischen Befreiungsorganisationen begehrlich nach Kirkuk schauen.
Doch nicht nur sie. Kürzlich schreckte der türkische Verteidigungsminister die arabische Region mit dem Hinweis auf, Kirkuk sei den Türken im Ersten Weltkrieg unrechtmäßig entrissen worden. Weitere Gefahren drohen, wenn die schiitischen Gruppen mit Unterstützung des Nachbarn Iran aufbegehren.
Die ökonomischen Fragen
Wie viele Besatzungssoldaten werden nötig sein, um Iran und die Türkei fernzuhalten, die Kurden und andere Volksgruppen zu befrieden und versprengte Teile der Armee ruhig zu halten? Und wie lange müssen sie bleiben? Wissenschaftler der amerikanischen Denkfabrik Brooking Institution vergleichen die Lage im Mittleren Osten mit Bosnien. Am Anfang setzte die Nato dort 50 000 Soldaten ein, was rund 10 Milliarden Dollar im Jahr kostete. Sechs Jahre später sind es immer noch 20 000 Uniformierte. Der Irak ist achtmal so groß wie Bosnien, hat sechsmal so viele Bewohner und unruhige Nachbarn an elend langen Grenzen.
Irak-Kenner Wimmer glaubt: „Amerika wird zur Kolonialmacht wider Willen." Mit anderen Worten: Das Militär bleibt lange und bestimmt im Land die Politik. Der Militäranalyst und Kriegsbefürworter Kenneth Pollack schätzt, in den ersten fünf Jahren würden 250 000 bis 300 000 Soldaten zur Friedenssicherung notwendig sein. Optimisten wagen die Prognosen, daß 75 000 Mann und wenige Jahre reichen könnten. William Nordhaus, Ökonomie-Professor an der Yale-Universität, rechnet auf dieser Basis im günstigsten Fall mit Gesamtkosten für die Friedenssicherung von 75 Milliarden Dollar, im schlechten Fall mit 200 Milliarden Dollar.
Einen Staat machen
In ungezügeltem Optimismus spricht die Bush-Administration davon, dem Land Frieden, Freiheit und Demokratie zu bringen. Hat es in Deutschland nicht schließlich auch geklappt? Der Schweizer Ethnologe Wimmer sagt dagegen: „Die Vorstellung, daß sich im Irak eine blühende Oase der Demokratie inmitten von lauter Despotien entwickeln könnte, ist verwegen." Sein ernüchterndes Fazit: Wer dort zuviel Demokratie wagt, riskiert die Stabilität.
Einen Staat machen
Es ist völlig offen, auf wen die Alliierten eigentlich setzen wollen für eine Regierungsbildung. Keine der zerstrittenen exilirakischen Gruppen spricht für die gesamte Bevölkerung. Die Siegermächte werden auf Mitglieder der schon jetzt herrschenden Baath-Partei und des Militärs setzen müssen, um die staatlichen Strukturen zu sichern. Schon der Gedanke daran treibt allerdings die Exil-Iraker zur Weißglut. Zur Zeit rekrutiert Amerika im Ausland lebende irakische Zivilisten, die nach dem Krieg helfen sollen, die Verwaltungen zu organisieren. 100 werden bereits trainiert.
Was Beobachter zusätzlich skeptisch stimmen muß: Versuche in Haiti oder Afghanistan zeigen, daß Amerika die Formel, wie man schnell eine Nation auf eigene Beine stellt, noch nicht gefunden hat. Je länger das aber dauert, desto höher sind die Kosten für die Siegermächte, desto schwerer sind die Risiken zu kalkulieren.
Aufbauen
Kürzlich sickerte in die Öffentlichkeit, daß Washington fünf amerikanische Baukonzerne gebeten hat, Angebote für den Wiederaufbau des Iraks abzugeben. Die Rede ist von einem Volumen von 900 Millionen Dollar. Nur: Das wird nicht reichen. Bei weitem nicht.
Wie hoch die Kosten werden, hängt davon ab, wie stark der Irak zerstört sein wird. Und das hängt von der Dauer des Krieges ab. Ein Vergleich: 1991 besuchte eine UN-Delegation das Land, um die Aufbaukosten nach dem Golfkrieg zu kalkulieren. 30 Milliarden Dollar seien nötig, um Straßen, Energie- und Wasserversorgung, Pipelines und die Ölindustrie wieder auf Vorkriegsniveau herzustellen, rechneten die Experten damals aus. Und soviel werde es jetzt mindestens wieder kosten, glaubt der ehemalige Präsidentenberater Nordhaus. Teurer wird es, wenn die Siegermächte ambitionierter sind und einen Marshall-Plan verwirklichen wollen. Das könnte dann auch mehr als 100 Milliarden Euro kosten.
Wer bezahlt?
Die unmittelbaren Kosten für den ersten Golfkrieg haben sich Amerika, Deutschland, die Golfstaaten und Saudi-Arabien weitgehend geteilt. Diesmal wird es anders sein. Sollten die Amerikaner zuschlagen, werden sie die größte finanzielle Last tragen müssen, besonders, wenn sie kein UN-Plazet bekommen. Hilfe können sie von England und Spanien erwarten. Saudi-Arabien und die Golfstaaten werden diesmal deutlich zurückhaltender sein.
Allerdings: Der Irak ist eines der ölreichsten Länder der Welt. Was liegt näher, als das Land selbst den Aufbau finanzieren zu lassen? Das unabhängige Washingtoner Congress Budget Office kommt in einer Berechnung für den Kongreß zu dem Schluß, daß da nicht viel zu holen ist. Die Erlöse aus dem Ölverkauf verwendet Bagdad, um im Rahmen des Brot-für-Öl-Programms unter anderem Nahrungsmittel für die darbende Bevölkerung zu kaufen. Die Not wird nach dem Krieg eher größer sein. Das Land benötigt gewaltige Investitionen (und das Opec-Plazet), um die Förderung hochfahren zu können.
Dabei bleibt unberücksichtigt, daß der Irak einen gewaltigen Schuldenberg aufgetürmt hat: Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) beziffert ihn auf 383 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr sechsmal soviel wie das Bruttoinlandsprodukt des Landes. Rund die Hälfte sind Forderungen zur Wiedergutmachung aus dem Golfkrieg 1991. Das Land muß die Schulden erlassen bekommen, damit die Ölerlöse für Versorgung und später für den Aufbau verwendet werden können, fordert die Washingtoner Denkfabrik (CSIS).
Ökonomische Folgekosten
Vieles hängt davon ab, wie lange der Krieg dauert und wie groß die Verwüstungen sind. Geht es schnell und ohne daß die Ölindustrie in Mitleidenschaft gezogen wird, dürfte der Ölpreis sinken mit stimulierenden Effekten für die Konjunktur. Dauert der Krieg dagegen lange, werden Ölfelder in Brand gesetzt, Nachbarländer mit einbezogen und die verschiedenen Volksgruppen in Aufruhr gesetzt, droht eine Katastrophe für die Konjunktur.
FAZ - 16.03.2003
Und nach dem Krieg?
Von Winand von Petersdorff
Letztlich steckt hinter der Entscheidung der Vereinigten Staaten, einen Krieg gegen den Irak zu führen, eine Kosten-Nutzen-Abwägung, ein ökonomisches Kalkül. Hoffentlich. Der Nutzen: Die Welt wird befreit von einem Diktator, der seine Nachbarn bedroht, seine Bevölkerung schikaniert, an Massenvernichtungswaffen arbeitet und wichtige Ressourcen kontrolliert. Und die Kosten? Was kostet es, aus dem zerstörten Irak ein lebensfähiges und liebenswertes Mitglied der Völkergemeinschaft zu machen? Und damit zu einem, wie Präsident George W. Bush wortreich wunschträumte, „Beispiel für Freiheit", das die ganze Region inspiriert.
Der Tag nach dem Krieg
Die Sieger werden mit folgender Lage konfrontiert sein: Das Regime und mit ihm die staatlichen Institutionen sind entmachtet. Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, kurz: die Infrastruktur, sind zerstört. „Entweder wir vernichten die Infrastruktur, um das Schlachtfeld zu isolieren, oder sie zerstören sie, um uns aufzuhalten", sagte ein General der US-Streitkräfte im amerikanischen Magazin „The Atlantic". Wahrscheinlich werden die Volksgruppen des Landes, Kurden im Norden und Schiiten im Südosten, das Machtvakuum zu nutzen versuchen, um sich Einfluß und - gefährlicher noch - die gewaltigen Ölquellen zu sichern. Dazu kommt, daß die Grenzen zu den Nachbarn Iran und Türkei militärisch entblößt sind. Doch am drängendsten wird das gewaltige menschliche Leid sein: Verwundete, Verletzte, Verschüttete, Verhungernde, Flüchtlinge. Das alles müssen die Sieger managen - ein gewaltiges Aufgabenpaket in einem unübersichtlichen Land mit 24 Millionen Menschen.
Die Agenda
Am Anfang stehen Nothilfe, Friedenssicherung und die Erhaltung der staatlichen Integrität. Der frühere Nato-Kommandeur im Kosovo, Wesley Clark, sieht für Phase zwei folgende Aufgaben: Aufbau einer Polizei und einer Justiz, Hilfe beim Aufbau der Infrastruktur und vor allem der Ölindustrie, Vorbereitung einer Übergangsregierung und einer neuen Verfassung. In einer nächsten Stufe müßte zunächst das Schulsystem gesichert werden, um die neben dem Öl wichtigste Ressource des Landes zu stärken: das Humankapital. In den zehn Jahren nach dem Golfkrieg ist das Bildungsniveau gesunken. Ein Drittel der jungen Kinder wird nicht mehr zur Schule geschickt. 5000 neue Schulen braucht das Land, berichteten die UN schon vor drei Jahren. 8000 Schulgebäude müßten repariert und 150 000 Lehrer bezahlt werden.
Frieden sichern
Die Entmachtung Saddams und seiner Anhänger setzt gewaltige innenpolitische Zentrifugalkräfte frei. „Und ich weiß nicht, wie die gebändigt werden sollen", sagt der Irak-Experte Andreas Wimmer, Ethnologie-Professor an der UCLA in Los Angeles. Das Symbol schlimmer „Krieg-nach-dem-Krieg-Szenarien" ist die Stadt Kirkuk. Dort werden rund 45 Prozent des irakischen Öls gefördert. Hier lebten vor allem Kurden und türkischstämmige Iraker, bis Saddam sie vertrieb. Jetzt sind rund drei Viertel der Bewohner der Region arabischstämmig. Fest steht, daß die kurdischen Befreiungsorganisationen begehrlich nach Kirkuk schauen.
Doch nicht nur sie. Kürzlich schreckte der türkische Verteidigungsminister die arabische Region mit dem Hinweis auf, Kirkuk sei den Türken im Ersten Weltkrieg unrechtmäßig entrissen worden. Weitere Gefahren drohen, wenn die schiitischen Gruppen mit Unterstützung des Nachbarn Iran aufbegehren.
Die ökonomischen Fragen
Wie viele Besatzungssoldaten werden nötig sein, um Iran und die Türkei fernzuhalten, die Kurden und andere Volksgruppen zu befrieden und versprengte Teile der Armee ruhig zu halten? Und wie lange müssen sie bleiben? Wissenschaftler der amerikanischen Denkfabrik Brooking Institution vergleichen die Lage im Mittleren Osten mit Bosnien. Am Anfang setzte die Nato dort 50 000 Soldaten ein, was rund 10 Milliarden Dollar im Jahr kostete. Sechs Jahre später sind es immer noch 20 000 Uniformierte. Der Irak ist achtmal so groß wie Bosnien, hat sechsmal so viele Bewohner und unruhige Nachbarn an elend langen Grenzen.
Irak-Kenner Wimmer glaubt: „Amerika wird zur Kolonialmacht wider Willen." Mit anderen Worten: Das Militär bleibt lange und bestimmt im Land die Politik. Der Militäranalyst und Kriegsbefürworter Kenneth Pollack schätzt, in den ersten fünf Jahren würden 250 000 bis 300 000 Soldaten zur Friedenssicherung notwendig sein. Optimisten wagen die Prognosen, daß 75 000 Mann und wenige Jahre reichen könnten. William Nordhaus, Ökonomie-Professor an der Yale-Universität, rechnet auf dieser Basis im günstigsten Fall mit Gesamtkosten für die Friedenssicherung von 75 Milliarden Dollar, im schlechten Fall mit 200 Milliarden Dollar.
Einen Staat machen
In ungezügeltem Optimismus spricht die Bush-Administration davon, dem Land Frieden, Freiheit und Demokratie zu bringen. Hat es in Deutschland nicht schließlich auch geklappt? Der Schweizer Ethnologe Wimmer sagt dagegen: „Die Vorstellung, daß sich im Irak eine blühende Oase der Demokratie inmitten von lauter Despotien entwickeln könnte, ist verwegen." Sein ernüchterndes Fazit: Wer dort zuviel Demokratie wagt, riskiert die Stabilität.
Einen Staat machen
Es ist völlig offen, auf wen die Alliierten eigentlich setzen wollen für eine Regierungsbildung. Keine der zerstrittenen exilirakischen Gruppen spricht für die gesamte Bevölkerung. Die Siegermächte werden auf Mitglieder der schon jetzt herrschenden Baath-Partei und des Militärs setzen müssen, um die staatlichen Strukturen zu sichern. Schon der Gedanke daran treibt allerdings die Exil-Iraker zur Weißglut. Zur Zeit rekrutiert Amerika im Ausland lebende irakische Zivilisten, die nach dem Krieg helfen sollen, die Verwaltungen zu organisieren. 100 werden bereits trainiert.
Was Beobachter zusätzlich skeptisch stimmen muß: Versuche in Haiti oder Afghanistan zeigen, daß Amerika die Formel, wie man schnell eine Nation auf eigene Beine stellt, noch nicht gefunden hat. Je länger das aber dauert, desto höher sind die Kosten für die Siegermächte, desto schwerer sind die Risiken zu kalkulieren.
Aufbauen
Kürzlich sickerte in die Öffentlichkeit, daß Washington fünf amerikanische Baukonzerne gebeten hat, Angebote für den Wiederaufbau des Iraks abzugeben. Die Rede ist von einem Volumen von 900 Millionen Dollar. Nur: Das wird nicht reichen. Bei weitem nicht.
Wie hoch die Kosten werden, hängt davon ab, wie stark der Irak zerstört sein wird. Und das hängt von der Dauer des Krieges ab. Ein Vergleich: 1991 besuchte eine UN-Delegation das Land, um die Aufbaukosten nach dem Golfkrieg zu kalkulieren. 30 Milliarden Dollar seien nötig, um Straßen, Energie- und Wasserversorgung, Pipelines und die Ölindustrie wieder auf Vorkriegsniveau herzustellen, rechneten die Experten damals aus. Und soviel werde es jetzt mindestens wieder kosten, glaubt der ehemalige Präsidentenberater Nordhaus. Teurer wird es, wenn die Siegermächte ambitionierter sind und einen Marshall-Plan verwirklichen wollen. Das könnte dann auch mehr als 100 Milliarden Euro kosten.
Wer bezahlt?
Die unmittelbaren Kosten für den ersten Golfkrieg haben sich Amerika, Deutschland, die Golfstaaten und Saudi-Arabien weitgehend geteilt. Diesmal wird es anders sein. Sollten die Amerikaner zuschlagen, werden sie die größte finanzielle Last tragen müssen, besonders, wenn sie kein UN-Plazet bekommen. Hilfe können sie von England und Spanien erwarten. Saudi-Arabien und die Golfstaaten werden diesmal deutlich zurückhaltender sein.
Allerdings: Der Irak ist eines der ölreichsten Länder der Welt. Was liegt näher, als das Land selbst den Aufbau finanzieren zu lassen? Das unabhängige Washingtoner Congress Budget Office kommt in einer Berechnung für den Kongreß zu dem Schluß, daß da nicht viel zu holen ist. Die Erlöse aus dem Ölverkauf verwendet Bagdad, um im Rahmen des Brot-für-Öl-Programms unter anderem Nahrungsmittel für die darbende Bevölkerung zu kaufen. Die Not wird nach dem Krieg eher größer sein. Das Land benötigt gewaltige Investitionen (und das Opec-Plazet), um die Förderung hochfahren zu können.
Dabei bleibt unberücksichtigt, daß der Irak einen gewaltigen Schuldenberg aufgetürmt hat: Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) beziffert ihn auf 383 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr sechsmal soviel wie das Bruttoinlandsprodukt des Landes. Rund die Hälfte sind Forderungen zur Wiedergutmachung aus dem Golfkrieg 1991. Das Land muß die Schulden erlassen bekommen, damit die Ölerlöse für Versorgung und später für den Aufbau verwendet werden können, fordert die Washingtoner Denkfabrik (CSIS).
Ökonomische Folgekosten
Vieles hängt davon ab, wie lange der Krieg dauert und wie groß die Verwüstungen sind. Geht es schnell und ohne daß die Ölindustrie in Mitleidenschaft gezogen wird, dürfte der Ölpreis sinken mit stimulierenden Effekten für die Konjunktur. Dauert der Krieg dagegen lange, werden Ölfelder in Brand gesetzt, Nachbarländer mit einbezogen und die verschiedenen Volksgruppen in Aufruhr gesetzt, droht eine Katastrophe für die Konjunktur.
FAZ - 16.03.2003
Dem CEO von Goldcorp. hat das plunge protection team wohl auch ins Gehirn gesch...en.
Wenn der so weitertönt verkauf ich meine Goldcorp. lieber und tausche in Durban Deep.
Der Kerl hat zuviel George Dabbeluh Interviews gesehen...das geht auf`s Gehirn auf die Dauer.
Press Release
Source: Goldcorp
Goldcorp Sends Letter to Urge Prime Minister Chretien
to Join U.S. President Bush`s War on Terrorism, Now!
Wednesday March 19, 3:28 pm ET
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--March 19, 2003--The following letter was sent to Prime
Minister Jean Chretien from Robert R. McEwen, Chairman & CEO of Goldcorp (NYSE:GG -
News; TSX:G - News).
-0-
Honorable Jean Chretien
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington St.
Ottawa, K1A 0A2
Dear Prime Minister:
The dream of peace, democracy and civil rights in the Middle East, ever so elusive, has never
been closer. You and all Canadians have a responsibility to help shape this dream. To make
this world vision a reality, the dictator Saddam Hussein must go, Now!
Your opposition to the US led coalition guarantees Canada no role in shaping the future of this
region. And it will also transform our once longest undefended border in the world into a
formidable barrier to trade, capital, travel and friendship with our largest trading partner. The
cost to all Canadians will be very significant!
The opportunity to support the US initiative must be done today before it starts. Call President
Bush, tell him you and Canada support his plan. Offer Canada`s diplomatic skills in shaping the
renewal and growth of this region.
Yours truly,
Robert R. McEwen
Chairman & CEO
Cc: Mr. George W. Bush, President of the United States of America
Mr. Michael F. Kergin, Canadian Ambassador to the United States
Mr. Paul Cellucci, United States Ambassador to Canada
Mr. Stephen Harper, Canadian Alliance
Editor, Financial Post
Editor, Globe & Mail
Editor, Toronto Star
Editor, Ottawa Citizen
President, Canada Newswire
Wenn der so weitertönt verkauf ich meine Goldcorp. lieber und tausche in Durban Deep.
Der Kerl hat zuviel George Dabbeluh Interviews gesehen...das geht auf`s Gehirn auf die Dauer.
Press Release
Source: Goldcorp
Goldcorp Sends Letter to Urge Prime Minister Chretien
to Join U.S. President Bush`s War on Terrorism, Now!
Wednesday March 19, 3:28 pm ET
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--March 19, 2003--The following letter was sent to Prime
Minister Jean Chretien from Robert R. McEwen, Chairman & CEO of Goldcorp (NYSE:GG -
News; TSX:G - News).
-0-
Honorable Jean Chretien
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington St.
Ottawa, K1A 0A2
Dear Prime Minister:
The dream of peace, democracy and civil rights in the Middle East, ever so elusive, has never
been closer. You and all Canadians have a responsibility to help shape this dream. To make
this world vision a reality, the dictator Saddam Hussein must go, Now!
Your opposition to the US led coalition guarantees Canada no role in shaping the future of this
region. And it will also transform our once longest undefended border in the world into a
formidable barrier to trade, capital, travel and friendship with our largest trading partner. The
cost to all Canadians will be very significant!
The opportunity to support the US initiative must be done today before it starts. Call President
Bush, tell him you and Canada support his plan. Offer Canada`s diplomatic skills in shaping the
renewal and growth of this region.
Yours truly,
Robert R. McEwen
Chairman & CEO
Cc: Mr. George W. Bush, President of the United States of America
Mr. Michael F. Kergin, Canadian Ambassador to the United States
Mr. Paul Cellucci, United States Ambassador to Canada
Mr. Stephen Harper, Canadian Alliance
Editor, Financial Post
Editor, Globe & Mail
Editor, Toronto Star
Editor, Ottawa Citizen
President, Canada Newswire
@Sovereign
Artikel über Durban:
www.mips1.net/MGGold.nsf/Current/4225685F0043D1B242256CEE003AC069?OpenDocument
JOHANNESBURG – Durban Roodepoort Deep [JSE UR], the South African gold producer which claimed for itself the sobriquet - Roodepoort Rocket - owing to its gold price leverage, could be making a U-Turn for earth following an steady improvement in the value of the rand. The company earlier today conceded the rand strength was affecting its operations in the March quarter, but analysts say that statement doesn’t quite address the severity of the risk in the counter.
UR], the South African gold producer which claimed for itself the sobriquet - Roodepoort Rocket - owing to its gold price leverage, could be making a U-Turn for earth following an steady improvement in the value of the rand. The company earlier today conceded the rand strength was affecting its operations in the March quarter, but analysts say that statement doesn’t quite address the severity of the risk in the counter.
Amid a strengthening rand, a marginal gold producer such as Durban Roodepoort Deep (DRD) runs the risk of serious losses. At the same time, another sudden weakening in the rand changes again the picture for a company that is handmade for trading. No wonder it’s so popular in the US where the majority of its shareholders are situated.
Based on its previous quarter’s performance, in which total cash costs averaged R85,600/kg, DRD is in a precarious position. The current rand gold price is R88,000/kg providing the slimmest of margins; moreover, there is little room for error at mines where the company is turning a profit.
DRD’s consolidated figures are largely driven by its exposure to the Hartebeestfontein mine in the North West province. The mine provides roughly 56 percent of total gold production. However, on the evidence of the last two quarter’s total cash costs – R94,000/kg in the December quarter and R89,000/kg in the September quarter - that production is now likely unprofitable.
ERPM, the mine Durban Deep recently bought in joint venture with Khumo Bathong, a black empowerment company, totalled cash costs of R127,000/kg even before the fire of the current quarter which has knocked out significant production. Clearly, this mine will not be the profit centre it was hoped to be especially since labour is no longer contracted out. Wage talks, scheduled to start in May, will be a major complicating factor for DRD.
Much of the company’s margin depends on the smooth running of its Blyvooruitzicht mine which produced average total cash costs of R78,000 per kilogram. Surface retreatment operations also remain reasonably profitable based on last quarter’s figures. While it is clearly unfair to claim DRD will be loss-making this quarter based on the previous quarter’s costs, the exercise illustrates the dangers of its marginality.
Bullet proof gold company
DRD ought to bottle and sell whatever immunises itself against all manner of slings and arrows that come its way. For example, on the day its company secretary ratted on chairman and chief executive, Mark Wellesley-Wood, the firm’s stock gained a couple of percent courtesy of its predominantly US shareholder base’s interest in the rising gold price. Even as company officials prepared to meet with the Johannesburg Stock Exchange (JSE) to explain insider trading accusations, Durban Deep raced up another 4.3 percent and therefore becoming one of the JSE’s top gold performers.
Is it possible the company’s shareholders are oblivious to Durban Deep’s protracted battle with the Kebble family, the owners of JCI Ltd which has a large stake in JSE-listed Western Areas? It’s true that a significant part of its 80 percent offshore (non-South African) shareholder base are drawn from the retail sector. “These are US dentists and the like who don’t have access to wire services that report on DRD’s activities,” one local analyst said. Or is it that shareholders simply don’t care what happens to the company because Durban Deep is a share to trade rather than own. How else explain a share price performance that appears completely out of kilter with the company’s situation.
The company’s situation appears to be serious. Last week, company secretary, Maryna Eloff, resigned after circulating allegations of certain insider trading activities involving the Durban Deep directorate. Eloff’s parting shot was to address her letter of resignation to the JSE president, Russell Loubser - an act which triggered Monday’s meeting. Should Eloff’s comments prove true, the outcome would be crippling to Wellesley-Wood who has spent months hoping to prove he has restored corporate governance standards at the company following the departure of Roger Kebble, former Durban Deep chairman.
Analysts believe Durban Deep is still liquid – it raised about $65 million of which a large portion is now committed – but the company really stands or falls on exogenous factors such as rand depreciation and, of course, the gold price.
Artikel über Durban:
www.mips1.net/MGGold.nsf/Current/4225685F0043D1B242256CEE003AC069?OpenDocument
JOHANNESBURG – Durban Roodepoort Deep [JSE
 UR], the South African gold producer which claimed for itself the sobriquet - Roodepoort Rocket - owing to its gold price leverage, could be making a U-Turn for earth following an steady improvement in the value of the rand. The company earlier today conceded the rand strength was affecting its operations in the March quarter, but analysts say that statement doesn’t quite address the severity of the risk in the counter.
UR], the South African gold producer which claimed for itself the sobriquet - Roodepoort Rocket - owing to its gold price leverage, could be making a U-Turn for earth following an steady improvement in the value of the rand. The company earlier today conceded the rand strength was affecting its operations in the March quarter, but analysts say that statement doesn’t quite address the severity of the risk in the counter. Amid a strengthening rand, a marginal gold producer such as Durban Roodepoort Deep (DRD) runs the risk of serious losses. At the same time, another sudden weakening in the rand changes again the picture for a company that is handmade for trading. No wonder it’s so popular in the US where the majority of its shareholders are situated.
Based on its previous quarter’s performance, in which total cash costs averaged R85,600/kg, DRD is in a precarious position. The current rand gold price is R88,000/kg providing the slimmest of margins; moreover, there is little room for error at mines where the company is turning a profit.
DRD’s consolidated figures are largely driven by its exposure to the Hartebeestfontein mine in the North West province. The mine provides roughly 56 percent of total gold production. However, on the evidence of the last two quarter’s total cash costs – R94,000/kg in the December quarter and R89,000/kg in the September quarter - that production is now likely unprofitable.
ERPM, the mine Durban Deep recently bought in joint venture with Khumo Bathong, a black empowerment company, totalled cash costs of R127,000/kg even before the fire of the current quarter which has knocked out significant production. Clearly, this mine will not be the profit centre it was hoped to be especially since labour is no longer contracted out. Wage talks, scheduled to start in May, will be a major complicating factor for DRD.
Much of the company’s margin depends on the smooth running of its Blyvooruitzicht mine which produced average total cash costs of R78,000 per kilogram. Surface retreatment operations also remain reasonably profitable based on last quarter’s figures. While it is clearly unfair to claim DRD will be loss-making this quarter based on the previous quarter’s costs, the exercise illustrates the dangers of its marginality.
Bullet proof gold company
DRD ought to bottle and sell whatever immunises itself against all manner of slings and arrows that come its way. For example, on the day its company secretary ratted on chairman and chief executive, Mark Wellesley-Wood, the firm’s stock gained a couple of percent courtesy of its predominantly US shareholder base’s interest in the rising gold price. Even as company officials prepared to meet with the Johannesburg Stock Exchange (JSE) to explain insider trading accusations, Durban Deep raced up another 4.3 percent and therefore becoming one of the JSE’s top gold performers.
Is it possible the company’s shareholders are oblivious to Durban Deep’s protracted battle with the Kebble family, the owners of JCI Ltd which has a large stake in JSE-listed Western Areas? It’s true that a significant part of its 80 percent offshore (non-South African) shareholder base are drawn from the retail sector. “These are US dentists and the like who don’t have access to wire services that report on DRD’s activities,” one local analyst said. Or is it that shareholders simply don’t care what happens to the company because Durban Deep is a share to trade rather than own. How else explain a share price performance that appears completely out of kilter with the company’s situation.
The company’s situation appears to be serious. Last week, company secretary, Maryna Eloff, resigned after circulating allegations of certain insider trading activities involving the Durban Deep directorate. Eloff’s parting shot was to address her letter of resignation to the JSE president, Russell Loubser - an act which triggered Monday’s meeting. Should Eloff’s comments prove true, the outcome would be crippling to Wellesley-Wood who has spent months hoping to prove he has restored corporate governance standards at the company following the departure of Roger Kebble, former Durban Deep chairman.
Analysts believe Durban Deep is still liquid – it raised about $65 million of which a large portion is now committed – but the company really stands or falls on exogenous factors such as rand depreciation and, of course, the gold price.
#288
Wieder ein bash-Versuch um DROOY kaputt zu reden. Ich würde nichts auf das Geschwafel geben. OK, DROOY ist ein Hochkostenproduzent, aber die Bilanz ist mE solide und steckt nicht voller etwaiger böser Überraschungen...im Gegensatz zu einer Menge Aktien aus dem Nichtgoldminensektor...die sollten sich die Herren Analysten mal ansehen, bevor sie über DROOY herziehen...
Wieder ein bash-Versuch um DROOY kaputt zu reden. Ich würde nichts auf das Geschwafel geben. OK, DROOY ist ein Hochkostenproduzent, aber die Bilanz ist mE solide und steckt nicht voller etwaiger böser Überraschungen...im Gegensatz zu einer Menge Aktien aus dem Nichtgoldminensektor...die sollten sich die Herren Analysten mal ansehen, bevor sie über DROOY herziehen...

@Sovereign: falscher Thread!!!, der arme Konradi
leidet schon genug, und jetzt auch noch so ´was.
Grüße aus dem trüben Hamburg,
passend zu den Ereignissen des Tages
Die Achse des Bösen ist in Wahrheit ein Kreis,
in dessen Mittelpunkt das Capitol steht:
Mal sehen, wie das Strategiespiel Mr. Wofowitz´s
und seiner "Think Tank"-Genossen weitergeht.
Willkommen in der Welt der "pax americana"
leidet schon genug, und jetzt auch noch so ´was.
Grüße aus dem trüben Hamburg,
passend zu den Ereignissen des Tages
Die Achse des Bösen ist in Wahrheit ein Kreis,
in dessen Mittelpunkt das Capitol steht:
Mal sehen, wie das Strategiespiel Mr. Wofowitz´s
und seiner "Think Tank"-Genossen weitergeht.
Willkommen in der Welt der "pax americana"
#290 All Black
"Willkommen in der Welt der "pax americana""
Irgendwie muß ich bei der neuen Sprachdiktion der USA an das "Neusprech" aus George Orwells 1984 denken...besonders nett sind die "Freedom Fries" statt "French Fries"...bei Orwell hieß der billige Fusel "Victory Gin"...
"Willkommen in der Welt der "pax americana""
Irgendwie muß ich bei der neuen Sprachdiktion der USA an das "Neusprech" aus George Orwells 1984 denken...besonders nett sind die "Freedom Fries" statt "French Fries"...bei Orwell hieß der billige Fusel "Victory Gin"...

@ allblack + Sovereign
@Sovereign: falscher Thread!!!, der arme Konradi
leidet schon genug, und jetzt auch noch so ´was.
mach Dir keine Sorgen, allblack,
Sovereign ist mir immer herzlich willkommen
Ich heiße ja nicht Angela Merkel ...
- Soll heißen: man kann politisch durchaus konträr sein
und sich trotzdem freundlich respektieren.
Im Übrigen kannst Du mir ruhig glauben, daß ich mir bei den Fernsehbildern
aus Bagdad nicht gerade vor Begeisterung auf die Knie schlage ...
Gruß Konradi
@Sovereign: falscher Thread!!!, der arme Konradi
leidet schon genug, und jetzt auch noch so ´was.
mach Dir keine Sorgen, allblack,
Sovereign ist mir immer herzlich willkommen

Ich heiße ja nicht Angela Merkel ...

- Soll heißen: man kann politisch durchaus konträr sein
und sich trotzdem freundlich respektieren.
Im Übrigen kannst Du mir ruhig glauben, daß ich mir bei den Fernsehbildern
aus Bagdad nicht gerade vor Begeisterung auf die Knie schlage ...
Gruß Konradi
.
Und sie zittern auf der Stelle
Großanleger halten sich zurück, Analysten verstehen die Aktienwelt nicht mehr, Tagesspekulanten und Trendjäger beherrschen die Börse. Eine echte Erholung wird noch Jahre dauern
Von Marc Brost und Robert von Heusinger
Als die Börse so tief gefallen war wie seit acht Jahren nicht mehr, gab Andreas Utermann eine ungewöhnliche Anweisung: Der Chefinvestor der Allianz Dresdner Asset Management (Adam) ließ die Computerschirme ausschalten. Mehr als 350 Milliarden Euro steuert Utermann von seinen Büros in London, Frankfurt oder New York aus, mehr als 330 Portfolio-Manager der Allianz berichten ihm täglich, in welchen Aktien sie das Geld der Versicherten oder Fondskunden anlegen. Ihr wichtigstes Hilfsmittel sind die Kursinformationen der Computerterminals, ihre wichtigste Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben.
Doch von Ruhe kann an der Börse in diesen Tagen keine Rede sein.
Rot, rot, rot, meldeten die Computer in der vergangenen Woche, sieben Tage hintereinander krachten die Börsen weltweit – und niemand wusste, warum. „We can’t bear watching these screens anymore“, stöhnten die Londoner Adam-Manager, „wir können es einfach nicht mehr sehen“. Ungläubiges Erstaunen über den Absturz der Kurse, fassungsloses Bangen, wie tief die Aktien noch fallen werden. Wenn selbst Finanzprofis den Mut verlieren, muss eine Entscheidung her. Also: Computer aus. Und wenn es nur symbolisch ist. Das war am Mittwoch.
Grün, grün, grün, melden die Terminals seit Donnerstag vergangener Woche. Die Kurse steigen, und zwar rasant. Der europäische Aktienindex EuroStoxx 50 gewann binnen vier Tagen mehr als 20 Prozent, der deutsche Dax mehr als 15. Gut möglich, dass die Börse auch in den kommenden Tagen zulegt. Zu tief sind vor allem die deutschen Aktien gefallen.
Allerdings: Nichts spricht dafür, dass es nach einem schnellen Anstieg genauso schnell weitergeht. Im Gegenteil. Die Aktionäre werden sich an magere Jahre gewöhnen müssen.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken
Es gibt zwei unterschiedliche Erklärungen für das Jojo der Kurse. Die erste: Die Angst vor einem Krieg im Irak hat die Kurse zu stark abstürzen lassen. Nun sehen die Börsianer, wie tief die Aktien vor allem in Europa stehen, sie spekulieren auf die Zeit nach einem Krieg. Die Dividendenrendite der Unternehmen in den großen europäischen Indizes übersteigt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen, das gab es zuletzt in den fünfziger Jahren.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Analystenschätzungen für 2004 liegt für den Dax bei neun – so niedrig wie seit Anfang der Achtziger nicht mehr. Würde man die großen deutschen Unternehmen in ihre Einzelteile zerlegen und verkaufen, wären sie mehr wert, als sie als Ganzes derzeit an der Börse kosten. Günstige Bewertungen locken Börsianer immer. Also werden jetzt Aktien gekauft. Also steigen jetzt die Kurse.
Es ist das Szenario der Optimisten.
Die zweite Erklärung für das dramatische Ab und Auf: Selbst die Finanzprofis haben den Überblick verloren. Sie haben resigniert und wissen nicht, worauf sie sich verlassen sollen. Der Markt ist in der Hand von Spekulanten. Diese haben auf einen langwierigen Konflikt gewettet, mit steigenden Ölpreisen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Deshalb krachten die Kurse, deshalb erreichte der Index der Investmentbank Credit Suisse First Boston, die wöchentlich den Risikoappetit der globalen Investoren misst, zuletzt fast Panikniveau.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken – dann steigen die Kurse plötzlich kräftig. Vergangenen Donnerstag hieß es, die Vereinigten Staaten stünden in Geheimverhandlungen mit irakischen Generälen. Es war das Zeichen zum Kauf. Langfristig orientierte Investoren dagegen, die sonst die hektischen Kursausschläge ausgleichen – also Versicherer, Fondsgesellschaften oder Privatanleger –, bleiben dem Aktienmarkt fern. So wie nach der Ölkrise 1973/74: Damals brauchte die Börse fast eine Anlegergeneration, um sich zu erholen. Wegen des niedrigen Handelsvolumens schwankten die Kurse heftig, starken Einbrüchen folgten regelmäßig kräftige Gewinne. Bis die Kurse wieder krachten.
Es ist das Szenario der Pessimisten. Und es ist ziemlich nah an der Realität.
An der Börse herrscht eine Situation wie in den letzten Tagen vor dem Platzen der großen Spekulationsblase am Aktienmarkt – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Im Frühjahr 2000 schwärmten die Ökonomen von den Segnungen der New Economy mit ihrem unendlichen Wachstum. Die Kurse kletterten und kletterten, obwohl sie schon so hoch waren wie nie zuvor. Fondsmanager und Analysten starrten auf ihre Computerschirme und verstanden die Welt nicht mehr. Drei Jahre später sind sie ebenso ratlos.
Die Fondsmanager und Analysten haben den Glauben an die Bewertungsrelationen verloren. „Die haben Ende der neunziger Jahre als Richtschnur versagt, warum sollte man sich jetzt auf sie verlassen?“, fragt Conrad Mattern, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Activest. Die Aktienanalysten von ABN Amro stellen ihren verunsicherten Kunden gar die provokante Frage, ob Aktien überhaupt noch fundamental zu bewerten seien. Die meisten Anleger handelten nur noch nach schnell entworfenen Taktiken, wie Währungsspekulanten.
„Seit 1997 können Investoren mit Trendfolgemodellen die Aktienindizes schlagen“, sagt Jürgen Callies, Leiter Research bei der Fondsgesellschaft MEAG. Während früher die Unternehmensgewinne die Hauptrolle spielten, seien seit sechs Jahren prozyklische Strategien immer erfolgreicher. Das heißt: Man kauft, wenn die Kurse steigen, und verkauft, wenn die Kurse fallen. Damit ähneln Aktien tatsächlich Devisen: Bis heute gibt es keine Theorie, die erklärt, warum sich Währungen über Jahre anders entwickeln, als volkswirtschaftliche Daten vorgeben.
Vor allem mit deutschen Aktien wird gern gezockt. „Wenn große Investoren schnell Aktien verkaufen wollen, suchen sie sich den deutschen Markt aus“, sagt Peter Knacke, Wertpapierstratege der Commerzbank. Das hat verschiedene Gründe: In Deutschland haben die Verkäufer nach zwei Tagen das Geld auf dem Konto, in anderen Ländern gelten zum Teil längere Fristen. Und: Die deutsch-schweizerische Terminbörse Eurex ist mittlerweile der größte Handelsplatz für Optionsgeschäfte, mit denen sich die Finanzprofis gegen Kursschwankungen absichern. Je größer das Handelsvolumen an der Terminbörse, desto größer sind auch die Kursschwankungen am normalen Aktienmarkt.
Das Ratespiel heißt: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien?
Mehr als 70 Prozent hat der Dax seit dem Höchststand vor drei Jahren verloren. Der japanische Topix, der ebenfalls 70 Prozent verlor, hat dafür 13 Jahre gebraucht. Der britische Footsie wiederum ist seit dem Hoch vom März 2000 um 50 Prozent gefallen, der amerikanische Dow Jones gar nur um 30.
Die kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Tage haben im besten Fall die Wende markiert. Im schlechtesten Fall waren sie nur die fünfte Gegenbewegung in dem seit drei Jahren gültigen Abwärtstrend. Auf alle Fälle sind sie kein Aufbruchsignal, dafür bleiben die Rahmenbedingungen zu schlecht – ganz unabhängig vom Ausgang des Irak-Konflikts.
So sind die krisengeschüttelten Banken und Versicherer im Dax – im Gegensatz zu anderen Indizes – überproportional vertreten. Die Banken aber leiden unter der Rekordzahl an Firmenpleiten, sie müssen so viele Kredite abschreiben wie selten zuvor. Die Versicherer wiederum leiden, weil sie so viele Aktien besitzen, speziell Bankwerte. Die Verflechtung der Geldhäuser ist ein Teufelskreis. Kein Wunder, dass drei der vier schlechtesten Dax-Werte der vergangenen zwölf Monate Finanzwerte sind: HypoVereinsbank (minus 80 Prozent), Allianz (minus 80 Prozent), Münchener Rück (minus 75 Prozent).
Nur mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen. Dann steigen die Gewinne der Unternehmen, gehen die Pleiten zurück und schreiben die Banken weniger Kredite ab. Dann steigen die Gewinne der Geldhäuser, und damit steigt der Aktienmarkt insgesamt. Doch danach sieht es nicht aus.
„Warum fallen die Renditen der Staatsanleihen auf ein 40-Jahres-Tief und die der Unternehmensanleihen auf ein 35-Jahres-Tief, während gleichzeitig die Aktienkurse krachen?“, fragt Michael Hartnett, Aktienstratege bei Merrill Lynch. „Weil alle die Deflation erwarten“ – also fallende Preise, gepaart mit Rezession. Es sind die Nachwehen der gigantischen Aktienblase: Das wachsende Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten und der Verfall des Dollarkurses, die Zurückhaltung der amerikanischen Verbraucher und der überteuerte US-Immobilienmarkt. All das spricht nicht gerade für Impulse aus Amerika. Und dass Europa aus sich heraus Wachstum entfalten könnte, wagt niemand zu hoffen.
So lautet das beliebteste Ratespiel unter den Geldmanagern derzeit: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien? Die Privatanleger sind immer nur Trendverstärker, nie Initiatoren einer Wende. Und institutionelle Investoren wie Versicherer oder Pensionsfonds überdenken im Augenblick ihr Engagement an der Börse. So ist die Aktienquote der latent aktienbegeisterten britischen Lebensversicherer auf 50 Prozent gesunken, das niedrigste Niveau seit zwei Jahrzehnten. „Wahrscheinlich wird der Gesetzgeber in einigen Ländern künftig für Altersvorsorgeprodukte sogar niedrigere Quoten vorschreiben“, vermutet Adam-Chefinvestor Utermann. Viele Unternehmen hätten einen zu großen Teil ihrer Reserven in Aktien angelegt. „Jetzt gibt es bei den Pensionsverpflichtungen große Deckungslücken.“ Wenn die langfristigen Investoren fehlen, fällt es den Hegdefonds leichter, mit ihren Wetten den Markt zu dominieren.
Selbst ohne diese Probleme müssten sich Altaktionäre lange gedulden. Langfristig wachsen die Gewinne der Unternehmen nicht schneller als die Volkswirtschaft an sich – im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte um drei bis vier Prozent jährlich. Rechnet man noch die Inflation und eine Zitterprämie hinzu, die jeder Käufer verlangt, um überhaupt in riskante Aktien zu investieren und nicht in sichere Staatsanleihen, kommt eine Rendite von sieben bis acht Prozent im Jahr heraus. Jedoch: Selbst bei Steigerungen von acht Prozent jährlich würde der Dax 16 Jahre benötigen, um sein Allzeithoch von 8136 Punkten überhaupt wieder zu erreichen.
Anderthalb Jahrzehnte hat es in der Vergangenheit im Schnitt gedauert, bis die Aktienkurse nach großen Crashs wieder ihr altes Niveau erreichten. Nach dem Crash 1929 waren es sogar fast 30 Jahre.
DIE ZEIT - 13/2003
Und sie zittern auf der Stelle
Großanleger halten sich zurück, Analysten verstehen die Aktienwelt nicht mehr, Tagesspekulanten und Trendjäger beherrschen die Börse. Eine echte Erholung wird noch Jahre dauern
Von Marc Brost und Robert von Heusinger
Als die Börse so tief gefallen war wie seit acht Jahren nicht mehr, gab Andreas Utermann eine ungewöhnliche Anweisung: Der Chefinvestor der Allianz Dresdner Asset Management (Adam) ließ die Computerschirme ausschalten. Mehr als 350 Milliarden Euro steuert Utermann von seinen Büros in London, Frankfurt oder New York aus, mehr als 330 Portfolio-Manager der Allianz berichten ihm täglich, in welchen Aktien sie das Geld der Versicherten oder Fondskunden anlegen. Ihr wichtigstes Hilfsmittel sind die Kursinformationen der Computerterminals, ihre wichtigste Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben.
Doch von Ruhe kann an der Börse in diesen Tagen keine Rede sein.
Rot, rot, rot, meldeten die Computer in der vergangenen Woche, sieben Tage hintereinander krachten die Börsen weltweit – und niemand wusste, warum. „We can’t bear watching these screens anymore“, stöhnten die Londoner Adam-Manager, „wir können es einfach nicht mehr sehen“. Ungläubiges Erstaunen über den Absturz der Kurse, fassungsloses Bangen, wie tief die Aktien noch fallen werden. Wenn selbst Finanzprofis den Mut verlieren, muss eine Entscheidung her. Also: Computer aus. Und wenn es nur symbolisch ist. Das war am Mittwoch.
Grün, grün, grün, melden die Terminals seit Donnerstag vergangener Woche. Die Kurse steigen, und zwar rasant. Der europäische Aktienindex EuroStoxx 50 gewann binnen vier Tagen mehr als 20 Prozent, der deutsche Dax mehr als 15. Gut möglich, dass die Börse auch in den kommenden Tagen zulegt. Zu tief sind vor allem die deutschen Aktien gefallen.
Allerdings: Nichts spricht dafür, dass es nach einem schnellen Anstieg genauso schnell weitergeht. Im Gegenteil. Die Aktionäre werden sich an magere Jahre gewöhnen müssen.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken
Es gibt zwei unterschiedliche Erklärungen für das Jojo der Kurse. Die erste: Die Angst vor einem Krieg im Irak hat die Kurse zu stark abstürzen lassen. Nun sehen die Börsianer, wie tief die Aktien vor allem in Europa stehen, sie spekulieren auf die Zeit nach einem Krieg. Die Dividendenrendite der Unternehmen in den großen europäischen Indizes übersteigt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen, das gab es zuletzt in den fünfziger Jahren.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Analystenschätzungen für 2004 liegt für den Dax bei neun – so niedrig wie seit Anfang der Achtziger nicht mehr. Würde man die großen deutschen Unternehmen in ihre Einzelteile zerlegen und verkaufen, wären sie mehr wert, als sie als Ganzes derzeit an der Börse kosten. Günstige Bewertungen locken Börsianer immer. Also werden jetzt Aktien gekauft. Also steigen jetzt die Kurse.
Es ist das Szenario der Optimisten.
Die zweite Erklärung für das dramatische Ab und Auf: Selbst die Finanzprofis haben den Überblick verloren. Sie haben resigniert und wissen nicht, worauf sie sich verlassen sollen. Der Markt ist in der Hand von Spekulanten. Diese haben auf einen langwierigen Konflikt gewettet, mit steigenden Ölpreisen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Deshalb krachten die Kurse, deshalb erreichte der Index der Investmentbank Credit Suisse First Boston, die wöchentlich den Risikoappetit der globalen Investoren misst, zuletzt fast Panikniveau.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken – dann steigen die Kurse plötzlich kräftig. Vergangenen Donnerstag hieß es, die Vereinigten Staaten stünden in Geheimverhandlungen mit irakischen Generälen. Es war das Zeichen zum Kauf. Langfristig orientierte Investoren dagegen, die sonst die hektischen Kursausschläge ausgleichen – also Versicherer, Fondsgesellschaften oder Privatanleger –, bleiben dem Aktienmarkt fern. So wie nach der Ölkrise 1973/74: Damals brauchte die Börse fast eine Anlegergeneration, um sich zu erholen. Wegen des niedrigen Handelsvolumens schwankten die Kurse heftig, starken Einbrüchen folgten regelmäßig kräftige Gewinne. Bis die Kurse wieder krachten.
Es ist das Szenario der Pessimisten. Und es ist ziemlich nah an der Realität.
An der Börse herrscht eine Situation wie in den letzten Tagen vor dem Platzen der großen Spekulationsblase am Aktienmarkt – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Im Frühjahr 2000 schwärmten die Ökonomen von den Segnungen der New Economy mit ihrem unendlichen Wachstum. Die Kurse kletterten und kletterten, obwohl sie schon so hoch waren wie nie zuvor. Fondsmanager und Analysten starrten auf ihre Computerschirme und verstanden die Welt nicht mehr. Drei Jahre später sind sie ebenso ratlos.
Die Fondsmanager und Analysten haben den Glauben an die Bewertungsrelationen verloren. „Die haben Ende der neunziger Jahre als Richtschnur versagt, warum sollte man sich jetzt auf sie verlassen?“, fragt Conrad Mattern, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Activest. Die Aktienanalysten von ABN Amro stellen ihren verunsicherten Kunden gar die provokante Frage, ob Aktien überhaupt noch fundamental zu bewerten seien. Die meisten Anleger handelten nur noch nach schnell entworfenen Taktiken, wie Währungsspekulanten.
„Seit 1997 können Investoren mit Trendfolgemodellen die Aktienindizes schlagen“, sagt Jürgen Callies, Leiter Research bei der Fondsgesellschaft MEAG. Während früher die Unternehmensgewinne die Hauptrolle spielten, seien seit sechs Jahren prozyklische Strategien immer erfolgreicher. Das heißt: Man kauft, wenn die Kurse steigen, und verkauft, wenn die Kurse fallen. Damit ähneln Aktien tatsächlich Devisen: Bis heute gibt es keine Theorie, die erklärt, warum sich Währungen über Jahre anders entwickeln, als volkswirtschaftliche Daten vorgeben.
Vor allem mit deutschen Aktien wird gern gezockt. „Wenn große Investoren schnell Aktien verkaufen wollen, suchen sie sich den deutschen Markt aus“, sagt Peter Knacke, Wertpapierstratege der Commerzbank. Das hat verschiedene Gründe: In Deutschland haben die Verkäufer nach zwei Tagen das Geld auf dem Konto, in anderen Ländern gelten zum Teil längere Fristen. Und: Die deutsch-schweizerische Terminbörse Eurex ist mittlerweile der größte Handelsplatz für Optionsgeschäfte, mit denen sich die Finanzprofis gegen Kursschwankungen absichern. Je größer das Handelsvolumen an der Terminbörse, desto größer sind auch die Kursschwankungen am normalen Aktienmarkt.
Das Ratespiel heißt: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien?
Mehr als 70 Prozent hat der Dax seit dem Höchststand vor drei Jahren verloren. Der japanische Topix, der ebenfalls 70 Prozent verlor, hat dafür 13 Jahre gebraucht. Der britische Footsie wiederum ist seit dem Hoch vom März 2000 um 50 Prozent gefallen, der amerikanische Dow Jones gar nur um 30.
Die kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Tage haben im besten Fall die Wende markiert. Im schlechtesten Fall waren sie nur die fünfte Gegenbewegung in dem seit drei Jahren gültigen Abwärtstrend. Auf alle Fälle sind sie kein Aufbruchsignal, dafür bleiben die Rahmenbedingungen zu schlecht – ganz unabhängig vom Ausgang des Irak-Konflikts.
So sind die krisengeschüttelten Banken und Versicherer im Dax – im Gegensatz zu anderen Indizes – überproportional vertreten. Die Banken aber leiden unter der Rekordzahl an Firmenpleiten, sie müssen so viele Kredite abschreiben wie selten zuvor. Die Versicherer wiederum leiden, weil sie so viele Aktien besitzen, speziell Bankwerte. Die Verflechtung der Geldhäuser ist ein Teufelskreis. Kein Wunder, dass drei der vier schlechtesten Dax-Werte der vergangenen zwölf Monate Finanzwerte sind: HypoVereinsbank (minus 80 Prozent), Allianz (minus 80 Prozent), Münchener Rück (minus 75 Prozent).
Nur mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen. Dann steigen die Gewinne der Unternehmen, gehen die Pleiten zurück und schreiben die Banken weniger Kredite ab. Dann steigen die Gewinne der Geldhäuser, und damit steigt der Aktienmarkt insgesamt. Doch danach sieht es nicht aus.
„Warum fallen die Renditen der Staatsanleihen auf ein 40-Jahres-Tief und die der Unternehmensanleihen auf ein 35-Jahres-Tief, während gleichzeitig die Aktienkurse krachen?“, fragt Michael Hartnett, Aktienstratege bei Merrill Lynch. „Weil alle die Deflation erwarten“ – also fallende Preise, gepaart mit Rezession. Es sind die Nachwehen der gigantischen Aktienblase: Das wachsende Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten und der Verfall des Dollarkurses, die Zurückhaltung der amerikanischen Verbraucher und der überteuerte US-Immobilienmarkt. All das spricht nicht gerade für Impulse aus Amerika. Und dass Europa aus sich heraus Wachstum entfalten könnte, wagt niemand zu hoffen.
So lautet das beliebteste Ratespiel unter den Geldmanagern derzeit: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien? Die Privatanleger sind immer nur Trendverstärker, nie Initiatoren einer Wende. Und institutionelle Investoren wie Versicherer oder Pensionsfonds überdenken im Augenblick ihr Engagement an der Börse. So ist die Aktienquote der latent aktienbegeisterten britischen Lebensversicherer auf 50 Prozent gesunken, das niedrigste Niveau seit zwei Jahrzehnten. „Wahrscheinlich wird der Gesetzgeber in einigen Ländern künftig für Altersvorsorgeprodukte sogar niedrigere Quoten vorschreiben“, vermutet Adam-Chefinvestor Utermann. Viele Unternehmen hätten einen zu großen Teil ihrer Reserven in Aktien angelegt. „Jetzt gibt es bei den Pensionsverpflichtungen große Deckungslücken.“ Wenn die langfristigen Investoren fehlen, fällt es den Hegdefonds leichter, mit ihren Wetten den Markt zu dominieren.
Selbst ohne diese Probleme müssten sich Altaktionäre lange gedulden. Langfristig wachsen die Gewinne der Unternehmen nicht schneller als die Volkswirtschaft an sich – im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte um drei bis vier Prozent jährlich. Rechnet man noch die Inflation und eine Zitterprämie hinzu, die jeder Käufer verlangt, um überhaupt in riskante Aktien zu investieren und nicht in sichere Staatsanleihen, kommt eine Rendite von sieben bis acht Prozent im Jahr heraus. Jedoch: Selbst bei Steigerungen von acht Prozent jährlich würde der Dax 16 Jahre benötigen, um sein Allzeithoch von 8136 Punkten überhaupt wieder zu erreichen.
Anderthalb Jahrzehnte hat es in der Vergangenheit im Schnitt gedauert, bis die Aktienkurse nach großen Crashs wieder ihr altes Niveau erreichten. Nach dem Crash 1929 waren es sogar fast 30 Jahre.
DIE ZEIT - 13/2003
.
Regierungen aller Länder, bewaffnet Euch!
Kommentar von Harald Schumann
Mit dem Angriffskrieg gegen den Irak und dem offenen Bruch des Völkerrechts provoziert die US-Regierung einen globalen Wettlauf um Massenvernichtungswaffen. Von Marokko bis Indonesien stärkt der Krieg nicht die Demokraten, sondern die radikalen Islamisten. Und sie werden sich gegen künftige Angriffe zu schützen wissen.
Osama bin Laden und seine Killer-Banden haben einen neuen Feiertag. Heute, am 20. März 2003, beweisen George W. Bush und seine Neo-Imperialisten, dass sie bereit sind, das Recht zu brechen, wenn sie sich dazu berufen fühlen. Gewiss, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist alles andere als eine demokratische Instanz. Seine Mitglieder sind willkürlich gewählt, die Verteilung der Veto-Rechte folgt einem hoffnungslos veralteteten Muster, der Welt wichtigstes Gremium bedarf dringend der Reform.
Gleichwohl ist das Völkerrecht eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften des vergangenen Jahrhunderts. Das Gewaltverbot der Uno-Charta bot bislang wenigstens im Grundsatz jedem Volk Schutz gegen Angreifer. Wer dagegen verstieß, musste zumindest damit rechnen, vom Sicherheitsrat und den Großmächten zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Diese Rechtsgrundlage gilt ab sofort nicht mehr. Und genau diese Arroganz der absoluten Macht haben bin Laden und andere fanatische Amerika-Hasser den Weltenlenkern aus Washington seit je unterstellt. Indem sie nun den Bombenkrieg gegen ein Volk entfesseln, das zwar blutig unterdrückt wird, aber schon seit einigen Jahren nicht mehr die Kraft zum Angriff hat, betreiben Amerikas Führer genau das Gegenteil dessen, was sie zur Rechtfertigung ihres Präventiv-Krieges anführen: Von Marokko bis Indonesien werden nicht die demokratischen Kräfte der islamischen Welt gestärkt, sondern deren Widersacher, die Klerikal-Faschisten und Terror-Propheten des Heiligen Kriegs "gegen Kreuzzügler und Juden", wie bin Laden seine Mission beschrieb. Sie können mit wachsendem Zulauf und vielen jungen, gewaltbereiten Rekruten rechnen.
Welch verhängnisvolle Signale von der Ignoranz der US-Politik gegenüber der Forderung nach Respekt für die islamische Kultur und Autonomie ausgehen, offenbart schon der Blick nach Pakistan. Dort vereinigt die religiöse Rechte inzwischen die Mehrheit des Volkes hinter sich. Sie ist längst die stärkste politische Kraft im Land und organisierte einen "Marsch der einen Million" in Karatschi zum Protest gegen den Krieg. Schon kam es zu ersten Feuergefechten zwischen pakistanischen und amerikanischen Soldaten und unübersehbar wird, dass die Demokratisierung Pakistans unweigerlich in eine Feindschaft zu den USA führen würde.
Was dabei auf dem Spiel steht, sprach einer der radikalen Mullahs jüngst in einer Predigt offen aus: "Allah hat uns gesagt, Atombomben zu bauen. Amerika sagt uns, wir sollen es nicht. Moslems, auf wen sollen wir hören, auf Allah oder Amerika?", tönte er und ließ seine Botschaft auf Kassetten im ganzen Land verbreiten. So könnte "Amerikas strategische Kurzsichtigkeit Pakistan, den einzigen Staat der islamischen Welt mit Atomwaffen, unregierbar machen", warnte jüngst der pakistanische Physiker und Demokratie-Aktivist Pervez Hoodbhoy.
Der Irak kann nur angegriffen werden, weil Saddam keine Atomwaffen hat
Diese Gefahr beschränkt sich nicht nur auf Pakistan. Die weitere, womöglich noch gefährlichere Botschaft des Bush-Krieges lautet: Aufrüstung. Das ist das Gebot der Stunde für alle Regierungen und Militärs, die nicht auf das ewige Wohlwollen aus Washington vertrauen wollen. Denn das ist die ganze fatale Logik der jetzt laufenden Eroberung des Irak. Nicht die Tatsache, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügt, hat in diesen Krieg geführt. Das genaue Gegenteil ist richtig. Gerade weil der Schlächter von Bagdad noch nicht über solche Waffen verfügt, kann die US-Armee überhaupt einmarschieren. Denn hätte die irakische Armee auch nur zwei oder drei einsetzbare Langstreckenraketen mit Atomsprengkopf, wäre der Krieg ein völlig unkalkulierbares Risiko, Israel müsste um seine Existenz fürchten.
Die zwingende Schlussfolgerung für jeden strategisch denkenden Regierungs- oder Armeechef dieser Welt lautet daher, dass nur die perverse alte Abschreckungslogik aus der Zeit des Kalten Krieges die einzig zuverlässige Versicherung gegen eine erzwungene Unterwerfung darstellt. Genau darum verbietet sich ja ein Krieg gegen Nordkorea, weil dessen Regime die Funktionstüchtigkeit seiner Raketen regelmäßig unter Beweis stellt. Diese Bedrohung kann selbst die größte Militärmacht der Welt nicht ausschalten, es sei denn bei Strafe des drohenden Untergangs für das befreundete Südkorea.
Folglich sind auch die Anstrengungen des Iran, sich über eine eigene Anlage hoch angereichertes Uran für den Bombenbau zu verschaffen, vollkommen rational. Auf der Achse des Bösen markiert, lassen viele Bush-Apologeten schon heute keine Zweifel daran, dass Teheran das nächste Ziel ist,und das, obwohl dort die Jugend sowie die akademische und wirtschaftliche Elite längst für Demokratisierung und Öffnung kämpfen statt für Feldzüge gegen den "Großen Satan", wie sie Chomeini einst propagierte. Anders als früher müssen die Drohungen der amerikanischen Rechten aber ab sofort für bare Münze genommen werden. Darum werden sich selbst die Demokraten im Iran der Atomrüstung wohl kaum in den Weg stellen.
Diese Überlegung wird nicht in Teheran halt machen. Auch in Riad oder in Damaskus steht die Strategie der Abschreckung in den engeren Regierungszirkeln gewiss längst zur Debatte. Und selbst im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, im Inselreich Indonesien, werden die Generäle langfristige Überlegungen anstellen. Von Amerikas Investmentbankern und IWF-Helfern während der Asienkrise gedemütigt, in den folgenden Wirren bei den Reformen allein gelassen und neuerdings als Ursprungsland terroristischer Gefahren gebrandmarkt, werden auch die Lenker dieser großen und stolzen Nation nach langfristiger Sicherheit suchen.
So zerstört Amerikas Politik weltweit das Vertrauen, es könne jenseits des Schutzes durch die Abschreckung mit Massenvernichtungswaffen irgend eine Art von Sicherheit geben. Dieser Krieg wird die Welt nicht sicherer machen, sondern in eine Spirale der Aufrüstung treiben.
SPIEGEL ONLINE - 20. März 2003
Regierungen aller Länder, bewaffnet Euch!
Kommentar von Harald Schumann
Mit dem Angriffskrieg gegen den Irak und dem offenen Bruch des Völkerrechts provoziert die US-Regierung einen globalen Wettlauf um Massenvernichtungswaffen. Von Marokko bis Indonesien stärkt der Krieg nicht die Demokraten, sondern die radikalen Islamisten. Und sie werden sich gegen künftige Angriffe zu schützen wissen.
Osama bin Laden und seine Killer-Banden haben einen neuen Feiertag. Heute, am 20. März 2003, beweisen George W. Bush und seine Neo-Imperialisten, dass sie bereit sind, das Recht zu brechen, wenn sie sich dazu berufen fühlen. Gewiss, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist alles andere als eine demokratische Instanz. Seine Mitglieder sind willkürlich gewählt, die Verteilung der Veto-Rechte folgt einem hoffnungslos veralteteten Muster, der Welt wichtigstes Gremium bedarf dringend der Reform.
Gleichwohl ist das Völkerrecht eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften des vergangenen Jahrhunderts. Das Gewaltverbot der Uno-Charta bot bislang wenigstens im Grundsatz jedem Volk Schutz gegen Angreifer. Wer dagegen verstieß, musste zumindest damit rechnen, vom Sicherheitsrat und den Großmächten zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Diese Rechtsgrundlage gilt ab sofort nicht mehr. Und genau diese Arroganz der absoluten Macht haben bin Laden und andere fanatische Amerika-Hasser den Weltenlenkern aus Washington seit je unterstellt. Indem sie nun den Bombenkrieg gegen ein Volk entfesseln, das zwar blutig unterdrückt wird, aber schon seit einigen Jahren nicht mehr die Kraft zum Angriff hat, betreiben Amerikas Führer genau das Gegenteil dessen, was sie zur Rechtfertigung ihres Präventiv-Krieges anführen: Von Marokko bis Indonesien werden nicht die demokratischen Kräfte der islamischen Welt gestärkt, sondern deren Widersacher, die Klerikal-Faschisten und Terror-Propheten des Heiligen Kriegs "gegen Kreuzzügler und Juden", wie bin Laden seine Mission beschrieb. Sie können mit wachsendem Zulauf und vielen jungen, gewaltbereiten Rekruten rechnen.
Welch verhängnisvolle Signale von der Ignoranz der US-Politik gegenüber der Forderung nach Respekt für die islamische Kultur und Autonomie ausgehen, offenbart schon der Blick nach Pakistan. Dort vereinigt die religiöse Rechte inzwischen die Mehrheit des Volkes hinter sich. Sie ist längst die stärkste politische Kraft im Land und organisierte einen "Marsch der einen Million" in Karatschi zum Protest gegen den Krieg. Schon kam es zu ersten Feuergefechten zwischen pakistanischen und amerikanischen Soldaten und unübersehbar wird, dass die Demokratisierung Pakistans unweigerlich in eine Feindschaft zu den USA führen würde.
Was dabei auf dem Spiel steht, sprach einer der radikalen Mullahs jüngst in einer Predigt offen aus: "Allah hat uns gesagt, Atombomben zu bauen. Amerika sagt uns, wir sollen es nicht. Moslems, auf wen sollen wir hören, auf Allah oder Amerika?", tönte er und ließ seine Botschaft auf Kassetten im ganzen Land verbreiten. So könnte "Amerikas strategische Kurzsichtigkeit Pakistan, den einzigen Staat der islamischen Welt mit Atomwaffen, unregierbar machen", warnte jüngst der pakistanische Physiker und Demokratie-Aktivist Pervez Hoodbhoy.
Der Irak kann nur angegriffen werden, weil Saddam keine Atomwaffen hat
Diese Gefahr beschränkt sich nicht nur auf Pakistan. Die weitere, womöglich noch gefährlichere Botschaft des Bush-Krieges lautet: Aufrüstung. Das ist das Gebot der Stunde für alle Regierungen und Militärs, die nicht auf das ewige Wohlwollen aus Washington vertrauen wollen. Denn das ist die ganze fatale Logik der jetzt laufenden Eroberung des Irak. Nicht die Tatsache, dass Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügt, hat in diesen Krieg geführt. Das genaue Gegenteil ist richtig. Gerade weil der Schlächter von Bagdad noch nicht über solche Waffen verfügt, kann die US-Armee überhaupt einmarschieren. Denn hätte die irakische Armee auch nur zwei oder drei einsetzbare Langstreckenraketen mit Atomsprengkopf, wäre der Krieg ein völlig unkalkulierbares Risiko, Israel müsste um seine Existenz fürchten.
Die zwingende Schlussfolgerung für jeden strategisch denkenden Regierungs- oder Armeechef dieser Welt lautet daher, dass nur die perverse alte Abschreckungslogik aus der Zeit des Kalten Krieges die einzig zuverlässige Versicherung gegen eine erzwungene Unterwerfung darstellt. Genau darum verbietet sich ja ein Krieg gegen Nordkorea, weil dessen Regime die Funktionstüchtigkeit seiner Raketen regelmäßig unter Beweis stellt. Diese Bedrohung kann selbst die größte Militärmacht der Welt nicht ausschalten, es sei denn bei Strafe des drohenden Untergangs für das befreundete Südkorea.
Folglich sind auch die Anstrengungen des Iran, sich über eine eigene Anlage hoch angereichertes Uran für den Bombenbau zu verschaffen, vollkommen rational. Auf der Achse des Bösen markiert, lassen viele Bush-Apologeten schon heute keine Zweifel daran, dass Teheran das nächste Ziel ist,und das, obwohl dort die Jugend sowie die akademische und wirtschaftliche Elite längst für Demokratisierung und Öffnung kämpfen statt für Feldzüge gegen den "Großen Satan", wie sie Chomeini einst propagierte. Anders als früher müssen die Drohungen der amerikanischen Rechten aber ab sofort für bare Münze genommen werden. Darum werden sich selbst die Demokraten im Iran der Atomrüstung wohl kaum in den Weg stellen.
Diese Überlegung wird nicht in Teheran halt machen. Auch in Riad oder in Damaskus steht die Strategie der Abschreckung in den engeren Regierungszirkeln gewiss längst zur Debatte. Und selbst im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, im Inselreich Indonesien, werden die Generäle langfristige Überlegungen anstellen. Von Amerikas Investmentbankern und IWF-Helfern während der Asienkrise gedemütigt, in den folgenden Wirren bei den Reformen allein gelassen und neuerdings als Ursprungsland terroristischer Gefahren gebrandmarkt, werden auch die Lenker dieser großen und stolzen Nation nach langfristiger Sicherheit suchen.
So zerstört Amerikas Politik weltweit das Vertrauen, es könne jenseits des Schutzes durch die Abschreckung mit Massenvernichtungswaffen irgend eine Art von Sicherheit geben. Dieser Krieg wird die Welt nicht sicherer machen, sondern in eine Spirale der Aufrüstung treiben.
SPIEGEL ONLINE - 20. März 2003
Dow Jones Business News, Thursday March 20
Major Gold Producers Expect Price Rebound Despite Iraq
PERTH -(Dow Jones)- Two of the world`s biggest gold producers said Thursday that the bullion price will rise in coming months, despite recent selling linked to the start of the Iraqi conflict.
U.S.-based Newmont Mining Corp. , the world`s biggest producer, and South Africa`s Gold Fields Ltd. , the fourth largest, said the price recovery will be largely linked to concerns about the U.S. economy.
Analysts say that the so-called war premium in gold has vanished over the past few weeks as investors take the view that the U.S.-led war in Iraq will be successful and short-lived. Uncertainty over the Iraqi situation had helped propel gold prices to more than U$380 an ounce early this year, but in Asian trading Thursday the metal fell to a three-month low of US$331.75 as demand for safe-haven buying waned.
But Ian Cockerill, chief executive of Gold Fields, said that there is still an "overwhelmingly positive" argument for buying gold in an economic environment where the U.S. dollar is predicted to soften further. "The war is an event that is taking place, but it is superimposed on what is a weakening U.S. economy," he told reporters at the Paydirt gold conference in Perth.
"America has been on a spending binge and at some stage someone has to pay for that, and that is going to lead to the reality that the dollar is overvalued," he added. "And if you believe in a weakening U.S. dollar then, by definition, you should believe in an improving gold price."
Cockerill said investors are betting that the war will finish swiftly. "But I don`t believe that we are going to see any real change in the global financial markets - the seeds for real economic problems are there and are likely to stay there."
John Dow, managing director of Newmont Australia, said that the gold price has lost some of its war-related glitter in recent weeks. "But underlying that are the fundamental financial conditions that are going to keep the price of gold probably somewhere where it is now, or maybe even (cause) further increases," Dow said.
"We are in a long-term upward trend and the forces that are causing it are only getting worse," he added.
"You might see a short-term price reaction (downwards) in a matter of days, but longer term the U.S. economy isn`t going to be fixed overnight and the debt crisis that is looming in the U.S. isn`t going to go away."
Both Gold Fields and Newmont have made major investments in Australia`s gold mining sector in recent times. Newmont last year completed its A$4.5 billion takeover of Normandy Mining and Gold Fields paid US$233 million purchase for WMC`s gold assets in late 2001.
Newmont last year produced 1.7 million ounces of gold in Australia, out of its total output of 7.6 million, and is looking to expand production further.
Dow said that Newmont expects to finish a feasibility study on its 44%-owned Boddington gold project in Western Australia by the third quarter of this calendar year, and "be ready to take a decision" on its development.
He added that Newmont has no plans to sell its stake in Boddington, which is a joint venture with AngloGold Ltd. and Newcrest Mining Ltd. . "It is absolutely a core project," he said.
-By Stephen Bell, Dow Jones Newswires; 61-8-9245-6408
Major Gold Producers Expect Price Rebound Despite Iraq
PERTH -(Dow Jones)- Two of the world`s biggest gold producers said Thursday that the bullion price will rise in coming months, despite recent selling linked to the start of the Iraqi conflict.
U.S.-based Newmont Mining Corp. , the world`s biggest producer, and South Africa`s Gold Fields Ltd. , the fourth largest, said the price recovery will be largely linked to concerns about the U.S. economy.
Analysts say that the so-called war premium in gold has vanished over the past few weeks as investors take the view that the U.S.-led war in Iraq will be successful and short-lived. Uncertainty over the Iraqi situation had helped propel gold prices to more than U$380 an ounce early this year, but in Asian trading Thursday the metal fell to a three-month low of US$331.75 as demand for safe-haven buying waned.
But Ian Cockerill, chief executive of Gold Fields, said that there is still an "overwhelmingly positive" argument for buying gold in an economic environment where the U.S. dollar is predicted to soften further. "The war is an event that is taking place, but it is superimposed on what is a weakening U.S. economy," he told reporters at the Paydirt gold conference in Perth.
"America has been on a spending binge and at some stage someone has to pay for that, and that is going to lead to the reality that the dollar is overvalued," he added. "And if you believe in a weakening U.S. dollar then, by definition, you should believe in an improving gold price."
Cockerill said investors are betting that the war will finish swiftly. "But I don`t believe that we are going to see any real change in the global financial markets - the seeds for real economic problems are there and are likely to stay there."
John Dow, managing director of Newmont Australia, said that the gold price has lost some of its war-related glitter in recent weeks. "But underlying that are the fundamental financial conditions that are going to keep the price of gold probably somewhere where it is now, or maybe even (cause) further increases," Dow said.
"We are in a long-term upward trend and the forces that are causing it are only getting worse," he added.
"You might see a short-term price reaction (downwards) in a matter of days, but longer term the U.S. economy isn`t going to be fixed overnight and the debt crisis that is looming in the U.S. isn`t going to go away."
Both Gold Fields and Newmont have made major investments in Australia`s gold mining sector in recent times. Newmont last year completed its A$4.5 billion takeover of Normandy Mining and Gold Fields paid US$233 million purchase for WMC`s gold assets in late 2001.
Newmont last year produced 1.7 million ounces of gold in Australia, out of its total output of 7.6 million, and is looking to expand production further.
Dow said that Newmont expects to finish a feasibility study on its 44%-owned Boddington gold project in Western Australia by the third quarter of this calendar year, and "be ready to take a decision" on its development.
He added that Newmont has no plans to sell its stake in Boddington, which is a joint venture with AngloGold Ltd. and Newcrest Mining Ltd. . "It is absolutely a core project," he said.
-By Stephen Bell, Dow Jones Newswires; 61-8-9245-6408
.

UNICEF: Kinder werden sterben
Auch nach dem Abzug internationaler Mitarbeiter geht die UNICEF-Hilfe im Irak weiter. Ein Team von 160 nationalen Mitarbeitern hält in den UNICEF-Büros in Bagdad und Basra sowie den nordirakischen Städten Kirkuk, Erbil, Mosul und Dohuk die Hilfsprogramme aufrecht.
In den vergangenen Monaten hat UNICEF große Mengen Medikamente, Zusatznahrung, Materialien zur Wasseraufbereitung und andere Hilfsgüter zur Versorgung von Kindern, schwangeren Frauen, Flüchtlingen und Kindern in Heimen im Irak an Familien und Einrichtungen verteilt und Massenimpfungen durchgeführt. In den Nachbarländern Iran, Türkei, Jordanien und Syrien hat UNICEF große Lager mit Hilfsgütern und logistische Kapazitäten aufgebaut.

UNICEF bittet dringend um Spenden für die Kinder im Irak:
Spendenkonto 300.000
Sozialbank Köln (BLZ 370 205 00)
Stichwort: Irak
oder: Spendentelefon 0137/300.000
Bei Rückfragen und Interviewwünschen wenden Sie sich bitte an die UNICEF-Pressestelle, Rudi Tarneden und Helga Kuhn,
0221/93650-235/234 oder 0170/8518846
UNICEF hat in der jordanischen Hauptstadt Amman ein "Newsdesk" eingerichtet, das internationale Korrespondenten mit aktuellen Informationen versorgt.
Telefon: 00962/79/692-6191.
Anfragen für Interviews mit Mitarbeitern in der Region (in Englisch) können per Mail geschickt werden an iraqichild@unicef.org.
---
"Die Kinder werden sterben, das ist eine Tatsache"
Von Markus Deggerich, Amman
In Jordanien stellen sich die Hilfsorganisationen auf Hunderttausende von Flüchtlingen ein - falls die es überhaupt über die Grenze in die Auffanglager schaffen. Unicef-Vertreter sehen kaum Chancen dafür, dass die unterernährten Kinder überleben.
Amman - Es ist der Sturm vor dem Sturm. Heftige Winde erschweren den Aufbau der Planen und Zelte für die zwei großen Flüchtlingslager in Jordanien, 80 Kilometer westlich der Grenze zum Irak, nahe der Stadt Ruweished. Die Hilfsorganisationen, die fast alle ihr Hauptquartier in Amman aufgeschlagen haben, zeigen sich erleichtert, dass das Bombardement Bagdads bisher "verhalten" war, wenn es das überhaupt gibt. Noch haben die großen Flüchtlingsströme nicht eingesetzt, das Rote Kreuz und Unicef können jede Stunde gut gebrauchen, um sich einzustellen auf die Tausende, die Schutz suchen werden.
Seit am Freitag dann Nachrichten die Runde machten, dass B-52 Bomber abgehoben haben und auf dem Weg in den Irak sind, rechnet man in Jordanien spätestens ab Samstag mit den ersten Flüchtlingsströmen. Falls die Hilfesuchenden durchkommen. Denn es wird an der Grenze gerätselt, warum in den vergangenen zwei Tagen ausschließlich Ausländer aus dem Irak im jordanischen Auffanglager ankamen. Zur Zeit wohnen in einigen der Zelte etwa 250 Familien aus dem Sudan und Somalia. Die Gastarbeiter aus dem Irak sind auf dem Weg in ihre Heimat. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes wurden sie gebeten, das Lager spätestens nach drei Tagen wieder zu verlassen, um es nicht für irakische Flüchtlinge zu blockieren.
Unicef geht zur Not auch in den Irak
"Wir wissen nicht, ob die Iraker daran gehindert werden zu fliehen", sagt Patrick Howard, Leiter des Roten Kreuzes an der Grenze. Es besteht die Möglichkeit, dass die irakische Führung ihre Bevölkerung hindern will zu flüchten - um sie als menschliches Schutzschild zu nutzen. Howard hat eine kleine Task Force eingerichtet, die im Zweifelsfall bereit ist, auf die irakische Seite zu wechseln, um den Menschen dort an der Grenze zu helfen. Aber noch ist das alles Spekulation.
Sicher ist nur, auch wenn in Jordanien noch keine sichtbare Massenflucht zu erkennen ist, dass die Zivilbevölkerung im Irak bereits stark leidet. "Als erstes sterben die Kinder", sagt Carol Bellamy von Unicef. Rund die Hälfte der irakischen Bevölkerung sind Kinder. "Sie sind bereits geschwächt und haben keinerlei Reserven, um einen Krieg zu überleben", warnt Bellamy. Ein Viertel der Kinder unter fünf Jahren sei unterernährt, und nach zwölf Jahren des Embargos waren über 60 Prozent aller Iraker bereits in "friedlichen" Zeiten auf staatliche Lebensmittelversorgung angewiesen. Doch die dürfte bereits zusammengebrochen sein.
"Die Kinder werden sterben, das ist eine Tatsache", sagt Bellamy. "Die Frage ist nur, wie viele wir noch retten können." Die Hilfsorganisationen rechnen mit zwei Millionen Menschen, die innerhalb des Irak umherirren werden. 600.000 könnten ihren Schätzungen zufolge die Lager in den Nachbarländern erreichen.
EU gewährt 21 Millionen Euro Hilfe
Das könnte die bisherigen Kapazitäten der Helfenden übersteigen. Das Rote Kreuz ist eingerichtet auf 55.000 Menschen, die man innerhalb des Irak versorgen könnte, 100.000 in Iran, 25.000 in Jordanien, 25.000 in Syrien und rund 80.000 in der Türkei. "Wir brauchen dringend Unterstützung von der internationalen Staatengemeinschaft", sagt Juan Manuel Suarez del Toro, Präsident des Internationalen Roten Kreuzes.
Die Europäische Union hatte am Donnerstag 21 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Irak aufgelegt. "Die Situation wird viel Flexibilität erfordern", sagt Paul Nielson, der EU-Kommissar für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, die nun ein Koordinierungsbüro in Amman eingerichtet haben. Zwar sind große Lager gefüllt mit medizinischer Ausrüstung, Zelten, Decken und Lebensmitteln. Aber keiner kann genau vorhersagen, wann wie viel wo gebraucht wird.
Zwar bemühen sich die zahlreichen Hilfsgruppen um bestmögliche Koordination untereinander. Aber auch die Helfer stehen in "Konkurrenz" zueinander um Förder- und Spendengelder. Sie alle arbeiten mit professionellen Pressebetreuern. "Ich hoffe, dass im Interesse der Menschen jeder sein Bestes tut und kein Wettlauf um die dramatischsten Bilder oder Zahlen einsetzt", warnt ein Mitarbeiter von Unicef. Ein deutscher Diplomat kritisiert, dass einige Hilfsorganisationen eigene Mitarbeiter großer Gefahr aussetzen würden, in dem sie sie in Bagdad beließen: "Dort ist niemand sicher vor Plünderungen".
Für die Kollegen des Kinderhilfswerks kommt dadurch auch viel persönlicher, psychischer Stress dazu. Unicef blieb so lange wie möglich in Bagdad. Die meisten ausländischen Mitarbeiter waren erst am Mittwoch nach Jordanien ausgereist. Sie ließen 160 irakische Kollegen zurück, mit denen sie jahrelang Seite an Seite versucht haben, die desaströsen Folgen des Embargos für die Kinder aufzufangen. Jetzt sind sie allein in Bagdad
ES GIBT KEIN FEINDLICHES KIND !
http://www.unicef.de
.

UNICEF: Kinder werden sterben
Auch nach dem Abzug internationaler Mitarbeiter geht die UNICEF-Hilfe im Irak weiter. Ein Team von 160 nationalen Mitarbeitern hält in den UNICEF-Büros in Bagdad und Basra sowie den nordirakischen Städten Kirkuk, Erbil, Mosul und Dohuk die Hilfsprogramme aufrecht.
In den vergangenen Monaten hat UNICEF große Mengen Medikamente, Zusatznahrung, Materialien zur Wasseraufbereitung und andere Hilfsgüter zur Versorgung von Kindern, schwangeren Frauen, Flüchtlingen und Kindern in Heimen im Irak an Familien und Einrichtungen verteilt und Massenimpfungen durchgeführt. In den Nachbarländern Iran, Türkei, Jordanien und Syrien hat UNICEF große Lager mit Hilfsgütern und logistische Kapazitäten aufgebaut.

UNICEF bittet dringend um Spenden für die Kinder im Irak:
Spendenkonto 300.000
Sozialbank Köln (BLZ 370 205 00)
Stichwort: Irak
oder: Spendentelefon 0137/300.000
Bei Rückfragen und Interviewwünschen wenden Sie sich bitte an die UNICEF-Pressestelle, Rudi Tarneden und Helga Kuhn,
0221/93650-235/234 oder 0170/8518846
UNICEF hat in der jordanischen Hauptstadt Amman ein "Newsdesk" eingerichtet, das internationale Korrespondenten mit aktuellen Informationen versorgt.
Telefon: 00962/79/692-6191.
Anfragen für Interviews mit Mitarbeitern in der Region (in Englisch) können per Mail geschickt werden an iraqichild@unicef.org.
---
"Die Kinder werden sterben, das ist eine Tatsache"
Von Markus Deggerich, Amman
In Jordanien stellen sich die Hilfsorganisationen auf Hunderttausende von Flüchtlingen ein - falls die es überhaupt über die Grenze in die Auffanglager schaffen. Unicef-Vertreter sehen kaum Chancen dafür, dass die unterernährten Kinder überleben.
Amman - Es ist der Sturm vor dem Sturm. Heftige Winde erschweren den Aufbau der Planen und Zelte für die zwei großen Flüchtlingslager in Jordanien, 80 Kilometer westlich der Grenze zum Irak, nahe der Stadt Ruweished. Die Hilfsorganisationen, die fast alle ihr Hauptquartier in Amman aufgeschlagen haben, zeigen sich erleichtert, dass das Bombardement Bagdads bisher "verhalten" war, wenn es das überhaupt gibt. Noch haben die großen Flüchtlingsströme nicht eingesetzt, das Rote Kreuz und Unicef können jede Stunde gut gebrauchen, um sich einzustellen auf die Tausende, die Schutz suchen werden.
Seit am Freitag dann Nachrichten die Runde machten, dass B-52 Bomber abgehoben haben und auf dem Weg in den Irak sind, rechnet man in Jordanien spätestens ab Samstag mit den ersten Flüchtlingsströmen. Falls die Hilfesuchenden durchkommen. Denn es wird an der Grenze gerätselt, warum in den vergangenen zwei Tagen ausschließlich Ausländer aus dem Irak im jordanischen Auffanglager ankamen. Zur Zeit wohnen in einigen der Zelte etwa 250 Familien aus dem Sudan und Somalia. Die Gastarbeiter aus dem Irak sind auf dem Weg in ihre Heimat. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes wurden sie gebeten, das Lager spätestens nach drei Tagen wieder zu verlassen, um es nicht für irakische Flüchtlinge zu blockieren.
Unicef geht zur Not auch in den Irak
"Wir wissen nicht, ob die Iraker daran gehindert werden zu fliehen", sagt Patrick Howard, Leiter des Roten Kreuzes an der Grenze. Es besteht die Möglichkeit, dass die irakische Führung ihre Bevölkerung hindern will zu flüchten - um sie als menschliches Schutzschild zu nutzen. Howard hat eine kleine Task Force eingerichtet, die im Zweifelsfall bereit ist, auf die irakische Seite zu wechseln, um den Menschen dort an der Grenze zu helfen. Aber noch ist das alles Spekulation.
Sicher ist nur, auch wenn in Jordanien noch keine sichtbare Massenflucht zu erkennen ist, dass die Zivilbevölkerung im Irak bereits stark leidet. "Als erstes sterben die Kinder", sagt Carol Bellamy von Unicef. Rund die Hälfte der irakischen Bevölkerung sind Kinder. "Sie sind bereits geschwächt und haben keinerlei Reserven, um einen Krieg zu überleben", warnt Bellamy. Ein Viertel der Kinder unter fünf Jahren sei unterernährt, und nach zwölf Jahren des Embargos waren über 60 Prozent aller Iraker bereits in "friedlichen" Zeiten auf staatliche Lebensmittelversorgung angewiesen. Doch die dürfte bereits zusammengebrochen sein.
"Die Kinder werden sterben, das ist eine Tatsache", sagt Bellamy. "Die Frage ist nur, wie viele wir noch retten können." Die Hilfsorganisationen rechnen mit zwei Millionen Menschen, die innerhalb des Irak umherirren werden. 600.000 könnten ihren Schätzungen zufolge die Lager in den Nachbarländern erreichen.
EU gewährt 21 Millionen Euro Hilfe
Das könnte die bisherigen Kapazitäten der Helfenden übersteigen. Das Rote Kreuz ist eingerichtet auf 55.000 Menschen, die man innerhalb des Irak versorgen könnte, 100.000 in Iran, 25.000 in Jordanien, 25.000 in Syrien und rund 80.000 in der Türkei. "Wir brauchen dringend Unterstützung von der internationalen Staatengemeinschaft", sagt Juan Manuel Suarez del Toro, Präsident des Internationalen Roten Kreuzes.
Die Europäische Union hatte am Donnerstag 21 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Irak aufgelegt. "Die Situation wird viel Flexibilität erfordern", sagt Paul Nielson, der EU-Kommissar für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, die nun ein Koordinierungsbüro in Amman eingerichtet haben. Zwar sind große Lager gefüllt mit medizinischer Ausrüstung, Zelten, Decken und Lebensmitteln. Aber keiner kann genau vorhersagen, wann wie viel wo gebraucht wird.
Zwar bemühen sich die zahlreichen Hilfsgruppen um bestmögliche Koordination untereinander. Aber auch die Helfer stehen in "Konkurrenz" zueinander um Förder- und Spendengelder. Sie alle arbeiten mit professionellen Pressebetreuern. "Ich hoffe, dass im Interesse der Menschen jeder sein Bestes tut und kein Wettlauf um die dramatischsten Bilder oder Zahlen einsetzt", warnt ein Mitarbeiter von Unicef. Ein deutscher Diplomat kritisiert, dass einige Hilfsorganisationen eigene Mitarbeiter großer Gefahr aussetzen würden, in dem sie sie in Bagdad beließen: "Dort ist niemand sicher vor Plünderungen".
Für die Kollegen des Kinderhilfswerks kommt dadurch auch viel persönlicher, psychischer Stress dazu. Unicef blieb so lange wie möglich in Bagdad. Die meisten ausländischen Mitarbeiter waren erst am Mittwoch nach Jordanien ausgereist. Sie ließen 160 irakische Kollegen zurück, mit denen sie jahrelang Seite an Seite versucht haben, die desaströsen Folgen des Embargos für die Kinder aufzufangen. Jetzt sind sie allein in Bagdad
ES GIBT KEIN FEINDLICHES KIND !
http://www.unicef.de
.
.
Schwere Zeiten in der Weltwerkstatt
China boomt – trotzdem steht die neue Regierung vor riesigen Problemen
Von Georg Blume
Den Westen plagen Rezessionsängste. Kein Land aber stört das weniger als China, die Volksrepublik setzt ihren Wachstumskurs fort. Acht Prozent Wachstum konnte die Chinesen in der jüngsten Quartalsstatistik vorweisen. In diesem Jahr wird eine Steigerung des Bruttosozialprodukts von mindestens sieben Prozent erwartet. Vielleicht sind die Zahlen etwas geschönt, aber der Wirtschaftsboom wird sich weder von Börsenkurs- noch von Ölpreisschwankungen aufhalten lassen. Schon heute ist China nach Frankreich und vor Italien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und sie steht erst am Anfang ihrer Entwicklung.
Das scheinen gute Ausgangsbedingungen für den neuen Regierungschef Wen Jiabao zu sein, der diese Woche Premierminister Zhu Rongji ablöste. Zhu machte vieles anders, als es die Ökonomen im Westen rieten, zog die schweren Lösungen den leichten stets vor. So vermeidet Peking bislang die Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte für ausländische Investoren und betreibt den Aufbau einer Marktwirtschaft aus eigenen Kräften, an der sich ausländische Unternehmen nur über direkte Investitionen beteiligen können. Noch geht das Rezept prächtig auf. Allein im vergangenen Jahr investierten Firmen aus Übersee 53 Milliarden Dollar in China. Damit stieg die Volksrepublik auf Platz eins der Empfängerliste für ausländische Direktinvestitionen. Ein Beweis dafür, dass viele Manager im Westen der chinesischen Entwicklung auch langfristig vertrauen.
Grund dafür gibt es genug. Siemens-Chef Heinrich von Pierer bezeichnet China als „globale Fabrik“ für sein Unternehmen. Hier werden ihm chinesische Tüchtigkeit und proletarische Opferbereitschaft für Fabriklöhne ab 60 Cent pro Stunde geboten. Und so, wie es aussieht, wird sich daran auch so schnell nichts ändern. Das ist der große Unterschied zwischen China und seinen vielen Vorbildern, von Japan über Singapur bis Südkorea: Diese Länder setzten vor Jahren auch einmal auf Disziplin, Tüchtigkeit und niedrige Löhne. Doch kaum hatten sie die ersten wirtschaftlichen Erfolge erzielt, wollten sie auch die sozialen Errungenschaften der Industriegesellschaften nachahmen. Die fleißigen Arbeiter forderten mehr Geld.
Darauf werden die Chinesen lange warten können. Im Reich der Mitte haben Lohndrücker noch auf Jahrzehnte beste Aussichten, denn die industrielle Reservearmee des Landes verspricht einen unbegrenzten Nachschub an Arbeitskräften. 400 Millionen Chinesen werden in den nächsten zehn Jahren versuchen, dem harten Leben auf dem Lande zu entkommen und einen Arbeitsplatz in der Stadt zu finden.Mit ihnen kann ein Siemens-Chef auch im Jahr 2010 noch rechnen, die Löhne dürften kaum steigen.
Nicht umsonst wird China eine Zukunft als „Weltwerkstatt“ vorausgesagt. Schon heute stammen 60 Prozent aller neuen Fahrräder und die Hälfte aller Schuhe rund um den Globus aus der Volksrepublik. Bis zum Jahr 2005 wird China laut Weltbank seinen Anteil an den weltweiten Textilexporten von 20 auf 50 Prozent steigern können. Bald wird das Land auch noch Halbleiter und Computer exportieren.
Doch trotz der Leistungen der vergangenen Jahre und der glorreichen Zukunftsprognosen steht Wen Jiabao, der neue Premier, vor einem riesigen Berg von Problemen.
Verantwortlich ist dafür in erster Linie die schiere Größe seines Landes und seiner Bevölkerung. In China wollen in den nächsten Jahren ebenso viele Menschen reich werden, wie heute Menschen in den wohlhabenden Industrieländern leben. Alle Chinesen träumen vom Wohlstand des Westens, vom Kühlschrank und Fernseher, vom Auto und der eigenen Wohnung. Bei der Oberschicht in den großen Städten, in Peking oder Shanghai, sind diese Insignien des materiellen Aufstiegs längst verbreitet. Handys sind für viele extrovertierte Städter ein Muss. Der große Rest, die chinesischen Massen, haben das Ziel also schon dicht vor Augen. Doch die meisten Bewohner der Volksrepublik werden noch lange warten müssen, um es selbst zu erreichen.
Es gereicht dem neuen Regierungschef zur Ehre, dass er seine Volk nicht darüber im Unklaren ließ, wie weit der Weg zum besseren Leben noch ist. Er tat es, indem er die nackten Zahlen der Arbeitslosigkeit veröffentlichen ließ. Seine Regierung zählt heute acht Millionen registrierte Arbeitslose. Dazu kommen vier Millionen beschäftigungslose Arbeiter in den Staatsbetrieben. Zusätzlich drängen jedes Jahr acht Millionen junge Menschen neu auf den Arbeitsmarkt. Es gibt schon jetzt 90 Millionen unregelmäßig beschäftige Wanderarbeiter und 150 Millionen überschüssige Arbeitskräfte auf dem Land. Das macht insgesamt 260 Millionen Menschen, die nach einem festen Job suchen – zum Beispiel in einem Siemens-Werk. Doch so viele Fabriken, dass alle Arbeitssuchenden Arbeit finden, wird China selbst mit ausländischer Hilfe nicht bauen können.
Darüber hinaus hat die neue Regierung ihren Bürgern offen gelegt, wie dramatisch sich der Graben zwischen Arm und Reich in China geöffnet hat. Während die städtischen Einkommen um zweistellige Beträge stiegen, mussten 800 Millionen Landbewohner in den letzten fünf Jahren Nettoeinkommenseinbußen hinnehmen. Der „gedämpfte Enthusiasmus“ der Bauern, heißt es im Regierungsbericht zum Antritt Wens, gefährde heute die gesamte Entwicklung des Landes. Warum sollten sich auch ausgerechnet die Bauern für eine Zukunft begeistern, die sie schlechter stellt als die Vergangenheit. Die ungleiche Verteilung sorgt für gewaltigen Sprengstoff.
Die sozialen Zerwürfnisse, die sich hier andeuten, bedrohen China aus den gleichen Gründen, die dem Land so viel Fortschritt schenken: Die Chinesen sind ein mobiles, pragmatisches Volk, sie fühlen sich wenigen Traditionen verpflichtet. Umso größer sind ihre materiellen Wünsche, ihr Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit. Bisher hat das noch nicht zu Massenprotesten geführt, nur zu massenhaften Wanderbewegungen.Doch der Sog, den der Luxus in den Städten auf die Landbevölkerung ausübt, ist eine Bedrohung für Chinas Metropolen. Sie vermögen die verelendeten Massen schlicht nicht zu beherbergen.
Lange Zeit gelang es den Kommunisten in Peking, diese Entwicklung – oder zumindest die offiziellen Statistiken – so zu steuern, dass alle glaubten, am Fortschritt teilhaben zu können. Heute räumen die Regierenden selbst ein, dass gleichzeitiger Fortschritt für alle eine Illusion ist.
Kein Wunder also, dass sich China derzeit nicht um die Sorgen des Westens schert. Auch inmitten einer Glanzperiode steht es vor weit größeren Problemen.
DIE ZEIT - 13/2003
Schwere Zeiten in der Weltwerkstatt
China boomt – trotzdem steht die neue Regierung vor riesigen Problemen
Von Georg Blume
Den Westen plagen Rezessionsängste. Kein Land aber stört das weniger als China, die Volksrepublik setzt ihren Wachstumskurs fort. Acht Prozent Wachstum konnte die Chinesen in der jüngsten Quartalsstatistik vorweisen. In diesem Jahr wird eine Steigerung des Bruttosozialprodukts von mindestens sieben Prozent erwartet. Vielleicht sind die Zahlen etwas geschönt, aber der Wirtschaftsboom wird sich weder von Börsenkurs- noch von Ölpreisschwankungen aufhalten lassen. Schon heute ist China nach Frankreich und vor Italien die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und sie steht erst am Anfang ihrer Entwicklung.
Das scheinen gute Ausgangsbedingungen für den neuen Regierungschef Wen Jiabao zu sein, der diese Woche Premierminister Zhu Rongji ablöste. Zhu machte vieles anders, als es die Ökonomen im Westen rieten, zog die schweren Lösungen den leichten stets vor. So vermeidet Peking bislang die Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte für ausländische Investoren und betreibt den Aufbau einer Marktwirtschaft aus eigenen Kräften, an der sich ausländische Unternehmen nur über direkte Investitionen beteiligen können. Noch geht das Rezept prächtig auf. Allein im vergangenen Jahr investierten Firmen aus Übersee 53 Milliarden Dollar in China. Damit stieg die Volksrepublik auf Platz eins der Empfängerliste für ausländische Direktinvestitionen. Ein Beweis dafür, dass viele Manager im Westen der chinesischen Entwicklung auch langfristig vertrauen.
Grund dafür gibt es genug. Siemens-Chef Heinrich von Pierer bezeichnet China als „globale Fabrik“ für sein Unternehmen. Hier werden ihm chinesische Tüchtigkeit und proletarische Opferbereitschaft für Fabriklöhne ab 60 Cent pro Stunde geboten. Und so, wie es aussieht, wird sich daran auch so schnell nichts ändern. Das ist der große Unterschied zwischen China und seinen vielen Vorbildern, von Japan über Singapur bis Südkorea: Diese Länder setzten vor Jahren auch einmal auf Disziplin, Tüchtigkeit und niedrige Löhne. Doch kaum hatten sie die ersten wirtschaftlichen Erfolge erzielt, wollten sie auch die sozialen Errungenschaften der Industriegesellschaften nachahmen. Die fleißigen Arbeiter forderten mehr Geld.
Darauf werden die Chinesen lange warten können. Im Reich der Mitte haben Lohndrücker noch auf Jahrzehnte beste Aussichten, denn die industrielle Reservearmee des Landes verspricht einen unbegrenzten Nachschub an Arbeitskräften. 400 Millionen Chinesen werden in den nächsten zehn Jahren versuchen, dem harten Leben auf dem Lande zu entkommen und einen Arbeitsplatz in der Stadt zu finden.Mit ihnen kann ein Siemens-Chef auch im Jahr 2010 noch rechnen, die Löhne dürften kaum steigen.
Nicht umsonst wird China eine Zukunft als „Weltwerkstatt“ vorausgesagt. Schon heute stammen 60 Prozent aller neuen Fahrräder und die Hälfte aller Schuhe rund um den Globus aus der Volksrepublik. Bis zum Jahr 2005 wird China laut Weltbank seinen Anteil an den weltweiten Textilexporten von 20 auf 50 Prozent steigern können. Bald wird das Land auch noch Halbleiter und Computer exportieren.
Doch trotz der Leistungen der vergangenen Jahre und der glorreichen Zukunftsprognosen steht Wen Jiabao, der neue Premier, vor einem riesigen Berg von Problemen.
Verantwortlich ist dafür in erster Linie die schiere Größe seines Landes und seiner Bevölkerung. In China wollen in den nächsten Jahren ebenso viele Menschen reich werden, wie heute Menschen in den wohlhabenden Industrieländern leben. Alle Chinesen träumen vom Wohlstand des Westens, vom Kühlschrank und Fernseher, vom Auto und der eigenen Wohnung. Bei der Oberschicht in den großen Städten, in Peking oder Shanghai, sind diese Insignien des materiellen Aufstiegs längst verbreitet. Handys sind für viele extrovertierte Städter ein Muss. Der große Rest, die chinesischen Massen, haben das Ziel also schon dicht vor Augen. Doch die meisten Bewohner der Volksrepublik werden noch lange warten müssen, um es selbst zu erreichen.
Es gereicht dem neuen Regierungschef zur Ehre, dass er seine Volk nicht darüber im Unklaren ließ, wie weit der Weg zum besseren Leben noch ist. Er tat es, indem er die nackten Zahlen der Arbeitslosigkeit veröffentlichen ließ. Seine Regierung zählt heute acht Millionen registrierte Arbeitslose. Dazu kommen vier Millionen beschäftigungslose Arbeiter in den Staatsbetrieben. Zusätzlich drängen jedes Jahr acht Millionen junge Menschen neu auf den Arbeitsmarkt. Es gibt schon jetzt 90 Millionen unregelmäßig beschäftige Wanderarbeiter und 150 Millionen überschüssige Arbeitskräfte auf dem Land. Das macht insgesamt 260 Millionen Menschen, die nach einem festen Job suchen – zum Beispiel in einem Siemens-Werk. Doch so viele Fabriken, dass alle Arbeitssuchenden Arbeit finden, wird China selbst mit ausländischer Hilfe nicht bauen können.
Darüber hinaus hat die neue Regierung ihren Bürgern offen gelegt, wie dramatisch sich der Graben zwischen Arm und Reich in China geöffnet hat. Während die städtischen Einkommen um zweistellige Beträge stiegen, mussten 800 Millionen Landbewohner in den letzten fünf Jahren Nettoeinkommenseinbußen hinnehmen. Der „gedämpfte Enthusiasmus“ der Bauern, heißt es im Regierungsbericht zum Antritt Wens, gefährde heute die gesamte Entwicklung des Landes. Warum sollten sich auch ausgerechnet die Bauern für eine Zukunft begeistern, die sie schlechter stellt als die Vergangenheit. Die ungleiche Verteilung sorgt für gewaltigen Sprengstoff.
Die sozialen Zerwürfnisse, die sich hier andeuten, bedrohen China aus den gleichen Gründen, die dem Land so viel Fortschritt schenken: Die Chinesen sind ein mobiles, pragmatisches Volk, sie fühlen sich wenigen Traditionen verpflichtet. Umso größer sind ihre materiellen Wünsche, ihr Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit. Bisher hat das noch nicht zu Massenprotesten geführt, nur zu massenhaften Wanderbewegungen.Doch der Sog, den der Luxus in den Städten auf die Landbevölkerung ausübt, ist eine Bedrohung für Chinas Metropolen. Sie vermögen die verelendeten Massen schlicht nicht zu beherbergen.
Lange Zeit gelang es den Kommunisten in Peking, diese Entwicklung – oder zumindest die offiziellen Statistiken – so zu steuern, dass alle glaubten, am Fortschritt teilhaben zu können. Heute räumen die Regierenden selbst ein, dass gleichzeitiger Fortschritt für alle eine Illusion ist.
Kein Wunder also, dass sich China derzeit nicht um die Sorgen des Westens schert. Auch inmitten einer Glanzperiode steht es vor weit größeren Problemen.
DIE ZEIT - 13/2003
.
kleine Umfrage zur Kriegsrallye:
Der Goldpreis hat stärker nachgegeben als von mir erwartet.
Bei der sich abzeichnenden Lösung des Irakkonflikts wird der Erdölpreis noch weiter fallen, das allgemeine Sentiment wird sich verbessern und die Risikoprämie an den Finanzmärkten verringert sich. Vor dem Hintergrund des anstehenden Wiederaufbaus im Irak könnte die Mehrzahl der Anleger auf eine amerikanische Konjunkturerholung setzen und die negativen Fundamentals (Immoblase etc...) einfach ignorieren – und sei es nur für das nächste halbe Jahr !
Schon ein halbes Jahr prosperierende Kurse in New York könnte uns Goldbugs aber das Genick brechen !
Fällt der Goldpreis noch weiter unter das heutige Tief von 325 $ ist mit einer sich selbst dynamisierenden Abwärtsspirale zu rechnen !
Von der Industrie ist keine Entwarnung zu erwarten. Die globale physische Nachfrage ist im letzten Jahr um 10 % zurückgegangen. Die indische Schmuckindustrie, die 85 % der weltweiten physischen Nachfrage ausmacht, generiert keine Kaufsignale.
Was also bleibt als Argument für ein Investment im Goldmarkt ?
- Nur noch ein fallender Dollar: Wenn der auf Euro auf 1,10 steigt, könnten wir die Kurve gerade noch mal so kratzen ...
- ich frage mich nur, ob er das auch tut, wenn über Bagdad das Star-Spangled Banner gehißt wird.
Konradi
kleine Umfrage zur Kriegsrallye:
Der Goldpreis hat stärker nachgegeben als von mir erwartet.
Bei der sich abzeichnenden Lösung des Irakkonflikts wird der Erdölpreis noch weiter fallen, das allgemeine Sentiment wird sich verbessern und die Risikoprämie an den Finanzmärkten verringert sich. Vor dem Hintergrund des anstehenden Wiederaufbaus im Irak könnte die Mehrzahl der Anleger auf eine amerikanische Konjunkturerholung setzen und die negativen Fundamentals (Immoblase etc...) einfach ignorieren – und sei es nur für das nächste halbe Jahr !
Schon ein halbes Jahr prosperierende Kurse in New York könnte uns Goldbugs aber das Genick brechen !
Fällt der Goldpreis noch weiter unter das heutige Tief von 325 $ ist mit einer sich selbst dynamisierenden Abwärtsspirale zu rechnen !
Von der Industrie ist keine Entwarnung zu erwarten. Die globale physische Nachfrage ist im letzten Jahr um 10 % zurückgegangen. Die indische Schmuckindustrie, die 85 % der weltweiten physischen Nachfrage ausmacht, generiert keine Kaufsignale.
Was also bleibt als Argument für ein Investment im Goldmarkt ?
- Nur noch ein fallender Dollar: Wenn der auf Euro auf 1,10 steigt, könnten wir die Kurve gerade noch mal so kratzen ...
- ich frage mich nur, ob er das auch tut, wenn über Bagdad das Star-Spangled Banner gehißt wird.

Konradi
Hmm, keine Kommentare ?
- Wohl etwas frustriert die Damen und Herren ?
- Na gut, dann befragen wir mal die Financial Times:
Gold and oil on a rocky road
By Kevin Morrison
Oil and gold have been riding high on a war premium this year as investors have fled equities for commodity safe havens. But the price peaks hit several weeks ago are unlikely to be repeated soon despite concerns that the war against Iraq may not be as short as initially expected.
(…)
As for gold, it peaked and fell long before the oil price repeated the same performance, suggesting that most of the war premium is already out of the price and it is trading closer to supply and demand levels.
John Reade, precious metals analyst at UBS Warburg, said depending on movements in the US dollar, the gold price could settle around $320 a troy ounce in the short term - more than $60 below its 6½-year peak of $388.50 reached in early February.
The consensus view on gold among analysts is a price average of about $344.92 a troy ounce this year, which is still above last year`s average of $309.77 an ounce.
Most of the interest in gold in the past 18 months has come from speculators, such as US hedge funds, who are not interested in buying physical gold, only in making money from price movements.
Unlike the 1991 Gulf war, the gold price fell on Thursday, the first day of conflict. Whereas the Iraqi invasion of Kuwait in 1990 prompted gold to jump $10 to $380 an ounce and eventually rise to $411 an ounce.
Financial Times 20.03.2003
- Wohl etwas frustriert die Damen und Herren ?

- Na gut, dann befragen wir mal die Financial Times:
Gold and oil on a rocky road
By Kevin Morrison
Oil and gold have been riding high on a war premium this year as investors have fled equities for commodity safe havens. But the price peaks hit several weeks ago are unlikely to be repeated soon despite concerns that the war against Iraq may not be as short as initially expected.
(…)
As for gold, it peaked and fell long before the oil price repeated the same performance, suggesting that most of the war premium is already out of the price and it is trading closer to supply and demand levels.
John Reade, precious metals analyst at UBS Warburg, said depending on movements in the US dollar, the gold price could settle around $320 a troy ounce in the short term - more than $60 below its 6½-year peak of $388.50 reached in early February.
The consensus view on gold among analysts is a price average of about $344.92 a troy ounce this year, which is still above last year`s average of $309.77 an ounce.
Most of the interest in gold in the past 18 months has come from speculators, such as US hedge funds, who are not interested in buying physical gold, only in making money from price movements.
Unlike the 1991 Gulf war, the gold price fell on Thursday, the first day of conflict. Whereas the Iraqi invasion of Kuwait in 1990 prompted gold to jump $10 to $380 an ounce and eventually rise to $411 an ounce.
Financial Times 20.03.2003
.
...mag ja sein, daß der Autor keine Ahnung vom tatsächlichen Kräftespiel im Goldmarkt hat. Nur orientieren sich Kleinanleger an Warnungen wie diese:
Goldglanz verblasst - Hoffnung auf kurzen Krieg drückt Preis
Wie in anderen Krisenzeiten auch war Gold mit dem Heraufziehen des Golfkrieges wieder eine "Fluchtwährung". Aber schon unmittelbar vor Kriegsausbruch und damit früher als in vergleichbaren Situationen stand das Edelmetall wieder auf der Verkaufsliste. Der Glanz des Edelmetalls verblasst schneller als angenommen.
"Gold blüht in der Unsicherheit", sagte Ross Norman, Analyst bei TheBullionDesk.com. Aber die Anleger setzten immer mehr auf einen schnellen Sieg der USA. Die Unsicherheit an den Märkten werde langsam wieder von Zuversicht abgelöst.
HÖCHSTPREIS 800 DOLLAR
Nach dem 2. Weltkrieg und zu Zeiten hoher Inflation war das unverwüstliche Metall immer wieder ins Interesse gerückt. Gold kann in Krisen schließlich schnell und überall zu Geld gemacht werden. Ende der 70er Jahre kostete die Feinunze Gold 800 US-Dollar - ein nie wieder erreichter Wert, zumal der Dollar damals deutlich mehr wert war als heute.
Wer damals mit Goldbarren oder -münzen vorsorgen wollte, hat sich mächtig verrechnet. Der Goldpreis fiel und erreichte im Spätsommer 1999 mit wenig mehr als 250 Dollar den Tiefpunkt. Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Gold die "schlechteste Vermögensanlage".
Etliche Anlageberater hielten kaum noch etwas vom viel zitierten sicheren Hafen und verwiesen auf die starken Preisschwankungen sowie die seit langem niedrige Inflationsrate. Zinsen fallen ohnehin nicht an. Von der Faszination Gold war nicht mehr viel zu spüren. Die Wende kam im Laufe des Jahres 2002, auch als Folge der Terroranschläge und der seit mehr als drei Jahren anhaltenden Börsenschwäche.
KRIEG TRIEB SPEKULATIONEN
Die Irakkrise trieb dann die Spekulationen wieder an. Mit jedem Bericht der UN-Inspektoren, Meldungen über Verstöße des Iraks und jeder Erklärung der US-Regierung stieg die Nervosität an den Märkten und damit kräftig der Preis für die "Fluchtwährung" Gold. Anfang Februar kletterte der Goldpreis zeitweise auf 389 Dollar. Das war der höchste Stand seit sechseinhalb Jahren. Einige Experten liebäugelten sogar schon mit 400 Dollar. So mahnte die DekaBank, ein "kräftiges Überschießen" des Goldpreises in einer Spekulationsblase könne kurzfristig den Preis auf 400 Dollar je Feinunze treiben.
Doch es kam anders. Die zwischenzeitlich nachlassende Kriegsangst drückte den Preis wieder. Zwar sorgten nordkoreanische Raketentests und die Gewissheit über einen Angriff auf den Irak für Zwischenhochs. Doch noch vor dem Kriegsausbruch wurde das Edelmetall verstärkt wieder abgestoßen. Beim letzten Golfkrieg war das noch anders: Da wurden Anleger am Morgen nach Kriegsbeginn von einem Preissturz binnen weniger Stunden um bis zu 40 Dollar überrascht.
TIEFSTER PREIS SEIT 3 MONATEN
Seit Beginn des Kriegs sinkt der Goldpreis weiter. Er rutschte am zweiten Kriegstag auf 333 Dollar je Feinunze und damit den niedrigsten Wert seit drei Monaten. Über ein Jahr gesehen können sich viele Gold-Anleger aber immer noch über ein Plus freuen. Händler führen den Rückgang auch darauf zurück, dass viele Fonds, die auf hohe Preise spekulierten, ihr Geld wieder abgezogen haben. "Die haben schnell noch mal Kasse gemacht", heißt es.
Für die weitere Entwicklung des Goldpreises sind die Dauer des Irakkrieges und der Dollarkurs sowie die Aktienmärkte entscheidend. Einige Experten sehen bei einem längeren Konflikt den Goldpreis wieder über die Marke von 370 Dollar steigen. Bei schneller Beilegung könnte er aber weiter bis auf 320 oder so gar 310 Dollar sinken.
Focus Money - 22.03.2003
...mag ja sein, daß der Autor keine Ahnung vom tatsächlichen Kräftespiel im Goldmarkt hat. Nur orientieren sich Kleinanleger an Warnungen wie diese:
Goldglanz verblasst - Hoffnung auf kurzen Krieg drückt Preis
Wie in anderen Krisenzeiten auch war Gold mit dem Heraufziehen des Golfkrieges wieder eine "Fluchtwährung". Aber schon unmittelbar vor Kriegsausbruch und damit früher als in vergleichbaren Situationen stand das Edelmetall wieder auf der Verkaufsliste. Der Glanz des Edelmetalls verblasst schneller als angenommen.
"Gold blüht in der Unsicherheit", sagte Ross Norman, Analyst bei TheBullionDesk.com. Aber die Anleger setzten immer mehr auf einen schnellen Sieg der USA. Die Unsicherheit an den Märkten werde langsam wieder von Zuversicht abgelöst.
HÖCHSTPREIS 800 DOLLAR
Nach dem 2. Weltkrieg und zu Zeiten hoher Inflation war das unverwüstliche Metall immer wieder ins Interesse gerückt. Gold kann in Krisen schließlich schnell und überall zu Geld gemacht werden. Ende der 70er Jahre kostete die Feinunze Gold 800 US-Dollar - ein nie wieder erreichter Wert, zumal der Dollar damals deutlich mehr wert war als heute.
Wer damals mit Goldbarren oder -münzen vorsorgen wollte, hat sich mächtig verrechnet. Der Goldpreis fiel und erreichte im Spätsommer 1999 mit wenig mehr als 250 Dollar den Tiefpunkt. Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Gold die "schlechteste Vermögensanlage".
Etliche Anlageberater hielten kaum noch etwas vom viel zitierten sicheren Hafen und verwiesen auf die starken Preisschwankungen sowie die seit langem niedrige Inflationsrate. Zinsen fallen ohnehin nicht an. Von der Faszination Gold war nicht mehr viel zu spüren. Die Wende kam im Laufe des Jahres 2002, auch als Folge der Terroranschläge und der seit mehr als drei Jahren anhaltenden Börsenschwäche.
KRIEG TRIEB SPEKULATIONEN
Die Irakkrise trieb dann die Spekulationen wieder an. Mit jedem Bericht der UN-Inspektoren, Meldungen über Verstöße des Iraks und jeder Erklärung der US-Regierung stieg die Nervosität an den Märkten und damit kräftig der Preis für die "Fluchtwährung" Gold. Anfang Februar kletterte der Goldpreis zeitweise auf 389 Dollar. Das war der höchste Stand seit sechseinhalb Jahren. Einige Experten liebäugelten sogar schon mit 400 Dollar. So mahnte die DekaBank, ein "kräftiges Überschießen" des Goldpreises in einer Spekulationsblase könne kurzfristig den Preis auf 400 Dollar je Feinunze treiben.
Doch es kam anders. Die zwischenzeitlich nachlassende Kriegsangst drückte den Preis wieder. Zwar sorgten nordkoreanische Raketentests und die Gewissheit über einen Angriff auf den Irak für Zwischenhochs. Doch noch vor dem Kriegsausbruch wurde das Edelmetall verstärkt wieder abgestoßen. Beim letzten Golfkrieg war das noch anders: Da wurden Anleger am Morgen nach Kriegsbeginn von einem Preissturz binnen weniger Stunden um bis zu 40 Dollar überrascht.
TIEFSTER PREIS SEIT 3 MONATEN
Seit Beginn des Kriegs sinkt der Goldpreis weiter. Er rutschte am zweiten Kriegstag auf 333 Dollar je Feinunze und damit den niedrigsten Wert seit drei Monaten. Über ein Jahr gesehen können sich viele Gold-Anleger aber immer noch über ein Plus freuen. Händler führen den Rückgang auch darauf zurück, dass viele Fonds, die auf hohe Preise spekulierten, ihr Geld wieder abgezogen haben. "Die haben schnell noch mal Kasse gemacht", heißt es.
Für die weitere Entwicklung des Goldpreises sind die Dauer des Irakkrieges und der Dollarkurs sowie die Aktienmärkte entscheidend. Einige Experten sehen bei einem längeren Konflikt den Goldpreis wieder über die Marke von 370 Dollar steigen. Bei schneller Beilegung könnte er aber weiter bis auf 320 oder so gar 310 Dollar sinken.
Focus Money - 22.03.2003
@konradi
Das das Gold diesmal schon vor dem ersten Schuss gefallen ist könnte auch folgende Gründe haben:
Erstens, jeder hat das Szenario von der Iran/Contra-Geschichte und von dem 90/91`er Golfkrieg im Kopf.
Diesmal wollte halt keiner kalt erwischt werden, so ist man dezent nach und nach vorher raus.
Zweitens haben wir heute dank Internet ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten.
D.h. wie können uns schneller und besser informieren und vor allem reagieren.
Ich hatte zum Beispiel bis vor c. 6 Jahren noch 2 Mann die nichts anderes gemacht hatten als Nachrichten und Info`s zu sichten.
Heutzutage kommt alles so schnell rein, das man schon an Reizüberflutung leidet wenn man nicht aufpasst.
Drittens sind durch die lange Baisse auch viele Leute insofern geschädigt, das sie nicht mehr wie früher kaufen und liegen lassen, sondern deutlich schneller verkaufen.
----------------------------------------------------
Zu Deiner Umfrage unten:
auch dieses Szenario ist denkbar. In meinem Thread ist irgendwo der Dow-verlauf von 90/91, der ist recht aufschlussreich.
Auch wenn man sich mal die Mühe macht und die wirtschaftlichen Begleitumstände zum Beispiel BIP, Dollarkurs, etc. ansieht wird man zu erstaunlichen Ergebnissen kommen.
Nur die Inflation war damals etwas höher.
Was ich zu bedenken gebe, ist allerdings nur ein Gedankendank von mir, ist das wir jetzt den Euro haben.
Ich behaupte mal, das wenn wir den Euro nicht hätten, also noch DM, Franc, etc. wäre Gold deutlich höher gestiegen.
Durch die Einführung des Euro`s wurde ein vermeintlich neuer sicherer Hafen eingeführt, in den ja auch kräftig Kohle fließt.
Damit dürften wir auf der Papierseite noch jahrelang einigermassen Ruhe haben.
Das ist einer der Gründe warum ich nicht glaube das Gold "kurzfristig" in Bereiche von 500 - xxxxxx steigen wird.
Langfristig sieht es natürlich aus den hier im Board vielfach besprochenen Gründen anders aus.
Wie gesagt, das obige ist alles nur eine These von einem relativ alten, müden und verbrauchtem Mann.

Das das Gold diesmal schon vor dem ersten Schuss gefallen ist könnte auch folgende Gründe haben:
Erstens, jeder hat das Szenario von der Iran/Contra-Geschichte und von dem 90/91`er Golfkrieg im Kopf.
Diesmal wollte halt keiner kalt erwischt werden, so ist man dezent nach und nach vorher raus.
Zweitens haben wir heute dank Internet ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten.
D.h. wie können uns schneller und besser informieren und vor allem reagieren.
Ich hatte zum Beispiel bis vor c. 6 Jahren noch 2 Mann die nichts anderes gemacht hatten als Nachrichten und Info`s zu sichten.
Heutzutage kommt alles so schnell rein, das man schon an Reizüberflutung leidet wenn man nicht aufpasst.

Drittens sind durch die lange Baisse auch viele Leute insofern geschädigt, das sie nicht mehr wie früher kaufen und liegen lassen, sondern deutlich schneller verkaufen.
----------------------------------------------------
Zu Deiner Umfrage unten:
auch dieses Szenario ist denkbar. In meinem Thread ist irgendwo der Dow-verlauf von 90/91, der ist recht aufschlussreich.
Auch wenn man sich mal die Mühe macht und die wirtschaftlichen Begleitumstände zum Beispiel BIP, Dollarkurs, etc. ansieht wird man zu erstaunlichen Ergebnissen kommen.

Nur die Inflation war damals etwas höher.
Was ich zu bedenken gebe, ist allerdings nur ein Gedankendank von mir, ist das wir jetzt den Euro haben.
Ich behaupte mal, das wenn wir den Euro nicht hätten, also noch DM, Franc, etc. wäre Gold deutlich höher gestiegen.
Durch die Einführung des Euro`s wurde ein vermeintlich neuer sicherer Hafen eingeführt, in den ja auch kräftig Kohle fließt.
Damit dürften wir auf der Papierseite noch jahrelang einigermassen Ruhe haben.
Das ist einer der Gründe warum ich nicht glaube das Gold "kurzfristig" in Bereiche von 500 - xxxxxx steigen wird.
Langfristig sieht es natürlich aus den hier im Board vielfach besprochenen Gründen anders aus.
Wie gesagt, das obige ist alles nur eine These von einem relativ alten, müden und verbrauchtem Mann.


Hallo Imoen
merci, wenigstens Du läßt mich nicht im Regen stehen ...
Wie gesagt, das obige ist alles nur eine These von einem relativ alten, müden und verbrauchtem Mann.
Sorry das so direkt sagen zu müssen :
aber Du schaust ein wenig urlaubsreif aus ...
Könnte es eventuell sein, daß Du zu oft vor dem
Bildschirm sitzt und Dich zuviel über idiotische Postings
im WO Goldforum ärgerst ?
... ist aber auch nur ´ne These von einem alten Mann ...
Gruß Konradi
merci, wenigstens Du läßt mich nicht im Regen stehen ...

Wie gesagt, das obige ist alles nur eine These von einem relativ alten, müden und verbrauchtem Mann.
Sorry das so direkt sagen zu müssen :
aber Du schaust ein wenig urlaubsreif aus ...

Könnte es eventuell sein, daß Du zu oft vor dem
Bildschirm sitzt und Dich zuviel über idiotische Postings
im WO Goldforum ärgerst ?
... ist aber auch nur ´ne These von einem alten Mann ...
Gruß Konradi

.
Krieg stellt Anlegern viele Fallen
Börsenpsychologen warnen vor falschen Schlüssen - Rückblicke nicht hilfreich
von Jens Wiegmann
Berlin - Die spinnen, die Anleger. Erst meiden sie wochenlang aus Angst vor einem Irak-Krieg Aktien und investieren massiv in festverzinsliche Wertpapiere und Gold. Und gleich einen Tag nach Beginn der Kampfhandlungen stürzen sie sich wie Lemminge in den deutschen Aktienmarkt. Dieser Schluss lag jedenfalls am Freitag nah, als der Dax in nur wenigen Stunden um 3,7 Prozent auf 2700 Punkte kletterte.
Nach Ansicht der Diplom-Psychologin und Börsenexpertin Monika Müller ist der Kursaufschwung jedoch leicht nachvollziehbar: "Für mich wird hier eher ein rationales, gewinnorientiertes Verhalten sichtbar." Die Situation sei völlig anders als nach den Terroranschlägen im September 2001, als Banker und Börsianer selbst direkt betroffen waren: "Da haben viele irrational und emotional gehandelt."
Schon seit einiger Zeit ist wieder die alte Börsenweisheit im Umlauf, wonach man Aktien kaufen soll, wenn die Kanonen donnern. Nun sei eben das eingetreten, was prognostiziert und erwartet worden war, sagt Müller, die private und institutionelle Investoren berät. "Viele Leute haben das gehört und gelesen, und springen jetzt auf den Zug auf." Die Expertin sieht allerdings weniger Privatanleger am Werk, die auf eine Trendumkehr setzen, als vielmehr professionelle Investoren, die kurzfristige Möglichkeiten nutzen. Der aktuelle Trend ist nach Ansicht Müllers nicht nur im Krieg begründet. "Es ist grundsätzlich eine Menge Kapital vorhanden, das investiert werden will, wie man zum Beispiel gerade an der Kursexplosion der Bayer-Aktie sehen konnte."
Die Marktteilnehmer hätten sich schon seit geraumer Zeit auf die Stunde X vorbereitet, sagt Joachim Goldberg, Geschäftsführer der auf die Analyse von Anlegerverhalten spezialisierten Firma Cognitrend. "Viele sind schon vorher aktiv geworden aus Angst, den besten Zeitpunkt zu verpassen." Aber nun sei natürlich erst einmal eine Dominanz der Ereignisse im Nahen Osten festzustellen: "Stürzt ein Hubschrauber ab fallen die Kurse, wird die Einnahme einer irakischen Stellung oder Stadt gemeldet steigen sie."
Der Krieg macht eine Einschätzung der Finanzmärkte schwieriger. Durch die schnellen und scharfen Kursbewegungen werde bei vielen Anlegern das Gefühl verstärkt, etwas zu verpassen, sagt Goldberg. Ein anderes Problem beschreibt der Börsenpsychologe als "Verfügbarkeitsfalle": Meist würden nur leicht verfügbare Informationen genutzt, zum Beispiel aus dem Fernsehen. Das führe oft zu einem weiteren Fehler: "Da werden einzelne Fakten für repräsentativ gehalten, und dadurch die falschen Schlüsse gezogen." Andere als Kriegsnachrichten würden am Markt zwar noch wahrgenommen, aber nur besonders wichtige. "Das ist wie in der Akustik mit dem Grundrauschen - da sind nur noch Geräusche mit bestimmter Lautstärke und Frequenz hörbar."
Es ist diese ungewohnte Situation, die viele Anleger auf der Suche nach einer Orientierungshilfe in die Vergangenheit schauen lässt. "Gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen haben die Menschen ein Kontrollbedürfnis", sagt Goldberg.
Historische Vergleiche brächten aber nicht viel, wie der Rückblick auf 1991 zeige. Solche Vergleiche seien nachträglich als Erklärungen hilfreich, konkrete Handlungsanweisungen könne man daraus aber nicht ableiten.
"Wenn sich alles in vorhersagbarer Weise wiederholen würden, könnten sich ja alle angemessen darauf vorbereiten." Privatanlegern rät Goldberg trotz der jüngsten Kurssprünge zu Ruhe: "Wenn das, was wir jetzt sehen, wirklich zu einem nachhaltigen Aufwärtstrend wird, hat der langfristig orientierte Anleger immer noch genügend Zeit für einen Einstieg."
DIE WELT - 22.03.2003
Krieg stellt Anlegern viele Fallen
Börsenpsychologen warnen vor falschen Schlüssen - Rückblicke nicht hilfreich
von Jens Wiegmann
Berlin - Die spinnen, die Anleger. Erst meiden sie wochenlang aus Angst vor einem Irak-Krieg Aktien und investieren massiv in festverzinsliche Wertpapiere und Gold. Und gleich einen Tag nach Beginn der Kampfhandlungen stürzen sie sich wie Lemminge in den deutschen Aktienmarkt. Dieser Schluss lag jedenfalls am Freitag nah, als der Dax in nur wenigen Stunden um 3,7 Prozent auf 2700 Punkte kletterte.
Nach Ansicht der Diplom-Psychologin und Börsenexpertin Monika Müller ist der Kursaufschwung jedoch leicht nachvollziehbar: "Für mich wird hier eher ein rationales, gewinnorientiertes Verhalten sichtbar." Die Situation sei völlig anders als nach den Terroranschlägen im September 2001, als Banker und Börsianer selbst direkt betroffen waren: "Da haben viele irrational und emotional gehandelt."
Schon seit einiger Zeit ist wieder die alte Börsenweisheit im Umlauf, wonach man Aktien kaufen soll, wenn die Kanonen donnern. Nun sei eben das eingetreten, was prognostiziert und erwartet worden war, sagt Müller, die private und institutionelle Investoren berät. "Viele Leute haben das gehört und gelesen, und springen jetzt auf den Zug auf." Die Expertin sieht allerdings weniger Privatanleger am Werk, die auf eine Trendumkehr setzen, als vielmehr professionelle Investoren, die kurzfristige Möglichkeiten nutzen. Der aktuelle Trend ist nach Ansicht Müllers nicht nur im Krieg begründet. "Es ist grundsätzlich eine Menge Kapital vorhanden, das investiert werden will, wie man zum Beispiel gerade an der Kursexplosion der Bayer-Aktie sehen konnte."
Die Marktteilnehmer hätten sich schon seit geraumer Zeit auf die Stunde X vorbereitet, sagt Joachim Goldberg, Geschäftsführer der auf die Analyse von Anlegerverhalten spezialisierten Firma Cognitrend. "Viele sind schon vorher aktiv geworden aus Angst, den besten Zeitpunkt zu verpassen." Aber nun sei natürlich erst einmal eine Dominanz der Ereignisse im Nahen Osten festzustellen: "Stürzt ein Hubschrauber ab fallen die Kurse, wird die Einnahme einer irakischen Stellung oder Stadt gemeldet steigen sie."
Der Krieg macht eine Einschätzung der Finanzmärkte schwieriger. Durch die schnellen und scharfen Kursbewegungen werde bei vielen Anlegern das Gefühl verstärkt, etwas zu verpassen, sagt Goldberg. Ein anderes Problem beschreibt der Börsenpsychologe als "Verfügbarkeitsfalle": Meist würden nur leicht verfügbare Informationen genutzt, zum Beispiel aus dem Fernsehen. Das führe oft zu einem weiteren Fehler: "Da werden einzelne Fakten für repräsentativ gehalten, und dadurch die falschen Schlüsse gezogen." Andere als Kriegsnachrichten würden am Markt zwar noch wahrgenommen, aber nur besonders wichtige. "Das ist wie in der Akustik mit dem Grundrauschen - da sind nur noch Geräusche mit bestimmter Lautstärke und Frequenz hörbar."
Es ist diese ungewohnte Situation, die viele Anleger auf der Suche nach einer Orientierungshilfe in die Vergangenheit schauen lässt. "Gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen haben die Menschen ein Kontrollbedürfnis", sagt Goldberg.
Historische Vergleiche brächten aber nicht viel, wie der Rückblick auf 1991 zeige. Solche Vergleiche seien nachträglich als Erklärungen hilfreich, konkrete Handlungsanweisungen könne man daraus aber nicht ableiten.
"Wenn sich alles in vorhersagbarer Weise wiederholen würden, könnten sich ja alle angemessen darauf vorbereiten." Privatanlegern rät Goldberg trotz der jüngsten Kurssprünge zu Ruhe: "Wenn das, was wir jetzt sehen, wirklich zu einem nachhaltigen Aufwärtstrend wird, hat der langfristig orientierte Anleger immer noch genügend Zeit für einen Einstieg."
DIE WELT - 22.03.2003
@konradi
Postings von unbekannten virtuellen Figuren können mich amüsieren, weiterbilden und erfreuen.
Ärgern können sie mich keinesfalls.
Das können nur Menschen die ich kenne und an denen mir etwas liegt.
Was das Bild angeht, nach den letzten 14 Tagen fühle ich mich wirklich so.
Es waren äusserst heftige, interessante und auch spannende Tage.
Dafür aber sehr lukrativ.
Der Stress dürfte auch noch ein paar Tage weiter gehen bis sich die politische Lage einigermassen geklärt hat.
Gruss
imoen
Postings von unbekannten virtuellen Figuren können mich amüsieren, weiterbilden und erfreuen.
Ärgern können sie mich keinesfalls.
Das können nur Menschen die ich kenne und an denen mir etwas liegt.
Was das Bild angeht, nach den letzten 14 Tagen fühle ich mich wirklich so.

Es waren äusserst heftige, interessante und auch spannende Tage.
Dafür aber sehr lukrativ.
Der Stress dürfte auch noch ein paar Tage weiter gehen bis sich die politische Lage einigermassen geklärt hat.
Gruss
imoen
@ imoen
na wenigstens war´s lukrativ ...
( bei mir leider nicht )
)
hier noch ein "Nach - Schlag" :
US-Investmentbanken übertreffen Erwartungen
Anleihemarkt tröstet über Fusions-Flaute hinweg
New York - Die Investmentbanken Morgan Stanley, Goldman Sachs und Lehman Brothers haben mit ihren Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Bilanz wurde besonders von Anleiheemissionen und vom Bondhandel begünstigt. Im Handel erzielten die Banken Einnahmen von fünf Mrd. Dollar. Das sind 44 Prozent der gesamten Einkünfte. Hingegen sank bei den drei Häusern der Geldsegen aus dem Investmentbanking um durchschnittlich 18 Prozent.
Während die Zahl der Fusionen im abgelaufenen Quartal um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging und Neuemissionen sogar um zwei Drittel einbrachen, schnellte das Volumen der Anleiheemissionen um 25 Prozent nach oben. Angesichts der seit drei Jahren anhaltenden Nachfrageflaute bei der Fusionsberatung und der Konsortialführung von Aktienemissionen gehen die Investmentbanken im Handel auch größere Risiken mit ihrem eigenen Kapital ein.
"Zwei Worte: festverzinsliche Werte", kommentierte Mike Santelli, Fondsmanager bei Armada Funds, die Zahlen. "Bei allen sind die Festverzinslichen hochgegangen wie eine Rakete. Überall haben Handel und Emissionsgeschäft angezogen, während alles andere nach unten gegangen ist."
Morgan Stanley verkündete zum ersten Mal seit zehn Quartalen einen Gewinnanstieg. Der Nettogewinn verbesserte sich von 848 Mio. Dollar oder 76 Cent je Aktie um sieben Prozent auf 905 Mio. Dollar oder 82 Cent je Aktie. Die Einnahmen aus der Emission von Festverzinslichen und dem Bondhandel kletterten bei Morgan Stanley - traditionell am wenigsten von Rentenwerten abhängig - um 46 Prozent auf 1,7 Mrd. Dollar.
Goldman Sachs verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinnanstieg um 26 Prozent auf 662 Mio. Dollar. Die Einnahmen im Bondhandel schnellten um 65 Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar nach oben. Lehman - am stärksten vom Anleihegeschäft abhängig - erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 301 Mio. Dollar, ein Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Der Bereich Kapitalmärkte machte 70 Prozent der Gesamteinnahmen von 1,7 Mrd. Dollar aus.
"Der Markt für Festverzinsliche steht noch", sagte Paul Fusco, Fondsmanager bei John Hancock Advisers. "Die Unternehmen nutzen das niedrige Zinsniveau, während die Aktienmärkte erstarrt sind." Unternehmen begaben in den drei Monaten zum 28. Februar für 910 Mrd. Dollar Anleihen, 28 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hingegen sanken die Aktienemissionen im gleichen Zeitraum um 60 Prozent auf 26 Mrd. Dollar.
Da die Unsicherheit über den Irak-Krieg das Quartal dominiert, stiegen Handel und Volatilität überall, von Aktienoptionen bis zum Ölpreis. Die Investmentbanken "sind ausgezeichnete Händler, und die Chancen boten sich", kommentierte James Freeman, Gründer der gleichnamigen Finanzberatung.
Zwar bescheinigen Marktbeobachter den Investmentbanken, dass sie beim Handel gut abgeschnitten haben. Allerdings ist die Konzentration auf den Handel eine Umkehr von den Bemühungen der Wall Street-Firmen , sich berechenbareren Geschäftsbereichen mit stetigem Gebühreneinkommen wie der Vermögensverwaltung stärker zuzuwenden.
DIE WELT – 22.03.2003
na wenigstens war´s lukrativ ...

( bei mir leider nicht
 )
)hier noch ein "Nach - Schlag" :
US-Investmentbanken übertreffen Erwartungen
Anleihemarkt tröstet über Fusions-Flaute hinweg
New York - Die Investmentbanken Morgan Stanley, Goldman Sachs und Lehman Brothers haben mit ihren Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Bilanz wurde besonders von Anleiheemissionen und vom Bondhandel begünstigt. Im Handel erzielten die Banken Einnahmen von fünf Mrd. Dollar. Das sind 44 Prozent der gesamten Einkünfte. Hingegen sank bei den drei Häusern der Geldsegen aus dem Investmentbanking um durchschnittlich 18 Prozent.
Während die Zahl der Fusionen im abgelaufenen Quartal um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging und Neuemissionen sogar um zwei Drittel einbrachen, schnellte das Volumen der Anleiheemissionen um 25 Prozent nach oben. Angesichts der seit drei Jahren anhaltenden Nachfrageflaute bei der Fusionsberatung und der Konsortialführung von Aktienemissionen gehen die Investmentbanken im Handel auch größere Risiken mit ihrem eigenen Kapital ein.
"Zwei Worte: festverzinsliche Werte", kommentierte Mike Santelli, Fondsmanager bei Armada Funds, die Zahlen. "Bei allen sind die Festverzinslichen hochgegangen wie eine Rakete. Überall haben Handel und Emissionsgeschäft angezogen, während alles andere nach unten gegangen ist."
Morgan Stanley verkündete zum ersten Mal seit zehn Quartalen einen Gewinnanstieg. Der Nettogewinn verbesserte sich von 848 Mio. Dollar oder 76 Cent je Aktie um sieben Prozent auf 905 Mio. Dollar oder 82 Cent je Aktie. Die Einnahmen aus der Emission von Festverzinslichen und dem Bondhandel kletterten bei Morgan Stanley - traditionell am wenigsten von Rentenwerten abhängig - um 46 Prozent auf 1,7 Mrd. Dollar.
Goldman Sachs verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinnanstieg um 26 Prozent auf 662 Mio. Dollar. Die Einnahmen im Bondhandel schnellten um 65 Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar nach oben. Lehman - am stärksten vom Anleihegeschäft abhängig - erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 301 Mio. Dollar, ein Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Der Bereich Kapitalmärkte machte 70 Prozent der Gesamteinnahmen von 1,7 Mrd. Dollar aus.
"Der Markt für Festverzinsliche steht noch", sagte Paul Fusco, Fondsmanager bei John Hancock Advisers. "Die Unternehmen nutzen das niedrige Zinsniveau, während die Aktienmärkte erstarrt sind." Unternehmen begaben in den drei Monaten zum 28. Februar für 910 Mrd. Dollar Anleihen, 28 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hingegen sanken die Aktienemissionen im gleichen Zeitraum um 60 Prozent auf 26 Mrd. Dollar.
Da die Unsicherheit über den Irak-Krieg das Quartal dominiert, stiegen Handel und Volatilität überall, von Aktienoptionen bis zum Ölpreis. Die Investmentbanken "sind ausgezeichnete Händler, und die Chancen boten sich", kommentierte James Freeman, Gründer der gleichnamigen Finanzberatung.
Zwar bescheinigen Marktbeobachter den Investmentbanken, dass sie beim Handel gut abgeschnitten haben. Allerdings ist die Konzentration auf den Handel eine Umkehr von den Bemühungen der Wall Street-Firmen , sich berechenbareren Geschäftsbereichen mit stetigem Gebühreneinkommen wie der Vermögensverwaltung stärker zuzuwenden.
DIE WELT – 22.03.2003
.
zum Thema:
Krieg und Wirtschaftskrise => steigender Goldpreis – oder :
Frieden und Wohlstand => steigernder Goldpreis ?
Trading and Investing in Gold Bullion and Gold Stocks Myth, Reality and Changing Trends
By Reginald W. Ogden
People make markets and people do not release cherished falsehoods any more easily in the area of markets than they do in the area of science or philosophy."
"Indeed the collection of empirical contradiction to our theory, albeit impressive, never succeeds solely by its presence in over turning the theory it contradicts." - Holbrook Working
"An obstinate man does not hold opinions, they hold him." - Samuel Butler
Will Rogers said, that one of the biggest problems with information is not what we don’t know so much as what we know "that ain’t so". In many cases, we tend to believe easily, that which we hope for earnestly. This is especially true of the gold bullion market.
Despite large structural, geographical and market demand/supply changes over the past 20 years, most investors and market observers still regard gold as performing the same function, and enshrining the same attributes that characterized its behaviour in the 1970’s.
Almost all of the discussion on gold and gold mining stocks, by analysts and commentators, centers on its perceived role as a monetary instrument as an alternative currency, and as a political and economic haven. The reality is much different, in that, over the past twenty years gold demand has been more a function of prosperity than of adversity. Over this period, gold has been democratized, liberalized, internationalized and commoditized. Analyzing the demand for gold on the basis of monetary or investment demand is akin to forecasting the demand for diesel fuel by looking only at busses and trains while ignoring trucks. As economic growth and prosperity spreads throughout the world, the demand for gold increases in lockstep. In this sense, it is returning to its long-term function as decoration, and an indicator of individual and group prosperity. The structural changes in the demand and supply of gold has profound effects on its ability to perform as a monetary currency and its ability to perform as a forecasting instrument for economic trends, such as, inflation and interest rates.
In the mid 80’s, gold lost much of its function as a hedge against inflation and political adversity. Less and less, it operated as a store of value, as an alternative currency and as a safe haven. Fundamental changes in supply, demand, international currency structures and trade regulations helped transform it from a hoarded asset to a tradable commodity. In this transformation, it has returned to its original use as decoration, jewelry and conspicuous consumption. Over the past two hundred years gold assumed the role of a refuge; a bet against your fellow man giving the investor a stake in disorder, inflation and a call option on calamity. This scenario no longer holds true. As each year passes, gold’s role as a political and economic hedge, and store of value, becomes overwhelmed by the sheer magnitude of international fabrication demand.
Over time, the relationship of gold to other asset classes has also changed. In the 1970’s, it bore a strong correlation to oil prices, especially between 1972 and 1979, whereas, between 1980 and 1989, it maintained a strong correlation with 90-day Treasury rates.
Over the past twenty years, gold has operated primarily as a hedge against capital gains. There have been times when gold bullion was a good investment. For instance, when Warren Buffet began his first investment partnership in 1957, one unit was valued at the equivalent price of half a single ounce of gold ($17.50). Fifteen years later, one unit was still worth a half an ounce of gold ($177.50).
In the 1970’s when gold came into its own as a hedge, U.S. gold mining was insignificant. Few derivatives or hedging instruments existed and gold mines outside of South Africa did not sell production forward. Strong currency regulations and restrictions were in force in most western countries.
Historically, gold has operated as a hedge against inflation and currency devaluation, and has always been a better hedge against ‘cost push inflation’, as in the 1970’s, than against ‘demand pull inflation’. Once regarded as a portfolio diversification tool, it now works best in this capacity only when the whole equities market is in decline, as happened in the 28 months following the March 2000 ‘bubble burst’. For diversification purposes, gold has virtually no relationship with small stocks, long-term bonds or real estate.
In the 1980’s, speculators shunned the gold bullion market knowing that any price rise would be capped by the producers selling forward. Barrick Gold was the foremost exponent of hedging, in order to expand production at a rapid rate in the Carlin Belt in Nevada. This enabled them to reduce their price risk and to raise the necessary equity from investment bankers. In the early years, Barrick Gold earned more from interest on the forward sales than from gold mining. Many marginal mines would have remained on hold if it had not been for forward selling.
Pierce Lassonde, of Newmont, estimates that hedging by gold mines brings down the price of gold by about $5.00 an ounce for every 100 tonnes sold forward. Forward selling has the tendency to increase supply by preventing mine closures.
Higher lease rates and lower dollar interest rates have undercut the ‘gold carriage trade’. Severe losses by Cambior and Ashanti when gold spiked in 1999 have deterred many independents from hedging. The decision of gold stock investors to avoid hedged gold mines has also hurt many gold mining shareholders of Barrick and Placer Dome.
When viewed on a long-term secular basis the demand and supply of gold has remained remarkably stable. The amount of gold per person has remained constant over the centuries at two-thirds of an ounce per person. Overall gold demand has grown at a steady 1.75% per annum over this period.
Non-monetary demand has almost doubled in each of the past two decades while monetary/investment demand has been negative. Non-investment demand now consumes over 2,000 tonnes a year.
Fifty-percent of all gold ever mined, has been produced since 1960. The largest percentage increases in production took place between 1930 and 1940, when world production went from 600 tonnes per annum to 1,300 tonnes and from 1980 to 2000, when production went from 1,200 tonnes per annum to 2,700 tonnes.
Annual production stabilized in 2000 and 2001 and is not expected to increase over the next five to seven years. There is a long time lag before gold supply reacts to increased prices. For example the price of gold peaked in 1980, but world gold output did not increase until three years later.
In modern times, most mined gold has come from the English speaking former British Colonies, the U.S.A, Canada, South Africa and Australia.
By 1996, the U.S. produced eleven times as much gold as it produced in 1980, as the U.S. changed to a net exporter from a net importer.
Australia has also increased production ten times since 1980, due to tax holidays and the abundance of easily accessible oxide ores amenable to heap leaching.
The biggest increase in demand for both gold and oil over the past twenty years has come from Asia.
By 1989, Asia had overtaken Europe as the largest regional consumer of gold jewelry. Today, the largest consumer of gold jewelry is India, followed by the U.S.A. and China.
The biggest increases in demand have come from countries along the ‘Old Silk Road’ – from Turkey through to newly emerging Asian countries. In the 1970’s and 1980’s, the most rapid economic growth occurred in the so called ‘City States’ – Seoul, Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok and Singapore, small countries dominated by their capitals. In the 1990’s, development moved to the continents of Mainland China and India, where economic development caused a large increase in gold jewelry consumption.
If China imported as much gold as the rest of S.E. Asia, in relation to its GDP, the country would have to import 2,000 tonnes per annum. In both India and China, when government restraints on gold ownership were lifted it caused consumption to double.
The growing influence of Asia on gold, tends to have a stabilizing effect. Unlike in the West, where people buy high and sell low, Asian consumers tend to buy low and sell high.
The major Western Central Banks have reduced their holdings by 10% over the past thirty years. Despite extensive media hype, this is not a very important factor on the supply side of the equation. More significant, is the unwillingness of newly emerging country’s Central Banks to invest their reserves in gold bullion. Almost all of Asia’s banks have less than 2% to 3% of their total reserves in gold bullion.
Base metals, unlike gold and oil, have no restraint on inventory because they are easier to store and hold, especially when interest rates are low. Demand for non-monetary gold is very ‘price elastic’. In 1980, when gold hit $850, scrap gold brought to market increased from 6 million ounces in 1978 to 21 million ounces. When gold prices fall, breakeven grades and mining company reserves fall.
The demand and supply of gold is as malleable as the metal itself. When real inflation rates decline, the gold price is determined more by its own supply and demand characteristics than by macroeconomics. Like all commodities and currencies, demand is much more important than supply in determining prices especially in the short run. While demand for base metals correlates 95% to changes in industrial output, gold bullion demand for jewelry correlates most closely with consumer confidence. Supply is determined not by annual mining production so much as the total reserves above ground. Unlike platinum and silver, which tend to be consumed, gold reserves are extremely large in relation to annual mined production.
A major change in gold volatility took place in October 1979 when Paul Volker took over at the Federal Reserve. Fed policy switched from controlling and fine-tuning interest rates to controlling money supply. As inflation is always a monetary problem, the gold market adjusted to the new constraints placed on inflation.
The original contention that gold is an accurate reflection of inflation because it is not involved in the economy, no longer holds. Jewelry and fabrication are now the largest end users of gold production.
By 1980, jewelry demand on a worldwide basis had caught up with currency demand; each consumed 540 tonnes per annum. By 1990, world jewelry demand had increased to 2,000 tonnes and exceeded mine production by 250 tonnes. During the same period, investment demand has stabilized in the 400 to 500 tonnes per annum range.
Since 1850, world gold jewelry demand has increased one hundred times, while world population has increased five times. Since 1968, world gold jewelry demand has grown in step with world GDP growth.
The twentieth century has seen an ever-widening market for what was once the preserve of the rich and powerful. Today, gold jewelry consumption has been extended by mass-marketing to all sectors of society.
In recent years, there has been a quantum leap in demand from Asia. In 1984 Beijing lifted the ban on the sale of gold jewelry. Today, Mainland China’s average consumer owns a fraction of a gram versus over 10 grams per capita in Hong Kong and Taiwan.
In a typical year, India imports 800 tonnes, 95% of which goes into gold jewelry fabrication.
In the industrialized countries the typical markup on jewelry is 200% to 400%, whereas, in Asia and the Middle East a 10% to 20% markup is standard. A Western wedding ring contains approximately 4 grams of gold, while in India it can contain 100 grams. The average wedding in India involves at least a kilo of gold.
Trading Gold and Precious Metals Securities
When it comes to a choice between investing in gold bullion or gold securities, most investors have chosen to buy the goose rather than the golden egg. If we applied the same yardstick to gold and precious metals securities that we apply to other securities, nobody would ever buy them at their inflated prices. In the real world, a $1,000 ingot of zinc is worth the same as $1,000 of gold. In the marketplace, a company producing $10,000,000 worth of gold can be worth two to four times as much as a company producing the equivalent dollar amount of base metals, assuming they are equally as profitable as each other.
Since 1970, the average price earnings ratio for gold stocks has been twice that of the market as a whole, despite the fact that gold stocks pay few, if any dividends, and many of them have survival problems. World gold mining securities comprise a tiny fraction of tradable securities. The total worldwide market capitalization is less than one-third that of Coca-Cola.
Gold stocks, as a group, make for poor long-term investments, but can be extremely lucrative for the informed and astute investor, if he chooses the right security and the right time frames to trade them.
Gold mining securities perform a dual role, first as an instrument of gold and secondly as equities. At times, they behave as a thermometer, reflecting gold price changes, and at times as a barometer, forecasting the economic and political weather in the near future.
Gold itself has often behaved as a better forecaster than it has been a commodity to be forecasted. Traditionally viewed as a hedge against adversity and political turmoil, its function in this capacity has been complicated by gold miners hedging the commodity itself, as well as by changes in fabrication demand.
The market, in recent times, has shunned companies such as Barrick Gold and Placer Dome, who have ‘hedged the hedge’.
Most mining analysts, gold bugs and pundits, when writing about gold and gold mining securities, still view gold as a hedge against adversity and look for long-term appreciation from investors and speculators hoarding activities. They still view it as a potential store of monetary value. When gold, which has been in a twenty-year secular bear market, does not perform as expected blame is placed on Central Banks.
Over the past twenty years, Central Bank reserves have remained relatively stable. Sales by Australia, Canada and the United Kingdom have been offset by emerging countries Central Bank purchases. To date, Central Banks have not sold into gold rallies, as they are primarily concerned with the value of their total gold holding.
One should remember banking in the Western world owes its origins to goldsmiths who lent out their gold inventories to earn a profit and in the process laid the foundation of modern day debt and credit markets.
The growing commoditization of gold bullion, its decline in importance as a monetary store of value, and the growing use of derivatives as an alternative form of hedging, have made gold stocks the favorite vehicle for gold bugs and gold speculators.
Unlike base metals, gold mining and demand for its end product is still a growth industry. Demand for gold has become very price elastic, especially the demand for gold jewelry. A one percent increase in price leads to a three percent decline in jewelry demand and vice versa.
The long-term demand growth in gold consumption is now a function of prosperity not adversity.
In the 1980’s and 1990’s, speculators shunned the gold bullion market, knowing that producers were ready to sell into any rally. This caused speculators to focus almost exclusively on un-hedged mining securities for potential capital appreciation.
Over the past ten to twenty years, there have been many fundamental and influential changes in both the gold bullion demand/supply equation and in the nature and structure of publicly traded gold mining securities.
Because gold miners are commodity producers, investors wishing to find potential long-term buy-and-holds must follow the same criteria as any other commodity sector such as steel and oil. It must have large increases in physical production, cash flow and earnings per share.
If we compare Nucor to Bethleham Steel, CNQ to Imperial Oil, we see the same rules prevailing in those industries that determine long-term success in the gold mining industry. For instance, in 1986 Barrick Gold had a market capitalization of $86 million U.S., which went to over $6 billion U.S. due to large increases in physical production. Once growth stabilizes or declines the shares secular growth also declines, as they become trading vehicles instead of investment instruments.
Early in a gold bull market the companies that have increased production, cash flow or reserves in the bear market, are the first to appreciate. In the recent gold bull market, these were Goldcorp, Agnico-Eagle, IAMGold, Meridian Gold and Glamis Gold. In fact, Glamis Gold has been the best performing stock in the TSE 300 since March 2000.
When the market expects gold to appreciate, in terms of U.S. dollars, it needs to ignore companies such as Placer Dome and Barrick Gold, which are heavily hedged in U.S. dollar terms.
In the next phase the market rushes to fund the marginal producers or the companies with marginal deposits left over from the last bull phase – e.g. Kinross, Bema Gold and TVX. In the third phase, attention switches to new discoveries and junior exploration companies.
A review of gold, oil and base metal bull markets over the past thirty years shows that most of the action or price appreciation occurs over very short time frames of six to eight weeks.
In most cases, corrections of 50% to 60% occur even on some of the quality stocks or leaders. The secular bull market contains many of these ‘bursts’. One way to tell when a correction is due is to look for ‘sheet highs’; by this we mean a two to four week period in which all of the stocks in the sector are setting new twelve-month highs. This occurred in the last two weeks of May 2002, setting up the correction in the first two weeks of June 2002, when over one hundred gold and precious metal stocks all peaked at the same time. At these junctures, gold stocks behave like ‘fat bottomed ladies’; when the bullion price backs off, hedged and un-hedged stocks act alike and head south.
Most peaks occur when U.S. ownership is at its highest. This can be gauged by watching the relative volumes traded on inter-listed stocks such as Glamis Gold, Agnico-Eagle and Goldcorp on U.S. markets versus Canadian markets.
The investor needs to be aware of companies that pay too much for acquisitions, such as Placer Dome. Most major acquisitions have led to write-downs. One study done of acquisitions by major mining companies over the past twenty years showed that 80% of the benefits went to the company being acquired and only 20% to the acquirer.
Small mining exploration companies have been likened to slot machines emptying the pockets of investors. However, at the right phase of the gold exploration cycle they can be very profitable. As in all sectors, the largest gains are made in stocks that graduate from small cap to large cap status.
In the past two to three years, investors began to realize how profitable high-grade mines could be. Agnico-Eagle, Goldcorp and Franco-Nevada have all been extremely profitable with high-grade underground mines, causing substantial price appreciation in these company’s shares.
Ten years ago, analysts only looked at companies doing 100,000 ounces per annum. Rapid growth by industry leaders has pushed the bar to 250,000 ounces.
These mid-tier companies such as Goldcorp, Agnico-Eagle, Meridian and IAMGold have been star performers in the recent gold bull market. Unlike Barrick Gold and Placer Dome, which have sold forward a large part of production, these companies are either un-hedged or have closed out their hedge positions.
While it is true that great ore bodies can create great companies – e.g. Barrick, Newmont and Goldcorp – gold mining companies still need to make new discoveries to keep the market interested on a sustained basis.
In the late 1980’s, Newmont and Barrick both drilled deep in the Carlin belt. Previously, operators had been content to mine the very profitable low-grade surface ore. Barrick went on to become the first gold mining company to produce 1,000,000 ounces in North America.
The most significant trend over the past five years has been ‘deep drilling’. It has turned marginal mines at Agnico-Eagle and Goldcorp into highly productive cash flow machines. The second important trend has been the increased exploration activity in non-English speaking countries. The third significant trend has been the increased importance of gold as a byproduct of base metals mining which now accounts for 20% of total production.
In summary, the long-term secular trend in gold prices is now affected more by the level of world prosperity, especially outside of Europe and North America, whereas, short-term volatility and trends are determined by the U.S. dollar and economic and political dislocations.
zum Thema:
Krieg und Wirtschaftskrise => steigender Goldpreis – oder :
Frieden und Wohlstand => steigernder Goldpreis ?
Trading and Investing in Gold Bullion and Gold Stocks Myth, Reality and Changing Trends
By Reginald W. Ogden
People make markets and people do not release cherished falsehoods any more easily in the area of markets than they do in the area of science or philosophy."
"Indeed the collection of empirical contradiction to our theory, albeit impressive, never succeeds solely by its presence in over turning the theory it contradicts." - Holbrook Working
"An obstinate man does not hold opinions, they hold him." - Samuel Butler
Will Rogers said, that one of the biggest problems with information is not what we don’t know so much as what we know "that ain’t so". In many cases, we tend to believe easily, that which we hope for earnestly. This is especially true of the gold bullion market.
Despite large structural, geographical and market demand/supply changes over the past 20 years, most investors and market observers still regard gold as performing the same function, and enshrining the same attributes that characterized its behaviour in the 1970’s.
Almost all of the discussion on gold and gold mining stocks, by analysts and commentators, centers on its perceived role as a monetary instrument as an alternative currency, and as a political and economic haven. The reality is much different, in that, over the past twenty years gold demand has been more a function of prosperity than of adversity. Over this period, gold has been democratized, liberalized, internationalized and commoditized. Analyzing the demand for gold on the basis of monetary or investment demand is akin to forecasting the demand for diesel fuel by looking only at busses and trains while ignoring trucks. As economic growth and prosperity spreads throughout the world, the demand for gold increases in lockstep. In this sense, it is returning to its long-term function as decoration, and an indicator of individual and group prosperity. The structural changes in the demand and supply of gold has profound effects on its ability to perform as a monetary currency and its ability to perform as a forecasting instrument for economic trends, such as, inflation and interest rates.
In the mid 80’s, gold lost much of its function as a hedge against inflation and political adversity. Less and less, it operated as a store of value, as an alternative currency and as a safe haven. Fundamental changes in supply, demand, international currency structures and trade regulations helped transform it from a hoarded asset to a tradable commodity. In this transformation, it has returned to its original use as decoration, jewelry and conspicuous consumption. Over the past two hundred years gold assumed the role of a refuge; a bet against your fellow man giving the investor a stake in disorder, inflation and a call option on calamity. This scenario no longer holds true. As each year passes, gold’s role as a political and economic hedge, and store of value, becomes overwhelmed by the sheer magnitude of international fabrication demand.
Over time, the relationship of gold to other asset classes has also changed. In the 1970’s, it bore a strong correlation to oil prices, especially between 1972 and 1979, whereas, between 1980 and 1989, it maintained a strong correlation with 90-day Treasury rates.
Over the past twenty years, gold has operated primarily as a hedge against capital gains. There have been times when gold bullion was a good investment. For instance, when Warren Buffet began his first investment partnership in 1957, one unit was valued at the equivalent price of half a single ounce of gold ($17.50). Fifteen years later, one unit was still worth a half an ounce of gold ($177.50).
In the 1970’s when gold came into its own as a hedge, U.S. gold mining was insignificant. Few derivatives or hedging instruments existed and gold mines outside of South Africa did not sell production forward. Strong currency regulations and restrictions were in force in most western countries.
Historically, gold has operated as a hedge against inflation and currency devaluation, and has always been a better hedge against ‘cost push inflation’, as in the 1970’s, than against ‘demand pull inflation’. Once regarded as a portfolio diversification tool, it now works best in this capacity only when the whole equities market is in decline, as happened in the 28 months following the March 2000 ‘bubble burst’. For diversification purposes, gold has virtually no relationship with small stocks, long-term bonds or real estate.
In the 1980’s, speculators shunned the gold bullion market knowing that any price rise would be capped by the producers selling forward. Barrick Gold was the foremost exponent of hedging, in order to expand production at a rapid rate in the Carlin Belt in Nevada. This enabled them to reduce their price risk and to raise the necessary equity from investment bankers. In the early years, Barrick Gold earned more from interest on the forward sales than from gold mining. Many marginal mines would have remained on hold if it had not been for forward selling.
Pierce Lassonde, of Newmont, estimates that hedging by gold mines brings down the price of gold by about $5.00 an ounce for every 100 tonnes sold forward. Forward selling has the tendency to increase supply by preventing mine closures.
Higher lease rates and lower dollar interest rates have undercut the ‘gold carriage trade’. Severe losses by Cambior and Ashanti when gold spiked in 1999 have deterred many independents from hedging. The decision of gold stock investors to avoid hedged gold mines has also hurt many gold mining shareholders of Barrick and Placer Dome.
When viewed on a long-term secular basis the demand and supply of gold has remained remarkably stable. The amount of gold per person has remained constant over the centuries at two-thirds of an ounce per person. Overall gold demand has grown at a steady 1.75% per annum over this period.
Non-monetary demand has almost doubled in each of the past two decades while monetary/investment demand has been negative. Non-investment demand now consumes over 2,000 tonnes a year.
Fifty-percent of all gold ever mined, has been produced since 1960. The largest percentage increases in production took place between 1930 and 1940, when world production went from 600 tonnes per annum to 1,300 tonnes and from 1980 to 2000, when production went from 1,200 tonnes per annum to 2,700 tonnes.
Annual production stabilized in 2000 and 2001 and is not expected to increase over the next five to seven years. There is a long time lag before gold supply reacts to increased prices. For example the price of gold peaked in 1980, but world gold output did not increase until three years later.
In modern times, most mined gold has come from the English speaking former British Colonies, the U.S.A, Canada, South Africa and Australia.
By 1996, the U.S. produced eleven times as much gold as it produced in 1980, as the U.S. changed to a net exporter from a net importer.
Australia has also increased production ten times since 1980, due to tax holidays and the abundance of easily accessible oxide ores amenable to heap leaching.
The biggest increase in demand for both gold and oil over the past twenty years has come from Asia.
By 1989, Asia had overtaken Europe as the largest regional consumer of gold jewelry. Today, the largest consumer of gold jewelry is India, followed by the U.S.A. and China.
The biggest increases in demand have come from countries along the ‘Old Silk Road’ – from Turkey through to newly emerging Asian countries. In the 1970’s and 1980’s, the most rapid economic growth occurred in the so called ‘City States’ – Seoul, Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok and Singapore, small countries dominated by their capitals. In the 1990’s, development moved to the continents of Mainland China and India, where economic development caused a large increase in gold jewelry consumption.
If China imported as much gold as the rest of S.E. Asia, in relation to its GDP, the country would have to import 2,000 tonnes per annum. In both India and China, when government restraints on gold ownership were lifted it caused consumption to double.
The growing influence of Asia on gold, tends to have a stabilizing effect. Unlike in the West, where people buy high and sell low, Asian consumers tend to buy low and sell high.
The major Western Central Banks have reduced their holdings by 10% over the past thirty years. Despite extensive media hype, this is not a very important factor on the supply side of the equation. More significant, is the unwillingness of newly emerging country’s Central Banks to invest their reserves in gold bullion. Almost all of Asia’s banks have less than 2% to 3% of their total reserves in gold bullion.
Base metals, unlike gold and oil, have no restraint on inventory because they are easier to store and hold, especially when interest rates are low. Demand for non-monetary gold is very ‘price elastic’. In 1980, when gold hit $850, scrap gold brought to market increased from 6 million ounces in 1978 to 21 million ounces. When gold prices fall, breakeven grades and mining company reserves fall.
The demand and supply of gold is as malleable as the metal itself. When real inflation rates decline, the gold price is determined more by its own supply and demand characteristics than by macroeconomics. Like all commodities and currencies, demand is much more important than supply in determining prices especially in the short run. While demand for base metals correlates 95% to changes in industrial output, gold bullion demand for jewelry correlates most closely with consumer confidence. Supply is determined not by annual mining production so much as the total reserves above ground. Unlike platinum and silver, which tend to be consumed, gold reserves are extremely large in relation to annual mined production.
A major change in gold volatility took place in October 1979 when Paul Volker took over at the Federal Reserve. Fed policy switched from controlling and fine-tuning interest rates to controlling money supply. As inflation is always a monetary problem, the gold market adjusted to the new constraints placed on inflation.
The original contention that gold is an accurate reflection of inflation because it is not involved in the economy, no longer holds. Jewelry and fabrication are now the largest end users of gold production.
By 1980, jewelry demand on a worldwide basis had caught up with currency demand; each consumed 540 tonnes per annum. By 1990, world jewelry demand had increased to 2,000 tonnes and exceeded mine production by 250 tonnes. During the same period, investment demand has stabilized in the 400 to 500 tonnes per annum range.
Since 1850, world gold jewelry demand has increased one hundred times, while world population has increased five times. Since 1968, world gold jewelry demand has grown in step with world GDP growth.
The twentieth century has seen an ever-widening market for what was once the preserve of the rich and powerful. Today, gold jewelry consumption has been extended by mass-marketing to all sectors of society.
In recent years, there has been a quantum leap in demand from Asia. In 1984 Beijing lifted the ban on the sale of gold jewelry. Today, Mainland China’s average consumer owns a fraction of a gram versus over 10 grams per capita in Hong Kong and Taiwan.
In a typical year, India imports 800 tonnes, 95% of which goes into gold jewelry fabrication.
In the industrialized countries the typical markup on jewelry is 200% to 400%, whereas, in Asia and the Middle East a 10% to 20% markup is standard. A Western wedding ring contains approximately 4 grams of gold, while in India it can contain 100 grams. The average wedding in India involves at least a kilo of gold.
Trading Gold and Precious Metals Securities
When it comes to a choice between investing in gold bullion or gold securities, most investors have chosen to buy the goose rather than the golden egg. If we applied the same yardstick to gold and precious metals securities that we apply to other securities, nobody would ever buy them at their inflated prices. In the real world, a $1,000 ingot of zinc is worth the same as $1,000 of gold. In the marketplace, a company producing $10,000,000 worth of gold can be worth two to four times as much as a company producing the equivalent dollar amount of base metals, assuming they are equally as profitable as each other.
Since 1970, the average price earnings ratio for gold stocks has been twice that of the market as a whole, despite the fact that gold stocks pay few, if any dividends, and many of them have survival problems. World gold mining securities comprise a tiny fraction of tradable securities. The total worldwide market capitalization is less than one-third that of Coca-Cola.
Gold stocks, as a group, make for poor long-term investments, but can be extremely lucrative for the informed and astute investor, if he chooses the right security and the right time frames to trade them.
Gold mining securities perform a dual role, first as an instrument of gold and secondly as equities. At times, they behave as a thermometer, reflecting gold price changes, and at times as a barometer, forecasting the economic and political weather in the near future.
Gold itself has often behaved as a better forecaster than it has been a commodity to be forecasted. Traditionally viewed as a hedge against adversity and political turmoil, its function in this capacity has been complicated by gold miners hedging the commodity itself, as well as by changes in fabrication demand.
The market, in recent times, has shunned companies such as Barrick Gold and Placer Dome, who have ‘hedged the hedge’.
Most mining analysts, gold bugs and pundits, when writing about gold and gold mining securities, still view gold as a hedge against adversity and look for long-term appreciation from investors and speculators hoarding activities. They still view it as a potential store of monetary value. When gold, which has been in a twenty-year secular bear market, does not perform as expected blame is placed on Central Banks.
Over the past twenty years, Central Bank reserves have remained relatively stable. Sales by Australia, Canada and the United Kingdom have been offset by emerging countries Central Bank purchases. To date, Central Banks have not sold into gold rallies, as they are primarily concerned with the value of their total gold holding.
One should remember banking in the Western world owes its origins to goldsmiths who lent out their gold inventories to earn a profit and in the process laid the foundation of modern day debt and credit markets.
The growing commoditization of gold bullion, its decline in importance as a monetary store of value, and the growing use of derivatives as an alternative form of hedging, have made gold stocks the favorite vehicle for gold bugs and gold speculators.
Unlike base metals, gold mining and demand for its end product is still a growth industry. Demand for gold has become very price elastic, especially the demand for gold jewelry. A one percent increase in price leads to a three percent decline in jewelry demand and vice versa.
The long-term demand growth in gold consumption is now a function of prosperity not adversity.
In the 1980’s and 1990’s, speculators shunned the gold bullion market, knowing that producers were ready to sell into any rally. This caused speculators to focus almost exclusively on un-hedged mining securities for potential capital appreciation.
Over the past ten to twenty years, there have been many fundamental and influential changes in both the gold bullion demand/supply equation and in the nature and structure of publicly traded gold mining securities.
Because gold miners are commodity producers, investors wishing to find potential long-term buy-and-holds must follow the same criteria as any other commodity sector such as steel and oil. It must have large increases in physical production, cash flow and earnings per share.
If we compare Nucor to Bethleham Steel, CNQ to Imperial Oil, we see the same rules prevailing in those industries that determine long-term success in the gold mining industry. For instance, in 1986 Barrick Gold had a market capitalization of $86 million U.S., which went to over $6 billion U.S. due to large increases in physical production. Once growth stabilizes or declines the shares secular growth also declines, as they become trading vehicles instead of investment instruments.
Early in a gold bull market the companies that have increased production, cash flow or reserves in the bear market, are the first to appreciate. In the recent gold bull market, these were Goldcorp, Agnico-Eagle, IAMGold, Meridian Gold and Glamis Gold. In fact, Glamis Gold has been the best performing stock in the TSE 300 since March 2000.
When the market expects gold to appreciate, in terms of U.S. dollars, it needs to ignore companies such as Placer Dome and Barrick Gold, which are heavily hedged in U.S. dollar terms.
In the next phase the market rushes to fund the marginal producers or the companies with marginal deposits left over from the last bull phase – e.g. Kinross, Bema Gold and TVX. In the third phase, attention switches to new discoveries and junior exploration companies.
A review of gold, oil and base metal bull markets over the past thirty years shows that most of the action or price appreciation occurs over very short time frames of six to eight weeks.
In most cases, corrections of 50% to 60% occur even on some of the quality stocks or leaders. The secular bull market contains many of these ‘bursts’. One way to tell when a correction is due is to look for ‘sheet highs’; by this we mean a two to four week period in which all of the stocks in the sector are setting new twelve-month highs. This occurred in the last two weeks of May 2002, setting up the correction in the first two weeks of June 2002, when over one hundred gold and precious metal stocks all peaked at the same time. At these junctures, gold stocks behave like ‘fat bottomed ladies’; when the bullion price backs off, hedged and un-hedged stocks act alike and head south.
Most peaks occur when U.S. ownership is at its highest. This can be gauged by watching the relative volumes traded on inter-listed stocks such as Glamis Gold, Agnico-Eagle and Goldcorp on U.S. markets versus Canadian markets.
The investor needs to be aware of companies that pay too much for acquisitions, such as Placer Dome. Most major acquisitions have led to write-downs. One study done of acquisitions by major mining companies over the past twenty years showed that 80% of the benefits went to the company being acquired and only 20% to the acquirer.
Small mining exploration companies have been likened to slot machines emptying the pockets of investors. However, at the right phase of the gold exploration cycle they can be very profitable. As in all sectors, the largest gains are made in stocks that graduate from small cap to large cap status.
In the past two to three years, investors began to realize how profitable high-grade mines could be. Agnico-Eagle, Goldcorp and Franco-Nevada have all been extremely profitable with high-grade underground mines, causing substantial price appreciation in these company’s shares.
Ten years ago, analysts only looked at companies doing 100,000 ounces per annum. Rapid growth by industry leaders has pushed the bar to 250,000 ounces.
These mid-tier companies such as Goldcorp, Agnico-Eagle, Meridian and IAMGold have been star performers in the recent gold bull market. Unlike Barrick Gold and Placer Dome, which have sold forward a large part of production, these companies are either un-hedged or have closed out their hedge positions.
While it is true that great ore bodies can create great companies – e.g. Barrick, Newmont and Goldcorp – gold mining companies still need to make new discoveries to keep the market interested on a sustained basis.
In the late 1980’s, Newmont and Barrick both drilled deep in the Carlin belt. Previously, operators had been content to mine the very profitable low-grade surface ore. Barrick went on to become the first gold mining company to produce 1,000,000 ounces in North America.
The most significant trend over the past five years has been ‘deep drilling’. It has turned marginal mines at Agnico-Eagle and Goldcorp into highly productive cash flow machines. The second important trend has been the increased exploration activity in non-English speaking countries. The third significant trend has been the increased importance of gold as a byproduct of base metals mining which now accounts for 20% of total production.
In summary, the long-term secular trend in gold prices is now affected more by the level of world prosperity, especially outside of Europe and North America, whereas, short-term volatility and trends are determined by the U.S. dollar and economic and political dislocations.
@konradi oder auch andere
Was hälst Du/ihr von meiner These im # 301 bezüglich des Euro`s?
Hab ich einen Gefankenfehler oder ist es völlig abwegig?
Vielleicht fällt ja jemanden etwas dazu ein.
Was hälst Du/ihr von meiner These im # 301 bezüglich des Euro`s?
Hab ich einen Gefankenfehler oder ist es völlig abwegig?
Vielleicht fällt ja jemanden etwas dazu ein.

.
@ imoen
Durch die Einführung des Euro`s wurde ein vermeintlich neuer sicherer Hafen eingeführt, in den ja auch kräftig Kohle fließt. Damit dürften wir auf der Papierseite noch jahrelang einigermassen Ruhe haben.
Als lupenreiner goldbug darf man nur in worst case Szenarien denken, imoen
Wenn Du aber recht behalten behalten solltest, können wir uns schon mal den Revolver bereitlegen ...
Im Sentiment sieht´s jedenfalls beschissen aus. Der daily upside trend wurde nachhaltig gebrochen:
hier der sentiment composite index von sharelynx :

(These datasets have been collated from four primary gold producing regions :-
America - Australia - Canada - South Africa
Gold - Platinum - Silver - metals
XAU - HUI - GOX - CRB - GSCI - GPX - CANGOLD - J150 - XGO - indexes
ABX - GFI - NEM - PDG - stocks
ASA - DROOY - HGMCY - LHG - NCM - stocks
BGEIX - FSAGX - LEXMX - USERX - USAGX - mutual funds
Each of the index`s 26 components is arithmetically averaged giving them an equal weighting)
Ich habe keine Ahnung von Charttechnik, imoen, ich denke nur der nächste Widerstand des POG dürfte bei 320 liegen, dem Ausbruch zu Beginn Dezember. Allerdings könnten alle Trendfolgeindikatoren uninteressant werden, wenn morgen bei Al Jazeera 50 zerfetzte GI´s gezeigt werden.
Gruß Konradi
.
@ imoen
Durch die Einführung des Euro`s wurde ein vermeintlich neuer sicherer Hafen eingeführt, in den ja auch kräftig Kohle fließt. Damit dürften wir auf der Papierseite noch jahrelang einigermassen Ruhe haben.
Als lupenreiner goldbug darf man nur in worst case Szenarien denken, imoen

Wenn Du aber recht behalten behalten solltest, können wir uns schon mal den Revolver bereitlegen ...

Im Sentiment sieht´s jedenfalls beschissen aus. Der daily upside trend wurde nachhaltig gebrochen:
hier der sentiment composite index von sharelynx :

(These datasets have been collated from four primary gold producing regions :-
America - Australia - Canada - South Africa
Gold - Platinum - Silver - metals
XAU - HUI - GOX - CRB - GSCI - GPX - CANGOLD - J150 - XGO - indexes
ABX - GFI - NEM - PDG - stocks
ASA - DROOY - HGMCY - LHG - NCM - stocks
BGEIX - FSAGX - LEXMX - USERX - USAGX - mutual funds
Each of the index`s 26 components is arithmetically averaged giving them an equal weighting)
Ich habe keine Ahnung von Charttechnik, imoen, ich denke nur der nächste Widerstand des POG dürfte bei 320 liegen, dem Ausbruch zu Beginn Dezember. Allerdings könnten alle Trendfolgeindikatoren uninteressant werden, wenn morgen bei Al Jazeera 50 zerfetzte GI´s gezeigt werden.
Gruß Konradi
.
aber für die charties habe ich auch noch einen link,
- man wird ja nachdenklich in schweren Zeiten ...
http://www.clifdroke.com/gold/g032403.mgi
- man wird ja nachdenklich in schweren Zeiten ...

http://www.clifdroke.com/gold/g032403.mgi
@Konradi
Mit dem Euro meinte ich das die Leute noch eine Alternative zu Gold haben und die zur Zeit auch nutzen.
Unterstützungen beim Gold müssten so c. 320, 316 und 308 sein.
Nach oben erst mal c. 345 und 365 als grössere Widerstände.
Wichtig wäre erst mal in den Bereich 330 - 345 zurück zu kommen.
Persönlich glaube ich noch an ein kurzes abtauchen in den 308 Bereich und dann einen kräftigen upmove.
Handeln tue ich allerdings nach der aktuellen Nachrichtenlage, alles andere dürfte fahrlässig sein.
Gruss
Mit dem Euro meinte ich das die Leute noch eine Alternative zu Gold haben und die zur Zeit auch nutzen.
Unterstützungen beim Gold müssten so c. 320, 316 und 308 sein.
Nach oben erst mal c. 345 und 365 als grössere Widerstände.
Wichtig wäre erst mal in den Bereich 330 - 345 zurück zu kommen.
Persönlich glaube ich noch an ein kurzes abtauchen in den 308 Bereich und dann einen kräftigen upmove.
Handeln tue ich allerdings nach der aktuellen Nachrichtenlage, alles andere dürfte fahrlässig sein.
Gruss
Mit dem Euro meinte ich das die Leute noch eine Alternative zu Gold haben und die zur Zeit auch nutzen.
... habe ich auch so verstanden, - mittelfristig bleibt es daher beim Hase-Igel-Spiel, denn die Zentralbanken werden die Weltleitwährung nur "kontrolliert abschmieren" lassen können. Und da ist zwischendurch für gewiefte trader wie Dich immer noch ein Schnäppchen zu machen...
... habe ich auch so verstanden, - mittelfristig bleibt es daher beim Hase-Igel-Spiel, denn die Zentralbanken werden die Weltleitwährung nur "kontrolliert abschmieren" lassen können. Und da ist zwischendurch für gewiefte trader wie Dich immer noch ein Schnäppchen zu machen...

Ich überlege die ganze Zeit, an wen mich das blöde Gelabere von
`IMOEN` erinnert.
 ... kombiniere
... kombiniere
Ich hab da so eine Idee, aber ich will ja keinen beleidigen.
STRONG ANTIAMERIKANISCH
YO
`IMOEN` erinnert.
 ... kombiniere
... kombiniereIch hab da so eine Idee, aber ich will ja keinen beleidigen.
STRONG ANTIAMERIKANISCH

YO
ONLYYOU
Ich kombiniere.
GO???
Grüße Talvi
Ich kombiniere.
GO???

Grüße Talvi

@go
Warum habe ich wohl ausser Unsinn kein stichhaltiges Argument von Dir erwartet?
Warum habe ich wohl ausser Unsinn kein stichhaltiges Argument von Dir erwartet?

Wenn der Krieg schnell beendet ist, wird ein siegestrunkenes Volk den Goldpreis drücken. Das legt sich dann aber schnell. Es wird wohl noch günstigere Kaufkurse geben!
wie soll ich das nun wieder einordnen ... ? 
US-Ökonom prophezeit zehnjährigen Wirtschaftsboom
Der amerikanische Volkswirt Fred Bergsten erwartet, dass der Preis je Barrel Öl um weitere 10 bis 15 Dollar fällt. Das werde in den USA einen lang anhaltenden Wirtschaftsboom auslösen.
Berlin - Nach dem Golfkrieg 1991 sei der Ölpreis um ein Drittel gefallen: "Das war der Beginn eines zehnjährigen Booms in den USA. Ich glaube, wir werden dieses Mal ein ähnliches Ergebnis sehen."
Der Wirtschaft in den USA sagte Bergsten im "Tagesspiegel" unter dieser Annahme im zweiten Halbjahr ein Wachstum zwischen vier und fünf Prozent voraus. Voraussetzung für das Ende der weltweiten Konjunkturflaute sei aber auch, dass sich die durch den Krieg belasteten Beziehungen zwischen Europa und den USA wieder normalisierten, so Bergsten weiter.
Die Partner würden sich sehr stark bemühen, "den Scherbenhaufen so schnell wie möglich zusammenzufegen". Auch die Bush-Regierung werde erkennen, "dass sie sich mildern muss. Im Moment mag die US-Regierung eher verletzt oder rachsüchtig sein. Aber wenn der Krieg vorbei ist und sie mit der Realität der Nachkriegsphase konfrontiert ist, wird sie sich ebenfalls um eine Aussöhnung bemühen".
Fred Bergsten leitet das Washingtoner "Institute for International Economics" (IIE) seit dessen Gründung 1981. Das IIE gehört zu den führenden Denkfabriken der USA. In der Vergangenheit hatte Bergsten verschiedene Positionen in der US-Regierung inne: Für Henry Kissinger koordinierte er von 1969 bis 1971 die internationale Wirtschaftspolitik der USA, unter Jimmy Carter leitete er vier Jahre lang die Abteilung für Internationale Angelegenheiten.
DER SPIEGEL - 24.03.2003

US-Ökonom prophezeit zehnjährigen Wirtschaftsboom
Der amerikanische Volkswirt Fred Bergsten erwartet, dass der Preis je Barrel Öl um weitere 10 bis 15 Dollar fällt. Das werde in den USA einen lang anhaltenden Wirtschaftsboom auslösen.
Berlin - Nach dem Golfkrieg 1991 sei der Ölpreis um ein Drittel gefallen: "Das war der Beginn eines zehnjährigen Booms in den USA. Ich glaube, wir werden dieses Mal ein ähnliches Ergebnis sehen."
Der Wirtschaft in den USA sagte Bergsten im "Tagesspiegel" unter dieser Annahme im zweiten Halbjahr ein Wachstum zwischen vier und fünf Prozent voraus. Voraussetzung für das Ende der weltweiten Konjunkturflaute sei aber auch, dass sich die durch den Krieg belasteten Beziehungen zwischen Europa und den USA wieder normalisierten, so Bergsten weiter.
Die Partner würden sich sehr stark bemühen, "den Scherbenhaufen so schnell wie möglich zusammenzufegen". Auch die Bush-Regierung werde erkennen, "dass sie sich mildern muss. Im Moment mag die US-Regierung eher verletzt oder rachsüchtig sein. Aber wenn der Krieg vorbei ist und sie mit der Realität der Nachkriegsphase konfrontiert ist, wird sie sich ebenfalls um eine Aussöhnung bemühen".
Fred Bergsten leitet das Washingtoner "Institute for International Economics" (IIE) seit dessen Gründung 1981. Das IIE gehört zu den führenden Denkfabriken der USA. In der Vergangenheit hatte Bergsten verschiedene Positionen in der US-Regierung inne: Für Henry Kissinger koordinierte er von 1969 bis 1971 die internationale Wirtschaftspolitik der USA, unter Jimmy Carter leitete er vier Jahre lang die Abteilung für Internationale Angelegenheiten.
DER SPIEGEL - 24.03.2003
NYT: Irak-Wiederaufbau, US-Firmen bald bekannt

©BörseGo
Die New York Times (Montagsausgabe) berichtet, dass erste Unternehmen für den Wiederaufbau im Irak bald von der US-Regierung ausgewählt werden sollen. Eine diesbezügliche Bekanntgabe soll bald folgen, hieß es in dem am Montag publizierten Artikel. Das Volumen des Wiederaufbaus im Irak wird auf $25-$100 Milliarden geschätzt. Zu den möglichen Auftragsgewinnern könnten unter anderem Halliburton Company, Fluor Corporation und die Washington Group International gehören, hieß es.

©BörseGo
Die New York Times (Montagsausgabe) berichtet, dass erste Unternehmen für den Wiederaufbau im Irak bald von der US-Regierung ausgewählt werden sollen. Eine diesbezügliche Bekanntgabe soll bald folgen, hieß es in dem am Montag publizierten Artikel. Das Volumen des Wiederaufbaus im Irak wird auf $25-$100 Milliarden geschätzt. Zu den möglichen Auftragsgewinnern könnten unter anderem Halliburton Company, Fluor Corporation und die Washington Group International gehören, hieß es.
... neben Exxon Mobil und Chevronzu dürfte auch noch
Schlumberger zu den Kriegsgewinnlern zählen
- ebenfalls ein Anlagenbauer für Öl- und Gasförderung ...
Schlumberger zu den Kriegsgewinnlern zählen
- ebenfalls ein Anlagenbauer für Öl- und Gasförderung ...

Wir sollten alle im Sinne der der gesamten friedlichen Welt hoffen,
daß die verbrecherischen Amerikaner diesen Krieg gegen den tapferen Irak (!!) nicht gewinnen.
Ich weiß zwar nicht, ob das möglich ist.
Hoffe es jedoch sehr.
STRONG ANTIAMERIKANISCH
YO
daß die verbrecherischen Amerikaner diesen Krieg gegen den tapferen Irak (!!) nicht gewinnen.
Ich weiß zwar nicht, ob das möglich ist.
Hoffe es jedoch sehr.
STRONG ANTIAMERIKANISCH

YO
SPIEGEL ONLINE - 25. März 2003
Abschied von US-Aktien
Von Kai Lange
Während US-Truppen mühsam vorrücken, ziehen Anlageprofis Geld aus den USA ab. Auch ein rascher Sieg im Irak vertreibt die Sorgen nicht: Die Weltmacht kämpft mit einem milliardenschweren Defizit, und amerikanische Aktien sind vergleichsweise teuer. Die auf Pump lebende US-Wirtschaft steckt in der Klemme.
Fondsmanager sind ein vorsichtiges Volk. Nur nicht auffallen, lautet eine der wichtigsten Regeln in schwachen Börsenzeiten. Verluste in den Depots sind schmerzlich, aber nur halb so schlimm, solange auch der Vergleichsindex nach unten rauscht. Sich an die Benchmark zu halten, sichert in Zeiten schwankender Märkte den Job.
Im wichtigsten Vergleichsindex für weltweit anlegende Aktienfonds, dem MSCI World, sind US-Aktien mit rund 58 Prozent deutlich stärker gewichtet als europäische Papiere (28 Prozent). Bemerkenswert, dass ausgerechnet jetzt einige Anlageprofis den Ausbruch wagen und mehr Geld in Europa investieren: Nach Angaben des auf Fonds spezialisierten Analystenhauses Morningstar stecken weltweit anlegende Aktienfonds derzeit rund 43 Prozent ihres Geldes in europäische Aktien. Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten - der alte Kontinent holt auf.
US-Image ist angekratzt
"Wir haben Europa deutlich übergewichtet", sagt Thomas Meier, der mit dem UniGlobal einen rund drei Milliarden Euro schweren Fonds der Gesellschaft Union Investment betreut. Das liege nicht nur daran, dass die europäischen Aktienmärkte stärker als die Wall Street gefallen sind und größeres Erholungspotenzial bieten. "Viele Risiken, die auf den Finanzmärkten lasten, haben ihren Ursprung in den USA", sagt Meier.
Dazu zählt der Fondsmanager zum Beispiel die teuren Aktienoptionspläne für Topmanager sowie die Nachwehen der Bilanzskandale, die das Vertrauen der Anleger erschüttert haben. Im Vergleich zu asiatischen und europäischen Papieren seien US-Aktien noch immer hoch bewertet. Das Image der USA als weltweit bester Anlageplatz ist jedoch angekratzt.
Kapital im großen Stil aufgesogen
Dies trifft die US-Wirtschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn sowohl das Haushaltsdefizit als auch das Defizit in der Leistungsbilanz steigen rasant. "In den vergangenen Jahren haben die USA wie ein Staubsauger ausländisches Kapital aufgesogen", sagt Meier. Solange ein Haushalt Überschüsse ausweise und Investoren mit ordentlichen Renditen befriedigt werden, gehe diese Strategie auch auf.
Doch innerhalb von zwei Jahren hat US-Präsident George W. Bush einen grundsoliden Haushalt tief in die roten Zahlen getrieben. Die Kosten für den Irak-Feldzug sowie die massiven Steuersenkungen werden das Haushaltsdefizit nach jüngsten Schätzungen deutlich über die Marke von 300 Milliarden Dollar steigen lassen. Hinzu kommt ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 500 Milliarden Dollar: Die US-Bürger geben deutlich mehr Geld aus, als sie selbst erwirtschaften. "Da kommen einige Investoren ins Grübeln - sie sehen sich nach Anlage-Alternativen um", sagt Meier.
Abhängig wie nie zuvor
Sogar bei US-Ökonomen wachsen die Sorgen. "Die USA sind so abhängig von ausländischem Kapital wie niemals zuvor", warnt Steven Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley. Das hohe Defizit in der Leistungsbilanz werde nach seiner Einschätzung zu einer weiteren Abwertung des Dollar führen. Das Risiko: Sollten internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen, dürften Wall Street, US-Staatsanleihen und Dollar im Gleichschritt nach unten marschieren.
Anleger, die in den USA investiert haben, klammern sich an die Hoffnung, dass der private Konsum endlich wieder anzieht. Doch die amerikanischen Verbraucher zeigen sich durch Irak-Krise und Börsentalfahrt stark verunsichert, wie die jüngsten Daten zum Verbrauchervertrauen belegen. Betrachte man den privaten Sektor, nehmen die Konjunkturrisiken in den USA nach Einschätzung von Union Investment eher noch zu.
Auch Michael Fraikin, Fondsmanager des Global Dynamic bei Invesco, ist derzeit nicht in amerikanischen Einzeltiteln investiert. "Europa hat derzeit das größere Aufholpotenzial", bestätigt Fraikin. Die höhere Attraktivität europäischer Werte liege jedoch nicht an der wirtschaftlichen Dynamik Eurolands, sondern an dem tiefen Sturz der europäischen Werte. "Sie sind stärker gefallen als US-Aktien und dürften im Fall einer Erholung stärker steigen", stellt Fraikin fest.
"Trudelt Amerika, stürzen wir mit"
Anleger spekulieren bereits über eine Neuverteilung des internationalen, extrem beweglichen Kapitals. Besonders die Wachstumsregionen in Asien und auch Europa dürften schon bald aus dem Schatten der USA heraustreten und ihr weitere Anteile abjagen. Doch besonders für den alten Kontinent birgt diese Entwicklung auch Risiken: "Europäer haben keinen Grund, sich über Schwierigkeiten der USA zu freuen", sagt Philipp Vorndran, Leiter globale Strategie bei Credit Suisse Asset Management. "Kommt Amerika ins Trudeln, stürzen wir mit."
Mit knapp drei Prozent geschätztem Wachstum für dieses Jahr sei die US-Wirtschaft noch immer der wichtigste Treiber für die Weltwirtschaft - jeder Rückschlag in den USA werde auf das konjunkturlahme Europa doppelt durchschlagen. "Wir sollten das Defizit der USA lieben und auch künftig weiter finanzieren - denn ohne dieses Defizit wird der europäische Export nicht funktionieren", sagt Vorndran.
Arabische Investoren im Blick
Besonders Deutschland habe keinen Anlass, mit dem Finger auf die tiefroten Bilanzen der Bush-Regierung zu zeigen. "In den USA läuft der Konsum auf Pump, in Deutschland die Altersversorgung und die Sozialsysteme - das ist noch schwieriger zu korrigieren." Wegen fehlender Reformen seien deutsche Aktien derzeit zwar günstiger bewertet als die Emerging Markets in Asien - doch Vorndran sieht im Gegensatz zu vielen europäischen Kollegen keinen Grund, den Anteil seiner vergleichsweise teuren US-Aktien aufzugeben.
Kurzfristig hole Europa vielleicht etwas auf - doch mittelfristig werde die USA auf Grund der höheren Flexibilität stärker wachsen. Nur "deutliche politische Veränderungen" würden den Aktienstrategen von Credit Suisse zu einer Neugewichtung des Fondsvermögens bewegen. "Zum Beispiel, wenn die Europäische Zentralbank ihre Strategie ändert. Wenn der Ölpreis nicht mehr in Dollar, sondern in Euro abgerechnet wird. Oder wenn Großinvestoren aus dem arabischen Raum im großen Stil amerikanische Aktien verkaufen." Doch danach sehe es im Moment nicht aus.
Bushs Feldzug kostet 75 Milliarden - wenn alles glatt geht
Erstmals hat US-Präsident Bush deutlich gemacht, für wie hoch er die Kosten des Irak-Krieges hält: Allein für die Anfangsphase soll ihm der Kongress 75 Milliarden Dollar bewilligen. Dauert der Feldzug länger als ein paar Wochen, könnte die Kalkulation krachend zusammenbrechen.
Nach Regierungsangaben sind in der geforderten Summe auch Gelder für weitere Anti-Terror-Maßnahmen im eigenen Land und Hilfe für Alliierte wie Israel enthalten. Bush trug sein Anliegen am Montagabend einer Delegation führender Kongressabgeordneter im Weißen Haus vor. Bisher hatte der Präsident keine konkreten Aussagen über Kosten des Krieges gemacht und war daher vor allem von demokratischen Parlamentariern, aber auch von einigen Republikanern, harsch kritisiert worden.
Nun soll allein das Verteidigungsministerium zusätzliche 62,6 Milliarden Dollar erhalten. Diese Summe basiert auf der Erwartung eines sechs Monate währenden Engagements im Irak, einschließlich Maßnahmen zur Stabilisierung des Landes und Kosten für den Beginn des Truppenabzuges.
Wie lange die Kriegsphase nach den Prognosen der Regierung dauern wird, geht aus den ersten Budget-Dokumenten nicht genau hervor. Denn bisher verlangt die Regierung vom Kongress, dem Pentagon-Chef Donald Rumsfeld einen "Blanko-Scheck" auszustellen. Rumsfeld soll nach eigenem Ermessen entscheiden können, wie die Summe ausgegeben wird.
Laut "New York Times" basiert die Planung weitherhin auf der Prämisse, dass der eigentliche, "heiße" Krieg eher Wochen als Monate dauern wird. Sollte sich diese Annahme als falsch erweisen, müsste Bush den Kongress um zusätzliche Mittel bitten.
Angesichts der jüngsten Rückschläge für die Alliierten haben erste Kongressabgeordnete Zweifel am Budget-Szenario angemeldet. Ohnehin budgetiert die Regierung bisher nur die Kosten des Truppeneinsatzes bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres im September.
Da selbst bei einem schnellen Kriegsverlauf auch nach September noch Soldaten im Irak stationiert sein werden, um den Wiederaufbau zu überwachen, werden die realen Kriegskosten weit über die bisher genannten 75 Milliarden hinausgehen. Offenbar geht auch das Pentagon von höheren Kosten aus: Es soll laut "New York Times" statt der genannten 60 Milliarden 95 Milliarden Dollar gefordert haben, konnte sich bei den Budgetplanern des Weißen Hauses damit aber offenkundig nicht durchsetzen.
4,2 Milliarden Dollar sollen dem ersten Plan zufolge für die innere Sicherheit bereit gestellt werden, 7,8 Milliarden sind vorgesehen für die Unterstützung Israels, Afghanistans und anderer Verbündeter der USA.
Dem Weißen Haus zufolge will Bush seinen Plan noch am Dienstag bei einem Besuch im Verteidigungsministerium offiziell vorstellen. Die Kongressabgeordneten sollen dann bis zum 11. April eine entsprechende Gesetzesvorlage fertig stellen.
Da Bush in Meinungsumfragen derzeit sehr populär ist, wird damit gerechnet, dass seine Budgetplanung im wesentlichen akzeptiert wird. Vor allem die Demokraten könnten sich am "Blanko-Scheck" für Rumsfeld stören. Auch sorgt sich vor allem die Opposition, weil das Defizit des US-Haushaltes nach Regierungsprognosen 2003 wegen der Kriegskosten und der gleichzeitig geplanten, erheblichen Steuersenkungen auf 400 Milliarden Dollar anschwellen dürfte.
US-Markt verlor 1,1 Billionen Dollar
An den US-Börsen sind die Kriegskosten eingepreist, so die Universitäten Stanford und Harvard. Ein Beleg der Wissenschaftler ist die Wertentwicklung irischer Saddam-Optionsscheine. [/b]
Bereits vor Beginn des Irak-Krieges hat die Erwartung des Konflikts an den US-Aktienmärkten einer Studie zufolge Kapital in Höhe von 1,1 Billionen Dollar vernichtet.
Die Auswirkungen des Krieges auf die US-Börsen seien zu 95 Prozent bereits in den Kursen berücksichtigt, ergab die in der Nacht zum Samstag (MEZ) veröffentlichte Untersuchung der Universitäten Stanford und Harvard weiter.
In der abgelaufenen Handelswoche hatte das führende US-Börsenbarometer Dow Jones wegen zunehmender Hoffnungen auf ein rasches Kriegsende rund 8,4 Prozent zugelegt. Das war der höchste Wochengewinn des Standardwerte-Indexes seit Oktober 1982.
Der Krieg hatte am Donnerstagmorgen begonnen. Die Märkte hätten in der vergangenen Woche insbesondere auf die Dauer des Militärkonflikts spekuliert, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Eric Zitzewitz von der Universität Stanford. "Die Kosten des Kriegs sind bereits seit einer Weile eingepreist."
Handel mit "Saddam-Wertpapieren"
Um den Einfluss der Kriegsängste auf den Handel an der Wall Street einzuschätzen, hatten die Wissenschaftler die Wertentwicklung eines neuen Finanzinstruments beobachtet, an der sich die Wahrscheinlichkeit einer Absetzung des irakischen Präsidenten Saddam Hussein und damit eines Kriegsbeginns der USA gegen Irak ablesen ließ.
So bietet die irische Internet-Wettbörse Tradesports den Handel mit so genannten "Saddam Securities" an. Der Besitzer erhält zehn Dollar per Anteilsschein, wenn Saddam bis zu einem bestimmten Datum abgesetzt wird. Das "Saddam-Wertpapier" für März wurde am Freitag zuletzt mit 7,80 Dollar gehandelt.
Die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass der irakische Präsident bis Ende des Monats aus dem Amt gedrängt wird, kann demnach mit 78 Prozent bestimmt werden. Am Donnerstag betrug der Schlusskurs noch 6,50 Dollar und damit die geschätzte Wahrscheinlichkeit 65 Prozent. Anfang des Monats war das Papier mit lediglich 1,70 Dollar gehandelt worden.
Abschied von US-Aktien
Von Kai Lange
Während US-Truppen mühsam vorrücken, ziehen Anlageprofis Geld aus den USA ab. Auch ein rascher Sieg im Irak vertreibt die Sorgen nicht: Die Weltmacht kämpft mit einem milliardenschweren Defizit, und amerikanische Aktien sind vergleichsweise teuer. Die auf Pump lebende US-Wirtschaft steckt in der Klemme.
Fondsmanager sind ein vorsichtiges Volk. Nur nicht auffallen, lautet eine der wichtigsten Regeln in schwachen Börsenzeiten. Verluste in den Depots sind schmerzlich, aber nur halb so schlimm, solange auch der Vergleichsindex nach unten rauscht. Sich an die Benchmark zu halten, sichert in Zeiten schwankender Märkte den Job.
Im wichtigsten Vergleichsindex für weltweit anlegende Aktienfonds, dem MSCI World, sind US-Aktien mit rund 58 Prozent deutlich stärker gewichtet als europäische Papiere (28 Prozent). Bemerkenswert, dass ausgerechnet jetzt einige Anlageprofis den Ausbruch wagen und mehr Geld in Europa investieren: Nach Angaben des auf Fonds spezialisierten Analystenhauses Morningstar stecken weltweit anlegende Aktienfonds derzeit rund 43 Prozent ihres Geldes in europäische Aktien. Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten - der alte Kontinent holt auf.
US-Image ist angekratzt
"Wir haben Europa deutlich übergewichtet", sagt Thomas Meier, der mit dem UniGlobal einen rund drei Milliarden Euro schweren Fonds der Gesellschaft Union Investment betreut. Das liege nicht nur daran, dass die europäischen Aktienmärkte stärker als die Wall Street gefallen sind und größeres Erholungspotenzial bieten. "Viele Risiken, die auf den Finanzmärkten lasten, haben ihren Ursprung in den USA", sagt Meier.
Dazu zählt der Fondsmanager zum Beispiel die teuren Aktienoptionspläne für Topmanager sowie die Nachwehen der Bilanzskandale, die das Vertrauen der Anleger erschüttert haben. Im Vergleich zu asiatischen und europäischen Papieren seien US-Aktien noch immer hoch bewertet. Das Image der USA als weltweit bester Anlageplatz ist jedoch angekratzt.
Kapital im großen Stil aufgesogen
Dies trifft die US-Wirtschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn sowohl das Haushaltsdefizit als auch das Defizit in der Leistungsbilanz steigen rasant. "In den vergangenen Jahren haben die USA wie ein Staubsauger ausländisches Kapital aufgesogen", sagt Meier. Solange ein Haushalt Überschüsse ausweise und Investoren mit ordentlichen Renditen befriedigt werden, gehe diese Strategie auch auf.
Doch innerhalb von zwei Jahren hat US-Präsident George W. Bush einen grundsoliden Haushalt tief in die roten Zahlen getrieben. Die Kosten für den Irak-Feldzug sowie die massiven Steuersenkungen werden das Haushaltsdefizit nach jüngsten Schätzungen deutlich über die Marke von 300 Milliarden Dollar steigen lassen. Hinzu kommt ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 500 Milliarden Dollar: Die US-Bürger geben deutlich mehr Geld aus, als sie selbst erwirtschaften. "Da kommen einige Investoren ins Grübeln - sie sehen sich nach Anlage-Alternativen um", sagt Meier.
Abhängig wie nie zuvor
Sogar bei US-Ökonomen wachsen die Sorgen. "Die USA sind so abhängig von ausländischem Kapital wie niemals zuvor", warnt Steven Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley. Das hohe Defizit in der Leistungsbilanz werde nach seiner Einschätzung zu einer weiteren Abwertung des Dollar führen. Das Risiko: Sollten internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen, dürften Wall Street, US-Staatsanleihen und Dollar im Gleichschritt nach unten marschieren.
Anleger, die in den USA investiert haben, klammern sich an die Hoffnung, dass der private Konsum endlich wieder anzieht. Doch die amerikanischen Verbraucher zeigen sich durch Irak-Krise und Börsentalfahrt stark verunsichert, wie die jüngsten Daten zum Verbrauchervertrauen belegen. Betrachte man den privaten Sektor, nehmen die Konjunkturrisiken in den USA nach Einschätzung von Union Investment eher noch zu.
Auch Michael Fraikin, Fondsmanager des Global Dynamic bei Invesco, ist derzeit nicht in amerikanischen Einzeltiteln investiert. "Europa hat derzeit das größere Aufholpotenzial", bestätigt Fraikin. Die höhere Attraktivität europäischer Werte liege jedoch nicht an der wirtschaftlichen Dynamik Eurolands, sondern an dem tiefen Sturz der europäischen Werte. "Sie sind stärker gefallen als US-Aktien und dürften im Fall einer Erholung stärker steigen", stellt Fraikin fest.
"Trudelt Amerika, stürzen wir mit"
Anleger spekulieren bereits über eine Neuverteilung des internationalen, extrem beweglichen Kapitals. Besonders die Wachstumsregionen in Asien und auch Europa dürften schon bald aus dem Schatten der USA heraustreten und ihr weitere Anteile abjagen. Doch besonders für den alten Kontinent birgt diese Entwicklung auch Risiken: "Europäer haben keinen Grund, sich über Schwierigkeiten der USA zu freuen", sagt Philipp Vorndran, Leiter globale Strategie bei Credit Suisse Asset Management. "Kommt Amerika ins Trudeln, stürzen wir mit."
Mit knapp drei Prozent geschätztem Wachstum für dieses Jahr sei die US-Wirtschaft noch immer der wichtigste Treiber für die Weltwirtschaft - jeder Rückschlag in den USA werde auf das konjunkturlahme Europa doppelt durchschlagen. "Wir sollten das Defizit der USA lieben und auch künftig weiter finanzieren - denn ohne dieses Defizit wird der europäische Export nicht funktionieren", sagt Vorndran.
Arabische Investoren im Blick
Besonders Deutschland habe keinen Anlass, mit dem Finger auf die tiefroten Bilanzen der Bush-Regierung zu zeigen. "In den USA läuft der Konsum auf Pump, in Deutschland die Altersversorgung und die Sozialsysteme - das ist noch schwieriger zu korrigieren." Wegen fehlender Reformen seien deutsche Aktien derzeit zwar günstiger bewertet als die Emerging Markets in Asien - doch Vorndran sieht im Gegensatz zu vielen europäischen Kollegen keinen Grund, den Anteil seiner vergleichsweise teuren US-Aktien aufzugeben.
Kurzfristig hole Europa vielleicht etwas auf - doch mittelfristig werde die USA auf Grund der höheren Flexibilität stärker wachsen. Nur "deutliche politische Veränderungen" würden den Aktienstrategen von Credit Suisse zu einer Neugewichtung des Fondsvermögens bewegen. "Zum Beispiel, wenn die Europäische Zentralbank ihre Strategie ändert. Wenn der Ölpreis nicht mehr in Dollar, sondern in Euro abgerechnet wird. Oder wenn Großinvestoren aus dem arabischen Raum im großen Stil amerikanische Aktien verkaufen." Doch danach sehe es im Moment nicht aus.
Bushs Feldzug kostet 75 Milliarden - wenn alles glatt geht
Erstmals hat US-Präsident Bush deutlich gemacht, für wie hoch er die Kosten des Irak-Krieges hält: Allein für die Anfangsphase soll ihm der Kongress 75 Milliarden Dollar bewilligen. Dauert der Feldzug länger als ein paar Wochen, könnte die Kalkulation krachend zusammenbrechen.
Nach Regierungsangaben sind in der geforderten Summe auch Gelder für weitere Anti-Terror-Maßnahmen im eigenen Land und Hilfe für Alliierte wie Israel enthalten. Bush trug sein Anliegen am Montagabend einer Delegation führender Kongressabgeordneter im Weißen Haus vor. Bisher hatte der Präsident keine konkreten Aussagen über Kosten des Krieges gemacht und war daher vor allem von demokratischen Parlamentariern, aber auch von einigen Republikanern, harsch kritisiert worden.
Nun soll allein das Verteidigungsministerium zusätzliche 62,6 Milliarden Dollar erhalten. Diese Summe basiert auf der Erwartung eines sechs Monate währenden Engagements im Irak, einschließlich Maßnahmen zur Stabilisierung des Landes und Kosten für den Beginn des Truppenabzuges.
Wie lange die Kriegsphase nach den Prognosen der Regierung dauern wird, geht aus den ersten Budget-Dokumenten nicht genau hervor. Denn bisher verlangt die Regierung vom Kongress, dem Pentagon-Chef Donald Rumsfeld einen "Blanko-Scheck" auszustellen. Rumsfeld soll nach eigenem Ermessen entscheiden können, wie die Summe ausgegeben wird.
Laut "New York Times" basiert die Planung weitherhin auf der Prämisse, dass der eigentliche, "heiße" Krieg eher Wochen als Monate dauern wird. Sollte sich diese Annahme als falsch erweisen, müsste Bush den Kongress um zusätzliche Mittel bitten.
Angesichts der jüngsten Rückschläge für die Alliierten haben erste Kongressabgeordnete Zweifel am Budget-Szenario angemeldet. Ohnehin budgetiert die Regierung bisher nur die Kosten des Truppeneinsatzes bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres im September.
Da selbst bei einem schnellen Kriegsverlauf auch nach September noch Soldaten im Irak stationiert sein werden, um den Wiederaufbau zu überwachen, werden die realen Kriegskosten weit über die bisher genannten 75 Milliarden hinausgehen. Offenbar geht auch das Pentagon von höheren Kosten aus: Es soll laut "New York Times" statt der genannten 60 Milliarden 95 Milliarden Dollar gefordert haben, konnte sich bei den Budgetplanern des Weißen Hauses damit aber offenkundig nicht durchsetzen.
4,2 Milliarden Dollar sollen dem ersten Plan zufolge für die innere Sicherheit bereit gestellt werden, 7,8 Milliarden sind vorgesehen für die Unterstützung Israels, Afghanistans und anderer Verbündeter der USA.
Dem Weißen Haus zufolge will Bush seinen Plan noch am Dienstag bei einem Besuch im Verteidigungsministerium offiziell vorstellen. Die Kongressabgeordneten sollen dann bis zum 11. April eine entsprechende Gesetzesvorlage fertig stellen.
Da Bush in Meinungsumfragen derzeit sehr populär ist, wird damit gerechnet, dass seine Budgetplanung im wesentlichen akzeptiert wird. Vor allem die Demokraten könnten sich am "Blanko-Scheck" für Rumsfeld stören. Auch sorgt sich vor allem die Opposition, weil das Defizit des US-Haushaltes nach Regierungsprognosen 2003 wegen der Kriegskosten und der gleichzeitig geplanten, erheblichen Steuersenkungen auf 400 Milliarden Dollar anschwellen dürfte.
US-Markt verlor 1,1 Billionen Dollar
An den US-Börsen sind die Kriegskosten eingepreist, so die Universitäten Stanford und Harvard. Ein Beleg der Wissenschaftler ist die Wertentwicklung irischer Saddam-Optionsscheine. [/b]
Bereits vor Beginn des Irak-Krieges hat die Erwartung des Konflikts an den US-Aktienmärkten einer Studie zufolge Kapital in Höhe von 1,1 Billionen Dollar vernichtet.
Die Auswirkungen des Krieges auf die US-Börsen seien zu 95 Prozent bereits in den Kursen berücksichtigt, ergab die in der Nacht zum Samstag (MEZ) veröffentlichte Untersuchung der Universitäten Stanford und Harvard weiter.
In der abgelaufenen Handelswoche hatte das führende US-Börsenbarometer Dow Jones wegen zunehmender Hoffnungen auf ein rasches Kriegsende rund 8,4 Prozent zugelegt. Das war der höchste Wochengewinn des Standardwerte-Indexes seit Oktober 1982.
Der Krieg hatte am Donnerstagmorgen begonnen. Die Märkte hätten in der vergangenen Woche insbesondere auf die Dauer des Militärkonflikts spekuliert, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Eric Zitzewitz von der Universität Stanford. "Die Kosten des Kriegs sind bereits seit einer Weile eingepreist."
Handel mit "Saddam-Wertpapieren"
Um den Einfluss der Kriegsängste auf den Handel an der Wall Street einzuschätzen, hatten die Wissenschaftler die Wertentwicklung eines neuen Finanzinstruments beobachtet, an der sich die Wahrscheinlichkeit einer Absetzung des irakischen Präsidenten Saddam Hussein und damit eines Kriegsbeginns der USA gegen Irak ablesen ließ.
So bietet die irische Internet-Wettbörse Tradesports den Handel mit so genannten "Saddam Securities" an. Der Besitzer erhält zehn Dollar per Anteilsschein, wenn Saddam bis zu einem bestimmten Datum abgesetzt wird. Das "Saddam-Wertpapier" für März wurde am Freitag zuletzt mit 7,80 Dollar gehandelt.
Die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass der irakische Präsident bis Ende des Monats aus dem Amt gedrängt wird, kann demnach mit 78 Prozent bestimmt werden. Am Donnerstag betrug der Schlusskurs noch 6,50 Dollar und damit die geschätzte Wahrscheinlichkeit 65 Prozent. Anfang des Monats war das Papier mit lediglich 1,70 Dollar gehandelt worden.
.
US-Börsen grün trotz Krieg und Skandalen
(...)
Chef-Volkswirt Barton Biggs hält eine Rallye um 40 bis 50 % an den US-Märkten für plausibel, „wenn der Irakkrieg erfolgreich verläuft“. Sein Kollege Stephen Roach, der Globalstrategen von Morgan Stanley, sieht indes die Gefahr, dass der Krieg in eine weltweite Rezession mündet, die Konjunktur, Unternehmen und schließlich auch die Aktien mitreißen würde.
(...)
Markus Koch – 25.03.2003
http://www.abn-zertifikate.de/news/news_detail.asp
US-Börsen grün trotz Krieg und Skandalen
(...)
Chef-Volkswirt Barton Biggs hält eine Rallye um 40 bis 50 % an den US-Märkten für plausibel, „wenn der Irakkrieg erfolgreich verläuft“. Sein Kollege Stephen Roach, der Globalstrategen von Morgan Stanley, sieht indes die Gefahr, dass der Krieg in eine weltweite Rezession mündet, die Konjunktur, Unternehmen und schließlich auch die Aktien mitreißen würde.
(...)
Markus Koch – 25.03.2003
http://www.abn-zertifikate.de/news/news_detail.asp
.
Nabil Khayat - Fondex / WO 26.03.2003
WELCOME BACK TO THE POINT OF NO RETURN!
Die derzeitige Marktverhältnisse stellen die höchsten Anforderungen an alle Marktteilnehmer. Es gibt kaum eine These, die kein Gehör findet. Von Weltuntergangsszenarien bis zum Schwur auf die unmittelbar anstehende Boomphase wird praktisch alles geboten. Im Sonderangebot, und ganz besonders beliebt ist der Vergleich mit dem Golfkrieg 1991. Seinerzeit fiel der Ölpreis dramatisch und führte zu einem konjunkturellen Aufschwung, der nicht zuletzt von einem Bullenmarkt an den internationalen Börsen begleitet worden ist.
Was war damals anders?
Nun, ich denke, dass damals eine Menge Dinge anders waren als heute. Der markanteste Punkt liegt meines Erachtens in der Bewertung. Anfang 1991, sprich als der Golfkrieg begann, hatte der S&P500 (SPX) ein KGV von 15 und war damit fair bewertet. Heute hat der SPX ein KGV von 32 und das ist eine komplett andere Ausgangslage. Dieses KGV gehört historisch gesehen zu den 3 % am oberen Ende der KGV Statistik. Im Juli 2002 formulierte ich die These, dass die Unternehmensgewinne depressiv seien und das KGV somit potentiell deflationär. Auf dieser Grundlage räumte ich dem Markt die Chance ein, seinen Bärenmarkt im zweiten Halbjahr 2002 zu beenden.
Leider wurde ich nicht bestätigt...
...und als ich Oktober 2002 den Telefonkonferenzen großer US-Unternehmen beiwohnte, änderten sich meine Ansichten wieder. Diverse CEOs verkündeten im Brustton der Überzeugung, dass die Nettomargen ausgebaut werden konnten, da diverse Kosteneinsparungen und Rationalisierungsmaßnahmen gegriffen haben sollen. Im November änderte ich meine Ansicht wieder und ich plädierte auf eine Fortsetzung des Bärenmarktes. Warum? Eigentlich aus dem einfachsten Grund der Welt und zwar, weil ich mich nicht im Stande sah, eine Wette abzuschließen, die seit Menschengedenken noch NIE gewonnen worden ist. Kein Bärenmarkt hat jemals mit einem KGV über 15 geendet, nicht einer!
Sicherlich hört man bullische Thesen...
...und die hören sich so an. Bla..bla...bla..bla, bis auf die Bewertung des Marktes, was in unseren Augen der einzige Riss in der Fassade ist. Nein, ich möchte den Bullen keine Hörner aufsetzen, die haben sie schließlich von Natur aus. Ich möchte nur klarstellen, dass JEDER, der am aktuellen Punkt vom Beginn eines Bullenmarktes spricht, ein Wette abschließt, die noch NIE gewonnen worden ist. Es wäre interessant zu wissen, ob man eine gute Quote bei einem englischen Buchmacher bekommt, wenn man wettet, dass wir in einem Jahr höhere Kurse haben werden, als heute. In Anbetracht der Tatsache, dass man auf einen Ausgang wettet, den es noch NIE gegeben hat, müsste man eine Quote im Bereich von 5:1 bekommen, und das ist besser als die meisten Börsengeschäfte.
Nabil Khayat - Fondex / WO 26.03.2003
WELCOME BACK TO THE POINT OF NO RETURN!
Die derzeitige Marktverhältnisse stellen die höchsten Anforderungen an alle Marktteilnehmer. Es gibt kaum eine These, die kein Gehör findet. Von Weltuntergangsszenarien bis zum Schwur auf die unmittelbar anstehende Boomphase wird praktisch alles geboten. Im Sonderangebot, und ganz besonders beliebt ist der Vergleich mit dem Golfkrieg 1991. Seinerzeit fiel der Ölpreis dramatisch und führte zu einem konjunkturellen Aufschwung, der nicht zuletzt von einem Bullenmarkt an den internationalen Börsen begleitet worden ist.
Was war damals anders?
Nun, ich denke, dass damals eine Menge Dinge anders waren als heute. Der markanteste Punkt liegt meines Erachtens in der Bewertung. Anfang 1991, sprich als der Golfkrieg begann, hatte der S&P500 (SPX) ein KGV von 15 und war damit fair bewertet. Heute hat der SPX ein KGV von 32 und das ist eine komplett andere Ausgangslage. Dieses KGV gehört historisch gesehen zu den 3 % am oberen Ende der KGV Statistik. Im Juli 2002 formulierte ich die These, dass die Unternehmensgewinne depressiv seien und das KGV somit potentiell deflationär. Auf dieser Grundlage räumte ich dem Markt die Chance ein, seinen Bärenmarkt im zweiten Halbjahr 2002 zu beenden.
Leider wurde ich nicht bestätigt...
...und als ich Oktober 2002 den Telefonkonferenzen großer US-Unternehmen beiwohnte, änderten sich meine Ansichten wieder. Diverse CEOs verkündeten im Brustton der Überzeugung, dass die Nettomargen ausgebaut werden konnten, da diverse Kosteneinsparungen und Rationalisierungsmaßnahmen gegriffen haben sollen. Im November änderte ich meine Ansicht wieder und ich plädierte auf eine Fortsetzung des Bärenmarktes. Warum? Eigentlich aus dem einfachsten Grund der Welt und zwar, weil ich mich nicht im Stande sah, eine Wette abzuschließen, die seit Menschengedenken noch NIE gewonnen worden ist. Kein Bärenmarkt hat jemals mit einem KGV über 15 geendet, nicht einer!
Sicherlich hört man bullische Thesen...
...und die hören sich so an. Bla..bla...bla..bla, bis auf die Bewertung des Marktes, was in unseren Augen der einzige Riss in der Fassade ist. Nein, ich möchte den Bullen keine Hörner aufsetzen, die haben sie schließlich von Natur aus. Ich möchte nur klarstellen, dass JEDER, der am aktuellen Punkt vom Beginn eines Bullenmarktes spricht, ein Wette abschließt, die noch NIE gewonnen worden ist. Es wäre interessant zu wissen, ob man eine gute Quote bei einem englischen Buchmacher bekommt, wenn man wettet, dass wir in einem Jahr höhere Kurse haben werden, als heute. In Anbetracht der Tatsache, dass man auf einen Ausgang wettet, den es noch NIE gegeben hat, müsste man eine Quote im Bereich von 5:1 bekommen, und das ist besser als die meisten Börsengeschäfte.
.
Imperium oeconomicum
Die Vereinigten Staaten sind die wirtschaftliche Supermacht. Der Irak-Krieg könnte das ändern. Denn Amerika braucht den Rest der Welt – die Zuwanderer, die Finanziers und die Käufer
Von Thomas Fischermann
In Mount Pleasant, Texas, gibt es noch hausgemachten Apfelkuchen. Große Paraden zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Und einen unerschütterlichen Glauben an das Vaterland. Die Fernseher in dem 12000-Seelen-Städtchen zwei Autostunden östlich von Dallas laufen jetzt Tag und Nacht. Frische Nachrichten vom Krieg kommen rund um die Uhr.
Mount Pleasant ist das, was die Amerikaner Middle America nennen – ein gottesfürchtiger und patriotischer Flecken in der Provinz. Wie viele ärmere Gemeinden im ländlichen Texas stellt die Kleinstadt zahlreiche junge Männer als Soldaten. In Mount Pleasant hat fast jeder einmal gekämpft, ob im Zweiten Weltkrieg, in Korea oder am Golf. „Wir haben jeden beschützt, jeder Nation geholfen“, sagt Gene Hinson, der örtliche Apotheker. Und fügt hinzu, was Middle America in diesen Tagen so denkt: „Jetzt kehren uns viele Länder den Rücken zu. Da kann man nur hoffen, dass ihnen nie mehr ein Steuergroschen Entwicklungshilfe gezahlt wird.“
Die Stimmung ist eindeutig: Amerika will der Welt zeigen, wo es langgeht – ob mit militärischem oder wirtschaftlichem Druck. Dass das wirkt, denkt auch der eine oder andere Intellektuelle des Landes. Eine ganze Menge Geschäftsleute und Diplomaten aus Frankreich, berichtete am Wochenende der New York Times-Kolumnist Thomas L. Friedman mit spürbarer Befriedigung, meinten nun, dass der französische Präsident und sein Außenminister in ihrer Ablehnung des Krieges im Irak „zu weit gegangen sind“ – ganz einfach deshalb, weil die Franzosen „stark vom Handel mit und den Investitionen aus den USA abhängen“.
Ein voreiliger Triumph? Der Waffengang am Golf ist gerade erst in seine heiße Phase gegangen, und am Wochenanfang gab es für die alliierten Truppen nicht nur gute Nachrichten. Dennoch: Die militärische Übermacht der Vereinigten Staaten gilt – den Amerikanern jedenfalls – als so klar, dass die Börsennotierungen schon vor dem ersten Schusswechsel in die Höhe schnellten. Dass die Aktienkurse auch wieder sanken, ist für Amerikas Patrioten dabei nur ein vorübergehendes Phänomen. Wie soll ein Krieg wohl ausgehen, in dem der Angreifer die Hälfte aller Weltrüstungsausgaben tätigt?
Die US-Volkswirtschaft jedenfalls wird die militärische Muskelschau am Golf kaum belasten. Die Vereinigten Staaten können sich Kriege leisten. Das aberwitzige Rüstungsbudget von knapp 400 Milliarden Dollar macht gerade mal dreieinhalb Prozent des amerikanischen Sozialproduktes aus, und selbst das Bombardement von Bagdad schlägt nach den jüngsten Schätzungen aus dem Weißen Haus mit „nur“ 70 bis 80 Milliarden Dollar zu Buche. Das ist wenig im Vergleich zur Wirtschaftskraft der USA.
Amerika ist ein wirtschaftlicher Koloss. Mit fünf Prozent der Weltbevölkerung erwirtschaften die Vereinigten Staaten fast ein Drittel des Weltsozialprodukts. Die Mehrheit der 100 größten Unternehmen der Erde hat ihren Hauptsitz in Amerika, die mächtigsten Investmentbanken der Welt sind an der Wall Street zu Hause. Keine andere Nation liefert mehr Filme, Fernsehen und Musik, nirgendwo sonst wird Jahr für Jahr eine größere Zahl neuer Patente angemeldet.
Der Dollar ist nach wie vor die internationale Leitwährung, Amerikaner kontrollieren die Schaltzentralen des Internet und bilden die Topmanager der Welt aus. Betrachtet man die Statistiken, kann sich unter den großen Industrienationen kein anderes Land mit den Vereinigten Staaten messen. Ob beim Wachstum, bei der Produktivitätsentwicklung oder der Mobilisierung von Arbeitskräften – überall sind Amerikas Zahlen die besten.
Auf den ersten Blick jedenfalls. Zwischen all den Kriegsberichten geht fast unter, dass sich das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr um 28 Prozent vergrößert hat – auf rund eine halbe Billion Dollar. Wieder einmal führten die Amerikaner mehr Waren und Dienstleistungen ein, als sie exportierten, und wieder einmal taten sie das auf Pump, im Gegenzug für Anleihen, Investitionen und Aktien. Die Welt leiht Amerika Geld. Das ist einerseits ein Vertrauensbeweis, andererseits aber auch eine Zeitbombe, falls es sich die Welt irgendwann anders überlegt. So passierte es in den achtziger Jahren während der Ära Reagan, als der Dollarkurs stark schwankte und 1987 die Börsen krachten. Weltweite Finanztumulte waren die Folge. Heute haben „die internationalen Anleger weniger Kapital zur Verfügung, und sie sind ohnehin schon kräftig in amerikanische Werte investiert“, warnt Catherine Mann vom Institute for International Economics (IIE). „Die Finanzierungsprobleme für das explodierende Defizit wachsen rapide“, mahnt die Investmentbank Goldman Sachs.
Um sein Wachstum weiter zu finanzieren, ist Amerika auf Gedeih und Verderb auf den Goodwill der Anleger aus dem Ausland angewiesen. Der aber hängt nicht allein von schierer wirtschaftlicher Größe oder militärischer Macht ab. Dass die Vereinigten Staaten die ökonomische und politische Nummer eins der Welt sind, ist unbestritten. Dass sie es bleiben, nicht. Noch Anfang der neunziger Jahre war vom „decline“ Amerikas die Rede, von der Furcht vor einem relativen Abstieg. In den Augen der Kritiker fiel das Imperium schon damals zurück.
Gewarnt wurde vor etlichen Rissen im amerikanischen System. Der Princeton-Ökonom Paul Krugman etwa prangerte in seinem Bestseller The Age of Diminished Expectations die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich im Lande an und prognostizierte, dass immer größere Teile der Bevölkerung keine Chance haben würden, sich ihren „amerikanischen Traum“ zu erfüllen, sondern in einem Kreislauf aus Armut und Niedriglohnjobs stecken blieben – und tatsächlich wächst bis heute der Abstand zwischen wohlhabenden und verarmten Amerikanern. Kulturkritiker wie Robert Putnam (Bowling Alone) sahen die ganze amerikanische Gesellschaft auseinander driften. Andere Experten warnten angesichts eines in Teilen maroden Bildungssystems vor den Gefahren für die amerikanische Wissensgesellschaft. Heute haben 40 Millionen US-Bürger keine Krankenversicherung, verdienen die Chefs im Durchschnitt 400-mal mehr als ihre Angestellten und Arbeiter.
Dennoch sind die Debatten weitgehend verstummt. Zunächst machte ihnen der unerwartete Börsen- und Wirtschaftsboom der späten neunziger Jahre den Garaus, dann der aufwallende Patriotismus nach den Terroranschlägen des 11. September 2001. Und jetzt?
Zwar spiegelte schon die euphorische Reaktion der Börse zum Kriegsbeginn wider, was in diesen Tagen viele Ökonomen und Wall-Street-Auguren glauben: dass Amerika stark bleibt. Dass es „geopolitische Unsicherheiten“ waren, die zuletzt den Aufschwung verzögert haben, wie Notenbankchef Alan Greenspan sagte. Dass also ein schneller Sieg im Krieg den Markt und das Wachstum endlich wieder aus ihren Fesseln befreien wird. „Die USA stehen vor einem Wirtschaftsboom“, erwartet der amerikanische Ökonom Fred Bergsten. Es sei „gut möglich, dass die US-Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres um vier bis fünf Prozent wächst“.
Andere sind da weniger überzeugt: Er sei immer noch „entschieden zurückhaltend“ in Sachen Wirtschaftswachstum, sagt Morgan-Stanley-Chefökonom Stephen Roach. Das Economic Policy Institute in Washington prognostiziert auf absehbare Zeit bestenfalls jobless growth, also mäßiges Wachstum ohne zusätzliche Arbeitsplätze. Die Meldungen von Massenentlassungen und Betriebsschließungen reißen nicht ab, eine Reihe von Fluggesellschaften könnten in den kommenden Monaten Konkurs anmelden, die verschuldeten und um ihren Arbeitsplatz bangenden amerikanischen Konsumenten halten sich bei ihren Einkäufen neuerdings zurück. Ob es also in kurzer Frist zu einer Erholung der für die Welt so wichtigen US-Wirtschafskraft kommt, ist keine ausgemachte Sache.
Ohne einen nachhaltigen Aufschwung aber werden auch die strukturellen Probleme der USA wieder stärker zutage treten. Schon jetzt machen sich kritische Ökonomen Sorgen, dass etwa all jene ehemaligen Sozialhilfe-Empfänger, die während des Booms der Neunziger einen Job fanden, nun wieder in die Armut zurückfallen. Geld für neue Sozialprogramme allerdings fehlt – was auch daran liegt, dass der wichtigste Mann im Staat über seine Prioritäten längst entschieden hat. George W. Bush will in der kommenden zehn Jahre insgesamt 1,8 Billionen Dollar neuer Schulden aufnehmen, die ins Militär und in radikale Steuersenkungsprogramme fließen sollen. Zurückzahlen kann Bush diese Schulden nur, wenn Amerika bald wieder Wachstum nach dem Vorbild der neunziger Jahre liefert. Eine gewagte Wette.
Finanzieren muss er sie vorher. Dabei könnte der militärische Konflikt am Golf sogar hilfreich sein – sobald Siegesbilder aus Bagdad über die Bildschirme der Welt flackern. „Amerika bekommt all dieses ausländische Kapital, weil die Leute denken: Die USA sind so mächtig, sie sind geopolitisch sicher“, sagt Edward D. Luttwak vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Doch lässt sich die militärische Übermacht wirklich so einfach in die Welt der Wirtschaft übersetzen?
„Die wirtschaftliche Sphäre funktioniert anders als die militärische und geopolitische“, meint Joseph Nye, Dean der Kennedy School of Government in Harvard und Autor des Buches The Paradox of American Power. In der Wirtschaft, so Nye, „bestehen viele Abhängigkeiten, es gibt eher ein Kräftegleichgewicht zwischen den Blöcken“. Im Klartext: Amerika ist auf den Rest der Welt angewiesen – auch wenn es das nicht so gern wahrhaben will.
Große Teile der amerikanischen Exportwirtschaft – die immerhin zehn Prozent zum Bruttosozialprodukt des Landes beiträgt und Millionen Arbeitsplätze sichert – brauchen freundlich gesinnte Konsumenten in aller Welt. Globale Marken wie Coca-Cola und Nike könnten leiden, wenn Verbraucher in Asien, Lateinamerika oder Europa die Vereinigten Staaten für ein aufdringliches und selbstherrliches Imperium hielten. Sie sind es schließlich, die amerikanischen Lebensstil und amerikanische Coolness in die Wohnzimmer und Küchen der Welt transportieren – genauso wie die Musik- und Filmstudios Amerikas.
Zu den Geheimnissen des amerikanische Wirtschaftserfolges gehört bislang auch die anhaltende Attraktivität als Einwanderungsland. Junge Familien mit frischer Arbeitskraft und potenziell vielen Kindern, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum in die USA kommen, sorgen für eine „jüngere, gemischtere und im Schnitt dynamischere“ Gesellschaft, wie der britische Economist einmal urteilte. Hält dieser Trend an, wird diese Gesellschaft Mitte des Jahrhunderts 15 Jahre jünger sein als die Bevölkerung Europas – das dann zu Recht old Europe hieße und dessen Volkswirtschaften unter der Rentenlast ächzen werden.
Nur: Kommen die Einwanderer auch dann noch, wenn die USA ihr gutes Image in aller Welt verlieren und sich zunehmend abschotten?
Schon jetzt werden Immigranten aus islamischen Nationen bespitzelt und teilweise aus dem Land vertrieben. Sogar ausländische Studenten haben es immer schwerer. „Ich gehe davon aus, dass der Antragsweg künftig länger wird, vielleicht dreimal so lang“, fürchtet Allan Goodman, Präsident des Institute of International Education, das die begehrten Fulbright-Stipendien vergibt.
Und noch in einem weiteren Bereich könnte der amerikanischen Wirtschaft Übles drohen, wenn im Krieg und danach allzu viel Goodwill verloren ginge: Auch amerikanische Unternehmen sind in aller Welt auf die Kooperation mit den Behörden angewiesen. Konzerne, die fusionieren wollen, müssen sich dafür die Genehmigung europäischer Behörden holen; der Softwareproduzent Microsoft muss seine Wettbewerbspraktiken auch vor der EU-Kommission und Gerichten in aller Welt rechtfertigen. Amerikanische Fluggesellschaften brauchen Landeerlaubnis, amerikanische Film- und Fernsehmacher verdienen ohne internationale Copyright-Gesetze weniger Geld, und ohne Zulassungen in fernen Ländern bleiben amerikanische Landwirte auf ihren gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln sitzen. „Die Welt in Freunde und Feinde aufzuteilen würde ökonomisch teuer ausfallen“, glaubt Jeff Madrick, ein New Yorker Ökonom. Hier – eher als bei explodierenden Kriegskosten oder in einer unsicheren Versorgung mit Öl – liegen langfristig die größten Gefahren für die Vereinigten Staaten.
Das ist auch in den USA eigentlich keine neue Erkenntnis. Viele Regeln der internationalen Wirtschaft sind in den vergangenen Jahrzehnten unter starkem US-Einfluss entstanden. Die Welthandelsorganisation (WTO) zum Beispiel ist letztlich eine Erfindung der Amerikaner – und die kommende WTO-Verhandlungsrunde für eine weitere Liberalisierung des weltweiten Güter- und Dienstleistungsverkehrs könnte zu einem großen Test werden. Der transatlantische Streit um Agrarsubventionen etwa sei schon jetzt „eine tickende Zeitbombe“, meint Jagdish Bhagwati, Handelsökonom an der Columbia University – und ist ein möglicherweise auf Dauer gefährlicherer Konfliktpunkt als die anhaltende Auseinandersetzung um den Irak und den Krieg.
Die Preisfrage dabei ist, wie weit die Regierung des Kriegspräsidenten Bush ihre amerikazentrische Sicht der Dinge auch in der wirtschaftlichen Sphäre durchsetzen will. „Jeder weiß: Es gibt laute Stimmen in den USA, die internationale Institutionen ablehnen, und viele davon sind Bush sehr nahe“, glaubt Lester Thurow vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Längst schon gehört es zur offiziellen Strategie des US-Handelsrepräsentanten Robert Zoellick, außerhalb der WTO bilaterale Handelsverträge ganz nach dem Gusto der Vereinigten Staaten abzuschließen. Dass manche Entwicklungsländer mit Drohungen über den Entzug von Hilfe auf die eigene Seite gezogen werden sollen, war nicht nur Teil des diplomatischen Schauspiels vor Kriegsbeginn im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es gehört auch zum amerikanischen Geschäftsgebaren im Ringen um handelspolitische Verbündete.
Ob diese Strategie auch nach dem Ende des Irak-Kriegs fortgesetzt – und vielleicht noch verstärkt – wird, hängt ganz davon ab, wie dieser Krieg zu Ende geht und wann.
Triumphiert Amerika schnell und eindeutig, könnte das „eine generelle Aura schaffen, nach dem Motto ,Die USA sind stark genug, um es allein zu schaffen‘“, sagt Nye. Dauert es länger, werden die Verluste größer, schwächelt die Wirtschaft weiter und bleibt der Aufschwung aus, werden auch in Amerika jene Stimmen lauter, die Krieg nicht nur für das falsche Mittel der Politik gehalten haben. Es werden sich auch jene melden, die ihre Finger auf die Wunden der amerikanischen Gesellschaft und der amerikanischen Wirtschaft legen.
Gut möglich, dass man dann auch in Mount Pleasant nicht mehr nur über die Krieger redet, die der Ort hervorgebracht hat. Sondern auch über seine Arbeitslosen und seine Armen.
Imperium oeconomicum
Die Vereinigten Staaten sind die wirtschaftliche Supermacht. Der Irak-Krieg könnte das ändern. Denn Amerika braucht den Rest der Welt – die Zuwanderer, die Finanziers und die Käufer
Von Thomas Fischermann
In Mount Pleasant, Texas, gibt es noch hausgemachten Apfelkuchen. Große Paraden zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Und einen unerschütterlichen Glauben an das Vaterland. Die Fernseher in dem 12000-Seelen-Städtchen zwei Autostunden östlich von Dallas laufen jetzt Tag und Nacht. Frische Nachrichten vom Krieg kommen rund um die Uhr.
Mount Pleasant ist das, was die Amerikaner Middle America nennen – ein gottesfürchtiger und patriotischer Flecken in der Provinz. Wie viele ärmere Gemeinden im ländlichen Texas stellt die Kleinstadt zahlreiche junge Männer als Soldaten. In Mount Pleasant hat fast jeder einmal gekämpft, ob im Zweiten Weltkrieg, in Korea oder am Golf. „Wir haben jeden beschützt, jeder Nation geholfen“, sagt Gene Hinson, der örtliche Apotheker. Und fügt hinzu, was Middle America in diesen Tagen so denkt: „Jetzt kehren uns viele Länder den Rücken zu. Da kann man nur hoffen, dass ihnen nie mehr ein Steuergroschen Entwicklungshilfe gezahlt wird.“
Die Stimmung ist eindeutig: Amerika will der Welt zeigen, wo es langgeht – ob mit militärischem oder wirtschaftlichem Druck. Dass das wirkt, denkt auch der eine oder andere Intellektuelle des Landes. Eine ganze Menge Geschäftsleute und Diplomaten aus Frankreich, berichtete am Wochenende der New York Times-Kolumnist Thomas L. Friedman mit spürbarer Befriedigung, meinten nun, dass der französische Präsident und sein Außenminister in ihrer Ablehnung des Krieges im Irak „zu weit gegangen sind“ – ganz einfach deshalb, weil die Franzosen „stark vom Handel mit und den Investitionen aus den USA abhängen“.
Ein voreiliger Triumph? Der Waffengang am Golf ist gerade erst in seine heiße Phase gegangen, und am Wochenanfang gab es für die alliierten Truppen nicht nur gute Nachrichten. Dennoch: Die militärische Übermacht der Vereinigten Staaten gilt – den Amerikanern jedenfalls – als so klar, dass die Börsennotierungen schon vor dem ersten Schusswechsel in die Höhe schnellten. Dass die Aktienkurse auch wieder sanken, ist für Amerikas Patrioten dabei nur ein vorübergehendes Phänomen. Wie soll ein Krieg wohl ausgehen, in dem der Angreifer die Hälfte aller Weltrüstungsausgaben tätigt?
Die US-Volkswirtschaft jedenfalls wird die militärische Muskelschau am Golf kaum belasten. Die Vereinigten Staaten können sich Kriege leisten. Das aberwitzige Rüstungsbudget von knapp 400 Milliarden Dollar macht gerade mal dreieinhalb Prozent des amerikanischen Sozialproduktes aus, und selbst das Bombardement von Bagdad schlägt nach den jüngsten Schätzungen aus dem Weißen Haus mit „nur“ 70 bis 80 Milliarden Dollar zu Buche. Das ist wenig im Vergleich zur Wirtschaftskraft der USA.
Amerika ist ein wirtschaftlicher Koloss. Mit fünf Prozent der Weltbevölkerung erwirtschaften die Vereinigten Staaten fast ein Drittel des Weltsozialprodukts. Die Mehrheit der 100 größten Unternehmen der Erde hat ihren Hauptsitz in Amerika, die mächtigsten Investmentbanken der Welt sind an der Wall Street zu Hause. Keine andere Nation liefert mehr Filme, Fernsehen und Musik, nirgendwo sonst wird Jahr für Jahr eine größere Zahl neuer Patente angemeldet.
Der Dollar ist nach wie vor die internationale Leitwährung, Amerikaner kontrollieren die Schaltzentralen des Internet und bilden die Topmanager der Welt aus. Betrachtet man die Statistiken, kann sich unter den großen Industrienationen kein anderes Land mit den Vereinigten Staaten messen. Ob beim Wachstum, bei der Produktivitätsentwicklung oder der Mobilisierung von Arbeitskräften – überall sind Amerikas Zahlen die besten.
Auf den ersten Blick jedenfalls. Zwischen all den Kriegsberichten geht fast unter, dass sich das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr um 28 Prozent vergrößert hat – auf rund eine halbe Billion Dollar. Wieder einmal führten die Amerikaner mehr Waren und Dienstleistungen ein, als sie exportierten, und wieder einmal taten sie das auf Pump, im Gegenzug für Anleihen, Investitionen und Aktien. Die Welt leiht Amerika Geld. Das ist einerseits ein Vertrauensbeweis, andererseits aber auch eine Zeitbombe, falls es sich die Welt irgendwann anders überlegt. So passierte es in den achtziger Jahren während der Ära Reagan, als der Dollarkurs stark schwankte und 1987 die Börsen krachten. Weltweite Finanztumulte waren die Folge. Heute haben „die internationalen Anleger weniger Kapital zur Verfügung, und sie sind ohnehin schon kräftig in amerikanische Werte investiert“, warnt Catherine Mann vom Institute for International Economics (IIE). „Die Finanzierungsprobleme für das explodierende Defizit wachsen rapide“, mahnt die Investmentbank Goldman Sachs.
Um sein Wachstum weiter zu finanzieren, ist Amerika auf Gedeih und Verderb auf den Goodwill der Anleger aus dem Ausland angewiesen. Der aber hängt nicht allein von schierer wirtschaftlicher Größe oder militärischer Macht ab. Dass die Vereinigten Staaten die ökonomische und politische Nummer eins der Welt sind, ist unbestritten. Dass sie es bleiben, nicht. Noch Anfang der neunziger Jahre war vom „decline“ Amerikas die Rede, von der Furcht vor einem relativen Abstieg. In den Augen der Kritiker fiel das Imperium schon damals zurück.
Gewarnt wurde vor etlichen Rissen im amerikanischen System. Der Princeton-Ökonom Paul Krugman etwa prangerte in seinem Bestseller The Age of Diminished Expectations die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich im Lande an und prognostizierte, dass immer größere Teile der Bevölkerung keine Chance haben würden, sich ihren „amerikanischen Traum“ zu erfüllen, sondern in einem Kreislauf aus Armut und Niedriglohnjobs stecken blieben – und tatsächlich wächst bis heute der Abstand zwischen wohlhabenden und verarmten Amerikanern. Kulturkritiker wie Robert Putnam (Bowling Alone) sahen die ganze amerikanische Gesellschaft auseinander driften. Andere Experten warnten angesichts eines in Teilen maroden Bildungssystems vor den Gefahren für die amerikanische Wissensgesellschaft. Heute haben 40 Millionen US-Bürger keine Krankenversicherung, verdienen die Chefs im Durchschnitt 400-mal mehr als ihre Angestellten und Arbeiter.
Dennoch sind die Debatten weitgehend verstummt. Zunächst machte ihnen der unerwartete Börsen- und Wirtschaftsboom der späten neunziger Jahre den Garaus, dann der aufwallende Patriotismus nach den Terroranschlägen des 11. September 2001. Und jetzt?
Zwar spiegelte schon die euphorische Reaktion der Börse zum Kriegsbeginn wider, was in diesen Tagen viele Ökonomen und Wall-Street-Auguren glauben: dass Amerika stark bleibt. Dass es „geopolitische Unsicherheiten“ waren, die zuletzt den Aufschwung verzögert haben, wie Notenbankchef Alan Greenspan sagte. Dass also ein schneller Sieg im Krieg den Markt und das Wachstum endlich wieder aus ihren Fesseln befreien wird. „Die USA stehen vor einem Wirtschaftsboom“, erwartet der amerikanische Ökonom Fred Bergsten. Es sei „gut möglich, dass die US-Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres um vier bis fünf Prozent wächst“.
Andere sind da weniger überzeugt: Er sei immer noch „entschieden zurückhaltend“ in Sachen Wirtschaftswachstum, sagt Morgan-Stanley-Chefökonom Stephen Roach. Das Economic Policy Institute in Washington prognostiziert auf absehbare Zeit bestenfalls jobless growth, also mäßiges Wachstum ohne zusätzliche Arbeitsplätze. Die Meldungen von Massenentlassungen und Betriebsschließungen reißen nicht ab, eine Reihe von Fluggesellschaften könnten in den kommenden Monaten Konkurs anmelden, die verschuldeten und um ihren Arbeitsplatz bangenden amerikanischen Konsumenten halten sich bei ihren Einkäufen neuerdings zurück. Ob es also in kurzer Frist zu einer Erholung der für die Welt so wichtigen US-Wirtschafskraft kommt, ist keine ausgemachte Sache.
Ohne einen nachhaltigen Aufschwung aber werden auch die strukturellen Probleme der USA wieder stärker zutage treten. Schon jetzt machen sich kritische Ökonomen Sorgen, dass etwa all jene ehemaligen Sozialhilfe-Empfänger, die während des Booms der Neunziger einen Job fanden, nun wieder in die Armut zurückfallen. Geld für neue Sozialprogramme allerdings fehlt – was auch daran liegt, dass der wichtigste Mann im Staat über seine Prioritäten längst entschieden hat. George W. Bush will in der kommenden zehn Jahre insgesamt 1,8 Billionen Dollar neuer Schulden aufnehmen, die ins Militär und in radikale Steuersenkungsprogramme fließen sollen. Zurückzahlen kann Bush diese Schulden nur, wenn Amerika bald wieder Wachstum nach dem Vorbild der neunziger Jahre liefert. Eine gewagte Wette.
Finanzieren muss er sie vorher. Dabei könnte der militärische Konflikt am Golf sogar hilfreich sein – sobald Siegesbilder aus Bagdad über die Bildschirme der Welt flackern. „Amerika bekommt all dieses ausländische Kapital, weil die Leute denken: Die USA sind so mächtig, sie sind geopolitisch sicher“, sagt Edward D. Luttwak vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Doch lässt sich die militärische Übermacht wirklich so einfach in die Welt der Wirtschaft übersetzen?
„Die wirtschaftliche Sphäre funktioniert anders als die militärische und geopolitische“, meint Joseph Nye, Dean der Kennedy School of Government in Harvard und Autor des Buches The Paradox of American Power. In der Wirtschaft, so Nye, „bestehen viele Abhängigkeiten, es gibt eher ein Kräftegleichgewicht zwischen den Blöcken“. Im Klartext: Amerika ist auf den Rest der Welt angewiesen – auch wenn es das nicht so gern wahrhaben will.
Große Teile der amerikanischen Exportwirtschaft – die immerhin zehn Prozent zum Bruttosozialprodukt des Landes beiträgt und Millionen Arbeitsplätze sichert – brauchen freundlich gesinnte Konsumenten in aller Welt. Globale Marken wie Coca-Cola und Nike könnten leiden, wenn Verbraucher in Asien, Lateinamerika oder Europa die Vereinigten Staaten für ein aufdringliches und selbstherrliches Imperium hielten. Sie sind es schließlich, die amerikanischen Lebensstil und amerikanische Coolness in die Wohnzimmer und Küchen der Welt transportieren – genauso wie die Musik- und Filmstudios Amerikas.
Zu den Geheimnissen des amerikanische Wirtschaftserfolges gehört bislang auch die anhaltende Attraktivität als Einwanderungsland. Junge Familien mit frischer Arbeitskraft und potenziell vielen Kindern, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum in die USA kommen, sorgen für eine „jüngere, gemischtere und im Schnitt dynamischere“ Gesellschaft, wie der britische Economist einmal urteilte. Hält dieser Trend an, wird diese Gesellschaft Mitte des Jahrhunderts 15 Jahre jünger sein als die Bevölkerung Europas – das dann zu Recht old Europe hieße und dessen Volkswirtschaften unter der Rentenlast ächzen werden.
Nur: Kommen die Einwanderer auch dann noch, wenn die USA ihr gutes Image in aller Welt verlieren und sich zunehmend abschotten?
Schon jetzt werden Immigranten aus islamischen Nationen bespitzelt und teilweise aus dem Land vertrieben. Sogar ausländische Studenten haben es immer schwerer. „Ich gehe davon aus, dass der Antragsweg künftig länger wird, vielleicht dreimal so lang“, fürchtet Allan Goodman, Präsident des Institute of International Education, das die begehrten Fulbright-Stipendien vergibt.
Und noch in einem weiteren Bereich könnte der amerikanischen Wirtschaft Übles drohen, wenn im Krieg und danach allzu viel Goodwill verloren ginge: Auch amerikanische Unternehmen sind in aller Welt auf die Kooperation mit den Behörden angewiesen. Konzerne, die fusionieren wollen, müssen sich dafür die Genehmigung europäischer Behörden holen; der Softwareproduzent Microsoft muss seine Wettbewerbspraktiken auch vor der EU-Kommission und Gerichten in aller Welt rechtfertigen. Amerikanische Fluggesellschaften brauchen Landeerlaubnis, amerikanische Film- und Fernsehmacher verdienen ohne internationale Copyright-Gesetze weniger Geld, und ohne Zulassungen in fernen Ländern bleiben amerikanische Landwirte auf ihren gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln sitzen. „Die Welt in Freunde und Feinde aufzuteilen würde ökonomisch teuer ausfallen“, glaubt Jeff Madrick, ein New Yorker Ökonom. Hier – eher als bei explodierenden Kriegskosten oder in einer unsicheren Versorgung mit Öl – liegen langfristig die größten Gefahren für die Vereinigten Staaten.
Das ist auch in den USA eigentlich keine neue Erkenntnis. Viele Regeln der internationalen Wirtschaft sind in den vergangenen Jahrzehnten unter starkem US-Einfluss entstanden. Die Welthandelsorganisation (WTO) zum Beispiel ist letztlich eine Erfindung der Amerikaner – und die kommende WTO-Verhandlungsrunde für eine weitere Liberalisierung des weltweiten Güter- und Dienstleistungsverkehrs könnte zu einem großen Test werden. Der transatlantische Streit um Agrarsubventionen etwa sei schon jetzt „eine tickende Zeitbombe“, meint Jagdish Bhagwati, Handelsökonom an der Columbia University – und ist ein möglicherweise auf Dauer gefährlicherer Konfliktpunkt als die anhaltende Auseinandersetzung um den Irak und den Krieg.
Die Preisfrage dabei ist, wie weit die Regierung des Kriegspräsidenten Bush ihre amerikazentrische Sicht der Dinge auch in der wirtschaftlichen Sphäre durchsetzen will. „Jeder weiß: Es gibt laute Stimmen in den USA, die internationale Institutionen ablehnen, und viele davon sind Bush sehr nahe“, glaubt Lester Thurow vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Längst schon gehört es zur offiziellen Strategie des US-Handelsrepräsentanten Robert Zoellick, außerhalb der WTO bilaterale Handelsverträge ganz nach dem Gusto der Vereinigten Staaten abzuschließen. Dass manche Entwicklungsländer mit Drohungen über den Entzug von Hilfe auf die eigene Seite gezogen werden sollen, war nicht nur Teil des diplomatischen Schauspiels vor Kriegsbeginn im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es gehört auch zum amerikanischen Geschäftsgebaren im Ringen um handelspolitische Verbündete.
Ob diese Strategie auch nach dem Ende des Irak-Kriegs fortgesetzt – und vielleicht noch verstärkt – wird, hängt ganz davon ab, wie dieser Krieg zu Ende geht und wann.
Triumphiert Amerika schnell und eindeutig, könnte das „eine generelle Aura schaffen, nach dem Motto ,Die USA sind stark genug, um es allein zu schaffen‘“, sagt Nye. Dauert es länger, werden die Verluste größer, schwächelt die Wirtschaft weiter und bleibt der Aufschwung aus, werden auch in Amerika jene Stimmen lauter, die Krieg nicht nur für das falsche Mittel der Politik gehalten haben. Es werden sich auch jene melden, die ihre Finger auf die Wunden der amerikanischen Gesellschaft und der amerikanischen Wirtschaft legen.
Gut möglich, dass man dann auch in Mount Pleasant nicht mehr nur über die Krieger redet, die der Ort hervorgebracht hat. Sondern auch über seine Arbeitslosen und seine Armen.
.
Roland Leuschel
Das Universum und die Dummheit der Menschen …
Auch die Leser der boerse.de Kolumnen dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die Augen, Ohren und Nasen voll haben mit Bildern der Fernsehkanäle, auf denen geschossen und gebombt wird, auf denen explodierende Raketen und schreiende Kinder zu sehen sind, von Experten die eine Erfolgsmeldung nach der anderen geben und uns die Kriegstaktiken erklären, und wir sind erstaunt, dass anscheinend die ganze Welt von Nahost-Militärexperten wimmelt.
Die TV-Zuschauer dürften aber vor allem die Nase voll haben von dem Gestank, den all die Lügen verbreiten, die auf uns einprasseln. Einer der wenigen Augenblicke der Wahrheit : Im ZDF wurde der wohl bekannteste Nahost-Spezialist, Peter Scholl-Latour, gefragt, wie er erklären kann, dass die Amerikaner wohl tatsächlich daran geglaubt hatten, sie würden bei den Schijten in Basra willkommen sein, nachdem sie vor 12 Jahren von den Amerikanern im Stich gelassen worden waren ?
Scholl-Latour antwortete : « Die Dummheit der Menschen kennt keine Grenzen. » Eine klare und präzise Antwort, sie erinnert an einen Ausspruch eines der intelligentesten Wesen, das die Menschheit hervorgebracht hat, Albert Einstein, der sagte : « Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschheit, wobei das erste noch nicht endgültig bewiesen ist. » Diese Antwort hätte Albert Einstein auch heute gegeben, wenn jemand ihn nach dem Sinn und der Berechtigung dieses Krieges gefragt hätte.
Die Aktienbörsen haben am 12. März dieses Jahres einen neuen Tiefstpunkt erreicht (Dax 2.198), und als der Kriegsbeginn für jeden Anleger sichtbar wurde, setzte eine allgemeine Kursrallye ein, da die « Unsicherheit aus dem Markt war » (auch hier scheinen Einsteins Worte zu gelten). Ich würde sagen, mit Kriegsbeginn entstanden enorm viele neue Unsicherheiten, die auch die Wirtschaft und damit die Börsen belasten werden.
Viele Experten sahen in der fulminanten Börsenerholung (in einer Woche stiegen Dax um 23%, Dow Jones um 9% etc.), bereits das Ende der dreijährigen Baisseperiode und animierten die Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Daueroptimist Heiko Thieme schrieb in der FAZ vom 24.3. : « Eine solche achttätige Rekordsträhne ohne Unterbrechung hat es in der fast 107 Jahre alten Geschichte des Dow Jones bisher noch nie gebeben. »… und er las den Realisten unter den Experten die Leviten : « Die jüngste Entwicklung hat die Pessimisten, die drei Jahre lang die Oberhand hielten, in ihre Schranken verwiesen. », gerade Heiko Thieme, der den Anlegern und der Börsenwelt bewiesen hat, wohin blinder Daueroptimismus bei Aktien führen kann. Still und leise hat er seinen in Luxemburg aufgelegten Fonds, den Thieme Fonds International, geschlossen. Er war im vergangenen Jahr der schlechteste globale Aktienfonds. « Heiko Thieme gilt in Branchenkreisen als einer der schlechtesten Fondsmanager der USA. 2002 verlor sein Fonds fast 70%. Das ist doppelt so viel wie der MSCI World. », so der Originalton von BoerseOnline Nr : 12/2003.
Auch eine der grössten amerikanischen Investmentbanken, Morgan Stanley, trompetete mit Vehemenz ins optimistische Horn : « Der Beginn der Kampfhandlungen hat die zuvor verzeichnete Ungewissheit über die Entwicklung des Irak-Konflikts beseitigt. Die Risikoscheu der Anleger sinkt, und der Ölpreis fällt. » Nach dem eigenen MS-Modell sollte das Kursniveau in Europa noch um weitere 20% steigen, auch wenn die Rendite von Staatsanleihen im Euroraum auf 4,75 anziehen sollte. Ich könnte die Liste der Techniker und Volkswirte weiterführen, die in ihrer ersten Etappe eine Erholung des Daxes bis mindestens 3.500 erwarten (gegenüber dem Tiefstpunkt vom 12.03 wären das immerhin +60% !).
Ich schlage vor, in solch unsicheren Zeiten sollte der Anleger sich an einige fundamentale Fakten halten und versuchen mit Hilfe seines gesunden Menschenverstandes eine Anlagepolitik zu finden, die sein Kapital erhält, und wenn er etwas Glück hat, um 4 bis 6% per annum erhöht. Die Fakten :
Weltweit wurden seit dem Frühjahr 2000 Aktienvermögen von über 12.000 Milliarden Dollar vernichtet (entspricht einem Drittel des augenblicklichen, weltweiten Jahres-Bruttosozialproduktes). Wir haben die grösste Aktienbaisse erlebt, seitdem es Aktien gibt, und sie ist mittlerweile auch die Längste, sie dauerte 36 Monate, gegenüber 34 Monaten in den Jahren 1929 bis 1932. Wer glaubt, eine derartige Kapitalvernichtung hätte keine realwirtschaftlichen Folgen, der irrt gewaltig, zumal aufgrund der Medien und der Banken die Aktienanlage in den 90er Jahren als die rentabelste Anlageinvestition überhaupt angepriesen wurde, und die Anleger nicht nur im Privatsektor sondern auch bei Versicherungen und Pensionskassen die Aktienbestände auf nie gekannte Höhen getrieben hatten.
Der renommierte amerikanische Broker, Goldman Sachs, fasste in seiner Studie « Lessons from the Boom and Bust » fünf Schlussfolgerungen zusammen, deren vierte heisst : « Börse und Realwirtschaft wirken so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven, selbstverstärkenden Prozessen, als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge. »
Sie kennen die von mir in dieser Kolumne schon öfters vertretene Meinung, dass die Weltwirtschaftskrise II droht. Auch Goldman Sachs schreibt, dass diese Börsenbaisse eine Grössenordnung erreicht hat, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft darstellt.
Der Anleger hat in den drei Jahren der Aktienbaisse eine Risikoaversion gegenüber Aktien und im Gegensatz dazu ein völlig fehlendes Risikobewustsein bei Anleihenentwickelt, sodass er jetzt Gefahr läuft, bei einem Rentenmarktcrash ein zweites mal auf die Nase zu fallen, so schreibt der Chefredakteur von BoerseOnline Johannes Scherer in der letzten Ausgabe : « Deshalb schichten Aktienanleger bereits seit Monaten ihr Kapital in Rentenwerte um und kommen jetzt womöglich vom Regen in die Traufe ; denn die Flucht in länger laufende Zinspapiere hat deren Kurse dermassen nach oben gejagt, dass die Blase zu platzen droht. »
Fazit für den Anleger : Die augenblickliche Kurserholung ist eine zeitlich begrenzte (2 bis 3 Wochen ?) in einem Baissemarkt, der noch einige Jahre andauern wird (2000 bis 2012). Wer seine Kauflimite bei Qualitätsaktien im vergangenen Monat gelegt hat, hat diese Aktien bekommen und kann sie mit 20 bis 30% Kursgewinn verkaufen. Er sollte also nach wie vor Trading mit Aktien machen, aber schon heute die nächsten Kaufkurse in den Markt legen. Insgesamt sollte aber der Anteil der Aktien eines Portefeuilles nicht 20 bis 30% überschreiten, der Rest sollte wie gehabt in Triple A Kurzläufern angelegt sein, und vergessen Sie nicht 5 bis 10% in Gold zu legen. Die jetzige Kursschwäche (330 Dollar) ist ein günstiger Einsteigspreis, da die nächste Inflationswelle mit Sicherheit kommt. Schliesslich kostet der Krieg viel viel Geld.
Wieweit die Aktienkrise in Japan bereits fortgeschritten ist, zeigt der in einer einberufenen Krisensitzung der Bank of Japan in Tokio beschlossene Aktienkauf von 24 Milliarden Euro aus dem Beteiligungsbesitz finanziell angeschlagener Banken. Es steht sehr schlecht um das Bankensystem in Japan, und ein Kollaps würde mit Sicherheit Rückwirkungen auf das gesamte internationale Bankensystem haben.
www.boerse.de - 27.03.2003
Roland Leuschel
Das Universum und die Dummheit der Menschen …
Auch die Leser der boerse.de Kolumnen dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die Augen, Ohren und Nasen voll haben mit Bildern der Fernsehkanäle, auf denen geschossen und gebombt wird, auf denen explodierende Raketen und schreiende Kinder zu sehen sind, von Experten die eine Erfolgsmeldung nach der anderen geben und uns die Kriegstaktiken erklären, und wir sind erstaunt, dass anscheinend die ganze Welt von Nahost-Militärexperten wimmelt.
Die TV-Zuschauer dürften aber vor allem die Nase voll haben von dem Gestank, den all die Lügen verbreiten, die auf uns einprasseln. Einer der wenigen Augenblicke der Wahrheit : Im ZDF wurde der wohl bekannteste Nahost-Spezialist, Peter Scholl-Latour, gefragt, wie er erklären kann, dass die Amerikaner wohl tatsächlich daran geglaubt hatten, sie würden bei den Schijten in Basra willkommen sein, nachdem sie vor 12 Jahren von den Amerikanern im Stich gelassen worden waren ?
Scholl-Latour antwortete : « Die Dummheit der Menschen kennt keine Grenzen. » Eine klare und präzise Antwort, sie erinnert an einen Ausspruch eines der intelligentesten Wesen, das die Menschheit hervorgebracht hat, Albert Einstein, der sagte : « Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschheit, wobei das erste noch nicht endgültig bewiesen ist. » Diese Antwort hätte Albert Einstein auch heute gegeben, wenn jemand ihn nach dem Sinn und der Berechtigung dieses Krieges gefragt hätte.
Die Aktienbörsen haben am 12. März dieses Jahres einen neuen Tiefstpunkt erreicht (Dax 2.198), und als der Kriegsbeginn für jeden Anleger sichtbar wurde, setzte eine allgemeine Kursrallye ein, da die « Unsicherheit aus dem Markt war » (auch hier scheinen Einsteins Worte zu gelten). Ich würde sagen, mit Kriegsbeginn entstanden enorm viele neue Unsicherheiten, die auch die Wirtschaft und damit die Börsen belasten werden.
Viele Experten sahen in der fulminanten Börsenerholung (in einer Woche stiegen Dax um 23%, Dow Jones um 9% etc.), bereits das Ende der dreijährigen Baisseperiode und animierten die Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Daueroptimist Heiko Thieme schrieb in der FAZ vom 24.3. : « Eine solche achttätige Rekordsträhne ohne Unterbrechung hat es in der fast 107 Jahre alten Geschichte des Dow Jones bisher noch nie gebeben. »… und er las den Realisten unter den Experten die Leviten : « Die jüngste Entwicklung hat die Pessimisten, die drei Jahre lang die Oberhand hielten, in ihre Schranken verwiesen. », gerade Heiko Thieme, der den Anlegern und der Börsenwelt bewiesen hat, wohin blinder Daueroptimismus bei Aktien führen kann. Still und leise hat er seinen in Luxemburg aufgelegten Fonds, den Thieme Fonds International, geschlossen. Er war im vergangenen Jahr der schlechteste globale Aktienfonds. « Heiko Thieme gilt in Branchenkreisen als einer der schlechtesten Fondsmanager der USA. 2002 verlor sein Fonds fast 70%. Das ist doppelt so viel wie der MSCI World. », so der Originalton von BoerseOnline Nr : 12/2003.
Auch eine der grössten amerikanischen Investmentbanken, Morgan Stanley, trompetete mit Vehemenz ins optimistische Horn : « Der Beginn der Kampfhandlungen hat die zuvor verzeichnete Ungewissheit über die Entwicklung des Irak-Konflikts beseitigt. Die Risikoscheu der Anleger sinkt, und der Ölpreis fällt. » Nach dem eigenen MS-Modell sollte das Kursniveau in Europa noch um weitere 20% steigen, auch wenn die Rendite von Staatsanleihen im Euroraum auf 4,75 anziehen sollte. Ich könnte die Liste der Techniker und Volkswirte weiterführen, die in ihrer ersten Etappe eine Erholung des Daxes bis mindestens 3.500 erwarten (gegenüber dem Tiefstpunkt vom 12.03 wären das immerhin +60% !).
Ich schlage vor, in solch unsicheren Zeiten sollte der Anleger sich an einige fundamentale Fakten halten und versuchen mit Hilfe seines gesunden Menschenverstandes eine Anlagepolitik zu finden, die sein Kapital erhält, und wenn er etwas Glück hat, um 4 bis 6% per annum erhöht. Die Fakten :
Weltweit wurden seit dem Frühjahr 2000 Aktienvermögen von über 12.000 Milliarden Dollar vernichtet (entspricht einem Drittel des augenblicklichen, weltweiten Jahres-Bruttosozialproduktes). Wir haben die grösste Aktienbaisse erlebt, seitdem es Aktien gibt, und sie ist mittlerweile auch die Längste, sie dauerte 36 Monate, gegenüber 34 Monaten in den Jahren 1929 bis 1932. Wer glaubt, eine derartige Kapitalvernichtung hätte keine realwirtschaftlichen Folgen, der irrt gewaltig, zumal aufgrund der Medien und der Banken die Aktienanlage in den 90er Jahren als die rentabelste Anlageinvestition überhaupt angepriesen wurde, und die Anleger nicht nur im Privatsektor sondern auch bei Versicherungen und Pensionskassen die Aktienbestände auf nie gekannte Höhen getrieben hatten.
Der renommierte amerikanische Broker, Goldman Sachs, fasste in seiner Studie « Lessons from the Boom and Bust » fünf Schlussfolgerungen zusammen, deren vierte heisst : « Börse und Realwirtschaft wirken so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven, selbstverstärkenden Prozessen, als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge. »
Sie kennen die von mir in dieser Kolumne schon öfters vertretene Meinung, dass die Weltwirtschaftskrise II droht. Auch Goldman Sachs schreibt, dass diese Börsenbaisse eine Grössenordnung erreicht hat, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft darstellt.
Der Anleger hat in den drei Jahren der Aktienbaisse eine Risikoaversion gegenüber Aktien und im Gegensatz dazu ein völlig fehlendes Risikobewustsein bei Anleihenentwickelt, sodass er jetzt Gefahr läuft, bei einem Rentenmarktcrash ein zweites mal auf die Nase zu fallen, so schreibt der Chefredakteur von BoerseOnline Johannes Scherer in der letzten Ausgabe : « Deshalb schichten Aktienanleger bereits seit Monaten ihr Kapital in Rentenwerte um und kommen jetzt womöglich vom Regen in die Traufe ; denn die Flucht in länger laufende Zinspapiere hat deren Kurse dermassen nach oben gejagt, dass die Blase zu platzen droht. »
Fazit für den Anleger : Die augenblickliche Kurserholung ist eine zeitlich begrenzte (2 bis 3 Wochen ?) in einem Baissemarkt, der noch einige Jahre andauern wird (2000 bis 2012). Wer seine Kauflimite bei Qualitätsaktien im vergangenen Monat gelegt hat, hat diese Aktien bekommen und kann sie mit 20 bis 30% Kursgewinn verkaufen. Er sollte also nach wie vor Trading mit Aktien machen, aber schon heute die nächsten Kaufkurse in den Markt legen. Insgesamt sollte aber der Anteil der Aktien eines Portefeuilles nicht 20 bis 30% überschreiten, der Rest sollte wie gehabt in Triple A Kurzläufern angelegt sein, und vergessen Sie nicht 5 bis 10% in Gold zu legen. Die jetzige Kursschwäche (330 Dollar) ist ein günstiger Einsteigspreis, da die nächste Inflationswelle mit Sicherheit kommt. Schliesslich kostet der Krieg viel viel Geld.
Wieweit die Aktienkrise in Japan bereits fortgeschritten ist, zeigt der in einer einberufenen Krisensitzung der Bank of Japan in Tokio beschlossene Aktienkauf von 24 Milliarden Euro aus dem Beteiligungsbesitz finanziell angeschlagener Banken. Es steht sehr schlecht um das Bankensystem in Japan, und ein Kollaps würde mit Sicherheit Rückwirkungen auf das gesamte internationale Bankensystem haben.
www.boerse.de - 27.03.2003
Das Wochenende steht vor der Tür, also mal wieder Zeit etwas in den CD-Player zu werfen...Habe gerade die Hymne der doofen US-Konsumenten und der bubble economy gefunden (hat`s soagr in die Top 10 charts geschafft)  Ein richtig schön zynischer Text..
Ein richtig schön zynischer Text..
(Ka-Ching steht übrigens für den unvergleichlichen Sound einer ratternden Registrierkasse)
Shania Twain - Ka-Ching lyrics
We live in a greedy little world
that teaches every little boy and girl
To earn as much as they can possibly
then turn around and
Spend it foolishly
We`ve created us a credit card mess
We spend the money we don`t possess
Our religion is to go and blow it all
So it`s shoppin` every Sunday at the mall
All we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Chorus:
Can you hear it ring
It makes you wanna sing
It`s such a beautiful thing Ka-ching!
Lots of diamond rings
The happiness it brings
You`ll live like a king
With lots of money and things
When you`re broke go and get a loan
Take out another mortgage on your home
Consolidate so you can afford
To go and spend some more when
you get bored
All we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Repeat Chorus
Let`s swing
Dig deeper in your pocket
Oh, yeah, ha
Come on I know you`ve got it
Dig deeper in your wallet
Oh
All we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Repeat Chorus
Can you hear it ring
It makes you wanna sing
You`ll live like a king
With lots of money and things
Ka-ching!

 Ein richtig schön zynischer Text..
Ein richtig schön zynischer Text.. (Ka-Ching steht übrigens für den unvergleichlichen Sound einer ratternden Registrierkasse)

Shania Twain - Ka-Ching lyrics
We live in a greedy little world
that teaches every little boy and girl
To earn as much as they can possibly
then turn around and
Spend it foolishly
We`ve created us a credit card mess
We spend the money we don`t possess
Our religion is to go and blow it all
So it`s shoppin` every Sunday at the mall
All we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Chorus:
Can you hear it ring
It makes you wanna sing
It`s such a beautiful thing Ka-ching!
Lots of diamond rings
The happiness it brings
You`ll live like a king
With lots of money and things
When you`re broke go and get a loan
Take out another mortgage on your home
Consolidate so you can afford
To go and spend some more when
you get bored
All we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Repeat Chorus
Let`s swing
Dig deeper in your pocket
Oh, yeah, ha
Come on I know you`ve got it
Dig deeper in your wallet
Oh
All we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Repeat Chorus
Can you hear it ring
It makes you wanna sing
You`ll live like a king
With lots of money and things
Ka-ching!

.
Wenn man sich das shirt der Sängerin Shania Twain http://www.shania-twain.com/ anschaut, gehört sie wirklich nicht zu den Profiteueren der bubble economy ...
Beste Grüße Konradi
.
Wenn man sich das shirt der Sängerin Shania Twain http://www.shania-twain.com/ anschaut, gehört sie wirklich nicht zu den Profiteueren der bubble economy ...

Beste Grüße Konradi
.
.
"Geldverdienen ist eine Gottesgabe"
John D. Rockefeller erbaute ein Ölimperium. Konkurrenten trieb er in den Ruin, und am Sonntag fegte er die Kirche
Von Wolfgang Uchatius
Die Geschichte des John D. Rockefeller beginnt 303 Jahre vor seiner Geburt, und sie beginnt damit, dass Gott ein Freund des Geldes wird. Oder zumindest, dass die Menschen anfangen, das zu glauben.
Es geschieht im Jahr 1536 nach Christus, und es geschieht in Basel. Der Reformator Johannes Calvin gibt erstmals seine Institutio Christianae religionis, Unterweisung in der christlichen Religion, heraus. Er schreibt von armen Seelen, die von Geburt an für die Hölle bestimmt sind, und von Auserwählten, auf die das Himmelreich wartet. Eine Frage aber bleibt: Woran mag der Mensch erkennen, wozu Gott ihn ausersehen hat?
Calvin stirbt, doch die Calvinisten leben weiter, und sie geben eine Antwort: Gottes Gunst lässt sich am Geld ablesen, am Lohn für die Fleißigen und Sparsamen. Damit ist geschaffen, was der deutsche Soziologe Max Weber später den kapitalistischen Geist nennen wird. Der Reichtum hat den Gestank verloren. Wer im Leben etwas leistet, hat nach dem Tod nichts zu fürchten. Größer könnte der Anreiz zum Arbeiten nicht sein.
Vom Vater zum Sohn, vom Bruder zum Nachbarn – der neue Glaube verbreitet sich über Länder, Ozeane und Jahrhunderte, er erfüllt Handwerker und Kaufleute, Bauern und Fabrikanten und beseelt schließlich einen Mann, der am 8. Juli 1839 in Amerika zur Welt kommt, in einem Städtchen namens Richford im Bundesstaat New York.
Einen Mann, der als kleiner Junge kiloweise Süßigkeiten ersteht und sie mit Gewinn an seine Geschwister weiterverkauft.
Einen Mann, der jedes Jahr seinen „Jobday“ feiert: den Tag, an dem er seine erste Arbeitsstelle antrat.
Einen Mann, der sagt: „Die Gabe, Geld zu verdienen, ist eine Gabe Gottes, ein Pfund, mit dem wir wuchern müssen, so gut wir können.“
Einen Mann, der der reichste Mensch der Welt werden sollte.
Sein Name ist John Davison Rockefeller.
Seine Welt ist der wilde amerikanische Osten, Mitte des 19. Jahrhunderts. Millionen Einwanderer aus aller Welt strömen ins Land und wollen leben. Wo gestern noch Bäume wuchsen, stehen auf einmal Häuser und Fabriken, rollen Fuhrwerke und rattern Dampfmaschinen. Mittendrin: Johns Vater, ein Hausierer, der sich in den Dörfern gelegentlich als Arzt ausgibt und Ahnungslosen allerlei Essenzen als Medizin verkauft. Und Johns Mutter, eine gottesfürchtige Bauerntochter, die ihre Kinder mit Bibel und Birkenrute erzieht.
Das Paar hat vier Söhne und zwei Töchter, aber zu wenig Geld, sie anständig zu kleiden. In der Schule dürfen John und sein Bruder nicht aufs Klassenfoto, ihre Anzüge sind zu schäbig. „Ich erinnere mich nicht, jemals vernachlässigtere Kinder gesehen zu haben“, wird ein ehemaliger Nachbar sagen, viel später, als die halbe Welt „den Rockefeller“ kennt und die Journalisten und Biografen sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit machen.
Sie stellen fest, abgesehen von seiner Kleidung fiel der blasse und humorlose Schüler John den meisten Leuten nicht weiter auf. Seine Leistungen sind nicht überragend, außer in Mathematik. Kopfrechnen kann er wie wenige andere, und insofern ist es nur passend, dass John, inzwischen 16 Jahre alt und mit den Eltern nach Cleveland, Ohio, umgezogen, nach der Highschool eine Stelle als Buchhalter in einem Handelshaus antritt. Am 26. September 1855, dem Jobday.
Er sitzt dann mit Armschonern an seinem Schreibtisch und addiert Zahlen. Überträgt die Ergebnisse. Addiert. Überträgt. Addiert. Überträgt. Erledigt eine Arbeit, die andere Menschen langweilen würde, die ihn jedoch begeistert. „Die Systematik der Geldbeträge“ findet Rockefeller „herrlich“. Schon morgens um halb sieben ist er im Büro, wo er oft die halbe Nacht verbringt, obwohl er die freiwilligen Überstunden nicht bezahlt bekommt. „Arbeit befreite ihn, Arbeit gab ihm eine neue Identität“, wird der Rockefeller-Biograf Ron Chernow später folgern. Nur den Sonntag hält John sich frei. Da feiert er den Gottesdienst, da fegt er die Kirche, führt das Protokoll in den Sitzungen des Pfarrgemeinderates und unterrichtet die Kinder aus der Bibel. Von Anfang an spendet er einen Gutteil seines Einkommens der Kirchengemeinde, lebt anspruchslos und voller Abscheu gegenüber allem Geprasse.
Der amerikanische Bürgerkrieg kurbelt die Geschäfte an
Die Arbeit und der Glaube an Gott sind die Pfeiler in Rockefellers noch jungen Leben und werden es bis zum Ende bleiben, weitere Stützen braucht er nicht, um den Beifall der Menschen kümmert er sich wenig. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung wird Rockefeller in einer Vorlesung einmal als einen Menschen bezeichnen, in dessen Bewusstsein nur Platz für ein einziges Wort war: ich.
Dreieinhalb Jahre nach dem ersten Jobday verweigert sein Chef ihm die gewünschte Gehaltserhöhung. Rockefeller glaubt, genug gelernt zu haben, er gibt seine Stelle auf und gründet ein eigenes Handelshaus, gemeinsam mit einem englischen Freund, Maurice Clark.
Die Geschäfte laufen glänzend. Weiterhin strömen die Einwanderer ins Land, Amerika wächst, der beginnende Bürgerkrieg kurbelt die Nachfrage noch an. Die Soldaten und Fabrikarbeiter benötigen Essen, die Bauern brauchen Saatgut. Clark & Rockefeller verkaufen es ihnen. Sie handeln in Ohio mit Bohnen, in Michigan mit Weizen, in Illinois mit Salz und Schweinefleisch, und bald fangen sie an, ein neues Produkt zu verkaufen, das in immer mehr Häusern des Landes die bisher meist mit Walfischtran betriebenen Lampen füllt: Erdöl aus Pennsylvania.
Mit dem Öl verhält es sich in diesen Tagen ähnlich wie Jahrzehnte später mit Computern oder dem Internet: Die einen glauben, es sei von nun an ein anderes Wort für Gold, die anderen fürchten, besonders lange werde sich damit kein Geschäft machen lassen. Auch Rockefeller zweifelt zunächst, doch dann kaufen er und Clark eine kleine Raffinerie, und da sie Gewinn abwirft, nimmt Rockefeller einen Kredit nach dem anderen auf, um das Ölgeschäft zu erweitern. Die Raffinerie wächst und wächst. Als Clark ob der schnellen Expansion Bedenken anmeldet, kommt es zum Bruch. Die Firma wird aufgelöst und zur Auktion angeboten. Sowohl Clark als auch Rockefeller beschließen, das Unternehmen zu ersteigern.
So kommt es, dass Anfang Februar 1865, an einem der letzten Tage des amerikanischen Bürgerkriegs, in einem kargen Büroraum in Cleveland zwei gegensätzliche junge Männer ihre finanziellen Kräfte messen. Der eine, Clark, fürchtet das unternehmerische Risiko, gibt sich privat aber gern pompös. Der andere, Rockefeller, hebt jede Paketschnur und jedes Stück Packpapier auf, aber wenn er einmal an eine Geschäftsidee glaubt, scheut er keine Gefahr. Clark nennt ihn den „größten Schuldenmacher, dem ich je begegnet bin“. Dieser asketische Erzkapitalist pariert ungerührt jedes Gebot seines Gegners mit einem höheren Betrag, sagt schließlich „72500 Dollar!“ – und hat gewonnen. Clark gibt auf, Rockefeller ist Herr über die bei weitem größte Raffinerie der Stadt. Später wird er sagen: „Ich verweise immer auf diesen Tag als den Anfang des Erfolges, den ich im Leben hatte.“
Es hätte leicht auch der erste Tag seines Untergangs sein können. Zwar wächst auch nach Ende des Bürgerkriegs der Hunger nach Öl. Immer mehr Lampen benötigen Leuchtstoff, immer mehr Maschinen brauchen Schmiermittel. „Statt der Baumwolle regiert jetzt das Öl die Welt des Handels“, schreibt 1865 der amerikanische Kongressabgeordnete James Garfield.
Aber auch immer mehr Menschen wollen mit dem in Pennsylvania geförderten Öl Geld verdienen. Ob Cleveland, Pittsburgh, New York, Philadelphia oder Boston – überall stehen die Raffinerien, und bald sind es zu viele. Da sich das von ihnen hergestellte Petroleum und Schmieröl kaum unterscheidet, können sie miteinander nur über den Preis konkurrieren. Wer am kostengünstigsten produziert, gewinnt.
Der Gewinner heißt Rockefeller. Anders als Gottfried Daimler, der Erfinder des Automobils, entwickelt er kein neues Produkt. Anders als Henry Ford, der Vater des Fließbands, entdeckt er kein neues Produktionsverfahren. Worauf Rockefeller baut, ist so banal wie revolutionär. Es ist die Macht der Masse. Mit seinem neuen Partner Henry Flagler, einem ehemaligen Salzfabrikanten, gründet er die Standard Oil Company, die erste Erdölgesellschaft der Vereinigten Staaten. Als eines der ersten Industrieunternehmen der Geschichte macht sich Standard Oil im großen Stil zunutze, was heute zum Grundwissen jedes Betriebswirtschaftlers gehört: die Economies of Scale, die Vorteile der Größe.
Rockefeller kauft Wälder und Dampfschiffe, er produziert eigene Ölfässer und verfrachtet sie selbst über die Kanäle und Seen, um sich nicht mehr von plötzlich steigenden Holz- oder Transportpreisen die Gewinnmargen verkleinern zu lassen. Er arbeitet mit Strohmännern und Spionen, kauft konkurrierende Raffinerien auf, legt einige still, legt andere zusammen. Er erhöht die Produktion, senkt dadurch zuerst die Stückkosten und dann die Preise, wodurch er weitere Rivalen zur Aufgabe und zum Verkauf zwingt. Innerhalb eines Jahres übernimmt Standard Oil allein in Cleveland 22 seiner 26 Konkurrenten.
Die riesigen Mengen an Öl, über die Rockefeller bald befiehlt, machen ihn zum begehrten Verhandlungspartner der Eisenbahngesellschaften, die sich darum reißen, das Öl Amerikas zu transportieren. Nur Rockefeller kann garantieren, ihre Züge zu füllen, und so muss sich im April 1868 der ergraute Eisenbahn-Magnat Cornelius Vanderbildt, genannt der Commodore, in das Büro dieses 29-jährigen gefühlskalten Emporkömmlings begeben, um ihn zum Vertragsabschluss zu bewegen. Rockefeller schlägt ein, die Eisenbahn gewährt ihm großzügigen Rabatt, was er dazu nützt, die Preise weiter zu senken und weitere Konkurrenten „zum Schwitzen zu bringen“, wie er sagt.
Wenige Jahre später hat sich das Spielfeld verändert, Öl wird jetzt in Pipelines quer durchs Land befördert, die wichtigste Spielregel aber ist immer noch dieselbe: Der Größte gewinnt. Rockefeller kauft ganze Landstriche auf, damit die Konkurrenz dort keine Rohre verlegen kann, und überzieht den Westen Pennsylvanias mit einem riesigen eigenen Pipeline-Netz. „Sobald ein Ölsucher auf Öl stieß, war Standard Oil da, um seine Quellen anzuschließen – das sicherte die Existenz des Ölproduzenten ebenso wie seine unwiderrufliche Abhängigkeit vom Konzern“, so Rockefeller-Biograf Chernow.
Die mächtige Unternehmensmasse wächst zum Monopol. Anfang der 1880er Jahre kontrolliert die Standard Oil mit ihren Tochterfirmen, inzwischen zusammengefasst in einer Holding mit Sitz am Broadway 26 in New York, rund 90 Prozent des amerikanischen Raffineriegeschäfts. Rockefeller konzentriert fast die gesamte Produktion auf drei riesige Raffinerien, die viel rentabler arbeiteten als die zuvor übliche Vielzahl kleinerer Anlagen. Jahrzehnte später wird der Harvard-Ökonom Alfred D. Chandler zu dem Schluss kommen, dass dieser Schritt die Gewinnspannen noch einmal fast verdoppelt und damit das Fundament gelegt habe für eines der größten Vermögen der Industriegeschichte.
Rockefeller verkauft sein Petroleum bis nach Asien und vor allem nach Europa, auch nach London, wo 1883 ein Mann stirbt, der wenige Jahre zuvor einen Satz sagte, der auf niemanden besser passt als auf den alle Rivalen verdrängenden Rockefeller: „Je ein Kapitalist schlägt viele tot.“ Es ist Karl Marx.
Rockefeller hasst Gewerkschaften und jede Art von Arbeiterbewegung, trotzdem ist er eine Art positiver Marxist. Wie der 20 Jahr ältere deutsche Philosoph glaubt auch er an die Unvermeidbarkeit von immer weiter wachsenden Unternehmen, von Kartellen und Monopolen. Während Marx in den Monsterunternehmen jedoch die Symptome eines siechenden Kapitalismus sieht, hält Rockefeller sie für lebenswichtig. Nur so lasse sich Ordnung in die chaotische Welt des Marktes bringen. Rockefeller, der Freund Gottes und des Geldes, empfindet sich als den Retter der Ölindustrie.
Kein Wunder, dass er nicht recht versteht, weshalb ihm zunehmend Hass entgegenschlägt. Es würde all die kleinen, aus dem Markt gedrängten Ölunternehmer womöglich besänftigen, hätte Rockefeller einfach das bessere Produkt. Doch ihnen bleibt bloß das Gefühl, von einem Riesen ruiniert zu werden, der nicht intelligenter ist, sondern nur stärker. Und vor allem hungriger.
Die Wut schwelt, langsam wächst in Politik und Öffentlichkeit das Gefühl, dass ein freier Markt den Schutz des Gesetzes braucht, um frei zu bleiben. Der Monopolist Rockefeller wird zum Symbol unheimlicher Wirtschaftsmacht. Doch es dauert Jahrzehnte, bis aus dem Gedanken ein Paragraf, bis aus dem Unmut ein Gerichtsverfahren und aus der Anklage ein rechtskräftiges Urteil wird. Erst im Jahr 1911 ordnet der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Zerschlagung von Standard Oil an.
Er verschenkt sechs Milliarden Dollar
Der Riese wird in 34 Teile zerlegt, aus denen Ölkonzerne wie Exxon, Chevron, Mobil und Amoco hervorgehen, aber da hat sich Rockefeller längst aus dem Management zurückgezogen. Hat von außen erlebt, wie die Glühbirne die Petroleumlampe überflüssig macht und wie das Raffineriegeschäft trotzdem weiterlebt, weil fast gleichzeitig das Automobil den Pferdekarren ersetzt. Hat sich ein wenig öfter seiner Frau und seinen fünf Kindern gewidmet, aber nur ein wenig, denn noch immer meidet er den Müßiggang, noch immer ist er viel beschäftigt. Jetzt nicht mehr damit, Geld zu verdienen, sondern es auszugeben.
Der reichste Mann der damaligen Welt wird auch ihr größter Spender. Nicht aus schlechtem Gewissen, wie manche mutmaßen, sondern weil er dies für den Wunsch Gottes hält. Das Geld, das der Herr ihm gab, will er nicht für sich behalten. Rockefeller ermöglicht die Gründung der University of Chicago, er finanziert das modernste medizinische Forschungsinstitut Amerikas, er stiftet Schulen, Museen und Bibliotheken. Insgesamt verschenkt er, nach heutigem Geldwert, sechs Milliarden Dollar.
Für sich und seine Familie hat er nicht ganz so viel übrig, er raucht nicht, trinkt nicht, geht nicht auf Partys und nicht ins Theater, seine Kinder bekommen weniger Taschengeld als ihre Mitschüler, und als der größte Kapitalist aller Zeiten 1937 im Alter von 97 Jahren stirbt, hat er ein Leben gelebt, das sich nicht so sehr von dem eines frommen Bauern aus Ohio unterscheidet. Er ist früh aufgestanden, hat hart gearbeitet, ging gleich danach ins Bett, und am Sonntag war er in der Kirche.
Nur dass er es nicht gern hatte, wenn der Bauer vom Nachbarhof ihm Konkurrenz machte.
DIE ZEIT - 14/2003
"Geldverdienen ist eine Gottesgabe"
John D. Rockefeller erbaute ein Ölimperium. Konkurrenten trieb er in den Ruin, und am Sonntag fegte er die Kirche
Von Wolfgang Uchatius
Die Geschichte des John D. Rockefeller beginnt 303 Jahre vor seiner Geburt, und sie beginnt damit, dass Gott ein Freund des Geldes wird. Oder zumindest, dass die Menschen anfangen, das zu glauben.
Es geschieht im Jahr 1536 nach Christus, und es geschieht in Basel. Der Reformator Johannes Calvin gibt erstmals seine Institutio Christianae religionis, Unterweisung in der christlichen Religion, heraus. Er schreibt von armen Seelen, die von Geburt an für die Hölle bestimmt sind, und von Auserwählten, auf die das Himmelreich wartet. Eine Frage aber bleibt: Woran mag der Mensch erkennen, wozu Gott ihn ausersehen hat?
Calvin stirbt, doch die Calvinisten leben weiter, und sie geben eine Antwort: Gottes Gunst lässt sich am Geld ablesen, am Lohn für die Fleißigen und Sparsamen. Damit ist geschaffen, was der deutsche Soziologe Max Weber später den kapitalistischen Geist nennen wird. Der Reichtum hat den Gestank verloren. Wer im Leben etwas leistet, hat nach dem Tod nichts zu fürchten. Größer könnte der Anreiz zum Arbeiten nicht sein.
Vom Vater zum Sohn, vom Bruder zum Nachbarn – der neue Glaube verbreitet sich über Länder, Ozeane und Jahrhunderte, er erfüllt Handwerker und Kaufleute, Bauern und Fabrikanten und beseelt schließlich einen Mann, der am 8. Juli 1839 in Amerika zur Welt kommt, in einem Städtchen namens Richford im Bundesstaat New York.
Einen Mann, der als kleiner Junge kiloweise Süßigkeiten ersteht und sie mit Gewinn an seine Geschwister weiterverkauft.
Einen Mann, der jedes Jahr seinen „Jobday“ feiert: den Tag, an dem er seine erste Arbeitsstelle antrat.
Einen Mann, der sagt: „Die Gabe, Geld zu verdienen, ist eine Gabe Gottes, ein Pfund, mit dem wir wuchern müssen, so gut wir können.“
Einen Mann, der der reichste Mensch der Welt werden sollte.
Sein Name ist John Davison Rockefeller.
Seine Welt ist der wilde amerikanische Osten, Mitte des 19. Jahrhunderts. Millionen Einwanderer aus aller Welt strömen ins Land und wollen leben. Wo gestern noch Bäume wuchsen, stehen auf einmal Häuser und Fabriken, rollen Fuhrwerke und rattern Dampfmaschinen. Mittendrin: Johns Vater, ein Hausierer, der sich in den Dörfern gelegentlich als Arzt ausgibt und Ahnungslosen allerlei Essenzen als Medizin verkauft. Und Johns Mutter, eine gottesfürchtige Bauerntochter, die ihre Kinder mit Bibel und Birkenrute erzieht.
Das Paar hat vier Söhne und zwei Töchter, aber zu wenig Geld, sie anständig zu kleiden. In der Schule dürfen John und sein Bruder nicht aufs Klassenfoto, ihre Anzüge sind zu schäbig. „Ich erinnere mich nicht, jemals vernachlässigtere Kinder gesehen zu haben“, wird ein ehemaliger Nachbar sagen, viel später, als die halbe Welt „den Rockefeller“ kennt und die Journalisten und Biografen sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit machen.
Sie stellen fest, abgesehen von seiner Kleidung fiel der blasse und humorlose Schüler John den meisten Leuten nicht weiter auf. Seine Leistungen sind nicht überragend, außer in Mathematik. Kopfrechnen kann er wie wenige andere, und insofern ist es nur passend, dass John, inzwischen 16 Jahre alt und mit den Eltern nach Cleveland, Ohio, umgezogen, nach der Highschool eine Stelle als Buchhalter in einem Handelshaus antritt. Am 26. September 1855, dem Jobday.
Er sitzt dann mit Armschonern an seinem Schreibtisch und addiert Zahlen. Überträgt die Ergebnisse. Addiert. Überträgt. Addiert. Überträgt. Erledigt eine Arbeit, die andere Menschen langweilen würde, die ihn jedoch begeistert. „Die Systematik der Geldbeträge“ findet Rockefeller „herrlich“. Schon morgens um halb sieben ist er im Büro, wo er oft die halbe Nacht verbringt, obwohl er die freiwilligen Überstunden nicht bezahlt bekommt. „Arbeit befreite ihn, Arbeit gab ihm eine neue Identität“, wird der Rockefeller-Biograf Ron Chernow später folgern. Nur den Sonntag hält John sich frei. Da feiert er den Gottesdienst, da fegt er die Kirche, führt das Protokoll in den Sitzungen des Pfarrgemeinderates und unterrichtet die Kinder aus der Bibel. Von Anfang an spendet er einen Gutteil seines Einkommens der Kirchengemeinde, lebt anspruchslos und voller Abscheu gegenüber allem Geprasse.
Der amerikanische Bürgerkrieg kurbelt die Geschäfte an
Die Arbeit und der Glaube an Gott sind die Pfeiler in Rockefellers noch jungen Leben und werden es bis zum Ende bleiben, weitere Stützen braucht er nicht, um den Beifall der Menschen kümmert er sich wenig. Der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung wird Rockefeller in einer Vorlesung einmal als einen Menschen bezeichnen, in dessen Bewusstsein nur Platz für ein einziges Wort war: ich.
Dreieinhalb Jahre nach dem ersten Jobday verweigert sein Chef ihm die gewünschte Gehaltserhöhung. Rockefeller glaubt, genug gelernt zu haben, er gibt seine Stelle auf und gründet ein eigenes Handelshaus, gemeinsam mit einem englischen Freund, Maurice Clark.
Die Geschäfte laufen glänzend. Weiterhin strömen die Einwanderer ins Land, Amerika wächst, der beginnende Bürgerkrieg kurbelt die Nachfrage noch an. Die Soldaten und Fabrikarbeiter benötigen Essen, die Bauern brauchen Saatgut. Clark & Rockefeller verkaufen es ihnen. Sie handeln in Ohio mit Bohnen, in Michigan mit Weizen, in Illinois mit Salz und Schweinefleisch, und bald fangen sie an, ein neues Produkt zu verkaufen, das in immer mehr Häusern des Landes die bisher meist mit Walfischtran betriebenen Lampen füllt: Erdöl aus Pennsylvania.
Mit dem Öl verhält es sich in diesen Tagen ähnlich wie Jahrzehnte später mit Computern oder dem Internet: Die einen glauben, es sei von nun an ein anderes Wort für Gold, die anderen fürchten, besonders lange werde sich damit kein Geschäft machen lassen. Auch Rockefeller zweifelt zunächst, doch dann kaufen er und Clark eine kleine Raffinerie, und da sie Gewinn abwirft, nimmt Rockefeller einen Kredit nach dem anderen auf, um das Ölgeschäft zu erweitern. Die Raffinerie wächst und wächst. Als Clark ob der schnellen Expansion Bedenken anmeldet, kommt es zum Bruch. Die Firma wird aufgelöst und zur Auktion angeboten. Sowohl Clark als auch Rockefeller beschließen, das Unternehmen zu ersteigern.
So kommt es, dass Anfang Februar 1865, an einem der letzten Tage des amerikanischen Bürgerkriegs, in einem kargen Büroraum in Cleveland zwei gegensätzliche junge Männer ihre finanziellen Kräfte messen. Der eine, Clark, fürchtet das unternehmerische Risiko, gibt sich privat aber gern pompös. Der andere, Rockefeller, hebt jede Paketschnur und jedes Stück Packpapier auf, aber wenn er einmal an eine Geschäftsidee glaubt, scheut er keine Gefahr. Clark nennt ihn den „größten Schuldenmacher, dem ich je begegnet bin“. Dieser asketische Erzkapitalist pariert ungerührt jedes Gebot seines Gegners mit einem höheren Betrag, sagt schließlich „72500 Dollar!“ – und hat gewonnen. Clark gibt auf, Rockefeller ist Herr über die bei weitem größte Raffinerie der Stadt. Später wird er sagen: „Ich verweise immer auf diesen Tag als den Anfang des Erfolges, den ich im Leben hatte.“
Es hätte leicht auch der erste Tag seines Untergangs sein können. Zwar wächst auch nach Ende des Bürgerkriegs der Hunger nach Öl. Immer mehr Lampen benötigen Leuchtstoff, immer mehr Maschinen brauchen Schmiermittel. „Statt der Baumwolle regiert jetzt das Öl die Welt des Handels“, schreibt 1865 der amerikanische Kongressabgeordnete James Garfield.
Aber auch immer mehr Menschen wollen mit dem in Pennsylvania geförderten Öl Geld verdienen. Ob Cleveland, Pittsburgh, New York, Philadelphia oder Boston – überall stehen die Raffinerien, und bald sind es zu viele. Da sich das von ihnen hergestellte Petroleum und Schmieröl kaum unterscheidet, können sie miteinander nur über den Preis konkurrieren. Wer am kostengünstigsten produziert, gewinnt.
Der Gewinner heißt Rockefeller. Anders als Gottfried Daimler, der Erfinder des Automobils, entwickelt er kein neues Produkt. Anders als Henry Ford, der Vater des Fließbands, entdeckt er kein neues Produktionsverfahren. Worauf Rockefeller baut, ist so banal wie revolutionär. Es ist die Macht der Masse. Mit seinem neuen Partner Henry Flagler, einem ehemaligen Salzfabrikanten, gründet er die Standard Oil Company, die erste Erdölgesellschaft der Vereinigten Staaten. Als eines der ersten Industrieunternehmen der Geschichte macht sich Standard Oil im großen Stil zunutze, was heute zum Grundwissen jedes Betriebswirtschaftlers gehört: die Economies of Scale, die Vorteile der Größe.
Rockefeller kauft Wälder und Dampfschiffe, er produziert eigene Ölfässer und verfrachtet sie selbst über die Kanäle und Seen, um sich nicht mehr von plötzlich steigenden Holz- oder Transportpreisen die Gewinnmargen verkleinern zu lassen. Er arbeitet mit Strohmännern und Spionen, kauft konkurrierende Raffinerien auf, legt einige still, legt andere zusammen. Er erhöht die Produktion, senkt dadurch zuerst die Stückkosten und dann die Preise, wodurch er weitere Rivalen zur Aufgabe und zum Verkauf zwingt. Innerhalb eines Jahres übernimmt Standard Oil allein in Cleveland 22 seiner 26 Konkurrenten.
Die riesigen Mengen an Öl, über die Rockefeller bald befiehlt, machen ihn zum begehrten Verhandlungspartner der Eisenbahngesellschaften, die sich darum reißen, das Öl Amerikas zu transportieren. Nur Rockefeller kann garantieren, ihre Züge zu füllen, und so muss sich im April 1868 der ergraute Eisenbahn-Magnat Cornelius Vanderbildt, genannt der Commodore, in das Büro dieses 29-jährigen gefühlskalten Emporkömmlings begeben, um ihn zum Vertragsabschluss zu bewegen. Rockefeller schlägt ein, die Eisenbahn gewährt ihm großzügigen Rabatt, was er dazu nützt, die Preise weiter zu senken und weitere Konkurrenten „zum Schwitzen zu bringen“, wie er sagt.
Wenige Jahre später hat sich das Spielfeld verändert, Öl wird jetzt in Pipelines quer durchs Land befördert, die wichtigste Spielregel aber ist immer noch dieselbe: Der Größte gewinnt. Rockefeller kauft ganze Landstriche auf, damit die Konkurrenz dort keine Rohre verlegen kann, und überzieht den Westen Pennsylvanias mit einem riesigen eigenen Pipeline-Netz. „Sobald ein Ölsucher auf Öl stieß, war Standard Oil da, um seine Quellen anzuschließen – das sicherte die Existenz des Ölproduzenten ebenso wie seine unwiderrufliche Abhängigkeit vom Konzern“, so Rockefeller-Biograf Chernow.
Die mächtige Unternehmensmasse wächst zum Monopol. Anfang der 1880er Jahre kontrolliert die Standard Oil mit ihren Tochterfirmen, inzwischen zusammengefasst in einer Holding mit Sitz am Broadway 26 in New York, rund 90 Prozent des amerikanischen Raffineriegeschäfts. Rockefeller konzentriert fast die gesamte Produktion auf drei riesige Raffinerien, die viel rentabler arbeiteten als die zuvor übliche Vielzahl kleinerer Anlagen. Jahrzehnte später wird der Harvard-Ökonom Alfred D. Chandler zu dem Schluss kommen, dass dieser Schritt die Gewinnspannen noch einmal fast verdoppelt und damit das Fundament gelegt habe für eines der größten Vermögen der Industriegeschichte.
Rockefeller verkauft sein Petroleum bis nach Asien und vor allem nach Europa, auch nach London, wo 1883 ein Mann stirbt, der wenige Jahre zuvor einen Satz sagte, der auf niemanden besser passt als auf den alle Rivalen verdrängenden Rockefeller: „Je ein Kapitalist schlägt viele tot.“ Es ist Karl Marx.
Rockefeller hasst Gewerkschaften und jede Art von Arbeiterbewegung, trotzdem ist er eine Art positiver Marxist. Wie der 20 Jahr ältere deutsche Philosoph glaubt auch er an die Unvermeidbarkeit von immer weiter wachsenden Unternehmen, von Kartellen und Monopolen. Während Marx in den Monsterunternehmen jedoch die Symptome eines siechenden Kapitalismus sieht, hält Rockefeller sie für lebenswichtig. Nur so lasse sich Ordnung in die chaotische Welt des Marktes bringen. Rockefeller, der Freund Gottes und des Geldes, empfindet sich als den Retter der Ölindustrie.
Kein Wunder, dass er nicht recht versteht, weshalb ihm zunehmend Hass entgegenschlägt. Es würde all die kleinen, aus dem Markt gedrängten Ölunternehmer womöglich besänftigen, hätte Rockefeller einfach das bessere Produkt. Doch ihnen bleibt bloß das Gefühl, von einem Riesen ruiniert zu werden, der nicht intelligenter ist, sondern nur stärker. Und vor allem hungriger.
Die Wut schwelt, langsam wächst in Politik und Öffentlichkeit das Gefühl, dass ein freier Markt den Schutz des Gesetzes braucht, um frei zu bleiben. Der Monopolist Rockefeller wird zum Symbol unheimlicher Wirtschaftsmacht. Doch es dauert Jahrzehnte, bis aus dem Gedanken ein Paragraf, bis aus dem Unmut ein Gerichtsverfahren und aus der Anklage ein rechtskräftiges Urteil wird. Erst im Jahr 1911 ordnet der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Zerschlagung von Standard Oil an.
Er verschenkt sechs Milliarden Dollar
Der Riese wird in 34 Teile zerlegt, aus denen Ölkonzerne wie Exxon, Chevron, Mobil und Amoco hervorgehen, aber da hat sich Rockefeller längst aus dem Management zurückgezogen. Hat von außen erlebt, wie die Glühbirne die Petroleumlampe überflüssig macht und wie das Raffineriegeschäft trotzdem weiterlebt, weil fast gleichzeitig das Automobil den Pferdekarren ersetzt. Hat sich ein wenig öfter seiner Frau und seinen fünf Kindern gewidmet, aber nur ein wenig, denn noch immer meidet er den Müßiggang, noch immer ist er viel beschäftigt. Jetzt nicht mehr damit, Geld zu verdienen, sondern es auszugeben.
Der reichste Mann der damaligen Welt wird auch ihr größter Spender. Nicht aus schlechtem Gewissen, wie manche mutmaßen, sondern weil er dies für den Wunsch Gottes hält. Das Geld, das der Herr ihm gab, will er nicht für sich behalten. Rockefeller ermöglicht die Gründung der University of Chicago, er finanziert das modernste medizinische Forschungsinstitut Amerikas, er stiftet Schulen, Museen und Bibliotheken. Insgesamt verschenkt er, nach heutigem Geldwert, sechs Milliarden Dollar.
Für sich und seine Familie hat er nicht ganz so viel übrig, er raucht nicht, trinkt nicht, geht nicht auf Partys und nicht ins Theater, seine Kinder bekommen weniger Taschengeld als ihre Mitschüler, und als der größte Kapitalist aller Zeiten 1937 im Alter von 97 Jahren stirbt, hat er ein Leben gelebt, das sich nicht so sehr von dem eines frommen Bauern aus Ohio unterscheidet. Er ist früh aufgestanden, hat hart gearbeitet, ging gleich danach ins Bett, und am Sonntag war er in der Kirche.
Nur dass er es nicht gern hatte, wenn der Bauer vom Nachbarhof ihm Konkurrenz machte.
DIE ZEIT - 14/2003
.
...ich hatte ja schon alle Hoffnung fahren lassen, aber nun hat die alte Tante ja doch noch die Kurve gekriegt:
Newmont profit shines on higher gold prices
Year-end results beat estimates; CEO sees continued growth in 2003
Higher gold prices and stronger sales helped gold giant Newmont Mining Corp. beat analysts` year-end profit forecasts and prompted its top brass to forecast still stronger earnings this year.
"With continued strength in the gold market, 2003 should be another exciting year for the company with strong bottom-line earnings growth," said Wayne Murdy, chairman and chief executive officer yesterday.
Newmont`s stock shot up $3.24, or 9 per cent, to $39.21 on the Toronto Stock Exchange yesterday.
Company president Pierre Lassonde said the roughly $50-(U.S.)-an-ounce decline in the gold price since the start of the invasion of Iraq shouldn`t discourage investors.
"The Iraq war has become a weapon of mass financial distraction," he said.
"The fact is that the fundamentals for the bullish case for gold are tied to the fate of the U.S. dollar. And that trend will reassert itself with renewed vigour once the sideshow is over."
Denver-based Newmont, which completed its takeover of Normandy Mining Ltd. in Australia and Franco-Nevada Mining Corp. in Canada this year, reported a 2002 profit of $154.3-million or 42 cents a share, compared with a 2001 loss of $54.1-million or 28 cents.
Fourth-quarter profit was $75.1-million or 19 cents a share, compared with year-earlier profit of $18.4-million or 10 cents. The most recent results improved, despite a 3-per-cent rise in costs over the year because of the higher Australian dollar and rising energy prices.
Newmont said it will restate its previously reported quarterly statements for 2002 and 2001 after a reaudit by PricewaterhouseCoopers, which it hired last May to replace its previous auditor, Arthur Andersen.
The main area of concern was the accounting for prepaid forward contracts and depreciation calculations from 1999 and 2001, said spokesman Doug Hock. Newmont reported yesterday that the effect of the restatements for 1999 to 2001 was an increase in stockholders` equity of $19.7-million as of the end of 2001.
A concern among analysts was an investigation by U.S. regulators into the accounting of its Normandy and Franco-Nevada acquisitions that used a new purchase price method for the takeovers.
Newmont said it has completed its discussions with the Securities and Exchange Commission and that regulators have decided not take any action.
The company added that its latest profit was helped by the strong price of gold, which hovered around $328 an ounce in the fourth quarter. If all other costs and factors remained constant, a $1 increase in the gold price raises Newmont earnings by 1 cent a share, Mr. Murdy said.
He also noted that Newmont had acquired a "sizable" hedging position with the acquisition of Normandy that it has since worked to reduce. In 2002, it whittled down its committed hedged position to 5.1 million ounces, from 9 million, and has since reduced it further to 3.9 million.
For 2003, Newmont predicts equity gold sales of 7.0 million to 7.2 million ounces, down from 7.6 million in 2002, at a total cash cost of $193 to $200 an ounce. This would compare with $189 an ounce in 2002.
By GUY DIXON / The Globe and Mail / 29.03.2003
...ich hatte ja schon alle Hoffnung fahren lassen, aber nun hat die alte Tante ja doch noch die Kurve gekriegt:

Newmont profit shines on higher gold prices
Year-end results beat estimates; CEO sees continued growth in 2003
Higher gold prices and stronger sales helped gold giant Newmont Mining Corp. beat analysts` year-end profit forecasts and prompted its top brass to forecast still stronger earnings this year.
"With continued strength in the gold market, 2003 should be another exciting year for the company with strong bottom-line earnings growth," said Wayne Murdy, chairman and chief executive officer yesterday.
Newmont`s stock shot up $3.24, or 9 per cent, to $39.21 on the Toronto Stock Exchange yesterday.
Company president Pierre Lassonde said the roughly $50-(U.S.)-an-ounce decline in the gold price since the start of the invasion of Iraq shouldn`t discourage investors.
"The Iraq war has become a weapon of mass financial distraction," he said.
"The fact is that the fundamentals for the bullish case for gold are tied to the fate of the U.S. dollar. And that trend will reassert itself with renewed vigour once the sideshow is over."
Denver-based Newmont, which completed its takeover of Normandy Mining Ltd. in Australia and Franco-Nevada Mining Corp. in Canada this year, reported a 2002 profit of $154.3-million or 42 cents a share, compared with a 2001 loss of $54.1-million or 28 cents.
Fourth-quarter profit was $75.1-million or 19 cents a share, compared with year-earlier profit of $18.4-million or 10 cents. The most recent results improved, despite a 3-per-cent rise in costs over the year because of the higher Australian dollar and rising energy prices.
Newmont said it will restate its previously reported quarterly statements for 2002 and 2001 after a reaudit by PricewaterhouseCoopers, which it hired last May to replace its previous auditor, Arthur Andersen.
The main area of concern was the accounting for prepaid forward contracts and depreciation calculations from 1999 and 2001, said spokesman Doug Hock. Newmont reported yesterday that the effect of the restatements for 1999 to 2001 was an increase in stockholders` equity of $19.7-million as of the end of 2001.
A concern among analysts was an investigation by U.S. regulators into the accounting of its Normandy and Franco-Nevada acquisitions that used a new purchase price method for the takeovers.
Newmont said it has completed its discussions with the Securities and Exchange Commission and that regulators have decided not take any action.
The company added that its latest profit was helped by the strong price of gold, which hovered around $328 an ounce in the fourth quarter. If all other costs and factors remained constant, a $1 increase in the gold price raises Newmont earnings by 1 cent a share, Mr. Murdy said.
He also noted that Newmont had acquired a "sizable" hedging position with the acquisition of Normandy that it has since worked to reduce. In 2002, it whittled down its committed hedged position to 5.1 million ounces, from 9 million, and has since reduced it further to 3.9 million.
For 2003, Newmont predicts equity gold sales of 7.0 million to 7.2 million ounces, down from 7.6 million in 2002, at a total cash cost of $193 to $200 an ounce. This would compare with $189 an ounce in 2002.
By GUY DIXON / The Globe and Mail / 29.03.2003
.
"Die Börse wird immer politischer"
Von Christian Buchholz und Andreas Nölting
Makroökonomische Überlegungen funktionieren in Friedenszeiten. In diesen Tagen sind sie obsolet - der Krieg bestimmt die Kurse. Axa-Chefstratege Franz Wenzel spricht im Interview mit manager-magazin.de über den folgenschweren Paradigmenwechsel.
mm.de: Aus Empörung über Frankreichs Haltung zum Krieg wollen mehrere US-Pensionsfonds ihre französischen Aktien aus dem Portfolio werfen. Verkaufen die Axa-Fonds im Gegenzug ihre US-Aktien?
Wenzel: Nein. Wir handeln Aktien auf Grund fundamentaler Entscheidungen. Dabei spielen politische Aspekte zwar eine immer bedeutendere Rolle - es liegt uns aber fern, politische Signale zu setzen. Da gibt es in unserem Geschäft keine Ressentiments. Innenpolitisch erntet Jacques Chirac übrigens durch seine konsequente Haltung gerade viel Symphatie: Immer mehr Franzosen sind, und das passiert nicht häufig, wieder stolz auf ihren Präsidenten.
mm.de: Auf welchem Irak-Szenario basiert Ihre Investmentstrategie?
Wenzel: Der Krieg kann gewonnen werden. Aber die Gefahr von Terror-Anschlägen wird man auch in der Folgezeit nicht in den Griff bekommen. Daher gehe ich davon aus, dass es in der Zeit nach der Entmachtung von Saddam Hussein auch keine "Friedens-Dividende" an den Weltbörsen geben wird. Zweitens werden auch die Volatilitäten [Kursschwankungen] an den Aktien- und Rentenmärkten höher sein als in den vergangenen Jahrzehnten.
mm.de: Der Frieden wird sicher nicht übermorgen im Irak einkehren. Im Moment ziehen die Börsen an, wenn die US-Truppen ein paar Kilometer näher an Bagdad herankommen - und drehen abrupt nach unten, sobald der Vormarsch stockt.
Wenzel: Das stimmt. Makroökonomische Überlegungen und Bewertungsmodelle, die in Friedenszeiten funktionieren - das Rüstzeug des Ökonomen - sind in diesen Tagen obsolet. Der Krieg bestimmt die Kurse - und er wird noch zwei bis drei Monate andauern. Trotzdem lassen wir die Aktienquote unserer Fonds von im Schnitt 55 Prozent - bei 40 Prozent Rententiteln und fünf Prozent Liquidität - unverändert. Den Aktien-Anteil in den Portfolios haben wir im vergangenen September gesenkt, nachdem klar wurde, dass Bush den Militärschlag führen will. Heute halten wir die Gewichtung in der Annahme, dass die Weltkonjunktur sich am Ende des Krieges etwas dynamischer entwickelt.
mm.de: Früher galt die Börsenweisheit, dass politische Börsen kurze Beine haben - für Langfristanleger vernachlässigbar. Jetzt scheint der Einfluss der Politik auf die Aktienmärkte stark zu steigen.
Wenzel: Das ist eindeutig ein Trend. Auch wenn man vom Aktien-Research keine tagesaktuellen Politik-Prognosen erwarten kann - wir nutzen die Berichte der wenigen guten politischen Analysten heute stärker als je zuvor. Das wird aufgrund politischer Unwägbarkeiten auch nach dem Krieg noch lange so bleiben.
mm.de: Worauf werden die politischen Analysten ihr Hauptaugenmerk richten?
Wenzel: Vermutlich auf die Entwicklung des Terrors in der Welt. Leider sind auch künftig Anschläge zu erwarten, die - wenn auch nur kurzfristig - die Börsenkurse erschüttern. Auf solche Situationen sollte jeder Fondsmanager vorbereitet sein.
mm.de: Wo stufen Sie den US-Markt in der Ländergewichtung ein?
Wenzel: Hinter den meisten asiatischen Staaten, die mit einem stabilen Wirtschaftswachstum glänzen, aber deutlich vor Japan und Europa. Die KGV-Bewertung des US-Leitindex S&P 500 liegt bei etwa 16 und damit nur knapp über der des Dax. Aber die Aussichten für eine Konjunktur-Erholung nach dem Krieg im Irak sind für die USA deutlich besser als hierzulande. Ein Minuspunkt für den Aktienmarkt Europa ist zudem, dass er über keine nennenswerte Eigendynamik verfügt. Für uns ist es ein "High-Beta"-Markt, also hochriskant, der die Entwicklung von Dow Jones und S&P 500 nicht einfach spiegelt, sondern die Kursschwankungen mit höheren Ausschlägen nachvollzieht.
mm.de: Ein höherer Ausschlag nach oben wäre ja nicht verkehrt…
Wenzel: …nur leider haben wir in den vergangenen Monaten Übertreibungen meist lediglich in eine Richtung gesehen: Nach unten. Ein Grund für die Skepsis der Investoren gegenüber Europa ist die Führungslosigkeit des Staatenbunds. Die politische Stabilität und das Wirtschaftswachstum lassen zu wünschen übrig. Um eine Zahl zu nennen: Für 2002 hatte eine Experten-Mehrheit eine Steigerung beim Wachstum der Unternehmensgewinne von 20 Prozent erwartet. Tatsächlich gab es ein Minus von fünf Prozent. Solch eine Enttäuschung wirkt nach.
mm.de: Die EU-Zentrale in Brüssel gewinnt doch zunehmend an Einfluss.
Wenzel: Nun ja, die Tätigkeiten einer regulierenden Behörde beinhalten nicht unbedingt das Entwerfen von Visionen. Meine These ist, dass man während der Regierungszeit von Helmut Kohl und François Mitterand der Region Europa wesentlich mehr Entwicklungspotenzial zugetraut hat als heute.
mm.de: Wenn die Maastricht-Kriterien greifen, kann Europa aber beispielsweise nicht mehr, wie es Kritiker für die USA befürchten, in eine Schuldenfalle geraten.
Wenzel: In der Theorie sollen Verschuldungsquoten von mehr als drei Prozent in den europäischen Staaten zwar bald Geschichte sein. Ich halte diese starre Regelung aber für unklug, sie sollte auf Eis gelegt werden. Sie hemmt die Möglichkeiten einer Nachfragepolitik.
mm.de: Sie plädieren jetzt für Deficit Spending, wie es von Maynard Keynes propagiert wurde?
Wenzel: In den 70er Jahren hatte Europa bereits einmal mit Stagflation* zu kämpfen - und wir könnten wieder in diese Sackgasse laufen. Wenn die EU-Reglementierungen ausufern, könnte der Kampf gegen die Deflation ein schlechtes Ende nehmen. Dieser Ballon sollte nicht noch weiter aufgeblasen werden.
mm.de: Die US-Regierung ist hingegen bereit ein Defizit im Staatshaushalt von nie dagewesenen 400 Milliarden Dollar in Kauf zu nehmen…
Wenzel: …außerdem ist der Einfluss von Notenbank-Präsident Alan Greenspan auf die Wirtschaftsentwicklung gesunken, die Geldpolitik wird impotenter. Unter dem Strich sehe ich in den USA trotzdem die Ausgangsbasis für eine Konjunkturerholung. Meine Prognose ist, dass hier in der zweiten Jahreshälfte ein Wirtschaftswachstum von drei bis dreieinhalb Prozent gelingen kann; auch, weil die Lagerbestände niedrig sind. In Europa stehen die Vorzeichen ungünstiger. Für 2003 erwarte ich ein Gewinnwachstum bei den US-Unternehmen von zehn Prozent - und in Europa höchstens die Hälfte.
mm.de: Ihre bevorzugte Anlageregion Asien könnte auch leiden - und zwar wenn die USA nach der Eroberung Iraks mehr Einfluss auf den Ölpreis gewinnen. Stockt der Aufschwung in Asien, wenn der Preis des Wirtschafts-Schmiermittels steigt?
Wenzel: Eindeutig ja. In zehn Jahren etwa wird China den vierfachen Erdöl-Bedarf haben wie heute. Der Ölpreis ist also ein wichtiges Stellrad für die Entwicklung - es ist aber nicht groß genug, um den Aufschwung anzuhalten.
mm.de: Welche Branche werden von dem möglichen Aufschwung besonders profitieren?
Wenzel: Versorger- und Energietitel sind im Moment besonders aussichtsreich. Ein fallender Ölpreis könnte die Kurse von Energietiteln zwar belasten - auf der Guthaben-Seite werden den Aktionären in dem Segment aber Dividendenrenditen von fünf, sechs Prozent geboten. Deutlich weniger oder gar keine Dividende bietet die Telekom-Branche. Aber hier werden attraktive Cashflows generiert - hier gibt es Kaufgelegenheiten.
In Food-Titel, eine defensive Branche, investiert Axa derzeit, ausserdem bauen wir Posititonen in Investitionsgüter- und Industriewerten auf. Abzuraten ist von Finanztiteln, insbesondere von deutschen. Die Restrukturierung hat bei weitem noch nicht das erforderliche Tempo aufgenommen. Die aufgeregte Diskussionen um eine Bad Bank mit Staatsbürgschaften spricht Bände über die Schieflage der Branche.
Franz Wenzel ist Chefaktienstratege von Axa Investment Managers, einer Tochter des zweitgrößten Versicherers in Europa, Axa. Gemeinsam mit der US-Tochter des französischen Konzerns, Alliance Capital, werden in den Fonds-Depots der Gruppe weltweit rund 742 Milliarden Euro verwaltet.
manager-magazin.de, 31.03.2003
Irak-Krieg hinterlässt erste Spuren in der Wirtschaft
Von Sebastian Dullien und Thomas Fricke, Berlin
In den ersten Kriegstagen herrschte noch Zuversicht unter den Auguren. Von den ökonomischen Szenarien, die in den Monaten zuvor entwickelt worden waren, schienen jene einzutreffen, die auf schnelle militärische Erfolge und rasche Besserung bei Aktien, Ölpreisen, Wechselkursen und wirtschaftlichen Stimmungswerten gesetzt hatten.
Doch die Entwicklungen der letzten Tage lassen an diesen optimistischen Prognosen zweifeln. Der Vormarsch der Alliierten stockte, die USA müssen Verstärkung einfliegen, Fernsehbilder zeigen Tumulte überall in der arabischen Welt. Nach dem ersten Selbstmordattentat auf einen US-Checkpoint deutet noch wenig darauf hin, dass die USA Irak problemlos besetzen und befrieden können. Jetzt berechnen nicht nur die Militärs neue, ernüchterndere Szenarien, sondern auch die Ökonomen. Die Angst vor der Rezession geht um.
An warnenden Stimmen mangelt es plötzlich nicht mehr. "Der Optimismus der Märkte zum Kriegsbeginn war naiv", sagt Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Die Besetzung und Befriedung Iraks werde viel schwerer, als es einige gehofft hätten. Die EU-Kommission wird in Kürze eine deutlich revidierte Wachstumsprognose abgeben. Und Horst Köhler, Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), räumte ein, bei einem längeren Krieg sei eine globale Rezession nicht auszuschließen.
Noch am ersten Kriegswochenende beteuerte Frankreichs Finanzminister Francis Mer: "Der Großteil der negativen wirtschaftlichen Konsequenzen der Irak-Krise ist hinter uns." Gestern polterte Mers Chef, Premier Jean-Pierre Raffarin, der Krieg trage eine Mitschuld daran, dass Frankreichs Wirtschaft derzeit den schlimmsten konjunkturellen Absturz der jüngeren Geschichte erlebe. Folgt der naiven Zuversicht jetzt eine ebenso voreilige Panik? Oder sind die Sorgen berechtigt?
Revidierte Prognose
Fest steht, dass zumindest die günstigsten Szenarien überholt sind. "Nicht erfüllt" habe sich die Annahme, dass die Irak-Krise "bis zum Frühjahr überwunden" sei, gestehen die Ökonomen der Commerzbank ein. Ihre Prognose für das deutsche Wachstum revidierten sie für 2003 von 0,75 auf 0,5 Prozent. Begründung: Die negativen Kriegswirkungen würden "länger spürbar bleiben und die Weltwirtschaft auch im zweiten Quartal beeinträchtigen".
Überholt scheint auch das viel zitierte Best-Case-Szenario des renommierten amerikanischen Center for Strategic and International Studies (CSIS), dem Fachleute eine Wahrscheinlichkeit von 40 bis 60 Prozent zugebilligt hatten. Demnach müsste der Konflikt nach insgesamt vier bis sechs Wochen ohne große Widerstände vollständig beendet sein. Das wird immer unwahrscheinlicher. Damit schwindet aber auch die Hoffnung, dass sich aus Erleichterung die Finanzmärkte rasch erholen, der Ölpreis stark fällt und weltweit schon ab Jahresmitte ein kräftiger Aufschwung beginnt.
Wie schnell der Krieg je nach Verlauf ganz unmittelbar hiesige Firmen und Verbraucher belasten kann, zeigt das Auf und Ab an den Ölmärkten. Nach dem Bush-Ultimatum an Saddam Hussein und in den ersten Kriegstagen fiel der Ölpreis von mehr als 30 auf knapp 25 $ je Barrel - jetzt steuert er wieder auf die 30-$-Marke zu. Das kostet Wachstum.
Zurückhaltung bei Firmen
Mindestens so gefährlich ist nach Ansicht von Experten die kriegsbedingte Unsicherheit über die nahe wirtschaftliche Zukunft. "Wenn Firmen nicht wissen, wie sich Wechselkurs, Ölpreis und Welthandel entwickeln, halten sie sich mit Investitionen erstmal zurück", sagt Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise.
Erste Spuren sind davon bereits erkennbar. "Wir wissen, dass die Firmen für dieses Jahr bereits umfangreiche Investitionspläne ausgearbeitet hatten", sagt Gernot Nerb vom Ifo-Institut in München. Die Pläne würden aber derzeit nicht verwirklicht, sondern aufgeschoben. Aufträge für Maschinen, Gebäude und Ausrüstung bleiben aus. Das Geschäftsklima in den deutschen Firmen war laut Ifo im März deutlich schlechter als noch im Februar.
Ähnliches scheint für die Verbraucher zu gelten. Die Angst vor Arbeitslosigkeit steigt, die Menschen schieben Anschaffungen auf. "Das setzt eine negative Kettenreaktion in Gang", sagt Rolf Bürkl, Forscher bei der GfK Konsumforschung. Der Konsumklimaindex für März lag ebenfalls unter Vormonat.
Schwierige Zeiten
"Wir spüren Zurückhaltung - auch auf unseren Hauptmärkten in Europa. Wir haben uns auf schwierige Zeiten einzustellen", sagt Volkswagen-Personalvorstand Peter Hartz. Auch Nissan-Chef Carlos Ghosn verkündete, er rechne damit, dass die Nachfrage nach Autos in den USA und Europa wegen des Kriegs zurückgehe.
Besonders hart getroffen sind Fluggesellschaften und die Tourismusindustrie. Die US-Airlines verzeichnen nach Angaben der Air Transport Association (ATA) wegen des Kriegs Buchungsrückgänge um 20 Prozent. International liege das Minus in einigen Regionen sogar bei 40 Prozent, so ATA-Präsident James May. In der US-Regierung wird bereits über Hilfspakete für Not leidende Airlines diskutiert.
Je länger der Krieg dauert, desto größer werden auch die Kosten für den US-Staatshaushalt. Der stattliche Nachtragshaushalt von 75 Mrd. $, den George W. Bush vergangene Woche für die Kriegs- und Wiederaufbaukosten vorlegte, reicht nur bis September. Experten rechnen damit, dass selbst bei relativ günstigem Kriegsverlauf mindestens 25 Mrd. $ hinzukommen. Immer deutlicher wird, dass das US-Staatsdefizit 2003 auf rund 400 Mrd. $ oder fast vier Prozent der Wirtschaftsleistung steigen wird - mehr als der Maastricht-Vertrag den Europäern erlaubt.
Kapitalströme können kippen
"Wenn der Eindruck entsteht, die USA leben über ihre Verhältnisse, könnten die Investoren das Vertrauen verlieren", sagt Michael Heise von der Allianz. "Sollte sich der Krieg über ein halbes Jahr hinziehen und mit entsprechend höheren Staatsausgaben einhergehen, könnten die Kapitalströme kippen", warnt auch Rudolf Besch von der Deka-Bank. Dann fiele eine weitere wichtige Stütze für den US-Dollar. Die Währung droht abzustürzen, die Zinsen würden in die Höhe schnellen, so Heise.
Noch muss nach Einschätzung der meisten Experten all das nicht bedeuten, dass der Krieg in die Rezession führt. Gute Chancen gibt es noch, dass der ganz große Ölpreisschock ausbleibt - wenn es gelingt, größere Zerstörungen an den Ölfeldern der Region wie bislang zu verhindern. Als wenig wahrscheinlich gilt mittlerweile aber eine Annahme aus dem Best-Case-Szenario des CSIS: dass die globale Unsicherheit völlig verschwindet, sobald der Krieg in Irak - wann und wie auch immer - vorüber ist.
"Die Iraker sind nicht begeistert über die Befreiung durch die USA", sagt Deutsche-Bank-Ökonom Walter. Das mache es schwierig, Frieden zu schaffen. Ähnlich sieht es der renommierte US-Ökonom David Hale: "Anders als 1991 geht es diesmal nicht darum, dass die USA ein kleines Land befreien. Die Lösung des Konflikts wird weit weniger eindeutig ausfallen."
"Die Angst vor Terror wird nach Ende des Irak-Kriegs bleiben", sagt Thomas Hueck von der HypoVereinsbank. "Ein einziger Anschlag etwa in einem Einkaufszentrum würde US-Verbrauchervertrauen und Konsum sofort einbrechen lassen", so der Ökonom. David Hale geht noch weiter. Auf Grund der neuen unilateralen Militärdoktrin der USA sei bald ein neuer Krieg absehbar, etwa gegen Nordkorea. "Die Märkte müssen sich auf das Risiko von mindestens zwei Kriegen einstellen", so Hale - mit entsprechenden Folgen für die Weltwirtschaft.
FTD - 1.4.2003
Edelmetalle: Beim Gold gibt der Krieg den Takt vor
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Nachdem zuletzt immer deutlicher wurde, dass der Irak-Krieg länger als von vielen vermutet dauern würde, testete Gold mehrfach die Marke von 334 $ je Unze. Unterstützung ging hierbei auch von physischer Nachfrage aus, die zwischen 325 und 330 $ pro Unze eingesetzt hatte.
Die Umsätze waren dann jedoch zu gering, um einen anhaltenden Aufwärtstrend zu begründen. Auch in den kommenden Tagen wird der Handel eher durch kurzfristige Entwicklungen getrieben werden, insbesondere durch die Ereignisse am Persischen Golf. Große Positionen werden dabei vermutlich nicht bewegt. Spekulative Verkäufe könnten rasch auf Produzenten treffen, die ihre Absicherungspositionen reduzieren und somit Unterstützung bieten. Dies gilt auch für die physische Nachfrage, die auf dem derzeit erreichten Niveau wieder angesprungen ist.
Am Mittwoch meldete sich die Bundesbank zum Thema Gold zu Wort, genauer zum Goldabkommen der europäischen Zentralbanken: "Ob es zu einem weiteren Goldabkommen kommen wird, ist offen", sagte Bundesbankpräsident Ernst Welteke. Marktbeobachter gehen aber fest von einer Neuauflage aus, da ein Verzicht den Goldmarkt unnötig unter Druck bringen würde. Dies, so die Analysten, könnte schließlich auch nicht im Interesse der Zentralbanken sein, die ja noch immer ein Viertel der weltweiten Goldvorräte in ihren Tresoren bunkern.
Pluspositionen durch Hedge Funds aufgelöst
Silber pendelte um die psychologisch wichtige Marke von 4,40 $ je Unze. Das Marktgeschehen ist abhängig von den Entwicklungen beim Gold. Der Auflösung von Pluspositionen durch Hedge Funds steht industrielles Kaufinteresse sowie eine leichte Investorennachfrage gegenüber.
Deutlich verloren haben in der vergangenen Woche die Platinmetalle. Palladium, notierte am Dienstag mit 183 $ pro Unze so tief wie im Dezember 1997. Hinter den Verkäufen steckten Fonds, die ihre Pluspositionen auflösten. Industrielle Nachfrage verhinderte ein weiteres Abgleiten der Preise. Der Angebotsüberhang bei gleichzeitig sinkender Nachfrage macht nach Ansicht von Marktbeobachtern eine schnelle Erholung aber unwahrscheinlich.
Verkaufsdruck bei Platin-Fonds
Auch beim Platin standen unmittelbar vor dem Ende des japanischen Steuerjahres Fonds auf der Verkäuferseite. Zu Wochenbeginn konnten andere Marktteilnehmer diese Abgaben noch auffangen. Auch industrielle Nachfrage stützte das Metall zunächst und verhinderte ein Abrutschen des Preises. Zum Wochenschluss nahm der Verkaufsdruck jedoch überhand. Der Platinpreis gab deutlich nach und notierte mit 623 $ je Unze zeitweise auf einem Zwei-Monats-Tief.
Die weitere Entwicklung, so Analysten, hängt nun nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Eine Erholung dürfte die industrielle Nachfrage weiter stärken. Im Zuge eines längeren Irak-Konflikts bestehe außerdem die Möglichkeit, dass Investoren wieder verstärkt einsteigen.
Wolfgang Wrzesniok-Rossbach leitet den Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt.
Aus der FTD vom 31.3.2003
siehe auch Beitrag #24 imThread: Weltweite Goldnachfrage erneut gesunken !
Im Club der Autisten
Von Thomas Fricke
Der Irak-Konflikt hat die westliche Welt politisch entzweit. Noch folgenschwerer könnte aber sein, dass Notenbanken und Regierungen ziemlich chaotisch und uneins auf die ökonomische Risikolage reagieren.
Erst kam der Hoffnungsschub, dann die Ernüchterung. Eine Woche nach Beginn des Irak-Kriegs zeichnet sich ab, dass er länger dauert, als in den optimistischsten Szenarien veranschlagt. Jetzt droht mit jedem weiteren Tag wahrscheinlicher zu werden, dass der Krieg die ohnehin labile Weltwirtschaft in neue Turbulenzen bringt - ob über steigende Ölpreise und Militärkosten oder schwindendes Verbrauchervertrauen und fallende Aktienkurse.
Umso erstaunlicher wirkt, wie gelassen Regierungen und Notenbanken bislang auf die ökonomische Risikolage reagiert haben. Hierin liegt womöglich eine mindestens ebenso große Gefahr wie im militärisch-politischen Auseinanderdriften von Anglo-Amerikanern und Franzosen und Deutschen.
Ungewohnte Richtungswechsel
Das wirtschaftspolitische Wirken der großen Industrienationen trägt zunehmend autistische Züge. Klar: Ein paar Abstimmungen gab es. Die US-Regierung erwägt Hilfen für die Flugindustrie. Die Notenbanken würden auf mögliche Liquiditätsengpässe an den Finanzmärkten reagieren, wie sie es nach dem 11. September taten. Das sind aber nur die technischen Aspekte möglicher Turbulenzen.
Ziemlich ratlos reagierten die Finanzmärkte zuletzt auf das ungewohnte Ausbleiben klarer Richtungsvorgaben durch den hoch geschätzten US-Notenbankchef Alan Greenspan. Amerikas Zentralbanker streiten gerade über Grundsatzfragen. Europas Zentralbankchef Wim Duisenberg senkte umgekehrt zwar kurz vor Kriegsbeginn die Zinsen und gab mit ungewohnter Klarheit zu erkennen, dass weitere Schritte folgen könnten. Prima - wenn nur EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing selbiges nicht gleich wieder relativiert hätte. Laut Issing sollten die Zinsen, falls überhaupt, erst dann gesenkt werden, wenn gesicherte Daten über die Kriegsfolgen für die Konjunktur vorliegen - wohl wissend, dass dies Wochen dauern kann und die Zinssenkung dann mit Sicherheit zu spät käme.
Der US-Präsident macht unbekümmert neue Schulden, um Steuern zu senken, Staatspersonal aufzustocken und Kriege zu finanzieren - egal, welche wirtschaftlichen Folgen das haben könnte. In Deutschland herrscht umgekehrt der ebenso absurde Glaube, dass der Staat mitten in Krieg und globaler Konjunkturkrise sein Staatsdefizit sogar drastisch abbauen könnte, indem Steuern und Abgaben steigen. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Was in Amerika zu antizyklischem Überschwang geführt hat, gleicht in Deutschland einem fahrlässig prozyklischen Kurs, der die Krise nur verlängert. Laut Plan sollen Firmen und Verbraucher 2003 derart stark belastet werden, dass das Strukturdefizit im Etat um einen Prozentpunkt des BIP sinkt.
Die Liste der Kuriositäten lässt sich fast beliebig verlängern: Während Japan einsam gegen Deflation und Dollarschwäche kämpft, üben sich Amerikaner und Europäer im "benign neglect", im Ignorieren der gefährlichen Kapriolen bei den großen Weltwährungen.
Allein in den vergangenen 15 Monaten seien Japans Devisenreserven wegen der Stützungsaktionen für den Dollar um ein Drittel auf jetzt 500 Mrd. $ gestiegen, schätzt Norbert Walter, Chefökonom der Deutschen Bank.
Was fehle, sei ein Konsens darüber, wie auf den konjunkturellen Nachfrageeinbruch reagiert werde, sagt Walter. Frankreich lässt die Steuern senken, bricht dafür allerdings frühere Versprechen zum Schuldenabbau. Während sich die Bundesregierung an überholte Konjunkturprognosen klammert und Defizitziele zum Fetisch erklärt. "Damit sabotiert Deutschland die Glaubwürdigkeit der europäischen Finanzpolitik", sagt Walter.
Ein schlechter Kompromiss ist vor diesem Hintergrund die höchst vorsichtige Formel, mit der die EU-Kommission finanzpolitisch auf den Irak-Krieg "reagieren" will. Brüssel räumt ein, dass der Krieg jene "außergewöhnlichen Umstände" schaffen könne, die höhere Staatsdefizite notwendig machen. Was das im Einzelfall bedeutet, soll aber erst später geprüft werden. Das ist verquast - und wird nicht reichen, um Firmen und Verbrauchern die Zuversicht zu geben, dass ihnen wegen des Kriegs keine zusätzlichen Lasten mehr aufgebürdet werden.
Besser wäre, wenn die Notenbanken klar ankündigten, dass sie die Zinsen im Notfall sehr schnell senken würden - und nicht erst Wochen danach. Und wenn etwa die deutsche Bundesregierung daran arbeitete, wenigstens die eigens verursachten Abgabebelastungen dieses Jahres abzufedern - etwa durch vorgezogene Steuersenkungen.
Handelspolitik nach Wildwest-Manier
Für die USA wäre es dagegen keineswegs ein Drama, wenn die eine oder andere geplante Steuersenkung ausbliebe. Im Gegenteil: Auf Dauer wird Amerikas dramatischer Importüberschuss in der Leistungsbilanz nur dann sinken, wenn die Inlandsnachfrage nach Jahren der Exzesse mäßiger wächst und im Rest der Welt entsprechend schneller. Hier würde es lohnen, sich international abzustimmen.
Das Gleiche drängt sich in Sachen Wechselkurs auf. Je länger der Krieg dauert, desto größer wird die Gefahr, dass der ohnehin schwächelnde Dollar zu einem gefährlich unkontrollierten Absturz ansetzt. Ein Gegensteuern könnte auch bei Handelsfragen nötig werden - nach der Wildwest-Reaktion wichtiger US-Abgeordneter, wonach deutsche und französische Produkte boykottiert werden sollten.
Die Hoffnung auf rosige Zeiten nach einem schnellen Kriegsende ist doppelt gewagt. Erstens weil der Krieg eben doch noch Wochen dauern könnte. Zum Zweiten, weil dem Krieg zwar ein Schub der Erleichterung folgen dürfte, nicht aber automatisch ein dauerhafter Aufschwung. Die Terrorangst wird Firmen und Verbrauchern ebenso bleiben wie die Skepsis angesichts von Bilanzskandalen, Aktiencrashs und Bushs Schuldenkurs.
Eine bessere internationale Abstimmung könnte dringlicher kaum sein. Ein Club wirtschaftspolitischer Autisten wird kaum verhindern können, dass der Krieg die Lage noch schlimmer macht als ohnehin schon.
Aus der FTD vom 28.3.2003
Kolumne: Lehren aus drei Jahren Baisse
Von Lucas Zeise
(...)
Die "New York Times" betitelte ihren Leitartikel zum Thema Jahrestag der Baisse schlicht "Pop Went the Bubble". Die Kollegen dieser Zeitung interpretieren die Aktienmärkte als Abbild der, wie sie schreiben, "gesellschaftlichen Stimmung" im Lande und zitieren zum Beleg Artikel aus jener Zeit, die heute, nur drei Jahre später, unendlich fern und geradezu komisch wirken: Schon damals wusste niemand so recht, was die Firma Verisign dazu trieb, 20 Mrd. $ für die Übernahme von Network Solutions zu zahlen. "Heute haben die Amerikaner das Gefühl, sie hätten sehr viel mehr verloren in diesen drei Jahren als nur ein paar Billionen am Aktienmarkt", drückt die "New York Times" den Stimmungswandel aus. Nicht nur sie, fügen wir Europäer hinzu.
Den Aufstieg und Fall der Märkte hat die transatlantische Gesellschaft aus Europa und Amerika gemeinsam erlebt. Daraus lässt sich die erste Schlussfolgerung ziehen: Die Stimmung folgt der Börse, und nicht umgekehrt.
(...)
Analytischer als das New Yorker Qualitätsblatt geht Goldman Sachs mit der großen Baisse um. Unter dem Titel "Lessons from the Boom and Bust" bieten die Investmentbanker folgende fünf Schlussfolgerungen an:
Erstens steigen die Gewinne auf lange Sicht ähnlich wie das nominale Bruttoinlandsprodukt.
Zweitens bringen sinkende Inflationsraten (Disinflation) hohe Finanzmarkterträge. Ist der Zustand niedriger Inflation einmal erreicht, werden die Erträge deutlich schmaler.
Drittens birgt ein rasanter Aufschwung am Aktienmarkt die Saat des eigenen Untergangs bereits in sich.
Viertens wirken Börse und Realwirtschaft so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven selbst verstärkenden Prozessen als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge.
Und fünftens sollten sich die Verantwortlichen für die Geld- und Fiskalpolitik gegen den Strom stemmen und versuchen, sowohl Boom als auch Bust zu mäßigen.
Man mag von diesen Schlussfolgerungen nicht überrascht sein. Dennoch sollten sich Notenbanker und Finanzminister diese fünf Punkte an die Pinnwand über ihre Schreibtischen hängen oder als Bildschirmschoner für ihren Computer installieren. Auch im Schlaf sollten sie vor Augen haben, welche Verwerfungen der überschäumende Aktienmarkt und sein Zusammenbruch angerichtet haben. Der Boom hatte eine Welle der Überinvestition zu Folge, und schlimmer noch: Diese Investitionen sind in grandiosem Ausmaß Fehlallokationen von Ressourcen gewesen.
(...)
FTD - 12.3.2003
"Die Börse wird immer politischer"
Von Christian Buchholz und Andreas Nölting
Makroökonomische Überlegungen funktionieren in Friedenszeiten. In diesen Tagen sind sie obsolet - der Krieg bestimmt die Kurse. Axa-Chefstratege Franz Wenzel spricht im Interview mit manager-magazin.de über den folgenschweren Paradigmenwechsel.
mm.de: Aus Empörung über Frankreichs Haltung zum Krieg wollen mehrere US-Pensionsfonds ihre französischen Aktien aus dem Portfolio werfen. Verkaufen die Axa-Fonds im Gegenzug ihre US-Aktien?
Wenzel: Nein. Wir handeln Aktien auf Grund fundamentaler Entscheidungen. Dabei spielen politische Aspekte zwar eine immer bedeutendere Rolle - es liegt uns aber fern, politische Signale zu setzen. Da gibt es in unserem Geschäft keine Ressentiments. Innenpolitisch erntet Jacques Chirac übrigens durch seine konsequente Haltung gerade viel Symphatie: Immer mehr Franzosen sind, und das passiert nicht häufig, wieder stolz auf ihren Präsidenten.
mm.de: Auf welchem Irak-Szenario basiert Ihre Investmentstrategie?
Wenzel: Der Krieg kann gewonnen werden. Aber die Gefahr von Terror-Anschlägen wird man auch in der Folgezeit nicht in den Griff bekommen. Daher gehe ich davon aus, dass es in der Zeit nach der Entmachtung von Saddam Hussein auch keine "Friedens-Dividende" an den Weltbörsen geben wird. Zweitens werden auch die Volatilitäten [Kursschwankungen] an den Aktien- und Rentenmärkten höher sein als in den vergangenen Jahrzehnten.
mm.de: Der Frieden wird sicher nicht übermorgen im Irak einkehren. Im Moment ziehen die Börsen an, wenn die US-Truppen ein paar Kilometer näher an Bagdad herankommen - und drehen abrupt nach unten, sobald der Vormarsch stockt.
Wenzel: Das stimmt. Makroökonomische Überlegungen und Bewertungsmodelle, die in Friedenszeiten funktionieren - das Rüstzeug des Ökonomen - sind in diesen Tagen obsolet. Der Krieg bestimmt die Kurse - und er wird noch zwei bis drei Monate andauern. Trotzdem lassen wir die Aktienquote unserer Fonds von im Schnitt 55 Prozent - bei 40 Prozent Rententiteln und fünf Prozent Liquidität - unverändert. Den Aktien-Anteil in den Portfolios haben wir im vergangenen September gesenkt, nachdem klar wurde, dass Bush den Militärschlag führen will. Heute halten wir die Gewichtung in der Annahme, dass die Weltkonjunktur sich am Ende des Krieges etwas dynamischer entwickelt.
mm.de: Früher galt die Börsenweisheit, dass politische Börsen kurze Beine haben - für Langfristanleger vernachlässigbar. Jetzt scheint der Einfluss der Politik auf die Aktienmärkte stark zu steigen.
Wenzel: Das ist eindeutig ein Trend. Auch wenn man vom Aktien-Research keine tagesaktuellen Politik-Prognosen erwarten kann - wir nutzen die Berichte der wenigen guten politischen Analysten heute stärker als je zuvor. Das wird aufgrund politischer Unwägbarkeiten auch nach dem Krieg noch lange so bleiben.
mm.de: Worauf werden die politischen Analysten ihr Hauptaugenmerk richten?
Wenzel: Vermutlich auf die Entwicklung des Terrors in der Welt. Leider sind auch künftig Anschläge zu erwarten, die - wenn auch nur kurzfristig - die Börsenkurse erschüttern. Auf solche Situationen sollte jeder Fondsmanager vorbereitet sein.
mm.de: Wo stufen Sie den US-Markt in der Ländergewichtung ein?
Wenzel: Hinter den meisten asiatischen Staaten, die mit einem stabilen Wirtschaftswachstum glänzen, aber deutlich vor Japan und Europa. Die KGV-Bewertung des US-Leitindex S&P 500 liegt bei etwa 16 und damit nur knapp über der des Dax. Aber die Aussichten für eine Konjunktur-Erholung nach dem Krieg im Irak sind für die USA deutlich besser als hierzulande. Ein Minuspunkt für den Aktienmarkt Europa ist zudem, dass er über keine nennenswerte Eigendynamik verfügt. Für uns ist es ein "High-Beta"-Markt, also hochriskant, der die Entwicklung von Dow Jones und S&P 500 nicht einfach spiegelt, sondern die Kursschwankungen mit höheren Ausschlägen nachvollzieht.
mm.de: Ein höherer Ausschlag nach oben wäre ja nicht verkehrt…
Wenzel: …nur leider haben wir in den vergangenen Monaten Übertreibungen meist lediglich in eine Richtung gesehen: Nach unten. Ein Grund für die Skepsis der Investoren gegenüber Europa ist die Führungslosigkeit des Staatenbunds. Die politische Stabilität und das Wirtschaftswachstum lassen zu wünschen übrig. Um eine Zahl zu nennen: Für 2002 hatte eine Experten-Mehrheit eine Steigerung beim Wachstum der Unternehmensgewinne von 20 Prozent erwartet. Tatsächlich gab es ein Minus von fünf Prozent. Solch eine Enttäuschung wirkt nach.
mm.de: Die EU-Zentrale in Brüssel gewinnt doch zunehmend an Einfluss.
Wenzel: Nun ja, die Tätigkeiten einer regulierenden Behörde beinhalten nicht unbedingt das Entwerfen von Visionen. Meine These ist, dass man während der Regierungszeit von Helmut Kohl und François Mitterand der Region Europa wesentlich mehr Entwicklungspotenzial zugetraut hat als heute.
mm.de: Wenn die Maastricht-Kriterien greifen, kann Europa aber beispielsweise nicht mehr, wie es Kritiker für die USA befürchten, in eine Schuldenfalle geraten.
Wenzel: In der Theorie sollen Verschuldungsquoten von mehr als drei Prozent in den europäischen Staaten zwar bald Geschichte sein. Ich halte diese starre Regelung aber für unklug, sie sollte auf Eis gelegt werden. Sie hemmt die Möglichkeiten einer Nachfragepolitik.
mm.de: Sie plädieren jetzt für Deficit Spending, wie es von Maynard Keynes propagiert wurde?
Wenzel: In den 70er Jahren hatte Europa bereits einmal mit Stagflation* zu kämpfen - und wir könnten wieder in diese Sackgasse laufen. Wenn die EU-Reglementierungen ausufern, könnte der Kampf gegen die Deflation ein schlechtes Ende nehmen. Dieser Ballon sollte nicht noch weiter aufgeblasen werden.
mm.de: Die US-Regierung ist hingegen bereit ein Defizit im Staatshaushalt von nie dagewesenen 400 Milliarden Dollar in Kauf zu nehmen…
Wenzel: …außerdem ist der Einfluss von Notenbank-Präsident Alan Greenspan auf die Wirtschaftsentwicklung gesunken, die Geldpolitik wird impotenter. Unter dem Strich sehe ich in den USA trotzdem die Ausgangsbasis für eine Konjunkturerholung. Meine Prognose ist, dass hier in der zweiten Jahreshälfte ein Wirtschaftswachstum von drei bis dreieinhalb Prozent gelingen kann; auch, weil die Lagerbestände niedrig sind. In Europa stehen die Vorzeichen ungünstiger. Für 2003 erwarte ich ein Gewinnwachstum bei den US-Unternehmen von zehn Prozent - und in Europa höchstens die Hälfte.
mm.de: Ihre bevorzugte Anlageregion Asien könnte auch leiden - und zwar wenn die USA nach der Eroberung Iraks mehr Einfluss auf den Ölpreis gewinnen. Stockt der Aufschwung in Asien, wenn der Preis des Wirtschafts-Schmiermittels steigt?
Wenzel: Eindeutig ja. In zehn Jahren etwa wird China den vierfachen Erdöl-Bedarf haben wie heute. Der Ölpreis ist also ein wichtiges Stellrad für die Entwicklung - es ist aber nicht groß genug, um den Aufschwung anzuhalten.
mm.de: Welche Branche werden von dem möglichen Aufschwung besonders profitieren?
Wenzel: Versorger- und Energietitel sind im Moment besonders aussichtsreich. Ein fallender Ölpreis könnte die Kurse von Energietiteln zwar belasten - auf der Guthaben-Seite werden den Aktionären in dem Segment aber Dividendenrenditen von fünf, sechs Prozent geboten. Deutlich weniger oder gar keine Dividende bietet die Telekom-Branche. Aber hier werden attraktive Cashflows generiert - hier gibt es Kaufgelegenheiten.
In Food-Titel, eine defensive Branche, investiert Axa derzeit, ausserdem bauen wir Posititonen in Investitionsgüter- und Industriewerten auf. Abzuraten ist von Finanztiteln, insbesondere von deutschen. Die Restrukturierung hat bei weitem noch nicht das erforderliche Tempo aufgenommen. Die aufgeregte Diskussionen um eine Bad Bank mit Staatsbürgschaften spricht Bände über die Schieflage der Branche.
Franz Wenzel ist Chefaktienstratege von Axa Investment Managers, einer Tochter des zweitgrößten Versicherers in Europa, Axa. Gemeinsam mit der US-Tochter des französischen Konzerns, Alliance Capital, werden in den Fonds-Depots der Gruppe weltweit rund 742 Milliarden Euro verwaltet.
manager-magazin.de, 31.03.2003
Irak-Krieg hinterlässt erste Spuren in der Wirtschaft
Von Sebastian Dullien und Thomas Fricke, Berlin
In den ersten Kriegstagen herrschte noch Zuversicht unter den Auguren. Von den ökonomischen Szenarien, die in den Monaten zuvor entwickelt worden waren, schienen jene einzutreffen, die auf schnelle militärische Erfolge und rasche Besserung bei Aktien, Ölpreisen, Wechselkursen und wirtschaftlichen Stimmungswerten gesetzt hatten.
Doch die Entwicklungen der letzten Tage lassen an diesen optimistischen Prognosen zweifeln. Der Vormarsch der Alliierten stockte, die USA müssen Verstärkung einfliegen, Fernsehbilder zeigen Tumulte überall in der arabischen Welt. Nach dem ersten Selbstmordattentat auf einen US-Checkpoint deutet noch wenig darauf hin, dass die USA Irak problemlos besetzen und befrieden können. Jetzt berechnen nicht nur die Militärs neue, ernüchterndere Szenarien, sondern auch die Ökonomen. Die Angst vor der Rezession geht um.
An warnenden Stimmen mangelt es plötzlich nicht mehr. "Der Optimismus der Märkte zum Kriegsbeginn war naiv", sagt Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Die Besetzung und Befriedung Iraks werde viel schwerer, als es einige gehofft hätten. Die EU-Kommission wird in Kürze eine deutlich revidierte Wachstumsprognose abgeben. Und Horst Köhler, Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), räumte ein, bei einem längeren Krieg sei eine globale Rezession nicht auszuschließen.
Noch am ersten Kriegswochenende beteuerte Frankreichs Finanzminister Francis Mer: "Der Großteil der negativen wirtschaftlichen Konsequenzen der Irak-Krise ist hinter uns." Gestern polterte Mers Chef, Premier Jean-Pierre Raffarin, der Krieg trage eine Mitschuld daran, dass Frankreichs Wirtschaft derzeit den schlimmsten konjunkturellen Absturz der jüngeren Geschichte erlebe. Folgt der naiven Zuversicht jetzt eine ebenso voreilige Panik? Oder sind die Sorgen berechtigt?
Revidierte Prognose
Fest steht, dass zumindest die günstigsten Szenarien überholt sind. "Nicht erfüllt" habe sich die Annahme, dass die Irak-Krise "bis zum Frühjahr überwunden" sei, gestehen die Ökonomen der Commerzbank ein. Ihre Prognose für das deutsche Wachstum revidierten sie für 2003 von 0,75 auf 0,5 Prozent. Begründung: Die negativen Kriegswirkungen würden "länger spürbar bleiben und die Weltwirtschaft auch im zweiten Quartal beeinträchtigen".
Überholt scheint auch das viel zitierte Best-Case-Szenario des renommierten amerikanischen Center for Strategic and International Studies (CSIS), dem Fachleute eine Wahrscheinlichkeit von 40 bis 60 Prozent zugebilligt hatten. Demnach müsste der Konflikt nach insgesamt vier bis sechs Wochen ohne große Widerstände vollständig beendet sein. Das wird immer unwahrscheinlicher. Damit schwindet aber auch die Hoffnung, dass sich aus Erleichterung die Finanzmärkte rasch erholen, der Ölpreis stark fällt und weltweit schon ab Jahresmitte ein kräftiger Aufschwung beginnt.
Wie schnell der Krieg je nach Verlauf ganz unmittelbar hiesige Firmen und Verbraucher belasten kann, zeigt das Auf und Ab an den Ölmärkten. Nach dem Bush-Ultimatum an Saddam Hussein und in den ersten Kriegstagen fiel der Ölpreis von mehr als 30 auf knapp 25 $ je Barrel - jetzt steuert er wieder auf die 30-$-Marke zu. Das kostet Wachstum.
Zurückhaltung bei Firmen
Mindestens so gefährlich ist nach Ansicht von Experten die kriegsbedingte Unsicherheit über die nahe wirtschaftliche Zukunft. "Wenn Firmen nicht wissen, wie sich Wechselkurs, Ölpreis und Welthandel entwickeln, halten sie sich mit Investitionen erstmal zurück", sagt Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise.
Erste Spuren sind davon bereits erkennbar. "Wir wissen, dass die Firmen für dieses Jahr bereits umfangreiche Investitionspläne ausgearbeitet hatten", sagt Gernot Nerb vom Ifo-Institut in München. Die Pläne würden aber derzeit nicht verwirklicht, sondern aufgeschoben. Aufträge für Maschinen, Gebäude und Ausrüstung bleiben aus. Das Geschäftsklima in den deutschen Firmen war laut Ifo im März deutlich schlechter als noch im Februar.
Ähnliches scheint für die Verbraucher zu gelten. Die Angst vor Arbeitslosigkeit steigt, die Menschen schieben Anschaffungen auf. "Das setzt eine negative Kettenreaktion in Gang", sagt Rolf Bürkl, Forscher bei der GfK Konsumforschung. Der Konsumklimaindex für März lag ebenfalls unter Vormonat.
Schwierige Zeiten
"Wir spüren Zurückhaltung - auch auf unseren Hauptmärkten in Europa. Wir haben uns auf schwierige Zeiten einzustellen", sagt Volkswagen-Personalvorstand Peter Hartz. Auch Nissan-Chef Carlos Ghosn verkündete, er rechne damit, dass die Nachfrage nach Autos in den USA und Europa wegen des Kriegs zurückgehe.
Besonders hart getroffen sind Fluggesellschaften und die Tourismusindustrie. Die US-Airlines verzeichnen nach Angaben der Air Transport Association (ATA) wegen des Kriegs Buchungsrückgänge um 20 Prozent. International liege das Minus in einigen Regionen sogar bei 40 Prozent, so ATA-Präsident James May. In der US-Regierung wird bereits über Hilfspakete für Not leidende Airlines diskutiert.
Je länger der Krieg dauert, desto größer werden auch die Kosten für den US-Staatshaushalt. Der stattliche Nachtragshaushalt von 75 Mrd. $, den George W. Bush vergangene Woche für die Kriegs- und Wiederaufbaukosten vorlegte, reicht nur bis September. Experten rechnen damit, dass selbst bei relativ günstigem Kriegsverlauf mindestens 25 Mrd. $ hinzukommen. Immer deutlicher wird, dass das US-Staatsdefizit 2003 auf rund 400 Mrd. $ oder fast vier Prozent der Wirtschaftsleistung steigen wird - mehr als der Maastricht-Vertrag den Europäern erlaubt.
Kapitalströme können kippen
"Wenn der Eindruck entsteht, die USA leben über ihre Verhältnisse, könnten die Investoren das Vertrauen verlieren", sagt Michael Heise von der Allianz. "Sollte sich der Krieg über ein halbes Jahr hinziehen und mit entsprechend höheren Staatsausgaben einhergehen, könnten die Kapitalströme kippen", warnt auch Rudolf Besch von der Deka-Bank. Dann fiele eine weitere wichtige Stütze für den US-Dollar. Die Währung droht abzustürzen, die Zinsen würden in die Höhe schnellen, so Heise.
Noch muss nach Einschätzung der meisten Experten all das nicht bedeuten, dass der Krieg in die Rezession führt. Gute Chancen gibt es noch, dass der ganz große Ölpreisschock ausbleibt - wenn es gelingt, größere Zerstörungen an den Ölfeldern der Region wie bislang zu verhindern. Als wenig wahrscheinlich gilt mittlerweile aber eine Annahme aus dem Best-Case-Szenario des CSIS: dass die globale Unsicherheit völlig verschwindet, sobald der Krieg in Irak - wann und wie auch immer - vorüber ist.
"Die Iraker sind nicht begeistert über die Befreiung durch die USA", sagt Deutsche-Bank-Ökonom Walter. Das mache es schwierig, Frieden zu schaffen. Ähnlich sieht es der renommierte US-Ökonom David Hale: "Anders als 1991 geht es diesmal nicht darum, dass die USA ein kleines Land befreien. Die Lösung des Konflikts wird weit weniger eindeutig ausfallen."
"Die Angst vor Terror wird nach Ende des Irak-Kriegs bleiben", sagt Thomas Hueck von der HypoVereinsbank. "Ein einziger Anschlag etwa in einem Einkaufszentrum würde US-Verbrauchervertrauen und Konsum sofort einbrechen lassen", so der Ökonom. David Hale geht noch weiter. Auf Grund der neuen unilateralen Militärdoktrin der USA sei bald ein neuer Krieg absehbar, etwa gegen Nordkorea. "Die Märkte müssen sich auf das Risiko von mindestens zwei Kriegen einstellen", so Hale - mit entsprechenden Folgen für die Weltwirtschaft.
FTD - 1.4.2003
Edelmetalle: Beim Gold gibt der Krieg den Takt vor
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Nachdem zuletzt immer deutlicher wurde, dass der Irak-Krieg länger als von vielen vermutet dauern würde, testete Gold mehrfach die Marke von 334 $ je Unze. Unterstützung ging hierbei auch von physischer Nachfrage aus, die zwischen 325 und 330 $ pro Unze eingesetzt hatte.
Die Umsätze waren dann jedoch zu gering, um einen anhaltenden Aufwärtstrend zu begründen. Auch in den kommenden Tagen wird der Handel eher durch kurzfristige Entwicklungen getrieben werden, insbesondere durch die Ereignisse am Persischen Golf. Große Positionen werden dabei vermutlich nicht bewegt. Spekulative Verkäufe könnten rasch auf Produzenten treffen, die ihre Absicherungspositionen reduzieren und somit Unterstützung bieten. Dies gilt auch für die physische Nachfrage, die auf dem derzeit erreichten Niveau wieder angesprungen ist.
Am Mittwoch meldete sich die Bundesbank zum Thema Gold zu Wort, genauer zum Goldabkommen der europäischen Zentralbanken: "Ob es zu einem weiteren Goldabkommen kommen wird, ist offen", sagte Bundesbankpräsident Ernst Welteke. Marktbeobachter gehen aber fest von einer Neuauflage aus, da ein Verzicht den Goldmarkt unnötig unter Druck bringen würde. Dies, so die Analysten, könnte schließlich auch nicht im Interesse der Zentralbanken sein, die ja noch immer ein Viertel der weltweiten Goldvorräte in ihren Tresoren bunkern.
Pluspositionen durch Hedge Funds aufgelöst
Silber pendelte um die psychologisch wichtige Marke von 4,40 $ je Unze. Das Marktgeschehen ist abhängig von den Entwicklungen beim Gold. Der Auflösung von Pluspositionen durch Hedge Funds steht industrielles Kaufinteresse sowie eine leichte Investorennachfrage gegenüber.
Deutlich verloren haben in der vergangenen Woche die Platinmetalle. Palladium, notierte am Dienstag mit 183 $ pro Unze so tief wie im Dezember 1997. Hinter den Verkäufen steckten Fonds, die ihre Pluspositionen auflösten. Industrielle Nachfrage verhinderte ein weiteres Abgleiten der Preise. Der Angebotsüberhang bei gleichzeitig sinkender Nachfrage macht nach Ansicht von Marktbeobachtern eine schnelle Erholung aber unwahrscheinlich.
Verkaufsdruck bei Platin-Fonds
Auch beim Platin standen unmittelbar vor dem Ende des japanischen Steuerjahres Fonds auf der Verkäuferseite. Zu Wochenbeginn konnten andere Marktteilnehmer diese Abgaben noch auffangen. Auch industrielle Nachfrage stützte das Metall zunächst und verhinderte ein Abrutschen des Preises. Zum Wochenschluss nahm der Verkaufsdruck jedoch überhand. Der Platinpreis gab deutlich nach und notierte mit 623 $ je Unze zeitweise auf einem Zwei-Monats-Tief.
Die weitere Entwicklung, so Analysten, hängt nun nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Eine Erholung dürfte die industrielle Nachfrage weiter stärken. Im Zuge eines längeren Irak-Konflikts bestehe außerdem die Möglichkeit, dass Investoren wieder verstärkt einsteigen.
Wolfgang Wrzesniok-Rossbach leitet den Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt.
Aus der FTD vom 31.3.2003
siehe auch Beitrag #24 imThread: Weltweite Goldnachfrage erneut gesunken !
Im Club der Autisten
Von Thomas Fricke
Der Irak-Konflikt hat die westliche Welt politisch entzweit. Noch folgenschwerer könnte aber sein, dass Notenbanken und Regierungen ziemlich chaotisch und uneins auf die ökonomische Risikolage reagieren.
Erst kam der Hoffnungsschub, dann die Ernüchterung. Eine Woche nach Beginn des Irak-Kriegs zeichnet sich ab, dass er länger dauert, als in den optimistischsten Szenarien veranschlagt. Jetzt droht mit jedem weiteren Tag wahrscheinlicher zu werden, dass der Krieg die ohnehin labile Weltwirtschaft in neue Turbulenzen bringt - ob über steigende Ölpreise und Militärkosten oder schwindendes Verbrauchervertrauen und fallende Aktienkurse.
Umso erstaunlicher wirkt, wie gelassen Regierungen und Notenbanken bislang auf die ökonomische Risikolage reagiert haben. Hierin liegt womöglich eine mindestens ebenso große Gefahr wie im militärisch-politischen Auseinanderdriften von Anglo-Amerikanern und Franzosen und Deutschen.
Ungewohnte Richtungswechsel
Das wirtschaftspolitische Wirken der großen Industrienationen trägt zunehmend autistische Züge. Klar: Ein paar Abstimmungen gab es. Die US-Regierung erwägt Hilfen für die Flugindustrie. Die Notenbanken würden auf mögliche Liquiditätsengpässe an den Finanzmärkten reagieren, wie sie es nach dem 11. September taten. Das sind aber nur die technischen Aspekte möglicher Turbulenzen.
Ziemlich ratlos reagierten die Finanzmärkte zuletzt auf das ungewohnte Ausbleiben klarer Richtungsvorgaben durch den hoch geschätzten US-Notenbankchef Alan Greenspan. Amerikas Zentralbanker streiten gerade über Grundsatzfragen. Europas Zentralbankchef Wim Duisenberg senkte umgekehrt zwar kurz vor Kriegsbeginn die Zinsen und gab mit ungewohnter Klarheit zu erkennen, dass weitere Schritte folgen könnten. Prima - wenn nur EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing selbiges nicht gleich wieder relativiert hätte. Laut Issing sollten die Zinsen, falls überhaupt, erst dann gesenkt werden, wenn gesicherte Daten über die Kriegsfolgen für die Konjunktur vorliegen - wohl wissend, dass dies Wochen dauern kann und die Zinssenkung dann mit Sicherheit zu spät käme.
Der US-Präsident macht unbekümmert neue Schulden, um Steuern zu senken, Staatspersonal aufzustocken und Kriege zu finanzieren - egal, welche wirtschaftlichen Folgen das haben könnte. In Deutschland herrscht umgekehrt der ebenso absurde Glaube, dass der Staat mitten in Krieg und globaler Konjunkturkrise sein Staatsdefizit sogar drastisch abbauen könnte, indem Steuern und Abgaben steigen. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Was in Amerika zu antizyklischem Überschwang geführt hat, gleicht in Deutschland einem fahrlässig prozyklischen Kurs, der die Krise nur verlängert. Laut Plan sollen Firmen und Verbraucher 2003 derart stark belastet werden, dass das Strukturdefizit im Etat um einen Prozentpunkt des BIP sinkt.
Die Liste der Kuriositäten lässt sich fast beliebig verlängern: Während Japan einsam gegen Deflation und Dollarschwäche kämpft, üben sich Amerikaner und Europäer im "benign neglect", im Ignorieren der gefährlichen Kapriolen bei den großen Weltwährungen.
Allein in den vergangenen 15 Monaten seien Japans Devisenreserven wegen der Stützungsaktionen für den Dollar um ein Drittel auf jetzt 500 Mrd. $ gestiegen, schätzt Norbert Walter, Chefökonom der Deutschen Bank.
Was fehle, sei ein Konsens darüber, wie auf den konjunkturellen Nachfrageeinbruch reagiert werde, sagt Walter. Frankreich lässt die Steuern senken, bricht dafür allerdings frühere Versprechen zum Schuldenabbau. Während sich die Bundesregierung an überholte Konjunkturprognosen klammert und Defizitziele zum Fetisch erklärt. "Damit sabotiert Deutschland die Glaubwürdigkeit der europäischen Finanzpolitik", sagt Walter.
Ein schlechter Kompromiss ist vor diesem Hintergrund die höchst vorsichtige Formel, mit der die EU-Kommission finanzpolitisch auf den Irak-Krieg "reagieren" will. Brüssel räumt ein, dass der Krieg jene "außergewöhnlichen Umstände" schaffen könne, die höhere Staatsdefizite notwendig machen. Was das im Einzelfall bedeutet, soll aber erst später geprüft werden. Das ist verquast - und wird nicht reichen, um Firmen und Verbrauchern die Zuversicht zu geben, dass ihnen wegen des Kriegs keine zusätzlichen Lasten mehr aufgebürdet werden.
Besser wäre, wenn die Notenbanken klar ankündigten, dass sie die Zinsen im Notfall sehr schnell senken würden - und nicht erst Wochen danach. Und wenn etwa die deutsche Bundesregierung daran arbeitete, wenigstens die eigens verursachten Abgabebelastungen dieses Jahres abzufedern - etwa durch vorgezogene Steuersenkungen.
Handelspolitik nach Wildwest-Manier
Für die USA wäre es dagegen keineswegs ein Drama, wenn die eine oder andere geplante Steuersenkung ausbliebe. Im Gegenteil: Auf Dauer wird Amerikas dramatischer Importüberschuss in der Leistungsbilanz nur dann sinken, wenn die Inlandsnachfrage nach Jahren der Exzesse mäßiger wächst und im Rest der Welt entsprechend schneller. Hier würde es lohnen, sich international abzustimmen.
Das Gleiche drängt sich in Sachen Wechselkurs auf. Je länger der Krieg dauert, desto größer wird die Gefahr, dass der ohnehin schwächelnde Dollar zu einem gefährlich unkontrollierten Absturz ansetzt. Ein Gegensteuern könnte auch bei Handelsfragen nötig werden - nach der Wildwest-Reaktion wichtiger US-Abgeordneter, wonach deutsche und französische Produkte boykottiert werden sollten.
Die Hoffnung auf rosige Zeiten nach einem schnellen Kriegsende ist doppelt gewagt. Erstens weil der Krieg eben doch noch Wochen dauern könnte. Zum Zweiten, weil dem Krieg zwar ein Schub der Erleichterung folgen dürfte, nicht aber automatisch ein dauerhafter Aufschwung. Die Terrorangst wird Firmen und Verbrauchern ebenso bleiben wie die Skepsis angesichts von Bilanzskandalen, Aktiencrashs und Bushs Schuldenkurs.
Eine bessere internationale Abstimmung könnte dringlicher kaum sein. Ein Club wirtschaftspolitischer Autisten wird kaum verhindern können, dass der Krieg die Lage noch schlimmer macht als ohnehin schon.
Aus der FTD vom 28.3.2003
Kolumne: Lehren aus drei Jahren Baisse
Von Lucas Zeise
(...)
Die "New York Times" betitelte ihren Leitartikel zum Thema Jahrestag der Baisse schlicht "Pop Went the Bubble". Die Kollegen dieser Zeitung interpretieren die Aktienmärkte als Abbild der, wie sie schreiben, "gesellschaftlichen Stimmung" im Lande und zitieren zum Beleg Artikel aus jener Zeit, die heute, nur drei Jahre später, unendlich fern und geradezu komisch wirken: Schon damals wusste niemand so recht, was die Firma Verisign dazu trieb, 20 Mrd. $ für die Übernahme von Network Solutions zu zahlen. "Heute haben die Amerikaner das Gefühl, sie hätten sehr viel mehr verloren in diesen drei Jahren als nur ein paar Billionen am Aktienmarkt", drückt die "New York Times" den Stimmungswandel aus. Nicht nur sie, fügen wir Europäer hinzu.
Den Aufstieg und Fall der Märkte hat die transatlantische Gesellschaft aus Europa und Amerika gemeinsam erlebt. Daraus lässt sich die erste Schlussfolgerung ziehen: Die Stimmung folgt der Börse, und nicht umgekehrt.
(...)
Analytischer als das New Yorker Qualitätsblatt geht Goldman Sachs mit der großen Baisse um. Unter dem Titel "Lessons from the Boom and Bust" bieten die Investmentbanker folgende fünf Schlussfolgerungen an:
Erstens steigen die Gewinne auf lange Sicht ähnlich wie das nominale Bruttoinlandsprodukt.
Zweitens bringen sinkende Inflationsraten (Disinflation) hohe Finanzmarkterträge. Ist der Zustand niedriger Inflation einmal erreicht, werden die Erträge deutlich schmaler.
Drittens birgt ein rasanter Aufschwung am Aktienmarkt die Saat des eigenen Untergangs bereits in sich.
Viertens wirken Börse und Realwirtschaft so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven selbst verstärkenden Prozessen als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge.
Und fünftens sollten sich die Verantwortlichen für die Geld- und Fiskalpolitik gegen den Strom stemmen und versuchen, sowohl Boom als auch Bust zu mäßigen.
Man mag von diesen Schlussfolgerungen nicht überrascht sein. Dennoch sollten sich Notenbanker und Finanzminister diese fünf Punkte an die Pinnwand über ihre Schreibtischen hängen oder als Bildschirmschoner für ihren Computer installieren. Auch im Schlaf sollten sie vor Augen haben, welche Verwerfungen der überschäumende Aktienmarkt und sein Zusammenbruch angerichtet haben. Der Boom hatte eine Welle der Überinvestition zu Folge, und schlimmer noch: Diese Investitionen sind in grandiosem Ausmaß Fehlallokationen von Ressourcen gewesen.
(...)
FTD - 12.3.2003
.
Geldanlage-Interview: ´Ich bleibe bullish gestimmt´
Interview mit Stefan Schilbe, Chefvolkswirt von HSBC Trinkaus & Burkhardt, über die Entwicklung des Goldpreises.
FTD: Nach dem deutlichen Kursrutsch des Goldpreises in den vergangenen Wochen sehen sich viele Skeptiker bestätigt: Gold sei lediglich ein Barometer für geopolitische Turbulenzen und diene nicht als seriöses Investment. Hat Gold, nachdem die Kriegsprämie weitgehend abgebaut ist, langfristig an Attraktivität verloren?
Schilbe: Keineswegs. Wir müssen hier den nachrichtlichen Kontext sehen. Was war passiert? Die Rede von UN-Waffeninspekteur Blix Anfang Februar hatte die Kriegsängste zunächst gedämpft und zu kräftigen Gewinnmitnahmen beim Goldpreis geführt, der seit Anfang Dezember von unter 320 $ je Feinunze auf 388,50 $ geklettert war. In der Nacht des Kriegsbeginns, insbesondere aber am 21. März lösten Verkäufe in New York einen weiteren Kursrutsch aus, der dazu führte, dass die bisherige charttechnische Unterstützung bei 331,5 $ per Unze durchbrochen wurde und die Goldnotierung auf 326 $ fiel. Es handelt sich hier also eher um ein kurzfristiges technisches Phänomen. Tatsächlich finden sich bei sorgfältiger Analyse aber schlüssige fundamentale Gründe für eine langfristige Neubewertung des gelben Metalls.
FTD: Und welche wären das?
Schilbe: Mittel- bis langfristig dürfte Gold vor allem von den gravierenden strukturellen Problemen der US-Volkswirtschaft profitieren. Die USA sehen sich heute mit realwirtschaftlichen Problemen konfrontiert, die aus der spekulativen Blase an den Aktienmärkten resultieren. Die infolge übertriebener Renditeerwartungen - Stichwort "New Economy" - ausgelöste Fehlallokation von Kapital hat in den 90er Jahren zu rasant steigenden Investitionen geführt. Übrig geblieben ist nach dem Platzen der Blase ein Überhang an freien Kapazitäten und eine enorm hohe Verschuldung. Aktuell beläuft sich diese auf 31.000 Mrd. $. In Relation zum BIP entspricht das einer Verschuldung von rund 300 Prozent. Stellt sich die Frage, wie ein solcher Schuldenberg reduziert werden kann. Entweder schafft es die US-Volkswirtschaft zu den hohen realen Wachstumsraten zurückzukehren - oder die Schuldenlast wird durch eine Inflationierung real entwertet.
FTD: Wie ist das zu verstehen?
Schilbe: Im Prinzip durch erhöhte Inflation dafür zu sorgen, dass die stark verschuldeten privaten Konsumenten und Unternehmen etwas mehr Luft bekommen. Diese Möglichkeit wird auf Seiten der US-Notenbank auch durchaus ins Auge gefasst.
FTD: Fed-Chef Alan Greenspan ist dagegen.
Schilbe: Andere nicht. So hat zum Beispiel kürzlich der Fed-Gouverneur Ben Bernanke, ein potenzieller Nachfolger von US-Notenbankchef Greenspan, in einer Rede alternative Möglichkeiten für den Fall aufgezeigt, dass die USA in die Deflation abrutschen. Das Ganze läuft darauf hinaus, Dollars zu drucken. Für den Goldpreis wäre das natürlich gut, denn der gilt historisch als Hauptprofiteur eines schwachen Greenback.
FTD: Als weiteres gewichtiges Argument, in Gold zu investieren, wird auf das aktuell niedrige Zinsniveau verwiesen.
Schilbe: Das ist richtig. Die Opportunitätskosten der Goldhaltung sind deutlich gesunken, das heißt der Verzicht auf Zinserträge fällt vergleichsweise leicht. 1990 lagen wir bei den Notenbankzinsen (Fed-Funds) noch bei acht Prozent, zu Beginn des ersten Golfkriegs bei 6,75 Prozent. Das heißt, weil Gold keine Zinsen trägt, wären Anlegern damals pro Jahr Zinsen in der Größenordnung von schätzungsweise sieben Prozent entgangen. Das ist deutlich weniger geworden, seit die internationalen Zinsen massiv gesunken sind. Heute fällt es leichter, auf die zwei bis zweieinhalb Prozent, die es auf europäischen Sparbüchern gibt, zu verzichten als Anfang der 90er Jahre auf die hohen Zinsen. Andererseits verlieren Goldproduzenten den Anreiz, künftig anfallende Produktionen schon jetzt auf Termin zu verkaufen. Der so genannte Contango, die Differenz aus Goldleihe-Sätzen und den Fed-Funds, ist so gering, dass die Terminaufschläge fast verschwinden. Folglich sind die Produzenten kaum noch an einem Hedging interessiert.
FTD: Wie ist die Marktsituation derzeit zu bewerten?
Schilbe: Die Angebots-/Nachfrage-Konstellation ist schon seit einigen Jahren positiv. So übertrifft der industrielle Bedarf, insbesondere der Schmuckindustrie, die Goldproduktion kontinuierlich um rund 900 bis 1200 Tonnen. Ein wichtiger Schritt ist das 1999 abgeschlossene "Washington Agreement", in dem sich die 15 großen europäischen Notenbanken verpflichten, die Goldverkäufe bis einschließlich September 2004 auf 2000 Tonnen zu begrenzen, um einen freien Fall des Goldpreises künftig zu verhindern.
FTD: Ihre Bank hat sich im Goldgeschäft bisher weitgehend zurückgehalten. Ist demnächst mit einer Produktoffensive aus dem Hause HSBC Trinkaus zu rechnen?
Schilbe: Wir haben gerade ein Reihe von Optionsscheinen begeben. Mit dem ersten Power-Warrant auf Gold am deutschen Markt können Anleger unsere bullishe Markteinschätzung umsetzen. – [aha, deshalb dieses Interview... ] Wir denken auch darüber nach, währungsgesicherte Produkte auf Gold zu emittieren.
] Wir denken auch darüber nach, währungsgesicherte Produkte auf Gold zu emittieren.
FTD: Wie viel des edlen Metalls sollten sich Anleger in ihr Depot legen?
Schilbe: In den 80er Jahren war es völlig normal, über eine Portfolio-Beimischung von fünf bis zehn Prozent zu sprechen. So würde ich es auch heute halten.
FTD: Wo steht der Goldpreis Ende 2003?
Schilbe: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Rahmen der allgemeinen Aufwärtsbewegung neue Höchstkurse sehen werden, möglicherweise sogar jenseits der 400 $ per Unze. Ich bleibe bullish gestimmt.
Das Interview führte Hans-Jürgen Möhring.
ftd.de, Do, 3.4.2003, 2:00
Spiegelbildlicher Verlauf

Kaufsignal: Der Langfrist-Chart des Goldpreises scheint ein Spiegelbild der Aktienmärkte zu sein. Während der Dow Jones Industrial Average im Mai 2002 seinen 20-jährigen Hausse-Trend beendete, konnte Gold im gleichen Monat seinen Baisse-Trend verlassen und damit ein wichtiges strategisches Kaufsignal generieren.
Umkehrformation: Mittlerweile wurde durch den Sprung über die Marke von 330 $ eine klassische Umkehrformation in Form eines Doppel-Bodens komplettiert. Die Experten von HSBC Trinkaus leiten daraus ein langfristiges Kursziel von 410 $/Unze ab.
Geldanlage-Interview: ´Ich bleibe bullish gestimmt´
Interview mit Stefan Schilbe, Chefvolkswirt von HSBC Trinkaus & Burkhardt, über die Entwicklung des Goldpreises.
FTD: Nach dem deutlichen Kursrutsch des Goldpreises in den vergangenen Wochen sehen sich viele Skeptiker bestätigt: Gold sei lediglich ein Barometer für geopolitische Turbulenzen und diene nicht als seriöses Investment. Hat Gold, nachdem die Kriegsprämie weitgehend abgebaut ist, langfristig an Attraktivität verloren?
Schilbe: Keineswegs. Wir müssen hier den nachrichtlichen Kontext sehen. Was war passiert? Die Rede von UN-Waffeninspekteur Blix Anfang Februar hatte die Kriegsängste zunächst gedämpft und zu kräftigen Gewinnmitnahmen beim Goldpreis geführt, der seit Anfang Dezember von unter 320 $ je Feinunze auf 388,50 $ geklettert war. In der Nacht des Kriegsbeginns, insbesondere aber am 21. März lösten Verkäufe in New York einen weiteren Kursrutsch aus, der dazu führte, dass die bisherige charttechnische Unterstützung bei 331,5 $ per Unze durchbrochen wurde und die Goldnotierung auf 326 $ fiel. Es handelt sich hier also eher um ein kurzfristiges technisches Phänomen. Tatsächlich finden sich bei sorgfältiger Analyse aber schlüssige fundamentale Gründe für eine langfristige Neubewertung des gelben Metalls.
FTD: Und welche wären das?
Schilbe: Mittel- bis langfristig dürfte Gold vor allem von den gravierenden strukturellen Problemen der US-Volkswirtschaft profitieren. Die USA sehen sich heute mit realwirtschaftlichen Problemen konfrontiert, die aus der spekulativen Blase an den Aktienmärkten resultieren. Die infolge übertriebener Renditeerwartungen - Stichwort "New Economy" - ausgelöste Fehlallokation von Kapital hat in den 90er Jahren zu rasant steigenden Investitionen geführt. Übrig geblieben ist nach dem Platzen der Blase ein Überhang an freien Kapazitäten und eine enorm hohe Verschuldung. Aktuell beläuft sich diese auf 31.000 Mrd. $. In Relation zum BIP entspricht das einer Verschuldung von rund 300 Prozent. Stellt sich die Frage, wie ein solcher Schuldenberg reduziert werden kann. Entweder schafft es die US-Volkswirtschaft zu den hohen realen Wachstumsraten zurückzukehren - oder die Schuldenlast wird durch eine Inflationierung real entwertet.
FTD: Wie ist das zu verstehen?
Schilbe: Im Prinzip durch erhöhte Inflation dafür zu sorgen, dass die stark verschuldeten privaten Konsumenten und Unternehmen etwas mehr Luft bekommen. Diese Möglichkeit wird auf Seiten der US-Notenbank auch durchaus ins Auge gefasst.
FTD: Fed-Chef Alan Greenspan ist dagegen.
Schilbe: Andere nicht. So hat zum Beispiel kürzlich der Fed-Gouverneur Ben Bernanke, ein potenzieller Nachfolger von US-Notenbankchef Greenspan, in einer Rede alternative Möglichkeiten für den Fall aufgezeigt, dass die USA in die Deflation abrutschen. Das Ganze läuft darauf hinaus, Dollars zu drucken. Für den Goldpreis wäre das natürlich gut, denn der gilt historisch als Hauptprofiteur eines schwachen Greenback.
FTD: Als weiteres gewichtiges Argument, in Gold zu investieren, wird auf das aktuell niedrige Zinsniveau verwiesen.
Schilbe: Das ist richtig. Die Opportunitätskosten der Goldhaltung sind deutlich gesunken, das heißt der Verzicht auf Zinserträge fällt vergleichsweise leicht. 1990 lagen wir bei den Notenbankzinsen (Fed-Funds) noch bei acht Prozent, zu Beginn des ersten Golfkriegs bei 6,75 Prozent. Das heißt, weil Gold keine Zinsen trägt, wären Anlegern damals pro Jahr Zinsen in der Größenordnung von schätzungsweise sieben Prozent entgangen. Das ist deutlich weniger geworden, seit die internationalen Zinsen massiv gesunken sind. Heute fällt es leichter, auf die zwei bis zweieinhalb Prozent, die es auf europäischen Sparbüchern gibt, zu verzichten als Anfang der 90er Jahre auf die hohen Zinsen. Andererseits verlieren Goldproduzenten den Anreiz, künftig anfallende Produktionen schon jetzt auf Termin zu verkaufen. Der so genannte Contango, die Differenz aus Goldleihe-Sätzen und den Fed-Funds, ist so gering, dass die Terminaufschläge fast verschwinden. Folglich sind die Produzenten kaum noch an einem Hedging interessiert.
FTD: Wie ist die Marktsituation derzeit zu bewerten?
Schilbe: Die Angebots-/Nachfrage-Konstellation ist schon seit einigen Jahren positiv. So übertrifft der industrielle Bedarf, insbesondere der Schmuckindustrie, die Goldproduktion kontinuierlich um rund 900 bis 1200 Tonnen. Ein wichtiger Schritt ist das 1999 abgeschlossene "Washington Agreement", in dem sich die 15 großen europäischen Notenbanken verpflichten, die Goldverkäufe bis einschließlich September 2004 auf 2000 Tonnen zu begrenzen, um einen freien Fall des Goldpreises künftig zu verhindern.
FTD: Ihre Bank hat sich im Goldgeschäft bisher weitgehend zurückgehalten. Ist demnächst mit einer Produktoffensive aus dem Hause HSBC Trinkaus zu rechnen?
Schilbe: Wir haben gerade ein Reihe von Optionsscheinen begeben. Mit dem ersten Power-Warrant auf Gold am deutschen Markt können Anleger unsere bullishe Markteinschätzung umsetzen. – [aha, deshalb dieses Interview...
 ] Wir denken auch darüber nach, währungsgesicherte Produkte auf Gold zu emittieren.
] Wir denken auch darüber nach, währungsgesicherte Produkte auf Gold zu emittieren. FTD: Wie viel des edlen Metalls sollten sich Anleger in ihr Depot legen?
Schilbe: In den 80er Jahren war es völlig normal, über eine Portfolio-Beimischung von fünf bis zehn Prozent zu sprechen. So würde ich es auch heute halten.
FTD: Wo steht der Goldpreis Ende 2003?
Schilbe: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Rahmen der allgemeinen Aufwärtsbewegung neue Höchstkurse sehen werden, möglicherweise sogar jenseits der 400 $ per Unze. Ich bleibe bullish gestimmt.
Das Interview führte Hans-Jürgen Möhring.
ftd.de, Do, 3.4.2003, 2:00
Spiegelbildlicher Verlauf

Kaufsignal: Der Langfrist-Chart des Goldpreises scheint ein Spiegelbild der Aktienmärkte zu sein. Während der Dow Jones Industrial Average im Mai 2002 seinen 20-jährigen Hausse-Trend beendete, konnte Gold im gleichen Monat seinen Baisse-Trend verlassen und damit ein wichtiges strategisches Kaufsignal generieren.
Umkehrformation: Mittlerweile wurde durch den Sprung über die Marke von 330 $ eine klassische Umkehrformation in Form eines Doppel-Bodens komplettiert. Die Experten von HSBC Trinkaus leiten daraus ein langfristiges Kursziel von 410 $/Unze ab.
.
Der Mann, die Gier, das Debakel:
Wie der betrügerische Spekulant Nick Leeson die britische Barings Bank zu Fall brachte
Von Robert von Heusinger
Der Markt wird ins Bodenlose fallen.“ Nur dieser eine Gedanke schießt Nick Leeson durch den Kopf, als er von dem schweren Erdbeben in der westjapanischen Industriestadt Kobe erfährt. Es ist Dienstag, der 17. Januar 1995. „Der Markt“, das ist der japanische Aktienmarkt. Auf diesen hat der 28-jährige Händler der britischen Merchantbank Barings hohe Wetten laufen. Sie gehen nur auf, wenn sich der japanische Aktienindex Nikkei in den nächsten Monaten nicht groß bewegt, nicht unter 19000 Punkte fällt und nicht über 20000 steigt. Nur dann besteht für den „Top-Händler des Jahres 1994 am Singapurer Terminmarkt“ überhaupt eine Chance, seine horrenden, aber gut kaschierten Verluste – mehr als 200 Millionen Dollar – auszugleichen. Ein einstürzender Nikkei würde die Verluste dramatisch ausweiten. Alles würde auffliegen. Der Bluff, sein Geheimkonto, verbotene Transaktionen. Sein Leben wäre ruiniert.
Leesons Ahnung war richtig. Gleich nach der Eröffnung des Marktes bricht der Nikkei regelrecht zusammen, kommt 19000 Punkten bedrohlich nahe. Allein an diesem Dienstag addieren sich weitere 80 Millionen Dollar zu seinen Verlusten. Leeson muss zwischen zwei Extremen wählen: Entweder er kapituliert, oder er setzt alles auf eine Karte. Er entscheidet sich, aufs Ganze zu gehen, will den Markt in seine Richtung lenken – nach oben. Getreu dem alten Händler-Motto „if in trouble, double“ (Verdopple, wenn du schief liegst) beginnt Leeson zu kaufen, was das Zeug hält: 10000 Future-Kontrakte auf den Nikkei am 20. Januar, so viel hatte er noch nie an einem Tag gekauft. Am Folgetag sackt der Index auf 18000 Punkte ab. 30000 Kontrakte am 27. Januar – 19000 Indexpunkte sind noch immer in weiter Ferne. Leeson gelingt es, die rasante Talfahrt zu verlangsamen, stoppen kann er sie nicht.
In den nächsten Tagen verliert Leeson völlig die Kontrolle, handelt wie ein Besessener, addiert nicht einmal mehr die Verluste und wird immer häufiger auf der Toilette gesichtet. Die Schlinge zieht sich zu. Leesons Bosse in London befehlen ihm, Positionen zu verringern, und die Wirtschaftsprüfer verlangen Erklärungen, die der Händler nicht liefern kann, ohne aufzufliegen. In immer kürzeren Abständen fälscht er Urkunden, manipuliert Abwicklungssysteme, vollführt Buchungstricks, um den Anschein zu wahren, alles gehe mit rechten Dingen zu.
Doch das Rad, das Leeson dreht, ist längst zu groß. Am Donnerstag, dem 23. Februar, betritt er ein letztes Mal in dem blau-gelb gestreiften Händlerjackett der Barings Bank die Terminbörse. Wieder sackt der japanische Index ab – deutlich unter 18000 Zähler. Allein dieser Tag bringt Verluste von mehr als 220 Millionen Dollar – Weltrekord für einen einzelnen Händler. Leeson hält fast 50 Prozent aller Risikopositionen in Singapur. Er ist der einzige Käufer weit und breit. Nichts geht mehr. Nach Börsenschluss fliehen er und seine Frau Lisa nach Malaysia.
1,4 Milliarden Dollar Verlust
Erst am nächsten Morgen dämmert es Barings’ Managern in London: Ihr „Wunderhändler“ Leeson, der „Turbo-Arbitrageur“ aus Singapur ist tatsächlich ein Zocker und Betrüger. Entsetzt stellen sie fest, dass Leeson seine Positionen nie abgesichert hat, dass sich seine Wetten auf die Kursbewegungen eines Nominalvolumens von rund 60 Milliarden Dollar beziehen. Sie müssen einräumen, dass die Bank nicht genug Geld hat, um den verlangten Sicherheiten der Terminbörse Simex nachkommen zu können. Die Bank ist zahlungsunfähig. Zerknirscht sehen sie zu, wie die Bank of England, der Regulierer, ihr Institut schließt. Als alle Terminkontrakte Leesons verkauft sind, steht ein Verlust in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar zu Buche. Barings’ Eigenkapital liegt bei 615 Millionen Dollar.
London hat seinen Skandal: Der Sohn eines Handwerkers aus Watford ruiniert eine der feinsten Londoner Bankadressen. Barings ist die Bank der britischen Könige. 1762 wird sie von Francis Baring, dem Sohn eines Bremer Tuchhändlers, als erste reine Merchantbank gegründet: Sie handelt selbst mit Rohstoffen, gleichzeitig finanziert sie den Handel, berät und fädelt Geschäfte ein. Innerhalb weniger Jahrzehnte erlangt sie enormen Einfluss. Im späten 18. Jahrhundert finanziert Barings Britanniens Kriege: den Kampf gegen die abtrünnigen USA, den Feldzug gegen Napoleon. Als die Vereinigten Staaten 1802 den Franzosen den Staat Louisiana abkaufen wollen, gibt es für sie nur eine Geldquelle: Francis Baring. Im frühen 19. Jahrhundert gilt die Bank als Europas „sechste Großmacht“. 180 Jahre später hat sie jene Bedeutung zwar verloren, Ruhm und Arroganz aber sind geblieben – auch weil mit Peter Baring als Chairman die siebte Generation der Familie an den Schalthebeln sitzt.
Genau das schafft die Voraussetzungen für den Skandal: Barings tickt noch immer so wie in der guten alten Zeit vor dem Big Bang von 1985, jenem radikalen Deregulierungsprojekt, das den Londoner Finanzplatz revolutioniert und zum internationalen Zentrum in Europa werden lässt. Mit dem Einzug ausländischer, vor allem amerikanischer, Banken verändert sich das Geschäftsgebaren nachhaltig. Es wird schneller, flexibler und aggressiver. Der Big Bang bedeutet das Ende des Old-Boys-Network und der Bowler-Hüte. Die ehedem einträglichen Nischen der alten Merchantbanks werden immer kleiner. Kaum eine bewahrt ihre Unabhängigkeit: Morgan Grenfell, Kleinwort Benson, Warburg, Schroders, Flemings, sie alle werden von ausländischen Häusern übernommen. Wer in der neuen Bankenwelt etwas werden will, muss nicht mehr in Oxford studiert haben, sondern Geld verdienen für sein Haus. Es ist der Beginn der Yuppie-Ära.
Barings überlebt den Big Bang, passt sich aber nicht an. Das Leitbild bleibt das des Gentlemans, das Motto: „Überwachung ist gut, Vertrauen ist billiger.“ So ist der Anfang von Barings’ Ende leicht definiert: Mitte 1992, als Leeson nach Singapur geschickt wird, um den Derivate-Handel aufzubauen. Wider besseres Wissen verstoßen die Vorgesetzten gegen eine uralte Vorsichtsmaßnahme beim Wertpapierhandel: Lass den Händler nie die Abwicklung seiner eigenen Transaktionen übernehmen. Die Versuchung ist zu groß, Verluste zu verschleiern und Gewinne zu manipulieren. Leeson erliegt der Versuchung. Der Junge aus einfachen Verhältnissen will ein berühmter Händler werden und viel Geld verdienen. Bei Barings bekommt er die besten Karten dafür. Er ist Händler und Abwickler zugleich. Auch nachdem interne Prüfer anregen, einen Mitarbeiter für die Überprüfung und Buchung von Leesons Geschäften abzustellen, ändert sich nichts. „Zu wenig zu tun und zu teuer“, befinden die feinen Manager in London.
Leeson soll in Singapur den Arbitragehandel aufbauen und Kundengeschäfte ausführen. Ein fast risikoloses Geschäft. Geringe Preisdifferenzen in den japanischen Derivaten, die parallel an der japanischen Terminbörse in Osaka und in Singapur gehandelt werden, soll er ausnutzen. Den Kontrakt dort verkaufen, wo gerade der höhere Preis zu erzielen ist und gleichzeitig dort kaufen, wo er zum niedrigeren angeboten wird. Eigenhandel, mit dem Geld der Bank auf steigende und fallende Kurse zu spekulieren, ist ihm strikt untersagt. Doch genau das tut Leeson, und niemand in London wundert sich, wie sein vermeintlich risikoloses Geschäft derartige Gewinne abwerfen kann. Leeson scheint die moderne Finanztheorie zu widerlegen: kein Risiko, aber satte Renditen.
In Wirklichkeit macht Leeson alles, aber kaum Arbitrage. Das Vehikel für seinen Betrug ist das Konto mit der Nummer 88888, fünfmal die chinesische Glückszahl. Dieses Geheimkonto benutzt er, um die Verluste und nicht genehmigten offenen Positionen zu verbergen. Auf dem Handelsparkett stellt Leeson die besten Kurse. Bietet die Konkurrenz einen Kontrakt für 1950 Yen an, verlangt Leeson nur 1940. Kauft die Konkurrenz für 1920 Yen, zahlt Leeson 1930. Er kalkuliert so knapp, dass er oft Geld an seine Handelspartner verschenkt. Die Verluste wandern auf das Konto 88888. Bald stehen die Kunden Schlange, um mit Leeson zu handeln. Die Terminbörse ehrt ihren aktivsten Händler. Dabei ist Leeson ein gnadenlos schlechter Händler. Schon in seinem ersten Monat an der Simex verliert er 60000 Dollar. Nur einmal, Mitte 1993, gelingt es ihm, seinen Gesamtverlust in Höhe von knapp 10 Millionen Dollar durch gewagte Transaktionen in Gewinne zu wandeln. Leeson ist total erleichtert und schwört sich, nie wieder Positionen zu verstecken. Doch sein riskantes Spiel geht nicht spurlos an ihm vorbei. Er kaut Fingernägel, stopft unablässig Bonbons in sich hinein und trinkt immer mehr Alkohol. Der Vorsatz hält nicht lange. Schon einen Tag später erliegt er der Verführung von Konto 88888.
Das schwarze Konto 88888
Unterdessen macht er sich in London beliebt, indem er ansehnliche Gewinne ausweist – mehr als ein Fünftel des Gewinns der Gesamtbank. Nur: Der Gegenposten ist ein Verlust auf dem Konto 88888, der Gewinn hat also nie existiert. Um sein Geheimkonto nicht auffliegen zu lassen, muss Leeson Geschäfte frisieren, Gelder umbuchen, Optionen verkaufen und Lügen erzählen. Als Abwicklungskünstler ist er brillant. Bis zum letzten Tag gehen die Londoner Kontrolleure davon aus, dass die hohen offenen Positionen Kunden gehören, für die Barings lediglich handelt. Sie überweisen fast wöchentlich mehr Geld nach Singapur, um die Sicherheitsleistungen für die Terminbörse zu erfüllen. Sie fragen aber nie nach, für welche Kunden sie eigentlich die Millionen überweisen.
Das Ende des Falls Barings ist rasch erzählt: Der holländische Finanzkonzern ING übernimmt die britische Nobeladresse für den symbolischen Preis von einem Pfund. Die Führungsebene wird fast komplett ausgetauscht. Der Name Barings verschwindet im April 2002 endgültig. Nick Leeson wird zu einer tragischen Figur. Im Moment seiner Niederlage erreicht er, wovon er immer geträumt hat: Er ist auf einen Schlag weltberühmt. Seine Flucht endet auf dem Frankfurter Flughafen, wo die Journalistenmeute schon auf ihn wartet. Großbritannien stellt kein Auslieferungsersuchen. London will es vermeiden, den Ruf seines Finanzplatzes durch diesen spektakulären Fall noch weiter zu schädigen. Auch die zuständige Aufsichtsbehörde, die Bank of England, hat keine rechte Lust, ihr eklatantes Versagen allzu ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert zu sehen. Nick Leeson wird in Singapur zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Bald darauf verlässt ihn seine Frau, sein einziger Halt, und heiratet einen erfolgreicheren Händler. Leeson erkrankt an Krebs und wird in der Haft operiert. Als er nach vier Jahren wegen guter Führung vorzeitig entlassen wird, steht er wieder im Mittelpunkt. Er bedient die Sehnsüchte und Klischees der Massen. Der gefallene Starhändler, das Arbeiterkind, das als Sündenbock für die Managementfehler herhalten muss. Leeson kehrt nach England zurück, kämpft gegen seinen Krebs und wird zum gefragten Konferenzredner.
Der Fall Barings wird zum Lehrstück des Finanz- und Risikomanagements. Niemals wurde so eklatant gegen die Vorsichtsprinzipien im Bankgeschäft verstoßen und so offensichtlich. Im September 1993 erklärt Peter Baring zufrieden: „Bei Barings setzte sich die Ansicht durch, dass es eigentlich gar nicht so schrecklich schwer ist, im Wertpapiergeschäft Geld zu machen.“ – Hochmut kommt vor dem Fall.
Der Mann, die Gier, das Debakel:
Wie der betrügerische Spekulant Nick Leeson die britische Barings Bank zu Fall brachte
Von Robert von Heusinger
Der Markt wird ins Bodenlose fallen.“ Nur dieser eine Gedanke schießt Nick Leeson durch den Kopf, als er von dem schweren Erdbeben in der westjapanischen Industriestadt Kobe erfährt. Es ist Dienstag, der 17. Januar 1995. „Der Markt“, das ist der japanische Aktienmarkt. Auf diesen hat der 28-jährige Händler der britischen Merchantbank Barings hohe Wetten laufen. Sie gehen nur auf, wenn sich der japanische Aktienindex Nikkei in den nächsten Monaten nicht groß bewegt, nicht unter 19000 Punkte fällt und nicht über 20000 steigt. Nur dann besteht für den „Top-Händler des Jahres 1994 am Singapurer Terminmarkt“ überhaupt eine Chance, seine horrenden, aber gut kaschierten Verluste – mehr als 200 Millionen Dollar – auszugleichen. Ein einstürzender Nikkei würde die Verluste dramatisch ausweiten. Alles würde auffliegen. Der Bluff, sein Geheimkonto, verbotene Transaktionen. Sein Leben wäre ruiniert.
Leesons Ahnung war richtig. Gleich nach der Eröffnung des Marktes bricht der Nikkei regelrecht zusammen, kommt 19000 Punkten bedrohlich nahe. Allein an diesem Dienstag addieren sich weitere 80 Millionen Dollar zu seinen Verlusten. Leeson muss zwischen zwei Extremen wählen: Entweder er kapituliert, oder er setzt alles auf eine Karte. Er entscheidet sich, aufs Ganze zu gehen, will den Markt in seine Richtung lenken – nach oben. Getreu dem alten Händler-Motto „if in trouble, double“ (Verdopple, wenn du schief liegst) beginnt Leeson zu kaufen, was das Zeug hält: 10000 Future-Kontrakte auf den Nikkei am 20. Januar, so viel hatte er noch nie an einem Tag gekauft. Am Folgetag sackt der Index auf 18000 Punkte ab. 30000 Kontrakte am 27. Januar – 19000 Indexpunkte sind noch immer in weiter Ferne. Leeson gelingt es, die rasante Talfahrt zu verlangsamen, stoppen kann er sie nicht.
In den nächsten Tagen verliert Leeson völlig die Kontrolle, handelt wie ein Besessener, addiert nicht einmal mehr die Verluste und wird immer häufiger auf der Toilette gesichtet. Die Schlinge zieht sich zu. Leesons Bosse in London befehlen ihm, Positionen zu verringern, und die Wirtschaftsprüfer verlangen Erklärungen, die der Händler nicht liefern kann, ohne aufzufliegen. In immer kürzeren Abständen fälscht er Urkunden, manipuliert Abwicklungssysteme, vollführt Buchungstricks, um den Anschein zu wahren, alles gehe mit rechten Dingen zu.
Doch das Rad, das Leeson dreht, ist längst zu groß. Am Donnerstag, dem 23. Februar, betritt er ein letztes Mal in dem blau-gelb gestreiften Händlerjackett der Barings Bank die Terminbörse. Wieder sackt der japanische Index ab – deutlich unter 18000 Zähler. Allein dieser Tag bringt Verluste von mehr als 220 Millionen Dollar – Weltrekord für einen einzelnen Händler. Leeson hält fast 50 Prozent aller Risikopositionen in Singapur. Er ist der einzige Käufer weit und breit. Nichts geht mehr. Nach Börsenschluss fliehen er und seine Frau Lisa nach Malaysia.
1,4 Milliarden Dollar Verlust
Erst am nächsten Morgen dämmert es Barings’ Managern in London: Ihr „Wunderhändler“ Leeson, der „Turbo-Arbitrageur“ aus Singapur ist tatsächlich ein Zocker und Betrüger. Entsetzt stellen sie fest, dass Leeson seine Positionen nie abgesichert hat, dass sich seine Wetten auf die Kursbewegungen eines Nominalvolumens von rund 60 Milliarden Dollar beziehen. Sie müssen einräumen, dass die Bank nicht genug Geld hat, um den verlangten Sicherheiten der Terminbörse Simex nachkommen zu können. Die Bank ist zahlungsunfähig. Zerknirscht sehen sie zu, wie die Bank of England, der Regulierer, ihr Institut schließt. Als alle Terminkontrakte Leesons verkauft sind, steht ein Verlust in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar zu Buche. Barings’ Eigenkapital liegt bei 615 Millionen Dollar.
London hat seinen Skandal: Der Sohn eines Handwerkers aus Watford ruiniert eine der feinsten Londoner Bankadressen. Barings ist die Bank der britischen Könige. 1762 wird sie von Francis Baring, dem Sohn eines Bremer Tuchhändlers, als erste reine Merchantbank gegründet: Sie handelt selbst mit Rohstoffen, gleichzeitig finanziert sie den Handel, berät und fädelt Geschäfte ein. Innerhalb weniger Jahrzehnte erlangt sie enormen Einfluss. Im späten 18. Jahrhundert finanziert Barings Britanniens Kriege: den Kampf gegen die abtrünnigen USA, den Feldzug gegen Napoleon. Als die Vereinigten Staaten 1802 den Franzosen den Staat Louisiana abkaufen wollen, gibt es für sie nur eine Geldquelle: Francis Baring. Im frühen 19. Jahrhundert gilt die Bank als Europas „sechste Großmacht“. 180 Jahre später hat sie jene Bedeutung zwar verloren, Ruhm und Arroganz aber sind geblieben – auch weil mit Peter Baring als Chairman die siebte Generation der Familie an den Schalthebeln sitzt.
Genau das schafft die Voraussetzungen für den Skandal: Barings tickt noch immer so wie in der guten alten Zeit vor dem Big Bang von 1985, jenem radikalen Deregulierungsprojekt, das den Londoner Finanzplatz revolutioniert und zum internationalen Zentrum in Europa werden lässt. Mit dem Einzug ausländischer, vor allem amerikanischer, Banken verändert sich das Geschäftsgebaren nachhaltig. Es wird schneller, flexibler und aggressiver. Der Big Bang bedeutet das Ende des Old-Boys-Network und der Bowler-Hüte. Die ehedem einträglichen Nischen der alten Merchantbanks werden immer kleiner. Kaum eine bewahrt ihre Unabhängigkeit: Morgan Grenfell, Kleinwort Benson, Warburg, Schroders, Flemings, sie alle werden von ausländischen Häusern übernommen. Wer in der neuen Bankenwelt etwas werden will, muss nicht mehr in Oxford studiert haben, sondern Geld verdienen für sein Haus. Es ist der Beginn der Yuppie-Ära.
Barings überlebt den Big Bang, passt sich aber nicht an. Das Leitbild bleibt das des Gentlemans, das Motto: „Überwachung ist gut, Vertrauen ist billiger.“ So ist der Anfang von Barings’ Ende leicht definiert: Mitte 1992, als Leeson nach Singapur geschickt wird, um den Derivate-Handel aufzubauen. Wider besseres Wissen verstoßen die Vorgesetzten gegen eine uralte Vorsichtsmaßnahme beim Wertpapierhandel: Lass den Händler nie die Abwicklung seiner eigenen Transaktionen übernehmen. Die Versuchung ist zu groß, Verluste zu verschleiern und Gewinne zu manipulieren. Leeson erliegt der Versuchung. Der Junge aus einfachen Verhältnissen will ein berühmter Händler werden und viel Geld verdienen. Bei Barings bekommt er die besten Karten dafür. Er ist Händler und Abwickler zugleich. Auch nachdem interne Prüfer anregen, einen Mitarbeiter für die Überprüfung und Buchung von Leesons Geschäften abzustellen, ändert sich nichts. „Zu wenig zu tun und zu teuer“, befinden die feinen Manager in London.
Leeson soll in Singapur den Arbitragehandel aufbauen und Kundengeschäfte ausführen. Ein fast risikoloses Geschäft. Geringe Preisdifferenzen in den japanischen Derivaten, die parallel an der japanischen Terminbörse in Osaka und in Singapur gehandelt werden, soll er ausnutzen. Den Kontrakt dort verkaufen, wo gerade der höhere Preis zu erzielen ist und gleichzeitig dort kaufen, wo er zum niedrigeren angeboten wird. Eigenhandel, mit dem Geld der Bank auf steigende und fallende Kurse zu spekulieren, ist ihm strikt untersagt. Doch genau das tut Leeson, und niemand in London wundert sich, wie sein vermeintlich risikoloses Geschäft derartige Gewinne abwerfen kann. Leeson scheint die moderne Finanztheorie zu widerlegen: kein Risiko, aber satte Renditen.
In Wirklichkeit macht Leeson alles, aber kaum Arbitrage. Das Vehikel für seinen Betrug ist das Konto mit der Nummer 88888, fünfmal die chinesische Glückszahl. Dieses Geheimkonto benutzt er, um die Verluste und nicht genehmigten offenen Positionen zu verbergen. Auf dem Handelsparkett stellt Leeson die besten Kurse. Bietet die Konkurrenz einen Kontrakt für 1950 Yen an, verlangt Leeson nur 1940. Kauft die Konkurrenz für 1920 Yen, zahlt Leeson 1930. Er kalkuliert so knapp, dass er oft Geld an seine Handelspartner verschenkt. Die Verluste wandern auf das Konto 88888. Bald stehen die Kunden Schlange, um mit Leeson zu handeln. Die Terminbörse ehrt ihren aktivsten Händler. Dabei ist Leeson ein gnadenlos schlechter Händler. Schon in seinem ersten Monat an der Simex verliert er 60000 Dollar. Nur einmal, Mitte 1993, gelingt es ihm, seinen Gesamtverlust in Höhe von knapp 10 Millionen Dollar durch gewagte Transaktionen in Gewinne zu wandeln. Leeson ist total erleichtert und schwört sich, nie wieder Positionen zu verstecken. Doch sein riskantes Spiel geht nicht spurlos an ihm vorbei. Er kaut Fingernägel, stopft unablässig Bonbons in sich hinein und trinkt immer mehr Alkohol. Der Vorsatz hält nicht lange. Schon einen Tag später erliegt er der Verführung von Konto 88888.
Das schwarze Konto 88888
Unterdessen macht er sich in London beliebt, indem er ansehnliche Gewinne ausweist – mehr als ein Fünftel des Gewinns der Gesamtbank. Nur: Der Gegenposten ist ein Verlust auf dem Konto 88888, der Gewinn hat also nie existiert. Um sein Geheimkonto nicht auffliegen zu lassen, muss Leeson Geschäfte frisieren, Gelder umbuchen, Optionen verkaufen und Lügen erzählen. Als Abwicklungskünstler ist er brillant. Bis zum letzten Tag gehen die Londoner Kontrolleure davon aus, dass die hohen offenen Positionen Kunden gehören, für die Barings lediglich handelt. Sie überweisen fast wöchentlich mehr Geld nach Singapur, um die Sicherheitsleistungen für die Terminbörse zu erfüllen. Sie fragen aber nie nach, für welche Kunden sie eigentlich die Millionen überweisen.
Das Ende des Falls Barings ist rasch erzählt: Der holländische Finanzkonzern ING übernimmt die britische Nobeladresse für den symbolischen Preis von einem Pfund. Die Führungsebene wird fast komplett ausgetauscht. Der Name Barings verschwindet im April 2002 endgültig. Nick Leeson wird zu einer tragischen Figur. Im Moment seiner Niederlage erreicht er, wovon er immer geträumt hat: Er ist auf einen Schlag weltberühmt. Seine Flucht endet auf dem Frankfurter Flughafen, wo die Journalistenmeute schon auf ihn wartet. Großbritannien stellt kein Auslieferungsersuchen. London will es vermeiden, den Ruf seines Finanzplatzes durch diesen spektakulären Fall noch weiter zu schädigen. Auch die zuständige Aufsichtsbehörde, die Bank of England, hat keine rechte Lust, ihr eklatantes Versagen allzu ausführlich in der Öffentlichkeit diskutiert zu sehen. Nick Leeson wird in Singapur zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Bald darauf verlässt ihn seine Frau, sein einziger Halt, und heiratet einen erfolgreicheren Händler. Leeson erkrankt an Krebs und wird in der Haft operiert. Als er nach vier Jahren wegen guter Führung vorzeitig entlassen wird, steht er wieder im Mittelpunkt. Er bedient die Sehnsüchte und Klischees der Massen. Der gefallene Starhändler, das Arbeiterkind, das als Sündenbock für die Managementfehler herhalten muss. Leeson kehrt nach England zurück, kämpft gegen seinen Krebs und wird zum gefragten Konferenzredner.
Der Fall Barings wird zum Lehrstück des Finanz- und Risikomanagements. Niemals wurde so eklatant gegen die Vorsichtsprinzipien im Bankgeschäft verstoßen und so offensichtlich. Im September 1993 erklärt Peter Baring zufrieden: „Bei Barings setzte sich die Ansicht durch, dass es eigentlich gar nicht so schrecklich schwer ist, im Wertpapiergeschäft Geld zu machen.“ – Hochmut kommt vor dem Fall.
@konradi
#331
der Artikel zu Nick Leeson war echt gut
hatte nur noch im Gedächtnis dass es Lesson
einmal schaffte durch Derivatenhandel den
Markt in Honkong so zu beeinflussen dass der
Markt drehte.
Aber ewig kann man nicht gegen den Markt manipulieren.
Ist wie bei Gold-Future-Handel ewig können
Bullion-Banken wie JP-Morgan nicht
gegen den Markttrend agieren.
Und schön ist auch zu wissen das JP-Morgan von
Chase Manhatten aufgekauft wurde sonst wäre
JP-Morgan schon pleite.
#331
der Artikel zu Nick Leeson war echt gut
hatte nur noch im Gedächtnis dass es Lesson
einmal schaffte durch Derivatenhandel den
Markt in Honkong so zu beeinflussen dass der
Markt drehte.
Aber ewig kann man nicht gegen den Markt manipulieren.
Ist wie bei Gold-Future-Handel ewig können
Bullion-Banken wie JP-Morgan nicht
gegen den Markttrend agieren.
Und schön ist auch zu wissen das JP-Morgan von
Chase Manhatten aufgekauft wurde sonst wäre
JP-Morgan schon pleite.
Hi keepit,
nett von Dir zu hören, dass auch "off-topics"
auf Interesse stoßen -
Gruß Konradi
nett von Dir zu hören, dass auch "off-topics"
auf Interesse stoßen -
Gruß Konradi

Die Welt 15.04.2003
Gold-Fans glauben an die nächste Rallye
Preis des Edelmetalls befindet sich in Konsolidierungsphase - Experten sehen langfristig wieder Aufwärtspotenzial
von Daniel Eckert
Dem sagenhaften König Midas wäre seine Vorliebe für Gold beinahe zum Verhängnis worden. Alles, was er berührte, verwandelte sich in Gold - dummerweise auch Getränke und Speisen. Besser erging es Anlegern, die im zurückliegenden Winter auf Gold setzten. Allein zwischen Oktober und Februar legte der Wert des Edelmetalls im Londoner Fixing um rund 20 Prozent zu. Am 5. Februar erreichte er mit 385 Dollar je Feinunze ein langjähriges Hoch.
Wer schon Anfang 2002 den richtigen Riecher hatte und sich mit Goldbarren, -münzen oder -zertifikaten eindeckte, konnte sich innerhalb von zwölf Monaten über eine Wertsteigerung von stattlichen 35 Prozent freuen. Die Freude war umso größer, da die wichtigsten Aktienmärkte der Welt in dieser Zeit um bis zu 50 Prozent einknickten.
Doch mit der Hausse am Goldmarkt scheint es nun erst einmal vorbei zu sein. Bereits in den Wochen vor Ausbruch des Irak-Kriegs war der Kurs stark ins Rutschen gekommen. Inzwischen ist er auf 323,20 Dollar je Feinunze zurückgefallen. Das ist der tiefste Stand sei vier Monaten.
"Was wir am Goldmarkt im Winter gesehen haben, war eine typische Überhitzung", sagt Stefan Gresse, Goldexperte bei ABN Amro. "Jetzt baut sich der Kriegsaufschlag ab." Auch Gernot Rumpf, Fondsmanager bei Union Investment, ist der Meinung, dass sich "Preisexzesse" von um die 380 Dollar je Feinunze so schnell nicht wieder einstellen werden. Die Korrektur werde sich noch eine Weile fortsetzten.
Wolfgang Wrzesniok, Leiter des Edelmetall- und Rohstoffhandels bei Dresdner Kleinwort Wasserstein, hat indessen beobachtet, dass es unterhalb von 330 Dollar bereits wieder zu Käufen kommt, die den Kurs stützen. Umgekehrt streiken derzeit viele indische und fernöstliche Käufer bei Kursen oberhalb von 340 Dollar. Aus diesem Grund glaubt Axel Breil von der Bankgesellschaft Berlin, dass sich der Goldpreis im kommenden halben Jahr zwischen 330 bis 340 Dollar bewegen wird.
Alles in allem sind die meisten Marktbeobachter der Meinung, dass der langfristige Trend hin zu höheren Goldpreisen intakt ist. Immerhin zehn von 21 Analysten, die die Nachrichtenagentur Reuters befragte, sehen im Jahresschnitt einen Preis von 350 Dollar je Feinunze oder darüber.
Grund für diese Wiederentdeckung des gelben Metalls ist ein Paradigmenwechsel bei den Investoren. "Wir beobachten bei der Anlageentscheidung eine Verlagerung von der Rendite zu Sicherheit", sagt Gresse. Deshalb könne das Gold für Anleger, deren Risikoneigung sehr gering geworden ist, in ganz ungekannter Weise interessant werden.
Physisches Gold ist aber vor allem eine Sache für Liebhaber und Apokalyptiker [ ], die befürchten, dass das Weltfinanzsystem über Nacht zusammenbrechen könnte. Für ABN Amro hat Gresse daher eine Reihe von Zertifikaten entwickelt, mit denen Anleger mit unterschiedlichsten Hebeln an der Dynamik des Goldpreises teilhaben können.
], die befürchten, dass das Weltfinanzsystem über Nacht zusammenbrechen könnte. Für ABN Amro hat Gresse daher eine Reihe von Zertifikaten entwickelt, mit denen Anleger mit unterschiedlichsten Hebeln an der Dynamik des Goldpreises teilhaben können.
Wer auf einen steigenden Goldpreis setzt und es etwas Spekulative mag, sollte sich an die Aktien von Minengesellschaften halten. "Eine Faustregel besagt, dass Goldaktien Bewegungen des Rohstoffs um den Faktor zwei bis drei verstärken", sagt Martin Siegel, Fondsmanager des PEH-Q-Goldmines. Das gilt jedoch nur für Goldproduzenten, die kein oder nur wenig "Hedging" betreiben, ihre Produktion also nicht schon Jahre im Voraus zu einem festgesetzten Preis verkaufen. "Wer Gold, das er 2005 fördert, zum heutigen Kurs verkauft, hat von zwischenzeitlich steigenden Preisen keinen Vorteil", erklärt Siegel.
Interessant unter diesem Gesichtspunkt sind die Aktien der südafrikanischen Gesellschaften Gold Fields und Harmony sowie der australischen Kingsgate und Croesus Mining.
Gold-Fans glauben an die nächste Rallye
Preis des Edelmetalls befindet sich in Konsolidierungsphase - Experten sehen langfristig wieder Aufwärtspotenzial
von Daniel Eckert
Dem sagenhaften König Midas wäre seine Vorliebe für Gold beinahe zum Verhängnis worden. Alles, was er berührte, verwandelte sich in Gold - dummerweise auch Getränke und Speisen. Besser erging es Anlegern, die im zurückliegenden Winter auf Gold setzten. Allein zwischen Oktober und Februar legte der Wert des Edelmetalls im Londoner Fixing um rund 20 Prozent zu. Am 5. Februar erreichte er mit 385 Dollar je Feinunze ein langjähriges Hoch.
Wer schon Anfang 2002 den richtigen Riecher hatte und sich mit Goldbarren, -münzen oder -zertifikaten eindeckte, konnte sich innerhalb von zwölf Monaten über eine Wertsteigerung von stattlichen 35 Prozent freuen. Die Freude war umso größer, da die wichtigsten Aktienmärkte der Welt in dieser Zeit um bis zu 50 Prozent einknickten.
Doch mit der Hausse am Goldmarkt scheint es nun erst einmal vorbei zu sein. Bereits in den Wochen vor Ausbruch des Irak-Kriegs war der Kurs stark ins Rutschen gekommen. Inzwischen ist er auf 323,20 Dollar je Feinunze zurückgefallen. Das ist der tiefste Stand sei vier Monaten.
"Was wir am Goldmarkt im Winter gesehen haben, war eine typische Überhitzung", sagt Stefan Gresse, Goldexperte bei ABN Amro. "Jetzt baut sich der Kriegsaufschlag ab." Auch Gernot Rumpf, Fondsmanager bei Union Investment, ist der Meinung, dass sich "Preisexzesse" von um die 380 Dollar je Feinunze so schnell nicht wieder einstellen werden. Die Korrektur werde sich noch eine Weile fortsetzten.
Wolfgang Wrzesniok, Leiter des Edelmetall- und Rohstoffhandels bei Dresdner Kleinwort Wasserstein, hat indessen beobachtet, dass es unterhalb von 330 Dollar bereits wieder zu Käufen kommt, die den Kurs stützen. Umgekehrt streiken derzeit viele indische und fernöstliche Käufer bei Kursen oberhalb von 340 Dollar. Aus diesem Grund glaubt Axel Breil von der Bankgesellschaft Berlin, dass sich der Goldpreis im kommenden halben Jahr zwischen 330 bis 340 Dollar bewegen wird.
Alles in allem sind die meisten Marktbeobachter der Meinung, dass der langfristige Trend hin zu höheren Goldpreisen intakt ist. Immerhin zehn von 21 Analysten, die die Nachrichtenagentur Reuters befragte, sehen im Jahresschnitt einen Preis von 350 Dollar je Feinunze oder darüber.
Grund für diese Wiederentdeckung des gelben Metalls ist ein Paradigmenwechsel bei den Investoren. "Wir beobachten bei der Anlageentscheidung eine Verlagerung von der Rendite zu Sicherheit", sagt Gresse. Deshalb könne das Gold für Anleger, deren Risikoneigung sehr gering geworden ist, in ganz ungekannter Weise interessant werden.
Physisches Gold ist aber vor allem eine Sache für Liebhaber und Apokalyptiker [
 ], die befürchten, dass das Weltfinanzsystem über Nacht zusammenbrechen könnte. Für ABN Amro hat Gresse daher eine Reihe von Zertifikaten entwickelt, mit denen Anleger mit unterschiedlichsten Hebeln an der Dynamik des Goldpreises teilhaben können.
], die befürchten, dass das Weltfinanzsystem über Nacht zusammenbrechen könnte. Für ABN Amro hat Gresse daher eine Reihe von Zertifikaten entwickelt, mit denen Anleger mit unterschiedlichsten Hebeln an der Dynamik des Goldpreises teilhaben können. Wer auf einen steigenden Goldpreis setzt und es etwas Spekulative mag, sollte sich an die Aktien von Minengesellschaften halten. "Eine Faustregel besagt, dass Goldaktien Bewegungen des Rohstoffs um den Faktor zwei bis drei verstärken", sagt Martin Siegel, Fondsmanager des PEH-Q-Goldmines. Das gilt jedoch nur für Goldproduzenten, die kein oder nur wenig "Hedging" betreiben, ihre Produktion also nicht schon Jahre im Voraus zu einem festgesetzten Preis verkaufen. "Wer Gold, das er 2005 fördert, zum heutigen Kurs verkauft, hat von zwischenzeitlich steigenden Preisen keinen Vorteil", erklärt Siegel.
Interessant unter diesem Gesichtspunkt sind die Aktien der südafrikanischen Gesellschaften Gold Fields und Harmony sowie der australischen Kingsgate und Croesus Mining.
DIE WELT 05.04.2003
Analysten sehen jetzt bei Aktien historisch niedrige Preise
Deutscher Markt am stärksten unterbewertet
Egal welchen Maßstab man anlegt - die Aktienmärkte sind nach Aussagen von Volkswirten und Börsenexperten derzeit deutlich unterbewertet.
Allerdings sei es unmöglich, schon von einer Bodenbildung zu sprechen und dem Anleger damit wieder zum Kauf von Aktien zu raten. Die noch unklaren Folgen des Irak-Kriegs für die Weltwirtschaft und die Preisschwankungen beim Öl machten Prognosen kaum möglich und überlagerten an den Aktienmärkten aktuell auch grundsätzliche Bewertungsansätze.
Ohnehin hatten zahlreiche Experten schon kurz nach Beginn des historischen Kursrutsches an den Märkten in Deutschland vor nun rund drei Jahren immer wieder vergeblich das Ende der Talfahrt beschworen.
"Im Vergleich zu Anleihen sind Aktien derzeit historisch billig", sagt Frank Bulthaupt, Volkswirt der Dresdner Bank. Dabei seien die europäischen Märkte noch stärker unterbewertet als der US-Markt. Seit den Höchstständen im Frühjahr 2000 hat der Dow Jones rund 30 Prozent verloren, der europäische Stoxx-50-Index mit rund 60 Prozent deutlich mehr und der Dax sogar 70 Prozent auf derzeit gerade noch rund 2600 Punkte.
Beim Vergleich der Experten von Aktien- zu Rentenmärkten wird meist die Gewinnrendite eines Aktienindexes ins Verhältnis gesetzt zur Rendite lang laufender Staatsanleihen. Weil Aktien im Vergleich als risikoreichere Papiere gelten, ist in der Regel ihre Gewinnrendite höher als die Anleiherendite. Dieser Aufschlag wird als Risikoprämie bezeichnet. "Auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr liegt die Dax-Aktienrendite derzeit bei 8,2 Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen im Euroraum", erläutert Bulthaupt. "Dieser Renditeabstand ist enorm."
Bulthaupts Fazit zur Begründung der aktuell niedrigen Kursniveaus lautet daher: "Die Anleger verlangen derzeit eine enorm hohe Risikoprämie bei Aktien - vor allem wegen des Irak-Krieges, aber auch wegen des geschwundenen Vertrauens in den Aktienmarkt. Wegen dieser hohen Prämie sind Aktien im Vergleich zu Anleihen so preiswert." Sollte der Irak-Krieg aber nicht lange dauern, dann könnte diese Prämie laut Bulthaupt schnell sinken und die Märkte legten somit zu.
Jörg Krämer von Invesco Asset Management arbeitet mit einem ähnlichen Bewertungsmodell, das Aktien- und Anleihemarkt vergleicht. "Die europäischen Aktien sind derzeit 40 Prozent unterbewertet", urteilt er. "Selbst wenn für den Euroraum noch deutliche Revisionen bei den Unternehmensgewinnen kämen, bliebe eine Unterbewertung von 20 Prozent."
Oliver Rupprecht, Leiter des Research Private Banking bei der NordLB, bewertet den deutschen Markt unter anderem, indem er das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Indexes mit einem mehrjährigen Durchschnitt vergleicht. "Danach kommen wir zu einem fairen Dax-Wert von 2800 Punkten."
Soll der Anleger jetzt also einsteigen? Roland Ziegler, Aktienstratege bei der ING BHF-Bank gibt ein warnendes Beispiel: "Vor einem Jahr stand der Dax bei 5200 Punkten und galt als historisch niedrig bewertet."
Analysten sehen jetzt bei Aktien historisch niedrige Preise
Deutscher Markt am stärksten unterbewertet
Egal welchen Maßstab man anlegt - die Aktienmärkte sind nach Aussagen von Volkswirten und Börsenexperten derzeit deutlich unterbewertet.
Allerdings sei es unmöglich, schon von einer Bodenbildung zu sprechen und dem Anleger damit wieder zum Kauf von Aktien zu raten. Die noch unklaren Folgen des Irak-Kriegs für die Weltwirtschaft und die Preisschwankungen beim Öl machten Prognosen kaum möglich und überlagerten an den Aktienmärkten aktuell auch grundsätzliche Bewertungsansätze.
Ohnehin hatten zahlreiche Experten schon kurz nach Beginn des historischen Kursrutsches an den Märkten in Deutschland vor nun rund drei Jahren immer wieder vergeblich das Ende der Talfahrt beschworen.
"Im Vergleich zu Anleihen sind Aktien derzeit historisch billig", sagt Frank Bulthaupt, Volkswirt der Dresdner Bank. Dabei seien die europäischen Märkte noch stärker unterbewertet als der US-Markt. Seit den Höchstständen im Frühjahr 2000 hat der Dow Jones rund 30 Prozent verloren, der europäische Stoxx-50-Index mit rund 60 Prozent deutlich mehr und der Dax sogar 70 Prozent auf derzeit gerade noch rund 2600 Punkte.
Beim Vergleich der Experten von Aktien- zu Rentenmärkten wird meist die Gewinnrendite eines Aktienindexes ins Verhältnis gesetzt zur Rendite lang laufender Staatsanleihen. Weil Aktien im Vergleich als risikoreichere Papiere gelten, ist in der Regel ihre Gewinnrendite höher als die Anleiherendite. Dieser Aufschlag wird als Risikoprämie bezeichnet. "Auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr liegt die Dax-Aktienrendite derzeit bei 8,2 Prozent und ist damit fast doppelt so hoch wie die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen im Euroraum", erläutert Bulthaupt. "Dieser Renditeabstand ist enorm."
Bulthaupts Fazit zur Begründung der aktuell niedrigen Kursniveaus lautet daher: "Die Anleger verlangen derzeit eine enorm hohe Risikoprämie bei Aktien - vor allem wegen des Irak-Krieges, aber auch wegen des geschwundenen Vertrauens in den Aktienmarkt. Wegen dieser hohen Prämie sind Aktien im Vergleich zu Anleihen so preiswert." Sollte der Irak-Krieg aber nicht lange dauern, dann könnte diese Prämie laut Bulthaupt schnell sinken und die Märkte legten somit zu.
Jörg Krämer von Invesco Asset Management arbeitet mit einem ähnlichen Bewertungsmodell, das Aktien- und Anleihemarkt vergleicht. "Die europäischen Aktien sind derzeit 40 Prozent unterbewertet", urteilt er. "Selbst wenn für den Euroraum noch deutliche Revisionen bei den Unternehmensgewinnen kämen, bliebe eine Unterbewertung von 20 Prozent."
Oliver Rupprecht, Leiter des Research Private Banking bei der NordLB, bewertet den deutschen Markt unter anderem, indem er das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Indexes mit einem mehrjährigen Durchschnitt vergleicht. "Danach kommen wir zu einem fairen Dax-Wert von 2800 Punkten."
Soll der Anleger jetzt also einsteigen? Roland Ziegler, Aktienstratege bei der ING BHF-Bank gibt ein warnendes Beispiel: "Vor einem Jahr stand der Dax bei 5200 Punkten und galt als historisch niedrig bewertet."
.
Düstere Aussicht: Alles wird noch schlimmer
Von Carsten Germis und Rainer Hank
Die Stimmung könnte schlechter kaum sein. Wenn Kanzler Gerhard Schröder an diesem Sonntag in seiner Heimatstadt Hannover die größte Industrieschau der Welt eröffnet, dann wird er bei den Unternehmern auf wenig Begeisterung treffen: Der Krieg im Irak lähmt die Weltwirtschaft, die Globalisierung macht schon seit geraumer Zeit Pause, und in Asien, der einzigen Hoffnungsregion der Welt, grassiert die Krankheit SARS, die das Wirschaftsleben zu lähmen droht. Düstere Aussichten sind das für die traditionell exportorientierte deutsche Industrie.
"Gründe für Optimismus lassen sich kaum finden", klagt Michael Rogowski, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Ein ums andere Mal haben seine Experten in den vergangenen Monaten ihre Prognosen nach unten korrigiert. Ein halbes Prozent Wachstum hat der BDI zuletzt für Deutschland veranschlagt. Jetzt sind alle froh, wenn die deutsche Wirtschaft, ohne zu schrumpfen, aus diesem Jahr herausfindet. Die Drohung einer Stagnation steht im Raum. Vom "kräftigsten Einbruch seit Ende des Zweiten Welkriegs" spricht Dietmar Harting, Präsident des Verbandes der Elektroindustrie ZVEI. "Wir erwarten eine schwarze Null", heißt es dagegen trotzig beim Maschinenbau. Angesichts der weltpolitischen Lage sei das schon "ganz beruhigend", fügt die Branche hinzu. So weit ist der Defätismus schon gediehen.
Um so dringlicher bettelt die deutsche Industrie beim Kanzler jetzt, er möge seiner Rede an die Nation vom 14. März rasch Taten folgen lassen, ohne Irritation von den Blockierern in SPD und Gewerkschaften. Die Hoffnung steht auf tönernen Füßen. Denn in der Zwischenzeit haben Roland Koch (CDU) und Peer Steinbrück (SPD), die heimlichen Führer einer de facto großen Koalition, sich längst an der Industrie schadlos gehalten und eine veritable Steuererhöhung für die Kapitalgesellschaften beschlossen. Angesichts der weltweiten Unsicherheiten ein fatales Signal.
Export
Die Impulse aus dem Außenhandel - traditionell die Stütze der deutschen Industrie - reichen in diesem Jahr nicht mehr aus, die Binnenwirtschaft zu stabilisieren. Nur ein leichtes Exportwachstum erwartet der BDI für das laufende Jahr. Im besten Fall könne eine drohende Rezession abgewendet werden, heißt es. Hinzu kommt der dauerhaft schwächere Dollar, welcher die Erlöse dämpft. Die Klagen vieler Unternehmen über den erstarkten Euro teilt der BDI indessen nicht: Die Abwertung des Dollars verhelfe Amerika zum Abbau seines Leistungsbilanzdefizits und beschere jene Exporterfolge, durch welche Amerika wieder zum Motor der Weltwirtschaft werden könne.
Globalisierung
Die Warnungen nehmen zu, daß die Globalisierung in diesem Jahr einen empfindlichen Rückschlag erleiden könnte. Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr im Ausland gerade 26 Milliarden Euro investiert, was einem Rückgang von 55 Prozent entspricht. "Die Zeit der großen Fusionen ist vorbei", sagt BDI-Präsident Rogowski. Insbesondere bei der Telekommunikation und der Informationstechnologie, wo bis in das Jahr 2001 hinein ein ungebremster Optimismus die Direktinvestitionen angetrieben hat, ist unterdessen Realismus eingekehrt.
Schlimmer noch: Die Welthandelsrunde (Doha) steht auf der Kippe. Europa päppelt seine Bauern und kann sich nicht dazu entschließen, die Agrarsubventionen zu stutzen. Das konservative Amerika George W. Bushs, getrieben von nationalen Interessengruppen, verfolgt immer egoistischer eine bilaterale Handelspolitik. "Die Vereinigten Staaten verwässern alle Regeln des liberalen Welthandels", kritisiert der indische Ökonom Jagdish Bhagwati.
Innovation
Wenigstens eine positive Nachricht gibt es: Auf ihre Erfindungen sind die deutschen Ingenieure immer noch stolz. Zwar wissen die Unternehmer, daß sie bei Chips, Computern oder Internet die technologische Führung an die Vereinigten Staaten verloren haben. Dafür sind die Deutschen jetzt dabei, die Fabriken zu automatisieren. "Miniaturisierung" und "Digitalisierung" heißen die Stichworte dieser Hannover-Messe. Es geht um die intelligente Vernetzung der Produktion. "Da sind wir führend", verkündet stolz ZVEI-Präsident Harting. Auch die deutschen Autobahnen würde die Branche gerne elektronisch aufrüsten ("Telematik" ) und klagt darüber, daß die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur mit einem Anteil von vier Prozent des Staatshaushaltes niedrig wie noch nie seien.
Schon wird der Nachwuchs bei Maschinenbauern und Ingenieuren knapp. Denn die Nachfrage nach technischer Intelligenz in den Unternehmen wächst. "Die Ingenieurlücke wird größer", jammern die Verbände. 13000 neue Elektroingenieure braucht die Branche jährlich. Dem stehen gerade einmal etwas mehr als 6000 Abschlüsse gegenüber. Der alte Schweinezyklus lebt.
FAZ 06.04.2003
Düstere Aussicht: Alles wird noch schlimmer
Von Carsten Germis und Rainer Hank
Die Stimmung könnte schlechter kaum sein. Wenn Kanzler Gerhard Schröder an diesem Sonntag in seiner Heimatstadt Hannover die größte Industrieschau der Welt eröffnet, dann wird er bei den Unternehmern auf wenig Begeisterung treffen: Der Krieg im Irak lähmt die Weltwirtschaft, die Globalisierung macht schon seit geraumer Zeit Pause, und in Asien, der einzigen Hoffnungsregion der Welt, grassiert die Krankheit SARS, die das Wirschaftsleben zu lähmen droht. Düstere Aussichten sind das für die traditionell exportorientierte deutsche Industrie.
"Gründe für Optimismus lassen sich kaum finden", klagt Michael Rogowski, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Ein ums andere Mal haben seine Experten in den vergangenen Monaten ihre Prognosen nach unten korrigiert. Ein halbes Prozent Wachstum hat der BDI zuletzt für Deutschland veranschlagt. Jetzt sind alle froh, wenn die deutsche Wirtschaft, ohne zu schrumpfen, aus diesem Jahr herausfindet. Die Drohung einer Stagnation steht im Raum. Vom "kräftigsten Einbruch seit Ende des Zweiten Welkriegs" spricht Dietmar Harting, Präsident des Verbandes der Elektroindustrie ZVEI. "Wir erwarten eine schwarze Null", heißt es dagegen trotzig beim Maschinenbau. Angesichts der weltpolitischen Lage sei das schon "ganz beruhigend", fügt die Branche hinzu. So weit ist der Defätismus schon gediehen.
Um so dringlicher bettelt die deutsche Industrie beim Kanzler jetzt, er möge seiner Rede an die Nation vom 14. März rasch Taten folgen lassen, ohne Irritation von den Blockierern in SPD und Gewerkschaften. Die Hoffnung steht auf tönernen Füßen. Denn in der Zwischenzeit haben Roland Koch (CDU) und Peer Steinbrück (SPD), die heimlichen Führer einer de facto großen Koalition, sich längst an der Industrie schadlos gehalten und eine veritable Steuererhöhung für die Kapitalgesellschaften beschlossen. Angesichts der weltweiten Unsicherheiten ein fatales Signal.
Export
Die Impulse aus dem Außenhandel - traditionell die Stütze der deutschen Industrie - reichen in diesem Jahr nicht mehr aus, die Binnenwirtschaft zu stabilisieren. Nur ein leichtes Exportwachstum erwartet der BDI für das laufende Jahr. Im besten Fall könne eine drohende Rezession abgewendet werden, heißt es. Hinzu kommt der dauerhaft schwächere Dollar, welcher die Erlöse dämpft. Die Klagen vieler Unternehmen über den erstarkten Euro teilt der BDI indessen nicht: Die Abwertung des Dollars verhelfe Amerika zum Abbau seines Leistungsbilanzdefizits und beschere jene Exporterfolge, durch welche Amerika wieder zum Motor der Weltwirtschaft werden könne.
Globalisierung
Die Warnungen nehmen zu, daß die Globalisierung in diesem Jahr einen empfindlichen Rückschlag erleiden könnte. Deutsche Unternehmen haben im vergangenen Jahr im Ausland gerade 26 Milliarden Euro investiert, was einem Rückgang von 55 Prozent entspricht. "Die Zeit der großen Fusionen ist vorbei", sagt BDI-Präsident Rogowski. Insbesondere bei der Telekommunikation und der Informationstechnologie, wo bis in das Jahr 2001 hinein ein ungebremster Optimismus die Direktinvestitionen angetrieben hat, ist unterdessen Realismus eingekehrt.
Schlimmer noch: Die Welthandelsrunde (Doha) steht auf der Kippe. Europa päppelt seine Bauern und kann sich nicht dazu entschließen, die Agrarsubventionen zu stutzen. Das konservative Amerika George W. Bushs, getrieben von nationalen Interessengruppen, verfolgt immer egoistischer eine bilaterale Handelspolitik. "Die Vereinigten Staaten verwässern alle Regeln des liberalen Welthandels", kritisiert der indische Ökonom Jagdish Bhagwati.
Innovation
Wenigstens eine positive Nachricht gibt es: Auf ihre Erfindungen sind die deutschen Ingenieure immer noch stolz. Zwar wissen die Unternehmer, daß sie bei Chips, Computern oder Internet die technologische Führung an die Vereinigten Staaten verloren haben. Dafür sind die Deutschen jetzt dabei, die Fabriken zu automatisieren. "Miniaturisierung" und "Digitalisierung" heißen die Stichworte dieser Hannover-Messe. Es geht um die intelligente Vernetzung der Produktion. "Da sind wir führend", verkündet stolz ZVEI-Präsident Harting. Auch die deutschen Autobahnen würde die Branche gerne elektronisch aufrüsten ("Telematik" ) und klagt darüber, daß die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur mit einem Anteil von vier Prozent des Staatshaushaltes niedrig wie noch nie seien.
Schon wird der Nachwuchs bei Maschinenbauern und Ingenieuren knapp. Denn die Nachfrage nach technischer Intelligenz in den Unternehmen wächst. "Die Ingenieurlücke wird größer", jammern die Verbände. 13000 neue Elektroingenieure braucht die Branche jährlich. Dem stehen gerade einmal etwas mehr als 6000 Abschlüsse gegenüber. Der alte Schweinezyklus lebt.
FAZ 06.04.2003
.
Gelobtes Land in Fernost
Chinas rasantes Wirtschaftswachstum zieht immer mehr ausländische Investoren an -
Aber viele müssen auch teures Lehrgeld zahlen
Von Harald Maass
Dieter Schreiber bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Drei Jahrzehnte verbrachte der Kaufmann in Afrika auf deutschen Baustellen. Von Algerien bis nach Zaire war er unterwegs, ließ Hafenanlagen, Staudämme, Brücken und Straßen errichten. Seit einem halben Jahr ist der 59-Jährige für das Bauunternehmen Bilfinger Berger in China, und er staunt noch immer. Auf seinen Autofahrten vorbei an den unzähligen neuen Hochhäusern in Peking bleibt er oft überrascht stehen. "Das Tempo in diesem Land ist beeindruckend."
Der Deutsche ist einer von tausenden Geschäftsleuten und Experten, die der starke wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen beiden Jahrzehnte nach China verschlagen hat. Sie sind in ein Land gekommen, in dem derzeit eine Stimmung herrscht, die gegensätzlicher zu der in Deutschland kaum sein könnte. Die Wirtschaft boomt mit jährlichen Zuwachsraten von im Schnitt acht Prozent. Um die ständig steigende Nachfrage zu decken, werden Milliardenbeträge investiert. Viele Branchen melden Rekordgewinne. "Wir sehen im Moment einen China-Boom", sagt Jürgen Kracht von der Unternehmensberatung Fiducia. Und für Verena Rothmaier, Chefrepräsentantin der Landesbank Baden-Württemberg in Peking, war 2002 ein "phänomenales Jahr".
Die Geschwindigkeit, mit der in der Volksrepublik Geschäfte gemacht werden, erlebte Schreiber gleich nach seiner Ankunft. "Die ersten Wochen haben wir Tag und Nacht gearbeitet", berichtet er. Bilfinger Berger, das seit 1995 in Peking ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma betreibt, bewarb sich um den Bau einer neuen U-Bahn-Linie in der Hauptstadt. Eine Woche nach der Angebotsabgabe war der Zuschlag für einen Drei-Kilometer-Abschnitt der Linie 5 da. Auftragsvolumen: 105 Millionen Yuan (11,8 Millionen Euro). Noch in diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten. "In anderen Ländern dauert so ein Verfahren Jahre." Für die Mannheimer ist das jedoch nur der erste Schritt; ein "Testauftrag", wie Schreiber sagt. Bis zu den Olympischen Spielen im Jahr 2008 sollen in Peking 120 U-Bahn-Kilometer gegraben werden. Einen Teil davon will Schreiber mit seiner Firma bauen. "Wir sind sehr optimistisch", sagt er.
Aus anderen Branchen ist Ähnliches zu hören. Viele deutsche Unternehmen melden Rekordergebnisse. Volkswagen, das in Shanghai und der nördlichen Industriestadt Changchun Fabriken unterhält, produzierte im vergangenen Jahr erstmals eine halbe Million Autos - ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2001. Für die Wolfsburger ist China damit der wichtigste Absatzmarkt nach Deutschland. Der Elektrokonzern Siemens, der unter dem chinesischen Namen Ximenzi auftritt, beschäftigt vor Ort 21 000 Leute in mehr als 40 Unternehmen. In Shanghai unterhält er ein hochmodernes Handy-Werk, in dem auch Modelle für den Export nach Deutschland produziert werden. Bayer und BASF investieren Milliardenbeträge in neue Fabriken, die in Zukunft von China aus ganz Asien mit chemischen Grundstoffen versorgen sollen.
Dies alles schlägt sich in den Statistiken über den Außenhandel (siehe Grafik) und Direktinvestitionen nieder. Deutschland ist der mit Abstand größte europäische Partner Chinas. Um die vielen tausend neuen Fabriken im ganzen Land auszurüsten, werden hochwertige Produktionsanlagen und Spezialmaschinen benötigt - traditionell eine Stärke der deutschen Exportwirtschaft. Ebenfalls enorm angeschwollen ist der Import aus China; mit der Folge, dass die Handelsbilanz aus deutscher Sicht anhaltend defizitär ist. Der beiderseitige Warenaustausch hat inzwischen ein höheres Volumen als der zwischen der Bundesrepublik und Japan. "Die Zahlen sind wirklich frappierend", sagt Jörg Wuttke von der Deutschen Handelskammer in Peking.
Für die deutschen Unternehmen zahlt es sich aus, dass sie früh in China investiert haben. Volkswagen rollte bereits vor zwei Jahrzehnten an den Start, als mit dem Reformpolitiker Deng Xiaoping die allmähliche Öffnung des sozialistischen Landes begann. Heute beträgt der Marktanteil der Wolfsburger rund 50 Prozent. Bilfinger Berger baute Anfang der neunziger Jahre, als Peking noch eine graue Stadt mit sozialistischen Wohnblöcken war, das Lufthansa Center, den ersten modernen Hotel- und Kaufhauskomplex der Hauptstadt. "In China muss man sich langsam hocharbeiten", weiß Schreiber inzwischen. 25 Millionen Yuan investierte seine Firma 1995 in ein Joint-Venture. Vergangenes Jahr wurde das Kapital auf 100 Millionen Yuan (elf Millionen Euro) aufgestockt. Dazwischen liegt ein langer Prozess des Lernens, des Kontaktaufbaus mit den heimischen Partnern.
Aber nicht nur Großkonzerne setzten auf China. Das rasante Wachstum vor allem in den Küstenprovinzen, in denen 300 Millionen Menschen leben, zieht immer mehr Mittelständler und Kleinunternehmer an. Der Bäcker Horst Lehn hat sich vor einigen Jahren in Peking niedergelassen, um die vielen tausend Deutschen und die Hotels mit frischem Brot zu versorgen.
"Wir registrieren ein großes Interesse, auch vom Mittelstand", erzählt Unternehmensberater Kracht. Die Gründe dafür lägen nicht nur in den beträchtlichen Chancen in China, sondern auch in der anhaltenden Flaute in der Heimat. "Der Renner ist Shanghai", sagt Kracht. Die Industriemetropole am Huangpu-Fluss hat durch ihre Lebensqualität und niedrigen Kosten bereits Hongkong den Rang abgelaufen. Allerdings würden sich viele Firmen nun auch in der zweiten Reihe der chinesischen Städte niederlassen. "Die Behörden sind dort oft unbürokratischer und den Investoren gegenüber aufgeschlossen."
Ein weiteres Erfolgsbeispiel liefert die RWE-Tochter Heidelberger Druckmaschinen. Lange Zeit hatte das Unternehmen seine Produkte nur über einen Agenten in China verkauft. Vor fünf Jahren beschlossen die Kurpfälzer, vor Ort zu investieren. Am Anfang stand ein Pekinger Repräsentanz-Büro, bald darauf folgten Servicefirmen in verschiedenen Provinzen. "Wenn man auf diesem Markt erfolgreich sein will, muss man sich als Unternehmen voll engagieren", sagt Geschäftsführer Chan Seng Lee. Der Malaysier betreut für die Heidelberger mit einem Team von 500 Leuten den wachsenden chinesischen Markt.
Allein in der südlichen Provinz Guandong sind Hunderte von Großdruckereien entstanden, oft mit mehreren tausend Angestellten. "Südchina ist die Druckerei für den Weltmarkt", sagt Chan. "Die Kunden verlangen Top-Qualität und sind bereit, dafür entsprechend zu bezahlen." Gewinnzahlen will er nicht nennen. Nur so viel sagt er: "Es ist ein durchaus einträgliches Geschäft."
Das Reich der Mitte rangiert auf der internen Heidelberg-Rangliste mittlerweile unter den fünf wichtigsten Märkten - neben den USA, Deutschland, Großbritannien und Japan. Ein Ende des Aufschwungs scheint nicht in Sicht. Im statistischen Durchschnitt gibt ein Chinese pro Jahr drei Euro für Gedrucktes aus, in Europa liegt der entsprechende Betrag bei 261 Euro. "In den nächsten fünf Jahren wird dies ein sehr guter Markt sein", glaubt Chan. Einfach sei das Geschäft für ihn deshalb aber nicht. Einige chinesische Unternehmen produzieren mittlerweile Kopien von Heidelberg-Druckmaschinen und verkaufen diese zu Niedrig-Preisen. Verwirrende Zollbestimmungen behindern zudem oft die Lieferungen aus Deutschland. "Man muss die komplexen Regeln dieses Land kennen", sagt Chan. Aber sein Arbeitgeber habe einen gewaltigen technologischen Vorsprung. "Die Präzision unserer Maschinen kann so leicht niemand kopieren."
Bei alledem sind die zahlreichen Klagen ausländischer Firmen noch nicht vergessen. Korruption, eine ausufernde Bürokratie und ein unsicheres Rechtssystem machten den Investoren das Leben schwer. Viele ausländischen Firmen schrieben Verluste. Die meisten der Probleme bestehen auch heute noch. Doch die Unternehmen aus Übersee haben gelernt, sich den Bedingungen anzupassen. "Wir werden von Jahr zu Jahr klüger", sagt auch Handelskammer-Chef Wuttke.
Trotz alledem ist immer wieder von Rückschlägen zu hören. Vor allem Mittelständler mit mangelnder internationaler Erfahrung sind die Opfer von Betrügereien und Übervorteilungen. Bilanzen werden gefälscht, Gelder unterschlagen und Verträge nicht eingehalten. Ein klassisches Muster: Die Angestellten eines ausländischen Investors klauen Maschinen und Know-how und bauen damit eigene Fabriken auf. Die meisten merken solche Machenschaften erst, wenn es zu spät ist. Da der Gang vor ein chinesisches Gericht aussichtslos ist, zieht sich der ausländische Investor still zurück.
Konsumartikel-Hersteller wie Unilever schätzen, dass ein Drittel der in Chinas Supermärkten verkauften Kosmetikprodukte Fälschungen sind. Ähnlich hoch ist die Quote bei Maschinen. "Über die Misserfolge wird in China nicht geredet", sagt ein deutscher Geschäftsmann in Peking.
Daneben werden aber auch häufig Managementfehler gemacht, weiß Verena Rothmaier von der Landesbank Baden- Württemberg. "Kontrolle ist in diesem Land sehr wichtig." Viele Unternehmer ließen sich von der Größe des Marktes blenden oder bereiteten ihr Investment nicht richtig vor. "Ich sehe oft, dass die Leute zu vertrauensselig sind."
Das lebhafte Interesse an China gerade beim Mittelstand hält die Bankerin dennoch für gerechtfertigt. "Grundsätzlich sehen wir Chinas Entwicklung positiv. Der Markt wird transparenter." Den etwa 50 deutschen Unternehmen, die jeden Monat mit ihrer Bank Kontakt aufnehmen, empfiehlt sie ein schrittweises Herangehen an den Markt. Und ein gesundes Maß an Misstrauen. "Man sollte das kaufmännische Denken nicht bei der Grenzkontrolle abgeben."
Unterschätzt werden auch oft die politischen und ökonomischen Unsicherheiten in China. Das Wohlstandsgefälle zwischen den relativ reichen Küstenprovinzen und dem armen Hinterland wächst, und damit nehmen auch die sozialen Spannungen zu. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte von Aufständen und Unruhen, die von der allein regierenden Kommunistischen Partei (KP) meist mit Polizeigewalt unterdrückt werden. Trotz des reibungslosen Machtwechsels in der Führung auf dem Parteitag im Herbst weiß niemand, wie lange die KP das Land noch unter Kontrolle haben wird. "Auch in China wird die staatliche Administration nicht mehr funktionsfähig sein, sobald sich die Staatspartei aufzulösen beginnt", warnt der Wissenschaftler Sebastian Heilmann von der Universität Trier.
Ein plötzlicher Kollaps wie zur der Wendezeit in den osteuropäischen Staaten sei gleichwohl unwahrscheinlich. Die KP habe auf manchen Gebieten mit ihren Reformbemühungen Erfolg gehabt. Dennoch sieht Heilmann grundlegende ökonomische Gefahren, vor allem im Finanzsystem. Die Staatsbanken seien faktisch pleite. Ein Berg fauler Kredite im vermuteten Wert von 500 bis 600 Milliarden Euro hat sich angehäuft. Die Regierung muss zudem für die Sozialleistungen von Millionen ehemaliger Angestellten in den staatlichen Geldhäusern aufkommen. Wegen der einseitigen Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft auf Massenkonsumgüter klagen etliche Branchen - zum Beispiel die Elektroindustrie - über Überkapazitäten und Preisverfall. Korruption und staatliche Zensur legen undurchsichtige Schleier über die Bilanzen und Eigentümerstrukturen chinesischer Firmen. Eine Konsequenz daraus ist nach den Worten Heilmanns: "Das Vertrauen in die Börsen in Shanghai und Shenzhen ist zerstört."
Geblendet von dem enormen Potenzial übersieht manch ausländische Firma die Risiken. Solange die Wirtschaft und der Konsum rapide wachsen, werden die strukturellen Probleme ignoriert. Die einen, wie Handelskammer-Chef Wuttke, hoffen darauf, dass der Regierung die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. "Die Politiker in diesem Land verschweigen die Probleme nicht und haben die Macht zur Veränderung." Der Wissenschaftler Heilmann ist da weniger zuversichtlich: "Ich halte es für ausgeschlossen, dass wirtschaftlich und politisch in den nächsten zehn Jahren alles glatt geht."
"China wird der Konkurrent von morgen sein"
Deutscher Maschinenbau verbucht enorme Export-Zuwächse / Defizit im Elektrohandel
Von Christine Skowronowski
Die Perspektiven auf dem chinesischen Markt werden auf der Hannover Messe, die Bundeskanzler Gerhard Schröder morgen Abend eröffnet, eines der zentralen Themen für die deutschen Investitionsgüterhersteller bilden. Dass der Handel mit der Volksrepublik an Dynamik gewinnt, zeigt aber auch das wachsende Interesse chinesischer Unternehmen, auf der weltgrößten Industrieschau präsent zu sein. Diesmal haben sich 282 Aussteller angemeldet und damit 117 mehr als im vorigen Jahr. Auf die Idee, ihnen die Teilnahme wegen der Lungenkrankheit Sars kurzfristig zu verweigern oder sie sogar, wie auf der Uhren- und Schmuckmesse in Basel geschehen, wieder nach Hause zu schicken, fiele dem Veranstalter, die Deutsche Messe, nicht einmal im Traum ein. "Unvorstellbar", bekräftigt Sprecher Ulrich Koch. Auch habe keiner der erwarteten Gäste wegen der Epidemie abgesagt.
Die hiesigen Unternehmen sehen ebenfalls keinen Anlass, ihre optimistischen Prognosen für das Geschäft mit dem Reich der Mitte wegen Sars zu korrigieren: "Keinerlei Beeinträchtigungen" meldet zum Beispiel die Firma Turck aus Mülheim an der Ruhr. Für den Hersteller von industrieller Automatisierung ist China als Absatzmarkt inzwischen zum dritten Standbein geworden. Das Unternehmen erwirtschaftete im vorigen Jahr mit 1700 Beschäftigten einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Das asiatische Land steuert dazu 15 Prozent bei. "Wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht", sagt Marketingchef Christian Wolf. In drei bis fünf Jahren peilt Turck dort einen Umsatz von 40 bis 50 Millionen Euro an.
Für den gesamten Maschinen- und Anlagenbau ist China das Abnehmerland mit den steilsten Plusraten. Von Januar bis November 2002 nahm die Ausfuhr um 35 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro zu. In der Exportstatistik des Branchenverbands VDMA rangiert China inzwischen auf dem vierten Rang - hinter den USA, Frankreich und Italien.
Mit einem über zehn Jahre kumulierten Auftragseingang von mehr als acht Milliarden Euro habe sich allein im Großanlagenbau die Volksrepublik noch vor den USA (6,9 Milliarden Euro) zum "bedeutendsten Kunden der vergangenen Dekade entwickelt", betont Aldo Belloni, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft im VDMA. Über eines sind die hiesigen Hersteller sich allerdings bereits im Klaren. "China wird der Konkurrent von morgen sein."
In der Elektrotechnik und Elektronik handelte sich die Bundesrepublik mit dem Reich der Mitte bereits ein dickes Defizit ein, wie der Chefvolkswirt des Branchenverbandes ZVEI, Ulrich Scheinost, erläutert. Lieferungen im Wert von drei Milliarden Euro standen im vorigen Jahr Bezüge aus der Gegenrichtung von neun Milliarden Euro gegenüber. Und das liegt nur zum Teil daran, dass deutsche Unternehmen dort selbst produzieren und den hiesigen Markt mit diesen Erzeugnissen versorgen. Die chinesische Ausfuhr umfasst vor allem Konsumelektronik und Vorprodukte. "China hat einen Riesensprung gemacht", sagt der Ökonom. Innerhalb von vier Jahren stieg das Land in der Tabelle der weltgrößten Elektroexporteure hinter den USA, Japan und Deutschland auf Platz vier auf.
Ein immer wieder beklagtes Problem dabei: Mit dem Schutz geistigen Eigentums nimmt es China, vorsichtig ausgedrückt, nicht so genau. Es wird kopiert, was das Zeug hält. Da könne es schon mal passieren, sagt Scheinost, "dass deutsche Firmen auf Messen plötzlich ihrem eigenen Produkt gegenüber stehen".
FR 04.04.2003
Gelobtes Land in Fernost
Chinas rasantes Wirtschaftswachstum zieht immer mehr ausländische Investoren an -
Aber viele müssen auch teures Lehrgeld zahlen
Von Harald Maass
Dieter Schreiber bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Drei Jahrzehnte verbrachte der Kaufmann in Afrika auf deutschen Baustellen. Von Algerien bis nach Zaire war er unterwegs, ließ Hafenanlagen, Staudämme, Brücken und Straßen errichten. Seit einem halben Jahr ist der 59-Jährige für das Bauunternehmen Bilfinger Berger in China, und er staunt noch immer. Auf seinen Autofahrten vorbei an den unzähligen neuen Hochhäusern in Peking bleibt er oft überrascht stehen. "Das Tempo in diesem Land ist beeindruckend."
Der Deutsche ist einer von tausenden Geschäftsleuten und Experten, die der starke wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen beiden Jahrzehnte nach China verschlagen hat. Sie sind in ein Land gekommen, in dem derzeit eine Stimmung herrscht, die gegensätzlicher zu der in Deutschland kaum sein könnte. Die Wirtschaft boomt mit jährlichen Zuwachsraten von im Schnitt acht Prozent. Um die ständig steigende Nachfrage zu decken, werden Milliardenbeträge investiert. Viele Branchen melden Rekordgewinne. "Wir sehen im Moment einen China-Boom", sagt Jürgen Kracht von der Unternehmensberatung Fiducia. Und für Verena Rothmaier, Chefrepräsentantin der Landesbank Baden-Württemberg in Peking, war 2002 ein "phänomenales Jahr".
Die Geschwindigkeit, mit der in der Volksrepublik Geschäfte gemacht werden, erlebte Schreiber gleich nach seiner Ankunft. "Die ersten Wochen haben wir Tag und Nacht gearbeitet", berichtet er. Bilfinger Berger, das seit 1995 in Peking ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma betreibt, bewarb sich um den Bau einer neuen U-Bahn-Linie in der Hauptstadt. Eine Woche nach der Angebotsabgabe war der Zuschlag für einen Drei-Kilometer-Abschnitt der Linie 5 da. Auftragsvolumen: 105 Millionen Yuan (11,8 Millionen Euro). Noch in diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten. "In anderen Ländern dauert so ein Verfahren Jahre." Für die Mannheimer ist das jedoch nur der erste Schritt; ein "Testauftrag", wie Schreiber sagt. Bis zu den Olympischen Spielen im Jahr 2008 sollen in Peking 120 U-Bahn-Kilometer gegraben werden. Einen Teil davon will Schreiber mit seiner Firma bauen. "Wir sind sehr optimistisch", sagt er.
Aus anderen Branchen ist Ähnliches zu hören. Viele deutsche Unternehmen melden Rekordergebnisse. Volkswagen, das in Shanghai und der nördlichen Industriestadt Changchun Fabriken unterhält, produzierte im vergangenen Jahr erstmals eine halbe Million Autos - ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2001. Für die Wolfsburger ist China damit der wichtigste Absatzmarkt nach Deutschland. Der Elektrokonzern Siemens, der unter dem chinesischen Namen Ximenzi auftritt, beschäftigt vor Ort 21 000 Leute in mehr als 40 Unternehmen. In Shanghai unterhält er ein hochmodernes Handy-Werk, in dem auch Modelle für den Export nach Deutschland produziert werden. Bayer und BASF investieren Milliardenbeträge in neue Fabriken, die in Zukunft von China aus ganz Asien mit chemischen Grundstoffen versorgen sollen.
Dies alles schlägt sich in den Statistiken über den Außenhandel (siehe Grafik) und Direktinvestitionen nieder. Deutschland ist der mit Abstand größte europäische Partner Chinas. Um die vielen tausend neuen Fabriken im ganzen Land auszurüsten, werden hochwertige Produktionsanlagen und Spezialmaschinen benötigt - traditionell eine Stärke der deutschen Exportwirtschaft. Ebenfalls enorm angeschwollen ist der Import aus China; mit der Folge, dass die Handelsbilanz aus deutscher Sicht anhaltend defizitär ist. Der beiderseitige Warenaustausch hat inzwischen ein höheres Volumen als der zwischen der Bundesrepublik und Japan. "Die Zahlen sind wirklich frappierend", sagt Jörg Wuttke von der Deutschen Handelskammer in Peking.
Für die deutschen Unternehmen zahlt es sich aus, dass sie früh in China investiert haben. Volkswagen rollte bereits vor zwei Jahrzehnten an den Start, als mit dem Reformpolitiker Deng Xiaoping die allmähliche Öffnung des sozialistischen Landes begann. Heute beträgt der Marktanteil der Wolfsburger rund 50 Prozent. Bilfinger Berger baute Anfang der neunziger Jahre, als Peking noch eine graue Stadt mit sozialistischen Wohnblöcken war, das Lufthansa Center, den ersten modernen Hotel- und Kaufhauskomplex der Hauptstadt. "In China muss man sich langsam hocharbeiten", weiß Schreiber inzwischen. 25 Millionen Yuan investierte seine Firma 1995 in ein Joint-Venture. Vergangenes Jahr wurde das Kapital auf 100 Millionen Yuan (elf Millionen Euro) aufgestockt. Dazwischen liegt ein langer Prozess des Lernens, des Kontaktaufbaus mit den heimischen Partnern.
Aber nicht nur Großkonzerne setzten auf China. Das rasante Wachstum vor allem in den Küstenprovinzen, in denen 300 Millionen Menschen leben, zieht immer mehr Mittelständler und Kleinunternehmer an. Der Bäcker Horst Lehn hat sich vor einigen Jahren in Peking niedergelassen, um die vielen tausend Deutschen und die Hotels mit frischem Brot zu versorgen.
"Wir registrieren ein großes Interesse, auch vom Mittelstand", erzählt Unternehmensberater Kracht. Die Gründe dafür lägen nicht nur in den beträchtlichen Chancen in China, sondern auch in der anhaltenden Flaute in der Heimat. "Der Renner ist Shanghai", sagt Kracht. Die Industriemetropole am Huangpu-Fluss hat durch ihre Lebensqualität und niedrigen Kosten bereits Hongkong den Rang abgelaufen. Allerdings würden sich viele Firmen nun auch in der zweiten Reihe der chinesischen Städte niederlassen. "Die Behörden sind dort oft unbürokratischer und den Investoren gegenüber aufgeschlossen."
Ein weiteres Erfolgsbeispiel liefert die RWE-Tochter Heidelberger Druckmaschinen. Lange Zeit hatte das Unternehmen seine Produkte nur über einen Agenten in China verkauft. Vor fünf Jahren beschlossen die Kurpfälzer, vor Ort zu investieren. Am Anfang stand ein Pekinger Repräsentanz-Büro, bald darauf folgten Servicefirmen in verschiedenen Provinzen. "Wenn man auf diesem Markt erfolgreich sein will, muss man sich als Unternehmen voll engagieren", sagt Geschäftsführer Chan Seng Lee. Der Malaysier betreut für die Heidelberger mit einem Team von 500 Leuten den wachsenden chinesischen Markt.
Allein in der südlichen Provinz Guandong sind Hunderte von Großdruckereien entstanden, oft mit mehreren tausend Angestellten. "Südchina ist die Druckerei für den Weltmarkt", sagt Chan. "Die Kunden verlangen Top-Qualität und sind bereit, dafür entsprechend zu bezahlen." Gewinnzahlen will er nicht nennen. Nur so viel sagt er: "Es ist ein durchaus einträgliches Geschäft."
Das Reich der Mitte rangiert auf der internen Heidelberg-Rangliste mittlerweile unter den fünf wichtigsten Märkten - neben den USA, Deutschland, Großbritannien und Japan. Ein Ende des Aufschwungs scheint nicht in Sicht. Im statistischen Durchschnitt gibt ein Chinese pro Jahr drei Euro für Gedrucktes aus, in Europa liegt der entsprechende Betrag bei 261 Euro. "In den nächsten fünf Jahren wird dies ein sehr guter Markt sein", glaubt Chan. Einfach sei das Geschäft für ihn deshalb aber nicht. Einige chinesische Unternehmen produzieren mittlerweile Kopien von Heidelberg-Druckmaschinen und verkaufen diese zu Niedrig-Preisen. Verwirrende Zollbestimmungen behindern zudem oft die Lieferungen aus Deutschland. "Man muss die komplexen Regeln dieses Land kennen", sagt Chan. Aber sein Arbeitgeber habe einen gewaltigen technologischen Vorsprung. "Die Präzision unserer Maschinen kann so leicht niemand kopieren."
Bei alledem sind die zahlreichen Klagen ausländischer Firmen noch nicht vergessen. Korruption, eine ausufernde Bürokratie und ein unsicheres Rechtssystem machten den Investoren das Leben schwer. Viele ausländischen Firmen schrieben Verluste. Die meisten der Probleme bestehen auch heute noch. Doch die Unternehmen aus Übersee haben gelernt, sich den Bedingungen anzupassen. "Wir werden von Jahr zu Jahr klüger", sagt auch Handelskammer-Chef Wuttke.
Trotz alledem ist immer wieder von Rückschlägen zu hören. Vor allem Mittelständler mit mangelnder internationaler Erfahrung sind die Opfer von Betrügereien und Übervorteilungen. Bilanzen werden gefälscht, Gelder unterschlagen und Verträge nicht eingehalten. Ein klassisches Muster: Die Angestellten eines ausländischen Investors klauen Maschinen und Know-how und bauen damit eigene Fabriken auf. Die meisten merken solche Machenschaften erst, wenn es zu spät ist. Da der Gang vor ein chinesisches Gericht aussichtslos ist, zieht sich der ausländische Investor still zurück.
Konsumartikel-Hersteller wie Unilever schätzen, dass ein Drittel der in Chinas Supermärkten verkauften Kosmetikprodukte Fälschungen sind. Ähnlich hoch ist die Quote bei Maschinen. "Über die Misserfolge wird in China nicht geredet", sagt ein deutscher Geschäftsmann in Peking.
Daneben werden aber auch häufig Managementfehler gemacht, weiß Verena Rothmaier von der Landesbank Baden- Württemberg. "Kontrolle ist in diesem Land sehr wichtig." Viele Unternehmer ließen sich von der Größe des Marktes blenden oder bereiteten ihr Investment nicht richtig vor. "Ich sehe oft, dass die Leute zu vertrauensselig sind."
Das lebhafte Interesse an China gerade beim Mittelstand hält die Bankerin dennoch für gerechtfertigt. "Grundsätzlich sehen wir Chinas Entwicklung positiv. Der Markt wird transparenter." Den etwa 50 deutschen Unternehmen, die jeden Monat mit ihrer Bank Kontakt aufnehmen, empfiehlt sie ein schrittweises Herangehen an den Markt. Und ein gesundes Maß an Misstrauen. "Man sollte das kaufmännische Denken nicht bei der Grenzkontrolle abgeben."
Unterschätzt werden auch oft die politischen und ökonomischen Unsicherheiten in China. Das Wohlstandsgefälle zwischen den relativ reichen Küstenprovinzen und dem armen Hinterland wächst, und damit nehmen auch die sozialen Spannungen zu. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte von Aufständen und Unruhen, die von der allein regierenden Kommunistischen Partei (KP) meist mit Polizeigewalt unterdrückt werden. Trotz des reibungslosen Machtwechsels in der Führung auf dem Parteitag im Herbst weiß niemand, wie lange die KP das Land noch unter Kontrolle haben wird. "Auch in China wird die staatliche Administration nicht mehr funktionsfähig sein, sobald sich die Staatspartei aufzulösen beginnt", warnt der Wissenschaftler Sebastian Heilmann von der Universität Trier.
Ein plötzlicher Kollaps wie zur der Wendezeit in den osteuropäischen Staaten sei gleichwohl unwahrscheinlich. Die KP habe auf manchen Gebieten mit ihren Reformbemühungen Erfolg gehabt. Dennoch sieht Heilmann grundlegende ökonomische Gefahren, vor allem im Finanzsystem. Die Staatsbanken seien faktisch pleite. Ein Berg fauler Kredite im vermuteten Wert von 500 bis 600 Milliarden Euro hat sich angehäuft. Die Regierung muss zudem für die Sozialleistungen von Millionen ehemaliger Angestellten in den staatlichen Geldhäusern aufkommen. Wegen der einseitigen Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft auf Massenkonsumgüter klagen etliche Branchen - zum Beispiel die Elektroindustrie - über Überkapazitäten und Preisverfall. Korruption und staatliche Zensur legen undurchsichtige Schleier über die Bilanzen und Eigentümerstrukturen chinesischer Firmen. Eine Konsequenz daraus ist nach den Worten Heilmanns: "Das Vertrauen in die Börsen in Shanghai und Shenzhen ist zerstört."
Geblendet von dem enormen Potenzial übersieht manch ausländische Firma die Risiken. Solange die Wirtschaft und der Konsum rapide wachsen, werden die strukturellen Probleme ignoriert. Die einen, wie Handelskammer-Chef Wuttke, hoffen darauf, dass der Regierung die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. "Die Politiker in diesem Land verschweigen die Probleme nicht und haben die Macht zur Veränderung." Der Wissenschaftler Heilmann ist da weniger zuversichtlich: "Ich halte es für ausgeschlossen, dass wirtschaftlich und politisch in den nächsten zehn Jahren alles glatt geht."
"China wird der Konkurrent von morgen sein"
Deutscher Maschinenbau verbucht enorme Export-Zuwächse / Defizit im Elektrohandel
Von Christine Skowronowski
Die Perspektiven auf dem chinesischen Markt werden auf der Hannover Messe, die Bundeskanzler Gerhard Schröder morgen Abend eröffnet, eines der zentralen Themen für die deutschen Investitionsgüterhersteller bilden. Dass der Handel mit der Volksrepublik an Dynamik gewinnt, zeigt aber auch das wachsende Interesse chinesischer Unternehmen, auf der weltgrößten Industrieschau präsent zu sein. Diesmal haben sich 282 Aussteller angemeldet und damit 117 mehr als im vorigen Jahr. Auf die Idee, ihnen die Teilnahme wegen der Lungenkrankheit Sars kurzfristig zu verweigern oder sie sogar, wie auf der Uhren- und Schmuckmesse in Basel geschehen, wieder nach Hause zu schicken, fiele dem Veranstalter, die Deutsche Messe, nicht einmal im Traum ein. "Unvorstellbar", bekräftigt Sprecher Ulrich Koch. Auch habe keiner der erwarteten Gäste wegen der Epidemie abgesagt.
Die hiesigen Unternehmen sehen ebenfalls keinen Anlass, ihre optimistischen Prognosen für das Geschäft mit dem Reich der Mitte wegen Sars zu korrigieren: "Keinerlei Beeinträchtigungen" meldet zum Beispiel die Firma Turck aus Mülheim an der Ruhr. Für den Hersteller von industrieller Automatisierung ist China als Absatzmarkt inzwischen zum dritten Standbein geworden. Das Unternehmen erwirtschaftete im vorigen Jahr mit 1700 Beschäftigten einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Das asiatische Land steuert dazu 15 Prozent bei. "Wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht", sagt Marketingchef Christian Wolf. In drei bis fünf Jahren peilt Turck dort einen Umsatz von 40 bis 50 Millionen Euro an.
Für den gesamten Maschinen- und Anlagenbau ist China das Abnehmerland mit den steilsten Plusraten. Von Januar bis November 2002 nahm die Ausfuhr um 35 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro zu. In der Exportstatistik des Branchenverbands VDMA rangiert China inzwischen auf dem vierten Rang - hinter den USA, Frankreich und Italien.
Mit einem über zehn Jahre kumulierten Auftragseingang von mehr als acht Milliarden Euro habe sich allein im Großanlagenbau die Volksrepublik noch vor den USA (6,9 Milliarden Euro) zum "bedeutendsten Kunden der vergangenen Dekade entwickelt", betont Aldo Belloni, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft im VDMA. Über eines sind die hiesigen Hersteller sich allerdings bereits im Klaren. "China wird der Konkurrent von morgen sein."
In der Elektrotechnik und Elektronik handelte sich die Bundesrepublik mit dem Reich der Mitte bereits ein dickes Defizit ein, wie der Chefvolkswirt des Branchenverbandes ZVEI, Ulrich Scheinost, erläutert. Lieferungen im Wert von drei Milliarden Euro standen im vorigen Jahr Bezüge aus der Gegenrichtung von neun Milliarden Euro gegenüber. Und das liegt nur zum Teil daran, dass deutsche Unternehmen dort selbst produzieren und den hiesigen Markt mit diesen Erzeugnissen versorgen. Die chinesische Ausfuhr umfasst vor allem Konsumelektronik und Vorprodukte. "China hat einen Riesensprung gemacht", sagt der Ökonom. Innerhalb von vier Jahren stieg das Land in der Tabelle der weltgrößten Elektroexporteure hinter den USA, Japan und Deutschland auf Platz vier auf.
Ein immer wieder beklagtes Problem dabei: Mit dem Schutz geistigen Eigentums nimmt es China, vorsichtig ausgedrückt, nicht so genau. Es wird kopiert, was das Zeug hält. Da könne es schon mal passieren, sagt Scheinost, "dass deutsche Firmen auf Messen plötzlich ihrem eigenen Produkt gegenüber stehen".
FR 04.04.2003
.
Wirtschaft im Euro-Raum steht am Rande der Rezession
Von Sebastian Dullien, Berlin
Der Ausbruch des Irak-Kriegs droht die Wirtschaft der Euro-Zone im ersten Halbjahr 2003 in die Rezession zu stoßen. Das lässt die April-Auswertung des Euro-Wachstumsindikators der Financial Times und der Financial Times Deutschland befürchten.
"Der Krieg hat unter Unternehmen und Verbrauchern die Unsicherheit über die Wirtschaftsaussichten verstärkt und dazu geführt, dass Ausgaben aufgeschoben werden", sagte Paavo Suni vom finnischen ETLA-Institut. Das ETLA ist Mitglied der Euroframe-Gruppe, einer Vereinigung von acht führenden Wirtschaftsinstituten, die den FTD-Euro-Indikator monatlich errechnet. Aus Deutschland arbeiten das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Institut für Weltwirtschaft (IfW) an der Aufbereitung des Indikators mit.
Der FTD-Indikator zeigt laut April-Auswertung für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von nur noch 0,6 Prozent im Vorjahresvergleich, das im zweiten Quartal weiter auf 0,3 Prozent nachlassen dürfte. Damit revidierten die Institute wegen der jüngsten Negativmeldungen zur Konjunktur verglichen zur März-Auswertung um 0,3 Prozentpunkte für das erste und sogar um 0,5 Prozentpunkte für das zweite Quartal 2003 nach unten.
Widrige Bedingungen für Prognosen
"Im Quartalsvergleich der Wirtschaftsleistung impliziert dies eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft vom vierten Quartal 2002 zum ersten Quartal 2003 und eine Stagnation im zweiten Quartal", sagte Suni. Damit stehe die Wirtschaft der Euro-Zone nach einer gängigen Definition derzeit am Rande einer Rezession: eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in zwei aufeinander folgenden Quartalen.
Catherine Mathieu vom französischen Institut OFCE, das den Indikator berechnet, wies allerdings darauf hin, dass in Zeiten großer geopolitischer Unsicherheit auch der Indikator mit größerer Vorsicht zu interpretieren sei als in Normalzeiten. Der Indikator könne nicht beantworten, ob der jüngste kriegsbedingte Stimmungsschock vorübergehend ist oder je nach Kriegsverlauf länger anhält. Diese Stimmungsindizes schwankten derzeit stark.
Der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex etwa, der in den FTD-Indikator eingeht, um die Konjunktur auf den Exportmärkten abzubilden, war im März mit Kriegsausbruch drastisch gesunken. Dieser Einbruch alleine trug bei der März-Auswertung des FTD-Indikators 0,2 Prozentpunkte zur Abwärtsrevision des Wachstums im ersten Quartal und 0,3 Prozentpunkte zur Abwärtsrevision der BIP-Entwicklung im zweiten Quartal bei.
Krieg dämpft Konsum und Investitionen
"Es könnte durchaus sein, dass die US-Firmen derzeit die Kriegsfolgen unterschätzen", sagte Catherine Mathieu. Für die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate bleibt der Fortgang der US-Offensive in Irak entscheidend. "Wenn der Krieg länger dauert, wird sich der Abschwung verstärken." Sei der Krieg dagegen schnell vorbei, und käme es zu einem Stimmungsaufschwung in den Unternehmen, könne sich die Wirtschaft noch im zweiten Quartal wieder beleben.
Neben der schwachen Wirtschaftsentwicklung in den USA war vor allem die eingetrübte Stimmung in der europäischen Industrie und unter den Einzelhändlern in der Euro-Zone für den Rückgang des Indikators verantwortlich. Auch die jüngste Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar machte sich für das erste und zweite Quartal negativ bemerkbar.
FTD 07.04.2003

Wirtschaft im Euro-Raum steht am Rande der Rezession
Von Sebastian Dullien, Berlin
Der Ausbruch des Irak-Kriegs droht die Wirtschaft der Euro-Zone im ersten Halbjahr 2003 in die Rezession zu stoßen. Das lässt die April-Auswertung des Euro-Wachstumsindikators der Financial Times und der Financial Times Deutschland befürchten.
"Der Krieg hat unter Unternehmen und Verbrauchern die Unsicherheit über die Wirtschaftsaussichten verstärkt und dazu geführt, dass Ausgaben aufgeschoben werden", sagte Paavo Suni vom finnischen ETLA-Institut. Das ETLA ist Mitglied der Euroframe-Gruppe, einer Vereinigung von acht führenden Wirtschaftsinstituten, die den FTD-Euro-Indikator monatlich errechnet. Aus Deutschland arbeiten das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und das Institut für Weltwirtschaft (IfW) an der Aufbereitung des Indikators mit.
Der FTD-Indikator zeigt laut April-Auswertung für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von nur noch 0,6 Prozent im Vorjahresvergleich, das im zweiten Quartal weiter auf 0,3 Prozent nachlassen dürfte. Damit revidierten die Institute wegen der jüngsten Negativmeldungen zur Konjunktur verglichen zur März-Auswertung um 0,3 Prozentpunkte für das erste und sogar um 0,5 Prozentpunkte für das zweite Quartal 2003 nach unten.
Widrige Bedingungen für Prognosen
"Im Quartalsvergleich der Wirtschaftsleistung impliziert dies eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft vom vierten Quartal 2002 zum ersten Quartal 2003 und eine Stagnation im zweiten Quartal", sagte Suni. Damit stehe die Wirtschaft der Euro-Zone nach einer gängigen Definition derzeit am Rande einer Rezession: eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in zwei aufeinander folgenden Quartalen.
Catherine Mathieu vom französischen Institut OFCE, das den Indikator berechnet, wies allerdings darauf hin, dass in Zeiten großer geopolitischer Unsicherheit auch der Indikator mit größerer Vorsicht zu interpretieren sei als in Normalzeiten. Der Indikator könne nicht beantworten, ob der jüngste kriegsbedingte Stimmungsschock vorübergehend ist oder je nach Kriegsverlauf länger anhält. Diese Stimmungsindizes schwankten derzeit stark.
Der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex etwa, der in den FTD-Indikator eingeht, um die Konjunktur auf den Exportmärkten abzubilden, war im März mit Kriegsausbruch drastisch gesunken. Dieser Einbruch alleine trug bei der März-Auswertung des FTD-Indikators 0,2 Prozentpunkte zur Abwärtsrevision des Wachstums im ersten Quartal und 0,3 Prozentpunkte zur Abwärtsrevision der BIP-Entwicklung im zweiten Quartal bei.
Krieg dämpft Konsum und Investitionen
"Es könnte durchaus sein, dass die US-Firmen derzeit die Kriegsfolgen unterschätzen", sagte Catherine Mathieu. Für die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Monate bleibt der Fortgang der US-Offensive in Irak entscheidend. "Wenn der Krieg länger dauert, wird sich der Abschwung verstärken." Sei der Krieg dagegen schnell vorbei, und käme es zu einem Stimmungsaufschwung in den Unternehmen, könne sich die Wirtschaft noch im zweiten Quartal wieder beleben.
Neben der schwachen Wirtschaftsentwicklung in den USA war vor allem die eingetrübte Stimmung in der europäischen Industrie und unter den Einzelhändlern in der Euro-Zone für den Rückgang des Indikators verantwortlich. Auch die jüngste Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar machte sich für das erste und zweite Quartal negativ bemerkbar.
FTD 07.04.2003

.
Die Börse im Bann des Irak-Kriegs?
Wall Street bleibt von Ziellosigkeit geprägt
Seit Wochen schwanken die amerikanischen Aktienmärkte hin und her, ohne dass ein Trend erkennbar würde. Dies wird gemeinhin mit den geopolitischen Ungewissheiten begründet. Ein grösseres Fragezeichen muss aber wohl hinsichtlich des weiteren Wirtschaftsverlaufs gesetzt werden. Fast alle Konjunkturindikatoren weisen nach unten.
Glaubt man den Kommentatoren der mittlerweile weitgehend in Propagandazentralen der Regierung Bush umfunktionierten US-Fernsehanstalten, dann kann die Börse durchstarten, sobald sich im Irak der Sieg abzeichnet. In den letzten Tagen wurde der zügige Vormarsch der «Allianz der Willigen» in Richtung Bagdad jeweils mit Pluspunkten quittiert, während jede Rast der Jungs einen Schwächeanfall auslöste. Für jede Bombe, die am Mittwoch auf Bagdad fiel, stieg der Dow Jones Industrial um einen Zähler. Die Einnahme des Flugplatzes in Bagdad brachte am Freitag morgen rund 50 Bonuspunkte, die sich angesichts der schlechten Arbeitsmarktdaten allerdings rasch wieder verflüchtigten.
Privatanleger im Abseits
Die Aktienmärkte bleiben von hoher Volatilität und völliger Ziellosigkeit gekennzeichnet. Die alte Börsenweisheit «What goes up, must come down» - und umgekehrt - hat sich in den vergangenen Wochen wie schon lange nicht mehr bewahrheitet. Per saldo steht die Börse da, wo sie bei Kriegsausbruch war. Dies ist allerdings rund 10% höher als Anfang März, als die Finanzmärkte in Agonie der Dinge im Irak harrten. Die Euphorie unmittelbar nach Kriegsausbruch erwies sich als Strohfeuer. Die Trendlosigkeit mag in der Tat mit den geopolitischen Ungewissheiten zusammenhängen, aber dass die Anlegerentscheide von jedem Schritt der Alliierten oder jedem Zug der irakischen Guerillas unmittelbar beeinflusst werden, wie viele Kommentatoren vorgeben, muss füglich angezweifelt werden. In Tat und Wahrheit wird der Markt vom Berufshandel diktiert, und die privaten Investoren stehen abseits.
Über den militärischen Ausgang des Krieges können kaum Zweifel bestehen; die Frage ist, ob die Falken in Washington im Golf danach Frieden stiften können - und zu welchem Preis (in Dollar). Ein Sieg der Alliierten im Irak markiert vielleicht nicht das Ende der Unsicherheit, sondern den Anfang noch grösserer Ungewissheit. Mehr und mehr Amerikaner fragen sich, ob mit dem Geld nicht besser die Probleme an der Heimfront angepackt werden sollten. Der Wirtschaft geht es sichtlich nicht gut. John Doe und Henry Sixpack sorgen sich weniger über die richtigen Anlageentscheide als darüber, ob sie in sechs Monaten noch einen Job haben werden.
Rezessive Kräfte
Praktisch alle Konjunkturindikatoren weisen mittlerweile nach unten. Stellt man auf die neusten Statistiken der Einkäufervereinigung ab, so befindet sich nicht nur der Verarbeitungssektor, sondern die Gesamtwirtschaft in der Kontraktion.
Der vielbeschworene Konjunkturaufschwung hat sich jedenfalls nicht eingestellt. Ob er nach dem Kriegsende einsetzen wird, wie die Optimisten - unter ihnen die meisten Exponenten der Federal Reserve - glauben, muss sich erst weisen. Skeptiker meinen, die Investitionstätigkeit werde nicht durch die politischen Unwägbarkeiten behindert, sondern durch die Gewissheit, dass nach wie vor umfangreiche Kapazitäten brach liegen; von einem kriegsbedingten Investitionsstau könne also nicht die Rede sein.
Die Pessimisten befürchten zudem, dass bei einer weiteren Verschlechterung der Arbeitsmarktlage - die mit den März- Zahlen am Freitag bestätigt wurde - die private Konsumnachfrage wegbrechen und die Wirtschaft in eine rezessive Spirale stürzen könnte.
NZZ 05.04.2003
Die Börse im Bann des Irak-Kriegs?
Wall Street bleibt von Ziellosigkeit geprägt
Seit Wochen schwanken die amerikanischen Aktienmärkte hin und her, ohne dass ein Trend erkennbar würde. Dies wird gemeinhin mit den geopolitischen Ungewissheiten begründet. Ein grösseres Fragezeichen muss aber wohl hinsichtlich des weiteren Wirtschaftsverlaufs gesetzt werden. Fast alle Konjunkturindikatoren weisen nach unten.
Glaubt man den Kommentatoren der mittlerweile weitgehend in Propagandazentralen der Regierung Bush umfunktionierten US-Fernsehanstalten, dann kann die Börse durchstarten, sobald sich im Irak der Sieg abzeichnet. In den letzten Tagen wurde der zügige Vormarsch der «Allianz der Willigen» in Richtung Bagdad jeweils mit Pluspunkten quittiert, während jede Rast der Jungs einen Schwächeanfall auslöste. Für jede Bombe, die am Mittwoch auf Bagdad fiel, stieg der Dow Jones Industrial um einen Zähler. Die Einnahme des Flugplatzes in Bagdad brachte am Freitag morgen rund 50 Bonuspunkte, die sich angesichts der schlechten Arbeitsmarktdaten allerdings rasch wieder verflüchtigten.
Privatanleger im Abseits
Die Aktienmärkte bleiben von hoher Volatilität und völliger Ziellosigkeit gekennzeichnet. Die alte Börsenweisheit «What goes up, must come down» - und umgekehrt - hat sich in den vergangenen Wochen wie schon lange nicht mehr bewahrheitet. Per saldo steht die Börse da, wo sie bei Kriegsausbruch war. Dies ist allerdings rund 10% höher als Anfang März, als die Finanzmärkte in Agonie der Dinge im Irak harrten. Die Euphorie unmittelbar nach Kriegsausbruch erwies sich als Strohfeuer. Die Trendlosigkeit mag in der Tat mit den geopolitischen Ungewissheiten zusammenhängen, aber dass die Anlegerentscheide von jedem Schritt der Alliierten oder jedem Zug der irakischen Guerillas unmittelbar beeinflusst werden, wie viele Kommentatoren vorgeben, muss füglich angezweifelt werden. In Tat und Wahrheit wird der Markt vom Berufshandel diktiert, und die privaten Investoren stehen abseits.
Über den militärischen Ausgang des Krieges können kaum Zweifel bestehen; die Frage ist, ob die Falken in Washington im Golf danach Frieden stiften können - und zu welchem Preis (in Dollar). Ein Sieg der Alliierten im Irak markiert vielleicht nicht das Ende der Unsicherheit, sondern den Anfang noch grösserer Ungewissheit. Mehr und mehr Amerikaner fragen sich, ob mit dem Geld nicht besser die Probleme an der Heimfront angepackt werden sollten. Der Wirtschaft geht es sichtlich nicht gut. John Doe und Henry Sixpack sorgen sich weniger über die richtigen Anlageentscheide als darüber, ob sie in sechs Monaten noch einen Job haben werden.
Rezessive Kräfte
Praktisch alle Konjunkturindikatoren weisen mittlerweile nach unten. Stellt man auf die neusten Statistiken der Einkäufervereinigung ab, so befindet sich nicht nur der Verarbeitungssektor, sondern die Gesamtwirtschaft in der Kontraktion.
Der vielbeschworene Konjunkturaufschwung hat sich jedenfalls nicht eingestellt. Ob er nach dem Kriegsende einsetzen wird, wie die Optimisten - unter ihnen die meisten Exponenten der Federal Reserve - glauben, muss sich erst weisen. Skeptiker meinen, die Investitionstätigkeit werde nicht durch die politischen Unwägbarkeiten behindert, sondern durch die Gewissheit, dass nach wie vor umfangreiche Kapazitäten brach liegen; von einem kriegsbedingten Investitionsstau könne also nicht die Rede sein.
Die Pessimisten befürchten zudem, dass bei einer weiteren Verschlechterung der Arbeitsmarktlage - die mit den März- Zahlen am Freitag bestätigt wurde - die private Konsumnachfrage wegbrechen und die Wirtschaft in eine rezessive Spirale stürzen könnte.
NZZ 05.04.2003
so, jetzt habe ich alle Zeitungen durch ...
einen erfolgreichen Wochenstart wünscht
Konradi
Öl aus dem Irak:
Die Goldgrube ist nur schwer zugänglich
Internationale Ölkonzerne sind an Geschäften im Irak interessiert, doch noch sind die Risiken hoch
Der Irak könnte theoretisch ein reiches Land sein. Seine Ölvorräte sind die zweitgrößten der Welt. Doch Saddam Husseins Regime hat in den Jahren seit dem ersten Golfkrieg einen riesigen Schuldenberg angehäuft - zudem ist die Ölinfrastruktur des Landes in einem desolaten Zustand.
Von Eva Drews
Nein, begeistert waren die beiden Ölmultis Exxon und Shell wahrlich nicht. Nicht nur, dass die US-Soldaten in den ersten Kriegstagen nichts Besseres zu tun hatten, als den Flugplatz von Nasirija nach der Eroberung in "Bush International Airport" umzubenennen und damit Wasser auf die Mühlen der internationalen Kritik gegen die USA gießen. Die Truppen dachten sich auch schöne Namen für zwei Vorposten in der Wüste aus: Camp Shell und Camp Exxon - und bestätigten damit scheinbar den Vorwurf, die Amerikaner würden nur in den Krieg ziehen, um an die gigantischen Ölvorräte des Irak zu kommen. "Das fanden wir überhaupt nicht gut", sagt ein Shell-Sprecher, "Wir wollen nicht als Steigbügelhalter der Militärs dastehen." Er folgt damit der Linie, die Shell-Chef Philip Watts vorgegeben hat: "Unser Konzept ist, uns absolut rauszuhalten - das ist eine Sache von Regierungen und den Vereinten Nationen", sagte er Anfang Februar vor Journalisten. Und weiter: "Es gibt im Irak riesige Ölfelder, und Sie wären sicher überrascht, wenn wir das nicht erkundet hätten."
So unbeteiligt sich die internationalen Ölmultis derzeit geben - das Geschäft, das im Irak wartet, lockt jeden von ihnen. Neben Shell stehen auch US-Konzerne wie Exxon-Mobil oder Chevron-Texaco, wo die Sicherheitsberaterin von US-Präsident Bush, Condoleezza Rice, bis 2001 im Vorstand saß, in den Startlöchern. Die französische Total-Fina-Elf, die italienische Eni und die russische Lukoil haben sogar schon milliardenschwere Vorverträge mit dem Irak geschlossen.
Doch die meisten Experten gehen davon aus, dass der Start des großen Geschäfts noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. "Büros werden die Ölkonzerne ganz schnell in Bagdad eröffnen", sagt etwa Friedemann Müller, Irak-Experte des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit (SWP) in Berlin, aber bis die Unternehmen im Irak tatsächlich in größerem Umfang investierten, könne noch eine ganze Weile vergehen. Denn Grundvoraussetzung für deren Engagement seien stabile Verhältnisse: eine vertrauenswürdige Regierung, Sicherheit vor Anschlägen sowie eine verlässliche Steuergesetzgebung nennt Müller etwa. Solange das im Land an Euphrat und Tigris noch nicht gegeben sei, würden die Ölmultis auch nicht die nötigen Kredite erhalten. Fast 40 Milliarden Dollar, schätzt die Deutsche Bank in einer Studie, werden nötig sein, um die Förderkapazitäten des Irak von den derzeitigen zwei bis drei Millionen Barrel Öl pro Tag auf sechs Millionen Barrel anzuheben. Zudem hätten die Unternehmen ihren Aktionären gegenüber eine Verantwortung: "Wenn bei einem Anschlag wichtige Mitarbeiter umkämen, müssten sich die Unternehmen vor ihren Aktionären rechtfertigen."
Dass es unter den Ölmultis zum Hauen und Stechen um die Vormacht im Irak kommen könnte, befürchtet Müller nicht. "Sicher, unter dem Tisch wird es Schienbeintretereien geben, aber ich habe keine Zweifel, dass alle Beteiligten für möglichst faire Wettbewerbsbedingungen plädieren werden." Entsprechend scheint es ihm auch undenkbar, dass sich amerikanische und britische Unternehmen in den Vordergrund drängen könnten. Stattdessen gehe er davon aus, so der SWP-Experte, dass sich die Unternehmen zu Konsortien zusammenfinden werden, die sich die Risiken des Geschäfts teilten - unabhängig davon, ob sie aus Ländern stammten, die den Krieg befürworten oder nicht.
Bisher ist das irakische Ölgeschäft in staatlicher Hand - und Müller glaubt, dass es das auch bleiben wird. Die Ölstaaten am Kaspischen Meer machten vor, wie eine staatlich Ölindustrie mit freier Marktwirtschaft umgehen könne: Dort teilten sich die Staaten die Gewinne aus den Ölförderungen so mit den Unternehmen auf, dass gut 80 Prozent des Profits im Land blieben. Für die Unternehmen sei das immer noch profitabel. "Und es ist viel effektiver, als die Nachbarn des Irak bisher produzieren." Der Charme dieser Lösung steckt für Müller zudem darin, dass so auch keine Konflikte mit der Opec entstehen könnten, zu deren Gründern der Irak gehört. Als Land mit einer privatisierten Ölindustrie sähe das für den Irak wohl anders aus - schließlich ist die Opec einmal als Gegengewicht zu den großen Ölmultis entstanden.
Zwei bis drei Jahre, so schätzt Manouchihr Takin vom Londoner Center for Global Energy Studies, wird es dauern, bis stabile Verhältnisse im Irak entstanden sind - das Royal Institute of International Affairs in London geht sogar von fünf Jahren aus. Bis dahin muss der Irak, da sind sich Takin und Müller einig, zunächst vor allem mit eigenen Mitteln zurechtkommen, um seine desolate Ölinfrastruktur zumindest wieder auf den Stand der späten 80er Jahre zu bringen. Um aber wieder Einnahmen zu haben, muss der Irak so schnell wie möglich wieder mit dem Export von Öl beginnen. Zwei, eher bis zu sechs Monate wird es dauern, bis das Zweistromland so weit ist, schätzt Takin. Dann könnten wieder rund zwei Millionen Barrel Öl am Tag ins Ausland fließen.
Legt man einen Ölpreis von 25 Dollar zu Grunde, würde das für den Irak Einnahmen von rund 18 Milliarden Dollar jährlich bedeuten.
Eine lächerliche Summe, wenn man sich den Schuldenstand des Landes ansieht, den Saddam Hussein seit dem Beginn des ersten Golfkrieges angehäuft hat: Die Wochenzeitschrift Middle East Economic Digest (MEED) geht von sage und schreibe 250 Milliarden Dollar (rund 234 Milliarden Euro) aus. Alleine 70 Milliarden Dollar, so rechnet das Blatt vor, resultierten aus Reparationsforderungen aus dem zweiten Golfkrieg 1990/91 - der Großteil dieser Forderungen gehe von Kuwait aus, nur 16 Milliarden Dollar seien bisher gezahlt worden. Weitere 100 Milliarden Wiedergutmachungsforderungen stammten noch aus dem Golfkrieg gegen den Iran. Und schließlich, so die MEED, habe der Irak auch noch Schulden: vor allem bei Russland und Frankreich für die Lieferung von zivilen und militärischen Gütern während des Irak-Iran-Krieges Bei Saudi-Arabien und Kuwait stünden zudem Kredite aus. Insgesamt mindestens 60 Milliarden Dollar, inklusive Zinsen aber wohl eher 100 Milliarden. Selbst wenn die Gläubiger auf einen Teil der Schulden verzichten sollten: Es sieht nicht danach aus, als würde der Irak in absehbarer Zukunft etwas von seinem Reichtum haben.
Stuttgarter Zeitung 05.04.2003

einen erfolgreichen Wochenstart wünscht
Konradi
Öl aus dem Irak:
Die Goldgrube ist nur schwer zugänglich
Internationale Ölkonzerne sind an Geschäften im Irak interessiert, doch noch sind die Risiken hoch
Der Irak könnte theoretisch ein reiches Land sein. Seine Ölvorräte sind die zweitgrößten der Welt. Doch Saddam Husseins Regime hat in den Jahren seit dem ersten Golfkrieg einen riesigen Schuldenberg angehäuft - zudem ist die Ölinfrastruktur des Landes in einem desolaten Zustand.
Von Eva Drews
Nein, begeistert waren die beiden Ölmultis Exxon und Shell wahrlich nicht. Nicht nur, dass die US-Soldaten in den ersten Kriegstagen nichts Besseres zu tun hatten, als den Flugplatz von Nasirija nach der Eroberung in "Bush International Airport" umzubenennen und damit Wasser auf die Mühlen der internationalen Kritik gegen die USA gießen. Die Truppen dachten sich auch schöne Namen für zwei Vorposten in der Wüste aus: Camp Shell und Camp Exxon - und bestätigten damit scheinbar den Vorwurf, die Amerikaner würden nur in den Krieg ziehen, um an die gigantischen Ölvorräte des Irak zu kommen. "Das fanden wir überhaupt nicht gut", sagt ein Shell-Sprecher, "Wir wollen nicht als Steigbügelhalter der Militärs dastehen." Er folgt damit der Linie, die Shell-Chef Philip Watts vorgegeben hat: "Unser Konzept ist, uns absolut rauszuhalten - das ist eine Sache von Regierungen und den Vereinten Nationen", sagte er Anfang Februar vor Journalisten. Und weiter: "Es gibt im Irak riesige Ölfelder, und Sie wären sicher überrascht, wenn wir das nicht erkundet hätten."
So unbeteiligt sich die internationalen Ölmultis derzeit geben - das Geschäft, das im Irak wartet, lockt jeden von ihnen. Neben Shell stehen auch US-Konzerne wie Exxon-Mobil oder Chevron-Texaco, wo die Sicherheitsberaterin von US-Präsident Bush, Condoleezza Rice, bis 2001 im Vorstand saß, in den Startlöchern. Die französische Total-Fina-Elf, die italienische Eni und die russische Lukoil haben sogar schon milliardenschwere Vorverträge mit dem Irak geschlossen.
Doch die meisten Experten gehen davon aus, dass der Start des großen Geschäfts noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. "Büros werden die Ölkonzerne ganz schnell in Bagdad eröffnen", sagt etwa Friedemann Müller, Irak-Experte des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit (SWP) in Berlin, aber bis die Unternehmen im Irak tatsächlich in größerem Umfang investierten, könne noch eine ganze Weile vergehen. Denn Grundvoraussetzung für deren Engagement seien stabile Verhältnisse: eine vertrauenswürdige Regierung, Sicherheit vor Anschlägen sowie eine verlässliche Steuergesetzgebung nennt Müller etwa. Solange das im Land an Euphrat und Tigris noch nicht gegeben sei, würden die Ölmultis auch nicht die nötigen Kredite erhalten. Fast 40 Milliarden Dollar, schätzt die Deutsche Bank in einer Studie, werden nötig sein, um die Förderkapazitäten des Irak von den derzeitigen zwei bis drei Millionen Barrel Öl pro Tag auf sechs Millionen Barrel anzuheben. Zudem hätten die Unternehmen ihren Aktionären gegenüber eine Verantwortung: "Wenn bei einem Anschlag wichtige Mitarbeiter umkämen, müssten sich die Unternehmen vor ihren Aktionären rechtfertigen."
Dass es unter den Ölmultis zum Hauen und Stechen um die Vormacht im Irak kommen könnte, befürchtet Müller nicht. "Sicher, unter dem Tisch wird es Schienbeintretereien geben, aber ich habe keine Zweifel, dass alle Beteiligten für möglichst faire Wettbewerbsbedingungen plädieren werden." Entsprechend scheint es ihm auch undenkbar, dass sich amerikanische und britische Unternehmen in den Vordergrund drängen könnten. Stattdessen gehe er davon aus, so der SWP-Experte, dass sich die Unternehmen zu Konsortien zusammenfinden werden, die sich die Risiken des Geschäfts teilten - unabhängig davon, ob sie aus Ländern stammten, die den Krieg befürworten oder nicht.
Bisher ist das irakische Ölgeschäft in staatlicher Hand - und Müller glaubt, dass es das auch bleiben wird. Die Ölstaaten am Kaspischen Meer machten vor, wie eine staatlich Ölindustrie mit freier Marktwirtschaft umgehen könne: Dort teilten sich die Staaten die Gewinne aus den Ölförderungen so mit den Unternehmen auf, dass gut 80 Prozent des Profits im Land blieben. Für die Unternehmen sei das immer noch profitabel. "Und es ist viel effektiver, als die Nachbarn des Irak bisher produzieren." Der Charme dieser Lösung steckt für Müller zudem darin, dass so auch keine Konflikte mit der Opec entstehen könnten, zu deren Gründern der Irak gehört. Als Land mit einer privatisierten Ölindustrie sähe das für den Irak wohl anders aus - schließlich ist die Opec einmal als Gegengewicht zu den großen Ölmultis entstanden.
Zwei bis drei Jahre, so schätzt Manouchihr Takin vom Londoner Center for Global Energy Studies, wird es dauern, bis stabile Verhältnisse im Irak entstanden sind - das Royal Institute of International Affairs in London geht sogar von fünf Jahren aus. Bis dahin muss der Irak, da sind sich Takin und Müller einig, zunächst vor allem mit eigenen Mitteln zurechtkommen, um seine desolate Ölinfrastruktur zumindest wieder auf den Stand der späten 80er Jahre zu bringen. Um aber wieder Einnahmen zu haben, muss der Irak so schnell wie möglich wieder mit dem Export von Öl beginnen. Zwei, eher bis zu sechs Monate wird es dauern, bis das Zweistromland so weit ist, schätzt Takin. Dann könnten wieder rund zwei Millionen Barrel Öl am Tag ins Ausland fließen.
Legt man einen Ölpreis von 25 Dollar zu Grunde, würde das für den Irak Einnahmen von rund 18 Milliarden Dollar jährlich bedeuten.
Eine lächerliche Summe, wenn man sich den Schuldenstand des Landes ansieht, den Saddam Hussein seit dem Beginn des ersten Golfkrieges angehäuft hat: Die Wochenzeitschrift Middle East Economic Digest (MEED) geht von sage und schreibe 250 Milliarden Dollar (rund 234 Milliarden Euro) aus. Alleine 70 Milliarden Dollar, so rechnet das Blatt vor, resultierten aus Reparationsforderungen aus dem zweiten Golfkrieg 1990/91 - der Großteil dieser Forderungen gehe von Kuwait aus, nur 16 Milliarden Dollar seien bisher gezahlt worden. Weitere 100 Milliarden Wiedergutmachungsforderungen stammten noch aus dem Golfkrieg gegen den Iran. Und schließlich, so die MEED, habe der Irak auch noch Schulden: vor allem bei Russland und Frankreich für die Lieferung von zivilen und militärischen Gütern während des Irak-Iran-Krieges Bei Saudi-Arabien und Kuwait stünden zudem Kredite aus. Insgesamt mindestens 60 Milliarden Dollar, inklusive Zinsen aber wohl eher 100 Milliarden. Selbst wenn die Gläubiger auf einen Teil der Schulden verzichten sollten: Es sieht nicht danach aus, als würde der Irak in absehbarer Zukunft etwas von seinem Reichtum haben.
Stuttgarter Zeitung 05.04.2003
.
Nachkriegs-Irak
Die Milchmädchen-Rechnung der Öl-Strategen
Von Michael Kröger
Die US-Regierung ist noch immer davon überzeugt, dass sich der Wiederaufbau des Iraks durch dessen Öleinnahmen finanzieren lässt. Das könnte sich jedoch als teure Fehlkalkulation erweisen - mit weit reichenden Folgen.
Washington - Auf den Etappensieg sind die US-Strategen besonders stolz. Mit Erfolg hatten sie ihre irakischen Widersacher daran gehindert, im letzten Rückzugsgefecht die Ölquellen im Süden des Landes anzuzünden. Lediglich neun Bohrtürme konnten Saboteure in Brand setzen, bevor sie die Flucht antraten - kein Vergleich zu dem Inferno, das sie 1991 entfacht hatten.
Brennende Ölfelder hätten nicht nur den Vormarsch der alliierten Bodentruppen erschwert. Die Zerstörung der Ölförderanlagen hätte auch den Wiederaufbau nach dem Krieg merklich verlangsamt. Deshalb hatte die Sicherung von Bohrtürmen und Ölleitungen durch alliierte Truppen höchste Priorität.
Dennoch dürfte der große Geldsegen nach der Wiederaufnahme der irakischen Produktion noch lange auf sich warten lassen. Ein erster Augenschein genügte den Experten, um festzustellen, welche Arbeit noch auf zukommt. Rostige Leitungen, leckende Ventile und verrottete Steuerungstechnik - kaum ein System auf den Ölfeldern ist noch in brauchbarem Zustand. "Die Infrastruktur ist hoffnungslos veraltet", sagt Energieexperte Herman Franssen vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Jahrelange Sanktionen und dürftige Wartungsarbeiten haben die Industrie dahin siechen lassen. Weil Ersatzteile und Knowhow fehlten, fürchten viele Experten gar, dass die Felder bleibende Schäden erlitten haben.
An Produktionsanlauf ist nicht zu denken
In Rumaila, wo rund 60 Prozent des irakischen Öls gefördert wurden, ist deshalb auch vorerst nicht an ein Anfahren der Produktion zu denken. "Es wird mindestens drei Monate dauern, bevor dort überhaupt wieder gepumpt werden kann", vermutet Brian Burridge, Kommandeur der britischen Truppen im Golf, die das Gebiet im Süden des Landes eingenommen hatten
Damit könnte sich aber auch der Plan der Pentagon-Strategen als Luftbuchung erweisen, dass der Aufbau des Landes nach dem Krieg im Wesentlichen durch das Erölgeschäft finanziert werden kann. Ursprünglich war geplant, die Produktion so schnell wie möglich wieder auf das Niveau vor der irakischen Invasion Kuweits zu bringen, also rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag. Danach soll die Produktion so schnell wie möglich weiter gesteigert werden.
Kein Problem, so schien es zunächst, angesichts der gewaltigen Ölvorräte - immerhin verfügt der Irak über die zweitgrößten konventionellen Ölreserven der Welt und förderte davon vor dem Krieg lediglich 2,5 Millionen Barrel täglich, rund zwei Prozent der weltweiten Produktion.
Doch bis allein das erste Etappenziel erreicht ist, braucht es mindestens zwei bis drei Jahre, schätzt Franssen. "Die Produktion könnte zwar schneller wieder hochgefahren werden, doch die Iraker müssen die Anlagen zuerst modernisieren, damit die Reservoire nicht weiter geschädigt werden."
40 Milliarden Dollar Investitionen sind nötig
Zu diesem Ergebnis kommen auch die Experten vom London Centre for Global Energy Studies (CGES). Nach ihrer Schätzung dauert es mindestens bis zum Jahr 2005 um einen Ausstoß von 3,5 Millionen Barrel pro Tag zu fördern - doch das sei nur unter optimalen Bedingungen möglich. Um die geplante Tagesproduktion schließlich bis auf fünf Millionen Barrel anzuheben, seien 40 Milliarden Dollar an Investitionen nötig.
Als sicher gilt, dass sich diese Summe keinesfalls aus den Öleinnahmen finanzieren lässt. Denn zunächst sind Ausgaben für Nahrungsmittel, der Aufbau von Gesundheits- und Schulwesen und vieles andere fällig. Die Iraker sind deshalb auf ausländische Partner angewiesen. Exxon und Co stehen bereits in den Startlöchern, argwöhnisch beobachtet von russischen und französischen Öl-Konzernen.
Doch auch für die Öl-Barone könnte sich die Hoffnung auf das große Geschäft unter diesen Bedingungen als trügerisch erweisen. Denn sie werden gezwungen sein, möglichst schnell möglichst viel Öl zu verkaufen, um ihre Investitionen zu amortisieren. Die US-Regierung ebnet dafür bereits den Weg: Die Opec soll dem Irak gestatten, seine Produktion nach Kräften auszuweiten.
Opec in Gefahr
Das könnte jedoch, so befürchtet Opec-Präsident Abdullah al-Attijah, Ölminister von Katar, zu einer Überschwemmung des Marktes und damit zu einem drastischen Preissturz führen. Schlimmer noch: Nach Einschätzung des venezolanischen Vizepräsidenten José Vicente Rangel könnte so das Kräfteverhältnis innerhalb der Opec aus den Fugen geraten.
Es würde die Motivation der anderen Mitgliedsländer, sich an die eigenen Regeln zu halten, empfindlich verringern. Ein neuer Konkurrenzkampf würde entbrennen. Kurzfristige Folge: Mehrproduktion und fallende Preise - das wäre, so die Befürchtung von CGES-Chef Ahmed Saki al-Jamani, das Ende der Organisation.
SPIEGEL ONLINE 07.04.2003
Nachkriegs-Irak
Die Milchmädchen-Rechnung der Öl-Strategen
Von Michael Kröger
Die US-Regierung ist noch immer davon überzeugt, dass sich der Wiederaufbau des Iraks durch dessen Öleinnahmen finanzieren lässt. Das könnte sich jedoch als teure Fehlkalkulation erweisen - mit weit reichenden Folgen.
Washington - Auf den Etappensieg sind die US-Strategen besonders stolz. Mit Erfolg hatten sie ihre irakischen Widersacher daran gehindert, im letzten Rückzugsgefecht die Ölquellen im Süden des Landes anzuzünden. Lediglich neun Bohrtürme konnten Saboteure in Brand setzen, bevor sie die Flucht antraten - kein Vergleich zu dem Inferno, das sie 1991 entfacht hatten.
Brennende Ölfelder hätten nicht nur den Vormarsch der alliierten Bodentruppen erschwert. Die Zerstörung der Ölförderanlagen hätte auch den Wiederaufbau nach dem Krieg merklich verlangsamt. Deshalb hatte die Sicherung von Bohrtürmen und Ölleitungen durch alliierte Truppen höchste Priorität.
Dennoch dürfte der große Geldsegen nach der Wiederaufnahme der irakischen Produktion noch lange auf sich warten lassen. Ein erster Augenschein genügte den Experten, um festzustellen, welche Arbeit noch auf zukommt. Rostige Leitungen, leckende Ventile und verrottete Steuerungstechnik - kaum ein System auf den Ölfeldern ist noch in brauchbarem Zustand. "Die Infrastruktur ist hoffnungslos veraltet", sagt Energieexperte Herman Franssen vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Jahrelange Sanktionen und dürftige Wartungsarbeiten haben die Industrie dahin siechen lassen. Weil Ersatzteile und Knowhow fehlten, fürchten viele Experten gar, dass die Felder bleibende Schäden erlitten haben.
An Produktionsanlauf ist nicht zu denken
In Rumaila, wo rund 60 Prozent des irakischen Öls gefördert wurden, ist deshalb auch vorerst nicht an ein Anfahren der Produktion zu denken. "Es wird mindestens drei Monate dauern, bevor dort überhaupt wieder gepumpt werden kann", vermutet Brian Burridge, Kommandeur der britischen Truppen im Golf, die das Gebiet im Süden des Landes eingenommen hatten
Damit könnte sich aber auch der Plan der Pentagon-Strategen als Luftbuchung erweisen, dass der Aufbau des Landes nach dem Krieg im Wesentlichen durch das Erölgeschäft finanziert werden kann. Ursprünglich war geplant, die Produktion so schnell wie möglich wieder auf das Niveau vor der irakischen Invasion Kuweits zu bringen, also rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag. Danach soll die Produktion so schnell wie möglich weiter gesteigert werden.
Kein Problem, so schien es zunächst, angesichts der gewaltigen Ölvorräte - immerhin verfügt der Irak über die zweitgrößten konventionellen Ölreserven der Welt und förderte davon vor dem Krieg lediglich 2,5 Millionen Barrel täglich, rund zwei Prozent der weltweiten Produktion.
Doch bis allein das erste Etappenziel erreicht ist, braucht es mindestens zwei bis drei Jahre, schätzt Franssen. "Die Produktion könnte zwar schneller wieder hochgefahren werden, doch die Iraker müssen die Anlagen zuerst modernisieren, damit die Reservoire nicht weiter geschädigt werden."
40 Milliarden Dollar Investitionen sind nötig
Zu diesem Ergebnis kommen auch die Experten vom London Centre for Global Energy Studies (CGES). Nach ihrer Schätzung dauert es mindestens bis zum Jahr 2005 um einen Ausstoß von 3,5 Millionen Barrel pro Tag zu fördern - doch das sei nur unter optimalen Bedingungen möglich. Um die geplante Tagesproduktion schließlich bis auf fünf Millionen Barrel anzuheben, seien 40 Milliarden Dollar an Investitionen nötig.
Als sicher gilt, dass sich diese Summe keinesfalls aus den Öleinnahmen finanzieren lässt. Denn zunächst sind Ausgaben für Nahrungsmittel, der Aufbau von Gesundheits- und Schulwesen und vieles andere fällig. Die Iraker sind deshalb auf ausländische Partner angewiesen. Exxon und Co stehen bereits in den Startlöchern, argwöhnisch beobachtet von russischen und französischen Öl-Konzernen.
Doch auch für die Öl-Barone könnte sich die Hoffnung auf das große Geschäft unter diesen Bedingungen als trügerisch erweisen. Denn sie werden gezwungen sein, möglichst schnell möglichst viel Öl zu verkaufen, um ihre Investitionen zu amortisieren. Die US-Regierung ebnet dafür bereits den Weg: Die Opec soll dem Irak gestatten, seine Produktion nach Kräften auszuweiten.
Opec in Gefahr
Das könnte jedoch, so befürchtet Opec-Präsident Abdullah al-Attijah, Ölminister von Katar, zu einer Überschwemmung des Marktes und damit zu einem drastischen Preissturz führen. Schlimmer noch: Nach Einschätzung des venezolanischen Vizepräsidenten José Vicente Rangel könnte so das Kräfteverhältnis innerhalb der Opec aus den Fugen geraten.
Es würde die Motivation der anderen Mitgliedsländer, sich an die eigenen Regeln zu halten, empfindlich verringern. Ein neuer Konkurrenzkampf würde entbrennen. Kurzfristige Folge: Mehrproduktion und fallende Preise - das wäre, so die Befürchtung von CGES-Chef Ahmed Saki al-Jamani, das Ende der Organisation.
SPIEGEL ONLINE 07.04.2003
.
Gerüchte als Waffe
In der Wirtschaft herrscht Krieg. Diese These vertritt eine Schule in Paris. Sie lehrt, wie Unternehmen sich gegen Angreifer wehren können.
MARC GOERGEN
Seit die Amerikaner Pommes frites nicht mehr "French Fries", sondern "Freedom Fries" nennen, ist Christian Harbulot, 50, ein gefragter Mann. Französische Behörden und Unternehmen fragen um Rat, Rundfunksender bitten um ein Interview. Sie alle wollen wissen: Was tun, wenn US-Behörden aus Ärger über Frankreichs Irak-Politik keine Aufträge mehr an französische Firmen vergeben? Wenn amerikanische Konsumenten gar französischen Wein boykottieren?
Harbulot gilt als Mann vom Fach. Der ehemalige Geheimdienstler steht als Direktor der Pariser Ecole de Guerre Economique (EGE) vor, Europas einziger Schule des Wirtschaftskriegs. Dort lernen pro Jahr 30 Studenten, Boykotte zu bekämpfen, Desinformationskampagnen abzuwehren und Gegenangriffe zu starten. Die 1997 von Wehrexperten und Geheimdienstlern gegründete EGE gehört zur Pariser Handelsschule ESLSCA. Sie wird gesponsert vom französischen Verteidigungsministerium und der Rüstungsberatungsfirma Défense Conseil International.
"In der Wirtschaft herrscht Krieg", glaubt Harbulot. Es geht um die Eroberung von Märkten und um die Vernichtung des Gegners. Da sind viele Unternehmen und Staaten in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich.
Wichtigstes Werkzeug in diesem Krieg ist das Internet. Die wirksamsten Waffen sind Gerüchte.
Massive Aktionen wie Industriespionage oder Bestechung, so lehrt die Schule, kommen meistens ans Licht. Ein von den Medien oder übers Internet verbreitetes Gerücht etwa über Schwächen eines Produkts kann einem Unternehmen deutlich mehr schaden.
Die Aggressoren sitzen aus Harbulots Sicht in den USA, die Opfer in Europa und das nicht erst seit gestern: Anschaulichster Beleg dafür ist für ihn der Kampf, den der amerikanische Wodkahersteller Phillips Millennium und dessen französischer Konkurrent Belvédère schon 1998 ausfochten.
Nachdem die beiden Spirituosenproduzenten zwei Jahre lang ohne großen Erfolg versuchten, sich Marktanteile abzujagen, gingen die Amerikaner in die Offensive. Sie beauftragten die PR-Agentur Edelman, eine Kampagne gegen Belvédère zu starten. Zunächst wurden unter handverlesenen Journalisten Gerüchte gestreut. Dann, einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz der französischen Firma, stellte Phillips Millennium eine Website ins Netz. Dort wurde das Ergebnis von Belvédère offen angezweifelt, die Aktionäre des Konkurrenten wurden mit kritischen Fragen an die Geschäftsleitung munitioniert. Das Resultat: Der Aktienkurs von Belvédère stürzte um ein Drittel ab und hat sich seitdem kaum erholt.
Solche Attacken rechtzeitig zu erkennen und Gegenstrategien zu entwickeln ist Ziel des einjährigen Aufbaustudiengangs. Bewerben kann sich jeder, der ein Uni-Diplom oder fünf Jahre Berufserfahrung hat und die Studiengebühren von 10 000 Euro bezahlen kann. Dafür lernen die Schüler, Schmutzkampagnen zu lancieren, effektives Lobbying zu betreiben und nicht zuletzt auch fernöstliche Kampfkunst.
"Das Paradebeispiel in unserem Lehrgang war die Kampagne von Greenpeace zur `Brent Spar`", sagt Bernd Bühler, 28, der 2001 als bislang einziger Deutscher die Schule abschloss. "Da konnte man perfekt die Auswirkungen geschickt gestreuter Fehlinformation beobachten. Schließlich musste Shell ja nachgeben obwohl gar nicht so viel Öl in der Plattform war wie behauptet." Thema der Abschlussklausur war, als Nichtregierungsorganisation eine Kampagne gegen gentechnisch modifizierte Lebensmittel zu starten. Unter anderem stellten die Studenten dazu aus Daten von Konkurrenten, Pharmafirmen und der Weltgesundheitsorganisation eine Website zusammen, die mit viel Polemik Konsumenten vom Kauf des Gen-Food abhalten sollte.
Besonders geschickt in diesen Techniken des Wirtschaftskriegs sind nach Harbulots Erkenntnissen vor allem Globalisierungsgegner und US-Manager. "Amerikanische Firmen kennen sich viel besser mit Lobbying oder dem Streuen von Informationen aus als europäische", sagt der Schulleiter.
Die US-Manager nutzen derzeit nach seiner Meinung die antieuropäische Stimmung in Amerika, um Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. "Als Gegenmaßnahme müssten die europäischen Unternehmen in einer konzertierten Aktion genau die Leute ansprechen, die in Amerika nicht blind George W. Bush folgen", sagt Harbulot, "doch genau das fehlt gerade."
In Deutschland gibt es bislang keine Hochschule, die sich dem Wirtschaftskrieg verschrieben hat. Aber der Bedarf ist offenbar vorhanden. Eine Ausbildung in diesem Bereich sei sehr sinnvoll, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Bernd Bühler hatte jedenfalls keine Mühe, einen Job zu finden. Er arbeitet heute bei einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Sicherheitsberatung.
Die Pariser Strategen haben die Marktlücke in Deutschland längst entdeckt, ab Herbst wollen sie sie schließen. Dann sollen auch deutsche Manager in Mehrtagesseminaren in die Techniken der Kriegskunst eingeführt werden gegen eine Tagesgebühr von 800 bis 1000 Euro.
"Wir haben schon Anfragen großer deutscher Unternehmen erhalten", sagt Harbulot. Namen nennt er nicht.
DER SPIEGEL 07.04.2003
Gerüchte als Waffe
In der Wirtschaft herrscht Krieg. Diese These vertritt eine Schule in Paris. Sie lehrt, wie Unternehmen sich gegen Angreifer wehren können.
MARC GOERGEN
Seit die Amerikaner Pommes frites nicht mehr "French Fries", sondern "Freedom Fries" nennen, ist Christian Harbulot, 50, ein gefragter Mann. Französische Behörden und Unternehmen fragen um Rat, Rundfunksender bitten um ein Interview. Sie alle wollen wissen: Was tun, wenn US-Behörden aus Ärger über Frankreichs Irak-Politik keine Aufträge mehr an französische Firmen vergeben? Wenn amerikanische Konsumenten gar französischen Wein boykottieren?
Harbulot gilt als Mann vom Fach. Der ehemalige Geheimdienstler steht als Direktor der Pariser Ecole de Guerre Economique (EGE) vor, Europas einziger Schule des Wirtschaftskriegs. Dort lernen pro Jahr 30 Studenten, Boykotte zu bekämpfen, Desinformationskampagnen abzuwehren und Gegenangriffe zu starten. Die 1997 von Wehrexperten und Geheimdienstlern gegründete EGE gehört zur Pariser Handelsschule ESLSCA. Sie wird gesponsert vom französischen Verteidigungsministerium und der Rüstungsberatungsfirma Défense Conseil International.
"In der Wirtschaft herrscht Krieg", glaubt Harbulot. Es geht um die Eroberung von Märkten und um die Vernichtung des Gegners. Da sind viele Unternehmen und Staaten in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich.
Wichtigstes Werkzeug in diesem Krieg ist das Internet. Die wirksamsten Waffen sind Gerüchte.
Massive Aktionen wie Industriespionage oder Bestechung, so lehrt die Schule, kommen meistens ans Licht. Ein von den Medien oder übers Internet verbreitetes Gerücht etwa über Schwächen eines Produkts kann einem Unternehmen deutlich mehr schaden.
Die Aggressoren sitzen aus Harbulots Sicht in den USA, die Opfer in Europa und das nicht erst seit gestern: Anschaulichster Beleg dafür ist für ihn der Kampf, den der amerikanische Wodkahersteller Phillips Millennium und dessen französischer Konkurrent Belvédère schon 1998 ausfochten.
Nachdem die beiden Spirituosenproduzenten zwei Jahre lang ohne großen Erfolg versuchten, sich Marktanteile abzujagen, gingen die Amerikaner in die Offensive. Sie beauftragten die PR-Agentur Edelman, eine Kampagne gegen Belvédère zu starten. Zunächst wurden unter handverlesenen Journalisten Gerüchte gestreut. Dann, einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz der französischen Firma, stellte Phillips Millennium eine Website ins Netz. Dort wurde das Ergebnis von Belvédère offen angezweifelt, die Aktionäre des Konkurrenten wurden mit kritischen Fragen an die Geschäftsleitung munitioniert. Das Resultat: Der Aktienkurs von Belvédère stürzte um ein Drittel ab und hat sich seitdem kaum erholt.
Solche Attacken rechtzeitig zu erkennen und Gegenstrategien zu entwickeln ist Ziel des einjährigen Aufbaustudiengangs. Bewerben kann sich jeder, der ein Uni-Diplom oder fünf Jahre Berufserfahrung hat und die Studiengebühren von 10 000 Euro bezahlen kann. Dafür lernen die Schüler, Schmutzkampagnen zu lancieren, effektives Lobbying zu betreiben und nicht zuletzt auch fernöstliche Kampfkunst.
"Das Paradebeispiel in unserem Lehrgang war die Kampagne von Greenpeace zur `Brent Spar`", sagt Bernd Bühler, 28, der 2001 als bislang einziger Deutscher die Schule abschloss. "Da konnte man perfekt die Auswirkungen geschickt gestreuter Fehlinformation beobachten. Schließlich musste Shell ja nachgeben obwohl gar nicht so viel Öl in der Plattform war wie behauptet." Thema der Abschlussklausur war, als Nichtregierungsorganisation eine Kampagne gegen gentechnisch modifizierte Lebensmittel zu starten. Unter anderem stellten die Studenten dazu aus Daten von Konkurrenten, Pharmafirmen und der Weltgesundheitsorganisation eine Website zusammen, die mit viel Polemik Konsumenten vom Kauf des Gen-Food abhalten sollte.
Besonders geschickt in diesen Techniken des Wirtschaftskriegs sind nach Harbulots Erkenntnissen vor allem Globalisierungsgegner und US-Manager. "Amerikanische Firmen kennen sich viel besser mit Lobbying oder dem Streuen von Informationen aus als europäische", sagt der Schulleiter.
Die US-Manager nutzen derzeit nach seiner Meinung die antieuropäische Stimmung in Amerika, um Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. "Als Gegenmaßnahme müssten die europäischen Unternehmen in einer konzertierten Aktion genau die Leute ansprechen, die in Amerika nicht blind George W. Bush folgen", sagt Harbulot, "doch genau das fehlt gerade."
In Deutschland gibt es bislang keine Hochschule, die sich dem Wirtschaftskrieg verschrieben hat. Aber der Bedarf ist offenbar vorhanden. Eine Ausbildung in diesem Bereich sei sehr sinnvoll, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Bernd Bühler hatte jedenfalls keine Mühe, einen Job zu finden. Er arbeitet heute bei einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Sicherheitsberatung.
Die Pariser Strategen haben die Marktlücke in Deutschland längst entdeckt, ab Herbst wollen sie sie schließen. Dann sollen auch deutsche Manager in Mehrtagesseminaren in die Techniken der Kriegskunst eingeführt werden gegen eine Tagesgebühr von 800 bis 1000 Euro.
"Wir haben schon Anfragen großer deutscher Unternehmen erhalten", sagt Harbulot. Namen nennt er nicht.
DER SPIEGEL 07.04.2003
.
Oracle-Chef Ellison: Larrys düstere Valley-Vision
Larry Ellison gefällt sich neuerdings in der Rolle der Hightech-Kassandra. Nach Meinung des Oracle-Chefs ist die goldene Phase der Computerindustrie unwiderruflich vorbei. Für das kalifornische Silicon Valley sei das Ende nah.
New York - "Was wir erleben ... ist das Ende des Silicon Valley in seiner jetzigen Form", sagte Ellison in einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal". Der als exzentrisch geltende Milliardär hält die Vorstellung für überholt, dass sich die Informationstechnologie-Branche immer wieder neu erfinde und stetig weiter wachse. "Das nächste große Ding sind nicht Computer", so Ellison. Er sieht Biotechnologie als den kommenden Wachstumsmarkt.
Der Oracle-Chef prophezeit dem Wachstumssektor der vergangenen Jahrzehnte eine düstere Zukunft. Zunehmend standardisierte Produkte würden fortan von einer kleinen Zahl Unternehmen verkauft, dünne Gewinnmargen seien in Zukunft die Norm. "In der Computerindustrie gibt es die bizarre Vorstellung, dass wir nie eine reife Industrie sein werden." Dabei habe die Branche ihre maximale Größe bereits erreicht.
Weitere Vorhersagen der Internet-Kassandra: Die Hardware-Preise werden durch Billigrechner mit Linux als Betriebssystem weiter sinken. Die Entwicklung neuer Software werde in zunehmendem Maße außerhalb der USA stattfinden. Der Branche steht nach Ellisons Ansicht eine Konsolidierungsphase bevor, nach der nur ein paar große Mitspieler übrig bleiben werden, die dann eine breite Palette von Produkten anbieten.
Neidisch auf den großen Bill
Der einzige, der relativ unabhängig von der Branchenentwicklung agieren könne, sei der Betriebssystem-Anbieter Microsoft . "Wie hat Bill [Gates] die Rezession überstanden? Indem er die Preise erhöht hat! Warum ist das mir nicht eingefallen? Er ist ein Genie!" Ellison gesteht ein, dass er nicht ganz in der gleichen Liga spielt: "Wenn wir die Preise erhöhen, kaufen die Leute nichts mehr von uns. ... Wir sind kein Monopolist, verdammt! ... Dann hätte ich mehr Zeit zum Segeln."
Ellison ist sich zudem sicher, wer außer Microsoft und natürlich Oracle den langen kalten Winter überstehen wird und wer nicht. Cisco Systems , IBM , Dell , Intel , SAP und Amazon.com seien überlebensfähig. Spezialanbieter wie Ariba, Commerce One, BEA oder Siebel Systems trifft hingegen Ellisions Bannstrahl: Sie seien dem Untergang geweiht.
Ellisons pointierte Prognosen werden in der Technologiebranche stets mit Interesse und einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen. Seine bekannteste Prophezeiung ist der unmittelbar bevorstehende Tod des PCs (1995). Das Ereignis steht bekanntermaßen noch aus. Siebel-Chef Tom Siebel hat einen ganz eigenen Erklärungsansatz für Ellisons Valley-Vision: "Vielleicht hat er eine Sitzung mit seinem Therapeuten verpasst."
---
Hoffnungsträger MMS
Von Klaus Lüpertz
Trotz der leichten Kurserholung in den letzten Tagen bleiben die Börsen in einem mittelfristigen Abwärtstrend, und gegen diesen Trend werden sich Technologieaktien voraussichtlich nicht nachhaltig abheben können.
Es war wirklich nicht überraschend: MMS (Multimedia Messaging Services) war das herausragende Thema der diesjährigen Hightech-Messe Cebit in Hannover. Die neuen Handymodelle, auch die mit Farbdisplays bzw. eingebauter Kamera, wurden dagegen fast in die zweite Reihe gedrängt.
Bluetooth läuft mittlerweile in vielen Bereichen, aber es bleibt die Erkenntnis, dass der Massenmarkt "Blauzahn" noch lange nicht akzeptiert hat. Stichwort "3G": Das Thema, das eigentlich schon im Fokus des laufenden Jahres stehen sollte, ist zunächst einmal großzügig auf 2004 vertagt worden.
Auf der einen Seite ist die Verbreitung der Technologie mittlerweile recht erstaunlich - immerhin gibt es in den meisten europäischen Ländern, USA, Venezuela, Brasilien und vielen asiatischen Staaten entsprechend ausgerüstete Netze und Mobiltelefone -, und die Interoperabilitäts-Probleme, d.h. die Abstimmung zwischen den einzelnen nationalen Netzen, scheinen weitestgehend gelöst zu sein.
Sind die Hoffnungen auf Erfolge dank MMS berechtigt?
Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass die Zahl der MMS-Nutzer in Europa bei über 1 Million liegt, und in China allein wurden im abgelaufenen Kalenderjahr mehr als eine Million MMS-fähige Mobiltelefone verkauft.
Auf der anderen Seite gebe ich zu bedenken: Wenn wir tatsächlich eine Million MMS-Nutzer in Europa haben – wie viele der Nutzer werden MMS nachhaltig, d.h. auch mit entsprechend Profitaussichten für die Anbieterfirmen einsetzen?
Die bisherige Preisfindung von MMS läßt eher darauf schließen, dass MMS von vielen gelegentlich genutzt wird und sich nicht so schnell wie erhofft zu einer dynamischen Einnahmequelle entwickelt. Ähnliche Überlegungen gelten für die eine Million Nutzer in China, wenngleich mir sehr wohl bewusst ist, dass gerade asiatische Nutzer sehr viel technikfreundlicher eingestellt sind als wir hier in Europa oder in den USA.
MMS kann dann erfolgreich sein, wenn die neuen Funktionen vom Massenmarkt akzeptiert werden. Ich denke dabei vor allem an Spiele, Musik und ruhende bzw. bewegte Bilder.
Positive Effekte dank MMS kaum zu erwarten
So gibt es mittlerweile sogar interaktive Spiele für mehrere Nutzer, die über Bluetooth miteinander verbunden sind. Aber mal ehrlich: Wer von Ihnen hat das bereits ausprobiert?
Ob das Handy es wirklich schafft, die bisher schon stark verbreiteten mobilen Tonträger (angefangen von tragbaren Kassettenspielern, über DVD-, MD- und MP3-Spieler bis hin zu Radios) zu verdrängen, kann auch durchaus angezweifelt werden.
Für die Aktien der entsprechenden Unternehmen heißt das zunächst, dass kurzfristig nicht mit wirklich vielen guten Nachrichten seitens MMS zu rechnen sein wird.
Von daher bleibe ich auch bei einer Aussage der Vorwochen: Trotz der leichten Kurserholung in den letzten Tagen bleiben die Börsen in einem mittelfristigen Abwärtstrend, und gegen diesen Trend werden sich Technologieaktien voraussichtlich nicht nachhaltig abheben können.
Klaus Lüpertz, Analyst bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, bewertet regelmäßig ausgewählte Hightechwerte bei manager-magazin.de.
manager-magazin.de, 07.04.2003
Oracle-Chef Ellison: Larrys düstere Valley-Vision
Larry Ellison gefällt sich neuerdings in der Rolle der Hightech-Kassandra. Nach Meinung des Oracle-Chefs ist die goldene Phase der Computerindustrie unwiderruflich vorbei. Für das kalifornische Silicon Valley sei das Ende nah.
New York - "Was wir erleben ... ist das Ende des Silicon Valley in seiner jetzigen Form", sagte Ellison in einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal". Der als exzentrisch geltende Milliardär hält die Vorstellung für überholt, dass sich die Informationstechnologie-Branche immer wieder neu erfinde und stetig weiter wachse. "Das nächste große Ding sind nicht Computer", so Ellison. Er sieht Biotechnologie als den kommenden Wachstumsmarkt.
Der Oracle-Chef prophezeit dem Wachstumssektor der vergangenen Jahrzehnte eine düstere Zukunft. Zunehmend standardisierte Produkte würden fortan von einer kleinen Zahl Unternehmen verkauft, dünne Gewinnmargen seien in Zukunft die Norm. "In der Computerindustrie gibt es die bizarre Vorstellung, dass wir nie eine reife Industrie sein werden." Dabei habe die Branche ihre maximale Größe bereits erreicht.
Weitere Vorhersagen der Internet-Kassandra: Die Hardware-Preise werden durch Billigrechner mit Linux als Betriebssystem weiter sinken. Die Entwicklung neuer Software werde in zunehmendem Maße außerhalb der USA stattfinden. Der Branche steht nach Ellisons Ansicht eine Konsolidierungsphase bevor, nach der nur ein paar große Mitspieler übrig bleiben werden, die dann eine breite Palette von Produkten anbieten.
Neidisch auf den großen Bill
Der einzige, der relativ unabhängig von der Branchenentwicklung agieren könne, sei der Betriebssystem-Anbieter Microsoft . "Wie hat Bill [Gates] die Rezession überstanden? Indem er die Preise erhöht hat! Warum ist das mir nicht eingefallen? Er ist ein Genie!" Ellison gesteht ein, dass er nicht ganz in der gleichen Liga spielt: "Wenn wir die Preise erhöhen, kaufen die Leute nichts mehr von uns. ... Wir sind kein Monopolist, verdammt! ... Dann hätte ich mehr Zeit zum Segeln."
Ellison ist sich zudem sicher, wer außer Microsoft und natürlich Oracle den langen kalten Winter überstehen wird und wer nicht. Cisco Systems , IBM , Dell , Intel , SAP und Amazon.com seien überlebensfähig. Spezialanbieter wie Ariba, Commerce One, BEA oder Siebel Systems trifft hingegen Ellisions Bannstrahl: Sie seien dem Untergang geweiht.
Ellisons pointierte Prognosen werden in der Technologiebranche stets mit Interesse und einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen. Seine bekannteste Prophezeiung ist der unmittelbar bevorstehende Tod des PCs (1995). Das Ereignis steht bekanntermaßen noch aus. Siebel-Chef Tom Siebel hat einen ganz eigenen Erklärungsansatz für Ellisons Valley-Vision: "Vielleicht hat er eine Sitzung mit seinem Therapeuten verpasst."
---
Hoffnungsträger MMS
Von Klaus Lüpertz
Trotz der leichten Kurserholung in den letzten Tagen bleiben die Börsen in einem mittelfristigen Abwärtstrend, und gegen diesen Trend werden sich Technologieaktien voraussichtlich nicht nachhaltig abheben können.
Es war wirklich nicht überraschend: MMS (Multimedia Messaging Services) war das herausragende Thema der diesjährigen Hightech-Messe Cebit in Hannover. Die neuen Handymodelle, auch die mit Farbdisplays bzw. eingebauter Kamera, wurden dagegen fast in die zweite Reihe gedrängt.
Bluetooth läuft mittlerweile in vielen Bereichen, aber es bleibt die Erkenntnis, dass der Massenmarkt "Blauzahn" noch lange nicht akzeptiert hat. Stichwort "3G": Das Thema, das eigentlich schon im Fokus des laufenden Jahres stehen sollte, ist zunächst einmal großzügig auf 2004 vertagt worden.
Auf der einen Seite ist die Verbreitung der Technologie mittlerweile recht erstaunlich - immerhin gibt es in den meisten europäischen Ländern, USA, Venezuela, Brasilien und vielen asiatischen Staaten entsprechend ausgerüstete Netze und Mobiltelefone -, und die Interoperabilitäts-Probleme, d.h. die Abstimmung zwischen den einzelnen nationalen Netzen, scheinen weitestgehend gelöst zu sein.
Sind die Hoffnungen auf Erfolge dank MMS berechtigt?
Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass die Zahl der MMS-Nutzer in Europa bei über 1 Million liegt, und in China allein wurden im abgelaufenen Kalenderjahr mehr als eine Million MMS-fähige Mobiltelefone verkauft.
Auf der anderen Seite gebe ich zu bedenken: Wenn wir tatsächlich eine Million MMS-Nutzer in Europa haben – wie viele der Nutzer werden MMS nachhaltig, d.h. auch mit entsprechend Profitaussichten für die Anbieterfirmen einsetzen?
Die bisherige Preisfindung von MMS läßt eher darauf schließen, dass MMS von vielen gelegentlich genutzt wird und sich nicht so schnell wie erhofft zu einer dynamischen Einnahmequelle entwickelt. Ähnliche Überlegungen gelten für die eine Million Nutzer in China, wenngleich mir sehr wohl bewusst ist, dass gerade asiatische Nutzer sehr viel technikfreundlicher eingestellt sind als wir hier in Europa oder in den USA.
MMS kann dann erfolgreich sein, wenn die neuen Funktionen vom Massenmarkt akzeptiert werden. Ich denke dabei vor allem an Spiele, Musik und ruhende bzw. bewegte Bilder.
Positive Effekte dank MMS kaum zu erwarten
So gibt es mittlerweile sogar interaktive Spiele für mehrere Nutzer, die über Bluetooth miteinander verbunden sind. Aber mal ehrlich: Wer von Ihnen hat das bereits ausprobiert?
Ob das Handy es wirklich schafft, die bisher schon stark verbreiteten mobilen Tonträger (angefangen von tragbaren Kassettenspielern, über DVD-, MD- und MP3-Spieler bis hin zu Radios) zu verdrängen, kann auch durchaus angezweifelt werden.
Für die Aktien der entsprechenden Unternehmen heißt das zunächst, dass kurzfristig nicht mit wirklich vielen guten Nachrichten seitens MMS zu rechnen sein wird.
Von daher bleibe ich auch bei einer Aussage der Vorwochen: Trotz der leichten Kurserholung in den letzten Tagen bleiben die Börsen in einem mittelfristigen Abwärtstrend, und gegen diesen Trend werden sich Technologieaktien voraussichtlich nicht nachhaltig abheben können.
Klaus Lüpertz, Analyst bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, bewertet regelmäßig ausgewählte Hightechwerte bei manager-magazin.de.
manager-magazin.de, 07.04.2003
.
Warren Buffett sieht das offenbar völlig anders ...
Perfektes Timing
Warren Buffetts lukratives Internet-Investment
Von Thomas Hillenbrand

Während die Weltbörsen weiter schwächeln, hat Anlageguru Warren Buffett offenbar einen neuen Coup landen können. Dem Orakel von Omaha steht eine zweistellige Rendite ins Haus, weil er zum richtigen Zeitpunkt in die Internet-Branche investiert hat.
Omaha - Warren Buffet mag keine Technologieaktien. Der Börsenguru kaufte in der Vergangenheit lieber so genannte Value-Aktien wie Coca-Cola oder Gillette, die sich durch ein erprobtes Geschäftsmodell, eine starke Marke und stabile Erträge auszeichnen. Die viel zu hohe Bewertung von Hightech-Aktien hatte Buffet bereits früh zu der Bemerkung veranlasst, dass man mit der Ignoranz von Investoren nie mehr Geld habe machen können als während des Internet-Booms.
Inzwischen hat Buffett seine Strategie modifiziert. Im Sommer 2002 hatte er über die Geico Corporation, eine Tochter seines Unternehmens Berkshire Hathaway, Schrottanleihen des Internet-Einzelhändlers Amazon.com für insgesamt 98,3 Millionen Dollar erworben. Der Kurs der hoch verzinsten Junkbonds lag damals am Boden.
Nach mehreren positiven Quartalen hat sich nicht nur der Kurs von Amazon-Aktien inzwischen kräftig erholt, auch die von Buffet erworbene Anleihe ist im Wert wieder deutlich gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass das Online-Kaufhaus im Rahmen der Schuldentilgung die Anleihe im kommenden Monat zurückkaufen wird. Nach Berechnungen des Börseninformationsdienstes Bloomberg striche Buffet in diesem Fall einen Gewinn von 16,4 Millionen Dollar ein - das entspräche einer Rendite von satten 17 Prozent. Der Standard & Poor`s 500 Aktienindex fiel im gleichen Zeitraum um gut zwölf Prozent.
Blumen für Bezos
Der Einstieg war wohl auch ein Dankeschön an die Adresse von Amazon-Chef Jeff Bezos. Der hatte kurz vor Buffets Kauf bekannt gegeben, sein Unternehmen werde fortan Managern und Angestellten als Gehaltsbestandteil gewährte Aktienoptionen als Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen. Das Gros der amerikanischen Technologieunternehmen verweigert seinen Aktionären eine solch transparente Politik - obwohl Kritiker, allen voran Warren Buffet, das so genannte "options expensing" seit Jahren fordern.
Aber auch sonst hat Buffet sein Herz für Junkbonds von Technologie- und Internetunternehmen entdeckt. Im vergangenen Jahr hat Berkshire Hathaway seinen Bestand an Anleihen mit schlechter Bonität auf 8,3 Milliarden Dollar versechsfacht. Viele der von Buffett ins Visier genommenen Unternehmen hatten in den Neuzigern ein gutes Schuldenrating und sind in der Krise bei den großen Ratingagenturen in Ungnade gefallen.
Buffet hofft, dass diese "gefallenen Engel" mittelfristig wieder auf die Beine kommen und die Kurse ihrer Anleihen wieder anziehen. Berkshire hat unter anderem Bonds von AOL Time Warner, AT&T oder Level 3 Communications erworben. Auch bei abgeschmierten Versorgern (El Paso) und Mischkonzernen (Tyco) ist das Unternehmen eingestiegen.
Erst letzte Woche bewies Buffett jedoch, dass ihm bodenständige Produkte immer noch am liebsten sind: Für 1,7 Milliarden Dollar in bar kaufte er das amerikanische Unternehmen Clayton Homes, einen Hersteller von Fertighäusern.
"Buffettology"- die Regeln des Aktiengurus
Bei Aktienkäufen richtet sich Warren Buffett nach dem "Value-Ansatz" den er selber entscheidend mitgeprägt hat. Nach dem Value-Ansatz ist vor allem die Substanz eines Unternehmens wichtig - Internetfirmen, bei denen "Phantasie" eine Rolle spielt, sind für Buffett tabu.
Wichtige "Buffetology"-Kriterien sind:
hohe Eigenkapitalrendite,
geringe Verschuldung,
kontinuierliches Gewinnwachstum,
leicht verständliches Geschäft,
hohe Gewinnmargen,
hoher Free-Cash-Flow,
gute Marktstellung,
starker Markenname,
aktionärsfreundliches Management.
Buffett-Zitate
"Konzentrieren Sie sich auf Ihre Investments. Wenn Sie über einen Harem mit 40 Frauen verfügen, lernen Sie keine richtig kennen."
"Man sollte in Unternehmen investieren, die selbst ein Vollidiot leiten könnte, denn eines Tages wird genau das passieren."
"Wenn ich eine Aktie einmal habe, gebe ich sie am liebsten nie wieder her."
"Diversifikation ist ein Schutz gegen Ignoranz. Sie macht wenig Sinn für diejenigen, die wissen, was sie tun."
"Ein Unternehmen braucht einen Burggraben, um sich vor demjenigen zu schützen, der eines Tages kommen und das gleiche Produkt für einen Cent weniger anbieten wird."
"Wenn ich eine Aktie erwerbe, stelle ich mir vor, ich würde ein ganzes Unternehmen kaufen, so als ob ich einfach den kleinen Laden an der Ecke kaufen würde. Kaufte ich den kleinen Laden, würde ich alles über ihn wissen wollen."
"Risiken entstehen, wenn man nicht weiß, was man tut."
SPIEGEL ONLINE - 09. April 2003
Warren Buffett sieht das offenbar völlig anders ...

Perfektes Timing
Warren Buffetts lukratives Internet-Investment
Von Thomas Hillenbrand

Während die Weltbörsen weiter schwächeln, hat Anlageguru Warren Buffett offenbar einen neuen Coup landen können. Dem Orakel von Omaha steht eine zweistellige Rendite ins Haus, weil er zum richtigen Zeitpunkt in die Internet-Branche investiert hat.
Omaha - Warren Buffet mag keine Technologieaktien. Der Börsenguru kaufte in der Vergangenheit lieber so genannte Value-Aktien wie Coca-Cola oder Gillette, die sich durch ein erprobtes Geschäftsmodell, eine starke Marke und stabile Erträge auszeichnen. Die viel zu hohe Bewertung von Hightech-Aktien hatte Buffet bereits früh zu der Bemerkung veranlasst, dass man mit der Ignoranz von Investoren nie mehr Geld habe machen können als während des Internet-Booms.
Inzwischen hat Buffett seine Strategie modifiziert. Im Sommer 2002 hatte er über die Geico Corporation, eine Tochter seines Unternehmens Berkshire Hathaway, Schrottanleihen des Internet-Einzelhändlers Amazon.com für insgesamt 98,3 Millionen Dollar erworben. Der Kurs der hoch verzinsten Junkbonds lag damals am Boden.
Nach mehreren positiven Quartalen hat sich nicht nur der Kurs von Amazon-Aktien inzwischen kräftig erholt, auch die von Buffet erworbene Anleihe ist im Wert wieder deutlich gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass das Online-Kaufhaus im Rahmen der Schuldentilgung die Anleihe im kommenden Monat zurückkaufen wird. Nach Berechnungen des Börseninformationsdienstes Bloomberg striche Buffet in diesem Fall einen Gewinn von 16,4 Millionen Dollar ein - das entspräche einer Rendite von satten 17 Prozent. Der Standard & Poor`s 500 Aktienindex fiel im gleichen Zeitraum um gut zwölf Prozent.
Blumen für Bezos
Der Einstieg war wohl auch ein Dankeschön an die Adresse von Amazon-Chef Jeff Bezos. Der hatte kurz vor Buffets Kauf bekannt gegeben, sein Unternehmen werde fortan Managern und Angestellten als Gehaltsbestandteil gewährte Aktienoptionen als Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen. Das Gros der amerikanischen Technologieunternehmen verweigert seinen Aktionären eine solch transparente Politik - obwohl Kritiker, allen voran Warren Buffet, das so genannte "options expensing" seit Jahren fordern.
Aber auch sonst hat Buffet sein Herz für Junkbonds von Technologie- und Internetunternehmen entdeckt. Im vergangenen Jahr hat Berkshire Hathaway seinen Bestand an Anleihen mit schlechter Bonität auf 8,3 Milliarden Dollar versechsfacht. Viele der von Buffett ins Visier genommenen Unternehmen hatten in den Neuzigern ein gutes Schuldenrating und sind in der Krise bei den großen Ratingagenturen in Ungnade gefallen.
Buffet hofft, dass diese "gefallenen Engel" mittelfristig wieder auf die Beine kommen und die Kurse ihrer Anleihen wieder anziehen. Berkshire hat unter anderem Bonds von AOL Time Warner, AT&T oder Level 3 Communications erworben. Auch bei abgeschmierten Versorgern (El Paso) und Mischkonzernen (Tyco) ist das Unternehmen eingestiegen.
Erst letzte Woche bewies Buffett jedoch, dass ihm bodenständige Produkte immer noch am liebsten sind: Für 1,7 Milliarden Dollar in bar kaufte er das amerikanische Unternehmen Clayton Homes, einen Hersteller von Fertighäusern.
"Buffettology"- die Regeln des Aktiengurus
Bei Aktienkäufen richtet sich Warren Buffett nach dem "Value-Ansatz" den er selber entscheidend mitgeprägt hat. Nach dem Value-Ansatz ist vor allem die Substanz eines Unternehmens wichtig - Internetfirmen, bei denen "Phantasie" eine Rolle spielt, sind für Buffett tabu.
Wichtige "Buffetology"-Kriterien sind:
hohe Eigenkapitalrendite,
geringe Verschuldung,
kontinuierliches Gewinnwachstum,
leicht verständliches Geschäft,
hohe Gewinnmargen,
hoher Free-Cash-Flow,
gute Marktstellung,
starker Markenname,
aktionärsfreundliches Management.
Buffett-Zitate
"Konzentrieren Sie sich auf Ihre Investments. Wenn Sie über einen Harem mit 40 Frauen verfügen, lernen Sie keine richtig kennen."
"Man sollte in Unternehmen investieren, die selbst ein Vollidiot leiten könnte, denn eines Tages wird genau das passieren."
"Wenn ich eine Aktie einmal habe, gebe ich sie am liebsten nie wieder her."
"Diversifikation ist ein Schutz gegen Ignoranz. Sie macht wenig Sinn für diejenigen, die wissen, was sie tun."
"Ein Unternehmen braucht einen Burggraben, um sich vor demjenigen zu schützen, der eines Tages kommen und das gleiche Produkt für einen Cent weniger anbieten wird."
"Wenn ich eine Aktie erwerbe, stelle ich mir vor, ich würde ein ganzes Unternehmen kaufen, so als ob ich einfach den kleinen Laden an der Ecke kaufen würde. Kaufte ich den kleinen Laden, würde ich alles über ihn wissen wollen."
"Risiken entstehen, wenn man nicht weiß, was man tut."
SPIEGEL ONLINE - 09. April 2003
.
Marktkommentar Fredmund Malik vom 08.04.2003 :
Aktienrally vermutlich zu Ende
- heftige Abwärtsbewegung zu erwarten
- Gold und Dollar prognoseentsprechend
- Zinstrend gedreht
Die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte, die ich am 17. März 03 kommentierte und als vorübergehend und eher bedeutungslos einstufte, dürfte nun zu Ende sein. Der Anstieg war im Vergleich mit den vorangegangenen Kursverlusten insgesamt schwach.
Der Bearmarket ist intakt. Ich erwarte jetzt eine heftige Abwärtsbewegung. Nur wenn die Kurse den Höchststand vom 7. 4. nochmals überbieten, wird es einen erneuten Zeitgewinn geben und eine weitere Chance zum Glattstellen noch bestehender Long-Positionen.
Die Prognose für den Dollar ist auf Kurs. Die Erholung kann noch einige Zeit anhalten.
Der Abwärtstrend bei Gold und Silber entspricht den Beurteilungen seit November 02. Die einhellige Meinung, die zu Beginn des Jahres in den Medien vertreten wurde, hat sich einmal mehr als falsch erwiesen. In den Edelmetallen kann es in der nächsten Zeit eine Aufwärtsbewegung geben. Falls es so ist, wird es eher eine technische Reaktion sein und noch nicht das Ende des Bearmarkets. Ich halte vorläufig an den früher angegebenen Orientierungs-Marken fest.
Auch die Zinsen zeigen, wie vorausgesagt, eine steigende Tendenz.
Ich empfehle, die Kommentare in Aktuell seit dem November 02 zu rekapitulieren, um Orientierung für die längerfristige Entwicklung zu haben.
Marktkommentar Fredmund Malik vom 08.04.2003 :
Aktienrally vermutlich zu Ende
- heftige Abwärtsbewegung zu erwarten
- Gold und Dollar prognoseentsprechend
- Zinstrend gedreht
Die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte, die ich am 17. März 03 kommentierte und als vorübergehend und eher bedeutungslos einstufte, dürfte nun zu Ende sein. Der Anstieg war im Vergleich mit den vorangegangenen Kursverlusten insgesamt schwach.
Der Bearmarket ist intakt. Ich erwarte jetzt eine heftige Abwärtsbewegung. Nur wenn die Kurse den Höchststand vom 7. 4. nochmals überbieten, wird es einen erneuten Zeitgewinn geben und eine weitere Chance zum Glattstellen noch bestehender Long-Positionen.
Die Prognose für den Dollar ist auf Kurs. Die Erholung kann noch einige Zeit anhalten.
Der Abwärtstrend bei Gold und Silber entspricht den Beurteilungen seit November 02. Die einhellige Meinung, die zu Beginn des Jahres in den Medien vertreten wurde, hat sich einmal mehr als falsch erwiesen. In den Edelmetallen kann es in der nächsten Zeit eine Aufwärtsbewegung geben. Falls es so ist, wird es eher eine technische Reaktion sein und noch nicht das Ende des Bearmarkets. Ich halte vorläufig an den früher angegebenen Orientierungs-Marken fest.
Auch die Zinsen zeigen, wie vorausgesagt, eine steigende Tendenz.
Ich empfehle, die Kommentare in Aktuell seit dem November 02 zu rekapitulieren, um Orientierung für die längerfristige Entwicklung zu haben.
.
Welthandelsorganisation WTO :
Gibst du mir, nehm ich dir
Der Krieg behindert eine gerechte Globalisierung: Im Welthandel sucht der Norden nur noch seinen Vorteil
von Christian Tenbrock, Wolfgang Uchatius, Jan Dirk Herbermann
Der Irak-Krieg ist noch nicht zu Ende, aber Verlierer zeichnen sich schon ab. Menschen, von denen in dem Konflikt nie die Rede war: Milchproduzenten in Indien, Kleinbauern in Burkina Faso, Aids-Kranke in Uganda. Menschen, von denen westliche Regierungschefs nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 fast täglich sprachen. Der Krieg gegen den Terrorismus beginne damit, „die Armen der Welt am Wohlstandswachstum teilhaben zu lassen“, sagte damals der amerikanische Präsident George W. Bush. Vertreter von 142 Staaten trafen sich zur Welthandelskonferenz, um ein neues Miteinander von Nord und Süd zu demonstrieren. In Doha am Persischen Golf beschlossen sie, dem Welthandel neue Regeln zu geben, auf dass die Entwicklungsländer stärker von der Globalisierung profitierten.
Das ist lange her.
Heute entwerfen in Doha, im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte, die Generäle ihre Einsatzbefehle. Und in Genf, wo am Sitz der Welthandelsorganisation WTO die Verhandlungen laufen, zählen die Diplomaten die Rückschläge.
Längst denken die Industrieländer wieder zuerst an sich. Beispiel Patentschutz: Als einziges WTO-Mitglied blockiert Amerika eine Vereinbarung, die armen Staaten billig Medikamente verschaffen soll. Beispiel Landwirtschaft: Bis vergangenen Montag sollten sich die Unterhändler in Genf auf einen Vorschlag zum Abbau von Agrarzöllen und -subventionen verständigen – die Basis eines für die Entwicklungsländer profitableren Welthandels. Der Termin verstrich, eine Einigung blieb aus.
Ist das nur der bei politischen Verhandlungen übliche Schaukampf, der am Ende doch noch in einen Kompromiss mündet? Das glauben die Optimisten. Die Verhandlungen seien trotz aller Konflikte auf einem guten Weg, heißt es etwa im Umfeld des europäischen Handelsbeauftragten Pascal Lamy in Brüssel.
Oder ist das Blockieren und Bremsen der erste Kollateralschaden des Irak-Kriegs? Lassen die Streitereien zwischen Amerika und Kontinentaleuropa die WTO-Verhandlungen und die Hoffnung auf eine gerechtere Globalisierung scheitern? Das fürchten die Pessimisten. Es sei naiv zu glauben, die Weltlage habe keinen Einfluss auf die Verhandlungen, meint Walden Bello, Leiter der Dritte-Welt-Organisation Focus on the Global South in Bangkok. „Die nationalen Interessen treten wieder in den Vordergund“, sagt Thomas Straubhaar, Präsident des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs.
Nirgends wird das so deutlich wie beim Streit um Patente. In Doha zeigten sich Europäer und Amerikaner noch kompromissbereit. Sie willigten ein, das so genannte TRIPS-Abkommen zu modifizieren, das den Erfindern von Medikamenten einen 20-jährigen Patentschutz gewährt. So lange ist es anderen Ländern verboten, billigere Versionen der oft sehr teuren Arzneien zu importieren. Die Originale aber sind für viele Länder der Dritten Welt kaum zu bezahlen. Zwar erlaubt ihnen das TRIPS-Abkommen, die Imitate selbst herzustellen, aber Ländern wie Uganda, Angola oder Mali nützt das wenig. Die haben Millionen Aids- und Lungen-Kranke, doch keine eigene Pharmaindustrie. Deshalb sind sie auf den Import der billigen Imitate angewiesen. Jedes Jahr sterben weltweit rund 15 Millionen Menschen an heilbaren Krankheiten.
In Doha kündigten Nord und Süd an, das Problem zu lösen. „Damals hielten wir das für einen echten Fortschritt“, sagt Thomas Luppe von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Doch jetzt scheitert die Neuregelung an den USA, die durch den Handel mit kopierten Arzneien die Profite amerikanischer Pharmaunternehmen gefährdet sehen.
Auch die Einkommen amerikanischer Bauern liegen Präsident Bush am Herzen. Nur wenige Monate nach der Doha-Konferenz beschloss der amerikanische Kongress, die nicht gerade geringen staatlichen Subventionen für amerikanische Landwirte um 80 Prozent zu erhöhen. Gut 180 Milliarden Dollar sollen zusätzlich ausgeschüttet werden, für Sojabohnen und Mais, Erdnüsse, Baumwolle und Weizen. Dabei bewegt sich Bush ganz in der Tradition des alten Europa. Nach Berechnung der Hilfsorganisation Oxfam unterstützt die Europäische Union jede einzelne Kuh mit durchschnittlich zwei Dollar am Tag. Damit bekommt europäisches Vieh mehr als das, was der Hälfte der Weltbevölkerung täglich zum Leben bleibt. Das mit diesen Zuschüssen produzierte Milchpulver exportieren die Europäer dann billig nach Afrika oder in die Karibik, wo die örtlichen Bauern plötzlich ihre Kunden verlieren. Auf ausländische Butter aber schlägt die EU einen Zoll von 150 Prozent auf.
Durch die Agrarpolitik des Nordens entgehen den Bauern des Südens jedes Jahr 26Milliarden Dollar, hat das Internationale Forschungsinstitut für Nahrungspolitik in Washington ausgerechnet. In Doha hatten die Regierungsvertreter der Industrieländer noch zugestimmt, Importbeschränkungen und Subventionen abzubauen. Doch als der WTO-Diplomat Stuart Harbinson jüngst den Vorschlag machte, die Zölle auf Agrarprodukte um 60 Prozent zu reduzieren und Exporthilfen in den nächsten fünf Jahren um mindestens die Hälfte abzubauen, lehnte Europa ab. Viel zu viel!, sagten die EU-Vertreter in Genf.
Dabei ist die Landwirtschaft „das Schlüsselthema der Verhandlungen“, so der thailändische WTO-Chef Supachai Panitchpakdi. Und tatsächlich: Ohne Angebote des Nordens wird es kein Entgegenkommen des Südens geben – etwa bei der Öffnung der Märkte für Dienstleistungen, die den Industrienationen so wichtig ist (siehe nächste Seite).
Damit es in Genf vorwärts geht, müssten sich Amerikaner und Europäer – die Elefanten des Welthandels, auf die 60 Prozent des globalen Güter- und Dienstleistungsaustauschs entfallen – zunächst untereinander auf konkrete Zugeständnisse einigen. Das mache einen Erfolg der Welthandelsrunde zwar nicht sicher, „aber sehr viel wahrscheinlicher“, schrieb der amerikanische Handelsbeauftragte Bob Zoellick im britischen Economist.
Doch das war im Dezember, bevor in Amerika die Wut über die vermeintlich unsolidarische Haltung der Europäer anschwoll. Und in Europa die Empörung über die vermeintlich rücksichtslose Kriegspolitik Amerikas.
Jetzt fällt eine Einigung auch in der Handelspolitik schwerer denn je. „Die Atmosphäre zwischen den Blöcken ist vergiftet“, sagt Clyde Prestowitz, Chef des Washingtoner Economic Strategy Institute (ESI).
Das aber könnte in den USA jenen Stimmen Auftrieb geben, die in der WTO – wie auch in den UN und anderen multilateralen Organisationen – nur lästige Hindernisse sehen. „Diese Administration hat nichts übrig für internationale Vereinbarungen“, urteilt Jens van Scherpenberg, Amerika-Experte der Berliner Stifung Wissenschaft und Politik, über die Regierung Bush. „Die WTO passt nicht in ihre Denkweise, und die Welthandelsrunde ist ihr kein Anliegen mehr.“
Stattdessen setzt die amerikanische Regierung zunehmend auf direkte Verhandlungen mit einzelnen Ländern. Mit einer „Koalition der Willigen“ ist George W. Bush in den Irak-Krieg gezogen; „Arbeiten mit willigen Partnern“ nennt es Bob Zoellick, wenn Amerika mit Staaten wie Südafrika, Marokko oder Chile über eigene Handelsabkommen spricht. Kein Wunder, in der Begegnung eins gegen eins mit kleineren Staaten lassen sich Interessen der USA leichter durchsetzen als in multilateralen Verhandlungen.
In der WTO stellen die Entwicklungsländer 100 von inzwischen 145 Mitgliedern. Um diese rechnerische Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen, um die Einigkeit von Nord und Süd zu demonstrieren, behaupteten in Doha die Diplomaten der Industrienationen noch, die anstehenden Verhandlungen würden eine „Entwicklungsrunde“.
Anderthalb Jahre später, am WTO-Sitz in Genf, fürchtet Supachai Panitchpakdi, dass dieser Begriff „zur hohlen Phrase wird“.

DIE ZEIT - 15/2003
Welthandelsorganisation WTO :
Gibst du mir, nehm ich dir
Der Krieg behindert eine gerechte Globalisierung: Im Welthandel sucht der Norden nur noch seinen Vorteil
von Christian Tenbrock, Wolfgang Uchatius, Jan Dirk Herbermann
Der Irak-Krieg ist noch nicht zu Ende, aber Verlierer zeichnen sich schon ab. Menschen, von denen in dem Konflikt nie die Rede war: Milchproduzenten in Indien, Kleinbauern in Burkina Faso, Aids-Kranke in Uganda. Menschen, von denen westliche Regierungschefs nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 fast täglich sprachen. Der Krieg gegen den Terrorismus beginne damit, „die Armen der Welt am Wohlstandswachstum teilhaben zu lassen“, sagte damals der amerikanische Präsident George W. Bush. Vertreter von 142 Staaten trafen sich zur Welthandelskonferenz, um ein neues Miteinander von Nord und Süd zu demonstrieren. In Doha am Persischen Golf beschlossen sie, dem Welthandel neue Regeln zu geben, auf dass die Entwicklungsländer stärker von der Globalisierung profitierten.
Das ist lange her.
Heute entwerfen in Doha, im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte, die Generäle ihre Einsatzbefehle. Und in Genf, wo am Sitz der Welthandelsorganisation WTO die Verhandlungen laufen, zählen die Diplomaten die Rückschläge.
Längst denken die Industrieländer wieder zuerst an sich. Beispiel Patentschutz: Als einziges WTO-Mitglied blockiert Amerika eine Vereinbarung, die armen Staaten billig Medikamente verschaffen soll. Beispiel Landwirtschaft: Bis vergangenen Montag sollten sich die Unterhändler in Genf auf einen Vorschlag zum Abbau von Agrarzöllen und -subventionen verständigen – die Basis eines für die Entwicklungsländer profitableren Welthandels. Der Termin verstrich, eine Einigung blieb aus.
Ist das nur der bei politischen Verhandlungen übliche Schaukampf, der am Ende doch noch in einen Kompromiss mündet? Das glauben die Optimisten. Die Verhandlungen seien trotz aller Konflikte auf einem guten Weg, heißt es etwa im Umfeld des europäischen Handelsbeauftragten Pascal Lamy in Brüssel.
Oder ist das Blockieren und Bremsen der erste Kollateralschaden des Irak-Kriegs? Lassen die Streitereien zwischen Amerika und Kontinentaleuropa die WTO-Verhandlungen und die Hoffnung auf eine gerechtere Globalisierung scheitern? Das fürchten die Pessimisten. Es sei naiv zu glauben, die Weltlage habe keinen Einfluss auf die Verhandlungen, meint Walden Bello, Leiter der Dritte-Welt-Organisation Focus on the Global South in Bangkok. „Die nationalen Interessen treten wieder in den Vordergund“, sagt Thomas Straubhaar, Präsident des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs.
Nirgends wird das so deutlich wie beim Streit um Patente. In Doha zeigten sich Europäer und Amerikaner noch kompromissbereit. Sie willigten ein, das so genannte TRIPS-Abkommen zu modifizieren, das den Erfindern von Medikamenten einen 20-jährigen Patentschutz gewährt. So lange ist es anderen Ländern verboten, billigere Versionen der oft sehr teuren Arzneien zu importieren. Die Originale aber sind für viele Länder der Dritten Welt kaum zu bezahlen. Zwar erlaubt ihnen das TRIPS-Abkommen, die Imitate selbst herzustellen, aber Ländern wie Uganda, Angola oder Mali nützt das wenig. Die haben Millionen Aids- und Lungen-Kranke, doch keine eigene Pharmaindustrie. Deshalb sind sie auf den Import der billigen Imitate angewiesen. Jedes Jahr sterben weltweit rund 15 Millionen Menschen an heilbaren Krankheiten.
In Doha kündigten Nord und Süd an, das Problem zu lösen. „Damals hielten wir das für einen echten Fortschritt“, sagt Thomas Luppe von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Doch jetzt scheitert die Neuregelung an den USA, die durch den Handel mit kopierten Arzneien die Profite amerikanischer Pharmaunternehmen gefährdet sehen.
Auch die Einkommen amerikanischer Bauern liegen Präsident Bush am Herzen. Nur wenige Monate nach der Doha-Konferenz beschloss der amerikanische Kongress, die nicht gerade geringen staatlichen Subventionen für amerikanische Landwirte um 80 Prozent zu erhöhen. Gut 180 Milliarden Dollar sollen zusätzlich ausgeschüttet werden, für Sojabohnen und Mais, Erdnüsse, Baumwolle und Weizen. Dabei bewegt sich Bush ganz in der Tradition des alten Europa. Nach Berechnung der Hilfsorganisation Oxfam unterstützt die Europäische Union jede einzelne Kuh mit durchschnittlich zwei Dollar am Tag. Damit bekommt europäisches Vieh mehr als das, was der Hälfte der Weltbevölkerung täglich zum Leben bleibt. Das mit diesen Zuschüssen produzierte Milchpulver exportieren die Europäer dann billig nach Afrika oder in die Karibik, wo die örtlichen Bauern plötzlich ihre Kunden verlieren. Auf ausländische Butter aber schlägt die EU einen Zoll von 150 Prozent auf.
Durch die Agrarpolitik des Nordens entgehen den Bauern des Südens jedes Jahr 26Milliarden Dollar, hat das Internationale Forschungsinstitut für Nahrungspolitik in Washington ausgerechnet. In Doha hatten die Regierungsvertreter der Industrieländer noch zugestimmt, Importbeschränkungen und Subventionen abzubauen. Doch als der WTO-Diplomat Stuart Harbinson jüngst den Vorschlag machte, die Zölle auf Agrarprodukte um 60 Prozent zu reduzieren und Exporthilfen in den nächsten fünf Jahren um mindestens die Hälfte abzubauen, lehnte Europa ab. Viel zu viel!, sagten die EU-Vertreter in Genf.
Dabei ist die Landwirtschaft „das Schlüsselthema der Verhandlungen“, so der thailändische WTO-Chef Supachai Panitchpakdi. Und tatsächlich: Ohne Angebote des Nordens wird es kein Entgegenkommen des Südens geben – etwa bei der Öffnung der Märkte für Dienstleistungen, die den Industrienationen so wichtig ist (siehe nächste Seite).
Damit es in Genf vorwärts geht, müssten sich Amerikaner und Europäer – die Elefanten des Welthandels, auf die 60 Prozent des globalen Güter- und Dienstleistungsaustauschs entfallen – zunächst untereinander auf konkrete Zugeständnisse einigen. Das mache einen Erfolg der Welthandelsrunde zwar nicht sicher, „aber sehr viel wahrscheinlicher“, schrieb der amerikanische Handelsbeauftragte Bob Zoellick im britischen Economist.
Doch das war im Dezember, bevor in Amerika die Wut über die vermeintlich unsolidarische Haltung der Europäer anschwoll. Und in Europa die Empörung über die vermeintlich rücksichtslose Kriegspolitik Amerikas.
Jetzt fällt eine Einigung auch in der Handelspolitik schwerer denn je. „Die Atmosphäre zwischen den Blöcken ist vergiftet“, sagt Clyde Prestowitz, Chef des Washingtoner Economic Strategy Institute (ESI).
Das aber könnte in den USA jenen Stimmen Auftrieb geben, die in der WTO – wie auch in den UN und anderen multilateralen Organisationen – nur lästige Hindernisse sehen. „Diese Administration hat nichts übrig für internationale Vereinbarungen“, urteilt Jens van Scherpenberg, Amerika-Experte der Berliner Stifung Wissenschaft und Politik, über die Regierung Bush. „Die WTO passt nicht in ihre Denkweise, und die Welthandelsrunde ist ihr kein Anliegen mehr.“
Stattdessen setzt die amerikanische Regierung zunehmend auf direkte Verhandlungen mit einzelnen Ländern. Mit einer „Koalition der Willigen“ ist George W. Bush in den Irak-Krieg gezogen; „Arbeiten mit willigen Partnern“ nennt es Bob Zoellick, wenn Amerika mit Staaten wie Südafrika, Marokko oder Chile über eigene Handelsabkommen spricht. Kein Wunder, in der Begegnung eins gegen eins mit kleineren Staaten lassen sich Interessen der USA leichter durchsetzen als in multilateralen Verhandlungen.
In der WTO stellen die Entwicklungsländer 100 von inzwischen 145 Mitgliedern. Um diese rechnerische Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen, um die Einigkeit von Nord und Süd zu demonstrieren, behaupteten in Doha die Diplomaten der Industrienationen noch, die anstehenden Verhandlungen würden eine „Entwicklungsrunde“.
Anderthalb Jahre später, am WTO-Sitz in Genf, fürchtet Supachai Panitchpakdi, dass dieser Begriff „zur hohlen Phrase wird“.

DIE ZEIT - 15/2003
.
Finanzieller Fall-out
Banken drehen sich gegenseitig große Kredite an. Mehr als eine Billion Dollar werden jährlich auf diese Weise verschoben. Die Deals gefährden das Weltfinanzsystem
Von Thomas Hammer
Das Orakel hat gesprochen. „Immense Kreditrisiken sind mittlerweile bei einigen wenigen Kreditderivate-Händlern konzentriert“, warnt Warren Buffet, mit seiner Holding Berkshire Hathaway immerhin einer der erfolgreichsten und wohlhabendsten Investoren der Welt, in seinem aktuellen Brief an die Aktionäre. Finanzielle Probleme bei einem einzigen Marktteilnehmer könnten eine Kettenreaktion in Gang setzen, die das weltweite Finanzsystem ins Wanken bringen könne.
Damit lenkt Großinvestor Buffet den Blick auf einen Markt, der bislang im Verborgenen blüht. Die Wachstumsraten sind eindrucksvoll: 1996 lag das weltweit gehandelte Volumen an Kreditderivaten noch bei 50 Milliarden Dollar, zwei Jahre später waren es schon 350 Milliarden. Im vergangenen Jahr gingen Kontrakte im Wert von 1,2 Billionen Dollar über die Tresen der Händler, für dieses Jahr erwartet die British Bankers Association (BBA) einen Anstieg auf zwei Billionen Dollar. „Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das ungebremste Wachstum des Kreditderivate-Geschäfts ist hoch“, schreibt die BBA in einer aktuellen Studie.
Mit Kreditderivaten sichern sich Banken gegen Kreditausfälle ab. Manche Varianten ähneln einer Kreditversicherung oder Bürgschaft. Die Kredit gebende Bank bezahlt dem Garantiegeber eine Prämie dafür, dass dieser einspringt, wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann. Der Unterschied zur Bürgschaft oder Versicherung besteht jedoch darin, dass die Garantien handelbar sind. Die Konsequenz: Bei einem Ausfall des Schuldners muss derjenige zahlen, der gerade im Besitz des Garantiekontraktes ist. Die Alternative besteht darin, eine Anleihe in Höhe des abzusichernden Kreditvolumens herauszugeben und Zins- oder Tilgungszahlungen von der Höhe der Kreditausfälle abhängig zu machen.
Bei der Gestaltung der Kontrakte gibt es fast keine Regulierung. Ob die Geschäfte an einen einzelnen Großkredit oder an ein ganzes Kreditportfolio gekoppelt werden, entscheiden die Konstrukteure, deren Visitenkarte meist der schöne Titel „Risk Designer“ schmückt. Auch die Definition eines Ausfalls entspricht keinesfalls der einer normalen Insolvenz. Das für die Verträge ausschlaggebende „Credit Event“ kann schon eintreten, wenn der Schuldner lediglich mit den Zahlungen in Verzug gerät oder einen Teil seiner Schulden erlassen bekommt. Interessant in diesem Zusammenhang: In der Liste der größten Ausfälle bei Kreditderivaten kommen nach den obligatorischen Spitzenreitern Enron und Worldcom der britische Telekom-Ausrüster Marconi und der Bürogerätekonzern Xerox – zwei Unternehmen, die offiziell nie Insolvenz angemeldet haben. Erst danach stehen andere populäre Pleiten wie Swissair oder Global Crossing in der Katastrophen-Hitliste.
Für die Banken, die ihre Kreditrisiken mithilfe von Derivaten absichern, lohnt sich der Aufwand. Das in jüngster Vergangenheit bedenklich gewachsene Ausfallrisiko lässt sich auf diese Weise reduzieren, und bei manchen Konstruktionen verschwinden die Kredite sogar gänzlich aus der Bilanz – was wiederum Spielraum für neue Kredite eröffnet. So will etwa die Deutsche Bank künftig alle Großkredite mit mehr als 180 Tagen Laufzeit über Derivate absichern. Der Deal dürfte nach Expertenschätzungen zwar rund 400 Millionen Euro pro Jahr kosten. Im Gegenzug kann die Bank dadurch allerdings Wertberichtigungen in Höhe von fast zwei Milliarden Euro vermeiden.
Doch was für die eine Seite ein glänzendes Geschäft ist, stellt für die andere Seite ein unkalkulierbares Risiko dar. Aus welchen Krediten sich die Konstruktion zusammensetzt und unter welchen Bedingungen das Credit Event als eingetreten gilt, wird im in der Regel mehrere hundert Seiten umfassenden Kleingedruckten versteckt. Dazu kommt, dass für den Garantiegeber die Einnahmen durch die Risikoprämie nur einen Bruchteil der zu leistenden Zahlung im Ernstfall ausmachen. So kann beispielsweise die Übernahme eines Ausfallrisikos gegen eine Prämie von zehn Millionen Euro mit der Verpflichtung verbunden sein, im Ernstfall 100 Millionen Euro oder sogar noch viel mehr Geld zahlen zu müssen.
Auch die Transparenz des Marktes lässt zu wünschen übrig. Die meisten Geschäfte werden nicht über eine Börse, sondern im direkten Handel innerhalb der Institute abgewickelt. Drei Investmentbanken dominieren den weltweiten Handel: JP Morgan, Merrill Lynch und die Deutsche Bank.
Neulinge im Markt laufen Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden. So wähnte sich die japanische Versicherung Nomura auf der sicheren Seite, nachdem sie mit Kreditderivaten eine Wandelanleihe auf die britische Eisenbahngesellschaft Railtrack abgedeckt hatte. Als jedoch Railtrack Pleite ging, präsentierte die Credit Suisse First Boston (CSFB) als Emittentin des Derivates eine tief im Kleingedruckten versteckte Klausel, die sie von jeglicher Zahlungspflicht freistellte. Nomura klagte wegen unzureichender Risikoaufklärung vor einem britischen Gericht gegen CSFB – und bekam im Februar sogar Schadensersatz zugesprochen: Immerhin knapp zwei Millionen Euro. Auch wenn keine spektakulären Summen im Spiel sind, zeigt dieser Fall gleichwohl, welche Fallstricke das Derivate-Geschäft für weniger ausgebuffte Anlagemanager enthält. Die nämlich überblicken oft nicht, auf welche Risiken sie sich de facto einlassen.
Damit aber wächst auch die Gefahr, dass größere Ausfälle zu einer Kettenreaktion führen, die, wie Buffet befürchtet, sogar das gesamte Finanzsystem ins Wanken bringen könnte.
Und der alte Fuchs ist nicht der Einzige, der warnt. „Das Risiko schwirrt irgendwo da draußen herum. Es wird ja nicht einfach in einer Mine in Aserbajdschan vergraben“, macht Oliver Harris von der auf Banken spezialisierten Unternehmensberatung Oliver Wyman in London gegenüber dem Wall Street Journal das Problem deutlich. Über die Tresen der Händler verteilen sich die Ausfallrisiken als finanzieller Fall-out – aber nicht einmal Insider wissen genau, wo dieser im Ernstfall herunterkommt.
Denn von der internationalen Investmentbank bis zur kleinen Regionalbank, von der Lebensversicherung bis zum Hedge-Fonds haben Akteure unterschiedlichster Couleur inzwischen ihre Hände im gefährlichen Spiel. Selbst die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau hilft über ihre Handelsplattform „Promise“ Geschäftsbanken wie der Commerzbank und HypoVereinsbank, Risiken aus Mittelstandskrediten in Milliardenhöhe auszulagern – wohin auch immer. In den Bilanzen tauchen Kreditderivate allenfalls bruchstückhaft aus, weil ein großer Teil der Geschäfte von vielen Banken nur im Anhang erwähnt wird.
Nicht einmal darauf ist Verlass: Die Deutsche Bank verweist in ihrem Geschäftsbericht 2001 lediglich darauf, dass Kreditderivate „im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen den zinsbezogenen beziehungsweise den aktien- oder indexbezogenen Geschäften zugeordnet werden“. Das bedeutet für den geneigten Leser: Irgendwo im gesamten jährlichen Derivate-Handelsvolumen von fünf Billionen Euro darf er sie vermuten.
Die Rating-Agentur Fitch hat versucht, mit einer groß angelegten Studie etwas Licht ins Dunkel zu bringen. So zählen die großen internationalen Investmentbanken zu den „Protection Buyers“, die gegen Zahlung von Prämien oder Zinsaufschlägen ihre Risiken mit der Emission von Derivaten absichern. Die größten „Protection Sellers“, die Risiken übernehmen und dafür auf zusätzliche Renditen aus den Prämieneinnahmen hoffen, sind hingegen in der Versicherungswirtschaft zu finden. Insgesamt haben nach der Fitch-Studie die Versicherungen weltweit 283 Milliarden Dollar an Kreditrisiken über Derivate in ihren Anlage- und Handelsbestand geholt.
Weitere Anteile entfallen auf Hedge-Fonds und Investmentgesellschaften. Aber auch innerhalb der Bankenbranche zeichnet sich ein differenziertes Bild ab. So trifft die Aussage, dass Banken ihre Risiken aus der Bilanz auslagern, nur auf einen Teil der Institute zu. Denn die Banken in Deutschland zählen überwiegend zu den „Protection Sellers“: Nach Abzug der ausgelagerten Risiken bleibt bei den Banken hierzulande unterm Strich ein Zusatzrisiko von elf Milliarden Euro übrig.
Besonders eifrige Aktivitäten hat Fitch bei den Landesbanken festgestellt. „Die Netto-Risikoaufnahme in Deutschland wird stark von den Landesbanken beeinflusst“, schreibt die Rating-Agentur in ihrer Studie und weist darauf hin, dass vor allem die staatlichen Institute auf der Suche nach höheren Margen seit einigen Jahren verstärkt in Kreditderivate investieren. Da wundert es nicht weiter, dass auf der Liste der Worldcom-Gläubiger die WestLB und die Bayerische Landesbank mit jeweils dreistelligen Millionenbeträgen auftauchen. Ebenfalls auffällig ist die Baden-Württembergische Bank, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, deren Kreditderivate-Handelsvolumen von 38 Millionen Euro im Jahr 2000 sich innerhalb eines einzigen Jahres mehr als verdreißigfacht hat.
Diese Erkenntnisse dürften Wolfgang Artopeus nur mäßig überraschen. Schon im November 1998 bezweifelte der damalige Chef des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, dass die neu aufgekommenen Kreditderivate das Risiko in den Bankbilanzen wirklich nennenswert reduzieren würden. „Die Banken pflegen die durch die Absicherung gewonnenen Spielräume dazu zu nutzen, um neue, mit Ausfallrisiken behaftete Geschäfte einzugehen“, sagte Artopeus in einem Vortrag über Kreditrisiken.
Er hat Recht behalten.
Finanzieller Fall-out
Banken drehen sich gegenseitig große Kredite an. Mehr als eine Billion Dollar werden jährlich auf diese Weise verschoben. Die Deals gefährden das Weltfinanzsystem
Von Thomas Hammer
Das Orakel hat gesprochen. „Immense Kreditrisiken sind mittlerweile bei einigen wenigen Kreditderivate-Händlern konzentriert“, warnt Warren Buffet, mit seiner Holding Berkshire Hathaway immerhin einer der erfolgreichsten und wohlhabendsten Investoren der Welt, in seinem aktuellen Brief an die Aktionäre. Finanzielle Probleme bei einem einzigen Marktteilnehmer könnten eine Kettenreaktion in Gang setzen, die das weltweite Finanzsystem ins Wanken bringen könne.
Damit lenkt Großinvestor Buffet den Blick auf einen Markt, der bislang im Verborgenen blüht. Die Wachstumsraten sind eindrucksvoll: 1996 lag das weltweit gehandelte Volumen an Kreditderivaten noch bei 50 Milliarden Dollar, zwei Jahre später waren es schon 350 Milliarden. Im vergangenen Jahr gingen Kontrakte im Wert von 1,2 Billionen Dollar über die Tresen der Händler, für dieses Jahr erwartet die British Bankers Association (BBA) einen Anstieg auf zwei Billionen Dollar. „Das Vertrauen der Marktteilnehmer in das ungebremste Wachstum des Kreditderivate-Geschäfts ist hoch“, schreibt die BBA in einer aktuellen Studie.
Mit Kreditderivaten sichern sich Banken gegen Kreditausfälle ab. Manche Varianten ähneln einer Kreditversicherung oder Bürgschaft. Die Kredit gebende Bank bezahlt dem Garantiegeber eine Prämie dafür, dass dieser einspringt, wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann. Der Unterschied zur Bürgschaft oder Versicherung besteht jedoch darin, dass die Garantien handelbar sind. Die Konsequenz: Bei einem Ausfall des Schuldners muss derjenige zahlen, der gerade im Besitz des Garantiekontraktes ist. Die Alternative besteht darin, eine Anleihe in Höhe des abzusichernden Kreditvolumens herauszugeben und Zins- oder Tilgungszahlungen von der Höhe der Kreditausfälle abhängig zu machen.
Bei der Gestaltung der Kontrakte gibt es fast keine Regulierung. Ob die Geschäfte an einen einzelnen Großkredit oder an ein ganzes Kreditportfolio gekoppelt werden, entscheiden die Konstrukteure, deren Visitenkarte meist der schöne Titel „Risk Designer“ schmückt. Auch die Definition eines Ausfalls entspricht keinesfalls der einer normalen Insolvenz. Das für die Verträge ausschlaggebende „Credit Event“ kann schon eintreten, wenn der Schuldner lediglich mit den Zahlungen in Verzug gerät oder einen Teil seiner Schulden erlassen bekommt. Interessant in diesem Zusammenhang: In der Liste der größten Ausfälle bei Kreditderivaten kommen nach den obligatorischen Spitzenreitern Enron und Worldcom der britische Telekom-Ausrüster Marconi und der Bürogerätekonzern Xerox – zwei Unternehmen, die offiziell nie Insolvenz angemeldet haben. Erst danach stehen andere populäre Pleiten wie Swissair oder Global Crossing in der Katastrophen-Hitliste.
Für die Banken, die ihre Kreditrisiken mithilfe von Derivaten absichern, lohnt sich der Aufwand. Das in jüngster Vergangenheit bedenklich gewachsene Ausfallrisiko lässt sich auf diese Weise reduzieren, und bei manchen Konstruktionen verschwinden die Kredite sogar gänzlich aus der Bilanz – was wiederum Spielraum für neue Kredite eröffnet. So will etwa die Deutsche Bank künftig alle Großkredite mit mehr als 180 Tagen Laufzeit über Derivate absichern. Der Deal dürfte nach Expertenschätzungen zwar rund 400 Millionen Euro pro Jahr kosten. Im Gegenzug kann die Bank dadurch allerdings Wertberichtigungen in Höhe von fast zwei Milliarden Euro vermeiden.
Doch was für die eine Seite ein glänzendes Geschäft ist, stellt für die andere Seite ein unkalkulierbares Risiko dar. Aus welchen Krediten sich die Konstruktion zusammensetzt und unter welchen Bedingungen das Credit Event als eingetreten gilt, wird im in der Regel mehrere hundert Seiten umfassenden Kleingedruckten versteckt. Dazu kommt, dass für den Garantiegeber die Einnahmen durch die Risikoprämie nur einen Bruchteil der zu leistenden Zahlung im Ernstfall ausmachen. So kann beispielsweise die Übernahme eines Ausfallrisikos gegen eine Prämie von zehn Millionen Euro mit der Verpflichtung verbunden sein, im Ernstfall 100 Millionen Euro oder sogar noch viel mehr Geld zahlen zu müssen.
Auch die Transparenz des Marktes lässt zu wünschen übrig. Die meisten Geschäfte werden nicht über eine Börse, sondern im direkten Handel innerhalb der Institute abgewickelt. Drei Investmentbanken dominieren den weltweiten Handel: JP Morgan, Merrill Lynch und die Deutsche Bank.
Neulinge im Markt laufen Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden. So wähnte sich die japanische Versicherung Nomura auf der sicheren Seite, nachdem sie mit Kreditderivaten eine Wandelanleihe auf die britische Eisenbahngesellschaft Railtrack abgedeckt hatte. Als jedoch Railtrack Pleite ging, präsentierte die Credit Suisse First Boston (CSFB) als Emittentin des Derivates eine tief im Kleingedruckten versteckte Klausel, die sie von jeglicher Zahlungspflicht freistellte. Nomura klagte wegen unzureichender Risikoaufklärung vor einem britischen Gericht gegen CSFB – und bekam im Februar sogar Schadensersatz zugesprochen: Immerhin knapp zwei Millionen Euro. Auch wenn keine spektakulären Summen im Spiel sind, zeigt dieser Fall gleichwohl, welche Fallstricke das Derivate-Geschäft für weniger ausgebuffte Anlagemanager enthält. Die nämlich überblicken oft nicht, auf welche Risiken sie sich de facto einlassen.
Damit aber wächst auch die Gefahr, dass größere Ausfälle zu einer Kettenreaktion führen, die, wie Buffet befürchtet, sogar das gesamte Finanzsystem ins Wanken bringen könnte.
Und der alte Fuchs ist nicht der Einzige, der warnt. „Das Risiko schwirrt irgendwo da draußen herum. Es wird ja nicht einfach in einer Mine in Aserbajdschan vergraben“, macht Oliver Harris von der auf Banken spezialisierten Unternehmensberatung Oliver Wyman in London gegenüber dem Wall Street Journal das Problem deutlich. Über die Tresen der Händler verteilen sich die Ausfallrisiken als finanzieller Fall-out – aber nicht einmal Insider wissen genau, wo dieser im Ernstfall herunterkommt.
Denn von der internationalen Investmentbank bis zur kleinen Regionalbank, von der Lebensversicherung bis zum Hedge-Fonds haben Akteure unterschiedlichster Couleur inzwischen ihre Hände im gefährlichen Spiel. Selbst die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau hilft über ihre Handelsplattform „Promise“ Geschäftsbanken wie der Commerzbank und HypoVereinsbank, Risiken aus Mittelstandskrediten in Milliardenhöhe auszulagern – wohin auch immer. In den Bilanzen tauchen Kreditderivate allenfalls bruchstückhaft aus, weil ein großer Teil der Geschäfte von vielen Banken nur im Anhang erwähnt wird.
Nicht einmal darauf ist Verlass: Die Deutsche Bank verweist in ihrem Geschäftsbericht 2001 lediglich darauf, dass Kreditderivate „im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen den zinsbezogenen beziehungsweise den aktien- oder indexbezogenen Geschäften zugeordnet werden“. Das bedeutet für den geneigten Leser: Irgendwo im gesamten jährlichen Derivate-Handelsvolumen von fünf Billionen Euro darf er sie vermuten.
Die Rating-Agentur Fitch hat versucht, mit einer groß angelegten Studie etwas Licht ins Dunkel zu bringen. So zählen die großen internationalen Investmentbanken zu den „Protection Buyers“, die gegen Zahlung von Prämien oder Zinsaufschlägen ihre Risiken mit der Emission von Derivaten absichern. Die größten „Protection Sellers“, die Risiken übernehmen und dafür auf zusätzliche Renditen aus den Prämieneinnahmen hoffen, sind hingegen in der Versicherungswirtschaft zu finden. Insgesamt haben nach der Fitch-Studie die Versicherungen weltweit 283 Milliarden Dollar an Kreditrisiken über Derivate in ihren Anlage- und Handelsbestand geholt.
Weitere Anteile entfallen auf Hedge-Fonds und Investmentgesellschaften. Aber auch innerhalb der Bankenbranche zeichnet sich ein differenziertes Bild ab. So trifft die Aussage, dass Banken ihre Risiken aus der Bilanz auslagern, nur auf einen Teil der Institute zu. Denn die Banken in Deutschland zählen überwiegend zu den „Protection Sellers“: Nach Abzug der ausgelagerten Risiken bleibt bei den Banken hierzulande unterm Strich ein Zusatzrisiko von elf Milliarden Euro übrig.
Besonders eifrige Aktivitäten hat Fitch bei den Landesbanken festgestellt. „Die Netto-Risikoaufnahme in Deutschland wird stark von den Landesbanken beeinflusst“, schreibt die Rating-Agentur in ihrer Studie und weist darauf hin, dass vor allem die staatlichen Institute auf der Suche nach höheren Margen seit einigen Jahren verstärkt in Kreditderivate investieren. Da wundert es nicht weiter, dass auf der Liste der Worldcom-Gläubiger die WestLB und die Bayerische Landesbank mit jeweils dreistelligen Millionenbeträgen auftauchen. Ebenfalls auffällig ist die Baden-Württembergische Bank, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, deren Kreditderivate-Handelsvolumen von 38 Millionen Euro im Jahr 2000 sich innerhalb eines einzigen Jahres mehr als verdreißigfacht hat.
Diese Erkenntnisse dürften Wolfgang Artopeus nur mäßig überraschen. Schon im November 1998 bezweifelte der damalige Chef des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, dass die neu aufgekommenen Kreditderivate das Risiko in den Bankbilanzen wirklich nennenswert reduzieren würden. „Die Banken pflegen die durch die Absicherung gewonnenen Spielräume dazu zu nutzen, um neue, mit Ausfallrisiken behaftete Geschäfte einzugehen“, sagte Artopeus in einem Vortrag über Kreditrisiken.
Er hat Recht behalten.
.
Für Arbeitnehmer, gegen Arbeitslose
Von Christoph Keese / Financial Times Deutschland
Der neue IG-Metall-Chef Jürgen Peters sieht sich gern als Anwalt seiner Mitglieder. Anders gesagt richtet er die Gewerkschaft allein auf Politik für die eigene Klientel aus.
Jeder, der eine neue Aufgabe übernimmt, bekommt eine faire Chance und hundert Tage Schonfrist - auch Jürgen Peters, der designierte Nachfolger von Klaus Zwickel als IG-Metall-Vorsitzender. Was Peters jetzt zur Wirtschaftspolitik sagte, zeigt jedoch, dass er die Schonfrist nicht in Anspruch nimmt, sondern schon vor seinem Amtsantritt den Konflikt sucht. In einer Reihe von Interviews droht er Widerstand gegen die Politik der Regierung an. Besonders eine Reform des Kündigungsschutzes und die Zahlung des Krankengeldes durch Arbeitnehmer möchte er verhindern. Damit gibt er den Ton für die linken SPD-Bundestagsabgeordneten vor, die den Bundeskanzler per Mitgliederbegehren von seinem Reformkurs abbringen wollen.
Peters bestreitet, ein "Betonkopf" zu sein oder die Gewerkschaft zur "klassenkämpferischen Sekte" machen zu wollen. Was er will, ist dies: "Wir haben über 2,6 Millionen Mitglieder. Denen sind wir verpflichtet. Deren Arbeits- und Lebensbedingungen müssen wir verbessern." Damit spricht er aus, was andere Gewerkschaftsführer nur ungern zugeben. Er sieht sich ausschließlich als Anwalt seiner Mitglieder. Wer Beiträge zahlt, genießt Schutz. Wer nicht dabei ist, darf nicht auf ihn zählen.
Selten zuvor hat ein IG-Metall-Chef den Konflikt zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen so unmissverständlich auf den Punkt gebracht: Die Gewerkschaft ist für Arbeitsplatzinhaber da, wer seine Arbeit verliert, verliert auch seine Stimme. Gegen diese Deutung mag man einwenden, dass auch Arbeitslose Mitglieder der IG Metall sind, Peters folglich auch sie als Mandanten verstehen muss.
Auseinander klaffende Interessen
Doch das Argument sticht nicht. Schon nach ihrer Zahl fallen Arbeitslose in der IG Metall kaum ins Gewicht. Auch politisch kann Peters nicht beide Gruppen gleichzeitig bedienen. Je härter eine Konjunktur- und Strukturkrise ausfällt, desto weiter klaffen die Interessen der Besitzenden und der Habenichtse auseinander. Die einen wollen bewahren, die anderen neu verteilen. Beides auf einmal geht nicht. Peters muss sich entscheiden, und er ergreift schon jetzt für die Besitzenden Partei. Sie stellen die Mehrheit der IG Metall, ihnen fühlt er sich verpflichtet. Konsequent verfolgt Peters genau diesen Kurs.
Die "FAZ" hat ihn gefragt, was er von der Einschätzung des IWF-Chefs Horst Köhler halte, dass der überregulierte Arbeitsmarkt die Volkswirtschaft stranguliere. Peters antwortete mit einer Beleidigung: "Dadurch, dass Dummheiten 35-mal wiederholt werden, werden sie auch nicht besser." Ein valides ökonomisches Argument hat er nicht. Auch der unbestreitbaren Tatsache, dass der übertriebene Kündigungsschutz Einstellungen verhindert, weiß Peters nichts zu entgegnen. Wieder antwortet er flapsig und weicht aus.
Eine volkswirtschaftliche Debatte wird mit diesem IG-Metall-Chef nicht zu führen sein. Er hegt ebenso viel Interesse für Empirie wie ein Verteidiger, der seinen Mandanten beschützt. Beweise sind gut, wenn sie dem Ziel dienen, sonst werden sie rhetorisch niedergebügelt. Weil Peters immer so gedacht hat, halten viele ihn für einen Betonkopf. Doch sein Denken ist nicht mehr oder weniger betoniert als das eines Rechtsbeistands. Für seinen Mandanten nicht das Maximum herausholen zu wollen, ist in seinen Augen Verrat. Peters will nicht die objektiv fairste Lösung finden, sondern die maximale Verhandlungsposition aufbauen. Gewerkschafter, die diese Rolle verlassen und den neutralen Wirtschaftspolitiker spielen möchten, sind ihm ein Gräuel.
Dialektischer Konflikt
Für die Debatte der nächsten Jahre lassen sich daraus einige Schlussfolgerungen ziehen. Runde Tische sind überflüssig und werden kein Ergebnis bringen. Peters ist Dialektiker. Er formuliert scharfe Thesen und will die Antithese entkräften. Synthesen zu finden ist nicht seine Sache. Damit drängt er die Regierung in die Richterrolle. So entschlossen, wie er sie provoziert, muss sie entscheiden. Wenn sie Konsens sucht, wird er das als Schwäche deuten und seine Forderung hochschrauben.
Gegen jede harte Entscheidung wird er seine Massen mobilisieren. Arbeitgeber und Volkswirte haben nur eine Chance, wenn sie mit gleicher Münze zurückzahlen. Sie müssen den Konflikt in die Öffentlichkeit tragen und emotionalisieren. Peters wird sie als neoliberale Arbeitnehmerfeinde brandmarken, sie müssen ihn als reformfeindlichen Betonkopf titulieren. Die Chancen, Peters dabei in die Ecke zu drängen, sind nicht schlecht.
Seine größte Schwäche ist das mangelnde Interesse für empirische Fakten. Fast jedes Argument, das Peters in Interviews und Talkshows anführt, ist schnell zu zertrümmern. Ein Beispiel: Er behauptet, dass die Lockerung des Kündigungsschutzes unter Helmut Kohl nicht mehr, sondern weniger Arbeitsplätze gebracht hätte. Eine unhaltbare These - Kohls Reform war zu klein und zu kurz, um einen messbaren Effekt entfalten zu können, und wurde zudem von einer Reihe gegenteilig wirkender Kräfte überlagert.
Ob er seiner Sache mit der Taktik des maximalen Polarisierens hilft, ist fraglich. Gerade weil er viel Energie auf Profilschärfe, aber wenig auf Denkschärfe verwendet, läuft er Gefahr, von der Wirklichkeit widerlegt zu werden. Die IG Metall-Mitglieder werden unter Peters vielleicht mehr verdienen als unter Zwickel. Aber auf Dauer werden immer weniger von ihnen Arbeit haben. Damit schmilzt die Zustimmung für seinen Konfliktkurs.
Für Arbeitnehmer, gegen Arbeitslose
Von Christoph Keese / Financial Times Deutschland
Der neue IG-Metall-Chef Jürgen Peters sieht sich gern als Anwalt seiner Mitglieder. Anders gesagt richtet er die Gewerkschaft allein auf Politik für die eigene Klientel aus.
Jeder, der eine neue Aufgabe übernimmt, bekommt eine faire Chance und hundert Tage Schonfrist - auch Jürgen Peters, der designierte Nachfolger von Klaus Zwickel als IG-Metall-Vorsitzender. Was Peters jetzt zur Wirtschaftspolitik sagte, zeigt jedoch, dass er die Schonfrist nicht in Anspruch nimmt, sondern schon vor seinem Amtsantritt den Konflikt sucht. In einer Reihe von Interviews droht er Widerstand gegen die Politik der Regierung an. Besonders eine Reform des Kündigungsschutzes und die Zahlung des Krankengeldes durch Arbeitnehmer möchte er verhindern. Damit gibt er den Ton für die linken SPD-Bundestagsabgeordneten vor, die den Bundeskanzler per Mitgliederbegehren von seinem Reformkurs abbringen wollen.
Peters bestreitet, ein "Betonkopf" zu sein oder die Gewerkschaft zur "klassenkämpferischen Sekte" machen zu wollen. Was er will, ist dies: "Wir haben über 2,6 Millionen Mitglieder. Denen sind wir verpflichtet. Deren Arbeits- und Lebensbedingungen müssen wir verbessern." Damit spricht er aus, was andere Gewerkschaftsführer nur ungern zugeben. Er sieht sich ausschließlich als Anwalt seiner Mitglieder. Wer Beiträge zahlt, genießt Schutz. Wer nicht dabei ist, darf nicht auf ihn zählen.
Selten zuvor hat ein IG-Metall-Chef den Konflikt zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen so unmissverständlich auf den Punkt gebracht: Die Gewerkschaft ist für Arbeitsplatzinhaber da, wer seine Arbeit verliert, verliert auch seine Stimme. Gegen diese Deutung mag man einwenden, dass auch Arbeitslose Mitglieder der IG Metall sind, Peters folglich auch sie als Mandanten verstehen muss.
Auseinander klaffende Interessen
Doch das Argument sticht nicht. Schon nach ihrer Zahl fallen Arbeitslose in der IG Metall kaum ins Gewicht. Auch politisch kann Peters nicht beide Gruppen gleichzeitig bedienen. Je härter eine Konjunktur- und Strukturkrise ausfällt, desto weiter klaffen die Interessen der Besitzenden und der Habenichtse auseinander. Die einen wollen bewahren, die anderen neu verteilen. Beides auf einmal geht nicht. Peters muss sich entscheiden, und er ergreift schon jetzt für die Besitzenden Partei. Sie stellen die Mehrheit der IG Metall, ihnen fühlt er sich verpflichtet. Konsequent verfolgt Peters genau diesen Kurs.
Die "FAZ" hat ihn gefragt, was er von der Einschätzung des IWF-Chefs Horst Köhler halte, dass der überregulierte Arbeitsmarkt die Volkswirtschaft stranguliere. Peters antwortete mit einer Beleidigung: "Dadurch, dass Dummheiten 35-mal wiederholt werden, werden sie auch nicht besser." Ein valides ökonomisches Argument hat er nicht. Auch der unbestreitbaren Tatsache, dass der übertriebene Kündigungsschutz Einstellungen verhindert, weiß Peters nichts zu entgegnen. Wieder antwortet er flapsig und weicht aus.
Eine volkswirtschaftliche Debatte wird mit diesem IG-Metall-Chef nicht zu führen sein. Er hegt ebenso viel Interesse für Empirie wie ein Verteidiger, der seinen Mandanten beschützt. Beweise sind gut, wenn sie dem Ziel dienen, sonst werden sie rhetorisch niedergebügelt. Weil Peters immer so gedacht hat, halten viele ihn für einen Betonkopf. Doch sein Denken ist nicht mehr oder weniger betoniert als das eines Rechtsbeistands. Für seinen Mandanten nicht das Maximum herausholen zu wollen, ist in seinen Augen Verrat. Peters will nicht die objektiv fairste Lösung finden, sondern die maximale Verhandlungsposition aufbauen. Gewerkschafter, die diese Rolle verlassen und den neutralen Wirtschaftspolitiker spielen möchten, sind ihm ein Gräuel.
Dialektischer Konflikt
Für die Debatte der nächsten Jahre lassen sich daraus einige Schlussfolgerungen ziehen. Runde Tische sind überflüssig und werden kein Ergebnis bringen. Peters ist Dialektiker. Er formuliert scharfe Thesen und will die Antithese entkräften. Synthesen zu finden ist nicht seine Sache. Damit drängt er die Regierung in die Richterrolle. So entschlossen, wie er sie provoziert, muss sie entscheiden. Wenn sie Konsens sucht, wird er das als Schwäche deuten und seine Forderung hochschrauben.
Gegen jede harte Entscheidung wird er seine Massen mobilisieren. Arbeitgeber und Volkswirte haben nur eine Chance, wenn sie mit gleicher Münze zurückzahlen. Sie müssen den Konflikt in die Öffentlichkeit tragen und emotionalisieren. Peters wird sie als neoliberale Arbeitnehmerfeinde brandmarken, sie müssen ihn als reformfeindlichen Betonkopf titulieren. Die Chancen, Peters dabei in die Ecke zu drängen, sind nicht schlecht.
Seine größte Schwäche ist das mangelnde Interesse für empirische Fakten. Fast jedes Argument, das Peters in Interviews und Talkshows anführt, ist schnell zu zertrümmern. Ein Beispiel: Er behauptet, dass die Lockerung des Kündigungsschutzes unter Helmut Kohl nicht mehr, sondern weniger Arbeitsplätze gebracht hätte. Eine unhaltbare These - Kohls Reform war zu klein und zu kurz, um einen messbaren Effekt entfalten zu können, und wurde zudem von einer Reihe gegenteilig wirkender Kräfte überlagert.
Ob er seiner Sache mit der Taktik des maximalen Polarisierens hilft, ist fraglich. Gerade weil er viel Energie auf Profilschärfe, aber wenig auf Denkschärfe verwendet, läuft er Gefahr, von der Wirklichkeit widerlegt zu werden. Die IG Metall-Mitglieder werden unter Peters vielleicht mehr verdienen als unter Zwickel. Aber auf Dauer werden immer weniger von ihnen Arbeit haben. Damit schmilzt die Zustimmung für seinen Konfliktkurs.
.
Edelmetalle: Nach dem Krieg bewegt die Konjunktur den Goldpreis
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Auf die Entwicklungen in Irak haben die Aktienmärkte in der vergangenen Woche mit Kursgewinnen reagiert. Anleihen, Euro und Gold standen dagegen auf der Verliererseite.
Der Goldpreis gab zeitweise bis auf 318,75 $/Unze nach, dies war der tiefste Stand seit dem 3. Dezember. Gewinnmitnahmen bei Aktien sorgten aber für einen Stimmungsumschwung. Am Freitag notierte der Goldpreis bei 328,50 $.
Marktteilnehmer rechnen damit, dass Konjunkturdaten wieder zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses der Märkte rücken werden. Eine negative Entwicklung hier könnte den Goldpreis auf über 350 $ im zweiten Halbjahr steigen lassen. Für diese Woche erwarten Händler eine Handelsspanne zwischen 320 und 330 $. Die Dollarentwicklung könnte hier wesentliche Impulse setzen.
Steigender Preis für Silber
Platin rutschte mit 606 $/Unze zeitweise auf den tiefsten Stand seit Januar dieses Jahres. Allerdings gab es auch hier Erholung. Zum Wochenende kostete die Unze 625 $. Analysten sehen einen Anstieg auf bis zu 640 $, sollte der Euro weiter zulegen.
Mit 4,51 $/Unze notierte Silber am Dienstag zeitweise so hoch wie seit Mitte März nicht mehr. Auftrieb gab es vor allem durch Käufe von Marktteilnehmern, die ihre Minuspositionen schlossen, nachdem sie von dem steigenden Silberpreis überrascht worden waren.
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach ist Leiter Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein
FTD vom 14.4.2003
Goldexperten rechnen mit steigenden Preisen
Von Meike Schreiber, Frankfurt
Der Goldpreis dürfte in diesem Jahr wieder anziehen. Obwohl sich ein rasches Ende des Irak-Kriegs abzeichnet, rechnet die Londoner Research- und Beratungsfirma Gold Fields Mineral Services (GFMS) für die zweite Hälfte 2003 mit einem erneuten Preisanstieg über die Marke von 350 $.
Grund sei die unsichere Weltwirtschaft, teilte GFMS bei der Vorstellung des "Gold Survey 2003" mit, einer jährlichen Branchenstudie. Gold gilt in Kriegs- und Krisenzeiten als sichere Anlage. Der Preis war in den vergangenen zwei Jahren nach einem jahrelangen Bärenmarkt auf Grund der weltweiten politischen und konjunkturellen Unsicherheiten stark gestiegen. Im Februar 2003 hatte er mit 380 $ je Feinunze ein Sechs-Jahres-Hoch erreicht.
Die Erleichterung über einen schnellen Sieg der US-Truppen im Irak-Krieg werde die Nachfrage nach dem Edelmetall allenfalls kurzfristig hemmen, vermuten die Autoren der Studie. "Der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibt pro Gold, vor allem, wenn die USA entscheiden, ihren Krieg gegen den Terror nach dem Irak fortzusetzen", sagte GFMS-Geschäftsführer Philip Klapwijk. Für steigende Preise sprächen die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: schwache Aktienmärkte, geringes Wirtschaftswachstum, der sinkende Kurs des US-Dollar und niedrige Zinsen.
"Wenn der Krieg vorbei ist, fällt zwar die Kriegsprämie weg, aber die fundamentalen Wirtschaftsdaten sprechen weiterhin für einen steigenden Goldpreis", sagte Edelmetallhändler Wolfgang Wrzesniok-Roßbach von der Investmentbank Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Auch Privatanleger steigen um
Er rechnet damit, dass auch Privatanleger in diesem Jahr mehr Gold kaufen, denn das Edelmetall spiele bei der Vermögensbildung derzeit noch eine recht untergeordnete Rolle.
Als Preistreiber könnten sich - zumindest auf mittelfristige Sicht - auch die gesunkenen Fördermengen erweisen, meint Wrzesniok-Roßbach. So wurde 2002 der Studie zufolge mit insgesamt 2587 Tonnen erstmals seit neun Jahren weltweit weniger Gold abgebaut als im Jahr zuvor. Vor allem die USA und Indonesien erzeugten weniger. Zwar war der Rückgang mit 36 Tonnen nicht groß, markierte aber immerhin eine Trendwende.
Höhere Produktionskosten
Der Goldabbau wurde 2002 der Studie zufolge teurer. Erstmals seit fünf Jahren stiegen die Produktionskosten, und zwar um 4 $ auf 180 $ je Feinunze. Grund seien höhere Energiepreise, Währungsabwertungen und die gesunkene Produktion. Ausnahme bei dieser Entwicklung sei Südafrika. Damit sei das Land der kostengünstigste Goldproduzent der Welt.
Der gestiegene Goldpreis führte auch zu verstärkten Zentralbankverkäufen. Mit 556 Tonnen veräußerten die Notenbanken weltweit rund 5 Prozent mehr Gold. Dies war vor allem im vierten Quartal zu beobachten, denn zu diesem Zeitpunkt hatte der Preis für das Edelmetall seinen Jahreshöchststand erreicht.
Mehr Goldschrott aus Nahost
Die Wiedergewinnung aus Goldschrott stieg um 18 Prozent an, vor allem im Nahen Osten und in Indien. Die Irak-Krise und der Goldpreis hätten den Recyclinganteil Anfang 2003 weiter auf hohem Niveau gehalten, stellt GFMS fest. In Nahost sei die Wiederverwertung um 26 Prozent gestiegen.
Weniger Einfluss auf die Preisentwicklung hätten zuletzt Absicherungsgeschäfte, das so genannte Hedging, gehabt. Dessen Bedeutung verminderte sich der Studie zufolge im vergangenen Jahr. "Ohne diesen Rückgang wäre der Preis im vergangenen Sommer unter 300 $ gefallen", sagte GFMS-Chef Klapwijk.
Wenn Produzenten ihr Gold auf Termin verkaufen, sichern sie zumindest einen Teil des Volumens ab, um nicht von stark fallenden Preisen überrascht zu werden. Diese Hedging-Positionen verringerten sich 2002 um 423 Tonnen. Im Jahr zuvor hatte der Rückgang 151 Tonnen betragen. Das Beratungsunternehmen macht dafür vor allem den nach oben gerichteten Preistrend aus.
Juweliere verarbeiten weniger Gold
Das produzierende Gewerbe fragte im vergangenen Jahr weniger Gold nach. Auffällig war dabei vor allem der geringere Bedarf der Schmuckindustrie, die insgesamt 2689 Tonnen kaufte - 11 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Damit lag der weltweite Bedarf der Juweliere auf dem niedrigsten Niveau seit sieben Jahren.
Die Verfasser der Studie sehen die Ursachen dafür in der schwachen Weltkonjunktur. Die Verbraucher würden sparen und kauften weniger Goldschmuck. Das machte sich besonders in Italien und Indien bemerkbar, die als weltweit wichtigste Schmuckproduzenten gelten. Sie verzeichneten eine deutlich gesunkene Nachfrage.
Andere Sektoren erlebten dagegen eine leichte Erholung. So stieg die Nachfrage nach Gold aus dem Elektronikbereich und der Zahnmedizin an. Außerdem wurden wieder mehr Goldmünzen geprägt.
Aus der FTD vom 12.4.2003
Edelmetalle: Nach dem Krieg bewegt die Konjunktur den Goldpreis
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Auf die Entwicklungen in Irak haben die Aktienmärkte in der vergangenen Woche mit Kursgewinnen reagiert. Anleihen, Euro und Gold standen dagegen auf der Verliererseite.
Der Goldpreis gab zeitweise bis auf 318,75 $/Unze nach, dies war der tiefste Stand seit dem 3. Dezember. Gewinnmitnahmen bei Aktien sorgten aber für einen Stimmungsumschwung. Am Freitag notierte der Goldpreis bei 328,50 $.
Marktteilnehmer rechnen damit, dass Konjunkturdaten wieder zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses der Märkte rücken werden. Eine negative Entwicklung hier könnte den Goldpreis auf über 350 $ im zweiten Halbjahr steigen lassen. Für diese Woche erwarten Händler eine Handelsspanne zwischen 320 und 330 $. Die Dollarentwicklung könnte hier wesentliche Impulse setzen.
Steigender Preis für Silber
Platin rutschte mit 606 $/Unze zeitweise auf den tiefsten Stand seit Januar dieses Jahres. Allerdings gab es auch hier Erholung. Zum Wochenende kostete die Unze 625 $. Analysten sehen einen Anstieg auf bis zu 640 $, sollte der Euro weiter zulegen.
Mit 4,51 $/Unze notierte Silber am Dienstag zeitweise so hoch wie seit Mitte März nicht mehr. Auftrieb gab es vor allem durch Käufe von Marktteilnehmern, die ihre Minuspositionen schlossen, nachdem sie von dem steigenden Silberpreis überrascht worden waren.
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach ist Leiter Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein
FTD vom 14.4.2003
Goldexperten rechnen mit steigenden Preisen
Von Meike Schreiber, Frankfurt
Der Goldpreis dürfte in diesem Jahr wieder anziehen. Obwohl sich ein rasches Ende des Irak-Kriegs abzeichnet, rechnet die Londoner Research- und Beratungsfirma Gold Fields Mineral Services (GFMS) für die zweite Hälfte 2003 mit einem erneuten Preisanstieg über die Marke von 350 $.
Grund sei die unsichere Weltwirtschaft, teilte GFMS bei der Vorstellung des "Gold Survey 2003" mit, einer jährlichen Branchenstudie. Gold gilt in Kriegs- und Krisenzeiten als sichere Anlage. Der Preis war in den vergangenen zwei Jahren nach einem jahrelangen Bärenmarkt auf Grund der weltweiten politischen und konjunkturellen Unsicherheiten stark gestiegen. Im Februar 2003 hatte er mit 380 $ je Feinunze ein Sechs-Jahres-Hoch erreicht.
Die Erleichterung über einen schnellen Sieg der US-Truppen im Irak-Krieg werde die Nachfrage nach dem Edelmetall allenfalls kurzfristig hemmen, vermuten die Autoren der Studie. "Der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibt pro Gold, vor allem, wenn die USA entscheiden, ihren Krieg gegen den Terror nach dem Irak fortzusetzen", sagte GFMS-Geschäftsführer Philip Klapwijk. Für steigende Preise sprächen die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: schwache Aktienmärkte, geringes Wirtschaftswachstum, der sinkende Kurs des US-Dollar und niedrige Zinsen.
"Wenn der Krieg vorbei ist, fällt zwar die Kriegsprämie weg, aber die fundamentalen Wirtschaftsdaten sprechen weiterhin für einen steigenden Goldpreis", sagte Edelmetallhändler Wolfgang Wrzesniok-Roßbach von der Investmentbank Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Auch Privatanleger steigen um
Er rechnet damit, dass auch Privatanleger in diesem Jahr mehr Gold kaufen, denn das Edelmetall spiele bei der Vermögensbildung derzeit noch eine recht untergeordnete Rolle.
Als Preistreiber könnten sich - zumindest auf mittelfristige Sicht - auch die gesunkenen Fördermengen erweisen, meint Wrzesniok-Roßbach. So wurde 2002 der Studie zufolge mit insgesamt 2587 Tonnen erstmals seit neun Jahren weltweit weniger Gold abgebaut als im Jahr zuvor. Vor allem die USA und Indonesien erzeugten weniger. Zwar war der Rückgang mit 36 Tonnen nicht groß, markierte aber immerhin eine Trendwende.
Höhere Produktionskosten
Der Goldabbau wurde 2002 der Studie zufolge teurer. Erstmals seit fünf Jahren stiegen die Produktionskosten, und zwar um 4 $ auf 180 $ je Feinunze. Grund seien höhere Energiepreise, Währungsabwertungen und die gesunkene Produktion. Ausnahme bei dieser Entwicklung sei Südafrika. Damit sei das Land der kostengünstigste Goldproduzent der Welt.
Der gestiegene Goldpreis führte auch zu verstärkten Zentralbankverkäufen. Mit 556 Tonnen veräußerten die Notenbanken weltweit rund 5 Prozent mehr Gold. Dies war vor allem im vierten Quartal zu beobachten, denn zu diesem Zeitpunkt hatte der Preis für das Edelmetall seinen Jahreshöchststand erreicht.
Mehr Goldschrott aus Nahost
Die Wiedergewinnung aus Goldschrott stieg um 18 Prozent an, vor allem im Nahen Osten und in Indien. Die Irak-Krise und der Goldpreis hätten den Recyclinganteil Anfang 2003 weiter auf hohem Niveau gehalten, stellt GFMS fest. In Nahost sei die Wiederverwertung um 26 Prozent gestiegen.
Weniger Einfluss auf die Preisentwicklung hätten zuletzt Absicherungsgeschäfte, das so genannte Hedging, gehabt. Dessen Bedeutung verminderte sich der Studie zufolge im vergangenen Jahr. "Ohne diesen Rückgang wäre der Preis im vergangenen Sommer unter 300 $ gefallen", sagte GFMS-Chef Klapwijk.
Wenn Produzenten ihr Gold auf Termin verkaufen, sichern sie zumindest einen Teil des Volumens ab, um nicht von stark fallenden Preisen überrascht zu werden. Diese Hedging-Positionen verringerten sich 2002 um 423 Tonnen. Im Jahr zuvor hatte der Rückgang 151 Tonnen betragen. Das Beratungsunternehmen macht dafür vor allem den nach oben gerichteten Preistrend aus.
Juweliere verarbeiten weniger Gold
Das produzierende Gewerbe fragte im vergangenen Jahr weniger Gold nach. Auffällig war dabei vor allem der geringere Bedarf der Schmuckindustrie, die insgesamt 2689 Tonnen kaufte - 11 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Damit lag der weltweite Bedarf der Juweliere auf dem niedrigsten Niveau seit sieben Jahren.
Die Verfasser der Studie sehen die Ursachen dafür in der schwachen Weltkonjunktur. Die Verbraucher würden sparen und kauften weniger Goldschmuck. Das machte sich besonders in Italien und Indien bemerkbar, die als weltweit wichtigste Schmuckproduzenten gelten. Sie verzeichneten eine deutlich gesunkene Nachfrage.
Andere Sektoren erlebten dagegen eine leichte Erholung. So stieg die Nachfrage nach Gold aus dem Elektronikbereich und der Zahnmedizin an. Außerdem wurden wieder mehr Goldmünzen geprägt.
Aus der FTD vom 12.4.2003
.
Das Wunder von Michigan
Von Kai Lange
Investoren setzen auf die Stimmungswende. Die Umsätze im Einzelhandel sind ebenso deutlich gestiegen wie die von der Uni Michigan ermittelte Konsumentenstimmung. Dennoch notieren die US-Börsen bereits auf Boom-Niveau.
Hamburg - Eine Telefonbefragung von 500 US-Bürgern bewegt Monat für Monat Milliarden an den Börsen. Sollte Jim Brown aus Talahassee den Autokauf zurückstellen oder Debbie Miller aus Baraboo künftig auf die Familienpackung Cornflakes verzichten, kann das auch für den Börsenwert des Münchener Versicherers Allianz weit reichende Folgen haben.
Stimmungsindikatoren als Weltereignis
In der nervösen Börsenwelt gewinnen Stimmungsindikatoren immer größere Bedeutung. Für ihren jeweils zur Monatsmitte ermittelten Konsumklima-Index befragt die Universität von Michigan 500 US-Konsumenten und eine weit größere Zahl von Analysten und Investmentbankern wartet begierig auf die Ergebnisse.
Heute ist wieder Showtime: Nachdem der Index im vergangenen Monat auf das Zehnjahrestief von 77,6 Punkten gefallen war, erwarten Analysten heute mindestens eine Erholung auf 78,1 Punkte. Ersten Angaben um 15.45 Uhr zu Folge soll der Index sogar auf 83,2 Punkte gestiegen sein.
Ein paar Punkte aufwärts, nun ja. Doch die Börse liebt Psychologie, und allein der schöne Begriff Zehnjahrestief ruft nach einer Trendwende. Tiefer soll es nicht mehr gehen, zumal die US-Boys inzwischen nach Bagdad vorgerückt sind. Verbraucher schöpfen Mut, die Nachfrage steigt und schon bald steht die US-Konjunktur wieder unter Dampf. So einfach ist das und deshalb sind ein paar Punkte mehr aus Michigan so wichtig.
Einzelhandel: Umsätze kräftig gestiegen
Im Schatten des Michigan-Orakels stehen heute die US-Einzelhandelsumsätze, die im März um 2,1 Prozent gestiegen sind. Dies ist deutlich mehr als der von Analysten erwartete Anstieg von 0,6 Prozent. Vor allem die Autohersteller haben im März mit Preisnachlässen geworben und dürften die Gesamtumsätze nach oben getrieben haben.
Eine etwas verbesserte Verbraucherstimmung und anziehende Umsätze im Einzelhandel - dieses Szenario lässt die Augen vieler spekulativer Investoren glänzen, weil sie auf eine ähnlich deutliche Erholung der Börsen hoffen wie in den Monaten nach den Anschlägen vom 11. September.
Kursniveau ist bereits hoch
Dies würde jedoch bedeuten, dass die US-Börsen von einem aktuell bereits hohen Niveau auf ein extrem hohes Niveau steigen müssen. Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 für das laufende Jahr sind amerikanische Aktien bereits jetzt bewertet wie zu Boom-Zeiten und fast dreimal so teuer wie deutsche Aktien. Das deutlich dynamischere Wachstum der USA rechtfertigt auch einen Bewertungsvorsprung. Doch angesichts des Doppeldefizits der USA (300 Milliarden Dollar Defizit im Staatshaushalt, 500 Milliarden Dollar Defizit in der Leistungsbilanz) fragen sich manche, ob eine Boom-Bewertung wirklich gerechtfertigt ist.
Auch GE hat Probleme
Der Mischkonzern General Electric, der heute einen Umsatz- und Gewinnrückgang gemeldet hat, bringt es gemeinsam mit Microsoft auf annähernd die gleiche Börsenbewertung wie alle 850 deutschen börsennotierten Unternehmen zusammen. Dass teure Aktienoptionspläne und Löcher in den Pensionskassen die Bilanzen vieler US-Unternehmen schon bald deutlich belasten dürften, scheint kaum jemanden zu stören.
GE hat im ersten Quartal des laufenden Jahres neun Prozent weniger verdient als vor einem Jahr. Grund dafür sei vor allem der Einbruch im Gas-Turbinengeschäft, einer Sparte, die zuvor zu den hohen Gewinnen des Dow-Jones-Schwergewichtes beigetragen hatte. Mit dem Rückgang des Gewinns auf 3,2 Milliarden Dollar von 3,5 Milliarden Dollar vor Jahresfrist lag der Konzern aber im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn je Aktie rutschte auf 32 Cents von 35 Cents.
An der Wall Street hängt alles
Die US-Börsen bewegen sich auf dünnem Eis - doch Europäer haben keinen Grund, sich darüber zu freuen. "Amerika ist der wichtigste Treiber der Weltwirtschaft", betont Philipp Vorndran, Leiter globale Strategie bei Credit Suisse Asset Management. Die meisten europäischen Volkswirtschaften hinkten hinterher und könnten nur darauf hoffen, dass die USA die weltweite Konjunktur wieder in Schwung bringt - gelingt dies nicht, stürzen auch sie mit. "Wir sollten das Defizit der USA lieben und auch künftig weiter finanzieren – denn ohne dieses Defizit wird der europäische Export nicht funktionieren", sagt Vorndran.
Für den Strategen von CSFB ist es nicht verwunderlich, dass deutsche Aktien derzeit etwa auf dem gleichen Niveau bewertet sind wie die Emerging Markets in Asien. Erst wenn sich Deutschland zu wirklichen Reformen auf dem Arbeitsmarkt und bei den Sozialsystemen durchringe, könnte Europas größte Volkswirtschaft aus eigener Kraft Impulse setzen. Bis dahin, so ist zu befürchten, blickt auch der deutsche Aktionär gebannt gen Michigan.
manager-magazin 11.04.2003
Konzern-Zahlen sorgen für Unsicherheit
Charttechnik liefert positive Signale für den Dax - Daten von US-Technologiefirmen könnten aber die Stimmung verderben
von Jens Wiegmann
Berlin - Die Börsen hatten kaum Zeit, den schnellen Fall Bagdads zu verarbeiten, da geht es schon in die nächste Runde. Egal ob die Anleger für eine Nachkriegsbörse bereit sind oder nicht: Ab sofort jagt in den USA ein Quartalsbericht den nächsten, die Aufmerksamkeit der Investoren rund um den Globus ist voll gefordert. In dieser Woche dominieren die Zahlen aus der Technologiebranche - bisher der Bereich mit den meisten Gewinnwarnungen. Daher sehen die Börsianer den nächsten Handelstagen mit gemischten Gefühlen entgegen. Der Erleichterung über den raschen Kriegsverlauf steht die Angst vor weiteren negativen Überraschungen von der Weltleitbörse an Wall Street gegenüber.
Die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte verlief vor diesem Hintergrund zuletzt gebremst. Der Dow Jones verlor in der vergangenen Woche sogar knapp ein Prozent - trotz positiver Konjunkturindikatoren. So war der Index des US-Verbrauchervertrauens von der Universität Michigan über den Erwartungen ausgefallen, die Einzelhandelsumsätze im März waren gestiegen. Das eröffnet zum Wochenstart jedoch auch Chancen. Es sei möglich, dass die am Freitag präsentierten US-Zahlen von den Märkten noch nicht richtig verdaut worden seien und erst heute für einen kleinen Kursschub sorgen, sagt Fidel Helmer, Chefhändler des Bankhauses Hauck & Aufhäuser. "Grundsätzlich wollen die Kurse nach oben."
Doch können in dieser Woche eben jederzeit negative Quartalsberichte und Ausblicke dazwischenkommen. Das Gewicht, die Märkte massiv zu bewegen, hat gleich am Montag der Computer-, Software- und Dienstleistungskonzern IBM. Da "Big Blue" praktisch in allen Bereichen der Informationstechnologie tätig ist, dienen dessen Zahlen der gesamten IT-Branche als Orientierung. Eine ähnliche Rolle für den Finanzsektor spielt die Citigroup, die ebenfalls am Montag antritt. Am Dienstag geht es weiter mit den Weltmarktführern bei Chips und Software, Intel und Microsoft, gefolgt vom Handy- und Chiphersteller Motorola. Interessant für die Börsianer sind auch die Ergebnisse von Texas Instruments, einem der größten Zulieferer der Handy-Industrie. Und was Intel und Microsoft für ihre Branche sind, ist General Motors für die Autoindustrie. Der Quartalsbericht von GM dürfte akribisch unter die Lupe genommen werden: Vergangene Woche hatte die Ratingagentur Standard & Poor`s das Kreditrating des Branchengrößten von "Stabil" auf "Negativ" gesenkt.
Am Mittwoch wird es mit den Berichten des Intel-Konkurrenten AMD und der Computerhersteller Sun und Apple noch einmal IT-lastig. Größere Aufmerksamkeit dürften wegen der Bedeutung der Branche für die Konjunktur allerdings die Konsumgüterhersteller Coca-Cola und Altria (ehemals Philip Morris) auf sich ziehen. Bei dem Getränkekonzern interessiert die Börsianer die Frage, ob sich die weltpolitische Situation und die Ablehnung der US-Politik in vielen Staaten bereits in der Bilanz oder dem Ausblick bemerkbar machen. Altria leidet unter Klagen von Rauchern und den scharfen Gesetzen gegen das Rauchen in den USA. Zudem geht der Autoriese Ford am Mittwoch mit seinen Dreimonatszahlen an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag schließt Nokia mit seinen Daten die Handelswoche ab, die wegen der Osterfeiertage verkürzt ist. Der weltgrößte Hersteller von Mobiltelefonen hat gerade 1800 Stellen im Netzwerkbereich gestrichen, besser soll es aber im Handy-Geschäft laufen. In Deutschland stehen Karstadt-Quelle mit dem Geschäftsbericht für 2002 und SAP mit den Ergebnissen des ersten Quartals im Fokus.
Doch trotz der Risiken, die die Datenflut birgt: Die meisten Experten lassen sich ihren kurzfristigen Optimismus nicht nehmen. "Einen Rückschlag auf die Tiefstkurse der vergangenen Wochen werden wir wohl nicht mehr sehen", ist Händler Helmer überzeugt. Unterstützung erhält er von Charttechniker Wieland Staud. "Nach oben sind die Kurse noch ohne Dynamik, aber nach unten passiert nichts - das ist positiv." Der Aufwärtstrend sei intakt. Der Dax habe derzeit ein starkes Momentum, meint auch ein anderer Experte. "Diese Woche schafft er vielleicht ein Plus von vier bis fünf Prozent."
DIE WELT 14. Apr 2003
Das Wunder von Michigan
Von Kai Lange
Investoren setzen auf die Stimmungswende. Die Umsätze im Einzelhandel sind ebenso deutlich gestiegen wie die von der Uni Michigan ermittelte Konsumentenstimmung. Dennoch notieren die US-Börsen bereits auf Boom-Niveau.
Hamburg - Eine Telefonbefragung von 500 US-Bürgern bewegt Monat für Monat Milliarden an den Börsen. Sollte Jim Brown aus Talahassee den Autokauf zurückstellen oder Debbie Miller aus Baraboo künftig auf die Familienpackung Cornflakes verzichten, kann das auch für den Börsenwert des Münchener Versicherers Allianz weit reichende Folgen haben.
Stimmungsindikatoren als Weltereignis
In der nervösen Börsenwelt gewinnen Stimmungsindikatoren immer größere Bedeutung. Für ihren jeweils zur Monatsmitte ermittelten Konsumklima-Index befragt die Universität von Michigan 500 US-Konsumenten und eine weit größere Zahl von Analysten und Investmentbankern wartet begierig auf die Ergebnisse.
Heute ist wieder Showtime: Nachdem der Index im vergangenen Monat auf das Zehnjahrestief von 77,6 Punkten gefallen war, erwarten Analysten heute mindestens eine Erholung auf 78,1 Punkte. Ersten Angaben um 15.45 Uhr zu Folge soll der Index sogar auf 83,2 Punkte gestiegen sein.
Ein paar Punkte aufwärts, nun ja. Doch die Börse liebt Psychologie, und allein der schöne Begriff Zehnjahrestief ruft nach einer Trendwende. Tiefer soll es nicht mehr gehen, zumal die US-Boys inzwischen nach Bagdad vorgerückt sind. Verbraucher schöpfen Mut, die Nachfrage steigt und schon bald steht die US-Konjunktur wieder unter Dampf. So einfach ist das und deshalb sind ein paar Punkte mehr aus Michigan so wichtig.
Einzelhandel: Umsätze kräftig gestiegen
Im Schatten des Michigan-Orakels stehen heute die US-Einzelhandelsumsätze, die im März um 2,1 Prozent gestiegen sind. Dies ist deutlich mehr als der von Analysten erwartete Anstieg von 0,6 Prozent. Vor allem die Autohersteller haben im März mit Preisnachlässen geworben und dürften die Gesamtumsätze nach oben getrieben haben.
Eine etwas verbesserte Verbraucherstimmung und anziehende Umsätze im Einzelhandel - dieses Szenario lässt die Augen vieler spekulativer Investoren glänzen, weil sie auf eine ähnlich deutliche Erholung der Börsen hoffen wie in den Monaten nach den Anschlägen vom 11. September.
Kursniveau ist bereits hoch
Dies würde jedoch bedeuten, dass die US-Börsen von einem aktuell bereits hohen Niveau auf ein extrem hohes Niveau steigen müssen. Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 für das laufende Jahr sind amerikanische Aktien bereits jetzt bewertet wie zu Boom-Zeiten und fast dreimal so teuer wie deutsche Aktien. Das deutlich dynamischere Wachstum der USA rechtfertigt auch einen Bewertungsvorsprung. Doch angesichts des Doppeldefizits der USA (300 Milliarden Dollar Defizit im Staatshaushalt, 500 Milliarden Dollar Defizit in der Leistungsbilanz) fragen sich manche, ob eine Boom-Bewertung wirklich gerechtfertigt ist.
Auch GE hat Probleme
Der Mischkonzern General Electric, der heute einen Umsatz- und Gewinnrückgang gemeldet hat, bringt es gemeinsam mit Microsoft auf annähernd die gleiche Börsenbewertung wie alle 850 deutschen börsennotierten Unternehmen zusammen. Dass teure Aktienoptionspläne und Löcher in den Pensionskassen die Bilanzen vieler US-Unternehmen schon bald deutlich belasten dürften, scheint kaum jemanden zu stören.
GE hat im ersten Quartal des laufenden Jahres neun Prozent weniger verdient als vor einem Jahr. Grund dafür sei vor allem der Einbruch im Gas-Turbinengeschäft, einer Sparte, die zuvor zu den hohen Gewinnen des Dow-Jones-Schwergewichtes beigetragen hatte. Mit dem Rückgang des Gewinns auf 3,2 Milliarden Dollar von 3,5 Milliarden Dollar vor Jahresfrist lag der Konzern aber im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn je Aktie rutschte auf 32 Cents von 35 Cents.
An der Wall Street hängt alles
Die US-Börsen bewegen sich auf dünnem Eis - doch Europäer haben keinen Grund, sich darüber zu freuen. "Amerika ist der wichtigste Treiber der Weltwirtschaft", betont Philipp Vorndran, Leiter globale Strategie bei Credit Suisse Asset Management. Die meisten europäischen Volkswirtschaften hinkten hinterher und könnten nur darauf hoffen, dass die USA die weltweite Konjunktur wieder in Schwung bringt - gelingt dies nicht, stürzen auch sie mit. "Wir sollten das Defizit der USA lieben und auch künftig weiter finanzieren – denn ohne dieses Defizit wird der europäische Export nicht funktionieren", sagt Vorndran.
Für den Strategen von CSFB ist es nicht verwunderlich, dass deutsche Aktien derzeit etwa auf dem gleichen Niveau bewertet sind wie die Emerging Markets in Asien. Erst wenn sich Deutschland zu wirklichen Reformen auf dem Arbeitsmarkt und bei den Sozialsystemen durchringe, könnte Europas größte Volkswirtschaft aus eigener Kraft Impulse setzen. Bis dahin, so ist zu befürchten, blickt auch der deutsche Aktionär gebannt gen Michigan.
manager-magazin 11.04.2003
Konzern-Zahlen sorgen für Unsicherheit
Charttechnik liefert positive Signale für den Dax - Daten von US-Technologiefirmen könnten aber die Stimmung verderben
von Jens Wiegmann
Berlin - Die Börsen hatten kaum Zeit, den schnellen Fall Bagdads zu verarbeiten, da geht es schon in die nächste Runde. Egal ob die Anleger für eine Nachkriegsbörse bereit sind oder nicht: Ab sofort jagt in den USA ein Quartalsbericht den nächsten, die Aufmerksamkeit der Investoren rund um den Globus ist voll gefordert. In dieser Woche dominieren die Zahlen aus der Technologiebranche - bisher der Bereich mit den meisten Gewinnwarnungen. Daher sehen die Börsianer den nächsten Handelstagen mit gemischten Gefühlen entgegen. Der Erleichterung über den raschen Kriegsverlauf steht die Angst vor weiteren negativen Überraschungen von der Weltleitbörse an Wall Street gegenüber.
Die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte verlief vor diesem Hintergrund zuletzt gebremst. Der Dow Jones verlor in der vergangenen Woche sogar knapp ein Prozent - trotz positiver Konjunkturindikatoren. So war der Index des US-Verbrauchervertrauens von der Universität Michigan über den Erwartungen ausgefallen, die Einzelhandelsumsätze im März waren gestiegen. Das eröffnet zum Wochenstart jedoch auch Chancen. Es sei möglich, dass die am Freitag präsentierten US-Zahlen von den Märkten noch nicht richtig verdaut worden seien und erst heute für einen kleinen Kursschub sorgen, sagt Fidel Helmer, Chefhändler des Bankhauses Hauck & Aufhäuser. "Grundsätzlich wollen die Kurse nach oben."
Doch können in dieser Woche eben jederzeit negative Quartalsberichte und Ausblicke dazwischenkommen. Das Gewicht, die Märkte massiv zu bewegen, hat gleich am Montag der Computer-, Software- und Dienstleistungskonzern IBM. Da "Big Blue" praktisch in allen Bereichen der Informationstechnologie tätig ist, dienen dessen Zahlen der gesamten IT-Branche als Orientierung. Eine ähnliche Rolle für den Finanzsektor spielt die Citigroup, die ebenfalls am Montag antritt. Am Dienstag geht es weiter mit den Weltmarktführern bei Chips und Software, Intel und Microsoft, gefolgt vom Handy- und Chiphersteller Motorola. Interessant für die Börsianer sind auch die Ergebnisse von Texas Instruments, einem der größten Zulieferer der Handy-Industrie. Und was Intel und Microsoft für ihre Branche sind, ist General Motors für die Autoindustrie. Der Quartalsbericht von GM dürfte akribisch unter die Lupe genommen werden: Vergangene Woche hatte die Ratingagentur Standard & Poor`s das Kreditrating des Branchengrößten von "Stabil" auf "Negativ" gesenkt.
Am Mittwoch wird es mit den Berichten des Intel-Konkurrenten AMD und der Computerhersteller Sun und Apple noch einmal IT-lastig. Größere Aufmerksamkeit dürften wegen der Bedeutung der Branche für die Konjunktur allerdings die Konsumgüterhersteller Coca-Cola und Altria (ehemals Philip Morris) auf sich ziehen. Bei dem Getränkekonzern interessiert die Börsianer die Frage, ob sich die weltpolitische Situation und die Ablehnung der US-Politik in vielen Staaten bereits in der Bilanz oder dem Ausblick bemerkbar machen. Altria leidet unter Klagen von Rauchern und den scharfen Gesetzen gegen das Rauchen in den USA. Zudem geht der Autoriese Ford am Mittwoch mit seinen Dreimonatszahlen an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag schließt Nokia mit seinen Daten die Handelswoche ab, die wegen der Osterfeiertage verkürzt ist. Der weltgrößte Hersteller von Mobiltelefonen hat gerade 1800 Stellen im Netzwerkbereich gestrichen, besser soll es aber im Handy-Geschäft laufen. In Deutschland stehen Karstadt-Quelle mit dem Geschäftsbericht für 2002 und SAP mit den Ergebnissen des ersten Quartals im Fokus.
Doch trotz der Risiken, die die Datenflut birgt: Die meisten Experten lassen sich ihren kurzfristigen Optimismus nicht nehmen. "Einen Rückschlag auf die Tiefstkurse der vergangenen Wochen werden wir wohl nicht mehr sehen", ist Händler Helmer überzeugt. Unterstützung erhält er von Charttechniker Wieland Staud. "Nach oben sind die Kurse noch ohne Dynamik, aber nach unten passiert nichts - das ist positiv." Der Aufwärtstrend sei intakt. Der Dax habe derzeit ein starkes Momentum, meint auch ein anderer Experte. "Diese Woche schafft er vielleicht ein Plus von vier bis fünf Prozent."
DIE WELT 14. Apr 2003
.
Deutsche Industrie erwartet Irak-Bonanza
Von Birgit Marschall, Reinhard Schulze-Hoenighaus und Kirsten Bialdi
Deutsche Unternehmen stehen in den Startlöchern für Aufträge beim Wiederaufbau Iraks. Firmen wie MAN, ThyssenKrupp und Salzgitter, die Erfahrung mit dem Geschäft im Nahen Osten haben, rechnen sich trotz der politischen Fehde zwischen Washington und Berlin gute Chancen aus - keine Spur von Angst vor einer Blockade durch die USA.
An einem Marktführer könne die Politik "nicht einfach vorbeimarschieren", sagte Salzgitter-Chef Wolfgang Leese der FTD. Der Stahlkonzern verkauft in der Region vor allem große Rohrsysteme. "Wir werden sicher in der ersten Phase des Wiederaufbaus nicht besonders beteiligt werden", sagte BDI-Präsident Michael Rogowski der FTD. "In der zweiten Phase, in der es um den Aufbau von Industriestrukturen geht und Irak wieder eine eigene Regierung haben wird, bin ich einigermaßen zuversichtlich."
Tatsächlich gibt es in den USA bislang keine Anzeichen, dass Firmen aus kriegsskeptischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Russland systematisch ausgeschlossen werden sollen - im Gegenteil: Die US-Regierung hat zuletzt mehrere Versuche verärgerter Kongressmitglieder abgeblockt, die Kriegsgegner wirtschaftlich zu bestrafen.
Die ersten acht Ausschreibungen für Wiederaufbauprojekte im Umfang von rund 2 Mrd. $ seien zwar ausschließlich an US-Firmen gegangen, sagte der DIHK-Nahost-Experte Jochen Münker. Das liege jedoch daran, dass diese Unternehmen bereits die notwendigen Sicherheitszertifikate hatten. "Künftige Ausschreibungen werden international laufen", sagte Münker. Größer würden die Chancen deutscher Firmen allerdings, wenn Ausschreibungen für Irak über die Uno oder die Weltbank liefen, räumte Münker ein.
Guter Ruf im Nahen Osten
Made in Germany habe einen "so guten Ruf im Nahen Osten, dass wir jetzt nicht zu diskutieren brauchen, wo unsere Probleme liegen könnten, sondern lieber überlegen sollten, wie wir in Irak antreten", warnte die Geschäftsführerin des Nah- und Mittelost-Vereins der deutschen Wirtschaft, Helene Rang. "Wir Deutschen können ja versuchen, unsere Konkurrenz kaputtzujammern. Ich glaube nicht, dass das klappt."
Konzerne wie ThyssenKrupp sehen die Lage ohnehin gelassen. Dass ökonomische Grundsätze bei Iraks Wiederaufbau völlig außer Acht blieben, sei unwahrscheinlich, sagte ein ThyssenKrupp-Sprecher. "Dann würde doch jeder fragen: Geht es darum, dass man seine politischen Spielchen fortsetzt oder bestmöglich knappe Mittel einsetzt?" Auch MAN rechnet nach Aussage eines Sprechers mit "ordentlichen Ausschreibungen. Wenn es so weit ist, beteiligen wir uns natürlich."
Zuversichtlich sind vor allem Mittelständler, die Spezialmaschinen liefern. Holger Hansen, der die Maschinenbauer Herrenknecht und Bauer in Bagdad vertritt, rechnet mit einem Auftragsschub. "Nach einer Stabilisierung des Irak wird es nun sicher einen Riesenumtrieb geben." Dank der Ölreserven stünden Altschulden der Finanzierung nicht im Wege.
Keine Angst vor US-Blockade
Angst, dass eine US-Militärverwaltung allein amerikanische Firmen engagiert, hat Hansen nicht. "Zur Not bieten wir halt über eine ausländische Tochter an. Das haben wir doch alles schon durchexerziert. Auch Saddam hat ja zuweilen politisch motivierte Boykotts verhängt." US-Firmen interessierten sich "nur für das große Geld" - die Ölwirtschaft. "Unsere Bohrmaschinen aber gibt es dort gar nicht. Die exportieren wir doch auch in die USA. Wenn man sich Mühe gibt, kommt man auch ins Geschäft."
Auch die alten Kontakte aus seiner Zeit in Bagdad gibt Hansen nicht verloren. "Ich kann meinen Mann in Bagdad zwar jetzt nicht erreichen. Ich würde auch jetzt noch nicht hinfahren, weil die Ministerien in Trümmern liegen." Eines sei aber sicher: Auf die Ingenieure und Technokraten in den Ministerien, die Iraks Großinvestitionen bislang abgewickelt haben, könnten die USA beim Wiederaufbau nicht verzichten. (FTD)
das war die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte:
Frühjahrsgutachten
Auf Wiedersehen, Wachstum
Im Frühjahrsgutachten malen die sechs führenden Wirtschaftsinstitute ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Zukunft. Selbst wenn Bundeskanzler Gerhard Schröder mit allen Reformvorhaben durchkäme, brächte dies die deutsche Wirtschaft nicht wieder auf einen gesunden Wachstumskurs.
Berlin - "Wenn diese Agenda alles enthält, was bis zum Jahr 2010 auf den Weg gebracht werden soll, werden sich die Wachstumsbedingungen nur unwesentlich verbessern", heißt es im Frühjahrsgutachten der Ökonomen, das sie am Dienstagvormittag in Berlin veröffentlicht haben.
"Die deutsche Wirtschaft verharrt in einer Phase langanhaltender Schwäche", stellen die Forscher fest. In der zweiten Hälfte dieses Jahres sei zwar mit einer leichten Konjunkturbelebung zu rechnen. "Sie wird aber nur schleppend vorankommen." Die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung werde weiter sinken, die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich nochmals verschlechtern, so das ernüchternde Fazit.
Die von Schröder in seiner Agenda 2010 vorgestellten Maßnahmen zielten mikro- und makroökonomisch in die richtige Richtung. Sie könnten jedoch nur der Anfang sein. Die mit den Vorschlägen der Hartz-Kommission angegangenen Reformen des Arbeitsmarktes verbesserten vor allem die Arbeitsvermittlung, dies wirke sich jedoch erst bei einem Anziehen der Konjunktur aus. Insgesamt bewerten die Institute den Versuch skeptisch, Reformen über Kommissionen und damit über einen gesellschaftlichen Konsens auf den Weg zu bringen: "Die Initiative muss von der Bundesregierung ausgehen, denn sie, und nicht Kommissionen, ist letztlich für die Wirtschaftspolitik in Deutschland verantwortlich."
4,5 Millionen Arbeitslose
In ihrem Gutachten rechnen die Institute 2003 mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl auf durchschnittlich 4,45 Millionen. 2004 erwarteten sie angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums mit einem weiteren Anstieg auf 4,5 Millionen. Die Hartz-Reformen würden 2003 die Zahl der Arbeitslosen um höchstens 50.000 senken und damit deutlich weniger als von der Regierung erwartet, hieß es. Die Bundesanstalt für Arbeit benötige auf Grund der schlechten Arbeitsmarktsituation einen Zuschuss von 5,6 Milliarden Euro. Eigentlich sollte in diesem Jahr kein Zuschuss mehr an die Bundesanstalt gezahlt werden.
Wachstum kaum vorhanden
Die Institute schrauben zudem ihre Wachstumserwartungen deutlich zurück. Sie gehen im laufenden Jahr nur noch von einer Zunahme des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 0,5 Prozent aus. Im Herbstgutachten hatten sie noch mit 1,4 Prozent gerechnet. Auch im kommenden Jahr werde sich die Wirtschaft nicht deutlich erholen. "Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aber auch im Jahr 2004 ohne große Dynamik bleiben", heißt es in dem Bericht. 2004 werde es nach Schätzungen der Experten 1,8 Prozent Wachstum geben, gut ein halber Prozentpunkt des Wachstums beruhe jedoch darauf, dass das kommende Jahr fünf Arbeitstage mehr hat als das Vorjahr.
Neuer Ärger mit Brüssel
Angesichts des schlechten Wirtschaftswachstums wird nach Ansicht der Ökonomen auch im laufenden Jahr das europäisch festgelegte Defizitkriterium verletzt. Mit einer Defizitquote von 3,4 Prozent liege man erneut deutlich über der Obergrenze von drei Prozent. Erst im Jahr 2004 werde die Marke mit einer Defizitquote von 2,9 Prozent wieder unterschritten.
Die Inflation wird nach Einschätzung der Institute weiterhin niedrig bleiben. So stiegen die Verbraucherpreise nach dem Gutachten 2003 lediglich um 1,3 Prozent und 2004 um 1,2 Prozent. Die Wirtschaftsforscher rechnen deshalb mit einer Senkung der europäischen Leitzinsen um 25 Basispunkte auf dann 2,25 Prozent. Für den späteren Verlauf 2004 erwarten die Institute dem Bericht zufolge dann wieder eine Anhebung der Zinsen um 25 Basispunkte.
In der Euro-Zone erwarten die Forscher 2003 ein Wachstum von 0,9 Prozent, in den USA 2,4 Prozent. Für 2004 prognostizierten die Forscher dann in der Euro-Zone ein Wachstum von 2,3 und in den USA 3,5 Prozent.
(SPIEGEL)
Deutsche Industrie erwartet Irak-Bonanza
Von Birgit Marschall, Reinhard Schulze-Hoenighaus und Kirsten Bialdi
Deutsche Unternehmen stehen in den Startlöchern für Aufträge beim Wiederaufbau Iraks. Firmen wie MAN, ThyssenKrupp und Salzgitter, die Erfahrung mit dem Geschäft im Nahen Osten haben, rechnen sich trotz der politischen Fehde zwischen Washington und Berlin gute Chancen aus - keine Spur von Angst vor einer Blockade durch die USA.
An einem Marktführer könne die Politik "nicht einfach vorbeimarschieren", sagte Salzgitter-Chef Wolfgang Leese der FTD. Der Stahlkonzern verkauft in der Region vor allem große Rohrsysteme. "Wir werden sicher in der ersten Phase des Wiederaufbaus nicht besonders beteiligt werden", sagte BDI-Präsident Michael Rogowski der FTD. "In der zweiten Phase, in der es um den Aufbau von Industriestrukturen geht und Irak wieder eine eigene Regierung haben wird, bin ich einigermaßen zuversichtlich."
Tatsächlich gibt es in den USA bislang keine Anzeichen, dass Firmen aus kriegsskeptischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Russland systematisch ausgeschlossen werden sollen - im Gegenteil: Die US-Regierung hat zuletzt mehrere Versuche verärgerter Kongressmitglieder abgeblockt, die Kriegsgegner wirtschaftlich zu bestrafen.
Die ersten acht Ausschreibungen für Wiederaufbauprojekte im Umfang von rund 2 Mrd. $ seien zwar ausschließlich an US-Firmen gegangen, sagte der DIHK-Nahost-Experte Jochen Münker. Das liege jedoch daran, dass diese Unternehmen bereits die notwendigen Sicherheitszertifikate hatten. "Künftige Ausschreibungen werden international laufen", sagte Münker. Größer würden die Chancen deutscher Firmen allerdings, wenn Ausschreibungen für Irak über die Uno oder die Weltbank liefen, räumte Münker ein.
Guter Ruf im Nahen Osten
Made in Germany habe einen "so guten Ruf im Nahen Osten, dass wir jetzt nicht zu diskutieren brauchen, wo unsere Probleme liegen könnten, sondern lieber überlegen sollten, wie wir in Irak antreten", warnte die Geschäftsführerin des Nah- und Mittelost-Vereins der deutschen Wirtschaft, Helene Rang. "Wir Deutschen können ja versuchen, unsere Konkurrenz kaputtzujammern. Ich glaube nicht, dass das klappt."
Konzerne wie ThyssenKrupp sehen die Lage ohnehin gelassen. Dass ökonomische Grundsätze bei Iraks Wiederaufbau völlig außer Acht blieben, sei unwahrscheinlich, sagte ein ThyssenKrupp-Sprecher. "Dann würde doch jeder fragen: Geht es darum, dass man seine politischen Spielchen fortsetzt oder bestmöglich knappe Mittel einsetzt?" Auch MAN rechnet nach Aussage eines Sprechers mit "ordentlichen Ausschreibungen. Wenn es so weit ist, beteiligen wir uns natürlich."
Zuversichtlich sind vor allem Mittelständler, die Spezialmaschinen liefern. Holger Hansen, der die Maschinenbauer Herrenknecht und Bauer in Bagdad vertritt, rechnet mit einem Auftragsschub. "Nach einer Stabilisierung des Irak wird es nun sicher einen Riesenumtrieb geben." Dank der Ölreserven stünden Altschulden der Finanzierung nicht im Wege.
Keine Angst vor US-Blockade
Angst, dass eine US-Militärverwaltung allein amerikanische Firmen engagiert, hat Hansen nicht. "Zur Not bieten wir halt über eine ausländische Tochter an. Das haben wir doch alles schon durchexerziert. Auch Saddam hat ja zuweilen politisch motivierte Boykotts verhängt." US-Firmen interessierten sich "nur für das große Geld" - die Ölwirtschaft. "Unsere Bohrmaschinen aber gibt es dort gar nicht. Die exportieren wir doch auch in die USA. Wenn man sich Mühe gibt, kommt man auch ins Geschäft."
Auch die alten Kontakte aus seiner Zeit in Bagdad gibt Hansen nicht verloren. "Ich kann meinen Mann in Bagdad zwar jetzt nicht erreichen. Ich würde auch jetzt noch nicht hinfahren, weil die Ministerien in Trümmern liegen." Eines sei aber sicher: Auf die Ingenieure und Technokraten in den Ministerien, die Iraks Großinvestitionen bislang abgewickelt haben, könnten die USA beim Wiederaufbau nicht verzichten. (FTD)
das war die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte:

Frühjahrsgutachten
Auf Wiedersehen, Wachstum
Im Frühjahrsgutachten malen die sechs führenden Wirtschaftsinstitute ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Zukunft. Selbst wenn Bundeskanzler Gerhard Schröder mit allen Reformvorhaben durchkäme, brächte dies die deutsche Wirtschaft nicht wieder auf einen gesunden Wachstumskurs.
Berlin - "Wenn diese Agenda alles enthält, was bis zum Jahr 2010 auf den Weg gebracht werden soll, werden sich die Wachstumsbedingungen nur unwesentlich verbessern", heißt es im Frühjahrsgutachten der Ökonomen, das sie am Dienstagvormittag in Berlin veröffentlicht haben.
"Die deutsche Wirtschaft verharrt in einer Phase langanhaltender Schwäche", stellen die Forscher fest. In der zweiten Hälfte dieses Jahres sei zwar mit einer leichten Konjunkturbelebung zu rechnen. "Sie wird aber nur schleppend vorankommen." Die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung werde weiter sinken, die Lage auf dem Arbeitsmarkt werde sich nochmals verschlechtern, so das ernüchternde Fazit.
Die von Schröder in seiner Agenda 2010 vorgestellten Maßnahmen zielten mikro- und makroökonomisch in die richtige Richtung. Sie könnten jedoch nur der Anfang sein. Die mit den Vorschlägen der Hartz-Kommission angegangenen Reformen des Arbeitsmarktes verbesserten vor allem die Arbeitsvermittlung, dies wirke sich jedoch erst bei einem Anziehen der Konjunktur aus. Insgesamt bewerten die Institute den Versuch skeptisch, Reformen über Kommissionen und damit über einen gesellschaftlichen Konsens auf den Weg zu bringen: "Die Initiative muss von der Bundesregierung ausgehen, denn sie, und nicht Kommissionen, ist letztlich für die Wirtschaftspolitik in Deutschland verantwortlich."
4,5 Millionen Arbeitslose
In ihrem Gutachten rechnen die Institute 2003 mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl auf durchschnittlich 4,45 Millionen. 2004 erwarteten sie angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums mit einem weiteren Anstieg auf 4,5 Millionen. Die Hartz-Reformen würden 2003 die Zahl der Arbeitslosen um höchstens 50.000 senken und damit deutlich weniger als von der Regierung erwartet, hieß es. Die Bundesanstalt für Arbeit benötige auf Grund der schlechten Arbeitsmarktsituation einen Zuschuss von 5,6 Milliarden Euro. Eigentlich sollte in diesem Jahr kein Zuschuss mehr an die Bundesanstalt gezahlt werden.
Wachstum kaum vorhanden
Die Institute schrauben zudem ihre Wachstumserwartungen deutlich zurück. Sie gehen im laufenden Jahr nur noch von einer Zunahme des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 0,5 Prozent aus. Im Herbstgutachten hatten sie noch mit 1,4 Prozent gerechnet. Auch im kommenden Jahr werde sich die Wirtschaft nicht deutlich erholen. "Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aber auch im Jahr 2004 ohne große Dynamik bleiben", heißt es in dem Bericht. 2004 werde es nach Schätzungen der Experten 1,8 Prozent Wachstum geben, gut ein halber Prozentpunkt des Wachstums beruhe jedoch darauf, dass das kommende Jahr fünf Arbeitstage mehr hat als das Vorjahr.
Neuer Ärger mit Brüssel
Angesichts des schlechten Wirtschaftswachstums wird nach Ansicht der Ökonomen auch im laufenden Jahr das europäisch festgelegte Defizitkriterium verletzt. Mit einer Defizitquote von 3,4 Prozent liege man erneut deutlich über der Obergrenze von drei Prozent. Erst im Jahr 2004 werde die Marke mit einer Defizitquote von 2,9 Prozent wieder unterschritten.
Die Inflation wird nach Einschätzung der Institute weiterhin niedrig bleiben. So stiegen die Verbraucherpreise nach dem Gutachten 2003 lediglich um 1,3 Prozent und 2004 um 1,2 Prozent. Die Wirtschaftsforscher rechnen deshalb mit einer Senkung der europäischen Leitzinsen um 25 Basispunkte auf dann 2,25 Prozent. Für den späteren Verlauf 2004 erwarten die Institute dem Bericht zufolge dann wieder eine Anhebung der Zinsen um 25 Basispunkte.
In der Euro-Zone erwarten die Forscher 2003 ein Wachstum von 0,9 Prozent, in den USA 2,4 Prozent. Für 2004 prognostizierten die Forscher dann in der Euro-Zone ein Wachstum von 2,3 und in den USA 3,5 Prozent.
(SPIEGEL)
.
Hoffen auf den heiligen Alan
Am Wochenende treffen sich die Finanzminister der großen Industrienationen. Zusammenarbeit im Kampf gegen die Wirtschaftskrise steht nicht auf der Tagesordnung. Alan Greenspan soll’s richten
Von Thomas Fischermann
Alan Greenspan muss es vorkommen, als fechte er diesen Krieg zum zweiten Mal. Im August 1990, wenige Wochen nach der irakischen Invasion in Kuwait, spielten die Märkte verrückt: Die Ölpreise stiegen vorübergehend an, die Finanzmärkte zitterten, die ohnehin angeschlagene amerikanische Volkswirtschaft schlitterte in eine Rezession. Der Chef der amerikanischen Notenbank gab sich damals freilich gelassen. Einer wie Greenspan, sagte Greenspan, habe ohnehin nur „geringe Möglichkeiten, die Wirtschaft wesentlich zu beeinflussen“.
Von alten Gewohnheiten trennt man sich offenbar schwer. Greenspan gehört auch heute zu den größten Konjunktur-Optimisten in Washington. „Geopolitische Unsicherheiten“ hielten das Wachstum vorübergehend zurück, erklärte er vor einigen Wochen. Bis vor kurzem galt der Notenbank noch ein Wachstum von dreieinhalb Prozent für möglich. Zinssenkungen als Vorbeugung gegen einen erneuten Abschwung? Ach was, die „Balance der Risiken“ rings um den Krieg sei dafür zu schwer einzuschätzen, meint Greenspan.
Es ist noch nicht so lange her, dass der Fed-Chef die alles überstrahlende Lichtgestalt des US-Finanzmarkts war. Seine jüngsten Prognosen allerdings haben einen tiefen Graben durch die Ökonomenzunft gerissen. Die Pessimisten fühlen sich von Tag zu Tag mehr bestätigt: In den Unternehmen wird wieder kräftig entlassen, Produktion und Investitionen stagnieren, die Verbraucher kaufen weniger. Steven Roach, Chefökonom der Investmentbank Morgan Stanley, befand zum Wochenbeginn düster, dass „die großen, entwickelten Volkswirtschaften im Februar und März geschrumpft sind“, dass die Welt „nicht mehr funktionsfähig“ sei, dass in den USA irgendwann die „Dollarblase“ platzen werde. Ähnlich schrill warnte schon Anfang April das Institute of International Finance (IIF) in Washington vor einer „grundlegenden Zerbrechlichkeit“ der Weltwirtschaft.
Optimisten wie Greenspan sehen das wesentlich gelassener. Aber so oder so – wenn sich an diesem Wochenende die Finanzminister und Notenbankchefs der G-7-Industrieländer und die Spitzen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington treffen, wissen sie nicht, wie schlimm die Krise ist oder werden kann. Sie haben nicht einmal einen Entwurf für eine gemeinsame, koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Tasche. Während die USA ihr Haushaltsdefizit ungeniert immer weiter wachsen lassen, plädieren die Europäer fürs Sparen. Und während Europa die Hoffnung auf Zinssenkungen anheizt, gibt sich Amerika derzeit abstinent.
Gemeinsamkeit herzustellen wird auch deshalb schwierig, weil in Amerikas Hauptstadt die Koalition der Kriegswilligen – allen voran die USA und Großbritannien – auf die der Kriegsunwilligen trifft, vor allem Deutschland und Frankreich. So ist es schon fast ein kleines Wunder, wie sehr die meisten Wirtschaftspolitiker bisher die gegenseitigen Schuldzuweisungen vermeiden. Der griechische Finanzminister Nikos Christodoulakis zum Beispiel bekommt in diesen Tagen einen starren Blick, wenn man ihn nach den ökonomischen Verhältnissen jenseits des Atlantiks fragt. Dann lässt er ein paar Floskeln fallen: Es sei nicht Europas Aufgabe, den USA zu raten, sagt der EU-Ratsvorsitzende. Bei ihrem Treffen in der Nähe von Athen am vergangenen Wochenende vermieden auch die anderen EU-Finanzminister nach Kräften unfreundliche Worte über die Amerikaner. In der am Dienstag von der Kommission veröffentlichten Frühjahrsprognose findet sich kein böses Wort zu Washingtons Haushaltsdefizit. Zu besseren Zeiten zählten kritische Seitenhiebe auf die ökonomische Supermacht dagegen noch zum guten Ton.
Miniwachstum in Fernost
Allerdings sitzen die Europäer im Glashaus. Weder auf dem Alten Kontinent noch im Fernen Osten rechnet jemand mit einem baldigen Aufschwung. So hängt die Weltkonjunktur auf Gedeih und Verderb an der US-Wirtschaft. Schon seit Mitte der Neunziger entfallen nach Berechnung von Morgan Stanley zwei Drittel des globalen Wirtschaftswachstums auf die USA. Im laufenden Jahr wird Amerikas Ökonomie wohl erneut um rund 2,5 Prozent zulegen – nicht viel, aber unter den Blinden ist der Einäugige König. Aus Japan dürfte Notenbankchef Masaru Hayami in Washington berichten, dass es nur ein Miniwachstum geben wird. Dem europäischen Wirtschaftsraum prognostiziert die EU-Kommission nur ein lächerliches Prozent Zuwachs, Deutschland könnte sogar in die Rezession rutschen. Immer vorausgesetzt, Börsen und Ölpreis blieben einigermaßen stabil.
Doch die Amerikaner haben ebenfalls Grund, auf laute Schelte zu verzichten. Wim Duisenberg, Greenspans Kollege bei der Europäischen Zentralbank, legte vergangene Woche den Finger in die Wunde. Er kritisierte offen Amerikas Defizite im Haushalt und in der Leistungsbilanz – und kündigte an, dies „definitiv“ beim G-7-Treffen zu diskutieren. Die Fakten sind unbestritten: George Bush reißt mit Steuersenkungspaketen und den Kriegskosten Milliardenlöcher in seine Staatskassen, und immer noch führen die Amerikaner von Jahr zu Jahr mehr Produkte und Dienstleistungen ein, als sie exportieren. Das Leistungsbilanzdefizit der USA beträgt bereits mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, nach Schätzungen könnte es bis 2004 auf sieben Prozent anschwellen. Wenn es nicht vorher zur platzenden Bombe wird und den Dollarkurs purzeln lässt – was in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte schon passiert ist.
Wenn der Dollar fällt und Amerika das Importieren einstellt, droht der Weltkonjunktur erst recht der Zusammenbruch. „Kaum ein Land könnte es ertragen, plötzlich weniger in die USA zu exportieren“, sagt Gail Fosler, Chefökonomin der New Yorker Denkfabrik Conference Board. Ähnlich steht es um Bushs Löcher im Etat. Ohne die künstlich angespornte Nachfrage wäre die Konjunkturlokomotive USA schon auf halber Strecke liegen geblieben, argumentiert das Weiße Haus. Der Rat Washingtons: Statt zu klagen, sollten die Europäer lieber ihren Stabilitätspakt lockern und eigene Konjunkturprogramme auflegen.
Davon wiederum wollen die Europäer nichts wissen. So werden die Finanzpolitiker von dies- und jenseits des Atlantiks ihr Augenmerk auf einen vertrauten Retter richten: Alan Greenspan. Der hält sich zwar bislang zurück, hat aber einige Direktoren vorgeschickt, um Nothilfen anzukündigen – falls die Pessimisten Recht behalten und ein Ende des Golfkrieges nicht den Aufschwung bringt. Zwar bleibt der Fed weniger geldpolitischer Spielraum als der EZB, weil sie seit 2001 beherzter die Zinsen gesenkt hat (siehe Grafik). Doch vor Wall-Street-Bankiers und Politikzirkeln in Washington haben Mitarbeiter Greenspans schon ausführlich dargelegt, wie sie notfalls Extrageld in den Kreislauf bringen könnten: durch den Rückkauf von Staatsanleihen oder die Ausgabe festverzinslicher und langfristiger Wertpapiere. „Da steckt ein komplettes Notprogramm in der Schublade“, glaubt Willi Semmler, Direktor des Center for Economic Policy Analysis in New York.
Sicher erinnert sich Greenspan dabei auch daran, was nach dem ersten Golfkrieg passierte. Damals lag der optimistische Notenbankchef nämlich falsch. Die amerikanische Rezession begann entgegen seiner Prognose noch im Monat der irakischen Invasion in Kuwait, und die Korrekturen der Notenbank kamen zu spät. Deshalb hat Greenspan bis heute erbitterte Gegner im Lager des Präsidenten. Die Wahlniederlage von Vater Bush im Jahr 1992 schreiben viele immer noch der damals dümpelnden Wirtschaft zu – und dem allzu lässigen Notenbanker Alan Greenspan.
DIE ZEIT - 16/2003
Mitarbeit: Petra Pinzler
Hoffen auf den heiligen Alan
Am Wochenende treffen sich die Finanzminister der großen Industrienationen. Zusammenarbeit im Kampf gegen die Wirtschaftskrise steht nicht auf der Tagesordnung. Alan Greenspan soll’s richten
Von Thomas Fischermann
Alan Greenspan muss es vorkommen, als fechte er diesen Krieg zum zweiten Mal. Im August 1990, wenige Wochen nach der irakischen Invasion in Kuwait, spielten die Märkte verrückt: Die Ölpreise stiegen vorübergehend an, die Finanzmärkte zitterten, die ohnehin angeschlagene amerikanische Volkswirtschaft schlitterte in eine Rezession. Der Chef der amerikanischen Notenbank gab sich damals freilich gelassen. Einer wie Greenspan, sagte Greenspan, habe ohnehin nur „geringe Möglichkeiten, die Wirtschaft wesentlich zu beeinflussen“.
Von alten Gewohnheiten trennt man sich offenbar schwer. Greenspan gehört auch heute zu den größten Konjunktur-Optimisten in Washington. „Geopolitische Unsicherheiten“ hielten das Wachstum vorübergehend zurück, erklärte er vor einigen Wochen. Bis vor kurzem galt der Notenbank noch ein Wachstum von dreieinhalb Prozent für möglich. Zinssenkungen als Vorbeugung gegen einen erneuten Abschwung? Ach was, die „Balance der Risiken“ rings um den Krieg sei dafür zu schwer einzuschätzen, meint Greenspan.
Es ist noch nicht so lange her, dass der Fed-Chef die alles überstrahlende Lichtgestalt des US-Finanzmarkts war. Seine jüngsten Prognosen allerdings haben einen tiefen Graben durch die Ökonomenzunft gerissen. Die Pessimisten fühlen sich von Tag zu Tag mehr bestätigt: In den Unternehmen wird wieder kräftig entlassen, Produktion und Investitionen stagnieren, die Verbraucher kaufen weniger. Steven Roach, Chefökonom der Investmentbank Morgan Stanley, befand zum Wochenbeginn düster, dass „die großen, entwickelten Volkswirtschaften im Februar und März geschrumpft sind“, dass die Welt „nicht mehr funktionsfähig“ sei, dass in den USA irgendwann die „Dollarblase“ platzen werde. Ähnlich schrill warnte schon Anfang April das Institute of International Finance (IIF) in Washington vor einer „grundlegenden Zerbrechlichkeit“ der Weltwirtschaft.
Optimisten wie Greenspan sehen das wesentlich gelassener. Aber so oder so – wenn sich an diesem Wochenende die Finanzminister und Notenbankchefs der G-7-Industrieländer und die Spitzen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington treffen, wissen sie nicht, wie schlimm die Krise ist oder werden kann. Sie haben nicht einmal einen Entwurf für eine gemeinsame, koordinierte Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Tasche. Während die USA ihr Haushaltsdefizit ungeniert immer weiter wachsen lassen, plädieren die Europäer fürs Sparen. Und während Europa die Hoffnung auf Zinssenkungen anheizt, gibt sich Amerika derzeit abstinent.
Gemeinsamkeit herzustellen wird auch deshalb schwierig, weil in Amerikas Hauptstadt die Koalition der Kriegswilligen – allen voran die USA und Großbritannien – auf die der Kriegsunwilligen trifft, vor allem Deutschland und Frankreich. So ist es schon fast ein kleines Wunder, wie sehr die meisten Wirtschaftspolitiker bisher die gegenseitigen Schuldzuweisungen vermeiden. Der griechische Finanzminister Nikos Christodoulakis zum Beispiel bekommt in diesen Tagen einen starren Blick, wenn man ihn nach den ökonomischen Verhältnissen jenseits des Atlantiks fragt. Dann lässt er ein paar Floskeln fallen: Es sei nicht Europas Aufgabe, den USA zu raten, sagt der EU-Ratsvorsitzende. Bei ihrem Treffen in der Nähe von Athen am vergangenen Wochenende vermieden auch die anderen EU-Finanzminister nach Kräften unfreundliche Worte über die Amerikaner. In der am Dienstag von der Kommission veröffentlichten Frühjahrsprognose findet sich kein böses Wort zu Washingtons Haushaltsdefizit. Zu besseren Zeiten zählten kritische Seitenhiebe auf die ökonomische Supermacht dagegen noch zum guten Ton.
Miniwachstum in Fernost
Allerdings sitzen die Europäer im Glashaus. Weder auf dem Alten Kontinent noch im Fernen Osten rechnet jemand mit einem baldigen Aufschwung. So hängt die Weltkonjunktur auf Gedeih und Verderb an der US-Wirtschaft. Schon seit Mitte der Neunziger entfallen nach Berechnung von Morgan Stanley zwei Drittel des globalen Wirtschaftswachstums auf die USA. Im laufenden Jahr wird Amerikas Ökonomie wohl erneut um rund 2,5 Prozent zulegen – nicht viel, aber unter den Blinden ist der Einäugige König. Aus Japan dürfte Notenbankchef Masaru Hayami in Washington berichten, dass es nur ein Miniwachstum geben wird. Dem europäischen Wirtschaftsraum prognostiziert die EU-Kommission nur ein lächerliches Prozent Zuwachs, Deutschland könnte sogar in die Rezession rutschen. Immer vorausgesetzt, Börsen und Ölpreis blieben einigermaßen stabil.
Doch die Amerikaner haben ebenfalls Grund, auf laute Schelte zu verzichten. Wim Duisenberg, Greenspans Kollege bei der Europäischen Zentralbank, legte vergangene Woche den Finger in die Wunde. Er kritisierte offen Amerikas Defizite im Haushalt und in der Leistungsbilanz – und kündigte an, dies „definitiv“ beim G-7-Treffen zu diskutieren. Die Fakten sind unbestritten: George Bush reißt mit Steuersenkungspaketen und den Kriegskosten Milliardenlöcher in seine Staatskassen, und immer noch führen die Amerikaner von Jahr zu Jahr mehr Produkte und Dienstleistungen ein, als sie exportieren. Das Leistungsbilanzdefizit der USA beträgt bereits mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, nach Schätzungen könnte es bis 2004 auf sieben Prozent anschwellen. Wenn es nicht vorher zur platzenden Bombe wird und den Dollarkurs purzeln lässt – was in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte schon passiert ist.
Wenn der Dollar fällt und Amerika das Importieren einstellt, droht der Weltkonjunktur erst recht der Zusammenbruch. „Kaum ein Land könnte es ertragen, plötzlich weniger in die USA zu exportieren“, sagt Gail Fosler, Chefökonomin der New Yorker Denkfabrik Conference Board. Ähnlich steht es um Bushs Löcher im Etat. Ohne die künstlich angespornte Nachfrage wäre die Konjunkturlokomotive USA schon auf halber Strecke liegen geblieben, argumentiert das Weiße Haus. Der Rat Washingtons: Statt zu klagen, sollten die Europäer lieber ihren Stabilitätspakt lockern und eigene Konjunkturprogramme auflegen.
Davon wiederum wollen die Europäer nichts wissen. So werden die Finanzpolitiker von dies- und jenseits des Atlantiks ihr Augenmerk auf einen vertrauten Retter richten: Alan Greenspan. Der hält sich zwar bislang zurück, hat aber einige Direktoren vorgeschickt, um Nothilfen anzukündigen – falls die Pessimisten Recht behalten und ein Ende des Golfkrieges nicht den Aufschwung bringt. Zwar bleibt der Fed weniger geldpolitischer Spielraum als der EZB, weil sie seit 2001 beherzter die Zinsen gesenkt hat (siehe Grafik). Doch vor Wall-Street-Bankiers und Politikzirkeln in Washington haben Mitarbeiter Greenspans schon ausführlich dargelegt, wie sie notfalls Extrageld in den Kreislauf bringen könnten: durch den Rückkauf von Staatsanleihen oder die Ausgabe festverzinslicher und langfristiger Wertpapiere. „Da steckt ein komplettes Notprogramm in der Schublade“, glaubt Willi Semmler, Direktor des Center for Economic Policy Analysis in New York.
Sicher erinnert sich Greenspan dabei auch daran, was nach dem ersten Golfkrieg passierte. Damals lag der optimistische Notenbankchef nämlich falsch. Die amerikanische Rezession begann entgegen seiner Prognose noch im Monat der irakischen Invasion in Kuwait, und die Korrekturen der Notenbank kamen zu spät. Deshalb hat Greenspan bis heute erbitterte Gegner im Lager des Präsidenten. Die Wahlniederlage von Vater Bush im Jahr 1992 schreiben viele immer noch der damals dümpelnden Wirtschaft zu – und dem allzu lässigen Notenbanker Alan Greenspan.
DIE ZEIT - 16/2003
Mitarbeit: Petra Pinzler
Was solls, der Al hat aber vor dem Krieg gewarnt und die Kosten angesprochen, viel für jemanden, der sonst eigentlich nie etwas verwertbares sagt.
Immerhin, jetzt ist er wohl 76 oder 77 Jahre alt, wenn er nach seiner Amtszeit nicht jeden Tag warm isst, dann müsste er auch ohne das Wohlgefallen von irgendwelchen Regierungen überleben können.
Warum tut er sich das alles an, lass doch mal die anderen Notenbänkern.
J2
Immerhin, jetzt ist er wohl 76 oder 77 Jahre alt, wenn er nach seiner Amtszeit nicht jeden Tag warm isst, dann müsste er auch ohne das Wohlgefallen von irgendwelchen Regierungen überleben können.

Warum tut er sich das alles an, lass doch mal die anderen Notenbänkern.
J2
.
Frohlocken der Goldbranche
European Gold Forum in Zürich als Treffpunkt
Hatte die Goldbranche jahrelang bei den Anlegern ein Mauerblümchendasein gefristet, so sind mit dem jüngsten Goldpreisanstieg neues Geld und neues Leben in den Sektor gekommen. Dies drückt sich auch in den Marketing-Aktivitäten aus: So gab es am Dienstag und am Mittwoch in Zürich eine Goldkonferenz der Denver Gold Group, nachdem dieser bekannte Organisator der Schweiz einige Jahre lang ferngeblieben war. Edelmetallgesellschaften aller Art erhielten die Gelegenheit, sich den Investoren vorzustellen und Kontakte zu knüpfen.
Die Goldbranche ist im Laufe von fünf mageren Jahren, während deren der Goldpreis fast bis auf 250 $/Unze und damit unter die Produktionskosten vieler Anbieter gefallen war, stark ausgedünnt worden. Schossen einst kleine Explorationsgesellschaften wie die Pilze aus dem Boden, so sind heute in dem Bereich fast nur noch alte Bekannte auf dem Markt zu finden. Für Neugründungen fehlte sehr häufig das Kapital. Aber auch der Mittelbau wurde stark dezimiert: Die Grossen der Branche, zu denen die nordamerikanischen Gesellschaften Newmont Mining, Placer Dome und Barrick Gold sowie die Südafrikaner Anglogold, Gold Fields und Harmony Gold gehören, haben die Kleineren aufgekauft. Mittelgrosse Unternehmen existieren zurzeit fast nur noch in Nordamerika, wo die Bewertungen der Aktien relativ hoch sind.
In Südafrika, wo die einzelnen Minen traditionell anteilsmässig verschiedenen grossen Holdinggesellschaften gehört hatten, wurden diese Kreuzbeteiligungen aufgelöst und die Minen mit den Holdings verschmolzen. Teilweise aufgeweicht wird diese Struktur neuerdings durch Holdinggesellschaften schwarzer Investoren, die sich, gefördert vom neuen Bergbaugesetz, wieder an einzelnen Minen beteiligen. In Australien dagegen, wo fast alle Goldgesellschaften ins mittlere oder kleinere Segment gehört hatten, sind nur wenige unabhängige Unternehmen übrig geblieben. Die Aktien waren vergleichsweise tief bewertet gewesen - vermutlich, weil die Nordamerikaner und die Südafrikaner auf eine breitere Investorenbasis zurückgreifen konnten. Gerade die südafrikanischen Konzerne deckten sich in Australien ein, um sich geographisch zu diversifizieren. Aber auch die nordamerikanischen Konzerne griffen zu.
Mittelgrosse Goldunternehmen weisen für Anleger andere Charakteristika auf als grosse oder ganz kleine. Die Aktienkurse der Grossen, von denen die meisten ihre Goldverkaufspreise durch derivative Geschäfte absichern, reagieren mit den Ausnahmen von Harmony Gold und Gold Fields relativ träge auf Goldpreisentwicklungen. Strittig ist auch das Synergiepotenzial bei den Übernahmen. Die Kursentwicklung der Aktien der Kleinen ist stark abhängig vom Nachrichtenfluss bezüglich der Erfolge bei der Exploration oder dem Aufbau von Minen. Mittelgrosse Unternehmen, die ein oder zwei reiche Bergwerke in Regionen mit tiefem Länderrisiko besitzen, können dagegen relativ reine Wetten auf den Goldpreis sein. Allerdings ist dort die Auswahl des Investitionsobjektes sehr wichtig. Trotz den vergangenen Hungerjahren gelten nicht alle Managements als über jeden Zweifel erhaben.
Allenthalben wurde an der Konferenz Freude darüber geäussert, dass sich Goldanlagen einmal mehr in Zeiten politischer Unsicherheit und schwacher Aktienmärkte als Gegengewicht erwiesen haben. Allerdings tauchte auch ein möglicher Wermutstropfen auf: Die Gerüchte in der Branche intensivieren sich, dass das Washingtoner Agreement, das zurzeit die Verkäufe von Goldreserven durch die Notenbanken limitiert und 2004 ausläuft, möglicherweise nicht mehr verlängert wird. Sollte dem so sein, könnte der Goldpreis erneut unter Druck geraten, denn Länder wie Deutschland und Italien, die zu den grössten Goldbesitzern gehören, könnten sehr wohl noch an Reserve-Verkäufe denken.
NZZ - 17.04.2003
Frohlocken der Goldbranche
European Gold Forum in Zürich als Treffpunkt
Hatte die Goldbranche jahrelang bei den Anlegern ein Mauerblümchendasein gefristet, so sind mit dem jüngsten Goldpreisanstieg neues Geld und neues Leben in den Sektor gekommen. Dies drückt sich auch in den Marketing-Aktivitäten aus: So gab es am Dienstag und am Mittwoch in Zürich eine Goldkonferenz der Denver Gold Group, nachdem dieser bekannte Organisator der Schweiz einige Jahre lang ferngeblieben war. Edelmetallgesellschaften aller Art erhielten die Gelegenheit, sich den Investoren vorzustellen und Kontakte zu knüpfen.
Die Goldbranche ist im Laufe von fünf mageren Jahren, während deren der Goldpreis fast bis auf 250 $/Unze und damit unter die Produktionskosten vieler Anbieter gefallen war, stark ausgedünnt worden. Schossen einst kleine Explorationsgesellschaften wie die Pilze aus dem Boden, so sind heute in dem Bereich fast nur noch alte Bekannte auf dem Markt zu finden. Für Neugründungen fehlte sehr häufig das Kapital. Aber auch der Mittelbau wurde stark dezimiert: Die Grossen der Branche, zu denen die nordamerikanischen Gesellschaften Newmont Mining, Placer Dome und Barrick Gold sowie die Südafrikaner Anglogold, Gold Fields und Harmony Gold gehören, haben die Kleineren aufgekauft. Mittelgrosse Unternehmen existieren zurzeit fast nur noch in Nordamerika, wo die Bewertungen der Aktien relativ hoch sind.
In Südafrika, wo die einzelnen Minen traditionell anteilsmässig verschiedenen grossen Holdinggesellschaften gehört hatten, wurden diese Kreuzbeteiligungen aufgelöst und die Minen mit den Holdings verschmolzen. Teilweise aufgeweicht wird diese Struktur neuerdings durch Holdinggesellschaften schwarzer Investoren, die sich, gefördert vom neuen Bergbaugesetz, wieder an einzelnen Minen beteiligen. In Australien dagegen, wo fast alle Goldgesellschaften ins mittlere oder kleinere Segment gehört hatten, sind nur wenige unabhängige Unternehmen übrig geblieben. Die Aktien waren vergleichsweise tief bewertet gewesen - vermutlich, weil die Nordamerikaner und die Südafrikaner auf eine breitere Investorenbasis zurückgreifen konnten. Gerade die südafrikanischen Konzerne deckten sich in Australien ein, um sich geographisch zu diversifizieren. Aber auch die nordamerikanischen Konzerne griffen zu.
Mittelgrosse Goldunternehmen weisen für Anleger andere Charakteristika auf als grosse oder ganz kleine. Die Aktienkurse der Grossen, von denen die meisten ihre Goldverkaufspreise durch derivative Geschäfte absichern, reagieren mit den Ausnahmen von Harmony Gold und Gold Fields relativ träge auf Goldpreisentwicklungen. Strittig ist auch das Synergiepotenzial bei den Übernahmen. Die Kursentwicklung der Aktien der Kleinen ist stark abhängig vom Nachrichtenfluss bezüglich der Erfolge bei der Exploration oder dem Aufbau von Minen. Mittelgrosse Unternehmen, die ein oder zwei reiche Bergwerke in Regionen mit tiefem Länderrisiko besitzen, können dagegen relativ reine Wetten auf den Goldpreis sein. Allerdings ist dort die Auswahl des Investitionsobjektes sehr wichtig. Trotz den vergangenen Hungerjahren gelten nicht alle Managements als über jeden Zweifel erhaben.
Allenthalben wurde an der Konferenz Freude darüber geäussert, dass sich Goldanlagen einmal mehr in Zeiten politischer Unsicherheit und schwacher Aktienmärkte als Gegengewicht erwiesen haben. Allerdings tauchte auch ein möglicher Wermutstropfen auf: Die Gerüchte in der Branche intensivieren sich, dass das Washingtoner Agreement, das zurzeit die Verkäufe von Goldreserven durch die Notenbanken limitiert und 2004 ausläuft, möglicherweise nicht mehr verlängert wird. Sollte dem so sein, könnte der Goldpreis erneut unter Druck geraten, denn Länder wie Deutschland und Italien, die zu den grössten Goldbesitzern gehören, könnten sehr wohl noch an Reserve-Verkäufe denken.
NZZ - 17.04.2003
.
Wiederaufbau Irak:
Basar Bagdad
Öl, Straßen, Telefonanlagen: Regierungen und Konzerne feilschen um die größten Aufträge im Irak ? und darum, wer sie bezahlt
Von Petra Pinzler und Joachim Fritz-Vannahme
Zwei Tage, und dann war das Seminar Arabisch verstehen beim Hamburger Nah- und Mittelost-Verein der deutschen Wirtschaft ausverkauft. In London erfreuen sich die Irak-Informationsabende der Trade Partners UK ähnlicher Beliebtheit. Und in Washington kann das Forschungsinstitut CSIS dieser Tage sogar 1000 Dollar für ein Seminar verlangen, auf dem Senatoren, ehemalige Generäle und Staatssekretäre reden. Thema: Aufbau Irak – Die Herausforderung für Unternehmen.
Rund um die Welt sprießen die Hoffnungen aufs schnelle Geschäft in Bagdad. Obwohl die letzten Bomben noch nicht gefallen und die Toten nicht begraben sind, schnüren auf den Philippinen die Wanderarbeiter bereits ihr Säckchen. Kaum jemand arbeitet so billig in der Montage wie sie und versteht dabei noch Englisch.
In Minnesota träumen die Farmer davon, „die Freundschaft mit den irakischen Müllern zu erneuern“, so Alan Tracy, Präsident des amerikanischen Weizenverbandes. In Kuwait hoffen die Ölfachleute darauf, bald auch an den Quellen des ehemaligen Feindes bohren zu dürfen. Und in Spanien versucht die Regierung Aznar, ihren Unternehmen durch geheime Absprachen und eilfertige Reisen nach Washington einen Startvorteil zu sichern.
Doch wer wird wirklich das große Geschäft in Bagdad machen? Wer wird es bezahlen? Und wer wird das liefern, was die Iraker wirklich brauchen?
In Deutschland gibt man sich derzeit pessimistisch. „Bei der Vergabe der Aufträge wird sich deutlich bemerkbar machen, dass Deutschland die USA im Krieg nicht unterstützt hat“, fürchtet Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels. „Wenig zu bestellen“ hätten die Deutschen, glaubt auch VDMA-Hauptgeschäftsführer Hannes Hesse. Ähnliche Prognosen sind in Frankreich zu hören.
Von der Zeitung La Tribune befragt, fürchten zwei Drittel der Leser eine Benachteiligung der heimischen Wirtschaft. Viele denken wie der erstaunte Vertreter des Pariser Wirtschaftsministeriums: „Die Art, wie die Amerikaner ihre Unternehmen durchsetzen und dabei jene bevorzugen, die der Regierung nahe stehen, ist einfach atemberaubend.“ Oder sie reagieren verärgert wie Claude Schneider vom Bauunternehmen Case Poclin: „Wir waren seit 35 Jahren im Irak vertreten. Doch nun sollen alle Aufträge an die Amerikaner gehen.“
Missmut auch in Russland, bei dem dritten mächtigen Verbündeten der Friedensachse. Dort hat Nikolaj Tokarew, der Direktor der russischen Ölfirma Zaroubenjneft, seine Verträge zur Ausbeutung irakischer Ölfelder innerlich bereits abgeschrieben. Er nennt das schwarze Gold kurz „die Kriegsbeute der Amis“.
Amerikanische Kapitalisten gegen russische Ölbarone? Deutsche Bauunternehmen gegen britische Consultants?
Jahrelang predigten Ökonomen, Manager und Politiker aller Länder, dass Nationalitäten in der Weltwirtschaft keine Rolle mehr spielten, die Globalisierung die Grenzen schleife, Kapital keine Heimat kenne und frei und ungebunden nach den lukrativsten Anlagemöglichkeiten suche – zum Wohle aller. Sie hatten ihren Marx gelernt und predigten wie er, dass „nationale Einseitigkeit und Beschränktheit mehr und mehr unmöglich“ und „Produktion und Konsumption global“ gestaltet werden. Nationale Verbundenheit, patriotische Pflicht, Vorzugsbehandlung heimischer Unternehmen, all das klang altmodisch.
Auf einmal aber ist das alte Denken wieder da.
Am klarsten formuliert Richard Perle, der ungekrönte Vordenker des amerikanischen Verteidigungsministeriums, den neuen Trend. „Warum sollten die Franzosen, die nicht zum Club gehören, zum Abendessen kommen“, ätzte er, während in Bagdad noch die Bomben fielen. Doch nicht nur der nassforsche Polemiker weckt in Europa die Angst, beim Wirtschaftswunder im Land von Tausendundeiner Nacht ausgeschlossen zu werden. Genährt wird die Furcht durch Fakten, die die amerikanische Regierung längst geschaffen hat (siehe auch Seite 20).
Bislang finanzieren die Amerikaner als Einzige den Wiederaufbau in großem Maße aus eigener Tasche: Zwei Milliarden Dollar hat der US-Kongress bereitgestellt, und die gehen nun seit Tagen in kleineren oder größeren Aufträgen vor allem an amerikanische Unternehmen. Während Europas Regierungen noch debattieren, ob sie sich überhaupt am Wiederaufbau beteiligen wollen, und die Europäische Kommission hilflos die amerikanische Vergabepraxis ob ihrer „Konformität mit den Regeln der Welthandelsorganisation“ prüft, löschen die Amerikaner bereits Ölbrände, sichern Häfen und heuern Polizisten an.
Mehr als 200 Beamte aus den verschiedenen amerikanischen Ministerien hat der pensionierte US-General Jay Garner unter sich; mit ihnen soll er die Verwaltung des Iraks möglich bald wieder zum Laufen bringen: Es geht um die Haushalts- und Finanzaufsicht, den Ausbau des Autobahnnetzes, ein funktionsfähiges Zollamt, die Verteilung der Sendefrequenzen für Telefone, das Bankensystem.
Während die Amerikaner handeln, läuft dem Rest der Welt langsam die Zeit davon. Bei einer Krisensitzung mit Vertretern des französischen Wirtschaftsministeriums Anfang April warnte Jean-Marie Aouste vom Unternehmerverband Medef, dass die französische Wirtschaft viel zu spät komme. „Beim Wiederaufbau des Kosovo waren wir bereits drei, vier Monate vor dem Ende des Konfliktes am Ort.“ Und diesmal?
Auch in Tschechien, von US-Präsident George W. Bush immer zu den „Willigen“ gezählt, mahnte der Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdik mit Blick auf den Irak: „Unsere Unternehmen schaffen es nicht, den guten tschechischen Ruf angemessen zu nutzen.“
Selbst in England hoffte die Industrie bislang vergeblich, dass sich die politische und militärische Loyalität ihrer Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten auszahlt. Inzwischen erfleht das British Consultants and Construction Bureau (BCCB), eine Dachorganisation von 300 britischen Konstruktions- und Beratungsfirmen, verzweifelt von der eigenen Regierung, „Beihilfen oder Darlehen für Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu stellen, welche britische Firmen dann ausführen können, um dem irakischen Volk langfristig zu helfen“.
Vor allem in jenen Märkten, wo Standards gesetzt werden, könnte das Rennen schon bald entschieden sein.
Beispiel Telekommunikation: Der europäische GSM-Standard wird heute von mehr als 800 Millionen Telefonkunden in 193 Ländern verwendet. Marktführer beim Bau von Geräten und Netzen sind Nokia, Ericsson, Siemens und Alcatel. Doch es besteht kein Zweifel, dass die Amerikaner mit ihrem im kommenden Herbst einsatzbereiten Standard namens DCMA 2000 aufholen wollen.
In Rumänien und Polen haben amerikanische Firmen ihre Technik, die einfacher und billiger, aber auch weniger leistungsfähig ist, bereits durchgesetzt. Wenn es nach dem kalifornischen Kongress-Abgeordneten und Industrielobbyisten Darrell Issa geht, soll die US-Norm bald die derzeitige europäische Dominanz im Nahen und Mittleren Osten brechen. Obwohl die ganze Nachbarschaft des Iraks per GSM telefoniert, fordert Industriefreund Issa: „Unsere Regierung darf keine europäischen Firmen mit dem Aufbau des irakischen Netzes beauftragen.“
Kann eine Besatzungsmacht das einfach tun? Dürfen die USA Standards setzen, möglicherweise gar langfristige Verträge vergeben und die Einkünfte selbst verwalten?
Der stellvertretende UN-Generalsekretär Shashi Tharoor gibt eine klare Antwort: „Die Besatzungsmacht hat nach der Genfer Konvention kein Recht, die Ressourcen eines Landes langfristig auszubeuten.“ Die Vereinten Nationen stehen mit dieser Interpretation des Völkerrechtes nicht allein, ihr eilen Unternehmervertreter aller Herren Länder zur Seite. „Die deutsche Wirtschaft unterstützt die Politik bei ihrer Forderung, dass der Wiederaufbau unter der Koordination der Vereinten Nationen stehen soll“, sagt Michael Rogowski, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie – natürlich von der Hoffnung getrieben, dass deutsche Firmen bei einer internationalen Verwaltung eher zum Zug kommen.
In der Pariser Zentrale des Energiekonzerns TotalFinaElf pocht man noch aus einem anderen Grund auf das Völkerrecht und eine schnelle Übergabe der Verwaltung an eine irakische Führung. „Ohne repräsentative Regierung geht langfristig nichts. Solange die nicht existiert, wird keine Gesellschaft der Welt im Irak arbeiten, auch Exxon, ChevronTexaco oder Shell nicht“, sagt der Konzernsprecher Paul Florin. Man wolle daher die eigenen Verträge auch „nicht mit einem amerikanischen General, sondern mit einer neuen irakischen Regierung“ besprechen.
Tatsächlich zählt bei Großprojekten internationales Recht. So werden in der Erdölindustrie Verträge in Milliardenhöhe mit bis zu 25 Jahren Laufzeit geschlossen. Solche Summen könne man nur investieren, wenn die Stabilität eines Landes langfristig gesichert sei, sagt Florin und mutmaßt: „Keine internationale Firma wird bereit sein, unter einem vorübergehenden US-Protektorat oder auch unter einem UN-Mandat einen Vertrag zu unterzeichnen.“
Ähnlich argumentiert Alexander Görbing von der Walter-Bau AG, einem international aktiven Bauunternehmen. „Wir brauchen Verlässlichkeit“, sagt er stellvertretend für viele Unternehmen, die Brücken, Straßen, Häfen bauen, die Förderanlagen modernisieren oder neue Ölfelder erschließen. Schließlich kann ein Investor bei Problemen nicht einfach gehen und die halbe Brücke mitnehmen.
Ob das internationale Recht tatsächlich auf dem Basar von Bagdad hilft? Vielleicht über einen Umweg: So können die Amerikaner zwar relativ unangefochten von internationalen Regeln ihr eigenes Geld im Irak durch eigene Firmen ausgeben – aber der Wiederaufbau wird sich damit kaum finanzieren lassen. 2,4 Milliarden Dollar hat Washington als Aufbauhilfe ausgewiesen – immerhin mehr als für den Balkan oder Afghanistan. Mit Sicherheit aber zu wenig Mittel für ein Land, das von Kriegen, von Diktatur und Embargo tief gezeichnet ist. Jede zusätzliche Hilfe, beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, setze aber eine völkerrechtliche Legitimation der irakischen Verwaltung voraus. „Nur auf der Basis eines neuen Mandates“, so Weltbank-Chef James Wolfensohn, könne man aktiv werden.
Die wirklich großen Summen für den Wiederaufbau sollen allerdings ganz anders erwirtschaftet werden: durch Öl.
Die Optimisten hoffen, dass schon in zwei bis drei Jahren Öl im Wert von 15 bis 20 Milliarden Dollar jährlich gefördert werden kann. Derzeit ist man davon allerdings weit entfernt, weil die Anlagen zum Teil veraltet oder verrottet und etliche durch den Krieg beschädigt sind. Allein für die Notreparaturen könnten drei Milliarden Dollar nötig sein, und auch hier hemmt die verworrene Rechtslage.
Noch verwaltet die UN mit ihrem „Oil-for-Food“ Programm die Einkünfte. Konservative US-Politiker würden die Quellen gerne privatisieren – und mit einem Teil der Erlöse die Besatzungskosten decken. Das aber würde weltweit zu einem politischen Aufschrei führen, zudem hat die Bush-Regierung den Irakern ihre Ölmilliarden versprochen.
Auf 78 Milliarden Barrel schätzt die Internationale Energieagentur die Ölreserven des Landes, von 112 Milliarden geht das angesehene Oil and Gas Journal aus. Bis dieser Reichtum allerdings dem Land zugute kommt, wird noch viel Zeit vergehen, weil es ihm schlicht an Aufnahmefähigkeit fehlt.
„Wie ist es um die irakische Wirtschaft bestellt?“, fragt das Washingtoner Council on Foreign Relations und gibt sich selbst die knappe Antwort: „Entsetzlich.“ Die wichtigsten Industrien, von der Ölförderung bis zur Textilherstellung, seien in der Hand der Regierung und ineffizient, so seine Studie The Day After. Allein der zivile Staatsapparat hält jeden fünften Beschäftigten in Arbeit und Brot, mehr als vierzig Prozent der Haushalte hängen am Tropf des Regimes, rechnete das Atlantic Council im Januar vor. Die Weltbank schätzt das Pro-Kopf-Einkommen auf 1200 Dollar, kaum ein Drittel dessen, was ein Iraker vor zwanzig Jahren nach Hause trug.
Genaueres über den Zustand der Ökonomie im Zweistromland werden westliche Fachleute frühestens in einigen Monaten wissen. „Wir haben keinerlei Vorstellung, was wir an ökonomischen Daten vorfinden werden“, sagt Weltbank-Vize Jean Louis Sarbib. Kein Wunder in einem Land voller Staatsgeheimnisse, dessen letztes Budget 1978, dessen letzte Karte von Staats wegen 1973 veröffentlicht wurden. Der Internationale Währungsfonds setzt das Einkommen noch niedriger an, irgendwo zwischen 700 und 1200 Dollar, weniger als das Durchschnittseinkommen auf dem westlichen Balkan. Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt liefert die Weltbank lieber gar nicht, der britische Economist spricht von 26 Milliarden, das Weiße Haus taxiert es auf 59 Milliarden Dollar. Die Lebenserwartung ist auf 61 Jahre gesunken, jedes fünfte Kind ist ungenügend ernährt.
Das müsste nicht sein, lässt sich aber so schnell nicht ändern: Seit den siebziger Jahren lebt der Irak vom Öl, was dazu geführt hat, dass es zu einer massiven Abwanderung in die Städte gekommen ist. Deshalb wird kaum noch die Hälfte des kultivierbaren Bodens beackert.
Wo also anfangen? „Man kann nicht alles zur selben Zeit, die Schulden tilgen, die Kriegskosten erstatten, den Wiederaufbau bezahlen, wirtschaftliche Verbesserungen bezahlen, die Demokratisierung zum Erfolg machen. Man muss sich entscheiden. Und diese Entscheidung ist nun mal politisch“, sagt Jean-François Giannesini vom Pariser Institut français du pétrole.
Das wäre ein Grund, die Iraker schon bald selbst die Wahl treffen zu lassen – auch darüber, wie sie ihre Öleinnahmen verwenden wollen. Das meint übrigens auch das Forschungsinstitut von James Baker III., dem ehemaligen Außenminister von Präsident Bush senior. Eine Studie aus seinem Haus kommt zu dem klaren Schluss: „Man sollte unterstreichen, dass die Iraker fähig sind, über die Zukunft ihrer Ölindustrie zu entscheiden.“
Bei einem aber wollen die Amerikaner auf jeden Fall auch künftig helfen: Der Krieg sei ein Werbefeldzug für die amerikanische Rüstungsindustrie gewesen, lässt sich der pensionierte amerikanische General David Daker von der Herald Tribune zitieren. Und schon bittet das Weiße Haus in Washington den Kongress um die Genehmigung, bestimmte Lieferbeschränkungen für Rüstungsgeschäfte in den befreiten Irak aufzuheben. Aus dem Feind von eben soll ein „bevorzugter Kunde“ werden.
DIE ZEIT 17 / 2003
Mitarbeit: Thomas Fischermann, John F. Jungclaussen, Michael Mönninger,
Stefanie Müller, Frank Schulte
"Mindestens zwei Jahre"
Die Besatzungszeit wird lange dauern, warnt der Wiederaufbau-Experte Frederick Barton
die zeit: Die amerikanische Regierung hat die ersten Aufträge für den Wiederaufbau des Iraks schon ausgeschrieben, bevor überhaupt Schüsse fielen. Ist das nicht etwas ungewöhnlich?
Frederick D. Barton: Ich halte das für unproblematisch. Der Großteil der Verträge rings um den Wiederaufbau ist noch gar nicht vergeben – im Augenblick geht es nur um ungefähr 1,5 Milliarden Dollar. Und es geht um amerikanisches Steuergeld, nicht um irakisches Vermögen.
zeit: Das große Geschäft kommt also erst noch – die Verwendung der Ölmilliarden des Iraks für den Löwenanteil des Wiederaufbaus, so wie es das Weiße Haus vorgesehen hat. Viele glauben, dass die Vereinigten Staaten als Besatzungsmacht schon jetzt entscheiden, wer diese Aufträge erhält.
Barton: Es wäre ein schwerer Fehler, wenn Amerika jetzt die Hände einer künftigen irakischen Regierung mit langfristigen Verträgen binden würde. Diese Frage berührt den Kern irakischer Souveränität.
zeit: Konservative amerikanische Politiker fordern, mit dem irakischen Öl solle man auch einen Teil der amerikanischen Kriegskosten finanzieren.
Barton: Das ist eine schlechte Idee. Der Irak und die siegreiche Koalition haben eigentlich die gleichen ökonomischen Interessen: Je mehr Öl der Irak fördert, desto mehr Geld kann er in seinen eigenen Wiederaufbau stecken – und desto stabiler wird die Ölversorgung für die westliche Welt. Der Irak ist reich genug, um seinen Wiederaufbau zu großen Teilen selbst zu bezahlen. Er hat das Geld und die technokratische Elite.
zeit: Wie lange wird dann die Übergangszeit der Besatzung dauern? Im Verteidigungsministerium ist von sechs Monaten die Rede.
Barton: Ich gehe von zwei Jahren aus. Und das ist optimistisch kalkuliert. Es ist klar, dass unter einem Besatzungsregime erst einmal grundlegende Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Das Land muss für die Bevölkerung wieder sicher sein, jedermann sollte sich auf die Straße trauen können und nicht um sein Eigentum fürchten müssen. Zunächst geht es um das Überleben der Menschen im Irak – um Unterkünfte, Wasser und Nahrungsmittel. Im nächsten Schritt kommt es auf eine funktionierende Verwaltung an und darauf, dass das Recht wieder herrscht. Erst dann ist überhaupt an eine wirtschaftliche Expansion zu denken.
Frederick D. Barton beschäftigt sich mit Nationenbildung und Flüchtlingshilfe. Er forscht am Center for International and Strategic Studies in Washington und an der Princeton University. Die Fragen stellteThomas Fischermann
White House Connection
Wie amerikanische Unternehmen ihre engen Verbindungen zur Regierung nutzen
Von Thomas Fischermann
Im frisch befreiten Irak gibt es die ersten Job-Angebote. Unter der Telefonnummer 866-258 8770 können sich arbeitslose und pensionierte Polizisten ab sofort Stellen im Besatzungsgebiet reservieren: „Wiederaufbau der Polizei, Gerichte und Gefängnisse“ steht als Aufgabe in der Stellenbeschreibung – und sicher geht es auch darum, die Plünderungen in den Straßen von Bagdad und Basra in den Griff zu bekommen.
Mitzubringen sind die amerikanische Staatsbürgerschaft, Berufserfahrung als Polizist, eine US-Fahrerlaubnis und „ausgezeichnete Gesundheit“. Der Arbeitgeber in spe weiß nämlich, worauf es ankommt. Die Firma Dyncorp aus Fort Worth in Texas schickt schon seit Jahren Aufpasser in Krisengebiete von Bosnien bis Afghanistan – 23000 Beschäftigte zählt sie weltweit, der Jahresumsatz beträgt 2,3 Milliarden Dollar.
Fragt man genauer nach, ist die Streifenarbeit im Irak aber noch keine ausgemachte Sache. Dyncorp wirbt seine Mitarbeiter im Moment noch „vorläufig“ an, für „eventuelle“ Aufträge – schließlich ist die Besatzung des Iraks derzeit noch Sache der ganz großen Weltpolitik, und vielleicht bekommen Blauhelme der Vereinten Nationen den Job. Doch große Zweifel am baldigen Einsatz im Irak hat bei Dyncorp niemand. Die Regierung hat deutlich erkennen lassen, wie sie den Irak wiederaufbauen will: in einer Rekordzeit von etwa einem Jahr und unter kräftiger Beteiligung effizienter, amerikanischer Firmen. Der Schlacht am Golf soll die Mutter aller Wiederaufbau-Arbeiten folgen – Aufträge im Wert von 30 bis 105 Milliarden Dollar könnten US-Firmen winken, schätzt die American Academy of Arts & Sciences.
Kein Wunder, dass vor dem ersten Schusswechsel am Golf in den Bürohäusern Washingtons eine andere Schlacht ausbrach. Schon Mitte Februar, einen Monat vor dem Bombardement, wurden rings um das Weiße Haus die ersten Aufträge vergeben. Natürlich heimlich und im Verborgenen, mithilfe von Beziehungen und Seilschaften. Es war die Zeit der Lobbyisten und oft dubioser Grenzgänger zwischen öffentlichem Dienst und privatem Profit.
Zum Beispiel: Richard Perle. Der Washingtoner Insider und erzkonservative „Falke“ aus dem Umkreis George W. Bushs sorgte Ende März für Schlagzeilen, als er wegen seiner Verquickungen mit der Verteidigungswirtschaft seinen Posten als Topregierungsberater und Chef des Arbeitskreises Defense Policy Board abgeben musste.
Perle hatte nebenbei die Telekomfirma Global Crossing beraten, im Vorstand eines Zulieferers des Unternehmens Bechtel gesessen (eines der Hauptbewerber um den Wiederaufbau im Irak) – und obendrein Anleger bei ihren Investitionen in Firmen rund um den Kampf gegen den Terror betreut.
Der Skandal blieb ohne größere Folgen. Perle sitzt weiter als einfaches Mitglied im Defense Policy Board. Nach Informationen der Washingtoner Antikorruptionsgruppe Center for Public Integrity haben neun weitere Mitglieder in diesem Gremium ähnliche Verbindungen zu Firmen, die sich um den Wiederaufbau am Golf bewerben.
Das prominenteste Beispiel: Dick Cheney. Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten sorgte seit seinem Amtsantritt für hochgezogene Augenbrauen in Washington. Denn er war besonders oft durch die „Drehtür“ zwischen Politik und Wirtschaft gegangen. Cheney war in den frühen neunziger Jahren Verteidigungsminister gewesen und hatte dem Houstoner Großkonzern Halliburton 1992 einen folgenreichen Auftrag erteilt: Die Firma sollte untersuchen, wie sich Routinearbeiten der Armee in Kriegsgebieten privatisieren lassen. Der Bericht blieb geheim, Cheney verließ das Pentagon, wurde Chef von Halliburton und baute das Verteidigungsgeschäft des Konzerns kräftig aus. Seit 2000 sitzt Cheney wieder in der Regierung und gilt Kritikern als Helfer eines ganzen Clubs ehemaliger Öl- und Verteidigungsindustrieller. Halliburton jedenfalls geht es weiterhin bestens. Das Unternehmen baute zuletzt das Taliban-Gefängnis in Guantánamo Bay. Cheney selbst bezieht im Jahr etwa eine Milliarde Dollar Rente von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Er soll sehr gut mit dem pensionierten Admiral Joe Lopez befreundet sein, dem Chef-Lobbyisten von Halliburton in Washington.
So wundert es wenige Beobachter in der Hauptstadt, dass Halliburton im Irak von Beginn an neben den U. S. Marines kämpfte. Schon seit Dezember 2001 besteht ein Vertrag zwischen Halliburton und der US-Armee, logistische Unterstützung im „Kampf gegen den Terror“ zu leisten – und im aktuellen Krieg fiel zum Beispiel der Aufbau der Zeltstädte von Kuwait unter diese Regelung. Nach den ersten Bombenabwürfen wurde außerdem bekannt, dass die spezialisierte Feuerwehr-Firma Boots & Coots Mitarbeiter an den Golf entsandt hatte – ein Subunternehmen des Halliburton-Ablegers KBR.
Während Generäle berichteten, dass Saddam seine „gesamte Wirtschaft in die Luft jagen“ wolle und „praktisch alle“ Öl- und Gasanlagen des Landes vermint habe, trat der Boots-&-Coots-Chef Jerry Winchester unnötig geheimnisvoll vor die Analysten: Er erklärte, dass er „Verbesserungen unserer Einnahmen aus Löschtätigkeiten im ersten Quartal 2003“ erwarte. Der Kurs der kleinen Houstoner Firma in Finanznöten kletterte kräftig. Wer erinnerte sich nicht an das Inferno von 1991, als in Kuwait rund 700 Quellen brannten?
Inzwischen hat die Auftragsvergabe an Firmen wie Boots & Coots allerdings die ersten Gegner auf den Plan gerufen: nicht nur Wettbewerber aus Kanada, die sich aus politischen Gründen übergangen fühlen – sondern auch demokratische Abgeordnete im Kongress, die der Geheimniskrämerei der Regierung gerne ein Ende setzen würden. Der Demokrat Henry Waxman etwa fragte schon im März ungehalten beim Corps of Engineers der US-Armee an, warum es bei der Vergabe des Löschauftrages eigentlich keine öffentliche Ausschreibung gegeben habe. Was ihn besonders erboste: Die Firma KBR hatte offenbar einen so genannten „Kosten-Plus“-Vertrag erhalten. Das heißt, dass die Firma alle Kosten erstattet bekommt plus eines Zuschlags von sieben Prozent als Gewinn, wie das Waxman-Büro mitteilt. So habe sie keinerlei Anreiz zum sparsamen Wirtschaften – eine Verschwendung von Steuergeld.
Vergangene Woche legte Waxman noch einmal nach und forderte einen genaueren Blick auf die Auftragsvergabe der amerikanischen Entwicklungshilfeagentur USAid. Von der Verwaltung des Seehafens bis zum Wiederaufbau der Krankenhäuser seien deren Ausschreibungen undurchsichtig. Mehrere Demokraten im Kongress haben offiziell eine unabhängige Untersuchung jener Aufträge gefordert, die die US-Armee zurzeit fast wöchentlich vergibt: die Reparatur von Straßen und Brücken, der Ersatz zerbrochener Fenstern und Türen, der Bau von Baracken für militärisches Personal und sogar für die Beseitigung eventueller chemischer oder nuklearer Waffen im Irak.
Die ganz großen Deals freilich folgen erst noch. Der große Preis der derzeitigen Auftragsrunde sind Bauarbeiten für schätzungsweise 600 Millionen Dollar, um die nötigste Infrastruktur in Bagdad wiederaufzubauen. Halliburton sei bei diesem Auftrag aus dem Rennen, erklärte die Firma vor zwei Wochen – nachdem seit Mitte Februar die Pressegerüchte um diesen Auftrag nicht abrissen und die Kritik an der Rolle des Vizepräsidenten Cheney nicht verstummen mochte. Ob ein Zusammenhang besteht, blieb unklar, und manche Brancheninsider spekulieren, dass Halliburton sein Gebot aus politischen Gründen selbst zurückgezogen habe. Zumal es als ein wesentliches Subunternehmen des Mitbewerbers Parsons sozusagen getarnt im Rennen verblieben sei. Alles Gerüchte – offizielle Bestätigungen sind nicht zu bekommen.
Während sich die Großen der Branche in Stellung bringen, hat die kleine Löschfirma Boots & Coots aus Houston freilich eine schmerzliche Erfahrung gemacht: Trotz bester Beziehungen verspricht der Irak-Krieg keineswegs automatisch Reichtümer. Es hat nicht lange gebrannt im Irak: Bisher gab es nach Schätzungen von Ölanalysten höchstens zehn Ölfeuer im Süden des Iraks, und davon löschte die kuwaitische Feuerwehr mehr als Boots & Coots.
Der vorläufig letzte Brand verlosch am Sonntag, und der Aktienkurs von Boots & Coots ist seither um mehr als die Hälfte gesunken.
Wiederaufbau Irak:
Basar Bagdad
Öl, Straßen, Telefonanlagen: Regierungen und Konzerne feilschen um die größten Aufträge im Irak ? und darum, wer sie bezahlt
Von Petra Pinzler und Joachim Fritz-Vannahme
Zwei Tage, und dann war das Seminar Arabisch verstehen beim Hamburger Nah- und Mittelost-Verein der deutschen Wirtschaft ausverkauft. In London erfreuen sich die Irak-Informationsabende der Trade Partners UK ähnlicher Beliebtheit. Und in Washington kann das Forschungsinstitut CSIS dieser Tage sogar 1000 Dollar für ein Seminar verlangen, auf dem Senatoren, ehemalige Generäle und Staatssekretäre reden. Thema: Aufbau Irak – Die Herausforderung für Unternehmen.
Rund um die Welt sprießen die Hoffnungen aufs schnelle Geschäft in Bagdad. Obwohl die letzten Bomben noch nicht gefallen und die Toten nicht begraben sind, schnüren auf den Philippinen die Wanderarbeiter bereits ihr Säckchen. Kaum jemand arbeitet so billig in der Montage wie sie und versteht dabei noch Englisch.
In Minnesota träumen die Farmer davon, „die Freundschaft mit den irakischen Müllern zu erneuern“, so Alan Tracy, Präsident des amerikanischen Weizenverbandes. In Kuwait hoffen die Ölfachleute darauf, bald auch an den Quellen des ehemaligen Feindes bohren zu dürfen. Und in Spanien versucht die Regierung Aznar, ihren Unternehmen durch geheime Absprachen und eilfertige Reisen nach Washington einen Startvorteil zu sichern.
Doch wer wird wirklich das große Geschäft in Bagdad machen? Wer wird es bezahlen? Und wer wird das liefern, was die Iraker wirklich brauchen?
In Deutschland gibt man sich derzeit pessimistisch. „Bei der Vergabe der Aufträge wird sich deutlich bemerkbar machen, dass Deutschland die USA im Krieg nicht unterstützt hat“, fürchtet Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels. „Wenig zu bestellen“ hätten die Deutschen, glaubt auch VDMA-Hauptgeschäftsführer Hannes Hesse. Ähnliche Prognosen sind in Frankreich zu hören.
Von der Zeitung La Tribune befragt, fürchten zwei Drittel der Leser eine Benachteiligung der heimischen Wirtschaft. Viele denken wie der erstaunte Vertreter des Pariser Wirtschaftsministeriums: „Die Art, wie die Amerikaner ihre Unternehmen durchsetzen und dabei jene bevorzugen, die der Regierung nahe stehen, ist einfach atemberaubend.“ Oder sie reagieren verärgert wie Claude Schneider vom Bauunternehmen Case Poclin: „Wir waren seit 35 Jahren im Irak vertreten. Doch nun sollen alle Aufträge an die Amerikaner gehen.“
Missmut auch in Russland, bei dem dritten mächtigen Verbündeten der Friedensachse. Dort hat Nikolaj Tokarew, der Direktor der russischen Ölfirma Zaroubenjneft, seine Verträge zur Ausbeutung irakischer Ölfelder innerlich bereits abgeschrieben. Er nennt das schwarze Gold kurz „die Kriegsbeute der Amis“.
Amerikanische Kapitalisten gegen russische Ölbarone? Deutsche Bauunternehmen gegen britische Consultants?
Jahrelang predigten Ökonomen, Manager und Politiker aller Länder, dass Nationalitäten in der Weltwirtschaft keine Rolle mehr spielten, die Globalisierung die Grenzen schleife, Kapital keine Heimat kenne und frei und ungebunden nach den lukrativsten Anlagemöglichkeiten suche – zum Wohle aller. Sie hatten ihren Marx gelernt und predigten wie er, dass „nationale Einseitigkeit und Beschränktheit mehr und mehr unmöglich“ und „Produktion und Konsumption global“ gestaltet werden. Nationale Verbundenheit, patriotische Pflicht, Vorzugsbehandlung heimischer Unternehmen, all das klang altmodisch.
Auf einmal aber ist das alte Denken wieder da.
Am klarsten formuliert Richard Perle, der ungekrönte Vordenker des amerikanischen Verteidigungsministeriums, den neuen Trend. „Warum sollten die Franzosen, die nicht zum Club gehören, zum Abendessen kommen“, ätzte er, während in Bagdad noch die Bomben fielen. Doch nicht nur der nassforsche Polemiker weckt in Europa die Angst, beim Wirtschaftswunder im Land von Tausendundeiner Nacht ausgeschlossen zu werden. Genährt wird die Furcht durch Fakten, die die amerikanische Regierung längst geschaffen hat (siehe auch Seite 20).
Bislang finanzieren die Amerikaner als Einzige den Wiederaufbau in großem Maße aus eigener Tasche: Zwei Milliarden Dollar hat der US-Kongress bereitgestellt, und die gehen nun seit Tagen in kleineren oder größeren Aufträgen vor allem an amerikanische Unternehmen. Während Europas Regierungen noch debattieren, ob sie sich überhaupt am Wiederaufbau beteiligen wollen, und die Europäische Kommission hilflos die amerikanische Vergabepraxis ob ihrer „Konformität mit den Regeln der Welthandelsorganisation“ prüft, löschen die Amerikaner bereits Ölbrände, sichern Häfen und heuern Polizisten an.
Mehr als 200 Beamte aus den verschiedenen amerikanischen Ministerien hat der pensionierte US-General Jay Garner unter sich; mit ihnen soll er die Verwaltung des Iraks möglich bald wieder zum Laufen bringen: Es geht um die Haushalts- und Finanzaufsicht, den Ausbau des Autobahnnetzes, ein funktionsfähiges Zollamt, die Verteilung der Sendefrequenzen für Telefone, das Bankensystem.
Während die Amerikaner handeln, läuft dem Rest der Welt langsam die Zeit davon. Bei einer Krisensitzung mit Vertretern des französischen Wirtschaftsministeriums Anfang April warnte Jean-Marie Aouste vom Unternehmerverband Medef, dass die französische Wirtschaft viel zu spät komme. „Beim Wiederaufbau des Kosovo waren wir bereits drei, vier Monate vor dem Ende des Konfliktes am Ort.“ Und diesmal?
Auch in Tschechien, von US-Präsident George W. Bush immer zu den „Willigen“ gezählt, mahnte der Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdik mit Blick auf den Irak: „Unsere Unternehmen schaffen es nicht, den guten tschechischen Ruf angemessen zu nutzen.“
Selbst in England hoffte die Industrie bislang vergeblich, dass sich die politische und militärische Loyalität ihrer Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten auszahlt. Inzwischen erfleht das British Consultants and Construction Bureau (BCCB), eine Dachorganisation von 300 britischen Konstruktions- und Beratungsfirmen, verzweifelt von der eigenen Regierung, „Beihilfen oder Darlehen für Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu stellen, welche britische Firmen dann ausführen können, um dem irakischen Volk langfristig zu helfen“.
Vor allem in jenen Märkten, wo Standards gesetzt werden, könnte das Rennen schon bald entschieden sein.
Beispiel Telekommunikation: Der europäische GSM-Standard wird heute von mehr als 800 Millionen Telefonkunden in 193 Ländern verwendet. Marktführer beim Bau von Geräten und Netzen sind Nokia, Ericsson, Siemens und Alcatel. Doch es besteht kein Zweifel, dass die Amerikaner mit ihrem im kommenden Herbst einsatzbereiten Standard namens DCMA 2000 aufholen wollen.
In Rumänien und Polen haben amerikanische Firmen ihre Technik, die einfacher und billiger, aber auch weniger leistungsfähig ist, bereits durchgesetzt. Wenn es nach dem kalifornischen Kongress-Abgeordneten und Industrielobbyisten Darrell Issa geht, soll die US-Norm bald die derzeitige europäische Dominanz im Nahen und Mittleren Osten brechen. Obwohl die ganze Nachbarschaft des Iraks per GSM telefoniert, fordert Industriefreund Issa: „Unsere Regierung darf keine europäischen Firmen mit dem Aufbau des irakischen Netzes beauftragen.“
Kann eine Besatzungsmacht das einfach tun? Dürfen die USA Standards setzen, möglicherweise gar langfristige Verträge vergeben und die Einkünfte selbst verwalten?
Der stellvertretende UN-Generalsekretär Shashi Tharoor gibt eine klare Antwort: „Die Besatzungsmacht hat nach der Genfer Konvention kein Recht, die Ressourcen eines Landes langfristig auszubeuten.“ Die Vereinten Nationen stehen mit dieser Interpretation des Völkerrechtes nicht allein, ihr eilen Unternehmervertreter aller Herren Länder zur Seite. „Die deutsche Wirtschaft unterstützt die Politik bei ihrer Forderung, dass der Wiederaufbau unter der Koordination der Vereinten Nationen stehen soll“, sagt Michael Rogowski, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie – natürlich von der Hoffnung getrieben, dass deutsche Firmen bei einer internationalen Verwaltung eher zum Zug kommen.
In der Pariser Zentrale des Energiekonzerns TotalFinaElf pocht man noch aus einem anderen Grund auf das Völkerrecht und eine schnelle Übergabe der Verwaltung an eine irakische Führung. „Ohne repräsentative Regierung geht langfristig nichts. Solange die nicht existiert, wird keine Gesellschaft der Welt im Irak arbeiten, auch Exxon, ChevronTexaco oder Shell nicht“, sagt der Konzernsprecher Paul Florin. Man wolle daher die eigenen Verträge auch „nicht mit einem amerikanischen General, sondern mit einer neuen irakischen Regierung“ besprechen.
Tatsächlich zählt bei Großprojekten internationales Recht. So werden in der Erdölindustrie Verträge in Milliardenhöhe mit bis zu 25 Jahren Laufzeit geschlossen. Solche Summen könne man nur investieren, wenn die Stabilität eines Landes langfristig gesichert sei, sagt Florin und mutmaßt: „Keine internationale Firma wird bereit sein, unter einem vorübergehenden US-Protektorat oder auch unter einem UN-Mandat einen Vertrag zu unterzeichnen.“
Ähnlich argumentiert Alexander Görbing von der Walter-Bau AG, einem international aktiven Bauunternehmen. „Wir brauchen Verlässlichkeit“, sagt er stellvertretend für viele Unternehmen, die Brücken, Straßen, Häfen bauen, die Förderanlagen modernisieren oder neue Ölfelder erschließen. Schließlich kann ein Investor bei Problemen nicht einfach gehen und die halbe Brücke mitnehmen.
Ob das internationale Recht tatsächlich auf dem Basar von Bagdad hilft? Vielleicht über einen Umweg: So können die Amerikaner zwar relativ unangefochten von internationalen Regeln ihr eigenes Geld im Irak durch eigene Firmen ausgeben – aber der Wiederaufbau wird sich damit kaum finanzieren lassen. 2,4 Milliarden Dollar hat Washington als Aufbauhilfe ausgewiesen – immerhin mehr als für den Balkan oder Afghanistan. Mit Sicherheit aber zu wenig Mittel für ein Land, das von Kriegen, von Diktatur und Embargo tief gezeichnet ist. Jede zusätzliche Hilfe, beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, setze aber eine völkerrechtliche Legitimation der irakischen Verwaltung voraus. „Nur auf der Basis eines neuen Mandates“, so Weltbank-Chef James Wolfensohn, könne man aktiv werden.
Die wirklich großen Summen für den Wiederaufbau sollen allerdings ganz anders erwirtschaftet werden: durch Öl.
Die Optimisten hoffen, dass schon in zwei bis drei Jahren Öl im Wert von 15 bis 20 Milliarden Dollar jährlich gefördert werden kann. Derzeit ist man davon allerdings weit entfernt, weil die Anlagen zum Teil veraltet oder verrottet und etliche durch den Krieg beschädigt sind. Allein für die Notreparaturen könnten drei Milliarden Dollar nötig sein, und auch hier hemmt die verworrene Rechtslage.
Noch verwaltet die UN mit ihrem „Oil-for-Food“ Programm die Einkünfte. Konservative US-Politiker würden die Quellen gerne privatisieren – und mit einem Teil der Erlöse die Besatzungskosten decken. Das aber würde weltweit zu einem politischen Aufschrei führen, zudem hat die Bush-Regierung den Irakern ihre Ölmilliarden versprochen.
Auf 78 Milliarden Barrel schätzt die Internationale Energieagentur die Ölreserven des Landes, von 112 Milliarden geht das angesehene Oil and Gas Journal aus. Bis dieser Reichtum allerdings dem Land zugute kommt, wird noch viel Zeit vergehen, weil es ihm schlicht an Aufnahmefähigkeit fehlt.
„Wie ist es um die irakische Wirtschaft bestellt?“, fragt das Washingtoner Council on Foreign Relations und gibt sich selbst die knappe Antwort: „Entsetzlich.“ Die wichtigsten Industrien, von der Ölförderung bis zur Textilherstellung, seien in der Hand der Regierung und ineffizient, so seine Studie The Day After. Allein der zivile Staatsapparat hält jeden fünften Beschäftigten in Arbeit und Brot, mehr als vierzig Prozent der Haushalte hängen am Tropf des Regimes, rechnete das Atlantic Council im Januar vor. Die Weltbank schätzt das Pro-Kopf-Einkommen auf 1200 Dollar, kaum ein Drittel dessen, was ein Iraker vor zwanzig Jahren nach Hause trug.
Genaueres über den Zustand der Ökonomie im Zweistromland werden westliche Fachleute frühestens in einigen Monaten wissen. „Wir haben keinerlei Vorstellung, was wir an ökonomischen Daten vorfinden werden“, sagt Weltbank-Vize Jean Louis Sarbib. Kein Wunder in einem Land voller Staatsgeheimnisse, dessen letztes Budget 1978, dessen letzte Karte von Staats wegen 1973 veröffentlicht wurden. Der Internationale Währungsfonds setzt das Einkommen noch niedriger an, irgendwo zwischen 700 und 1200 Dollar, weniger als das Durchschnittseinkommen auf dem westlichen Balkan. Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt liefert die Weltbank lieber gar nicht, der britische Economist spricht von 26 Milliarden, das Weiße Haus taxiert es auf 59 Milliarden Dollar. Die Lebenserwartung ist auf 61 Jahre gesunken, jedes fünfte Kind ist ungenügend ernährt.
Das müsste nicht sein, lässt sich aber so schnell nicht ändern: Seit den siebziger Jahren lebt der Irak vom Öl, was dazu geführt hat, dass es zu einer massiven Abwanderung in die Städte gekommen ist. Deshalb wird kaum noch die Hälfte des kultivierbaren Bodens beackert.
Wo also anfangen? „Man kann nicht alles zur selben Zeit, die Schulden tilgen, die Kriegskosten erstatten, den Wiederaufbau bezahlen, wirtschaftliche Verbesserungen bezahlen, die Demokratisierung zum Erfolg machen. Man muss sich entscheiden. Und diese Entscheidung ist nun mal politisch“, sagt Jean-François Giannesini vom Pariser Institut français du pétrole.
Das wäre ein Grund, die Iraker schon bald selbst die Wahl treffen zu lassen – auch darüber, wie sie ihre Öleinnahmen verwenden wollen. Das meint übrigens auch das Forschungsinstitut von James Baker III., dem ehemaligen Außenminister von Präsident Bush senior. Eine Studie aus seinem Haus kommt zu dem klaren Schluss: „Man sollte unterstreichen, dass die Iraker fähig sind, über die Zukunft ihrer Ölindustrie zu entscheiden.“
Bei einem aber wollen die Amerikaner auf jeden Fall auch künftig helfen: Der Krieg sei ein Werbefeldzug für die amerikanische Rüstungsindustrie gewesen, lässt sich der pensionierte amerikanische General David Daker von der Herald Tribune zitieren. Und schon bittet das Weiße Haus in Washington den Kongress um die Genehmigung, bestimmte Lieferbeschränkungen für Rüstungsgeschäfte in den befreiten Irak aufzuheben. Aus dem Feind von eben soll ein „bevorzugter Kunde“ werden.
DIE ZEIT 17 / 2003
Mitarbeit: Thomas Fischermann, John F. Jungclaussen, Michael Mönninger,
Stefanie Müller, Frank Schulte
"Mindestens zwei Jahre"
Die Besatzungszeit wird lange dauern, warnt der Wiederaufbau-Experte Frederick Barton
die zeit: Die amerikanische Regierung hat die ersten Aufträge für den Wiederaufbau des Iraks schon ausgeschrieben, bevor überhaupt Schüsse fielen. Ist das nicht etwas ungewöhnlich?
Frederick D. Barton: Ich halte das für unproblematisch. Der Großteil der Verträge rings um den Wiederaufbau ist noch gar nicht vergeben – im Augenblick geht es nur um ungefähr 1,5 Milliarden Dollar. Und es geht um amerikanisches Steuergeld, nicht um irakisches Vermögen.
zeit: Das große Geschäft kommt also erst noch – die Verwendung der Ölmilliarden des Iraks für den Löwenanteil des Wiederaufbaus, so wie es das Weiße Haus vorgesehen hat. Viele glauben, dass die Vereinigten Staaten als Besatzungsmacht schon jetzt entscheiden, wer diese Aufträge erhält.
Barton: Es wäre ein schwerer Fehler, wenn Amerika jetzt die Hände einer künftigen irakischen Regierung mit langfristigen Verträgen binden würde. Diese Frage berührt den Kern irakischer Souveränität.
zeit: Konservative amerikanische Politiker fordern, mit dem irakischen Öl solle man auch einen Teil der amerikanischen Kriegskosten finanzieren.
Barton: Das ist eine schlechte Idee. Der Irak und die siegreiche Koalition haben eigentlich die gleichen ökonomischen Interessen: Je mehr Öl der Irak fördert, desto mehr Geld kann er in seinen eigenen Wiederaufbau stecken – und desto stabiler wird die Ölversorgung für die westliche Welt. Der Irak ist reich genug, um seinen Wiederaufbau zu großen Teilen selbst zu bezahlen. Er hat das Geld und die technokratische Elite.
zeit: Wie lange wird dann die Übergangszeit der Besatzung dauern? Im Verteidigungsministerium ist von sechs Monaten die Rede.
Barton: Ich gehe von zwei Jahren aus. Und das ist optimistisch kalkuliert. Es ist klar, dass unter einem Besatzungsregime erst einmal grundlegende Dinge in Ordnung gebracht werden müssen. Das Land muss für die Bevölkerung wieder sicher sein, jedermann sollte sich auf die Straße trauen können und nicht um sein Eigentum fürchten müssen. Zunächst geht es um das Überleben der Menschen im Irak – um Unterkünfte, Wasser und Nahrungsmittel. Im nächsten Schritt kommt es auf eine funktionierende Verwaltung an und darauf, dass das Recht wieder herrscht. Erst dann ist überhaupt an eine wirtschaftliche Expansion zu denken.
Frederick D. Barton beschäftigt sich mit Nationenbildung und Flüchtlingshilfe. Er forscht am Center for International and Strategic Studies in Washington und an der Princeton University. Die Fragen stellteThomas Fischermann
White House Connection
Wie amerikanische Unternehmen ihre engen Verbindungen zur Regierung nutzen
Von Thomas Fischermann
Im frisch befreiten Irak gibt es die ersten Job-Angebote. Unter der Telefonnummer 866-258 8770 können sich arbeitslose und pensionierte Polizisten ab sofort Stellen im Besatzungsgebiet reservieren: „Wiederaufbau der Polizei, Gerichte und Gefängnisse“ steht als Aufgabe in der Stellenbeschreibung – und sicher geht es auch darum, die Plünderungen in den Straßen von Bagdad und Basra in den Griff zu bekommen.
Mitzubringen sind die amerikanische Staatsbürgerschaft, Berufserfahrung als Polizist, eine US-Fahrerlaubnis und „ausgezeichnete Gesundheit“. Der Arbeitgeber in spe weiß nämlich, worauf es ankommt. Die Firma Dyncorp aus Fort Worth in Texas schickt schon seit Jahren Aufpasser in Krisengebiete von Bosnien bis Afghanistan – 23000 Beschäftigte zählt sie weltweit, der Jahresumsatz beträgt 2,3 Milliarden Dollar.
Fragt man genauer nach, ist die Streifenarbeit im Irak aber noch keine ausgemachte Sache. Dyncorp wirbt seine Mitarbeiter im Moment noch „vorläufig“ an, für „eventuelle“ Aufträge – schließlich ist die Besatzung des Iraks derzeit noch Sache der ganz großen Weltpolitik, und vielleicht bekommen Blauhelme der Vereinten Nationen den Job. Doch große Zweifel am baldigen Einsatz im Irak hat bei Dyncorp niemand. Die Regierung hat deutlich erkennen lassen, wie sie den Irak wiederaufbauen will: in einer Rekordzeit von etwa einem Jahr und unter kräftiger Beteiligung effizienter, amerikanischer Firmen. Der Schlacht am Golf soll die Mutter aller Wiederaufbau-Arbeiten folgen – Aufträge im Wert von 30 bis 105 Milliarden Dollar könnten US-Firmen winken, schätzt die American Academy of Arts & Sciences.
Kein Wunder, dass vor dem ersten Schusswechsel am Golf in den Bürohäusern Washingtons eine andere Schlacht ausbrach. Schon Mitte Februar, einen Monat vor dem Bombardement, wurden rings um das Weiße Haus die ersten Aufträge vergeben. Natürlich heimlich und im Verborgenen, mithilfe von Beziehungen und Seilschaften. Es war die Zeit der Lobbyisten und oft dubioser Grenzgänger zwischen öffentlichem Dienst und privatem Profit.
Zum Beispiel: Richard Perle. Der Washingtoner Insider und erzkonservative „Falke“ aus dem Umkreis George W. Bushs sorgte Ende März für Schlagzeilen, als er wegen seiner Verquickungen mit der Verteidigungswirtschaft seinen Posten als Topregierungsberater und Chef des Arbeitskreises Defense Policy Board abgeben musste.
Perle hatte nebenbei die Telekomfirma Global Crossing beraten, im Vorstand eines Zulieferers des Unternehmens Bechtel gesessen (eines der Hauptbewerber um den Wiederaufbau im Irak) – und obendrein Anleger bei ihren Investitionen in Firmen rund um den Kampf gegen den Terror betreut.
Der Skandal blieb ohne größere Folgen. Perle sitzt weiter als einfaches Mitglied im Defense Policy Board. Nach Informationen der Washingtoner Antikorruptionsgruppe Center for Public Integrity haben neun weitere Mitglieder in diesem Gremium ähnliche Verbindungen zu Firmen, die sich um den Wiederaufbau am Golf bewerben.
Das prominenteste Beispiel: Dick Cheney. Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten sorgte seit seinem Amtsantritt für hochgezogene Augenbrauen in Washington. Denn er war besonders oft durch die „Drehtür“ zwischen Politik und Wirtschaft gegangen. Cheney war in den frühen neunziger Jahren Verteidigungsminister gewesen und hatte dem Houstoner Großkonzern Halliburton 1992 einen folgenreichen Auftrag erteilt: Die Firma sollte untersuchen, wie sich Routinearbeiten der Armee in Kriegsgebieten privatisieren lassen. Der Bericht blieb geheim, Cheney verließ das Pentagon, wurde Chef von Halliburton und baute das Verteidigungsgeschäft des Konzerns kräftig aus. Seit 2000 sitzt Cheney wieder in der Regierung und gilt Kritikern als Helfer eines ganzen Clubs ehemaliger Öl- und Verteidigungsindustrieller. Halliburton jedenfalls geht es weiterhin bestens. Das Unternehmen baute zuletzt das Taliban-Gefängnis in Guantánamo Bay. Cheney selbst bezieht im Jahr etwa eine Milliarde Dollar Rente von seinem ehemaligen Arbeitgeber. Er soll sehr gut mit dem pensionierten Admiral Joe Lopez befreundet sein, dem Chef-Lobbyisten von Halliburton in Washington.
So wundert es wenige Beobachter in der Hauptstadt, dass Halliburton im Irak von Beginn an neben den U. S. Marines kämpfte. Schon seit Dezember 2001 besteht ein Vertrag zwischen Halliburton und der US-Armee, logistische Unterstützung im „Kampf gegen den Terror“ zu leisten – und im aktuellen Krieg fiel zum Beispiel der Aufbau der Zeltstädte von Kuwait unter diese Regelung. Nach den ersten Bombenabwürfen wurde außerdem bekannt, dass die spezialisierte Feuerwehr-Firma Boots & Coots Mitarbeiter an den Golf entsandt hatte – ein Subunternehmen des Halliburton-Ablegers KBR.
Während Generäle berichteten, dass Saddam seine „gesamte Wirtschaft in die Luft jagen“ wolle und „praktisch alle“ Öl- und Gasanlagen des Landes vermint habe, trat der Boots-&-Coots-Chef Jerry Winchester unnötig geheimnisvoll vor die Analysten: Er erklärte, dass er „Verbesserungen unserer Einnahmen aus Löschtätigkeiten im ersten Quartal 2003“ erwarte. Der Kurs der kleinen Houstoner Firma in Finanznöten kletterte kräftig. Wer erinnerte sich nicht an das Inferno von 1991, als in Kuwait rund 700 Quellen brannten?
Inzwischen hat die Auftragsvergabe an Firmen wie Boots & Coots allerdings die ersten Gegner auf den Plan gerufen: nicht nur Wettbewerber aus Kanada, die sich aus politischen Gründen übergangen fühlen – sondern auch demokratische Abgeordnete im Kongress, die der Geheimniskrämerei der Regierung gerne ein Ende setzen würden. Der Demokrat Henry Waxman etwa fragte schon im März ungehalten beim Corps of Engineers der US-Armee an, warum es bei der Vergabe des Löschauftrages eigentlich keine öffentliche Ausschreibung gegeben habe. Was ihn besonders erboste: Die Firma KBR hatte offenbar einen so genannten „Kosten-Plus“-Vertrag erhalten. Das heißt, dass die Firma alle Kosten erstattet bekommt plus eines Zuschlags von sieben Prozent als Gewinn, wie das Waxman-Büro mitteilt. So habe sie keinerlei Anreiz zum sparsamen Wirtschaften – eine Verschwendung von Steuergeld.
Vergangene Woche legte Waxman noch einmal nach und forderte einen genaueren Blick auf die Auftragsvergabe der amerikanischen Entwicklungshilfeagentur USAid. Von der Verwaltung des Seehafens bis zum Wiederaufbau der Krankenhäuser seien deren Ausschreibungen undurchsichtig. Mehrere Demokraten im Kongress haben offiziell eine unabhängige Untersuchung jener Aufträge gefordert, die die US-Armee zurzeit fast wöchentlich vergibt: die Reparatur von Straßen und Brücken, der Ersatz zerbrochener Fenstern und Türen, der Bau von Baracken für militärisches Personal und sogar für die Beseitigung eventueller chemischer oder nuklearer Waffen im Irak.
Die ganz großen Deals freilich folgen erst noch. Der große Preis der derzeitigen Auftragsrunde sind Bauarbeiten für schätzungsweise 600 Millionen Dollar, um die nötigste Infrastruktur in Bagdad wiederaufzubauen. Halliburton sei bei diesem Auftrag aus dem Rennen, erklärte die Firma vor zwei Wochen – nachdem seit Mitte Februar die Pressegerüchte um diesen Auftrag nicht abrissen und die Kritik an der Rolle des Vizepräsidenten Cheney nicht verstummen mochte. Ob ein Zusammenhang besteht, blieb unklar, und manche Brancheninsider spekulieren, dass Halliburton sein Gebot aus politischen Gründen selbst zurückgezogen habe. Zumal es als ein wesentliches Subunternehmen des Mitbewerbers Parsons sozusagen getarnt im Rennen verblieben sei. Alles Gerüchte – offizielle Bestätigungen sind nicht zu bekommen.
Während sich die Großen der Branche in Stellung bringen, hat die kleine Löschfirma Boots & Coots aus Houston freilich eine schmerzliche Erfahrung gemacht: Trotz bester Beziehungen verspricht der Irak-Krieg keineswegs automatisch Reichtümer. Es hat nicht lange gebrannt im Irak: Bisher gab es nach Schätzungen von Ölanalysten höchstens zehn Ölfeuer im Süden des Iraks, und davon löschte die kuwaitische Feuerwehr mehr als Boots & Coots.
Der vorläufig letzte Brand verlosch am Sonntag, und der Aktienkurs von Boots & Coots ist seither um mehr als die Hälfte gesunken.
.
HELMUT SCHMIDT :
Wider die Großsprecher
Der Börsenboom hat Deutschlands Banker geblendet. Höchste Zeit, sich wieder am Vorbild des soliden Kaufmanns zu orientieren
Wenn es heute manchen deutschen Kreditinstituten nicht gut geht, so ist dies zum großen Teil ihre eigene Schuld. Sie haben zu viel in Aktien investiert. Sie haben die inzwischen zerplatzte Blase der Aktienspekulation selbst angeheizt. Sie haben sich am weltweiten merger and acquisitions-Zirkus munter beteiligt. Sie haben bei vielen Großkrediten die Situation und die Bonität des Kreditnehmers nicht sorgfältig genug geprüft. Sie haben versagt.
Viele deutsche Geldinstitute leisten sich immer noch eine viel zu teure Kostenstruktur. Im Schnitt liegt ihre Ertragsstärke ziemlich niedrig. Natürlich rangieren einige gut oberhalb des Durchschnitts – so wie die Deutsche Bank oder die Hamburger Sparkasse, die größte deutsche Sparkasse. Andere jedoch liegen weit unter dem Durchschnitt und erscheinen als gefährdet – und dies keineswegs bloß in Berlin, wo die gleichnamige Bankgesellschaft um ihre Zukunft ringt.
Vorgänge wie Schneider, Holzmann, Babcock oder Kirch erinnern mich an Favag oder an Nordwolle und an die Darmstädter und Nationalbank – noch vor Beginn der Nazi-Zeit. Josef Ackermann, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hat vor einigen Tagen dem Handelsblatt gesagt, weder von einer Liquiditätskrise noch von Unterkapitalisierung des deutschen Bankensystems könne die Rede sein, wohl aber von einer Ertragskrise, die über Jahre hinweg zu Bilanzproblemen führen könne. Ich gehe davon aus, dass der Chief Executive des größten deutschen Geldhauses für den Durchschnitt durchaus Recht hat. Aber mich bekümmern einige sehr unterdurchschnittliche Fälle! „Wir unterstützen alle Bemühungen … dass die Situation auch im schlimmsten Fall aufgefangen werden kann“, hat Josef Ackermann hinzugefügt. Es waren diese Worte, die mich sowohl an 1931 erinnert haben als auch an den Herstatt-Fall und an die seinerzeitige Schaffung des Sicherungsfonds, die ich vier Jahrzehnte später als Bundesfinanzminister miterlebt habe.
Ich will genauso wenig schwarz malen, wie Josef Ackermann das gewollt hat. Die heutige Situation ist aus mehreren Gründen mit jener von 1931 nicht vergleichbar. Sie ist auch nicht vergleichbar mit der seit Jahren bedrohlichen Situation der japanischen Finanzinstitute. Eine Mahnung aber, die sich aus jenen beiden notorischen Finanzkrisen für die Gegenwart ergibt, will ich doch aussprechen: Die Spitzen des Bankgewerbes, das Finanzministerium, die Bundesbank und die Aufsichtsbehörde müssen im engen Kontakt miteinander sein. Denn sie müssen in einem Notfall schnell und in enger Zusammenarbeit handeln. Keineswegs wäre allein der Staat gefragt. Und alle müssen notabene wissen, dass deflationistisches Handeln die generelle Lage nur noch verschlechtern würde. Zum Beispiel darf Basel II nicht zum Vorwand für ein Aushungern des mittelständischen Gewerbes werden. Genau dies aber ist in einigen deutschen Banken derzeit der Fall. Für manchen mittelständischen Kunden ist das fatal.
Weit über das Bankgewerbe hinaus können wir uns mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung seit 1996 nicht zufrieden geben. Immer noch, nun schon seit Mitte der neunziger Jahre, leiden wir unter einer Massenarbeitslosigkeit von offiziell mehr als vier Millionen Menschen. Immer noch ist die Arbeitslosigkeit im Osten doppelt so hoch wie im Westen. Deshalb brauchen die östlichen Länder einen bundesgesetzlich zu ermöglichenden weitreichenden Deregulierungsspielraum – und diesen keineswegs allein für den Arbeitsmarkt! – und außerdem eine spürbare Mehrwertsteuer-Präferenz für ostdeutsche Wertschöpfung.
In einer allgemein rezessiv gestimmten Wirtschaft, mit unklaren politischen und weltwirtschaftlichen Konsequenzen des Irak-Krieges vor Augen, mit immer noch unzureichenden Konzepten der Regierung wie ganz genauso der Opposition, in einer Lage, in der manche Bilanzen und manche Testate sich als unzuverlässig erweisen, in der viele Prognosen sich als Irrtümer herausstellen, in solcher Lage bedürfen wir dringend einer klarsichtigen Führung. Zur Führung können – und müssen! – aber auch die Vorstände der deutschen Banken hörbar und sichtbar beitragen.
Es wäre gut, wenn jetzt in der deutschen Kreditwirtschaft wieder Ruhe einkehrte. Es wäre gut, wenn jetzt alle Mitarbeiter zur Normalität des Geschäftes zurückfänden. Noch besser wäre es, wenn statt der Karrieren großsprecherischer Börsianer und Investmentbanker jetzt wieder die Solidität von gelernten und erfahrenen Bankkaufleuten zum Vorbild würde.
DIE ZEIT 16.04.2003
HELMUT SCHMIDT :
Wider die Großsprecher
Der Börsenboom hat Deutschlands Banker geblendet. Höchste Zeit, sich wieder am Vorbild des soliden Kaufmanns zu orientieren
Wenn es heute manchen deutschen Kreditinstituten nicht gut geht, so ist dies zum großen Teil ihre eigene Schuld. Sie haben zu viel in Aktien investiert. Sie haben die inzwischen zerplatzte Blase der Aktienspekulation selbst angeheizt. Sie haben sich am weltweiten merger and acquisitions-Zirkus munter beteiligt. Sie haben bei vielen Großkrediten die Situation und die Bonität des Kreditnehmers nicht sorgfältig genug geprüft. Sie haben versagt.
Viele deutsche Geldinstitute leisten sich immer noch eine viel zu teure Kostenstruktur. Im Schnitt liegt ihre Ertragsstärke ziemlich niedrig. Natürlich rangieren einige gut oberhalb des Durchschnitts – so wie die Deutsche Bank oder die Hamburger Sparkasse, die größte deutsche Sparkasse. Andere jedoch liegen weit unter dem Durchschnitt und erscheinen als gefährdet – und dies keineswegs bloß in Berlin, wo die gleichnamige Bankgesellschaft um ihre Zukunft ringt.
Vorgänge wie Schneider, Holzmann, Babcock oder Kirch erinnern mich an Favag oder an Nordwolle und an die Darmstädter und Nationalbank – noch vor Beginn der Nazi-Zeit. Josef Ackermann, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hat vor einigen Tagen dem Handelsblatt gesagt, weder von einer Liquiditätskrise noch von Unterkapitalisierung des deutschen Bankensystems könne die Rede sein, wohl aber von einer Ertragskrise, die über Jahre hinweg zu Bilanzproblemen führen könne. Ich gehe davon aus, dass der Chief Executive des größten deutschen Geldhauses für den Durchschnitt durchaus Recht hat. Aber mich bekümmern einige sehr unterdurchschnittliche Fälle! „Wir unterstützen alle Bemühungen … dass die Situation auch im schlimmsten Fall aufgefangen werden kann“, hat Josef Ackermann hinzugefügt. Es waren diese Worte, die mich sowohl an 1931 erinnert haben als auch an den Herstatt-Fall und an die seinerzeitige Schaffung des Sicherungsfonds, die ich vier Jahrzehnte später als Bundesfinanzminister miterlebt habe.
Ich will genauso wenig schwarz malen, wie Josef Ackermann das gewollt hat. Die heutige Situation ist aus mehreren Gründen mit jener von 1931 nicht vergleichbar. Sie ist auch nicht vergleichbar mit der seit Jahren bedrohlichen Situation der japanischen Finanzinstitute. Eine Mahnung aber, die sich aus jenen beiden notorischen Finanzkrisen für die Gegenwart ergibt, will ich doch aussprechen: Die Spitzen des Bankgewerbes, das Finanzministerium, die Bundesbank und die Aufsichtsbehörde müssen im engen Kontakt miteinander sein. Denn sie müssen in einem Notfall schnell und in enger Zusammenarbeit handeln. Keineswegs wäre allein der Staat gefragt. Und alle müssen notabene wissen, dass deflationistisches Handeln die generelle Lage nur noch verschlechtern würde. Zum Beispiel darf Basel II nicht zum Vorwand für ein Aushungern des mittelständischen Gewerbes werden. Genau dies aber ist in einigen deutschen Banken derzeit der Fall. Für manchen mittelständischen Kunden ist das fatal.
Weit über das Bankgewerbe hinaus können wir uns mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung seit 1996 nicht zufrieden geben. Immer noch, nun schon seit Mitte der neunziger Jahre, leiden wir unter einer Massenarbeitslosigkeit von offiziell mehr als vier Millionen Menschen. Immer noch ist die Arbeitslosigkeit im Osten doppelt so hoch wie im Westen. Deshalb brauchen die östlichen Länder einen bundesgesetzlich zu ermöglichenden weitreichenden Deregulierungsspielraum – und diesen keineswegs allein für den Arbeitsmarkt! – und außerdem eine spürbare Mehrwertsteuer-Präferenz für ostdeutsche Wertschöpfung.
In einer allgemein rezessiv gestimmten Wirtschaft, mit unklaren politischen und weltwirtschaftlichen Konsequenzen des Irak-Krieges vor Augen, mit immer noch unzureichenden Konzepten der Regierung wie ganz genauso der Opposition, in einer Lage, in der manche Bilanzen und manche Testate sich als unzuverlässig erweisen, in der viele Prognosen sich als Irrtümer herausstellen, in solcher Lage bedürfen wir dringend einer klarsichtigen Führung. Zur Führung können – und müssen! – aber auch die Vorstände der deutschen Banken hörbar und sichtbar beitragen.
Es wäre gut, wenn jetzt in der deutschen Kreditwirtschaft wieder Ruhe einkehrte. Es wäre gut, wenn jetzt alle Mitarbeiter zur Normalität des Geschäftes zurückfänden. Noch besser wäre es, wenn statt der Karrieren großsprecherischer Börsianer und Investmentbanker jetzt wieder die Solidität von gelernten und erfahrenen Bankkaufleuten zum Vorbild würde.
DIE ZEIT 16.04.2003
.
"Ich bin kein Ausbeuter"
Die Alten von heute plündern das Sozialsystem und verprassen die Renten - sagen die Jungen. Die Alten von morgen werden arm und entrechtet sein - behaupten Politiker. Sie alle irren sich. Ein Plädoyer wider den Kampf der Generationen
Von Wilfried Herz
In wenigen Jahren werde ich dazugehören: zu den Alten, die auf Kosten der Jungen leben. Dann werde ich einer derjenigen sein, die als Rentner – so die inzwischen weit verbreitete Lesart in Parlament und Medien – „überversorgt“ sind. Werde ich das honigsüße Leben einer Drohne genießen, während die emsigen Arbeitsbienen nicht mehr wissen, wie sie die üppigen Altersrenten aufbringen sollen?
Schon seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Propagandisten eines „Kriegs der Generationen“ am Werke – 1989 hat der Gießener Sozialwissenschaftler Reimer Gronemeyer den „drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten“ vorhergesagt. Mitte der neunziger Jahre säte das Autorengespann Vater Günter und Sohn Peer Ederer Zwietracht: „Eine Generation der Schmarotzer hat eine ,Vollkaskogesellschaft‘ aufgebaut, die ihre Enkel einlösen sollen.“ Und vor wenigen Monaten verteufelte Walter Wüllenweber im stern meine Generation als rücksichtslose Schmarotzer, die ihre Kinder bestehlen.
Die Debatte wird mit üblen falschen Argumenten angeheizt, und sie offenbart bei den Einpeitschern ein erschreckendes Ausmaß ökonomischer Unkenntnis. Doch die Polemik zeigt Wirkung. Jüngere fühlen sich als Opfer – fremdbestimmt von der Führungsriege der Alten in Wirtschaft und Politik und ausgeplündert von einem Sozialsystem, das Rentner und Pensionäre großzügig bedenkt, von dem sie aber selbst kaum noch etwas zu erwarten haben. 80 Prozent der unter 25-Jährigen glauben laut einer Umfrage nicht, dass sie im Alter noch eine Rente bekommen, von der sie leben können. Die Politik hat parteiübergreifend reagiert: Nicht mehr die Alten, wie bis in die achtziger Jahre hinein, gelten als schützenswerte Spezies, sondern die Jungen.
Zeit meines Berufslebens habe ich zu den Besserverdienenden gezählt, jahrzehntelang Höchstbeiträge an die Rentenversicherung gezahlt. Die Arbeit, auch viel Arbeit, hat mir immer Spaß gemacht, die Grenzen tariflicher Arbeitszeiten haben mich nie interessiert. Nun kündigt mir die Angestelltenversicherung eine Monatsrente netto – nach Abzug des Krankenversicherungsbeitrags – von 1500 Euro an. (Die Rente wäre etwas höher, wäre ich nicht von einem gesetzgeberischen Kuriosum der deutschen Einheit betroffen: Weil das Berliner Büro der ZEIT wenige Kilometer vom ehemaligen Westen in den einstigen Ostteil der Stadt umgezogen ist, bin ich seit einigen Jahren für die Rentenversicherung ein Ossi – mit einem geringeren Höchstbeitrag, aber eben auch später mit einer niedrigeren Rente.)
Ein solcher Betrag erlaubt kein Leben im Luxus, auch wenn dies mehr ist, als die meisten Ruheständler aus den Rentenkassen bekommen. Zum Glück habe ich zusätzlich fürs Alter vorgesorgt. Aber bis ich in den Ruhestand gehe, werden die Renten besteuert. Das schmälert nicht nur die Rente, sondern vor allem auch die eingeplanten Zusatzeinkünfte aus dem in Jahrzehnten zurückgelegten und durch den Börsencrash ohnehin reduzierten Sparkapital. Und bis zur Altersgrenze bleibt mir auch nicht genug Zeit, die Verluste durch die im Nachhinein geänderten Regeln auszugleichen. Nein, ich klage nicht. Aber auch für die nachfolgende Generation gibt es keinen Anlass zum Jammern.
Dass die Angstmache bei so vielen Jüngeren überhaupt verfängt, hat vor allem einen Grund: Weil Kinder ein knappes Gut geworden sind und die Alten immer länger leben, altert die Gesellschaft. Folglich müssen im Rentensystem, in dem die Berufstätigen mit ihren Beiträgen direkt die Renten bezahlen, immer weniger Berufstätige für immer mehr Ruheständler aufkommen. Schon jeder Lehrling, jeder Student kennt die furchteinflößende Kennzahl: dass in drei Jahrzehnten ein Beitragszahler einen Rentner zu versorgen hat, während heute das Verhältnis zwei zu eins ist.
Tatsächlich sind die Bevölkerungsprognosen das einzig Sichere in diesen Katastrophenszenarien. Dabei sagt die Altersstruktur nichts über den Wohlstand gegenwärtiger und künftiger Generationen aus. „Eigentlich müssten wir nach der Kopfzahltheorie verhungert sein“, schrieb der ehemalige Sozialminister Norbert Blüm (CDU), weil 1900 ein Bauer drei Konsumenten ernährt habe, heute aber auf einen Landwirt über achtzig Verbraucher kämen. In diesem Punkt hat Blüm Recht: Entscheidend ist die Produktivität.
Deshalbaber sind die so genannten Generationenbilanzen, die den Jungen eine düstere Zukunft verheißen, mehr als fragwürdig. Andererseits wecken jedoch Politiker wie früher Blüm, Jahrgang 1935, oder heute die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, Jahrgang 1966, mit ihren Versprechungen, die Rentenversicherung „zukunftsfest“ zu machen, nur Illusionen. Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft in den nächsten drei- ßig Jahren entwickeln wird. Gerade in jüngster Zeit haben doch die Wirtschaftsgelehrten ihr Unvermögen bewiesen, auch nur die Entwicklung der nächsten Monate halbwegs zuverlässig einzuschätzen. Das künftige Wachstum entscheidet aber darüber, wie groß der Kuchen sein wird, der zwischen Alt und Jung verteilt werden kann.
Wächst die deutsche Volkswirtschaft nur um bescheidene zwei Prozent im Jahresdurchschnitt – und das wäre zu wenig, um die Massenarbeitslosigkeit substanziell zu verringern –, wäre das Bruttoinlandsprodukt in gut drei Jahrzehnten immerhin real doppelt so hoch wie heute. Das sollte wirklich für ein auskömmliches Leben aller, vom Baby bis zum Greis, reichen. Vielleicht gelingt es den heute Jungen im Laufe ihres Arbeitslebens sogar, dank neuer Technologien, besserer Bildung und mehr Investitionen die Produktivität deutlich zu erhöhen. Wenn dadurch die jährliche Wachstumsrate gar auf vier Prozent im Durchschnitt stiege, würde der Kuchen in dreißig Jahren auf mehr als das Dreifache zunehmen. Immerhin wurden solche Raten in der Bundesrepublik bis in die siebziger Jahre und in den Vereinigten Staaten in den neunziger Jahren erreicht. Die Wachstumschancen und nicht die Versorgung im Alter sollten der Dauerbrenner in der innenpolitischen Debatte sein.
Wer den Jüngeren weismacht, sie seien die Armen und Entrechteten, vernachlässigt eindeutige Fakten und simpelste ökonomische Zusammenhänge. Denn jede Generation baut auf den Fundamenten auf, die ihr die Vorgänger hinterlassen. Ich neide doch nicht den Jüngeren, dass sie heute mehr verdienen, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub haben, in größeren Wohnungen wohnen als meine Generation oder die meiner Eltern. Aber die Wirtschaft ist doch jetzt weitaus produktiver als in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren, weil die Senioren von heute in ihrer aktiven Zeit gespart und das Kapital investiert haben.
Ich lasse mir auch kein schlechtes Gewissen einreden, weil es mir voraussichtlich auch als Rentner besser gehen wird als den Vorvätern und -müttern. Aber vielleicht neiden viele Junge den Alten auch deren Einkommen, weil sie die Höhe der Renten überschätzen. Denn nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge aus dem Jahre 2001 stufen zwei Drittel der Frauen, aber auch ein erklecklicher Anteil unter den Männern ihren Rentenanspruch deutlich höher ein, als er tatsächlich ist.
Die Grauhaarigen, die es sich auf Kreuzfahrtschiffen und in Luxushotels unter südlicher Sonne gut gehen lassen, sind nicht diejenigen, die ausschließlich auf ihre Sozialrenten angewiesen sind. Ein „Eckrentner“, so der Fachjargon für einen Ruheständler, der 45 Jahre lang exakt das Durchschnittseinkommen verdient hat, bekommt im Westen eine Rente von netto 1072 und im Osten von gerade einmal 941 Euro. Altersarmut ist zum Glück selten geworden, aber mit den meisten Renten lassen sich wahrlich keine großen Sprünge machen.
Ich kann mich nur wundern, wie leicht sich Junge ins Bockshorn jagen lassen und glauben, dass sie statt privater Milliardenvermögen nur einen staatlichen Schuldenberg erben. Es gibt kein ernst zu nehmendes Anzeichen dafür, dass die unternehmungslustigen Alten ihr gesamtes Vermögen verjubeln, bevor die Erben zum Zuge kommen. Denn es ist merkwürdig: Obwohl die Altersvorsorge für die Bundesbürger das Hauptmotiv für das eigene Sparen ist, legen viele der Alten immer noch Geld auf die hohe Kante, wenn sie längst Rente beziehen.
Es ist nicht einmal die halbe ökonomische Wahrheit, wenn der SPD-Fraktionschef Franz Müntefering, Jahrgang 1940, in der Etatdebatte des Parlaments den Sparkurs der Koalition mit dem Argument begründet, sie wolle, „dass unsere Kinder und Kindeskinder von uns noch etwas anderes erben als Schuldscheine und Hypotheken“. Der Schuldenberg belastet zwar die staatlichen Budgets und die Steuerzahler, aber er schafft mit den Kreditzinsen auch Einkommen.
Das macht deutlich: Es geht nicht um einen Verteilungsstreit zwischen Alt und Jung, sondern es ist das uralte Problem der gerechten Verteilung zwischen Arm und Reich – unabhängig von der Generation. Es sind ja nicht die Bedürftigsten, die dem Staat Geld leihen. Es ist auch nicht der Nachwuchs der armen Teufel, der sich auf ein opulentes Erbe freuen kann.
Ähnliches gilt auch für die Debatte, wie die Rentenlasten zwischen Kinderlosen einerseits und Vätern und Müttern andererseits aufgeteilt werden sollen. Sollen diejenigen, die keine Kinder aufziehen (und damit keine potenziellen Beitragszahler in die Welt setzen) künftig kräftige Rentenabschläge hinnehmen, wie es der Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn, selbst Vater von drei Kindern, oder auch die kinderlose CDU-Chefin Angela Merkel vorschlagen? Jeder soll nach seiner Fasson leben, aber immerhin belastet jedes Kind in seinen ersten achtzehn Lebensjahren das Familienbudget mit insgesamt mehr als 150000 Euro. Unfair ist es jedoch, das in den letzten Jahrzehnten gestiegene Armutsrisiko von Kinderreichen gegen die inzwischen weitaus geringere Altersarmut ausspielen zu wollen.
Ausgesprochen boshaft ist das Argument, die Lastenverteilung zwischen Jung und Alt müsste sehr schnell neu geregelt werden, weil sonst der übermächtige Block der Senioren-Wähler solche Reformen verhindern werde. Die Altenteiler haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie unumgängliche Abstriche an der Altersversorgung akzeptieren. Seit Mitte der siebziger Jahre die ersten Löcher in den Rentenkassen offenkundig wurden, hat der Gesetzgeber viele Male die Rentenansprüche gekürzt, ohne dass die Alten auf die Barrikaden gegangen sind. Ohne die ganzen Eingriffe wären die Renten heute um rund die Hälfte höher. Und die aktuelle Debatte in der rot-grünen Koalition um eine Streichung der Rentenerhöhung 2004 und eine neue Rentenformel für die nächsten Jahrzehnte sind Vorboten weiterer Reduzierungen.
Selbstverständlich habe auch ich ein Interesse daran, dass die Jungen nicht überfordert werden – schließlich lebe ich bald von ihnen. Die Höhe des Rentenversicherungsbeitrags ist vor allem eine Frage nüchternen ökonomischen Kalküls, weniger der Gerechtigkeit. Die Grenze liegt dort, wo die Beiträge Arbeitsplätze vernichten und neue Beschäftigung verhindern. Gelingt es tatsächlich, der Massenarbeitslosigkeit Herr zu werden, könnten allein wegen der zusätzlichen Einzahler in die Rentenkassen die Beiträge gesenkt werden. Und die Jüngeren würden sogar doppelt profitieren, weil für sie dann auch die Arbeitslosenversicherung billiger würde.
Wenn Junge glauben, mit einer kapitalgedeckten Rentenversicherung, wie sie mit der Riester-Rente ansatzweise begonnen wurde, der vermeintlichen Demografiefalle entkommen zu können, irren sie. Die Hoffnung auf mehr Sicherheit und Rendite ist trügerisch. Solche Versicherungen, die ihr Kapital in Wertpapieren und Immobilien anlegen, können sich nicht vom Auf und Ab der Wirtschaft und der Börsen abkoppeln – spätestens mit dem Platzen der Spekulationsblase an den Aktienmärkten sollten auch diese Träume erledigt sein. Denkbar ist noch eine ganz andere Variante: dass die neue Arbeitswelt ein ganz neues Finanzierungssystem der Sozialversicherung erzwingt, und zwar über Steuern und nicht mehr durch vom Arbeitseinkommen abhängige Beiträge – erste Ansätze und Überlegungen gibt es bereits.
Doch jenseits aller Finanzierungsmodelle können die Älteren die Jungen entlasten – wenn es die Jungen zulassen. Die Senioren müssten länger arbeiten und dürften nicht – so der seit Jahrzehnten nahezu unveränderte Durchschnitt – mit sechzig in Rente gehen. Sie würden dann nicht nur länger Beiträge zahlen, sie wären zugleich auch kürzere Zeit Kostgänger der Rentenversicherung. Wer sich in seinem Berufsleben schon immer an das Wort vom lebenslangen Lernen gehalten hat, ist auch mit sechzig plus fit genug, um im Arbeitsprozess mitzuhalten. Eine generell verminderte Leistungsfähigkeit der Älteren ist, abgesehen bei harter körperlicher Arbeit, eine von Medizinern längst widerlegte Mär.
Inzwischen gehöre ich schon zu der Minderheit, die in meiner Altersgruppe noch einen festen Job hat. In der Hälfte der deutschen Unternehmen arbeitet keiner mehr, der über fünfzig ist. Ein Netto-Supermarkt, der nur über 45-Jährige einstellt und damit gute Erfahrungen gesammelt hat, signalisiert noch keine Wende. Auch nicht die Bellheims, die nach dem Ende der New-Economy-Träume vorübergehend wieder an die Chef-Schreibtische zurückgeholt wurden.
Eigentlich ist es längst eine allgemeine Erkenntnis, dass der vorzeitige Wechsel von älteren Beschäftigten in den Ruhestand für alle zu teuer ist – nicht nur für die Sozialversicherung, sondern auch für die Volkswirtschaft. Meine Erfahrung und mein Wissen, in fast vier Jahrzehnten angesammelt, beschränken sich doch keineswegs auf heute nicht mehr so bedeutsame Ereignisse – etwa wie sich in den siebziger Jahren Helmut Schmidt als Chef der SPD/FDP-Regierung vor dem Bundestag für eine Wahltäuschung der Rentner entschuldigte oder wie die Bundesregierung Anfang der achtziger Jahre den Bau von Bunkern in Saddam Husseins Bagdad mit einer staatlichen Bürgschaft absicherte. Die Hochs und Tiefs in der Wirtschaft, auch die misslungenen Versuche der Konjunkturankurbelung, eine Vielzahl von Währungskrisen und das Abstürzen großer Konzerne oder ganzer Staaten in die Misere, all die wechselnden Moden in der Wissenschaft verfolgt zu haben, das ist ein Erfahrungsschatz. Es geht nicht darum, die unbestreitbaren Leistungen der Jüngeren zu schmälern, sondern das human capital, und zwar von Alt und Jung, optimal zu nutzen.
Doch auch den Älteren, denen weitere Karrierestufen nicht mehr wichtig sind, müssen attraktive Jobs geboten werden, damit sie nicht vorzeitig auf Golfplätze, in Kleingärten oder nach Mallorca ausschwärmen. Wer eigenverantwortlich gearbeitet hat, will im Alter nicht zum Handlanger und Befehlsempfänger werden, nur um die Jüngeren in der Rentenversicherung zu entlasten.
Meine Rente ist sicher. Aber mir ist bewusst – und das muss allen künftigen und heutigen Rentnern klar sein: Wegen der Wechselfälle der Wirtschaft kann kein Sozialstaat eine absolute Höhe der Rente garantieren. Eine größere Sicherheit als die glaubwürdige Zusicherung, dass die Rentner angemessen an der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung teilhaben, konnte und kann es nie geben. Wenn ein Krieg der Generationen dieses Versprechen zerstören würde, wäre dies für alle künftigen Rentner schädlich. Auch noch in Jahrzehnten.
"Ich bin kein Ausbeuter"
Die Alten von heute plündern das Sozialsystem und verprassen die Renten - sagen die Jungen. Die Alten von morgen werden arm und entrechtet sein - behaupten Politiker. Sie alle irren sich. Ein Plädoyer wider den Kampf der Generationen
Von Wilfried Herz
In wenigen Jahren werde ich dazugehören: zu den Alten, die auf Kosten der Jungen leben. Dann werde ich einer derjenigen sein, die als Rentner – so die inzwischen weit verbreitete Lesart in Parlament und Medien – „überversorgt“ sind. Werde ich das honigsüße Leben einer Drohne genießen, während die emsigen Arbeitsbienen nicht mehr wissen, wie sie die üppigen Altersrenten aufbringen sollen?
Schon seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Propagandisten eines „Kriegs der Generationen“ am Werke – 1989 hat der Gießener Sozialwissenschaftler Reimer Gronemeyer den „drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten“ vorhergesagt. Mitte der neunziger Jahre säte das Autorengespann Vater Günter und Sohn Peer Ederer Zwietracht: „Eine Generation der Schmarotzer hat eine ,Vollkaskogesellschaft‘ aufgebaut, die ihre Enkel einlösen sollen.“ Und vor wenigen Monaten verteufelte Walter Wüllenweber im stern meine Generation als rücksichtslose Schmarotzer, die ihre Kinder bestehlen.
Die Debatte wird mit üblen falschen Argumenten angeheizt, und sie offenbart bei den Einpeitschern ein erschreckendes Ausmaß ökonomischer Unkenntnis. Doch die Polemik zeigt Wirkung. Jüngere fühlen sich als Opfer – fremdbestimmt von der Führungsriege der Alten in Wirtschaft und Politik und ausgeplündert von einem Sozialsystem, das Rentner und Pensionäre großzügig bedenkt, von dem sie aber selbst kaum noch etwas zu erwarten haben. 80 Prozent der unter 25-Jährigen glauben laut einer Umfrage nicht, dass sie im Alter noch eine Rente bekommen, von der sie leben können. Die Politik hat parteiübergreifend reagiert: Nicht mehr die Alten, wie bis in die achtziger Jahre hinein, gelten als schützenswerte Spezies, sondern die Jungen.
Zeit meines Berufslebens habe ich zu den Besserverdienenden gezählt, jahrzehntelang Höchstbeiträge an die Rentenversicherung gezahlt. Die Arbeit, auch viel Arbeit, hat mir immer Spaß gemacht, die Grenzen tariflicher Arbeitszeiten haben mich nie interessiert. Nun kündigt mir die Angestelltenversicherung eine Monatsrente netto – nach Abzug des Krankenversicherungsbeitrags – von 1500 Euro an. (Die Rente wäre etwas höher, wäre ich nicht von einem gesetzgeberischen Kuriosum der deutschen Einheit betroffen: Weil das Berliner Büro der ZEIT wenige Kilometer vom ehemaligen Westen in den einstigen Ostteil der Stadt umgezogen ist, bin ich seit einigen Jahren für die Rentenversicherung ein Ossi – mit einem geringeren Höchstbeitrag, aber eben auch später mit einer niedrigeren Rente.)
Ein solcher Betrag erlaubt kein Leben im Luxus, auch wenn dies mehr ist, als die meisten Ruheständler aus den Rentenkassen bekommen. Zum Glück habe ich zusätzlich fürs Alter vorgesorgt. Aber bis ich in den Ruhestand gehe, werden die Renten besteuert. Das schmälert nicht nur die Rente, sondern vor allem auch die eingeplanten Zusatzeinkünfte aus dem in Jahrzehnten zurückgelegten und durch den Börsencrash ohnehin reduzierten Sparkapital. Und bis zur Altersgrenze bleibt mir auch nicht genug Zeit, die Verluste durch die im Nachhinein geänderten Regeln auszugleichen. Nein, ich klage nicht. Aber auch für die nachfolgende Generation gibt es keinen Anlass zum Jammern.
Dass die Angstmache bei so vielen Jüngeren überhaupt verfängt, hat vor allem einen Grund: Weil Kinder ein knappes Gut geworden sind und die Alten immer länger leben, altert die Gesellschaft. Folglich müssen im Rentensystem, in dem die Berufstätigen mit ihren Beiträgen direkt die Renten bezahlen, immer weniger Berufstätige für immer mehr Ruheständler aufkommen. Schon jeder Lehrling, jeder Student kennt die furchteinflößende Kennzahl: dass in drei Jahrzehnten ein Beitragszahler einen Rentner zu versorgen hat, während heute das Verhältnis zwei zu eins ist.
Tatsächlich sind die Bevölkerungsprognosen das einzig Sichere in diesen Katastrophenszenarien. Dabei sagt die Altersstruktur nichts über den Wohlstand gegenwärtiger und künftiger Generationen aus. „Eigentlich müssten wir nach der Kopfzahltheorie verhungert sein“, schrieb der ehemalige Sozialminister Norbert Blüm (CDU), weil 1900 ein Bauer drei Konsumenten ernährt habe, heute aber auf einen Landwirt über achtzig Verbraucher kämen. In diesem Punkt hat Blüm Recht: Entscheidend ist die Produktivität.
Deshalbaber sind die so genannten Generationenbilanzen, die den Jungen eine düstere Zukunft verheißen, mehr als fragwürdig. Andererseits wecken jedoch Politiker wie früher Blüm, Jahrgang 1935, oder heute die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, Jahrgang 1966, mit ihren Versprechungen, die Rentenversicherung „zukunftsfest“ zu machen, nur Illusionen. Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft in den nächsten drei- ßig Jahren entwickeln wird. Gerade in jüngster Zeit haben doch die Wirtschaftsgelehrten ihr Unvermögen bewiesen, auch nur die Entwicklung der nächsten Monate halbwegs zuverlässig einzuschätzen. Das künftige Wachstum entscheidet aber darüber, wie groß der Kuchen sein wird, der zwischen Alt und Jung verteilt werden kann.
Wächst die deutsche Volkswirtschaft nur um bescheidene zwei Prozent im Jahresdurchschnitt – und das wäre zu wenig, um die Massenarbeitslosigkeit substanziell zu verringern –, wäre das Bruttoinlandsprodukt in gut drei Jahrzehnten immerhin real doppelt so hoch wie heute. Das sollte wirklich für ein auskömmliches Leben aller, vom Baby bis zum Greis, reichen. Vielleicht gelingt es den heute Jungen im Laufe ihres Arbeitslebens sogar, dank neuer Technologien, besserer Bildung und mehr Investitionen die Produktivität deutlich zu erhöhen. Wenn dadurch die jährliche Wachstumsrate gar auf vier Prozent im Durchschnitt stiege, würde der Kuchen in dreißig Jahren auf mehr als das Dreifache zunehmen. Immerhin wurden solche Raten in der Bundesrepublik bis in die siebziger Jahre und in den Vereinigten Staaten in den neunziger Jahren erreicht. Die Wachstumschancen und nicht die Versorgung im Alter sollten der Dauerbrenner in der innenpolitischen Debatte sein.
Wer den Jüngeren weismacht, sie seien die Armen und Entrechteten, vernachlässigt eindeutige Fakten und simpelste ökonomische Zusammenhänge. Denn jede Generation baut auf den Fundamenten auf, die ihr die Vorgänger hinterlassen. Ich neide doch nicht den Jüngeren, dass sie heute mehr verdienen, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub haben, in größeren Wohnungen wohnen als meine Generation oder die meiner Eltern. Aber die Wirtschaft ist doch jetzt weitaus produktiver als in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren, weil die Senioren von heute in ihrer aktiven Zeit gespart und das Kapital investiert haben.
Ich lasse mir auch kein schlechtes Gewissen einreden, weil es mir voraussichtlich auch als Rentner besser gehen wird als den Vorvätern und -müttern. Aber vielleicht neiden viele Junge den Alten auch deren Einkommen, weil sie die Höhe der Renten überschätzen. Denn nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge aus dem Jahre 2001 stufen zwei Drittel der Frauen, aber auch ein erklecklicher Anteil unter den Männern ihren Rentenanspruch deutlich höher ein, als er tatsächlich ist.
Die Grauhaarigen, die es sich auf Kreuzfahrtschiffen und in Luxushotels unter südlicher Sonne gut gehen lassen, sind nicht diejenigen, die ausschließlich auf ihre Sozialrenten angewiesen sind. Ein „Eckrentner“, so der Fachjargon für einen Ruheständler, der 45 Jahre lang exakt das Durchschnittseinkommen verdient hat, bekommt im Westen eine Rente von netto 1072 und im Osten von gerade einmal 941 Euro. Altersarmut ist zum Glück selten geworden, aber mit den meisten Renten lassen sich wahrlich keine großen Sprünge machen.
Ich kann mich nur wundern, wie leicht sich Junge ins Bockshorn jagen lassen und glauben, dass sie statt privater Milliardenvermögen nur einen staatlichen Schuldenberg erben. Es gibt kein ernst zu nehmendes Anzeichen dafür, dass die unternehmungslustigen Alten ihr gesamtes Vermögen verjubeln, bevor die Erben zum Zuge kommen. Denn es ist merkwürdig: Obwohl die Altersvorsorge für die Bundesbürger das Hauptmotiv für das eigene Sparen ist, legen viele der Alten immer noch Geld auf die hohe Kante, wenn sie längst Rente beziehen.
Es ist nicht einmal die halbe ökonomische Wahrheit, wenn der SPD-Fraktionschef Franz Müntefering, Jahrgang 1940, in der Etatdebatte des Parlaments den Sparkurs der Koalition mit dem Argument begründet, sie wolle, „dass unsere Kinder und Kindeskinder von uns noch etwas anderes erben als Schuldscheine und Hypotheken“. Der Schuldenberg belastet zwar die staatlichen Budgets und die Steuerzahler, aber er schafft mit den Kreditzinsen auch Einkommen.
Das macht deutlich: Es geht nicht um einen Verteilungsstreit zwischen Alt und Jung, sondern es ist das uralte Problem der gerechten Verteilung zwischen Arm und Reich – unabhängig von der Generation. Es sind ja nicht die Bedürftigsten, die dem Staat Geld leihen. Es ist auch nicht der Nachwuchs der armen Teufel, der sich auf ein opulentes Erbe freuen kann.
Ähnliches gilt auch für die Debatte, wie die Rentenlasten zwischen Kinderlosen einerseits und Vätern und Müttern andererseits aufgeteilt werden sollen. Sollen diejenigen, die keine Kinder aufziehen (und damit keine potenziellen Beitragszahler in die Welt setzen) künftig kräftige Rentenabschläge hinnehmen, wie es der Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn, selbst Vater von drei Kindern, oder auch die kinderlose CDU-Chefin Angela Merkel vorschlagen? Jeder soll nach seiner Fasson leben, aber immerhin belastet jedes Kind in seinen ersten achtzehn Lebensjahren das Familienbudget mit insgesamt mehr als 150000 Euro. Unfair ist es jedoch, das in den letzten Jahrzehnten gestiegene Armutsrisiko von Kinderreichen gegen die inzwischen weitaus geringere Altersarmut ausspielen zu wollen.
Ausgesprochen boshaft ist das Argument, die Lastenverteilung zwischen Jung und Alt müsste sehr schnell neu geregelt werden, weil sonst der übermächtige Block der Senioren-Wähler solche Reformen verhindern werde. Die Altenteiler haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie unumgängliche Abstriche an der Altersversorgung akzeptieren. Seit Mitte der siebziger Jahre die ersten Löcher in den Rentenkassen offenkundig wurden, hat der Gesetzgeber viele Male die Rentenansprüche gekürzt, ohne dass die Alten auf die Barrikaden gegangen sind. Ohne die ganzen Eingriffe wären die Renten heute um rund die Hälfte höher. Und die aktuelle Debatte in der rot-grünen Koalition um eine Streichung der Rentenerhöhung 2004 und eine neue Rentenformel für die nächsten Jahrzehnte sind Vorboten weiterer Reduzierungen.
Selbstverständlich habe auch ich ein Interesse daran, dass die Jungen nicht überfordert werden – schließlich lebe ich bald von ihnen. Die Höhe des Rentenversicherungsbeitrags ist vor allem eine Frage nüchternen ökonomischen Kalküls, weniger der Gerechtigkeit. Die Grenze liegt dort, wo die Beiträge Arbeitsplätze vernichten und neue Beschäftigung verhindern. Gelingt es tatsächlich, der Massenarbeitslosigkeit Herr zu werden, könnten allein wegen der zusätzlichen Einzahler in die Rentenkassen die Beiträge gesenkt werden. Und die Jüngeren würden sogar doppelt profitieren, weil für sie dann auch die Arbeitslosenversicherung billiger würde.
Wenn Junge glauben, mit einer kapitalgedeckten Rentenversicherung, wie sie mit der Riester-Rente ansatzweise begonnen wurde, der vermeintlichen Demografiefalle entkommen zu können, irren sie. Die Hoffnung auf mehr Sicherheit und Rendite ist trügerisch. Solche Versicherungen, die ihr Kapital in Wertpapieren und Immobilien anlegen, können sich nicht vom Auf und Ab der Wirtschaft und der Börsen abkoppeln – spätestens mit dem Platzen der Spekulationsblase an den Aktienmärkten sollten auch diese Träume erledigt sein. Denkbar ist noch eine ganz andere Variante: dass die neue Arbeitswelt ein ganz neues Finanzierungssystem der Sozialversicherung erzwingt, und zwar über Steuern und nicht mehr durch vom Arbeitseinkommen abhängige Beiträge – erste Ansätze und Überlegungen gibt es bereits.
Doch jenseits aller Finanzierungsmodelle können die Älteren die Jungen entlasten – wenn es die Jungen zulassen. Die Senioren müssten länger arbeiten und dürften nicht – so der seit Jahrzehnten nahezu unveränderte Durchschnitt – mit sechzig in Rente gehen. Sie würden dann nicht nur länger Beiträge zahlen, sie wären zugleich auch kürzere Zeit Kostgänger der Rentenversicherung. Wer sich in seinem Berufsleben schon immer an das Wort vom lebenslangen Lernen gehalten hat, ist auch mit sechzig plus fit genug, um im Arbeitsprozess mitzuhalten. Eine generell verminderte Leistungsfähigkeit der Älteren ist, abgesehen bei harter körperlicher Arbeit, eine von Medizinern längst widerlegte Mär.
Inzwischen gehöre ich schon zu der Minderheit, die in meiner Altersgruppe noch einen festen Job hat. In der Hälfte der deutschen Unternehmen arbeitet keiner mehr, der über fünfzig ist. Ein Netto-Supermarkt, der nur über 45-Jährige einstellt und damit gute Erfahrungen gesammelt hat, signalisiert noch keine Wende. Auch nicht die Bellheims, die nach dem Ende der New-Economy-Träume vorübergehend wieder an die Chef-Schreibtische zurückgeholt wurden.
Eigentlich ist es längst eine allgemeine Erkenntnis, dass der vorzeitige Wechsel von älteren Beschäftigten in den Ruhestand für alle zu teuer ist – nicht nur für die Sozialversicherung, sondern auch für die Volkswirtschaft. Meine Erfahrung und mein Wissen, in fast vier Jahrzehnten angesammelt, beschränken sich doch keineswegs auf heute nicht mehr so bedeutsame Ereignisse – etwa wie sich in den siebziger Jahren Helmut Schmidt als Chef der SPD/FDP-Regierung vor dem Bundestag für eine Wahltäuschung der Rentner entschuldigte oder wie die Bundesregierung Anfang der achtziger Jahre den Bau von Bunkern in Saddam Husseins Bagdad mit einer staatlichen Bürgschaft absicherte. Die Hochs und Tiefs in der Wirtschaft, auch die misslungenen Versuche der Konjunkturankurbelung, eine Vielzahl von Währungskrisen und das Abstürzen großer Konzerne oder ganzer Staaten in die Misere, all die wechselnden Moden in der Wissenschaft verfolgt zu haben, das ist ein Erfahrungsschatz. Es geht nicht darum, die unbestreitbaren Leistungen der Jüngeren zu schmälern, sondern das human capital, und zwar von Alt und Jung, optimal zu nutzen.
Doch auch den Älteren, denen weitere Karrierestufen nicht mehr wichtig sind, müssen attraktive Jobs geboten werden, damit sie nicht vorzeitig auf Golfplätze, in Kleingärten oder nach Mallorca ausschwärmen. Wer eigenverantwortlich gearbeitet hat, will im Alter nicht zum Handlanger und Befehlsempfänger werden, nur um die Jüngeren in der Rentenversicherung zu entlasten.
Meine Rente ist sicher. Aber mir ist bewusst – und das muss allen künftigen und heutigen Rentnern klar sein: Wegen der Wechselfälle der Wirtschaft kann kein Sozialstaat eine absolute Höhe der Rente garantieren. Eine größere Sicherheit als die glaubwürdige Zusicherung, dass die Rentner angemessen an der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung teilhaben, konnte und kann es nie geben. Wenn ein Krieg der Generationen dieses Versprechen zerstören würde, wäre dies für alle künftigen Rentner schädlich. Auch noch in Jahrzehnten.
@355
@Konradi
Artikel zum Öl sind wichtig
da haben die heute gebracht dass Lukoil und
noch einige Russische Ölkonzerne
Eigentumsrechte auf irakische Ölqullen anmelden.
Jetzt geht der Streit ums Öl erst richtig los.
@Konradi
Artikel zum Öl sind wichtig
da haben die heute gebracht dass Lukoil und
noch einige Russische Ölkonzerne
Eigentumsrechte auf irakische Ölqullen anmelden.
Jetzt geht der Streit ums Öl erst richtig los.
.
Hier der aktuelle "Ostergruß" von Nabil Khayat.
– Der Mann hat eine wirklich erfrischende und schörkellose Art, seine Meinung kund zu tun. Respekt !
Khayats Marktkommentare Kann man zwar auch an anderer Stelle nachlesen,
dieser hier aber gehört irgendwie in das Archiv eines jeden "bekennenden Goldbug"
Keine Rezession dank Irakkrieg?
Nun, meine Damen und Herren,
die Gretchenfrage des Jahres lautet: "Werden wir in eine Rezession schlittern oder nicht? Wer diese Frage beantworten kann, der kennt wohl auch den mittelfristigen Trend der Aktienmärkte. Wusstet Ihr, dass die Aktienmärkte erfahrungsgemäß ihren Boden bilden, wenn die Rezession zu sehen ist? Per Definition sprechen wir von einer Rezession, wenn wir zwei negative Quartale in Folge zählen können.
Wann können wir frühestens...
...zwei negative Quartale in Folge zählen? Ich würde sagen im Oktober, wenn wir die Zahlen für das dritte Quartal auf den Tisch bekommen. Angenommen das zweite Quartal wird negativ, dann würde ein negatives drittes Quartal die Rezession sichtbar machen, was eben im Oktober dieses Jahres wäre. Es gibt jedoch genügend Anhänger der Theorie, dass wir keine Rezession mehr sehen werden, da wir dank Irakkrieg und niedriger Zinsen unmittelbar vor einem Aufschwung stehen.
Erfüllen wir denn die Voraussetzungen...
...für einen Aufschwung in der USA? Was ist Aufschwung überhaupt und wer finanziert solche Veranstaltungen? Blicken wir nach Amerika, können wir feststellen, dass Aufschwung zu 2/3 etwas mit dem Konsumentenverhalten zu tun hat. Wenn der Amerikaner mehr ausgibt als im Vorjahr, dann klappt es auch mit dem Aufschwung. Nun gibt es zwei Gründe, weshalb der Amerikaner mehr ausgeben kann. Entweder er verdient mehr, oder er geht an seine Ersparnisse ran.
Was ersteres angeht...
...ist zu sagen, dass der amerikanische Konsument nicht in einer Zeit enormer Lohnsteigerungen lebt. Die Arbeitsmarktsituation ist sehr angespannt und der Arbeitgeber schafft mehr an, als je zuvor. Wir zählen 5,8 % Arbeitslose in der USA, oder sagen wir Mal Menschen die offiziell nach Arbeit suchen. Zählt man jene dazu, die zwar keine Arbeit besitzen, aber auch keine Anstalten machen eine zu suchen, kommen wir auf 8,8 %.
Wirtschaftaufschwung kann es...
...also nur geben, wenn sich der amerikanische Konsument neu verschuldet. Jetzt haben wir jedoch das Problem, dass der amerikanische Konsument bereits eine Rekordlast an Schulden trägt. Die Sparquote ist negativ und mehr als 40 % aller privaten Haushalte sind praktisch bankrott! Der Rest lebt zwar auch von Schulden, doch er hat als Gegenwert eine Immobilie im Petto, die ihn in den letzten 3 Jahren wohlhabender gemacht hat und von diesem neuen Reichtum gibt man gerne etwas aus.
Folglich sind die Hypothekenverbindlichkeiten...
...auch auf einem historisch Rekordhoch. 2002 haben die Amerikaner ihre Hypothekenverbindlichkeiten um 700 Mrd. USD gesteigert. Wow, oder? Amerika ist eben das Land der Rekorde, Rekordwachstum, Rekordschulden, Rekordkriegsgeschwindigkeit und natürlich Rekordbärenmarkt. Und wo bleibt die Rekordrezession? Die haben wir noch nicht gesehen, doch aus welchem Grund sollten wir annehmen, dass der Faden der Kausalität an jener Stelle reißen sollte, die uns am meisten Schmerz zubereiten könnte.
Sollten wir wirklich glauben,
dass wir so viel Glück haben werden. Ist es nicht so, als würde man ein Flugzeug abstürzen sehen und hoffen, dass die Schwerkraft aussetzt, damit es unversehrt bleibt? Ich frage nur, weil ich es selber nicht weiß. Ich höre viele Volkswirte sagen, dass der Irakkrieg alles richten wird. Ein niedriger Ölpreis und der Wiederaufbau des Landes werden zu einem Wirtschaftsaufschwung in Amerika führen. So die Optimisten unter den Volkswirten.
Also doch Aufschwung!
Nun ja, aber was ist mit der Tatsache, dass die Grundlage für einen nachhaltigen Aufschwung nicht gegeben ist? In den Aufschwüngen der Vergangenheit hat man immer wieder gesehen, dass sich die Privathaushalte konsolidiert haben und somit Platz für eine Neuverschuldung und den vermeintlichen Aufschwung war. Heute stehen die Zeichen von dieser Seite eher auf Rekordrezession.
Die Immobilienpreise...
...sind die Grundlage der Hypothekenverschuldung. An ihnen wird die Beleihungsgrenze festgemacht. Der US-Immobiliemarkt unterliegt einem typischen Schweinezyklus und auf eine Rekordserie an satten Jahren, stehen uns nun magere Jahre aus. Die Preise für private Wohnimmobilien sind längst aus ihrem langfristigen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen und es ist nur eine Frage von Monaten und nicht Jahren, bis die ersten Banken reagieren.
Fallen die Immobilienpreise,
so fallen auch die Beleihungsgrenzen und ist man der Ansicht, dass der Rückgang noch andauern könnte, senkt man die Beleihungsgrenze überproportional. Banken werden bald dazu gezwungen sein, Kredite zurückzufordern, wenn diese über der neuen Beleihungsgrenze liegen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer und am Ende werden sich die meisten ihre Finger verbrannt haben.
Die US-Notenbank weiß das...
...und als Reaktion darauf leugnet sie die Immobilien- & Kreditblase. Offensichtlich muss sie es leugnen, denn was uns da um die Ohren fliegt ist gut für die saftigste und schwerste Rezession seit den 30er Jahren. Eine Verzögerung dieser Rezession kann nur durch Neuverschuldung erreicht werden und dieses Verzögerungsmoment verleiht ihr immer mehr Größe. Je länger es also dauert, bis die Rezession kommt, desto größer und gewaltiger wird sie sein.
Der Irakkrieg ist in der Lage...
...einen Teil dieser Rezession aufzufangen, oder sagen wir Mal, die Rezession zu verkürzen. Die Rezession sollte dazu führen, dass sich der private Haushalt konsolidiert und das kann Jahre dauern. Im Zuge dessen wird es meines Erachtens eine Unmenge an Bankenpleiten geben und wenn wir das alles hinter uns haben, dann könnte die Stunde 0 kommen und wir könnten für einen neuen und nachhaltigen Aufschwung gerüstet sein.
Wir allen kennen wohl...
Die große Schulter-Kopf-Schulter Formation im S&P500, welche sich über die letzten 6 Jahre ausgebildet hat und mit dem Durchbruch der Nackenlinie im Jahre 2002 als abgeschlossen gilt. Diese S-K-S diktiert dem S&P500 ein Mindestkursziel von 620 Punkten. Da waren wir noch nicht. Nachdem wir durch die Nackenlinie gerauscht sind, bilden wir seit 8 Monaten ein Dreieck im SPX.
Die Nackenlinie ist bei 950 Punkten...
...und nun stellt sich die Frage, ob dieses Dreieck nach oben, oder nach unten ausbrechen wird. Wenn Sie an einen Wirtschaftsaufschwung im großen Stil glauben, sollten Sie unbedingt von einem nachhaltigen Ausbruch nach oben ausgehen, aufhören den Khayat zu lesen und sich in bekannten Aktien positionieren.
Sollten Sie jedoch...
...nicht an den Aufschwung glauben, dann tun Sie sehr gut daran, einen Ausbruch nach unten zu erwarten und sich in langfristigen Putoptionen, sog. LEAPS oder CASH zu positionieren. Ich rate von kurzen Laufzeiten in Optionen ab, da man wohl an den letzten Wochen erkennen kann, zu was das gegebenenfalls führt. Der Markt legt eben immer wieder Rallyes hin und manche erkennt man eben nicht. In diesem Fall geht die mittelfristige Tradingthese dennoch auf, wenn man sich bei der Auswahl der Optionen genügend Zeit kauft.
Ich habe mich mit den Jahren...
...daran gewöhnt, dass ich manche Moves verpasse und wie ich mit der Sache umgehe, sollte klar sein. Ich gehen davon aus, dass der SPX einen nachhaltigen Ausbruch nach unten haben wird und wir noch im laufenden Jahr frische Tiefs im SPX bilden werden. Darauf habe ich mich positioniert und je mehr wir in den oberen Bereich des Dreiecks kommen, desto stärker lehne ich mich auf die kurze Seite.
Ich kann Euch nicht verraten,
ob wir von hier aus abbrechen werden, oder an den oberen Bereich des Dreiecks bei 940 Punkten laufen werden. Ich werde das ganze vom FSI (Fondex Sentiment Indikator)und den Candlesticks abhängig machen. Sobald der FSI bei 90 ist (akt. 80 ) und ich ein Verkaufssignal auf Candlestickbasis erhalte, werde ich mich mit maximaler Kraft auf die kurze Seite lehnen.
Zu guter Letzt...
...muss jeder seinen eigenen Weg gehen und ich kann Euch nicht verspreche, dass mein Weg der richtige ist. Es ist lediglich der Weg, den ich am besten gehen kann. Der Unterschied zwischen einem Verlust und einem noch nicht eingefahrenen Gewinn ist oft nur die zeitliche Perspektive. Deshalb rate ich zu Leaps oder Endloszertifikaten mit großem Platz zur Knockoutschwelle, denn damit kann man warten, bis sich die These ausspielt!
Frohe Ostern!
Feedback an: nabil.khayat@fondex.de
Hier der aktuelle "Ostergruß" von Nabil Khayat.
– Der Mann hat eine wirklich erfrischende und schörkellose Art, seine Meinung kund zu tun. Respekt !
Khayats Marktkommentare Kann man zwar auch an anderer Stelle nachlesen,
dieser hier aber gehört irgendwie in das Archiv eines jeden "bekennenden Goldbug"

Keine Rezession dank Irakkrieg?
Nun, meine Damen und Herren,
die Gretchenfrage des Jahres lautet: "Werden wir in eine Rezession schlittern oder nicht? Wer diese Frage beantworten kann, der kennt wohl auch den mittelfristigen Trend der Aktienmärkte. Wusstet Ihr, dass die Aktienmärkte erfahrungsgemäß ihren Boden bilden, wenn die Rezession zu sehen ist? Per Definition sprechen wir von einer Rezession, wenn wir zwei negative Quartale in Folge zählen können.
Wann können wir frühestens...
...zwei negative Quartale in Folge zählen? Ich würde sagen im Oktober, wenn wir die Zahlen für das dritte Quartal auf den Tisch bekommen. Angenommen das zweite Quartal wird negativ, dann würde ein negatives drittes Quartal die Rezession sichtbar machen, was eben im Oktober dieses Jahres wäre. Es gibt jedoch genügend Anhänger der Theorie, dass wir keine Rezession mehr sehen werden, da wir dank Irakkrieg und niedriger Zinsen unmittelbar vor einem Aufschwung stehen.
Erfüllen wir denn die Voraussetzungen...
...für einen Aufschwung in der USA? Was ist Aufschwung überhaupt und wer finanziert solche Veranstaltungen? Blicken wir nach Amerika, können wir feststellen, dass Aufschwung zu 2/3 etwas mit dem Konsumentenverhalten zu tun hat. Wenn der Amerikaner mehr ausgibt als im Vorjahr, dann klappt es auch mit dem Aufschwung. Nun gibt es zwei Gründe, weshalb der Amerikaner mehr ausgeben kann. Entweder er verdient mehr, oder er geht an seine Ersparnisse ran.
Was ersteres angeht...
...ist zu sagen, dass der amerikanische Konsument nicht in einer Zeit enormer Lohnsteigerungen lebt. Die Arbeitsmarktsituation ist sehr angespannt und der Arbeitgeber schafft mehr an, als je zuvor. Wir zählen 5,8 % Arbeitslose in der USA, oder sagen wir Mal Menschen die offiziell nach Arbeit suchen. Zählt man jene dazu, die zwar keine Arbeit besitzen, aber auch keine Anstalten machen eine zu suchen, kommen wir auf 8,8 %.
Wirtschaftaufschwung kann es...
...also nur geben, wenn sich der amerikanische Konsument neu verschuldet. Jetzt haben wir jedoch das Problem, dass der amerikanische Konsument bereits eine Rekordlast an Schulden trägt. Die Sparquote ist negativ und mehr als 40 % aller privaten Haushalte sind praktisch bankrott! Der Rest lebt zwar auch von Schulden, doch er hat als Gegenwert eine Immobilie im Petto, die ihn in den letzten 3 Jahren wohlhabender gemacht hat und von diesem neuen Reichtum gibt man gerne etwas aus.
Folglich sind die Hypothekenverbindlichkeiten...
...auch auf einem historisch Rekordhoch. 2002 haben die Amerikaner ihre Hypothekenverbindlichkeiten um 700 Mrd. USD gesteigert. Wow, oder? Amerika ist eben das Land der Rekorde, Rekordwachstum, Rekordschulden, Rekordkriegsgeschwindigkeit und natürlich Rekordbärenmarkt. Und wo bleibt die Rekordrezession? Die haben wir noch nicht gesehen, doch aus welchem Grund sollten wir annehmen, dass der Faden der Kausalität an jener Stelle reißen sollte, die uns am meisten Schmerz zubereiten könnte.
Sollten wir wirklich glauben,
dass wir so viel Glück haben werden. Ist es nicht so, als würde man ein Flugzeug abstürzen sehen und hoffen, dass die Schwerkraft aussetzt, damit es unversehrt bleibt? Ich frage nur, weil ich es selber nicht weiß. Ich höre viele Volkswirte sagen, dass der Irakkrieg alles richten wird. Ein niedriger Ölpreis und der Wiederaufbau des Landes werden zu einem Wirtschaftsaufschwung in Amerika führen. So die Optimisten unter den Volkswirten.
Also doch Aufschwung!
Nun ja, aber was ist mit der Tatsache, dass die Grundlage für einen nachhaltigen Aufschwung nicht gegeben ist? In den Aufschwüngen der Vergangenheit hat man immer wieder gesehen, dass sich die Privathaushalte konsolidiert haben und somit Platz für eine Neuverschuldung und den vermeintlichen Aufschwung war. Heute stehen die Zeichen von dieser Seite eher auf Rekordrezession.
Die Immobilienpreise...
...sind die Grundlage der Hypothekenverschuldung. An ihnen wird die Beleihungsgrenze festgemacht. Der US-Immobiliemarkt unterliegt einem typischen Schweinezyklus und auf eine Rekordserie an satten Jahren, stehen uns nun magere Jahre aus. Die Preise für private Wohnimmobilien sind längst aus ihrem langfristigen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen und es ist nur eine Frage von Monaten und nicht Jahren, bis die ersten Banken reagieren.
Fallen die Immobilienpreise,
so fallen auch die Beleihungsgrenzen und ist man der Ansicht, dass der Rückgang noch andauern könnte, senkt man die Beleihungsgrenze überproportional. Banken werden bald dazu gezwungen sein, Kredite zurückzufordern, wenn diese über der neuen Beleihungsgrenze liegen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer und am Ende werden sich die meisten ihre Finger verbrannt haben.
Die US-Notenbank weiß das...
...und als Reaktion darauf leugnet sie die Immobilien- & Kreditblase. Offensichtlich muss sie es leugnen, denn was uns da um die Ohren fliegt ist gut für die saftigste und schwerste Rezession seit den 30er Jahren. Eine Verzögerung dieser Rezession kann nur durch Neuverschuldung erreicht werden und dieses Verzögerungsmoment verleiht ihr immer mehr Größe. Je länger es also dauert, bis die Rezession kommt, desto größer und gewaltiger wird sie sein.
Der Irakkrieg ist in der Lage...
...einen Teil dieser Rezession aufzufangen, oder sagen wir Mal, die Rezession zu verkürzen. Die Rezession sollte dazu führen, dass sich der private Haushalt konsolidiert und das kann Jahre dauern. Im Zuge dessen wird es meines Erachtens eine Unmenge an Bankenpleiten geben und wenn wir das alles hinter uns haben, dann könnte die Stunde 0 kommen und wir könnten für einen neuen und nachhaltigen Aufschwung gerüstet sein.
Wir allen kennen wohl...
Die große Schulter-Kopf-Schulter Formation im S&P500, welche sich über die letzten 6 Jahre ausgebildet hat und mit dem Durchbruch der Nackenlinie im Jahre 2002 als abgeschlossen gilt. Diese S-K-S diktiert dem S&P500 ein Mindestkursziel von 620 Punkten. Da waren wir noch nicht. Nachdem wir durch die Nackenlinie gerauscht sind, bilden wir seit 8 Monaten ein Dreieck im SPX.
Die Nackenlinie ist bei 950 Punkten...
...und nun stellt sich die Frage, ob dieses Dreieck nach oben, oder nach unten ausbrechen wird. Wenn Sie an einen Wirtschaftsaufschwung im großen Stil glauben, sollten Sie unbedingt von einem nachhaltigen Ausbruch nach oben ausgehen, aufhören den Khayat zu lesen und sich in bekannten Aktien positionieren.
Sollten Sie jedoch...
...nicht an den Aufschwung glauben, dann tun Sie sehr gut daran, einen Ausbruch nach unten zu erwarten und sich in langfristigen Putoptionen, sog. LEAPS oder CASH zu positionieren. Ich rate von kurzen Laufzeiten in Optionen ab, da man wohl an den letzten Wochen erkennen kann, zu was das gegebenenfalls führt. Der Markt legt eben immer wieder Rallyes hin und manche erkennt man eben nicht. In diesem Fall geht die mittelfristige Tradingthese dennoch auf, wenn man sich bei der Auswahl der Optionen genügend Zeit kauft.
Ich habe mich mit den Jahren...
...daran gewöhnt, dass ich manche Moves verpasse und wie ich mit der Sache umgehe, sollte klar sein. Ich gehen davon aus, dass der SPX einen nachhaltigen Ausbruch nach unten haben wird und wir noch im laufenden Jahr frische Tiefs im SPX bilden werden. Darauf habe ich mich positioniert und je mehr wir in den oberen Bereich des Dreiecks kommen, desto stärker lehne ich mich auf die kurze Seite.
Ich kann Euch nicht verraten,
ob wir von hier aus abbrechen werden, oder an den oberen Bereich des Dreiecks bei 940 Punkten laufen werden. Ich werde das ganze vom FSI (Fondex Sentiment Indikator)und den Candlesticks abhängig machen. Sobald der FSI bei 90 ist (akt. 80 ) und ich ein Verkaufssignal auf Candlestickbasis erhalte, werde ich mich mit maximaler Kraft auf die kurze Seite lehnen.
Zu guter Letzt...
...muss jeder seinen eigenen Weg gehen und ich kann Euch nicht verspreche, dass mein Weg der richtige ist. Es ist lediglich der Weg, den ich am besten gehen kann. Der Unterschied zwischen einem Verlust und einem noch nicht eingefahrenen Gewinn ist oft nur die zeitliche Perspektive. Deshalb rate ich zu Leaps oder Endloszertifikaten mit großem Platz zur Knockoutschwelle, denn damit kann man warten, bis sich die These ausspielt!
Frohe Ostern!
Feedback an: nabil.khayat@fondex.de
.
India gold demand booms as wedding bells toll
Demand for gold in India, the world`s biggest market, has risen sharply with the wedding
season in full swing.
"The current demand is the best I have seen in the past one year," Ranjit Rathod, a bullion trader based in the southern city of Madras, said on Monday. He said retail buying was likely to rise in the coming weeks.
Rathod said gold imports into Madras had risen to about 300 kg per day, against a normal of 150 to 175 kg. Other importing centres such as the western city of Ahmedabad also reported a rise in overseas purchases.
India imports nearly 70 per cent of its annual consumption of more than 800 tonnes, making it the world`s biggest gold market with one-fifth of the global demand.
Demand for gold jewellery that forms nearly 85 per cent of the domestic sales rises during the wedding season, which begins in January and runs through May as parents and relatives customarily gift the metal to brides for financial security.
Traders said consumers had been placing advance orders with jewellers to ensure timely deliveries due to many auspicious days for Hindu weddings in May.
"We are hoping to see a good demand till May-end, provided gold prices stay in a range of $320-$330 an ounce," said a bullion dealer with an international bank.
Spot gold was quoted at $328.50/329.50 an ounce at 0720 GMT on Monday, up from $326.35/327.75 at Tokyo`s close on Friday. It is down about 15 per cent from more than six-year highs in early February.
Domestic prices follow global trends due to the country`s heavy dependence on imports.
Jewellers had been building gold inventories, which had fallen due to poor purchases in the past three months following firm prices, traders said.
Rural demand is also expected to rise with the start of summer harvests, they said.
About 70 per cent of India`s more than a billion people live in rural farmlands and they traditionally invest in gold ornaments after harvests.
REUTERS 21.4.2003
India gold demand booms as wedding bells toll
Demand for gold in India, the world`s biggest market, has risen sharply with the wedding
season in full swing.
"The current demand is the best I have seen in the past one year," Ranjit Rathod, a bullion trader based in the southern city of Madras, said on Monday. He said retail buying was likely to rise in the coming weeks.
Rathod said gold imports into Madras had risen to about 300 kg per day, against a normal of 150 to 175 kg. Other importing centres such as the western city of Ahmedabad also reported a rise in overseas purchases.
India imports nearly 70 per cent of its annual consumption of more than 800 tonnes, making it the world`s biggest gold market with one-fifth of the global demand.
Demand for gold jewellery that forms nearly 85 per cent of the domestic sales rises during the wedding season, which begins in January and runs through May as parents and relatives customarily gift the metal to brides for financial security.
Traders said consumers had been placing advance orders with jewellers to ensure timely deliveries due to many auspicious days for Hindu weddings in May.
"We are hoping to see a good demand till May-end, provided gold prices stay in a range of $320-$330 an ounce," said a bullion dealer with an international bank.
Spot gold was quoted at $328.50/329.50 an ounce at 0720 GMT on Monday, up from $326.35/327.75 at Tokyo`s close on Friday. It is down about 15 per cent from more than six-year highs in early February.
Domestic prices follow global trends due to the country`s heavy dependence on imports.
Jewellers had been building gold inventories, which had fallen due to poor purchases in the past three months following firm prices, traders said.
Rural demand is also expected to rise with the start of summer harvests, they said.
About 70 per cent of India`s more than a billion people live in rural farmlands and they traditionally invest in gold ornaments after harvests.
REUTERS 21.4.2003
.
Kleine Randnotiz für moralisch gefestigte Gutmenschen und Amerikahasser hier im board...
Moskau hofft auf weitere glänzende Geschäfte mit den "Schurkenstaaten"
von Jens Hartmann
"Besten Dank für die kostenlose Werbung", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergei Iwanow und richtete seinen Blick gen Washington. "Zweifelsohne hat der Krieg im Irak das Hochrüsten nicht nur in Nordkorea, sondern auf der ganzen Welt angeheizt. Wir können uns, nachdem man uns auch noch illegale Waffendeals vorwarf, jedenfalls vor Anfragen nicht retten."
Russland, hinter den USA der zweitgrößte Rüstungsexporteur der Welt, hat erst im vergangenen Jahr mit Waffenverkäufen für 4,8 Milliarden Dollar einen Rekord aufgestellt. Das Gros, rund 70 Prozent, geht auf offiziellem Wege nach China und Indien.
Für russische Rüstungsproduzenten sind jedoch Staaten wie Syrien und Iran - für die USA "Schurkenstaaten" - lukrative Geschäftspartner. "Gerade in Syrien haben wir glänzende Perspektiven", sagt Michail Dmitrijew, Vorsitzender des Staatskomitees für militärische und technische Zusammenarbeit.
Tatsächlich sind 90 Prozent der syrischen Waffenarsenale made in USSR, 80 Prozent harren der Modernisierung. Die syrischen Streitkräfte zählen 315 000 Mann, gerade Offiziere wurden häufig in der Sowjetunion und Russland ausgebildet. Die Raketentechnik – Scuds verschiedener Baureihen und Frog-7 - stammen aus sowjetischer Produktion, auch wenn in den vergangenen Jahren Russland als Hoflieferant von Nordkorea abgelöst wurde. Die meisten der 4600 Panzer der Typen T-54/55, T 62M/K und T-728 wurden in Russlands Waffenschmieden im Ural gefertigt. Dasselbe gilt für Artilleriegeschütze, Anti-Panzer-Raketen Maljutka sowie Strela-Raketen. Auch die syrische Luftwaffe setzt auf sowjetisches Know-how.
Dass Syrien tatsächlich über C-Waffen verfügt, Nervengase wie Tabun und Sarin in seinen Arsenalen und Scud-Sprengköpfe mit den Giften bestückt hat, gilt unter russischen Rüstungsexperten als wahrscheinlich. Zwischen Moskau und Damaskus gibt es zudem eine Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung von Kernenergie.
Russlands Geschäfte mit dem Iran laufen ähnlich. Mit russischer Hilfe wird zum einen das Atomkraftwerk Bushera, aus US-Sicht ein Schritt zur Atombombe, errichtet. Zum anderen hat Teheran zwischen 1991 und 2001 in Russland Waffensysteme für 3,6 Milliarden Dollar geordert.
Die US-Kriegstaktik im Irak hat russischen Militärexperten zufolge zu einem Nachfrageschub nach mobilen Waffen wie von der Schulter abgefeuerten Anti-Flugzeug-Raketen und Anti-Panzer-Raketen geführt. Russische Unternehmen wie das Ingenieursbüro in Kolomna oder das Werk KBP in Tula wollen nun auf ihre Rechnung kommen. KBP lieferte bereits Ende der neunziger Jahre insgesamt 1000 Anti-Panzer-Raketen des Typs Kornet an Syrien. Die kleine Firma aus der russischen Provinz ist Washington ein Dorn im Auge, soll sie doch an den Irak diese Waffensysteme unter Bruch des Embargos geliefert haben.
Dass Russland nur auf offiziellem Wege Waffen anbietet, behauptet zwar der Kreml. Für Branchenkenner gilt es jedoch als sicher, dass russische Rüstungsfirmen Syrien als Einfallstor für Schwarzmarktlieferungen in den Nahen Osten nutzen.
Welt - 23. Apr 2003
Kleine Randnotiz für moralisch gefestigte Gutmenschen und Amerikahasser hier im board...

Moskau hofft auf weitere glänzende Geschäfte mit den "Schurkenstaaten"
von Jens Hartmann
"Besten Dank für die kostenlose Werbung", sagte Russlands Verteidigungsminister Sergei Iwanow und richtete seinen Blick gen Washington. "Zweifelsohne hat der Krieg im Irak das Hochrüsten nicht nur in Nordkorea, sondern auf der ganzen Welt angeheizt. Wir können uns, nachdem man uns auch noch illegale Waffendeals vorwarf, jedenfalls vor Anfragen nicht retten."
Russland, hinter den USA der zweitgrößte Rüstungsexporteur der Welt, hat erst im vergangenen Jahr mit Waffenverkäufen für 4,8 Milliarden Dollar einen Rekord aufgestellt. Das Gros, rund 70 Prozent, geht auf offiziellem Wege nach China und Indien.
Für russische Rüstungsproduzenten sind jedoch Staaten wie Syrien und Iran - für die USA "Schurkenstaaten" - lukrative Geschäftspartner. "Gerade in Syrien haben wir glänzende Perspektiven", sagt Michail Dmitrijew, Vorsitzender des Staatskomitees für militärische und technische Zusammenarbeit.
Tatsächlich sind 90 Prozent der syrischen Waffenarsenale made in USSR, 80 Prozent harren der Modernisierung. Die syrischen Streitkräfte zählen 315 000 Mann, gerade Offiziere wurden häufig in der Sowjetunion und Russland ausgebildet. Die Raketentechnik – Scuds verschiedener Baureihen und Frog-7 - stammen aus sowjetischer Produktion, auch wenn in den vergangenen Jahren Russland als Hoflieferant von Nordkorea abgelöst wurde. Die meisten der 4600 Panzer der Typen T-54/55, T 62M/K und T-728 wurden in Russlands Waffenschmieden im Ural gefertigt. Dasselbe gilt für Artilleriegeschütze, Anti-Panzer-Raketen Maljutka sowie Strela-Raketen. Auch die syrische Luftwaffe setzt auf sowjetisches Know-how.
Dass Syrien tatsächlich über C-Waffen verfügt, Nervengase wie Tabun und Sarin in seinen Arsenalen und Scud-Sprengköpfe mit den Giften bestückt hat, gilt unter russischen Rüstungsexperten als wahrscheinlich. Zwischen Moskau und Damaskus gibt es zudem eine Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung von Kernenergie.
Russlands Geschäfte mit dem Iran laufen ähnlich. Mit russischer Hilfe wird zum einen das Atomkraftwerk Bushera, aus US-Sicht ein Schritt zur Atombombe, errichtet. Zum anderen hat Teheran zwischen 1991 und 2001 in Russland Waffensysteme für 3,6 Milliarden Dollar geordert.
Die US-Kriegstaktik im Irak hat russischen Militärexperten zufolge zu einem Nachfrageschub nach mobilen Waffen wie von der Schulter abgefeuerten Anti-Flugzeug-Raketen und Anti-Panzer-Raketen geführt. Russische Unternehmen wie das Ingenieursbüro in Kolomna oder das Werk KBP in Tula wollen nun auf ihre Rechnung kommen. KBP lieferte bereits Ende der neunziger Jahre insgesamt 1000 Anti-Panzer-Raketen des Typs Kornet an Syrien. Die kleine Firma aus der russischen Provinz ist Washington ein Dorn im Auge, soll sie doch an den Irak diese Waffensysteme unter Bruch des Embargos geliefert haben.
Dass Russland nur auf offiziellem Wege Waffen anbietet, behauptet zwar der Kreml. Für Branchenkenner gilt es jedoch als sicher, dass russische Rüstungsfirmen Syrien als Einfallstor für Schwarzmarktlieferungen in den Nahen Osten nutzen.
Welt - 23. Apr 2003
.
... speziell und mit Gruß an @ Jeffery2
Ein Bär windet sich
von Bernd Niquet / www.instock.de
Vor einigen Wochen bin ich einmal wieder auf die Internet-Seite gekommen, für die ich lange Jahre geschrieben habe – wallstreet:online. Dort gibt es reichlich personifizierte Kolumnen. Eine von ihnen, nämlich die von Nabil Khayat, habe ich seitdem regelmäßig verfolgt. Denn Khayat ist ein eingeschworener Bär, und ich liebe den Zoo.
Schon bevor wir damals unter die 2500er Marke im Dax gefallen waren, prognostizierte er weitere deutlich tiefere Lows und lag richtig damit. Ich war erstaunt, wie sicher er sich seiner Sache war – und beobachtete fasziniert, wie jede Börsenphase ganz analog zu den Jahreszeiten ihre ganz eigenen Früchte hervorbringt: im Frühjahr die Süßkirschen, im Sommer die Erdbeeren, im Herbst die Äpfel und im Winter die Salzheringe.
An der Börse ist es völlig identisch, wie wir uns erinnern: In der Hausse gab es da plötzlich Leute, von denen vorher niemand etwas gehört hatte und die nun plötzlich völlig richtig lagen. In der Baisse sind sie dann jedoch verfault wie die Äpfel im Winter. Doch schon bringt die Börsennatur wieder neue Sprösslinge hervor: Diejenigen, die genau dann – und auch nur dann – richtig liegen, wenn es herunter geht.
So wie Khayat. Den ganzen Kursanstieg von 2200 bis 3000 Punkten hat Khayat nämlich verpasst. Und es gehört zum Interessantesten, was ich in den vergangenen Wochen gelesen habe, wie er sich windet (wie ein Salzhering im Netz des Fischers), seine Überzeugung nicht aufgeben zu müssen. Ob er letztlich Recht haben wird, weiß heute keiner. Denn im Unterschied zur Natur sind Börsenjahreszeiten im Voraus nicht berechenbar. Eines hingegen ist ganz sicher: Auch der überzeugendste Bär ist auf lange Sicht nicht mehr als ein temporäres Zeitphänomen. Er ist wie ein Salzhering, der irgendwann der Zersetzung anheim fällt.
... speziell und mit Gruß an @ Jeffery2

Ein Bär windet sich
von Bernd Niquet / www.instock.de
Vor einigen Wochen bin ich einmal wieder auf die Internet-Seite gekommen, für die ich lange Jahre geschrieben habe – wallstreet:online. Dort gibt es reichlich personifizierte Kolumnen. Eine von ihnen, nämlich die von Nabil Khayat, habe ich seitdem regelmäßig verfolgt. Denn Khayat ist ein eingeschworener Bär, und ich liebe den Zoo.
Schon bevor wir damals unter die 2500er Marke im Dax gefallen waren, prognostizierte er weitere deutlich tiefere Lows und lag richtig damit. Ich war erstaunt, wie sicher er sich seiner Sache war – und beobachtete fasziniert, wie jede Börsenphase ganz analog zu den Jahreszeiten ihre ganz eigenen Früchte hervorbringt: im Frühjahr die Süßkirschen, im Sommer die Erdbeeren, im Herbst die Äpfel und im Winter die Salzheringe.
An der Börse ist es völlig identisch, wie wir uns erinnern: In der Hausse gab es da plötzlich Leute, von denen vorher niemand etwas gehört hatte und die nun plötzlich völlig richtig lagen. In der Baisse sind sie dann jedoch verfault wie die Äpfel im Winter. Doch schon bringt die Börsennatur wieder neue Sprösslinge hervor: Diejenigen, die genau dann – und auch nur dann – richtig liegen, wenn es herunter geht.
So wie Khayat. Den ganzen Kursanstieg von 2200 bis 3000 Punkten hat Khayat nämlich verpasst. Und es gehört zum Interessantesten, was ich in den vergangenen Wochen gelesen habe, wie er sich windet (wie ein Salzhering im Netz des Fischers), seine Überzeugung nicht aufgeben zu müssen. Ob er letztlich Recht haben wird, weiß heute keiner. Denn im Unterschied zur Natur sind Börsenjahreszeiten im Voraus nicht berechenbar. Eines hingegen ist ganz sicher: Auch der überzeugendste Bär ist auf lange Sicht nicht mehr als ein temporäres Zeitphänomen. Er ist wie ein Salzhering, der irgendwann der Zersetzung anheim fällt.
.
Engelbert Hörmannsdorfer
Gold baut Kriegsprämie ab – noch lange?
Nachdem der Irak-Konflikt nun seinem Ende zugeht, baut das Krisenmetall Gold seine Kriegsprämie zusehends ab. Stellt sich die Frage: Wie lange noch? Charttechnisch auffällig, das beim aktuellen Kurs von um die 325 USD die Aufwärtstrendlinie verläuft, die bereits 2001 begann. Zusätzlich verläuft hier eine Widerstandslinie, die einigermassen Unterstützung bieten dürfte.
Das ergibt ein interessantes Szenario: Es besteht nämlich chart- und markttechnisch eine gute Chance, dass hier der jüngste Abwärtstrend ein Ende findet. Evtl. könnte sogar die Unterstützungslinie als Sprungbrett für ein neuerliches Anziehen des Goldpreises dienen. Aber dies dürfte vermutlich nicht sofort geschehen, der Kampf mit den Widerstands- und Charttechniklinie wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls Sie noch nicht in Gold investiert sind, ergibt sich hier möglicherweise eine neuerliche Einstiegschance. Denn ein begrenzter Depotanteil sollte mittel- bis langfristig in dem gelben Metall gehalten werden. Der Aufwärtstrend in diesem Segment ist unverkennbar und intakt.
Bedenken Sie: Der Wert aller Goldminen (damit auch aller ungeförderten Goldreserven) erreicht noch nicht einmal die Marke von 70 Mrd. USD. Zum Vergleich: US-Präsident George W. Bush beantragte kurz vor dem Irak-Krieg nochmals 75 Mrd. USD, die er im Konflikt verpulvern will. Bezogen auf die Inflationsentwicklung, ist der Goldpreis heute etwa nur mit zwei Dritteln seines inflationsbereinigten Durchschnittswerts der Vergangenheit bewertet.
Goldminen wiederum notieren heute auf einer Basis, die sonst im Durchschnitt bei einem Goldpreis von fast 10% unter den heutigen Notierungen gegeben war. Aus dieser Sicht ist sowohl das Gold als Metall, als auch die Gold-Aktienanlage, unterbewertet. Interessant auch: Nachdem sich der Irak-Konflikt schneller als erwartet zu erledigen scheint, ist auch die Optimistenschar für Gold deutlich kleiner geworden. Halten Sie sich bitte vor Augen: Dies ist in der Regel ein markanter Indikator für mögliche antizyklische Investments.
Lediglich der Anstieg des südafrikanischen Rand vergrätzt zumindest ein Investment in Goldaktien aus diesem Land. Prinzipiell gefällt mir hier Harmony Gold Mining (Nyse: HMY; WKN: 864439; akt. Kurs: 10,80 EUR), hier sind aber Neuengagements wegen der Wechselkursentwicklung aktuell nicht ratsam. Setzen Sie statt dessen Randgold (WKN: 725199; akt. Kurs: 14,11 EUR) auf Ihre Beobachtungsliste. Der Wert hat die Gegenbewegung schon eingeleitet, die bei Harmony noch aussteht.
Um sich von Währungsschwankungen etwas unabhängiger zu machen, offeriert seit ein paar Monaten ABN Amro sowohl auf den Kurs der Feinunze als auch auf den Amex-Gold-Bugs-Minen-Index eine währungsneutrale Quanto-Version. Das heisst: Gegen ein moderates Aufgeld wird die Euro/Dollar-Relation auf dem fiktiven Niveau von Eins zu Eins festgeschrieben. Damit werden Wechselkursschwankungen neutralisiert. Für den hiesigen Anleger stellt sich sein Engagement mithin so, als würde das Gold in Euro notiert. Emittiert wurde ein Zertifikat auf den »Amex Gold Bugs« (WKN: 664552) und eines auf das Londoner Goldfixing (WKN: 664551). Mir gefällt auf Grund der hohen internen Sicherungskosten beim Gold Bugs das direkt ins Gold investierende Produkt etwas besser. Beide werden mit einem gerade noch akzeptablen Spread von 2% zwischen Kauf- und Verkaufkurs quotiert und laufen bis zum 19.12.2005.
Ratsam ist der Wechsel zum Quanto-Gold freilich nur für Anleger, die von einer weiter anhaltenden Dollar-Schwäche ausgehen. Denn sollte der Dollar nach dem Ende der Irak-Unsicherheiten wieder Boden gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung gut machen, wird für die unbesicherten Zertifikate aus dem Nachteil der Vergangenheit schnell ein Vorteil.
Engelbert Hörmannsdorfer
Engelbert Hörmannsdorfer
Gold baut Kriegsprämie ab – noch lange?
Nachdem der Irak-Konflikt nun seinem Ende zugeht, baut das Krisenmetall Gold seine Kriegsprämie zusehends ab. Stellt sich die Frage: Wie lange noch? Charttechnisch auffällig, das beim aktuellen Kurs von um die 325 USD die Aufwärtstrendlinie verläuft, die bereits 2001 begann. Zusätzlich verläuft hier eine Widerstandslinie, die einigermassen Unterstützung bieten dürfte.
Das ergibt ein interessantes Szenario: Es besteht nämlich chart- und markttechnisch eine gute Chance, dass hier der jüngste Abwärtstrend ein Ende findet. Evtl. könnte sogar die Unterstützungslinie als Sprungbrett für ein neuerliches Anziehen des Goldpreises dienen. Aber dies dürfte vermutlich nicht sofort geschehen, der Kampf mit den Widerstands- und Charttechniklinie wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls Sie noch nicht in Gold investiert sind, ergibt sich hier möglicherweise eine neuerliche Einstiegschance. Denn ein begrenzter Depotanteil sollte mittel- bis langfristig in dem gelben Metall gehalten werden. Der Aufwärtstrend in diesem Segment ist unverkennbar und intakt.
Bedenken Sie: Der Wert aller Goldminen (damit auch aller ungeförderten Goldreserven) erreicht noch nicht einmal die Marke von 70 Mrd. USD. Zum Vergleich: US-Präsident George W. Bush beantragte kurz vor dem Irak-Krieg nochmals 75 Mrd. USD, die er im Konflikt verpulvern will. Bezogen auf die Inflationsentwicklung, ist der Goldpreis heute etwa nur mit zwei Dritteln seines inflationsbereinigten Durchschnittswerts der Vergangenheit bewertet.
Goldminen wiederum notieren heute auf einer Basis, die sonst im Durchschnitt bei einem Goldpreis von fast 10% unter den heutigen Notierungen gegeben war. Aus dieser Sicht ist sowohl das Gold als Metall, als auch die Gold-Aktienanlage, unterbewertet. Interessant auch: Nachdem sich der Irak-Konflikt schneller als erwartet zu erledigen scheint, ist auch die Optimistenschar für Gold deutlich kleiner geworden. Halten Sie sich bitte vor Augen: Dies ist in der Regel ein markanter Indikator für mögliche antizyklische Investments.
Lediglich der Anstieg des südafrikanischen Rand vergrätzt zumindest ein Investment in Goldaktien aus diesem Land. Prinzipiell gefällt mir hier Harmony Gold Mining (Nyse: HMY; WKN: 864439; akt. Kurs: 10,80 EUR), hier sind aber Neuengagements wegen der Wechselkursentwicklung aktuell nicht ratsam. Setzen Sie statt dessen Randgold (WKN: 725199; akt. Kurs: 14,11 EUR) auf Ihre Beobachtungsliste. Der Wert hat die Gegenbewegung schon eingeleitet, die bei Harmony noch aussteht.
Um sich von Währungsschwankungen etwas unabhängiger zu machen, offeriert seit ein paar Monaten ABN Amro sowohl auf den Kurs der Feinunze als auch auf den Amex-Gold-Bugs-Minen-Index eine währungsneutrale Quanto-Version. Das heisst: Gegen ein moderates Aufgeld wird die Euro/Dollar-Relation auf dem fiktiven Niveau von Eins zu Eins festgeschrieben. Damit werden Wechselkursschwankungen neutralisiert. Für den hiesigen Anleger stellt sich sein Engagement mithin so, als würde das Gold in Euro notiert. Emittiert wurde ein Zertifikat auf den »Amex Gold Bugs« (WKN: 664552) und eines auf das Londoner Goldfixing (WKN: 664551). Mir gefällt auf Grund der hohen internen Sicherungskosten beim Gold Bugs das direkt ins Gold investierende Produkt etwas besser. Beide werden mit einem gerade noch akzeptablen Spread von 2% zwischen Kauf- und Verkaufkurs quotiert und laufen bis zum 19.12.2005.
Ratsam ist der Wechsel zum Quanto-Gold freilich nur für Anleger, die von einer weiter anhaltenden Dollar-Schwäche ausgehen. Denn sollte der Dollar nach dem Ende der Irak-Unsicherheiten wieder Boden gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung gut machen, wird für die unbesicherten Zertifikate aus dem Nachteil der Vergangenheit schnell ein Vorteil.
Engelbert Hörmannsdorfer
.
Roland Leuschel
Der Dax bald über 5.000 ?
Seit dem Crash vom März 2000, als der Dax von seinem Höhepunkt von 8.100 hinabstieg, erlebten wir zwei markante Kurserholungen. Eine die im Oktober 2001 bei 3.600 begann und im März 2002 bei 5.600 endete, das waren rund 50% Kursgewinn.
Die nächste Rallye startete wiederum im Oktober 2002, damals stand der Dax bei 2.500 und erholte sich auf 3.500, das waren wieder satte 40% Gewinn.
In diesem Jahr begann die Rallye Mitte März bei 2.200 und stieg mittlerweile auf rund 2.900, das sind bisher immerhin bereits 30% Steigerung.
Gleichgeblieben sind die Kommentare der Bullen, die sofort aus ihren Löchern kriechen und, sobald die Rallye 25% bis 30% erreicht, von alten Höchstkursen träumen und den Anlegern die Wiederkehr des Nirwana-Wunderlandes der Aktien der 90er Jahre suggerieren. Nächstes Hindernis sei lediglich die 3.000er Marke, die überwunden werden muss, damit die Post weiter abgehen kann.
Der bekannte US-Vermögensverwalter, Ken Fisher, prognostiziert für Ende des Jahres einen Dax über 5.000 und einen Standard & Poors 500 über 1.200. Sein Optimismus für Amerika ist fundamental und mit soliden Argumenten begründet: Erst einmal in der Nachkriegsgeschichte ist der US-Markt im dritten und vierten Amtsjahr eines Präsidenten gefallen, und nächstes Jahr haben wir Präsidentschaftswahlen. [ ]
]
Zweites solides und « tiefgründiges » Argument besteht in der Weiterführung des Amtes als US-Notenbankchef durch Alan Greenspan. Fishers bestechendes Argument im Wortlaut : « Greenspans junge Freundin will, dass er noch eine Amtszeit dranhängt, und damit ihn Bush wieder nominiert, werde er eine sehr wirtschaftsfreundliche Geldpolitik fahren. » Das Argument des Boerse Online Redakteurs, die Bewertung der US-Aktien sei sehr hoch, wischt Fisher galant vom Tisch : « Wer glaubt, die Kurs/Gewinnverhältnisse bestimmen die Richtung an den Aktienmärkten, der irrt. »
Professor Robert Shiller scheint seinen Bestseller « Irrational Exuberance » umsonst geschrieben zu haben, aber immerhin sagte er punktgerecht den Crash vom März 2000 voraus, als er nachwies, dass die KGV des Standard & Poors mit 44 weit über dem historischen Durchschnitt von 16 lag, und deshalb die Kurse einer Korrektur bedürfen. Heute hält Shiller den amerikanischen Markt nach wie vor für stark überbewertet.
Ich bleibe bei meiner Meinung seit 2001, dass wir für rund 10 Jahre eine Börse erleben wie in den 70er Jahren, das heisst eine Seitwärtsbewegung. Ich wiederhole, wie in den 70er Jahren müssen Sie als Anleger die Kurserholungen nutzen, und nach 15 bis 20% Kurserholung die Kursgewinne glattstellen. Nach dem Motto : Die Börse ist wie eine kalte Dusche nach der Saune, schnell reinspringen und schnell wieder raus. Nur so kommen Sie auf einen grünen Zweig.
Misstrauen Sie Scharlatanen wie Professsor Fred Bergsten, Leiter des Institute for International Economics in Washington, eine der führenden Denkfabriken der USA, die behaupten, wie nach dem Kuwait-Krieg von 1991, als die Goldenen 90er Jahre begannen, kommt nach diesem Irak-Krieg wieder ein Jahrzehnt der Prosperität auf Amerika zu. Lassen Sie sich eher von dem an dieser Stelle schon öfters zitierten Nobelpreisträger Joseph Stiglitz überzeugen, der den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton beriet und Chefvolkswirt der Weltbank war :
« Die fundamentalen Probleme der US-Wirtschaft sind immens, und sie wachsen durch den Krieg noch an. George Bush und seine Regierung haben nicht nur die Haushaltsüberschüsse der Clinton-Jahre verbraucht, sie haben sie in kürzester Zeit in Defizite umgewandelt, grösser als sich irgend jemand vorstellen konnte. Ich erwarte kein Jahrzehnt des Wachstums. Das reichste Land der Welt kann sich nicht unbegrenzt beim Rest der Welt verschulden. »
Also aufgepasst : Demnächst platzt die Dollar-Blase. Fazit : Zweimal war es richtig nach 15 bis 20%iger Kurserholung seine Gewinne glattzustellen, es dürfte auch beim dritten Mal so sein. Verkaufen Sie also Ihre hier an dieser Stelle empfohlenen Allianz, Siemens, Daimler etc.
Die grosse Wende an den Aktienbörsen liegt noch in weiter Ferne, und bis dahin werden wir alle kleinere Brötchen backen müssen. Merke : Kleinere Brötchen können knuspriger sein als grosse.
Roland Leuschel
Der Dax bald über 5.000 ?
Seit dem Crash vom März 2000, als der Dax von seinem Höhepunkt von 8.100 hinabstieg, erlebten wir zwei markante Kurserholungen. Eine die im Oktober 2001 bei 3.600 begann und im März 2002 bei 5.600 endete, das waren rund 50% Kursgewinn.
Die nächste Rallye startete wiederum im Oktober 2002, damals stand der Dax bei 2.500 und erholte sich auf 3.500, das waren wieder satte 40% Gewinn.
In diesem Jahr begann die Rallye Mitte März bei 2.200 und stieg mittlerweile auf rund 2.900, das sind bisher immerhin bereits 30% Steigerung.
Gleichgeblieben sind die Kommentare der Bullen, die sofort aus ihren Löchern kriechen und, sobald die Rallye 25% bis 30% erreicht, von alten Höchstkursen träumen und den Anlegern die Wiederkehr des Nirwana-Wunderlandes der Aktien der 90er Jahre suggerieren. Nächstes Hindernis sei lediglich die 3.000er Marke, die überwunden werden muss, damit die Post weiter abgehen kann.
Der bekannte US-Vermögensverwalter, Ken Fisher, prognostiziert für Ende des Jahres einen Dax über 5.000 und einen Standard & Poors 500 über 1.200. Sein Optimismus für Amerika ist fundamental und mit soliden Argumenten begründet: Erst einmal in der Nachkriegsgeschichte ist der US-Markt im dritten und vierten Amtsjahr eines Präsidenten gefallen, und nächstes Jahr haben wir Präsidentschaftswahlen. [
 ]
]Zweites solides und « tiefgründiges » Argument besteht in der Weiterführung des Amtes als US-Notenbankchef durch Alan Greenspan. Fishers bestechendes Argument im Wortlaut : « Greenspans junge Freundin will, dass er noch eine Amtszeit dranhängt, und damit ihn Bush wieder nominiert, werde er eine sehr wirtschaftsfreundliche Geldpolitik fahren. » Das Argument des Boerse Online Redakteurs, die Bewertung der US-Aktien sei sehr hoch, wischt Fisher galant vom Tisch : « Wer glaubt, die Kurs/Gewinnverhältnisse bestimmen die Richtung an den Aktienmärkten, der irrt. »
Professor Robert Shiller scheint seinen Bestseller « Irrational Exuberance » umsonst geschrieben zu haben, aber immerhin sagte er punktgerecht den Crash vom März 2000 voraus, als er nachwies, dass die KGV des Standard & Poors mit 44 weit über dem historischen Durchschnitt von 16 lag, und deshalb die Kurse einer Korrektur bedürfen. Heute hält Shiller den amerikanischen Markt nach wie vor für stark überbewertet.
Ich bleibe bei meiner Meinung seit 2001, dass wir für rund 10 Jahre eine Börse erleben wie in den 70er Jahren, das heisst eine Seitwärtsbewegung. Ich wiederhole, wie in den 70er Jahren müssen Sie als Anleger die Kurserholungen nutzen, und nach 15 bis 20% Kurserholung die Kursgewinne glattstellen. Nach dem Motto : Die Börse ist wie eine kalte Dusche nach der Saune, schnell reinspringen und schnell wieder raus. Nur so kommen Sie auf einen grünen Zweig.
Misstrauen Sie Scharlatanen wie Professsor Fred Bergsten, Leiter des Institute for International Economics in Washington, eine der führenden Denkfabriken der USA, die behaupten, wie nach dem Kuwait-Krieg von 1991, als die Goldenen 90er Jahre begannen, kommt nach diesem Irak-Krieg wieder ein Jahrzehnt der Prosperität auf Amerika zu. Lassen Sie sich eher von dem an dieser Stelle schon öfters zitierten Nobelpreisträger Joseph Stiglitz überzeugen, der den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton beriet und Chefvolkswirt der Weltbank war :
« Die fundamentalen Probleme der US-Wirtschaft sind immens, und sie wachsen durch den Krieg noch an. George Bush und seine Regierung haben nicht nur die Haushaltsüberschüsse der Clinton-Jahre verbraucht, sie haben sie in kürzester Zeit in Defizite umgewandelt, grösser als sich irgend jemand vorstellen konnte. Ich erwarte kein Jahrzehnt des Wachstums. Das reichste Land der Welt kann sich nicht unbegrenzt beim Rest der Welt verschulden. »
Also aufgepasst : Demnächst platzt die Dollar-Blase. Fazit : Zweimal war es richtig nach 15 bis 20%iger Kurserholung seine Gewinne glattzustellen, es dürfte auch beim dritten Mal so sein. Verkaufen Sie also Ihre hier an dieser Stelle empfohlenen Allianz, Siemens, Daimler etc.
Die grosse Wende an den Aktienbörsen liegt noch in weiter Ferne, und bis dahin werden wir alle kleinere Brötchen backen müssen. Merke : Kleinere Brötchen können knuspriger sein als grosse.
.
Geld oder Leben
Wirtschaftsforscher entdecken das Glück als Maß allen Wohlstands. Nun vermessen sie weltweit die Zufriedenheit von Berufspendlern, Eheleuten oder Arbeitslosen.

Glücksfaktor Ehe (im Spielfilm "My Big Fat Greek Wedding" ):
Hebt nur das Paardasein dauerhaft das Lebensgefühl?
Den verstorbenen Gatten kann nichts ersetzen. Oder doch? Wie wäre es mit 21.000 Euro im Monat? Das sollte den Gram der Durchschnittswitwe auf lange Sicht ziemlich genau ausgleichen. Der britische Ökonom Andrew Oswald hat das ausgerechnet. Diese Summe, meint er, steigert das Wohlbefinden im gleichen Maß, wie der Tod es gesenkt hat.
So denken Statistiker. Für sie gibt es in der Gefühlswelt nur Ausschläge nach oben oder unten. Was auch immer dem Menschen geschieht, er fühlt sich hinterher entweder besser oder schlechter. Und das eine lässt sich mit dem anderen verrechnen.
Oswald konnte eine Fülle von Daten aus Umfragen auswerten. Rund 7500 Briten gaben sieben Jahre lang Auskunft über ihre Lebenszufriedenheit. Hunderte strichen in dieser Zeitspanne unverhofft Lotteriegewinne, Preisgelder, Erbschaften ein. Andere wieder verloren Teile ihres Vermögens. Oswald verfolgte, wie sich das auf die Kurve des Wohlbefindens niederschlug. Dann verglich er damit die Wirkungskraft anderer Ereignisse - von der Arbeitslosigkeit bis zum Kindersegen.
Der Forscher sucht nicht weniger als das Maß für das Glück und sein Gegenteil. Damit ist er nicht allein. Eine wachsende Schar von Ökonomen hat sich weltweit aufgemacht, die Lebenszufriedenheit der Menschen zu messen.
Vorvergangenes Wochenende kamen die Glücksforscher zu einem internationalen Kongress in Mailand zusammen. Dort zeigte sich die ganze Vielfalt der neuen Denkrichtung. Die einen untersuchen den Einfluss der Paarbindung, andere haben sich den Fluglärm auserkoren, die Inflation oder die Ungleichheit der Einkommen im Land.
Die Frage nach der Glückswirkung lässt sich jeweils ganz einfach ausdrücken: Wie viel Geld müsste man den Leuten geben (oder wegnehmen), um sie im gleichen Maß zu erfreuen (oder zu verdrießen)? Da kommen zum Ausgleich schnell große Summen zusammen. Das muss auch so sein, denn das Geld wirkt umgekehrt erstaunlich schwach aufs Wohlbefinden: Als Maß der Dinge ist es noch weniger brauchbar als gedacht.
In den reichen Ländern des Westens hat sich zum Beispiel das Einkommen pro Kopf nach dem Zweiten Weltkrieg rund verdreifacht. Dennoch zeigen sich die Leute in Umfragen bis heute nicht glücklicher als damals. Hier hat steigender Wohlstand offenbar nur noch einen Statuswert - man muss mit den Nebenmenschen mithalten.
Anders in den armen Ländern. Dort liegt die allgemeine Zufriedenheit meist niedriger als in den wohlhabenden Weltgegenden. Die Ökonomen vermuten deshalb, dass der Glückspegel steigen kann, bis die Existenz rundum gesichert ist. Dann aber wird die Kurve rasch flach.
Allerhand Lebensfragen erscheinen damit in neuem Licht: Wenn ein höheres Gehalt nicht wirklich euphorisiert, wären Kinder statt Karriere dann die bessere Wahl? Die Antwort der Glücksforschung: auch egal. Kinder bewirken gar nichts, abgesehen von einem kleinen Glücksschub nach der Geburt. "Das ist verblüffend", sagt Oswald, "aber wir finden es immer wieder bestätigt."
Die Menschen gewöhnen sich offenbar an alles, mit wenigen Ausnahmen: Lebenspartner heben dauerhaft den Glückspegel, Krankheiten senken ihn. Arbeitslosigkeit trifft die Menschen härter als alle anderen Faktoren, von schweren Erkrankungen abgesehen. Das gälte selbst dann, wenn sie den Lohn in voller Höhe fortbezahlt bekämen.

Mit all diesen Befunden möchten die Glücksforscher eine Wende in ihrem Fach anstiften. Bislang haben die meisten Ökonomen sich die Gesellschaft mit einem recht blutleeren Modell erklärt: Demnach betritt der Mensch den Markt als rationaler "Agent", kalt wie ein Automat und immer bestrebt, zu möglichst geringen Kosten seinen Nutzen zu mehren.
Ob es dem Agenten gut oder schlecht ergeht, nachdem er einen Porsche auf Kredit gekauft hat, ist in diesem Modell egal. Er hat seine Wahl getroffen, alles andere tut nichts zur Sache. Selbst wenn der Agent arbeitslos wird, ist das für Ökonomen alten Schlags nur ein Problem von Angebot und Nachfrage: Er mochte eben nicht billig genug seine Arbeitskraft verkaufen.
Dass reale Menschen aber auch - vom Geld abgesehen - inständig gern arbeiten, ist in dem altgedienten Modell gar nicht vorgesehen. Den Glücksforschern genügt es deshalb nicht mehr. Sie wollen das Lebensglück als ökonomischen Faktor in die Modelle einbauen; denn die Jagd danach ist es, sagen sie, was den fühlenden Menschen im richtigen Leben umtreibt.
Deshalb müsse sorgsam gemessen werden, so die neuen Ökonomen, ob der Glücksjäger erfolgreich war, ob er sich in falsche Hoffnungen verrannt hat oder ob ihm einfach nur eine steigende Inflation sein Dasein verleidet. Nur auf diese Weise erfahre man genau, wie sich das allgemeine Wohlbefinden steigern lasse. Und darauf läuft schließlich, wenigstens in der Theorie, die ganze Wirtschaft hinaus. Was zählt am Ende, wenn nicht das Bruttoinlandsprodukt an Lebenszufriedenheit?
Die Daten der Glücksfraktion kommen aus Umfragen, wie sie fast überall auf der Welt seit Jahrzehnten reichlich erhoben werden. Material aus 68 Ländern hat der niederländische Soziologe Ruut Veenhoven in seiner "World Database of Happiness" zusammengetragen. Die Ökonomen brauchen davon nicht viel mehr als die Auskunft, wie die Leute mit ihrem Dasein im Allgemeinen zufrieden sind (auf einer Skala von "sehr" bis "gar nicht" ).
Solche pauschalen Antworten sagen wenig über das wahre Glück. Darum geht es auch nicht. Wichtig ist nur, wie der Pegel im Lauf der Jahre schwankt, wie stark er ausschlägt, wenn die Dinge sich ändern, und welchen Einfluss etwa Beruf oder Wohnort haben. Das genügt den Forschern, um aus den Datenmassen immer mehr Befunde herauszufiltern: wie viel Zufriedenheit die Gebildeten den Ungebildeten voraushaben, die Frauen den Männern, die Jungen den Älteren. Im durchschnittlichen Lebenslauf, so viel steht bereits fest, beschreibt das Glück eine unerwartete U-Kurve: hoch am Anfang, tief zwischen 30 und 35 Jahren, wieder ansteigend bis ins hohe Alter.
Der Zürcher Ökonom Bruno Frey hat gerade den Glücksgrad der Berufspendler untersucht. Gemäß der Theorie nehmen diese Leute lange Wege in Kauf, weil sie sich dafür einen Ausgleich versprechen: den höheren Lohn in der Stadt, das schönere Haus draußen auf dem Land. Diese Rechnung geht aber, statistisch gesehen, nicht auf. Pendler sind deutlich weniger glücklich, fand Frey. Die Zeit, die sie auf dem Weg zur Arbeit vergeuden, fehlt ihnen, so scheint es, für die Produktion von Lebenszufriedenheit im Kreis der Lieben.
Freunde und Familie sind eben Güter, deren Wert sich erst im Erleben zeigt, sagt Frey: "Sie werden systematisch unterschätzt."
Wer die Wahl hat, nimmt das Geld. Zufrieden machen aber ganz andere Dinge. Zumindest in der Schweiz gehört, wie Frey ermittelte, die direkte Demokratie zu den Glücksfaktoren. Die Eidgenossen stimmen für ihr Leben gern ab, sei es übers neue Asylgesetz oder über die "Gewährung einer Hilfe an die Holzverzuckerungs-AG".
Allerdings gestatten die 26 Schweizer Kantone die Mitbestimmung in ganz unterschiedlichem Maß - und je mehr, desto besser fühlen sich offenbar die Bürger. Das kommt nicht nur daher, dass in abstimmungsfrohen Kantonen die Politiker vielleicht volksnäher entscheiden. Von diesen Segnungen profitieren ja auch die Ausländer in der Schweiz. Bei denen schwankt aber der Glückspegel kaum von Kanton zu Kanton - sie dürfen nicht abstimmen. Die häufigen Urnen-Akte scheinen also allein schon das Lebensgefühl im Gemeinwesen zu heben.
Ein Schweizer, der vom Kanton mit der schwächsten Mitbestimmung (Genf) in den mit der stärksten (Basel-Landschaft) zieht, hat demnach eine Menge Glück zu gewinnen. In Geld umgerechnet: Es bringt ihm mehr, als wenn er von der niedrigsten in die höchste Einkommensgruppe befördert würde. Das kann man glauben oder nicht.
Das Zufriedenheitsmaß hat geradezu das Zeug zu einer neuen Währung. Alles, was im Leben zählt, kann mit ihr verrechnet werden. "Alles hat seinen Preis in der Glücksökonomie", so sagt es der britische Ökonom Oswald. Wenn es nach ihm ginge, käme das Maß auch bald eifrig zum Einsatz - zum Beispiel bei Schadensersatzklagen vor Gericht. "Wir können emotionale Verluste beziffern", sagt Oswald, "etwa für einen Mann, dessen Ehefrau seit einem Unfall im Koma liegt."
Vor allem aber hat Oswald die Politik im Sinn. "Wer an die nächste Wahl denken muss", sagt er, "sollte auf die Ergebnisse der Glücksforschung achten."
Eine lustige Vorstellung: Politiker, die für jede Tat vorher am Computer Glücksertrag und Verdrusskosten kalkulieren. Der Schweizer Ökonom Frey hält davon nicht so viel. "Die Technokraten unter uns", sagt er, "finden solche Träume natürlich sehr verlockend." In Wahrheit aber sind die Chancen nicht sehr hoch, dass der Fortschritt eines Tages an einem Glücksindex, kurz Glüx, gemessen wird.
Das Hauptproblem der Glücksforschung besteht darin, dass sie angewiesen ist auf die Selbstauskunft der Befragten. Die pauschale Frage nach der Lebenszufriedenheit hat jedoch ihre Grenzen. Das sieht auch der Psychologe Daniel Kahneman aus Princeton, ein Glücksforscher, der gerade den Nobelpreis für Ökonomie gewonnen hat. "Die Leute", sagt er, "beurteilen ihr Leben oft eher danach, wie sie meinen, dass es sein sollte."
Kahneman will direkter an das Erleben heran. Deshalb lässt er seine Probanden jeweils den Verlauf des vorherigen Tages auflisten: die Fahrt zur Arbeit, das Schwimmen mit den Kindern, den Abend über der Steuererklärung. Dann bewerten sie jedes Ereignis auf einer Skala der Erfreulichkeit. Das ergibt, sagt Kahneman, eine ziemlich wirklichkeitsnahe Emotionskurve.
Ganz oben im Katalog der schönen Erlebnisse rangiert der Sex, danach kommt das Ausspannen mit Freunden und an dritter Stelle bereits das Mittagessen mit Kollegen. Am unteren Ende der Skala dagegen ist alles versammelt, was in Eile zu geschehen hat: "Jeglicher Zeitdruck", sagt Kahneman, "ist ein Genusskiller."
Singles schnitten durchweg erstaunlich gut ab: Im Tageslauf erleben sie mindestens ebenso viele frohe Stunden wie die Paarmenschen. Warum sie sich dennoch, pauschal gefragt, stets als weniger glücklich einschätzten, ist bislang ungeklärt - vielleicht aus dem Glauben heraus, dass zu einem guten Leben einfach zwei gehören.

Die Rätsel gehen der Glücksforschung so schnell nicht aus. Als Nächstes, sagt Bruno Frey, sollte man untersuchen, inwieweit rundum zufriedene Menschen anders handeln. Zahlt es sich aus, sie glücklich zu machen? Sind sie dann gesünder - und, vor allem, produktiver?
Vielleicht schließt sich ja der Wirtschaftskreislauf am Ende, und aus Glück wird wieder Kapital. Etliche Studien deuten bereits darauf hin. Nun gilt es, diesen Glückseffekt zu messen - praktische Folgen nicht ausgeschlossen. "Dann werden wir zum Beispiel sehen", sagt Frey, "was in einem Betrieb unterm Strich die Mitbestimmung bringt."
MANFRED DWORSCHAK / DER SPIEGEL 14/2003 - 31. März 2003
Zum Thema:
Neid-Experiment: Verlierer wollen Rache um jeden Preis (13.02.2002)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,182113,00.h…
Gesellschaft: Strafe muss sein (10.01.2002)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,176273,00.h…
Im Internet :
Homepage von Andrew Oswald
http://www.andrewoswald.com/
Ruut Veenhoven: World Database of Happiness
http://www.eur.nl/fsw/research/happiness/
Forschungsgruppe von Bruno Frey
http://www.iew.unizh.ch/grp/frey/
Homepage von Daniel Kahneman
http://www.princeton.edu/~psych/PsychSite/fac_kahneman.html" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.iew.unizh.ch/grp/frey/
Homepage von Daniel Kahneman
http://www.princeton.edu/~psych/PsychSite/fac_kahneman.html
Geld oder Leben
Wirtschaftsforscher entdecken das Glück als Maß allen Wohlstands. Nun vermessen sie weltweit die Zufriedenheit von Berufspendlern, Eheleuten oder Arbeitslosen.

Glücksfaktor Ehe (im Spielfilm "My Big Fat Greek Wedding" ):
Hebt nur das Paardasein dauerhaft das Lebensgefühl?
Den verstorbenen Gatten kann nichts ersetzen. Oder doch? Wie wäre es mit 21.000 Euro im Monat? Das sollte den Gram der Durchschnittswitwe auf lange Sicht ziemlich genau ausgleichen. Der britische Ökonom Andrew Oswald hat das ausgerechnet. Diese Summe, meint er, steigert das Wohlbefinden im gleichen Maß, wie der Tod es gesenkt hat.
So denken Statistiker. Für sie gibt es in der Gefühlswelt nur Ausschläge nach oben oder unten. Was auch immer dem Menschen geschieht, er fühlt sich hinterher entweder besser oder schlechter. Und das eine lässt sich mit dem anderen verrechnen.
Oswald konnte eine Fülle von Daten aus Umfragen auswerten. Rund 7500 Briten gaben sieben Jahre lang Auskunft über ihre Lebenszufriedenheit. Hunderte strichen in dieser Zeitspanne unverhofft Lotteriegewinne, Preisgelder, Erbschaften ein. Andere wieder verloren Teile ihres Vermögens. Oswald verfolgte, wie sich das auf die Kurve des Wohlbefindens niederschlug. Dann verglich er damit die Wirkungskraft anderer Ereignisse - von der Arbeitslosigkeit bis zum Kindersegen.
Der Forscher sucht nicht weniger als das Maß für das Glück und sein Gegenteil. Damit ist er nicht allein. Eine wachsende Schar von Ökonomen hat sich weltweit aufgemacht, die Lebenszufriedenheit der Menschen zu messen.
Vorvergangenes Wochenende kamen die Glücksforscher zu einem internationalen Kongress in Mailand zusammen. Dort zeigte sich die ganze Vielfalt der neuen Denkrichtung. Die einen untersuchen den Einfluss der Paarbindung, andere haben sich den Fluglärm auserkoren, die Inflation oder die Ungleichheit der Einkommen im Land.
Die Frage nach der Glückswirkung lässt sich jeweils ganz einfach ausdrücken: Wie viel Geld müsste man den Leuten geben (oder wegnehmen), um sie im gleichen Maß zu erfreuen (oder zu verdrießen)? Da kommen zum Ausgleich schnell große Summen zusammen. Das muss auch so sein, denn das Geld wirkt umgekehrt erstaunlich schwach aufs Wohlbefinden: Als Maß der Dinge ist es noch weniger brauchbar als gedacht.
In den reichen Ländern des Westens hat sich zum Beispiel das Einkommen pro Kopf nach dem Zweiten Weltkrieg rund verdreifacht. Dennoch zeigen sich die Leute in Umfragen bis heute nicht glücklicher als damals. Hier hat steigender Wohlstand offenbar nur noch einen Statuswert - man muss mit den Nebenmenschen mithalten.
Anders in den armen Ländern. Dort liegt die allgemeine Zufriedenheit meist niedriger als in den wohlhabenden Weltgegenden. Die Ökonomen vermuten deshalb, dass der Glückspegel steigen kann, bis die Existenz rundum gesichert ist. Dann aber wird die Kurve rasch flach.
Allerhand Lebensfragen erscheinen damit in neuem Licht: Wenn ein höheres Gehalt nicht wirklich euphorisiert, wären Kinder statt Karriere dann die bessere Wahl? Die Antwort der Glücksforschung: auch egal. Kinder bewirken gar nichts, abgesehen von einem kleinen Glücksschub nach der Geburt. "Das ist verblüffend", sagt Oswald, "aber wir finden es immer wieder bestätigt."
Die Menschen gewöhnen sich offenbar an alles, mit wenigen Ausnahmen: Lebenspartner heben dauerhaft den Glückspegel, Krankheiten senken ihn. Arbeitslosigkeit trifft die Menschen härter als alle anderen Faktoren, von schweren Erkrankungen abgesehen. Das gälte selbst dann, wenn sie den Lohn in voller Höhe fortbezahlt bekämen.

Mit all diesen Befunden möchten die Glücksforscher eine Wende in ihrem Fach anstiften. Bislang haben die meisten Ökonomen sich die Gesellschaft mit einem recht blutleeren Modell erklärt: Demnach betritt der Mensch den Markt als rationaler "Agent", kalt wie ein Automat und immer bestrebt, zu möglichst geringen Kosten seinen Nutzen zu mehren.
Ob es dem Agenten gut oder schlecht ergeht, nachdem er einen Porsche auf Kredit gekauft hat, ist in diesem Modell egal. Er hat seine Wahl getroffen, alles andere tut nichts zur Sache. Selbst wenn der Agent arbeitslos wird, ist das für Ökonomen alten Schlags nur ein Problem von Angebot und Nachfrage: Er mochte eben nicht billig genug seine Arbeitskraft verkaufen.
Dass reale Menschen aber auch - vom Geld abgesehen - inständig gern arbeiten, ist in dem altgedienten Modell gar nicht vorgesehen. Den Glücksforschern genügt es deshalb nicht mehr. Sie wollen das Lebensglück als ökonomischen Faktor in die Modelle einbauen; denn die Jagd danach ist es, sagen sie, was den fühlenden Menschen im richtigen Leben umtreibt.
Deshalb müsse sorgsam gemessen werden, so die neuen Ökonomen, ob der Glücksjäger erfolgreich war, ob er sich in falsche Hoffnungen verrannt hat oder ob ihm einfach nur eine steigende Inflation sein Dasein verleidet. Nur auf diese Weise erfahre man genau, wie sich das allgemeine Wohlbefinden steigern lasse. Und darauf läuft schließlich, wenigstens in der Theorie, die ganze Wirtschaft hinaus. Was zählt am Ende, wenn nicht das Bruttoinlandsprodukt an Lebenszufriedenheit?
Die Daten der Glücksfraktion kommen aus Umfragen, wie sie fast überall auf der Welt seit Jahrzehnten reichlich erhoben werden. Material aus 68 Ländern hat der niederländische Soziologe Ruut Veenhoven in seiner "World Database of Happiness" zusammengetragen. Die Ökonomen brauchen davon nicht viel mehr als die Auskunft, wie die Leute mit ihrem Dasein im Allgemeinen zufrieden sind (auf einer Skala von "sehr" bis "gar nicht" ).
Solche pauschalen Antworten sagen wenig über das wahre Glück. Darum geht es auch nicht. Wichtig ist nur, wie der Pegel im Lauf der Jahre schwankt, wie stark er ausschlägt, wenn die Dinge sich ändern, und welchen Einfluss etwa Beruf oder Wohnort haben. Das genügt den Forschern, um aus den Datenmassen immer mehr Befunde herauszufiltern: wie viel Zufriedenheit die Gebildeten den Ungebildeten voraushaben, die Frauen den Männern, die Jungen den Älteren. Im durchschnittlichen Lebenslauf, so viel steht bereits fest, beschreibt das Glück eine unerwartete U-Kurve: hoch am Anfang, tief zwischen 30 und 35 Jahren, wieder ansteigend bis ins hohe Alter.
Der Zürcher Ökonom Bruno Frey hat gerade den Glücksgrad der Berufspendler untersucht. Gemäß der Theorie nehmen diese Leute lange Wege in Kauf, weil sie sich dafür einen Ausgleich versprechen: den höheren Lohn in der Stadt, das schönere Haus draußen auf dem Land. Diese Rechnung geht aber, statistisch gesehen, nicht auf. Pendler sind deutlich weniger glücklich, fand Frey. Die Zeit, die sie auf dem Weg zur Arbeit vergeuden, fehlt ihnen, so scheint es, für die Produktion von Lebenszufriedenheit im Kreis der Lieben.
Freunde und Familie sind eben Güter, deren Wert sich erst im Erleben zeigt, sagt Frey: "Sie werden systematisch unterschätzt."
Wer die Wahl hat, nimmt das Geld. Zufrieden machen aber ganz andere Dinge. Zumindest in der Schweiz gehört, wie Frey ermittelte, die direkte Demokratie zu den Glücksfaktoren. Die Eidgenossen stimmen für ihr Leben gern ab, sei es übers neue Asylgesetz oder über die "Gewährung einer Hilfe an die Holzverzuckerungs-AG".
Allerdings gestatten die 26 Schweizer Kantone die Mitbestimmung in ganz unterschiedlichem Maß - und je mehr, desto besser fühlen sich offenbar die Bürger. Das kommt nicht nur daher, dass in abstimmungsfrohen Kantonen die Politiker vielleicht volksnäher entscheiden. Von diesen Segnungen profitieren ja auch die Ausländer in der Schweiz. Bei denen schwankt aber der Glückspegel kaum von Kanton zu Kanton - sie dürfen nicht abstimmen. Die häufigen Urnen-Akte scheinen also allein schon das Lebensgefühl im Gemeinwesen zu heben.
Ein Schweizer, der vom Kanton mit der schwächsten Mitbestimmung (Genf) in den mit der stärksten (Basel-Landschaft) zieht, hat demnach eine Menge Glück zu gewinnen. In Geld umgerechnet: Es bringt ihm mehr, als wenn er von der niedrigsten in die höchste Einkommensgruppe befördert würde. Das kann man glauben oder nicht.
Das Zufriedenheitsmaß hat geradezu das Zeug zu einer neuen Währung. Alles, was im Leben zählt, kann mit ihr verrechnet werden. "Alles hat seinen Preis in der Glücksökonomie", so sagt es der britische Ökonom Oswald. Wenn es nach ihm ginge, käme das Maß auch bald eifrig zum Einsatz - zum Beispiel bei Schadensersatzklagen vor Gericht. "Wir können emotionale Verluste beziffern", sagt Oswald, "etwa für einen Mann, dessen Ehefrau seit einem Unfall im Koma liegt."
Vor allem aber hat Oswald die Politik im Sinn. "Wer an die nächste Wahl denken muss", sagt er, "sollte auf die Ergebnisse der Glücksforschung achten."
Eine lustige Vorstellung: Politiker, die für jede Tat vorher am Computer Glücksertrag und Verdrusskosten kalkulieren. Der Schweizer Ökonom Frey hält davon nicht so viel. "Die Technokraten unter uns", sagt er, "finden solche Träume natürlich sehr verlockend." In Wahrheit aber sind die Chancen nicht sehr hoch, dass der Fortschritt eines Tages an einem Glücksindex, kurz Glüx, gemessen wird.
Das Hauptproblem der Glücksforschung besteht darin, dass sie angewiesen ist auf die Selbstauskunft der Befragten. Die pauschale Frage nach der Lebenszufriedenheit hat jedoch ihre Grenzen. Das sieht auch der Psychologe Daniel Kahneman aus Princeton, ein Glücksforscher, der gerade den Nobelpreis für Ökonomie gewonnen hat. "Die Leute", sagt er, "beurteilen ihr Leben oft eher danach, wie sie meinen, dass es sein sollte."
Kahneman will direkter an das Erleben heran. Deshalb lässt er seine Probanden jeweils den Verlauf des vorherigen Tages auflisten: die Fahrt zur Arbeit, das Schwimmen mit den Kindern, den Abend über der Steuererklärung. Dann bewerten sie jedes Ereignis auf einer Skala der Erfreulichkeit. Das ergibt, sagt Kahneman, eine ziemlich wirklichkeitsnahe Emotionskurve.
Ganz oben im Katalog der schönen Erlebnisse rangiert der Sex, danach kommt das Ausspannen mit Freunden und an dritter Stelle bereits das Mittagessen mit Kollegen. Am unteren Ende der Skala dagegen ist alles versammelt, was in Eile zu geschehen hat: "Jeglicher Zeitdruck", sagt Kahneman, "ist ein Genusskiller."
Singles schnitten durchweg erstaunlich gut ab: Im Tageslauf erleben sie mindestens ebenso viele frohe Stunden wie die Paarmenschen. Warum sie sich dennoch, pauschal gefragt, stets als weniger glücklich einschätzten, ist bislang ungeklärt - vielleicht aus dem Glauben heraus, dass zu einem guten Leben einfach zwei gehören.

Die Rätsel gehen der Glücksforschung so schnell nicht aus. Als Nächstes, sagt Bruno Frey, sollte man untersuchen, inwieweit rundum zufriedene Menschen anders handeln. Zahlt es sich aus, sie glücklich zu machen? Sind sie dann gesünder - und, vor allem, produktiver?
Vielleicht schließt sich ja der Wirtschaftskreislauf am Ende, und aus Glück wird wieder Kapital. Etliche Studien deuten bereits darauf hin. Nun gilt es, diesen Glückseffekt zu messen - praktische Folgen nicht ausgeschlossen. "Dann werden wir zum Beispiel sehen", sagt Frey, "was in einem Betrieb unterm Strich die Mitbestimmung bringt."
MANFRED DWORSCHAK / DER SPIEGEL 14/2003 - 31. März 2003
Zum Thema:
Neid-Experiment: Verlierer wollen Rache um jeden Preis (13.02.2002)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,182113,00.h…
Gesellschaft: Strafe muss sein (10.01.2002)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,176273,00.h…
Im Internet :
Homepage von Andrew Oswald
http://www.andrewoswald.com/
Ruut Veenhoven: World Database of Happiness
http://www.eur.nl/fsw/research/happiness/
Forschungsgruppe von Bruno Frey
http://www.iew.unizh.ch/grp/frey/
Homepage von Daniel Kahneman
http://www.princeton.edu/~psych/PsychSite/fac_kahneman.html" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.iew.unizh.ch/grp/frey/
Homepage von Daniel Kahneman
http://www.princeton.edu/~psych/PsychSite/fac_kahneman.html
Aktuelles vom Immobilienmarkt:
Privatkonkurse belasten die Wohnungswirtschaft
Deutschland steht die größte Insolvenzwelle der Nachkriegsgeschichte bevor. Auch private Insolvenzen nehmen drastisch zu. Im Jahre 2002 waren 30 000 Privatkonkurse zu verzeichnen, doppelt so viele wie im Vorjahr. In den letzten acht Jahren hat sich die Zahl der überschuldeten Privathaushalte auf 2,8 Mio. vervierfacht. Insgesamt lasten auf den privaten Haushalten durchschnittlich fast 40 000 Euro Schulden.
Die Wohnungswirtschaft ist von dieser Entwicklung stark betroffen. Nach Angaben des Eigentümerverbands Haus & Grund belaufen sich im Bereich der organisierten Wohnungsunternehmen die Mietaußenstände pro Jahr auf 796 Mio. Euro. Im Bereich der organisierten privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer sind Außenstände an Mietforderungen von rund 1,1 Mrd. Euro zu verzeichnen. Dies ergibt ein gesamtes Mietforderungsvolumen von rund 1,9 Mrd. Euro. Die nicht in Verbänden organisierten Vermieter sind dabei ebenso wenig berücksichtigt wie Mietausfälle infolge des wachsenden Wohnungsleerstandes. Als gesamtvolkswirtschaftlicher Schaden ergibt sich hieraus eine Summe von 247 Mio. Euro. Diese Entwicklung bringt insbesondere den privaten Vermieter in eine bedrohliche Situation. Er muss aus den Mieten Zins- und Tilgungsleistungen für kreditfinanzierte Immobilien erbringen.
Große Wohnungen sind Mangelware
In vielen deutschen Städten treibt der Mangel an großen Wohnungen die Mietpreise in die Höhe. Weil Wohnungsbaugesellschaften nur zögerlich auf den Neubaubedarf reagieren, wird der Erwerb von Wohneigentum zur echten Alternative.
"Wohnungsnot und große Leerstände liegen in vielen Städten oft nur wenige Straßenzeilen auseinander", beschreibt Eduard Oswald (CSU), Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, den Wohnungsmarkt, der tief gespalten ist durch eine Massenbewegung der Deutschen hin zum komfortableren Wohnen. "Insbesondere die kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen, nach dem zweiten Weltkrieg in großer Zahl gebaut, entsprechen nicht mehr den Ansprüchen der Mieter", urteilt Ex-Bauminister Oswald.
Auch Apartments in den Betontürmen der 60er und 70er Jahre sind nicht mehr im Trend, der nach den Worten von Reinhard Wagner, Vorstandsvorsitzender der BHW Holding AG, Hameln, "weg geht von Schlichtwohnungen in Mietskasernen hin zu großflächigen Wohnungen in kleineren Häusern". Und aus demografischen Gründen werde die Nachfrage nach größeren Objekten in den kommenden fünf Jahren noch steigen, verweist Wagner auf den Marktandrang der Baby-Boom-Generation.
Das Angebot an attraktivem Wohnraum ist allerdings begrenzt und in Ballungszentren mit hoher Wirtschaftskraft bereits erschöpft. "Dort wiederholt sich, was in München bereits Normalität ist - eine echte Knappheit an Vier-Zimmer-Wohnungen, verbunden mit drastischen Preissteigerungen für Mieten und Grundstücke", beobachtet der Bonner Wohnungsforscher Bernhard Faller. Mit durchschnittlich 8,42 Euro pro qm liegen die Mieten in München bundesweit auf Spitzenniveau. Bei neu abgeschlossenen Mietverträgen seien es sogar 12,50 Euro.
Um zwölf Prozent sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren bundesweit gestiegen. In den Städten wird sich dieser Trend fortsetzen, bedingt durch den anhaltenden Mangel an attraktiven Wohnungen. "In Köln ist der Wohnungsbau fast gänzlich zum Erliegen gekommen, obwohl sich das Wirtschaftswachstum seit Jahren positiv entwickelt", weist Faller auf die widersprüchliche Entwicklung hin. Gleiches gelte auch für Mainz, für Karlsruhe oder Frankfurt/Main.
Weil die Wohnungswirtschaft nur äußerst zögerlich auf die steigende Nachfrage reagiere, sei mit einem entlastenden Zusatzangebot frühestens in fünf Jahren zu rechnen. "Bis dahin hat ein Familienvater mit zwei Kindern und durchschnittlichem Gehalt nur geringe Chancen, in der Stadt eine angemessen große und zugleich bezahlbare Wohnung zu finden", resümiert Wagner. Unter diesen Umständen sei der Erwerb von Wohneigentum eine echte Alternative. Leider hemme die immer wieder neu angefachte Diskussion um den Abbau der Eigenheimzulage jedoch ausgerechnet bei den Schwellenhaushalten die Eigentumsbildung.
Für Wagner stehen dabei in erster Linie die Kommunen in der Pflicht. "Mittlerweile machen die Grundstückspreise fast ein Drittel der Baukosten aus. Daher sollten die Kommunen endlich nachfragegerechtes Bauland zu angemessenen Preisen anbieten
Die Welt 30.04. und 02.05.03
Privatkonkurse belasten die Wohnungswirtschaft
Deutschland steht die größte Insolvenzwelle der Nachkriegsgeschichte bevor. Auch private Insolvenzen nehmen drastisch zu. Im Jahre 2002 waren 30 000 Privatkonkurse zu verzeichnen, doppelt so viele wie im Vorjahr. In den letzten acht Jahren hat sich die Zahl der überschuldeten Privathaushalte auf 2,8 Mio. vervierfacht. Insgesamt lasten auf den privaten Haushalten durchschnittlich fast 40 000 Euro Schulden.
Die Wohnungswirtschaft ist von dieser Entwicklung stark betroffen. Nach Angaben des Eigentümerverbands Haus & Grund belaufen sich im Bereich der organisierten Wohnungsunternehmen die Mietaußenstände pro Jahr auf 796 Mio. Euro. Im Bereich der organisierten privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer sind Außenstände an Mietforderungen von rund 1,1 Mrd. Euro zu verzeichnen. Dies ergibt ein gesamtes Mietforderungsvolumen von rund 1,9 Mrd. Euro. Die nicht in Verbänden organisierten Vermieter sind dabei ebenso wenig berücksichtigt wie Mietausfälle infolge des wachsenden Wohnungsleerstandes. Als gesamtvolkswirtschaftlicher Schaden ergibt sich hieraus eine Summe von 247 Mio. Euro. Diese Entwicklung bringt insbesondere den privaten Vermieter in eine bedrohliche Situation. Er muss aus den Mieten Zins- und Tilgungsleistungen für kreditfinanzierte Immobilien erbringen.
Große Wohnungen sind Mangelware
In vielen deutschen Städten treibt der Mangel an großen Wohnungen die Mietpreise in die Höhe. Weil Wohnungsbaugesellschaften nur zögerlich auf den Neubaubedarf reagieren, wird der Erwerb von Wohneigentum zur echten Alternative.
"Wohnungsnot und große Leerstände liegen in vielen Städten oft nur wenige Straßenzeilen auseinander", beschreibt Eduard Oswald (CSU), Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, den Wohnungsmarkt, der tief gespalten ist durch eine Massenbewegung der Deutschen hin zum komfortableren Wohnen. "Insbesondere die kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen, nach dem zweiten Weltkrieg in großer Zahl gebaut, entsprechen nicht mehr den Ansprüchen der Mieter", urteilt Ex-Bauminister Oswald.
Auch Apartments in den Betontürmen der 60er und 70er Jahre sind nicht mehr im Trend, der nach den Worten von Reinhard Wagner, Vorstandsvorsitzender der BHW Holding AG, Hameln, "weg geht von Schlichtwohnungen in Mietskasernen hin zu großflächigen Wohnungen in kleineren Häusern". Und aus demografischen Gründen werde die Nachfrage nach größeren Objekten in den kommenden fünf Jahren noch steigen, verweist Wagner auf den Marktandrang der Baby-Boom-Generation.
Das Angebot an attraktivem Wohnraum ist allerdings begrenzt und in Ballungszentren mit hoher Wirtschaftskraft bereits erschöpft. "Dort wiederholt sich, was in München bereits Normalität ist - eine echte Knappheit an Vier-Zimmer-Wohnungen, verbunden mit drastischen Preissteigerungen für Mieten und Grundstücke", beobachtet der Bonner Wohnungsforscher Bernhard Faller. Mit durchschnittlich 8,42 Euro pro qm liegen die Mieten in München bundesweit auf Spitzenniveau. Bei neu abgeschlossenen Mietverträgen seien es sogar 12,50 Euro.
Um zwölf Prozent sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren bundesweit gestiegen. In den Städten wird sich dieser Trend fortsetzen, bedingt durch den anhaltenden Mangel an attraktiven Wohnungen. "In Köln ist der Wohnungsbau fast gänzlich zum Erliegen gekommen, obwohl sich das Wirtschaftswachstum seit Jahren positiv entwickelt", weist Faller auf die widersprüchliche Entwicklung hin. Gleiches gelte auch für Mainz, für Karlsruhe oder Frankfurt/Main.
Weil die Wohnungswirtschaft nur äußerst zögerlich auf die steigende Nachfrage reagiere, sei mit einem entlastenden Zusatzangebot frühestens in fünf Jahren zu rechnen. "Bis dahin hat ein Familienvater mit zwei Kindern und durchschnittlichem Gehalt nur geringe Chancen, in der Stadt eine angemessen große und zugleich bezahlbare Wohnung zu finden", resümiert Wagner. Unter diesen Umständen sei der Erwerb von Wohneigentum eine echte Alternative. Leider hemme die immer wieder neu angefachte Diskussion um den Abbau der Eigenheimzulage jedoch ausgerechnet bei den Schwellenhaushalten die Eigentumsbildung.
Für Wagner stehen dabei in erster Linie die Kommunen in der Pflicht. "Mittlerweile machen die Grundstückspreise fast ein Drittel der Baukosten aus. Daher sollten die Kommunen endlich nachfragegerechtes Bauland zu angemessenen Preisen anbieten
Die Welt 30.04. und 02.05.03
#367 Hallo Konradi,
ich finde den Artikel echt interessant.
Es ist für mich immer wieder faszinierend, die Aussagen von Leuten wie Wagner etc. zu hören/lesen. Ich frage mich immer, ob die das, was Sie verzapfen, selbst glauben, oder sich morgens schon beim rasieren übergeben müßen.
Deutschland, und übrigen auch alle!!! anderen westeuropäischen Staaten haben ein gigantisches demographisches Problem (im Jahr 2020 stellen die über 60 jährigen ca.60% der Gesamtbevölkerung). Bei uns streiten sich die Experten gerade, ob wir im Jahr 2025-30 noch 70 oder schon 65 Mio. Einwohner haben.
Die BuBa hat 1994/95? eine Untersuchung zum Wertzuwachs von Wohn-Immo`s in D-Land veröffentlicht. Der durchschnittliche Wertzuwachs von 1890 bis 1994 lag im Schnitt bei ca. 1,2% p.a. - trotz zweier Weltkriege, Depressionen etc.
Der gigantische Wohnflächenzuwachs beispielsweise, den wir in den letzten Jahren hatten, lagen oft daran, das die Jungen (in kleine WHG) bei den Alten ausgezogen sind. Jetzt wohnen ein oder zwei alte Menschen in den 120 - 140 m² Wohnfläche die sie mal für eine Familie mit ... Kindern gebaut haben. Und wenn jetzt das große Sterben (ist nicht böse gemeint sondern nur flapsig formuliert) anfängt, dann werden die ganzen Immo`s (auch großen Wohnungen) auf den Markt kommen. Für (fast) jeden der wegstirbt wird eine Wohnung frei !!! und die kommt auf einen Markt, bei dem die Nachfrage rückläufig ist (weil die letzten geburtenstarken Jahrgänge die 1961-1964er waren) und die sind schon im Markt und haben schon Ihre Immo gekauft.
Und die marktwirtschaftliche Basis sagt, das bei einem erhöhten Angebot (viele verwaiste Häuser) und einer reduzierten Nachfrage (geburtenschwache Jahrgänge kommen jetzt auf den Immomarkt) die Preis fallen werden (auch in München und Stuttgart und und).
In der Ecke wo meine Eltern gewohnt haben, stehen Reihenhäuser. 8 Stück je Reihe auf 3 Reihen (=24 Häuser). Von diesen 24 Häusern werden derzeit 12 !!!! von alleinstehenden alten Menschen bewohnt die im Schnitt sicherlich alle zwischen 75 und 80 Jahre alt sind -Neubausiedlung aus den 60er Jahren). Und in den letzten 6 Monaten haben bei den 24 Häusern bereits 4 den Eigentümer gewechselt, weil die Bewohner ausgestorben sind.
Mit den genau gleichen blöden Argumenten plant man in Stuttgart in den nächsten 8 Jahren zusätzliche 600- 700000 m² Liegenschaftsfläche (alleine auf dem Bahnhofsgelände sollen 500000 m² Geschoßfläche entstehen) und das bei rückläufiger Wirtschaft. Bis zum Jahr 2010 sind ca. 70%!!!!!!!!!!!!! aller jetzt noch berufstätigen Beamten (und im Schnitt sicherlich auch anderen Arbeitnehmer) im Ruhestand. Aus den ganzen Büroparks werden dann rießige Friedhöfe.
Und wenn die Jungs auf dem Thema mietfrei Wohnen im Alter rumreiten kann ich mich auch schon lange nur noch kaputtlachen. Mietfrei wohnen imALter geht nur dann, wenn man sein Liegenschaft abwohnt (und das stellt auch Werteverzehr dar!!!) Neues Dach alle 20 Jahre (15000 Euro) neuer Anstrich (alle 20 Jahre!!!) die Heizung hält im Schnitt noch 10 Jahre, Fenster und Türen ....
Und es wird immer der gleiche Schwachsinn propagiert. eigner Herd, mietfrei wohnen im Alter, die Preis sind derzeit so nieder, die Zinsen werden bald wieder steigen, es gibt wieder 50 cent Subvention für...,
100 Jahre die Leute für blöd verkauft und mit immer dem selben seichten Hintergrundgeseicher (das nenn ich kollektive Gehirnwäsche) die Leute in den Ruin getrieben (Die drei Großen Lügen lauten: Immobilien sind eine gute Kapitalanlage, die Renten sind sicher und das besten was man sich zusätzlich ansparen kann ist eine deutsche Lebensversicherung, nahallmasch).
Schade, das sich so wenige ersthaft mit diesem Thema auseinandersetzten und kritsch hinterfragen.
All Times Good T und CU
Gruß Kickaha
ich finde den Artikel echt interessant.
Es ist für mich immer wieder faszinierend, die Aussagen von Leuten wie Wagner etc. zu hören/lesen. Ich frage mich immer, ob die das, was Sie verzapfen, selbst glauben, oder sich morgens schon beim rasieren übergeben müßen.
Deutschland, und übrigen auch alle!!! anderen westeuropäischen Staaten haben ein gigantisches demographisches Problem (im Jahr 2020 stellen die über 60 jährigen ca.60% der Gesamtbevölkerung). Bei uns streiten sich die Experten gerade, ob wir im Jahr 2025-30 noch 70 oder schon 65 Mio. Einwohner haben.
Die BuBa hat 1994/95? eine Untersuchung zum Wertzuwachs von Wohn-Immo`s in D-Land veröffentlicht. Der durchschnittliche Wertzuwachs von 1890 bis 1994 lag im Schnitt bei ca. 1,2% p.a. - trotz zweier Weltkriege, Depressionen etc.
Der gigantische Wohnflächenzuwachs beispielsweise, den wir in den letzten Jahren hatten, lagen oft daran, das die Jungen (in kleine WHG) bei den Alten ausgezogen sind. Jetzt wohnen ein oder zwei alte Menschen in den 120 - 140 m² Wohnfläche die sie mal für eine Familie mit ... Kindern gebaut haben. Und wenn jetzt das große Sterben (ist nicht böse gemeint sondern nur flapsig formuliert) anfängt, dann werden die ganzen Immo`s (auch großen Wohnungen) auf den Markt kommen. Für (fast) jeden der wegstirbt wird eine Wohnung frei !!! und die kommt auf einen Markt, bei dem die Nachfrage rückläufig ist (weil die letzten geburtenstarken Jahrgänge die 1961-1964er waren) und die sind schon im Markt und haben schon Ihre Immo gekauft.
Und die marktwirtschaftliche Basis sagt, das bei einem erhöhten Angebot (viele verwaiste Häuser) und einer reduzierten Nachfrage (geburtenschwache Jahrgänge kommen jetzt auf den Immomarkt) die Preis fallen werden (auch in München und Stuttgart und und).
In der Ecke wo meine Eltern gewohnt haben, stehen Reihenhäuser. 8 Stück je Reihe auf 3 Reihen (=24 Häuser). Von diesen 24 Häusern werden derzeit 12 !!!! von alleinstehenden alten Menschen bewohnt die im Schnitt sicherlich alle zwischen 75 und 80 Jahre alt sind -Neubausiedlung aus den 60er Jahren). Und in den letzten 6 Monaten haben bei den 24 Häusern bereits 4 den Eigentümer gewechselt, weil die Bewohner ausgestorben sind.
Mit den genau gleichen blöden Argumenten plant man in Stuttgart in den nächsten 8 Jahren zusätzliche 600- 700000 m² Liegenschaftsfläche (alleine auf dem Bahnhofsgelände sollen 500000 m² Geschoßfläche entstehen) und das bei rückläufiger Wirtschaft. Bis zum Jahr 2010 sind ca. 70%!!!!!!!!!!!!! aller jetzt noch berufstätigen Beamten (und im Schnitt sicherlich auch anderen Arbeitnehmer) im Ruhestand. Aus den ganzen Büroparks werden dann rießige Friedhöfe.
Und wenn die Jungs auf dem Thema mietfrei Wohnen im Alter rumreiten kann ich mich auch schon lange nur noch kaputtlachen. Mietfrei wohnen imALter geht nur dann, wenn man sein Liegenschaft abwohnt (und das stellt auch Werteverzehr dar!!!) Neues Dach alle 20 Jahre (15000 Euro) neuer Anstrich (alle 20 Jahre!!!) die Heizung hält im Schnitt noch 10 Jahre, Fenster und Türen ....
Und es wird immer der gleiche Schwachsinn propagiert. eigner Herd, mietfrei wohnen im Alter, die Preis sind derzeit so nieder, die Zinsen werden bald wieder steigen, es gibt wieder 50 cent Subvention für...,
100 Jahre die Leute für blöd verkauft und mit immer dem selben seichten Hintergrundgeseicher (das nenn ich kollektive Gehirnwäsche) die Leute in den Ruin getrieben (Die drei Großen Lügen lauten: Immobilien sind eine gute Kapitalanlage, die Renten sind sicher und das besten was man sich zusätzlich ansparen kann ist eine deutsche Lebensversicherung, nahallmasch).
Schade, das sich so wenige ersthaft mit diesem Thema auseinandersetzten und kritsch hinterfragen.
All Times Good T und CU
Gruß Kickaha
Der Wohnflächenzuwachs lag auch an den vielen Scheidungen!
.
hallo @ Kickaha,
- danke für den ausführlichen Kommentar ! Deine Zweifel an den Aussagen von Reinhard Wagner (Vorstandsvorsitzender der BHW Holding AG) und "den üblichen Verdächtigen" aus der Branche sind auch nach meiner Meinung absolut angebracht !
Ich denke da wird knallharte Verbandspolitik betrieben. Jeder, der es mal mit einem Makler zu tun hatte weiß: das erstes Ausbildungsziel der Branche lautet: wie belüge ich am Geschicktesten meine Klientel ?...
Du scheinst Dich recht gut auszukennen im Immobilienmarkt, daher sind Dir die nachstehenden Links vermutlich bekannt, aber für die anderen hier seien sie genannt:
http://www.stalys.de
http://www.bulwien.de
http://www.empirica-institut.de
aber Vorsicht, fast alle Marktforschungsinstitute finanzieren sich weitgehend über Aufträge von BHW, LBS etc ...
Gruß Konradi
---
@ stormwatch :
hallo @ Kickaha,
- danke für den ausführlichen Kommentar ! Deine Zweifel an den Aussagen von Reinhard Wagner (Vorstandsvorsitzender der BHW Holding AG) und "den üblichen Verdächtigen" aus der Branche sind auch nach meiner Meinung absolut angebracht !
Ich denke da wird knallharte Verbandspolitik betrieben. Jeder, der es mal mit einem Makler zu tun hatte weiß: das erstes Ausbildungsziel der Branche lautet: wie belüge ich am Geschicktesten meine Klientel ?...

Du scheinst Dich recht gut auszukennen im Immobilienmarkt, daher sind Dir die nachstehenden Links vermutlich bekannt, aber für die anderen hier seien sie genannt:
http://www.stalys.de
http://www.bulwien.de
http://www.empirica-institut.de
aber Vorsicht, fast alle Marktforschungsinstitute finanzieren sich weitgehend über Aufträge von BHW, LBS etc ...
Gruß Konradi

---
@ stormwatch :

.
Edelmetalle: Nachfrageschub heizt Goldpreis an
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Die Entwicklung des Goldpreises stand vergangene Woche ganz im Zeichen der Bewegung auf den Währungsmärkten. Nach zum Teil schwachen US-Wirtschaftsdaten fiel der US-Dollar auf den tiefsten Stand seit März 1999.
Ein schwacher Dollar wirkt sich üblicherweise positiv auf die Goldnachfrage aus, weil der Preis für das Edelmetall für Käufer im Nicht-Dollar-Raum sinkt. Gold erreichte am Freitag mit 343,35 $/Feinunze sein Wochenhoch und zugleich den höchsten Stand seit Mitte März. Zugleich gehen von der laufenden Hochzeitssaison in Indien positive Nachfrage-Impulse aus. Lokale Händler berichten von den höchsten Verkäufen seit einem Jahr und erwarten für die kommenden Wochen weiterhin positive Zahlen. Auch die Investitionsnachfrage legte stark zu.
Analysten gehen für die kommenden Tage zunächst von einer Handelsspanne zwischen 337 und 345 $/Unze aus. Auch wenn der Goldpreis seit Anfang April einen neuen Aufwärtstrend gebildet habe, stelle das obere Ende dieser Handelsspanne derzeit einen stabilen charttechnischen Widerstand dar.
Silber legt zu
Die Notierungen für Silber stiegen nach Verlusten am vergangenen Montag bis Freitag in der Spitze um mehr als 20 Cent auf über 4,80 $/Unze. Innerhalb von sechs Wochen konnte das Metall damit deutlich von 4,34 $/Unze zulegen. Während die physische Nachfrage auf niedrigem Niveau verharrt, waren es vor allem Händler und Fonds, die das Metall kauften. Dazu trug bei, dass Silber wichtige Chartlinien überschritt.
Der Markt sieht zwar eindeutig überkauft aus, spätestens bei der Marke von 4,95 $/Unze, dem letzten Hoch vom Februar, dürften deshalb Gewinnmitnahmen das Bild bestimmen.
Sorge über die Nachfrage in Asien und speziell China drückte den Platinpreis deutlich. Das Edelmetall startete die Woche bei 635 $/Unze. Institutionelle Verkäufe in Europa führten sehr schnell zu massiven Verlusten. Erst am Mittwoch kam es zu einer Stabilisierung bei 605 $. Negativ wirkte sich die weitgehende Zurückhaltung der industriellen Verbraucher wegen der unklaren Konjunkturentwicklung aus. Händler erwarten trotzdem eine Stabilisierung der Notierungen und begründen dies mit den niedrigen Preisen auf Euro-Basis. Sie prognostizieren einen Wiederanstieg in eine Spanne zwischen 615 und 635 $/Unze.
FTD - 5.5.2003
Edelmetalle: Nachfrageschub heizt Goldpreis an
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Die Entwicklung des Goldpreises stand vergangene Woche ganz im Zeichen der Bewegung auf den Währungsmärkten. Nach zum Teil schwachen US-Wirtschaftsdaten fiel der US-Dollar auf den tiefsten Stand seit März 1999.
Ein schwacher Dollar wirkt sich üblicherweise positiv auf die Goldnachfrage aus, weil der Preis für das Edelmetall für Käufer im Nicht-Dollar-Raum sinkt. Gold erreichte am Freitag mit 343,35 $/Feinunze sein Wochenhoch und zugleich den höchsten Stand seit Mitte März. Zugleich gehen von der laufenden Hochzeitssaison in Indien positive Nachfrage-Impulse aus. Lokale Händler berichten von den höchsten Verkäufen seit einem Jahr und erwarten für die kommenden Wochen weiterhin positive Zahlen. Auch die Investitionsnachfrage legte stark zu.
Analysten gehen für die kommenden Tage zunächst von einer Handelsspanne zwischen 337 und 345 $/Unze aus. Auch wenn der Goldpreis seit Anfang April einen neuen Aufwärtstrend gebildet habe, stelle das obere Ende dieser Handelsspanne derzeit einen stabilen charttechnischen Widerstand dar.
Silber legt zu
Die Notierungen für Silber stiegen nach Verlusten am vergangenen Montag bis Freitag in der Spitze um mehr als 20 Cent auf über 4,80 $/Unze. Innerhalb von sechs Wochen konnte das Metall damit deutlich von 4,34 $/Unze zulegen. Während die physische Nachfrage auf niedrigem Niveau verharrt, waren es vor allem Händler und Fonds, die das Metall kauften. Dazu trug bei, dass Silber wichtige Chartlinien überschritt.
Der Markt sieht zwar eindeutig überkauft aus, spätestens bei der Marke von 4,95 $/Unze, dem letzten Hoch vom Februar, dürften deshalb Gewinnmitnahmen das Bild bestimmen.
Sorge über die Nachfrage in Asien und speziell China drückte den Platinpreis deutlich. Das Edelmetall startete die Woche bei 635 $/Unze. Institutionelle Verkäufe in Europa führten sehr schnell zu massiven Verlusten. Erst am Mittwoch kam es zu einer Stabilisierung bei 605 $. Negativ wirkte sich die weitgehende Zurückhaltung der industriellen Verbraucher wegen der unklaren Konjunkturentwicklung aus. Händler erwarten trotzdem eine Stabilisierung der Notierungen und begründen dies mit den niedrigen Preisen auf Euro-Basis. Sie prognostizieren einen Wiederanstieg in eine Spanne zwischen 615 und 635 $/Unze.
FTD - 5.5.2003
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
.
Stärke des Euro verlängert Stagnation
Von Sebastian Dullien, Berlin
Die von der Konsumschwäche und der Euro-Aufwertung verursachte lange Stagnation könnte dazu führen, dass die Wirtschaft in der Euro-Zone 2003 im Jahresvergleich um deutlich weniger als 1,0 Prozent wächst. Der FTD-Indikator sieht bis zum Herbst ein Nullwachstum in der Euro-Zone.

Das lässt die Mai-Auswertung des Euro-Wachstumsindikators befürchten, den die Euroframe-Gruppe führender europäischer Forschungsinstitute monatlich für die Financial Times Deutschland und die Financial Times berechnet. Der Indikator zeigt dabei an, dass die Wirtschaft von Juli bis September sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich nicht mehr wächst. Bereits für das erste Halbjahr zeigt der Indikator im Schnitt ein Nullwachstum gegenüber dem jeweiligen Vorquartal an. Sollten sich diese Schätzungen bestätigen, würde selbst bei einem kräftigen Wachstumsschub zum Jahresende das Bruttoinlandsprodukt 2003 kaum mehr als 0,5 Prozent über Vorjahr liegen.
Wachstum deutlich unter 1,0 Prozent
Damit sind die Ergebnisse des Euro-Indikators deutlich pessimistischer als die aktuellen Prognosen. Die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten noch im April der Euro-Zone ein Wachstum von 0,9 Prozent für das Gesamtjahr prognostiziert, die Industrieländerorganisation OECD sogar 1,0 Prozent.
"Der größte Dämpfer für das Wachstum kommt von der schlechten Stimmung im europäischen Einzelhandel", sagte Volz. Auch die Stärke der Gemeinschaftswährung trägt laut FTD-Indikator negativ zur Wachstumsbilanz bei: Im dritten Quartal dürften die Folgen der Aufwertung der vergangenen Monate einen halben Prozentpunkt Wachstum kosten; das jüngste Hochschnellen des Euro auf mehr als 1,10 $ wird sich erst später bemerkbar machen.
Entlastend dürfte im Sommer nach wie vor die Geldpolitik wirken, allerdings deutlich weniger als noch im zweiten Quartal. "Die fallende Inflationsrate lässt die Realzinsen steigen", so Volz. Da für Firmeninvestitionen die preisbereinigten Zinsen wichtig sind, die Inflation aber zuletzt zurückgegangen ist, wird die Geldpolitik zunehmend restriktiver. Hoffnung für eine Besserung bietet laut Volz eine mögliche weitere Zinssenkung der Europäischen Zentralbank. "Das wäre eine neue Wachstumsquelle für die Euro-Zone."
Aufhellung nach Unsicherheit durch Irak-Krise
Zudem sei denkbar, dass die Schwäche der in den Indikator eingehenden Stimmungsindikatoren die tatsächliche Lage etwas überzeichnet. "Vor dem Krieg ist durch die Unsicherheit die Stimmung stark belastet worden", sagte Volz.
Wenn sich in den kommenden Monaten das Geschäfts- und Konsumklima wieder aufhelle, würden sich auch die Wachstumsaussichten verbessern. Der FTD-Indikator schreibt die jeweils jüngsten Stimmungsindikatoren für die nahe Zukunft fort. In den Indikator gehen neben dem US-Einkaufsmanagerindex, der die Exportnachfrage abbildet, auch die Umfragen der EU-Kommission zum Geschäftsklima ein.
Auch der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Joachim Scheide, hält es für möglich, dass die Stimmungsindikatoren den Trend unterzeichnen. "In letzter Zeit waren die aus Umfragen ermittelten Indikatoren nicht sehr zuverlässig", sagte Scheide. Die Kriegsangst könne dieses Problem zuletzt noch verschärft haben. Es bestehe deshalb noch eine gewisse Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr.
Deutschland: Industrie auf Rezessionskurs
In Deutschland hat sich im April die Talfahrt der Industrie laut Umfragen unter Einkaufsmanagern beschleunigt. Der entsprechende Index des NTC-Instituts fiel gegenüber März um 1,9 auf 45,8 Punkte und lag damit deutlich unter jener Schwelle von 50 Punkten, deren Unterschreiten eine Schrumpfung des Sektors anzeigt. Auch für die Euro-Zone gab der Einkaufsmanagerindex nach. Er fiel um 0,6 auf 47,8 Punkte und zeigt damit ebenfalls einen Rückgang der Industrieaktivität an.
Die Einkaufsmanagerindizes waren von Ökonomen mit Spannung erwartet worden, weil die Umfragen anders als bei den nationalen Geschäftsklimaindizes komplett nach dem Fall Bagdads am 9. April stattfanden.
In Deutschland hat sich zuletzt auch der Einzelhandelsumsatz wieder extrem schwach entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verkauften die Händler preis- und saisonbereinigt im März 3,0 Prozent weniger als im Vormonat. Weil allerdings schon im Januar deutlich mehr als im Dezember umgesetzt worden war, lagen die Verkäufe im ersten Quartal insgesamt 0,6 Prozent über Vorquartal. Laut Jörg Krämer von Invesco Asset Management zeigt dieser Anstieg jedoch keine Trendwende an, sondern korrigiert nur die sehr schwachen Umsätze zum Jahresende.
FTD – 05.05.03
Stärke des Euro verlängert Stagnation
Von Sebastian Dullien, Berlin
Die von der Konsumschwäche und der Euro-Aufwertung verursachte lange Stagnation könnte dazu führen, dass die Wirtschaft in der Euro-Zone 2003 im Jahresvergleich um deutlich weniger als 1,0 Prozent wächst. Der FTD-Indikator sieht bis zum Herbst ein Nullwachstum in der Euro-Zone.

Das lässt die Mai-Auswertung des Euro-Wachstumsindikators befürchten, den die Euroframe-Gruppe führender europäischer Forschungsinstitute monatlich für die Financial Times Deutschland und die Financial Times berechnet. Der Indikator zeigt dabei an, dass die Wirtschaft von Juli bis September sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich nicht mehr wächst. Bereits für das erste Halbjahr zeigt der Indikator im Schnitt ein Nullwachstum gegenüber dem jeweiligen Vorquartal an. Sollten sich diese Schätzungen bestätigen, würde selbst bei einem kräftigen Wachstumsschub zum Jahresende das Bruttoinlandsprodukt 2003 kaum mehr als 0,5 Prozent über Vorjahr liegen.
Wachstum deutlich unter 1,0 Prozent
Damit sind die Ergebnisse des Euro-Indikators deutlich pessimistischer als die aktuellen Prognosen. Die deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten noch im April der Euro-Zone ein Wachstum von 0,9 Prozent für das Gesamtjahr prognostiziert, die Industrieländerorganisation OECD sogar 1,0 Prozent.
"Der größte Dämpfer für das Wachstum kommt von der schlechten Stimmung im europäischen Einzelhandel", sagte Volz. Auch die Stärke der Gemeinschaftswährung trägt laut FTD-Indikator negativ zur Wachstumsbilanz bei: Im dritten Quartal dürften die Folgen der Aufwertung der vergangenen Monate einen halben Prozentpunkt Wachstum kosten; das jüngste Hochschnellen des Euro auf mehr als 1,10 $ wird sich erst später bemerkbar machen.
Entlastend dürfte im Sommer nach wie vor die Geldpolitik wirken, allerdings deutlich weniger als noch im zweiten Quartal. "Die fallende Inflationsrate lässt die Realzinsen steigen", so Volz. Da für Firmeninvestitionen die preisbereinigten Zinsen wichtig sind, die Inflation aber zuletzt zurückgegangen ist, wird die Geldpolitik zunehmend restriktiver. Hoffnung für eine Besserung bietet laut Volz eine mögliche weitere Zinssenkung der Europäischen Zentralbank. "Das wäre eine neue Wachstumsquelle für die Euro-Zone."
Aufhellung nach Unsicherheit durch Irak-Krise
Zudem sei denkbar, dass die Schwäche der in den Indikator eingehenden Stimmungsindikatoren die tatsächliche Lage etwas überzeichnet. "Vor dem Krieg ist durch die Unsicherheit die Stimmung stark belastet worden", sagte Volz.
Wenn sich in den kommenden Monaten das Geschäfts- und Konsumklima wieder aufhelle, würden sich auch die Wachstumsaussichten verbessern. Der FTD-Indikator schreibt die jeweils jüngsten Stimmungsindikatoren für die nahe Zukunft fort. In den Indikator gehen neben dem US-Einkaufsmanagerindex, der die Exportnachfrage abbildet, auch die Umfragen der EU-Kommission zum Geschäftsklima ein.
Auch der Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Joachim Scheide, hält es für möglich, dass die Stimmungsindikatoren den Trend unterzeichnen. "In letzter Zeit waren die aus Umfragen ermittelten Indikatoren nicht sehr zuverlässig", sagte Scheide. Die Kriegsangst könne dieses Problem zuletzt noch verschärft haben. Es bestehe deshalb noch eine gewisse Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr.
Deutschland: Industrie auf Rezessionskurs
In Deutschland hat sich im April die Talfahrt der Industrie laut Umfragen unter Einkaufsmanagern beschleunigt. Der entsprechende Index des NTC-Instituts fiel gegenüber März um 1,9 auf 45,8 Punkte und lag damit deutlich unter jener Schwelle von 50 Punkten, deren Unterschreiten eine Schrumpfung des Sektors anzeigt. Auch für die Euro-Zone gab der Einkaufsmanagerindex nach. Er fiel um 0,6 auf 47,8 Punkte und zeigt damit ebenfalls einen Rückgang der Industrieaktivität an.
Die Einkaufsmanagerindizes waren von Ökonomen mit Spannung erwartet worden, weil die Umfragen anders als bei den nationalen Geschäftsklimaindizes komplett nach dem Fall Bagdads am 9. April stattfanden.
In Deutschland hat sich zuletzt auch der Einzelhandelsumsatz wieder extrem schwach entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verkauften die Händler preis- und saisonbereinigt im März 3,0 Prozent weniger als im Vormonat. Weil allerdings schon im Januar deutlich mehr als im Dezember umgesetzt worden war, lagen die Verkäufe im ersten Quartal insgesamt 0,6 Prozent über Vorquartal. Laut Jörg Krämer von Invesco Asset Management zeigt dieser Anstieg jedoch keine Trendwende an, sondern korrigiert nur die sehr schwachen Umsätze zum Jahresende.
FTD – 05.05.03
.
Über die Geduld beim Backen kleiner Brötchen ...
Gold as a Business -
By Lawrence Roulston
Many investors again became disillusioned with gold when the price recently slipped back under $330. While the price was at the bottom, investors and analysts were talking of further declines. Now, a few days later, with only a few dollars swing in the price, the outlook is for immediate and huge gains. We need to stand back a moment, and take a longer term perspective on the gold market.
The current price is 30% higher than it was two years ago. It is also important to note that there were three other times in the past two years when gold backed off by at least $20 before subsequently moving higher. However, that is little comfort to those investors who bought bullion or gold equities near the top of the last spike and then saw their gains eroded as the gold price by $60 from its high.
Every time the gold price runs up, investors and speculators rush to buy gold. In fact, the price reaches a high for the very reason that so many people are buying.
At the bottom, with the gold price well down from its recent high, sellers predominated the markets. Sadly, many of those selling at the bottom were the same people who recently bought gold at the top of the last spike. To a large extent, it is the casual investors who get caught in these momentum plays: They buy after the price has established an uptrend and then sell in disgust after the momentum has turned downward. All too frequently, they sell at a lower price than they paid. Most often, it is the professional traders on the flip side of those momentum-driven trades.
The gold equities, of course, follow the flip-flop in the bullion prices. Unfortunately, the same scenario prevails in the equity markets: Investors buy gold equities after the bullion price has already established an uptrend that pushes equity prices higher. Then they head for the exit once the gold price is on its way downwards and the equities have already given up the gains.
Clearly, those investors who take a contrary view to the general markets can make money from these swings in sentiment toward gold. I have written on this phenomenon several times before, and I hope that Resource Opportunities readers are buying gold equities when others don’t want to touch them, and then obliging investors who want to buy after the prices have shot up.
It is curious and unfortunate that so many people get caught over and over again on the wrong side of these momentum-driven trading cycles.
An explanation for this irrational behaviour began to take shape in the course of the latest resource investment conference that I was involved in. As at most of these events, several speakers made extraordinary projections for the gold price. In fact, for the second time in the past few months, I heard a pronouncement that gold would soon reach $3,000 an ounce.
That may happen. Indeed, I hope it does, and it probably will happen. But not right away! Perhaps not for years.
Unfortunately, once people develop a mind set that gold will soon go to $1,000 or $3,000 an ounce, they lose perspective on the near-term market. The recent run up from $330 to $390 became, to many people, the confirmation that the gold price was just starting its journey to the moon. That is, people didn`t mind giving up the first $60 of the move in the gold price, because they thought it had hundreds of dollars or even thousands of dollars yet to go.
Sadly, every time investors get caught up by one of these false starts, they lose money. More importantly, they lose confidence that gold will ever have a big run.
After all, it has been more than 20 years now that we have been waiting for that next big run-up in gold. In fact, the vast majority of investors have completely lost confidence in gold. They think: Gold isn’t ever going to go half-way to infinity, and therefore there is no reason to own gold.
There are still a small number of people who believe in the long term future of gold, and we keep talking to one another, even though the size of the group continues to dwindle.
It’s fine to look at the people sitting in the audience at an investment conference, nodding at the stories of doom and gloom that will propel the gold price to unimaginable levels. But now, it is time to look at something much, much more important. It is time to notice the large number of chairs in the room that are sitting vacant.
Lets face it: This constant focus on the pending big move in the gold price has done enormous damage to the credibility of the gold market. Not only have investors lost confidence in gold, they have definitely lost confidence in those people who continue to predict that gold will soon be on its way to the moon.
Let me be perfectly clear. I believe that the gold price will go higher … much higher … but it may take years.
I pointed out in the June 2001 issue of Resource Opportunities that a fundamental change was then beginning in the gold market. That scenario is playing out exactly as I anticipated. The gold price is 30% higher, and trending higher. If we accept that the price pattern of the past two years is likely to continue out into the future, we can all make a lot of money.
If the gold price was suddenly $1,000 an ounce, then you could make a fortune by owning any company that had anything to do with gold. However, if we realize that the journey to $1,000 may take a long time, we may have to be a little more selective in the gold companies that we own.
In short, its time to start thinking of gold companies first as businesses and secondly as a way to own gold.
If the gold industry adopted a more business-oriented approach in place of the constant obsession about the pending big gains in the gold price, the industry would attract a lot more investors.
It takes a lot of hard work to evaluate a company when you start with the premise that the company should be able to make money for investors at the current gold price. It’s a lot easier to convince oneself that the gold price is going higher in the near term, and therefore, one’s favourite gold company, whatever that company is, will suddenly sky-rocket in value.
I’m much too impatient to buy a company and simply wait for a move in the gold price to push the share price higher.
Knowing that the gold price will trend higher over time, and may one day reward us with a big move, I want a big portion of my investment portfolio to be in gold companies. I want to own companies that give me a big exposure to gold, but I want to own companies that will also create value by executing a smart business plan. Therefore, I favour the smaller, well managed companies. We need some patience, as these business plans evolve over a period of months or a year or more.
The gold price will continue to bounce around as it trends higher. That means that gold equities will also continue to alternately delight and then disappoint investors as they move up and down on a week-by-week basis. That volatility will be compounded by the general nervousness of investors in this most uncertain of times.
Over time, the value of the well-run gold companies should move higher as the businesses advance. On top of that, the long-term uptrend in the gold price should add further value. As a bonus, one day the gold price will move much higher, and make us all very happy.
Knowing that the gold price will continue to move upward in a series of steps and pull-backs, it’s important to take some profits when there has been a big run-up in price. Keep a position, because its hard to know how far it will run. But, knowing that there is a strong likelihood that a big run in the bullion price will be followed by a pull-back, its worthwhile having some cash available in order to take advantage when stocks go on sale.
Right now, many gold stocks are on sale.
This issue introduces a new gold company, and also updates some of the companies that we have been following. The next issue will provide more updates.
www.resourceopportunities.com
.
Über die Geduld beim Backen kleiner Brötchen ...

Gold as a Business -
By Lawrence Roulston
Many investors again became disillusioned with gold when the price recently slipped back under $330. While the price was at the bottom, investors and analysts were talking of further declines. Now, a few days later, with only a few dollars swing in the price, the outlook is for immediate and huge gains. We need to stand back a moment, and take a longer term perspective on the gold market.
The current price is 30% higher than it was two years ago. It is also important to note that there were three other times in the past two years when gold backed off by at least $20 before subsequently moving higher. However, that is little comfort to those investors who bought bullion or gold equities near the top of the last spike and then saw their gains eroded as the gold price by $60 from its high.
Every time the gold price runs up, investors and speculators rush to buy gold. In fact, the price reaches a high for the very reason that so many people are buying.
At the bottom, with the gold price well down from its recent high, sellers predominated the markets. Sadly, many of those selling at the bottom were the same people who recently bought gold at the top of the last spike. To a large extent, it is the casual investors who get caught in these momentum plays: They buy after the price has established an uptrend and then sell in disgust after the momentum has turned downward. All too frequently, they sell at a lower price than they paid. Most often, it is the professional traders on the flip side of those momentum-driven trades.
The gold equities, of course, follow the flip-flop in the bullion prices. Unfortunately, the same scenario prevails in the equity markets: Investors buy gold equities after the bullion price has already established an uptrend that pushes equity prices higher. Then they head for the exit once the gold price is on its way downwards and the equities have already given up the gains.
Clearly, those investors who take a contrary view to the general markets can make money from these swings in sentiment toward gold. I have written on this phenomenon several times before, and I hope that Resource Opportunities readers are buying gold equities when others don’t want to touch them, and then obliging investors who want to buy after the prices have shot up.
It is curious and unfortunate that so many people get caught over and over again on the wrong side of these momentum-driven trading cycles.
An explanation for this irrational behaviour began to take shape in the course of the latest resource investment conference that I was involved in. As at most of these events, several speakers made extraordinary projections for the gold price. In fact, for the second time in the past few months, I heard a pronouncement that gold would soon reach $3,000 an ounce.
That may happen. Indeed, I hope it does, and it probably will happen. But not right away! Perhaps not for years.
Unfortunately, once people develop a mind set that gold will soon go to $1,000 or $3,000 an ounce, they lose perspective on the near-term market. The recent run up from $330 to $390 became, to many people, the confirmation that the gold price was just starting its journey to the moon. That is, people didn`t mind giving up the first $60 of the move in the gold price, because they thought it had hundreds of dollars or even thousands of dollars yet to go.
Sadly, every time investors get caught up by one of these false starts, they lose money. More importantly, they lose confidence that gold will ever have a big run.
After all, it has been more than 20 years now that we have been waiting for that next big run-up in gold. In fact, the vast majority of investors have completely lost confidence in gold. They think: Gold isn’t ever going to go half-way to infinity, and therefore there is no reason to own gold.
There are still a small number of people who believe in the long term future of gold, and we keep talking to one another, even though the size of the group continues to dwindle.
It’s fine to look at the people sitting in the audience at an investment conference, nodding at the stories of doom and gloom that will propel the gold price to unimaginable levels. But now, it is time to look at something much, much more important. It is time to notice the large number of chairs in the room that are sitting vacant.
Lets face it: This constant focus on the pending big move in the gold price has done enormous damage to the credibility of the gold market. Not only have investors lost confidence in gold, they have definitely lost confidence in those people who continue to predict that gold will soon be on its way to the moon.
Let me be perfectly clear. I believe that the gold price will go higher … much higher … but it may take years.
I pointed out in the June 2001 issue of Resource Opportunities that a fundamental change was then beginning in the gold market. That scenario is playing out exactly as I anticipated. The gold price is 30% higher, and trending higher. If we accept that the price pattern of the past two years is likely to continue out into the future, we can all make a lot of money.
If the gold price was suddenly $1,000 an ounce, then you could make a fortune by owning any company that had anything to do with gold. However, if we realize that the journey to $1,000 may take a long time, we may have to be a little more selective in the gold companies that we own.
In short, its time to start thinking of gold companies first as businesses and secondly as a way to own gold.
If the gold industry adopted a more business-oriented approach in place of the constant obsession about the pending big gains in the gold price, the industry would attract a lot more investors.
It takes a lot of hard work to evaluate a company when you start with the premise that the company should be able to make money for investors at the current gold price. It’s a lot easier to convince oneself that the gold price is going higher in the near term, and therefore, one’s favourite gold company, whatever that company is, will suddenly sky-rocket in value.
I’m much too impatient to buy a company and simply wait for a move in the gold price to push the share price higher.
Knowing that the gold price will trend higher over time, and may one day reward us with a big move, I want a big portion of my investment portfolio to be in gold companies. I want to own companies that give me a big exposure to gold, but I want to own companies that will also create value by executing a smart business plan. Therefore, I favour the smaller, well managed companies. We need some patience, as these business plans evolve over a period of months or a year or more.
The gold price will continue to bounce around as it trends higher. That means that gold equities will also continue to alternately delight and then disappoint investors as they move up and down on a week-by-week basis. That volatility will be compounded by the general nervousness of investors in this most uncertain of times.
Over time, the value of the well-run gold companies should move higher as the businesses advance. On top of that, the long-term uptrend in the gold price should add further value. As a bonus, one day the gold price will move much higher, and make us all very happy.
Knowing that the gold price will continue to move upward in a series of steps and pull-backs, it’s important to take some profits when there has been a big run-up in price. Keep a position, because its hard to know how far it will run. But, knowing that there is a strong likelihood that a big run in the bullion price will be followed by a pull-back, its worthwhile having some cash available in order to take advantage when stocks go on sale.
Right now, many gold stocks are on sale.
This issue introduces a new gold company, and also updates some of the companies that we have been following. The next issue will provide more updates.
www.resourceopportunities.com
.
.
Chris Temple hat im Januar ziemlich präzise Voraussagen über den Goldpreis gemacht.
Hier zur Erinnerung zunächst ein Ausschnitt aus seinem Marktkommentar vom 10. 01. 2003 :
One minute, we could see gold spike to $380, $400 or higher if we get into a war and it gets ugly, or if there is a more concerted "run" on the U.S. dollar.
Just as easily, however, we could see gold plunge back to $325—or even, temporarily, lower—if the stock market rallies, we don’t go to war (or a war goes off swimmingly) and the dollar surges anew.
Though it will be more volatile in 2003, I believe that—at a minimum—gold will this year carve out a new trading range in the $350-380 area.
- und hier sein aktueller Kommentar:
Will Gold Now Pull Gold Shares Higher?
- New U.S. Dollar Lows Will Help Both
By Chris Temple
In the early stages of this new gold bull market that got underway in the latter part of 2001, shares of gold mining companies led the way. While the yellow metal itself plodded higher but in a relatively unspectacular way, gold shares soared; our recommended basket more than doubled between the Fall of 2001 and the sector’s peak in June, 2002.
Since that time, however, gold shares have under performed the metal itself. Even a brief, albeit unsustainable, spike in spot gold to $390 per ounce in early February failed to bring mining shares along with it commensurately; even at that point (with gold $60 higher) the gold mining sector couldn’t move above last June’s levels.
Gold shares did seem ready to regain their usual role of a new upward move in gold when, back in mid-March, they bottomed and then turned higher, even as gold itself continued to decline to its recent lows a shade under $320 per ounce. Curiously, however, the gold stock sector again began to slip; first failing to move convincingly above key resistance levels and then—until the last couple days—failing as well to keep up with a gold price which suddenly has some substantial tail wind.
While there are several possible reasons for this, real or imagined, there are two chief ones in my view.
First, significant short positions had been taken in gold shares many weeks back, as hedge funds (primarily) were betting that the sector would cool off. They were correct. This activity has helped keep gold shares in check. However, with gold’s biggest dangers of declining seeming to have abated, we may see more earnest short covering, which will help the mining shares catch up with gold’s own price strength.
Second, it must be remembered that sometimes the macroeconomic picture might not be good for gold mining companies, even if the price of gold is doing well. This can particularly occur if there are fears about overall the overall economy’s health. Keep in mind that jewelry demand comprises the majority of overall demand for the yellow metal; and all other things being equal, a contraction in the world economy and, consequently, in said demand sure can’t be good.
However, there are many more reasons why gold—though it could still have some near-term trouble getting back above the psychologically important $340 per ounce hump—may finally be poised to more significantly reassert its long term bullish trend. Most of the factors that gave rise to the birth of this bull market in late 2001 remain fairly well in tact, though a couple of elements (such as jewelry demand) are a bit worrisome.
Helping out more than ever currently, though, is the action concerning the U.S. dollar.
You already know that the dollar has lost ground against the euro over the last year. At its zenith, it only took a bit over 80 cents to buy a euro. Today, it takes nearly $1.12, bringing it back most of the way to the $1.17 per euro level that existed when the new currency was introduced four years ago.
There are many reasons for this, which I have previously expounded on. Not all of them, frankly, are debilitating for either the U.S. economy or U.S. markets all by themselves. However, two factors suggest that—though sharp rebounds may from time to time occur—the worst may still be ahead for the U.S. currency:
First, the dollar has not enjoyed anything like the kind of "post-war bounce" that we’ve seen to some extent on Wall Street. Quite the contrary; the broad U.S. dollar index is threatening to break below its previous lows, a development which would no doubt invite more "piling on" by hedge funds and assorted other investors.
This bearish attitude is based on many factors: record Treasury borrowing, burgeoning external debts to the rest of the world, an economic outlook that is not exactly rosy, the heightened enmity between the U.S. and much of the rest of the world over our foreign policy and, last but not least, what could be the beginning of a more concerted international "boycott" of the dollar. Whatever the many reasons you might like to choose from, it’s telling that we have a weak dollar after Saddam Hussein has been vanquished, and even as other major economies are in arguably worse shape than our own.
Second—and a development that is truly extraordinary—currency traders have in recent days been giving their strongest signals yet that they now believe there shall be no return to previous glory days for the greenback.
Ever since the great bull market for the dollar began in 1995, it was routine for currency traders to borrow currencies both weak and cheap (such as the Japanese yen) and invest them elsewhere in anticipation of both relative currency strength and higher interest rates, allowing this "carry trade" to generate profits. The dollar was clearly the depository and beneficiary of this, helping to explain how the dollar itself became a momentum-created bubble over several years’ time.
Now, of all things, we’re seeing reports of traders borrowing dollars and investing them in safer and higher-yielding currencies. Not only the euro is benefiting from this; higher-yielding (and more commodity-dependent) currencies such as the Canadian and Australian dollars are getting some action as well.
The significance of this sea change in the attitude of the currency markets cannot be overstated and, though this very different treatment of the U.S. dollar will be inviting even more volatility in its value down the road, it nevertheless shows the growing conviction that the buck’s long term trend has been decided upon by those who matter most.
A weaker U.S. dollar—which in the end will do more harm than good, no matter how much you hear about how wonderful it will be for some multinationals who might temporarily be able to export more—will ultimately be inflationary. It could cause financial turmoil world-wide. That will be a bonus for gold, on top of the many reasons already existing, and into which I go into great detail in my latest research report on the sector.
(…)
www.nationalinvestor.com
Chris Temple hat im Januar ziemlich präzise Voraussagen über den Goldpreis gemacht.
Hier zur Erinnerung zunächst ein Ausschnitt aus seinem Marktkommentar vom 10. 01. 2003 :
One minute, we could see gold spike to $380, $400 or higher if we get into a war and it gets ugly, or if there is a more concerted "run" on the U.S. dollar.
Just as easily, however, we could see gold plunge back to $325—or even, temporarily, lower—if the stock market rallies, we don’t go to war (or a war goes off swimmingly) and the dollar surges anew.
Though it will be more volatile in 2003, I believe that—at a minimum—gold will this year carve out a new trading range in the $350-380 area.
- und hier sein aktueller Kommentar:
Will Gold Now Pull Gold Shares Higher?
- New U.S. Dollar Lows Will Help Both
By Chris Temple
In the early stages of this new gold bull market that got underway in the latter part of 2001, shares of gold mining companies led the way. While the yellow metal itself plodded higher but in a relatively unspectacular way, gold shares soared; our recommended basket more than doubled between the Fall of 2001 and the sector’s peak in June, 2002.
Since that time, however, gold shares have under performed the metal itself. Even a brief, albeit unsustainable, spike in spot gold to $390 per ounce in early February failed to bring mining shares along with it commensurately; even at that point (with gold $60 higher) the gold mining sector couldn’t move above last June’s levels.
Gold shares did seem ready to regain their usual role of a new upward move in gold when, back in mid-March, they bottomed and then turned higher, even as gold itself continued to decline to its recent lows a shade under $320 per ounce. Curiously, however, the gold stock sector again began to slip; first failing to move convincingly above key resistance levels and then—until the last couple days—failing as well to keep up with a gold price which suddenly has some substantial tail wind.
While there are several possible reasons for this, real or imagined, there are two chief ones in my view.
First, significant short positions had been taken in gold shares many weeks back, as hedge funds (primarily) were betting that the sector would cool off. They were correct. This activity has helped keep gold shares in check. However, with gold’s biggest dangers of declining seeming to have abated, we may see more earnest short covering, which will help the mining shares catch up with gold’s own price strength.
Second, it must be remembered that sometimes the macroeconomic picture might not be good for gold mining companies, even if the price of gold is doing well. This can particularly occur if there are fears about overall the overall economy’s health. Keep in mind that jewelry demand comprises the majority of overall demand for the yellow metal; and all other things being equal, a contraction in the world economy and, consequently, in said demand sure can’t be good.
However, there are many more reasons why gold—though it could still have some near-term trouble getting back above the psychologically important $340 per ounce hump—may finally be poised to more significantly reassert its long term bullish trend. Most of the factors that gave rise to the birth of this bull market in late 2001 remain fairly well in tact, though a couple of elements (such as jewelry demand) are a bit worrisome.
Helping out more than ever currently, though, is the action concerning the U.S. dollar.
You already know that the dollar has lost ground against the euro over the last year. At its zenith, it only took a bit over 80 cents to buy a euro. Today, it takes nearly $1.12, bringing it back most of the way to the $1.17 per euro level that existed when the new currency was introduced four years ago.
There are many reasons for this, which I have previously expounded on. Not all of them, frankly, are debilitating for either the U.S. economy or U.S. markets all by themselves. However, two factors suggest that—though sharp rebounds may from time to time occur—the worst may still be ahead for the U.S. currency:
First, the dollar has not enjoyed anything like the kind of "post-war bounce" that we’ve seen to some extent on Wall Street. Quite the contrary; the broad U.S. dollar index is threatening to break below its previous lows, a development which would no doubt invite more "piling on" by hedge funds and assorted other investors.
This bearish attitude is based on many factors: record Treasury borrowing, burgeoning external debts to the rest of the world, an economic outlook that is not exactly rosy, the heightened enmity between the U.S. and much of the rest of the world over our foreign policy and, last but not least, what could be the beginning of a more concerted international "boycott" of the dollar. Whatever the many reasons you might like to choose from, it’s telling that we have a weak dollar after Saddam Hussein has been vanquished, and even as other major economies are in arguably worse shape than our own.
Second—and a development that is truly extraordinary—currency traders have in recent days been giving their strongest signals yet that they now believe there shall be no return to previous glory days for the greenback.
Ever since the great bull market for the dollar began in 1995, it was routine for currency traders to borrow currencies both weak and cheap (such as the Japanese yen) and invest them elsewhere in anticipation of both relative currency strength and higher interest rates, allowing this "carry trade" to generate profits. The dollar was clearly the depository and beneficiary of this, helping to explain how the dollar itself became a momentum-created bubble over several years’ time.
Now, of all things, we’re seeing reports of traders borrowing dollars and investing them in safer and higher-yielding currencies. Not only the euro is benefiting from this; higher-yielding (and more commodity-dependent) currencies such as the Canadian and Australian dollars are getting some action as well.
The significance of this sea change in the attitude of the currency markets cannot be overstated and, though this very different treatment of the U.S. dollar will be inviting even more volatility in its value down the road, it nevertheless shows the growing conviction that the buck’s long term trend has been decided upon by those who matter most.
A weaker U.S. dollar—which in the end will do more harm than good, no matter how much you hear about how wonderful it will be for some multinationals who might temporarily be able to export more—will ultimately be inflationary. It could cause financial turmoil world-wide. That will be a bonus for gold, on top of the many reasons already existing, and into which I go into great detail in my latest research report on the sector.
(…)
www.nationalinvestor.com
.
Nachtrag zu #367 :
Immobilien: Düstere Aussichten
Die Immobilienbranche zeichnet für 2003 ein eher negatives Bild. Nach Einschätzungen von Experten werde der Investmentmarkt in diesem Jahr stagnieren, der Vermietungsmarkt weiter rückläufig sein und das An- und Verkaufsverhalten sich im Vergleich zum Vorjahr nicht eklatant ändern.
Das geht aus der halbjährlichen bundesweiten Erhebung des Immobilieninvestment-Hauses Angermann hervor. Angermann fragt in seinem "Geschäftsklima-Index der Immobilienbranche" 800 ausgewählte Experten nach der mittelfristigen Entwicklung des Immobilienmarktes.
Im Vergleich zur Befragung im Juni/Juli 2002 erwarten 65,5 Prozent einen stagnierenden Markt im Vergleich zu 55 Prozent im Jahr 2002. Eine sinkende Tendenz sehen 22,5 Prozent (zuvor 13 Prozent), und eine steigende Tendenz erhoffen sich nur noch 12 Prozent (32 Prozent). Auch für den Vermietungsmarkt zeichnet Angermann ein düsteres Bild. Für die Hochburgen Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart stehen die Zeichen auf Stagnation. Frankfurt und München trifft es noch härter. Hier rechnet man mit einer negativen Entwicklung.
Nachtrag zu #367 :
Immobilien: Düstere Aussichten
Die Immobilienbranche zeichnet für 2003 ein eher negatives Bild. Nach Einschätzungen von Experten werde der Investmentmarkt in diesem Jahr stagnieren, der Vermietungsmarkt weiter rückläufig sein und das An- und Verkaufsverhalten sich im Vergleich zum Vorjahr nicht eklatant ändern.
Das geht aus der halbjährlichen bundesweiten Erhebung des Immobilieninvestment-Hauses Angermann hervor. Angermann fragt in seinem "Geschäftsklima-Index der Immobilienbranche" 800 ausgewählte Experten nach der mittelfristigen Entwicklung des Immobilienmarktes.
Im Vergleich zur Befragung im Juni/Juli 2002 erwarten 65,5 Prozent einen stagnierenden Markt im Vergleich zu 55 Prozent im Jahr 2002. Eine sinkende Tendenz sehen 22,5 Prozent (zuvor 13 Prozent), und eine steigende Tendenz erhoffen sich nur noch 12 Prozent (32 Prozent). Auch für den Vermietungsmarkt zeichnet Angermann ein düsteres Bild. Für die Hochburgen Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart stehen die Zeichen auf Stagnation. Frankfurt und München trifft es noch härter. Hier rechnet man mit einer negativen Entwicklung.
.

Morgen kommt ein mit 5 Sternen bewertetes Gangster-Epos des brasilianischen Regisseurs Fernando Meirelles in die Kinos. Er schildert das Leben einer Jugendgang in der Cidade de Deus, der "City of God" – einer der Favelas von Rio de Janeiro. Ich habe gerade zwei Kritiken dazu gelesen und werde mir den Film anschauen:
Die Gangs von Rio: "City of God"
Von Michael Althen
Vielleicht der beste Film der letzten zehn Jahre, wird Bernd Eichinger auf dem Plakat zitiert. Er muß es wissen, schließlich bringt seine Constantin "Cidade de Deus" hierzulande in die Kinos, wo er nun auf gut Deutsch "City of God" heißt.
Der englische Titel mag signalisieren, daß Fernando Meirelles` Film durchaus internationalen Standards entspricht, und tatsächlich wirft er alle Vorstellungen, wie lateinamerikanisches Kino aussehen könnte, locker über den Haufen. Die Geschichte aus den Favelas von Rio bezieht ihren Realismus nicht aus einer besonders ausdauernden Beobachtungsgabe für die Schattenseiten des Lebens, sondern aus der Atemlosigkeit, mit welcher der beschleunigte Herzschlag des Lebens und vor allem Sterbens geschildert wird.
Schon zu Beginn saust immer wieder ein Messer durchs Bild, mit dem Hühner für den Grill zubereitet werden, und diesen Rhythmus nimmt der Schnitt begierig auf, verwandelt das Treiben auf der Straße in einen wilden Tanz, der das ungerührte Schlachten und die ungetrübte Lebenslust verquickt. Als ein Huhn dem Messer entkommt und von einer fröhlichen Menge bewaffneter Jugendlicher durchs Viertel gejagt wird, folgt ihm die Kamera in Bodennähe über Stock und Stein, treppauf, treppab, durch belebte Gassen und befahrene Straßen.
Man könnte einwenden, daß der Film ein bißchen viel Wind um ein einzelnes blödes Huhn macht, daß die Virtuosität in keinem rechten Verhältnis zum Ereignis steht, aber andererseits wird sich herausstellen, daß in dieser Welt ein Menschenleben kaum mehr wert ist als das eines Huhns und unsere Parteinahme für das fliehende Tier ähnlich naiv ist wie jedwede Illusion, mit der man den Überlebensweg der Helden begleitet. Jedenfalls ist von Anfang an klar, daß wir uns in einem Reich der entfesselten Kamera bewegen, die nichts unversucht läßt, die Geschichte nach allen Regeln der Kunst zu akzentuieren.
Nichts scheint improvisiert
"Cidade de Deus" war in Brasilien der ganz große Hit und hat dort Diskussionen über die Mißstände in den Favelas in Gang gebracht. Regisseur Meirelles selbst, der aus Sao Paulo kommt, hatte keine rechte Vorstellung von den wahren Zuständen in dem Slums, als er sich an die Lektüre des Bestsellers "Cidade de Deus" von Paulo Lins machte. Das Buch hat, wie er sagt, ihm die Augen geöffnet und sein Leben verändert. Der Werbefilmer ging nach Rio, castete 300 Amateure und probte dann mit seiner Besetzung ein Jahr lang. Und weil er in einem ähnlichen Slum wie der Cidade de Deus drehte, engagierte er als Coregisseurin Katia Lund, die bereits Erfahrung mit der Arbeit in Favelas mitbrachte. Unter all diesen Umständen ist es umso erstaunlicher, daß im fertigen Film nichts improvisiert erscheint, sondern alles auf fast schon unheimliche Weise kalkuliert wirkt.
Meirelles verfolgt den Weg einer Bande von Jungs aus dem Siedlungsprojekt Cidade de Deus von den Sechzigern bis in die achtziger Jahre hinein - und das Schockierendste an seinem Film ist womöglich, daß sich die Lage in den vergangenen Jahren noch weiter verschlechtert hat, obwohl man sich kaum noch etwas Schlimmeres vorstellen kann als die Kinderbanden, die Cowboy und Indianer mit echten Waffen und echtem Blut spielen. Wenn es losgeht, ist noch alles von einem nostalgischen Sonnengelb durchflutet. In den Siebzigern wird es dann bunt, und danach scheinen die Farben zu erkalten, aber bis dahin ist einen ohnehin das Blut längst in den Adern gefroren.
"City of God" ist ein Drogenthriller, ein "Scarface" im Sambagewand, eine Gewaltorgie, die weitgehend ohne Blut auskommt, aber sonst nichts unversucht läßt, unter die Haut zu gehen. Wenn die Jungs anfangs einen Lastwagen überfallen, dann wirken sie noch wie eine Kinderbande, die zwar mit echten Waffen herumfuchtelt, aber nicht im Traum auf die Idee käme, sie auch zu benutzen. Auch der Überfall auf ein Bordell, bei dem sie die Gesellschaft mit heruntergelassenen Hosen überraschen, wirkt noch wie ein fröhlicher Diebesstreich. Aber schon kurz darauf lehrt uns der Film auf ungeahnte Weise das Fürchten.
Vom Kind zum Bandenchef
Vor dem Überfall haben sie einem kleinen vorlauten Jungen, der sie unbedingt begleiten wollte, eingeschärft, vor dem Bordell auf sie zu warten. Als alle Angestellten und Gäste gefesselt und beraubt sind, finden sie den Junge nicht mehr im Auto und fahren ohne ihn zurück. Als später die Polizei in die Cidade de Deus kommt, ist plötzlich die Rede von mehreren Toten, obwohl der Überfall gänzlich unblutig über die Bühne gegangen ist. Da beginnt man plötzlich zu ahnen, was geschehen sein muß und was Meirelles erst in einer Rückblende nachreicht. Der kleine Junge hat sich aus dem Handschuhfach eine Waffe geholt und ist auf eigene Faust in das Haus eingedrungen, wo er fröhlich grinsend ein wehrloses Opfer nach dem anderen erschossen hat, ein Kind, das nicht weiß, was es tut, aber dabei so richtig auf den Geschmack kommt. Gerade diese Eigenheit ist es, die aus dem Jungen später den rücksichtslosesten und gefährlichsten Bandenchef der Favelas macht, einen Mann, der genau weiß, was er tut, wenn er tötet.
In dieser Welt ohne Mitleid zieht Fernando Meirelles alle Register. All die vergleiche mit Scorsese und Tarantino zeigen, daß er seine Lektion gelernt hat. Der Mann hat etwas zu erzählen und er weiß auch wie. Aber am Ende, wenn alle Freundschaften entzwei und alle Hoffnungen zerstört sind, wenn immer noch jüngere Kids dem Tod ins Auge blicken, dann fragt man sich, ob dem Regisseur an seinen Helden wirklich mehr gelegen hat als an dem Hähnchen auf der Flucht. Vielleicht ist also "City of God" letztlich auch nur eine Art Chicken Run.
---
Gangs of Rio de Janeiro
Je größer die Waffen, desto kleiner die Schützen:
Fernando Meirelles` explosiver Film "City of God"
von Hanns-Georg Rodek
Es gab viel zu bestaunen dieses Frühjahr in "Gangs of New York". Martin Scorseses längster, teuerster, schwerstgeborener Film löste laute Bewunderung aus - aber gedämpfte Begeisterung. Wer ab morgen Fernando Meirelles` "City of God" im Kino sieht, wird begreifen, warum.
Beide Filme sind Epen über das Wohl und Wehe einer Stadt. Bei Scorsese erheben sich in anderthalb Jahrzehnten eine Ordnung und ein Staatsgedanke aus dem Chaos, bei Meirelles dauert es ebenso lang, aus der Ordnung ins Chaos zu stürzen. Der Amerikaner erzählt aus der Mitte des 19., der Brasilianer vom Ende des 20. Jahrhunderts. Beide scheinen einander zeitlich und räumlich fern - und sind sich näher, als man glaubt.
Meirelles` New York ist Rio de Janeiro, zynisch "Cidade de Deus" ("Stadt Gottes" ) getauft, ein Slum vor den Toren der Metropole, Abschiebe- und Sackbahnhof für die Armen Rios, die nicht an den Touristenstränden herumlungern sollen.
Zunächst sehen wir Kinder kicken auf den staubtrockenen Ödlanden zwischen ihren erdfarbenen Bungalows. Dann sehen wir Kinder stehlen, einen Lkw mit Propangas, die Flaschen werden verscheuert. Die Kinder werden älter und kühner, überfallen ein Bordell und lassen die Kunden mit Hosen, aber ohne Brieftaschen zurück. Cliquen stecken ihr Territorium ab, und ein Junge, der die Grenzen verletzt, wird vor die Wahl gestellt: Kugel in die Hand oder den Fuß; wir sehen ihn davonhumpeln. Und ein Dreikäsehoch reklamiert die Aufnahme in eine Bande: "Ich rauche und ich schnupfe, ich habe geraubt und getötet", lautet sein Plädoyer. "Ich bin ein Mann."
Das ist das eigentlich Schockierende an Meirelles` drittem Kinofilm. Je größer die eingesetzten Waffen, desto kleiner die Kinder, die sie handhaben. "Gangs of New York" ließ Leonardo DiCaprio erwachsen werden, bevor er seinen Racheplan umsetzte; in "City of God" sind die meisten Hauptfiguren tot, bevor sie DiCaprios Alter erreichen. Und es ist nicht der starke Arm des Gesetzes, der sie zerquetscht; der Groß-Dealer wird von der Waffe eines Knirpses getötet, der nur ein Ziel vor Augen hat: selbst in den Kokain-Handel einzusteigen.
Über die Wirkung von "City of God" zu reden, heißt über Unbekannte zu reden. Über Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Phellipe Haagensen. Meirelles hat mit 200 Straßenkindern acht Monate einen Schauspiel-Workshop veranstaltet und die besten besetzt. Das ergab einen ganz anderen Typ von Gangster als wir ihn kennen, ohne Filzhut, Zweireiher und Baseballschläger. Diese Gangster sind Kinder, ungewaschen und ungekämmt, zerrissene Marken-T-Shirts am dürren Leib, dessen Gewichtslosigkeit man zu spüren glaubt, wenn sie vom neuesten Tatort hinwegfedern. So nahe Meirelles seinen Darstellern in der Vorbereitung war, so dicht bleibt er an seinen Figuren.
"City of God" ist die Antithese zum klagenden Neorealismus des lateinamerikanischen Slum-Kinos der Sechziger. Dieser Film beginnt wie ein Video-Clip (Meirelles hat viele Werbespots inszeniert) mit raschen Schnitten: Eine Klinge wird geschärft, eine Trommel geschlagen, ein Huhn flattert durch die engen Gassen, verfolgt von seinen hungrigen Mördern. "City of God" badet in Lokalkolorit und Testosteron, genießt den Überschwang und die Exzentrizität, platzt wie seine Protagonisten vor ungezähmter Energie - anders als die millimeterscharf durchkalkulierten "Gangs of New York", denen dieser ansteckende Enthusiasmus fehlt.
Es ist ein Film über Armut und Hoffnungslosigkeit und Gewalt, es ist - soweit es so was geben kann - ein lustvoller Film über das Töten. Ja, es gibt ein paar Szenen unwillkürlicher Mythologisierung, und wo Mythen sprießen, wird verharmlost, und übrig bleibt der Glamour spritzenden Bluts. Aber das sind isolierte Momente. Ansonsten seziert Meirelles klinisch präzise Ursachen und Auswirkungen, ohne in Gewalt-Romantik zu verfallen. Sein Film fühlt sich roh an, unpoliert, und selbst die Schüsse klingen echt, nicht aufgemotzt zu Donnerschlägen wie in Hollywood.
Am Anfang von Scorseses wahrlich großem New-York-Film "Goodfellas" bekennt der Erzähler, er habe schon immer ein Gangster werden wollen. Für die Kinder von "City of God" ist dies keine Frage des Wollens. Sie haben keine Wahl.
Info und Trailer: www.city-of-god.de

Morgen kommt ein mit 5 Sternen bewertetes Gangster-Epos des brasilianischen Regisseurs Fernando Meirelles in die Kinos. Er schildert das Leben einer Jugendgang in der Cidade de Deus, der "City of God" – einer der Favelas von Rio de Janeiro. Ich habe gerade zwei Kritiken dazu gelesen und werde mir den Film anschauen:
Die Gangs von Rio: "City of God"
Von Michael Althen
Vielleicht der beste Film der letzten zehn Jahre, wird Bernd Eichinger auf dem Plakat zitiert. Er muß es wissen, schließlich bringt seine Constantin "Cidade de Deus" hierzulande in die Kinos, wo er nun auf gut Deutsch "City of God" heißt.
Der englische Titel mag signalisieren, daß Fernando Meirelles` Film durchaus internationalen Standards entspricht, und tatsächlich wirft er alle Vorstellungen, wie lateinamerikanisches Kino aussehen könnte, locker über den Haufen. Die Geschichte aus den Favelas von Rio bezieht ihren Realismus nicht aus einer besonders ausdauernden Beobachtungsgabe für die Schattenseiten des Lebens, sondern aus der Atemlosigkeit, mit welcher der beschleunigte Herzschlag des Lebens und vor allem Sterbens geschildert wird.
Schon zu Beginn saust immer wieder ein Messer durchs Bild, mit dem Hühner für den Grill zubereitet werden, und diesen Rhythmus nimmt der Schnitt begierig auf, verwandelt das Treiben auf der Straße in einen wilden Tanz, der das ungerührte Schlachten und die ungetrübte Lebenslust verquickt. Als ein Huhn dem Messer entkommt und von einer fröhlichen Menge bewaffneter Jugendlicher durchs Viertel gejagt wird, folgt ihm die Kamera in Bodennähe über Stock und Stein, treppauf, treppab, durch belebte Gassen und befahrene Straßen.
Man könnte einwenden, daß der Film ein bißchen viel Wind um ein einzelnes blödes Huhn macht, daß die Virtuosität in keinem rechten Verhältnis zum Ereignis steht, aber andererseits wird sich herausstellen, daß in dieser Welt ein Menschenleben kaum mehr wert ist als das eines Huhns und unsere Parteinahme für das fliehende Tier ähnlich naiv ist wie jedwede Illusion, mit der man den Überlebensweg der Helden begleitet. Jedenfalls ist von Anfang an klar, daß wir uns in einem Reich der entfesselten Kamera bewegen, die nichts unversucht läßt, die Geschichte nach allen Regeln der Kunst zu akzentuieren.
Nichts scheint improvisiert
"Cidade de Deus" war in Brasilien der ganz große Hit und hat dort Diskussionen über die Mißstände in den Favelas in Gang gebracht. Regisseur Meirelles selbst, der aus Sao Paulo kommt, hatte keine rechte Vorstellung von den wahren Zuständen in dem Slums, als er sich an die Lektüre des Bestsellers "Cidade de Deus" von Paulo Lins machte. Das Buch hat, wie er sagt, ihm die Augen geöffnet und sein Leben verändert. Der Werbefilmer ging nach Rio, castete 300 Amateure und probte dann mit seiner Besetzung ein Jahr lang. Und weil er in einem ähnlichen Slum wie der Cidade de Deus drehte, engagierte er als Coregisseurin Katia Lund, die bereits Erfahrung mit der Arbeit in Favelas mitbrachte. Unter all diesen Umständen ist es umso erstaunlicher, daß im fertigen Film nichts improvisiert erscheint, sondern alles auf fast schon unheimliche Weise kalkuliert wirkt.
Meirelles verfolgt den Weg einer Bande von Jungs aus dem Siedlungsprojekt Cidade de Deus von den Sechzigern bis in die achtziger Jahre hinein - und das Schockierendste an seinem Film ist womöglich, daß sich die Lage in den vergangenen Jahren noch weiter verschlechtert hat, obwohl man sich kaum noch etwas Schlimmeres vorstellen kann als die Kinderbanden, die Cowboy und Indianer mit echten Waffen und echtem Blut spielen. Wenn es losgeht, ist noch alles von einem nostalgischen Sonnengelb durchflutet. In den Siebzigern wird es dann bunt, und danach scheinen die Farben zu erkalten, aber bis dahin ist einen ohnehin das Blut längst in den Adern gefroren.
"City of God" ist ein Drogenthriller, ein "Scarface" im Sambagewand, eine Gewaltorgie, die weitgehend ohne Blut auskommt, aber sonst nichts unversucht läßt, unter die Haut zu gehen. Wenn die Jungs anfangs einen Lastwagen überfallen, dann wirken sie noch wie eine Kinderbande, die zwar mit echten Waffen herumfuchtelt, aber nicht im Traum auf die Idee käme, sie auch zu benutzen. Auch der Überfall auf ein Bordell, bei dem sie die Gesellschaft mit heruntergelassenen Hosen überraschen, wirkt noch wie ein fröhlicher Diebesstreich. Aber schon kurz darauf lehrt uns der Film auf ungeahnte Weise das Fürchten.
Vom Kind zum Bandenchef
Vor dem Überfall haben sie einem kleinen vorlauten Jungen, der sie unbedingt begleiten wollte, eingeschärft, vor dem Bordell auf sie zu warten. Als alle Angestellten und Gäste gefesselt und beraubt sind, finden sie den Junge nicht mehr im Auto und fahren ohne ihn zurück. Als später die Polizei in die Cidade de Deus kommt, ist plötzlich die Rede von mehreren Toten, obwohl der Überfall gänzlich unblutig über die Bühne gegangen ist. Da beginnt man plötzlich zu ahnen, was geschehen sein muß und was Meirelles erst in einer Rückblende nachreicht. Der kleine Junge hat sich aus dem Handschuhfach eine Waffe geholt und ist auf eigene Faust in das Haus eingedrungen, wo er fröhlich grinsend ein wehrloses Opfer nach dem anderen erschossen hat, ein Kind, das nicht weiß, was es tut, aber dabei so richtig auf den Geschmack kommt. Gerade diese Eigenheit ist es, die aus dem Jungen später den rücksichtslosesten und gefährlichsten Bandenchef der Favelas macht, einen Mann, der genau weiß, was er tut, wenn er tötet.
In dieser Welt ohne Mitleid zieht Fernando Meirelles alle Register. All die vergleiche mit Scorsese und Tarantino zeigen, daß er seine Lektion gelernt hat. Der Mann hat etwas zu erzählen und er weiß auch wie. Aber am Ende, wenn alle Freundschaften entzwei und alle Hoffnungen zerstört sind, wenn immer noch jüngere Kids dem Tod ins Auge blicken, dann fragt man sich, ob dem Regisseur an seinen Helden wirklich mehr gelegen hat als an dem Hähnchen auf der Flucht. Vielleicht ist also "City of God" letztlich auch nur eine Art Chicken Run.
---
Gangs of Rio de Janeiro
Je größer die Waffen, desto kleiner die Schützen:
Fernando Meirelles` explosiver Film "City of God"
von Hanns-Georg Rodek
Es gab viel zu bestaunen dieses Frühjahr in "Gangs of New York". Martin Scorseses längster, teuerster, schwerstgeborener Film löste laute Bewunderung aus - aber gedämpfte Begeisterung. Wer ab morgen Fernando Meirelles` "City of God" im Kino sieht, wird begreifen, warum.
Beide Filme sind Epen über das Wohl und Wehe einer Stadt. Bei Scorsese erheben sich in anderthalb Jahrzehnten eine Ordnung und ein Staatsgedanke aus dem Chaos, bei Meirelles dauert es ebenso lang, aus der Ordnung ins Chaos zu stürzen. Der Amerikaner erzählt aus der Mitte des 19., der Brasilianer vom Ende des 20. Jahrhunderts. Beide scheinen einander zeitlich und räumlich fern - und sind sich näher, als man glaubt.
Meirelles` New York ist Rio de Janeiro, zynisch "Cidade de Deus" ("Stadt Gottes" ) getauft, ein Slum vor den Toren der Metropole, Abschiebe- und Sackbahnhof für die Armen Rios, die nicht an den Touristenstränden herumlungern sollen.
Zunächst sehen wir Kinder kicken auf den staubtrockenen Ödlanden zwischen ihren erdfarbenen Bungalows. Dann sehen wir Kinder stehlen, einen Lkw mit Propangas, die Flaschen werden verscheuert. Die Kinder werden älter und kühner, überfallen ein Bordell und lassen die Kunden mit Hosen, aber ohne Brieftaschen zurück. Cliquen stecken ihr Territorium ab, und ein Junge, der die Grenzen verletzt, wird vor die Wahl gestellt: Kugel in die Hand oder den Fuß; wir sehen ihn davonhumpeln. Und ein Dreikäsehoch reklamiert die Aufnahme in eine Bande: "Ich rauche und ich schnupfe, ich habe geraubt und getötet", lautet sein Plädoyer. "Ich bin ein Mann."
Das ist das eigentlich Schockierende an Meirelles` drittem Kinofilm. Je größer die eingesetzten Waffen, desto kleiner die Kinder, die sie handhaben. "Gangs of New York" ließ Leonardo DiCaprio erwachsen werden, bevor er seinen Racheplan umsetzte; in "City of God" sind die meisten Hauptfiguren tot, bevor sie DiCaprios Alter erreichen. Und es ist nicht der starke Arm des Gesetzes, der sie zerquetscht; der Groß-Dealer wird von der Waffe eines Knirpses getötet, der nur ein Ziel vor Augen hat: selbst in den Kokain-Handel einzusteigen.
Über die Wirkung von "City of God" zu reden, heißt über Unbekannte zu reden. Über Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Phellipe Haagensen. Meirelles hat mit 200 Straßenkindern acht Monate einen Schauspiel-Workshop veranstaltet und die besten besetzt. Das ergab einen ganz anderen Typ von Gangster als wir ihn kennen, ohne Filzhut, Zweireiher und Baseballschläger. Diese Gangster sind Kinder, ungewaschen und ungekämmt, zerrissene Marken-T-Shirts am dürren Leib, dessen Gewichtslosigkeit man zu spüren glaubt, wenn sie vom neuesten Tatort hinwegfedern. So nahe Meirelles seinen Darstellern in der Vorbereitung war, so dicht bleibt er an seinen Figuren.
"City of God" ist die Antithese zum klagenden Neorealismus des lateinamerikanischen Slum-Kinos der Sechziger. Dieser Film beginnt wie ein Video-Clip (Meirelles hat viele Werbespots inszeniert) mit raschen Schnitten: Eine Klinge wird geschärft, eine Trommel geschlagen, ein Huhn flattert durch die engen Gassen, verfolgt von seinen hungrigen Mördern. "City of God" badet in Lokalkolorit und Testosteron, genießt den Überschwang und die Exzentrizität, platzt wie seine Protagonisten vor ungezähmter Energie - anders als die millimeterscharf durchkalkulierten "Gangs of New York", denen dieser ansteckende Enthusiasmus fehlt.
Es ist ein Film über Armut und Hoffnungslosigkeit und Gewalt, es ist - soweit es so was geben kann - ein lustvoller Film über das Töten. Ja, es gibt ein paar Szenen unwillkürlicher Mythologisierung, und wo Mythen sprießen, wird verharmlost, und übrig bleibt der Glamour spritzenden Bluts. Aber das sind isolierte Momente. Ansonsten seziert Meirelles klinisch präzise Ursachen und Auswirkungen, ohne in Gewalt-Romantik zu verfallen. Sein Film fühlt sich roh an, unpoliert, und selbst die Schüsse klingen echt, nicht aufgemotzt zu Donnerschlägen wie in Hollywood.
Am Anfang von Scorseses wahrlich großem New-York-Film "Goodfellas" bekennt der Erzähler, er habe schon immer ein Gangster werden wollen. Für die Kinder von "City of God" ist dies keine Frage des Wollens. Sie haben keine Wahl.
Info und Trailer: www.city-of-god.de
.
Pleiten-Prognose
650.000 Arbeitsplätze bedroht
Die Inkasso-Unternehmen schlagen Alarm. Deutschland droht in diesem Jahr der vierte Pleiterekord in Folge - mit fatalen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
2003 müssten erstmals deutlich über 40.000 Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter antreten, heißt es in einer aktuellen Prognose des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). 2002 waren es noch 37.579 - auch das eine bisher unübertroffene Zahl.
Der pessimistische Ausblick für dieses Jahr basiert auf dramatischen Daten. Schon im Januar sind die Insolvenz-Meldungen nochmals in die Höhe geschnellt. Bundesweit mussten 3245 Unternehmen zum Konkursrichter, das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 19,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtzahl der Insolvenzen - Privatleute eingeschlossen - stieg im ersten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 8158.
Von den Unternehmenszusammenbrüchen sind laut Verband 650.000 Jobs bedroht. Der Gesamtschaden für die Volkswirtschaft wird nach BDIU-Rechnung rund 50 Milliarden Euro betragen. Gleichzeitig erwartet der Verband, dass in diesem Jahr 58.000 Privatleute Insolvenz anmelden müssen.
"Die Zahlungsmoral hat sich in ganz Deutschland verschlechtert", sagte Verbandschef Dieter Plambeck. In einer BDIU-Umfrage erklärten fast zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen, dass private und gewerbliche Schuldner heute schlechter zahlen als vor sechs Monaten. Dies treibt laut Plambeck vor allem kleinere Handwerks- und Baubetriebe in den Ruin. In der Insolvenzstatistik sei der Bau "einsame Spitze". Jeder vierte Pleitier kommt laut BDIU-Zahlen aus dieser Branche, die als wichtiger Indikator für einen konjunkturellen Auf- oder Abschwung gilt.
Vor allem ostdeutsche Unternehmen seien von der Pleitewelle bedroht. So haben etwa Firmen in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge ein dreifach höheres Insolvenzrisiko als in Hessen, Bayern oder Baden-Württemberg.
Grund für die schlechtere Zahlungsmoral der Verbraucher ist laut BDIU eine teils drastische Überschuldung. Mehr als zweieinhalb Millionen Haushalte können ihren Zahlungspflichen nicht mehr nachkommen - viele davon mit Kindern. Bei den Jugendlichen gilt bereits etwa eine Viertelmillion als überschuldet. "Kleidung und Handy sind für die Jugendlichen die größte Schuldenfalle", sagte Plambeck.
SPIEGEL ONLINE - 07. Mai 2003
Pleiten-Prognose
650.000 Arbeitsplätze bedroht
Die Inkasso-Unternehmen schlagen Alarm. Deutschland droht in diesem Jahr der vierte Pleiterekord in Folge - mit fatalen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
2003 müssten erstmals deutlich über 40.000 Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter antreten, heißt es in einer aktuellen Prognose des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). 2002 waren es noch 37.579 - auch das eine bisher unübertroffene Zahl.
Der pessimistische Ausblick für dieses Jahr basiert auf dramatischen Daten. Schon im Januar sind die Insolvenz-Meldungen nochmals in die Höhe geschnellt. Bundesweit mussten 3245 Unternehmen zum Konkursrichter, das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 19,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtzahl der Insolvenzen - Privatleute eingeschlossen - stieg im ersten Monat des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 8158.
Von den Unternehmenszusammenbrüchen sind laut Verband 650.000 Jobs bedroht. Der Gesamtschaden für die Volkswirtschaft wird nach BDIU-Rechnung rund 50 Milliarden Euro betragen. Gleichzeitig erwartet der Verband, dass in diesem Jahr 58.000 Privatleute Insolvenz anmelden müssen.
"Die Zahlungsmoral hat sich in ganz Deutschland verschlechtert", sagte Verbandschef Dieter Plambeck. In einer BDIU-Umfrage erklärten fast zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen, dass private und gewerbliche Schuldner heute schlechter zahlen als vor sechs Monaten. Dies treibt laut Plambeck vor allem kleinere Handwerks- und Baubetriebe in den Ruin. In der Insolvenzstatistik sei der Bau "einsame Spitze". Jeder vierte Pleitier kommt laut BDIU-Zahlen aus dieser Branche, die als wichtiger Indikator für einen konjunkturellen Auf- oder Abschwung gilt.
Vor allem ostdeutsche Unternehmen seien von der Pleitewelle bedroht. So haben etwa Firmen in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge ein dreifach höheres Insolvenzrisiko als in Hessen, Bayern oder Baden-Württemberg.
Grund für die schlechtere Zahlungsmoral der Verbraucher ist laut BDIU eine teils drastische Überschuldung. Mehr als zweieinhalb Millionen Haushalte können ihren Zahlungspflichen nicht mehr nachkommen - viele davon mit Kindern. Bei den Jugendlichen gilt bereits etwa eine Viertelmillion als überschuldet. "Kleidung und Handy sind für die Jugendlichen die größte Schuldenfalle", sagte Plambeck.
SPIEGEL ONLINE - 07. Mai 2003
.
"Wir müssen ganze Stadtteile schließen"
Erster Fachkongress zum Stadtumbau West: Jetzt drohen auch in den alten Bundesländern massive Wohnungsleerstände
von Dankwart Guratzsch
Die "schrumpfende Gesellschaft" wirft nun auch im Westen Deutschlands ihre Schatten voraus. Überalterung und Leerstände unbekannter Größenordnung werden das Bild auch der westdeutschen Städte prägen - nachdem der Osten Deutschlands schon heute einen Wohnungsleerstand von 1,4 Mio. Wohnungen verkraften muss. Auf der ersten bundesweiten Konferenz "Stadtumbau West" in Bremen räumte der Staatssekretär im Bundesbauministerium, Achim Großmann, jetzt ein, dass es erste Anzeichen dieser Entwicklung gibt: "Verluste an Einwohnern und Arbeitsplätzen stellen einzelne Regionen und Kommunen in Westdeutschland zunehmend vor die Herausforderung, ihre Städte den demographischen und wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen."
Die Experten der Wohnungswirtschaft deuteten dies als eine eher beschwichtigende Beschreibung. "In Städten wie Essen müssen wir uns auf einen dramatischen Bevölkerungsrückgang von mehr als zehn Prozent in nur 15 Jahren einstellen - mit dramatischen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt: Bis 2020 haben wir hier mit 24 000 leerstehenden Wohnungen zu rechnen, das sind 20 Prozent des Bestandes", so Prof. Volker Eichener (Inwis GmbH, Bochum). Eichener warf den Politikern vor, sich damit schwer zu tun, die Tragweite der Schrumpfungsprozesse zu begreifen: "Tatsächlich hätte man schon vor zwanzig Jahren reagieren müssen."
Übereinstimmend bezeichneten die Experten das sich erstmals seit dem Dreißigjährigen Krieg stellende Problem der Schrumpfung als "epochal". Norbert Portz, Beigeordneter für Umwelt und Städtebau beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, Bonn: "Die Verlierer sind gerade jene Städte, die im 19. und 20. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung explosionsartig gewachsen sind und sich monostrukturell entwickelt haben." Betroffen sind aber auch kleine Gemeinden wie Selb und Wildflecken im Nordosten Bayerns, die ihre wirtschaftliche Basis verloren und massive Bevölkerungsverluste zu verkraften haben. So gehen der Gemeinde Wildflecken in der bayerischen Rhön nach dem Abzug der US-Soldaten zwei Drittel der Bevölkerung verloren.
Die tiefen sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen des jetzt auf ganz Deutschland ausgreifenden Schrumpfungsprozesses werden seit dem vergangenen Jahr im Forschungsfeld "Stadtumbau West" im Rahmen des Programms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt) der Bundesregierung analysiert. Parallel zu dem mit 2,7 Mrd. Euro ausgestatteten Programm "Stadtumbau Ost" werden dabei mit Finanzhilfen des Bundes von 15 Mio. Euro (und einem etwa gleich hohen Beitrag der Bundesländer) "Projektwerkstätten" initiiert, die "Pilotstadtprofile" zu den Themen "Stadt im Strukturwandel" und "Wohngebiet im Wandel" erarbeiten sollen.
Dabei geht es laut Großmann nicht darum, neue städtebauliche Instrumente für die Bewältigung der Anpassungsprozesse zu erfinden, sondern darum, diese mit Blick auf die epochalen Stagnations- und Schrumpfungstendenzen zu überprüfen. Unter anderem müssten zwei grundsätzliche Fragen geklärt werden: Brauchen wir mehr Regionalisierung in der Städtebauförderung? Brauchen wir eine Förderinitiative "Stadtumbau West"? Insgesamt wurden elf Pilotstädte ausgewählt, in denen sich die Dramatik der Prozesse schon jetzt abzeichnet:
- Hochhaussiedlung Tenever in Bremen (Bevölkerungsverlust seit 1995 11,5 Prozent, Arbeitslosenquote 25 Prozent, Leerstände bis zu 44 Prozent).
- Großsiedlung Lübeck-Buntekuh (Bevölkerungsverlust 5,7 Prozent, Arbeitslosenquote 16,3 Prozent).
- Bergbaustadt Oer-Erkenschwick (Wohnsiedlung Schillerpark mit wachsenden Leerständen: 2002 bereits 15 Prozent);
- Schuhstadt Pirmasens (Verlust 15 000 Arbeitsplätze in der Schuhindustrie, Abzug der Amerikaner, 20 Prozent Arbeitslosigkeit, Verlust von 5000 Einwohnern);
- Porzellanstadt Selb (Schrumpfung von 24 000 auf 18 000 Einwohner, Wohnungsleerstände von zehn bis 14 Prozent);
- Stahlstadt Völklingen (Leerstand von 40 Prozent der Einzelhandelsflächen im Zentrum, jährlicher Bevölkerungsverlust 0,8 Prozent);
- Landgemeinde Wildflecken (Konversionsfläche von 30 Hektar, 30 Prozent Leerstand im Geschosswohnungsbau);
- Marinestadt Wilhelmshaven (20 Prozent Arbeitslose, Prognose für zwei Siedlungen bis 2010: 3700 leerstehende Wohnungen);
- Textilstadt Albstadt (seit 1993 2000 Einwohner verloren, Wegfall von zwei Drittel aller Arbeitsplätze, zunehmende Leerstände im Mietwohnungsbereich);
- Seestadt Bremerhaven (in zehn Jahren 10 000 Einwohner verloren, Leerstand sechs Prozent);
- Stahlstadt Salzgitter (bis 2015 Schrumpfung von 112 000 auf 96 500 Einwohner).
Übereinstimmendes Kennzeichen aller Krisenstandorte ist der überproportionale Bevölkerungsrückgang auf Grund wirtschaftlicher Strukturbrüche und einer davon ausgelösten massenhaften Abwanderung. Angesichts derartiger Prozesse halten Experten wie Dietrich Henckel vom Deutschen Institut für Urbanistik, Berlin, die Parole "Stadtumbau" für eine "massive Beschönigung".
Henckel in Bremen: "Es geht nicht um Ausdünnung, sondern radikalen Rückbau [ das ist "Expertendeutsch" und heißt übersetzt nichts anderes als: Abriss ] - bis hin zur Schließung ganzer Stadtteile."
] - bis hin zur Schließung ganzer Stadtteile."
DIE WELT - 7. Mai 2003
"Wir müssen ganze Stadtteile schließen"
Erster Fachkongress zum Stadtumbau West: Jetzt drohen auch in den alten Bundesländern massive Wohnungsleerstände
von Dankwart Guratzsch
Die "schrumpfende Gesellschaft" wirft nun auch im Westen Deutschlands ihre Schatten voraus. Überalterung und Leerstände unbekannter Größenordnung werden das Bild auch der westdeutschen Städte prägen - nachdem der Osten Deutschlands schon heute einen Wohnungsleerstand von 1,4 Mio. Wohnungen verkraften muss. Auf der ersten bundesweiten Konferenz "Stadtumbau West" in Bremen räumte der Staatssekretär im Bundesbauministerium, Achim Großmann, jetzt ein, dass es erste Anzeichen dieser Entwicklung gibt: "Verluste an Einwohnern und Arbeitsplätzen stellen einzelne Regionen und Kommunen in Westdeutschland zunehmend vor die Herausforderung, ihre Städte den demographischen und wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen."
Die Experten der Wohnungswirtschaft deuteten dies als eine eher beschwichtigende Beschreibung. "In Städten wie Essen müssen wir uns auf einen dramatischen Bevölkerungsrückgang von mehr als zehn Prozent in nur 15 Jahren einstellen - mit dramatischen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt: Bis 2020 haben wir hier mit 24 000 leerstehenden Wohnungen zu rechnen, das sind 20 Prozent des Bestandes", so Prof. Volker Eichener (Inwis GmbH, Bochum). Eichener warf den Politikern vor, sich damit schwer zu tun, die Tragweite der Schrumpfungsprozesse zu begreifen: "Tatsächlich hätte man schon vor zwanzig Jahren reagieren müssen."
Übereinstimmend bezeichneten die Experten das sich erstmals seit dem Dreißigjährigen Krieg stellende Problem der Schrumpfung als "epochal". Norbert Portz, Beigeordneter für Umwelt und Städtebau beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, Bonn: "Die Verlierer sind gerade jene Städte, die im 19. und 20. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung explosionsartig gewachsen sind und sich monostrukturell entwickelt haben." Betroffen sind aber auch kleine Gemeinden wie Selb und Wildflecken im Nordosten Bayerns, die ihre wirtschaftliche Basis verloren und massive Bevölkerungsverluste zu verkraften haben. So gehen der Gemeinde Wildflecken in der bayerischen Rhön nach dem Abzug der US-Soldaten zwei Drittel der Bevölkerung verloren.
Die tiefen sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen des jetzt auf ganz Deutschland ausgreifenden Schrumpfungsprozesses werden seit dem vergangenen Jahr im Forschungsfeld "Stadtumbau West" im Rahmen des Programms "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt) der Bundesregierung analysiert. Parallel zu dem mit 2,7 Mrd. Euro ausgestatteten Programm "Stadtumbau Ost" werden dabei mit Finanzhilfen des Bundes von 15 Mio. Euro (und einem etwa gleich hohen Beitrag der Bundesländer) "Projektwerkstätten" initiiert, die "Pilotstadtprofile" zu den Themen "Stadt im Strukturwandel" und "Wohngebiet im Wandel" erarbeiten sollen.
Dabei geht es laut Großmann nicht darum, neue städtebauliche Instrumente für die Bewältigung der Anpassungsprozesse zu erfinden, sondern darum, diese mit Blick auf die epochalen Stagnations- und Schrumpfungstendenzen zu überprüfen. Unter anderem müssten zwei grundsätzliche Fragen geklärt werden: Brauchen wir mehr Regionalisierung in der Städtebauförderung? Brauchen wir eine Förderinitiative "Stadtumbau West"? Insgesamt wurden elf Pilotstädte ausgewählt, in denen sich die Dramatik der Prozesse schon jetzt abzeichnet:
- Hochhaussiedlung Tenever in Bremen (Bevölkerungsverlust seit 1995 11,5 Prozent, Arbeitslosenquote 25 Prozent, Leerstände bis zu 44 Prozent).
- Großsiedlung Lübeck-Buntekuh (Bevölkerungsverlust 5,7 Prozent, Arbeitslosenquote 16,3 Prozent).
- Bergbaustadt Oer-Erkenschwick (Wohnsiedlung Schillerpark mit wachsenden Leerständen: 2002 bereits 15 Prozent);
- Schuhstadt Pirmasens (Verlust 15 000 Arbeitsplätze in der Schuhindustrie, Abzug der Amerikaner, 20 Prozent Arbeitslosigkeit, Verlust von 5000 Einwohnern);
- Porzellanstadt Selb (Schrumpfung von 24 000 auf 18 000 Einwohner, Wohnungsleerstände von zehn bis 14 Prozent);
- Stahlstadt Völklingen (Leerstand von 40 Prozent der Einzelhandelsflächen im Zentrum, jährlicher Bevölkerungsverlust 0,8 Prozent);
- Landgemeinde Wildflecken (Konversionsfläche von 30 Hektar, 30 Prozent Leerstand im Geschosswohnungsbau);
- Marinestadt Wilhelmshaven (20 Prozent Arbeitslose, Prognose für zwei Siedlungen bis 2010: 3700 leerstehende Wohnungen);
- Textilstadt Albstadt (seit 1993 2000 Einwohner verloren, Wegfall von zwei Drittel aller Arbeitsplätze, zunehmende Leerstände im Mietwohnungsbereich);
- Seestadt Bremerhaven (in zehn Jahren 10 000 Einwohner verloren, Leerstand sechs Prozent);
- Stahlstadt Salzgitter (bis 2015 Schrumpfung von 112 000 auf 96 500 Einwohner).
Übereinstimmendes Kennzeichen aller Krisenstandorte ist der überproportionale Bevölkerungsrückgang auf Grund wirtschaftlicher Strukturbrüche und einer davon ausgelösten massenhaften Abwanderung. Angesichts derartiger Prozesse halten Experten wie Dietrich Henckel vom Deutschen Institut für Urbanistik, Berlin, die Parole "Stadtumbau" für eine "massive Beschönigung".
Henckel in Bremen: "Es geht nicht um Ausdünnung, sondern radikalen Rückbau [ das ist "Expertendeutsch" und heißt übersetzt nichts anderes als: Abriss
 ] - bis hin zur Schließung ganzer Stadtteile."
] - bis hin zur Schließung ganzer Stadtteile."DIE WELT - 7. Mai 2003
.
So, und wer den vorherigen Beitrag #380 gelesen hat, kann jetzt mal genau vergleichen und sehen, wie verlogen da von den Interessenverbänden argumentiert wird und wie schlichte Tatsachen einfach auf den kopf gestellt werden !

Versicherungskrise stärkt Immobilienmarkt
Maklerverband VDM sieht nach Börsenkrise und Mindestzins-Senkung eine spürbar höhere Nachfrage nach Sachwerten
Die schwere Krise der Lebensversicherungskonzerne beschert Deutschlands Immobilienmaklern eine spürbar stärkere Nachfrage. Denn seit die klassische Kapitallebensversicherung für die Altersvorsorge ins Gerede gekommen ist, sorgen sich Anleger um ihr Erspartes und suchen ihr Heil wieder vermehrt in krisensicheren Sachwertanlagen. Dies erklärte Jürgen Michael Schick, Sprecher des Verbandes Deutscher Makler (VDM) in Berlin.
"Als die Kurse an den Aktienmärkten in den Keller fielen, dachten viele Anleger, das wäre nur ein zwischenzeitliches Tief. Jetzt sehen die Sparer aber auf den regelmäßigen Mitteilungen ihrer Lebensversicherung, wie die Überschussbeteiligung immer weiter dahinschmilzt", sagte Schick.
Vor allem bei noch langen Restlaufzeiten wirke sich dies - bedingt durch den Zinseszinseffekt - deutlicher aus als bei kürzeren. Und spätestens jetzt schrillten bei vielen die Alarmglocken. Ohne die üppigen Überschüsse, mit denen viele Lebensversicherer noch bis vor kurzem geworben hätten, platze der Traum vom sorgenfreien Leben im Alter.
In der Folge verspürten die Makler in ganz Deutschland im neuen Jahr bereits eine deutlich größere Nachfrage nach Immobilien jeder Couleur. Besonders gefragt seien dabei Anlageimmobilien, die dem Käufer eine durchschnittliche Rendite zwischen fünf und acht Prozent bringen. "Das ist schnell das Doppelte des gesetzlichen Garantiezinses, den viele Lebensversicherungen gerade noch mit aller Not erwirtschaften", rechnet der VDM-Sprecher vor.
Auch die Nachfrage nach selbstgenutzten Immobilien sei mittlerweile wieder gestiegen. Eigentumswohnungen in Innenstadtlagen und für Familien das eigene Haus mit Garten rückten wieder vermehrt in den Fokus der Anleger. Zumal gerade die deutschen Immobilienmärkte mit ihren meist günstigen Preisen und historisch niedrigen Hypothekenzinsen das ideale Käuferumfeld darstellten.
Die finanziell angeschlagenen Anbieter von Lebensversicherungen könnten zwar auf die Hilfe von der Bundesregierung hoffen. Der gesetzlich garantierte Mindestzins, den die Versicherer ihren Kunden für eine Kapitalpolice zusichern müssten, werde aller Wahrscheinlichkeit nach von 3,25 auf 2,75 Prozent abgesenkt, kennt Schick die Marktberichte. Schick: "Das heißt, dass ein Ende der Talfahrt noch nicht abzusehen ist. Wer bei seinem Vermögensaufbau auf Nummer Sicher gehen will, ist mit einem Direktinvestment in Immobilien auf der richtigen Seite."
Wer die Lage des Objekts, die Baubeschaffenheit des Hauses und die mittelfristig realisierbaren Mieterträge genau geprüft habe, könne sein Immobilienengagement überblicken. "Rückschläge wie jetzt bei den Lebensversicherungen bleiben Hausbesitzern, die die passende Immobilie gefunden haben, erspart", erklärte Maklersprecher Schick.
Eine ganze Reihe von Immobilienbesitzern wird die Krise der Lebensversicherungen besonders spüren: jene, die ihre Betongold-Anlage mit einer Kapitallebensversicherung refinanziert haben. Sie laufen Gefahr, am Ende der Laufzeit wegen der geringeren Zinserträge mit der Ablaufleistung nicht wie erwartet die Hypothek der Versicherung auf einmal abtragen zu können.
So, und wer den vorherigen Beitrag #380 gelesen hat, kann jetzt mal genau vergleichen und sehen, wie verlogen da von den Interessenverbänden argumentiert wird und wie schlichte Tatsachen einfach auf den kopf gestellt werden !

Versicherungskrise stärkt Immobilienmarkt
Maklerverband VDM sieht nach Börsenkrise und Mindestzins-Senkung eine spürbar höhere Nachfrage nach Sachwerten
Die schwere Krise der Lebensversicherungskonzerne beschert Deutschlands Immobilienmaklern eine spürbar stärkere Nachfrage. Denn seit die klassische Kapitallebensversicherung für die Altersvorsorge ins Gerede gekommen ist, sorgen sich Anleger um ihr Erspartes und suchen ihr Heil wieder vermehrt in krisensicheren Sachwertanlagen. Dies erklärte Jürgen Michael Schick, Sprecher des Verbandes Deutscher Makler (VDM) in Berlin.
"Als die Kurse an den Aktienmärkten in den Keller fielen, dachten viele Anleger, das wäre nur ein zwischenzeitliches Tief. Jetzt sehen die Sparer aber auf den regelmäßigen Mitteilungen ihrer Lebensversicherung, wie die Überschussbeteiligung immer weiter dahinschmilzt", sagte Schick.
Vor allem bei noch langen Restlaufzeiten wirke sich dies - bedingt durch den Zinseszinseffekt - deutlicher aus als bei kürzeren. Und spätestens jetzt schrillten bei vielen die Alarmglocken. Ohne die üppigen Überschüsse, mit denen viele Lebensversicherer noch bis vor kurzem geworben hätten, platze der Traum vom sorgenfreien Leben im Alter.
In der Folge verspürten die Makler in ganz Deutschland im neuen Jahr bereits eine deutlich größere Nachfrage nach Immobilien jeder Couleur. Besonders gefragt seien dabei Anlageimmobilien, die dem Käufer eine durchschnittliche Rendite zwischen fünf und acht Prozent bringen. "Das ist schnell das Doppelte des gesetzlichen Garantiezinses, den viele Lebensversicherungen gerade noch mit aller Not erwirtschaften", rechnet der VDM-Sprecher vor.
Auch die Nachfrage nach selbstgenutzten Immobilien sei mittlerweile wieder gestiegen. Eigentumswohnungen in Innenstadtlagen und für Familien das eigene Haus mit Garten rückten wieder vermehrt in den Fokus der Anleger. Zumal gerade die deutschen Immobilienmärkte mit ihren meist günstigen Preisen und historisch niedrigen Hypothekenzinsen das ideale Käuferumfeld darstellten.
Die finanziell angeschlagenen Anbieter von Lebensversicherungen könnten zwar auf die Hilfe von der Bundesregierung hoffen. Der gesetzlich garantierte Mindestzins, den die Versicherer ihren Kunden für eine Kapitalpolice zusichern müssten, werde aller Wahrscheinlichkeit nach von 3,25 auf 2,75 Prozent abgesenkt, kennt Schick die Marktberichte. Schick: "Das heißt, dass ein Ende der Talfahrt noch nicht abzusehen ist. Wer bei seinem Vermögensaufbau auf Nummer Sicher gehen will, ist mit einem Direktinvestment in Immobilien auf der richtigen Seite."
Wer die Lage des Objekts, die Baubeschaffenheit des Hauses und die mittelfristig realisierbaren Mieterträge genau geprüft habe, könne sein Immobilienengagement überblicken. "Rückschläge wie jetzt bei den Lebensversicherungen bleiben Hausbesitzern, die die passende Immobilie gefunden haben, erspart", erklärte Maklersprecher Schick.
Eine ganze Reihe von Immobilienbesitzern wird die Krise der Lebensversicherungen besonders spüren: jene, die ihre Betongold-Anlage mit einer Kapitallebensversicherung refinanziert haben. Sie laufen Gefahr, am Ende der Laufzeit wegen der geringeren Zinserträge mit der Ablaufleistung nicht wie erwartet die Hypothek der Versicherung auf einmal abtragen zu können.
.
Schlaraffenland ist abgebrannt
Berlin streicht Subventionen für den Wohnungsbau: Ehemals lukrative Steuersparmodelle werden für die Zeichner von Immobilienfonds zum finanziellen Desaster
Von Marie-Luise Hauch-Fleck und Frank Schulte
Sichere Einnahmen und das wohlige Gefühl, dem Fiskus ein Schnippchen zu schlagen: Das ist es, wovon viele Bestverdiener träumen, die ihr Geld vor der Steuer retten wollen. Solche Angebote aber sind rar. Für eine ausgewählte Klientel wohlhabender Bundesbürger allerdings schien sich dieser Traum tatsächlich zu erfüllen: die Zeichner geschlossener Immobilienfonds in Berlin.
Deren Anbieter, bestens vertraut mit Berliner Eigenheiten und fest verankert in der örtlichen Politik, haben vor allem dort investiert, wo üblicherweise nicht das große Geld zu machen ist: im sozialen Wohnungsbau. Doch in der ehemaligen Frontstadt ist vieles anders als im Rest der Republik.
Dort nahm der Senat den Investoren praktisch jedes Risiko ab. Reichte die Miete nicht aus, um die Baukosten zu decken, half das Land nicht nur großzügig mit Aufwendungsdarlehen, die 30 Jahre zins- und tilgungsfrei sind. Außerdem gab es direkte Zuschüsse, die überhaupt nicht zurückgezahlt werden müssen. Voraussetzung war nur, dass die Vorhaben von der zuständigen Bewilligungsstelle, der landeseigenen Wohnungsbaukreditanstalt – inzwischen in Investitionsbank Berlin umbenannt – als förderfähig anerkannt wurden. Überdurchschnittlich hohe Baukosten waren kein Hinderungsgrund. Die Subventionen wurden grundsätzlich für 15 Jahre garantiert und dann traditionell als so genannte Anschlussförderung noch einmal um weitere 15 Jahre verlängert.
Für Fondsanbieter und Käufer war das ein konkurrenzlos gutes Geschäft. Erstere verdienten prächtig an allerlei Dienstleistungen wie Beratung oder Baubetreuung, die sie den Gesellschaftern in Rechnung stellten. Denen wiederum war egal, dass dadurch die gesamten Kosten in die Höhe getrieben wurden. Dafür, dass unterm Strich genug Geld da war, um alles zu bezahlen, auch wenn die Mieten nicht reichten, garantierte ihnen nach Fertigstellung der Wohnungen der Berliner Senat. Und vorher waren ihnen bilanzielle Verluste sogar hoch willkommen. Die minderten schließlich ihre Steuerlast.
Die Angst der Anleger
Dieses schöne System funktionierte seit Beginn der siebziger Jahre stets wie geschmiert. Dass das Land Berlin eines Tages die Anschlussförderung kappen könnte, kam deshalb auch niemandem in den Sinn. „Das wurde so weit weggeschoben wie die Möglichkeit, dass man sein Geld mit Bundesschatzbriefen verliert, weil Deutschland pleite ist“, beschreibt ein Fondsverkäufer die allgemein herrschende Zuversicht.
Pleite ist nicht der Bund, wohl aber Berlin. Am 3. Februar entschied das Berliner Abgeordnetenhaus deshalb, dass es zukünftig keine Anschlussförderung mehr gibt. Die hätte das Land bis 2029 immerhin 2,5 Milliarden Euro gekostet. Betroffen vom Förderstopp sind 25000 Wohnungen, für die zwischen 1987 und 1997 erstmals eine Förderung bewilligt worden war. Rund 13000 davon gehören privaten Immobilienfonds, der Rest städtischen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften.
Seither ist es mit der Ruhe dieser Fondsgesellschafter vorbei. „Die Leute haben jetzt Existenzangst“, sagt Frank-Michael Demuth, Geschäftsführer der R&W Immobilienanlagen. Für zwei Fonds dieser Gesellschaft gibt es schon kein Geld vom Staat mehr. Klagen dagegen hatten bisher keinen Erfolg. Inzwischen dämmert nicht nur deren Gesellschaftern, dass aus einem vermeintlich attraktiven, risikolosen Investment, mit dem man so schön Steuern sparen konnte, eine erhebliche finanzielle Belastung zu werden droht.
Für Hiltrud Sprungalla, die Geschäftsführerin des Landesverbandes freier Wohnungsunternehmen (IfW), der die Interessen der Fondsanbieter vertritt, ist das Votum der Abgeordneten denn auch ein „unglaublicher Vorgang“, eine „modellhafte Enteignung“. Alle seien davon ausgegangen, dass 30 Jahre gefördert werde. Schließlich, so Sprungalla „geht das Konzept nicht anders auf“.
Das ist wohl wahr. Unter der Schirmherrschaft des Berliner Politestablishments konnten Fondsanbieter und Bauunternehmen zulasten des Staatshaushalts frei schalten und walten. Die Folge sind absurd hohe Kostenmieten von bis zu 21,65 Euro je Quadratmeter für Bleiben, die „überwiegend zum Segment der einfachen Wohnungen“ gehören, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) konstatiert.
Am freien Markt werden für ähnliche Wohnungen sechs bis sieben Euro verlangt. Für die einkommensschwache Klientel von geförderten Wohnungen hat der Senat Mieten von durchschnittlich vier Euro pro Quadratmeter festgelegt. Für die Fonds kein Problem: Die Differenz von bis zu 16 Euro zur Kostenmiete zahlte ja das Land.
Dass die Kosten im Berliner Sozialwohnungsbau exorbitant höher als in anderen Bundesländern sind, hatte das DIW schon 1993 in einem Gutachten für den Senat festgestellt. Danach lagen allein die reinen Baukosten ohne Finanzierungskosten in der Landeshauptstadt um 56 Prozent über denen in Hamburg, ohne dass es, so die Gutachter, Qualitätsunterschiede gab. Die spannende Frage, „warum Bauleistungen in Berlin teurer angeboten werden“ als anderswo in der Republik, beantwortet das Papier leider nicht. An den Löhnen jedenfalls lag es nicht. Die waren bei allen untersuchten Gewerken sogar niedriger als in der Hansestadt. Dafür waren die Baunebenkosten wie Architekten- und Ingenieurleistungen oder Verwaltungsleistungen der Bauherren um 88 Prozent auffällig viel höher.
Vor der Wende wurden die hohen Baukosten von Fondsanbietern und Bauunternehmern stets mit der Insellage der Stadt begründet. Als die Mauer gefallen war und die Preise trotzdem noch weiter anzogen, hieß es schlicht, in Berlin könne man einfach nicht billiger bauen. Das sei, so das DIW in einem Gutachten im Auftrag des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen „ökonomisch kaum zu erklären“.
Politisch vielleicht schon. Denn die Beziehungen zwischen Fonds, Bauunternehmen und Politikern waren in Berlin schon immer gut. So gehört beispielsweise Klaus Groth, Bauunternehmer und gemeinsam mit dem Architekten Dieter Graalfs einer der aktivsten Fondsanbieter, nicht nur zu den großzügigen Spendern seiner eigenen Partei, der CDU. SPD und FDP hat er ebenfalls bedacht. Auch CDU-Mitglied Dietmar Otremba, der seiner Partei über die Jahre viele Millionen gespendet hat, ist nicht nur einer der großen Berliner Bauunternehmer, sondern über gemeinsame Immobilienfirmen und Dienstleistungsgesellschaften geschäftlich mit Wolfgang Görlich, einem der größten Berliner Fondsinitiatoren, verbunden.
Eine ehrenwerte Gesellschaft
Deren Anträge segnete die Wohnungsbaukreditanstalt ab. Dort bestimmten „Politiker – von der SPD Klaus Riebschläger (Senator und später Rechtsanwalt von Klaus Groth) und der CDU-Politiker Klaus Landowsky (später Vorstandssprecher der Berliner Hyp)–, wer Zuschüsse und Kredite erhält“ , schreibt der Journalist Mathew Rose in seinem gerade erschienenen Buch Eine ehrenwerte Gesellschaft, das die Hintergründe der Beinahe-Pleite der Berliner Bankgesellschaft beleuchtet. Eine Kostendecklung als Voraussetzung für eine Förderung verlangte die landeseigene Bank erstaunlicherweise nie.
Um die abstruse Relation zwischen Aufwand und Ertrag der von ihren Fonds finanzierten Objekte machten sich die Anleger bis zum 3. Februar keine Sorgen. Ihre teilweise immensen Kosten wurden ja anstandslos größtenteils mit Steuergroschen finanziert. Auch ihren vordringlichen Wunsch, die eigene Steuerlast gleichwohl möglichst zu minimieren, hatten die Fonds zuverlässig erfüllt – nicht zuletzt durch geschickte Wahl der Rechtsform. „Die war regelmäßig an steuerlichen Gesichtspunkten orientiert“, bestätigt der Berliner Anlegeranwalt Wolfgang Schirp.
Bei den besonders gut verdienenden Anlegern waren Fonds, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) firmieren, deshalb besonders beliebt. Der Grund: Verluste aus einer solchen Beteiligung konnten unbegrenzt mit anderen Einkünften verrechnet werden. „Viele Gutverdienende haben offenbar bis Mitte der neunziger Jahre routinemäßig jedes Jahr Beträge von 50000 bis 100000 Euro gezeichnet“, sagt Martin Klingsporn, Chefredakteur des DFI-Gerlach Reports. Und sitzen damit nun, warnt Klingsporn, „auf einer Haftungsbombe“.
Sozusagen als Gegenleistung für die unbegrenzte Abzugfähigkeit von Verlusten müssen GbR-Gesellschafter laut Steuerrecht nicht nur mit ihrer Fondseinlage, sondern mit ihrem Gesamtvermögen haften. „Wer glaubte, 50000 Euro angelegt zu haben, sieht sich nun einer möglichen Haftung in Millionenhöhe gegenüber“ , warnt Anwalt Schirp. Nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen sind die Fondsobjekte in der Regel bis zu 80 Prozent fremdfinanziert. Reichen nun die Einnahmen nicht mehr aus, um Zinsen und Tilgung zu finanzieren, müssen die Gesellschafter das Geld aus ihren sonstigen Einnahmen aufbringen. Können sie das nicht, droht die Zwangsvollstreckung in das private Vermögen. Die selbst bewohnte Villa ist dann nicht mehr sicher vor dem Zugriff der Banken.
Im Vergleich dazu kommen Anleger, deren Fonds Gmbh & Co KGs sind, noch vergleichsweise glimpflich davon. Werden ihre Fonds insolvent, haften sie lediglich mit ihrem Kommanditanteil. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings auch für sie: Im Pleitefall drohen ihnen möglicherweise erhebliche Steuernachzahlungen.
„Hut ab vor Sarrazin“, lobt Ulrich Pfeiffer vom Institut Empirica den amtierenden Berliner Finanzsenator, der die Notbremse gezogen hat. Sonst hätte die Förderung Berlin bis 2029 noch weitere 2,5 Milliarden Euro gekostet, und das bei derzeit 100000 leer stehenden Wohnungen.
Doch das Fördernetz ist so eng gesponnen, dass derzeit niemand sagen kann, wie viel Berlin durch den Stopp wirklich spart. Denn viele Bankkredite der Fonds sind vom Land verbürgt. Ohne Sicherheiten, versteht sich. Allein der Barwert dieser Bürgschaften beläuft sich nach Berechnungen des DIW auf knapp 900 Millionen Euro. Die werden im Insolvenzfall fällig. Zudem haben alle Fonds nach wie vor den Anspruch auf die Förderung innerhalb der ersten 15 Jahre. Das heißt, für die 1997 genehmigten Wohnungen laufen die Subventionen erst 2012 aus.
Für den Geschäftsführer des Berliner Mieterbundes, Hartmann Vetter, ergibt diese Förderpolitik nur einen Sinn: „Das war eine Vermögensumverteilungspolitik von der öffentlichen Hand in private Taschen.“
---
zum Thema:
Sozialer Wohnungsbau in Deutschland -
Den Menschen ein Dach über den Kopf
Als Deutschland nach dem Krieg in Schutt und Asche lag, hatte der Bau von Wohnungen für die Politik absolute Priorität. „Sozialer Wohnungsbau bedeutete damals, den Menschen ein Dach über den Kopf zu geben“, sagt Bernd Bartholmai, Experte für Immobilienwirtschaft im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Es fehlten sechs Millionen Wohnungen. Während heute nur noch einkommensschwache Personen gefördert werden, definierte das erste Wohnbaugesetz von 1950, dass „breite Schichten“ von der öffentlichen Förderung profitieren sollten.
Es war der Staat, der nach Kriegsende massiv in den Wohnungsneubau investierte, der private Kapitalmarkt musste sich erst wieder entwickeln. Doch bereits 1956 sank der Anteil der öffentlichen Mittel an sämtlichen Wohnbauinvestitionen auf 27 Prozent. Auch im Wohnungsbau kam die soziale Marktwirtschaft zum Zuge.
Die Bundesländer entwickelten nach und nach eigene Richtlinien für ihre Förderung. Im Grundsatz folgen sie alle dem Prinzip, zinsverbilligte Baudarlehen, Aufwandszuschüsse und Aufwandsdarlehen zu vergeben. Hinzu kommen lukrative Steuerabschreibungen. Mit den zinsverbilligten Darlehen wird direkt das Kapital subventioniert, das der Bauherr braucht, um seine Baufinanzierung auf die Beine zu stellen. Bei den Aufwandszuschüssen und -darlehen dagegen muss der Bauherr das Kapital selbst aufbringen, der Staat steht ihm dann allerdings bei Zins und Tilgung zur Seite.
Neun Millionen Sozialwohnungen wurden auf diese Weise bis heute gefördert. Während sich viele Bundesländer mit Aufwandszuschüssen und -darlehen eher zurückhielten, setzte Berlin von 1969 an ganz massiv auf diese Förderart.
Die Höhe der Förderung schwankt von Bundesland zu Bundesland. Anders als im frei finanzierten Wohnungsbau, in dem die Miete dem Markt überlassen wird, gilt im sozialen Wohnungsbau das Prinzip der Kostenmiete: Der Bauherr stellt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung auf, die auflistet, wie teuer der Bau einer Immobilie mit allen Bau-, Grundstücks- und Nutzungskosten ist. Daraus ergibt sich die Kostenmiete, die die Obergrenze dessen darstellt, was der mit öffentlichen Geldern unterstützte Bauherr von seinen Mietern verlangen darf.
In der Kostenmiete sind also sämtliche Kapitalkosten (Eigen- und Fremdkapital) und Bewirtschaftungskosten (Abschreibung, Verwaltung, Instandhaltung) enthalten. Ist diese Kostenmiete zu hoch für einkommensschwache Mieter, subventioniert der Staat die Differenz zwischen Kostenmiete und der Miete, die die Bewohner letztlich zahlen sollen.
In den vergangenen 50 Jahren ist die Zahl der Sozialwohnungen gesunken: 1955 wurden im alten Bundesgebiet noch 341000 Wohnungen gefördert, 2001 waren es lediglich 34 000.
Weil der Wohnungsmarkt tendenziell entspannt ist, schränkte die Bundesregierung die objektorientierte Förderung, die sich am Neubau von Wohnungen orientierte, weiter ein. Seit dem 1. Januar 2002 gilt das erste Wohnraumförderungsgesetz. Die so genannte subjektorientierte Förderung richtet sich direkt an Personen mit besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche: etwa Behinderte, Geringverdiener oder Arbeitslose. So genannte Belegungsrechte sollen es dem Staat ermöglichen, diesen Mietern geförderten Wohnraum auch in Häusern anbieten zu können, die frei finanziert sind.
Momentan gibt es noch rund 1,9 Millionen Sozialwohnungen. Es werden weniger, weil jährlich mindestens 100000 Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen. Zwar gehen aktuelle Prognosen nicht von Engpässen aus, Vorsicht ist trotzdem geboten: Anfang der neunziger Jahre strömten so viele Aussiedler, Übersiedler und Flüchtlinge auf den Wohnungsmarkt, dass dies die Zeit der „neuen Wohnungsnot“ wurde.
DIE ZEIT 20 / 2003
Schlaraffenland ist abgebrannt
Berlin streicht Subventionen für den Wohnungsbau: Ehemals lukrative Steuersparmodelle werden für die Zeichner von Immobilienfonds zum finanziellen Desaster
Von Marie-Luise Hauch-Fleck und Frank Schulte
Sichere Einnahmen und das wohlige Gefühl, dem Fiskus ein Schnippchen zu schlagen: Das ist es, wovon viele Bestverdiener träumen, die ihr Geld vor der Steuer retten wollen. Solche Angebote aber sind rar. Für eine ausgewählte Klientel wohlhabender Bundesbürger allerdings schien sich dieser Traum tatsächlich zu erfüllen: die Zeichner geschlossener Immobilienfonds in Berlin.
Deren Anbieter, bestens vertraut mit Berliner Eigenheiten und fest verankert in der örtlichen Politik, haben vor allem dort investiert, wo üblicherweise nicht das große Geld zu machen ist: im sozialen Wohnungsbau. Doch in der ehemaligen Frontstadt ist vieles anders als im Rest der Republik.
Dort nahm der Senat den Investoren praktisch jedes Risiko ab. Reichte die Miete nicht aus, um die Baukosten zu decken, half das Land nicht nur großzügig mit Aufwendungsdarlehen, die 30 Jahre zins- und tilgungsfrei sind. Außerdem gab es direkte Zuschüsse, die überhaupt nicht zurückgezahlt werden müssen. Voraussetzung war nur, dass die Vorhaben von der zuständigen Bewilligungsstelle, der landeseigenen Wohnungsbaukreditanstalt – inzwischen in Investitionsbank Berlin umbenannt – als förderfähig anerkannt wurden. Überdurchschnittlich hohe Baukosten waren kein Hinderungsgrund. Die Subventionen wurden grundsätzlich für 15 Jahre garantiert und dann traditionell als so genannte Anschlussförderung noch einmal um weitere 15 Jahre verlängert.
Für Fondsanbieter und Käufer war das ein konkurrenzlos gutes Geschäft. Erstere verdienten prächtig an allerlei Dienstleistungen wie Beratung oder Baubetreuung, die sie den Gesellschaftern in Rechnung stellten. Denen wiederum war egal, dass dadurch die gesamten Kosten in die Höhe getrieben wurden. Dafür, dass unterm Strich genug Geld da war, um alles zu bezahlen, auch wenn die Mieten nicht reichten, garantierte ihnen nach Fertigstellung der Wohnungen der Berliner Senat. Und vorher waren ihnen bilanzielle Verluste sogar hoch willkommen. Die minderten schließlich ihre Steuerlast.
Die Angst der Anleger
Dieses schöne System funktionierte seit Beginn der siebziger Jahre stets wie geschmiert. Dass das Land Berlin eines Tages die Anschlussförderung kappen könnte, kam deshalb auch niemandem in den Sinn. „Das wurde so weit weggeschoben wie die Möglichkeit, dass man sein Geld mit Bundesschatzbriefen verliert, weil Deutschland pleite ist“, beschreibt ein Fondsverkäufer die allgemein herrschende Zuversicht.
Pleite ist nicht der Bund, wohl aber Berlin. Am 3. Februar entschied das Berliner Abgeordnetenhaus deshalb, dass es zukünftig keine Anschlussförderung mehr gibt. Die hätte das Land bis 2029 immerhin 2,5 Milliarden Euro gekostet. Betroffen vom Förderstopp sind 25000 Wohnungen, für die zwischen 1987 und 1997 erstmals eine Förderung bewilligt worden war. Rund 13000 davon gehören privaten Immobilienfonds, der Rest städtischen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften.
Seither ist es mit der Ruhe dieser Fondsgesellschafter vorbei. „Die Leute haben jetzt Existenzangst“, sagt Frank-Michael Demuth, Geschäftsführer der R&W Immobilienanlagen. Für zwei Fonds dieser Gesellschaft gibt es schon kein Geld vom Staat mehr. Klagen dagegen hatten bisher keinen Erfolg. Inzwischen dämmert nicht nur deren Gesellschaftern, dass aus einem vermeintlich attraktiven, risikolosen Investment, mit dem man so schön Steuern sparen konnte, eine erhebliche finanzielle Belastung zu werden droht.
Für Hiltrud Sprungalla, die Geschäftsführerin des Landesverbandes freier Wohnungsunternehmen (IfW), der die Interessen der Fondsanbieter vertritt, ist das Votum der Abgeordneten denn auch ein „unglaublicher Vorgang“, eine „modellhafte Enteignung“. Alle seien davon ausgegangen, dass 30 Jahre gefördert werde. Schließlich, so Sprungalla „geht das Konzept nicht anders auf“.
Das ist wohl wahr. Unter der Schirmherrschaft des Berliner Politestablishments konnten Fondsanbieter und Bauunternehmen zulasten des Staatshaushalts frei schalten und walten. Die Folge sind absurd hohe Kostenmieten von bis zu 21,65 Euro je Quadratmeter für Bleiben, die „überwiegend zum Segment der einfachen Wohnungen“ gehören, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) konstatiert.
Am freien Markt werden für ähnliche Wohnungen sechs bis sieben Euro verlangt. Für die einkommensschwache Klientel von geförderten Wohnungen hat der Senat Mieten von durchschnittlich vier Euro pro Quadratmeter festgelegt. Für die Fonds kein Problem: Die Differenz von bis zu 16 Euro zur Kostenmiete zahlte ja das Land.
Dass die Kosten im Berliner Sozialwohnungsbau exorbitant höher als in anderen Bundesländern sind, hatte das DIW schon 1993 in einem Gutachten für den Senat festgestellt. Danach lagen allein die reinen Baukosten ohne Finanzierungskosten in der Landeshauptstadt um 56 Prozent über denen in Hamburg, ohne dass es, so die Gutachter, Qualitätsunterschiede gab. Die spannende Frage, „warum Bauleistungen in Berlin teurer angeboten werden“ als anderswo in der Republik, beantwortet das Papier leider nicht. An den Löhnen jedenfalls lag es nicht. Die waren bei allen untersuchten Gewerken sogar niedriger als in der Hansestadt. Dafür waren die Baunebenkosten wie Architekten- und Ingenieurleistungen oder Verwaltungsleistungen der Bauherren um 88 Prozent auffällig viel höher.
Vor der Wende wurden die hohen Baukosten von Fondsanbietern und Bauunternehmern stets mit der Insellage der Stadt begründet. Als die Mauer gefallen war und die Preise trotzdem noch weiter anzogen, hieß es schlicht, in Berlin könne man einfach nicht billiger bauen. Das sei, so das DIW in einem Gutachten im Auftrag des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen „ökonomisch kaum zu erklären“.
Politisch vielleicht schon. Denn die Beziehungen zwischen Fonds, Bauunternehmen und Politikern waren in Berlin schon immer gut. So gehört beispielsweise Klaus Groth, Bauunternehmer und gemeinsam mit dem Architekten Dieter Graalfs einer der aktivsten Fondsanbieter, nicht nur zu den großzügigen Spendern seiner eigenen Partei, der CDU. SPD und FDP hat er ebenfalls bedacht. Auch CDU-Mitglied Dietmar Otremba, der seiner Partei über die Jahre viele Millionen gespendet hat, ist nicht nur einer der großen Berliner Bauunternehmer, sondern über gemeinsame Immobilienfirmen und Dienstleistungsgesellschaften geschäftlich mit Wolfgang Görlich, einem der größten Berliner Fondsinitiatoren, verbunden.
Eine ehrenwerte Gesellschaft
Deren Anträge segnete die Wohnungsbaukreditanstalt ab. Dort bestimmten „Politiker – von der SPD Klaus Riebschläger (Senator und später Rechtsanwalt von Klaus Groth) und der CDU-Politiker Klaus Landowsky (später Vorstandssprecher der Berliner Hyp)–, wer Zuschüsse und Kredite erhält“ , schreibt der Journalist Mathew Rose in seinem gerade erschienenen Buch Eine ehrenwerte Gesellschaft, das die Hintergründe der Beinahe-Pleite der Berliner Bankgesellschaft beleuchtet. Eine Kostendecklung als Voraussetzung für eine Förderung verlangte die landeseigene Bank erstaunlicherweise nie.
Um die abstruse Relation zwischen Aufwand und Ertrag der von ihren Fonds finanzierten Objekte machten sich die Anleger bis zum 3. Februar keine Sorgen. Ihre teilweise immensen Kosten wurden ja anstandslos größtenteils mit Steuergroschen finanziert. Auch ihren vordringlichen Wunsch, die eigene Steuerlast gleichwohl möglichst zu minimieren, hatten die Fonds zuverlässig erfüllt – nicht zuletzt durch geschickte Wahl der Rechtsform. „Die war regelmäßig an steuerlichen Gesichtspunkten orientiert“, bestätigt der Berliner Anlegeranwalt Wolfgang Schirp.
Bei den besonders gut verdienenden Anlegern waren Fonds, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) firmieren, deshalb besonders beliebt. Der Grund: Verluste aus einer solchen Beteiligung konnten unbegrenzt mit anderen Einkünften verrechnet werden. „Viele Gutverdienende haben offenbar bis Mitte der neunziger Jahre routinemäßig jedes Jahr Beträge von 50000 bis 100000 Euro gezeichnet“, sagt Martin Klingsporn, Chefredakteur des DFI-Gerlach Reports. Und sitzen damit nun, warnt Klingsporn, „auf einer Haftungsbombe“.
Sozusagen als Gegenleistung für die unbegrenzte Abzugfähigkeit von Verlusten müssen GbR-Gesellschafter laut Steuerrecht nicht nur mit ihrer Fondseinlage, sondern mit ihrem Gesamtvermögen haften. „Wer glaubte, 50000 Euro angelegt zu haben, sieht sich nun einer möglichen Haftung in Millionenhöhe gegenüber“ , warnt Anwalt Schirp. Nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen sind die Fondsobjekte in der Regel bis zu 80 Prozent fremdfinanziert. Reichen nun die Einnahmen nicht mehr aus, um Zinsen und Tilgung zu finanzieren, müssen die Gesellschafter das Geld aus ihren sonstigen Einnahmen aufbringen. Können sie das nicht, droht die Zwangsvollstreckung in das private Vermögen. Die selbst bewohnte Villa ist dann nicht mehr sicher vor dem Zugriff der Banken.
Im Vergleich dazu kommen Anleger, deren Fonds Gmbh & Co KGs sind, noch vergleichsweise glimpflich davon. Werden ihre Fonds insolvent, haften sie lediglich mit ihrem Kommanditanteil. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings auch für sie: Im Pleitefall drohen ihnen möglicherweise erhebliche Steuernachzahlungen.
„Hut ab vor Sarrazin“, lobt Ulrich Pfeiffer vom Institut Empirica den amtierenden Berliner Finanzsenator, der die Notbremse gezogen hat. Sonst hätte die Förderung Berlin bis 2029 noch weitere 2,5 Milliarden Euro gekostet, und das bei derzeit 100000 leer stehenden Wohnungen.
Doch das Fördernetz ist so eng gesponnen, dass derzeit niemand sagen kann, wie viel Berlin durch den Stopp wirklich spart. Denn viele Bankkredite der Fonds sind vom Land verbürgt. Ohne Sicherheiten, versteht sich. Allein der Barwert dieser Bürgschaften beläuft sich nach Berechnungen des DIW auf knapp 900 Millionen Euro. Die werden im Insolvenzfall fällig. Zudem haben alle Fonds nach wie vor den Anspruch auf die Förderung innerhalb der ersten 15 Jahre. Das heißt, für die 1997 genehmigten Wohnungen laufen die Subventionen erst 2012 aus.
Für den Geschäftsführer des Berliner Mieterbundes, Hartmann Vetter, ergibt diese Förderpolitik nur einen Sinn: „Das war eine Vermögensumverteilungspolitik von der öffentlichen Hand in private Taschen.“
---
zum Thema:
Sozialer Wohnungsbau in Deutschland -
Den Menschen ein Dach über den Kopf
Als Deutschland nach dem Krieg in Schutt und Asche lag, hatte der Bau von Wohnungen für die Politik absolute Priorität. „Sozialer Wohnungsbau bedeutete damals, den Menschen ein Dach über den Kopf zu geben“, sagt Bernd Bartholmai, Experte für Immobilienwirtschaft im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Es fehlten sechs Millionen Wohnungen. Während heute nur noch einkommensschwache Personen gefördert werden, definierte das erste Wohnbaugesetz von 1950, dass „breite Schichten“ von der öffentlichen Förderung profitieren sollten.
Es war der Staat, der nach Kriegsende massiv in den Wohnungsneubau investierte, der private Kapitalmarkt musste sich erst wieder entwickeln. Doch bereits 1956 sank der Anteil der öffentlichen Mittel an sämtlichen Wohnbauinvestitionen auf 27 Prozent. Auch im Wohnungsbau kam die soziale Marktwirtschaft zum Zuge.
Die Bundesländer entwickelten nach und nach eigene Richtlinien für ihre Förderung. Im Grundsatz folgen sie alle dem Prinzip, zinsverbilligte Baudarlehen, Aufwandszuschüsse und Aufwandsdarlehen zu vergeben. Hinzu kommen lukrative Steuerabschreibungen. Mit den zinsverbilligten Darlehen wird direkt das Kapital subventioniert, das der Bauherr braucht, um seine Baufinanzierung auf die Beine zu stellen. Bei den Aufwandszuschüssen und -darlehen dagegen muss der Bauherr das Kapital selbst aufbringen, der Staat steht ihm dann allerdings bei Zins und Tilgung zur Seite.
Neun Millionen Sozialwohnungen wurden auf diese Weise bis heute gefördert. Während sich viele Bundesländer mit Aufwandszuschüssen und -darlehen eher zurückhielten, setzte Berlin von 1969 an ganz massiv auf diese Förderart.
Die Höhe der Förderung schwankt von Bundesland zu Bundesland. Anders als im frei finanzierten Wohnungsbau, in dem die Miete dem Markt überlassen wird, gilt im sozialen Wohnungsbau das Prinzip der Kostenmiete: Der Bauherr stellt eine Wirtschaftlichkeitsrechnung auf, die auflistet, wie teuer der Bau einer Immobilie mit allen Bau-, Grundstücks- und Nutzungskosten ist. Daraus ergibt sich die Kostenmiete, die die Obergrenze dessen darstellt, was der mit öffentlichen Geldern unterstützte Bauherr von seinen Mietern verlangen darf.
In der Kostenmiete sind also sämtliche Kapitalkosten (Eigen- und Fremdkapital) und Bewirtschaftungskosten (Abschreibung, Verwaltung, Instandhaltung) enthalten. Ist diese Kostenmiete zu hoch für einkommensschwache Mieter, subventioniert der Staat die Differenz zwischen Kostenmiete und der Miete, die die Bewohner letztlich zahlen sollen.
In den vergangenen 50 Jahren ist die Zahl der Sozialwohnungen gesunken: 1955 wurden im alten Bundesgebiet noch 341000 Wohnungen gefördert, 2001 waren es lediglich 34 000.
Weil der Wohnungsmarkt tendenziell entspannt ist, schränkte die Bundesregierung die objektorientierte Förderung, die sich am Neubau von Wohnungen orientierte, weiter ein. Seit dem 1. Januar 2002 gilt das erste Wohnraumförderungsgesetz. Die so genannte subjektorientierte Förderung richtet sich direkt an Personen mit besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche: etwa Behinderte, Geringverdiener oder Arbeitslose. So genannte Belegungsrechte sollen es dem Staat ermöglichen, diesen Mietern geförderten Wohnraum auch in Häusern anbieten zu können, die frei finanziert sind.
Momentan gibt es noch rund 1,9 Millionen Sozialwohnungen. Es werden weniger, weil jährlich mindestens 100000 Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen. Zwar gehen aktuelle Prognosen nicht von Engpässen aus, Vorsicht ist trotzdem geboten: Anfang der neunziger Jahre strömten so viele Aussiedler, Übersiedler und Flüchtlinge auf den Wohnungsmarkt, dass dies die Zeit der „neuen Wohnungsnot“ wurde.
DIE ZEIT 20 / 2003
@konradi
Na so ganz widerspricht sich das nicht.
Diese Leerstände sind ja größtenteils in Siedlungen und dort Wohnungen zu verkaufen ist natürlich schwer.
Nicht nur das, es werden ja im Osten sogar ganze Strassenzüge abgerissen.
Andererseits wird man in vernünftigen Lagen sehr gut die Immo`s los und wie auch geschrieben wurde, an Leute die es für Eigenbedarf nutzen.
Na so ganz widerspricht sich das nicht.
Diese Leerstände sind ja größtenteils in Siedlungen und dort Wohnungen zu verkaufen ist natürlich schwer.
Nicht nur das, es werden ja im Osten sogar ganze Strassenzüge abgerissen.
Andererseits wird man in vernünftigen Lagen sehr gut die Immo`s los und wie auch geschrieben wurde, an Leute die es für Eigenbedarf nutzen.
@ imoen
Basisdaten zur Immobilienpreisentwicklung in Deutschland gibt es eigentlich nur aus einer Quelle: dem RDM.
Der listet seit 30 Jahren die Preisentwicklung aus 250 deutschen Städten auf und dient der Presse, wie auch den Marktteilnehmern als Richtschnur. Die dort angeführten Mittelwerte sollen in 95 % aller Fälle zutreffen. (Konfidenz) Der Haken dabei:
Es handelt sich um die "Wohnwertkategorie mittlerer Wohnwert" und da hat man natürlich eine sehr geringe Streuung (Standardabweichung) Diese Klassifizierung ist zu knapp und die sehr unterschiedlichen Lagequalitäten in den Großstädten
werden dabei zu wenig berücksichtigt. Ich denke daß bei einem Bevölkerungsrückgang von mehr als zehn Prozent in 15 Jahren der gesamte Immobilienmarkt ins Trudeln kommt. Sicher werden Spitzenlagen immer ihre Käufer finden, aber die Preise für mittlere Wohnlagen werden – siehe Berlin – noch kräftig fallen !
Hier der Link zum RDM Preisatlas:
http://www.rdm-bundesverband.de/statisch/informationsforum/m…
Gruß Konradi
Basisdaten zur Immobilienpreisentwicklung in Deutschland gibt es eigentlich nur aus einer Quelle: dem RDM.
Der listet seit 30 Jahren die Preisentwicklung aus 250 deutschen Städten auf und dient der Presse, wie auch den Marktteilnehmern als Richtschnur. Die dort angeführten Mittelwerte sollen in 95 % aller Fälle zutreffen. (Konfidenz) Der Haken dabei:
Es handelt sich um die "Wohnwertkategorie mittlerer Wohnwert" und da hat man natürlich eine sehr geringe Streuung (Standardabweichung) Diese Klassifizierung ist zu knapp und die sehr unterschiedlichen Lagequalitäten in den Großstädten
werden dabei zu wenig berücksichtigt. Ich denke daß bei einem Bevölkerungsrückgang von mehr als zehn Prozent in 15 Jahren der gesamte Immobilienmarkt ins Trudeln kommt. Sicher werden Spitzenlagen immer ihre Käufer finden, aber die Preise für mittlere Wohnlagen werden – siehe Berlin – noch kräftig fallen !
Hier der Link zum RDM Preisatlas:
http://www.rdm-bundesverband.de/statisch/informationsforum/m…
Gruß Konradi
.
Zartes Pflänzchen Aufschwung
Von Joachim Dreykluft
Die Berichtssaison in den USA geht zu Ende - mit erfreulichen Anzeichen für einen Aufschwung: Die Gewinne der Unternehmen im Dow Jones waren deutlich höher als erwartet. Doch auch die Skeptiker führen gewichtige Argumente ins Feld.
Irak-Krieg, SARS und Wirtschaftsflaute zum Trotz: Börsennotierte US-Unternehmen haben sich im ersten Quartal des Jahres wacker geschlagen. Die Erträge der im Dow Jones vertretenen Gesellschaften lagen im Durchschnitt deutlich über denen von vor einem Jahr und auch über den Erwartungen der Analysten.
Rechnet man die Gewinne pro Aktie (ohne Einmaleffekte) der 27 Unternehmen ( Wal-Mart , Home Depot und Hewlett-Packard melden erst einen Monat später) zusammen, ergeben sich 16,03 $. Die Analysten hatten in ihren Konsensschätzungen lediglich mit 14,30 $ gerechnet - zwölf Prozent weniger. In der Berichtssaison vor einem Jahr waren es 14,29 $ pro Aktie. 18 Unternehmen schlugen sich aktuell besser als erwartet. Lediglich Honeywell schaffte den Analystenkonsens nicht.
Der Dow Jones blieb von den Zahlen nicht unbeeindruckt. Vom Zwischentief am 12. März bis zum Ende der Berichtssaison am 1. Mai hat der Dow 14 Prozent zugelegt. Im Vergleich mit Anfang Mai 2002 ist er jedoch 15 Prozent im Minus - bei heute zwölf Prozent höheren Unternehmensgewinnen.
(...)
Bevorstehender Investitionsschub ist nicht zu erwarten
Die schwammige Prognose ist verständlich, denn die Skeptiker haben viele Argumente auf ihrer Seite. Der private Konsum ist zwar noch auf hohem Niveau, da viele US-Haushalte Geld durch billigere Hypothekenzinsen zur Verfügung haben. Mittelfristig ist aber nicht mit einem Anstieg zu rechnen. Bedenklich ist auch, dass sich der Immobilienboom langsam dem Ende zuneigt, obwohl die März-Zahlen noch einmal ganz ordentlich waren.
Die Kapazitätsauslastung von nur rund 75 Prozent spricht nicht für einen bevorstehenden Investitionsschub aus der Industrie. SARS könnte den Handel mit Asien schwer beeinträchtigen, außerdem leiden Luftfahrt- und Tourismusindustrie. Dazu kommen unterfinanzierte Pensionsfonds, die die Unternehmen auch 2003 Milliarden kosten. 2002 waren es nach Berechnungen von Credit Suisse First Boston für die im S&P-500-Index versammelten Gesellschaften 46 Mrd. $.
Und was ist mit der Bewertung der Aktien? Das durchschnittliche 2004er-KGV liegt im Dow jetzt bei knapp 15. Damit ist der US-Blue-Chip-Index zwar teurer als der Dax (13), aber alles andere als Schwindel erregend. Die Zahl steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Unternehmen die prognostizierten Gewinne tatsächlich erwirtschaften. Das erste Quartal 2003 jedenfalls war ein ermutigender Anfang.
FTD - 09.05.2003
Zartes Pflänzchen Aufschwung
Von Joachim Dreykluft
Die Berichtssaison in den USA geht zu Ende - mit erfreulichen Anzeichen für einen Aufschwung: Die Gewinne der Unternehmen im Dow Jones waren deutlich höher als erwartet. Doch auch die Skeptiker führen gewichtige Argumente ins Feld.
Irak-Krieg, SARS und Wirtschaftsflaute zum Trotz: Börsennotierte US-Unternehmen haben sich im ersten Quartal des Jahres wacker geschlagen. Die Erträge der im Dow Jones vertretenen Gesellschaften lagen im Durchschnitt deutlich über denen von vor einem Jahr und auch über den Erwartungen der Analysten.
Rechnet man die Gewinne pro Aktie (ohne Einmaleffekte) der 27 Unternehmen ( Wal-Mart , Home Depot und Hewlett-Packard melden erst einen Monat später) zusammen, ergeben sich 16,03 $. Die Analysten hatten in ihren Konsensschätzungen lediglich mit 14,30 $ gerechnet - zwölf Prozent weniger. In der Berichtssaison vor einem Jahr waren es 14,29 $ pro Aktie. 18 Unternehmen schlugen sich aktuell besser als erwartet. Lediglich Honeywell schaffte den Analystenkonsens nicht.
Der Dow Jones blieb von den Zahlen nicht unbeeindruckt. Vom Zwischentief am 12. März bis zum Ende der Berichtssaison am 1. Mai hat der Dow 14 Prozent zugelegt. Im Vergleich mit Anfang Mai 2002 ist er jedoch 15 Prozent im Minus - bei heute zwölf Prozent höheren Unternehmensgewinnen.
(...)
Bevorstehender Investitionsschub ist nicht zu erwarten
Die schwammige Prognose ist verständlich, denn die Skeptiker haben viele Argumente auf ihrer Seite. Der private Konsum ist zwar noch auf hohem Niveau, da viele US-Haushalte Geld durch billigere Hypothekenzinsen zur Verfügung haben. Mittelfristig ist aber nicht mit einem Anstieg zu rechnen. Bedenklich ist auch, dass sich der Immobilienboom langsam dem Ende zuneigt, obwohl die März-Zahlen noch einmal ganz ordentlich waren.
Die Kapazitätsauslastung von nur rund 75 Prozent spricht nicht für einen bevorstehenden Investitionsschub aus der Industrie. SARS könnte den Handel mit Asien schwer beeinträchtigen, außerdem leiden Luftfahrt- und Tourismusindustrie. Dazu kommen unterfinanzierte Pensionsfonds, die die Unternehmen auch 2003 Milliarden kosten. 2002 waren es nach Berechnungen von Credit Suisse First Boston für die im S&P-500-Index versammelten Gesellschaften 46 Mrd. $.
Und was ist mit der Bewertung der Aktien? Das durchschnittliche 2004er-KGV liegt im Dow jetzt bei knapp 15. Damit ist der US-Blue-Chip-Index zwar teurer als der Dax (13), aber alles andere als Schwindel erregend. Die Zahl steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Unternehmen die prognostizierten Gewinne tatsächlich erwirtschaften. Das erste Quartal 2003 jedenfalls war ein ermutigender Anfang.
FTD - 09.05.2003
.
Lest mal im Paule - Thread: Salami-Crash an den Weltbörsen Teil 6 - den Beitrag # 2308 !!
ist für uns zwar nix Neues, stützt aber ungemein die Moral...
Konradi
Lest mal im Paule - Thread: Salami-Crash an den Weltbörsen Teil 6 - den Beitrag # 2308 !!
ist für uns zwar nix Neues, stützt aber ungemein die Moral...

Konradi
.
Na gut, ich klau das mal von Paule, solche Doomsdayreports gehören ja irgendwie ins "Archiv"
Von "paule 2" und dem user "Aktienbar" (stock-channel-net)
Eilsendung von Dr. Martin D. Weiss, Amerikas bekanntestem Anlegerschützer. Weiss sagte als Gutachter im US-Kongress aus und sah zahlreiche Firmenpleiten voraus. Anleger, die seine Tipps befolgten, erzielten letztes Jahr Gewinne von bis zu 152 Prozent! Jetzt warnt der Börsenexperte. Die Baisse ist noch nicht mal halb vorüber, d.h., die Talfahrt an der Börse wird noch Jahre dauern! Aktien sind noch immer absolut überbewertet. Niemals zuvor hat der Staat, haben Unternehmen und Privatpersonen so hohe Schuldenberge aufgetürmt. Und die Zahl der Konkurse erreicht traurige Rekordhöhen!
Lesen Sie, warum die Pleitewelle bald auch die Großkonzerne erreichen und mindestens 5 Billionen Euro Anlegervermögen vernichten wird! Ich sage Ihnen, was Sie sofort tun müssen, um Ihr Vermögen wirksam zu schützen. Und ich erkläre Ihnen auch, wie Sie Gewinne von über 152 % erzielen können, während ein Unternehmen nach dem anderen Pleite geht.
MARTIN D. WEISS:
FALLEN SIE NICHT AUF KURSERHOLUNGEN HEREIN!
DER WELTWEITE BÖRSENCRASH STEHT UNMITTELBAR BEVOR !
Lieber Anleger,
gleich zu Beginn habe ich eine große Bitte: Lassen Sie sich nicht von kurzfristigen Erholungen an der Börse täuschen. Der Zusammenbruch des Aktienmarktes, vor dem ich schon so oft gewarnt habe, findet gerade statt. Nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt!
Der Nasdaq und der Nemax sind bereits zusammengebrochen. Jetzt werden der Dow Jones und der DAX folgen.
Der Dow Jones wird mindestens um
3.000 Punkte fallen, der DAX um mindestens 800.
Warum ich mir da so sicher bin? Weil der Großteil der Anleger erst begonnen hat, sich aus dem Markt zurückzuziehen. Vergangenes Jahr im Juni und Anfang Juli haben private Anleger 30 Milliarden Dollar aus Investmentfonds herausgezogen. Allein diese Tatsache unterstützte den Fall des Dow Jones um 2.007 Punkte!
Auch in Deutschland ziehen enttäuschte Anleger ihre Gelder aus Investmentfonds ab, zusätzlich nimmt das verwaltete Anlagevolumen durch den Kursverfall permanent ab.
Darüber hinaus gibt es drei weitere Ursachen, die zu einem noch stärkeren Verkauf führen werden. Ich schätze, dass in den kommenden Wochen panische Anleger Fondsanteile in Höhe von weiteren 300 Milliarden Dollar verkaufen werden. Dieser Wert ist zehn Mal höher als jener, der zum Kursverfall im Juni und Juli 2002 geführt hat!
Sie sind skeptisch, ob das alles so stimmt? Nun ja, diese drei unbestreitbaren Tatsachen sprechen dafür:
TATSACHE 1:
Der Massen-Exodus ausländischer Investoren
aus dem US-Markt hat begonnen.
Die anhaltende Schwäche des US-Dollar hat den Rückzug ausländischer Investoren aus dem amerikanischen Markt bereits eingeläutet. Dies führte schon 1929 und 1987 zu einer dramatischen Talfahrt des Dow Jones.
Die US-Währung gilt längst nicht mehr als "sicherer Hafen" für anlagesuchendes Kapital. Das Image einer übermächtigen US-Leitwährung stürzt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Im Augenblick fliehen hauptsächlich britische und deutsche Anleger, die in den späten 90er Jahren am stärksten im US-Markt investiert waren, in Scharen. Aber auch die Japaner, Anfang der 90er die größten Käufer amerikanischer Aktien, suchen bereits das Weite. Und das ist erst der Anfang!
Ein dramatischer Wertverlust des Dow Jones zieht unweigerlich auch einen Fall des DAX nach sich. Und Sie als deutscher Anleger müssen sich noch einer weiteren Tatsache bewusst sein: Ein schwacher Dollar und ein gestärkter Euro bergen zusätzliche Nachteile für die deutsche Volkswirtschaft.
Weitaus stärker als etwa die USA und Japan ist Deutschland als Export-Vizeweltmeister von florierenden Ausfuhren abhängig. Der Anteil des Exports von Waren und Dienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt liegt bei 35 Prozent. Eine nachhaltige Dollar-Abwertung trifft vor allem die deutschen Autohersteller und den Maschinenbau. Für beide Branchen zählt die USA zu den wichtigsten Kundenländern.
TATSACHE 2:
Die Versicherer wirken als Turbo
beim Börsen-Crash.
In Deutschland gehören die Lebensversicherer zu den größten Kapitalsammlern. 2002 hatten sie 65,2 Milliarden Euro eingenommen. Wichtigstes Argument im Wettbewerb ist die Verzinsung dieses Geldes, auch Überschussbeteiligung genannt. Zahlte die Branche 2002 im Schnitt noch mehr als 6 Prozent, haben die Kapitalmärkte die Versicherer gezwungen, diesen Wert auf rund 5 Prozent für 2003 zu senken.
Die Entwicklung zeigt ganz klar in eine Richtung: Seit Anfang des letzten Jahrzehnts sinken die Zinsen. Das trifft die Versicherer besonders, weil mehr als 80 Prozent ihrer Kapitalanlagen in festverzinslichen Papieren stecken. Ab Mitte der 90er versuchten sie, mit Aktienkäufen gegenzusteuern. Die Versicherungsbranche war mit ihrer Anlagemasse einer der größten Treiber für den Höhenflug des DAX.
Aber seit 2000 fallen die Aktienpreise. Beim Abwärtstrend wirkt dieselbe Mechanik, nur in die andere Richtung: Wenn alle verkaufen, verkaufen erst recht die Versicherer ihre Aktien.
Können Sie sich ausmalen, welch ein Massaker es geben wird, wenn die ersten Panikverkäufe einsetzen, immer mehr Anleger immer schneller verkaufen - und irgendwann alle gleichzeitig versuchen zu retten, was zu retten ist?
TATSACHE 3:
Besitzen Sie Aktien von Commerzbank, WCM?
Dann herrscht höchste Gefahr für Ihr Geld!
Meine Firma hat gerade eine umfassende, 6 Monate dauernde Studie veröffentlicht. Erschütterndes Ergebnis: In Amerika treiben 1.552 börsennotierte Aktiengesellschaften am Rande des Ruins, darunter zahlreiche bekannte Namen. In Deutschland stehen aktuell 47 Aktiengesellschaften kurz vor der Pleite. Auch hier finden sich große Namen: Dyckerhoff, Gildemeister, Berliner Effektengesellschaft, Plettac Roeder, Commerzbank, WCM - um nur einige zu nennen. Und es werden täglich mehr!
Einige Firmen werden natürlich überleben, klar. Andere werden, schwer angeschlagen, um ihr Überleben kämpfen und eine gewisse Zeit bis zum Konkurs brauchen. Und die restlichen Firmen sind letztendlich Todgeweihte, denen ein schneller, schmerzvoller Exitus bevorsteht. Es würde einem Wunder gleichkommen, wenn es die meisten dieser Firmen 2004 noch geben würde!
Um es ganz deutlich zu sagen: Ich spreche hier nicht über kleine, obskure Firmen. Ganz im Gegenteil. Gemeint sind die Großen, die beim Anleger das Image eines soliden Unternehmens genießen. Wie z.B. Lucent, Amazon.com oder Nortel Networks. Einige stehen auf so wackeligen Beinen, dass praktisch jeden Augenblick die Lichter ausgehen können.
Im Augenblick erleben wir die größte Vernichtung von Unternehmensgewinnen seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Stellen Sie sich vor: Der Gesamtgewinn aller seit Mitte 1994 am Nasdaq gelisteten Unternehmen hat sich in Luft aufgelöst - jeder Cent Gewinn von mehr als 4.000 Firmen! AOL verzeichnete sogar den höchsten Einzel-Verlust aller Zeiten.
Sie denken, schlimmer kann es nicht mehr kommen? Irrtum, es wird viel schlimmer als das grausamste Horrorszenario, das Sie sich vorstellen können. Für arglose Sparer und Anleger wird dies verheerende Auswirkungen haben. Sogar für Aktionäre überlebender Unternehmen.
Weil nämlich keine Firma allein untergeht, sondern stets unzählige andere mit in den Bankrott zieht. Egal, ob es um einen großen Konzern wie die Philipp Holzmann AG geht oder um ein mittelständisches Unternehmen - bleiben Subunternehmer und Zulieferbetriebe in diesen angespannten Zeiten auf unbezahlten Rechnungen sitzen, bedeutet das ganz schnell auch das Aus für sie.
Die Zahlen sprechen für sich: In Deutschland stieg 2002 die Zahl der Verbraucher- und Firmeninsolvenzen um 66,4 % auf 82.400, davon waren 37.700 Firmenpleiten. In diesem Jahr erwarten die Experten einen weiteren Anstieg auf bis zu 42.000 Unternehmenskonkurse. Die Zahl aller Pleiten, also einschließlich der Verbraucherinsolvenzen, soll auf rund 90.000 hochschnellen. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform geht davon aus, dass 41,2 % der Mittelständler unterkapitalisiert sind - ganz eindeutige Pleitekandidaten!
Eine äußerst dünne Eigenkapitaldecke ist aber keineswegs nur das Schicksal kleiner mittelständischer Betriebe. Denn es sind gerade die DAX-Unternehmen, die enorm verschuldet sind. Beispiel TUI: Kaum ein anderer DAX-Wert hat ein derart ungünstiges Verhältnis von Schuldenstand und Börsenwert. Alle TUI-Aktien zusammen sind rechnerisch weniger als 3 Milliarden Euro wert, die Verbindlichkeiten betragen heute netto allerdings stolze 5,3 Milliarden Euro.
Ich kann es nicht oft genug wiederholen:
Fallen Sie nicht auf kurzfristige Kurserholungen herein.
Die gigantische Pleitewelle, die in einem rasanten Tempo auf uns zuströmt, wird eine Flut von Panikverkäufen auslösen. Ergebnis: Der Dow Jones wird auf 5.000 Punkte fallen, der Nasdaq auf weniger als 1.000 Punkte, der DAX auf mindestens 1.900 Punkte.
Wenn Sie Aktien einer dieser hoch verschuldeten Firmen besitzen, ist Ihr hart verdientes Geld in allergrößter Gefahr! Und das Gleiche gilt natürlich auch für die unzähligen Firmen, die in Geschäftsbeziehung zu diesen Pleitefirmen stehen!
Denn die Schleusen haben sich gerade geöffnet - Hunderte von großen Firmen in Deutschland und den USA, darunter auch bekannte Traditionsunternehmen, werden von der ungeheuren Kraft hinweggespült werden.
Vielleicht zweifeln Sie noch immer. Vielleicht fragen Sie sich, woher ich das alles weiß. Ich möchte Ihnen darauf antworten:
Es ist mein Beruf und auch meine persönliche Leidenschaft, immer genau zu wissen, wann Unternehmen kurz vor der Pleite stehen. Mit meinen 200 Analysten und Mitarbeitern arbeite ich das ganze Jahr Tag für Tag daran, Schwächen und Stärken von fast jeder deutschen und amerikanischen Bank, Versicherung und Aktiengesellschaft herauszufinden. Dabei helfen uns modernste Computer-Technologie und das Expertenwissen der besten Analysten weltweit.
So versuchen Banken ihre Bilanzen "schön zu reden"
Steht die zweite große Bankenkrise innerhalb von 70 Jahren unmittelbar bevor?
Stellen Sie sich vor, der Vorstandsvorsitzende der X-Bank gibt bekannt: "Unsere am Jahresanfang getroffenen Planungen für das operative Geschäft werden wir für das Gesamtjahr 2002 nicht erreichen - wenn die momentane Marktentwicklung anhält ..."
Und dann kommt der Hammer:
Wie aus heiterem Himmel steht nur einen Tag später in der Zeitung: "X-Bank präsentiert für das laufende Geschäftsjahr schwarze Zahlen" - Begründung: "Unter Einbeziehung des Ergebnisses aus Finanzanlagen" wurde im ersten Halbjahr ein Gewinn vor Steuern von 171.000.000 Euro erwirtschaftet. Nach Steuern sind es sogar 512.000.000 Euro ...
"Nanu, ... wie kann denn das sein?" fragen Sie sich ...
GENAU DAS ist bei der Dresdner Bank vor kurzem passiert! Was dahinter steckt? Nun:
Die Zauberformel dafür heißt "außerordentliche Erträge": Rund 1,4 Milliarden Euro wurden schlichtweg "herbeigezaubert", indem Aktienpakete an den Mutterkonzern Allianz verkauft wurden.
Man könnte natürlich auch sagen "umgeschichtet". Sie merken schon: Mit der eigentlichen Tätigkeit der Bank haben diese Geschäfte
nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil: Die sind noch so rot wie vorher. Und die Dresdner Bank ist kein Einzelfall:
Mir liegt gerade das Endergebnis der neuesten Weiss-Studie vor. Erschreckendes Ergebnis: Viele Banken, Sparkassen und andere Institutionen stehen unmittelbar am Rand einer Katastrophe:
Das "Turnaround-Programm" der Dresdner Bank hat kurz vor dem Jahreswechsel weitere Arbeitsplätze gekostet: 800 Firmenbetreuer und 450 Mitarbeiter der lateinamerikanischen Tochter mussten Ende des Jahres das Unternehmen verlassen. Insgesamt summiert sich jetzt die Zahl der Entlassungen auf wahnsinnige 11.000 seit der Übernahme durch die Allianz.
Die Commerzbank suchte während des Booms Fachleute in Massen. Und wird sie jetzt wegen des strengen, arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsrechts nicht so einfach wieder los.
Die Gontard & Metallbank musste im Mai 2002 Insolvenz anmelden. Und zwar aus einem Grund, an dem noch so manch andere Bank schwer zu knabbern hat: Ihr Hauptgeschäft war es, Unternehmen an die Börse zu bringen (so genannte IPOs). Doch dieses früher äußerst lukrative Geschäft ist zusammen mit dem Neuen Markt drastisch eingebrochen.
Wenn Geldverleiher in Schwierigkeiten geraten, lösen sie einen gefährlichen Mechanismus aus: Kredite werden eingefroren. So ziehen sie die ganze Wirtschaft immer tiefer in eine steile Abwärts-Spirale.
Diese unermüdliche Arbeit im Dienst aller Privatanleger findet Anerkennung von höchster Stelle: Kürzlich erklärte die US-Behörde zur Überwachung der Buchführungspflichten (GAO), dass meine Voraussagen drei Mal genauer sind als die des besten Konkurrenten. Und das ist auch der Grund, warum die New York Times schrieb, ich hätte "als Erster die Gefahren erkannt und diese auch eindeutig beim Namen genannt".
Und dies ist auch der Grund dafür, warum ich den Abonnenten meines Geldanlage-Informationsdienstes 2001 und 2002 zu Gewinnen von bis zu 152 % verholfen habe. Während die meisten Anleger nur tatenlos daneben stehen konnten, als die große Geldvernichtungsmaschine angeworfen wurde, die über 5 Billionen Euro Vermögen für immer auslöschte.
Es ist meine tiefe Überzeugung und ich habe auch die Beweise, dass wir dieses Jahr noch besser abschneiden werden. Weil tausende deutscher und amerikanischer Aktiengesellschaften gegen 3 Killer-Faktoren kämpfen:
KILLER-FAKTOR 1:
Massive Schulden. Auch Großkonzerne werden daran ersticken.
In Amerika hat man gesehen, dass die Bilanzierungsskandale ein Unternehmen nach dem anderen verwüsteten: Enron, Global Crossing, WorldCom. Viele Leute vergessen, dass alle Bilanzierungstricks zur Folge haben, dass massive Schuldenberge angehäuft werden. Schulden, die niemals beglichen werden können.
In Deutschland ist das Bild ebenso erschütternd: Nahezu alle DAX-Unternehmen haben in den letzten Jahren weit über ihre Verhältnisse gelebt und Milliarden von Verbindlichkeiten aufgetürmt. Der gigantische Schuldenberg ist im vergangenen Jahr auf 1.468 Milliarden Euro angewachsen.
Zur Verdeutlichung: 30 Unternehmen haben Schulden, die zwei Dritteln des Bruttoinlandsprodukts von 82 Millionen Deutschen entsprechen! Z.B.:
*
DaimlerChrysler. Ungekrönter Schuldenkönig im DAX. Bei Banken und Bond-Anlegern steht der Stuttgarter Autobauer mit über 90 Milliarden Euro in der Kreide.
*
Deutsche Telekom. Europas größter Telekommunikations-Konzern steckt tief in den roten Zahlen. Er schiebt Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 65 Milliarden Euro vor sich her.
*
RWE. Der Schuldenberg des Essener Energiekonzerns belief sich 2002 auf 26 Milliarden Euro. Nach Angaben des Konzerns sollen sie erst 2004 ihren Höchststand erreichen.
*
BMW. Trägt eine Schuldenlast in Höhe von 25,67 Milliarden Euro.
*
VW.Die Verbindlichkeiten von Europas größtem Autohersteller belaufen sich auf 42,79 Milliarden Euro.
Ich habe eine Reihe weiterer Unternehmen identifiziert, denen die rote Tinte quasi aus jeder Pore tropft. Fast unmöglich, dass Sie ein weiteres Jahr überleben. Darunter sind z.B. Ford, JP Morgan, Kellogg`s und Xerox. Wohlklingende Namen, nicht wahr? Aber auch sie werden unter ihren immensen Schulden zusammenbrechen.
Auch in Deutschland waren noch nie so viele Unternehmen in einem katastrophalen Zustand - einschließlich der Blue Chips.
KILLER-FAKTOR 2:
Uns steht die verheerendste Deflation seit 1929 bevor.
Die Geschichte hat uns gelehrt, die Inflation zu fürchten. In Wirklichkeit aber hat die Deflation weitaus verheerendere Folgen. Im Rückblick hat die Inflation das Anlegervermögen nur um einen kleinen Prozentsatz reduziert. Die Deflation hingegen führt zu einer bodenlosen Senkung der Preise und damit auch zum rasanten Verlust von Unternehmensgewinnen. Mit der Folge, dass ihre Aktien 10 %, 20 %, 30 % oder mehr in weniger als nur einem Monat an Wert verlieren.
Deflation war auch der Grund, dass die Weltwirtschaftskrise ein ganzes Jahrzehnt dauerte. Und genau das Gleiche passiert im Augenblick. Exakt in diesem Moment:
*
Bei Computer-Servern der Firmen IBM, Compaq oder Sun Microsystems wurden die Preise um 70% gesenkt.
*
Der Preis eines 128-Megabyte-DRAM-Chip, mit dem nahezu jeder PC ausgestattet ist, fiel von 14 Dollar im Februar 2001 auf augenblicklich weniger als 2 Dollar. Können Sie sich das vorstellen? Eine Preissenkung von 86 % innerhalb von nur zwei Jahren! Unglaublich, aber kein Einzelfall:
*
Durch aberwitzige Rabattschlachten versucht der deutsche Einzelhandel seine Krise zu bewältigen - und erreicht damit genau das Gegenteil: Die Umsätze brechen weg, Investitionen müssen zurückgefahren werden und zwangsläufig wird auch Personal abgebaut. Was ebenfalls zu einem geringeren Konsum führt. Ein Teufelskreis.
*
Fast zwei Drittel aller Deutschen beabsichtigen, dieses Jahr ihr Budget für Urlaub und Reisen zu kappen - obwohl die Preise zwischen 8 und 20 Prozent gesunken sind.
*
Fiat und Nissan bieten mittlerweile die Autofinanzierung zum Nulltarif. Echte Freundschaftskonditionen auch bei vielen anderen Herstellern: Suzuki will 0,1 Prozent, Mitsubishi verlangt 0,25 und Honda 0,9 (Stand: Januar 2003). Ein Ende der Null-Zins-Offerten ist nicht in Sicht.
Sogar im Geschäftskunden-Bereich sind die Preise dramatisch gefallen. Niemand scheint zu verstehen, welche Gefahr von diesen massiven Preissenkungen ausgeht. Es ist ungefähr so, als würde man zusehen, wie diese Unternehmen sich selber die Kehle durchschneiden. Und zwar ganz langsam, in Zeitlupe.
Warum? Weil diese Preissenkungen niemals zu steigenden Einnahmen oder Gewinnen führen und auch nicht im geringsten Maße dazu beitragen, dass betroffene Unternehmen ihre Schulden abtragen oder die Pleite abwenden können.
Überall wohin man schaut, findet ein regelrechter Preiskrieg zwischen konkurrierenden Unternehmen statt. Da braucht man kein Studium, um zu verstehen, dass dabei auch bis dato große, erfolgreiche Unternehmen zugrunde gehen können: Sie bekommen immer weniger Geld für jedes verkaufte Stück und verkaufen aufgrund der niedrigeren Nachfrage auch weniger!
Und natürlich lehren immer drastischere Rabatt-Aktionen den Konsumenten vor allem eines: nicht zu kaufen. Steigende Preise lösen beim Konsumenten einen Kaufimpuls aus, nach dem Motto "Jetzt zugreifen, bevor es zu spät ist". Wenn die Preise aber erst mal fallen, passiert genau das Gegenteil.
Sie haben sich in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon sehr oft gefragt: "Warum soll ich heute kaufen, wenn es morgen alles billiger gibt?" Oder noch schlimmer: "Warum soll ich überhaupt noch etwas kaufen, wenn die Waren innerhalb kürzester Zeit nichts mehr wert sind?"
Und natürlich haben Sie damit Recht. Denn in einer Deflations-Phase sparen Sie tatsächlich am meisten, je länger Sie warten. Die "Schnell zugreifen, bevor es zu spät ist"-Mentalität wird verdrängt durch das Motto "Später kaufen, noch mehr sparen".
Ironischerweise sinken Umsätze und Gewinne mit jeder Preissenkung kontinuierlich. Damit führen sich diese Unternehmen quasi selbst zum Schafott - das Umsatzvolumen fällt, und mit der Senkung der Preise fallen auch die Gewinne immer weiter. Und das ist der sichere K.O-Schlag für jede Firma, die bis zum Hals in Schulden steckt und keine Barmittel mehr hat.
In genau dieser Situation befinden sich aber Hunderte von Firmen -
im Schuldensumpf, gierig nach Barem, sich selber eine Schrotflinte in
den Hals schiebend, damit auch ja nichts schief geht beim Suizid.
Denken Sie, das sei wirklich schlimm? Ich sage Ihnen: Es wird noch viel, viel schlimmer kommen. Ein noch nie da gewesenes schauriges Gemetzel steht uns bevor. Es dauert nämlich gar nicht mehr lange, bis immer mehr Firmen in einem immer schnelleren Tempo Bankrott gehen und ihre Waren immer billiger in immer gnadenloseren Räumungsverkäufen anbieten müssen. Die Deflation, die Sie dann erleben werden, wird die bisher da gewesene wie ein Kinderspiel aussehen lassen.
KILLER-FAKTOR 3:
Argentiniens Zahlungsunfähigkeit - nur ein kleiner Vorgeschmack auf die bevorstehende weltweite Schuldenkrise.
Unternehmens-Pleiten in Deutschland und Amerika sowie eine nie da gewesene Deflation reichen allein schon aus, ein Blutbad an der Börse auszulösen. Aber diese Katastrophe wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass die gesamte Weltwirtschaft miteinander vernetzt ist. Desaströse Zustände in einem Staat haben unweigerlich Auswirkungen auf die Wall Street und alle anderen Börsen rund um den Globus.
In Ihrer persönlichen Gratis-Ausgabe meines Buches "Verdoppeln Sie Ihr Vermögen in der großen Geldpanik 2003!" beschreibe ich konkret, welche Auswirkungen die Globalisierung auf die Kapitalmärkte und damit auch auf Ihr Vermögen hat. Ich warne vor Staaten, die Pleite gehen könnten und mit dem totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch flirten.
Und ich sage Ihnen, welche Unternehmen ebenfalls untergehen, wenn die Wirtschaft dieser Staaten kollabiert. Des Weiteren zeige ich, warum wirklich jedes Unternehmen, speziell jene mit hohen Schulden - auch wenn sie gar keine Beziehungen zu den bankrotten Staaten haben -, dem Untergang geweiht ist.
Die Lektüre meines Buches könnte also auch ein lohnenswerter Hinweis für all jene Anleger sein, die mit exotischen Staatsanleihen liebäugeln. Denn was nutzen in Aussicht gestellte Top-Renditen, wenn sich das eingesetzte Kapital komplett in Luft auflöst?
Was interessiert mich die Lage in Lateinamerika, mögen Sie vielleicht denken. "Alles sehr weit weg ... Wenn ich mein Geld in Deutschland anlege, kann ja nicht so viel passieren ... Die Schuldenkrise in Brasilien ist zwar tragisch, aber was hat das mit mir zu tun?" Ich möchte Ihnen jetzt erklären, warum die Probleme der Entwicklungsländer letztendlich auch Ihre sind.
Noch nie war die Weltwirtschaft in einem schlechteren Zustand als heute.
*
Argentinien, die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, ist mit rund 140 Milliarden Dollar verschuldet. Bei Privatanlegern weltweit steht Argentinien mit rund 51 Milliarden Dollar in der Kreide. Im Dezember 2001 hatte das Land seine Zahlungsunfähigkeit erklärt und jeglichen Schuldendienst gegenüber privaten Kapitalgebern eingestellt. Vor der Peso-Abwertung und der Umwandlung von Dollar in Peso waren die von den Anlegern gehaltenen Anleihen 95 Milliarden Dollar wert gewesen.
Jetzt gab die argentinische Regierung bekannt, welche Investmentbank mit den Privatanlegern verhandeln soll. Experten rechnen damit, dass diese Verhandlungen Jahre dauern werden - wenn es überhaupt zu einer Lösung kommt. Allein deutsche Anleger hatten 7 Milliarden Dollar in Argentinien investiert und verloren.
Dieser Vorgang ist wesentlich schlimmer, als sich irgendjemand hätte ausmalen können. Das größte Horror-Szenario für einen Anleger ist doch entweder ein Zahlungsverzug oder eine Abwertung. Doch in diesem Fall ist beides gleichzeitig eingetreten ...
Überflüssig zu erwähnen, dass natürlich nicht nur Privatanleger, sondern auch zahlreiche große Banken rund um den Globus vom Zahlungsverzug Argentiniens betroffen sind. Und auch hunderte anderer Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Argentinien. Welche Firmen und Banken das sind, sage ich Ihnen in meinem Buch.
Argentinien bringt nicht zuletzt auch die Entscheidungsträger des Internationalen Währungsfonds (IWF) in eine Zwickmühle: Zwar hat das Direktorium des IWF kürzlich eine Kreditverlängerung genehmigt, jedoch werden keine neuen Gelder bereitgestellt. Falls weiterhin eine wirkliche Hilfe ausbleibt, werden Kritiker dem IWF vorhalten, für Plünderungen, Unruhen und sogar einen Bürgerkrieg verantwortlich zu sein, der möglicherweise den Tod tausender Menschen zur Folge hat. Sollte der IWF allerdings tatsächlich mehr Geld austeilen, würde jedes Entwicklungsland verführt sein, seine Zahlungsverpflichtungen auf die lange Bank zu schieben und die Währung abzuwerten. Ein weiterer Kandidat ist zum Beispiel Brasilien:
*
Brasilien hat doppelt so hohe Verbindlichkeiten wie Argentinien. Die Regierung hat bereits zugelassen, dass der Real um 60 % abgewertet wurde. Außerdem haben die Brasilianer bei den Präsidentschaftswahlen den Linkspopulisten Lula da Silva gewählt. Dieser versprach, weiterhin Schulden zu tilgen, aber er wird wahrscheinlich die wenig beneidenswerte Aufgabe übernehmen, die Schuldenstruktur des Landes ohne internationale Hilfe zu verbessern.
*
Zahlungsverzüge in Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand und der Türkei sind heute wahrscheinlicher denn je.
*
Japan: 2002 war das Jahr der Negativrekorde. Tokios Aktienmarkt stürzte auf sein tiefstes Niveau seit 19 Jahren, die Arbeitslosenquote stieg auf neuen Nachkriegsrekord, die öffentliche Verschuldung lag bei rund 5 Billionen Dollar, was dem 12fachen an jährlichen Steuereinnahmen oder 140 % der gesamten japanischen Wirtschaftsleistung entspricht. Damit ist Japan, Ende der 80er Jahre praktisch schuldenfrei, zum größten Schuldner der Welt geworden.
Die japanische Zentralbank gab zu, dass die Summe fauler Kredite um 25 % höher ist als die bisher zugegebenen 1,5 Billionen Dollar. Nicht nur kleine Kreditinstitute leiden unter einer dünnen Kapitaldeckung, auch die ersten Großbanken sind in Konkurs gegangen. Der nächste Zusammenbruch der japanischen Wirtschaft ist unabwendbar, mit unberechenbaren Folgen auf Deutschland, Asien und die USA.
*
Europa: In allen europäischen Staaten und Branchen haben sich immense Unternehmensschulden aufgetürmt. Sei es bei den Versicherungen, Fluggesellschaften, der chemischen Industrie, im Automobil- oder im Freizeitsektor.
Deutschland ist im europäischen Vergleich nicht nur Schlusslicht im Wachstum, sondern verzeichnet auch die meisten Unternehmenspleiten. Zu einer schwachen Eigenkapitalbasis und einer hohen Verschuldung vieler Unternehmen kommen eine steigende Arbeitslosenquote und Konsumverzicht. Die Banken stecken ebenfalls in einer tiefen Krise und müssen immer mehr Kredite abschreiben.
Das kommt Ihnen bekannt vor? Richtig, eine Abwärtsspirale à la Japan ist nicht mehr ausgeschlossen. Zu dieser desolaten Lage kommt auch noch eine galoppierende Deflation, die die Unternehmensgewinne verschlingt - sozusagen als letzter Sargnagel für krisengeschüttelte Firmen.
Um es noch mal deutlich zu sagen: Schon bald werden weltweit große Unternehmen und Banken wie Dominosteine umfallen. Die Schockwellen der einstürzenden Unternehmen werden die Finanzmärkte rund um den Globus erschüttern. Mit der Folge, dass jegliches Verbrauchervertrauen vernichtet wird, der Konsum zurückgefahren wird, Aktienkurse in ungeahnte Tiefen abrutschen und unzählige weitere Unternehmen mit untergehen....
Na gut, ich klau das mal von Paule, solche Doomsdayreports gehören ja irgendwie ins "Archiv"

Von "paule 2" und dem user "Aktienbar" (stock-channel-net)
Eilsendung von Dr. Martin D. Weiss, Amerikas bekanntestem Anlegerschützer. Weiss sagte als Gutachter im US-Kongress aus und sah zahlreiche Firmenpleiten voraus. Anleger, die seine Tipps befolgten, erzielten letztes Jahr Gewinne von bis zu 152 Prozent! Jetzt warnt der Börsenexperte. Die Baisse ist noch nicht mal halb vorüber, d.h., die Talfahrt an der Börse wird noch Jahre dauern! Aktien sind noch immer absolut überbewertet. Niemals zuvor hat der Staat, haben Unternehmen und Privatpersonen so hohe Schuldenberge aufgetürmt. Und die Zahl der Konkurse erreicht traurige Rekordhöhen!
Lesen Sie, warum die Pleitewelle bald auch die Großkonzerne erreichen und mindestens 5 Billionen Euro Anlegervermögen vernichten wird! Ich sage Ihnen, was Sie sofort tun müssen, um Ihr Vermögen wirksam zu schützen. Und ich erkläre Ihnen auch, wie Sie Gewinne von über 152 % erzielen können, während ein Unternehmen nach dem anderen Pleite geht.
MARTIN D. WEISS:
FALLEN SIE NICHT AUF KURSERHOLUNGEN HEREIN!
DER WELTWEITE BÖRSENCRASH STEHT UNMITTELBAR BEVOR !
Lieber Anleger,
gleich zu Beginn habe ich eine große Bitte: Lassen Sie sich nicht von kurzfristigen Erholungen an der Börse täuschen. Der Zusammenbruch des Aktienmarktes, vor dem ich schon so oft gewarnt habe, findet gerade statt. Nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt!
Der Nasdaq und der Nemax sind bereits zusammengebrochen. Jetzt werden der Dow Jones und der DAX folgen.
Der Dow Jones wird mindestens um
3.000 Punkte fallen, der DAX um mindestens 800.
Warum ich mir da so sicher bin? Weil der Großteil der Anleger erst begonnen hat, sich aus dem Markt zurückzuziehen. Vergangenes Jahr im Juni und Anfang Juli haben private Anleger 30 Milliarden Dollar aus Investmentfonds herausgezogen. Allein diese Tatsache unterstützte den Fall des Dow Jones um 2.007 Punkte!
Auch in Deutschland ziehen enttäuschte Anleger ihre Gelder aus Investmentfonds ab, zusätzlich nimmt das verwaltete Anlagevolumen durch den Kursverfall permanent ab.
Darüber hinaus gibt es drei weitere Ursachen, die zu einem noch stärkeren Verkauf führen werden. Ich schätze, dass in den kommenden Wochen panische Anleger Fondsanteile in Höhe von weiteren 300 Milliarden Dollar verkaufen werden. Dieser Wert ist zehn Mal höher als jener, der zum Kursverfall im Juni und Juli 2002 geführt hat!
Sie sind skeptisch, ob das alles so stimmt? Nun ja, diese drei unbestreitbaren Tatsachen sprechen dafür:
TATSACHE 1:
Der Massen-Exodus ausländischer Investoren
aus dem US-Markt hat begonnen.
Die anhaltende Schwäche des US-Dollar hat den Rückzug ausländischer Investoren aus dem amerikanischen Markt bereits eingeläutet. Dies führte schon 1929 und 1987 zu einer dramatischen Talfahrt des Dow Jones.
Die US-Währung gilt längst nicht mehr als "sicherer Hafen" für anlagesuchendes Kapital. Das Image einer übermächtigen US-Leitwährung stürzt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Im Augenblick fliehen hauptsächlich britische und deutsche Anleger, die in den späten 90er Jahren am stärksten im US-Markt investiert waren, in Scharen. Aber auch die Japaner, Anfang der 90er die größten Käufer amerikanischer Aktien, suchen bereits das Weite. Und das ist erst der Anfang!
Ein dramatischer Wertverlust des Dow Jones zieht unweigerlich auch einen Fall des DAX nach sich. Und Sie als deutscher Anleger müssen sich noch einer weiteren Tatsache bewusst sein: Ein schwacher Dollar und ein gestärkter Euro bergen zusätzliche Nachteile für die deutsche Volkswirtschaft.
Weitaus stärker als etwa die USA und Japan ist Deutschland als Export-Vizeweltmeister von florierenden Ausfuhren abhängig. Der Anteil des Exports von Waren und Dienstleistungen am Bruttoinlandsprodukt liegt bei 35 Prozent. Eine nachhaltige Dollar-Abwertung trifft vor allem die deutschen Autohersteller und den Maschinenbau. Für beide Branchen zählt die USA zu den wichtigsten Kundenländern.
TATSACHE 2:
Die Versicherer wirken als Turbo
beim Börsen-Crash.
In Deutschland gehören die Lebensversicherer zu den größten Kapitalsammlern. 2002 hatten sie 65,2 Milliarden Euro eingenommen. Wichtigstes Argument im Wettbewerb ist die Verzinsung dieses Geldes, auch Überschussbeteiligung genannt. Zahlte die Branche 2002 im Schnitt noch mehr als 6 Prozent, haben die Kapitalmärkte die Versicherer gezwungen, diesen Wert auf rund 5 Prozent für 2003 zu senken.
Die Entwicklung zeigt ganz klar in eine Richtung: Seit Anfang des letzten Jahrzehnts sinken die Zinsen. Das trifft die Versicherer besonders, weil mehr als 80 Prozent ihrer Kapitalanlagen in festverzinslichen Papieren stecken. Ab Mitte der 90er versuchten sie, mit Aktienkäufen gegenzusteuern. Die Versicherungsbranche war mit ihrer Anlagemasse einer der größten Treiber für den Höhenflug des DAX.
Aber seit 2000 fallen die Aktienpreise. Beim Abwärtstrend wirkt dieselbe Mechanik, nur in die andere Richtung: Wenn alle verkaufen, verkaufen erst recht die Versicherer ihre Aktien.
Können Sie sich ausmalen, welch ein Massaker es geben wird, wenn die ersten Panikverkäufe einsetzen, immer mehr Anleger immer schneller verkaufen - und irgendwann alle gleichzeitig versuchen zu retten, was zu retten ist?
TATSACHE 3:
Besitzen Sie Aktien von Commerzbank, WCM?
Dann herrscht höchste Gefahr für Ihr Geld!
Meine Firma hat gerade eine umfassende, 6 Monate dauernde Studie veröffentlicht. Erschütterndes Ergebnis: In Amerika treiben 1.552 börsennotierte Aktiengesellschaften am Rande des Ruins, darunter zahlreiche bekannte Namen. In Deutschland stehen aktuell 47 Aktiengesellschaften kurz vor der Pleite. Auch hier finden sich große Namen: Dyckerhoff, Gildemeister, Berliner Effektengesellschaft, Plettac Roeder, Commerzbank, WCM - um nur einige zu nennen. Und es werden täglich mehr!
Einige Firmen werden natürlich überleben, klar. Andere werden, schwer angeschlagen, um ihr Überleben kämpfen und eine gewisse Zeit bis zum Konkurs brauchen. Und die restlichen Firmen sind letztendlich Todgeweihte, denen ein schneller, schmerzvoller Exitus bevorsteht. Es würde einem Wunder gleichkommen, wenn es die meisten dieser Firmen 2004 noch geben würde!
Um es ganz deutlich zu sagen: Ich spreche hier nicht über kleine, obskure Firmen. Ganz im Gegenteil. Gemeint sind die Großen, die beim Anleger das Image eines soliden Unternehmens genießen. Wie z.B. Lucent, Amazon.com oder Nortel Networks. Einige stehen auf so wackeligen Beinen, dass praktisch jeden Augenblick die Lichter ausgehen können.
Im Augenblick erleben wir die größte Vernichtung von Unternehmensgewinnen seit der Weltwirtschaftskrise 1929. Stellen Sie sich vor: Der Gesamtgewinn aller seit Mitte 1994 am Nasdaq gelisteten Unternehmen hat sich in Luft aufgelöst - jeder Cent Gewinn von mehr als 4.000 Firmen! AOL verzeichnete sogar den höchsten Einzel-Verlust aller Zeiten.
Sie denken, schlimmer kann es nicht mehr kommen? Irrtum, es wird viel schlimmer als das grausamste Horrorszenario, das Sie sich vorstellen können. Für arglose Sparer und Anleger wird dies verheerende Auswirkungen haben. Sogar für Aktionäre überlebender Unternehmen.
Weil nämlich keine Firma allein untergeht, sondern stets unzählige andere mit in den Bankrott zieht. Egal, ob es um einen großen Konzern wie die Philipp Holzmann AG geht oder um ein mittelständisches Unternehmen - bleiben Subunternehmer und Zulieferbetriebe in diesen angespannten Zeiten auf unbezahlten Rechnungen sitzen, bedeutet das ganz schnell auch das Aus für sie.
Die Zahlen sprechen für sich: In Deutschland stieg 2002 die Zahl der Verbraucher- und Firmeninsolvenzen um 66,4 % auf 82.400, davon waren 37.700 Firmenpleiten. In diesem Jahr erwarten die Experten einen weiteren Anstieg auf bis zu 42.000 Unternehmenskonkurse. Die Zahl aller Pleiten, also einschließlich der Verbraucherinsolvenzen, soll auf rund 90.000 hochschnellen. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform geht davon aus, dass 41,2 % der Mittelständler unterkapitalisiert sind - ganz eindeutige Pleitekandidaten!
Eine äußerst dünne Eigenkapitaldecke ist aber keineswegs nur das Schicksal kleiner mittelständischer Betriebe. Denn es sind gerade die DAX-Unternehmen, die enorm verschuldet sind. Beispiel TUI: Kaum ein anderer DAX-Wert hat ein derart ungünstiges Verhältnis von Schuldenstand und Börsenwert. Alle TUI-Aktien zusammen sind rechnerisch weniger als 3 Milliarden Euro wert, die Verbindlichkeiten betragen heute netto allerdings stolze 5,3 Milliarden Euro.
Ich kann es nicht oft genug wiederholen:
Fallen Sie nicht auf kurzfristige Kurserholungen herein.
Die gigantische Pleitewelle, die in einem rasanten Tempo auf uns zuströmt, wird eine Flut von Panikverkäufen auslösen. Ergebnis: Der Dow Jones wird auf 5.000 Punkte fallen, der Nasdaq auf weniger als 1.000 Punkte, der DAX auf mindestens 1.900 Punkte.
Wenn Sie Aktien einer dieser hoch verschuldeten Firmen besitzen, ist Ihr hart verdientes Geld in allergrößter Gefahr! Und das Gleiche gilt natürlich auch für die unzähligen Firmen, die in Geschäftsbeziehung zu diesen Pleitefirmen stehen!
Denn die Schleusen haben sich gerade geöffnet - Hunderte von großen Firmen in Deutschland und den USA, darunter auch bekannte Traditionsunternehmen, werden von der ungeheuren Kraft hinweggespült werden.
Vielleicht zweifeln Sie noch immer. Vielleicht fragen Sie sich, woher ich das alles weiß. Ich möchte Ihnen darauf antworten:
Es ist mein Beruf und auch meine persönliche Leidenschaft, immer genau zu wissen, wann Unternehmen kurz vor der Pleite stehen. Mit meinen 200 Analysten und Mitarbeitern arbeite ich das ganze Jahr Tag für Tag daran, Schwächen und Stärken von fast jeder deutschen und amerikanischen Bank, Versicherung und Aktiengesellschaft herauszufinden. Dabei helfen uns modernste Computer-Technologie und das Expertenwissen der besten Analysten weltweit.
So versuchen Banken ihre Bilanzen "schön zu reden"
Steht die zweite große Bankenkrise innerhalb von 70 Jahren unmittelbar bevor?
Stellen Sie sich vor, der Vorstandsvorsitzende der X-Bank gibt bekannt: "Unsere am Jahresanfang getroffenen Planungen für das operative Geschäft werden wir für das Gesamtjahr 2002 nicht erreichen - wenn die momentane Marktentwicklung anhält ..."
Und dann kommt der Hammer:
Wie aus heiterem Himmel steht nur einen Tag später in der Zeitung: "X-Bank präsentiert für das laufende Geschäftsjahr schwarze Zahlen" - Begründung: "Unter Einbeziehung des Ergebnisses aus Finanzanlagen" wurde im ersten Halbjahr ein Gewinn vor Steuern von 171.000.000 Euro erwirtschaftet. Nach Steuern sind es sogar 512.000.000 Euro ...
"Nanu, ... wie kann denn das sein?" fragen Sie sich ...
GENAU DAS ist bei der Dresdner Bank vor kurzem passiert! Was dahinter steckt? Nun:
Die Zauberformel dafür heißt "außerordentliche Erträge": Rund 1,4 Milliarden Euro wurden schlichtweg "herbeigezaubert", indem Aktienpakete an den Mutterkonzern Allianz verkauft wurden.
Man könnte natürlich auch sagen "umgeschichtet". Sie merken schon: Mit der eigentlichen Tätigkeit der Bank haben diese Geschäfte
nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil: Die sind noch so rot wie vorher. Und die Dresdner Bank ist kein Einzelfall:
Mir liegt gerade das Endergebnis der neuesten Weiss-Studie vor. Erschreckendes Ergebnis: Viele Banken, Sparkassen und andere Institutionen stehen unmittelbar am Rand einer Katastrophe:
Das "Turnaround-Programm" der Dresdner Bank hat kurz vor dem Jahreswechsel weitere Arbeitsplätze gekostet: 800 Firmenbetreuer und 450 Mitarbeiter der lateinamerikanischen Tochter mussten Ende des Jahres das Unternehmen verlassen. Insgesamt summiert sich jetzt die Zahl der Entlassungen auf wahnsinnige 11.000 seit der Übernahme durch die Allianz.
Die Commerzbank suchte während des Booms Fachleute in Massen. Und wird sie jetzt wegen des strengen, arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsrechts nicht so einfach wieder los.
Die Gontard & Metallbank musste im Mai 2002 Insolvenz anmelden. Und zwar aus einem Grund, an dem noch so manch andere Bank schwer zu knabbern hat: Ihr Hauptgeschäft war es, Unternehmen an die Börse zu bringen (so genannte IPOs). Doch dieses früher äußerst lukrative Geschäft ist zusammen mit dem Neuen Markt drastisch eingebrochen.
Wenn Geldverleiher in Schwierigkeiten geraten, lösen sie einen gefährlichen Mechanismus aus: Kredite werden eingefroren. So ziehen sie die ganze Wirtschaft immer tiefer in eine steile Abwärts-Spirale.
Diese unermüdliche Arbeit im Dienst aller Privatanleger findet Anerkennung von höchster Stelle: Kürzlich erklärte die US-Behörde zur Überwachung der Buchführungspflichten (GAO), dass meine Voraussagen drei Mal genauer sind als die des besten Konkurrenten. Und das ist auch der Grund, warum die New York Times schrieb, ich hätte "als Erster die Gefahren erkannt und diese auch eindeutig beim Namen genannt".
Und dies ist auch der Grund dafür, warum ich den Abonnenten meines Geldanlage-Informationsdienstes 2001 und 2002 zu Gewinnen von bis zu 152 % verholfen habe. Während die meisten Anleger nur tatenlos daneben stehen konnten, als die große Geldvernichtungsmaschine angeworfen wurde, die über 5 Billionen Euro Vermögen für immer auslöschte.
Es ist meine tiefe Überzeugung und ich habe auch die Beweise, dass wir dieses Jahr noch besser abschneiden werden. Weil tausende deutscher und amerikanischer Aktiengesellschaften gegen 3 Killer-Faktoren kämpfen:
KILLER-FAKTOR 1:
Massive Schulden. Auch Großkonzerne werden daran ersticken.
In Amerika hat man gesehen, dass die Bilanzierungsskandale ein Unternehmen nach dem anderen verwüsteten: Enron, Global Crossing, WorldCom. Viele Leute vergessen, dass alle Bilanzierungstricks zur Folge haben, dass massive Schuldenberge angehäuft werden. Schulden, die niemals beglichen werden können.
In Deutschland ist das Bild ebenso erschütternd: Nahezu alle DAX-Unternehmen haben in den letzten Jahren weit über ihre Verhältnisse gelebt und Milliarden von Verbindlichkeiten aufgetürmt. Der gigantische Schuldenberg ist im vergangenen Jahr auf 1.468 Milliarden Euro angewachsen.
Zur Verdeutlichung: 30 Unternehmen haben Schulden, die zwei Dritteln des Bruttoinlandsprodukts von 82 Millionen Deutschen entsprechen! Z.B.:
*
DaimlerChrysler. Ungekrönter Schuldenkönig im DAX. Bei Banken und Bond-Anlegern steht der Stuttgarter Autobauer mit über 90 Milliarden Euro in der Kreide.
*
Deutsche Telekom. Europas größter Telekommunikations-Konzern steckt tief in den roten Zahlen. Er schiebt Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 65 Milliarden Euro vor sich her.
*
RWE. Der Schuldenberg des Essener Energiekonzerns belief sich 2002 auf 26 Milliarden Euro. Nach Angaben des Konzerns sollen sie erst 2004 ihren Höchststand erreichen.
*
BMW. Trägt eine Schuldenlast in Höhe von 25,67 Milliarden Euro.
*
VW.Die Verbindlichkeiten von Europas größtem Autohersteller belaufen sich auf 42,79 Milliarden Euro.
Ich habe eine Reihe weiterer Unternehmen identifiziert, denen die rote Tinte quasi aus jeder Pore tropft. Fast unmöglich, dass Sie ein weiteres Jahr überleben. Darunter sind z.B. Ford, JP Morgan, Kellogg`s und Xerox. Wohlklingende Namen, nicht wahr? Aber auch sie werden unter ihren immensen Schulden zusammenbrechen.
Auch in Deutschland waren noch nie so viele Unternehmen in einem katastrophalen Zustand - einschließlich der Blue Chips.
KILLER-FAKTOR 2:
Uns steht die verheerendste Deflation seit 1929 bevor.
Die Geschichte hat uns gelehrt, die Inflation zu fürchten. In Wirklichkeit aber hat die Deflation weitaus verheerendere Folgen. Im Rückblick hat die Inflation das Anlegervermögen nur um einen kleinen Prozentsatz reduziert. Die Deflation hingegen führt zu einer bodenlosen Senkung der Preise und damit auch zum rasanten Verlust von Unternehmensgewinnen. Mit der Folge, dass ihre Aktien 10 %, 20 %, 30 % oder mehr in weniger als nur einem Monat an Wert verlieren.
Deflation war auch der Grund, dass die Weltwirtschaftskrise ein ganzes Jahrzehnt dauerte. Und genau das Gleiche passiert im Augenblick. Exakt in diesem Moment:
*
Bei Computer-Servern der Firmen IBM, Compaq oder Sun Microsystems wurden die Preise um 70% gesenkt.
*
Der Preis eines 128-Megabyte-DRAM-Chip, mit dem nahezu jeder PC ausgestattet ist, fiel von 14 Dollar im Februar 2001 auf augenblicklich weniger als 2 Dollar. Können Sie sich das vorstellen? Eine Preissenkung von 86 % innerhalb von nur zwei Jahren! Unglaublich, aber kein Einzelfall:
*
Durch aberwitzige Rabattschlachten versucht der deutsche Einzelhandel seine Krise zu bewältigen - und erreicht damit genau das Gegenteil: Die Umsätze brechen weg, Investitionen müssen zurückgefahren werden und zwangsläufig wird auch Personal abgebaut. Was ebenfalls zu einem geringeren Konsum führt. Ein Teufelskreis.
*
Fast zwei Drittel aller Deutschen beabsichtigen, dieses Jahr ihr Budget für Urlaub und Reisen zu kappen - obwohl die Preise zwischen 8 und 20 Prozent gesunken sind.
*
Fiat und Nissan bieten mittlerweile die Autofinanzierung zum Nulltarif. Echte Freundschaftskonditionen auch bei vielen anderen Herstellern: Suzuki will 0,1 Prozent, Mitsubishi verlangt 0,25 und Honda 0,9 (Stand: Januar 2003). Ein Ende der Null-Zins-Offerten ist nicht in Sicht.
Sogar im Geschäftskunden-Bereich sind die Preise dramatisch gefallen. Niemand scheint zu verstehen, welche Gefahr von diesen massiven Preissenkungen ausgeht. Es ist ungefähr so, als würde man zusehen, wie diese Unternehmen sich selber die Kehle durchschneiden. Und zwar ganz langsam, in Zeitlupe.
Warum? Weil diese Preissenkungen niemals zu steigenden Einnahmen oder Gewinnen führen und auch nicht im geringsten Maße dazu beitragen, dass betroffene Unternehmen ihre Schulden abtragen oder die Pleite abwenden können.
Überall wohin man schaut, findet ein regelrechter Preiskrieg zwischen konkurrierenden Unternehmen statt. Da braucht man kein Studium, um zu verstehen, dass dabei auch bis dato große, erfolgreiche Unternehmen zugrunde gehen können: Sie bekommen immer weniger Geld für jedes verkaufte Stück und verkaufen aufgrund der niedrigeren Nachfrage auch weniger!
Und natürlich lehren immer drastischere Rabatt-Aktionen den Konsumenten vor allem eines: nicht zu kaufen. Steigende Preise lösen beim Konsumenten einen Kaufimpuls aus, nach dem Motto "Jetzt zugreifen, bevor es zu spät ist". Wenn die Preise aber erst mal fallen, passiert genau das Gegenteil.
Sie haben sich in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon sehr oft gefragt: "Warum soll ich heute kaufen, wenn es morgen alles billiger gibt?" Oder noch schlimmer: "Warum soll ich überhaupt noch etwas kaufen, wenn die Waren innerhalb kürzester Zeit nichts mehr wert sind?"
Und natürlich haben Sie damit Recht. Denn in einer Deflations-Phase sparen Sie tatsächlich am meisten, je länger Sie warten. Die "Schnell zugreifen, bevor es zu spät ist"-Mentalität wird verdrängt durch das Motto "Später kaufen, noch mehr sparen".
Ironischerweise sinken Umsätze und Gewinne mit jeder Preissenkung kontinuierlich. Damit führen sich diese Unternehmen quasi selbst zum Schafott - das Umsatzvolumen fällt, und mit der Senkung der Preise fallen auch die Gewinne immer weiter. Und das ist der sichere K.O-Schlag für jede Firma, die bis zum Hals in Schulden steckt und keine Barmittel mehr hat.
In genau dieser Situation befinden sich aber Hunderte von Firmen -
im Schuldensumpf, gierig nach Barem, sich selber eine Schrotflinte in
den Hals schiebend, damit auch ja nichts schief geht beim Suizid.
Denken Sie, das sei wirklich schlimm? Ich sage Ihnen: Es wird noch viel, viel schlimmer kommen. Ein noch nie da gewesenes schauriges Gemetzel steht uns bevor. Es dauert nämlich gar nicht mehr lange, bis immer mehr Firmen in einem immer schnelleren Tempo Bankrott gehen und ihre Waren immer billiger in immer gnadenloseren Räumungsverkäufen anbieten müssen. Die Deflation, die Sie dann erleben werden, wird die bisher da gewesene wie ein Kinderspiel aussehen lassen.
KILLER-FAKTOR 3:
Argentiniens Zahlungsunfähigkeit - nur ein kleiner Vorgeschmack auf die bevorstehende weltweite Schuldenkrise.
Unternehmens-Pleiten in Deutschland und Amerika sowie eine nie da gewesene Deflation reichen allein schon aus, ein Blutbad an der Börse auszulösen. Aber diese Katastrophe wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass die gesamte Weltwirtschaft miteinander vernetzt ist. Desaströse Zustände in einem Staat haben unweigerlich Auswirkungen auf die Wall Street und alle anderen Börsen rund um den Globus.
In Ihrer persönlichen Gratis-Ausgabe meines Buches "Verdoppeln Sie Ihr Vermögen in der großen Geldpanik 2003!" beschreibe ich konkret, welche Auswirkungen die Globalisierung auf die Kapitalmärkte und damit auch auf Ihr Vermögen hat. Ich warne vor Staaten, die Pleite gehen könnten und mit dem totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch flirten.
Und ich sage Ihnen, welche Unternehmen ebenfalls untergehen, wenn die Wirtschaft dieser Staaten kollabiert. Des Weiteren zeige ich, warum wirklich jedes Unternehmen, speziell jene mit hohen Schulden - auch wenn sie gar keine Beziehungen zu den bankrotten Staaten haben -, dem Untergang geweiht ist.
Die Lektüre meines Buches könnte also auch ein lohnenswerter Hinweis für all jene Anleger sein, die mit exotischen Staatsanleihen liebäugeln. Denn was nutzen in Aussicht gestellte Top-Renditen, wenn sich das eingesetzte Kapital komplett in Luft auflöst?
Was interessiert mich die Lage in Lateinamerika, mögen Sie vielleicht denken. "Alles sehr weit weg ... Wenn ich mein Geld in Deutschland anlege, kann ja nicht so viel passieren ... Die Schuldenkrise in Brasilien ist zwar tragisch, aber was hat das mit mir zu tun?" Ich möchte Ihnen jetzt erklären, warum die Probleme der Entwicklungsländer letztendlich auch Ihre sind.
Noch nie war die Weltwirtschaft in einem schlechteren Zustand als heute.
*
Argentinien, die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, ist mit rund 140 Milliarden Dollar verschuldet. Bei Privatanlegern weltweit steht Argentinien mit rund 51 Milliarden Dollar in der Kreide. Im Dezember 2001 hatte das Land seine Zahlungsunfähigkeit erklärt und jeglichen Schuldendienst gegenüber privaten Kapitalgebern eingestellt. Vor der Peso-Abwertung und der Umwandlung von Dollar in Peso waren die von den Anlegern gehaltenen Anleihen 95 Milliarden Dollar wert gewesen.
Jetzt gab die argentinische Regierung bekannt, welche Investmentbank mit den Privatanlegern verhandeln soll. Experten rechnen damit, dass diese Verhandlungen Jahre dauern werden - wenn es überhaupt zu einer Lösung kommt. Allein deutsche Anleger hatten 7 Milliarden Dollar in Argentinien investiert und verloren.
Dieser Vorgang ist wesentlich schlimmer, als sich irgendjemand hätte ausmalen können. Das größte Horror-Szenario für einen Anleger ist doch entweder ein Zahlungsverzug oder eine Abwertung. Doch in diesem Fall ist beides gleichzeitig eingetreten ...
Überflüssig zu erwähnen, dass natürlich nicht nur Privatanleger, sondern auch zahlreiche große Banken rund um den Globus vom Zahlungsverzug Argentiniens betroffen sind. Und auch hunderte anderer Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Argentinien. Welche Firmen und Banken das sind, sage ich Ihnen in meinem Buch.
Argentinien bringt nicht zuletzt auch die Entscheidungsträger des Internationalen Währungsfonds (IWF) in eine Zwickmühle: Zwar hat das Direktorium des IWF kürzlich eine Kreditverlängerung genehmigt, jedoch werden keine neuen Gelder bereitgestellt. Falls weiterhin eine wirkliche Hilfe ausbleibt, werden Kritiker dem IWF vorhalten, für Plünderungen, Unruhen und sogar einen Bürgerkrieg verantwortlich zu sein, der möglicherweise den Tod tausender Menschen zur Folge hat. Sollte der IWF allerdings tatsächlich mehr Geld austeilen, würde jedes Entwicklungsland verführt sein, seine Zahlungsverpflichtungen auf die lange Bank zu schieben und die Währung abzuwerten. Ein weiterer Kandidat ist zum Beispiel Brasilien:
*
Brasilien hat doppelt so hohe Verbindlichkeiten wie Argentinien. Die Regierung hat bereits zugelassen, dass der Real um 60 % abgewertet wurde. Außerdem haben die Brasilianer bei den Präsidentschaftswahlen den Linkspopulisten Lula da Silva gewählt. Dieser versprach, weiterhin Schulden zu tilgen, aber er wird wahrscheinlich die wenig beneidenswerte Aufgabe übernehmen, die Schuldenstruktur des Landes ohne internationale Hilfe zu verbessern.
*
Zahlungsverzüge in Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand und der Türkei sind heute wahrscheinlicher denn je.
*
Japan: 2002 war das Jahr der Negativrekorde. Tokios Aktienmarkt stürzte auf sein tiefstes Niveau seit 19 Jahren, die Arbeitslosenquote stieg auf neuen Nachkriegsrekord, die öffentliche Verschuldung lag bei rund 5 Billionen Dollar, was dem 12fachen an jährlichen Steuereinnahmen oder 140 % der gesamten japanischen Wirtschaftsleistung entspricht. Damit ist Japan, Ende der 80er Jahre praktisch schuldenfrei, zum größten Schuldner der Welt geworden.
Die japanische Zentralbank gab zu, dass die Summe fauler Kredite um 25 % höher ist als die bisher zugegebenen 1,5 Billionen Dollar. Nicht nur kleine Kreditinstitute leiden unter einer dünnen Kapitaldeckung, auch die ersten Großbanken sind in Konkurs gegangen. Der nächste Zusammenbruch der japanischen Wirtschaft ist unabwendbar, mit unberechenbaren Folgen auf Deutschland, Asien und die USA.
*
Europa: In allen europäischen Staaten und Branchen haben sich immense Unternehmensschulden aufgetürmt. Sei es bei den Versicherungen, Fluggesellschaften, der chemischen Industrie, im Automobil- oder im Freizeitsektor.
Deutschland ist im europäischen Vergleich nicht nur Schlusslicht im Wachstum, sondern verzeichnet auch die meisten Unternehmenspleiten. Zu einer schwachen Eigenkapitalbasis und einer hohen Verschuldung vieler Unternehmen kommen eine steigende Arbeitslosenquote und Konsumverzicht. Die Banken stecken ebenfalls in einer tiefen Krise und müssen immer mehr Kredite abschreiben.
Das kommt Ihnen bekannt vor? Richtig, eine Abwärtsspirale à la Japan ist nicht mehr ausgeschlossen. Zu dieser desolaten Lage kommt auch noch eine galoppierende Deflation, die die Unternehmensgewinne verschlingt - sozusagen als letzter Sargnagel für krisengeschüttelte Firmen.
Um es noch mal deutlich zu sagen: Schon bald werden weltweit große Unternehmen und Banken wie Dominosteine umfallen. Die Schockwellen der einstürzenden Unternehmen werden die Finanzmärkte rund um den Globus erschüttern. Mit der Folge, dass jegliches Verbrauchervertrauen vernichtet wird, der Konsum zurückgefahren wird, Aktienkurse in ungeahnte Tiefen abrutschen und unzählige weitere Unternehmen mit untergehen....
.
Wenn man ein paar Namen und Fakten austauscht könnte man denken, der Bericht beschreibt die Situation in Deutschland ...
Brasilien: Aus dem roten Traum erwacht
In Brasilien regieren Trotzkisten, Leninisten und Guerillakämpfer - und werden darüber zu moderaten Sozialdemokraten
Von Anne Grüttner
Linke Bewegungen in Lateinamerika und dem Rest der Welt hatten sich viel versprochen von der Regierung des Luiz Inácio „Lula“ da Silva. Aber die soziale Revolution in Brasilien ist ausgeblieben.
Wer sich aber im Kongress oder in den Ministerien der Hauptstadt Brasília bewegt, erkennt dennoch einen revolutionär anmutenden Wandel. Nach zehn Jahren in der Opposition spüren die ehemaligen Guerillakämpfer und Gewerkschafter, Trotzkisten und Leninisten von Lulas Arbeiterpartei Partido dos Trabalhadores (PT) nun erstmals die Last der Verantwortung. Lula, der im brasilianischen System zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef ist, hat sein Kabinett größtenteils mit Mitgliedern der Arbeiterpartei besetzt. Und auch im Kongress, dessen Abgeordnete und Senatoren gleichzeitig mit dem Präsidenten neu gewählt wurden, legte Lulas Partei in den letzten Wahlen stark zu.
Die früheren Oppositionellen versuchen nun als Senatoren, Abgeordnete, Sekretäre und Minister, alte Ideale der realen Welt anzupassen. „Ich habe früher die Verstaatlichung des Finanzsystems und des Transportwesens verteidigt“, sagt Finanzminister Antonio Palocci. „Aber fängt man erst einmal an zu regieren, dann wird einem klar, dass diese Dinge in der Praxis nicht funktionieren.“
Paloccis Läuterung vom militanten Trotzkisten zum moderaten Führungsmitglied setzte bereits vor zehn Jahren ein, als Bürgermeister der Stadt Ribeirão Preto im Bundesstaat São Paulo. Schon damals setzte er sich der Kritik der eigenen Parteigenossen aus, als er etwa das lokale Telefonunternehmen privatisierte und der Stadt strenge Haushaltsdisziplin auferlegte. Nun steht Palocci noch größeren Herausforderungen gegenüber.
Als im vergangenen Jahr die Umfragen einen Wahlsieg für Lula vorhersagten, zogen Brasiliens Gläubiger und Investoren ihr Geld ab. Sie misstrauten den finanzpolitischen Fähigkeiten der „Linken“. Damit drohte ein Zahlungsausfall wie im Nachbarland Argentinien. Um das zu verhindern, bekannte sich Lula schon vor seiner Wahl zum Präsidenten im Oktober zu einer Fortführung der einst als „neoliberal“ etikettierten Wirtschaftspolitik seines Vorgängers Fernando Henrique Cardoso.
Tatsächlich verschrieb der neue Finanzminister dem brasilianischen Staat sehr schnell eine Kürzung der öffentlichen Ausgaben um vier Milliarden Dollar und setzte für dieses und das nächste Jahr sogar noch ehrgeizigere Haushaltsziele als die „neoliberalen“ Vorgänger. Zudem hob die Zentralbank in Übereinstimmung mit der Regierung die Leitzinsen wiederholt an, um die bedrohlich steigende Inflation zu kontrollieren.
Hohe Zinsen und strenge Sparpolitik drücken erst mal aufs Wachstum und schränken zudem den finanziellen Spielraum für die Realisierung der ambitionierten sozialpolitischen Versprechen stark ein. Die Regierung senkte ihre diesjährige Wachstumsprognose bereits von 2,8 auf 2,2 Prozent, viele Ökonomen gehen von einem noch niedrigeren Wirtschaftswachstum aus. „Die Arbeitslosigkeit dürfte weiter zulegen“, sagt Professor Anselmo Luiz Dos Santos, Experte für Arbeit und Gewerkschaftsthemen an der Universität Campinas.
„Es ist logisch, dass die Brasilianer eine Regierung wollen, die Zinssätze heruntersetzt, Wirtschaftswachstum schafft und Sozialpolitik macht“, verteidigt sich Palocci. „Aber der gesunde Menschenverstand sagt, dass jedes Regierungsprogramm einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt und dass ein Land mit vielen Schulden mehr einnehmen muss, um diese zu zahlen.“ Brasilien müsse in seine Glaubwürdigkeit investieren.
In dieser Hinsicht hat der Finanzminister bereits viel erreicht. Unter Lulas Regierung stieg der Real kräftig gegenüber dem Dollar. Die Zinsaufschläge für brasilianische Staatspapiere gegenüber denen der USA sanken von 24 Prozenpunkten kurz vor der Wahl auf nun unter 8 Prozentpunkte. Das ist ein Zeichen, dass Gläubiger die Gefahr eines Zahlungsausfalls mittlerweile deutlich niedriger einschätzen. „Wir haben eine ökonomische Katastrophe verhindert“, sagt Präsident Lula. Und Horst Köhler, Direktor des Internationalen Währungsfonds, zeigte sich „zutiefst beeindruckt“. Lula vermittle „eine Glaubwürdigkeit, die andere Staatsmänner oft vermissen lassen“.
Weil alte Ideale tief sitzen,…
Doch traditionelle Sympathisanten des Exgewerkschafters Lula und vor allem auch Teile seiner eigenen Partei sind anderer Meinung. Sie fordern eine Rückkehr zu den traditionellen Prinzipien der Arbeiterpartei. „Lulas Wahlsieg ist das Ergebnis des historischen Kampfes, den die PT in den letzten acht Jahren gegen das neoliberale Projekt von Expräsident Fernando Henrique Cardoso geführt hat“, mahnt Nestor Pellegrino, Fraktionschef der PT im Abgeordnetenhaus und Mitglied des linken Parteiflügels. Vielen Abgeordneten, die sich nicht so leicht von ihren Wurzeln trennen wollen, spricht er damit aus der Seele.
Dem entgegnet Lulas Präsidialamtsleiter José Dirceu: „Unsere Agenda ist hart und schwierig, in vielen Fällen sehr konfliktreich – aber die PT muss einfach einsehen, dass sie jetzt Regierung ist.“ Regieren heißt in diesem Falle nicht nur, dass Brasiliens Arbeiterpartei mit dem unpopulären Sparkurs fortfahren muss. Regieren heißt in diesem Fall auch, die Staatsausgaben mithilfe von Strukturreformen mittel- und langfristig zu stabilisieren.
…werden die Genossen geschult
Das wichtigste Projekt ist eine Überarbeitung des staatlichen Rentenversicherungssystems, die Ende des Monats in den Kongress eingebracht worden ist. Dabei geht es vor allem darum, Privilegien für Beamte abzuschaffen, die aus einem separaten Rentensystem bedient werden. Zum Vergleich: Das System für Beamte muss 2,6 Millionen Menschen unterstützen, weist aber ein Defizit von umgerechnet 18 Milliarden Dollar auf. Demgegenüber kommt das System für Private nur auf ein jährliches Defizit von 5,7 Milliarden Dollar – obwohl es fast zehnmal so viele Rentner versorgt.
Schon die Regierung Cardoso bemühte sich vergeblich um eine solche Reform. Sie scheiterte am Widerstand der Opposition, nicht zuletzt vonseiten der Arbeiterpartei. „Das Problem ist der linke Flügel, die haben die letzten zehn Jahre damit zugebracht, jegliche Sozialversicherungsreform zu verhindern“, sagt José Luciano Dias, Analyst des privaten Forschungsinstituts Góes Consultores Associados in Brasília. „Wenn jetzt die gleichen PT-Leute die Hand heben, um für die Reform zu stimmen, wäre das eine Revolution. Das geht bisher über meine Vorstellungskraft.“
Der moderate Führungszirkel der Regierung gibt sich allerdings optimistisch. „Man muss die Reform nur gut präsentieren und in allen Einzelheiten diskutieren, dann wird sie auch verabschiedet“, sagt Senator Eduardo Suplicy. „Die PT hat früher nur gegen einzelne Punkte der Reform gekämpft. Der Unterschied ist, dass frühere Entwürfe nicht in Übereinstimmung mit allen Betroffenen ausgearbeitet wurden.“
Getreu diesem Credo wurde der Gesetzesentwurf nun von einer Kommission ausgearbeitet, an der alle betroffenen Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen beteiligt sind. Zusätzlich organisiert die Partei für widerspenstige Genossen spezielle Seminare zum Thema Rentenreform sowie über allgemeine Wirtschaftspolitik, in denen Spezialisten den Sachverhalt erklären und anschließend diskutieren lassen. Die Linke müsse sich jetzt entscheiden, ob sie mehr Geld in Sozialpolitik stecken oder es lieber im ineffizienten staatlichen Rentensystem versacken lassen wolle, heißt es in der Hauptstadt Brasília.
Auf Diskussion und Konsensbildung baut die Regierung Lula auch im Konflikt mit den derzeit etwa 72000 landlosen Familien, die auf Zuteilung von Grund und Boden warten. Während des Karnevals kam es erstmals nach Lulas Antritt wieder zu Landbesetzungen. Die Landlosenbewegung droht mit weiteren Protesten, wenn die Administration Lula die seit 1988 in der Verfassung verankerte Landreform nicht beschleunigt. Eine Kommission, an der Regierungsvertreter sowie die verschiedenen Initiativen von Betroffenen teilnehmen, wird „bis Juni oder Juli einen langfristig angelegten Plan für die Landreform ausarbeiten“, hofft Geraldo Fontes, nationaler Koordinator der Landlosen-Bewegung Movimento sin Terra.
Entscheidend für Lulas Durchsetzungskraft gegen die verschiedenen Gruppen in der eigenen Partei wird sein, ob er seine Popularität in der Bevölkerung halten kann. Bisher sieht es danach aus. Ende März ergab eine Befragung, dass 76 Prozent der Brasilianer Lula weiterhin eine gute oder optimale Regierungsarbeit zutrauen.
Am besten von allen bisherigen Leistungen der Regierung bewerteten die Befragten dabei das Programm „Fome Zero“ („Kein Hunger“). Fome Zero ist Lulas sozialpolitisches Aushängeschild, für das eigens ein Ministerium für Ernährungssicherung und Kampf gegen Hunger mit etwa 130 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von 1,8 Milliarden Real (etwa 600 Millionen Dollar) geschaffen wurde. Bisher startete das Ministerium zwei Pilotprojekte in Gemeinden mit etwa 5000 Einwohnern im ärmsten brasilianischen Bundesstaat Piaui. Dort bekommen Familien, die weniger als die Hälfte des Mindestlohnes verdienen, Lebensmittelkarten im Wert von je 50 Real (etwa 17 Dollar) zugeteilt.
Gleichzeitig ist „Fome Zero ein reines Hilfsprogramm“, sagt Geraldo Fontes. Das größere Problem dahinter sei die Verarmung. Sie zu bekämpfen, brauche es Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten. Dass aber kann kein Hilfsprogramm auf Dauer leisten, sondern nur ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Antonio Rocha Magalhaes, Senior Advisor der Weltbank in Brasilien, ist da optimistisch: „Die Regierung hat die üblichen Umsetzungsschwierigkeiten, die bei einer solch komplexen Aufgabe normal sind.“ Doch sie habe gute Chancen, die aktuelle wirtschaftliche Schwäche zu überwinden. „Wenn der derzeitige Trend anhält, was ich nicht bezweifle, sollte Brasiliens Wirtschaft schnell wieder an Wachstum gewinnen.“
DIE ZEIT - 08.05.2003
Wenn man ein paar Namen und Fakten austauscht könnte man denken, der Bericht beschreibt die Situation in Deutschland ...

Brasilien: Aus dem roten Traum erwacht
In Brasilien regieren Trotzkisten, Leninisten und Guerillakämpfer - und werden darüber zu moderaten Sozialdemokraten
Von Anne Grüttner
Linke Bewegungen in Lateinamerika und dem Rest der Welt hatten sich viel versprochen von der Regierung des Luiz Inácio „Lula“ da Silva. Aber die soziale Revolution in Brasilien ist ausgeblieben.
Wer sich aber im Kongress oder in den Ministerien der Hauptstadt Brasília bewegt, erkennt dennoch einen revolutionär anmutenden Wandel. Nach zehn Jahren in der Opposition spüren die ehemaligen Guerillakämpfer und Gewerkschafter, Trotzkisten und Leninisten von Lulas Arbeiterpartei Partido dos Trabalhadores (PT) nun erstmals die Last der Verantwortung. Lula, der im brasilianischen System zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef ist, hat sein Kabinett größtenteils mit Mitgliedern der Arbeiterpartei besetzt. Und auch im Kongress, dessen Abgeordnete und Senatoren gleichzeitig mit dem Präsidenten neu gewählt wurden, legte Lulas Partei in den letzten Wahlen stark zu.
Die früheren Oppositionellen versuchen nun als Senatoren, Abgeordnete, Sekretäre und Minister, alte Ideale der realen Welt anzupassen. „Ich habe früher die Verstaatlichung des Finanzsystems und des Transportwesens verteidigt“, sagt Finanzminister Antonio Palocci. „Aber fängt man erst einmal an zu regieren, dann wird einem klar, dass diese Dinge in der Praxis nicht funktionieren.“
Paloccis Läuterung vom militanten Trotzkisten zum moderaten Führungsmitglied setzte bereits vor zehn Jahren ein, als Bürgermeister der Stadt Ribeirão Preto im Bundesstaat São Paulo. Schon damals setzte er sich der Kritik der eigenen Parteigenossen aus, als er etwa das lokale Telefonunternehmen privatisierte und der Stadt strenge Haushaltsdisziplin auferlegte. Nun steht Palocci noch größeren Herausforderungen gegenüber.
Als im vergangenen Jahr die Umfragen einen Wahlsieg für Lula vorhersagten, zogen Brasiliens Gläubiger und Investoren ihr Geld ab. Sie misstrauten den finanzpolitischen Fähigkeiten der „Linken“. Damit drohte ein Zahlungsausfall wie im Nachbarland Argentinien. Um das zu verhindern, bekannte sich Lula schon vor seiner Wahl zum Präsidenten im Oktober zu einer Fortführung der einst als „neoliberal“ etikettierten Wirtschaftspolitik seines Vorgängers Fernando Henrique Cardoso.
Tatsächlich verschrieb der neue Finanzminister dem brasilianischen Staat sehr schnell eine Kürzung der öffentlichen Ausgaben um vier Milliarden Dollar und setzte für dieses und das nächste Jahr sogar noch ehrgeizigere Haushaltsziele als die „neoliberalen“ Vorgänger. Zudem hob die Zentralbank in Übereinstimmung mit der Regierung die Leitzinsen wiederholt an, um die bedrohlich steigende Inflation zu kontrollieren.
Hohe Zinsen und strenge Sparpolitik drücken erst mal aufs Wachstum und schränken zudem den finanziellen Spielraum für die Realisierung der ambitionierten sozialpolitischen Versprechen stark ein. Die Regierung senkte ihre diesjährige Wachstumsprognose bereits von 2,8 auf 2,2 Prozent, viele Ökonomen gehen von einem noch niedrigeren Wirtschaftswachstum aus. „Die Arbeitslosigkeit dürfte weiter zulegen“, sagt Professor Anselmo Luiz Dos Santos, Experte für Arbeit und Gewerkschaftsthemen an der Universität Campinas.
„Es ist logisch, dass die Brasilianer eine Regierung wollen, die Zinssätze heruntersetzt, Wirtschaftswachstum schafft und Sozialpolitik macht“, verteidigt sich Palocci. „Aber der gesunde Menschenverstand sagt, dass jedes Regierungsprogramm einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt und dass ein Land mit vielen Schulden mehr einnehmen muss, um diese zu zahlen.“ Brasilien müsse in seine Glaubwürdigkeit investieren.
In dieser Hinsicht hat der Finanzminister bereits viel erreicht. Unter Lulas Regierung stieg der Real kräftig gegenüber dem Dollar. Die Zinsaufschläge für brasilianische Staatspapiere gegenüber denen der USA sanken von 24 Prozenpunkten kurz vor der Wahl auf nun unter 8 Prozentpunkte. Das ist ein Zeichen, dass Gläubiger die Gefahr eines Zahlungsausfalls mittlerweile deutlich niedriger einschätzen. „Wir haben eine ökonomische Katastrophe verhindert“, sagt Präsident Lula. Und Horst Köhler, Direktor des Internationalen Währungsfonds, zeigte sich „zutiefst beeindruckt“. Lula vermittle „eine Glaubwürdigkeit, die andere Staatsmänner oft vermissen lassen“.
Weil alte Ideale tief sitzen,…
Doch traditionelle Sympathisanten des Exgewerkschafters Lula und vor allem auch Teile seiner eigenen Partei sind anderer Meinung. Sie fordern eine Rückkehr zu den traditionellen Prinzipien der Arbeiterpartei. „Lulas Wahlsieg ist das Ergebnis des historischen Kampfes, den die PT in den letzten acht Jahren gegen das neoliberale Projekt von Expräsident Fernando Henrique Cardoso geführt hat“, mahnt Nestor Pellegrino, Fraktionschef der PT im Abgeordnetenhaus und Mitglied des linken Parteiflügels. Vielen Abgeordneten, die sich nicht so leicht von ihren Wurzeln trennen wollen, spricht er damit aus der Seele.
Dem entgegnet Lulas Präsidialamtsleiter José Dirceu: „Unsere Agenda ist hart und schwierig, in vielen Fällen sehr konfliktreich – aber die PT muss einfach einsehen, dass sie jetzt Regierung ist.“ Regieren heißt in diesem Falle nicht nur, dass Brasiliens Arbeiterpartei mit dem unpopulären Sparkurs fortfahren muss. Regieren heißt in diesem Fall auch, die Staatsausgaben mithilfe von Strukturreformen mittel- und langfristig zu stabilisieren.
…werden die Genossen geschult
Das wichtigste Projekt ist eine Überarbeitung des staatlichen Rentenversicherungssystems, die Ende des Monats in den Kongress eingebracht worden ist. Dabei geht es vor allem darum, Privilegien für Beamte abzuschaffen, die aus einem separaten Rentensystem bedient werden. Zum Vergleich: Das System für Beamte muss 2,6 Millionen Menschen unterstützen, weist aber ein Defizit von umgerechnet 18 Milliarden Dollar auf. Demgegenüber kommt das System für Private nur auf ein jährliches Defizit von 5,7 Milliarden Dollar – obwohl es fast zehnmal so viele Rentner versorgt.
Schon die Regierung Cardoso bemühte sich vergeblich um eine solche Reform. Sie scheiterte am Widerstand der Opposition, nicht zuletzt vonseiten der Arbeiterpartei. „Das Problem ist der linke Flügel, die haben die letzten zehn Jahre damit zugebracht, jegliche Sozialversicherungsreform zu verhindern“, sagt José Luciano Dias, Analyst des privaten Forschungsinstituts Góes Consultores Associados in Brasília. „Wenn jetzt die gleichen PT-Leute die Hand heben, um für die Reform zu stimmen, wäre das eine Revolution. Das geht bisher über meine Vorstellungskraft.“
Der moderate Führungszirkel der Regierung gibt sich allerdings optimistisch. „Man muss die Reform nur gut präsentieren und in allen Einzelheiten diskutieren, dann wird sie auch verabschiedet“, sagt Senator Eduardo Suplicy. „Die PT hat früher nur gegen einzelne Punkte der Reform gekämpft. Der Unterschied ist, dass frühere Entwürfe nicht in Übereinstimmung mit allen Betroffenen ausgearbeitet wurden.“
Getreu diesem Credo wurde der Gesetzesentwurf nun von einer Kommission ausgearbeitet, an der alle betroffenen Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppen beteiligt sind. Zusätzlich organisiert die Partei für widerspenstige Genossen spezielle Seminare zum Thema Rentenreform sowie über allgemeine Wirtschaftspolitik, in denen Spezialisten den Sachverhalt erklären und anschließend diskutieren lassen. Die Linke müsse sich jetzt entscheiden, ob sie mehr Geld in Sozialpolitik stecken oder es lieber im ineffizienten staatlichen Rentensystem versacken lassen wolle, heißt es in der Hauptstadt Brasília.
Auf Diskussion und Konsensbildung baut die Regierung Lula auch im Konflikt mit den derzeit etwa 72000 landlosen Familien, die auf Zuteilung von Grund und Boden warten. Während des Karnevals kam es erstmals nach Lulas Antritt wieder zu Landbesetzungen. Die Landlosenbewegung droht mit weiteren Protesten, wenn die Administration Lula die seit 1988 in der Verfassung verankerte Landreform nicht beschleunigt. Eine Kommission, an der Regierungsvertreter sowie die verschiedenen Initiativen von Betroffenen teilnehmen, wird „bis Juni oder Juli einen langfristig angelegten Plan für die Landreform ausarbeiten“, hofft Geraldo Fontes, nationaler Koordinator der Landlosen-Bewegung Movimento sin Terra.
Entscheidend für Lulas Durchsetzungskraft gegen die verschiedenen Gruppen in der eigenen Partei wird sein, ob er seine Popularität in der Bevölkerung halten kann. Bisher sieht es danach aus. Ende März ergab eine Befragung, dass 76 Prozent der Brasilianer Lula weiterhin eine gute oder optimale Regierungsarbeit zutrauen.
Am besten von allen bisherigen Leistungen der Regierung bewerteten die Befragten dabei das Programm „Fome Zero“ („Kein Hunger“). Fome Zero ist Lulas sozialpolitisches Aushängeschild, für das eigens ein Ministerium für Ernährungssicherung und Kampf gegen Hunger mit etwa 130 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von 1,8 Milliarden Real (etwa 600 Millionen Dollar) geschaffen wurde. Bisher startete das Ministerium zwei Pilotprojekte in Gemeinden mit etwa 5000 Einwohnern im ärmsten brasilianischen Bundesstaat Piaui. Dort bekommen Familien, die weniger als die Hälfte des Mindestlohnes verdienen, Lebensmittelkarten im Wert von je 50 Real (etwa 17 Dollar) zugeteilt.
Gleichzeitig ist „Fome Zero ein reines Hilfsprogramm“, sagt Geraldo Fontes. Das größere Problem dahinter sei die Verarmung. Sie zu bekämpfen, brauche es Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten. Dass aber kann kein Hilfsprogramm auf Dauer leisten, sondern nur ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Antonio Rocha Magalhaes, Senior Advisor der Weltbank in Brasilien, ist da optimistisch: „Die Regierung hat die üblichen Umsetzungsschwierigkeiten, die bei einer solch komplexen Aufgabe normal sind.“ Doch sie habe gute Chancen, die aktuelle wirtschaftliche Schwäche zu überwinden. „Wenn der derzeitige Trend anhält, was ich nicht bezweifle, sollte Brasiliens Wirtschaft schnell wieder an Wachstum gewinnen.“
DIE ZEIT - 08.05.2003
.
Neues (kostenpflichtiges) Handelsportal für Metalltrader:
http://www.vwd.de/vwd/content.htm?navi=produkte&id=143
.
Neues (kostenpflichtiges) Handelsportal für Metalltrader:
http://www.vwd.de/vwd/content.htm?navi=produkte&id=143
.
.
als stolzer Hanseat will ich mal was für das Stadtmarketing tun ...

Hamburg steuert den Hafen an
Sechs Kanonenschüsse eröffneten den Geburtstag: Schon am Freitag kamen rund 200 000 Besucher.
Charlotte Frank
Die Masten der "Kruzenshtern" sind das Erste, was am Horizont zu erkennen ist. Majestätisch und leuchtend gelb ragen sie in den Himmel, schneiden elegant durch die tief hängenden Wolken. Dann, wie aus dem Nichts, hebt sich die Silhouette der Fregatte "Bayern" vom Horizont ab. Als erstes Schiff der traditionellen Einlaufparade läuft sie in den Hamburger Hafen ein. Dahinter: rund 160 weitere Schiffe - vom imposanten Viermaster "Kruzenshtern" über Hochseekatamaran "Janina" und ein sprühendes Löschboot bis hin zu zahlreichen kleinen Segelbooten und Privatyachten. Mit drei Kanonenschüssen wird die Parade im Hafen empfangen. Es folgen drei Kanonenschüsse von Bord der Fregatte "Bayern". Jetzt hat es jeder gehört. Freitag, 15.45 Uhr: Der 814. Hafengeburtstag ist eröffnet.
Fast 200 000 Besucher kamen nach Schätzungen der Polizei ans Elbufer zwischen Blankenese und Speicherstadt, um die Einlaufparade mitzuerleben. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit bis zu 1,5 Millionen Gästen - jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt. Aber das ist noch nicht sicher: "Am Sonntag wird es den ganzen Tag über freundlich und trocken mit Temperaturen um die 20 Grad", so Meteorologe Kurt Flechsenhar vom Deutschen Wetterdienst. "Sonnabend allerdings erwarten wir durchwachsenes Wetter, nachmittags oder abends kann es Regen geben."
Auch das wäre kein Problem. Am Freitag jedenfalls schien das schlechte Wetter den Hamburgern nichts auszumachen. Seit zehn Uhr morgens flanierten die Gäste über die Hafenmeile, es roch nach Bratwurst und Popcorn, Schmalzgebäck und - ganz wichtig - Bier (0,3 Liter kosten 2,50 Euro). Die ersten Fischbrötchen wurden verkauft, die frühen Fahrgeschäfte waren in Betrieb, und alle paar Meter wechselte die Musik. Als um 12.30 Uhr der Helgoland-Katamaran "Halunder-Jet" an der Landungsbrücke 1a getauft wurde, sammelte sich bereits eine große Menschenmenge, die verfolgte, wie "Mamma Mia!"-Star Carolin Fortenbacher (39) die Sektflasche schwungvoll am Bug des Katamarans zerschellen ließ. "Wir sind stolz, den "Halunder-Jet" am ersten Tag des Hafengeburtstags zu taufen", so Günther Becker (63) von der Förde Reederei Seetouristik.
Dabei war offiziell noch gar nicht der Startschuss für das Fest gefallen. Erst sollte im Michel ab 13.30 Uhr der traditionelle Eröffnungsgottestdienst gefeiert werden - "mit sieben Geistlichen aus sechs Nationen", wie Michel-Pastor Helge Adolphsen (62) betonte. Aus der Kirche ging er direkt an Bord der "Rickmer Rickmers" - großes Glück, denn von hier, dem Logenplatz, waren die schönen Masten der "Kruzenshtern" früh zu sehen. Ein atemberaubender Ausblick.
Hamburger Abendblatt 10. Mai 2003
als stolzer Hanseat will ich mal was für das Stadtmarketing tun ...


Hamburg steuert den Hafen an
Sechs Kanonenschüsse eröffneten den Geburtstag: Schon am Freitag kamen rund 200 000 Besucher.
Charlotte Frank
Die Masten der "Kruzenshtern" sind das Erste, was am Horizont zu erkennen ist. Majestätisch und leuchtend gelb ragen sie in den Himmel, schneiden elegant durch die tief hängenden Wolken. Dann, wie aus dem Nichts, hebt sich die Silhouette der Fregatte "Bayern" vom Horizont ab. Als erstes Schiff der traditionellen Einlaufparade läuft sie in den Hamburger Hafen ein. Dahinter: rund 160 weitere Schiffe - vom imposanten Viermaster "Kruzenshtern" über Hochseekatamaran "Janina" und ein sprühendes Löschboot bis hin zu zahlreichen kleinen Segelbooten und Privatyachten. Mit drei Kanonenschüssen wird die Parade im Hafen empfangen. Es folgen drei Kanonenschüsse von Bord der Fregatte "Bayern". Jetzt hat es jeder gehört. Freitag, 15.45 Uhr: Der 814. Hafengeburtstag ist eröffnet.
Fast 200 000 Besucher kamen nach Schätzungen der Polizei ans Elbufer zwischen Blankenese und Speicherstadt, um die Einlaufparade mitzuerleben. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit bis zu 1,5 Millionen Gästen - jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt. Aber das ist noch nicht sicher: "Am Sonntag wird es den ganzen Tag über freundlich und trocken mit Temperaturen um die 20 Grad", so Meteorologe Kurt Flechsenhar vom Deutschen Wetterdienst. "Sonnabend allerdings erwarten wir durchwachsenes Wetter, nachmittags oder abends kann es Regen geben."
Auch das wäre kein Problem. Am Freitag jedenfalls schien das schlechte Wetter den Hamburgern nichts auszumachen. Seit zehn Uhr morgens flanierten die Gäste über die Hafenmeile, es roch nach Bratwurst und Popcorn, Schmalzgebäck und - ganz wichtig - Bier (0,3 Liter kosten 2,50 Euro). Die ersten Fischbrötchen wurden verkauft, die frühen Fahrgeschäfte waren in Betrieb, und alle paar Meter wechselte die Musik. Als um 12.30 Uhr der Helgoland-Katamaran "Halunder-Jet" an der Landungsbrücke 1a getauft wurde, sammelte sich bereits eine große Menschenmenge, die verfolgte, wie "Mamma Mia!"-Star Carolin Fortenbacher (39) die Sektflasche schwungvoll am Bug des Katamarans zerschellen ließ. "Wir sind stolz, den "Halunder-Jet" am ersten Tag des Hafengeburtstags zu taufen", so Günther Becker (63) von der Förde Reederei Seetouristik.
Dabei war offiziell noch gar nicht der Startschuss für das Fest gefallen. Erst sollte im Michel ab 13.30 Uhr der traditionelle Eröffnungsgottestdienst gefeiert werden - "mit sieben Geistlichen aus sechs Nationen", wie Michel-Pastor Helge Adolphsen (62) betonte. Aus der Kirche ging er direkt an Bord der "Rickmer Rickmers" - großes Glück, denn von hier, dem Logenplatz, waren die schönen Masten der "Kruzenshtern" früh zu sehen. Ein atemberaubender Ausblick.
Hamburger Abendblatt 10. Mai 2003
.

Ein neuer Geniestreich von Alan Greenspan
Alan Greenspan ist schon ein Genie. Seit der Zinssitzung am 6. Mai sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um rund 20 Stellen gefallen, während der Dollar um etwa 2 Cent gegenüber dem Euro nachgab. Unterdessen hat der S&P 500 wenigstens um ein paar Zähler zugelegt, und die durchschnittliche Rendite auf "Baa"-Bonds plumpste sogar um 26 Basispunkte.
Wie von Geisterhand scheint der inzwischen übliche Gleichklang der Renditen auf Staatsanleihen und der Börsen plötzlich durchbrochen. Wie Greenspan das geschafft hat? Nun ja, indem er die Gefahr einer Deflation nur andeutete, hat er impliziert, dass die Leitsätze noch lange sehr niedrig bleiben könnten.
Wie erhofft sind unmittelbar auch die langfristigen Zinsen gepurzelt.
Das entlastet die verschuldeten Unternehmen und Verbraucher und induziert vielleicht eine neue Immobilienrefinanzierungswelle. Zusammen mit dem fallenden Dollar, der sich bei den Importpreisen und in den Bilanzen der Firmen ohnehin schon bemerkbar macht, hilft das dabei, die Deflation zu vermeiden - beziehungsweise sie zu exportieren.
Aber das ist nicht der ganze Trick. Für die Börse hatte Greenspan noch ein Bonbon in petto. Er hat ihnen nicht nur bedeutet, wie sehr er auf der Hut ist. Nein, garniert hat er das noch mit der Bemerkung, dass die Risiken und Chancen in Bezug auf das Wachstum ausgeglichen seien. Na, dann ist doch eigentlich alles in Butter, nicht? Und all diese Botschaften auf zehn Zeilen. Hinreißend.
Wen wundert es bei solch kunstvoller Geldpolitik, dass der S&P 500 weiter über dem realen Nachkriegstrend notiert. Zwar können auf Dauer nicht alle Recht behalten, die pessimistischen Rentenanleger und die optimistischen Aktionäre. Aber obwohl die Bondmärkte eindeutig die verlässlicheren Signale senden, gibt es nun eine Chance für ein gutes zweites Börsenquartal. Nur ist sie hauchdünn. Und gesund wäre das nicht.
(...) FTD 12.05.03

Ein neuer Geniestreich von Alan Greenspan
Alan Greenspan ist schon ein Genie. Seit der Zinssitzung am 6. Mai sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um rund 20 Stellen gefallen, während der Dollar um etwa 2 Cent gegenüber dem Euro nachgab. Unterdessen hat der S&P 500 wenigstens um ein paar Zähler zugelegt, und die durchschnittliche Rendite auf "Baa"-Bonds plumpste sogar um 26 Basispunkte.
Wie von Geisterhand scheint der inzwischen übliche Gleichklang der Renditen auf Staatsanleihen und der Börsen plötzlich durchbrochen. Wie Greenspan das geschafft hat? Nun ja, indem er die Gefahr einer Deflation nur andeutete, hat er impliziert, dass die Leitsätze noch lange sehr niedrig bleiben könnten.
Wie erhofft sind unmittelbar auch die langfristigen Zinsen gepurzelt.
Das entlastet die verschuldeten Unternehmen und Verbraucher und induziert vielleicht eine neue Immobilienrefinanzierungswelle. Zusammen mit dem fallenden Dollar, der sich bei den Importpreisen und in den Bilanzen der Firmen ohnehin schon bemerkbar macht, hilft das dabei, die Deflation zu vermeiden - beziehungsweise sie zu exportieren.
Aber das ist nicht der ganze Trick. Für die Börse hatte Greenspan noch ein Bonbon in petto. Er hat ihnen nicht nur bedeutet, wie sehr er auf der Hut ist. Nein, garniert hat er das noch mit der Bemerkung, dass die Risiken und Chancen in Bezug auf das Wachstum ausgeglichen seien. Na, dann ist doch eigentlich alles in Butter, nicht? Und all diese Botschaften auf zehn Zeilen. Hinreißend.
Wen wundert es bei solch kunstvoller Geldpolitik, dass der S&P 500 weiter über dem realen Nachkriegstrend notiert. Zwar können auf Dauer nicht alle Recht behalten, die pessimistischen Rentenanleger und die optimistischen Aktionäre. Aber obwohl die Bondmärkte eindeutig die verlässlicheren Signale senden, gibt es nun eine Chance für ein gutes zweites Börsenquartal. Nur ist sie hauchdünn. Und gesund wäre das nicht.
(...) FTD 12.05.03
.
Devisenmärkte: Richtungsänderung der Flow of Funds ?
Eberhardt Unger
Die gravierendsten Veränderungen der Wechselkurse fanden seit Jahresbeginn zwischen Dollar und Euro statt. Das Pfund folgte dem Dollar. Und der Yen wurde durch äußerst umfangreiche Dollarkäufe der Bank of Japan künstlich gedrückt, um eine Abwertung des USD zu verhindern. Andere südostasiatische Währungen, wie z.B. Hongkong- Dollar, Yuan, sind fest an die US-Währung gekoppelt oder orientieren sich eng am Yen. So trifft die Hauptlast der Dollarschwäche die europäische Gemeinschaftswährung.
Erst in aller jüngster Zeit hat der Greenback auch gegenüber einem breiten Währungskorb amerikanischer Handelspartner nachgegeben. Könnte das der Beginn eines Aus- gleichs der Ungleichgewichte in den Leistungs- bilanzen sein ? In diesem Fall stehen den Devisen- märkten noch schwere Turbulenzen bevor.
Die Ungleichgewichte zwischen Volkswirtschaften mit einem Leistungsbilanzdefizit, das sind insbesondere die USA, und solche mit einem -überschuss, das sind insbesondere Südostasien und Europa, waren noch nie so groß.
Das US-Defizit liegt schon bei ca. 5 % des BIP und könnte 2003/2004 die Sechs-Prozent-Marke überschreiten, während die Überschussländer - schwache Importe wegen flauer Binnenkonjunktur - sogar noch höhere Überschüsse produzieren.
Dieses Szenario ruft geradezu nach einer Neuanpassung der Wechselkurse. Und " Neuanpassung " heißt hier Dollarabwertung. Die Frage ist nur, wie schnell und wieweit wird sie gehen.
Zur Finanzierung des Leistungsbilanzdefizits von 500 bis 600 Mrd. USD benötigen die USA einen Nettokapitalzufluss aus dem Ausland von rund 1,5 Mrd. USD täglich oder fast 50 Mrd. USD monatlich (Flow of Funds).
Bisher war Ihnen das gelungen, indem die US-Administration einer dollargläubigen Welt das Bild einer grundsoliden Volkswirtschaft mit nur vorübergehend leichter Beruhigung und anschließend erneut kräftigem Wachstum präsentierte. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die gegenwärtige Konjunkturflaute in den USA ist keine der üblichen, die kurz und wenig gravierend ausfällt und durch kräftige Zinssenkungen schnell wieder überwunden werden wird.
Eine Reihe von auf die Dauer nicht tragfähigen strukturellen Ungleichgewichten steht einer raschen Konjunkturumkehr entgegen. Und die Ausländer investieren nicht mehr so beherzt in USD-Anlagen. Seit drei Monaten infolge ist die Auslandsnachfrage nach US-Wertpapieren rückläufig. Im Februar betrugen die Nettokäufe 22 Mrd. USD, halb so viel wie im Januar. US-Investoren halten rund 2,1 Billionen USD Anlagen im Ausland, verglichen mit 3,2 Billionen US-Anlagen durch Ausländer.
Folgerung: Der Mittelzufluss aus dem Ausland in die USA scheint abzuebben. Wenn er nicht mehr 50 Mrd. USD monatlich erreicht, gerät die US-Valuta unter Druck. Nicht auszudenken wäre die Wirkung einer Richtungsänderung der Flow of Funds.
Devisenmärkte: Richtungsänderung der Flow of Funds ?
Eberhardt Unger
Die gravierendsten Veränderungen der Wechselkurse fanden seit Jahresbeginn zwischen Dollar und Euro statt. Das Pfund folgte dem Dollar. Und der Yen wurde durch äußerst umfangreiche Dollarkäufe der Bank of Japan künstlich gedrückt, um eine Abwertung des USD zu verhindern. Andere südostasiatische Währungen, wie z.B. Hongkong- Dollar, Yuan, sind fest an die US-Währung gekoppelt oder orientieren sich eng am Yen. So trifft die Hauptlast der Dollarschwäche die europäische Gemeinschaftswährung.
Erst in aller jüngster Zeit hat der Greenback auch gegenüber einem breiten Währungskorb amerikanischer Handelspartner nachgegeben. Könnte das der Beginn eines Aus- gleichs der Ungleichgewichte in den Leistungs- bilanzen sein ? In diesem Fall stehen den Devisen- märkten noch schwere Turbulenzen bevor.
Die Ungleichgewichte zwischen Volkswirtschaften mit einem Leistungsbilanzdefizit, das sind insbesondere die USA, und solche mit einem -überschuss, das sind insbesondere Südostasien und Europa, waren noch nie so groß.
Das US-Defizit liegt schon bei ca. 5 % des BIP und könnte 2003/2004 die Sechs-Prozent-Marke überschreiten, während die Überschussländer - schwache Importe wegen flauer Binnenkonjunktur - sogar noch höhere Überschüsse produzieren.
Dieses Szenario ruft geradezu nach einer Neuanpassung der Wechselkurse. Und " Neuanpassung " heißt hier Dollarabwertung. Die Frage ist nur, wie schnell und wieweit wird sie gehen.
Zur Finanzierung des Leistungsbilanzdefizits von 500 bis 600 Mrd. USD benötigen die USA einen Nettokapitalzufluss aus dem Ausland von rund 1,5 Mrd. USD täglich oder fast 50 Mrd. USD monatlich (Flow of Funds).
Bisher war Ihnen das gelungen, indem die US-Administration einer dollargläubigen Welt das Bild einer grundsoliden Volkswirtschaft mit nur vorübergehend leichter Beruhigung und anschließend erneut kräftigem Wachstum präsentierte. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die gegenwärtige Konjunkturflaute in den USA ist keine der üblichen, die kurz und wenig gravierend ausfällt und durch kräftige Zinssenkungen schnell wieder überwunden werden wird.
Eine Reihe von auf die Dauer nicht tragfähigen strukturellen Ungleichgewichten steht einer raschen Konjunkturumkehr entgegen. Und die Ausländer investieren nicht mehr so beherzt in USD-Anlagen. Seit drei Monaten infolge ist die Auslandsnachfrage nach US-Wertpapieren rückläufig. Im Februar betrugen die Nettokäufe 22 Mrd. USD, halb so viel wie im Januar. US-Investoren halten rund 2,1 Billionen USD Anlagen im Ausland, verglichen mit 3,2 Billionen US-Anlagen durch Ausländer.
Folgerung: Der Mittelzufluss aus dem Ausland in die USA scheint abzuebben. Wenn er nicht mehr 50 Mrd. USD monatlich erreicht, gerät die US-Valuta unter Druck. Nicht auszudenken wäre die Wirkung einer Richtungsänderung der Flow of Funds.
Kurz vor 11 hat Wardriver noch mal alles ins Feuer geworfen. 

J2

J2
Was heißt hier ins Feuer,ich shorte euch die Lichter aus,macht mich nur wütend auch noch. 

Wardriver


Wardriver

.
@ jeffery -
@ WD - jetzt heißt es tapfer bleiben, mein Freund ...
DOLLAR IM STURZFLUG
Der Offenbarungseid des Mister Snow
Die europäische Gemeinschaftswährung ist am Montag gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit vier Jahren geklettert. Neue Hiobsbotschaften über die finanzielle Lage der USA machen einen weiteren Absturz des Dollars in den kommenden Wochen wahrscheinlich.
London - Es war eine Binsenweisheit mit Folgen. US-Finanzminister John Snow sagte am Sonntag gegenüber dem Fernsehsender Fox: "Der Wert des Dollars wird im Wettbewerb der Wechselkurse festgesetzt." Bei Londoner Devisenhändlern, die wegen des seit Wochen andauernden Verfalls des Greenback gegenüber anderen wichtigen Währungen ohnehin schon nervös sind, löste Snows ökonomische Erstsemester-Erkenntnis Panik aus und trieb den Dollar weiter nach unten. Schon kurz vor neun am Montagmorgen war der Euro auf 1,1609 Dollar gestiegen - den höchsten Stand seit vier Jahren.
Eigentlich hatte Snow die Lage beruhigen wollen. Der rasante Verfall der amerikanischen Währung, so seine Argumentation, mache US-Produkte billiger, kurbele in der Folge den Export an und helfe so der amerikanischen Wirtschaft. Grundsätzlich ist Snows Darstellung richtig: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geht davon aus, dass ein fünfprozentiger Wertverlust des Dollars auf die US-Binnenkonjunktur eine ähnliche Wirkung hat wie eine Senkung der Leitzinsen um 0,5 Prozent.
Schneeball-Effekt
Devisenhändler interessieren sich momentan allerdings weniger für die Wachstumsaussichten als für die explodierende Verschuldung und das extrem hohe Leistungsbilanzdefizit der USA, zu dem der US-Finanzminister keine beruhigende Aussage parat hatte. Für den Markt kamen die Äußerungen Snows einer Art Offenbarungseid gleich: Snows Verweis auf die Marktkräfte bedeutet nichts anderes, als dass seine Regierung nicht willens ist, sich gegen den Verfall des Dollars zu stemmen.
Eine Intervention gilt zwar ohnehin als utopisch, da der Devisenmarkt mit einem Tagesumsatz von etwa 1,2 Billionen Dollar dafür einfach zu groß ist. Der psychologische Effekt von Snows Eingeständnis ist dennoch groß. "Snows Kommentare sind einfach eine weitere Ausrede [Dollar] zu verkaufen, denn die fundamentalen Daten für einen schwächeren Dollar gelten nach wie vor", sagt Hans Redeker von BNP Paribas.
Schon wieder Pleite
Derzeit verlassen die Investoren die USA in Scharen. Die Bank UBS Warburg hat ermittelt, dass derzeit täglich etwa 400 Millionen Dollar an Kapital durch Verkäufe auf dem US-Aktienmarkt abwandern. Das macht es für das Land zunehmend schwieriger, sein Leistungsbilanzdefizit, grob gesagt die Differenz zwischen volkwirtschaftlichen Einnahmen und Ausgaben, zu finanzieren. Täglich brauchen die USA, die erheblich mehr importieren als sie exportieren, etwa zwei Milliarden Dollar, um das stetig wachsende Loch in ihrer Leistungsbilanz zu finanzieren. Eine andere wichtige Geldquelle, der Verkauf von US-Staatsanleihen an ausländische Investoren, droht ebenfalls zu versiegen. Zwar gelten lang laufende amerikanische Staatsanleihen weiterhin als sichere Bank, wegen der extrem niedrigen Zinsen legen viele Investoren inzwischen jedoch ihr Geld lieber in den höher verzinsten europäischen Bonds an.
Für Unruhe bei Devisenexperten sorgt außerdem die Tatsache, dass die US-Regierung ihren vom Kongress erst kürzlich erhöhten Spielraum zum Schuldenmachen bereits voll ausgeschöpft hat. Derzeit versucht das US-Finanzministerium noch mit allerlei Tricks, das Unvermeidliche einige Tage herauszuzögern. Doch schon diese Woche muss das US-Parlament vermutlich über eine erneute Anhebung des Schulden-Plafonds von derzeit 6,4 Billionen Dollar beraten.
Einmal in den Keller und zurück
"Das positivste Szenario für die Cash Flows ist, dass sie [die US-Regierung] erst in der letzten Maiwoche Schwierigkeiten bekommen. Aber wenn es Enttäuschungen gibt, könnten die Dinge schon in den nächsten Tagen haarig werden", sagte Lou Crandall, Chefökonom von Wrightson Associates, gegenüber dem "Wall Street Journal".
Sollte der Kongress der Regierung von George W. Bush weitere Mittel versagen, könnte das an den Devisenmärkten erneut zu Turbulenzen führen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Euro dann die psychologisch bedeutsame Marke von 1,1745 Dollar überspringen könnte. Zu diesem Kurs war die Gemeinschaftswährung am 1. Januar 1999 in den Handel gestartet.
@ jeffery -

@ WD - jetzt heißt es tapfer bleiben, mein Freund ...

DOLLAR IM STURZFLUG
Der Offenbarungseid des Mister Snow
Die europäische Gemeinschaftswährung ist am Montag gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit vier Jahren geklettert. Neue Hiobsbotschaften über die finanzielle Lage der USA machen einen weiteren Absturz des Dollars in den kommenden Wochen wahrscheinlich.
London - Es war eine Binsenweisheit mit Folgen. US-Finanzminister John Snow sagte am Sonntag gegenüber dem Fernsehsender Fox: "Der Wert des Dollars wird im Wettbewerb der Wechselkurse festgesetzt." Bei Londoner Devisenhändlern, die wegen des seit Wochen andauernden Verfalls des Greenback gegenüber anderen wichtigen Währungen ohnehin schon nervös sind, löste Snows ökonomische Erstsemester-Erkenntnis Panik aus und trieb den Dollar weiter nach unten. Schon kurz vor neun am Montagmorgen war der Euro auf 1,1609 Dollar gestiegen - den höchsten Stand seit vier Jahren.
Eigentlich hatte Snow die Lage beruhigen wollen. Der rasante Verfall der amerikanischen Währung, so seine Argumentation, mache US-Produkte billiger, kurbele in der Folge den Export an und helfe so der amerikanischen Wirtschaft. Grundsätzlich ist Snows Darstellung richtig: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) geht davon aus, dass ein fünfprozentiger Wertverlust des Dollars auf die US-Binnenkonjunktur eine ähnliche Wirkung hat wie eine Senkung der Leitzinsen um 0,5 Prozent.
Schneeball-Effekt
Devisenhändler interessieren sich momentan allerdings weniger für die Wachstumsaussichten als für die explodierende Verschuldung und das extrem hohe Leistungsbilanzdefizit der USA, zu dem der US-Finanzminister keine beruhigende Aussage parat hatte. Für den Markt kamen die Äußerungen Snows einer Art Offenbarungseid gleich: Snows Verweis auf die Marktkräfte bedeutet nichts anderes, als dass seine Regierung nicht willens ist, sich gegen den Verfall des Dollars zu stemmen.
Eine Intervention gilt zwar ohnehin als utopisch, da der Devisenmarkt mit einem Tagesumsatz von etwa 1,2 Billionen Dollar dafür einfach zu groß ist. Der psychologische Effekt von Snows Eingeständnis ist dennoch groß. "Snows Kommentare sind einfach eine weitere Ausrede [Dollar] zu verkaufen, denn die fundamentalen Daten für einen schwächeren Dollar gelten nach wie vor", sagt Hans Redeker von BNP Paribas.
Schon wieder Pleite
Derzeit verlassen die Investoren die USA in Scharen. Die Bank UBS Warburg hat ermittelt, dass derzeit täglich etwa 400 Millionen Dollar an Kapital durch Verkäufe auf dem US-Aktienmarkt abwandern. Das macht es für das Land zunehmend schwieriger, sein Leistungsbilanzdefizit, grob gesagt die Differenz zwischen volkwirtschaftlichen Einnahmen und Ausgaben, zu finanzieren. Täglich brauchen die USA, die erheblich mehr importieren als sie exportieren, etwa zwei Milliarden Dollar, um das stetig wachsende Loch in ihrer Leistungsbilanz zu finanzieren. Eine andere wichtige Geldquelle, der Verkauf von US-Staatsanleihen an ausländische Investoren, droht ebenfalls zu versiegen. Zwar gelten lang laufende amerikanische Staatsanleihen weiterhin als sichere Bank, wegen der extrem niedrigen Zinsen legen viele Investoren inzwischen jedoch ihr Geld lieber in den höher verzinsten europäischen Bonds an.
Für Unruhe bei Devisenexperten sorgt außerdem die Tatsache, dass die US-Regierung ihren vom Kongress erst kürzlich erhöhten Spielraum zum Schuldenmachen bereits voll ausgeschöpft hat. Derzeit versucht das US-Finanzministerium noch mit allerlei Tricks, das Unvermeidliche einige Tage herauszuzögern. Doch schon diese Woche muss das US-Parlament vermutlich über eine erneute Anhebung des Schulden-Plafonds von derzeit 6,4 Billionen Dollar beraten.
Einmal in den Keller und zurück
"Das positivste Szenario für die Cash Flows ist, dass sie [die US-Regierung] erst in der letzten Maiwoche Schwierigkeiten bekommen. Aber wenn es Enttäuschungen gibt, könnten die Dinge schon in den nächsten Tagen haarig werden", sagte Lou Crandall, Chefökonom von Wrightson Associates, gegenüber dem "Wall Street Journal".
Sollte der Kongress der Regierung von George W. Bush weitere Mittel versagen, könnte das an den Devisenmärkten erneut zu Turbulenzen führen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Euro dann die psychologisch bedeutsame Marke von 1,1745 Dollar überspringen könnte. Zu diesem Kurs war die Gemeinschaftswährung am 1. Januar 1999 in den Handel gestartet.
.
Dollar-Tief bringt zweite Gold-Hausse
Anleger haben neue Chancen auf Kursgewinne beim Edelmetall - Schwache Aussichten für Aktien und Konjunktur
von Michael Fabricius
Berlin - Jeder sollte eine zweite Chance bekommen. Das gilt auch für die Gold-Anleger, die es versäumt haben, am Ende der jüngsten großen Preisrallye ihre Gewinne einzustecken. Sie könnten nun von einer zweiten Hausse profitieren. Dank Dollar-Schwäche, anhaltender Konjunktursorgen und einer weitgehenden Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt zeigt die Preiskurve des Edelmetalls wieder steil nach oben. Zusätzliche Impulse kamen von den Notenbank-Entscheidungen, die auf eine schwache Wirtschaftsentwicklung schließen lassen. In der vergangenen Woche scheiterte die Feinunze Gold nur knapp an der psychologisch wichtigen Marke von 350 Dollar. "Zum Wochenschluss entwickelte der Preis für das Edelmetall sogar eine gewisse eigene Stärke. Selbst als der Euro kurzfristig leicht nachgab, blieb der Goldpreis stabil", beobachteten die Experten von Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Und diese zweite Goldpreis-Rallye ist nach Einschätzung der Analysten noch nicht vorüber. "Sollte der momentane Trend an den Devisenmärkten anhalten, dürfte einem weiteren Anstieg nichts im Wege stehen. Auch ein Test der Hochs von Ende Februar bei 357/360 Dollar je Unze scheint möglich", so die Dresdner-Experten. Zusätzlich dürfte Unterstützung von den Privatanlegern kommen, die sich bislang mit neuen Positionen zurückgehalten hätten. [ hoffen wir ´s ]
]
Hauptmotor bleibt aber der Dollar, dem gegenüber sich Gold wie eine zweite Währung, etwa der Euro, verhält. Solange also der Euro steigt, geht es auch mit Gold aufwärts. Und die Gemeinschaftswährung könnte nach Einschätzung der Deutschen Bank noch bis auf 1,20 Dollar, wenn nicht sogar bis auf 1,30 Euro steigen, wie Goldman Sachs prophezeit.
Auch die Eigenschaft von Gold als Safe Haven kommt rückt wieder in den Vordergrund. "Am stärksten waren die Gold-Gewinne immer dann, wenn sowohl US-Dollar als auch US-Aktien sich schwach entwickelten", betont Kamal Naqvi von Macquarie Research.
Und ein Blick auf den Terminkalender dieser Woche zeigt, dass gerade auf der Aktienseite neue Kursrisiken auftauchen. Am Mittwoch etwa werden die US-Einzelhandelsumsätze vom April veröffentlicht. Volkswirte zeigten sich im Vorfeld eher pessimistisch, erwartet wird allenfalls ein minimales Plus von 0,4 Prozent, nach einem Anstieg um 1,2 Prozent im März. Und auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals (Donnerstag) wird wohl nur knapp am Minus vorbeischrammen. Ebenfalls im Rückwärtsgang befindet sich noch die Industrieproduktion in den USA (ebenfalls Donnerstag). Im März fiel die Aktivität bereits um 0,5 Prozent, für April schwanken die Prognosen zwischen minus 0,3 und 0,4 Prozent.
Erst am Freitag besteht die Chance auf positive Zahlen: Der Verbrauchervertrauens-Index der Universität Michigan ist für Mai den Erwartungen nach auf dem Niveau von April stehen geblieben und nicht weiter gefallen.
Die positive Tendenz an den Bondmärkten sollte also anhalten, während bei Aktien wieder Vorsicht geboten ist: "Auf Sicht der kommenden drei bis vier Wochen sind weitere Gewinnmitnahmen und Kursrückgänge nicht auszuschließen", so die DZ Bank.
Gold-Investoren haben also noch genug Zeit, um Kursgewinne zu realisieren und im Dollar-Raum zu bleiben, bis sich das Währungs-Gefälle wieder etwas abgeflacht hat.
Die Welt - 12. Mai 2003
---
Roland Leuschel
Warten auf die vierte Rallye
Wie in den vorangegangenen Kolumnen angedeutet, scheint die dritte Rallye an den Börsen nach Beginn des Crashes im Frühjahr 2000 « programmgemäss » zu Ende zu gehen. Zwar hat der Dax zweimal die 3.000er Marke knacken können, konnte aber nicht die 200 Tage Durchschnittslinie entscheidend überwinden.
Diese 200 Tage Durchschnittslinie hat sich in der Vergangenheit oft als entscheidende Widerstands- und Unterstützungslinie erwiesen, obwohl man es fundamental nicht erklären kann. Aber Sie wissen ja, die Börse ist weiblich, und ihre Natur bleibt daher den Börsianern immer und ewig verschlossen. Eine andere in mehreren Kolumnen vorausgesagte Entwicklung scheint jetzt Form anzunehmen : Der Euro stieg über 1,15 gegenüber dem Dollar, und die nächste Etappe dürfte bei 1,40 Euro sein. Dann allerdings wird es ernst. Wie in dieser Kolumne schon öfters erwähnt riskieren wir die Weltwirtschaftskrise II, und ein Dollar über 1,40 Euro würde eine tiefe Rezession in Europa bedeuten.
Wie aus den Protokollen des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank vom 18. März hervorgeht, herrscht in diesem Gremium inzwischen ein pessimistischer Grundton. Von mehreren Mitgliedern dieses Gremiums wird die Gefahr einer Deflation (dort spricht man von Desinflation der Kern-Verbraucherpreise) als wahrscheinlich erachtet, und « ein schwaches Wachstum für längere Zeit » nicht ausgeschlossen.
Wie wir alle wissen, ist eine Deflation keine gute Aussicht für Unternehmensgewinne und Investitionen, daher glaube ich den Ökonomen von Goldman Sachs, die behaupten, « eine weitere Zinssenkung in naher Zukunft, womöglich schon im nächsten Monat, wird immer wahrscheinlicher ». Ich vermute, der Zinssatz für Tagesgeld, der schon auf 40-jährigem Tiefstpunkt ist, wird schon im Juni um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75% gesenkt.
Eine Möglichkeit seine Anlagen gegen die Dollarschwäche abzusichern ist die neue währungsgesicherte Goldanleihe von HSBC Trinkaus & Burkhardt, die eine Laufzeit von 5 Jahren hat und einen Zins von 1% per annum abwirft. Ausserdem erhält der Inhaber 45% der positiven Performance des Goldpreises, in US-Dollar gerechnet. Die Anleihe liegt zur Zeichnung vor. Bei einer angenommenen jährlichen Entwicklung des Goldpreises von 15% (was sehr konservativ ist) ist die Performance dieser Garantie-Anleihe in Euro per annum 8,7%. Sie können also an der zukünftigen Goldpreisentwicklung ohne Risiko teilhaben, da Sie nach 5 Jahren Ihre Anleihe zu 100% in Euro zurückgezahlt bekommen.
« Ich denke, Alan Greenspan sollte eine weitere Amtszeit bekommen », erklärte am 22. April dieses Jahres der amerikanische Präsident. Die amerikanische Börse antwortete spontan positiv, und die Medien diesseits und jenseits des Ozeans waren voller Lob für diese Entscheidung, und Alan Greenspan hat auch bereits zugesagt.
Ich bin darüber auch sehr froh und stimme Claus Vogt von der Berliner Effektenbank zu, der in seiner letzten Ausgabe von Perspektiven nüchtern bemerkt : « Mit einer weiteren Amtszeit kann sich Greenspan als verantwortungsvoller Mensch hervortun, der die von ihm eingebrockte Suppe auch auszulöffeln gewillt ist. » (Weitere Details werden Sie in einem Buch finden können, das mit dem Titel « Alan und seine Jünger » im Finanzbuch Verlag München im Herbst erscheinen soll.)
Übrigens die gesamte industrielle Nachfrage (insbesondere der Schmuckindustrie) übertrifft seit einigen Jahren die jährliche Goldproduktion um rund 900 bis 1.200 Tonnen jährlich. Mehr als ausgeglichen wurde dieser Fehlbetrag durch die Verkäufe der europäischen Notenbanken, die den Erlös in zinstragende Dollar-Titel angelegt haben. Darüber kann sich der Bürger nur wundern. Als Argument haben diese Notenbanken angeführt, Gold bringe eben keine Erlöse. Da frage ich mich, warum haben diese Bürokraten das nicht vor 20 Jahren entdeckt, als der Goldpreis bei 850 Dollar die Feinunze lag und der US-Diskontsatz bei 14% ?
Fazit : Es gibt noch andere Gründe warum der Goldpreis demnächst stark ansteigen könnte. Erhöhen Sie daher den Gold-Anteil Ihres Portefeuillesüber die bisher empfohlene 5%-Grenze. Ansonsten machen sie Kasse bei Ihren Aktien-Tradingpositionen und vermindern Sie den Dollar-Anteil in Ihrem Portefeuille.
Am 20. Mai findet im Städel von Frankfurt das « Frankfurter Fonds Forum der Credit Suisse Asset Management » statt. Dort werde ich einen kurzen Vortrag halten und mit bekannten Leuten wie Dr. Jens Erhardt, oder Karl Fickel diskutiern unter der Leitung des N-TV Moderators Bernd Heller. Titel meines Vortrages : « Alan Greenspan : Biedermann und Brandstifter ». Übrigens wenn Sie die Börse weniger interessiert, zum Abschluss der Veranstaltung hält Professor Dr. Hellmuth Karasek, u.a. bekannt durch das « Literarische Quartett » einen Vortrag.
09.05.20003
Roland Leuschels Kolumnen sind zu finden unter www.boerse.de
Dollar-Tief bringt zweite Gold-Hausse
Anleger haben neue Chancen auf Kursgewinne beim Edelmetall - Schwache Aussichten für Aktien und Konjunktur
von Michael Fabricius
Berlin - Jeder sollte eine zweite Chance bekommen. Das gilt auch für die Gold-Anleger, die es versäumt haben, am Ende der jüngsten großen Preisrallye ihre Gewinne einzustecken. Sie könnten nun von einer zweiten Hausse profitieren. Dank Dollar-Schwäche, anhaltender Konjunktursorgen und einer weitgehenden Seitwärtsbewegung am Aktienmarkt zeigt die Preiskurve des Edelmetalls wieder steil nach oben. Zusätzliche Impulse kamen von den Notenbank-Entscheidungen, die auf eine schwache Wirtschaftsentwicklung schließen lassen. In der vergangenen Woche scheiterte die Feinunze Gold nur knapp an der psychologisch wichtigen Marke von 350 Dollar. "Zum Wochenschluss entwickelte der Preis für das Edelmetall sogar eine gewisse eigene Stärke. Selbst als der Euro kurzfristig leicht nachgab, blieb der Goldpreis stabil", beobachteten die Experten von Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Und diese zweite Goldpreis-Rallye ist nach Einschätzung der Analysten noch nicht vorüber. "Sollte der momentane Trend an den Devisenmärkten anhalten, dürfte einem weiteren Anstieg nichts im Wege stehen. Auch ein Test der Hochs von Ende Februar bei 357/360 Dollar je Unze scheint möglich", so die Dresdner-Experten. Zusätzlich dürfte Unterstützung von den Privatanlegern kommen, die sich bislang mit neuen Positionen zurückgehalten hätten. [ hoffen wir ´s
 ]
]Hauptmotor bleibt aber der Dollar, dem gegenüber sich Gold wie eine zweite Währung, etwa der Euro, verhält. Solange also der Euro steigt, geht es auch mit Gold aufwärts. Und die Gemeinschaftswährung könnte nach Einschätzung der Deutschen Bank noch bis auf 1,20 Dollar, wenn nicht sogar bis auf 1,30 Euro steigen, wie Goldman Sachs prophezeit.
Auch die Eigenschaft von Gold als Safe Haven kommt rückt wieder in den Vordergrund. "Am stärksten waren die Gold-Gewinne immer dann, wenn sowohl US-Dollar als auch US-Aktien sich schwach entwickelten", betont Kamal Naqvi von Macquarie Research.
Und ein Blick auf den Terminkalender dieser Woche zeigt, dass gerade auf der Aktienseite neue Kursrisiken auftauchen. Am Mittwoch etwa werden die US-Einzelhandelsumsätze vom April veröffentlicht. Volkswirte zeigten sich im Vorfeld eher pessimistisch, erwartet wird allenfalls ein minimales Plus von 0,4 Prozent, nach einem Anstieg um 1,2 Prozent im März. Und auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals (Donnerstag) wird wohl nur knapp am Minus vorbeischrammen. Ebenfalls im Rückwärtsgang befindet sich noch die Industrieproduktion in den USA (ebenfalls Donnerstag). Im März fiel die Aktivität bereits um 0,5 Prozent, für April schwanken die Prognosen zwischen minus 0,3 und 0,4 Prozent.
Erst am Freitag besteht die Chance auf positive Zahlen: Der Verbrauchervertrauens-Index der Universität Michigan ist für Mai den Erwartungen nach auf dem Niveau von April stehen geblieben und nicht weiter gefallen.
Die positive Tendenz an den Bondmärkten sollte also anhalten, während bei Aktien wieder Vorsicht geboten ist: "Auf Sicht der kommenden drei bis vier Wochen sind weitere Gewinnmitnahmen und Kursrückgänge nicht auszuschließen", so die DZ Bank.
Gold-Investoren haben also noch genug Zeit, um Kursgewinne zu realisieren und im Dollar-Raum zu bleiben, bis sich das Währungs-Gefälle wieder etwas abgeflacht hat.
Die Welt - 12. Mai 2003
---
Roland Leuschel
Warten auf die vierte Rallye
Wie in den vorangegangenen Kolumnen angedeutet, scheint die dritte Rallye an den Börsen nach Beginn des Crashes im Frühjahr 2000 « programmgemäss » zu Ende zu gehen. Zwar hat der Dax zweimal die 3.000er Marke knacken können, konnte aber nicht die 200 Tage Durchschnittslinie entscheidend überwinden.
Diese 200 Tage Durchschnittslinie hat sich in der Vergangenheit oft als entscheidende Widerstands- und Unterstützungslinie erwiesen, obwohl man es fundamental nicht erklären kann. Aber Sie wissen ja, die Börse ist weiblich, und ihre Natur bleibt daher den Börsianern immer und ewig verschlossen. Eine andere in mehreren Kolumnen vorausgesagte Entwicklung scheint jetzt Form anzunehmen : Der Euro stieg über 1,15 gegenüber dem Dollar, und die nächste Etappe dürfte bei 1,40 Euro sein. Dann allerdings wird es ernst. Wie in dieser Kolumne schon öfters erwähnt riskieren wir die Weltwirtschaftskrise II, und ein Dollar über 1,40 Euro würde eine tiefe Rezession in Europa bedeuten.
Wie aus den Protokollen des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank vom 18. März hervorgeht, herrscht in diesem Gremium inzwischen ein pessimistischer Grundton. Von mehreren Mitgliedern dieses Gremiums wird die Gefahr einer Deflation (dort spricht man von Desinflation der Kern-Verbraucherpreise) als wahrscheinlich erachtet, und « ein schwaches Wachstum für längere Zeit » nicht ausgeschlossen.
Wie wir alle wissen, ist eine Deflation keine gute Aussicht für Unternehmensgewinne und Investitionen, daher glaube ich den Ökonomen von Goldman Sachs, die behaupten, « eine weitere Zinssenkung in naher Zukunft, womöglich schon im nächsten Monat, wird immer wahrscheinlicher ». Ich vermute, der Zinssatz für Tagesgeld, der schon auf 40-jährigem Tiefstpunkt ist, wird schon im Juni um 0,5 Prozentpunkte auf 0,75% gesenkt.
Eine Möglichkeit seine Anlagen gegen die Dollarschwäche abzusichern ist die neue währungsgesicherte Goldanleihe von HSBC Trinkaus & Burkhardt, die eine Laufzeit von 5 Jahren hat und einen Zins von 1% per annum abwirft. Ausserdem erhält der Inhaber 45% der positiven Performance des Goldpreises, in US-Dollar gerechnet. Die Anleihe liegt zur Zeichnung vor. Bei einer angenommenen jährlichen Entwicklung des Goldpreises von 15% (was sehr konservativ ist) ist die Performance dieser Garantie-Anleihe in Euro per annum 8,7%. Sie können also an der zukünftigen Goldpreisentwicklung ohne Risiko teilhaben, da Sie nach 5 Jahren Ihre Anleihe zu 100% in Euro zurückgezahlt bekommen.
« Ich denke, Alan Greenspan sollte eine weitere Amtszeit bekommen », erklärte am 22. April dieses Jahres der amerikanische Präsident. Die amerikanische Börse antwortete spontan positiv, und die Medien diesseits und jenseits des Ozeans waren voller Lob für diese Entscheidung, und Alan Greenspan hat auch bereits zugesagt.
Ich bin darüber auch sehr froh und stimme Claus Vogt von der Berliner Effektenbank zu, der in seiner letzten Ausgabe von Perspektiven nüchtern bemerkt : « Mit einer weiteren Amtszeit kann sich Greenspan als verantwortungsvoller Mensch hervortun, der die von ihm eingebrockte Suppe auch auszulöffeln gewillt ist. » (Weitere Details werden Sie in einem Buch finden können, das mit dem Titel « Alan und seine Jünger » im Finanzbuch Verlag München im Herbst erscheinen soll.)
Übrigens die gesamte industrielle Nachfrage (insbesondere der Schmuckindustrie) übertrifft seit einigen Jahren die jährliche Goldproduktion um rund 900 bis 1.200 Tonnen jährlich. Mehr als ausgeglichen wurde dieser Fehlbetrag durch die Verkäufe der europäischen Notenbanken, die den Erlös in zinstragende Dollar-Titel angelegt haben. Darüber kann sich der Bürger nur wundern. Als Argument haben diese Notenbanken angeführt, Gold bringe eben keine Erlöse. Da frage ich mich, warum haben diese Bürokraten das nicht vor 20 Jahren entdeckt, als der Goldpreis bei 850 Dollar die Feinunze lag und der US-Diskontsatz bei 14% ?
Fazit : Es gibt noch andere Gründe warum der Goldpreis demnächst stark ansteigen könnte. Erhöhen Sie daher den Gold-Anteil Ihres Portefeuillesüber die bisher empfohlene 5%-Grenze. Ansonsten machen sie Kasse bei Ihren Aktien-Tradingpositionen und vermindern Sie den Dollar-Anteil in Ihrem Portefeuille.
Am 20. Mai findet im Städel von Frankfurt das « Frankfurter Fonds Forum der Credit Suisse Asset Management » statt. Dort werde ich einen kurzen Vortrag halten und mit bekannten Leuten wie Dr. Jens Erhardt, oder Karl Fickel diskutiern unter der Leitung des N-TV Moderators Bernd Heller. Titel meines Vortrages : « Alan Greenspan : Biedermann und Brandstifter ». Übrigens wenn Sie die Börse weniger interessiert, zum Abschluss der Veranstaltung hält Professor Dr. Hellmuth Karasek, u.a. bekannt durch das « Literarische Quartett » einen Vortrag.
09.05.20003
Roland Leuschels Kolumnen sind zu finden unter www.boerse.de
#396 Gold-Investoren haben also noch genug Zeit, um Kursgewinne zu realisieren und im Dollar-Raum zu bleiben, bis sich das Währungs-Gefälle wieder etwas abgeflacht hat.
Beispiel Mercury Gold Fond
9.5.2003 USD($) 15,06 + 0,27
9.5.2003 EUR(€) 13,11 + 0,09
Genau der richtige Weg, um Gewinne ein zufahren.
Grüße Talvi
Beispiel Mercury Gold Fond
9.5.2003 USD($) 15,06 + 0,27
9.5.2003 EUR(€) 13,11 + 0,09
Genau der richtige Weg, um Gewinne ein zufahren.

Grüße Talvi

tja man weiß nicht ob man lachen oder weinen soll ...
(...)
Am Montag ist die Unze Gold zur Lieferung im Juni in London mit 351,10 Dollar gehandelt worden, nachdem sie am Freitag noch 348,90 Dollar gekostet hatte. Anders ausgedrückt: Seit dem Zwischentief am 8. April ist Gold um knapp zehn Prozent teurer geworden.
Dem Goldpreis hat dabei die Aussage des amerikanischen Finanzministers John Snow geholfen, ein schwacher Dollar unterstütze Exporte aus den Vereinigten Staaten. Die Schwäche des Dollar vor allem gegenüber dem Euro macht Gold für Investoren, die nicht in Dollar rechnen, billiger und damit attraktiver. Mittlerweile bewegt sich der Goldpreis über dem 100-Tage-Durchschnitt.
Nun erwarten Beobachter einen weiteren Anstieg des Goldpreises: Die Agentur Reuters zitierte einen Edelmetall-Experten mit den Worten: „Ich denke, daß Gold die Marke von 365 Dollar testen könnte, wobei zwischen 349 und 352 Dollar wegen Gewinnmitnahmen ein starker Widerstand auftreten dürfte.“
Michael Guido, zuständig für Hedge Fund Marketing bei Barclays Capital sagte der Abentur Bloomberg, erwartet 360 Dollar je Unze im Verlauf der nächsten zwei bis drei Wochen. Denn das Goldchartmuster sehe sehr „bullish“ aus, nachdem der Preis über den 100-Tage-Durchschnitt gestiegen sei. Zudem gebe es neue Käufer im Markt. Berichten zufolge sollen Hedge Fonds zur jüngsten Rallye des Goldpreises mit Käufen von Gold-Futures beigetragen haben.
Daran schließt sich jedoch die Frage an, wie lange diese Positionen gehalten werden. Wenn die Nachfrage nach Terminkontrakten hinter den Verlauf zurückfallen sollte, dürfte Gold wieder unter Druck geraten.

Aktien von Goldproduzenten haben übrigens mit dem Anstieg des Goldpreises nicht mithalten können. Seit April legte das Papier von Barrick Gold um 8,3 Prozent, Anglo American verbesserte sich 0,7 Prozent, Konkurrent Gold Fields fiel sogar um 5,2 Prozent ab, und Impala Platinum gab um 3,4 Prozent nach. Überdurchschnittlich entwickelte sich dagegen Novagold mit einem Kursplus von fast 16 Prozent.
(...)
Am Montag ist die Unze Gold zur Lieferung im Juni in London mit 351,10 Dollar gehandelt worden, nachdem sie am Freitag noch 348,90 Dollar gekostet hatte. Anders ausgedrückt: Seit dem Zwischentief am 8. April ist Gold um knapp zehn Prozent teurer geworden.
Dem Goldpreis hat dabei die Aussage des amerikanischen Finanzministers John Snow geholfen, ein schwacher Dollar unterstütze Exporte aus den Vereinigten Staaten. Die Schwäche des Dollar vor allem gegenüber dem Euro macht Gold für Investoren, die nicht in Dollar rechnen, billiger und damit attraktiver. Mittlerweile bewegt sich der Goldpreis über dem 100-Tage-Durchschnitt.
Nun erwarten Beobachter einen weiteren Anstieg des Goldpreises: Die Agentur Reuters zitierte einen Edelmetall-Experten mit den Worten: „Ich denke, daß Gold die Marke von 365 Dollar testen könnte, wobei zwischen 349 und 352 Dollar wegen Gewinnmitnahmen ein starker Widerstand auftreten dürfte.“
Michael Guido, zuständig für Hedge Fund Marketing bei Barclays Capital sagte der Abentur Bloomberg, erwartet 360 Dollar je Unze im Verlauf der nächsten zwei bis drei Wochen. Denn das Goldchartmuster sehe sehr „bullish“ aus, nachdem der Preis über den 100-Tage-Durchschnitt gestiegen sei. Zudem gebe es neue Käufer im Markt. Berichten zufolge sollen Hedge Fonds zur jüngsten Rallye des Goldpreises mit Käufen von Gold-Futures beigetragen haben.
Daran schließt sich jedoch die Frage an, wie lange diese Positionen gehalten werden. Wenn die Nachfrage nach Terminkontrakten hinter den Verlauf zurückfallen sollte, dürfte Gold wieder unter Druck geraten.


Aktien von Goldproduzenten haben übrigens mit dem Anstieg des Goldpreises nicht mithalten können. Seit April legte das Papier von Barrick Gold um 8,3 Prozent, Anglo American verbesserte sich 0,7 Prozent, Konkurrent Gold Fields fiel sogar um 5,2 Prozent ab, und Impala Platinum gab um 3,4 Prozent nach. Überdurchschnittlich entwickelte sich dagegen Novagold mit einem Kursplus von fast 16 Prozent.
.
Gold looks forward to Washington Accord renewal
Daniel Thole
High-ranking South African government officials will head the drive to renew the key Washington Accord, which has helped underpin so much of gold’s strength over the last three years.
Treasury director general Maria Ramos was one of the architects of the original accord Accord, signed in September 1999, which ensured that 15 European central banks would not sell in excess of 400 tonnes of gold a year. At the time of the agreement the gold price was floundering around $260/oz, but the accord helped the metal higher by stemming the tide of Central Bank sales – famously started by the Bank of England’s ill conceived gold auction programme - that had until then put gold under pressure.
Ramos told Mineweb in an exclusive interview that she would resume her attempts to secure the extension of the Accord on central banks’ gold sales. The agreement expires next year.
Ramos undertook a whirlwind tour of the world’s central banks with then SA Reserve Bank deputy governor James Cross in 1999, eventually securing the support of key institutions for the more responsible sale of gold reserves. It is an endeavour she is keen to repeat.
“I think it is one of those things that we will be discussing with the (South African) Reserve Bank over the next couple of months, and I think we’ll probably take that up with our colleagues in the central banks over the next few months,” Ramos said.
“But, in the same way as last time, we wanted to ensure that what we have is a more orderly, more transparent gold market. I think that those principles would be principles that are worth retaining,” Ramos said. She said she had only just been reminded that the accord was close to expiration, and would now be driving its renewal.
Despite the fact that gold is now trading around the $350/oz level, analysts said the market still needed the accord to support the metal’s value. “I wouldn’t say the accord is vital – but it certainly underpins the gold price,” a Johannesburg based bullion trader said.
“Of the 32,000 tons of gold held by the world’s central banks, 46% is held by the 15 European banks that signed the accord – that provides some serious stability for the gold price,” the trader said.
The US Federal Reserve holds another 25% of the world’s total reserves, the International Monetary Fund 10% and the Japanese central bank and other smaller players hold the balance. It remains unclear whether the US will join the accord.
The accord helped shift the tone of the market from one wary of central banks pushing huge amounts of gold onto the market, to smaller, but nonetheless important drivers like currencies and de-hedging.
South African players said the market has not forgotten the importance of the accord, and is looking forward to its renewal. They said the market was expecting Ramos to at least push for the retention of the 400 ton a year sale limit.
Some said, however, they would not be surprised if the limit on sales was increased this time around – there are rumours that certain European central banks want to reduce their holdings.
Initial speculation names Germany as one of the prime suspects for lightening its gold holdings, rumour fuelled by governor Ernst Welteke’s persistent comments to that effect. Italy and France have also featured as prime candidates for getting in on the action.
But the timing for a favourable sequel to the first Washington Accord may be just right for the gold market; there may also be external factors supporting the retention of gold as a reserve asset - dollar weakness may sway central bankers to hold onto their gold as they shy away from the dollar.
mineweb - 13.05.03
---
Das World Gold Council verkündet die Geburt eines neuen Goldfonds:
Equity Gold Trust fund
The World Gold Council has filed with the Securities and Exchange Commission for approval to create a stock-exchange traded form of gold under the name Equity Gold Trust. Equity Gold Trust would be the first commodities linked exchange traded fund in North America, and only the second in the world. The registration is for 60.4 million shares with an estimated value of $2 billion, according to the filing. The fund would be backed by real bullion and trade every second of the market day. The London-based World Gold Council has applied for approval to list the Shares on the New York Stock Exchange under the symbol "GLD."
The new exchange-traded fund (ETF) would be only the second commodities-linked exchange fund in the world. The first commodity-based ETF, Gold Bullion Ltd.`s Australia-traded security entered the market earlier this spring.
The Australia gold fund is also backed by the World Gold Council.
An ETF is a portfolio that trades on an exchange like a stock. The U.S. marketplace for ETFs includes more than 100 funds based on domestic and international stock indexes and fixed-income products.
Equity Gold Trust fund would be backed by real bullion in a vault and trade every second of the market day, the filing said.
According to the filing, the initial offering of shares would be at a per share price based on one-tenth of an ounce of gold at the time of the offering.
While gold investors were excited about the new product, some, like Mitsui`s Smith, were skeptical about the 1.2 percent annual management fee that is expected to come with it.
Frank Holmes, chief executive of gold-based mutual fund manager U.S. Global Investors, also called the management fee expensive, but said "this security should expand the audience for gold."
Another gold instrument was filed in Canada recently. Central Gold Trust is a closed-end trust that would allow investors to purchase gold-based securities at a discount or premium to the fund`s net asset value, on the Toronto Stock Exchange. As of today, only one other closed-end fund dealing in bullion trades in North America. Central Fund of Canada, on the American and Toronto Stock Exchanges, is a repository for gold and silver and trades at an approximately 20 percent premium to bullion`s price.
The Gold Council`s new gold instrument on the NYSE is expected to benefit investors who expect gold`s gains to continue to accelerate. It provides an investment instrument with a direct price link to gold`s daily price movements and eliminates the need for storage and insurance, which can be expensive for individual and institutional investors.
The filing came as gold prices hit a two-month high of $354 Wednesday in New York.
Robert Bishop, editor of the Gold Mining Stock Report newsletter, said "hard as it may seem to believe, it has always been very difficult for individuals to own gold. This should have an impact on the gold price."
Chris Thompson, the chairman of the World Gold Council and former chief executive of South Africa`s Gold Fields Ltd. has been leading the effort the market gold to individuals. Individuals often complain that access to gold in western markets is problematic.
CBS.MarketWatch.com 14.05.03
---
South African mining production decreases
Key findings regarding mining production as at the end of March 2003.
Total mining production for the first quarter of 2003, after seasonal adjustment, reflected a decrease of 1,1% compared with the last quarter of 2002.
The decrease of 1,1% after seasonal adjustment in the total mining production was due to a seasonally adjusted decrease of 1,6% in the production of non-gold minerals during the first quarter of 2003 compared with the last quarter of 2002. However, this decrease was partially counteracted by an increase of 1,1% in gold production during the same period. The major contributors to the seasonally adjusted decrease of 1,6% in the production of non-gold minerals were platinum and diamond mines.
Adjustment of the base period of the index of physical volume of mining production from 1995=100 to 2000=100
Following international practice of re-basing indices every five years, the base year of the index of physical volume of mining production has been changed from 1995=100 to 2000=100 with effect from the December 2002 statistical release.
The base period is the reference point of an index and is usually set at 100. Base periods have to be chosen carefully because different results can be obtained with different base periods. The following are important criteria for selecting base periods:
The base period must be recent to ensure that as many as possible of the components of the index are included in both the base period and the current period. The more recent the base period, the more comparable the current indices are with those of the base period.
Due to a large number of indices being published regularly, it is useful if they all have a common base period.
The internationally accepted current base period is 2000.
To compare different indices or to compare the movements in a specific index over a period, it often becomes necessary to shift the base period of an index.
The re-basing of indices was done on all the mineral groups of mining, recalculating the weights based on the 2000 sales of minerals as per the Minerals Bureau. The average indices of the mineral groups for the year 2000 were equated to 100. Each index was transformed to the new base period by dividing each monthly index by the average annual index for the year 2000 and multiplying the result by 100.
As from January 2000, the composite index for total mining was obtained by re-weighting the indices of the mineral groups after re-basing. The current weights were revised based on the 2000 sales data supplied by the Minerals Bureau, Department of Minerals and Energy. For the period before 2000, the composite index for total mining was linked with the so-called linking method for consecutive periods. This re-weighted composite index for total mining differs slightly from the index obtained by dividing the previously published composite index for total mining by the year 2000 average.
Key findings regarding mineral sales as at the end of February 2003 Mineral sales decrease
The seasonally adjusted value of mineral sales at current prices for the three months ended February 2003 reflected a decrease of 17,4% compared with the previous three months. Furthermore, the actual value of mineral sales at current prices for the three months ended February 2003 reflected a decrease of 8,3% compared with the three months ended February 2002.
The decrease of 17,4% in the seasonally adjusted value of mineral sales for the three months ended February 2003 compared with the previous three months can be attributed to a decrease of 18,4% (-R4 857,5 million) in sales of non-gold minerals and a decrease of 14,7% (-R1 493,7 million) in sales of gold.
The 8,3% decrease in the actual value of mineral sales at current prices for the three months ended February 2003 compared with the three months ended February 2002 was mainly due to a decrease of 8,9% (-R840,5 million) in sales of gold and a decrease of 8,0% (-R1 924,0 million) in sales of non-gold minerals. The decrease of 8,0% in non-gold mineral sales was mainly due to decreases of 28,7% (-R139,5 million) in sales of copper, 18,2% (-R223,7 million) in sales of iron ore and 14,2% (-R420,2 million) in sales of ‘other ‘non-metallic minerals.
Mbendi 13.05.03
Gold looks forward to Washington Accord renewal
Daniel Thole
High-ranking South African government officials will head the drive to renew the key Washington Accord, which has helped underpin so much of gold’s strength over the last three years.
Treasury director general Maria Ramos was one of the architects of the original accord Accord, signed in September 1999, which ensured that 15 European central banks would not sell in excess of 400 tonnes of gold a year. At the time of the agreement the gold price was floundering around $260/oz, but the accord helped the metal higher by stemming the tide of Central Bank sales – famously started by the Bank of England’s ill conceived gold auction programme - that had until then put gold under pressure.
Ramos told Mineweb in an exclusive interview that she would resume her attempts to secure the extension of the Accord on central banks’ gold sales. The agreement expires next year.
Ramos undertook a whirlwind tour of the world’s central banks with then SA Reserve Bank deputy governor James Cross in 1999, eventually securing the support of key institutions for the more responsible sale of gold reserves. It is an endeavour she is keen to repeat.
“I think it is one of those things that we will be discussing with the (South African) Reserve Bank over the next couple of months, and I think we’ll probably take that up with our colleagues in the central banks over the next few months,” Ramos said.
“But, in the same way as last time, we wanted to ensure that what we have is a more orderly, more transparent gold market. I think that those principles would be principles that are worth retaining,” Ramos said. She said she had only just been reminded that the accord was close to expiration, and would now be driving its renewal.
Despite the fact that gold is now trading around the $350/oz level, analysts said the market still needed the accord to support the metal’s value. “I wouldn’t say the accord is vital – but it certainly underpins the gold price,” a Johannesburg based bullion trader said.
“Of the 32,000 tons of gold held by the world’s central banks, 46% is held by the 15 European banks that signed the accord – that provides some serious stability for the gold price,” the trader said.
The US Federal Reserve holds another 25% of the world’s total reserves, the International Monetary Fund 10% and the Japanese central bank and other smaller players hold the balance. It remains unclear whether the US will join the accord.
The accord helped shift the tone of the market from one wary of central banks pushing huge amounts of gold onto the market, to smaller, but nonetheless important drivers like currencies and de-hedging.
South African players said the market has not forgotten the importance of the accord, and is looking forward to its renewal. They said the market was expecting Ramos to at least push for the retention of the 400 ton a year sale limit.
Some said, however, they would not be surprised if the limit on sales was increased this time around – there are rumours that certain European central banks want to reduce their holdings.
Initial speculation names Germany as one of the prime suspects for lightening its gold holdings, rumour fuelled by governor Ernst Welteke’s persistent comments to that effect. Italy and France have also featured as prime candidates for getting in on the action.
But the timing for a favourable sequel to the first Washington Accord may be just right for the gold market; there may also be external factors supporting the retention of gold as a reserve asset - dollar weakness may sway central bankers to hold onto their gold as they shy away from the dollar.
mineweb - 13.05.03
---
Das World Gold Council verkündet die Geburt eines neuen Goldfonds:
Equity Gold Trust fund
The World Gold Council has filed with the Securities and Exchange Commission for approval to create a stock-exchange traded form of gold under the name Equity Gold Trust. Equity Gold Trust would be the first commodities linked exchange traded fund in North America, and only the second in the world. The registration is for 60.4 million shares with an estimated value of $2 billion, according to the filing. The fund would be backed by real bullion and trade every second of the market day. The London-based World Gold Council has applied for approval to list the Shares on the New York Stock Exchange under the symbol "GLD."
The new exchange-traded fund (ETF) would be only the second commodities-linked exchange fund in the world. The first commodity-based ETF, Gold Bullion Ltd.`s Australia-traded security entered the market earlier this spring.
The Australia gold fund is also backed by the World Gold Council.
An ETF is a portfolio that trades on an exchange like a stock. The U.S. marketplace for ETFs includes more than 100 funds based on domestic and international stock indexes and fixed-income products.
Equity Gold Trust fund would be backed by real bullion in a vault and trade every second of the market day, the filing said.
According to the filing, the initial offering of shares would be at a per share price based on one-tenth of an ounce of gold at the time of the offering.
While gold investors were excited about the new product, some, like Mitsui`s Smith, were skeptical about the 1.2 percent annual management fee that is expected to come with it.
Frank Holmes, chief executive of gold-based mutual fund manager U.S. Global Investors, also called the management fee expensive, but said "this security should expand the audience for gold."
Another gold instrument was filed in Canada recently. Central Gold Trust is a closed-end trust that would allow investors to purchase gold-based securities at a discount or premium to the fund`s net asset value, on the Toronto Stock Exchange. As of today, only one other closed-end fund dealing in bullion trades in North America. Central Fund of Canada, on the American and Toronto Stock Exchanges, is a repository for gold and silver and trades at an approximately 20 percent premium to bullion`s price.
The Gold Council`s new gold instrument on the NYSE is expected to benefit investors who expect gold`s gains to continue to accelerate. It provides an investment instrument with a direct price link to gold`s daily price movements and eliminates the need for storage and insurance, which can be expensive for individual and institutional investors.
The filing came as gold prices hit a two-month high of $354 Wednesday in New York.
Robert Bishop, editor of the Gold Mining Stock Report newsletter, said "hard as it may seem to believe, it has always been very difficult for individuals to own gold. This should have an impact on the gold price."
Chris Thompson, the chairman of the World Gold Council and former chief executive of South Africa`s Gold Fields Ltd. has been leading the effort the market gold to individuals. Individuals often complain that access to gold in western markets is problematic.
CBS.MarketWatch.com 14.05.03
---
South African mining production decreases
Key findings regarding mining production as at the end of March 2003.
Total mining production for the first quarter of 2003, after seasonal adjustment, reflected a decrease of 1,1% compared with the last quarter of 2002.
The decrease of 1,1% after seasonal adjustment in the total mining production was due to a seasonally adjusted decrease of 1,6% in the production of non-gold minerals during the first quarter of 2003 compared with the last quarter of 2002. However, this decrease was partially counteracted by an increase of 1,1% in gold production during the same period. The major contributors to the seasonally adjusted decrease of 1,6% in the production of non-gold minerals were platinum and diamond mines.
Adjustment of the base period of the index of physical volume of mining production from 1995=100 to 2000=100
Following international practice of re-basing indices every five years, the base year of the index of physical volume of mining production has been changed from 1995=100 to 2000=100 with effect from the December 2002 statistical release.
The base period is the reference point of an index and is usually set at 100. Base periods have to be chosen carefully because different results can be obtained with different base periods. The following are important criteria for selecting base periods:
The base period must be recent to ensure that as many as possible of the components of the index are included in both the base period and the current period. The more recent the base period, the more comparable the current indices are with those of the base period.
Due to a large number of indices being published regularly, it is useful if they all have a common base period.
The internationally accepted current base period is 2000.
To compare different indices or to compare the movements in a specific index over a period, it often becomes necessary to shift the base period of an index.
The re-basing of indices was done on all the mineral groups of mining, recalculating the weights based on the 2000 sales of minerals as per the Minerals Bureau. The average indices of the mineral groups for the year 2000 were equated to 100. Each index was transformed to the new base period by dividing each monthly index by the average annual index for the year 2000 and multiplying the result by 100.
As from January 2000, the composite index for total mining was obtained by re-weighting the indices of the mineral groups after re-basing. The current weights were revised based on the 2000 sales data supplied by the Minerals Bureau, Department of Minerals and Energy. For the period before 2000, the composite index for total mining was linked with the so-called linking method for consecutive periods. This re-weighted composite index for total mining differs slightly from the index obtained by dividing the previously published composite index for total mining by the year 2000 average.
Key findings regarding mineral sales as at the end of February 2003 Mineral sales decrease
The seasonally adjusted value of mineral sales at current prices for the three months ended February 2003 reflected a decrease of 17,4% compared with the previous three months. Furthermore, the actual value of mineral sales at current prices for the three months ended February 2003 reflected a decrease of 8,3% compared with the three months ended February 2002.
The decrease of 17,4% in the seasonally adjusted value of mineral sales for the three months ended February 2003 compared with the previous three months can be attributed to a decrease of 18,4% (-R4 857,5 million) in sales of non-gold minerals and a decrease of 14,7% (-R1 493,7 million) in sales of gold.
The 8,3% decrease in the actual value of mineral sales at current prices for the three months ended February 2003 compared with the three months ended February 2002 was mainly due to a decrease of 8,9% (-R840,5 million) in sales of gold and a decrease of 8,0% (-R1 924,0 million) in sales of non-gold minerals. The decrease of 8,0% in non-gold mineral sales was mainly due to decreases of 28,7% (-R139,5 million) in sales of copper, 18,2% (-R223,7 million) in sales of iron ore and 14,2% (-R420,2 million) in sales of ‘other ‘non-metallic minerals.
Mbendi 13.05.03
.
kleine Meldung am Rande mit einer möglicherweise großen Wirkung ...
Shanghaier Goldbörse will individuellen Handel[
Shanghai 14.05.03 (asia-economy.de) Wie das China Informations Center mitteilt, hat die Shanghaier Goldbörse bei der Chinesischen Volksbank, der chinesischen Zentralbank, beantragt, dass auch individuelle Investoren an dem Goldhandel der Börse teilnehmen dürfen.
Gegenwärtig haben nur juristische Personen, Unternehmen, die Gold produzieren, verarbeiten oder mit Gold handeln, und die vier chinesischen Staatsbanken Zugang zu der Börse.
An- und Verkäufe durch den Goldeinzelhandel unterliegen verschiedenen Gebühren und willkürlichen Preisen, die von der Zentralbank festgesetzt werden. Handel an der Börse würde individuellen Investoren eine bessere und einfachere Möglichkeit geben, von den Schwankungen des Goldpreises zu profitieren.
asia economy - 14.05.03
kleine Meldung am Rande mit einer möglicherweise großen Wirkung ...

Shanghaier Goldbörse will individuellen Handel[
Shanghai 14.05.03 (asia-economy.de) Wie das China Informations Center mitteilt, hat die Shanghaier Goldbörse bei der Chinesischen Volksbank, der chinesischen Zentralbank, beantragt, dass auch individuelle Investoren an dem Goldhandel der Börse teilnehmen dürfen.
Gegenwärtig haben nur juristische Personen, Unternehmen, die Gold produzieren, verarbeiten oder mit Gold handeln, und die vier chinesischen Staatsbanken Zugang zu der Börse.
An- und Verkäufe durch den Goldeinzelhandel unterliegen verschiedenen Gebühren und willkürlichen Preisen, die von der Zentralbank festgesetzt werden. Handel an der Börse würde individuellen Investoren eine bessere und einfachere Möglichkeit geben, von den Schwankungen des Goldpreises zu profitieren.
asia economy - 14.05.03
Also nur noch 32000 tons. Vor 3 Jahren waren es angeblich 44 000, wieviel sind es.?
J2
J2
.
Der nachstehende Artikel ist von Andreas Hoose, den ich aus dem
"Antizyklischen Aktienclub" kenne. Hoose gibt hier einen guten wirtschaftlichen Überblick für eher pessimistisch eingestellten Investoren. Den Artikel kann man heute im redaktionellen Teil von WO nachlesen.
Die webseiten von www.antizyklischer-aktienclub.de kann ich wärmstens empfehlen.
ANDREAS HOOSE :
"DIE BULLEN SIND ZURÜCK"
So titelte das Anlegermagazin „Barron’s" in dieser Woche und feierte damit das Ende der dreijährigen Baisse. Die Redaktion stützt sich bei der Erkenntnis auf die jüngste Umfrage unter den „Big Boys“ des Aktiemarktes. Fondsmanager und Vermögensverwalter sind so euphorisch wie lange nicht mehr. Das ist doch endlich einmal eine gute Nachricht.
Und es kommt noch besser: 60 Prozent (!) der Befragten sind "optimistisch" bis "sehr optimistisch" was die weitere Entwicklung in 2003 am US-Aktienmarkt angeht. Im Schnitt erwarten die Geldmanager bis Jahresende einen Kursanstieg von zehn Prozent. Die Marke von 9500 Zählern käme damit beim Dow Jones ins Visier. Einige Profis sind noch weit zuversichtlicher und prophezeien Kursanstiege bis nahe der Allzeithochs. Beim Dow wären das fast 12.000 Zähler, eine Kletterpartie von rund 40 Prozent.
Der Aufbruch zu neuen Ufern wird nach Ansicht der Geldverwalter von sehr gewichtigen Gründen vorangetrieben: Einmal würden die Firmenbosse nach den Erfahrungen mit Enron und Worldcom ihre Bilanzen jetzt endlich in Ordnung bringen. Das Konsumentenvertrauen sei im Aufwind, die Ergebnisse des ersten Quartals seien überraschend gut ausgefallen. Mit Verlaub: Lauter alte Hüte, die schon seit Monaten, wenn nicht Jahren herumgereicht werden.
Auch die Börsengeschichte wird bemüht, um den Aufschwung zu beschwören: Von den professionellen Anlegern kann sich offenbar kaum jemand vorstellen, dass die Aktienkurse im dritten Jahr einer US-Präsidentschaft auch einmal sinken könnten. In der Vergangenheit zumindest war dies nur selten der Fall. Im Schnitt legten die US-Börsen im Jahr vor der Wahl sowie im Wahljahr selbst um rund elf Prozent zu. 2004 endet die Amtszeit von George W. Bush.
Schade, dass Börse nicht immer so einfach ist. Wer an den Aktienmärkten antizyklisch vorgeht, der wird bei solchen Prognosen hellhörig. Insbesondere die Tatsache, dass rund zwei Drittel der Börsenprofis auf steigende Kurse setzen, ist ein zuverlässiges Indiz dafür, dass es anders kommen wird. Wer positiv gestimmt ist, der ist in der Regel bereits investiert; die Zahl derer, die noch auf den Bullenzug aufspringen und die Kurse nach oben treiben könnte, ist also entsprechend gering.
Gut im Futter ?
Sehen wir uns doch einmal an, wie gut der junge Bulle im Futter steht. Bekanntlich ist eine fundamentale Unterbewertung, sowohl bei einzelnen Aktien wie auch bei ganzen Märkten, ein zuverlässiges Indiz für demnächst steigende Kurse. An dieser Stelle war schon mehrfach davon die Rede, dass die US-Märkte insgesamt recht teuer sind. Wie teuer sie tatsächlich sind, wird recht gut anhand folgender Grafik deutlich:

Die schwarze Linie bildet den Kursverlauf des S&P 500 seit 1982 ab. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Bewertung des Index bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 15. Dies gilt im übrigen auch dann, wenn man wesentlich weiter in die Vergangenheit zurückblickt, als dies im Chart dargestellt ist: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-Aktien liegt seit 1872 im Schnitt bei 14,5. Die blaue Linie verdeutlicht, was derzeit ein „durchschnittliches“ Niveau beim S&P 500 wäre: Etwas mehr als 420 Punkte wären im historischen Vergleich immer noch fair.
Auch Zeiten deutlicher Unterbewertung hat es beim S&P während der vergangenen beiden Jahrzehnte gegeben. Zum Start der Mega-Hausse vor etwas mehr als 20 Jahren etwa. 1982 lag das durchschnittliche KGV aller im S&P 500 gelisteten Unternehmen bei sechs bis acht. Der Kursverlauf notierte seinerzeit unterhalb der grünen Linie, die eine Unterbewertung im S&P 500 signalisiert. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste der S&P 500 auf kaum vorstellbare 280 Zähler fallen, um als echtes Schnäppchen durchzugehen. Kommen wir zur roten Linie. Bei einem KGV von 20 und darüber spricht man im historischen Vergleich von einer Überbewertung. Die Schlussfolgerung lautet: Selbst bei einem Index-Stand von rund 560 Zählern wäre der S&P 500 immer noch reichlich teuer.
Anleger mit Durchblick?
Allzu einseitig sollte man die Angelegenheit allerdings nicht betrachten. Theoretisch besteht immerhin die Möglichkeit, dass höhere KGVs künftig nicht die Ausnahme sind, sondern zur Regel werden. Beispielsweise könnte man einwenden, dass die technologische Entwicklung seit 1970 dazu beigetragen hat, dass Investoren einen umfassenderen und schnelleren Zugriff auf Informationen haben, bessere Kommunikations- und Transaktionswege zur Verfügung stehen und die Vertragssicherheit gesteigert wurde.
Hinzu kommen verbesserte Möglichkeiten der Risikostreuung. Diese Entwicklungen haben den Informationsstand der Marktakteure zweifellos verbessert und Unsicherheiten abgebaut. Dies könnte sich letztendlich in der Bereitschaft niederschlagen, höhere Bewertungen langfristig zu tolerieren. Ein Aspekt, über den insbesondere die Super-Pessimisten unter den Bären einmal nachdenken könnten. Auch muss man verstehen, dass Märkte ständigen Veränderungen unterliegen. Es gibt Zeiten, da Investoren akribisch auf Bewertungskennzahlen achten. Dann wieder gibt es Phasen, in denen solche Daten bei Anlageentscheidungen überhaupt keine Rolle spielen.
Ein Faktor jedoch bleibt mit auffallender Regelmäßigkeit konstant, und zwar insbesondere dann, wenn man das hektische Tagesgeschehen ausblendet: Die Entwicklung an den Märkten wird ganz entscheidend von zyklisch auftretenden Phänomenen geprägt. Man könnte auch sagen, die Märkte unterliegen einem Rhythmus. In diesen Tagen, da die Mehrzahl der professionellen Anleger von einem bevorstehenden Bullenmarkt ausgeht, lohnt sich ein Blick auf die größeren Zusammenhänge: Buchwert Im Chart unten ist das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis aller im S&P 500 gelisteten Unternehmen seit 1928 dargestellt.
Es fällt auf, dass der Wert im Vergleich zu den Übertreibungen Anfang des Jahres 2000 inzwischen deutlich korrigiert hat. Und noch etwas wird klar: Die Behauptung, US-Aktien seien auf einem günstigen Niveau angekommen, ist reichlich vermessen. Das gegenwärtige Kurs-Buchwert-Verhältnis ist deutlich höher als vor dem Crash von 1929, höher als während der Aktienhausse der 60er Jahre und auch höher als unmittelbar vor dem Einbruch 1987.

Ähnlich wie der Buchwert, lassen sich auch die Umsätze eines Unternehmens als Maßstab für die Bewertung heranziehen. Den Umsätzen kommt eine noch höhere Bedeutung zu als den Gewinnen, denn bekanntlich werden Gewinne aus den Einnahmen gespeist. Insbesondere bei der Analyse antizyklischer Investments sollte man daher stärker auf die Umsätze als auf die Gewinne achten. Oftmals lässt sich anhand steigender Umsätze ein Turnaround bei den Gewinnen prognostizieren. Die Grafik unten zeigt, dass US-Aktien im historischen Vergleich auch hinsichtlich der Umsätze teuer sind. Mitte der 70er und während der frühen 80er Jahre lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis der im S&P 500 gelisteten Firmen bei weniger als 0,5. Heute ist der Quotient fast dreimal so hoch.

Da wundert es nicht, dass die Aktienkäufe von Unternehmensinsidern in den USA im April 2003 den niedrigsten Wert seit acht Jahren aufweisen. Offenbar trauen die Firmenlenker der frommen Wallstreet-Propaganda am allerwenigsten über den Weg. Die Herren im Nadelstreif wissen natürlich, dass ein KGV von 32 beim S&P 500 mehr als ambitioniert ist. Wer 32 US-Dollar für jeden Dollar Gewinn bezahlt, den ein Unternehmen aus dem S&P 500 in diesem Jahr erwirtschaftet, der muss schon eine Menge Gottvertrauen besitzen.
Phantasievoll?
Vermutlich phantasieren viele Anlegern, die jetzt den neuen Bullenmarkt ausrufen, immer noch von der Super-Hausse der späten 90er Jahre und können sich selbst nach drei Jahren Baisse eine mehrjährige Durstrecke nicht vorstellen. Kein Wunder, immerhin hatte der Aufschwung von 1982 bis 2000 für eine inflationsbereinigte Rendite von 12,8 Prozent pro Jahr gesorgt. Man hatte sich daran gewöhnt, dass man jedes Jahr ein gutes Stück reicher wurde. In den rund 180 (!) Jahren davor mussten sich Anleger an den Aktienmärkten im Schnitt allerdings mit 7,5 Prozent Rendite pro Jahr begnügen.
Und auch die Zeiten sehr kleiner Brötchen liegen noch nicht allzu weit zurück: In den 15 Jahren von 1966 bis 1981 notierte die Realrendite von US-Aktien jährlich bei minus (!) 0,4 Prozentpunkten. Doch zurück zum Ausgangspunkt der Überlegungen: Wie sehr das Geschehen an den Aktienmärkten tatsächlich durch Zyklen geprägt ist, verdeutlicht folgende Darstellung des Dow Jones (bzw. seines Vorgängers) seit 1800. Die Grafik will keine langfristigen Kursziele bestimmen. Vielmehr soll die inflationsbereinigte Entwicklung dargestellt werden, die US-Aktien im Verlauf der vergangenen 200 Jahre genommen haben. Die Botschaft dürfte klar sein: Auf Übertreibungsphasen folgen langjährige Abschnitte mit weit unterdurchschnittlicher Performance.

Und jetzt startet nach Meinung der Fondsmanager also die nächste Hausse?
Die Wette gilt. Dollar im Sturzflug Gegen eine bevorstehende stärkere Aufwärtsbewegung in den USA spricht schon die desolate Verfassung des US-Dollar, die zwar der US-Exportwirtschaft einen warmen Geldsegen beschert, unterm Strich aber bereits jetzt einige Probleme verursacht. Angesichts der Währungsverluste, die sich europäische Anleger nun schon seit Monaten in den USA einhandeln und des ungebrochenen Abwärtstrend des Greenback, besteht die Gefahr, dass sich die Flucht aus dem Dollar-Raum noch verstärkt. Die Risiken durch die wachsenden Defizite in Amerikas Leistungsbilanz und Staatshaushalt scheinen von den Märkten immer stärker wahrgenommen zu werden.
Folgerichtig wird Kapital aus den USA abgezogen. In den Newslettern des Antizyklischen Aktienclubs hatten wir schon vor Monaten auf die Gefahr hingewiesen. Jüngste Zahlen belegen den Trend: Während der ersten beiden Monate des laufenden Jahres haben ausländische Investoren rund 64 Milliarden US-Dollar an den US-Bondmärkten angelegt. Hochgerechnet bis Dezember 2003 ergibt das eine Summe von rund 384 Milliarden US-Dollar, die in diesem Jahr aus dem Ausland in US-Bonds fließen werden - und damit deutlich weniger als in früheren Jahren. Da auch ausländische Direktinvestitionen in den USA stark zurückgegangen sind, darf man gespannt sein, wie die Vereinigten Staaten ihr Handelsbilanzdefizit von rund 500 Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr finanzieren wollen.

Die Sache könnte noch höchst ungemütlich werden. Und zwar dann, wenn auch asiatische Anleger dem Trend zur Kapitalflucht aus den USA in größerem Stil folgen sollten und beispielsweise Geld in den Euro-Raum umschichten. Ein noch dramatischerer Dollar-Sturz wäre die Folge. Die Bank of America rechnet bereits jetzt mit einem Euro-Kurs von bis zu 1,30 US-Dollar bis Mitte nächsten Jahres.
Japan und die Zinsen
Eine entscheidende Bedeutung wird dabei Japan zukommen. Mehr als elf Prozent aller auf dem Markt verfügbaren US-Treasuries befinden sich in den Händen japanischer Anleger - fast zehnmal soviel wie in Deutschland. Sollten die sicherheitsorientierten Investoren Nippons auf die Idee kommen, dass dieses Geld andernorts besser aufgehoben ist, könnte sich die Talfahrt des US-Dollar dramatisch beschleunigen. Dies wiederum würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu steigenden Zinsen in den USA führen.
Angesichts der prekären Wirtschaftslage keine besonders erbauliche Vorstellung. Aktuell fällt die Reputation des Dollar mit jedem Cent, den er gegenüber dem Euro verliert - obwohl auch Europa unter Wachstumsschwäche und Strukturproblemen zu leiden hat. Zuletzt marschierte der Greenback mit Volldampf durch einige wichtige Unterstützungszonen. Der seit Frühjahr 2001 bestehende steile Abwärtstrend (Chart unten) wurde nach unten durchbrochen; auch das längerfristige Bild seit 1996 (darunter) präsentiert sich nicht gerade ermutigend. Wie sich der Trend beim Dollar auf die Entwicklung des Goldpreises auswirkt, soll demnächst an dieser Stelle einmal ausführlich erläutert werden.


Womöglich steht uns der schwierigste Teil des Bärenmarktes erst noch bevor. Nachdem technisch orientierte Anleger seit mehr als zwei Jahren leichtes Spiel hatten – ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte genügte beinahe schon – könnte es jetzt ganz anders werden. Vor einer Woche hatten wir an dieser Stelle ausgeführt, dass der langfristige Kursverlauf beim S&P 500 im Moment ein Kaufsignal bildet (Chart unten). Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil: Das Kaufsignal beim Trendfolger MACD ist jetzt sogar klar auszumachen. Auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt wurde inzwischen mehr als deutlich überwunden. Diese Tatsachen mit den geschilderten fundamentalen Fakten auf einen Nenner zu bringen, erfordert erheblich mehr Geschick als bislang nötig war, um erfolgreich durch die Baisse zu manövrieren. Ganz im Sinne des Bären also: Erst wenn genügend Anleger ihr Geld in den Sand gesetzt haben, wird der größte Bärenmarkt seit 1929 zu Ende sein.

Glücklicherweise muss sagen, denn wer die Fährte des Bären lesen kann, dem eröffnen sich gerade in der Baisse spektakuläre Chancen. Antizyklisch vorgehenden Anlegern werden sich daher auch in den kommenden Monaten immer wieder günstige Gelegenheiten bieten. Ein paar Kostproben gefällig? Nach einem vernichtenden Artikel im weiter oben schon einmal zitierten Anlegermagazin Barron´s hatten wir für das Signal-Depot des Antizyklischen Aktienclubs vor einigen Wochen die Papiere von Royal Gold (RGLD; Chart unten) eingesammelt. Während die Masse der Anleger dem Ausverkauf entsetzt zugesehen hatte, sind wir gegen den Trend eingestiegen. Das Gap, das der Kurs unmittelbar nach dem Verriss gebildet hatte, wurde inzwischen annähernd wieder geschlossen. Der MACD scheint kurz vor einem Kaufsignal zu stehen. In unserem Depot notiert der Wert inzwischen mit fast 40 Prozent im Plus.

Auch beim Gesundheitsdienstleister Tenet Healthcare (THC, Chart unten) sind wir vor einigen Wochen fündig geworden. Der Titel scheint die Bodenbildung abzuschließen. Der Trendfolger MACD hat eine positive Divergenz ausgebildet.

Bei einigen Dax-Werten, wie dem Finanzdienstleister MLP, dem Tourismuskonzern TUI oder dem Index-Schwergewicht Münchner Rück haben wir während der Panikstimmung Mitte März ebenfalls antizyklisch zugegriffen. Mittlerweile konnten wir jeweils zweistellige Kursgewinne realisieren. Beim Blick auf den Volatilitätsindikator VIX (unten) wird klar, dass neue Kaufgelegenheiten nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen werden. Das Stimmungsbarometer bewegt sich im Bereich seiner unteren Extremzone, das heißt, die Stimmung nähert sich ihrem Siedepunkt. Gute Zeiten für geduldige Bären.

.
Der nachstehende Artikel ist von Andreas Hoose, den ich aus dem
"Antizyklischen Aktienclub" kenne. Hoose gibt hier einen guten wirtschaftlichen Überblick für eher pessimistisch eingestellten Investoren. Den Artikel kann man heute im redaktionellen Teil von WO nachlesen.
Die webseiten von www.antizyklischer-aktienclub.de kann ich wärmstens empfehlen.
ANDREAS HOOSE :
"DIE BULLEN SIND ZURÜCK"
So titelte das Anlegermagazin „Barron’s" in dieser Woche und feierte damit das Ende der dreijährigen Baisse. Die Redaktion stützt sich bei der Erkenntnis auf die jüngste Umfrage unter den „Big Boys“ des Aktiemarktes. Fondsmanager und Vermögensverwalter sind so euphorisch wie lange nicht mehr. Das ist doch endlich einmal eine gute Nachricht.
Und es kommt noch besser: 60 Prozent (!) der Befragten sind "optimistisch" bis "sehr optimistisch" was die weitere Entwicklung in 2003 am US-Aktienmarkt angeht. Im Schnitt erwarten die Geldmanager bis Jahresende einen Kursanstieg von zehn Prozent. Die Marke von 9500 Zählern käme damit beim Dow Jones ins Visier. Einige Profis sind noch weit zuversichtlicher und prophezeien Kursanstiege bis nahe der Allzeithochs. Beim Dow wären das fast 12.000 Zähler, eine Kletterpartie von rund 40 Prozent.
Der Aufbruch zu neuen Ufern wird nach Ansicht der Geldverwalter von sehr gewichtigen Gründen vorangetrieben: Einmal würden die Firmenbosse nach den Erfahrungen mit Enron und Worldcom ihre Bilanzen jetzt endlich in Ordnung bringen. Das Konsumentenvertrauen sei im Aufwind, die Ergebnisse des ersten Quartals seien überraschend gut ausgefallen. Mit Verlaub: Lauter alte Hüte, die schon seit Monaten, wenn nicht Jahren herumgereicht werden.
Auch die Börsengeschichte wird bemüht, um den Aufschwung zu beschwören: Von den professionellen Anlegern kann sich offenbar kaum jemand vorstellen, dass die Aktienkurse im dritten Jahr einer US-Präsidentschaft auch einmal sinken könnten. In der Vergangenheit zumindest war dies nur selten der Fall. Im Schnitt legten die US-Börsen im Jahr vor der Wahl sowie im Wahljahr selbst um rund elf Prozent zu. 2004 endet die Amtszeit von George W. Bush.
Schade, dass Börse nicht immer so einfach ist. Wer an den Aktienmärkten antizyklisch vorgeht, der wird bei solchen Prognosen hellhörig. Insbesondere die Tatsache, dass rund zwei Drittel der Börsenprofis auf steigende Kurse setzen, ist ein zuverlässiges Indiz dafür, dass es anders kommen wird. Wer positiv gestimmt ist, der ist in der Regel bereits investiert; die Zahl derer, die noch auf den Bullenzug aufspringen und die Kurse nach oben treiben könnte, ist also entsprechend gering.
Gut im Futter ?
Sehen wir uns doch einmal an, wie gut der junge Bulle im Futter steht. Bekanntlich ist eine fundamentale Unterbewertung, sowohl bei einzelnen Aktien wie auch bei ganzen Märkten, ein zuverlässiges Indiz für demnächst steigende Kurse. An dieser Stelle war schon mehrfach davon die Rede, dass die US-Märkte insgesamt recht teuer sind. Wie teuer sie tatsächlich sind, wird recht gut anhand folgender Grafik deutlich:

Die schwarze Linie bildet den Kursverlauf des S&P 500 seit 1982 ab. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Bewertung des Index bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 15. Dies gilt im übrigen auch dann, wenn man wesentlich weiter in die Vergangenheit zurückblickt, als dies im Chart dargestellt ist: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-Aktien liegt seit 1872 im Schnitt bei 14,5. Die blaue Linie verdeutlicht, was derzeit ein „durchschnittliches“ Niveau beim S&P 500 wäre: Etwas mehr als 420 Punkte wären im historischen Vergleich immer noch fair.
Auch Zeiten deutlicher Unterbewertung hat es beim S&P während der vergangenen beiden Jahrzehnte gegeben. Zum Start der Mega-Hausse vor etwas mehr als 20 Jahren etwa. 1982 lag das durchschnittliche KGV aller im S&P 500 gelisteten Unternehmen bei sechs bis acht. Der Kursverlauf notierte seinerzeit unterhalb der grünen Linie, die eine Unterbewertung im S&P 500 signalisiert. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste der S&P 500 auf kaum vorstellbare 280 Zähler fallen, um als echtes Schnäppchen durchzugehen. Kommen wir zur roten Linie. Bei einem KGV von 20 und darüber spricht man im historischen Vergleich von einer Überbewertung. Die Schlussfolgerung lautet: Selbst bei einem Index-Stand von rund 560 Zählern wäre der S&P 500 immer noch reichlich teuer.
Anleger mit Durchblick?
Allzu einseitig sollte man die Angelegenheit allerdings nicht betrachten. Theoretisch besteht immerhin die Möglichkeit, dass höhere KGVs künftig nicht die Ausnahme sind, sondern zur Regel werden. Beispielsweise könnte man einwenden, dass die technologische Entwicklung seit 1970 dazu beigetragen hat, dass Investoren einen umfassenderen und schnelleren Zugriff auf Informationen haben, bessere Kommunikations- und Transaktionswege zur Verfügung stehen und die Vertragssicherheit gesteigert wurde.
Hinzu kommen verbesserte Möglichkeiten der Risikostreuung. Diese Entwicklungen haben den Informationsstand der Marktakteure zweifellos verbessert und Unsicherheiten abgebaut. Dies könnte sich letztendlich in der Bereitschaft niederschlagen, höhere Bewertungen langfristig zu tolerieren. Ein Aspekt, über den insbesondere die Super-Pessimisten unter den Bären einmal nachdenken könnten. Auch muss man verstehen, dass Märkte ständigen Veränderungen unterliegen. Es gibt Zeiten, da Investoren akribisch auf Bewertungskennzahlen achten. Dann wieder gibt es Phasen, in denen solche Daten bei Anlageentscheidungen überhaupt keine Rolle spielen.
Ein Faktor jedoch bleibt mit auffallender Regelmäßigkeit konstant, und zwar insbesondere dann, wenn man das hektische Tagesgeschehen ausblendet: Die Entwicklung an den Märkten wird ganz entscheidend von zyklisch auftretenden Phänomenen geprägt. Man könnte auch sagen, die Märkte unterliegen einem Rhythmus. In diesen Tagen, da die Mehrzahl der professionellen Anleger von einem bevorstehenden Bullenmarkt ausgeht, lohnt sich ein Blick auf die größeren Zusammenhänge: Buchwert Im Chart unten ist das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis aller im S&P 500 gelisteten Unternehmen seit 1928 dargestellt.
Es fällt auf, dass der Wert im Vergleich zu den Übertreibungen Anfang des Jahres 2000 inzwischen deutlich korrigiert hat. Und noch etwas wird klar: Die Behauptung, US-Aktien seien auf einem günstigen Niveau angekommen, ist reichlich vermessen. Das gegenwärtige Kurs-Buchwert-Verhältnis ist deutlich höher als vor dem Crash von 1929, höher als während der Aktienhausse der 60er Jahre und auch höher als unmittelbar vor dem Einbruch 1987.

Ähnlich wie der Buchwert, lassen sich auch die Umsätze eines Unternehmens als Maßstab für die Bewertung heranziehen. Den Umsätzen kommt eine noch höhere Bedeutung zu als den Gewinnen, denn bekanntlich werden Gewinne aus den Einnahmen gespeist. Insbesondere bei der Analyse antizyklischer Investments sollte man daher stärker auf die Umsätze als auf die Gewinne achten. Oftmals lässt sich anhand steigender Umsätze ein Turnaround bei den Gewinnen prognostizieren. Die Grafik unten zeigt, dass US-Aktien im historischen Vergleich auch hinsichtlich der Umsätze teuer sind. Mitte der 70er und während der frühen 80er Jahre lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis der im S&P 500 gelisteten Firmen bei weniger als 0,5. Heute ist der Quotient fast dreimal so hoch.

Da wundert es nicht, dass die Aktienkäufe von Unternehmensinsidern in den USA im April 2003 den niedrigsten Wert seit acht Jahren aufweisen. Offenbar trauen die Firmenlenker der frommen Wallstreet-Propaganda am allerwenigsten über den Weg. Die Herren im Nadelstreif wissen natürlich, dass ein KGV von 32 beim S&P 500 mehr als ambitioniert ist. Wer 32 US-Dollar für jeden Dollar Gewinn bezahlt, den ein Unternehmen aus dem S&P 500 in diesem Jahr erwirtschaftet, der muss schon eine Menge Gottvertrauen besitzen.
Phantasievoll?
Vermutlich phantasieren viele Anlegern, die jetzt den neuen Bullenmarkt ausrufen, immer noch von der Super-Hausse der späten 90er Jahre und können sich selbst nach drei Jahren Baisse eine mehrjährige Durstrecke nicht vorstellen. Kein Wunder, immerhin hatte der Aufschwung von 1982 bis 2000 für eine inflationsbereinigte Rendite von 12,8 Prozent pro Jahr gesorgt. Man hatte sich daran gewöhnt, dass man jedes Jahr ein gutes Stück reicher wurde. In den rund 180 (!) Jahren davor mussten sich Anleger an den Aktienmärkten im Schnitt allerdings mit 7,5 Prozent Rendite pro Jahr begnügen.
Und auch die Zeiten sehr kleiner Brötchen liegen noch nicht allzu weit zurück: In den 15 Jahren von 1966 bis 1981 notierte die Realrendite von US-Aktien jährlich bei minus (!) 0,4 Prozentpunkten. Doch zurück zum Ausgangspunkt der Überlegungen: Wie sehr das Geschehen an den Aktienmärkten tatsächlich durch Zyklen geprägt ist, verdeutlicht folgende Darstellung des Dow Jones (bzw. seines Vorgängers) seit 1800. Die Grafik will keine langfristigen Kursziele bestimmen. Vielmehr soll die inflationsbereinigte Entwicklung dargestellt werden, die US-Aktien im Verlauf der vergangenen 200 Jahre genommen haben. Die Botschaft dürfte klar sein: Auf Übertreibungsphasen folgen langjährige Abschnitte mit weit unterdurchschnittlicher Performance.

Und jetzt startet nach Meinung der Fondsmanager also die nächste Hausse?
Die Wette gilt. Dollar im Sturzflug Gegen eine bevorstehende stärkere Aufwärtsbewegung in den USA spricht schon die desolate Verfassung des US-Dollar, die zwar der US-Exportwirtschaft einen warmen Geldsegen beschert, unterm Strich aber bereits jetzt einige Probleme verursacht. Angesichts der Währungsverluste, die sich europäische Anleger nun schon seit Monaten in den USA einhandeln und des ungebrochenen Abwärtstrend des Greenback, besteht die Gefahr, dass sich die Flucht aus dem Dollar-Raum noch verstärkt. Die Risiken durch die wachsenden Defizite in Amerikas Leistungsbilanz und Staatshaushalt scheinen von den Märkten immer stärker wahrgenommen zu werden.
Folgerichtig wird Kapital aus den USA abgezogen. In den Newslettern des Antizyklischen Aktienclubs hatten wir schon vor Monaten auf die Gefahr hingewiesen. Jüngste Zahlen belegen den Trend: Während der ersten beiden Monate des laufenden Jahres haben ausländische Investoren rund 64 Milliarden US-Dollar an den US-Bondmärkten angelegt. Hochgerechnet bis Dezember 2003 ergibt das eine Summe von rund 384 Milliarden US-Dollar, die in diesem Jahr aus dem Ausland in US-Bonds fließen werden - und damit deutlich weniger als in früheren Jahren. Da auch ausländische Direktinvestitionen in den USA stark zurückgegangen sind, darf man gespannt sein, wie die Vereinigten Staaten ihr Handelsbilanzdefizit von rund 500 Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr finanzieren wollen.

Die Sache könnte noch höchst ungemütlich werden. Und zwar dann, wenn auch asiatische Anleger dem Trend zur Kapitalflucht aus den USA in größerem Stil folgen sollten und beispielsweise Geld in den Euro-Raum umschichten. Ein noch dramatischerer Dollar-Sturz wäre die Folge. Die Bank of America rechnet bereits jetzt mit einem Euro-Kurs von bis zu 1,30 US-Dollar bis Mitte nächsten Jahres.
Japan und die Zinsen
Eine entscheidende Bedeutung wird dabei Japan zukommen. Mehr als elf Prozent aller auf dem Markt verfügbaren US-Treasuries befinden sich in den Händen japanischer Anleger - fast zehnmal soviel wie in Deutschland. Sollten die sicherheitsorientierten Investoren Nippons auf die Idee kommen, dass dieses Geld andernorts besser aufgehoben ist, könnte sich die Talfahrt des US-Dollar dramatisch beschleunigen. Dies wiederum würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu steigenden Zinsen in den USA führen.
Angesichts der prekären Wirtschaftslage keine besonders erbauliche Vorstellung. Aktuell fällt die Reputation des Dollar mit jedem Cent, den er gegenüber dem Euro verliert - obwohl auch Europa unter Wachstumsschwäche und Strukturproblemen zu leiden hat. Zuletzt marschierte der Greenback mit Volldampf durch einige wichtige Unterstützungszonen. Der seit Frühjahr 2001 bestehende steile Abwärtstrend (Chart unten) wurde nach unten durchbrochen; auch das längerfristige Bild seit 1996 (darunter) präsentiert sich nicht gerade ermutigend. Wie sich der Trend beim Dollar auf die Entwicklung des Goldpreises auswirkt, soll demnächst an dieser Stelle einmal ausführlich erläutert werden.


Womöglich steht uns der schwierigste Teil des Bärenmarktes erst noch bevor. Nachdem technisch orientierte Anleger seit mehr als zwei Jahren leichtes Spiel hatten – ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte genügte beinahe schon – könnte es jetzt ganz anders werden. Vor einer Woche hatten wir an dieser Stelle ausgeführt, dass der langfristige Kursverlauf beim S&P 500 im Moment ein Kaufsignal bildet (Chart unten). Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil: Das Kaufsignal beim Trendfolger MACD ist jetzt sogar klar auszumachen. Auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt wurde inzwischen mehr als deutlich überwunden. Diese Tatsachen mit den geschilderten fundamentalen Fakten auf einen Nenner zu bringen, erfordert erheblich mehr Geschick als bislang nötig war, um erfolgreich durch die Baisse zu manövrieren. Ganz im Sinne des Bären also: Erst wenn genügend Anleger ihr Geld in den Sand gesetzt haben, wird der größte Bärenmarkt seit 1929 zu Ende sein.

Glücklicherweise muss sagen, denn wer die Fährte des Bären lesen kann, dem eröffnen sich gerade in der Baisse spektakuläre Chancen. Antizyklisch vorgehenden Anlegern werden sich daher auch in den kommenden Monaten immer wieder günstige Gelegenheiten bieten. Ein paar Kostproben gefällig? Nach einem vernichtenden Artikel im weiter oben schon einmal zitierten Anlegermagazin Barron´s hatten wir für das Signal-Depot des Antizyklischen Aktienclubs vor einigen Wochen die Papiere von Royal Gold (RGLD; Chart unten) eingesammelt. Während die Masse der Anleger dem Ausverkauf entsetzt zugesehen hatte, sind wir gegen den Trend eingestiegen. Das Gap, das der Kurs unmittelbar nach dem Verriss gebildet hatte, wurde inzwischen annähernd wieder geschlossen. Der MACD scheint kurz vor einem Kaufsignal zu stehen. In unserem Depot notiert der Wert inzwischen mit fast 40 Prozent im Plus.

Auch beim Gesundheitsdienstleister Tenet Healthcare (THC, Chart unten) sind wir vor einigen Wochen fündig geworden. Der Titel scheint die Bodenbildung abzuschließen. Der Trendfolger MACD hat eine positive Divergenz ausgebildet.

Bei einigen Dax-Werten, wie dem Finanzdienstleister MLP, dem Tourismuskonzern TUI oder dem Index-Schwergewicht Münchner Rück haben wir während der Panikstimmung Mitte März ebenfalls antizyklisch zugegriffen. Mittlerweile konnten wir jeweils zweistellige Kursgewinne realisieren. Beim Blick auf den Volatilitätsindikator VIX (unten) wird klar, dass neue Kaufgelegenheiten nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen werden. Das Stimmungsbarometer bewegt sich im Bereich seiner unteren Extremzone, das heißt, die Stimmung nähert sich ihrem Siedepunkt. Gute Zeiten für geduldige Bären.

.
Die neue Leichtigkeit
Wie die großen Notenbanken lernen, die Inflation zu lieben
Von Robert von Heusinger
Nun ist es passiert. Nach mehr als zwanzigjährigem Kampf gegen die Inflation haben die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt die Waffen gestreckt. Die amerikanische Federal Reserve, kurz Fed, erklärte jüngst, sie fürchte eher fallende denn steigende Preise. Und die Europäische Zentralbank (EZB) hob ganz verschämt ihr Inflationsziel um einen halben Prozentpunkt an. Das klingt ungeheuerlich und ist doch nichts anderes als der Rückschlag des Pendels.
Es ist das Ende einer Epoche, die 1979 mit der Berufung von Fed-Chef Paul Volcker begann. Seine Politik der ausschließlichen Inflationsbekämpfung war die Antwort auf die siebziger Jahre: Der auf die Feinsteuerung der Wirtschaft reduzierte Keynesianismus galt als gescheitert, die theoretischen Modelle der Ökonomen, die einen Mix aus höheren Staatsausgaben und Inflation vorschlugen, hatten der komplexen Wirklichkeit nicht standgehalten. Ende der Siebziger gab es in den Volkswirtschaften weltweit zwar Inflation, aber kein Wachstum. Es herrschte Stagflation.
Doch mit ihrem jüngsten Eingeständnis haben die Notenbanker in Amerika und Europa jetzt auch die Gegentherapie entzaubert, die da lautete: Ohne Inflation und ohne Staatsverschuldung geht es der Volkswirtschaft am besten.
Die Hoffnung, alles werde gut, wenn nur die Inflation schön niedrig sei, war trügerisch. Die Inflationsbekämpfung der Fed bescherte den Vereinigten Staaten zwar den längsten Konjunkturaufschwung ihrer Wirtschaftsgeschichte. Aber der Abschwung war und ist nicht minder heftig. Noch immer leiden die großen Industrieländer weltweit unter den Nachwirkungen der gigantischen Aktienspekulation zur Jahrtausendwende.
Manche erinnert die Lage schon stark an die dreißiger Jahre. Nicht umsonst gilt die Sorge des US-Notenbankchefs Alan Greenspan nun der Rückkehr der Deflation – dem wirtschaftlichen Schreckenserlebnis der Amerikaner im vergangenen Jahrhundert. Und bei einem Blick in die aktuellen Forschungspapiere der Fed, die sich der Deflation widmen, wird rasch klar, wohin die Reise gehen wird: zurück zur Koordination der Geld- und Fiskalpolitik und zu mehr Interventionismus.
Aus europäischer Sicht hat die Deflationsdebatte durchaus etwas Befreiendes. Sie macht Schluss mit der Überhöhung der Preisstabilität als wirtschaftspolitischem Ziel schlechthin. Das vorrangige Ziel der Wirtschaftspolitik muss schließlich die Steigerung des Wohlstandes sein, gefolgt von Vollbeschäftigung. Erst danach kommen Hilfsziele wie etwa die Preisstabilität. Niedrige Inflation ist so lange willkommen, wie sie Wachstum und Beschäftigung fördert und zur Stabilität des Wirtschafts- und Finanzsystems beiträgt.
Warum ist Deflation gefährlich? Warum lieber vier Prozent Inflation als ein Prozent Deflation? Weil Deflation ganz anders wirkt als Inflation mit negativem Vorzeichen. Erstens sind fallende Preise nichts anderes als eine Umverteilung von Schuldnern zu Gläubigern. Je höher die Deflation, desto werthaltiger werden die Schulden. Das provoziert Pleiten und Bankrotte. Denn die Deflation mindert den Gewinn der Unternehmen und macht so die Rückzahlung der Schulden schwierig.
Gleichzeitig leihen die Banken weniger aus, da sie Kreditausfälle befürchten. Mit diesem Verhalten aber provozieren sie erst recht Ausfälle. Diese wiederum reißen Löcher in die Bankbilanzen. Das gesamte Finanzsystem wird anfälliger, im Extremfall bricht es zusammen. Die Notenbank kann mit traditionellen Mitteln wie Zinssenkungen nichts ausrichten.
Zweitens sind sich die Wirtschaftsforscher einig, dass es nach unten unflexible Preise gibt, zum Beispiel Löhne. Zwei Prozent Lohnanstieg bei einer Inflationsrate von drei Prozent werden eher akzeptiert als eine Lohnkürzung von einem Prozent bei einer Inflationrate von null.
Drittens sind die Menschen auf Preissteigerungen programmiert, weil sie zu ihren Lebzeiten nichts anderes kennen gelernt haben. Das macht die Anpassung an länger fallende Preise sehr schwierig und führt zu Wachstumseinbußen.
Inflation dagegen lässt alle beschriebenen Probleme verschwinden. Das Finanzsystem lebt mit ein bisschen mehr Inflation sogar exzellent. Denn die Abwertung der Schulden macht deren Zurückzahlung wahrscheinlicher. Auch die Lebensversicherer können ihre Versprechen leichter halten, wenn die Inflation ansehnlich ist. Dann liegen die Zinsen der sicheren Staatsanleihen höher als die Garantiezinsen. Und selbst der Staat profitiert über die „kalte Progression“ des Steuersystems von höherer Inflation. Seine Einnahmen steigen.
Deshalb muss die richtige Frage lauten: Was ist die optimale Rate der Inflation? Theoretisch ist das ganz rasch berechnet: Es ist die Inflationsrate, bei der Vollbeschäftigung herrscht.
Praktisch gestaltet sich die Suche schwieriger. Irgendwo bei einer Inflationsrate zwischen fünf und zehn Prozent pro Jahr wird das Wachstum beeinträchtigt, haben empirische Studien ergeben. Von einer gewissen Inflationshöhe an können Unternehmer und Konsumenten die Preissignale nicht mehr exakt deuten. Handelt es sich um einen Preisanstieg, der auf größerer Nachfrage basiert oder schlicht auf Inflationsanpassung? Der Einsatz der Ressourcen erfolgt dann nicht mehr effizient.
Genauso vage ist es, die Grenze nach unten zu ziehen. Null Prozent sind eindeutig zu ambitioniert, weil ein Sicherheitsabstand zur Deflation gewahrt werden muss. Das hat selbst die EZB jüngst eingesehen und ihr Preisziel von „unter zwei Prozent“ auf „nahe zwei“ erhöht. Denn die große Unbekannte ist der Messfehler. Fast alle Studien, die sich dieser Frage widmeten, kommen zum Ergebnis, dass Preisindizes die wahre Inflation um 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte überzeichnen. „Nahe zwei Prozent“ klingt immer noch etwas eng bemessen.
Sei’s drum. Die Notenbanker haben erkannt, dass sie es mit der Inflationsbekämpfung übertrieben haben. Niemand muss sich vor drei oder vier Prozent Preissteigerung fürchten. Das ist die gute Nachricht.
.
Wie die großen Notenbanken lernen, die Inflation zu lieben
Von Robert von Heusinger
Nun ist es passiert. Nach mehr als zwanzigjährigem Kampf gegen die Inflation haben die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt die Waffen gestreckt. Die amerikanische Federal Reserve, kurz Fed, erklärte jüngst, sie fürchte eher fallende denn steigende Preise. Und die Europäische Zentralbank (EZB) hob ganz verschämt ihr Inflationsziel um einen halben Prozentpunkt an. Das klingt ungeheuerlich und ist doch nichts anderes als der Rückschlag des Pendels.
Es ist das Ende einer Epoche, die 1979 mit der Berufung von Fed-Chef Paul Volcker begann. Seine Politik der ausschließlichen Inflationsbekämpfung war die Antwort auf die siebziger Jahre: Der auf die Feinsteuerung der Wirtschaft reduzierte Keynesianismus galt als gescheitert, die theoretischen Modelle der Ökonomen, die einen Mix aus höheren Staatsausgaben und Inflation vorschlugen, hatten der komplexen Wirklichkeit nicht standgehalten. Ende der Siebziger gab es in den Volkswirtschaften weltweit zwar Inflation, aber kein Wachstum. Es herrschte Stagflation.
Doch mit ihrem jüngsten Eingeständnis haben die Notenbanker in Amerika und Europa jetzt auch die Gegentherapie entzaubert, die da lautete: Ohne Inflation und ohne Staatsverschuldung geht es der Volkswirtschaft am besten.
Die Hoffnung, alles werde gut, wenn nur die Inflation schön niedrig sei, war trügerisch. Die Inflationsbekämpfung der Fed bescherte den Vereinigten Staaten zwar den längsten Konjunkturaufschwung ihrer Wirtschaftsgeschichte. Aber der Abschwung war und ist nicht minder heftig. Noch immer leiden die großen Industrieländer weltweit unter den Nachwirkungen der gigantischen Aktienspekulation zur Jahrtausendwende.
Manche erinnert die Lage schon stark an die dreißiger Jahre. Nicht umsonst gilt die Sorge des US-Notenbankchefs Alan Greenspan nun der Rückkehr der Deflation – dem wirtschaftlichen Schreckenserlebnis der Amerikaner im vergangenen Jahrhundert. Und bei einem Blick in die aktuellen Forschungspapiere der Fed, die sich der Deflation widmen, wird rasch klar, wohin die Reise gehen wird: zurück zur Koordination der Geld- und Fiskalpolitik und zu mehr Interventionismus.
Aus europäischer Sicht hat die Deflationsdebatte durchaus etwas Befreiendes. Sie macht Schluss mit der Überhöhung der Preisstabilität als wirtschaftspolitischem Ziel schlechthin. Das vorrangige Ziel der Wirtschaftspolitik muss schließlich die Steigerung des Wohlstandes sein, gefolgt von Vollbeschäftigung. Erst danach kommen Hilfsziele wie etwa die Preisstabilität. Niedrige Inflation ist so lange willkommen, wie sie Wachstum und Beschäftigung fördert und zur Stabilität des Wirtschafts- und Finanzsystems beiträgt.
Warum ist Deflation gefährlich? Warum lieber vier Prozent Inflation als ein Prozent Deflation? Weil Deflation ganz anders wirkt als Inflation mit negativem Vorzeichen. Erstens sind fallende Preise nichts anderes als eine Umverteilung von Schuldnern zu Gläubigern. Je höher die Deflation, desto werthaltiger werden die Schulden. Das provoziert Pleiten und Bankrotte. Denn die Deflation mindert den Gewinn der Unternehmen und macht so die Rückzahlung der Schulden schwierig.
Gleichzeitig leihen die Banken weniger aus, da sie Kreditausfälle befürchten. Mit diesem Verhalten aber provozieren sie erst recht Ausfälle. Diese wiederum reißen Löcher in die Bankbilanzen. Das gesamte Finanzsystem wird anfälliger, im Extremfall bricht es zusammen. Die Notenbank kann mit traditionellen Mitteln wie Zinssenkungen nichts ausrichten.
Zweitens sind sich die Wirtschaftsforscher einig, dass es nach unten unflexible Preise gibt, zum Beispiel Löhne. Zwei Prozent Lohnanstieg bei einer Inflationsrate von drei Prozent werden eher akzeptiert als eine Lohnkürzung von einem Prozent bei einer Inflationrate von null.
Drittens sind die Menschen auf Preissteigerungen programmiert, weil sie zu ihren Lebzeiten nichts anderes kennen gelernt haben. Das macht die Anpassung an länger fallende Preise sehr schwierig und führt zu Wachstumseinbußen.
Inflation dagegen lässt alle beschriebenen Probleme verschwinden. Das Finanzsystem lebt mit ein bisschen mehr Inflation sogar exzellent. Denn die Abwertung der Schulden macht deren Zurückzahlung wahrscheinlicher. Auch die Lebensversicherer können ihre Versprechen leichter halten, wenn die Inflation ansehnlich ist. Dann liegen die Zinsen der sicheren Staatsanleihen höher als die Garantiezinsen. Und selbst der Staat profitiert über die „kalte Progression“ des Steuersystems von höherer Inflation. Seine Einnahmen steigen.
Deshalb muss die richtige Frage lauten: Was ist die optimale Rate der Inflation? Theoretisch ist das ganz rasch berechnet: Es ist die Inflationsrate, bei der Vollbeschäftigung herrscht.
Praktisch gestaltet sich die Suche schwieriger. Irgendwo bei einer Inflationsrate zwischen fünf und zehn Prozent pro Jahr wird das Wachstum beeinträchtigt, haben empirische Studien ergeben. Von einer gewissen Inflationshöhe an können Unternehmer und Konsumenten die Preissignale nicht mehr exakt deuten. Handelt es sich um einen Preisanstieg, der auf größerer Nachfrage basiert oder schlicht auf Inflationsanpassung? Der Einsatz der Ressourcen erfolgt dann nicht mehr effizient.
Genauso vage ist es, die Grenze nach unten zu ziehen. Null Prozent sind eindeutig zu ambitioniert, weil ein Sicherheitsabstand zur Deflation gewahrt werden muss. Das hat selbst die EZB jüngst eingesehen und ihr Preisziel von „unter zwei Prozent“ auf „nahe zwei“ erhöht. Denn die große Unbekannte ist der Messfehler. Fast alle Studien, die sich dieser Frage widmeten, kommen zum Ergebnis, dass Preisindizes die wahre Inflation um 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte überzeichnen. „Nahe zwei Prozent“ klingt immer noch etwas eng bemessen.
Sei’s drum. Die Notenbanker haben erkannt, dass sie es mit der Inflationsbekämpfung übertrieben haben. Niemand muss sich vor drei oder vier Prozent Preissteigerung fürchten. Das ist die gute Nachricht.
.
.
"Die nächste Hausse ist meilenweit weg"
Weltweit steigen die Aktien. Ist das die Wende?
Oder nur ein kurzes Hoch?
Und vor allem: Was sollen Anleger jetzt tun?
Ein Streitgespräch
die zeit: Weltweit steigen die Aktien. Ist die Krise vorbei?
Rolf Elgeti: Ja. Zumindest die kräftige Abwertung der Aktie dürfte ihr Ende gefunden haben.
zeit: Warum?
Elgeti: Aktienkurse werden von zwei wesentlichen Einflüssen getrieben: Von der Entwicklung der Unternehmensgewinne und von der Bereitschaft der Investoren das 10-, 20- oder aber auch 40fache des Jahresgewinns zu zahlen. In den neunziger Jahren standen Aktien hoch im Kurs, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis schnellte auf über 30 empor. Auf diese Aufwertung folgte die drei Jahre andauernde Abwertung wegen der gestiegenen geopolitischen und makroökonomischen Risiken. Die kräftige Erholung seit Ende März hat die Phase der Abwertung beendet. Europäische Aktien sind wieder fair bewertet. Jetzt kommt es auf die Gewinnentwicklung an. Da könnten wir noch die eine oder andere Überraschung erleben. Danach kann es weiter bergauf gehen.
Michael Hartnett: Diese Prognose ist mir zu optimistisch. Ich schließe zwar nicht aus, dass die europäischen Aktien von heute aus weitere 25 Prozent gewinnen. Aber danach können sie sich genauso gut wieder halbieren. Das Einzige, was man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann: Es bildet sich gerade eine Spanne heraus, in der die großen Indizes die kommenden fünf, sechs Jahre schwanken werden. Das Schlimmste der Baisse ist vielleicht überstanden, aber die nächste Hausse ist noch meilenweit entfernt.
zeit: Warum so pessimistisch?
Hartnett: Der amerikanische Aktienmarkt ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30, basierend auf den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate, nach wie vor teuer. Hier steht die Abwertung noch aus. Ohne freundliche US-Märkte wird es aber auch in Europa zu keinem weiteren, kräftigen Kursanstieg kommen. Ohne Hausse zu keinem echten Konjunkturaufschwung, ohne Aufschwung aber bleiben auch die Überkapazitäten. Und die Unternehmen haben weiter mit fallenden Preisen auf den Produktmärkten zu kämpfen.
zeit: Das klingt nach Deflation…
Hartnett: Genau das ist meine Sorge. Ohne Aufschwung droht den USA und Europa Deflation, also fallende Preise, dazu Konsum- und Investitionszurückhaltung auf breiter Front, gepaart mit Nullwachstum bis hin zur Rezession.
Elgeti: Einverstanden, was die Einschätzung der USA angeht. Aber Europa steht in vielerlei Hinsicht deutlich besser da. Das große Thema lautet deshalb nicht Deflation, sondern: Kann sich die europäische Wirtschaft von der amerikanischen abkoppeln? Das passiert, wenn die amerikanischen Investoren keine europäischen Aktien mehr besitzen. Von diesem Zustand sind wir nicht mehr weit entfernt.
zeit: Wieso?
Elgeti: Seit zweieinhalb Jahren trennen sich die Amerikaner in signifikantem Umfang von europäischen Titeln. Lagen noch vor drei Jahren rund ein Drittel aller europäischen Aktien in amerikanischen Depots, sind es inzwischen weniger als zehn Prozent. Die Abkopplung kann glücken.
zeit: Und dann…
Elgeti: …müssen wir fragen: Gibt es Unternehmen, die auch in einem schwachen konjunkturellen Umfeld Gewinne machen? Dafür müssen zumindest einige Branchen wieder Preisfestsetzungsmacht zurückerlangen. Dann sind wir ganz rasch beim Übeltäter Nummer eins, China. Mit seiner total unterbewerteten Währung überschwemmt das Reich der Mitte die internationalen Gütermärkte und sorgt für deflationäre Tendenzen. Aber – und das ist mein Joker für das optimistische Szenario – China wird in den kommenden Jahren nicht umhinkönnen, seine Währung der Realität anzupassen. Damit können die Unternehmen aus den anderen Ländern ihre Preise erhöhen.
zeit: Warum sollte China das tun?
Elgeti: Weil China auch Importeur ist, und zwar von Rohstoffen. Bei einigen wie Nickel fragt China mehr als die Hälfte der weltweiten Jahresproduktion nach. Durch eine Aufwertung kommt das Land billiger an die Rohstoffe heran. Wertet der chinesische Yuan auf, ist die Deflationsgefahr verschwunden. Angesichts günstig bewerteter Aktien in Europa bleibe ich optimistisch.
Hartnett: Was heißt günstig? Auch in Europa ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch nicht einstellig. Optimismus ist nur gerechtfertigt, wenn ein anständiger Konjunkturaufschwung in Sicht wäre…
zeit: …und davon kann keine Rede sein…
Hartnett: Richtig. Die konjunkturelle Lage ist rezessiv und sehr anfällig. Ich halte eine Deflation in den kommenden drei Jahren für wahrscheinlich. Bricht die Wirtschaft weiter ein, sind auch europäische Aktien schon wieder zu teuer.
zeit: Warum reden Sie von Deflation, wo doch die Verbraucherpreise in Europa und Amerika noch steigen?
Hartnett: Ich schaue mir das Zusammenspiel von Anleihe- und Aktienmarkt an. Normalerweise bewegen sich die Kurse von Aktien und Bonds parallel. Heute dagegen fallen die Aktien und steigen die Anleihen und umgekehrt. Dieses Muster konnte man in den neunziger Jahren in Japan und in den dreißiger Jahren in den USA erkennen – beides deflationäre Phasen.
Elgeti: Auch bei der Deflationsgefahr gilt: Das Schlimmste ist vorüber. Es gab in einigen Bereichen der Wirtschaft Deflation, sei es wegen Überinvestitionen, Überkapazitäten oder zu lockerer Regulierung wie bei Versorgern und Telekomfirmen. Doch das ist Vergangenheit. In Deutschland zum Beispiel ist Strom inzwischen teurer als vor der Deregulierung der Monopole.
Hartnett: Das China-Argument hat mich mehr überzeugt. Wenn China seine Währung tatsächlich aufwertet, könnte das der Wendepunkt für das deflationäre Umfeld sein. Dennoch: Das makroökonomische Umfeld ist und bleibt sehr zerbrechlich. Richtig schlimm wird es, wenn es zu einer Schulden-Deflation kommt wie in Japan. Dann fallen die Aktienkurse noch weitere zehn Jahre, Banken brechen zusammen, und die Wirtschaft schrumpft mehrere Jahre hintereinander.
zeit: Gibt es einen Hoffnungsschimmer?
Hartnett: Nein. Es muss zu einem Stimmungsumschwung bei Unternehmen oder Verbrauchern kommen. Aber mir fehlt die Idee, wodurch es in Amerika, Deutschland, Frankreich plötzlich zu einem starken Wachstum kommen könnte.
Elgeti: Ich habe eine: durch den europäischen Verbraucher.
zeit: Warum?
Elgeti: Die Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren einfach zu viel gespart. Sie sind weder hoch verschuldet wie die Amerikaner, noch gibt es am Immobilienmarkt eine Blase wie früher in Japan.
Hartnett: Aber wie soll der Konsument aus der Reserve gelockt werden? Niedrigere Zinsen werden nichts ausrichten. Die Fiskalpolitik wird – selbst wenn sie wollte – mit Steuersenkungen wenig erreichen. Das wäre wie in Japan, wo die Menschen genau wissen, dass sie irgendwann für das höhere Staatsdefizit zahlen müssen, und deshalb weiter sparen. Der europäische Konsument wird die Wende nicht einleiten, die Welt nicht retten.
Elgeti: Es muss gelingen, die Rentner zum Geldausgeben zu motivieren. Sie haben in den vergangenen Jahren geknausert und sogar mehr gespart als die arbeitende Bevölkerung. Das ist ökonomischer Wahnsinn, so funktioniert das System nicht. Die Alten müssen entsparen. Diese Paradoxie verdeutlicht das Potenzial der europäischen Volkswirtschaft. Die Politik wird nicht umhinkönnen, über eine Rentenreform die Alten zum Entsparen zu zwingen.
Hartnett: Richtig, Europa hat dasselbe Problem wie Japan: Wie die Sparquote verringern? Die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden zehn Jahren in Deutschland, Italien, Frankreich, England und Spanien spricht eine klare Sprache: Die Zahl der Sparer wird dramatisch zunehmen und damit auch die Gefahr der Deflation. Die Gruppe der besten Konsumenten, der 20- bis 40-Jährigen, verliert 12 Millionen Menschen, während gleichzeitig die Gruppe der traditionellen Sparer, die 40- bis 60-Jährigen, 10 Millionen gewinnen. Deshalb haben Sie Recht, wenn Sie auf das Verhalten der Rentner abzielen. Die Gruppe der 60- bis 70-Jährigen wächst um 11 Millionen Menschen. Ich glaube aber nicht, dass sie entsparen werden. Und dazu zwingen wird sie die Politik auch kaum können. Denn der Einfluss der Alten wird immer größer.
Elgeti: Na ja. Wichtig ist doch zu erkennen, wie schnell sich etwas in Europa zum Besseren wenden kann. Die Stimmung der Verbraucher muss nur ein ganz klein wenig positiver werden, schon wächst die Wirtschaft wieder. So haben die deutschen Konsumenten im vergangenen Jahr ihre Ausgaben um sechs Prozent zurückgefahren. Das ist dramatisch, zeigt aber auch, wie rasch es in die andere Richtung gehen könnte. Dafür müssten sich nur die Aussichten am Arbeitsmarkt leicht bessern.
Hartnett: Ich stimme zu, Europa steht fundamental besser als Amerika da. Aber US-Politik und Notenbank haben die richtigen Entscheidungen getroffen, um die US-Wirtschaft vor einem zweiten Japan zu beschützen. In Europa ist es genau umgekehrt. Die Ausgangssituation ist deutlich weniger schlimm, aber Notenbank und Politik tun wenig dafür, das Japan-Szenario zu verhindern, und machen es so wahrscheinlicher. Warum ist der Dax sonst von seinem Hoch um 73 Prozent abgestürzt, deutlich mehr als jeder US-Aktienindex?
Elgeti: Das kann ich Ihnen genau erklären: Es gab massive Verkäufe vonseiten der Versicherer in einem weniger liquiden Markt. Doch wer verkauft heute noch europäische Aktien? Die Amerikaner haben fast alles verkauft, die Versicherer und Pensionsfonds sind entweder abgesichert oder besitzen keine mehr.
Hartnett: Das reicht nicht aus, dass die Kurse steigen. Es muss Käufer geben. Woher sollen die kommen?
Elgeti: Zum Beenden der Talfahrt genügt es, wenn die Verkäufer verschwinden. Für eine neue Hausse sind Käufer sicherlich wichtig. Denken Sie an die Defizite bei der privaten und betrieblichen Altersvorsorge in Kontinentaleuropa. Aus dieser Ecke werden erste Käufe kommen.
zeit: Was soll der Investor tun?
Hartnett: In einem deflationären Umfeld suchen die Investoren Rendite; im inflationären Umfeld dagegen Schulden. Bekommen wir japanische Verhältnisse, stehen Anleihen, die die höchsten Zinsen bieten, hoch im Kurs, also Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Bonds.
zeit: Aber steigt in der Deflation nicht das Risiko, dass Firmen Pleite gehen?
Hartnett: Ja, doch der Blick in die Geschichte zeigt, dass Unternehmensanleihen in der Deflation die Top-Performer sind. So konnte man mit dieser Vermögensklasse im Amerika der dreißiger Jahre eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 7 Prozent erzielen, gefolgt von Staatsanleihen mit 5 Prozent.
zeit: Und wenn Inflation das wahrscheinliche Szenario ist…
Hartnett: …dann sollten sich die Investoren auf die Jagd nach hoch verschuldeten Firmen und anderen Gewinnern in der Inflation machen. Ironischerweise laufen diese Titel ganz gut. Denn nichts feuert die Inflation mehr an als die Drohung einer unmittelbar bevorstehenden Deflation. Die Sorge vor Verhältnissen wie in den Dreißigern lässt Politiker und Notenbanker in Panik verfallen und Inflation produzieren. Deshalb ist mein bester Tipp: Auf Sicht von drei, vier Jahren droht Deflation, danach Inflation oder gar Stagflation, also kein Wachstum, aber steigende Preise.
zeit: Woher soll denn Inflation kommen?
Hartnett: Eher von steigenden Löhnen und teureren Dienstleistungen denn von den Produkten. Und natürlich vom Staatssektor…
Elgeti: …und den Rohstoffpreisen.
zeit: Und was empfehlen Sie, Herr Elgeti, Ihren Kunden?
Elgeti: Auch Unternehmensanleihen. Denn ob die Firmen je wieder profitabel werden, ist ungewisser, als dass sie ihre Schulden zurückzahlen. Außerdem ist das wieder eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das Angebot sinkt, weil immer mehr Firmen ihre Schulden zurückzahlen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage, weil die Lebensversicherer mit Staatsanleiherenditen von 4 Prozent nicht glücklich werden. Im Unterschied zu Ihnen halte ich auch billige zyklische Aktien für attraktiv, da ich eine konjunkturelle Erholung in Europa nicht kategorisch ausschließe.
zeit: An welche Branchen denken Sie?
Elgeti: Autos, Maschinenbau und Rohstoffe.
zeit: Wie kann Deflation bekämpft werden?
Hartnett: Bringen Sie den Dow Jones zurück auf 12000 Punkte! Kommt es zu einer deutlichen Rally am Aktienmarkt, wird niemand mehr über Deflation sprechen.
zeit: Scherz beiseite!
Hartnett: Es muss ein Mix aus Reflation bei Notenbank und Regierung sowie Restrukturierung bei den Unternehmen sein. Reflation heißt, alles zu tun, damit Deflation verhindert wird, wie niedrige Notenbankzinsen, gepaart mit hohen Staatsausgaben.
zeit: Gibt es dafür Anzeichen?
Hartnett: In den USA schon, weniger dagegen in Europa. Aber es gibt auch einen großen kulturellen Unterschied zwischen Europa und Amerika: Das schlimmste Wirtschaftserlebnis der USA war die Depression in den dreißiger Jahren – und die war klar deflationistisch. Für Europa, vor allem aber Deutschland war es die Hyperinflation. Das muss man wissen, um zu verstehen, dass die Wähler und Politiker in Amerika alles tun werden, um Deflation zu verhindern, und in Europa alles, um Inflation im Zaum zu halten.
zeit: Würde mehr Inflation in Europa helfen?
Hartnett: Ganz sicher. Banken, verschuldete Unternehmen und der Aktienmarkt würden profitieren.
zeit: Was muss sich ändern, damit Herr Elgeti pessimistischer und Herr Hartnett optimistischer wird?
Hartnett: Wenn der Ölpreis nach unten rasselt, unter 15 Dollar pro Barrel, dann werde ich ein Aktien-Bulle.
Elgeti: Meine größte Sorge gilt dem Dollar. Wenn es zum Dollar-Crash kommt, gilt fast nichts von dem, was ich gesagt habe.
Rolf Elgeti ist leitender Europa-Stratege der Commerzbank Securities in London
Michael Hartnett ist bei Merrill Lynch Director der Pan-European Equity Strategy. Er ist damit für die Koordinierung der europäischen Anlagestrategie verantwortlich
Das Gespräch moderierten Robert von Heusinger und John F. Jungclaussen
DIE ZEIT 21 / 2003
.
"Die nächste Hausse ist meilenweit weg"
Weltweit steigen die Aktien. Ist das die Wende?
Oder nur ein kurzes Hoch?
Und vor allem: Was sollen Anleger jetzt tun?
Ein Streitgespräch
die zeit: Weltweit steigen die Aktien. Ist die Krise vorbei?
Rolf Elgeti: Ja. Zumindest die kräftige Abwertung der Aktie dürfte ihr Ende gefunden haben.
zeit: Warum?
Elgeti: Aktienkurse werden von zwei wesentlichen Einflüssen getrieben: Von der Entwicklung der Unternehmensgewinne und von der Bereitschaft der Investoren das 10-, 20- oder aber auch 40fache des Jahresgewinns zu zahlen. In den neunziger Jahren standen Aktien hoch im Kurs, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis schnellte auf über 30 empor. Auf diese Aufwertung folgte die drei Jahre andauernde Abwertung wegen der gestiegenen geopolitischen und makroökonomischen Risiken. Die kräftige Erholung seit Ende März hat die Phase der Abwertung beendet. Europäische Aktien sind wieder fair bewertet. Jetzt kommt es auf die Gewinnentwicklung an. Da könnten wir noch die eine oder andere Überraschung erleben. Danach kann es weiter bergauf gehen.
Michael Hartnett: Diese Prognose ist mir zu optimistisch. Ich schließe zwar nicht aus, dass die europäischen Aktien von heute aus weitere 25 Prozent gewinnen. Aber danach können sie sich genauso gut wieder halbieren. Das Einzige, was man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann: Es bildet sich gerade eine Spanne heraus, in der die großen Indizes die kommenden fünf, sechs Jahre schwanken werden. Das Schlimmste der Baisse ist vielleicht überstanden, aber die nächste Hausse ist noch meilenweit entfernt.
zeit: Warum so pessimistisch?
Hartnett: Der amerikanische Aktienmarkt ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30, basierend auf den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate, nach wie vor teuer. Hier steht die Abwertung noch aus. Ohne freundliche US-Märkte wird es aber auch in Europa zu keinem weiteren, kräftigen Kursanstieg kommen. Ohne Hausse zu keinem echten Konjunkturaufschwung, ohne Aufschwung aber bleiben auch die Überkapazitäten. Und die Unternehmen haben weiter mit fallenden Preisen auf den Produktmärkten zu kämpfen.
zeit: Das klingt nach Deflation…
Hartnett: Genau das ist meine Sorge. Ohne Aufschwung droht den USA und Europa Deflation, also fallende Preise, dazu Konsum- und Investitionszurückhaltung auf breiter Front, gepaart mit Nullwachstum bis hin zur Rezession.
Elgeti: Einverstanden, was die Einschätzung der USA angeht. Aber Europa steht in vielerlei Hinsicht deutlich besser da. Das große Thema lautet deshalb nicht Deflation, sondern: Kann sich die europäische Wirtschaft von der amerikanischen abkoppeln? Das passiert, wenn die amerikanischen Investoren keine europäischen Aktien mehr besitzen. Von diesem Zustand sind wir nicht mehr weit entfernt.
zeit: Wieso?
Elgeti: Seit zweieinhalb Jahren trennen sich die Amerikaner in signifikantem Umfang von europäischen Titeln. Lagen noch vor drei Jahren rund ein Drittel aller europäischen Aktien in amerikanischen Depots, sind es inzwischen weniger als zehn Prozent. Die Abkopplung kann glücken.
zeit: Und dann…
Elgeti: …müssen wir fragen: Gibt es Unternehmen, die auch in einem schwachen konjunkturellen Umfeld Gewinne machen? Dafür müssen zumindest einige Branchen wieder Preisfestsetzungsmacht zurückerlangen. Dann sind wir ganz rasch beim Übeltäter Nummer eins, China. Mit seiner total unterbewerteten Währung überschwemmt das Reich der Mitte die internationalen Gütermärkte und sorgt für deflationäre Tendenzen. Aber – und das ist mein Joker für das optimistische Szenario – China wird in den kommenden Jahren nicht umhinkönnen, seine Währung der Realität anzupassen. Damit können die Unternehmen aus den anderen Ländern ihre Preise erhöhen.
zeit: Warum sollte China das tun?
Elgeti: Weil China auch Importeur ist, und zwar von Rohstoffen. Bei einigen wie Nickel fragt China mehr als die Hälfte der weltweiten Jahresproduktion nach. Durch eine Aufwertung kommt das Land billiger an die Rohstoffe heran. Wertet der chinesische Yuan auf, ist die Deflationsgefahr verschwunden. Angesichts günstig bewerteter Aktien in Europa bleibe ich optimistisch.
Hartnett: Was heißt günstig? Auch in Europa ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch nicht einstellig. Optimismus ist nur gerechtfertigt, wenn ein anständiger Konjunkturaufschwung in Sicht wäre…
zeit: …und davon kann keine Rede sein…
Hartnett: Richtig. Die konjunkturelle Lage ist rezessiv und sehr anfällig. Ich halte eine Deflation in den kommenden drei Jahren für wahrscheinlich. Bricht die Wirtschaft weiter ein, sind auch europäische Aktien schon wieder zu teuer.
zeit: Warum reden Sie von Deflation, wo doch die Verbraucherpreise in Europa und Amerika noch steigen?
Hartnett: Ich schaue mir das Zusammenspiel von Anleihe- und Aktienmarkt an. Normalerweise bewegen sich die Kurse von Aktien und Bonds parallel. Heute dagegen fallen die Aktien und steigen die Anleihen und umgekehrt. Dieses Muster konnte man in den neunziger Jahren in Japan und in den dreißiger Jahren in den USA erkennen – beides deflationäre Phasen.
Elgeti: Auch bei der Deflationsgefahr gilt: Das Schlimmste ist vorüber. Es gab in einigen Bereichen der Wirtschaft Deflation, sei es wegen Überinvestitionen, Überkapazitäten oder zu lockerer Regulierung wie bei Versorgern und Telekomfirmen. Doch das ist Vergangenheit. In Deutschland zum Beispiel ist Strom inzwischen teurer als vor der Deregulierung der Monopole.
Hartnett: Das China-Argument hat mich mehr überzeugt. Wenn China seine Währung tatsächlich aufwertet, könnte das der Wendepunkt für das deflationäre Umfeld sein. Dennoch: Das makroökonomische Umfeld ist und bleibt sehr zerbrechlich. Richtig schlimm wird es, wenn es zu einer Schulden-Deflation kommt wie in Japan. Dann fallen die Aktienkurse noch weitere zehn Jahre, Banken brechen zusammen, und die Wirtschaft schrumpft mehrere Jahre hintereinander.
zeit: Gibt es einen Hoffnungsschimmer?
Hartnett: Nein. Es muss zu einem Stimmungsumschwung bei Unternehmen oder Verbrauchern kommen. Aber mir fehlt die Idee, wodurch es in Amerika, Deutschland, Frankreich plötzlich zu einem starken Wachstum kommen könnte.
Elgeti: Ich habe eine: durch den europäischen Verbraucher.
zeit: Warum?
Elgeti: Die Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren einfach zu viel gespart. Sie sind weder hoch verschuldet wie die Amerikaner, noch gibt es am Immobilienmarkt eine Blase wie früher in Japan.
Hartnett: Aber wie soll der Konsument aus der Reserve gelockt werden? Niedrigere Zinsen werden nichts ausrichten. Die Fiskalpolitik wird – selbst wenn sie wollte – mit Steuersenkungen wenig erreichen. Das wäre wie in Japan, wo die Menschen genau wissen, dass sie irgendwann für das höhere Staatsdefizit zahlen müssen, und deshalb weiter sparen. Der europäische Konsument wird die Wende nicht einleiten, die Welt nicht retten.
Elgeti: Es muss gelingen, die Rentner zum Geldausgeben zu motivieren. Sie haben in den vergangenen Jahren geknausert und sogar mehr gespart als die arbeitende Bevölkerung. Das ist ökonomischer Wahnsinn, so funktioniert das System nicht. Die Alten müssen entsparen. Diese Paradoxie verdeutlicht das Potenzial der europäischen Volkswirtschaft. Die Politik wird nicht umhinkönnen, über eine Rentenreform die Alten zum Entsparen zu zwingen.
Hartnett: Richtig, Europa hat dasselbe Problem wie Japan: Wie die Sparquote verringern? Die Bevölkerungsentwicklung in den kommenden zehn Jahren in Deutschland, Italien, Frankreich, England und Spanien spricht eine klare Sprache: Die Zahl der Sparer wird dramatisch zunehmen und damit auch die Gefahr der Deflation. Die Gruppe der besten Konsumenten, der 20- bis 40-Jährigen, verliert 12 Millionen Menschen, während gleichzeitig die Gruppe der traditionellen Sparer, die 40- bis 60-Jährigen, 10 Millionen gewinnen. Deshalb haben Sie Recht, wenn Sie auf das Verhalten der Rentner abzielen. Die Gruppe der 60- bis 70-Jährigen wächst um 11 Millionen Menschen. Ich glaube aber nicht, dass sie entsparen werden. Und dazu zwingen wird sie die Politik auch kaum können. Denn der Einfluss der Alten wird immer größer.
Elgeti: Na ja. Wichtig ist doch zu erkennen, wie schnell sich etwas in Europa zum Besseren wenden kann. Die Stimmung der Verbraucher muss nur ein ganz klein wenig positiver werden, schon wächst die Wirtschaft wieder. So haben die deutschen Konsumenten im vergangenen Jahr ihre Ausgaben um sechs Prozent zurückgefahren. Das ist dramatisch, zeigt aber auch, wie rasch es in die andere Richtung gehen könnte. Dafür müssten sich nur die Aussichten am Arbeitsmarkt leicht bessern.
Hartnett: Ich stimme zu, Europa steht fundamental besser als Amerika da. Aber US-Politik und Notenbank haben die richtigen Entscheidungen getroffen, um die US-Wirtschaft vor einem zweiten Japan zu beschützen. In Europa ist es genau umgekehrt. Die Ausgangssituation ist deutlich weniger schlimm, aber Notenbank und Politik tun wenig dafür, das Japan-Szenario zu verhindern, und machen es so wahrscheinlicher. Warum ist der Dax sonst von seinem Hoch um 73 Prozent abgestürzt, deutlich mehr als jeder US-Aktienindex?
Elgeti: Das kann ich Ihnen genau erklären: Es gab massive Verkäufe vonseiten der Versicherer in einem weniger liquiden Markt. Doch wer verkauft heute noch europäische Aktien? Die Amerikaner haben fast alles verkauft, die Versicherer und Pensionsfonds sind entweder abgesichert oder besitzen keine mehr.
Hartnett: Das reicht nicht aus, dass die Kurse steigen. Es muss Käufer geben. Woher sollen die kommen?
Elgeti: Zum Beenden der Talfahrt genügt es, wenn die Verkäufer verschwinden. Für eine neue Hausse sind Käufer sicherlich wichtig. Denken Sie an die Defizite bei der privaten und betrieblichen Altersvorsorge in Kontinentaleuropa. Aus dieser Ecke werden erste Käufe kommen.
zeit: Was soll der Investor tun?
Hartnett: In einem deflationären Umfeld suchen die Investoren Rendite; im inflationären Umfeld dagegen Schulden. Bekommen wir japanische Verhältnisse, stehen Anleihen, die die höchsten Zinsen bieten, hoch im Kurs, also Unternehmensanleihen und Emerging-Markets-Bonds.
zeit: Aber steigt in der Deflation nicht das Risiko, dass Firmen Pleite gehen?
Hartnett: Ja, doch der Blick in die Geschichte zeigt, dass Unternehmensanleihen in der Deflation die Top-Performer sind. So konnte man mit dieser Vermögensklasse im Amerika der dreißiger Jahre eine durchschnittliche Jahresrendite von rund 7 Prozent erzielen, gefolgt von Staatsanleihen mit 5 Prozent.
zeit: Und wenn Inflation das wahrscheinliche Szenario ist…
Hartnett: …dann sollten sich die Investoren auf die Jagd nach hoch verschuldeten Firmen und anderen Gewinnern in der Inflation machen. Ironischerweise laufen diese Titel ganz gut. Denn nichts feuert die Inflation mehr an als die Drohung einer unmittelbar bevorstehenden Deflation. Die Sorge vor Verhältnissen wie in den Dreißigern lässt Politiker und Notenbanker in Panik verfallen und Inflation produzieren. Deshalb ist mein bester Tipp: Auf Sicht von drei, vier Jahren droht Deflation, danach Inflation oder gar Stagflation, also kein Wachstum, aber steigende Preise.
zeit: Woher soll denn Inflation kommen?
Hartnett: Eher von steigenden Löhnen und teureren Dienstleistungen denn von den Produkten. Und natürlich vom Staatssektor…
Elgeti: …und den Rohstoffpreisen.
zeit: Und was empfehlen Sie, Herr Elgeti, Ihren Kunden?
Elgeti: Auch Unternehmensanleihen. Denn ob die Firmen je wieder profitabel werden, ist ungewisser, als dass sie ihre Schulden zurückzahlen. Außerdem ist das wieder eine Frage von Angebot und Nachfrage. Das Angebot sinkt, weil immer mehr Firmen ihre Schulden zurückzahlen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage, weil die Lebensversicherer mit Staatsanleiherenditen von 4 Prozent nicht glücklich werden. Im Unterschied zu Ihnen halte ich auch billige zyklische Aktien für attraktiv, da ich eine konjunkturelle Erholung in Europa nicht kategorisch ausschließe.
zeit: An welche Branchen denken Sie?
Elgeti: Autos, Maschinenbau und Rohstoffe.
zeit: Wie kann Deflation bekämpft werden?
Hartnett: Bringen Sie den Dow Jones zurück auf 12000 Punkte! Kommt es zu einer deutlichen Rally am Aktienmarkt, wird niemand mehr über Deflation sprechen.
zeit: Scherz beiseite!
Hartnett: Es muss ein Mix aus Reflation bei Notenbank und Regierung sowie Restrukturierung bei den Unternehmen sein. Reflation heißt, alles zu tun, damit Deflation verhindert wird, wie niedrige Notenbankzinsen, gepaart mit hohen Staatsausgaben.
zeit: Gibt es dafür Anzeichen?
Hartnett: In den USA schon, weniger dagegen in Europa. Aber es gibt auch einen großen kulturellen Unterschied zwischen Europa und Amerika: Das schlimmste Wirtschaftserlebnis der USA war die Depression in den dreißiger Jahren – und die war klar deflationistisch. Für Europa, vor allem aber Deutschland war es die Hyperinflation. Das muss man wissen, um zu verstehen, dass die Wähler und Politiker in Amerika alles tun werden, um Deflation zu verhindern, und in Europa alles, um Inflation im Zaum zu halten.
zeit: Würde mehr Inflation in Europa helfen?
Hartnett: Ganz sicher. Banken, verschuldete Unternehmen und der Aktienmarkt würden profitieren.
zeit: Was muss sich ändern, damit Herr Elgeti pessimistischer und Herr Hartnett optimistischer wird?
Hartnett: Wenn der Ölpreis nach unten rasselt, unter 15 Dollar pro Barrel, dann werde ich ein Aktien-Bulle.
Elgeti: Meine größte Sorge gilt dem Dollar. Wenn es zum Dollar-Crash kommt, gilt fast nichts von dem, was ich gesagt habe.
Rolf Elgeti ist leitender Europa-Stratege der Commerzbank Securities in London
Michael Hartnett ist bei Merrill Lynch Director der Pan-European Equity Strategy. Er ist damit für die Koordinierung der europäischen Anlagestrategie verantwortlich
Das Gespräch moderierten Robert von Heusinger und John F. Jungclaussen
DIE ZEIT 21 / 2003
.
.
Auf die japanische Art
Unternehmensgewinn? Gutes Produkt? Günstige Prognose?
In der Deflation zählen beim Aktienkauf ganz andere Dinge
Von Thomas Hammer
Deflation ist Gift für Aktien. Das haben die dreißiger Jahre bewiesen, und Japan zeigt es noch immer. Sollen Anleger deshalb im Falle einer Deflation lieber ganz die Finger von Aktien lassen? Nicht unbedingt: So zeigt das Beispiel Japan auch, dass sich selbst in einer lang anhaltenden Deflation mit Aktien Gewinne erzielen lassen – auch wenn sich der japanische Aktienindex von einem Zwanzigjahrestief zum nächsten hangelt.
Trotz des negativen Börsenumfelds konnten nämlich einige Titel kräftig zulegen. Eine Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley liefert den Beweis: Die beste japanische Aktie konnte von 1990 bis 2002 einen Kurszuwachs von 528 Prozent verbuchen, während der breite japanische Aktienindex Topix um 70 Prozent fiel. Selbst der auf dem 20.Rang in der Rendite-Hitliste platzierte Titel konnte immerhin noch 80 Prozent Wertsteigerung vorweisen.
Warum einzelne Unternehmen in der Deflation gewinnen und andere verlieren, wird über die Auswirkungen sinkender Preise für die Wirtschaft verständlich. Auf der Nachfrageseite ist zu beobachten, dass angesichts immer günstiger werdender Angebote Verbraucher und Unternehmen größere Anschaffungen und Investitionen lieber hinauszögern.
„Betroffen wären dann vor allem die Gebrauchs- und Investitionsgütersektoren wie etwa die Bau- oder Automobilindustrie“, sagt Roland Ziegler, Aktienstratege bei der ING BHF Bank. Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen: So konnte sich der japanische Autohersteller Toyota trotz Deflation gut behaupten. Dafür gibt es zwei Gründe. In der Branche gilt Toyota als sehr kostengünstiger und profitabler Hersteller, der sinkende Preise besser verkraften kann als die Konkurrenz. Dazu kommt, dass der schwache Yen einen regelrechten Turbolader für das Exportgeschäft des Konzerns darstellte. Als klassische Deflationsgewinner gelten hingegen Titel aus wenig konjunkturempfindlichen Branchen wie Versorger- oder Pharmawerte.
Doch es kommt nicht nur auf die Branche, sondern auch auf das einzelne Unternehmen an, vor allem auf seine Verschuldungssituation. Denn in der Deflation gilt der Grundsatz, dass Geldbesitzer gewinnen und Schuldner auf der Verliererseite stehen. Der Grund: Durch Preisverfall werden Bargeld und Guthaben wertvoller – aber auch der Wert der Schulden nimmt zu. Zwar sparen verschuldete Unternehmen kurzfristig Geld durch niedrigere Zinsen. Aber wenn die Gewinne unter Druck geraten und die als Kreditsicherheit dienenden Immobilien- und Sachwerte dem Preisverfall ausgesetzt sind, droht schnell der Abstieg in die zweite Schuldnerliga.
In diesem Mechanismus liegt auch die Gefahr für Banken und Versicherungen in Phasen der Deflation. So können Geldinstitute unter Druck kommen, wenn grundschuld- und aktiengesicherte Kredite faul werden und die Sicherheiten nicht mehr für die Deckung des Ausfalls ausreichen. Die Versicherer wiederum sitzen in der Renditefalle: Weil sie ihre Leistungszusagen einhalten müssen, aber die mageren Zinseinnahmen oft nicht einmal den Wertverfall des Aktien- und Immobilienportfolios ausgleichen, schwindet die finanzielle Substanz wie Butter in der Sonne. Die Probleme der japanischen und mittlerweile auch einiger schweizerischer und deutscher Assekuranzen liefern das Praxisbeispiel zur Theorie.
Vorteil für Finanzwerte
Gleichwohl warnen Experten davor, das japanische Beispiel als Prototypen für die Aktienentwicklung in der Deflation zu betrachten. „Japan ist eher ein Sonderfall, weil dort die Probleme der Deflation durch finanzpolitische Fehlentscheidungen verstärkt wurden“, betont Burkhard Varnholt, leitender Investmentstratege bei Credit Suisse Private Banking. So reagierte die japanische Notenbank viel zu spät mit Zinssenkungen auf den konjunkturellen Einbruch, sodass sich nun trotz Nullzins die Deflation wie ein hartnäckiges Virus einnisten konnte.
Zu den weiteren japanspezifischen Problemen zählen das Ausmaß der Spekulationsblase am Immobilienmarkt und die Tatsache, dass die großen Banken ihre Probleme im Kreditgeschäft über Jahre vertuscht haben. Selbst wenn in Europa eine Deflation kommen sollte, würden Banken- und Versicherungsaktien zwar stark darunter leiden, jedoch nicht in dem dramatischen Ausmaß wie in Japan.
Eine lockere Zinspolitik der Notenbanken, oft noch in Verbindung mit staatlichen Ausgabeprogrammen zur Ankurbelung der Konjunktur, kann eine Deflation stoppen und in die so genannte Reflation umkehren. Über die Belebung der Nachfrage zieht die Wirtschaft wieder an, der Preisverfall wird beendet, und es entsteht eine neue Inflation.
Selbst eine milde Inflation könnte den Aktienmarkt in Gewinner und Verlierer spalten. In diesem Fall würde sich das Interesse der Anleger wieder vom Geldwert auf den Sachwert verlagern, und hohe Cash-Bestände in Unternehmensbilanzen verlieren als Qualitätskriterium an Bedeutung. So sieht Roland Ziegler unter anderem sachwertorientierte Unternehmen als Reflationsgewinner: „Ein Unternehmen mit großem Immobilienbestand könnte dann interessant werden.“ Denn: In der Reflation ziehen meist auch die Immobilienpreise wieder an – dieser Fakt würde auch so mancher Bank- und Versicherungsaktie auf die Beine helfen.
Die Kombination aus Wirtschaftsaufschwung und Inflation dürfte auch die Unternehmen aus zyklischen Branchen wieder nach oben bringen. Unter diesem Oberbegriff fassen Wirtschaftswissenschaftler die Branchen zusammen, deren Erfolg sehr stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig ist und die sich praktisch parallel zum Konjunkturzyklus entwickeln. „Damit können beispielsweise Fluggesellschaften oder die Grundstoffindustrie zu den Profiteuren zählen“, sagt Varnholt. Auch Technologiebranchen wie die Halbleiter- oder Computerindustrie werden in diesem Szenario oft als interessante Investmentziele genannt.
Favoriten werden langweilig
Aber selbst wenn es mit der Wirtschaft aufwärts geht, kann es durchaus Verlierer geben. Die Neuorientierung der Anleger ist im Aufschwung mit einer Abkehr von defensiven Aktien und einer Zuwendung zu risikoreicheren Titeln verbunden. Die Folge: In den defensiven Segmenten des Aktienmarktes ist das Verkaufsangebot größer als die Nachfrage – und das kann trotz Aufschwung die Kurse zum Sinken bringen. Krisensichere Investments wie Aktien der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie könnten dann zu den Verlierern gehören.
Ein weiteres denkbares Szenario liegt darin, dass die Inflation infolge drastisch gelockerter Geldpolitik zu galoppieren beginnt und auf einen Wert von fünf Prozent oder mehr steigt. Zumindest theoretisch könnte eine zügellose Geldpolitik den Konsum und damit die Konjunktur so stark anheizen, dass die Preise schnell und auf breiter Front steigen. Gewinner und Verlierer würden sich bei einer starken Inflation ähnlich gruppieren wie bei der milden Variante – mit einem Unterschied: Defensive Aktien mit wenig Gewinnsteigerungspotenzial brechen stärker ein, weil die mit der Inflation einhergehenden steigenden Zinsen zusätzlich für niedrigere Bewertungen am Aktienmarkt sorgen.
Welchen Weg die Weltwirtschaft und damit auch der globale Aktienmarkt einschlägt, ist momentan nur schwer abschätzbar. Zwar hofft ein großer Teil der Analysten auf eine freundliche und moderate Reflation, aber weder das Gespenst der Deflation noch die Risiken einer außer Kontrolle geratenden Inflation sind gänzlich vertrieben. Aktienstratege Matthias Joerss vom Bankhaus Sal. Oppenheim rät daher den Anlegern, die Entwicklung genau zu beobachten und ihre Strategie schrittweise anzupassen, und meint: „Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich eine Wette auf eines der beiden Extremszenarien für zu riskant.“
.
Auf die japanische Art
Unternehmensgewinn? Gutes Produkt? Günstige Prognose?
In der Deflation zählen beim Aktienkauf ganz andere Dinge
Von Thomas Hammer
Deflation ist Gift für Aktien. Das haben die dreißiger Jahre bewiesen, und Japan zeigt es noch immer. Sollen Anleger deshalb im Falle einer Deflation lieber ganz die Finger von Aktien lassen? Nicht unbedingt: So zeigt das Beispiel Japan auch, dass sich selbst in einer lang anhaltenden Deflation mit Aktien Gewinne erzielen lassen – auch wenn sich der japanische Aktienindex von einem Zwanzigjahrestief zum nächsten hangelt.
Trotz des negativen Börsenumfelds konnten nämlich einige Titel kräftig zulegen. Eine Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley liefert den Beweis: Die beste japanische Aktie konnte von 1990 bis 2002 einen Kurszuwachs von 528 Prozent verbuchen, während der breite japanische Aktienindex Topix um 70 Prozent fiel. Selbst der auf dem 20.Rang in der Rendite-Hitliste platzierte Titel konnte immerhin noch 80 Prozent Wertsteigerung vorweisen.
Warum einzelne Unternehmen in der Deflation gewinnen und andere verlieren, wird über die Auswirkungen sinkender Preise für die Wirtschaft verständlich. Auf der Nachfrageseite ist zu beobachten, dass angesichts immer günstiger werdender Angebote Verbraucher und Unternehmen größere Anschaffungen und Investitionen lieber hinauszögern.
„Betroffen wären dann vor allem die Gebrauchs- und Investitionsgütersektoren wie etwa die Bau- oder Automobilindustrie“, sagt Roland Ziegler, Aktienstratege bei der ING BHF Bank. Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen: So konnte sich der japanische Autohersteller Toyota trotz Deflation gut behaupten. Dafür gibt es zwei Gründe. In der Branche gilt Toyota als sehr kostengünstiger und profitabler Hersteller, der sinkende Preise besser verkraften kann als die Konkurrenz. Dazu kommt, dass der schwache Yen einen regelrechten Turbolader für das Exportgeschäft des Konzerns darstellte. Als klassische Deflationsgewinner gelten hingegen Titel aus wenig konjunkturempfindlichen Branchen wie Versorger- oder Pharmawerte.
Doch es kommt nicht nur auf die Branche, sondern auch auf das einzelne Unternehmen an, vor allem auf seine Verschuldungssituation. Denn in der Deflation gilt der Grundsatz, dass Geldbesitzer gewinnen und Schuldner auf der Verliererseite stehen. Der Grund: Durch Preisverfall werden Bargeld und Guthaben wertvoller – aber auch der Wert der Schulden nimmt zu. Zwar sparen verschuldete Unternehmen kurzfristig Geld durch niedrigere Zinsen. Aber wenn die Gewinne unter Druck geraten und die als Kreditsicherheit dienenden Immobilien- und Sachwerte dem Preisverfall ausgesetzt sind, droht schnell der Abstieg in die zweite Schuldnerliga.
In diesem Mechanismus liegt auch die Gefahr für Banken und Versicherungen in Phasen der Deflation. So können Geldinstitute unter Druck kommen, wenn grundschuld- und aktiengesicherte Kredite faul werden und die Sicherheiten nicht mehr für die Deckung des Ausfalls ausreichen. Die Versicherer wiederum sitzen in der Renditefalle: Weil sie ihre Leistungszusagen einhalten müssen, aber die mageren Zinseinnahmen oft nicht einmal den Wertverfall des Aktien- und Immobilienportfolios ausgleichen, schwindet die finanzielle Substanz wie Butter in der Sonne. Die Probleme der japanischen und mittlerweile auch einiger schweizerischer und deutscher Assekuranzen liefern das Praxisbeispiel zur Theorie.
Vorteil für Finanzwerte
Gleichwohl warnen Experten davor, das japanische Beispiel als Prototypen für die Aktienentwicklung in der Deflation zu betrachten. „Japan ist eher ein Sonderfall, weil dort die Probleme der Deflation durch finanzpolitische Fehlentscheidungen verstärkt wurden“, betont Burkhard Varnholt, leitender Investmentstratege bei Credit Suisse Private Banking. So reagierte die japanische Notenbank viel zu spät mit Zinssenkungen auf den konjunkturellen Einbruch, sodass sich nun trotz Nullzins die Deflation wie ein hartnäckiges Virus einnisten konnte.
Zu den weiteren japanspezifischen Problemen zählen das Ausmaß der Spekulationsblase am Immobilienmarkt und die Tatsache, dass die großen Banken ihre Probleme im Kreditgeschäft über Jahre vertuscht haben. Selbst wenn in Europa eine Deflation kommen sollte, würden Banken- und Versicherungsaktien zwar stark darunter leiden, jedoch nicht in dem dramatischen Ausmaß wie in Japan.
Eine lockere Zinspolitik der Notenbanken, oft noch in Verbindung mit staatlichen Ausgabeprogrammen zur Ankurbelung der Konjunktur, kann eine Deflation stoppen und in die so genannte Reflation umkehren. Über die Belebung der Nachfrage zieht die Wirtschaft wieder an, der Preisverfall wird beendet, und es entsteht eine neue Inflation.
Selbst eine milde Inflation könnte den Aktienmarkt in Gewinner und Verlierer spalten. In diesem Fall würde sich das Interesse der Anleger wieder vom Geldwert auf den Sachwert verlagern, und hohe Cash-Bestände in Unternehmensbilanzen verlieren als Qualitätskriterium an Bedeutung. So sieht Roland Ziegler unter anderem sachwertorientierte Unternehmen als Reflationsgewinner: „Ein Unternehmen mit großem Immobilienbestand könnte dann interessant werden.“ Denn: In der Reflation ziehen meist auch die Immobilienpreise wieder an – dieser Fakt würde auch so mancher Bank- und Versicherungsaktie auf die Beine helfen.
Die Kombination aus Wirtschaftsaufschwung und Inflation dürfte auch die Unternehmen aus zyklischen Branchen wieder nach oben bringen. Unter diesem Oberbegriff fassen Wirtschaftswissenschaftler die Branchen zusammen, deren Erfolg sehr stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig ist und die sich praktisch parallel zum Konjunkturzyklus entwickeln. „Damit können beispielsweise Fluggesellschaften oder die Grundstoffindustrie zu den Profiteuren zählen“, sagt Varnholt. Auch Technologiebranchen wie die Halbleiter- oder Computerindustrie werden in diesem Szenario oft als interessante Investmentziele genannt.
Favoriten werden langweilig
Aber selbst wenn es mit der Wirtschaft aufwärts geht, kann es durchaus Verlierer geben. Die Neuorientierung der Anleger ist im Aufschwung mit einer Abkehr von defensiven Aktien und einer Zuwendung zu risikoreicheren Titeln verbunden. Die Folge: In den defensiven Segmenten des Aktienmarktes ist das Verkaufsangebot größer als die Nachfrage – und das kann trotz Aufschwung die Kurse zum Sinken bringen. Krisensichere Investments wie Aktien der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie könnten dann zu den Verlierern gehören.
Ein weiteres denkbares Szenario liegt darin, dass die Inflation infolge drastisch gelockerter Geldpolitik zu galoppieren beginnt und auf einen Wert von fünf Prozent oder mehr steigt. Zumindest theoretisch könnte eine zügellose Geldpolitik den Konsum und damit die Konjunktur so stark anheizen, dass die Preise schnell und auf breiter Front steigen. Gewinner und Verlierer würden sich bei einer starken Inflation ähnlich gruppieren wie bei der milden Variante – mit einem Unterschied: Defensive Aktien mit wenig Gewinnsteigerungspotenzial brechen stärker ein, weil die mit der Inflation einhergehenden steigenden Zinsen zusätzlich für niedrigere Bewertungen am Aktienmarkt sorgen.
Welchen Weg die Weltwirtschaft und damit auch der globale Aktienmarkt einschlägt, ist momentan nur schwer abschätzbar. Zwar hofft ein großer Teil der Analysten auf eine freundliche und moderate Reflation, aber weder das Gespenst der Deflation noch die Risiken einer außer Kontrolle geratenden Inflation sind gänzlich vertrieben. Aktienstratege Matthias Joerss vom Bankhaus Sal. Oppenheim rät daher den Anlegern, die Entwicklung genau zu beobachten und ihre Strategie schrittweise anzupassen, und meint: „Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich eine Wette auf eines der beiden Extremszenarien für zu riskant.“
.
.
Hätten wir nur auf Opa gehört
Der Goldpreis steigt und steigt. Das Edelmetall ist ein krisenfestes Investment
– aber wehe, die Krise endet
Von Klaus Spanke
Welch eine Enttäuschung: Keine Carrera-Bahn, kein Zauberwürfel. Noch nicht einmal Geld. Nein, zur Heiligen Kommunion gab’s vor zwanzig Jahren eine olle Goldmünze vom Opa. Und als sei das noch nicht Strafe genug, erzählte er, nachdem man sich artig bedankt hatte, obendrein noch eine langweilige Geschichte. Davon, dass früher während der großen Inflation nur auf Gold Verlass gewesen sei.
Zwanzig Jahre und einen Börsenkrach später erkennen viele Anleger, was der Großvater immer schon gewusst hat: Gold ist in schweren Zeiten ein sicherer Hafen fürs eigene Vermögen. Seit Menschengedenken gilt Gold in Kriegen und Krisen als letzter Helfer in der Not. Wenn Geld nichts mehr wert ist und Unsicherheit allerorten herrscht, dann brechen goldene Zeiten an – zumindest für das gelbe Edelmetall.
Den besten Beweis lieferte jüngst die Irak-Krise. Mit stetig wachsender Kriegsgefahr stieg auch der Goldpreis, bis er im Februar mit 380 US-Dollar je Feinunze seinen höchsten Stand seit sechs Jahren erreichte. Mit Kriegsausbruch und dem späteren Sieg über Saddam Hussein gab der Goldpreis wieder nach – die Kriegsprämie fiel weg. Doch nach Ansicht vieler Experten ist dieser Preisrückgang nur vorübergehend.
Denn während so mancher Aktienkurs ins Bodenlose stürzte, startete der Goldpreis schon vor zwei Jahren seine Aufholjagd. Und die soll weitergehen.
So erwartet die Londoner Research- und Beratungsagentur Gold Fields Mineral Services (GFMS) für die zweite Jahreshälfte einen erneuten Anstieg des Goldpreises. GFMS veröffentlicht einmal jährlich den Branchenreport Gold Survey 2003. GFMS-Geschäftsführer Philip Klapwijk ist sich sicher: „Der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibt pro Gold.“
Vor allem, wenn die USA auch nach dem Sieg im Irak ihren Krieg gegen den Terror fortsetzten. Doch auch ohne weitere Kriege sprächen alle Anzeichen für einen weiter steigenden Goldpreis, so Philip Klapwijk. Niedrige Zinsen, geringes Wirtschaftswachstum, müde Aktienmärkte und der schwache Dollar seien beste Voraussetzungen für einen steigenden Goldpreis.
Eine Sichtweise, die Wolfgang Wilke, Rohstoff- und Edelmetall-Experte der Dresdner Bank in Frankfurt, teilt. Nach zwanzig Jahren Gold-Baisse mehren sich für ihn die Anzeichen einer Trendwende am Goldmarkt.
Seien für steigende Aktienkurse die Gewinnsituation der Unternehmen sowie die Zinsen bestimmend, so sei für einen steigenden Goldpreis die Höhe der Inflationsrate grundlegend. Wilke gesteht ein, dass der Goldpreisanstieg der vergangenen beiden Jahre auf den ersten Blick nicht mit der Inflationsrate erklärt werden könne. Denn in den Industrienationen herrscht ausgesprochene Preisstabilität.
Warum also der Preisanstieg für eine Unze, also 31,1035 Gramm, des gelben Metalls?
Des Rätsels Lösung sei in der US-Wirtschaft und im Dollar zu finden, meint Wilke. Schließlich wird die Feinunze Gold international in US-Dollar abgerechnet. In einem Dollar, der mit großen Problemen der US-Wirtschaft zunehmend belastet wird. „Ich vermute, dass der Goldmarkt derzeit die Erwartung einer drohenden US-Inflation zur Finanzierung des riesigen Leistungsbilanzdefizites vorwegnimmt“, sagt Wilke.
Während des Börsenbooms der neunziger Jahre hätten die Finanzmärkte dieses Problem ignoriert und ausländische Investoren dieses Defizit bereitwillig finanziert. Doch mittlerweile investieren japanische und europäische Anleger in den USA nicht mehr so kräftig oder ziehen sogar Gelder ab.
Und das niedrige Zinsniveau sowie der schwächere Dollar locken keine neuen Finanz-Investoren mehr an. In dieser Situation bleibe der US-Regierung eigentlich nur noch die staatliche Binnenfinanzierung über die Notenpresse, so Wilke. Die US-Regierung weitete ihren Rüstungsetat enorm aus und bewilligte allein für den Irak-Krieg 75 Milliarden US-Dollar. Ein Szenario, das stark an die Finanzierung des Vietnam-Krieges erinnert. Damals folgte den aufgeblähten Etats mit rund zwei Jahren Verzögerung die Inflation, der Wertverfall des Dollars und damit der Anstieg des Goldpreises.
Dass die US-Notenbank die Geldpresse anwirft und frische Dollar unters Volk bringt, erscheint heute nicht mehr ganz abwegig. Sie bereitet sich auf den Ernstfall vor: die Bekämpfung der Deflation mit allen Mitteln. Bereits im vergangenen November sprach US-Notenbank-Gouverneur Ben Bernanke den berühmten und für einen Notenbanker provozierenden Satz: „Die US-Regierung verfügt über eine Technologie, genannt ‚Geldpresse‘, mit der sich so viele Dollar wie gewünscht herstellen lassen.“ Je mehr wertlosere Dollar es im Vergleich zur Goldmenge gibt, desto höher wird der Goldpreis.
Doch nicht nur der schwache Dollar gilt als Argument für ein Investment in Gold. „Auch das niedrige Zinsniveau in den Industrienationen macht Gold attraktiv für Anleger“, sagt Stefan Schilbe, Chefvolkswirt des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt in Düsseldorf. Gold, das als Edelmetall keine Zinsen abwirft, wird attraktiver, weil der Verzicht auf die niedrigeren Zinserträge leichter wird.
Grundsätzlich sieht auch Schilbe kaum Hemmnisse für einen weiteren Anstieg des Goldpreises.
„Seit einigen Jahren übertrifft die Nachfrage die Goldproduktion jährlich um 900 bis 1200 Tonnen.“ Größter Nachfrager auf dem Weltmarkt ist die indische Schmuckindustrie. Im vergangenen Jahr wegen Dürre in die Krise geraten, könnte in diesem Jahr dort die Nachfrage weiter anziehen und so den Goldpreis stützen. Dass das Gold-Angebot weiter gering bleibt, dafür sorgt neben dem Rückgang der Goldförderung auch das Washington Agreement der 15 überwiegend europäischen Zentralbanken aus dem Jahr 1999. Die Zentralbanken verabredeten, ihre Goldverkäufe bis zum Jahr 2004 auf jährlich 400 Tonnen zu beschränken. Insgesamt lagern in den Tresoren dieser Zentralbanken aber über 15000 Tonnen Gold, die seit der Washingtoner Abmachung nicht mehr angeboten werden können.
Vermutungen, dass die Abmachung im kommenden Jahr verlängert werden soll, will die Deutsche Bundesbank zwar nicht kommentieren. Experten wie Schilbe erwarten jedoch eine Neuauflage. Kommt es dazu nicht, droht dem Goldpreis allerdings ein Rückschlag. Denn das Zentralbank-Gold könnte zehn Jahre und länger die Angebotslücke auf dem Weltmarkt schließen. Da die Zentralbanken aber kein Interesse an einem kräftigen Rückgang des Goldpreises haben dürften, spricht wenig gegen die Verlängerung des Abkommens.
Trotzdem sucht man in den meisten Depots Gold bislang vergebens. Micheal Durose, Goldanalyst bei Morgan Stanley, rät zu einem Mix: „In dem Maß, wie die Aktienmärkte stark schwankend und die geopolitischen Risiken hoch bleiben, sind drei bis fünf Prozent Goldanteil im Portfolio eine sinnvolle Strategie.“ Dabei ist der Kauf von Goldbarren oder -münzen nur eine Möglichkeit. Neben dem physischen Gold bieten fast alle Großbanken zahlreiche Alternativen. So bietet die Deutsche Bank ein Goldkonto ab einer Mindesteinlage von 7500 Euro an. Das Konto lautet nicht auf Euro, sondern auf eine bestimmte Menge Gold. Die Idee: Ohne reales Gold zu kaufen, profitieren die Anleger von der Wertentwicklung.
Doch leider haben derartige, unverzinste Konten einen entscheidenden Haken. Denn bei vielen Anbietern besteht kein Lieferanspruch auf physisches Gold im Wert des Kontostandes. „Als Anlage in Krisenzeiten sind diese Konten deshalb denkbar ungeeignet“, sagt Martin Siegel, Herausgeber der Zeitschrift Der Goldmarkt und Berater des Goldfonds PEH Q-Goldmines. Anleger sollen ja gerade mit dem Halten des Edelmetalls die Bonitätsrisiken von Banken ausschließen und sich so vor Bankenpleiten schützen. „Doch bei diesen Konten handele ich mir als Anleger genau dieses Bonitätsrisiko ein.“ Ein genauer Blick in die Vertragsbedingungen sei deshalb ratsam. Auf jeden Fall sollten Anleger vor einem Investment prüfen, ob die Bank das Goldkonto nur als Depotverwalter führt oder der Einlagensicherungsfonds die Anlage für den Fall der Bankenpleite absichert.
Auch Aktien von Goldminen haben ihre Tücken. Für Anleger in Deutschland besteht das Problem, dass Aktien australischer oder nordamerikanischer Goldminen an deutschen Börsen nur schwach gehandelt werden. „Das lässt die Kurse enorm schwanken.“ Und ein Kauf an den Heimatbörsen verteuere sich nicht zuletzt durch die Währungsumrechnungen. Deshalb rät Siegel zum Kauf von Fondsanteilen. „Dort zahlt man nur den Ausgabeaufschlag, der oft unter den Kosten des direkten Goldaktienkaufs liegt“ , sagt er. Der empfohlene Anteil von 20 Prozent physischem Gold der im Goldbereich angelegten Mittel sollte der Anleger in Form von mehrwertsteuerfreien Goldmünzen wie zum Beispiel Krügerrand oder Degussa-Goldbarren seinem Depot zusätzlich beimischen.
Eine weitere Möglichkeit, sich am Gold zu freuen und in sichere Werte zu investieren, sind historische Sammlermünzen. Laut Rudolf Reichert, Leiter des größten deutschen Münzkabinetts bei der BW-Bank in Stuttgart, ist der Markt für derartige Münzen erstaunlich stabil geblieben und so eine gute Adresse für werthaltige Anlagen. Doch er warnt: „Ohne Grundkenntnisse oder die nötige Geduld sollten Münzkäufer sehr vorsichtig sein.“ Nicht jede Goldmünze ist wertvoll, nur weil sie alt ist. Es komme vielmehr auf die Seltenheit und die Qualität einer Münze an. Im Zweifel sollte auf jeden Fall der Rat von Experten eingeholt werden, bevor blind Münzen gekauft oder verkauft werden.
Im Fall von Opas alter Münze war es die elterliche Expertise, die einen vorschnellen Verkauf verbot. Und mittlerweile scheint von der kalten, schweren Münze ein wärmerer goldener Glanz auszugehen als noch vor zwanzig Jahren.
DIE ZEIT - 21 / 2003
Hätten wir nur auf Opa gehört
Der Goldpreis steigt und steigt. Das Edelmetall ist ein krisenfestes Investment
– aber wehe, die Krise endet
Von Klaus Spanke
Welch eine Enttäuschung: Keine Carrera-Bahn, kein Zauberwürfel. Noch nicht einmal Geld. Nein, zur Heiligen Kommunion gab’s vor zwanzig Jahren eine olle Goldmünze vom Opa. Und als sei das noch nicht Strafe genug, erzählte er, nachdem man sich artig bedankt hatte, obendrein noch eine langweilige Geschichte. Davon, dass früher während der großen Inflation nur auf Gold Verlass gewesen sei.
Zwanzig Jahre und einen Börsenkrach später erkennen viele Anleger, was der Großvater immer schon gewusst hat: Gold ist in schweren Zeiten ein sicherer Hafen fürs eigene Vermögen. Seit Menschengedenken gilt Gold in Kriegen und Krisen als letzter Helfer in der Not. Wenn Geld nichts mehr wert ist und Unsicherheit allerorten herrscht, dann brechen goldene Zeiten an – zumindest für das gelbe Edelmetall.
Den besten Beweis lieferte jüngst die Irak-Krise. Mit stetig wachsender Kriegsgefahr stieg auch der Goldpreis, bis er im Februar mit 380 US-Dollar je Feinunze seinen höchsten Stand seit sechs Jahren erreichte. Mit Kriegsausbruch und dem späteren Sieg über Saddam Hussein gab der Goldpreis wieder nach – die Kriegsprämie fiel weg. Doch nach Ansicht vieler Experten ist dieser Preisrückgang nur vorübergehend.
Denn während so mancher Aktienkurs ins Bodenlose stürzte, startete der Goldpreis schon vor zwei Jahren seine Aufholjagd. Und die soll weitergehen.
So erwartet die Londoner Research- und Beratungsagentur Gold Fields Mineral Services (GFMS) für die zweite Jahreshälfte einen erneuten Anstieg des Goldpreises. GFMS veröffentlicht einmal jährlich den Branchenreport Gold Survey 2003. GFMS-Geschäftsführer Philip Klapwijk ist sich sicher: „Der gesamtwirtschaftliche Ausblick bleibt pro Gold.“
Vor allem, wenn die USA auch nach dem Sieg im Irak ihren Krieg gegen den Terror fortsetzten. Doch auch ohne weitere Kriege sprächen alle Anzeichen für einen weiter steigenden Goldpreis, so Philip Klapwijk. Niedrige Zinsen, geringes Wirtschaftswachstum, müde Aktienmärkte und der schwache Dollar seien beste Voraussetzungen für einen steigenden Goldpreis.
Eine Sichtweise, die Wolfgang Wilke, Rohstoff- und Edelmetall-Experte der Dresdner Bank in Frankfurt, teilt. Nach zwanzig Jahren Gold-Baisse mehren sich für ihn die Anzeichen einer Trendwende am Goldmarkt.
Seien für steigende Aktienkurse die Gewinnsituation der Unternehmen sowie die Zinsen bestimmend, so sei für einen steigenden Goldpreis die Höhe der Inflationsrate grundlegend. Wilke gesteht ein, dass der Goldpreisanstieg der vergangenen beiden Jahre auf den ersten Blick nicht mit der Inflationsrate erklärt werden könne. Denn in den Industrienationen herrscht ausgesprochene Preisstabilität.
Warum also der Preisanstieg für eine Unze, also 31,1035 Gramm, des gelben Metalls?
Des Rätsels Lösung sei in der US-Wirtschaft und im Dollar zu finden, meint Wilke. Schließlich wird die Feinunze Gold international in US-Dollar abgerechnet. In einem Dollar, der mit großen Problemen der US-Wirtschaft zunehmend belastet wird. „Ich vermute, dass der Goldmarkt derzeit die Erwartung einer drohenden US-Inflation zur Finanzierung des riesigen Leistungsbilanzdefizites vorwegnimmt“, sagt Wilke.
Während des Börsenbooms der neunziger Jahre hätten die Finanzmärkte dieses Problem ignoriert und ausländische Investoren dieses Defizit bereitwillig finanziert. Doch mittlerweile investieren japanische und europäische Anleger in den USA nicht mehr so kräftig oder ziehen sogar Gelder ab.
Und das niedrige Zinsniveau sowie der schwächere Dollar locken keine neuen Finanz-Investoren mehr an. In dieser Situation bleibe der US-Regierung eigentlich nur noch die staatliche Binnenfinanzierung über die Notenpresse, so Wilke. Die US-Regierung weitete ihren Rüstungsetat enorm aus und bewilligte allein für den Irak-Krieg 75 Milliarden US-Dollar. Ein Szenario, das stark an die Finanzierung des Vietnam-Krieges erinnert. Damals folgte den aufgeblähten Etats mit rund zwei Jahren Verzögerung die Inflation, der Wertverfall des Dollars und damit der Anstieg des Goldpreises.
Dass die US-Notenbank die Geldpresse anwirft und frische Dollar unters Volk bringt, erscheint heute nicht mehr ganz abwegig. Sie bereitet sich auf den Ernstfall vor: die Bekämpfung der Deflation mit allen Mitteln. Bereits im vergangenen November sprach US-Notenbank-Gouverneur Ben Bernanke den berühmten und für einen Notenbanker provozierenden Satz: „Die US-Regierung verfügt über eine Technologie, genannt ‚Geldpresse‘, mit der sich so viele Dollar wie gewünscht herstellen lassen.“ Je mehr wertlosere Dollar es im Vergleich zur Goldmenge gibt, desto höher wird der Goldpreis.
Doch nicht nur der schwache Dollar gilt als Argument für ein Investment in Gold. „Auch das niedrige Zinsniveau in den Industrienationen macht Gold attraktiv für Anleger“, sagt Stefan Schilbe, Chefvolkswirt des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt in Düsseldorf. Gold, das als Edelmetall keine Zinsen abwirft, wird attraktiver, weil der Verzicht auf die niedrigeren Zinserträge leichter wird.
Grundsätzlich sieht auch Schilbe kaum Hemmnisse für einen weiteren Anstieg des Goldpreises.
„Seit einigen Jahren übertrifft die Nachfrage die Goldproduktion jährlich um 900 bis 1200 Tonnen.“ Größter Nachfrager auf dem Weltmarkt ist die indische Schmuckindustrie. Im vergangenen Jahr wegen Dürre in die Krise geraten, könnte in diesem Jahr dort die Nachfrage weiter anziehen und so den Goldpreis stützen. Dass das Gold-Angebot weiter gering bleibt, dafür sorgt neben dem Rückgang der Goldförderung auch das Washington Agreement der 15 überwiegend europäischen Zentralbanken aus dem Jahr 1999. Die Zentralbanken verabredeten, ihre Goldverkäufe bis zum Jahr 2004 auf jährlich 400 Tonnen zu beschränken. Insgesamt lagern in den Tresoren dieser Zentralbanken aber über 15000 Tonnen Gold, die seit der Washingtoner Abmachung nicht mehr angeboten werden können.
Vermutungen, dass die Abmachung im kommenden Jahr verlängert werden soll, will die Deutsche Bundesbank zwar nicht kommentieren. Experten wie Schilbe erwarten jedoch eine Neuauflage. Kommt es dazu nicht, droht dem Goldpreis allerdings ein Rückschlag. Denn das Zentralbank-Gold könnte zehn Jahre und länger die Angebotslücke auf dem Weltmarkt schließen. Da die Zentralbanken aber kein Interesse an einem kräftigen Rückgang des Goldpreises haben dürften, spricht wenig gegen die Verlängerung des Abkommens.
Trotzdem sucht man in den meisten Depots Gold bislang vergebens. Micheal Durose, Goldanalyst bei Morgan Stanley, rät zu einem Mix: „In dem Maß, wie die Aktienmärkte stark schwankend und die geopolitischen Risiken hoch bleiben, sind drei bis fünf Prozent Goldanteil im Portfolio eine sinnvolle Strategie.“ Dabei ist der Kauf von Goldbarren oder -münzen nur eine Möglichkeit. Neben dem physischen Gold bieten fast alle Großbanken zahlreiche Alternativen. So bietet die Deutsche Bank ein Goldkonto ab einer Mindesteinlage von 7500 Euro an. Das Konto lautet nicht auf Euro, sondern auf eine bestimmte Menge Gold. Die Idee: Ohne reales Gold zu kaufen, profitieren die Anleger von der Wertentwicklung.
Doch leider haben derartige, unverzinste Konten einen entscheidenden Haken. Denn bei vielen Anbietern besteht kein Lieferanspruch auf physisches Gold im Wert des Kontostandes. „Als Anlage in Krisenzeiten sind diese Konten deshalb denkbar ungeeignet“, sagt Martin Siegel, Herausgeber der Zeitschrift Der Goldmarkt und Berater des Goldfonds PEH Q-Goldmines. Anleger sollen ja gerade mit dem Halten des Edelmetalls die Bonitätsrisiken von Banken ausschließen und sich so vor Bankenpleiten schützen. „Doch bei diesen Konten handele ich mir als Anleger genau dieses Bonitätsrisiko ein.“ Ein genauer Blick in die Vertragsbedingungen sei deshalb ratsam. Auf jeden Fall sollten Anleger vor einem Investment prüfen, ob die Bank das Goldkonto nur als Depotverwalter führt oder der Einlagensicherungsfonds die Anlage für den Fall der Bankenpleite absichert.
Auch Aktien von Goldminen haben ihre Tücken. Für Anleger in Deutschland besteht das Problem, dass Aktien australischer oder nordamerikanischer Goldminen an deutschen Börsen nur schwach gehandelt werden. „Das lässt die Kurse enorm schwanken.“ Und ein Kauf an den Heimatbörsen verteuere sich nicht zuletzt durch die Währungsumrechnungen. Deshalb rät Siegel zum Kauf von Fondsanteilen. „Dort zahlt man nur den Ausgabeaufschlag, der oft unter den Kosten des direkten Goldaktienkaufs liegt“ , sagt er. Der empfohlene Anteil von 20 Prozent physischem Gold der im Goldbereich angelegten Mittel sollte der Anleger in Form von mehrwertsteuerfreien Goldmünzen wie zum Beispiel Krügerrand oder Degussa-Goldbarren seinem Depot zusätzlich beimischen.
Eine weitere Möglichkeit, sich am Gold zu freuen und in sichere Werte zu investieren, sind historische Sammlermünzen. Laut Rudolf Reichert, Leiter des größten deutschen Münzkabinetts bei der BW-Bank in Stuttgart, ist der Markt für derartige Münzen erstaunlich stabil geblieben und so eine gute Adresse für werthaltige Anlagen. Doch er warnt: „Ohne Grundkenntnisse oder die nötige Geduld sollten Münzkäufer sehr vorsichtig sein.“ Nicht jede Goldmünze ist wertvoll, nur weil sie alt ist. Es komme vielmehr auf die Seltenheit und die Qualität einer Münze an. Im Zweifel sollte auf jeden Fall der Rat von Experten eingeholt werden, bevor blind Münzen gekauft oder verkauft werden.
Im Fall von Opas alter Münze war es die elterliche Expertise, die einen vorschnellen Verkauf verbot. Und mittlerweile scheint von der kalten, schweren Münze ein wärmerer goldener Glanz auszugehen als noch vor zwanzig Jahren.
DIE ZEIT - 21 / 2003
@konradi, schöne artikel - danke - svc
.
@ svc :
- jetzt ist aber auch erst mal gut ...

Carla Bruni: Zarter Triumph
Französisches Chanson: Fabelhafte Wiederkehr
von Christoph Dallach
Mit elektronischer Musik und coolen neuen Klängen haben sich französische Bands und Produzenten in der internationalen Popwelt etabliert. Nun lebt auch die Tradition des Chansons wieder auf - dank neuer Stars wie Carla Bruni und Benjamin Biolay.
Sie haben tolle Landschaften und schöne Frauen, das beste Essen und die besten Weine der Welt, da sei es doch tröstlich, dass die Franzosen wenigstens in einer Hinsicht zuverlässig nur Katastrophales zu Stande brächten - so schrieb gerade erst die US-Zeitschrift "New Yorker": Französische Popmusik sei "eines der hartnäckigsten europäischen Fiaskos".
Ob es an den aktuellen amerikanischfranzösischen Spannungen liegt, dass da ein altes Vorurteil aufgewärmt wurde? Unter jungen Musikfans diesseits und jenseits des Atlantiks jedenfalls ist absolut unbestritten, dass französische Musiker seit ein paar Jahren zu den weltweit wichtigsten Pop-Erneuerern gehören: Bands wie Daft Punk und Air gelten im Elektropop-Genre als stilbildend, Pariser Soundbastler wie Bertrand Burgalat oder der Produzent Mirwais sind global bestens im Geschäft: Mirwais durfte gerade für die US-Sängerin Madonna an den meisten Songs ihres neuen Album "American Life" feilen.
Neu aber ist, dass auch die Helden des französische Chansons plötzlich wieder außerhalb des Landes Anerkennung finden. So hat der Instrumentalist Yann Tiersen mit der Filmmusik zum Erfolgswerk "Die fabelhafte Welt der Amélie" allein in Deutschland rund 200 000 CDs verkauft, auch die junge Sängerin Alizée schaffte es mit dem Hit "Moi ... Lolita" in die Bestsellerlisten und lässt die Manager ihrer Plattenfirma Polydor nun für ihr neues Album "Mes courants électriques ..." auf eine Riesenauflage hoffen.
18 Jahre ist die Korsin Alizée, und über die Eigenheiten französischer Popmusik philosophiert sie im Interview: "Es gibt schon etwas wie einen französischen Stil. Den kann ich erkennen, aber leider nicht erklären." Dazu lächelt sie sehr hübsch.
Dass französische Popmusik derzeit in Italien oder Deutschland als cool gilt und auch die alten Hits von Stars wie Françoise Hardy oder Serge Gainsbourg auf Samplern neu aufgelegt werden, liegt aber an ungleich ernsthafteren Erneuerern des Chansons wie Benjamin Biolay. Der 30-Jährige stammt aus einer Musikerfamilie und wuchs in der französischen Provinz auf; soeben hat er sein zweites Album "Négatif" voller verwegen melancholischer Songs herausgebracht und ist in Frankreich, auch dank seiner Ehe mit der Catherine-Deneuve-Tochter Chiara Mastroianni, derzeit ungeheuer populär.
Der vielleicht überraschendste Coup im französischen Popgeschäft der letzten Jahre gelang der Wahlfranzösin Carla Bruni mit ihrem Debütalbum "Quelqu`un m`a dit". Die 34-jährige Italienerin zählte viele Jahre lang zu den Supermodels und hatte angeblich Liebeleien mit Donald Trump, Mick Jagger und Eric Clapton. Auf ihrer CD, die im Juni auch in Deutschland herauskommt, singt die schöne Industriellentochter zur Gitarre mit wunderbar rauchiger Stimme überwiegend selbst geschriebene Lieder über die Liebe und das Leben - ein zarter Triumph ganz in der großen Tradition des Chansons.
Auch ihm falle es schwer zu erklären, was wirklich neu sei am "Nouvelle Chanson Française", wie manche Kritiker seine Musik und die von Kollegen wie Jérôme Minière nennen, sagt Benjamin Biolay. Er gilt als eine Art Sprecher der Bewegung. Ganz sicher ist er ihr Glamourboy: Die Zigarette im Mundwinkel, die Augen immer ein wenig von dunklen Furchen umschattet, das Haar hübsch verstrubbelt, so wandert er auf Plattencovern am Meeresstrand entlang und so gibt er, während er in der Halle des Pariser Nobelhotels Lutetia an einem Orangensaft nippt, Auskunft über Vorzüge und Nachteile seines Erfolgs.
Vorbildlich bescheiden und sehr leise spricht er von den Mängeln seiner Stimme, die es ihm leider nicht ermögliche, wirklich laut zu singen, weshalb er sich vor Konzertauftritten in Riesenhallen immer noch ein wenig fürchte. Und mit schöner Leidenschaft schwärmt er von der Weltläufigkeit der modernen französischen Popmusik: "Ich liebe Amerika", sagt er zum Beispiel, "weil es dort sehr intelligente, wunderschöne Musik gibt, der ich viel verdanke - und natürlich auch viele intelligente Musiker, die den amerikanischen Präsidenten George W. Bush heftig ablehnen."
Im Übrigen behauptet Biolay, er interessiere sich nicht für Weltpolitik. Sein Fach ist der Weltschmerz: Seine Songs mühen sich, die ebenso hoffnungsvolle wie verletztliche Stimmung zur Zeit der Morgendämmerung wiederzugeben und die Verzweiflung einsamer Nächte, und im allerersten Song seines neuen Albums findet sich der Lehrsatz: "Die Menschen sind alle Arschlöcher." - Schon kurios, dass die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ihn ausgerechnet für das derart garstig anklingende "Négatif" als Vorsänger einer "neuen Bürgerlichkeit" preist.
Er selbst finde ja, das Wort Chanson rieche "nach kaltem Rauch und alten Schuhen", sagt der Sänger. Obwohl er nebenher Songs für alte Chanson-Helden wie Henri Salvador, Juliette Gréco und die Hardy schreibe, bevorzuge er für seine Musik doch den Begriff Pop. Seine Fans ignorieren solche Finessen allerdings ebenso beharrlich wie seine Abneigung gegen Vergleiche mit dem großen toten Absturzhelden Serge Gainsbourg. Die Duette, die Biolay etwa mit Gattin Chiara (im Song "Je ne t`ai pas aimé") vorträgt, erinnern nun mal an Gainsbourgs legendäres "Je t`aime"-Geturtel mit Jane Birkin.
Zum neuen französischen Popwunder hat nach Meinung einiger Fachleute der Staat durchaus beigetragen. Dank einer verbindlichen Radioquote, die beim Abspielen von Popsongs im Äther einen deutlichen Anteil an heimischen Produktionen vorschreibt, kann die Branche verlässlich auf Kunden hoffen.
Auf einen Durchbruch in Deutschland hofft nun auch Mylene Farmer, die im eigenen Land als Skandalkünstlerin für Krawall sorgt und in Deutschland eine Zusammenstellung ihrer größten Hits unter dem Titel "Les mots" präsentiert. "Porno Chic" nannte das Magazin "Paris Match" die Sex-Inszenierungen der Sängerin in Videoclips, die sie mitunter von Hollywood-Regisseuren wie Luc Besson oder Abel Ferrara inszenieren lässt. Mal liegt sie da nackt in einer Blutlache in der Kirche, mal lässt sie sich knapp bekleidet an eine Dampflok fesseln. Elton John schwärmt von der Auflagenmillionärin Farmer: "She`s so french!"
Nebenher ist Farmer die Produzentin und Mitentdeckerin der singenden Kindfrau Alizée, die sie wohl zu deren gleichfalls dreisten Sex-Koketterien angeregt hat: in Frankreich kein großer Aufreger, seit Maurice Chevalier vor knapp einem halben Jahrhundert sang: "Thank Heaven for Little Girls".
Für den Fall, dass die Tage doch bald wiederkehren, in denen Popmusik made in France als Geschmacksverirrung der ganz unangenehmen Art gilt, lernt die kleine Alizée übrigens neuerdings fleißig Englisch - schließlich, sagt sie, "habe ich jetzt international schon mal einen Fuß in der Tür".

Popstar Alizée: "Es gibt schon etwas wie einen französischen Stil"
DER SPIEGEL 20/2003
@ svc :
- jetzt ist aber auch erst mal gut ...


Carla Bruni: Zarter Triumph
Französisches Chanson: Fabelhafte Wiederkehr
von Christoph Dallach
Mit elektronischer Musik und coolen neuen Klängen haben sich französische Bands und Produzenten in der internationalen Popwelt etabliert. Nun lebt auch die Tradition des Chansons wieder auf - dank neuer Stars wie Carla Bruni und Benjamin Biolay.
Sie haben tolle Landschaften und schöne Frauen, das beste Essen und die besten Weine der Welt, da sei es doch tröstlich, dass die Franzosen wenigstens in einer Hinsicht zuverlässig nur Katastrophales zu Stande brächten - so schrieb gerade erst die US-Zeitschrift "New Yorker": Französische Popmusik sei "eines der hartnäckigsten europäischen Fiaskos".
Ob es an den aktuellen amerikanischfranzösischen Spannungen liegt, dass da ein altes Vorurteil aufgewärmt wurde? Unter jungen Musikfans diesseits und jenseits des Atlantiks jedenfalls ist absolut unbestritten, dass französische Musiker seit ein paar Jahren zu den weltweit wichtigsten Pop-Erneuerern gehören: Bands wie Daft Punk und Air gelten im Elektropop-Genre als stilbildend, Pariser Soundbastler wie Bertrand Burgalat oder der Produzent Mirwais sind global bestens im Geschäft: Mirwais durfte gerade für die US-Sängerin Madonna an den meisten Songs ihres neuen Album "American Life" feilen.
Neu aber ist, dass auch die Helden des französische Chansons plötzlich wieder außerhalb des Landes Anerkennung finden. So hat der Instrumentalist Yann Tiersen mit der Filmmusik zum Erfolgswerk "Die fabelhafte Welt der Amélie" allein in Deutschland rund 200 000 CDs verkauft, auch die junge Sängerin Alizée schaffte es mit dem Hit "Moi ... Lolita" in die Bestsellerlisten und lässt die Manager ihrer Plattenfirma Polydor nun für ihr neues Album "Mes courants électriques ..." auf eine Riesenauflage hoffen.
18 Jahre ist die Korsin Alizée, und über die Eigenheiten französischer Popmusik philosophiert sie im Interview: "Es gibt schon etwas wie einen französischen Stil. Den kann ich erkennen, aber leider nicht erklären." Dazu lächelt sie sehr hübsch.
Dass französische Popmusik derzeit in Italien oder Deutschland als cool gilt und auch die alten Hits von Stars wie Françoise Hardy oder Serge Gainsbourg auf Samplern neu aufgelegt werden, liegt aber an ungleich ernsthafteren Erneuerern des Chansons wie Benjamin Biolay. Der 30-Jährige stammt aus einer Musikerfamilie und wuchs in der französischen Provinz auf; soeben hat er sein zweites Album "Négatif" voller verwegen melancholischer Songs herausgebracht und ist in Frankreich, auch dank seiner Ehe mit der Catherine-Deneuve-Tochter Chiara Mastroianni, derzeit ungeheuer populär.
Der vielleicht überraschendste Coup im französischen Popgeschäft der letzten Jahre gelang der Wahlfranzösin Carla Bruni mit ihrem Debütalbum "Quelqu`un m`a dit". Die 34-jährige Italienerin zählte viele Jahre lang zu den Supermodels und hatte angeblich Liebeleien mit Donald Trump, Mick Jagger und Eric Clapton. Auf ihrer CD, die im Juni auch in Deutschland herauskommt, singt die schöne Industriellentochter zur Gitarre mit wunderbar rauchiger Stimme überwiegend selbst geschriebene Lieder über die Liebe und das Leben - ein zarter Triumph ganz in der großen Tradition des Chansons.
Auch ihm falle es schwer zu erklären, was wirklich neu sei am "Nouvelle Chanson Française", wie manche Kritiker seine Musik und die von Kollegen wie Jérôme Minière nennen, sagt Benjamin Biolay. Er gilt als eine Art Sprecher der Bewegung. Ganz sicher ist er ihr Glamourboy: Die Zigarette im Mundwinkel, die Augen immer ein wenig von dunklen Furchen umschattet, das Haar hübsch verstrubbelt, so wandert er auf Plattencovern am Meeresstrand entlang und so gibt er, während er in der Halle des Pariser Nobelhotels Lutetia an einem Orangensaft nippt, Auskunft über Vorzüge und Nachteile seines Erfolgs.
Vorbildlich bescheiden und sehr leise spricht er von den Mängeln seiner Stimme, die es ihm leider nicht ermögliche, wirklich laut zu singen, weshalb er sich vor Konzertauftritten in Riesenhallen immer noch ein wenig fürchte. Und mit schöner Leidenschaft schwärmt er von der Weltläufigkeit der modernen französischen Popmusik: "Ich liebe Amerika", sagt er zum Beispiel, "weil es dort sehr intelligente, wunderschöne Musik gibt, der ich viel verdanke - und natürlich auch viele intelligente Musiker, die den amerikanischen Präsidenten George W. Bush heftig ablehnen."
Im Übrigen behauptet Biolay, er interessiere sich nicht für Weltpolitik. Sein Fach ist der Weltschmerz: Seine Songs mühen sich, die ebenso hoffnungsvolle wie verletztliche Stimmung zur Zeit der Morgendämmerung wiederzugeben und die Verzweiflung einsamer Nächte, und im allerersten Song seines neuen Albums findet sich der Lehrsatz: "Die Menschen sind alle Arschlöcher." - Schon kurios, dass die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ihn ausgerechnet für das derart garstig anklingende "Négatif" als Vorsänger einer "neuen Bürgerlichkeit" preist.
Er selbst finde ja, das Wort Chanson rieche "nach kaltem Rauch und alten Schuhen", sagt der Sänger. Obwohl er nebenher Songs für alte Chanson-Helden wie Henri Salvador, Juliette Gréco und die Hardy schreibe, bevorzuge er für seine Musik doch den Begriff Pop. Seine Fans ignorieren solche Finessen allerdings ebenso beharrlich wie seine Abneigung gegen Vergleiche mit dem großen toten Absturzhelden Serge Gainsbourg. Die Duette, die Biolay etwa mit Gattin Chiara (im Song "Je ne t`ai pas aimé") vorträgt, erinnern nun mal an Gainsbourgs legendäres "Je t`aime"-Geturtel mit Jane Birkin.
Zum neuen französischen Popwunder hat nach Meinung einiger Fachleute der Staat durchaus beigetragen. Dank einer verbindlichen Radioquote, die beim Abspielen von Popsongs im Äther einen deutlichen Anteil an heimischen Produktionen vorschreibt, kann die Branche verlässlich auf Kunden hoffen.
Auf einen Durchbruch in Deutschland hofft nun auch Mylene Farmer, die im eigenen Land als Skandalkünstlerin für Krawall sorgt und in Deutschland eine Zusammenstellung ihrer größten Hits unter dem Titel "Les mots" präsentiert. "Porno Chic" nannte das Magazin "Paris Match" die Sex-Inszenierungen der Sängerin in Videoclips, die sie mitunter von Hollywood-Regisseuren wie Luc Besson oder Abel Ferrara inszenieren lässt. Mal liegt sie da nackt in einer Blutlache in der Kirche, mal lässt sie sich knapp bekleidet an eine Dampflok fesseln. Elton John schwärmt von der Auflagenmillionärin Farmer: "She`s so french!"
Nebenher ist Farmer die Produzentin und Mitentdeckerin der singenden Kindfrau Alizée, die sie wohl zu deren gleichfalls dreisten Sex-Koketterien angeregt hat: in Frankreich kein großer Aufreger, seit Maurice Chevalier vor knapp einem halben Jahrhundert sang: "Thank Heaven for Little Girls".
Für den Fall, dass die Tage doch bald wiederkehren, in denen Popmusik made in France als Geschmacksverirrung der ganz unangenehmen Art gilt, lernt die kleine Alizée übrigens neuerdings fleißig Englisch - schließlich, sagt sie, "habe ich jetzt international schon mal einen Fuß in der Tür".

Popstar Alizée: "Es gibt schon etwas wie einen französischen Stil"
DER SPIEGEL 20/2003
http://www.elliott-charts.de/old/index.html
FTD: Krise, wohin man blickt (mit eigenem Kommentar)
[ Börse & Wirtschaft: Elliott-Wellen-Forum ]
Geschrieben von Wal Buchenberg am 16. Mai 2003 08:35:51:
FTD: Kapitalistische Krise, wohin man blickt
„Die Wirtschaft steckt in der längsten Krise der Nachkriegszeit, schon seit drei Jahren ist sie nicht mehr spürbar gewachsen.
Bisher gab es aber zwischen Medien und Regierung einen Schweigepakt: Die elende Wirtschaftslage mit rund 5 Millionen Arbeitslosen und Rekordpleiten sollte und durfte nicht Krise genannt werden.
Warum nicht? Einmal, um die schwache Regierung zu stützen, aber auch, weil keine systemkonforme Hoffnung in Sicht ist: Weder gibt es – wie in früheren Krisen – eine Weltregion, die als kapitalistischer Wachstumsmotor in Frage kommt, noch kann man die Krisenursachen auf Rückständige Branchen wie Kohle, Stahl oder Textil schieben – nein die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist weltweit und hat mit der IT-Branche den größten kapitalistischen Hoffnungsträger infiziert.
Das bringt nach Einschätzung vieler Ökonomen eine ganz neue Qualität von Problemen mit sich. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Daten zur Wirtschaftsleistung im ersten Quartal steckt die Wirtschaft mit großer Wahrscheinlichkeit nun schon zum zweiten Mal seit 2001 in der Rezession. Einen solchen Double Dip erlitt die Wirtschaft zuletzt 1981. Anders als damals hat es nun allerdings auch in der kurzen Zeit zwischen den Dips kaum Wachstum gegeben. Für das laufende zweite Quartal rechnen Ökonomen mit einem weiteren Minus.
Der Vergleich mit 1981 ist schönfärberisch. Der einzig zutreffende Vergleich ist der mit den Weltwirtschaftsproblemen von 1929 bis 1939. Die Krisenfolgen der zehnjährigen Dauerkrise in Japan sind schon schlimmer als die Folgen der 29er Krise in den USA: „Der gesamte Produktionsrückgang in Japan während der Krisenjahre (1993-2003) könnte die Wirtschaftsverluste der großen US-Wirtschaftskrise der 30er Jahre weit übertreffen.“ (‚Economist` 2.3.2002, 76). Die heutige Weltwirtschaftskrise nimmt vielleicht nicht den gleichen Verlauf wie die kapitalistische Mega-Krise von 1929ff, aber die Folgen für uns alle werden ähnlich gravierend sein.
"Die Lage ist dramatisch", sagte Martin Hüfner, Chefvolkswirt der HypoVereinsbank. Die Wachstumsverluste werden das Staatsdefizit weiter in die Höhe treiben. Faustformeln zufolge steigt die Defizitquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt um einen halben Prozentpunkt, wenn das Wachstum um ein Prozent nachlässt. Selbst Defizitwerte von mehr als vier Prozent gelten jetzt als möglich - statt der im Stabilitätspakt fixierten maximal drei Prozent.
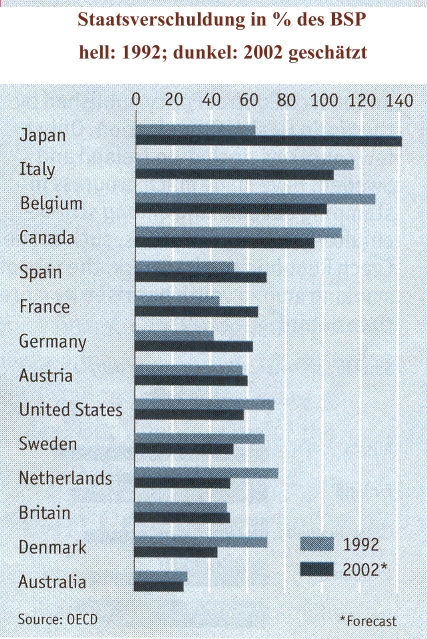
An der Grafik zu den Staatsschulden der Kapitalnationen wird sichtbar: Die „Verteilungsspielräume“, mit denen man große Teile der lohnabhängigen Bevölkerung „ruhig stellen“ kann, sind weg. Damit ist auch die politische Basis weg für jede SPD-Regierung. Was politisch noch kommen kann ist nur noch das „Wechselspiel“ zwischen heimlicher großer Koalition der bürgerlichen Parteien und offener großer Koalition der bürgerlichen Parteien. Was noch kommen kann, ist eine Dauer-Notstandsregierung aller „staatstragenden“ Parteien gegen das Volk. Es kann also nicht viele Neues kommen. Aber die Lügenspielräume für diese Parteien werden eng.
Dramatische Krise droht sich zu verstärken
Die Krise droht sich selbst zu verstärken. "Die konjunkturellen Probleme dauern mittlerweile zu lange, sodass ein neuer Aufschwung immer schwerer wird", sagte Gustav Horn, Konjunkturchef am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Grund: Firmen und Verbraucher passen ihre Erwartungen und Pläne immer mehr nach unten an, je länger der Aufschwung ausbleibt.
Laut Adolf Rosenstock von Nomura International entsteht durch die anhaltende Flaute eine gefährliche Mischung aus Nachfrageschwäche und geringerem Preisauftrieb. Das könne angesichts der ohnehin geringen Teuerung in Deutschland in eine Deflation münden, in der fallende Preise dazu führen, dass die Verbraucher in Erwartung sinkender Preise Anschaffungen aufschieben, was die Krise noch verstärkt. Dazu kommt: Bei fallenden Preisen steigen die realen Schulden von Firmen und Konsumenten.
Ist also die Krise an der Krise schuld? In jeder Wirtschaftskrise machen nicht nur Unternehmen bankrott, auch die Ökonomen, die Ideologen des Kapitals sehen ihren Bankrott. Erst wird die Krise auf Teufel komm raus geleugnet. Wenn sie nicht länger geleugnet werden kann, dann werden die lächerlichsten Ursachen für die Krise genannt: Der Terrorismus, SARS – oder eben die Krise selber. Vertuscht werden soll, dass die Kapitalistenklasse die Wirtschaft in den Sand gefahren hat. Vertuscht werden soll, dass der entwickelte Kapitalismus sich neue Aufschwungphasen nur noch durch zerstörerische Bankrotte und zerstörerische Kriege erkaufen kann. Vertuscht werden soll, dass der Kapitalismus selber eine zerstörerische Produktionsweise ist.
„In den Weltmarktkrisen bringen es die Widersprüche und Gegensätze der bürgerlichen Produktion zum Eklat. Statt nun zu untersuchen, worin die widerstreitenden Elemente bestehen, die in der Katastrophe eskalieren, begnügen sich die Befürworter des Systems damit, die Katastrophe selbst zu leugnen und ihrer gesetzmäßigen Periodizität gegenüber darauf zu beharren, dass die Produktion, wenn sie sich nach den Schulbüchern richtete, es nie zur Krise bringen würde.“ K. Marx, Theorien über den Mehrwert II., MEW 26.2, 500f.
Szenario noch abwendbar
Laut Horn könnten die Politiker ein solches Szenario noch abwenden: "Die Wirtschaft bräuchte jetzt einen großen Impuls, zum Beispiel durch eine weitere deutliche Senkung der Leitzinsen im Euro-Raum."
Wenn die Wirtschaft boomt, dann verlangen die Kapitalisten, dass sie vom Staat möglichst in Ruhe gelassen werden, dass sie ungestört ihre Profite einstreichen können. Wenn die Unternehmer erst den Wirtschaftskarren in den Dreck gefahren haben, dann sollen Regierungen und Politiker ihnen aus dem Dreck helfen. Der Staat und alle Regierungen sind aber durch die öffentliche Verschuldung selber in die Krise verstrickt und kann daher nichts zur Lösung beitragen.
Es müsste laut Horn zudem eine europäisch koordinierte Aktion der Finanzpolitik geben, bei der zum Beispiel die Steuern gesenkt würden. Heikel wäre es den meisten Experten zufolge, wenn Berlin die jetzt konjunkturbedingt entstehenden Einnahmeausfälle durch höhere Steuern und Abgaben oder hektische Ausgabenkürzungen zu kompensieren versuchte. "Die Bundesregierung muss auf jeden Fall die Staatsdefizite hinnehmen, sonst verschlimmert sie die Lage nur", sagte Rüdiger Pohl, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
Die Regierung kann also die Lage höchstens „verschlimmern“, etwas positiv erreichen kann sie nicht.
Auf Anhieb wird laut Rosenstock die Agenda 2010 kaum helfen, weil sie erst langfristig wirke und auf kurze Sicht sogar die Nachfrage belasten könne. Laut Pohl kommt es jetzt auf eine vernünftige Mischung aus Reformen und Schonung der Konjunktur an. "Wir sind so auf die Behebung der langfristigen Strukturprobleme fixiert, dass wir übersehen, dass die Konjunktur kurz vor dem Kollaps steht", sagte Rosenstock.“
Die Regierung ist tief verschuldet und soll noch mehr Schulden machen. Die Lohnarbeiter leiden unter gesunkenen Lohneinkommen und sollen noch weitere Einkommenseinbußen durch Erhöhung von Steuern und Abgaben und durch Senkung von Sozialleistungen hinnehmen.
„Wodurch überwindet die Bourgeoisie Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung der alten Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.“ Karl Marx, Kommunistisches Manifest, MEW 4, 468.
Normaltext ungekürzt aus: FTD, 16.5.2003
Roter Kommentar: Wal Buchenberg, 16.5.2003
Karl Marx über kapitalistische
FTD: Krise, wohin man blickt (mit eigenem Kommentar)
[ Börse & Wirtschaft: Elliott-Wellen-Forum ]
Geschrieben von Wal Buchenberg am 16. Mai 2003 08:35:51:
FTD: Kapitalistische Krise, wohin man blickt
„Die Wirtschaft steckt in der längsten Krise der Nachkriegszeit, schon seit drei Jahren ist sie nicht mehr spürbar gewachsen.
Bisher gab es aber zwischen Medien und Regierung einen Schweigepakt: Die elende Wirtschaftslage mit rund 5 Millionen Arbeitslosen und Rekordpleiten sollte und durfte nicht Krise genannt werden.
Warum nicht? Einmal, um die schwache Regierung zu stützen, aber auch, weil keine systemkonforme Hoffnung in Sicht ist: Weder gibt es – wie in früheren Krisen – eine Weltregion, die als kapitalistischer Wachstumsmotor in Frage kommt, noch kann man die Krisenursachen auf Rückständige Branchen wie Kohle, Stahl oder Textil schieben – nein die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist weltweit und hat mit der IT-Branche den größten kapitalistischen Hoffnungsträger infiziert.
Das bringt nach Einschätzung vieler Ökonomen eine ganz neue Qualität von Problemen mit sich. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Daten zur Wirtschaftsleistung im ersten Quartal steckt die Wirtschaft mit großer Wahrscheinlichkeit nun schon zum zweiten Mal seit 2001 in der Rezession. Einen solchen Double Dip erlitt die Wirtschaft zuletzt 1981. Anders als damals hat es nun allerdings auch in der kurzen Zeit zwischen den Dips kaum Wachstum gegeben. Für das laufende zweite Quartal rechnen Ökonomen mit einem weiteren Minus.
Der Vergleich mit 1981 ist schönfärberisch. Der einzig zutreffende Vergleich ist der mit den Weltwirtschaftsproblemen von 1929 bis 1939. Die Krisenfolgen der zehnjährigen Dauerkrise in Japan sind schon schlimmer als die Folgen der 29er Krise in den USA: „Der gesamte Produktionsrückgang in Japan während der Krisenjahre (1993-2003) könnte die Wirtschaftsverluste der großen US-Wirtschaftskrise der 30er Jahre weit übertreffen.“ (‚Economist` 2.3.2002, 76). Die heutige Weltwirtschaftskrise nimmt vielleicht nicht den gleichen Verlauf wie die kapitalistische Mega-Krise von 1929ff, aber die Folgen für uns alle werden ähnlich gravierend sein.
"Die Lage ist dramatisch", sagte Martin Hüfner, Chefvolkswirt der HypoVereinsbank. Die Wachstumsverluste werden das Staatsdefizit weiter in die Höhe treiben. Faustformeln zufolge steigt die Defizitquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt um einen halben Prozentpunkt, wenn das Wachstum um ein Prozent nachlässt. Selbst Defizitwerte von mehr als vier Prozent gelten jetzt als möglich - statt der im Stabilitätspakt fixierten maximal drei Prozent.
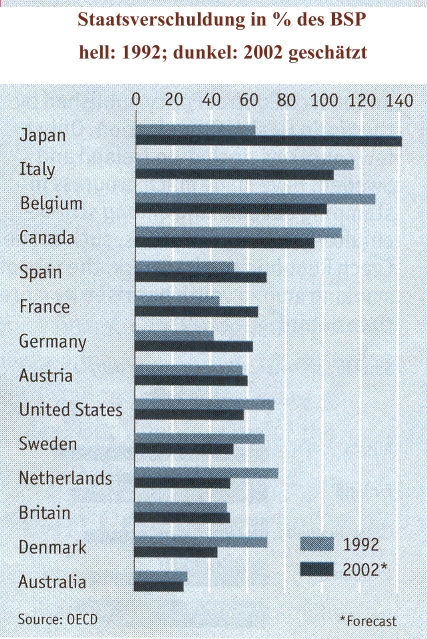
An der Grafik zu den Staatsschulden der Kapitalnationen wird sichtbar: Die „Verteilungsspielräume“, mit denen man große Teile der lohnabhängigen Bevölkerung „ruhig stellen“ kann, sind weg. Damit ist auch die politische Basis weg für jede SPD-Regierung. Was politisch noch kommen kann ist nur noch das „Wechselspiel“ zwischen heimlicher großer Koalition der bürgerlichen Parteien und offener großer Koalition der bürgerlichen Parteien. Was noch kommen kann, ist eine Dauer-Notstandsregierung aller „staatstragenden“ Parteien gegen das Volk. Es kann also nicht viele Neues kommen. Aber die Lügenspielräume für diese Parteien werden eng.
Dramatische Krise droht sich zu verstärken
Die Krise droht sich selbst zu verstärken. "Die konjunkturellen Probleme dauern mittlerweile zu lange, sodass ein neuer Aufschwung immer schwerer wird", sagte Gustav Horn, Konjunkturchef am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Der Grund: Firmen und Verbraucher passen ihre Erwartungen und Pläne immer mehr nach unten an, je länger der Aufschwung ausbleibt.
Laut Adolf Rosenstock von Nomura International entsteht durch die anhaltende Flaute eine gefährliche Mischung aus Nachfrageschwäche und geringerem Preisauftrieb. Das könne angesichts der ohnehin geringen Teuerung in Deutschland in eine Deflation münden, in der fallende Preise dazu führen, dass die Verbraucher in Erwartung sinkender Preise Anschaffungen aufschieben, was die Krise noch verstärkt. Dazu kommt: Bei fallenden Preisen steigen die realen Schulden von Firmen und Konsumenten.
Ist also die Krise an der Krise schuld? In jeder Wirtschaftskrise machen nicht nur Unternehmen bankrott, auch die Ökonomen, die Ideologen des Kapitals sehen ihren Bankrott. Erst wird die Krise auf Teufel komm raus geleugnet. Wenn sie nicht länger geleugnet werden kann, dann werden die lächerlichsten Ursachen für die Krise genannt: Der Terrorismus, SARS – oder eben die Krise selber. Vertuscht werden soll, dass die Kapitalistenklasse die Wirtschaft in den Sand gefahren hat. Vertuscht werden soll, dass der entwickelte Kapitalismus sich neue Aufschwungphasen nur noch durch zerstörerische Bankrotte und zerstörerische Kriege erkaufen kann. Vertuscht werden soll, dass der Kapitalismus selber eine zerstörerische Produktionsweise ist.
„In den Weltmarktkrisen bringen es die Widersprüche und Gegensätze der bürgerlichen Produktion zum Eklat. Statt nun zu untersuchen, worin die widerstreitenden Elemente bestehen, die in der Katastrophe eskalieren, begnügen sich die Befürworter des Systems damit, die Katastrophe selbst zu leugnen und ihrer gesetzmäßigen Periodizität gegenüber darauf zu beharren, dass die Produktion, wenn sie sich nach den Schulbüchern richtete, es nie zur Krise bringen würde.“ K. Marx, Theorien über den Mehrwert II., MEW 26.2, 500f.
Szenario noch abwendbar
Laut Horn könnten die Politiker ein solches Szenario noch abwenden: "Die Wirtschaft bräuchte jetzt einen großen Impuls, zum Beispiel durch eine weitere deutliche Senkung der Leitzinsen im Euro-Raum."
Wenn die Wirtschaft boomt, dann verlangen die Kapitalisten, dass sie vom Staat möglichst in Ruhe gelassen werden, dass sie ungestört ihre Profite einstreichen können. Wenn die Unternehmer erst den Wirtschaftskarren in den Dreck gefahren haben, dann sollen Regierungen und Politiker ihnen aus dem Dreck helfen. Der Staat und alle Regierungen sind aber durch die öffentliche Verschuldung selber in die Krise verstrickt und kann daher nichts zur Lösung beitragen.
Es müsste laut Horn zudem eine europäisch koordinierte Aktion der Finanzpolitik geben, bei der zum Beispiel die Steuern gesenkt würden. Heikel wäre es den meisten Experten zufolge, wenn Berlin die jetzt konjunkturbedingt entstehenden Einnahmeausfälle durch höhere Steuern und Abgaben oder hektische Ausgabenkürzungen zu kompensieren versuchte. "Die Bundesregierung muss auf jeden Fall die Staatsdefizite hinnehmen, sonst verschlimmert sie die Lage nur", sagte Rüdiger Pohl, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
Die Regierung kann also die Lage höchstens „verschlimmern“, etwas positiv erreichen kann sie nicht.
Auf Anhieb wird laut Rosenstock die Agenda 2010 kaum helfen, weil sie erst langfristig wirke und auf kurze Sicht sogar die Nachfrage belasten könne. Laut Pohl kommt es jetzt auf eine vernünftige Mischung aus Reformen und Schonung der Konjunktur an. "Wir sind so auf die Behebung der langfristigen Strukturprobleme fixiert, dass wir übersehen, dass die Konjunktur kurz vor dem Kollaps steht", sagte Rosenstock.“
Die Regierung ist tief verschuldet und soll noch mehr Schulden machen. Die Lohnarbeiter leiden unter gesunkenen Lohneinkommen und sollen noch weitere Einkommenseinbußen durch Erhöhung von Steuern und Abgaben und durch Senkung von Sozialleistungen hinnehmen.
„Wodurch überwindet die Bourgeoisie Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung der alten Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.“ Karl Marx, Kommunistisches Manifest, MEW 4, 468.
Normaltext ungekürzt aus: FTD, 16.5.2003
Roter Kommentar: Wal Buchenberg, 16.5.2003
Karl Marx über kapitalistische
.

Wirtschaftskrise - Keine Hoffnung auf Genesung
Von M. Schieritz, A. Krosta, C. Karweil und C. Baulig
Die versammelten Finanzminister übten sich in Optimismus: Man halte an den derzeitigen Wachstumsprognosen fest, die Wirtschaft werde sich wieder erholen, so das Abschluss-Kommuniqué zum Treffen der Ressortchefs aus den sieben wichtigsten Industrienationen (G7) am Wochenende im französischen Badeort Deauville.
Nur John Snow moserte am Rand der Veranstaltung: "Das Wachstum in den großen Volkswirtschaften ist nicht so hoch, wie es sein könnte", sagte der US-Finanzminister. "Wir müssen mehr unternehmen, um eine schnelle Gesundung zu erreichen."
Von Rekonvaleszenz ist auf dem Alten Kontinent keine Spur. Im Euro-Raum breitet sich das Krisenvirus aus. Italiens Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft, die Niederlande stecken bereits in der Rezession, und Deutschland, die größte Euro-Volkswirtschaft, steuert mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Double Dip zu, die zweite Rezession innerhalb von zwei Jahren. Um 0,2 Prozent ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März zurück, vermeldete das Statistische Bundesamt vergangene Woche, im Gesamtjahr dürfte die Wirtschaft damit nach Einschätzung von Bankvolkswirten annähernd stagnieren. Die Krise setzt sich fest, weil Verbraucher und Unternehmen hier zu Lande damit rechnen, das alles noch viel schlimmer wird.
US-Wirtschaft droht Deflation
Besonders gravierend wird die Lage für die Deutschen dadurch, dass es in den anderen Wirtschaftsblöcken kaum besser aussieht: Nur ein Jahr nach der letzten Rezession 2001 ist Japans Wirtschaftswachstum im ersten Quartal diesen Jahres wieder zum Erliegen gekommen. Für das laufende Vierteljahr erwarten die meisten Experten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung.
Die US-Wirtschaft ist zwar bislang noch vergleichsweise robust gewachsen, doch dafür droht den Amerikanern der Absturz in die Deflation - einen kontinuierlichen Rückgang des Preisniveaus über einen längeren Zeitraum. Vorvergangene Woche warnte die US-Notenbank Fed überraschend eindeutig vor einem "unwillkommenen Rückgang der Inflationsraten". Die Folgen wären dramatisch: Weil sich Konsumenten auf fallende Preise einstellen, verschieben sie Anschaffungen und treiben die Wirtschaft weiter in die Krise. Zugleich steigt der reale Wert von Schulden, was Verbraucher und Unternehmen in den Ruin treiben könnte.
Neue Weltrezession befürchtet
Von einer schnellen Erholung der globalen Ökonomie nach dem Sieg über Saddam Hussein und dem Wegfall der kriegsbedingten Unsicherheit, wie sie sich viele Experten erhofft hatten, ist derzeit nichts zu sehen. Im Gegenteil. Nach den Anschlägen von Riad und Casablanca wächst die Angst vor weiteren Terroranschlägen, die Lungenkrankheit SARS bringt den bisherigen Wachstumsmotor Asien zum Stottern. Weltbank und Bankvolkswirte mussten bereits ihre Prognosen für die Region nach unten revidieren. "Wir stehen vor einer erneuten Weltrezession", sagt Stephen Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley. Es wäre die zweite globale Krise in nur drei Jahren.
Schon warnen Experten davor, dass sich die anhaltende Flaute selbst zu nähren droht. Besonders in Deutschland ist diese Gefahr groß. "Wir haben eine gravierende konjunkturelle Krise, und es gibt ein Risiko, dass aus einer anhaltenden konjunkturellen Schwäche eine strukturelle Schwäche wird", sagt Rüdiger Pohl von Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
Schlechte Wachstumsaussichten verdunkeln die Absatzchancen der Unternehmen. "Wir befinden uns im dritten Abschwungjahr", sagt Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte wäre ein Aufschwung fällig, aber das Geschäft dümpelt so dahin." Wenn Aufträge eingehen, kommen sie kurzfristig und nur für kleine Stückzahlen. Keine Voraussetzung, um zusätzliches Personal einzustellen oder neue Anlagen anzuschaffen. "Investitionen werden tendenziell zurückgefahren", beobachtet Wiechers bei den Mitgliedsfirmen des Verbandes.
Investitionen werden radikal gekürzt
Warum auch sollten Firmen in die Tasche greifen, wenn ihre Kunden selbst ihre Investitionsbudgets radikal zusammenstreichen? Der Chemiekonzern Bayer verzichtet 2003 auf ursprünglich geplante Ausgaben in Höhe von 540 Mio. Euro. Die Deutsche Telekom glänzt mit einem Quartalsgewinn nicht zuletzt deshalb, weil die Ausgaben für den Ausbau des UMTS-Netzes massiv reduziert worden sind. Und Bosch -Finanzchef Gerhard Kümmel kündigt an, einen Teil der Investitionen des Elektronikunternehmens um ein bis zwei Monate zurückzustellen, weil er zunächst "den weiteren Verlauf der Konjunktur beobachten" wolle. "Jeder wartet ab, und unterm Strich passiert nichts", fasst VDMA-Ökonom Wiechers die Misere zusammen.
Was für den Einzelnen rational ist, führt gesamtwirtschaftlich in die Katastrophe. "Unternehmen und Konsumenten drohen sich in ihrem Verhalten immer mehr darauf einzustellen, dass es ohnehin kaum mehr Wachstum gibt", sagte Heiner Flassbeck, Chefökonom der Uno-Handelsorganisation Unctad. "Diese Vermutung erfüllt sich daher allmählich von selbst."
Der Pessimismus greift um sich. "Wenn eine Wirtschaft bereits gravierende Probleme hat und dann noch externe Probleme hinzukommen - wie etwa der steigenden Euro und einen schwache Auslandsnachfrage - wächst das Risiko einer Abwärtsspirale", sagt Holger Schmieding, Europa-Chefvolkswirt bei der Bank of America.
Wirtschaftspolitik reduziert Wachstum
Die Wirtschaftspolitik trägt ihren Teil zur Verschärfung der Krise bei. Die schwache Konjunktur führt dazu, dass Steuereinnahmen wegbrechen und die Ausgaben, etwa für Arbeitslose, steigen. Versucht der Staat gegenzusteuern, um das Haushaltsdefizit zu begrenzen, droht er die Nachfrage weiter zu schwächen - die Konjunktur bricht noch heftiger ein, der Etat gerät tiefer in die roten Zahlen und das nächste Konsolidierungsprogramm muss her.
Die deutsche Wirtschaft ist nach Ansicht vieler Experten Opfer dieses Mechanismus. Als das Etatdefizit im vergangenen Jahr über die im EU-Vertrag festgeschriebene Marke von 3,0 Prozent des BIP stieg, reagierte Finanzminister Hans Eichel mit kräftigen Steuer- und Abgabenerhöhungen, um den Fehlbetrag wieder unter die Grenze zu drücken. "Das verunsichert die Verbraucher und dämpft die Wirtschaft", sagt Stefan Schneider von Deutsche Bank Research. Nach Schätzungen der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute reduzieren die Maßnahmen 2003 das Wachstum hier zu Lande um etwa 0,5 Prozentpunkte.
Vergangene Woche musste Eichel eingestehen, dass das Etatdefizit auch in diesem Jahr über der Drei-Prozent-Marke liegt - und schon kündigt das Finanzministerium neue Einsparpakete an. "Die rezessiven Tendenzen fressen sich fest", sagt Adolf Rosenstock, Deutschland-Experte beim japanischen Investmenthaus Nomura International. Die von der Bundesregierung geplanten Sozialreformen seien zwar wichtig, um die langfristigen Wachstumschancen zu verbessern, sie würden indes nicht dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln.
Volkswirte fordern Erste-Hilfe-Maßnahmen
Angesichts der dramatischen Lage mehren sich die Stimmen, die die Politik zu entschlossenem Handeln aufrufen. "Die deutsche Wirtschaft ist wie die europäische in einem kritischen Zustand und braucht dringend Erste-Hilfe-Maßnahmen", sagt Morgan-Stanley-Ökonom Roach, "man sollte Deutschland erlauben, dass Etatdefizit steigen zu lassen, statt verzweifelt und erfolglos zu versuchen, es zu drücken."
Die Geldpolitik, fordern Volkswirte, müsse ebenfalls reagieren. "Europa ist in eine unvorsichtige, abwartende Haltung verfallen", stellen die Ökonomen des Pariser Forschungsinstituts OFCE fest, "die Europäische Zentralbank reagiert viel zu spät auf schlechte Nachrichten." Zwar rechnen die meisten Volkswirte im Juni mit einer Zinssenkung auf 2,0 Prozent - doch das könnte noch zu wenig sein. "Wenn der Euro weiter aufwertet und die Erholung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr ausbleibt, müssten die Zinsen auf 1,5 Prozent fallen", sagt Joachim Fels, Europa-Chefökonom bei Morgan Stanley.
Während Europas Fiskal- und Geldpolitiker noch zaudern, steuern ihre amerikanischen Kollegen massiv gegen: Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins seit dem Höchststand im Jahr 2000 um 550 Basispunkte auf nunmehr 1,25 Prozent gesenkt. Und mit ihrer Deflationswarnung hat die Fed nach Einschätzung von Peter Hooper, US-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, klar gemacht, dass sie bereit ist, auf die Gefahr sinkender Preise zu reagieren.
Unkonventionelle Maßnahmen
Da der Notenbank nicht mehr viel Spielraum bleibt, erwägen die Fed-Gouverneure unkonventionelle Mittel, um die Wirtschaft zu stimulieren, etwa den Ankauf von Staatsanleihen, wodurch die langfristigen Zinsen sinken könnten.
Auch die Finanzpolitik öffnet die Schleusen. Nur zwei Jahre nach dem letzten Steuersenkungsprogramm plant die Bush-Regierung ein neues Paket, das Bürger und Unternehmen in den kommenden zehn Jahren um mindestens 350 Mrd. $ entlasten soll. Allein in diesem Jahr soll das Wirtschaftswachstum dadurch um 0,3 Prozentpunkte steigen. Dass das Haushaltsdefizit dadurch auf 4,0 Prozent klettert, nimmt Bush in Kauf. Für Morgan-Stanley-Chefvolkswirt Roach ist dies eine Stimmungskur, an der sich die Deutschen ein Beispiel nehmen könnten.

Die Wirtschaft in Europa und Japan stagniert. Das magere Wachstum in den USA liefert für den Rest der Welt kaum Impulse.

Während die Regierung Bush ein wachsendes Haushaltsdefizit in Kauf nimmt, halten die Euro-Staaten am Sparkurs fest.

Auf beiden Seiten des Atlantiks sind die Erwartungen gedämpft. Kaum ein Unternehmen rechnet mit einer schnellen Erholung.

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen auf 1,25 Prozent gesenkt. In der Euro-Zone ist der Zinssatz noch doppelt so hoch.
(...)
Ein Rückschlag würde der Börse nur gut tun
Nicht umsonst gilt die Börse als einer der besseren Konjunktur-Frühindikatoren. Und in der Tat gibt es mehr Lichtblicke, als man denkt. Dass das Michigan-Verbrauchervertrauen Anfang Mai neuerlich sprunghaft zulegte, zählt zwar nicht dazu.
Denn der wöchentliche ABC-Konsumentenindex ist unterdessen zum dritten Mal in Folge gesunken, und beim Michigan-Index explodierten nur die volatilen Erwartungen, während sich die Lageeinschätzung sogar verdüsterte. Trotzdem, Alan Greenspan legt es mit seiner Rhetorik so unverkennbar auf günstigere Refinanzierungsbedingungen - also auch steigende Aktienkurse - an, dass nur noch das Wort von der irrationalen Schwermut fehlt. Die Anleger sehen derweil, dass sich viele Firmen langsam gesund gespart haben und wetten folglich auf ein Ende der Investitions- und Einstellungsscheu.
Tatsächlich sprechen die implodierten Nettoinvestitionen für Ersatzbedarfund die Zinsen auf "Baa"-Anleihen sind ja seit Mai 2002 von 8,1 auf nunmehr 6,3 Prozent gesunken. Dazu kommen weitere Steuersenkungen - und vermutlich eine neue Immobilienrefinanzierungswelle.
Aber das ist nicht alles. Der jüngste Rückgang der US-Kernimportpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem März war zwar genau so schockierend wie jener der Kernproduzentenpreise. Doch nicht nur wegen des Dollar-Verfalls können zumindest die US-Firmen bald auf milderen Preisdruck hoffen. In China, das seine Währung an den Dollar gebunden hat und für viele als Herd der Deflation gilt, haben die Verbraucherpreise zuletzt bereits um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr angezogen, nachdem sie jahrelang sanken. Vor allem die brummenden Exporte haben Kapazitäten absorbiert, während die Geldpresse weiter auf Hochtouren läuft. ,
Gehen wir also für einen Moment davon aus, dass SARS, Terror sowie die Überkapazitäten, der Sparmangel und die Verschuldung in den USA einen nachhaltigen Aufschwung nicht aufhalten können. Rechnen wir sodann mit den Konsensgewinnschätzungen, wiewohl die deutlich über dem realen Nachkriegstrend liegen. Dann notierte der S&P 500 mit einem 2003er KGV von 17,5. Das wäre vielleicht noch fair, wenn es nicht an Fahrlässigkeit grenzte, sich der an der Wall Street gängigen Definition von Gewinn anzuschließen. Aber attraktiv sind Standardaktien nicht mal mit einem KGV von 17,5.
Derweil sind die Vorzeichen im stagnierenden, strukturell verkommenen und demografisch bedrängten Europa gerade umgekehrt. Zwar sind die Aktien hier viel billiger. Dafür wird der Preisdruck wegen des Euro noch stärker, während schon kleinste Reformen von Interessengruppen torpediert werden, die Steuern wegen Maastricht eher angehoben als gesenkt werden und die Zentralbank gern erst dann reagiert, wenn es fast zu spät ist. Auch die europäischen Börsen brauchen daher erst einen Rückschlag, damit Aktien wieder das Risiko wert werden, das man sich mit ihnen einhandelt.
(...)
FTD – 19.05.2003

Wirtschaftskrise - Keine Hoffnung auf Genesung
Von M. Schieritz, A. Krosta, C. Karweil und C. Baulig
Die versammelten Finanzminister übten sich in Optimismus: Man halte an den derzeitigen Wachstumsprognosen fest, die Wirtschaft werde sich wieder erholen, so das Abschluss-Kommuniqué zum Treffen der Ressortchefs aus den sieben wichtigsten Industrienationen (G7) am Wochenende im französischen Badeort Deauville.
Nur John Snow moserte am Rand der Veranstaltung: "Das Wachstum in den großen Volkswirtschaften ist nicht so hoch, wie es sein könnte", sagte der US-Finanzminister. "Wir müssen mehr unternehmen, um eine schnelle Gesundung zu erreichen."
Von Rekonvaleszenz ist auf dem Alten Kontinent keine Spur. Im Euro-Raum breitet sich das Krisenvirus aus. Italiens Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft, die Niederlande stecken bereits in der Rezession, und Deutschland, die größte Euro-Volkswirtschaft, steuert mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Double Dip zu, die zweite Rezession innerhalb von zwei Jahren. Um 0,2 Prozent ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Januar und März zurück, vermeldete das Statistische Bundesamt vergangene Woche, im Gesamtjahr dürfte die Wirtschaft damit nach Einschätzung von Bankvolkswirten annähernd stagnieren. Die Krise setzt sich fest, weil Verbraucher und Unternehmen hier zu Lande damit rechnen, das alles noch viel schlimmer wird.
US-Wirtschaft droht Deflation
Besonders gravierend wird die Lage für die Deutschen dadurch, dass es in den anderen Wirtschaftsblöcken kaum besser aussieht: Nur ein Jahr nach der letzten Rezession 2001 ist Japans Wirtschaftswachstum im ersten Quartal diesen Jahres wieder zum Erliegen gekommen. Für das laufende Vierteljahr erwarten die meisten Experten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung.
Die US-Wirtschaft ist zwar bislang noch vergleichsweise robust gewachsen, doch dafür droht den Amerikanern der Absturz in die Deflation - einen kontinuierlichen Rückgang des Preisniveaus über einen längeren Zeitraum. Vorvergangene Woche warnte die US-Notenbank Fed überraschend eindeutig vor einem "unwillkommenen Rückgang der Inflationsraten". Die Folgen wären dramatisch: Weil sich Konsumenten auf fallende Preise einstellen, verschieben sie Anschaffungen und treiben die Wirtschaft weiter in die Krise. Zugleich steigt der reale Wert von Schulden, was Verbraucher und Unternehmen in den Ruin treiben könnte.
Neue Weltrezession befürchtet
Von einer schnellen Erholung der globalen Ökonomie nach dem Sieg über Saddam Hussein und dem Wegfall der kriegsbedingten Unsicherheit, wie sie sich viele Experten erhofft hatten, ist derzeit nichts zu sehen. Im Gegenteil. Nach den Anschlägen von Riad und Casablanca wächst die Angst vor weiteren Terroranschlägen, die Lungenkrankheit SARS bringt den bisherigen Wachstumsmotor Asien zum Stottern. Weltbank und Bankvolkswirte mussten bereits ihre Prognosen für die Region nach unten revidieren. "Wir stehen vor einer erneuten Weltrezession", sagt Stephen Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley. Es wäre die zweite globale Krise in nur drei Jahren.
Schon warnen Experten davor, dass sich die anhaltende Flaute selbst zu nähren droht. Besonders in Deutschland ist diese Gefahr groß. "Wir haben eine gravierende konjunkturelle Krise, und es gibt ein Risiko, dass aus einer anhaltenden konjunkturellen Schwäche eine strukturelle Schwäche wird", sagt Rüdiger Pohl von Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
Schlechte Wachstumsaussichten verdunkeln die Absatzchancen der Unternehmen. "Wir befinden uns im dritten Abschwungjahr", sagt Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte wäre ein Aufschwung fällig, aber das Geschäft dümpelt so dahin." Wenn Aufträge eingehen, kommen sie kurzfristig und nur für kleine Stückzahlen. Keine Voraussetzung, um zusätzliches Personal einzustellen oder neue Anlagen anzuschaffen. "Investitionen werden tendenziell zurückgefahren", beobachtet Wiechers bei den Mitgliedsfirmen des Verbandes.
Investitionen werden radikal gekürzt
Warum auch sollten Firmen in die Tasche greifen, wenn ihre Kunden selbst ihre Investitionsbudgets radikal zusammenstreichen? Der Chemiekonzern Bayer verzichtet 2003 auf ursprünglich geplante Ausgaben in Höhe von 540 Mio. Euro. Die Deutsche Telekom glänzt mit einem Quartalsgewinn nicht zuletzt deshalb, weil die Ausgaben für den Ausbau des UMTS-Netzes massiv reduziert worden sind. Und Bosch -Finanzchef Gerhard Kümmel kündigt an, einen Teil der Investitionen des Elektronikunternehmens um ein bis zwei Monate zurückzustellen, weil er zunächst "den weiteren Verlauf der Konjunktur beobachten" wolle. "Jeder wartet ab, und unterm Strich passiert nichts", fasst VDMA-Ökonom Wiechers die Misere zusammen.
Was für den Einzelnen rational ist, führt gesamtwirtschaftlich in die Katastrophe. "Unternehmen und Konsumenten drohen sich in ihrem Verhalten immer mehr darauf einzustellen, dass es ohnehin kaum mehr Wachstum gibt", sagte Heiner Flassbeck, Chefökonom der Uno-Handelsorganisation Unctad. "Diese Vermutung erfüllt sich daher allmählich von selbst."
Der Pessimismus greift um sich. "Wenn eine Wirtschaft bereits gravierende Probleme hat und dann noch externe Probleme hinzukommen - wie etwa der steigenden Euro und einen schwache Auslandsnachfrage - wächst das Risiko einer Abwärtsspirale", sagt Holger Schmieding, Europa-Chefvolkswirt bei der Bank of America.
Wirtschaftspolitik reduziert Wachstum
Die Wirtschaftspolitik trägt ihren Teil zur Verschärfung der Krise bei. Die schwache Konjunktur führt dazu, dass Steuereinnahmen wegbrechen und die Ausgaben, etwa für Arbeitslose, steigen. Versucht der Staat gegenzusteuern, um das Haushaltsdefizit zu begrenzen, droht er die Nachfrage weiter zu schwächen - die Konjunktur bricht noch heftiger ein, der Etat gerät tiefer in die roten Zahlen und das nächste Konsolidierungsprogramm muss her.
Die deutsche Wirtschaft ist nach Ansicht vieler Experten Opfer dieses Mechanismus. Als das Etatdefizit im vergangenen Jahr über die im EU-Vertrag festgeschriebene Marke von 3,0 Prozent des BIP stieg, reagierte Finanzminister Hans Eichel mit kräftigen Steuer- und Abgabenerhöhungen, um den Fehlbetrag wieder unter die Grenze zu drücken. "Das verunsichert die Verbraucher und dämpft die Wirtschaft", sagt Stefan Schneider von Deutsche Bank Research. Nach Schätzungen der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute reduzieren die Maßnahmen 2003 das Wachstum hier zu Lande um etwa 0,5 Prozentpunkte.
Vergangene Woche musste Eichel eingestehen, dass das Etatdefizit auch in diesem Jahr über der Drei-Prozent-Marke liegt - und schon kündigt das Finanzministerium neue Einsparpakete an. "Die rezessiven Tendenzen fressen sich fest", sagt Adolf Rosenstock, Deutschland-Experte beim japanischen Investmenthaus Nomura International. Die von der Bundesregierung geplanten Sozialreformen seien zwar wichtig, um die langfristigen Wachstumschancen zu verbessern, sie würden indes nicht dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln.
Volkswirte fordern Erste-Hilfe-Maßnahmen
Angesichts der dramatischen Lage mehren sich die Stimmen, die die Politik zu entschlossenem Handeln aufrufen. "Die deutsche Wirtschaft ist wie die europäische in einem kritischen Zustand und braucht dringend Erste-Hilfe-Maßnahmen", sagt Morgan-Stanley-Ökonom Roach, "man sollte Deutschland erlauben, dass Etatdefizit steigen zu lassen, statt verzweifelt und erfolglos zu versuchen, es zu drücken."
Die Geldpolitik, fordern Volkswirte, müsse ebenfalls reagieren. "Europa ist in eine unvorsichtige, abwartende Haltung verfallen", stellen die Ökonomen des Pariser Forschungsinstituts OFCE fest, "die Europäische Zentralbank reagiert viel zu spät auf schlechte Nachrichten." Zwar rechnen die meisten Volkswirte im Juni mit einer Zinssenkung auf 2,0 Prozent - doch das könnte noch zu wenig sein. "Wenn der Euro weiter aufwertet und die Erholung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr ausbleibt, müssten die Zinsen auf 1,5 Prozent fallen", sagt Joachim Fels, Europa-Chefökonom bei Morgan Stanley.
Während Europas Fiskal- und Geldpolitiker noch zaudern, steuern ihre amerikanischen Kollegen massiv gegen: Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins seit dem Höchststand im Jahr 2000 um 550 Basispunkte auf nunmehr 1,25 Prozent gesenkt. Und mit ihrer Deflationswarnung hat die Fed nach Einschätzung von Peter Hooper, US-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, klar gemacht, dass sie bereit ist, auf die Gefahr sinkender Preise zu reagieren.
Unkonventionelle Maßnahmen
Da der Notenbank nicht mehr viel Spielraum bleibt, erwägen die Fed-Gouverneure unkonventionelle Mittel, um die Wirtschaft zu stimulieren, etwa den Ankauf von Staatsanleihen, wodurch die langfristigen Zinsen sinken könnten.
Auch die Finanzpolitik öffnet die Schleusen. Nur zwei Jahre nach dem letzten Steuersenkungsprogramm plant die Bush-Regierung ein neues Paket, das Bürger und Unternehmen in den kommenden zehn Jahren um mindestens 350 Mrd. $ entlasten soll. Allein in diesem Jahr soll das Wirtschaftswachstum dadurch um 0,3 Prozentpunkte steigen. Dass das Haushaltsdefizit dadurch auf 4,0 Prozent klettert, nimmt Bush in Kauf. Für Morgan-Stanley-Chefvolkswirt Roach ist dies eine Stimmungskur, an der sich die Deutschen ein Beispiel nehmen könnten.

Die Wirtschaft in Europa und Japan stagniert. Das magere Wachstum in den USA liefert für den Rest der Welt kaum Impulse.

Während die Regierung Bush ein wachsendes Haushaltsdefizit in Kauf nimmt, halten die Euro-Staaten am Sparkurs fest.

Auf beiden Seiten des Atlantiks sind die Erwartungen gedämpft. Kaum ein Unternehmen rechnet mit einer schnellen Erholung.

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen auf 1,25 Prozent gesenkt. In der Euro-Zone ist der Zinssatz noch doppelt so hoch.
(...)
Ein Rückschlag würde der Börse nur gut tun
Nicht umsonst gilt die Börse als einer der besseren Konjunktur-Frühindikatoren. Und in der Tat gibt es mehr Lichtblicke, als man denkt. Dass das Michigan-Verbrauchervertrauen Anfang Mai neuerlich sprunghaft zulegte, zählt zwar nicht dazu.
Denn der wöchentliche ABC-Konsumentenindex ist unterdessen zum dritten Mal in Folge gesunken, und beim Michigan-Index explodierten nur die volatilen Erwartungen, während sich die Lageeinschätzung sogar verdüsterte. Trotzdem, Alan Greenspan legt es mit seiner Rhetorik so unverkennbar auf günstigere Refinanzierungsbedingungen - also auch steigende Aktienkurse - an, dass nur noch das Wort von der irrationalen Schwermut fehlt. Die Anleger sehen derweil, dass sich viele Firmen langsam gesund gespart haben und wetten folglich auf ein Ende der Investitions- und Einstellungsscheu.
Tatsächlich sprechen die implodierten Nettoinvestitionen für Ersatzbedarfund die Zinsen auf "Baa"-Anleihen sind ja seit Mai 2002 von 8,1 auf nunmehr 6,3 Prozent gesunken. Dazu kommen weitere Steuersenkungen - und vermutlich eine neue Immobilienrefinanzierungswelle.
Aber das ist nicht alles. Der jüngste Rückgang der US-Kernimportpreise um 0,9 Prozent gegenüber dem März war zwar genau so schockierend wie jener der Kernproduzentenpreise. Doch nicht nur wegen des Dollar-Verfalls können zumindest die US-Firmen bald auf milderen Preisdruck hoffen. In China, das seine Währung an den Dollar gebunden hat und für viele als Herd der Deflation gilt, haben die Verbraucherpreise zuletzt bereits um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr angezogen, nachdem sie jahrelang sanken. Vor allem die brummenden Exporte haben Kapazitäten absorbiert, während die Geldpresse weiter auf Hochtouren läuft. ,
Gehen wir also für einen Moment davon aus, dass SARS, Terror sowie die Überkapazitäten, der Sparmangel und die Verschuldung in den USA einen nachhaltigen Aufschwung nicht aufhalten können. Rechnen wir sodann mit den Konsensgewinnschätzungen, wiewohl die deutlich über dem realen Nachkriegstrend liegen. Dann notierte der S&P 500 mit einem 2003er KGV von 17,5. Das wäre vielleicht noch fair, wenn es nicht an Fahrlässigkeit grenzte, sich der an der Wall Street gängigen Definition von Gewinn anzuschließen. Aber attraktiv sind Standardaktien nicht mal mit einem KGV von 17,5.
Derweil sind die Vorzeichen im stagnierenden, strukturell verkommenen und demografisch bedrängten Europa gerade umgekehrt. Zwar sind die Aktien hier viel billiger. Dafür wird der Preisdruck wegen des Euro noch stärker, während schon kleinste Reformen von Interessengruppen torpediert werden, die Steuern wegen Maastricht eher angehoben als gesenkt werden und die Zentralbank gern erst dann reagiert, wenn es fast zu spät ist. Auch die europäischen Börsen brauchen daher erst einen Rückschlag, damit Aktien wieder das Risiko wert werden, das man sich mit ihnen einhandelt.
(...)
FTD – 19.05.2003
.
Eagle Gold Fund Index vom 16. Mai 2003

EAGLE GOLD FUND INDEX
Until now investors interested in gold and silver mining shares have had to rely on only one barometer of this global market: The venerable Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index, commonly referred to as the XAU. Since its creation the XAU has been composed of just a handful of stocks, which hopefully represented the global universe of a few thousand gold and silver mining stocks from the six continents. Although recently the XAU has added three new companies and deleted one to the index, it still remains an index composed of ONLY 11 stocks, which supposedly are representing the entire precious metals market.
These 11 stocks are:
Agnico Eagle - Apex Silver – Anglogold - Barrick Gold - Freeport McMoran Copper & Gold – Goldcorp - Gold Fields - Harmony Gold - Meridian Gold - Newmont Mining - Placer Dome
In our opinion it is NOT reasonable to believe that ONLY 11 stocks can possibly be an accurate representation of the world`s gold and silver stocks. Here is the basis of our rationale. Firstly, only one of the XAU components (Anglogold) represents gold stocks of the largest producer of the noble metal in the world: South Africa - which still produces about 25% of the western world`s mine output.
Secondly, the world`s third largest gold producing area is Australia - and the XAU shows no representation of this very important gold mining sector. And lastly, even if the XAU component mix were a good geographical cross-section of the global precious metals mining areas, statistically ONLY 11 components cannot equitably represent a universe of many thousands. It is NOT a statistically significant sample, and therefore cannot be an accurate barometer of the international market. In essence the XAU is too narrow and is a biased North-American Gold & Silver stock index.
It is precisely the inherent weaknesses of the XAU, which motivated us to create the GOLD-EAGLE Gold Fund Index. Our index is so designed as to be the best and most representative surrogate for the global gold and silver shares market.
The criteria employed to develop our index are the following:
4 Mutual Funds whose portfolios are 100% North-American and Australian
- Designated as (A).
3 Mutual Funds whose portfolios consist of approximately 50% North-American
and Australian and about 50% South African issues - Designated as (A/SA).
2 Mutual Funds whose portfolios are 100% South African shares
- designated as (SA).
Equal weight will be given to all 8 components.
Based upon the stated criteria the Gold-Eagle Gold Fund Index is composed of the following mutual funds and one closed-end Investment Trust (ASA):
1. FSAGX - Fidelity Select American Gold (A)
2. FGLDX - Invesco Strategic Gold (A)
3. SCGDX - Scudder Gold (A)
4. UNWPX - U.S. World Gold (A)
5. VGPMX - Vanguard Specilized Gold (A/SA)
6. FKRCX - Franklin Gold (A/SA)
7. ASA - American South African Investments (SA)
8. USERX - US Gold Shares (SA)
Our index is composed of 8 Global Gold Mutual Funds. Their investment portfolios contain many hundreds of different mining companies, whose operations span the earth - USA, Canada, South America, South Africa, Australia and Indonesia. The GOLD-EAGLE Gold Fund Index is truly a surrogate for the global precious metals mining shares universe.
Eagle Gold Fund Index vom 16. Mai 2003

EAGLE GOLD FUND INDEX
Until now investors interested in gold and silver mining shares have had to rely on only one barometer of this global market: The venerable Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index, commonly referred to as the XAU. Since its creation the XAU has been composed of just a handful of stocks, which hopefully represented the global universe of a few thousand gold and silver mining stocks from the six continents. Although recently the XAU has added three new companies and deleted one to the index, it still remains an index composed of ONLY 11 stocks, which supposedly are representing the entire precious metals market.
These 11 stocks are:
Agnico Eagle - Apex Silver – Anglogold - Barrick Gold - Freeport McMoran Copper & Gold – Goldcorp - Gold Fields - Harmony Gold - Meridian Gold - Newmont Mining - Placer Dome
In our opinion it is NOT reasonable to believe that ONLY 11 stocks can possibly be an accurate representation of the world`s gold and silver stocks. Here is the basis of our rationale. Firstly, only one of the XAU components (Anglogold) represents gold stocks of the largest producer of the noble metal in the world: South Africa - which still produces about 25% of the western world`s mine output.
Secondly, the world`s third largest gold producing area is Australia - and the XAU shows no representation of this very important gold mining sector. And lastly, even if the XAU component mix were a good geographical cross-section of the global precious metals mining areas, statistically ONLY 11 components cannot equitably represent a universe of many thousands. It is NOT a statistically significant sample, and therefore cannot be an accurate barometer of the international market. In essence the XAU is too narrow and is a biased North-American Gold & Silver stock index.
It is precisely the inherent weaknesses of the XAU, which motivated us to create the GOLD-EAGLE Gold Fund Index. Our index is so designed as to be the best and most representative surrogate for the global gold and silver shares market.
The criteria employed to develop our index are the following:
4 Mutual Funds whose portfolios are 100% North-American and Australian
- Designated as (A).
3 Mutual Funds whose portfolios consist of approximately 50% North-American
and Australian and about 50% South African issues - Designated as (A/SA).
2 Mutual Funds whose portfolios are 100% South African shares
- designated as (SA).
Equal weight will be given to all 8 components.
Based upon the stated criteria the Gold-Eagle Gold Fund Index is composed of the following mutual funds and one closed-end Investment Trust (ASA):
1. FSAGX - Fidelity Select American Gold (A)
2. FGLDX - Invesco Strategic Gold (A)
3. SCGDX - Scudder Gold (A)
4. UNWPX - U.S. World Gold (A)
5. VGPMX - Vanguard Specilized Gold (A/SA)
6. FKRCX - Franklin Gold (A/SA)
7. ASA - American South African Investments (SA)
8. USERX - US Gold Shares (SA)
Our index is composed of 8 Global Gold Mutual Funds. Their investment portfolios contain many hundreds of different mining companies, whose operations span the earth - USA, Canada, South America, South Africa, Australia and Indonesia. The GOLD-EAGLE Gold Fund Index is truly a surrogate for the global precious metals mining shares universe.
.
Japan fürchtet eine neue Bankenkrise
Regierung rettet fünftgrößte Finanzgruppe Resona mit Milliardenhilfe vor dem Konkurs
Tokio
Japans Bankentürme wackeln wieder, und die Manager erwarten voller Sorge die Börseneröffnung am Montag. Die Resona Holdings Inc. hat das handelsfreie Wochenende für ihre Hiobsbotschaft genutzt: Die fünftgrößte Bankengruppe des Landes kann nicht mehr alleine bestehen, wird eine staatliche Kapitalspritze beantragen.
Eilig berief die Regierung die Sondersitzung eines Finanzausschusses ein und verkündete, dass staatliche Hilfe gewährt werde. Für die Sicherheit der privaten Kundeneinlagen wird ebenfalls garantiert. "Ich werde eine Finanzkrise nicht zulassen", sagte Premierminister Junichiro Koizumi.
Zuvor war schon das Direktorium der Zentralbank zu einer Notsitzung zusammengetreten und hatte der Bank ausreichend Liquidität für die kommenden Tage zugesagt. Finanzminister Masajuro Shiokawa kehrte früher als geplant vom G-8-Treffen in Deauville zurück. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe er keinerlei Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft, versuchte Shiokawa noch in Frankreich zu beruhigen. "Dies wird weder die Fluktuation der Wechselkurse, noch den Handel beeinflussen."
Regierung und Finanzaufsicht nannten am Sonntag noch keinen Betrag für die Rettung Resonas. In japanischen Medien, darunter dier angesehene Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai" und die konservative Tageszeitung "Yomiuri", wurde allerdings mit bis zu zwei Billionen Yen gerechnet, fast 15 Mrd. Euro. Diese Summe wäre notwendig, um die Eigenkapitalquote von Resona wieder über zehn Prozent zu heben.
Das Resona-Management rief um Hilfe, nachdem die Eigenkapitalquote der Holding deutlich unter vier Prozent gefallen war. Kreditausfälle und Kursverluste an den Kapitalmärkten hatten die Reserven aufgezehrt. Vor wenigen Wochen war der Nikkei-Aktienindex auf ein Zwanzig-Jahres-Tief gefallen. Da die Banken seit einem Jahr verpflichtet sind, ihre Wertpapierbestände im eigenen Depot nach den Marktkursen zu bewerten, schlägt die Börsenbaisse mit voller Wucht auf die Bilanzen durch.
Streng genommen ist Resona eine japanische Regionalbank, mit Schwerpunkten in den Großstädten Tokio und Osaka. Die Bankengruppe ging im Jahr 2002 aus einer Fusion der Daiwa Bank, der Asahi Bank und drei kleinerer Instituten hervor. Internationalen Niederlassungen von Daiwa und Asahi wurden geschlossen, man konzentrierte sich auf das japanische Geschäft. Damit musste sich Resona nicht nach den Richtlinien der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) richten, die eine Eigenkapitalquote von mindestens acht Prozent vorschreibt, sondern nur den nationalen Regeln nachkommen, die vier Prozent verlangen.
Wegen Resonas Konzentration auf das japanische Geschäft, hofft die Regierung, dass die Schieflage an den internationalen Märkten keine Turbulenzen hervorrufen wird. In Tokio sehen Börsenanalysten die Kurse der Banken an diesem Montag jedoch kräftig unter Druck: Der Fall Resona könne den Nikkei, der die Vorwoche mit 8117 Punkten geschlossen hatte, wieder unter das Niveau von 8000 Zählern führen.
Die Resona-Gruppe verwaltet Kundeneinlagen in Höhe von 34 Billionen Yen, rund 254 Mrd. Euro. Nach Medienberichten sollen die Verbindlichkeiten inzwischen höher als das Eigenkapital sein. Ende Dezember belief sich das Volumen Not leidender Kredite, die Resona vergeben hatte, auf 3,2 Billionen Yen. Eigentlich wollte die Holding das Geschäftsjahr zum 31. März 2003 mit einem Verlust von 290 Mrd. Yen abschließen, doch jetzt muss mit mehr als 830 Mrd. Yen gerechnet werden. Schon am Samstag kündigte das Resona-Management seinen Rücktritt an.
Sollte der Staat wie geplant zur Seite springen, steht Resona kurz vor der Zwangsverstaatlichung, ähnlich wie die Long Term Credit Bank (LTCB) oder die Nippon Credit Bank, die nach der Intervention an private Investoren verkauft wurden. bew
DIE WELT - 19. Mai 2003
Japan fürchtet eine neue Bankenkrise
Regierung rettet fünftgrößte Finanzgruppe Resona mit Milliardenhilfe vor dem Konkurs
Tokio
Japans Bankentürme wackeln wieder, und die Manager erwarten voller Sorge die Börseneröffnung am Montag. Die Resona Holdings Inc. hat das handelsfreie Wochenende für ihre Hiobsbotschaft genutzt: Die fünftgrößte Bankengruppe des Landes kann nicht mehr alleine bestehen, wird eine staatliche Kapitalspritze beantragen.
Eilig berief die Regierung die Sondersitzung eines Finanzausschusses ein und verkündete, dass staatliche Hilfe gewährt werde. Für die Sicherheit der privaten Kundeneinlagen wird ebenfalls garantiert. "Ich werde eine Finanzkrise nicht zulassen", sagte Premierminister Junichiro Koizumi.
Zuvor war schon das Direktorium der Zentralbank zu einer Notsitzung zusammengetreten und hatte der Bank ausreichend Liquidität für die kommenden Tage zugesagt. Finanzminister Masajuro Shiokawa kehrte früher als geplant vom G-8-Treffen in Deauville zurück. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe er keinerlei Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft, versuchte Shiokawa noch in Frankreich zu beruhigen. "Dies wird weder die Fluktuation der Wechselkurse, noch den Handel beeinflussen."
Regierung und Finanzaufsicht nannten am Sonntag noch keinen Betrag für die Rettung Resonas. In japanischen Medien, darunter dier angesehene Wirtschaftszeitung "Nihon Keizai" und die konservative Tageszeitung "Yomiuri", wurde allerdings mit bis zu zwei Billionen Yen gerechnet, fast 15 Mrd. Euro. Diese Summe wäre notwendig, um die Eigenkapitalquote von Resona wieder über zehn Prozent zu heben.
Das Resona-Management rief um Hilfe, nachdem die Eigenkapitalquote der Holding deutlich unter vier Prozent gefallen war. Kreditausfälle und Kursverluste an den Kapitalmärkten hatten die Reserven aufgezehrt. Vor wenigen Wochen war der Nikkei-Aktienindex auf ein Zwanzig-Jahres-Tief gefallen. Da die Banken seit einem Jahr verpflichtet sind, ihre Wertpapierbestände im eigenen Depot nach den Marktkursen zu bewerten, schlägt die Börsenbaisse mit voller Wucht auf die Bilanzen durch.
Streng genommen ist Resona eine japanische Regionalbank, mit Schwerpunkten in den Großstädten Tokio und Osaka. Die Bankengruppe ging im Jahr 2002 aus einer Fusion der Daiwa Bank, der Asahi Bank und drei kleinerer Instituten hervor. Internationalen Niederlassungen von Daiwa und Asahi wurden geschlossen, man konzentrierte sich auf das japanische Geschäft. Damit musste sich Resona nicht nach den Richtlinien der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) richten, die eine Eigenkapitalquote von mindestens acht Prozent vorschreibt, sondern nur den nationalen Regeln nachkommen, die vier Prozent verlangen.
Wegen Resonas Konzentration auf das japanische Geschäft, hofft die Regierung, dass die Schieflage an den internationalen Märkten keine Turbulenzen hervorrufen wird. In Tokio sehen Börsenanalysten die Kurse der Banken an diesem Montag jedoch kräftig unter Druck: Der Fall Resona könne den Nikkei, der die Vorwoche mit 8117 Punkten geschlossen hatte, wieder unter das Niveau von 8000 Zählern führen.
Die Resona-Gruppe verwaltet Kundeneinlagen in Höhe von 34 Billionen Yen, rund 254 Mrd. Euro. Nach Medienberichten sollen die Verbindlichkeiten inzwischen höher als das Eigenkapital sein. Ende Dezember belief sich das Volumen Not leidender Kredite, die Resona vergeben hatte, auf 3,2 Billionen Yen. Eigentlich wollte die Holding das Geschäftsjahr zum 31. März 2003 mit einem Verlust von 290 Mrd. Yen abschließen, doch jetzt muss mit mehr als 830 Mrd. Yen gerechnet werden. Schon am Samstag kündigte das Resona-Management seinen Rücktritt an.
Sollte der Staat wie geplant zur Seite springen, steht Resona kurz vor der Zwangsverstaatlichung, ähnlich wie die Long Term Credit Bank (LTCB) oder die Nippon Credit Bank, die nach der Intervention an private Investoren verkauft wurden. bew
DIE WELT - 19. Mai 2003
.
Euro springt über Startwert
Von Fidelius Schmid, Andreas Krosta, Christiane Karweil
US-Finanzminister John Snow hat den Euro auf seinen höchsten Stand seit vier Jahren getrieben. Auch arabische Staaten geben der europäischen Gemeinschaftswährung Auftrieb.
Die Gemeinschaftswährung stieg am Montag bis auf 1,1739 $, weit über die Erstnotierung von 1,16675 $ Anfang Januar 1999. Konjunkturexperten warnten daraufhin vor einer Deflation in Deutschland, die Europäische Zentralbank (EZB) signalisierte eine Zinssenkung im Juni. Den seit Monaten anhaltenden Dollar-Verfall haben nach FTD-Informationen zuletzt auch arabische Staaten angetrieben. Sie kauften aus Angst vor einer zu großen Abhängigkeit von den USA im großen Stil Euro.
Snow hatte am Wochenende gesagt, er halte den Verfall des Dollar im Vergleich zum Euro für "moderat". Analysten werten die Aussage als klaren Beleg, dass sich die USA von einer Politik des starken Dollar verabschieden.
"Snow sagt eigentlich: Verkauft den Dollar weiter", sagte Chris Furness, Währungsspezialist beim renommierten britischen Beratungsunternehmen 4Cast. Der Euro werde weiter steigen. Analysten der französischen Bank BNP Paribas erwarten einen Anstieg auf 1,22 $ bis Ende des Jahres.
Arabische Länder steigen in den Euro ein
Neben der Konjunkturschwäche in den USA und der Zinsdifferenz zwischen EZB und US-Notenbank drückt auch der Einstieg arabischer Länder in den Euro den Dollar. In den vergangenen Wochen erwarben mehrere Staaten große Euro-Summen. "Sie haben mindestens 20 Mrd. Euro gekauft", sagte Furness. Händler in London berichteten sogar von bis zu 40 Mrd. Euro. Bei den Käufern soll es sich um Investoren und Zentralbanken aus Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten handeln.
"Wenn der Markt sowieso in diese Richtung geht, beeinflussen 20 Mrd. Euro den Kurs deutlich", sagte Antje Praefcke, Devisenhändlerin der Helaba. "Dazu kommt die Psychologie, da hängen sich dann Banken daran, und so verdoppelt sich eine Position", sagte Eugen Keller, Währungsstratege beim Bankhaus Metzler. Die Staaten versuchen, ihre Devisenreserven unabhängiger vom Dollar zu machen. Zudem grassiert in der arabischen Welt die Angst, die USA könnten im Krisenfall Dollar-Investments aus der Region einfrieren.
Bank of Japan interveniert
Snows Äußerungen zwingen die Notenbanken zum Handeln. Der japanische Yen zog am Montag gegenüber dem Dollar zunächst an. Später verlor der Yen, da die Bank of Japan zu Gunsten des Dollar intervenierte. EZB-Chef Wim Duisenberg stellte eine Zinssenkung von derzeit 2,50 Prozent bereits im Juni in Aussicht. Er sagte, er sei unsicher, ob die Euro-Zone 2003 das von der EZB prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent erreiche. Es werde keine sehr hohe Zahl werden. Im ersten Halbjahr werde das Wachstum stagnieren.
Zudem sagte er, der höhere Euro-Kurs drücke die Inflation. "Auf der anderen Seite, das kann man nicht abstreiten, untergräbt er unsere Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten", sagte Duisenberg. Damit gibt er erstmals zu, dass der Euro-Kurs die Exportwirtschaft der Euro-Zone schwächt. Eine Deflationsgefahr für die Euro-Zone sehe er allerdings nicht. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder sagte, er rechne "nicht mit Deflationsgefahr".
Gustav Horn, Leiter der Konjunkturabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht diese aber für Deutschland: "Wir hatten einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im ersten Quartal, den Börsencrash und jetzt die Euro-Aufwertung. All das führt zu sinkenden Preisen und Löhnen." Steigt der Euro, fallen die Importpreise. Ist die Binnennachfrage wie in Deutschland schwach, kann das eine Deflation beschleunigen. "Die Parallelen zu Japan werden immer größer", sagte Horn. Anfang der 90er Jahre war die starke Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar Auslöser für Japans Wirtschaftskrise und Deflation.
FTD - 20.05.2003
Euro springt über Startwert
Von Fidelius Schmid, Andreas Krosta, Christiane Karweil
US-Finanzminister John Snow hat den Euro auf seinen höchsten Stand seit vier Jahren getrieben. Auch arabische Staaten geben der europäischen Gemeinschaftswährung Auftrieb.
Die Gemeinschaftswährung stieg am Montag bis auf 1,1739 $, weit über die Erstnotierung von 1,16675 $ Anfang Januar 1999. Konjunkturexperten warnten daraufhin vor einer Deflation in Deutschland, die Europäische Zentralbank (EZB) signalisierte eine Zinssenkung im Juni. Den seit Monaten anhaltenden Dollar-Verfall haben nach FTD-Informationen zuletzt auch arabische Staaten angetrieben. Sie kauften aus Angst vor einer zu großen Abhängigkeit von den USA im großen Stil Euro.
Snow hatte am Wochenende gesagt, er halte den Verfall des Dollar im Vergleich zum Euro für "moderat". Analysten werten die Aussage als klaren Beleg, dass sich die USA von einer Politik des starken Dollar verabschieden.
"Snow sagt eigentlich: Verkauft den Dollar weiter", sagte Chris Furness, Währungsspezialist beim renommierten britischen Beratungsunternehmen 4Cast. Der Euro werde weiter steigen. Analysten der französischen Bank BNP Paribas erwarten einen Anstieg auf 1,22 $ bis Ende des Jahres.
Arabische Länder steigen in den Euro ein
Neben der Konjunkturschwäche in den USA und der Zinsdifferenz zwischen EZB und US-Notenbank drückt auch der Einstieg arabischer Länder in den Euro den Dollar. In den vergangenen Wochen erwarben mehrere Staaten große Euro-Summen. "Sie haben mindestens 20 Mrd. Euro gekauft", sagte Furness. Händler in London berichteten sogar von bis zu 40 Mrd. Euro. Bei den Käufern soll es sich um Investoren und Zentralbanken aus Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten handeln.
"Wenn der Markt sowieso in diese Richtung geht, beeinflussen 20 Mrd. Euro den Kurs deutlich", sagte Antje Praefcke, Devisenhändlerin der Helaba. "Dazu kommt die Psychologie, da hängen sich dann Banken daran, und so verdoppelt sich eine Position", sagte Eugen Keller, Währungsstratege beim Bankhaus Metzler. Die Staaten versuchen, ihre Devisenreserven unabhängiger vom Dollar zu machen. Zudem grassiert in der arabischen Welt die Angst, die USA könnten im Krisenfall Dollar-Investments aus der Region einfrieren.
Bank of Japan interveniert
Snows Äußerungen zwingen die Notenbanken zum Handeln. Der japanische Yen zog am Montag gegenüber dem Dollar zunächst an. Später verlor der Yen, da die Bank of Japan zu Gunsten des Dollar intervenierte. EZB-Chef Wim Duisenberg stellte eine Zinssenkung von derzeit 2,50 Prozent bereits im Juni in Aussicht. Er sagte, er sei unsicher, ob die Euro-Zone 2003 das von der EZB prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent erreiche. Es werde keine sehr hohe Zahl werden. Im ersten Halbjahr werde das Wachstum stagnieren.
Zudem sagte er, der höhere Euro-Kurs drücke die Inflation. "Auf der anderen Seite, das kann man nicht abstreiten, untergräbt er unsere Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten", sagte Duisenberg. Damit gibt er erstmals zu, dass der Euro-Kurs die Exportwirtschaft der Euro-Zone schwächt. Eine Deflationsgefahr für die Euro-Zone sehe er allerdings nicht. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder sagte, er rechne "nicht mit Deflationsgefahr".
Gustav Horn, Leiter der Konjunkturabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht diese aber für Deutschland: "Wir hatten einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im ersten Quartal, den Börsencrash und jetzt die Euro-Aufwertung. All das führt zu sinkenden Preisen und Löhnen." Steigt der Euro, fallen die Importpreise. Ist die Binnennachfrage wie in Deutschland schwach, kann das eine Deflation beschleunigen. "Die Parallelen zu Japan werden immer größer", sagte Horn. Anfang der 90er Jahre war die starke Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar Auslöser für Japans Wirtschaftskrise und Deflation.
FTD - 20.05.2003
.
J A P A N
"Ein Fass ohne Boden"
Mit einer milliardenschweren Geldspritze versucht die Zentralbank der Bankenkrise zu trotzen.
Branchenexperten bezweifeln den Erfolg der Rettungsaktion.
Tokio - Zur Stabilisierung der Finanzmärkte hat die japanische Zentralbank am Montag eine Billion Yen (rund 7,5 Milliarden Euro) in den Geldmarkt gepumpt. Die Finanzspritze erfolgte, nachdem sich die Regierung am Wochenende zur Rettung der fünftgrößten Bank des Landes, Resona, bereit erklärt hatte. Die wieder aufgeflammten Sorgen um Japans Finanz- und Bankensystem führten zu Kursverlusten an der Tokioter Börse.
Der Nikkei-Index schloss am Montag um 0,96 Prozent niedriger bei 8039,13 Punkten. Am stärksten waren die Kursverluste bei den Banktiteln. Die angeschlagene Resona-Bank gab um 17 Prozent nach.
Die Regierung hatte am Wochenende angekündigt, dass Resona eine Kapitalaufstockung aus Steuergeldern erhält, da die Reserven der Bank unter das gesetzlich vorgeschriebene Niveau gefallen waren. Die Bank hatte offenbar über Jahre hinweg die Ergebnisse in ihren Bilanzen geschönt.
"Die Situation bei Resona ist so, als ob man Wasser in ein Fass ohne Boden pumpen würde", erklärte Masaaki Kanno, Chefvolkswirt von J.P. Morgan in Tokio. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die vier größten japanischen Banken vor ähnlichen Problemen stehen. Regierungsvertreter erklärten dagegen, die anderen Banken seien sicher.
Die japanische Regierung hatte das Bankensystem bereits in den Jahren 1998 und 1999 mit hohen Summen unterstützt. Die Bankenkrise wird vor allem von faulen Kredite und mangelnder Profitabilität verursacht.
Resona hatte am Wochenende mitgeteilt, dass sie unter Anwendung strengerer Bilanzregeln im Finanzjahr Verluste von 838 Milliarden Yen in den Büchern hat (6,3 Milliarden Euro), fast drei Mal so viel wie zuvor geschätzt. Medienberichten zufolge wird die Regierung rund zwei Billionen Yen zur Stützung der Bank mit Sitz in Osaka aufbringen müssen.
Sony-Schock, SARS, Strukturkrise: Investoren verabschieden sich aus Japan.
Vor den Rückschlägen, die den Nikkei derzeit mit voller Wucht treffen, sind auch Europas Börsen nicht gefeit. Der Ausverkauf an Tokios Leitbörse will kein Ende nehmen. Der seit Jahren dahinsiechende Nikkei 225 markiert derzeit fast täglich ein neues 20-Jahres-Tief. Dafür sind nicht nur die Bankenkrise und die dramatischen Kursverluste beim Schwergewicht Sony, sondern auch die Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Lungenseuche SARS verantwortlich: Sollte sich das SARS-Virus in China ausbreiten, wäre die Exportwirtschaft auf der Nachbarinsel Japan empfindlich getroffen.
(...)
Faule Kredite in Höhe von 342 Milliarden Yen
Nach Einschätzung der Investmentbank CSFB ist Japans Krise mittlerweile chronisch. Auf Grund ihrer hohen Aktienbestände leiden die Banken überproportional unter der jahrelangen wirtschaftlichen Talfahrt des Landes. Nach Regierungsangaben lasten auf der Branche mittlerweile faule Kredite in Höhe von 342 Milliarden Yen.
Analysten erwarten, dass Japans Banken im Gesamtjahr erneut deutliche Verluste verbuchen müssen. Seit 1999 versucht die japanische Notenbank BoJ, mit einer Nullzinspolitik die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen - bislang vergeblich. Lediglich die Finanzhäuser haben sich zu Dumping-Konditionen frisches Geld beschafft und damit faule Kredite weiter vor sich hergeschoben. "Die Deflationsspirale in Japan dreht sich seit Jahren", sagt ein Börsianer. "Wenn nun auch China kränkelt, wird es kritisch."
(...)
Fünf Gründe, warum es Deutschland besser hat
Wie Japan vor gut zehn Jahren weist auch Deutschland ein schwaches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig sinkenden Inflationsraten auf. Auch die geplatzte Börsenblase erinnert an das damalige Szenario in Fernost.
Dennoch sei die Situation nicht vergleichbar:
Erstens ist der Einbruch des Bruttoinlandsproduktes in Japan viel dramatischer ausgefallen als jetzt in Deutschland,
zweitens liegt die Inflation in Japan schon seit Jahren deutlich unterhalb der deutschen Teuerungsrate, die dazu noch wesentlich größere Schwankungen aufzeigt,
drittens spielt der gewaltige Geldtransfer von West- nach Ostdeutschland eine nicht zu unterschätzende Rolle,
viertens gibt es in Deutschland keine vergleichbare Immobilien-Blase,
fünftens ist in Deutschland trotz aktueller Bankenkrise kein "Kredit-Crunch" zu befürchten. Außerdem gebe es zumindest noch kleine geld- und steuerpolitische Spielräume.
"Vor diesem Hintergrund ist ein Gleichsetzen von Japan und Deutschland eine zu vereinfachte Darstellung", fasst Goldman-Analyst Schumacher die Datenlage zusammen.
(...)
"Japans Krise ist mittlerweile chronisch"
Zudem ist die Notenbank weiter dabei, den Banken auch durch den Aufkauf von Aktien zu helfen. Bis Ende des Monats rechnen Experten damit, dass der Gesamtwert der von der BoJ aufgekauften Aktien die Marke von einer Billion Yen erreichen wird.
Ob jedoch die BoJ dem Aktienmarkt auf die Sprünge helfen kann, bezweifeln Börsianer. Eine Trendwende ist nach den Worten von Yasushi Okada unwahrscheinlich: "Japans Krise ist mittlerweile chronisch", sagt der Chefökonom der Credit Suisse First Boston in Tokio. Die wankenden Bankenriesen in Japan könnten mit diesen Maßnahmen kaum wieder aufgerichtet werden.
Auf Grund ihrer hohen Aktienbestände leiden die Banken so überproportional deutlich unter der jahrelangen wirtschaftlichen Talfahrt des Landes. Nach Regierungsangaben lasten auf der Branche mittlerweile faule Kredite in Höhe von 342 Milliarden Yen.
Die Nullzinspolitik brachte keine Besserung
Und mit jedem Punkt, den der Nikkei weiter nach unten rutscht, spitzt sich die Situation zu, da die Aktienbestände auch zur Absicherung dienen. Analysten erwarten, dass Japans Banken im Gesamtjahr spürbare Verluste verbuchen müssen.
Seit 1999 versucht die BoJ, mit einer Nullzinspolitik gegenzusteuern, um die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Der Erfolg blieb bislang aus.
Im Gegenteil: Finanzhäuser können sich weiterhin zu Dumping-Konditionen frisches Geld beschaffen und auf diese Weise die notwendige Abschreibung fauler Kredite weiter vor sich herschieben, schreiben Experten der Investmentbank Morgan Stanley. Dies sorge unter anderem dafür, dass Überkapazitäten bestehen bleiben, die Preise weiter sinken und sich die Deflationsspirale weiter dreht
zusammengestellt aus Beiträgen im "manager-magazin" am 20.05.03
J A P A N
"Ein Fass ohne Boden"
Mit einer milliardenschweren Geldspritze versucht die Zentralbank der Bankenkrise zu trotzen.
Branchenexperten bezweifeln den Erfolg der Rettungsaktion.
Tokio - Zur Stabilisierung der Finanzmärkte hat die japanische Zentralbank am Montag eine Billion Yen (rund 7,5 Milliarden Euro) in den Geldmarkt gepumpt. Die Finanzspritze erfolgte, nachdem sich die Regierung am Wochenende zur Rettung der fünftgrößten Bank des Landes, Resona, bereit erklärt hatte. Die wieder aufgeflammten Sorgen um Japans Finanz- und Bankensystem führten zu Kursverlusten an der Tokioter Börse.
Der Nikkei-Index schloss am Montag um 0,96 Prozent niedriger bei 8039,13 Punkten. Am stärksten waren die Kursverluste bei den Banktiteln. Die angeschlagene Resona-Bank gab um 17 Prozent nach.
Die Regierung hatte am Wochenende angekündigt, dass Resona eine Kapitalaufstockung aus Steuergeldern erhält, da die Reserven der Bank unter das gesetzlich vorgeschriebene Niveau gefallen waren. Die Bank hatte offenbar über Jahre hinweg die Ergebnisse in ihren Bilanzen geschönt.
"Die Situation bei Resona ist so, als ob man Wasser in ein Fass ohne Boden pumpen würde", erklärte Masaaki Kanno, Chefvolkswirt von J.P. Morgan in Tokio. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die vier größten japanischen Banken vor ähnlichen Problemen stehen. Regierungsvertreter erklärten dagegen, die anderen Banken seien sicher.
Die japanische Regierung hatte das Bankensystem bereits in den Jahren 1998 und 1999 mit hohen Summen unterstützt. Die Bankenkrise wird vor allem von faulen Kredite und mangelnder Profitabilität verursacht.
Resona hatte am Wochenende mitgeteilt, dass sie unter Anwendung strengerer Bilanzregeln im Finanzjahr Verluste von 838 Milliarden Yen in den Büchern hat (6,3 Milliarden Euro), fast drei Mal so viel wie zuvor geschätzt. Medienberichten zufolge wird die Regierung rund zwei Billionen Yen zur Stützung der Bank mit Sitz in Osaka aufbringen müssen.
Sony-Schock, SARS, Strukturkrise: Investoren verabschieden sich aus Japan.
Vor den Rückschlägen, die den Nikkei derzeit mit voller Wucht treffen, sind auch Europas Börsen nicht gefeit. Der Ausverkauf an Tokios Leitbörse will kein Ende nehmen. Der seit Jahren dahinsiechende Nikkei 225 markiert derzeit fast täglich ein neues 20-Jahres-Tief. Dafür sind nicht nur die Bankenkrise und die dramatischen Kursverluste beim Schwergewicht Sony, sondern auch die Angst vor einer weiteren Ausbreitung der Lungenseuche SARS verantwortlich: Sollte sich das SARS-Virus in China ausbreiten, wäre die Exportwirtschaft auf der Nachbarinsel Japan empfindlich getroffen.
(...)
Faule Kredite in Höhe von 342 Milliarden Yen
Nach Einschätzung der Investmentbank CSFB ist Japans Krise mittlerweile chronisch. Auf Grund ihrer hohen Aktienbestände leiden die Banken überproportional unter der jahrelangen wirtschaftlichen Talfahrt des Landes. Nach Regierungsangaben lasten auf der Branche mittlerweile faule Kredite in Höhe von 342 Milliarden Yen.
Analysten erwarten, dass Japans Banken im Gesamtjahr erneut deutliche Verluste verbuchen müssen. Seit 1999 versucht die japanische Notenbank BoJ, mit einer Nullzinspolitik die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen - bislang vergeblich. Lediglich die Finanzhäuser haben sich zu Dumping-Konditionen frisches Geld beschafft und damit faule Kredite weiter vor sich hergeschoben. "Die Deflationsspirale in Japan dreht sich seit Jahren", sagt ein Börsianer. "Wenn nun auch China kränkelt, wird es kritisch."
(...)
Fünf Gründe, warum es Deutschland besser hat
Wie Japan vor gut zehn Jahren weist auch Deutschland ein schwaches Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig sinkenden Inflationsraten auf. Auch die geplatzte Börsenblase erinnert an das damalige Szenario in Fernost.
Dennoch sei die Situation nicht vergleichbar:
Erstens ist der Einbruch des Bruttoinlandsproduktes in Japan viel dramatischer ausgefallen als jetzt in Deutschland,
zweitens liegt die Inflation in Japan schon seit Jahren deutlich unterhalb der deutschen Teuerungsrate, die dazu noch wesentlich größere Schwankungen aufzeigt,
drittens spielt der gewaltige Geldtransfer von West- nach Ostdeutschland eine nicht zu unterschätzende Rolle,
viertens gibt es in Deutschland keine vergleichbare Immobilien-Blase,
fünftens ist in Deutschland trotz aktueller Bankenkrise kein "Kredit-Crunch" zu befürchten. Außerdem gebe es zumindest noch kleine geld- und steuerpolitische Spielräume.
"Vor diesem Hintergrund ist ein Gleichsetzen von Japan und Deutschland eine zu vereinfachte Darstellung", fasst Goldman-Analyst Schumacher die Datenlage zusammen.
(...)
"Japans Krise ist mittlerweile chronisch"
Zudem ist die Notenbank weiter dabei, den Banken auch durch den Aufkauf von Aktien zu helfen. Bis Ende des Monats rechnen Experten damit, dass der Gesamtwert der von der BoJ aufgekauften Aktien die Marke von einer Billion Yen erreichen wird.
Ob jedoch die BoJ dem Aktienmarkt auf die Sprünge helfen kann, bezweifeln Börsianer. Eine Trendwende ist nach den Worten von Yasushi Okada unwahrscheinlich: "Japans Krise ist mittlerweile chronisch", sagt der Chefökonom der Credit Suisse First Boston in Tokio. Die wankenden Bankenriesen in Japan könnten mit diesen Maßnahmen kaum wieder aufgerichtet werden.
Auf Grund ihrer hohen Aktienbestände leiden die Banken so überproportional deutlich unter der jahrelangen wirtschaftlichen Talfahrt des Landes. Nach Regierungsangaben lasten auf der Branche mittlerweile faule Kredite in Höhe von 342 Milliarden Yen.
Die Nullzinspolitik brachte keine Besserung
Und mit jedem Punkt, den der Nikkei weiter nach unten rutscht, spitzt sich die Situation zu, da die Aktienbestände auch zur Absicherung dienen. Analysten erwarten, dass Japans Banken im Gesamtjahr spürbare Verluste verbuchen müssen.
Seit 1999 versucht die BoJ, mit einer Nullzinspolitik gegenzusteuern, um die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. Der Erfolg blieb bislang aus.
Im Gegenteil: Finanzhäuser können sich weiterhin zu Dumping-Konditionen frisches Geld beschaffen und auf diese Weise die notwendige Abschreibung fauler Kredite weiter vor sich herschieben, schreiben Experten der Investmentbank Morgan Stanley. Dies sorge unter anderem dafür, dass Überkapazitäten bestehen bleiben, die Preise weiter sinken und sich die Deflationsspirale weiter dreht
zusammengestellt aus Beiträgen im "manager-magazin" am 20.05.03
Das hier geht mir nun auch wieder zu schnell. Trotzdem soll es uns recht sein J2
J2
.
Guten Morgen Jeffery
... Hmm, beim letzten upmove war ich ja noch ganz locker und siegessicher,aber man reift ja mit der Zeit...:rolleyes.
Die Kiste läuft langsam heiß :
Deutsche Bank :
Gold, überkaufte Situation?
Der Goldpreis überwand im gestrigen Handel mit hoher Schwungkraft sein Widerstandsniveau um 357.30 / 360 USD und „schoss“ förmlich bis auf 366.65 USD im Tageshoch, so berichtet Uwe Wagner, Händler bei der Deutschen Bank.
Das heutige bisherige Hoch läge bei 368.90 USD. Der Goldpreis befände sich ungebrochen innerhalb eines absolut intakten Aufwärtstrends, der markttechnisch bestätigt werde. Nach Ansicht des Experten sei hier auffallend, dass mit dem letzten Bewegungsschub eine erste Überhitzung des Anstieges eingesetzt hätte. Dies bedeute, dass der Goldpreis aktuell als leicht überkauft interpretiert werden könne, ohne dass schon Verkaufssignale im Sinne klassischer Regelwerke vorlägen.
20.05.2003, 10:08 Uhr

Guten Morgen Jeffery

... Hmm, beim letzten upmove war ich ja noch ganz locker und siegessicher,aber man reift ja mit der Zeit...:rolleyes.
Die Kiste läuft langsam heiß :
Deutsche Bank :
Gold, überkaufte Situation?
Der Goldpreis überwand im gestrigen Handel mit hoher Schwungkraft sein Widerstandsniveau um 357.30 / 360 USD und „schoss“ förmlich bis auf 366.65 USD im Tageshoch, so berichtet Uwe Wagner, Händler bei der Deutschen Bank.
Das heutige bisherige Hoch läge bei 368.90 USD. Der Goldpreis befände sich ungebrochen innerhalb eines absolut intakten Aufwärtstrends, der markttechnisch bestätigt werde. Nach Ansicht des Experten sei hier auffallend, dass mit dem letzten Bewegungsschub eine erste Überhitzung des Anstieges eingesetzt hätte. Dies bedeute, dass der Goldpreis aktuell als leicht überkauft interpretiert werden könne, ohne dass schon Verkaufssignale im Sinne klassischer Regelwerke vorlägen.
20.05.2003, 10:08 Uhr

.
Marc Faber
Das niedrige Preisniveau in Asien ist verlockend
Zwar stimmt es, dass nach Meinungsumfragen Zürich, Vancouver und Wien die höchste Lebensqualität unter den bedeutenden Städten der Welt bieten und sich 17 der Städte mit der geringsten Lebensqualität in Afrika befinden. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint mir in gewissen asiatischen Städten bei weitem am günstigsten zu sein. Ich erwähne dies für den Fall, dass einige deutschen Leser das harsche nordeuropäische Wirtschafts- und Wetterklima verlassen und sich in einem anderen Land niederlassen möchten, wo die Wirtschaftsaussichten und die Lebensbedingungen wesentlich günstiger erscheinen.
Trotz SARS und eines relativ düsteren Ausblicks für die Weltwirtschaft wächst das Bruttosozialprodukt zurzeit in den meisten asiatischen Ländern um fünf bis sechs Prozent. Gründe hierfür sind, dass ausländische Firmen sich insbesondere nach dem Ausbrechen von SARS nicht nur auf China für den Bezug von Konsumgütern verlassen wollen, die Schwäche der asiatischen Währungen, die zusammen mit dem US-Dollar gegenüber dem Euro gefallen sind und damit den Export nach Europa belebt haben, und das niedrige Preisniveau, das zu wachsenden ausländischen Kapitalinvestitionen führt.
Um einen Überblick über das Preisniveau asiatischer Länder zu bekommen, bietet sich ein Kostenvergleich von Geschäftsräumen in verschiedenen Städten an.
- In Bangkok betragen die Gesamtkosten von Büros, trotz einer Teuerungsrate von 7,3 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten, inklusive Servicegebühren und Steuern 3,37 Dollar pro Quadratmeter pro Monat.
- Im Londoner West End liegen die vergleichbaren Kosten bei 45,86 Dollar, in Tokio bei 35,88 Dollar. Mit anderen Worten, in London ist es mehr als 13 Mal so teuer
Geschäftsräume zu mieten wie in Bangkok - immerhin die Hauptstadt eines Landes mit mehr als 60 Millionen Einwohnern, wovon rund zehn Millionen in der Stadt selbst leben.[/b]
Weltweit gibt es nur fünf andere große Städte mit günstigeren Mieten: Manila, Christchurch in Neuseeland, und Johannesburg, Kapstadt sowie Durban in Südafrika.
Das thailändische Preisniveau ist noch bedeutend niedriger im Norden des Landes, insbesondere verglichen mit Phuket im Süden, wo die Preise sogar höher liegen als in Bangkok.
Dies ist erwähnenswert, weil überall in Asien und in Neuseeland sowie Australien die Immobilienpreise auf dem Land und in kleineren Städten außerordentlich günstig sind. Falls nämlich SARS und der Terrorismus weltweit zu einem längerfristigen Problem werden sollten, dürfte die Nachfrage nach Immobilien außerhalb von größeren Städten, wo infektiöse Krankheiten sich schnell verbreiten und Terroranschläge wahrscheinlicher sind, stark zunehmen.
Dies gilt vor allem auch deshalb, weil das Internet es uns doch erlaubt, überall auf der Welt ebenso gut informiert zu sein wie in London, New York oder Tokio, in Zürich, Wien oder Vancouver. Außerdem sind natürlich nicht nur die Lebenskosten in Asien viel niedriger als in den westlichen Ländern, sondern auch die Aktienbewertungen, die meiner Meinung nach deutliche Kapitalgewinne in den nächsten Jahren versprechen.
DIE WELT - 19. Mai 2003
Marc Faber
Das niedrige Preisniveau in Asien ist verlockend
Zwar stimmt es, dass nach Meinungsumfragen Zürich, Vancouver und Wien die höchste Lebensqualität unter den bedeutenden Städten der Welt bieten und sich 17 der Städte mit der geringsten Lebensqualität in Afrika befinden. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint mir in gewissen asiatischen Städten bei weitem am günstigsten zu sein. Ich erwähne dies für den Fall, dass einige deutschen Leser das harsche nordeuropäische Wirtschafts- und Wetterklima verlassen und sich in einem anderen Land niederlassen möchten, wo die Wirtschaftsaussichten und die Lebensbedingungen wesentlich günstiger erscheinen.
Trotz SARS und eines relativ düsteren Ausblicks für die Weltwirtschaft wächst das Bruttosozialprodukt zurzeit in den meisten asiatischen Ländern um fünf bis sechs Prozent. Gründe hierfür sind, dass ausländische Firmen sich insbesondere nach dem Ausbrechen von SARS nicht nur auf China für den Bezug von Konsumgütern verlassen wollen, die Schwäche der asiatischen Währungen, die zusammen mit dem US-Dollar gegenüber dem Euro gefallen sind und damit den Export nach Europa belebt haben, und das niedrige Preisniveau, das zu wachsenden ausländischen Kapitalinvestitionen führt.
Um einen Überblick über das Preisniveau asiatischer Länder zu bekommen, bietet sich ein Kostenvergleich von Geschäftsräumen in verschiedenen Städten an.
- In Bangkok betragen die Gesamtkosten von Büros, trotz einer Teuerungsrate von 7,3 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten, inklusive Servicegebühren und Steuern 3,37 Dollar pro Quadratmeter pro Monat.
- Im Londoner West End liegen die vergleichbaren Kosten bei 45,86 Dollar, in Tokio bei 35,88 Dollar. Mit anderen Worten, in London ist es mehr als 13 Mal so teuer
Geschäftsräume zu mieten wie in Bangkok - immerhin die Hauptstadt eines Landes mit mehr als 60 Millionen Einwohnern, wovon rund zehn Millionen in der Stadt selbst leben.[/b]
Weltweit gibt es nur fünf andere große Städte mit günstigeren Mieten: Manila, Christchurch in Neuseeland, und Johannesburg, Kapstadt sowie Durban in Südafrika.
Das thailändische Preisniveau ist noch bedeutend niedriger im Norden des Landes, insbesondere verglichen mit Phuket im Süden, wo die Preise sogar höher liegen als in Bangkok.
Dies ist erwähnenswert, weil überall in Asien und in Neuseeland sowie Australien die Immobilienpreise auf dem Land und in kleineren Städten außerordentlich günstig sind. Falls nämlich SARS und der Terrorismus weltweit zu einem längerfristigen Problem werden sollten, dürfte die Nachfrage nach Immobilien außerhalb von größeren Städten, wo infektiöse Krankheiten sich schnell verbreiten und Terroranschläge wahrscheinlicher sind, stark zunehmen.
Dies gilt vor allem auch deshalb, weil das Internet es uns doch erlaubt, überall auf der Welt ebenso gut informiert zu sein wie in London, New York oder Tokio, in Zürich, Wien oder Vancouver. Außerdem sind natürlich nicht nur die Lebenskosten in Asien viel niedriger als in den westlichen Ländern, sondern auch die Aktienbewertungen, die meiner Meinung nach deutliche Kapitalgewinne in den nächsten Jahren versprechen.
DIE WELT - 19. Mai 2003
.
Gold-Aktien werden durchgesiebt
Analysten raten angesichts von Fusionswelle und Ertragsschwäche zur Risikostreuung
von Michael Fabricius
Goldaktien-Inhaber können mittlerweile ein reichhaltiges Gefühlsspektrum vorweisen. Innerhalb von 18 Monaten wurden Aktionäre von Gold Fields, Harmony Gold oder Newmont Mining zwischen "Himmelhoch jauchzend" und "zu Tode betrübt" hin und her gerissen. Denn parallel zur Entwicklung des Goldpreises konnten die Titel zu Beginn des Jahres 2002 beträchtliche Kurssteigerungen vorweisen
Leicht anziehende Aktienmärkte ließen den Preis für das Edelmetall dann jedoch wieder absinken - die Kurse der Minengesellschaften folgten. Nun notiert der Preis für eine Feinunze Gold wieder oberhalb der 350-Dollar-Marke, getrieben vor allem von der Dollar-Schwäche. Der Greenback verhält sich wie eine zweite Währung zum Gold.
Analysten zeichnen daher ein immer differenzierteres Bild von den Minengesellschaften. So steht für die Experten von Goldman Sachs etwa fest: "Rein währungsbedingt bevorzugen wir derzeit nordamerikanische Titel vor südamerikanischen", so James Copland in einer aktuellen Untersuchung.Die an der Börse in Johannesburg beheimateten Gold-Produzenten erwirtschaften ihre Erlöse auf dem Weltmarkt in Dollar, müssen ihre Kosten jedoch in Rand begleichen. Je stärker also der Rand, desto geringer die Gewinne und auch der Börsenwert. Das schlug sich auch in den Quartalsbilanzen von Gold Fields, Anglogold und Harmony Gold nieder.
Gleichzeitig sinkt in Südafrika an vielen Stellen die Ertragskraft einzelner Minen, weshalb die Betreiber im Ausland auf die Suche gehen. So verkündete jetzt Anglogold die Absicht, Ashanti Goldfields in Ghana zu übernehmen. Mit einem Produktionsvolumen zwischen sieben und 7,4 Mio. Unzen jährlich wäre der neue Gold-Riese der größte in der Branche. Newmont Mining rutscht trotz des Kaufs der australischen Normandy und Franco-Nevada auf Platz zwei.
Vor wenigen Wochen erst hatten die Goldförderer Harmony und ARM eine Fusion angekündigt. "Unter den kleineren Produzenten haben bereits etliche Übernahmen stattgefunden, jetzt sind eben die größeren Gesellschaften dran. Viele wollen die Gelegenheit nutzen, um im Zuge einer Fusion unrentable Produktionsstandorte zu schließen", sagt Norbert Faller, Fondsmanager und Gold-Experte bei Union Investment.
Der Experte erwartet eine anhaltende Angebotsknappheit und bis 2004 daher auch wenig Druck auf den Goldpreis. Auch bei Goldman Sachs gehen die Beobachter bis zum Jahresende von rund 350 Dollar je Unze aus. In erster Linie käme dies wiederum den nordamerikanischen Konzernen zugute, während die südafrikanischen eine Konsolidierungs- und Investitionspause einlegten.
So bevorzugt Goldman-Experte Copland auch hier Newmont Mining, da sich die Gesellschaft kaum noch per Termingeschäft (Hedging) gegen künftige Preisstürze abgesichert habe. Goldpreis-Steigerungen würden daher voll auf den Gewinn durchschlagen.
"Generell haben wir in den vergangenen drei Wochen beobachtet, dass massenweise Hedging-Positionen zurückgekauft wurden. Die Goldproduzenten scheinen also von einem weiter steigenden Preis auszugehen", erläutert Union-Experte Faller.
Wenn sich jedoch der Trend umkehrt und sowohl Dollar als auch Goldpreis den Rückwärtsgang einlegen, haben südafrikanische Produzenten wieder die Aussicht auf vergleichsweise hohe Margen. Auch Titel wie die kanadische Barrick oder Placier, die bis zu 50 Prozent ihrer künftigen Verkäufe per Termingeschäft abgesichert haben, könnten dann wieder in den Vordergrund rücken.
Um sich gegen weitere Gefühlsschwankungen abzusichern, sollten Gold-Aktionäre also vor allem Risikostreuung betreiben: Wer in seinem Portfolio einen kanadischen, einen US-Titel sowie zwei Südafrikaner hält, von denen einer mit vielen Hedge-Positionen glänzt, während der andere weitgehend darauf verzichtet, ist für alle Szenarien gewappnet.
DIE WELT - 20. Mai 2003
Gold-Aktien werden durchgesiebt
Analysten raten angesichts von Fusionswelle und Ertragsschwäche zur Risikostreuung
von Michael Fabricius
Goldaktien-Inhaber können mittlerweile ein reichhaltiges Gefühlsspektrum vorweisen. Innerhalb von 18 Monaten wurden Aktionäre von Gold Fields, Harmony Gold oder Newmont Mining zwischen "Himmelhoch jauchzend" und "zu Tode betrübt" hin und her gerissen. Denn parallel zur Entwicklung des Goldpreises konnten die Titel zu Beginn des Jahres 2002 beträchtliche Kurssteigerungen vorweisen
Leicht anziehende Aktienmärkte ließen den Preis für das Edelmetall dann jedoch wieder absinken - die Kurse der Minengesellschaften folgten. Nun notiert der Preis für eine Feinunze Gold wieder oberhalb der 350-Dollar-Marke, getrieben vor allem von der Dollar-Schwäche. Der Greenback verhält sich wie eine zweite Währung zum Gold.
Analysten zeichnen daher ein immer differenzierteres Bild von den Minengesellschaften. So steht für die Experten von Goldman Sachs etwa fest: "Rein währungsbedingt bevorzugen wir derzeit nordamerikanische Titel vor südamerikanischen", so James Copland in einer aktuellen Untersuchung.Die an der Börse in Johannesburg beheimateten Gold-Produzenten erwirtschaften ihre Erlöse auf dem Weltmarkt in Dollar, müssen ihre Kosten jedoch in Rand begleichen. Je stärker also der Rand, desto geringer die Gewinne und auch der Börsenwert. Das schlug sich auch in den Quartalsbilanzen von Gold Fields, Anglogold und Harmony Gold nieder.
Gleichzeitig sinkt in Südafrika an vielen Stellen die Ertragskraft einzelner Minen, weshalb die Betreiber im Ausland auf die Suche gehen. So verkündete jetzt Anglogold die Absicht, Ashanti Goldfields in Ghana zu übernehmen. Mit einem Produktionsvolumen zwischen sieben und 7,4 Mio. Unzen jährlich wäre der neue Gold-Riese der größte in der Branche. Newmont Mining rutscht trotz des Kaufs der australischen Normandy und Franco-Nevada auf Platz zwei.
Vor wenigen Wochen erst hatten die Goldförderer Harmony und ARM eine Fusion angekündigt. "Unter den kleineren Produzenten haben bereits etliche Übernahmen stattgefunden, jetzt sind eben die größeren Gesellschaften dran. Viele wollen die Gelegenheit nutzen, um im Zuge einer Fusion unrentable Produktionsstandorte zu schließen", sagt Norbert Faller, Fondsmanager und Gold-Experte bei Union Investment.
Der Experte erwartet eine anhaltende Angebotsknappheit und bis 2004 daher auch wenig Druck auf den Goldpreis. Auch bei Goldman Sachs gehen die Beobachter bis zum Jahresende von rund 350 Dollar je Unze aus. In erster Linie käme dies wiederum den nordamerikanischen Konzernen zugute, während die südafrikanischen eine Konsolidierungs- und Investitionspause einlegten.
So bevorzugt Goldman-Experte Copland auch hier Newmont Mining, da sich die Gesellschaft kaum noch per Termingeschäft (Hedging) gegen künftige Preisstürze abgesichert habe. Goldpreis-Steigerungen würden daher voll auf den Gewinn durchschlagen.
"Generell haben wir in den vergangenen drei Wochen beobachtet, dass massenweise Hedging-Positionen zurückgekauft wurden. Die Goldproduzenten scheinen also von einem weiter steigenden Preis auszugehen", erläutert Union-Experte Faller.
Wenn sich jedoch der Trend umkehrt und sowohl Dollar als auch Goldpreis den Rückwärtsgang einlegen, haben südafrikanische Produzenten wieder die Aussicht auf vergleichsweise hohe Margen. Auch Titel wie die kanadische Barrick oder Placier, die bis zu 50 Prozent ihrer künftigen Verkäufe per Termingeschäft abgesichert haben, könnten dann wieder in den Vordergrund rücken.
Um sich gegen weitere Gefühlsschwankungen abzusichern, sollten Gold-Aktionäre also vor allem Risikostreuung betreiben: Wer in seinem Portfolio einen kanadischen, einen US-Titel sowie zwei Südafrikaner hält, von denen einer mit vielen Hedge-Positionen glänzt, während der andere weitgehend darauf verzichtet, ist für alle Szenarien gewappnet.
DIE WELT - 20. Mai 2003
Hallo konradi,
alte Weisheit, die Kurse steigen an einer Wand von Angst.
Geht nicht anders, nur aufwärts, dann haben wir wieder die Fahnenstange vom letzten Jahr.
Aber es ist doch toll täglich gibt es entweder in Asien oder im späten Londoner Handel kräftig aufs Haupt, aber keine Stunde später werden immer wieder die Höchstkurse des Tages getestet.
Weiter so, blos Silber kann man glatt vergessen.
J2
alte Weisheit, die Kurse steigen an einer Wand von Angst.
Geht nicht anders, nur aufwärts, dann haben wir wieder die Fahnenstange vom letzten Jahr.
Aber es ist doch toll täglich gibt es entweder in Asien oder im späten Londoner Handel kräftig aufs Haupt, aber keine Stunde später werden immer wieder die Höchstkurse des Tages getestet.

Weiter so, blos Silber kann man glatt vergessen.
J2
.
George Soros gibt den Dollar zum Abschuss frei
Vor zehn Jahren verdiente er eine Milliarde Dollar, als er erfolgreich gegen das britische Pfund spekulierte. Nun setzt George Soros, einer der umstrittensten Devisenexperten überhaupt, auf einen weiteren Kursverfall des Dollar.
Soros verkauft nach eigenen Angaben Dollar-Anlagen zu Gunsten anderer führender Währungen. Mit diesem Bekenntnis hat der Investor am Abend zu einem erneuten Anstieg des Euro-Kurses beigetragen.
"Ich muss bekannt geben, dass ich nun eine Verkaufsposition gegenüber dem Dollar eingenommen habe, weil ich auf das höre, was der Finanzminister mir sagt", sagte Soros am Dienstag dem amerikanischen Börsenkanal CNBC.
Der Investor bezog sich auf die jüngsten Äußerungen von US-Finanzminister John Snow. Sie deuten darauf hin, dass die USA von der Politik des starken Dollar abrücken.
Soros bezeichnete diese Äußerungen als Fehler. Sie seien ein verbohrter Versuch, die US-Wirtschaft auf Kosten anderer Ökonomien anzukurbeln: "Das ist eine Politik nach dem Sankt-Florians-Prinzip", sagte Soros. Snow handle unverantwortlich.
Nach Ausstrahlung des Interviews stieg der Euro vorübergehend auf über 1,17 Dollar. Damit näherte er sich seiner Erstnotiz in Höhe von 1,1747 Dollar vom Januar 1999.
Wie groß die Short-Positionen sind, die Soros aufgebaut hat, blieb zunächst offen. Der Investor hatte 1992 mit seinem Quantum Fund mit Leerverkäufen massiv gegen das britische Pfund spekuliert und die Währung damit aus dem Europäischen Wechselkurssystem gedrängt. Seither gilt der Soros als "der Mann, der die Bank von England knackte". Sein Einfluss an den Devisenmärkten hat sich inzwischen vermindert. Trotzdem dürften viele Händler zögern, sich in ihrem Urteil gegen Soros zu stellen.
DER SPIEGEL – 20.05.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE SOROS -
Amerikanisch-ungarischer Großinvestor und erfolgreichster Spekulant der Welt

Wer ist der Megaspekulant, der die Bank von England auf die Knie gezwungen hat?
Er ist Philanthrop und Philosoph, Großinvestor und Manager, Akteur in der Wirtschafts- und Finanzkrise Asiens (außer Malaysia, nachdem er von Malaysias Premierminister Mahathir für die asiatische Finanzkrise verantwortlich gemacht wurde).
Die Auslösung der Rubelkrise 1998 soll auch auf seine Kappe gehen. Er unterbreitete Margret Thatcher und George Bush Vorschläge zur Gestaltung der weltwirtschaftlichen, Finanzbeziehungen; er sprach vor dem US-amerikanischen Kongreß. »Das kapitalistische Weltsystem ist von Finanzkrisen erschüttert und buchstäblich am Auseinanderbrechen. ... ich bin fest überzeugt, daß wir grundlegende Veränderungen brauchen.«
Als erster kapitalistischer Dissident machte Soros auf westlichen Finanzmärkten Milliarden und investierte sie in die postkommunistischen "Red Empire"-Länder. Über verschiedene Stiftungsnetzwerke und -organisationen versucht der "Mann mit der Midas-Hand" fast die halbe Erdkugel zu einer neuen Marktwirtschaft zu reformieren.
Die Stiftung unterstützt Ausbildung in Recht, Medien, Kultur und Internet. George Soros hat Visionen - "weil die Welt ohne solche Träume ein trostloser Ort wäre". Man denkt, daß er mit seinen Stiftungen allmählich und heimlich ein osteuropäisches Medienmonopol errichten will und wundert sich über soviel Menschenfreundlichkeit und Sendungsbewußtsein.
http://www.soros.org
George Soros wurde im August 1930 als Sohn eines jüdischen Anwalts in Budapest geboren. Er wuchs unter armen Verhältnissen in Budapest auf, dennoch besuchte er die höhere Schule, die ermit dem Abitur beendete. Während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten versteckt er sich im Speicher des Elternhauses
Im Jahr 1947 emigrierte der Siebzehnjährige aus dem kommunistischen Ungarn inach England. Dort begann er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Prestigeuniversität London School of Economics, das er im Jahr 1955 abschloss.
1956 reiste er nach New York und arbeitete zunächst bei einem Reinigungsdienst der Wall Street, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schon kurze Zeit später fand er eine Anstellung bei einer kleinen Handelsbank, bei der er erste Erfahrungen im Finanzgeschäft sammelte.
Da er überaus ehrgeizig war und komplexe Zusammenhänge in kürzester Zeit lernen und weitergeben konnte, wurde er schon nach wenigen Monaten in die Abteilung der Wertpapieranalyse berufen. Dort lernte er auch seinen späteren Partner Jim Rogers kennen, mit dem er sich im Jahr 1968 selbstständig machte. Im Jahr 1969 kauften sie mit einem Startkapital von vier Millionen Dollar einen Vermögensfonds, der den Namen "Quantum" erhielt.
Durch die extreme Risikobereitschaft und die Kompetenz der Betreiber entanden nach kurzer Zeit überdurchschnittliche Renditen, die den "Quantum-Fonds" schon nach wenigen Monaten an die Spitze der erfolgreichsten Investments der USA brachte. Der "Quantum-Fonds" verwaltete im Jahr seiner Auflösung im Jahr 1988 über 15 Milliarden US-Dollar. Heute verwaltet die Soros Fund Management sechs 70 Milliarden schwere offshore Hedge-Funds.
Seit Anfang der 80er Jahre galt Soros Interesse dem Ostblock. Dort gründete er zahlreiche Stiftungen wie die "Open Society Foundation", die er regelmäßig mit gigantischen Summen unterstützt und fördert.
Im September 1992 handelte George Soros das britische Pfund gegen die englische Zentralbank. Bei diesem riskanten Währungsgeschäft gelang es ihm, die Währung buchstäblich aus den Angeln zu heben. Soros verdiente in einer Nacht über 1,4 Milliarden US-Dollar. Seither wird Soros Einfluss auf Indices und Währungen genau beobachtet. Vor allem Soros Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind dabei von höchstem Interesse.
Soros wurde durch seine Finanzaktionen der Verfall mehrerer nationaler Währungen und die Schädigung ganzer Volkswirtschaften zugeschrieben. In Malaysia sehen Beobachter Soros beispielsweise als Urheber der Asienkrise im Jahr 2000. Soros` Fund Management verwaltete im Jahr 2002 rund zwölf Milliarden Dollar.
In Argentinien kaufte Soros einen Grundbesitz von rund 400.000 Hektar zur Viehzucht von über 100.000 Rindern. Darüber hinaus ist er an einigen Hotels und zahlreichen internationalen Unternehmen beteiligt. Soros investierte in Mexiko-City 1,3 Milliarden US-Dollar in den Bau eines gigantischen Geschäfts- und Wohnkomplexes.
In den letzten Jahren trat George Soros verstärkt auch publizistisch in Erscheinung. In einem seiner Schriften warnt er sogar vor der "Krise des globalen Kapitalismus". Privat lebt er relativ bescheiden. Anfang der 80er Jahre hatte er 25 Millionen Dollar. Das reichte ihm. Und als sein Quantum-Fonds 100 Millionen Dollar schwer war, beschloß er, daß er genug Geld habe. Kurz vor der Jahrtausendwende beaß er geschätzte fünf Milliarden US-Dollar.
Es scheint, als wolle Soros mit seinem pragmatisch-philantrophischen Engagement eine eigene Gesellschaftsordnung gründen. Im ukrainischen Czernowitz lehren englische, deutsche und österreichische Professoren die Mechanismen der "offenen Gesellschaft", in Riga wird ein baufälliger Jugendstilbau bald ein westliches Institut: Soros 500 Millionen schwere Spenden-Handschrift.
Georges Soros Unterstützungen und soziale Einrichtungen haben sich mittlerweile auf über 25 Länder und Staaten ausgeweitet und beinhalten neben der Welthungerhilfe auch Themen wie die Krebs-Forschung oder die aktive Sterbehilfe. Dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen stellte er 1992 dem 50 Millionen Dollar für die Einwohner von Sarajewo zur Verfügung. 1996 war er der großzügigste amerikanische Spender, als er 360 Millionen US-Dollar für legale Einwanderer spendete
Zitate:
"Da ich mit Derivaten und anderen künstlichen Produkten eine erhebliche Hebelwirkung entfalten kann, könnte es passieren, daß ganz automatisch eine Kettenreaktion in Gang kommt und der Markt zusammenbricht",
"Wenn Leute wie ich ein Währungsregime stürzen können, stimmt etwas mit dem System nicht ... Die Zentralbanken müssen reagieren, und oft sind sie damit überfordert."
"Die Summen, die an den Börsen täglich bewegt werden, sind fast doppelt so hoch wie die Währungsreserven aller Zentralbanken. Staaten müssen sich dieser Macht beugen, ob sie wollen oder nicht; schließlich finanzieren sie über den Kapitalmarkt ihre Schuldenlast. Die Staaten sind erpreßbar geworden."
"Es ist falsch zu glauben, die Märkte würden ihre Übertreibungen korrigieren, wenn man sie nur lässt. Finanzmärkte sind von Natur aus instabil...., ...und es gibt keine internationale Finanzinstitution, die für Stabilität im weltweiten Finanzsystem sorgen könnte."
"... ich empfinde weder Schuldgefühle noch ein schlechtes Gewissen, denn ich halte mich an die Regeln. Als Handelnder an den Märkten kann ich das, was geschieht nicht ändern; als Bürger bin ich sehr besorgt, über die Instabilität der Finanzmärkte und setze mich dafür ein, andere Spielregeln zu schaffen."
Bücher:
"Geldanlage mit George Soros" (Robert Slater; Droemer, 160 Seiten, 2000)
"Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr." (George Soros; Alexander Fest Verlag, 300 Seiten, 1998)
"Die 24 Geheimnisse des George Soros. Anlegen wie eine lebende Legende." (Robert Slater; Ueberreuter Wirtschaftsverlag, 166 Seiten, 1998)
"Die Alchemie der Finanzen. Wie man die Gedanken des Marktes liest." (George Soros, Börsenbuch-Verlag, 398 Seiten, 1994).
"Soros über Soros. Börsenguru und Mäzen." (George Soros, Eichborn Verlag, 312 Seiten, 1996)
.
George Soros gibt den Dollar zum Abschuss frei
Vor zehn Jahren verdiente er eine Milliarde Dollar, als er erfolgreich gegen das britische Pfund spekulierte. Nun setzt George Soros, einer der umstrittensten Devisenexperten überhaupt, auf einen weiteren Kursverfall des Dollar.
Soros verkauft nach eigenen Angaben Dollar-Anlagen zu Gunsten anderer führender Währungen. Mit diesem Bekenntnis hat der Investor am Abend zu einem erneuten Anstieg des Euro-Kurses beigetragen.
"Ich muss bekannt geben, dass ich nun eine Verkaufsposition gegenüber dem Dollar eingenommen habe, weil ich auf das höre, was der Finanzminister mir sagt", sagte Soros am Dienstag dem amerikanischen Börsenkanal CNBC.
Der Investor bezog sich auf die jüngsten Äußerungen von US-Finanzminister John Snow. Sie deuten darauf hin, dass die USA von der Politik des starken Dollar abrücken.
Soros bezeichnete diese Äußerungen als Fehler. Sie seien ein verbohrter Versuch, die US-Wirtschaft auf Kosten anderer Ökonomien anzukurbeln: "Das ist eine Politik nach dem Sankt-Florians-Prinzip", sagte Soros. Snow handle unverantwortlich.
Nach Ausstrahlung des Interviews stieg der Euro vorübergehend auf über 1,17 Dollar. Damit näherte er sich seiner Erstnotiz in Höhe von 1,1747 Dollar vom Januar 1999.
Wie groß die Short-Positionen sind, die Soros aufgebaut hat, blieb zunächst offen. Der Investor hatte 1992 mit seinem Quantum Fund mit Leerverkäufen massiv gegen das britische Pfund spekuliert und die Währung damit aus dem Europäischen Wechselkurssystem gedrängt. Seither gilt der Soros als "der Mann, der die Bank von England knackte". Sein Einfluss an den Devisenmärkten hat sich inzwischen vermindert. Trotzdem dürften viele Händler zögern, sich in ihrem Urteil gegen Soros zu stellen.
DER SPIEGEL – 20.05.2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE SOROS -
Amerikanisch-ungarischer Großinvestor und erfolgreichster Spekulant der Welt

Wer ist der Megaspekulant, der die Bank von England auf die Knie gezwungen hat?
Er ist Philanthrop und Philosoph, Großinvestor und Manager, Akteur in der Wirtschafts- und Finanzkrise Asiens (außer Malaysia, nachdem er von Malaysias Premierminister Mahathir für die asiatische Finanzkrise verantwortlich gemacht wurde).
Die Auslösung der Rubelkrise 1998 soll auch auf seine Kappe gehen. Er unterbreitete Margret Thatcher und George Bush Vorschläge zur Gestaltung der weltwirtschaftlichen, Finanzbeziehungen; er sprach vor dem US-amerikanischen Kongreß. »Das kapitalistische Weltsystem ist von Finanzkrisen erschüttert und buchstäblich am Auseinanderbrechen. ... ich bin fest überzeugt, daß wir grundlegende Veränderungen brauchen.«
Als erster kapitalistischer Dissident machte Soros auf westlichen Finanzmärkten Milliarden und investierte sie in die postkommunistischen "Red Empire"-Länder. Über verschiedene Stiftungsnetzwerke und -organisationen versucht der "Mann mit der Midas-Hand" fast die halbe Erdkugel zu einer neuen Marktwirtschaft zu reformieren.
Die Stiftung unterstützt Ausbildung in Recht, Medien, Kultur und Internet. George Soros hat Visionen - "weil die Welt ohne solche Träume ein trostloser Ort wäre". Man denkt, daß er mit seinen Stiftungen allmählich und heimlich ein osteuropäisches Medienmonopol errichten will und wundert sich über soviel Menschenfreundlichkeit und Sendungsbewußtsein.
http://www.soros.org
George Soros wurde im August 1930 als Sohn eines jüdischen Anwalts in Budapest geboren. Er wuchs unter armen Verhältnissen in Budapest auf, dennoch besuchte er die höhere Schule, die ermit dem Abitur beendete. Während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten versteckt er sich im Speicher des Elternhauses
Im Jahr 1947 emigrierte der Siebzehnjährige aus dem kommunistischen Ungarn inach England. Dort begann er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Prestigeuniversität London School of Economics, das er im Jahr 1955 abschloss.
1956 reiste er nach New York und arbeitete zunächst bei einem Reinigungsdienst der Wall Street, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schon kurze Zeit später fand er eine Anstellung bei einer kleinen Handelsbank, bei der er erste Erfahrungen im Finanzgeschäft sammelte.
Da er überaus ehrgeizig war und komplexe Zusammenhänge in kürzester Zeit lernen und weitergeben konnte, wurde er schon nach wenigen Monaten in die Abteilung der Wertpapieranalyse berufen. Dort lernte er auch seinen späteren Partner Jim Rogers kennen, mit dem er sich im Jahr 1968 selbstständig machte. Im Jahr 1969 kauften sie mit einem Startkapital von vier Millionen Dollar einen Vermögensfonds, der den Namen "Quantum" erhielt.
Durch die extreme Risikobereitschaft und die Kompetenz der Betreiber entanden nach kurzer Zeit überdurchschnittliche Renditen, die den "Quantum-Fonds" schon nach wenigen Monaten an die Spitze der erfolgreichsten Investments der USA brachte. Der "Quantum-Fonds" verwaltete im Jahr seiner Auflösung im Jahr 1988 über 15 Milliarden US-Dollar. Heute verwaltet die Soros Fund Management sechs 70 Milliarden schwere offshore Hedge-Funds.
Seit Anfang der 80er Jahre galt Soros Interesse dem Ostblock. Dort gründete er zahlreiche Stiftungen wie die "Open Society Foundation", die er regelmäßig mit gigantischen Summen unterstützt und fördert.
Im September 1992 handelte George Soros das britische Pfund gegen die englische Zentralbank. Bei diesem riskanten Währungsgeschäft gelang es ihm, die Währung buchstäblich aus den Angeln zu heben. Soros verdiente in einer Nacht über 1,4 Milliarden US-Dollar. Seither wird Soros Einfluss auf Indices und Währungen genau beobachtet. Vor allem Soros Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind dabei von höchstem Interesse.
Soros wurde durch seine Finanzaktionen der Verfall mehrerer nationaler Währungen und die Schädigung ganzer Volkswirtschaften zugeschrieben. In Malaysia sehen Beobachter Soros beispielsweise als Urheber der Asienkrise im Jahr 2000. Soros` Fund Management verwaltete im Jahr 2002 rund zwölf Milliarden Dollar.
In Argentinien kaufte Soros einen Grundbesitz von rund 400.000 Hektar zur Viehzucht von über 100.000 Rindern. Darüber hinaus ist er an einigen Hotels und zahlreichen internationalen Unternehmen beteiligt. Soros investierte in Mexiko-City 1,3 Milliarden US-Dollar in den Bau eines gigantischen Geschäfts- und Wohnkomplexes.
In den letzten Jahren trat George Soros verstärkt auch publizistisch in Erscheinung. In einem seiner Schriften warnt er sogar vor der "Krise des globalen Kapitalismus". Privat lebt er relativ bescheiden. Anfang der 80er Jahre hatte er 25 Millionen Dollar. Das reichte ihm. Und als sein Quantum-Fonds 100 Millionen Dollar schwer war, beschloß er, daß er genug Geld habe. Kurz vor der Jahrtausendwende beaß er geschätzte fünf Milliarden US-Dollar.
Es scheint, als wolle Soros mit seinem pragmatisch-philantrophischen Engagement eine eigene Gesellschaftsordnung gründen. Im ukrainischen Czernowitz lehren englische, deutsche und österreichische Professoren die Mechanismen der "offenen Gesellschaft", in Riga wird ein baufälliger Jugendstilbau bald ein westliches Institut: Soros 500 Millionen schwere Spenden-Handschrift.
Georges Soros Unterstützungen und soziale Einrichtungen haben sich mittlerweile auf über 25 Länder und Staaten ausgeweitet und beinhalten neben der Welthungerhilfe auch Themen wie die Krebs-Forschung oder die aktive Sterbehilfe. Dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen stellte er 1992 dem 50 Millionen Dollar für die Einwohner von Sarajewo zur Verfügung. 1996 war er der großzügigste amerikanische Spender, als er 360 Millionen US-Dollar für legale Einwanderer spendete
Zitate:
"Da ich mit Derivaten und anderen künstlichen Produkten eine erhebliche Hebelwirkung entfalten kann, könnte es passieren, daß ganz automatisch eine Kettenreaktion in Gang kommt und der Markt zusammenbricht",
"Wenn Leute wie ich ein Währungsregime stürzen können, stimmt etwas mit dem System nicht ... Die Zentralbanken müssen reagieren, und oft sind sie damit überfordert."
"Die Summen, die an den Börsen täglich bewegt werden, sind fast doppelt so hoch wie die Währungsreserven aller Zentralbanken. Staaten müssen sich dieser Macht beugen, ob sie wollen oder nicht; schließlich finanzieren sie über den Kapitalmarkt ihre Schuldenlast. Die Staaten sind erpreßbar geworden."
"Es ist falsch zu glauben, die Märkte würden ihre Übertreibungen korrigieren, wenn man sie nur lässt. Finanzmärkte sind von Natur aus instabil...., ...und es gibt keine internationale Finanzinstitution, die für Stabilität im weltweiten Finanzsystem sorgen könnte."
"... ich empfinde weder Schuldgefühle noch ein schlechtes Gewissen, denn ich halte mich an die Regeln. Als Handelnder an den Märkten kann ich das, was geschieht nicht ändern; als Bürger bin ich sehr besorgt, über die Instabilität der Finanzmärkte und setze mich dafür ein, andere Spielregeln zu schaffen."
Bücher:
"Geldanlage mit George Soros" (Robert Slater; Droemer, 160 Seiten, 2000)
"Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr." (George Soros; Alexander Fest Verlag, 300 Seiten, 1998)
"Die 24 Geheimnisse des George Soros. Anlegen wie eine lebende Legende." (Robert Slater; Ueberreuter Wirtschaftsverlag, 166 Seiten, 1998)
"Die Alchemie der Finanzen. Wie man die Gedanken des Marktes liest." (George Soros, Börsenbuch-Verlag, 398 Seiten, 1994).
"Soros über Soros. Börsenguru und Mäzen." (George Soros, Eichborn Verlag, 312 Seiten, 1996)
.
Moin, moin, im ersten Moment dachte ich, da steht der Esser von ex.Mannesmann. Ist aber ein anderes Kaliber der Soros. Hat vor ungefähr 10 Jahren schon einmal öffentlich bekannt gegeben, er investiere jetzt in Gold. 3 x darfst Du raten, was dann passierte.
So nun weiss jeder, der vom "Markt" oder den Cleverles über den Tisch gezogen wird, er tut Gutes in Osteuropa.
Is ja wie beim Zahlenlotto, vom Überschüss werden dann im Zoo die Löwen gefüttert.
Ich liebe Philantropen.
J2

So nun weiss jeder, der vom "Markt" oder den Cleverles über den Tisch gezogen wird, er tut Gutes in Osteuropa.
Is ja wie beim Zahlenlotto, vom Überschüss werden dann im Zoo die Löwen gefüttert.
Ich liebe Philantropen.

J2
.
Moin Jeffery
- die wirklich schlimmen Finger kreuzen aber auch schon auf ...

Corporate Raider
Auf Beutezug im alten Europa
Von Thomas Hillenbrand
Sie sind die Haifische der Kapitalmärkte, nun schwärmen sie nach Europa. US-Raider haben den größten Beutezug seit zwei Jahrzehnten gestartet, notleidende Konzerne des alten Kontinents ziehen sie magisch an. Obwohl das Land als hoffnungslos reformunfähig gilt, stehen auch deutsche Unternehmen auf der Einkaufsliste, besonders Medienfirmen.
Hamburg - Wenn deutsche Unternehmer den Begriff Private Equity (PE) hören, dann denken sie an Typen wie Gordon Gekko, den von Michael Douglas in "Wall Street" verkörperten Finanzpiraten. An einen, der hilflose Unternehmen gegen ihren Willen kapert, in Stücke hackt, weiterverkauft und dabei gekkoeske Sätze sagt wie: "Gier ist die Essenz der Evolution."
Gekko ist zwar nur eine Filmfigur aus den Achtzigern, doch er spiegelt recht gut das Image wider, das Private-Equity-Firmen haben - jene Kapitalgesellschaften, die nicht börsennotiert sind und mit ihrem eigenen Geld oder dem privater Investoren auf die Jagd gehen. Sie suchen preiswerte Firmen und kaufen diese auf. Nach der Akquisition, in der Fachsprache Buyout genannt, wird das Unternehmen dann entweder saniert oder in appetitliche Stücke zerlegt. Ziel ist es, die Braut so weit aufzuhübschen, dass man sie möglichst bald mit hohem Profit weiterverkaufen kann. Medien und Öffentlichkeit titulieren die Freibeuter der Kapitalmärkte deshalb häufig wenig schmeichelhaft als "Corporate Raider" oder "Sharks".
Während des Dotcom-Booms befand sich die Branche im Dämmerzustand. Denn Schnäppchen waren Mangelware - selbst subalterne Unternehmen verfügten damals über eine so hohe Börsenbewertung, dass Übernahmen aussichtslos waren.
The Boys Are Back In Town
Jetzt ist die Branche erwacht. Private-Equity-Granden wie Kohlberg Kravis Roberts (KKR, siehe Kasten), die Carlyle Group aber auch kleinere Investorengruppen sind seit einiger Zeit wieder auf Beutezug. Im Visier haben sie zunehmend Westeuropa. Nach Berechnungen des Finanzdatenanbieters Bloomberg sind die PE-Transaktionen in Europa im Jahr 2002 um 164 Prozent auf 47 Milliarden Dollar angestiegen - das ist ein mehr als doppelt so hoher Zuwachs wie in den USA.
Stephen Peel von der Texas Pacific Group (TPG) sieht die Entwicklung ähnlich: "In den vergangenen zwölf Monaten ist der Anteil von Private Equity am Fusionsgeschäft dramatisch angestiegen, von etwa 5 auf 40 Prozent", sagte er gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung "The Business". TPG ist eines von fünf PE-Unternehmen, das sich für Teile der in Großbritannien ansässigen Hotelkette Six Continents interessiert.
Britannica , The Beautiful
Großbritannien war im vergangenen Jahr ein Schwerpunkt der PE-Aktivitäten in Europa. Neben Six Continents sind etwa die Supermarktketten Safeway, Woolworth und Selfridges im Visier der Raider. Aber auch in Deutschland ist die Branche höchst aktiv. Der Medienkonzern Bertelsmann hat unlängst seinen Fachverlag BertelsmannSpringer für gut eine Milliarde Euro an das britische Konsortium Candover/Cinven veräußert. Auch beim untergegangenen Kirch-Imperium haben die Freibeuter zugeschlagen. Der Bezahlsender Premiere ging an das Unternehmen Permira. Richtig hingelangt haben PE-Investoren bei lokalen deutschen Kabelgesellschaften wie zum Beispiel der hessischen Iesy. "Die haben sich", so ein Manager eines Kabelanbieters, "praktisch die gesamte Branche unter den Nagel gerissen."
Den bisher größten Coup landete Branchenprimus KKR, als er 2002 den französischen Elektronikkonzern Legrand für 3,63 Milliarden Euro erwarb. Weitere Megadeals sind zu erwarten; derzeit verhandelt Telecom Italia über den Verkauf seiner Telefonbuchsparte Seat Pagina. An den US-Aktivitäten des angeschlagenen niederländischen Einzelhandelsriesen Ahold sollen ebenfalls mehrere Buyout-Spezialisten interessiert sein.
Wie lukrativ ein gut durchgezogener Buyout sein kann, machte unlängst Permira vor. Die Investmentgruppe kaufte 2002 die britische Baumarktkette Homebase. Das Unternehmen wurde zügig umstrukturiert und im Frühjahr 2003 weiterverkauft. Geschätzte Rendite: 600 Prozent.
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Gründe für die hektischen Aktivitäten in Westeuropa gibt es mehrere. Erstens ist die Grundvoraussetzung für eine ungezügelte Shoppingtour vorhanden: Die Branche schwimmt im Geld. Einer Studie der Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers (PwC) zufolge standen PE-Investoren Ende 2001 über 180 Milliarden Dollar zur Verfügung. Alleine KKR soll über eine mit mehr als sechs Milliarden Dollar gefüllte Kriegskasse verfügen.
Zweitens gelten europäische Unternehmen derzeit als sehr billig, nachdem die Börse wie ein Soufflé in sich zusammengefallen ist. Richard Davidson, Europa-Stratege bei der Investmentbank Morgan Stanley, meint, dass teilweise historisch günstige Schnäppchen zu machen sind: "Europas Bewertung ist immer noch sehr attraktiv." Eine Kennzahl, die Davidson für seine Analysen häufig benutzt, ist die Free-Cash-Flow-Rendite. Diese betrug Anfang April fast fünf Prozent. Das entspricht einem Zwanzig-Jahres-Hoch.
Drittens haben viele Unternehmen erhebliche finanzielle Probleme. In den guten Zeiten haben sie sich maßlos verschuldet - jetzt muss dringend frisches Kapital her. Das aber ist derzeit an der Börse kaum zu bekommen. Auch die Banken halten sich mit neuen Krediten zurück. Neuerdings ist die einst geschmähte Private-Equity-Branche deshalb mitunter äußerst willkommen. Denn die Piraten zahlen in bar.
Money Can`t Buy Me Love
Viele europäische Unternehmen haben keine andere Wahl, als in großem Stil Ballast abzuwerfen, wenn sie nicht untergehen wollen. Finanziell moribunde Konzerne wie France Télécom, Vivendi oder die Fiat-Gruppe wollen Unternehmensteile abstoßen oder haben dies bereits getan. Käufer sind im dritten Jahr der Baisse allerdings Mangelware - PE-Firmen sind häufig die einzigen Kaufwilligen. Auch gesunde Unternehmen wie Siemens verkaufen deshalb an die Freibeuter - für 1,7 Milliarden Euro veräußerten die Münchner im vergangenen Sommer sieben ihrer Töchter, die früher zu Atecs Mannesmann gehörten, an KKR.
Branchenbeobachter glauben, dass es in Westeuropa noch Potenzial für weitere Buyouts gibt. Im Moment sind nach Ansicht von PE-Spezialist Theo Weber von PwC Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien interessant, aber auch Skandinavien. Das Image der Branche schätzt Weber nach wie vor als durchwachsen ein: "Vorbehalte wird es immer geben - insbesondere in Deutschland - da ein PE-Haus immer innerhalb eines mittelfristigen Zeitrahmens weiterverkaufen will beziehungsweise muss."
Möglicherweise können die dreistelligen Renditen über das ungute Gefühl hinweghelfen, vom Rest der Welt als räuberisches Subjekt betrachtet zu werden. Oder wie Gordon Gekko sagt: "Wenn Du einen Freund brauchst, schaff Dir einen Hund an."

Barbaren vor den Toren
Als Pioniere der Firmenakquisition zum Zwecke des späteren Weiterverkaufs gelten die Banker Jerry Kohlberg, Henry Kravis und George Roberts. Ihr Vorgehen: Nachdem sie ein Unternehmen ins Visier genommen hatten, liehen sie sich große Summen Geld. Zur Absicherung der Kredite boten sie ihren Gläubigern die Aktiva der zu erwerbenden Firma an; die Schulden zahlten sie aus den liquiden Mitteln des übernommenen Unternehmens zurück - damit finanzierte sich der Deal größtenteils von selbst. Ging alles glatt, bekamen die drei ein Unternehmen für etwa ein Drittel des Kaufpreises.
Dieses "Bootstrapping" genannte Verfahren wurde von KKR in den achtziger Jahren perfektioniert und als "finanzieller Enterhaken" ("Neue Zürcher Zeitung" ) eingesetzt. 1988 gelang es KKR, den Genussmittelkonzern RJR Nabisco für etwa 25 Milliarden Dollar unter seine Kontrolle zu bringen. Zehntausende fürchteten um ihre Arbeitsplätze, denn KKR ging es nur um den Profit. Zwei Reporter des "Wall Street Journals" verewigten die Übernahmeschlacht in dem Buch "Barbarians at the Gate".
DER SPIEGEL - 22.05.2003
Moin Jeffery

- die wirklich schlimmen Finger kreuzen aber auch schon auf ...


Corporate Raider
Auf Beutezug im alten Europa
Von Thomas Hillenbrand
Sie sind die Haifische der Kapitalmärkte, nun schwärmen sie nach Europa. US-Raider haben den größten Beutezug seit zwei Jahrzehnten gestartet, notleidende Konzerne des alten Kontinents ziehen sie magisch an. Obwohl das Land als hoffnungslos reformunfähig gilt, stehen auch deutsche Unternehmen auf der Einkaufsliste, besonders Medienfirmen.
Hamburg - Wenn deutsche Unternehmer den Begriff Private Equity (PE) hören, dann denken sie an Typen wie Gordon Gekko, den von Michael Douglas in "Wall Street" verkörperten Finanzpiraten. An einen, der hilflose Unternehmen gegen ihren Willen kapert, in Stücke hackt, weiterverkauft und dabei gekkoeske Sätze sagt wie: "Gier ist die Essenz der Evolution."
Gekko ist zwar nur eine Filmfigur aus den Achtzigern, doch er spiegelt recht gut das Image wider, das Private-Equity-Firmen haben - jene Kapitalgesellschaften, die nicht börsennotiert sind und mit ihrem eigenen Geld oder dem privater Investoren auf die Jagd gehen. Sie suchen preiswerte Firmen und kaufen diese auf. Nach der Akquisition, in der Fachsprache Buyout genannt, wird das Unternehmen dann entweder saniert oder in appetitliche Stücke zerlegt. Ziel ist es, die Braut so weit aufzuhübschen, dass man sie möglichst bald mit hohem Profit weiterverkaufen kann. Medien und Öffentlichkeit titulieren die Freibeuter der Kapitalmärkte deshalb häufig wenig schmeichelhaft als "Corporate Raider" oder "Sharks".
Während des Dotcom-Booms befand sich die Branche im Dämmerzustand. Denn Schnäppchen waren Mangelware - selbst subalterne Unternehmen verfügten damals über eine so hohe Börsenbewertung, dass Übernahmen aussichtslos waren.
The Boys Are Back In Town
Jetzt ist die Branche erwacht. Private-Equity-Granden wie Kohlberg Kravis Roberts (KKR, siehe Kasten), die Carlyle Group aber auch kleinere Investorengruppen sind seit einiger Zeit wieder auf Beutezug. Im Visier haben sie zunehmend Westeuropa. Nach Berechnungen des Finanzdatenanbieters Bloomberg sind die PE-Transaktionen in Europa im Jahr 2002 um 164 Prozent auf 47 Milliarden Dollar angestiegen - das ist ein mehr als doppelt so hoher Zuwachs wie in den USA.
Stephen Peel von der Texas Pacific Group (TPG) sieht die Entwicklung ähnlich: "In den vergangenen zwölf Monaten ist der Anteil von Private Equity am Fusionsgeschäft dramatisch angestiegen, von etwa 5 auf 40 Prozent", sagte er gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung "The Business". TPG ist eines von fünf PE-Unternehmen, das sich für Teile der in Großbritannien ansässigen Hotelkette Six Continents interessiert.
Britannica , The Beautiful
Großbritannien war im vergangenen Jahr ein Schwerpunkt der PE-Aktivitäten in Europa. Neben Six Continents sind etwa die Supermarktketten Safeway, Woolworth und Selfridges im Visier der Raider. Aber auch in Deutschland ist die Branche höchst aktiv. Der Medienkonzern Bertelsmann hat unlängst seinen Fachverlag BertelsmannSpringer für gut eine Milliarde Euro an das britische Konsortium Candover/Cinven veräußert. Auch beim untergegangenen Kirch-Imperium haben die Freibeuter zugeschlagen. Der Bezahlsender Premiere ging an das Unternehmen Permira. Richtig hingelangt haben PE-Investoren bei lokalen deutschen Kabelgesellschaften wie zum Beispiel der hessischen Iesy. "Die haben sich", so ein Manager eines Kabelanbieters, "praktisch die gesamte Branche unter den Nagel gerissen."
Den bisher größten Coup landete Branchenprimus KKR, als er 2002 den französischen Elektronikkonzern Legrand für 3,63 Milliarden Euro erwarb. Weitere Megadeals sind zu erwarten; derzeit verhandelt Telecom Italia über den Verkauf seiner Telefonbuchsparte Seat Pagina. An den US-Aktivitäten des angeschlagenen niederländischen Einzelhandelsriesen Ahold sollen ebenfalls mehrere Buyout-Spezialisten interessiert sein.
Wie lukrativ ein gut durchgezogener Buyout sein kann, machte unlängst Permira vor. Die Investmentgruppe kaufte 2002 die britische Baumarktkette Homebase. Das Unternehmen wurde zügig umstrukturiert und im Frühjahr 2003 weiterverkauft. Geschätzte Rendite: 600 Prozent.
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Gründe für die hektischen Aktivitäten in Westeuropa gibt es mehrere. Erstens ist die Grundvoraussetzung für eine ungezügelte Shoppingtour vorhanden: Die Branche schwimmt im Geld. Einer Studie der Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers (PwC) zufolge standen PE-Investoren Ende 2001 über 180 Milliarden Dollar zur Verfügung. Alleine KKR soll über eine mit mehr als sechs Milliarden Dollar gefüllte Kriegskasse verfügen.
Zweitens gelten europäische Unternehmen derzeit als sehr billig, nachdem die Börse wie ein Soufflé in sich zusammengefallen ist. Richard Davidson, Europa-Stratege bei der Investmentbank Morgan Stanley, meint, dass teilweise historisch günstige Schnäppchen zu machen sind: "Europas Bewertung ist immer noch sehr attraktiv." Eine Kennzahl, die Davidson für seine Analysen häufig benutzt, ist die Free-Cash-Flow-Rendite. Diese betrug Anfang April fast fünf Prozent. Das entspricht einem Zwanzig-Jahres-Hoch.
Drittens haben viele Unternehmen erhebliche finanzielle Probleme. In den guten Zeiten haben sie sich maßlos verschuldet - jetzt muss dringend frisches Kapital her. Das aber ist derzeit an der Börse kaum zu bekommen. Auch die Banken halten sich mit neuen Krediten zurück. Neuerdings ist die einst geschmähte Private-Equity-Branche deshalb mitunter äußerst willkommen. Denn die Piraten zahlen in bar.
Money Can`t Buy Me Love
Viele europäische Unternehmen haben keine andere Wahl, als in großem Stil Ballast abzuwerfen, wenn sie nicht untergehen wollen. Finanziell moribunde Konzerne wie France Télécom, Vivendi oder die Fiat-Gruppe wollen Unternehmensteile abstoßen oder haben dies bereits getan. Käufer sind im dritten Jahr der Baisse allerdings Mangelware - PE-Firmen sind häufig die einzigen Kaufwilligen. Auch gesunde Unternehmen wie Siemens verkaufen deshalb an die Freibeuter - für 1,7 Milliarden Euro veräußerten die Münchner im vergangenen Sommer sieben ihrer Töchter, die früher zu Atecs Mannesmann gehörten, an KKR.
Branchenbeobachter glauben, dass es in Westeuropa noch Potenzial für weitere Buyouts gibt. Im Moment sind nach Ansicht von PE-Spezialist Theo Weber von PwC Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien interessant, aber auch Skandinavien. Das Image der Branche schätzt Weber nach wie vor als durchwachsen ein: "Vorbehalte wird es immer geben - insbesondere in Deutschland - da ein PE-Haus immer innerhalb eines mittelfristigen Zeitrahmens weiterverkaufen will beziehungsweise muss."
Möglicherweise können die dreistelligen Renditen über das ungute Gefühl hinweghelfen, vom Rest der Welt als räuberisches Subjekt betrachtet zu werden. Oder wie Gordon Gekko sagt: "Wenn Du einen Freund brauchst, schaff Dir einen Hund an."

Barbaren vor den Toren
Als Pioniere der Firmenakquisition zum Zwecke des späteren Weiterverkaufs gelten die Banker Jerry Kohlberg, Henry Kravis und George Roberts. Ihr Vorgehen: Nachdem sie ein Unternehmen ins Visier genommen hatten, liehen sie sich große Summen Geld. Zur Absicherung der Kredite boten sie ihren Gläubigern die Aktiva der zu erwerbenden Firma an; die Schulden zahlten sie aus den liquiden Mitteln des übernommenen Unternehmens zurück - damit finanzierte sich der Deal größtenteils von selbst. Ging alles glatt, bekamen die drei ein Unternehmen für etwa ein Drittel des Kaufpreises.
Dieses "Bootstrapping" genannte Verfahren wurde von KKR in den achtziger Jahren perfektioniert und als "finanzieller Enterhaken" ("Neue Zürcher Zeitung" ) eingesetzt. 1988 gelang es KKR, den Genussmittelkonzern RJR Nabisco für etwa 25 Milliarden Dollar unter seine Kontrolle zu bringen. Zehntausende fürchteten um ihre Arbeitsplätze, denn KKR ging es nur um den Profit. Zwei Reporter des "Wall Street Journals" verewigten die Übernahmeschlacht in dem Buch "Barbarians at the Gate".
DER SPIEGEL - 22.05.2003
.
Arbeit für 4,90 Euro
Erwerbslose sollen Billigjobs annehmen, fordert der Kanzler.
Wie sehen diese Jobs aus, und wie kann man davon leben?
Von Christian Tenbrock
Bis zu zwölf Stunden steht Susanne Schwab* auf den Beinen, schaut, prüft, kontrolliert. Zwölf Stunden täglich, von morgens sechs bis abends sechs, sechs Tage in der Woche, dann hat sie drei Tage frei. Schwab steht an einem Eingang des Berliner Reichstags an der Röntgen-Schleuse, dort, wo die Touristen und Bundestags-Besucher hereinkommen. Manchmal auch die Politiker. Friedrich Merz von der CDU hat sie schon mal gesehen, auch Guido Westerwelle von der FDP.
Für jede Stunde Arbeit bekommt Susanne Schwab vier Euro neunzig Cent. Etwa 240 Stunden kommen im Monat zusammen, das macht dann rund 1175 Euro – brutto. Netto bleiben ihr weniger als 1000. Dafür steht sie morgens um halb fünf auf und nimmt um fünf den Bus und die S-Bahn, um von ihrer Wohnung weit draußen im Berliner Osten rechtzeitig zum Reichstag zu kommen. Abends die gleiche Tour zurück. Zwei der fünf Kinder leben noch zu Hause.
Sie komme hin, sagt Schwab, gerade so eben, und nur, weil der Lebensgefährte Arbeitslosengeld beziehe. Fleisch gibt es einmal die Woche, das Bierchen mit den Kollegen einmal im Monat, neue Kleidung einmal im Jahr, und den Besuch im Kino oder im Restaurant nie. Im Urlaub war die 46-Jährige zuletzt 1988. Zwei Wochen an der Ostsee.
Susanne Schwab ist das, was in Deutschland „Billiglöhner“ heißt. Einer jener Menschen, von denen es nach Meinung vieler Politiker und Ökonomen mehr geben sollte. Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, fordern sie, müsse der Niedriglohnsektor in Deutschland ausgeweitet werden. Es müssten mehr Jobs her mit einem Verdienst, der irgendwo zwischen der Sozialhilfe und dem niedrigsten Tariflohn liegt. Und um die Menschen zu bewegen, solche Jobs anzunehmen, müssten sie dazu gezwungen werden – durch weniger Arbeitslosengeld und weniger Arbeitslosenhilfe. So will es auch der Kanzler mit seiner Agenda 2010.
Blutspenden frischen die Haushaltskasse auf
Dabei gibt es in Deutschland schon jetzt Millionen Beschäftigte wie Susanne Schwab. Doris Malert zum Beispiel: In einem Kaufhaus-Restaurant in Kiel spült sie und putzt die Tische ab. 836 Euro bleiben ihr am Monatsende, 400 nach Abzug von Miete, Telefon und Versicherungen. Oder Annelie Kaslak, die für 5 Euro in der Stunde Blumen in einem Geschäft in der Nähe von Zwickau verkauft; ohne den Verdienst ihres Freundes, der Rasen mäht und Hauswartsarbeiten erledigt, könnte sie nicht überleben. Oder Michael Möller, 48, ausgebildeter Elektriker, ein schmaler Mann mit kräftigen Händen: 6,90 Euro verdiente Möller als Zeitarbeiter in Plauen, bevor er vor wenigen Wochen auch diese Arbeit verlor.
In Amerika würde man Schwab, Kaslak, Malert oder Möller „arbeitende Arme“ nennen – Beschäftigte, die am Monatsende so wenig Geld nach Hause bringen, dass sie unter die Armutsgrenze fallen. Die liegt in Deutschland bei etwas mehr als 1200 Euro brutto, der Hälfte eines deutschen Durchschnittseinkommens. Nimmt man diese Grenze als Maßstab, dann arbeiten allein im Westen der Republik 12 Prozent aller Vollzeit-Beschäftigten zum Armutslohn, sagt Claus Schäfer vom gewerkschaftsnahen Forschungsinstitut WSI in Düsseldorf. Das wären 2,2 Millionen Menschen nur in den alten Bundesländern. Im Osten ist der Anteil der Billiglöhner weitaus höher.
Im Vogtlandkreis bei Zwickau beispielsweise verdienten im Jahr 2001 – neuere Statistiken gibt es nicht – 56 Prozent aller Beschäftigten weniger als 910 Euro netto im Monat. „Über Niedriglöhne muss man mir nichts mehr erzählen“, sagt Sabine Zimmermann, DGB-Chefin in Zwickau. Der Floristin Annelie Kaslak auch nicht. 27 Euro bleiben ihr von ihrem Monatslohn, nachdem sie die Miete, die Versicherungen und die Kosten für das Auto bezahlt hat, das sie braucht, um zum Job zu kommen. Zwölfmal hat sie in den letzten Monaten Blut gespendet, pro Spende gibt es 15 Euro extra. Der größte Luxus im letzten Jahr? „Eine neue Brille.“ Markenjeans? „Niemals.“ Ein anderer, besser bezahlter Job? „Wo denn?“
44935 Arbeitslosen im Arbeitsamtsbezirk Zwickau standen im April nur 2520 offene Stellen gegenüber. In Plauen kamen auf 24697 Menschen ohne Arbeit gerade mal 1158 freie Stellen. Dabei müsste das der Theorie nach ganz anders sein. Theoretisch müsste die Zahl der Arbeitsplätze steigen, wenn die Löhne niedrig sind. So sagen es zumindest all jene Ökonomen, die einen größeren Niedriglohnsektor in Deutschland fordern. Hans-Werner Sinn etwa, der Chef des Münchner Ifo-Instituts, spricht von 2,3 Millionen zusätzlicher Jobs, wenn die Löhne gering genug wären und Menschen ohne Arbeit zu ihrem Arbeitsglück gezwungen würden. Auch Klaus Zimmermann, der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, hält zahllose neue Billig-Arbeitsplätze für möglich: „Potenziell 2 Millionen.“
Hinter den Modellen der Theoretiker stehen ein paar simple Annahmen und der Blick ins Ausland:
Erstens seien einfachere Jobs in Deutschland dank zu hoher Tariflöhne auch im untersten Bereich zu teuer geworden, also wurden sie wegrationalisiert und Hilfsarbeiter aufs Arbeitsamt geschickt.
Zweitens sei die bisherige Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu hoch, deshalb gebe es für die Empfänger staatlicher Leistungen nicht genügend „Anreize“ , einen auch gering entlohnten Job anzunehmen.
Und drittens existiere in Deutschland eine „Dienstleistungslücke“ : Während zum Beispiel in den USA die in der Industrie verlorenen Stellen durch zahlreiche neue Arbeitsplätze ersetzt worden seien – im Handel, in der Gastronomie oder im Gesundheitswesen –, sei dies hierzulande nur unterdurchschnittlich geschehen. Wiederum auch deshalb, weil die Löhne in solchen Jobs angeblich zu hoch sind.
Die Therapie: Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes einerseits, Reduzierung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau andererseits. So steht es in der Agenda 2010, so will der Kanzler den Druck auf die Arbeitsfähigen erhöhen, tatsächlich nach einem Job zu suchen. Ifo-Chef Sinn geht noch weiter und will zusätzlich die Sozialhilfe um etwa ein Viertel absenken. Und DIW-Leiter Zimmermann möchte die Bezieher staatlicher Stütze zu einer Art staatlichem Arbeitsdienst verpflichten; auch das, so seine Hoffnung, werde sie am Ende dazu bewegen, einen regulären Job anzunehmen – jeden Job.
Würden sich Arbeitslose oder Menschen auf Sozialhilfe nur billig genug verdingen, würden diese Jobs auch geschaffen, sind die Therapeuten überzeugt. „Tankwarte, Parkplatzwächter, Tüten-Einpacker, Türöffner am Kaufhaus“, zählt Hilmar Schneider vom Forschungsinstitut Zukunft der Arbeit in Bonn auf. Oder auch Haushaltshilfen, Kinderbetreuer, Pfleger und Pizza-Lieferanten. „Potenziell rentable Arbeitsplätze gibt es in den Köpfen der Arbeitgeber genug“, glaubt Hans-Werner Sinn.
Wirklich?
So bestechend die Erfahrungen mit Billiglöhnern im Ausland auch sein mögen, als Blaupause für Deutschland taugen sie nur bedingt. Denn Deutschlands ökonomisches Dilemma ist der Osten. Dort fehlt es nicht an Druck auf Arbeitslose, dort fehlt es an Jobs – ganz gleich, wie günstig die Arbeitskräfte sind.
Die Vorstellung, in den neuen Bundesländern könne ein noch höheres und noch billigeres Angebot an Arbeitskräften quasi automatisch auch eine starke, Zehntausende Arbeitsplätze schaffende Nachfrage nach ihnen in Gang setzen, „ist absurd“, sagt Burkhard Lutz, Professor am Zentrum für Sozialforschung in Halle. In der gewerblichen Wirtschaft, berichtet die DGB-Frau Zimmermann, seien längst Absetzbewegungen der Betriebe in Niedrigstlohnländer wie Tschechien und Polen im Gange, wo Bandarbeiter weniger als zwei Euro die Stunde verdienen. Und bei den Dienstleistungen fehlt schlicht die Nachfrage derer, die sie bezahlen müssten – der privaten Haushalte also. „Man möchte die Kunden manchmal fast nötigen, einen Strauß Blumen zu kaufen“, sagt die Floristin Kaslak. „Aber man weiß eben auch, dass ihnen die Tüte Semmeln wichtiger ist.“
Und im Westen? Die Küchenhilfe Doris Malert bekommt einen Tariflohn von unter sieben Euro. „Allein kann ich davon leben“, sagt sie, „man richtet sich ein.“ Urlaub ist nicht drin, und auch der Kauf von teuren Gesundheitsschuhen nicht, die sie eigentlich nötig hätte. Wenn nun aber Malerts Lohn auf sechs oder sogar fünf Euro sänke oder die Lohnnebenkosten fielen – würden dann sofort mehr Küchenhilfen eingestellt? Kaum, sagt Hans Detlef Rahr, Betriebsratschef und Aufsichtsrat in dem Unternehmen, das die Spülerin beschäftigt. Auch Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, verspricht alles andere als massenhaft neue Jobs: „Wenn kein Geschäft da ist, werden keine Arbeitskräfte benötigt.“
Wenig Chancen für Einpackhelfer oder Tütenschlepper
Im Einzelhandel wiederum sind „die Niedriglohnjobs bereits besetzt“, sagt Heribert Jöris, Tarifexperte beim Einzelhandelsverband HDE. Ganz gering entlohnte Tätigkeiten wie die von „Regalpflegern“ – Beschäftigte, die Dosen und Kartons nachlegen – werden überdies meist von [/b]Minijobbern erledigt, und die sind in der Regel nicht ehemalige Arbeitslose, sondern Hausfrauen oder Studenten. Die Schaffung weiterer Billigjobs, etwa für Einpackhelfer oder Tütenschlepper, scheitert nach Jöris’ Worten zudem an der Unwilligkeit der Kundschaft, diesen Service mit einem kleinen Aufschlag auf die Warenpreise zu honorieren. [/b] Wenn es aber schon solche Jobs kaum gibt, dann bleibt wohl auch die Hoffnung, dass künftig Tausende Türöffner, Tankwarte oder Parkwächter neu eingestellt werden, genau das: die reine Hoffnung.
Selbst dort, wo auch Kritiker einer Niedriglohnstrategie noch die größten Chancen sehen, viele Arbeitsplätze zu schaffen und Schwarzarbeiter in die Legalität zu bringen, ist Vorsicht angebracht. 500000 neue Stellen könnten in privaten Haushalten für Putzhilfen eingerichtet werden, lautet die Vision von DIW-Chef Zimmermann. Viel zu optimistisch, nennt das Claudia Weinkopf, die für das Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen die bisherigen Erfahrungen in dieser Branche untersucht hat. Ihr Fazit: Auch dann, wenn professionelle und legale Putzarbeiten vom Staat hoch subventioniert werden – in einem Versuch in Rheinland-Pfalz zum Beispiel mit 50 Prozent –, liegen die Kosten für den Arbeitgeber oft deutlich über den üblichen Schwarzmarktpreisen. Keiner der mit viel Tamtam eingerichteten und staatlich bezuschussten „Dienstleistungspools“, in denen Reinigungskräfte für Privathaushalte ähnlich wie in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt werden, konnte bislang Kostendeckung erreichen. „Wer eine halbe Million Putzjobs erwartet“, sagt Weinkopf, „geht von völlig unrealistischen Annahmen aus.“
Ohne Nachfrage kein Wachstum – und auch keine neuen Jobs
Das alles heißt nicht, dass es überhaupt keine zusätzlichen Stellen für Arbeitnehmer geben wird, die mit fünf Euro pro Stunde zufrieden sein müssen. Wer es sich leisten kann, lässt sich Bier und Butter von einem Online-Supermarkt frei Haus liefern und zahlt dafür den Menschen, der die Kisten und Tüten auch in den fünften Stock schleppt. Wer genügend Geld hat, wird einen Kinderbetreuer oder eine Pflegerin für seine Eltern beschäftigen. Man braucht also Besserverdienende, die die schlechter Verdienenden bezahlen können. Ökonomisch formuliert heißt das: Man braucht Wachstum.
Selbst DIW-Chef Zimmermann räumt ein, dass ein Billigjobwunder à la Amerika zwei Dinge benötige: mehr Anreize für die Arbeitgeber, diese Jobs zu schaffen – und gleichzeitig eine starke Nachfrage. Aber die fehlt in Deutschland. Tatsächlich halten sich die Menschen mit Ausgaben zurück, die Sparquote ist so hoch wie lange nicht mehr, die Wirtschaft stagniert. Nur um 0,5 Prozent, schätzen Konjunkturforscher, wird Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr wachsen; doch um auch nur ein paar hunderttausend Jobs für die zwei Millionen niedrig qualifizierten Arbeitslosen und arbeitsfähigen Sozialhilfebezieher zu schaffen, braucht es schon ein Wachstum von drei oder vier Prozent. Und auch dann sind es zunächst nicht die gering Qualifizierten, die als Erste eingestellt werden. Call-Center beispielsweise, hat Claudia Weinkopf herausgefunden, rekrutieren ihre Angestellten vornehmlich aus den inzwischen ebenfalls massenhaft zur Verfügung stehenden Arbeitslosen mit Ausbildung und Vorkenntnissen.
Mit alldem ist die Debatte um die Ausweitung des Niedriglohnsektors viel mehr als ein rein ökonomisches oder arbeitsmarktpolitisches Thema. Es geht auch um die Frage, „wie sehr viele arbeitende Menschen in Deutschland künftig leben sollen“, sagt Gerhard Bäcker, Sozialexperte der Universität Duisburg-Essen. Gibt es ein massenhaftes Angebot an Billig-Arbeitskräften, würden selbst jene geringen Tariflöhne unter Druck geraten, die schon jetzt nur ein Einkommen unter, an oder knapp über der Armutsgrenze ermöglichen. Würde das passieren, wäre die Gesellschaft von morgen eine andere als die von heute. Das ist kein Argument gegen Billigjobs. Bloß ein Hinweis, darauf, dass es dann noch mehr Menschen geben wird, die so leben wie Schwab, Kaslak, Malert und Möller – oder noch ein bisschen schlechter.
Michael Möller sagt, es sei ein Glück, dass er sich noch zu DDR-Zeiten ein kleines Häuschen gebaut habe, neun mal neun Meter Grundfläche. Das kostet nur die 100 Euro Kreditrate pro Monat, nötige Renovierungen mache er eben nach und nach. Als der ehemalige Elektriker noch als Zeitarbeiter unterwegs war, brachte er immerhin zwischen 800 und 1200 Euro im Monat nach Hause. Das habe gereicht, zusammen mit dem Arbeitslosengeld der Frau. Vier-, fünfmal im Jahr seien sie sogar essen gegangen.
Jetzt hat Möller keine Arbeit mehr. Die Frau bezieht nur noch Arbeitslosenhilfe, 3,90 Euro am Tag. Auch die Tochter lebt wieder zu Hause, nachdem ihre Stelle in einem Restaurant gestrichen wurde. Vor ein paar Tagen war Möller zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Sozialamt, um Wohngeld zu beantragen. Befragt, was wäre, wenn er einen Job für 5 Euro annehmen müsste, nachdem in elf Monaten das Arbeitslosengeld ausläuft und die Arbeitslosenhilfe zum Leben nicht reicht, schaut der 48-Jährige nach unten, knetet die Hände. „Ich bin doch Familienvater, ich muss für meine Familie sorgen“, sagt er. Aber wenn er mit 5 Euro brutto heimkomme, dann sei das unwürdig. „Dann bin ich kein Versorger mehr.“
Mitarbeit: Fritz Vorholz
*Die Namen der betroffenen „Billiglöhner“ sind geändert
DIE ZEIT – 22 / 2003
Arbeit für 4,90 Euro
Erwerbslose sollen Billigjobs annehmen, fordert der Kanzler.
Wie sehen diese Jobs aus, und wie kann man davon leben?
Von Christian Tenbrock
Bis zu zwölf Stunden steht Susanne Schwab* auf den Beinen, schaut, prüft, kontrolliert. Zwölf Stunden täglich, von morgens sechs bis abends sechs, sechs Tage in der Woche, dann hat sie drei Tage frei. Schwab steht an einem Eingang des Berliner Reichstags an der Röntgen-Schleuse, dort, wo die Touristen und Bundestags-Besucher hereinkommen. Manchmal auch die Politiker. Friedrich Merz von der CDU hat sie schon mal gesehen, auch Guido Westerwelle von der FDP.
Für jede Stunde Arbeit bekommt Susanne Schwab vier Euro neunzig Cent. Etwa 240 Stunden kommen im Monat zusammen, das macht dann rund 1175 Euro – brutto. Netto bleiben ihr weniger als 1000. Dafür steht sie morgens um halb fünf auf und nimmt um fünf den Bus und die S-Bahn, um von ihrer Wohnung weit draußen im Berliner Osten rechtzeitig zum Reichstag zu kommen. Abends die gleiche Tour zurück. Zwei der fünf Kinder leben noch zu Hause.
Sie komme hin, sagt Schwab, gerade so eben, und nur, weil der Lebensgefährte Arbeitslosengeld beziehe. Fleisch gibt es einmal die Woche, das Bierchen mit den Kollegen einmal im Monat, neue Kleidung einmal im Jahr, und den Besuch im Kino oder im Restaurant nie. Im Urlaub war die 46-Jährige zuletzt 1988. Zwei Wochen an der Ostsee.
Susanne Schwab ist das, was in Deutschland „Billiglöhner“ heißt. Einer jener Menschen, von denen es nach Meinung vieler Politiker und Ökonomen mehr geben sollte. Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, fordern sie, müsse der Niedriglohnsektor in Deutschland ausgeweitet werden. Es müssten mehr Jobs her mit einem Verdienst, der irgendwo zwischen der Sozialhilfe und dem niedrigsten Tariflohn liegt. Und um die Menschen zu bewegen, solche Jobs anzunehmen, müssten sie dazu gezwungen werden – durch weniger Arbeitslosengeld und weniger Arbeitslosenhilfe. So will es auch der Kanzler mit seiner Agenda 2010.
Blutspenden frischen die Haushaltskasse auf
Dabei gibt es in Deutschland schon jetzt Millionen Beschäftigte wie Susanne Schwab. Doris Malert zum Beispiel: In einem Kaufhaus-Restaurant in Kiel spült sie und putzt die Tische ab. 836 Euro bleiben ihr am Monatsende, 400 nach Abzug von Miete, Telefon und Versicherungen. Oder Annelie Kaslak, die für 5 Euro in der Stunde Blumen in einem Geschäft in der Nähe von Zwickau verkauft; ohne den Verdienst ihres Freundes, der Rasen mäht und Hauswartsarbeiten erledigt, könnte sie nicht überleben. Oder Michael Möller, 48, ausgebildeter Elektriker, ein schmaler Mann mit kräftigen Händen: 6,90 Euro verdiente Möller als Zeitarbeiter in Plauen, bevor er vor wenigen Wochen auch diese Arbeit verlor.
In Amerika würde man Schwab, Kaslak, Malert oder Möller „arbeitende Arme“ nennen – Beschäftigte, die am Monatsende so wenig Geld nach Hause bringen, dass sie unter die Armutsgrenze fallen. Die liegt in Deutschland bei etwas mehr als 1200 Euro brutto, der Hälfte eines deutschen Durchschnittseinkommens. Nimmt man diese Grenze als Maßstab, dann arbeiten allein im Westen der Republik 12 Prozent aller Vollzeit-Beschäftigten zum Armutslohn, sagt Claus Schäfer vom gewerkschaftsnahen Forschungsinstitut WSI in Düsseldorf. Das wären 2,2 Millionen Menschen nur in den alten Bundesländern. Im Osten ist der Anteil der Billiglöhner weitaus höher.
Im Vogtlandkreis bei Zwickau beispielsweise verdienten im Jahr 2001 – neuere Statistiken gibt es nicht – 56 Prozent aller Beschäftigten weniger als 910 Euro netto im Monat. „Über Niedriglöhne muss man mir nichts mehr erzählen“, sagt Sabine Zimmermann, DGB-Chefin in Zwickau. Der Floristin Annelie Kaslak auch nicht. 27 Euro bleiben ihr von ihrem Monatslohn, nachdem sie die Miete, die Versicherungen und die Kosten für das Auto bezahlt hat, das sie braucht, um zum Job zu kommen. Zwölfmal hat sie in den letzten Monaten Blut gespendet, pro Spende gibt es 15 Euro extra. Der größte Luxus im letzten Jahr? „Eine neue Brille.“ Markenjeans? „Niemals.“ Ein anderer, besser bezahlter Job? „Wo denn?“
44935 Arbeitslosen im Arbeitsamtsbezirk Zwickau standen im April nur 2520 offene Stellen gegenüber. In Plauen kamen auf 24697 Menschen ohne Arbeit gerade mal 1158 freie Stellen. Dabei müsste das der Theorie nach ganz anders sein. Theoretisch müsste die Zahl der Arbeitsplätze steigen, wenn die Löhne niedrig sind. So sagen es zumindest all jene Ökonomen, die einen größeren Niedriglohnsektor in Deutschland fordern. Hans-Werner Sinn etwa, der Chef des Münchner Ifo-Instituts, spricht von 2,3 Millionen zusätzlicher Jobs, wenn die Löhne gering genug wären und Menschen ohne Arbeit zu ihrem Arbeitsglück gezwungen würden. Auch Klaus Zimmermann, der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, hält zahllose neue Billig-Arbeitsplätze für möglich: „Potenziell 2 Millionen.“
Hinter den Modellen der Theoretiker stehen ein paar simple Annahmen und der Blick ins Ausland:
Erstens seien einfachere Jobs in Deutschland dank zu hoher Tariflöhne auch im untersten Bereich zu teuer geworden, also wurden sie wegrationalisiert und Hilfsarbeiter aufs Arbeitsamt geschickt.
Zweitens sei die bisherige Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu hoch, deshalb gebe es für die Empfänger staatlicher Leistungen nicht genügend „Anreize“ , einen auch gering entlohnten Job anzunehmen.
Und drittens existiere in Deutschland eine „Dienstleistungslücke“ : Während zum Beispiel in den USA die in der Industrie verlorenen Stellen durch zahlreiche neue Arbeitsplätze ersetzt worden seien – im Handel, in der Gastronomie oder im Gesundheitswesen –, sei dies hierzulande nur unterdurchschnittlich geschehen. Wiederum auch deshalb, weil die Löhne in solchen Jobs angeblich zu hoch sind.
Die Therapie: Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes einerseits, Reduzierung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau andererseits. So steht es in der Agenda 2010, so will der Kanzler den Druck auf die Arbeitsfähigen erhöhen, tatsächlich nach einem Job zu suchen. Ifo-Chef Sinn geht noch weiter und will zusätzlich die Sozialhilfe um etwa ein Viertel absenken. Und DIW-Leiter Zimmermann möchte die Bezieher staatlicher Stütze zu einer Art staatlichem Arbeitsdienst verpflichten; auch das, so seine Hoffnung, werde sie am Ende dazu bewegen, einen regulären Job anzunehmen – jeden Job.
Würden sich Arbeitslose oder Menschen auf Sozialhilfe nur billig genug verdingen, würden diese Jobs auch geschaffen, sind die Therapeuten überzeugt. „Tankwarte, Parkplatzwächter, Tüten-Einpacker, Türöffner am Kaufhaus“, zählt Hilmar Schneider vom Forschungsinstitut Zukunft der Arbeit in Bonn auf. Oder auch Haushaltshilfen, Kinderbetreuer, Pfleger und Pizza-Lieferanten. „Potenziell rentable Arbeitsplätze gibt es in den Köpfen der Arbeitgeber genug“, glaubt Hans-Werner Sinn.
Wirklich?
So bestechend die Erfahrungen mit Billiglöhnern im Ausland auch sein mögen, als Blaupause für Deutschland taugen sie nur bedingt. Denn Deutschlands ökonomisches Dilemma ist der Osten. Dort fehlt es nicht an Druck auf Arbeitslose, dort fehlt es an Jobs – ganz gleich, wie günstig die Arbeitskräfte sind.
Die Vorstellung, in den neuen Bundesländern könne ein noch höheres und noch billigeres Angebot an Arbeitskräften quasi automatisch auch eine starke, Zehntausende Arbeitsplätze schaffende Nachfrage nach ihnen in Gang setzen, „ist absurd“, sagt Burkhard Lutz, Professor am Zentrum für Sozialforschung in Halle. In der gewerblichen Wirtschaft, berichtet die DGB-Frau Zimmermann, seien längst Absetzbewegungen der Betriebe in Niedrigstlohnländer wie Tschechien und Polen im Gange, wo Bandarbeiter weniger als zwei Euro die Stunde verdienen. Und bei den Dienstleistungen fehlt schlicht die Nachfrage derer, die sie bezahlen müssten – der privaten Haushalte also. „Man möchte die Kunden manchmal fast nötigen, einen Strauß Blumen zu kaufen“, sagt die Floristin Kaslak. „Aber man weiß eben auch, dass ihnen die Tüte Semmeln wichtiger ist.“
Und im Westen? Die Küchenhilfe Doris Malert bekommt einen Tariflohn von unter sieben Euro. „Allein kann ich davon leben“, sagt sie, „man richtet sich ein.“ Urlaub ist nicht drin, und auch der Kauf von teuren Gesundheitsschuhen nicht, die sie eigentlich nötig hätte. Wenn nun aber Malerts Lohn auf sechs oder sogar fünf Euro sänke oder die Lohnnebenkosten fielen – würden dann sofort mehr Küchenhilfen eingestellt? Kaum, sagt Hans Detlef Rahr, Betriebsratschef und Aufsichtsrat in dem Unternehmen, das die Spülerin beschäftigt. Auch Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, verspricht alles andere als massenhaft neue Jobs: „Wenn kein Geschäft da ist, werden keine Arbeitskräfte benötigt.“
Wenig Chancen für Einpackhelfer oder Tütenschlepper
Im Einzelhandel wiederum sind „die Niedriglohnjobs bereits besetzt“, sagt Heribert Jöris, Tarifexperte beim Einzelhandelsverband HDE. Ganz gering entlohnte Tätigkeiten wie die von „Regalpflegern“ – Beschäftigte, die Dosen und Kartons nachlegen – werden überdies meist von [/b]Minijobbern erledigt, und die sind in der Regel nicht ehemalige Arbeitslose, sondern Hausfrauen oder Studenten. Die Schaffung weiterer Billigjobs, etwa für Einpackhelfer oder Tütenschlepper, scheitert nach Jöris’ Worten zudem an der Unwilligkeit der Kundschaft, diesen Service mit einem kleinen Aufschlag auf die Warenpreise zu honorieren. [/b] Wenn es aber schon solche Jobs kaum gibt, dann bleibt wohl auch die Hoffnung, dass künftig Tausende Türöffner, Tankwarte oder Parkwächter neu eingestellt werden, genau das: die reine Hoffnung.
Selbst dort, wo auch Kritiker einer Niedriglohnstrategie noch die größten Chancen sehen, viele Arbeitsplätze zu schaffen und Schwarzarbeiter in die Legalität zu bringen, ist Vorsicht angebracht. 500000 neue Stellen könnten in privaten Haushalten für Putzhilfen eingerichtet werden, lautet die Vision von DIW-Chef Zimmermann. Viel zu optimistisch, nennt das Claudia Weinkopf, die für das Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen die bisherigen Erfahrungen in dieser Branche untersucht hat. Ihr Fazit: Auch dann, wenn professionelle und legale Putzarbeiten vom Staat hoch subventioniert werden – in einem Versuch in Rheinland-Pfalz zum Beispiel mit 50 Prozent –, liegen die Kosten für den Arbeitgeber oft deutlich über den üblichen Schwarzmarktpreisen. Keiner der mit viel Tamtam eingerichteten und staatlich bezuschussten „Dienstleistungspools“, in denen Reinigungskräfte für Privathaushalte ähnlich wie in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt werden, konnte bislang Kostendeckung erreichen. „Wer eine halbe Million Putzjobs erwartet“, sagt Weinkopf, „geht von völlig unrealistischen Annahmen aus.“
Ohne Nachfrage kein Wachstum – und auch keine neuen Jobs
Das alles heißt nicht, dass es überhaupt keine zusätzlichen Stellen für Arbeitnehmer geben wird, die mit fünf Euro pro Stunde zufrieden sein müssen. Wer es sich leisten kann, lässt sich Bier und Butter von einem Online-Supermarkt frei Haus liefern und zahlt dafür den Menschen, der die Kisten und Tüten auch in den fünften Stock schleppt. Wer genügend Geld hat, wird einen Kinderbetreuer oder eine Pflegerin für seine Eltern beschäftigen. Man braucht also Besserverdienende, die die schlechter Verdienenden bezahlen können. Ökonomisch formuliert heißt das: Man braucht Wachstum.
Selbst DIW-Chef Zimmermann räumt ein, dass ein Billigjobwunder à la Amerika zwei Dinge benötige: mehr Anreize für die Arbeitgeber, diese Jobs zu schaffen – und gleichzeitig eine starke Nachfrage. Aber die fehlt in Deutschland. Tatsächlich halten sich die Menschen mit Ausgaben zurück, die Sparquote ist so hoch wie lange nicht mehr, die Wirtschaft stagniert. Nur um 0,5 Prozent, schätzen Konjunkturforscher, wird Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr wachsen; doch um auch nur ein paar hunderttausend Jobs für die zwei Millionen niedrig qualifizierten Arbeitslosen und arbeitsfähigen Sozialhilfebezieher zu schaffen, braucht es schon ein Wachstum von drei oder vier Prozent. Und auch dann sind es zunächst nicht die gering Qualifizierten, die als Erste eingestellt werden. Call-Center beispielsweise, hat Claudia Weinkopf herausgefunden, rekrutieren ihre Angestellten vornehmlich aus den inzwischen ebenfalls massenhaft zur Verfügung stehenden Arbeitslosen mit Ausbildung und Vorkenntnissen.
Mit alldem ist die Debatte um die Ausweitung des Niedriglohnsektors viel mehr als ein rein ökonomisches oder arbeitsmarktpolitisches Thema. Es geht auch um die Frage, „wie sehr viele arbeitende Menschen in Deutschland künftig leben sollen“, sagt Gerhard Bäcker, Sozialexperte der Universität Duisburg-Essen. Gibt es ein massenhaftes Angebot an Billig-Arbeitskräften, würden selbst jene geringen Tariflöhne unter Druck geraten, die schon jetzt nur ein Einkommen unter, an oder knapp über der Armutsgrenze ermöglichen. Würde das passieren, wäre die Gesellschaft von morgen eine andere als die von heute. Das ist kein Argument gegen Billigjobs. Bloß ein Hinweis, darauf, dass es dann noch mehr Menschen geben wird, die so leben wie Schwab, Kaslak, Malert und Möller – oder noch ein bisschen schlechter.
Michael Möller sagt, es sei ein Glück, dass er sich noch zu DDR-Zeiten ein kleines Häuschen gebaut habe, neun mal neun Meter Grundfläche. Das kostet nur die 100 Euro Kreditrate pro Monat, nötige Renovierungen mache er eben nach und nach. Als der ehemalige Elektriker noch als Zeitarbeiter unterwegs war, brachte er immerhin zwischen 800 und 1200 Euro im Monat nach Hause. Das habe gereicht, zusammen mit dem Arbeitslosengeld der Frau. Vier-, fünfmal im Jahr seien sie sogar essen gegangen.
Jetzt hat Möller keine Arbeit mehr. Die Frau bezieht nur noch Arbeitslosenhilfe, 3,90 Euro am Tag. Auch die Tochter lebt wieder zu Hause, nachdem ihre Stelle in einem Restaurant gestrichen wurde. Vor ein paar Tagen war Möller zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Sozialamt, um Wohngeld zu beantragen. Befragt, was wäre, wenn er einen Job für 5 Euro annehmen müsste, nachdem in elf Monaten das Arbeitslosengeld ausläuft und die Arbeitslosenhilfe zum Leben nicht reicht, schaut der 48-Jährige nach unten, knetet die Hände. „Ich bin doch Familienvater, ich muss für meine Familie sorgen“, sagt er. Aber wenn er mit 5 Euro brutto heimkomme, dann sei das unwürdig. „Dann bin ich kein Versorger mehr.“
Mitarbeit: Fritz Vorholz
*Die Namen der betroffenen „Billiglöhner“ sind geändert
DIE ZEIT – 22 / 2003
.
Man soll ja gehen wenn die Party am schönsten ist ...
Edelmetalle: Aufwärtstrend beim Gold ist vorerst gestoppt
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Der Anstieg des Goldpreises dürfte diese Woche zum Stillstand kommen. Nach dem starken Aufwärtstrend der Vorwochen stehen die Zeichen auf Konsolidierung.
Der Goldpreis durchbrach vergangenen Montag den ersten charttechnischen Widerstand, als er auf 366 $ je Unze stieg. Später erreichte das Metall sogar 373 $ je Unze und notierte damit so fest wie seit dem 7. Februar nicht mehr. Erst gegen Ende der Woche nahmen Anleger Gewinne mit. Bevor der Goldpreis das Februar-Hoch bei 388,50 $ je Unze testen kann, müsste er nun die Marke von 370 $ überspringen.
Auch wenn sich das Gold zeitweise etwas von der Dollar-Entwicklung abkoppeln konnte, war die US- Währung Händlern zufolge insgesamt maßgeblicher Impulsgeber. Daneben bleiben die unsichere geopolitische Lage und die Sorge um die weitere Wirtschaftsentwicklung treibende Faktoren für den Goldpreis.
Indien setzt auf Recycling
Indien importiert nach Berichten lokaler Händler fast kein Gold mehr. Das Land, das ein Fünftel des weltweiten Konsums auf sich vereint, deckt seine Nachfrage inzwischen fast vollständig aus recyceltem Material und zum geringeren Teil durch Investorenverkäufe.
Die "Platinwoche" in London, ein jährliches Treffen von Produzenten, Händlern, Weiterverarbeitern und Verbrauchern, sorgte in der vergangenen Woche für ein geringes Handelsvolumen. Bereits kleinere Käufe reichten aus, um den Platinpreis in die Höhe zu treiben. Er stieg mit 682 $ je Unze auf ein Zwei-Monats-Hoch. Zum Wochenschluss drückten Gewinnmitnahmen auf den Preis.
Laut Londoner Brokerhaus Johnson Matthey legte die Platinnachfrage 2002 um 5 Prozent auf ein neues Hoch von 6,5 Millionen Unzen zu. Größter Endverbraucher ist die Schmuckindustrie, wobei allein die Nachfrage aus China um 14 Prozent anstieg.
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach ist Leiter des Edelmetall-Handels bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
FTD - 26.5.2003
Man soll ja gehen wenn die Party am schönsten ist ...

Edelmetalle: Aufwärtstrend beim Gold ist vorerst gestoppt
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Der Anstieg des Goldpreises dürfte diese Woche zum Stillstand kommen. Nach dem starken Aufwärtstrend der Vorwochen stehen die Zeichen auf Konsolidierung.
Der Goldpreis durchbrach vergangenen Montag den ersten charttechnischen Widerstand, als er auf 366 $ je Unze stieg. Später erreichte das Metall sogar 373 $ je Unze und notierte damit so fest wie seit dem 7. Februar nicht mehr. Erst gegen Ende der Woche nahmen Anleger Gewinne mit. Bevor der Goldpreis das Februar-Hoch bei 388,50 $ je Unze testen kann, müsste er nun die Marke von 370 $ überspringen.
Auch wenn sich das Gold zeitweise etwas von der Dollar-Entwicklung abkoppeln konnte, war die US- Währung Händlern zufolge insgesamt maßgeblicher Impulsgeber. Daneben bleiben die unsichere geopolitische Lage und die Sorge um die weitere Wirtschaftsentwicklung treibende Faktoren für den Goldpreis.
Indien setzt auf Recycling
Indien importiert nach Berichten lokaler Händler fast kein Gold mehr. Das Land, das ein Fünftel des weltweiten Konsums auf sich vereint, deckt seine Nachfrage inzwischen fast vollständig aus recyceltem Material und zum geringeren Teil durch Investorenverkäufe.
Die "Platinwoche" in London, ein jährliches Treffen von Produzenten, Händlern, Weiterverarbeitern und Verbrauchern, sorgte in der vergangenen Woche für ein geringes Handelsvolumen. Bereits kleinere Käufe reichten aus, um den Platinpreis in die Höhe zu treiben. Er stieg mit 682 $ je Unze auf ein Zwei-Monats-Hoch. Zum Wochenschluss drückten Gewinnmitnahmen auf den Preis.
Laut Londoner Brokerhaus Johnson Matthey legte die Platinnachfrage 2002 um 5 Prozent auf ein neues Hoch von 6,5 Millionen Unzen zu. Größter Endverbraucher ist die Schmuckindustrie, wobei allein die Nachfrage aus China um 14 Prozent anstieg.
Wolfgang Wrzesniok-Roßbach ist Leiter des Edelmetall-Handels bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
FTD - 26.5.2003
.
aber es gibt auch immer ein paar Schwerenöter, die durchfeiern ...
Die Hausse des Goldpreises geht weiter !
Michael Riesner , DZ Bank, 23.05.2003
Rückschläge können zum Einstieg genutzt werden
Für viele ist die jüngste Aufwärtsbewegung des Preises für die Feinunze Gold überraschend. Denn die Mehrzahl der Marktteilnehmer denkt immer noch in über Monate stabilen negativen Korrelationen von schwachen Aktienmärkten, steigenden Renten-Futures, schwachem Dollar und steigendem Goldpreis. Mit dem Ende der akuten Krise im Irak haben sich allerdings diese Korrelationen zumindest zuletzt weitgehend aufgelöst. Anleger müssen wieder vermehrt die isolierte technische Situation der einzelnen Asset-Klassen betrachten. Mit der Dollarschwäche hat Gold kräftig angezogen. Obwohl der Markt kurzfristig heiß gelaufen ist, spricht vieles dafür, dass der Goldpreis weiter steigen wird, so dass kurze Rückschläge durchaus zum Einstieg genutzt werden können.
Überzeugend ist vor allem das charttechnische Bild. Der primäre Aufwärtstrend seit Anfang 2001 ist intakt und weist eine zunehmende, positive Trenddynamik auf. Positiv ist der fehlgeschlagene Versuch, diesen Trend mit der Korrektur im ersten Quartal bei rund 325 $ zu brechen. Die Feinunze hat die markante Unterstützung mehrfach getestet und verteidigt, so dass sich der versuchte Trendbruch als Bärenfalle darstellt und somit die psychologische Grundlage der aktuell laufenden starken Aufwärtsbewegung ist. Passend zum Aufwärtstrend sind die bevorstehenden Kaufsignale des Trendfolgeindikators MACD auf Wochenbasis. Der Indikator zielt auf den mittelfristigen Bereich ab. Signale auf Wochenbasis sind in der Regel sehr stabil und nachhaltig, so dass aus dieser Sicht für die kommenden Wochen mit weiter steigenden Kursen zu rechnen ist.
Auch die Positionierung der professionellen Marktteilnehmer an der Terminbörse spricht für weiter steigende Goldpreise. Die Positionierung der "Commercials" ist als vorlaufender Indikator für den Markttrend zu werten. Beispielsweise hatten die Profis beim markanten Top bei 385 $ Anfang Februar hohe Shortpositionen aufgebaut. Mit der Korrektur der folgenden Wochen wurden diese Shortpositionen stark abgebaut und haben sich trotz der steigenden Goldnotierungen nicht derart erhöht, dass man von einem unmittelbar bevorstehenden Top im Gold ausgehen muss.
[na, wenn das man so bleibt ... ]
]
Nur kurzfristig ist der Markt durch die starke Aufwärtsbewegung rückschlagsgefährdet. Experten gehen davon aus, dass sich der Goldpreis in den kommenden Handelstagen auf ein Niveau von 360 bis maximal 355 $ zurückziehen kann. Konsolidierungstendenzen dienen in dem starken Trend als Möglichkeit einer erneuten Positionierung, da wir aus zyklischer Sicht erst für Ende Juni mit einem signifikanten Top rechnen. Das mögliche Kurspotenzial liegt allein aus der intakten Trendsystematik bei 400 bis maximal 410 $.
[... eben: allein aus der intakten Trendsystematik ... ]
]

Quelle: http://www.technical-investor.de/anl/print.asp?id=4537
aber es gibt auch immer ein paar Schwerenöter, die durchfeiern ...

Die Hausse des Goldpreises geht weiter !
Michael Riesner , DZ Bank, 23.05.2003
Rückschläge können zum Einstieg genutzt werden
Für viele ist die jüngste Aufwärtsbewegung des Preises für die Feinunze Gold überraschend. Denn die Mehrzahl der Marktteilnehmer denkt immer noch in über Monate stabilen negativen Korrelationen von schwachen Aktienmärkten, steigenden Renten-Futures, schwachem Dollar und steigendem Goldpreis. Mit dem Ende der akuten Krise im Irak haben sich allerdings diese Korrelationen zumindest zuletzt weitgehend aufgelöst. Anleger müssen wieder vermehrt die isolierte technische Situation der einzelnen Asset-Klassen betrachten. Mit der Dollarschwäche hat Gold kräftig angezogen. Obwohl der Markt kurzfristig heiß gelaufen ist, spricht vieles dafür, dass der Goldpreis weiter steigen wird, so dass kurze Rückschläge durchaus zum Einstieg genutzt werden können.
Überzeugend ist vor allem das charttechnische Bild. Der primäre Aufwärtstrend seit Anfang 2001 ist intakt und weist eine zunehmende, positive Trenddynamik auf. Positiv ist der fehlgeschlagene Versuch, diesen Trend mit der Korrektur im ersten Quartal bei rund 325 $ zu brechen. Die Feinunze hat die markante Unterstützung mehrfach getestet und verteidigt, so dass sich der versuchte Trendbruch als Bärenfalle darstellt und somit die psychologische Grundlage der aktuell laufenden starken Aufwärtsbewegung ist. Passend zum Aufwärtstrend sind die bevorstehenden Kaufsignale des Trendfolgeindikators MACD auf Wochenbasis. Der Indikator zielt auf den mittelfristigen Bereich ab. Signale auf Wochenbasis sind in der Regel sehr stabil und nachhaltig, so dass aus dieser Sicht für die kommenden Wochen mit weiter steigenden Kursen zu rechnen ist.
Auch die Positionierung der professionellen Marktteilnehmer an der Terminbörse spricht für weiter steigende Goldpreise. Die Positionierung der "Commercials" ist als vorlaufender Indikator für den Markttrend zu werten. Beispielsweise hatten die Profis beim markanten Top bei 385 $ Anfang Februar hohe Shortpositionen aufgebaut. Mit der Korrektur der folgenden Wochen wurden diese Shortpositionen stark abgebaut und haben sich trotz der steigenden Goldnotierungen nicht derart erhöht, dass man von einem unmittelbar bevorstehenden Top im Gold ausgehen muss.
[na, wenn das man so bleibt ...
 ]
]Nur kurzfristig ist der Markt durch die starke Aufwärtsbewegung rückschlagsgefährdet. Experten gehen davon aus, dass sich der Goldpreis in den kommenden Handelstagen auf ein Niveau von 360 bis maximal 355 $ zurückziehen kann. Konsolidierungstendenzen dienen in dem starken Trend als Möglichkeit einer erneuten Positionierung, da wir aus zyklischer Sicht erst für Ende Juni mit einem signifikanten Top rechnen. Das mögliche Kurspotenzial liegt allein aus der intakten Trendsystematik bei 400 bis maximal 410 $.
[... eben: allein aus der intakten Trendsystematik ...
 ]
]
Quelle: http://www.technical-investor.de/anl/print.asp?id=4537
Hier scheint ja viel Klärungsbedarf zu bestehen. Die Marktteilnehmer sind sich nicht einig und schmieren einen solchen Chart zusammen. Also rauf damit (Euro)ich will im Sommer meine GFI und HARM Dividende haben.

J2
J2
Jeffery, hast Du etwa zu viel Südafrikaner im Depot ...? 
EURO / US $ zu GOLD

letztes mal lag godmode ja richtig mit seiner Einschätzung.
Hier das update von heute:
Seit 2001 befinden sich Goldpreis und EURO/US $ in übergeordneten Aufwärtstrendphasen. Die Kursverläufe beider Basiswerte zeigen eine auffällige Korrelation. Wie bereits mehrfach berichtet, sehen wir den Goldpreis in einem Bullenmarkt. Mittelfristig erwarten wir deutliche Preissteigerungen für Gold.
Alleine nach dem Gesetz der Intermarketkorrelation zwischen Gold und Euro/US $ dürfte der EURO gegenüber dem US $ noch deutlich an Wert zugewinnen! Je länger sich eine Intermarketkorrelation etablieren kann, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, daß es zu einer Entkopplung der Korrelation kommen kann. Ein stark ansteigender Goldpreis und ein gleichzeitig kurz/mittelfristig abfallender EURO gegenüber dem US $ ist deshalb eher unwahrscheinlich.
... hmm, sieht ja tatsächlich so aus ...

EURO / US $ zu GOLD

letztes mal lag godmode ja richtig mit seiner Einschätzung.
Hier das update von heute:
Seit 2001 befinden sich Goldpreis und EURO/US $ in übergeordneten Aufwärtstrendphasen. Die Kursverläufe beider Basiswerte zeigen eine auffällige Korrelation. Wie bereits mehrfach berichtet, sehen wir den Goldpreis in einem Bullenmarkt. Mittelfristig erwarten wir deutliche Preissteigerungen für Gold.
Alleine nach dem Gesetz der Intermarketkorrelation zwischen Gold und Euro/US $ dürfte der EURO gegenüber dem US $ noch deutlich an Wert zugewinnen! Je länger sich eine Intermarketkorrelation etablieren kann, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, daß es zu einer Entkopplung der Korrelation kommen kann. Ein stark ansteigender Goldpreis und ein gleichzeitig kurz/mittelfristig abfallender EURO gegenüber dem US $ ist deshalb eher unwahrscheinlich.
... hmm, sieht ja tatsächlich so aus ...

.
Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest gefällt mir immer besser. In seinem aktuellen Marktkommentar nimmt er auch zum Goldpreis Stellung:
Kein Ende der Korrektur in Sicht – Thread: Wellenreiter: Kein Ende der Korrektur in Sicht
Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest gefällt mir immer besser. In seinem aktuellen Marktkommentar nimmt er auch zum Goldpreis Stellung:
Kein Ende der Korrektur in Sicht – Thread: Wellenreiter: Kein Ende der Korrektur in Sicht
.
Marktkommentar von Nabil Khayat 27.05.2003
Gold, Deflation & der heutige Handelstag!
Willkommen in der neuen Börsenwoche…
...und FASTEN YOUR SEATBELTS, denn die Börse verspricht in den kommenden Tagen turbulent zu werden. Der DAX hat sich heute Vormittag unter die Marke von 2800 Punkten begeben, der Dollar bekommt keinen Boden unter die Füße und Gold nähert sich verdächtig den Jahreshochs. In den Köpfen der Marktteilnehmer setzt sich das Deflationsgespenst fest und die ersten Stimmen behaupten, dass es keine Deflation geben kann, wenn alle damit rechnen. Ob man den antizyklischen Ansatz auch auf realwirtschaftliche Begebenheiten anwenden kann ist jedoch fraglich, denn es würde heißen, dass...
...keine Rezession kommt, wenn die Meisten damit rechnen.
...keine Ausweitung der Arbeitslosen stattfindet, wenn die Meisten damit rechnen.
...unser Kanzler und sein Finanzminister das Land nicht in den Ruin treiben, weil die Meisten damit rechnen.
...die Sonne morgen früh nicht aufgehen wird, weil die Meisten damit rechnen.
Der Goldpreis...
...steht aktuell bei 372,80, und nun stellt sich die Frage, ob wir das Jahreshochs im Bereich von 389 Punkten sehen werden. Ich mache seit langer Zeit keinen Hehl daraus, dass ich ein Goldbulle bin, was sich zuletzt daran messen lässt, dass ich seit 328 USD wieder long in Gold bin, nachdem ich im ersten Quartal 2003 zwischen 340 und 350 aus meinen Goldpositionen ausgestoppt worden bin. Nun stellt sich die Frage, wie es bei Gold weitergehen wird.
Zum aktuellen Zeitpunkt...
...sollten wir uns verdeutlichen, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen und diese Weisheit lässt sich wohl ganz gut auf Gold übertragen. Das Schlusshoch in Gold lag im laufenden Jahr bei 378,95 Punkten, und von diesem Niveau sind wir nur noch 2 % entfernt. Es ist nicht besonders wahrscheinlich, wenngleich auch nicht unmöglich, dass sich Gold zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Zone 378-390 kämpfen wird.
Es ist wesentlich wahrscheinlicher,
dass der Goldpreis eine Ruhepause einlegen wird, um seinen jüngsten Anstieg von 20 % zu festigen. Ich rate jedoch entschieden davon ab, Gold blind zu verkaufen, sondern bin vielmehr der Auffassung, dass man Stops zwischen 355 und 365 setzen sollte. Je nach Risikoprofil so to say. Wir sollten uns auch noch verdeutlichen, dass die Goldhausse durch den Dollarverfall begünstigt wird und der Dollar ist sehr überdehnt. Er schreit geradezu nach einer Erholung, die uns sicherlich schon sehr bald ins Haus stehen sollte.
Das Deflationsgespenst...
...passt nicht so recht zu dem steigenden Goldpreis, dass Gold in Deflationsphasen zwar an Kaufkraft gewinnt, doch in der Regel fällt der Preis eher, was den aktuellen Begebenheiten widerspricht. Es wird also keine ausgiebige Goldhausse geben, wenn wir in eine waschechte Deflationsphase rutschen sollten. Demzufolge müssen uns für ein Szenario entscheiden und am besten stellen wir uns die Frage, wo die Deflation eigentlich herkommt.
Ich erinnere mich, dass...
...der Euro letztes Jahr eingeführt worden ist und wir nun schon über ein Jahr das neue Geld in den Fingern haben. Ich erinnere mich auch, dass wir exorbitante Preissteigerungen sahen, da so mancher Wirt oder Einzelhändler der Ansicht war, dass der Konsument als solches ohnehin nicht den tiefen Teller erfunden habe und derartige Preissteigerungen mit Nichten schlucken werde. Dabei hat jedoch so mancher Preistreiber die Rechnung ohne den Wirt gemacht!
Tatsache ist nämlich,
dass zwar vieles teurer geworden ist, doch es wird nicht wirklich mehr verdient. Die selbe Anzahl an Waren steht dem gleichen Geld gegenüber, doch der Preis der Waren hat sich merklich erhöht. Bei dieser Konstellation gibt es mehrere Möglichkeiten das ursprüngliche Gleichgewicht wieder herzustellen. Entweder die Gehälter werden angepasst (sehr unwahrscheinlich), oder die Preise fallen, oder der Warenumschlag geht zurück.
Ich bin der Ansicht,
dass wir eine Mischung aus einer Reduzierung des Warenumschlags und einem Rückgang der Preise sehen werden, bzw. bereits sehen. Es handelt sich praktisch um einen Bereinigungsprozess, der zunächst nicht so gefährlich ist, wie so mancher Permabär behauptet. Gefährlich wird es erst, wenn der Konsument der Ansicht ist, dass die Preise ohnehin noch weiter fallen werden, obwohl der Bereinigungsprozess bereits abgeschlossen ist.
In diesem Fall hätten wird es...
...mit einer sehr gefährlichen Eigendynamik zu tun und die lässt sich nur schwer stoppen. Es ist jedoch sehr fraglich, ob es so weit kommen wird, und so bin ich der Ansicht, dass das Gespenst der Superdeflation etwas überzogen ist. Dennoch sollten wir uns verdeutlichen, dass Inflation mit steigenden Unternehmensgewinnen einher geht und Deflation eben mit steigenden Verlusten. Was also die realwirtschaftlichen Verhältnisse betrifft, ist schlicht und ergreifen keine nachhaltige Erholung in Sicht.
WO - 27.05.2003
Marktkommentar von Nabil Khayat 27.05.2003
Gold, Deflation & der heutige Handelstag!
Willkommen in der neuen Börsenwoche…
...und FASTEN YOUR SEATBELTS, denn die Börse verspricht in den kommenden Tagen turbulent zu werden. Der DAX hat sich heute Vormittag unter die Marke von 2800 Punkten begeben, der Dollar bekommt keinen Boden unter die Füße und Gold nähert sich verdächtig den Jahreshochs. In den Köpfen der Marktteilnehmer setzt sich das Deflationsgespenst fest und die ersten Stimmen behaupten, dass es keine Deflation geben kann, wenn alle damit rechnen. Ob man den antizyklischen Ansatz auch auf realwirtschaftliche Begebenheiten anwenden kann ist jedoch fraglich, denn es würde heißen, dass...
...keine Rezession kommt, wenn die Meisten damit rechnen.
...keine Ausweitung der Arbeitslosen stattfindet, wenn die Meisten damit rechnen.
...unser Kanzler und sein Finanzminister das Land nicht in den Ruin treiben, weil die Meisten damit rechnen.
...die Sonne morgen früh nicht aufgehen wird, weil die Meisten damit rechnen.
Der Goldpreis...
...steht aktuell bei 372,80, und nun stellt sich die Frage, ob wir das Jahreshochs im Bereich von 389 Punkten sehen werden. Ich mache seit langer Zeit keinen Hehl daraus, dass ich ein Goldbulle bin, was sich zuletzt daran messen lässt, dass ich seit 328 USD wieder long in Gold bin, nachdem ich im ersten Quartal 2003 zwischen 340 und 350 aus meinen Goldpositionen ausgestoppt worden bin. Nun stellt sich die Frage, wie es bei Gold weitergehen wird.
Zum aktuellen Zeitpunkt...
...sollten wir uns verdeutlichen, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen und diese Weisheit lässt sich wohl ganz gut auf Gold übertragen. Das Schlusshoch in Gold lag im laufenden Jahr bei 378,95 Punkten, und von diesem Niveau sind wir nur noch 2 % entfernt. Es ist nicht besonders wahrscheinlich, wenngleich auch nicht unmöglich, dass sich Gold zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Zone 378-390 kämpfen wird.
Es ist wesentlich wahrscheinlicher,
dass der Goldpreis eine Ruhepause einlegen wird, um seinen jüngsten Anstieg von 20 % zu festigen. Ich rate jedoch entschieden davon ab, Gold blind zu verkaufen, sondern bin vielmehr der Auffassung, dass man Stops zwischen 355 und 365 setzen sollte. Je nach Risikoprofil so to say. Wir sollten uns auch noch verdeutlichen, dass die Goldhausse durch den Dollarverfall begünstigt wird und der Dollar ist sehr überdehnt. Er schreit geradezu nach einer Erholung, die uns sicherlich schon sehr bald ins Haus stehen sollte.
Das Deflationsgespenst...
...passt nicht so recht zu dem steigenden Goldpreis, dass Gold in Deflationsphasen zwar an Kaufkraft gewinnt, doch in der Regel fällt der Preis eher, was den aktuellen Begebenheiten widerspricht. Es wird also keine ausgiebige Goldhausse geben, wenn wir in eine waschechte Deflationsphase rutschen sollten. Demzufolge müssen uns für ein Szenario entscheiden und am besten stellen wir uns die Frage, wo die Deflation eigentlich herkommt.
Ich erinnere mich, dass...
...der Euro letztes Jahr eingeführt worden ist und wir nun schon über ein Jahr das neue Geld in den Fingern haben. Ich erinnere mich auch, dass wir exorbitante Preissteigerungen sahen, da so mancher Wirt oder Einzelhändler der Ansicht war, dass der Konsument als solches ohnehin nicht den tiefen Teller erfunden habe und derartige Preissteigerungen mit Nichten schlucken werde. Dabei hat jedoch so mancher Preistreiber die Rechnung ohne den Wirt gemacht!
Tatsache ist nämlich,
dass zwar vieles teurer geworden ist, doch es wird nicht wirklich mehr verdient. Die selbe Anzahl an Waren steht dem gleichen Geld gegenüber, doch der Preis der Waren hat sich merklich erhöht. Bei dieser Konstellation gibt es mehrere Möglichkeiten das ursprüngliche Gleichgewicht wieder herzustellen. Entweder die Gehälter werden angepasst (sehr unwahrscheinlich), oder die Preise fallen, oder der Warenumschlag geht zurück.
Ich bin der Ansicht,
dass wir eine Mischung aus einer Reduzierung des Warenumschlags und einem Rückgang der Preise sehen werden, bzw. bereits sehen. Es handelt sich praktisch um einen Bereinigungsprozess, der zunächst nicht so gefährlich ist, wie so mancher Permabär behauptet. Gefährlich wird es erst, wenn der Konsument der Ansicht ist, dass die Preise ohnehin noch weiter fallen werden, obwohl der Bereinigungsprozess bereits abgeschlossen ist.
In diesem Fall hätten wird es...
...mit einer sehr gefährlichen Eigendynamik zu tun und die lässt sich nur schwer stoppen. Es ist jedoch sehr fraglich, ob es so weit kommen wird, und so bin ich der Ansicht, dass das Gespenst der Superdeflation etwas überzogen ist. Dennoch sollten wir uns verdeutlichen, dass Inflation mit steigenden Unternehmensgewinnen einher geht und Deflation eben mit steigenden Verlusten. Was also die realwirtschaftlichen Verhältnisse betrifft, ist schlicht und ergreifen keine nachhaltige Erholung in Sicht.
WO - 27.05.2003
.
Deflation
Aus Angst vor dem D-Wort
Vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Evian grassiert die Furcht: Kommt eine Deflation? Für den Aufschwung lässt Amerika den Dollarkurs sacken – und gefährdet Europa umso mehr
Von Robert von Heusinger
Schweinebäuche, Sojabohnen und Weizen sorgen unter Finanzinvestoren und Spekulanten oft für Gesprächsstoff. Aber Mineralwasser? Zumindest ein paar Tage lang wird ein aus Kiosk und Supermarkt bekannter französischer Name an den weltweiten Kapitalmärkten im Gespräch sein: Evian. Doch nicht das stille Wasser ist gemeint, sondern der gleichnamige Kurort am südlichen Rand des Genfer Sees. Dort treffen sich Anfang Juni die mächtigsten Regierungschefs der Welt zum Wirtschaftsgipfel. Sie werden über Geld reden, genauer: über die Deflation und den Dollar.
In den vergangenen Wochen ist auch dem letzten Optimisten klar geworden: Die Weltwirtschaft steckt weiter in der Krise. In Amerika und Europa häufen sich die Warnungen vor dauerhaft fallenden Preisen, Deflation genannt. Der Dollar verliert fast täglich an Wert.
In Evian sind neben den traditionellen G-8-Ländern USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und Russland auch die EU vertreten und, zum ersten Mal, China. Trotz des seit der Irak-Krise gestörten Verhältnisses zwischen Europäern und Amerikanern glaubt der französische Präsident Chirac schon jetzt zu wissen, was am Ende beim Gipfel herauskommen wird: „Obwohl noch Spannungen bleiben, glaube ich doch, dass von Evian eine Botschaft des Vertrauens in eine Erholung der Weltwirtschaft ausgehen kann.“
Nur, welche Botschaft genau? Plaza, Louvre und jetzt Evian? Der Gedanke eines neuen wirtschaftspolitischen Abkommens zwischen den Regierungen zur Stabilisierung der Weltkonjunktur klingt längst nicht mehr so absurd wie noch vor einigen Jahren.
Plaza und Louvre sind Chiffren für Wechselkursabkommen der G-5 (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich), geschlossen in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre. Im Plaza-Hotel in New York verabredeten die Staatschefs 1985 einen schwächeren Dollar. Die Zentralbanken intervenierten am Devisenmarkt, und zwei Jahre später hatte die amerikanische Währung tatsächlich 30 Prozent an Wert gegenüber den wichtigsten Handelspartnern verloren.
Niemand will den billigen Dollar – außer den Amerikanern selbst
1987 erklärten die G-5 dann die Dollar-Abwertung für beendet, verabredeten Zielzonen für die Wechselkurse und Stimulanzen für die jeweiligen Volkswirtschaften. Wieder versuchten die Zentralbanken, durch Devisenkäufe und -verkäufe die Märkte zu lenken. Doch diesmal fiel der Erfolg mager aus. Weitere Versuche, die Wirtschaftspolitik global zu koordinieren, unterblieben mangels Notwendigkeit. Anfang der neunziger Jahre begann in den USA der längste Boom der amerikanischen Geschichte, der auch in Europa für kräftiges Wachstum sorgte.
Vorbei. Die Lage gleicht auf dem ersten Blick wieder der des Jahres 1985. Der Dollar steht unter starkem Druck. Der Grund ist das riesige Leistungsbilanzdefizit der USA. So nennen Ökonomen die Finanzlücke, die entsteht, wenn ein Land mehr verbraucht, als es selbst erwirtschaftet. Das nötige Geld muss es sich dann aus dem Ausland leihen. Derzeit legen die Investoren der Welt jeden Tag mehr als eine Milliarde Dollar in Amerika an. Doch das Interesse nimmt ab, und das treibt den Dollar nach unten. Wie 1985. Bloß herrschte vor 18 Jahren allerorten Inflation, weshalb die Schwäche der US-Währung die übrigen Wirtschaftsmächte nicht weiter störte. Der sinkende Dollar machte Importgüter billiger und verringerte somit den Preisdruck in Kaufhäusern und Supermärkten.
Heute dagegen haben die Regierungschefs nicht Angst vor steigenden, sondern vor fallenden Preisen. Die Inflationsraten in den Industrieländern betragen weniger als zwei Prozent – ein Niveau so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Weltweit halten sich Unternehmen wie Verbraucher mit dem Geldausgeben zurück. Deshalb äußern die amerikanische Notenbank Fed und zahlreiche Volkswirte beidseits des Atlantiks ihre Sorge vor Deflation – einem Zustand der dauerhaften Investions- und Konsumschwäche, der die japanische Wirtschaft schon seit Jahren lähmt.
Je weiter der Dollar fällt, desto wahrscheinlicher wird das Deflationsszenario für Europa. Kein Wunder also, dass niemand an einer Abwertung des Dollar Interesse hat – mit Ausnahme der USA selbst.
Die japanische Notenbank interveniert fleißig am Devisenmarkt, damit der Yen nicht gegen den Dollar aufwertet.
China sorgt seit Jahren dafür, dass seine Währung unterbewertet bleibt. Daran wird sich so rasch nichts ändern, denn der niedrige Kurs des Yuan macht Produkte made in China weltweit billig und sorgt im Reich der Mitte für einen Exportboom. Die Marktkräfte jedoch können nicht für eine Aufwertung des Yuan sorgen, da China mit Kapitalverkehrskontrollen und einem festen Wechselkurs gegenüber dem Dollar operiert.
Nur die Europäer haben bisher nichts gegen den fallenden Dollar unternommen. Der Euro steigt und steigt. Während die Gemeinschaftswährung in den vergangenen zwölf Monaten knapp 30 Prozent gegenüber dem Dollar gewonnen hat, addieren sich die Zuwächse der wichtigsten übrigen Währungen auf lediglich 10 Prozent.
Europa trägt die Last der Aufwertung fast allein
Längst hält auch die amerikanische Regierung nicht mehr an der gewohnten Politik des „starken Dollar“ fest. Washington toleriert die Abwertung, denn die Amerikaner studieren ihre Geschichte. In der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre war es vor allem die einseitige Abwertung des Dollar gegenüber dem Goldkurs um 40 Prozent, die Amerika aus der Krise half, indem sie die Exportwirtschaft ankurbelte.
Werden sich die Amerikaner nun wieder auf diese Weise vor der Deflation retten? Oder definieren die Regierungschefs in Evian Wechselkursziele, bei deren Erreichen gemeinsam interveniert wird? Wird gar China zur Aufwertung gedrängt oder die Europäische Zentralbank zu aggressiven Zinssenkungen, um die negativen Auswirkungen des festen Euro auf den Export abzumildern? Sicher ist nur: Die wirtschaftspolitischen Ansätze der drei Wirtschaftsblöcke, die am Genfer See aufeinander treffen, könnten unterschiedlicher kaum sein.
Hier die Amerikaner: Mit Steuer- und Zinssenkungen und einem schwachen Dollar versuchen sie, die Wirtschaft anzukurbeln, getrieben von einer tiefsitzenden Furcht, dass sich die Depression der Dreißiger wiederholen könnte.
Dort die Europäer: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Leitzinsen vergleichsweise hoch, die Regierungen sparen, der Euro gewinnt an Stärke, und Minister wie Notenbanker bezweifeln, dass überhaupt Deflationsgefahr droht. Otmar Issing, Chevolkswirt der EZB, etwa sagte kürzlich, er kenne „keine Prognose, die jetzt Handlungsbedarf signalisiert“. Und als warnendes Beispiel schließlich die Japaner, die trotz eines Notenbankzinssatzes von null und wiederholter Erhöhung der Staatsausgaben sowie permanenter Interventionen am Devisenmarkt der Deflation nicht entrinnen können.
Der Internationale Währungsfonds hat die Entwicklung in Japan studiert und warnt seitdem vor fallenden Preisen: Da Deflation meist erst zu erkennen sei, nachdem sie eingetreten ist, sollten Notenbanken und Regierungen erhöhte Vorsicht walten lassen. Die Geldpolitik dürfe angesichts der Unsicherheit ruhig etwas lockerer sein, als es die konjunkturelle Lage erlaube, schreibt der IWF in seinem World Economic Outlook. Wenn sich diese Ansicht in Evian durchsetzt, könnte das mehr Aktivität bewirken als ein internationales Wechselkursabkommen.
DIE ZEIT - 28.05.2003
Deflation
Aus Angst vor dem D-Wort
Vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Evian grassiert die Furcht: Kommt eine Deflation? Für den Aufschwung lässt Amerika den Dollarkurs sacken – und gefährdet Europa umso mehr
Von Robert von Heusinger
Schweinebäuche, Sojabohnen und Weizen sorgen unter Finanzinvestoren und Spekulanten oft für Gesprächsstoff. Aber Mineralwasser? Zumindest ein paar Tage lang wird ein aus Kiosk und Supermarkt bekannter französischer Name an den weltweiten Kapitalmärkten im Gespräch sein: Evian. Doch nicht das stille Wasser ist gemeint, sondern der gleichnamige Kurort am südlichen Rand des Genfer Sees. Dort treffen sich Anfang Juni die mächtigsten Regierungschefs der Welt zum Wirtschaftsgipfel. Sie werden über Geld reden, genauer: über die Deflation und den Dollar.
In den vergangenen Wochen ist auch dem letzten Optimisten klar geworden: Die Weltwirtschaft steckt weiter in der Krise. In Amerika und Europa häufen sich die Warnungen vor dauerhaft fallenden Preisen, Deflation genannt. Der Dollar verliert fast täglich an Wert.
In Evian sind neben den traditionellen G-8-Ländern USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und Russland auch die EU vertreten und, zum ersten Mal, China. Trotz des seit der Irak-Krise gestörten Verhältnisses zwischen Europäern und Amerikanern glaubt der französische Präsident Chirac schon jetzt zu wissen, was am Ende beim Gipfel herauskommen wird: „Obwohl noch Spannungen bleiben, glaube ich doch, dass von Evian eine Botschaft des Vertrauens in eine Erholung der Weltwirtschaft ausgehen kann.“
Nur, welche Botschaft genau? Plaza, Louvre und jetzt Evian? Der Gedanke eines neuen wirtschaftspolitischen Abkommens zwischen den Regierungen zur Stabilisierung der Weltkonjunktur klingt längst nicht mehr so absurd wie noch vor einigen Jahren.
Plaza und Louvre sind Chiffren für Wechselkursabkommen der G-5 (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien und Frankreich), geschlossen in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre. Im Plaza-Hotel in New York verabredeten die Staatschefs 1985 einen schwächeren Dollar. Die Zentralbanken intervenierten am Devisenmarkt, und zwei Jahre später hatte die amerikanische Währung tatsächlich 30 Prozent an Wert gegenüber den wichtigsten Handelspartnern verloren.
Niemand will den billigen Dollar – außer den Amerikanern selbst
1987 erklärten die G-5 dann die Dollar-Abwertung für beendet, verabredeten Zielzonen für die Wechselkurse und Stimulanzen für die jeweiligen Volkswirtschaften. Wieder versuchten die Zentralbanken, durch Devisenkäufe und -verkäufe die Märkte zu lenken. Doch diesmal fiel der Erfolg mager aus. Weitere Versuche, die Wirtschaftspolitik global zu koordinieren, unterblieben mangels Notwendigkeit. Anfang der neunziger Jahre begann in den USA der längste Boom der amerikanischen Geschichte, der auch in Europa für kräftiges Wachstum sorgte.
Vorbei. Die Lage gleicht auf dem ersten Blick wieder der des Jahres 1985. Der Dollar steht unter starkem Druck. Der Grund ist das riesige Leistungsbilanzdefizit der USA. So nennen Ökonomen die Finanzlücke, die entsteht, wenn ein Land mehr verbraucht, als es selbst erwirtschaftet. Das nötige Geld muss es sich dann aus dem Ausland leihen. Derzeit legen die Investoren der Welt jeden Tag mehr als eine Milliarde Dollar in Amerika an. Doch das Interesse nimmt ab, und das treibt den Dollar nach unten. Wie 1985. Bloß herrschte vor 18 Jahren allerorten Inflation, weshalb die Schwäche der US-Währung die übrigen Wirtschaftsmächte nicht weiter störte. Der sinkende Dollar machte Importgüter billiger und verringerte somit den Preisdruck in Kaufhäusern und Supermärkten.
Heute dagegen haben die Regierungschefs nicht Angst vor steigenden, sondern vor fallenden Preisen. Die Inflationsraten in den Industrieländern betragen weniger als zwei Prozent – ein Niveau so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Weltweit halten sich Unternehmen wie Verbraucher mit dem Geldausgeben zurück. Deshalb äußern die amerikanische Notenbank Fed und zahlreiche Volkswirte beidseits des Atlantiks ihre Sorge vor Deflation – einem Zustand der dauerhaften Investions- und Konsumschwäche, der die japanische Wirtschaft schon seit Jahren lähmt.
Je weiter der Dollar fällt, desto wahrscheinlicher wird das Deflationsszenario für Europa. Kein Wunder also, dass niemand an einer Abwertung des Dollar Interesse hat – mit Ausnahme der USA selbst.
Die japanische Notenbank interveniert fleißig am Devisenmarkt, damit der Yen nicht gegen den Dollar aufwertet.
China sorgt seit Jahren dafür, dass seine Währung unterbewertet bleibt. Daran wird sich so rasch nichts ändern, denn der niedrige Kurs des Yuan macht Produkte made in China weltweit billig und sorgt im Reich der Mitte für einen Exportboom. Die Marktkräfte jedoch können nicht für eine Aufwertung des Yuan sorgen, da China mit Kapitalverkehrskontrollen und einem festen Wechselkurs gegenüber dem Dollar operiert.
Nur die Europäer haben bisher nichts gegen den fallenden Dollar unternommen. Der Euro steigt und steigt. Während die Gemeinschaftswährung in den vergangenen zwölf Monaten knapp 30 Prozent gegenüber dem Dollar gewonnen hat, addieren sich die Zuwächse der wichtigsten übrigen Währungen auf lediglich 10 Prozent.
Europa trägt die Last der Aufwertung fast allein
Längst hält auch die amerikanische Regierung nicht mehr an der gewohnten Politik des „starken Dollar“ fest. Washington toleriert die Abwertung, denn die Amerikaner studieren ihre Geschichte. In der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre war es vor allem die einseitige Abwertung des Dollar gegenüber dem Goldkurs um 40 Prozent, die Amerika aus der Krise half, indem sie die Exportwirtschaft ankurbelte.
Werden sich die Amerikaner nun wieder auf diese Weise vor der Deflation retten? Oder definieren die Regierungschefs in Evian Wechselkursziele, bei deren Erreichen gemeinsam interveniert wird? Wird gar China zur Aufwertung gedrängt oder die Europäische Zentralbank zu aggressiven Zinssenkungen, um die negativen Auswirkungen des festen Euro auf den Export abzumildern? Sicher ist nur: Die wirtschaftspolitischen Ansätze der drei Wirtschaftsblöcke, die am Genfer See aufeinander treffen, könnten unterschiedlicher kaum sein.
Hier die Amerikaner: Mit Steuer- und Zinssenkungen und einem schwachen Dollar versuchen sie, die Wirtschaft anzukurbeln, getrieben von einer tiefsitzenden Furcht, dass sich die Depression der Dreißiger wiederholen könnte.
Dort die Europäer: Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Leitzinsen vergleichsweise hoch, die Regierungen sparen, der Euro gewinnt an Stärke, und Minister wie Notenbanker bezweifeln, dass überhaupt Deflationsgefahr droht. Otmar Issing, Chevolkswirt der EZB, etwa sagte kürzlich, er kenne „keine Prognose, die jetzt Handlungsbedarf signalisiert“. Und als warnendes Beispiel schließlich die Japaner, die trotz eines Notenbankzinssatzes von null und wiederholter Erhöhung der Staatsausgaben sowie permanenter Interventionen am Devisenmarkt der Deflation nicht entrinnen können.
Der Internationale Währungsfonds hat die Entwicklung in Japan studiert und warnt seitdem vor fallenden Preisen: Da Deflation meist erst zu erkennen sei, nachdem sie eingetreten ist, sollten Notenbanken und Regierungen erhöhte Vorsicht walten lassen. Die Geldpolitik dürfe angesichts der Unsicherheit ruhig etwas lockerer sein, als es die konjunkturelle Lage erlaube, schreibt der IWF in seinem World Economic Outlook. Wenn sich diese Ansicht in Evian durchsetzt, könnte das mehr Aktivität bewirken als ein internationales Wechselkursabkommen.
DIE ZEIT - 28.05.2003
THE ECONOMIST warnt in seiner freitags ausgabe das die gefahr eines immobilien crashs in uk und usa sehr hoch sei und eine weltweite rezession auslösen könne
... danke für den Hinweis, goldhausse 
- ich hab´den Artikel mal rausgesucht. - ist in der Tat erschreckend, was da auf uns zukommt ...
Immobilien-Blase :
DER GROSSE KNALL STEHT BEVOR
Neue Gefahr für die Finanzmärkte: In vielen Ländern sind die Immobilienpreise ins Unermessliche gestiegen, nun droht die Blase zu platzen. Ein Preissturz könnte mehr Schaden anrichten als die Aktienbaisse und Staaten mit kränkelnder Wirtschaft tief in die Rezession drücken.
London/Frankfurt am Main - Von Deutschland und Japan abgesehen, hat es in den vergangenen Jahren in fast allen Ländern einen Boom für Hauspreise gegeben, berichtet das britische Wirtschaftsmagazin "The Economist" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe. Der Immobilienboom habe Blasen geschaffen - um mehr als 50 Prozent seien die Hauspreise seit Mitte der neunziger Jahre in Australien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Spanien und Schweden gestiegen, in den USA um 30 Prozent.
Das Platzen dieser Blasen im Laufe des nächsten Jahres sei sehr wahrscheinlich, so der "Economist". Um 15 bis 20 Prozent würden die Hauspreise in den USA dann stürzen, um 30 Prozent und mehr in anderen Ländern. Bei insgesamt niedriger Inflation sei der Wertverlust besonders drastisch. In Städten wie London, New York und Amsterdam gäbe es bereits Anzeichen für einen schnell abkühlenden Immobilienmarkt.
In den USA sind die Preise für Eigenheime seit 1995 um 27 Prozent gestiegen - doppelt so stark wie in den Boomjahren Ende der siebziger und achtziger Jahre. In den Großstädten ist der Anstieg sogar noch größer: In New York sind die Preise um 47 Prozent, in San Francisco um 70 Prozent, in London sogar um 136 Prozent gestiegen. In Deutschland und Japan dagegen sind die nominellen und die realen Preise im gleichen Zeitraum deutlich gesunken. Ein Haus in Tokio kostet heute nur die Hälfte des Preises von 1991
Eigenheime repräsentieren 15 Prozent des BIP
Das Platzen der Immobilienblase wird mehr Schaden anrichten als das Platzen der Aktienblase, sagt "The Economist" voraus. Die Zeitschrift sieht dafür drei Gründe: Steigende Hauspreise haben einen positiven Einfluss auf die Konsumausgaben, weil mehr Menschen Eigenheime besitzen als Aktien und mit steigenden Hauspreisen mehr Geld ausgeben. Für den Kauf eines Hause leihen sich Menschen eher Geld als für den Kauf von Aktien. Fallende Immobilienpreise führen zu notleidenden Darlehen bei Banken, denn für viele Hausbesitzer sind die Kosten für den Erwerb eines Eigenheims höher als der tatsächliche Wert.
Auf rund 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beläuft sich der Immobilienmarkt in reicheren Ländern nach Schätzungen von des "Economist". Dazu gehörten Bau, Kauf und Verkauf sowie Vermietung und kalkulatorische Zinsen für Nutzer-Eigentümer von Immobilien. Rund zwei Drittel des Sachvermögens machen Immobilien in den meisten Volkswirtschaften aus. Immobilien seien weltweit die größte Form der Einzelanlage. Investoren hätten mehr Geld in Immobilien angelegt als in Aktien oder Anleihen.
Deutschland sei das einzige Land unter den entwickelten Volkswirtschaften, in dem weniger als die Hälfte der Haushalte Hausbesitzer seien. In den meisten europäischen Ländern und in Australien mache Wohnen 40 bis 60 Prozent des privaten Haushaltsvermögens aus, in Nordamerika rund 30 Prozent. Selbst in den USA ist sechsmal mehr Vermögen eines typischen Haushalts in Wohneigentum gebunden als in Aktien.
Die Erträge aus Hauskäufen hätten in den vergangenen zehn Jahren in den meisten Ländern die Erträge aus Aktien deutlich überstiegen. Für Immobilien müsse die gleiche Wertanalyse angelegt werden wie für Aktien. Denn: Blasen bildeten sich, wenn der Preis für eine Anlage in keinem Verhältnis mehr zu seinem eigentlich Wert stehe. Die Kosten für den Erwerb von Eigenbesitz sollten die zukünftigen Entwicklungen widerspiegeln. Die Tatsache, daß in den meisten Ländern die Preise für Eigenheime und Bürogebäude viel schneller gewachsen sind als die Mietpreise, ist nach Ansicht von "The Economist" alarmierend.
100 Quadratmeter kosten in London 800.000 Dollar
Weil übergreifende Vergleichsdaten nicht zur Verfügung stehen, hat das Blatt im vergangenen Jahr Hauspreis-Indizes zusammengestellt, die vierteljährlich aktualisiert werden. Die Hauspreise hätten sich seit 1995 in Irland verdreifacht, in den Niederlanden und Großbritannien verdoppelt und sind um zwei Drittel in Australien, Spanien und Schweden angewachsen. Bei Berücksichtigung der Inflationsraten sind die Hauspreise in allen Ländern real um 25 Prozent gewachsen - ausgenommen Deutschland, Japan, Kanada und Italien. In Deutschland dagegen sind die Preise in den vergangenen sieben Jahren nominal um 5 Prozent und real - nach Abzug der Inflation - um 13 Prozent gesunken.
Zwar gäbe es einen Weltmarkt für den Handel mit Anleihen, Aktien und Devisen, aber nichts Vergleichbares für Wohnungen. Die Preise für Immobilien und die Regeln für den Kauf und Verkauf wichen weltweit stark voneinander ab. Der Preis für eine Zweizimmer-Wohnung mit rund 100 Quadratmetern im Stadtzentrum ist am teuersten in London, New York und Tokio mit mehr als 800.000 Dollar, liegt in Frankfurt bei unter 400.000 Dollar und in Brüssel bei unter 200.000 Dollar.
Nach Ansicht des "Economist" können weder niedrige Zinssätze noch Bevölkerungswachstum den Boom der Hauspreise rechtfertigen. Die Aktien-Blase habe gezeigt, daß der Grundwert einer Anlage nicht vernachlässigt werden dürfe. Zwei Wege sieht die Zeitschrift für die Bewertung von Hauspreisen: das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Verhältnis von Hauspreis und Einkommen. Der Wert jeder Anlage sollte seine zukünftigen Einkünfte widerspiegeln. So wie der Wert einer Aktie dem Wert der zukünftigen Dividenden entsprechen sollte, sollte der Wert eines Hauses die zukünftigen Leistungen des Eigentums widerspiegeln - entweder die Mieteinnahmen oder die eingesparte Miete für einen Eigentümer-Nutzer.
DER SPIEGEL - 29. Mai 2003
---
Europas Büro-Entwickler verschieben Projekte
Investoren und Banken verlieren zunehmend das Zutrauen in die Märkte - Steigende Leerstände
London - In Europa werden immer mehr Bauprojekte für Büroimmobilien verschoben, da sich die Geldgeber zurückziehen und die Mieter immer mehr überschüssige Flächen zur Verfügung haben. Das berichtete der Grundstücksmakler Jones Lang LaSalle.
So wurden in München und Barcelona Projekte, für die es noch keine Mieter gab, verschoben. In Amsterdam wurden alle so genannten spekulativen Projekte gestrichen. Dort suchen Unternehmen Untermieter für 270.000 qm Büroraum. "Banken oder institutionelle Anleger entscheiden sich gegen die Kreditvergabe", erklärte Tony Horrell, Chairman der Sparte für europäische Kapitalmärkte bei Jones Lang. "Riskante Projekte zählen nicht zu den Gewerbeimmobilien, die für diese Geldgeber interessant sind."
In den 90er Jahren haben Banken von Citigroup bis Lehman Brothers Leasingverträge mit bis zu 30 Jahren Laufzeit abgeschlossen. Jetzt suchen sie für überschüssigen Raum Mieter. Seit ihrem Allzeithoch sind die Mieten ein Drittel gesunken. Im Londoner Finanzbezirk werden für 545.000 qm Bürofläche Untermieter gesucht.
In den ersten drei Monaten des Jahres sank die Nachfrage nach Büroraum in Europa im Vergleich zum Vorquartal um 16 Prozent. Die Zahl der vermieteten Büros sackte von 2000 bis 2002 um 40 Prozent ab, berichtete Jones Lang. Im westlichen London hat Land Securities Group Plc kürzlich die Entwicklung einer Büro- und Wohnanlage nahe der U-Bahn-Station Paddington verschoben. "Wir planen jetzt mit einem Beginn 2010", erklärte Francis Salway, Vorstandschef der Entwicklungs-Sparte von Land Securities.
Doch nicht alle Entwickler verschieben ihre Baupläne. Für Berlin liegen Jones Lang keine Planänderungen vor, obwohl dort die Büromieten in 2002 um 21,4 Prozent zurückgegangen sind.
DIE WELT - 27. Mai 2003
---
Kein gutes Geld mehr für schwierige Großsiedlungen
Nordrhein-Westfalen bläst zur Götterdämmerung der Wohnungswirtschaft - Das Thema Leerstand war im Westen zu lange ein Tabu
von Dankwart Guratzsch
Bochum - Mit dem Knaller seiner Rede konfrontierte der Gast aus Düsseldorf seine Zuhörer gleich im ersten Satz: "Ich weiß, dass wir am Ende der Dienstzeit der Wohnungswirtschaft stehen." Geraune, Gelächter, halblaute Kommentare "Das ist schon peinlich" waren die Antwort aus dem Saal. Und doch erlebten die Teilnehmer der Fachtagung im Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Bochum so etwas wie einen historischen Augenblick. Zum ersten Mal in der hundertjährigen Geschichte des sozialen Wohnungsbaus wagte es mit Hans-Dieter Krupinski ein hochrangiger deutscher Wohnungspolitiker, die Götterdämmerung des Siedlungsbaus vorauszusagen.
Es war auf der Tagung "Weiterentwicklung von Großsiedlungen in NRW", und vorausgegangen waren schonungslose Bestandsaufnahmen, die allesamt zeigten: Das Gespenst des Leerstands hat den Westen Deutschlands erreicht. Dabei geraten die Großsiedlungen der 60er- und 70er-Jahre in eine aussichtslose Lage. Ähnlich wie im Osten nehmen hier die Leerstände unaufhaltsam zu. Deshalb war es ein gut gemeinter Einfall, den Diskussionsblock "Lernen vom Stadtumbau Ost" ins Programm zu nehmen. Am Ende der Tagung freilich hätte man das Motto umdrehen können: Denn von der Radikalität der Schlussfolgerungen und der Klarheit der Positionen, die diese Tagung kennzeichneten, müsste das mit unendlicher Vorsicht operierende politische Establishment im Osten lernen.
Gewiss, das Thema ist auch im Westen, so Burghard Schneider, VdW-Verbandsdirektor Rheinland-Westfalen, "viel zu lange tabuisiert worden". Wenn jetzt nicht nur einzelne Wohnlagen, sondern "die Großsiedlungen insgesamt auf dem Prüfstand stehen" (Schneider), so ist dies eine Entwicklung, die sich schon Mitte der 80er Jahre im Westen Deutschlands abzeichnete. "Seit der Errichtung dieser Siedlungen beschäftigt uns diese Problematik", stöhnte Manfred Morgenstern, Staatssekretär im Bauministerium Nordrhein-Westfalens. Und: "Auch ständige Nachsubventionierung hat nicht zur Problemlösung beigetragen."
Die Euphorie über diese Siedlungskomplexe habe kaum zehn Jahre überdauert, dann habe mit Nachbesserungen und Nachfinanzierungen nachgeholfen werden müssen. Doch was ist damit erreicht worden? Morgenstern: "Heute drohen Leerstand, hohe Fluktuationsraten und Mietausfälle, die sozialen Gettos sind zu Brutnestern von Vandalismus und Kleinkriminalität geworden." Allein NRW verfügt über mehr als 17 solcher Siedlungen mit über 2500 Einwohnern.
Morgenstern ließ keinen Zweifel, dass die heutigen Rahmenbedingungen ein "Hinterherschmeißen öffentlicher Gelder" auf unabsehbare Zeit verbieten. Schrumpfende Wohnungsmärkte, schrumpfende Bevölkerung, Arbeitslosigkeit und sinkende Einkommen schränkten die Möglichkeiten staatlicher Intervention auf das "absolut Notwendige" ein. Deshalb hätten die Ministerpräsidenten der Länder dem Bund vorgeschlagen, aus der sozialen Wohnraumförderung auszusteigen. Für die Länder werde es "im wesentlichen um die Bestandsförderung" gehen. Dass davon auch "Monostrukturen wie die Großsiedlungen" profitieren könnten, sei angesichts zunehmender Qualitätsauslese mehr als fraglich.
Der Düsseldorfer Staatssekretär sagte deshalb eine einschneidende politische Weichenstellung voraus: Großsiedlungen mit ihren dauerhaft höheren Bewirtschaftungskosten und den hier nötigen intensiveren Aufwendungen für die soziale Stabilisierung könnten nur noch gefördert werden, wenn die Wohnungsgesellschaften tragfähige "integrierte Bewirtschaftungsmodelle" vorlegen, die sich mit den Zielen der Stadtentwicklung verzahnen lassen.
Harald Förster, Projektleiter bei der RAG Immobilien AG mit dem Schwerpunkt Portfoliomanagement, riet daher zu schonungsloser Inventur: "Man kann nicht alles halten. Wir wollen keine Slums, also müssen wir einiges beseitigen." Es gehe nicht an, Bestände in den Markt zu drücken, die in 15 Jahren ohnehin keine Chance mehr hätten. Den Politikern riet der Experte, unter solchen Vorzeichen nicht etwa zur "Wegsubventionierung von anderen Wohnformen" Zuflucht zu nehmen. Im Städtebau stehe Deutschland vor der Alternative: "Kann es attraktive Ränder geben, wenn es keine attraktiven Zentren mehr gibt?" Für ihn sei die Sache klar: "Stadtumbau West muss in die Attraktivität der Zentren investieren."
Für den Osten zog Maren Kern, Geschäftsführerin der Potsdamer Domus Consult, eine verheerende Bilanz: "Kommunen und Wohnungsunternehmen stehen am Abgrund." So seien in der größten Stadt Thüringens, Gera, bei prognostiziertem Bevölkerungsrückgang von einst 135 000 auf 85 000 Einwohner und einem Wohnungsüberhang von 21,5 Prozent schon heute Wohnungen in Großsiedlungen trotz zum Teil "sehr umfassender Sanierung" nicht mehr nachgefragt. Eine "sozioökonomische Studie" zeige: Die Mieter wollen überwiegend raus und andere wollen nicht rein, weil sie die Blöcke als unattraktiv empfinden.
Aber die Handlungsspielräume sind nicht nur im Osten, sondern auch im Westen nahezu futsch. Klaus Wermker, Leiter des Büros Stadtentwicklung Essen, sieht bei einem Leerstand von heute schon 10 000- bis 12 000 Wohnungen eine fatale Konsequenz: "Wir müssen irgendwann das Abwassersystem umbauen." Rita Tölle, Referat Wohnungsbestandsförderung im Bauministerium NRW, kann sich nur noch die Förderung solcher Bestände vorstellen, die sich "langfristig alleine tragen". Dabei müsste sich die Wohnungsgesellschaft "auf Dauer" festlegen, dass der Erhalt dieser Komplexe "mehr kostet als eine drei- bis viergeschossige Neubebauung." Ohne Zusatzangebote wie Mieterbetreuung, Portierlogen oder Videokontrolle sei eine soziale Stabilisierung der Quartiere mit vermietbaren Wohnstrukturen zu konkurrenzfähigen Mieten nicht vorstellbar. Tölle zu den Wohnungwirtschaftlern: "Man muss das rechenfähig machen für 40 Jahre."
Als Hans-Dieter Krupinski das Podium betrat, war der Boden für die grausame Wahrheit bereitet: "Die schwierigen Siedlungen mit ihrem heruntergekommenen Image kann man nicht retten durch öffentliche Förderung. Sehen Sie sich den ältesten Bautenbestand an, der hat sich als Wohnform bewährt und überdauert alle Leerstandsphasen. Die Siedlungen aber funktionieren nur noch an Wachstumsstandorten mit hochpreisigen Wohnungen." Und dann das nüchterne Resümee: "Wir werden uns nicht engagieren, um überkommene Strukturen zu verfestigen, an deren langfristige Perspektive wir selbst nicht glauben. Zöpel ist tot." Zwischenrufe aus dem Publikum, der einstige Bauminister des Landes sei sehr wohl noch am Leben, quittierte der weißhaarige Draufgänger mit amüsiertem Schmunzeln: "Nur nicht politisch."
DIE WELT - 27. Mai 2003

- ich hab´den Artikel mal rausgesucht. - ist in der Tat erschreckend, was da auf uns zukommt ...

Immobilien-Blase :
DER GROSSE KNALL STEHT BEVOR
Neue Gefahr für die Finanzmärkte: In vielen Ländern sind die Immobilienpreise ins Unermessliche gestiegen, nun droht die Blase zu platzen. Ein Preissturz könnte mehr Schaden anrichten als die Aktienbaisse und Staaten mit kränkelnder Wirtschaft tief in die Rezession drücken.
London/Frankfurt am Main - Von Deutschland und Japan abgesehen, hat es in den vergangenen Jahren in fast allen Ländern einen Boom für Hauspreise gegeben, berichtet das britische Wirtschaftsmagazin "The Economist" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe. Der Immobilienboom habe Blasen geschaffen - um mehr als 50 Prozent seien die Hauspreise seit Mitte der neunziger Jahre in Australien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Spanien und Schweden gestiegen, in den USA um 30 Prozent.
Das Platzen dieser Blasen im Laufe des nächsten Jahres sei sehr wahrscheinlich, so der "Economist". Um 15 bis 20 Prozent würden die Hauspreise in den USA dann stürzen, um 30 Prozent und mehr in anderen Ländern. Bei insgesamt niedriger Inflation sei der Wertverlust besonders drastisch. In Städten wie London, New York und Amsterdam gäbe es bereits Anzeichen für einen schnell abkühlenden Immobilienmarkt.
In den USA sind die Preise für Eigenheime seit 1995 um 27 Prozent gestiegen - doppelt so stark wie in den Boomjahren Ende der siebziger und achtziger Jahre. In den Großstädten ist der Anstieg sogar noch größer: In New York sind die Preise um 47 Prozent, in San Francisco um 70 Prozent, in London sogar um 136 Prozent gestiegen. In Deutschland und Japan dagegen sind die nominellen und die realen Preise im gleichen Zeitraum deutlich gesunken. Ein Haus in Tokio kostet heute nur die Hälfte des Preises von 1991
Eigenheime repräsentieren 15 Prozent des BIP
Das Platzen der Immobilienblase wird mehr Schaden anrichten als das Platzen der Aktienblase, sagt "The Economist" voraus. Die Zeitschrift sieht dafür drei Gründe: Steigende Hauspreise haben einen positiven Einfluss auf die Konsumausgaben, weil mehr Menschen Eigenheime besitzen als Aktien und mit steigenden Hauspreisen mehr Geld ausgeben. Für den Kauf eines Hause leihen sich Menschen eher Geld als für den Kauf von Aktien. Fallende Immobilienpreise führen zu notleidenden Darlehen bei Banken, denn für viele Hausbesitzer sind die Kosten für den Erwerb eines Eigenheims höher als der tatsächliche Wert.
Auf rund 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beläuft sich der Immobilienmarkt in reicheren Ländern nach Schätzungen von des "Economist". Dazu gehörten Bau, Kauf und Verkauf sowie Vermietung und kalkulatorische Zinsen für Nutzer-Eigentümer von Immobilien. Rund zwei Drittel des Sachvermögens machen Immobilien in den meisten Volkswirtschaften aus. Immobilien seien weltweit die größte Form der Einzelanlage. Investoren hätten mehr Geld in Immobilien angelegt als in Aktien oder Anleihen.
Deutschland sei das einzige Land unter den entwickelten Volkswirtschaften, in dem weniger als die Hälfte der Haushalte Hausbesitzer seien. In den meisten europäischen Ländern und in Australien mache Wohnen 40 bis 60 Prozent des privaten Haushaltsvermögens aus, in Nordamerika rund 30 Prozent. Selbst in den USA ist sechsmal mehr Vermögen eines typischen Haushalts in Wohneigentum gebunden als in Aktien.
Die Erträge aus Hauskäufen hätten in den vergangenen zehn Jahren in den meisten Ländern die Erträge aus Aktien deutlich überstiegen. Für Immobilien müsse die gleiche Wertanalyse angelegt werden wie für Aktien. Denn: Blasen bildeten sich, wenn der Preis für eine Anlage in keinem Verhältnis mehr zu seinem eigentlich Wert stehe. Die Kosten für den Erwerb von Eigenbesitz sollten die zukünftigen Entwicklungen widerspiegeln. Die Tatsache, daß in den meisten Ländern die Preise für Eigenheime und Bürogebäude viel schneller gewachsen sind als die Mietpreise, ist nach Ansicht von "The Economist" alarmierend.
100 Quadratmeter kosten in London 800.000 Dollar
Weil übergreifende Vergleichsdaten nicht zur Verfügung stehen, hat das Blatt im vergangenen Jahr Hauspreis-Indizes zusammengestellt, die vierteljährlich aktualisiert werden. Die Hauspreise hätten sich seit 1995 in Irland verdreifacht, in den Niederlanden und Großbritannien verdoppelt und sind um zwei Drittel in Australien, Spanien und Schweden angewachsen. Bei Berücksichtigung der Inflationsraten sind die Hauspreise in allen Ländern real um 25 Prozent gewachsen - ausgenommen Deutschland, Japan, Kanada und Italien. In Deutschland dagegen sind die Preise in den vergangenen sieben Jahren nominal um 5 Prozent und real - nach Abzug der Inflation - um 13 Prozent gesunken.
Zwar gäbe es einen Weltmarkt für den Handel mit Anleihen, Aktien und Devisen, aber nichts Vergleichbares für Wohnungen. Die Preise für Immobilien und die Regeln für den Kauf und Verkauf wichen weltweit stark voneinander ab. Der Preis für eine Zweizimmer-Wohnung mit rund 100 Quadratmetern im Stadtzentrum ist am teuersten in London, New York und Tokio mit mehr als 800.000 Dollar, liegt in Frankfurt bei unter 400.000 Dollar und in Brüssel bei unter 200.000 Dollar.
Nach Ansicht des "Economist" können weder niedrige Zinssätze noch Bevölkerungswachstum den Boom der Hauspreise rechtfertigen. Die Aktien-Blase habe gezeigt, daß der Grundwert einer Anlage nicht vernachlässigt werden dürfe. Zwei Wege sieht die Zeitschrift für die Bewertung von Hauspreisen: das Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Verhältnis von Hauspreis und Einkommen. Der Wert jeder Anlage sollte seine zukünftigen Einkünfte widerspiegeln. So wie der Wert einer Aktie dem Wert der zukünftigen Dividenden entsprechen sollte, sollte der Wert eines Hauses die zukünftigen Leistungen des Eigentums widerspiegeln - entweder die Mieteinnahmen oder die eingesparte Miete für einen Eigentümer-Nutzer.
DER SPIEGEL - 29. Mai 2003
---
Europas Büro-Entwickler verschieben Projekte
Investoren und Banken verlieren zunehmend das Zutrauen in die Märkte - Steigende Leerstände
London - In Europa werden immer mehr Bauprojekte für Büroimmobilien verschoben, da sich die Geldgeber zurückziehen und die Mieter immer mehr überschüssige Flächen zur Verfügung haben. Das berichtete der Grundstücksmakler Jones Lang LaSalle.
So wurden in München und Barcelona Projekte, für die es noch keine Mieter gab, verschoben. In Amsterdam wurden alle so genannten spekulativen Projekte gestrichen. Dort suchen Unternehmen Untermieter für 270.000 qm Büroraum. "Banken oder institutionelle Anleger entscheiden sich gegen die Kreditvergabe", erklärte Tony Horrell, Chairman der Sparte für europäische Kapitalmärkte bei Jones Lang. "Riskante Projekte zählen nicht zu den Gewerbeimmobilien, die für diese Geldgeber interessant sind."
In den 90er Jahren haben Banken von Citigroup bis Lehman Brothers Leasingverträge mit bis zu 30 Jahren Laufzeit abgeschlossen. Jetzt suchen sie für überschüssigen Raum Mieter. Seit ihrem Allzeithoch sind die Mieten ein Drittel gesunken. Im Londoner Finanzbezirk werden für 545.000 qm Bürofläche Untermieter gesucht.
In den ersten drei Monaten des Jahres sank die Nachfrage nach Büroraum in Europa im Vergleich zum Vorquartal um 16 Prozent. Die Zahl der vermieteten Büros sackte von 2000 bis 2002 um 40 Prozent ab, berichtete Jones Lang. Im westlichen London hat Land Securities Group Plc kürzlich die Entwicklung einer Büro- und Wohnanlage nahe der U-Bahn-Station Paddington verschoben. "Wir planen jetzt mit einem Beginn 2010", erklärte Francis Salway, Vorstandschef der Entwicklungs-Sparte von Land Securities.
Doch nicht alle Entwickler verschieben ihre Baupläne. Für Berlin liegen Jones Lang keine Planänderungen vor, obwohl dort die Büromieten in 2002 um 21,4 Prozent zurückgegangen sind.
DIE WELT - 27. Mai 2003
---
Kein gutes Geld mehr für schwierige Großsiedlungen
Nordrhein-Westfalen bläst zur Götterdämmerung der Wohnungswirtschaft - Das Thema Leerstand war im Westen zu lange ein Tabu
von Dankwart Guratzsch
Bochum - Mit dem Knaller seiner Rede konfrontierte der Gast aus Düsseldorf seine Zuhörer gleich im ersten Satz: "Ich weiß, dass wir am Ende der Dienstzeit der Wohnungswirtschaft stehen." Geraune, Gelächter, halblaute Kommentare "Das ist schon peinlich" waren die Antwort aus dem Saal. Und doch erlebten die Teilnehmer der Fachtagung im Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Bochum so etwas wie einen historischen Augenblick. Zum ersten Mal in der hundertjährigen Geschichte des sozialen Wohnungsbaus wagte es mit Hans-Dieter Krupinski ein hochrangiger deutscher Wohnungspolitiker, die Götterdämmerung des Siedlungsbaus vorauszusagen.
Es war auf der Tagung "Weiterentwicklung von Großsiedlungen in NRW", und vorausgegangen waren schonungslose Bestandsaufnahmen, die allesamt zeigten: Das Gespenst des Leerstands hat den Westen Deutschlands erreicht. Dabei geraten die Großsiedlungen der 60er- und 70er-Jahre in eine aussichtslose Lage. Ähnlich wie im Osten nehmen hier die Leerstände unaufhaltsam zu. Deshalb war es ein gut gemeinter Einfall, den Diskussionsblock "Lernen vom Stadtumbau Ost" ins Programm zu nehmen. Am Ende der Tagung freilich hätte man das Motto umdrehen können: Denn von der Radikalität der Schlussfolgerungen und der Klarheit der Positionen, die diese Tagung kennzeichneten, müsste das mit unendlicher Vorsicht operierende politische Establishment im Osten lernen.
Gewiss, das Thema ist auch im Westen, so Burghard Schneider, VdW-Verbandsdirektor Rheinland-Westfalen, "viel zu lange tabuisiert worden". Wenn jetzt nicht nur einzelne Wohnlagen, sondern "die Großsiedlungen insgesamt auf dem Prüfstand stehen" (Schneider), so ist dies eine Entwicklung, die sich schon Mitte der 80er Jahre im Westen Deutschlands abzeichnete. "Seit der Errichtung dieser Siedlungen beschäftigt uns diese Problematik", stöhnte Manfred Morgenstern, Staatssekretär im Bauministerium Nordrhein-Westfalens. Und: "Auch ständige Nachsubventionierung hat nicht zur Problemlösung beigetragen."
Die Euphorie über diese Siedlungskomplexe habe kaum zehn Jahre überdauert, dann habe mit Nachbesserungen und Nachfinanzierungen nachgeholfen werden müssen. Doch was ist damit erreicht worden? Morgenstern: "Heute drohen Leerstand, hohe Fluktuationsraten und Mietausfälle, die sozialen Gettos sind zu Brutnestern von Vandalismus und Kleinkriminalität geworden." Allein NRW verfügt über mehr als 17 solcher Siedlungen mit über 2500 Einwohnern.
Morgenstern ließ keinen Zweifel, dass die heutigen Rahmenbedingungen ein "Hinterherschmeißen öffentlicher Gelder" auf unabsehbare Zeit verbieten. Schrumpfende Wohnungsmärkte, schrumpfende Bevölkerung, Arbeitslosigkeit und sinkende Einkommen schränkten die Möglichkeiten staatlicher Intervention auf das "absolut Notwendige" ein. Deshalb hätten die Ministerpräsidenten der Länder dem Bund vorgeschlagen, aus der sozialen Wohnraumförderung auszusteigen. Für die Länder werde es "im wesentlichen um die Bestandsförderung" gehen. Dass davon auch "Monostrukturen wie die Großsiedlungen" profitieren könnten, sei angesichts zunehmender Qualitätsauslese mehr als fraglich.
Der Düsseldorfer Staatssekretär sagte deshalb eine einschneidende politische Weichenstellung voraus: Großsiedlungen mit ihren dauerhaft höheren Bewirtschaftungskosten und den hier nötigen intensiveren Aufwendungen für die soziale Stabilisierung könnten nur noch gefördert werden, wenn die Wohnungsgesellschaften tragfähige "integrierte Bewirtschaftungsmodelle" vorlegen, die sich mit den Zielen der Stadtentwicklung verzahnen lassen.
Harald Förster, Projektleiter bei der RAG Immobilien AG mit dem Schwerpunkt Portfoliomanagement, riet daher zu schonungsloser Inventur: "Man kann nicht alles halten. Wir wollen keine Slums, also müssen wir einiges beseitigen." Es gehe nicht an, Bestände in den Markt zu drücken, die in 15 Jahren ohnehin keine Chance mehr hätten. Den Politikern riet der Experte, unter solchen Vorzeichen nicht etwa zur "Wegsubventionierung von anderen Wohnformen" Zuflucht zu nehmen. Im Städtebau stehe Deutschland vor der Alternative: "Kann es attraktive Ränder geben, wenn es keine attraktiven Zentren mehr gibt?" Für ihn sei die Sache klar: "Stadtumbau West muss in die Attraktivität der Zentren investieren."
Für den Osten zog Maren Kern, Geschäftsführerin der Potsdamer Domus Consult, eine verheerende Bilanz: "Kommunen und Wohnungsunternehmen stehen am Abgrund." So seien in der größten Stadt Thüringens, Gera, bei prognostiziertem Bevölkerungsrückgang von einst 135 000 auf 85 000 Einwohner und einem Wohnungsüberhang von 21,5 Prozent schon heute Wohnungen in Großsiedlungen trotz zum Teil "sehr umfassender Sanierung" nicht mehr nachgefragt. Eine "sozioökonomische Studie" zeige: Die Mieter wollen überwiegend raus und andere wollen nicht rein, weil sie die Blöcke als unattraktiv empfinden.
Aber die Handlungsspielräume sind nicht nur im Osten, sondern auch im Westen nahezu futsch. Klaus Wermker, Leiter des Büros Stadtentwicklung Essen, sieht bei einem Leerstand von heute schon 10 000- bis 12 000 Wohnungen eine fatale Konsequenz: "Wir müssen irgendwann das Abwassersystem umbauen." Rita Tölle, Referat Wohnungsbestandsförderung im Bauministerium NRW, kann sich nur noch die Förderung solcher Bestände vorstellen, die sich "langfristig alleine tragen". Dabei müsste sich die Wohnungsgesellschaft "auf Dauer" festlegen, dass der Erhalt dieser Komplexe "mehr kostet als eine drei- bis viergeschossige Neubebauung." Ohne Zusatzangebote wie Mieterbetreuung, Portierlogen oder Videokontrolle sei eine soziale Stabilisierung der Quartiere mit vermietbaren Wohnstrukturen zu konkurrenzfähigen Mieten nicht vorstellbar. Tölle zu den Wohnungwirtschaftlern: "Man muss das rechenfähig machen für 40 Jahre."
Als Hans-Dieter Krupinski das Podium betrat, war der Boden für die grausame Wahrheit bereitet: "Die schwierigen Siedlungen mit ihrem heruntergekommenen Image kann man nicht retten durch öffentliche Förderung. Sehen Sie sich den ältesten Bautenbestand an, der hat sich als Wohnform bewährt und überdauert alle Leerstandsphasen. Die Siedlungen aber funktionieren nur noch an Wachstumsstandorten mit hochpreisigen Wohnungen." Und dann das nüchterne Resümee: "Wir werden uns nicht engagieren, um überkommene Strukturen zu verfestigen, an deren langfristige Perspektive wir selbst nicht glauben. Zöpel ist tot." Zwischenrufe aus dem Publikum, der einstige Bauminister des Landes sei sehr wohl noch am Leben, quittierte der weißhaarige Draufgänger mit amüsiertem Schmunzeln: "Nur nicht politisch."
DIE WELT - 27. Mai 2003
.
Schwindel um den Dollar-Sturz
Von Thomas Fricke
Die US-Regierung steuert in eine Schwachwährungspolitik, mit der das Wachstum gestützt und das astronomische Außendefizit abgebaut werden soll - ein riskantes Spiel, das im Desaster enden könnte.
Der billige Dollar hilft Amerikas Exporteuren, wird das US-Wachstum stützen, das Rekorddefizit im Außenhandel abbauen und so auch den Rest der Welt beglücken - der Aufschwung steht bevor.
Wenn es nach der US-Regierung ginge, könnte es in den nächsten Monaten so kommen. Nur: Um das zu glauben, bedarf es dann doch eines sehr ausgeprägten Optimismus. Und den demonstrieren derzeit eher einsam die Regierenden der acht Industrieländer, die sich am Wochenende in Evian zum Gipfelritual und Aufschwungbeschwören treffen.
Die Zuversicht über die Dollar-Abwertung wirkt zunehmend gewagt. Und das liegt nicht allein daran, dass Europas Firmen schon jetzt den Wettbewerbsverlust schmerzlich spüren. Als ebenso fatal könnte sich die kaum verhohlene Hoffnung des US-Präsidenten erweisen, wonach der Greenback-Absturz wie wundersam das astronomische Außendefizit der USA verschwinden lassen wird. Ein riskantes Spiel, das im globalen Desaster enden könnte.
Enormer US-Importsog
Klar: Jeder weitere Kursverlust beim Dollar macht US-Waren billiger und europäische teurer. Verglichen mit der Zeit der Euro-Tiefstwerte müssen Amerikaner mittlerweile ein Drittel mehr zahlen, Schätzungen zufolge ist der Euro bei 1,19 Euro je Dollar überbewertet. Das stützt tendenziell die US-Exporte und bremst die Einfuhren, was positiv auf die Leistungsbilanz wirken müsste, deren Defizit derzeit fünf Prozent der US-Wirtschaftsleistung erreicht.
Die Wirklichkeit ist komplizierter. Vieles spricht sogar dafür, dass das US-Defizit vorläufig weiter wächst. Denn zuerst steigen bei fallendem Dollar automatisch die Preise und damit auch der Gesamtwert der US-Importe; erst später werden die Mengen angepasst.
Im akuten US-Fall ist selbst danach noch keineswegs garantiert, dass die Lehrbuchregel vom Bilanzausgleich rasch wirkt. Kaum eine andere Wirtschaft kauft bei anziehender Inlandskonjunktur so schnell so viele Waren im Ausland. In der Vergangenheit führte ein Plus von einem Prozent bei der US-Nachfrage zu einem Einfuhrplus von 1,6 bis 2 Prozent. Ein solcher Sog droht mühsame US-Exporterfolge im Saldo schnell wettzumachen. Hinzu kommt, dass Amerika zurzeit viel mehr importiert, als es exportiert. Und die Arithmetik will, dass die Ausfuhren daher prozentual viel schneller zulegen müssten, um einen Anstieg der Importe nominal aufzufangen.
Ganz scheitern könnte die Anpassung der US-Bilanz dann, wenn zur Dollar-Korrektur nicht auch eine Korrektur des Konjunkturgefälles zu Gunsten Europas und Japans kommt. Ex- und Importe hängen von Konjunktur und Nachfrage (noch) mehr ab als vom Wechselkurs. Nach Berechnung des US-Experten der Dresdner Bank, David Milleker, reagieren etwa die US-Einfuhren rund viermal so stark auf eine höhere Nachfrage wie auf einen niedrigeren Wechselkurs. Will heißen: Je stärker im globalen Vergleich die US-Wirtschaft wächst, desto schneller legen die eigenen Importe zu - und desto langsamer die Exporte in die schwächer wachsenden Abnehmerländer.
Die Konsequenz wirkt bedrohlich. "Solange das Wachstum in Übersee nicht höher als in den USA ist, wird es keinen nennenswerten Abbau des US-Defizits geben", so der US-Devisenexperte der Deutschen Bank, Michael Rosenberg. Das aber könnte der Dollar-Sturz vorerst verhindern. Modellrechnungen zufolyge hat schon die Euro-Aufwertung von 2002 ein halbes Prozentpunkt Wachstum im Euro-Raum gekostet. Sonst wäre die deutsche Wirtschaft zuletzt kaum geschrumpft.
Der Vergleich zu den 80er Jahren drängt sich auf. Damals verlor der Dollar zwischen 1985 und 1987 fast die Hälfte seines Wertes, und das bedrohlich wirkende Defizit in der US-Leistungsbilanz begann tatsächlich ab Ende 1987 zu sinken. Damals wuchs Europa allerdings viel stärker. Und zum wirklichen Defizitabbau kam es erst, als die USA 1990 in die Rezession stürzten, während Deutschland im Einheitstaumel noch boomte. Das Wachstumsgefälle erreichte einmalige Wunderwerte. In diese Zeit fiel zudem der freundliche deutsche Milliardenscheck zur Finanzierung des Golfkriegs, der als Transferposten die US-Leistungsbilanz sogar kurz ins Plus brachte.
Anpassung durch Verdrängung
All das ist fern, und dies macht die Angelegenheit so heikel. Heute drohten Japan und die Euro-Zone wegen des US-Währungskurses in die Rezession zu geraten, warnt David Ingram vom Beratungsdienst Economy.com. Laut Dresdner-Ökonom Milleker dürften die US-Firmen ihren Wechselkursvorteil vor allem nutzen, indem sie Importkonkurrenz verdrängen (was auch den Eifer von US-Lobbys erklären könnte, französische Kriegsverweigerer-Waren zu boykottieren). Der Dollar-Sturz drohe "wie eine Deglobalisierung zu wirken", sagte Milleker.
Wie drastisch der Dollar-Sturz die Europäer trifft, hängt stark davon ab, ob es gelingt, andere Wachstumspotenziale rasch zu mobilisieren. Dafür wären schnelle und sehr drastische Zinssenkungen ebenso dringlich wie deutlich sinkende Steuern und ein Verzicht auf alles, was die Konjunktur bremsen könnte. Strukturreformen wie in der Agenda 2010 können so schnell gar nicht wirken.
Spätestens wenn Europa krisenkursbedingt kein Geld mehr hat, um wie bisher US-Waren zu kaufen, droht der fatale Dollar-Kurs auf die USA zurückzuschlagen. Der Versuch einer "Abwertung nur zum eigenen Wettbewerbsnutzen" sei kurzsichtig und werde Amerikas Firmen nichts nützen, sagt Ingram. Bisher habe Bushs neuer Isolationismus vor allem eines gebracht: mehr Unsicherheit für die weltweiten Kapitalmärkte.
Die USA werden ihre Defizite aus vergangenen Exzess-Zeiten am Devisenmarkt nicht wegzaubern können - so polternd die Regierung jetzt auch auftritt.
FTD 30.05.2003
Schwindel um den Dollar-Sturz
Von Thomas Fricke
Die US-Regierung steuert in eine Schwachwährungspolitik, mit der das Wachstum gestützt und das astronomische Außendefizit abgebaut werden soll - ein riskantes Spiel, das im Desaster enden könnte.
Der billige Dollar hilft Amerikas Exporteuren, wird das US-Wachstum stützen, das Rekorddefizit im Außenhandel abbauen und so auch den Rest der Welt beglücken - der Aufschwung steht bevor.
Wenn es nach der US-Regierung ginge, könnte es in den nächsten Monaten so kommen. Nur: Um das zu glauben, bedarf es dann doch eines sehr ausgeprägten Optimismus. Und den demonstrieren derzeit eher einsam die Regierenden der acht Industrieländer, die sich am Wochenende in Evian zum Gipfelritual und Aufschwungbeschwören treffen.
Die Zuversicht über die Dollar-Abwertung wirkt zunehmend gewagt. Und das liegt nicht allein daran, dass Europas Firmen schon jetzt den Wettbewerbsverlust schmerzlich spüren. Als ebenso fatal könnte sich die kaum verhohlene Hoffnung des US-Präsidenten erweisen, wonach der Greenback-Absturz wie wundersam das astronomische Außendefizit der USA verschwinden lassen wird. Ein riskantes Spiel, das im globalen Desaster enden könnte.
Enormer US-Importsog
Klar: Jeder weitere Kursverlust beim Dollar macht US-Waren billiger und europäische teurer. Verglichen mit der Zeit der Euro-Tiefstwerte müssen Amerikaner mittlerweile ein Drittel mehr zahlen, Schätzungen zufolge ist der Euro bei 1,19 Euro je Dollar überbewertet. Das stützt tendenziell die US-Exporte und bremst die Einfuhren, was positiv auf die Leistungsbilanz wirken müsste, deren Defizit derzeit fünf Prozent der US-Wirtschaftsleistung erreicht.
Die Wirklichkeit ist komplizierter. Vieles spricht sogar dafür, dass das US-Defizit vorläufig weiter wächst. Denn zuerst steigen bei fallendem Dollar automatisch die Preise und damit auch der Gesamtwert der US-Importe; erst später werden die Mengen angepasst.
Im akuten US-Fall ist selbst danach noch keineswegs garantiert, dass die Lehrbuchregel vom Bilanzausgleich rasch wirkt. Kaum eine andere Wirtschaft kauft bei anziehender Inlandskonjunktur so schnell so viele Waren im Ausland. In der Vergangenheit führte ein Plus von einem Prozent bei der US-Nachfrage zu einem Einfuhrplus von 1,6 bis 2 Prozent. Ein solcher Sog droht mühsame US-Exporterfolge im Saldo schnell wettzumachen. Hinzu kommt, dass Amerika zurzeit viel mehr importiert, als es exportiert. Und die Arithmetik will, dass die Ausfuhren daher prozentual viel schneller zulegen müssten, um einen Anstieg der Importe nominal aufzufangen.
Ganz scheitern könnte die Anpassung der US-Bilanz dann, wenn zur Dollar-Korrektur nicht auch eine Korrektur des Konjunkturgefälles zu Gunsten Europas und Japans kommt. Ex- und Importe hängen von Konjunktur und Nachfrage (noch) mehr ab als vom Wechselkurs. Nach Berechnung des US-Experten der Dresdner Bank, David Milleker, reagieren etwa die US-Einfuhren rund viermal so stark auf eine höhere Nachfrage wie auf einen niedrigeren Wechselkurs. Will heißen: Je stärker im globalen Vergleich die US-Wirtschaft wächst, desto schneller legen die eigenen Importe zu - und desto langsamer die Exporte in die schwächer wachsenden Abnehmerländer.
Die Konsequenz wirkt bedrohlich. "Solange das Wachstum in Übersee nicht höher als in den USA ist, wird es keinen nennenswerten Abbau des US-Defizits geben", so der US-Devisenexperte der Deutschen Bank, Michael Rosenberg. Das aber könnte der Dollar-Sturz vorerst verhindern. Modellrechnungen zufolyge hat schon die Euro-Aufwertung von 2002 ein halbes Prozentpunkt Wachstum im Euro-Raum gekostet. Sonst wäre die deutsche Wirtschaft zuletzt kaum geschrumpft.
Der Vergleich zu den 80er Jahren drängt sich auf. Damals verlor der Dollar zwischen 1985 und 1987 fast die Hälfte seines Wertes, und das bedrohlich wirkende Defizit in der US-Leistungsbilanz begann tatsächlich ab Ende 1987 zu sinken. Damals wuchs Europa allerdings viel stärker. Und zum wirklichen Defizitabbau kam es erst, als die USA 1990 in die Rezession stürzten, während Deutschland im Einheitstaumel noch boomte. Das Wachstumsgefälle erreichte einmalige Wunderwerte. In diese Zeit fiel zudem der freundliche deutsche Milliardenscheck zur Finanzierung des Golfkriegs, der als Transferposten die US-Leistungsbilanz sogar kurz ins Plus brachte.
Anpassung durch Verdrängung
All das ist fern, und dies macht die Angelegenheit so heikel. Heute drohten Japan und die Euro-Zone wegen des US-Währungskurses in die Rezession zu geraten, warnt David Ingram vom Beratungsdienst Economy.com. Laut Dresdner-Ökonom Milleker dürften die US-Firmen ihren Wechselkursvorteil vor allem nutzen, indem sie Importkonkurrenz verdrängen (was auch den Eifer von US-Lobbys erklären könnte, französische Kriegsverweigerer-Waren zu boykottieren). Der Dollar-Sturz drohe "wie eine Deglobalisierung zu wirken", sagte Milleker.
Wie drastisch der Dollar-Sturz die Europäer trifft, hängt stark davon ab, ob es gelingt, andere Wachstumspotenziale rasch zu mobilisieren. Dafür wären schnelle und sehr drastische Zinssenkungen ebenso dringlich wie deutlich sinkende Steuern und ein Verzicht auf alles, was die Konjunktur bremsen könnte. Strukturreformen wie in der Agenda 2010 können so schnell gar nicht wirken.
Spätestens wenn Europa krisenkursbedingt kein Geld mehr hat, um wie bisher US-Waren zu kaufen, droht der fatale Dollar-Kurs auf die USA zurückzuschlagen. Der Versuch einer "Abwertung nur zum eigenen Wettbewerbsnutzen" sei kurzsichtig und werde Amerikas Firmen nichts nützen, sagt Ingram. Bisher habe Bushs neuer Isolationismus vor allem eines gebracht: mehr Unsicherheit für die weltweiten Kapitalmärkte.
Die USA werden ihre Defizite aus vergangenen Exzess-Zeiten am Devisenmarkt nicht wegzaubern können - so polternd die Regierung jetzt auch auftritt.
FTD 30.05.2003
.
... Thaiguru, Du hattest recht ..., mea culpa ... Gruß K.
Gruß K.
In Rußland wird offenbar tatsächlich über eine mögliche Goldwährung nachgedacht :
NOTHING IS BETTER THAN GOLD
Russian economists discuss an opportunity to put a golden ruble in circulation
PRAVDA MOSKAU - von Kira Poznakhirko - 30.05.2003
In developed countries, almost every family has stocks or state bonds. Exchange news is the real information, people show their interest in it. They do not keep their savings at home, they make money work for the economy, the money is invested in the real sector of economy, in the production of goods and export, in the development of new technologies, and so on. This is probably the reason why the living standard of developed countries seems to be a dream for the majority of the planet`s population.
It seems that Russia has chosen the way of the world`s poorest and hopeless countries. There are investment tools in Russia, but they are meant for a very narrow group of "insiders." Everyone else use notes of the American State Treasury. Russian governmental officials and bankers have been concerned about Russian people`s wish to save their money at home, not in banks. The government arranged the bank reform, they passed the law about insuring people`s deposits (which does not insure anything really). The result of those measures was ridiculous. The US dollar started going down, but Russians did not hurry to open bank deposits either. Therefore, the Russian bank system is not meant for saving funds and making investments. To all appearance, it is meant for something else. What if all Russians decided to bring all their money to banks one day? Nothing would change either way. Russian banks invest almost nothing in the country`s economy - it is a rather risky thing to do.
Most likely, that money would be used for purchasing a chalet in Switzerland or a house on Bermudas. The rest of the money would then be transferred to foreign banks in order to work for the economy of foreign countries (big money brings very good profit in developed countries without any risks). So why does Russia need such banks at all? Even Russian largest state monopolies have to borrow funds abroad.
Experts say that it is very hard to create an efficient and reliable investment tool in Russia. In fact, there are a lot of such tools in the country, but they are not used according to their purpose. Although, thee is a small group of people, who use investment tools, albeit for their personal interests only. Prices on land, apartments and other saving tools have been growing in Russia recently. The US dollar has exhausted such opportunities, and Russians do not see any other investment tool to use.
However, Russian people reportedly possess up to 60 billion dollars in total - this money does not work for anything. This "analytical suffering" will continue until the state pays attention to the most ancient and yet most reliable investment tool - gold.
Economists have been arguing about the golden ruble for along already, referring to the ten-ruble gold piece of Stalin`s era and recollecting the incredible industrial growth that occurred during the ruling of Russian emperors Alexander III and Nikolay II. That was the time, when the Russian golden ruble was the most secure and stable currency in the world. However, economists do not make any decisions - politicians and officials of the Russian Finance Ministry and the Central Bank do. They are all certain that the state can grow rich without gold too. It probably can, but not the Russian Federation of the stability and moderate economic growth period.
Bloomberg reports, world prices on gold have reached the highest point over recent months - 367,8 dollars per ounce. The agency believes that the price of a troy ounce on the world market may exceed the level of $400 until the end of the current year. There is probably no other way. The US dollar has been a saving tool for the whole world, not for Russia alone. Investors do not know, where to invest, that is why they prefer to buy gold. American state bonds lose their attraction on account of the interest rate reduction.
RBC news agency reports that gold does not work in Russia as an investment tool. Producers sell gold to banks, and banks sell it on world exchanges, obtaining demising dollars or euro for gold bars. The euro has been growing lately, but it will inevitably crash some day.
A common person can hardly buy gold - it is rather difficult. In addition to that, it is hard for a common person to sell it too. Jewelry does not count, for people buy it as a work of art, which is then sold as precious scrap. Analysts believe that such a situation takes place because of the tough control of the state and the taxation burden.
In general, the circulation of gold in Russia is a market for a very small group of people, it is impossible for a common person to access it. For example, one has to pay the value added tax of 20 percent for purchasing gold. When selling gold, the tax is not reimbursed. In other words, this 20 percent will go straight to the state. In addition to that, any bank will have to provide the information to fiscal bodies about anyone who purchases gold. Golden coins are not imposed with value added tax, though, and the Russian Central Bank has already launched the series production of them. In addition to it, the Central Bank periodically informs about the increase of their sales. However, golden coins cause problems as well. One can not use them in a store, selling them back to the Central Bank is not profitable either.
Why doesn`t Russia use the golden ruble yet? Investment tools are not meant for common people. Probably, the government wants to make Russians save their money in Russian banks. However, people do not trust the bank system anyway. Probably, they want to make Russians save their money in US dollars. A lot of experts believe that about two-thirds of all dollars are not secured with anything. The US Treasury has a goal to trace and destroy those dollars secretly.
To all appearance, Russia has agreed to become a place, where excessive dollars are saved. There is no one to claim this responsibility - they are not in power anymore. However, all people had to pay for their decisions. Nothing is better than gold.
Quelle:
http://english.pravda.ru/main/18/89/358/10148_gold.html
---
Converting Dollars to Gold
Russian people keep losing their faith in US dollar
It deems that the decade of Russian people-s whole-hearted confidence in US dollar is coming to its end. Years of reforms made people of Russia think that everything might crush, devaluate, turn to dust in a blink of an eye, although packs of green money would remain totally secure. However, an American dollar stumbled on the way of its constant growth. It seems that this will cost it a lot.
However, if a US dollar is not the most reliable way for people to save their money, Russians will have to deal with an inevitable question v what can serve as a substitute? Is it real estate or land, or cars? However, only a few people in Russia can convert their money the same way as Western common people do, taking into consideration the fact that practically every Russian person has a certain quantity of dollars. In this case Russians pay their attention to everlasting values.
Gold has always been the absolute universal equivalent on account of its chemical peculiarities. In addition to that, gold is the metal that is used in the jewelry industry. The economic boom of Western countries and the targeted policy of American and European banks used to push gold into the background. A dollar became much more important than gold. However, gold managed to keep its position anyway. As it seems, the present time is just the right moment for increasing the role of gold as the universal equivalent.
As a rule, the interest to gold as a way to save money grows little by little. However, the situation changes completely during a crisis or an economic disaster. Bank specialists say that the uneven growth of demand on gold occurs for the third time in Russia. The first time it happened after the crisis of 1998, then - in September of 2001. The third time takes place at present moment. Gold gets more expensive today. The majority of Russian experts think that the reason of such a sudden increase of demand on this precious metal is the same as it is with the growth of the euro rate. The subconscious distrust in dollar is finally finished with its quantity, turning to quality. Yet, according to experts- estimates, it is the rise of prices on gold, which makes a common consumer react. Common people think like this: if it becomes more expensive, this means that a lot of people need it, so why not joining them? On the other hand, it stands the reason that it is a lot better to buy something when prices go down, not up. If something becomes more and more expensive, it is the best time to start selling it.
Any Russian person can come to a bank and buy some gold there. Banks sell gold in the shape of bars and coins. It is the Russian Central Bank that produces gold coins. There are two kinds of those coins: investment and collectible coins.
Investment coins are not taxed with value-added tax at their purchase, which makes them rather attractive to buyers. It is possible to acquire them in banks, paying the price of metal, as well as the commission fee of up to five percent. If prices go up, one may sell those coins. Sometimes gold prices might experience the fluctuation of ten or fifteen percent within a weekend. However, gold prices might fall and grow rather considerably at times. Gold prices have been growing since 2001 v from $250 to $375 per troy ounce. Advanced ?investors¦ had a good opportunity to gain a lot of profit with the help of that fluctuation. On the other hand, those people, who purchased some gold at the price of $370 per ounce, were deprived of any profit at the moment. They are forced to hold their investments at the moment, hoping that gold might get more expensive in the future.
However, if someone does not like the idea of being worried over exchange fluctuations, it would be better to choose collectible gold coins. Unfortunately, they are taxed with value added tax, although their price grows with time, covering taxation costs. Yet, one should be a good specialists of collectible gold coins. It is possible to buy the goods of low liquidity, which will inevitably cause a lot of troubles in the future. Only two or three banks work with collectible coins. Selling those coins to onsellers or numismatists can be rather risky.
Russian Federation Central Bank specialists say that the most popular series of collectible gold coins is Zodiac Signs. The Central Bank is going to increase the output of those coins next year. In addition to that, coins are expected to become 2.5 times larger (they are rather small at the moment). One gold coin of Zodiac Signs series costs 1300 rubles, which is equal to the sum of $40. To crown it all, the Central Bank has something unique to offer as well. There is a unique gold coin, for example, which weighs one kilogram. The coin was issued to commemorate the 300th anniversary of St.Petersburg.
If Russian people do not believe in the all-mighty dollar anymore, if it is too late to buy euros, it is possible to buy some gold. This would be a nice, even a beautiful thing to do. Furthermore, it is possible to convert gold in rubles easily. More importantly, every sold gold coin will help the Central Bank to increase the Russian gold reserve, which has been hidden by Russian authorities in American and European banks right in the middle of another coming global economic crisis.
---
How Russian Gold Reserve Was Plundered
Investigation of embezzlement of 786 tons of gold lasts for half a year already. Russian Prosecutor-s Office already found the planes, countries and banks where the gold was delivered. The Soviet Union exported large oil supplies, earnings were exchanged for gold and never got back to the country; fourteen billion of dollars still remain unclaimed in Belgium. We know that so-called ?shadow flows¦ at the rate of 20 billion dollars leave the country every year. However, no measures are taken to stop such crimes.
I know lots of detective stories, one of them concerns Russian Duma faction Yabloko. In accordance with the agreement on differentiation of authorities between Russia and the republic of Tatarstan of 1992, enormous oil supplies left Tatarstan. As a repay, 200 computers were sent to Tatarstan, but they never arrived to the republic. Yabloko leader Grigory Yavlinsky preferred to hide for a month because of fear when the computers were stolen. In connection with this case and other facts, I can mention the assassination of Duma deputy Galina Starovoitova. Investigation of the crime is allegedly currently carried out, I also go to interrogations. But in fact, no measures are taken against the officials.
Let-s take Yegor Gaidar. It was he who was the author of the Chechen aviso made on 4 trillion rubles; this money was scattered about the country and sent to Siberia. Gold of the party and partially gold of artels was withdrawn from the country. The artels retained all gold within three years as the country experienced severe inflation, and gold always remained gold. But the gold was taken abroad, away from the country. However, Yegor Gaidar wasn-t brought into criminal account for such actions. Prosecutors are afraid to ask him questions concerning the case.
As for the money, it was used for privatization in the country. Those Supreme Council deputies who knew about the money, Vladimir Golovlev and Lezhnev are dead; Golovlev was assassinated in August this year. Investigator who carried out interrogations concerning gold of the party was killed at the same time.
Large supplies of oil, gold stolen from Magadan, Yakutia, Khabarovsk and silver from Russia-s Far East were withdrawn from the country; high-ranking officials such as Ministers for Internal Affairs Viktor Yerin, Andrey Dunayev, Anatoly Kulikov, Vladimir Rushailo were perfectly aware of the gold outflow. As a result of the criminal activity, 500 tons of gold were withdrawn from Russia, but no measures were taken in connection with the crime.
Finally, proceedings were instituted in connection with the gold withdrawing from the country; the investigation identified names of the pilots who removed the gold and the company involved into the operation. Two Il-76 planes removed gold to Latin America, Australia, Romania, England, Germany in batches of 40 or 15 tons within three years. The investigation already knows the banks and the countries where the gold is; certificates were written out for Belgium-s basic bank, Belgium Credit. Those people who were involved into the crime are already known; Vladislav Reznik from Unity faction was among them. Yegor Gaidar was also involved into withdrawal of Soviet gold. I am currently member of the Duma commission for corruption, that is why I-m not afraid to mention the facts.
I worked in the council on land reform under vice-president Alexander Rutskoy; being completely unaware of the whole of the situation, I concluded agreements with 88 gold artels of the Russian Federation. I was offered a preferential loan of the Central Bank. I distributed 1 trillion rubles in the prices of 1992 between the gold artels. The gold passed through my accounts. It was at the beginning of 1993, and inflation increased 300 times in 1995. In fact, the gold was laundered through me.
There was also the infamous case ?Urozhai¦, Vice-premier Gennady Kulik and other officials were involved in the case. The money was once again accumulated on my accounts. I was taken to prison in 1993; and in 1994-1995 the gold was removed from the country to the banks in Romania, England, Latin America. Certificates were written out to the bank Belgium-Credit. Now, I cannot make anyone bring the money back to Russia. Although I managed to prove everything, a special investigation group was created; several witnesses concerned with the gold case and one investigator are already killed. But the group is working on the case; special inquiries were sent to all banks. Some people were shocked when they learnt everything, and some still keep silent.
Everybody understands that a political will and a political order are necessary to bring everything back. But there is no will. And those who organized those gold deliveries are currently high-ranking officials, which certainly means that their names should be concealed.
Money obtained in that criminal gold operations were spent on construction of Moscow-s trading center Okhotny Ryad, of Slavyanskaya Hotel; this money is spent on financing of the Chechen war. The same financial schemes were used for privatization of state property objects.
The government and the Duma legislation committee know about the problem and admit its importance. However, no solutions of the problem are found yet. That is why I offer to pass a law that will probably allow to bring the withdrawn gold back to Russia and punish those who are guilty of the crime. The stolen resources belong to the Russian people. I don-t deny my guilt of the crime, as I compiled documents used for the gold withdrawal. Those who feel brave enough, must support the law I-m speaking about.
Sergey Shashurin
Member of the People-s Deputy group and
State Duma commission for struggle against corruption
The above mentioned text is the deputy-s speech at the Duma plenary session in November 2002
The legislation suggested by Sergey Shashurin was supported by 207 deputies (226 are required).
Translated by Maria Gousseva
... Thaiguru, Du hattest recht ..., mea culpa ...
 Gruß K.
Gruß K.In Rußland wird offenbar tatsächlich über eine mögliche Goldwährung nachgedacht :
NOTHING IS BETTER THAN GOLD
Russian economists discuss an opportunity to put a golden ruble in circulation
PRAVDA MOSKAU - von Kira Poznakhirko - 30.05.2003
In developed countries, almost every family has stocks or state bonds. Exchange news is the real information, people show their interest in it. They do not keep their savings at home, they make money work for the economy, the money is invested in the real sector of economy, in the production of goods and export, in the development of new technologies, and so on. This is probably the reason why the living standard of developed countries seems to be a dream for the majority of the planet`s population.
It seems that Russia has chosen the way of the world`s poorest and hopeless countries. There are investment tools in Russia, but they are meant for a very narrow group of "insiders." Everyone else use notes of the American State Treasury. Russian governmental officials and bankers have been concerned about Russian people`s wish to save their money at home, not in banks. The government arranged the bank reform, they passed the law about insuring people`s deposits (which does not insure anything really). The result of those measures was ridiculous. The US dollar started going down, but Russians did not hurry to open bank deposits either. Therefore, the Russian bank system is not meant for saving funds and making investments. To all appearance, it is meant for something else. What if all Russians decided to bring all their money to banks one day? Nothing would change either way. Russian banks invest almost nothing in the country`s economy - it is a rather risky thing to do.
Most likely, that money would be used for purchasing a chalet in Switzerland or a house on Bermudas. The rest of the money would then be transferred to foreign banks in order to work for the economy of foreign countries (big money brings very good profit in developed countries without any risks). So why does Russia need such banks at all? Even Russian largest state monopolies have to borrow funds abroad.
Experts say that it is very hard to create an efficient and reliable investment tool in Russia. In fact, there are a lot of such tools in the country, but they are not used according to their purpose. Although, thee is a small group of people, who use investment tools, albeit for their personal interests only. Prices on land, apartments and other saving tools have been growing in Russia recently. The US dollar has exhausted such opportunities, and Russians do not see any other investment tool to use.
However, Russian people reportedly possess up to 60 billion dollars in total - this money does not work for anything. This "analytical suffering" will continue until the state pays attention to the most ancient and yet most reliable investment tool - gold.
Economists have been arguing about the golden ruble for along already, referring to the ten-ruble gold piece of Stalin`s era and recollecting the incredible industrial growth that occurred during the ruling of Russian emperors Alexander III and Nikolay II. That was the time, when the Russian golden ruble was the most secure and stable currency in the world. However, economists do not make any decisions - politicians and officials of the Russian Finance Ministry and the Central Bank do. They are all certain that the state can grow rich without gold too. It probably can, but not the Russian Federation of the stability and moderate economic growth period.
Bloomberg reports, world prices on gold have reached the highest point over recent months - 367,8 dollars per ounce. The agency believes that the price of a troy ounce on the world market may exceed the level of $400 until the end of the current year. There is probably no other way. The US dollar has been a saving tool for the whole world, not for Russia alone. Investors do not know, where to invest, that is why they prefer to buy gold. American state bonds lose their attraction on account of the interest rate reduction.
RBC news agency reports that gold does not work in Russia as an investment tool. Producers sell gold to banks, and banks sell it on world exchanges, obtaining demising dollars or euro for gold bars. The euro has been growing lately, but it will inevitably crash some day.
A common person can hardly buy gold - it is rather difficult. In addition to that, it is hard for a common person to sell it too. Jewelry does not count, for people buy it as a work of art, which is then sold as precious scrap. Analysts believe that such a situation takes place because of the tough control of the state and the taxation burden.
In general, the circulation of gold in Russia is a market for a very small group of people, it is impossible for a common person to access it. For example, one has to pay the value added tax of 20 percent for purchasing gold. When selling gold, the tax is not reimbursed. In other words, this 20 percent will go straight to the state. In addition to that, any bank will have to provide the information to fiscal bodies about anyone who purchases gold. Golden coins are not imposed with value added tax, though, and the Russian Central Bank has already launched the series production of them. In addition to it, the Central Bank periodically informs about the increase of their sales. However, golden coins cause problems as well. One can not use them in a store, selling them back to the Central Bank is not profitable either.
Why doesn`t Russia use the golden ruble yet? Investment tools are not meant for common people. Probably, the government wants to make Russians save their money in Russian banks. However, people do not trust the bank system anyway. Probably, they want to make Russians save their money in US dollars. A lot of experts believe that about two-thirds of all dollars are not secured with anything. The US Treasury has a goal to trace and destroy those dollars secretly.
To all appearance, Russia has agreed to become a place, where excessive dollars are saved. There is no one to claim this responsibility - they are not in power anymore. However, all people had to pay for their decisions. Nothing is better than gold.
Quelle:
http://english.pravda.ru/main/18/89/358/10148_gold.html
---
Converting Dollars to Gold
Russian people keep losing their faith in US dollar
It deems that the decade of Russian people-s whole-hearted confidence in US dollar is coming to its end. Years of reforms made people of Russia think that everything might crush, devaluate, turn to dust in a blink of an eye, although packs of green money would remain totally secure. However, an American dollar stumbled on the way of its constant growth. It seems that this will cost it a lot.
However, if a US dollar is not the most reliable way for people to save their money, Russians will have to deal with an inevitable question v what can serve as a substitute? Is it real estate or land, or cars? However, only a few people in Russia can convert their money the same way as Western common people do, taking into consideration the fact that practically every Russian person has a certain quantity of dollars. In this case Russians pay their attention to everlasting values.
Gold has always been the absolute universal equivalent on account of its chemical peculiarities. In addition to that, gold is the metal that is used in the jewelry industry. The economic boom of Western countries and the targeted policy of American and European banks used to push gold into the background. A dollar became much more important than gold. However, gold managed to keep its position anyway. As it seems, the present time is just the right moment for increasing the role of gold as the universal equivalent.
As a rule, the interest to gold as a way to save money grows little by little. However, the situation changes completely during a crisis or an economic disaster. Bank specialists say that the uneven growth of demand on gold occurs for the third time in Russia. The first time it happened after the crisis of 1998, then - in September of 2001. The third time takes place at present moment. Gold gets more expensive today. The majority of Russian experts think that the reason of such a sudden increase of demand on this precious metal is the same as it is with the growth of the euro rate. The subconscious distrust in dollar is finally finished with its quantity, turning to quality. Yet, according to experts- estimates, it is the rise of prices on gold, which makes a common consumer react. Common people think like this: if it becomes more expensive, this means that a lot of people need it, so why not joining them? On the other hand, it stands the reason that it is a lot better to buy something when prices go down, not up. If something becomes more and more expensive, it is the best time to start selling it.
Any Russian person can come to a bank and buy some gold there. Banks sell gold in the shape of bars and coins. It is the Russian Central Bank that produces gold coins. There are two kinds of those coins: investment and collectible coins.
Investment coins are not taxed with value-added tax at their purchase, which makes them rather attractive to buyers. It is possible to acquire them in banks, paying the price of metal, as well as the commission fee of up to five percent. If prices go up, one may sell those coins. Sometimes gold prices might experience the fluctuation of ten or fifteen percent within a weekend. However, gold prices might fall and grow rather considerably at times. Gold prices have been growing since 2001 v from $250 to $375 per troy ounce. Advanced ?investors¦ had a good opportunity to gain a lot of profit with the help of that fluctuation. On the other hand, those people, who purchased some gold at the price of $370 per ounce, were deprived of any profit at the moment. They are forced to hold their investments at the moment, hoping that gold might get more expensive in the future.
However, if someone does not like the idea of being worried over exchange fluctuations, it would be better to choose collectible gold coins. Unfortunately, they are taxed with value added tax, although their price grows with time, covering taxation costs. Yet, one should be a good specialists of collectible gold coins. It is possible to buy the goods of low liquidity, which will inevitably cause a lot of troubles in the future. Only two or three banks work with collectible coins. Selling those coins to onsellers or numismatists can be rather risky.
Russian Federation Central Bank specialists say that the most popular series of collectible gold coins is Zodiac Signs. The Central Bank is going to increase the output of those coins next year. In addition to that, coins are expected to become 2.5 times larger (they are rather small at the moment). One gold coin of Zodiac Signs series costs 1300 rubles, which is equal to the sum of $40. To crown it all, the Central Bank has something unique to offer as well. There is a unique gold coin, for example, which weighs one kilogram. The coin was issued to commemorate the 300th anniversary of St.Petersburg.
If Russian people do not believe in the all-mighty dollar anymore, if it is too late to buy euros, it is possible to buy some gold. This would be a nice, even a beautiful thing to do. Furthermore, it is possible to convert gold in rubles easily. More importantly, every sold gold coin will help the Central Bank to increase the Russian gold reserve, which has been hidden by Russian authorities in American and European banks right in the middle of another coming global economic crisis.
---
How Russian Gold Reserve Was Plundered
Investigation of embezzlement of 786 tons of gold lasts for half a year already. Russian Prosecutor-s Office already found the planes, countries and banks where the gold was delivered. The Soviet Union exported large oil supplies, earnings were exchanged for gold and never got back to the country; fourteen billion of dollars still remain unclaimed in Belgium. We know that so-called ?shadow flows¦ at the rate of 20 billion dollars leave the country every year. However, no measures are taken to stop such crimes.
I know lots of detective stories, one of them concerns Russian Duma faction Yabloko. In accordance with the agreement on differentiation of authorities between Russia and the republic of Tatarstan of 1992, enormous oil supplies left Tatarstan. As a repay, 200 computers were sent to Tatarstan, but they never arrived to the republic. Yabloko leader Grigory Yavlinsky preferred to hide for a month because of fear when the computers were stolen. In connection with this case and other facts, I can mention the assassination of Duma deputy Galina Starovoitova. Investigation of the crime is allegedly currently carried out, I also go to interrogations. But in fact, no measures are taken against the officials.
Let-s take Yegor Gaidar. It was he who was the author of the Chechen aviso made on 4 trillion rubles; this money was scattered about the country and sent to Siberia. Gold of the party and partially gold of artels was withdrawn from the country. The artels retained all gold within three years as the country experienced severe inflation, and gold always remained gold. But the gold was taken abroad, away from the country. However, Yegor Gaidar wasn-t brought into criminal account for such actions. Prosecutors are afraid to ask him questions concerning the case.
As for the money, it was used for privatization in the country. Those Supreme Council deputies who knew about the money, Vladimir Golovlev and Lezhnev are dead; Golovlev was assassinated in August this year. Investigator who carried out interrogations concerning gold of the party was killed at the same time.
Large supplies of oil, gold stolen from Magadan, Yakutia, Khabarovsk and silver from Russia-s Far East were withdrawn from the country; high-ranking officials such as Ministers for Internal Affairs Viktor Yerin, Andrey Dunayev, Anatoly Kulikov, Vladimir Rushailo were perfectly aware of the gold outflow. As a result of the criminal activity, 500 tons of gold were withdrawn from Russia, but no measures were taken in connection with the crime.
Finally, proceedings were instituted in connection with the gold withdrawing from the country; the investigation identified names of the pilots who removed the gold and the company involved into the operation. Two Il-76 planes removed gold to Latin America, Australia, Romania, England, Germany in batches of 40 or 15 tons within three years. The investigation already knows the banks and the countries where the gold is; certificates were written out for Belgium-s basic bank, Belgium Credit. Those people who were involved into the crime are already known; Vladislav Reznik from Unity faction was among them. Yegor Gaidar was also involved into withdrawal of Soviet gold. I am currently member of the Duma commission for corruption, that is why I-m not afraid to mention the facts.
I worked in the council on land reform under vice-president Alexander Rutskoy; being completely unaware of the whole of the situation, I concluded agreements with 88 gold artels of the Russian Federation. I was offered a preferential loan of the Central Bank. I distributed 1 trillion rubles in the prices of 1992 between the gold artels. The gold passed through my accounts. It was at the beginning of 1993, and inflation increased 300 times in 1995. In fact, the gold was laundered through me.
There was also the infamous case ?Urozhai¦, Vice-premier Gennady Kulik and other officials were involved in the case. The money was once again accumulated on my accounts. I was taken to prison in 1993; and in 1994-1995 the gold was removed from the country to the banks in Romania, England, Latin America. Certificates were written out to the bank Belgium-Credit. Now, I cannot make anyone bring the money back to Russia. Although I managed to prove everything, a special investigation group was created; several witnesses concerned with the gold case and one investigator are already killed. But the group is working on the case; special inquiries were sent to all banks. Some people were shocked when they learnt everything, and some still keep silent.
Everybody understands that a political will and a political order are necessary to bring everything back. But there is no will. And those who organized those gold deliveries are currently high-ranking officials, which certainly means that their names should be concealed.
Money obtained in that criminal gold operations were spent on construction of Moscow-s trading center Okhotny Ryad, of Slavyanskaya Hotel; this money is spent on financing of the Chechen war. The same financial schemes were used for privatization of state property objects.
The government and the Duma legislation committee know about the problem and admit its importance. However, no solutions of the problem are found yet. That is why I offer to pass a law that will probably allow to bring the withdrawn gold back to Russia and punish those who are guilty of the crime. The stolen resources belong to the Russian people. I don-t deny my guilt of the crime, as I compiled documents used for the gold withdrawal. Those who feel brave enough, must support the law I-m speaking about.
Sergey Shashurin
Member of the People-s Deputy group and
State Duma commission for struggle against corruption
The above mentioned text is the deputy-s speech at the Duma plenary session in November 2002
The legislation suggested by Sergey Shashurin was supported by 207 deputies (226 are required).
Translated by Maria Gousseva
@Konradi
Die Indizien verdichten sich!
Gruss
ThaiGuru
Die Indizien verdichten sich!
Gruss
ThaiGuru
.
Hedged gold stocks achieve the unthinkable
Tim Wood
NEW YORK -- Conventional gold investing wisdom says that companies that hedge production in a rising gold price environment are guaranteed losers because they lack leverage. Not so one year after gold’s own dot.com experience.
The gold price gained $59 an ounce to just more than $326 in the year to end May 2002, at which point the rally in gold securities was well into its moon shot before scalpers and momentum traders took profits – apparently for good.
At that point conventional wisdom was working. Unhedged gold stocks had, on average, double the gains of their hedged rivals. However, the unseen consequences of a higher gold price – stronger commodity currencies and higher costs for example – have conspired to overturn conventional wisdom this year and allow the hedged producers to make a come back. This is despite gold adding a further $35 dollars an ounce in the past year.
On a weighted basis, the clutch of unhedged producers has dropped a quarter of its value against a one-fifth increase in the gold price. The hedged producers boast a more moderate loss of just 3%.

Exuberance and a reluctance to properly understand a weaker dollar’s reciprocal effects leaves some pundits to explain how excoriated Barrick [ABX] and Placer Dome [PDG] are only slightly worse off than Gold Fields [GFI] and Harmony [HMY] one year down the track. True, the two year performance is not pretty for the hedgers, but going out ten years returns the favour to them.
Those who would defend the unhedged group as having suffered a series of unlucky breaks may have a case, but it begs the question why they were more prone to problems.
It cannot be escaped that the most popular (populist?) gold investment punditry got it wrong over the past year, especially by predicting massive systemic failures produced by hedge books falling prey to gold prices above $300 an ounce; then a revised $330 an ounce; and then the further revised $350 an ounce. Now the apocalypse apparently lies in wait at $400. Betting on that and a contingent short-covering scramble is, on current evidence, a rather poor strategy.
Focus on quality
Gold stock investors have to be concerned that the peer group’s value has declined in the same period that gold has increased by a fifth. Indeed, very few stocks have outperformed gold yet they are supposed to be leveraged to it. Does the unexpected ascendancy of hedged stocks herald something altogether more gloomy; something akin to the way stocks discounted gold’s chase to $390 an ounce in early February?
What we can be sure of is that those vertiginous valuations of May-June 2002 appear to be a once-a-decade event.
To illustrate how overbought stocks were at the time, consider that it would have required a little over 7,000 tonnes of fine gold to buy every gold and silver focused public company in the world, a sum of around $74 billion. At this April’s roughly equivalent gold price, you needed just over 6,000 tonnes of gold to buy the group that was worth $63 billion.
Since gold crossed the $300 per ounce line, the trailing twelve month average value of global gold stocks has been just shy of 5,900 tonnes, up from a little over 5,000 tonnes in the corresponding period 2001-2. It is evidently going to take a massive jump in the gold price before we get anywhere near where the ebullience took us in the middle of 2002.

A lot of that has to do with producer profligacy. By our figures shares in issue have increased by nearly two fifths since last year. Put another way, producers are clearly more cautious than their investors. Hence, they cranked the printing presses to get stock certificates into the market quickly and, astutely, at the very best valuations. Clearly, insiders remain the most reliable indicators and this is backed up by the general pattern of insider sales through 2002 and into 2003.
The issuances were necessary in most cases to prop up ailing balance sheets, but it can be expected that investors will stop offering their wallets for more infusions – the flow has to be reversed in the year ahead if the industry is to establish itself as a credible, mainstream competitor. The correlation between issuances and fattened cash balances needs to be translated into true wealth generation rather than the historic norm of consuming it and then asking for more.
The net effect has been that industry margins per ounce of gold produced are largely unchanged from 2002 and only slightly better than in 2001 even. Free cash flow is stagnant and earnings are little better when you account for the dominance of a thimbleful of companies. On a per share basis the metrics are hideous; dilution, dilution, dilution from an industry that enjoys castigating US money supply.
The industry can no longer afford to fritter away higher gold prices with runaway costs and operational failures. The fact that this has happened – just look at cash costs deteriorating by a quarter among the leading companies whilst net margins per ounce are stagnant – suggests several problems.
Firstly, it is apparent now that many mines were being run a long way below their true replacement cost per ounce. It was and remains management’s prerogative to do that, but why have investors not properly understood the implications coming into the gold price rally? Those who bought at the top of the market in 2002 are also wondering why no doubt.
Second, recent results are highly suggestive of diminishing expertise so more consolidation is essential; helpful also to control costs and reform the industry into a price maker rather than taker.
Third, support for marginal operations has got to end. The industry has yet to demonstrate that it can move beyond a growth paradigm defined by increasing ounces of production rather than shareholder returns. Neither the banks nor producers will turn down marginal operations if there is the slimmest chance of grabbing some early cash flow; only shareholders can do it. And so they should because the medium to long-term record on marginal operators almost exclusively favours insiders.
Fourth, hedging should not be demonised. Had more extensive and smarter currency and fuel hedging, for example, been in place producers would not now be in the situation of exchanging increases in the gold price for increases in operating costs. What good is “real money” when it is not the currency of your suppliers and contractors?
When it comes to hedging the metal please note the following chart which shows that for the first time in two decades spot deferred prices have fallen below the average fixing price. Consequently, the current trend to reduce hedged ounces would appear to be correct for as long as interest rates continue to plumb historic lows. However, think about 20 years of foregone profits had hedging not been used as it should be.

There will come a day when the present trend reverses again and producers need to have a strategy in place to build hedges against future problems. The palladium market offers sufficient instruction on the perils of not being adequately hedged after a boom. Hedging is a fact of twenty first century corporate life and a sign of maturity.


MINEWEB 03.06.2003
Hedged gold stocks achieve the unthinkable
Tim Wood
NEW YORK -- Conventional gold investing wisdom says that companies that hedge production in a rising gold price environment are guaranteed losers because they lack leverage. Not so one year after gold’s own dot.com experience.
The gold price gained $59 an ounce to just more than $326 in the year to end May 2002, at which point the rally in gold securities was well into its moon shot before scalpers and momentum traders took profits – apparently for good.
At that point conventional wisdom was working. Unhedged gold stocks had, on average, double the gains of their hedged rivals. However, the unseen consequences of a higher gold price – stronger commodity currencies and higher costs for example – have conspired to overturn conventional wisdom this year and allow the hedged producers to make a come back. This is despite gold adding a further $35 dollars an ounce in the past year.
On a weighted basis, the clutch of unhedged producers has dropped a quarter of its value against a one-fifth increase in the gold price. The hedged producers boast a more moderate loss of just 3%.
Exuberance and a reluctance to properly understand a weaker dollar’s reciprocal effects leaves some pundits to explain how excoriated Barrick [ABX] and Placer Dome [PDG] are only slightly worse off than Gold Fields [GFI] and Harmony [HMY] one year down the track. True, the two year performance is not pretty for the hedgers, but going out ten years returns the favour to them.
Those who would defend the unhedged group as having suffered a series of unlucky breaks may have a case, but it begs the question why they were more prone to problems.
It cannot be escaped that the most popular (populist?) gold investment punditry got it wrong over the past year, especially by predicting massive systemic failures produced by hedge books falling prey to gold prices above $300 an ounce; then a revised $330 an ounce; and then the further revised $350 an ounce. Now the apocalypse apparently lies in wait at $400. Betting on that and a contingent short-covering scramble is, on current evidence, a rather poor strategy.
Focus on quality
Gold stock investors have to be concerned that the peer group’s value has declined in the same period that gold has increased by a fifth. Indeed, very few stocks have outperformed gold yet they are supposed to be leveraged to it. Does the unexpected ascendancy of hedged stocks herald something altogether more gloomy; something akin to the way stocks discounted gold’s chase to $390 an ounce in early February?
What we can be sure of is that those vertiginous valuations of May-June 2002 appear to be a once-a-decade event.
To illustrate how overbought stocks were at the time, consider that it would have required a little over 7,000 tonnes of fine gold to buy every gold and silver focused public company in the world, a sum of around $74 billion. At this April’s roughly equivalent gold price, you needed just over 6,000 tonnes of gold to buy the group that was worth $63 billion.
Since gold crossed the $300 per ounce line, the trailing twelve month average value of global gold stocks has been just shy of 5,900 tonnes, up from a little over 5,000 tonnes in the corresponding period 2001-2. It is evidently going to take a massive jump in the gold price before we get anywhere near where the ebullience took us in the middle of 2002.
A lot of that has to do with producer profligacy. By our figures shares in issue have increased by nearly two fifths since last year. Put another way, producers are clearly more cautious than their investors. Hence, they cranked the printing presses to get stock certificates into the market quickly and, astutely, at the very best valuations. Clearly, insiders remain the most reliable indicators and this is backed up by the general pattern of insider sales through 2002 and into 2003.
The issuances were necessary in most cases to prop up ailing balance sheets, but it can be expected that investors will stop offering their wallets for more infusions – the flow has to be reversed in the year ahead if the industry is to establish itself as a credible, mainstream competitor. The correlation between issuances and fattened cash balances needs to be translated into true wealth generation rather than the historic norm of consuming it and then asking for more.
The net effect has been that industry margins per ounce of gold produced are largely unchanged from 2002 and only slightly better than in 2001 even. Free cash flow is stagnant and earnings are little better when you account for the dominance of a thimbleful of companies. On a per share basis the metrics are hideous; dilution, dilution, dilution from an industry that enjoys castigating US money supply.
The industry can no longer afford to fritter away higher gold prices with runaway costs and operational failures. The fact that this has happened – just look at cash costs deteriorating by a quarter among the leading companies whilst net margins per ounce are stagnant – suggests several problems.
Firstly, it is apparent now that many mines were being run a long way below their true replacement cost per ounce. It was and remains management’s prerogative to do that, but why have investors not properly understood the implications coming into the gold price rally? Those who bought at the top of the market in 2002 are also wondering why no doubt.
Second, recent results are highly suggestive of diminishing expertise so more consolidation is essential; helpful also to control costs and reform the industry into a price maker rather than taker.
Third, support for marginal operations has got to end. The industry has yet to demonstrate that it can move beyond a growth paradigm defined by increasing ounces of production rather than shareholder returns. Neither the banks nor producers will turn down marginal operations if there is the slimmest chance of grabbing some early cash flow; only shareholders can do it. And so they should because the medium to long-term record on marginal operators almost exclusively favours insiders.
Fourth, hedging should not be demonised. Had more extensive and smarter currency and fuel hedging, for example, been in place producers would not now be in the situation of exchanging increases in the gold price for increases in operating costs. What good is “real money” when it is not the currency of your suppliers and contractors?
When it comes to hedging the metal please note the following chart which shows that for the first time in two decades spot deferred prices have fallen below the average fixing price. Consequently, the current trend to reduce hedged ounces would appear to be correct for as long as interest rates continue to plumb historic lows. However, think about 20 years of foregone profits had hedging not been used as it should be.
There will come a day when the present trend reverses again and producers need to have a strategy in place to build hedges against future problems. The palladium market offers sufficient instruction on the perils of not being adequately hedged after a boom. Hedging is a fact of twenty first century corporate life and a sign of maturity.
MINEWEB 03.06.2003
Da ihr hier so nette Artikel reinstellt, hier ist auch so eine miese Idee:
Wie erreicht man eine gerechte Weltordnung?
In seiner Grundsatzrede auf der Konferenz in Bangalore präsentierte Lyndon LAROUCHE eine mutige Analyse der Lage in den Vereinigten Staaten und international. Er beschriebseine anfängliche Einschätzung der Regierung Bush im Januar 2001, die sich „leider voll bestätigt hat“. Damals habeer als Parallele auf die Ereignisse in Deutschland zwischen 1928-33 hingewiesen, als sich die „Welt ebenfalls in einer internationalen,systemischen Krise befand“. Heute, sagte La-Rouche, „stehen wir vor der gleichen Bedrohung. Am 11.9.2001 erlebten die USA ihren ,Reichstagsbrand’.“ Vizepräsi-dent Dick CHENEY habe die Macht ursupiert und seine aggressivimperiale Politik einem Präsidenten aufgezwungen, der „praktisch eine Marionette geworden“ sei. Die USA seien „ein Präsidialsystem, in dem die Exekutiv-macht der Regierung und der Nation im Präsidentenamtliegt.“ Der Kongreß habe das Recht, zu beraten und zuzu-stimmen, aber mit dem Zusammenbruch der Demokrati-schen Partei gebe es derzeit „keine wirksame Opposition“. Die Gruppe um Cheney und Rumsfeld hätten den „verfassungswidrigen, illegalen und unmoralischen“ Krieg gegen den Irak als Beginn eines weitergehenden Kriegskurses
durchgeführt, der sich letztlich gegen China richte. Seine Mitarbeiter und er, so LaRouche weiter, „haben uns für Ver-
änderungen eingesetzt. Wir hatten keinen Erfolg. Aber wir konnten die Sache immerhin hinauszögern. Die Welt muß
jetzt die entsprechenden Lehren daraus ziehen“. LaRouche verwies auf den von ihm mitverfaßten Bericht, in dem die
Ideologie von Leo Strauss und der Synarchistenkreise, aus der die Fraktion um Cheney und Rumsfeld sich rekrutiert
hat. Dieser Bericht wird derzeit weltweit verbreitet und wurde inhaltlich von führenden amerikanischen und eu-ropäischen
Medien aufgegriffen. Jetzt sei gegen Rumsfeld und Cheney ein Prozeß wie bei „Watergate“ in Gang gekommen,
sagte er.
Aber eine Lösung der Krise erfordere noch mehr: „Man muß die Wurzeln der Krankheit angehen ... ein Finanzsy-stem,
das in seinem Kern parasitär, unmoralisch und bankrott ist ... Wir müssen jetzt das erreichen, für das wir schon
im August 1976 in Colombo auf Sri Lanka gekämpft haben. Wir müssen den Geist [der Blockfreienbewegung] von Ban-dung
wiederbeleben... Wir müssen die gemeinsamen Bemühungen für eine GERECHTE NEUE WELTWIRT-SCHAFTSORDNUNG
wieder aufgreifen — und zwar jetzt.“ Um Eurasien, „den zentralen Teil der Menschheit“, zu ent-wickeln,
benötige man Infrastruktur, Technologie und die „Orientierung an einer Mission“. Die Welt, so LaRouche, brauche einen „positiven universellen Frieden“. In seiner Eröffnungsansprache ging Natwar SINGH auf die historische Bedeutung der Vereinten Nationen ein, nachdem „das Scheitern der westlichen Diplomatie“ zu den verheerenden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts geführt habe. Aber heute hätten die USA, die soviel zur Errichtung der UNO beigetragen haben, die UNO umgangen und ver-unglimpft. Nach dem Irakkrieg befinde man sich wieder in der gleichen Situation, die im 19. Jahrhundert vorherrsch-te: Imperiale Mächte drängen in verschiedene Teile Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und zwingen ihren Willen auf. Er fuhr fort: „Die beste Chance zur Beilegung oder Verhin-derung internationaler Streitigkeiten ist eine Stärkung der UNO... Eine unipolare Welt in eine multipolare zu verwan-deln, kann nur durch guten Willen, Verständnis, gegensei-tiges Vertrauen und nicht auf dem Wege der Konfrontation erreicht werden.“
Reaktionen auf LaRouches Warnung vor einem „wirtschaftlichen 11. September“
Wie wir im Washington Insider (23/2003)berichteten, hatte LaRouche gewarnt, einflußreiche finanzielle und politische Interessen, die über Persönlichkeiten im Umfeld und innerhalb der Regierung Bush agierten, könnten einen „WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLEN 11. SEPTEMBER“ auslösen, um Panik zu verbreiten, einen Zusammenbruch des weltweiten Finanz- und Bankensystems herbeizuführen und so die Bedingungen für die Durchsetzung einer faschi-stischen, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zu schaffen. Am 30.5. erhielt Strategic Alert die folgenden ersten Reaktionen auf LaRouches Warnung: • Ein führender Finanzanalyst der City of London erklärte: „LaRouche hat mit dieser Warnung eine interessante Idee vorgebracht. Nichts von dem, was die Regierung Bush derzeit wirtschaftspolitisch unternimmt, schließt so etwas aus. Es ist sogar plausibel, ihre Maßnahmen so zu werten. Würde man dort an so etwas arbeiten, wäre es — wie da-mals in Deutschland vor Hitlers Machtergreifung — sehr wahrscheinlich, daß man die öffentlichen Finanzen zugrunde richtet, in dem man das Vertrauen in Regierungswertpapiere untergräbt und damit eine derartige Krise hervorruft, daß sich drastische Maßnahmen durchsetzen lassen. Dazu könnte es hilfreich sein, wenn eine größere Bank am Rande des Zusammenbruchs stünde... Das würde einen ziemlichen Schock auslösen.“ • Eine weitere Reaktion stammt ebenfalls aus London, von einem führenden Manager eines Investmentfonds, dessen Ansichten über die weltweite Finanzdesintegration sich in letzter Zeit immer mehr LaRouches Auffassung an-genähert haben. Er sagte: „LaRouches Gedanke ist faszi-nierend. In den USA machen heute bestimmt eine Menge sehr seltsamer Politiker und andere mit seltsamen politischen Ideen die Gegend unsicher. Ich glaube nicht, daß Bush selbst oder auch GREENSPAN so etwas täten, aber andere wären dazu bereit. Was die Regierung Bush tut, ist äußerst paradox... Sie wollen mit allen Mitteln einen massiven Wirtschaftskollaps vor den Wahlen 2004 vermeiden...und das wird möglicherweise genau die Krise auslösen, die sie eigentlich vermeiden wollen. Aber ob dies auch in die Di-mensionen führt, die LaRouche anspricht, kann ich nicht beurteilen.“
Gruß Mawerick
Wie erreicht man eine gerechte Weltordnung?
In seiner Grundsatzrede auf der Konferenz in Bangalore präsentierte Lyndon LAROUCHE eine mutige Analyse der Lage in den Vereinigten Staaten und international. Er beschriebseine anfängliche Einschätzung der Regierung Bush im Januar 2001, die sich „leider voll bestätigt hat“. Damals habeer als Parallele auf die Ereignisse in Deutschland zwischen 1928-33 hingewiesen, als sich die „Welt ebenfalls in einer internationalen,systemischen Krise befand“. Heute, sagte La-Rouche, „stehen wir vor der gleichen Bedrohung. Am 11.9.2001 erlebten die USA ihren ,Reichstagsbrand’.“ Vizepräsi-dent Dick CHENEY habe die Macht ursupiert und seine aggressivimperiale Politik einem Präsidenten aufgezwungen, der „praktisch eine Marionette geworden“ sei. Die USA seien „ein Präsidialsystem, in dem die Exekutiv-macht der Regierung und der Nation im Präsidentenamtliegt.“ Der Kongreß habe das Recht, zu beraten und zuzu-stimmen, aber mit dem Zusammenbruch der Demokrati-schen Partei gebe es derzeit „keine wirksame Opposition“. Die Gruppe um Cheney und Rumsfeld hätten den „verfassungswidrigen, illegalen und unmoralischen“ Krieg gegen den Irak als Beginn eines weitergehenden Kriegskurses
durchgeführt, der sich letztlich gegen China richte. Seine Mitarbeiter und er, so LaRouche weiter, „haben uns für Ver-
änderungen eingesetzt. Wir hatten keinen Erfolg. Aber wir konnten die Sache immerhin hinauszögern. Die Welt muß
jetzt die entsprechenden Lehren daraus ziehen“. LaRouche verwies auf den von ihm mitverfaßten Bericht, in dem die
Ideologie von Leo Strauss und der Synarchistenkreise, aus der die Fraktion um Cheney und Rumsfeld sich rekrutiert
hat. Dieser Bericht wird derzeit weltweit verbreitet und wurde inhaltlich von führenden amerikanischen und eu-ropäischen
Medien aufgegriffen. Jetzt sei gegen Rumsfeld und Cheney ein Prozeß wie bei „Watergate“ in Gang gekommen,
sagte er.
Aber eine Lösung der Krise erfordere noch mehr: „Man muß die Wurzeln der Krankheit angehen ... ein Finanzsy-stem,
das in seinem Kern parasitär, unmoralisch und bankrott ist ... Wir müssen jetzt das erreichen, für das wir schon
im August 1976 in Colombo auf Sri Lanka gekämpft haben. Wir müssen den Geist [der Blockfreienbewegung] von Ban-dung
wiederbeleben... Wir müssen die gemeinsamen Bemühungen für eine GERECHTE NEUE WELTWIRT-SCHAFTSORDNUNG
wieder aufgreifen — und zwar jetzt.“ Um Eurasien, „den zentralen Teil der Menschheit“, zu ent-wickeln,
benötige man Infrastruktur, Technologie und die „Orientierung an einer Mission“. Die Welt, so LaRouche, brauche einen „positiven universellen Frieden“. In seiner Eröffnungsansprache ging Natwar SINGH auf die historische Bedeutung der Vereinten Nationen ein, nachdem „das Scheitern der westlichen Diplomatie“ zu den verheerenden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts geführt habe. Aber heute hätten die USA, die soviel zur Errichtung der UNO beigetragen haben, die UNO umgangen und ver-unglimpft. Nach dem Irakkrieg befinde man sich wieder in der gleichen Situation, die im 19. Jahrhundert vorherrsch-te: Imperiale Mächte drängen in verschiedene Teile Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und zwingen ihren Willen auf. Er fuhr fort: „Die beste Chance zur Beilegung oder Verhin-derung internationaler Streitigkeiten ist eine Stärkung der UNO... Eine unipolare Welt in eine multipolare zu verwan-deln, kann nur durch guten Willen, Verständnis, gegensei-tiges Vertrauen und nicht auf dem Wege der Konfrontation erreicht werden.“
Reaktionen auf LaRouches Warnung vor einem „wirtschaftlichen 11. September“
Wie wir im Washington Insider (23/2003)berichteten, hatte LaRouche gewarnt, einflußreiche finanzielle und politische Interessen, die über Persönlichkeiten im Umfeld und innerhalb der Regierung Bush agierten, könnten einen „WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLEN 11. SEPTEMBER“ auslösen, um Panik zu verbreiten, einen Zusammenbruch des weltweiten Finanz- und Bankensystems herbeizuführen und so die Bedingungen für die Durchsetzung einer faschi-stischen, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zu schaffen. Am 30.5. erhielt Strategic Alert die folgenden ersten Reaktionen auf LaRouches Warnung: • Ein führender Finanzanalyst der City of London erklärte: „LaRouche hat mit dieser Warnung eine interessante Idee vorgebracht. Nichts von dem, was die Regierung Bush derzeit wirtschaftspolitisch unternimmt, schließt so etwas aus. Es ist sogar plausibel, ihre Maßnahmen so zu werten. Würde man dort an so etwas arbeiten, wäre es — wie da-mals in Deutschland vor Hitlers Machtergreifung — sehr wahrscheinlich, daß man die öffentlichen Finanzen zugrunde richtet, in dem man das Vertrauen in Regierungswertpapiere untergräbt und damit eine derartige Krise hervorruft, daß sich drastische Maßnahmen durchsetzen lassen. Dazu könnte es hilfreich sein, wenn eine größere Bank am Rande des Zusammenbruchs stünde... Das würde einen ziemlichen Schock auslösen.“ • Eine weitere Reaktion stammt ebenfalls aus London, von einem führenden Manager eines Investmentfonds, dessen Ansichten über die weltweite Finanzdesintegration sich in letzter Zeit immer mehr LaRouches Auffassung an-genähert haben. Er sagte: „LaRouches Gedanke ist faszi-nierend. In den USA machen heute bestimmt eine Menge sehr seltsamer Politiker und andere mit seltsamen politischen Ideen die Gegend unsicher. Ich glaube nicht, daß Bush selbst oder auch GREENSPAN so etwas täten, aber andere wären dazu bereit. Was die Regierung Bush tut, ist äußerst paradox... Sie wollen mit allen Mitteln einen massiven Wirtschaftskollaps vor den Wahlen 2004 vermeiden...und das wird möglicherweise genau die Krise auslösen, die sie eigentlich vermeiden wollen. Aber ob dies auch in die Di-mensionen führt, die LaRouche anspricht, kann ich nicht beurteilen.“
Gruß Mawerick

.
Post von Goldman Sachs:
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
vielen Dank für die Einladung zur öffentlichen Anhörung zum Finanzplatz Deutschland am 4. Juni 2003 in Berlin. Hiermit senden wir Ihnen unsere schriftliche Stellungnahme zu den Anträgen der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Fraktion der CDU/CSU sowie der Fraktion der FDP zum Finanzplatz Deutschland (Drucksachen 15/930, 15/748, 16/369). Wir tun dies aus der Sicht einer internationalen Bank mit einer starken Bindung zu Deutschland und zum Standort Frankfurt.
Für Goldman Sachs stellt die Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer zentralen Stellung im europäischen Binnenmarkt mit mehr als 82 Millionen Konsumenten als zweitstärkste Exportnation der Welt den neben China weltweit wichtigsten Wachstumsmarkt für Finanzdienstleistungen außerhalb der USA dar. Dies begründet unseren eigenen strategischen Fokus auf Deutschland, reflektiert aber auch die Chancen und Zukunftsperspektiven für den hiesigen Finanzsektor insgesamt.
Wie von allen Fraktionen betont wird, sollte die Debatte über den Finanzplatz Deutschland im volkswirtschaftlichen Kontext geführt werden. Der Finanzsektor ist stärker von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig als andere Sektoren der deutschen Volkswirtschaft. Zudem kommt dem Finanzsektor eine wesentliche Rolle bei der Gesundung der heimischen Wirtschaft zu. Deshalb gilt gerade für die Attraktivität Deutschlands als Finanzplatz, dass Märkte und Standorte keine Erbhöfe sind.
Im Zuge der Globalisierung formiert sich der Finanzsektor ständig neu. Ein Finanzplatz muss seine Position stetig dynamisch fortentwickeln; Infrastruktur, Rahmenbedingungen und Regelwerke müssen auch im Wettbewerb mit anderen Finanzplätzen auf ihre Konkurrenzfähigkeit überprüft werden, um einfallsreiche, innovative und qualifizierte Menschen anzuziehen.
Die strukturellen Schwächen werden offensichtlicher
Der deutsche Finanzsektor wie die deutsche Wirtschaft insgesamt leiden seit längerem unter strukturellen Schwächen, die mit der weltweiten Korrektur an den Aktienmärkten wieder offensichtlicher geworden sind. Im Zentrum der strukturellen Schwächen stehen der demographische Wandel, der Arbeitsmarkt, die Sozialversicherungssysteme, das Steuersystem sowie die Tendenz zur Überregulierung und Bürokratisierung unternehmerischer Prozesse. Alle diese Themenkomplexe sind umfassend in den volkswirtschaftlichen Analysen der OECD, der Bundesbank und der Wirtschaftsforschungsinstitute beschrieben.
Die Bundesbank hat in ihrem im März diesen Jahres veröffentlichten Papier "Wege aus der Krise" darauf hingewiesen, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Vertrauens- und Wachstumskrise befindet: "Das Vertrauen lässt sich nur zurückgewinnen, wenn die Wirtschaftspolitik verlässliche, d.h. für den Planungshorizont der Unternehmen und privaten Haushalte bestandsfeste Rahmenbedingungen setzt." (Deutsche Bundesbank, Wege aus der Krise - Wirtschaftspolitische Denkanstöße für Deutschland, März 2003, S. 5). Dies gilt in besonderem Maße für den Finanzsektor.
Kapitalströme schaffen sich ihre eigenen Bahnen
Die Globalisierung hat zum Zusammenbruch nationaler Schutzräume geführt. Da, wo Gesetzgeber versuchen, diese zu erhalten, anstatt konsequent auf supranationale (im Falle Deutschlands insbesondere europäische) Regelungen zu setzen, schaffen sich Kapitalströme ihre eigenen Bahnen. Die Gestaltung des allgemeinen wirtschaftspolitischen Rahmens und der Finanzmarktordnung liegt in der Verantwortung der Politik, damit Frankfurt der wichtigste kontinentaleuropäische Finanzplatz bleibt, und nicht hinter Paris, Zürich und Luxemburg zurückfällt.
Deshalb ist es zu begrüßen, dass alle Fraktionen des Deutschen Bundestages in ihren Anträgen an der Kontinuität der früheren Finanzmarktförderungsgesetze festhalten und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes in den Vordergrund ihrer Anträge stellen.
These 1: Die Globalisierung der Finanzmärkte hat dazu geführt, dass Kapital weltweit nach Anlagemöglichkeiten sucht und Finanzdienstleistungen über nationale Grenzen hinweg angeboten werden können. Ziel nationaler Gesetzgebung kann es daher nur sein, die Wertschöpfungskette soweit als möglich im Land zu halten. Notwendige Maßnahmen zum Investorenschutz müssen europaweit abgestimmt sein.
Die Finanzdienstleistungsbranche ist die am weitesten globalisierte Industrie überhaupt, da die Dienstleistungsproduktion nicht an einen bestimmten Standort gebunden ist. Daher werden regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen in einem noch stärkeren Umfang als in anderen Sektoren zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor eines Finanzplatzes.
Wird dieser Zusammenhang nicht ausreichend berücksichtigt, führen fehlende oder relativ schlechtere Rahmenbedingungen zu einer Verlagerung von Angebot und Nachfrage und damit der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ins Ausland.
Deutschland darf nicht nur "Vertriebsstandort" bleiben
Plakativ gesprochen steht für den Gesetzgeber zur Disposition, ob Deutschland bloßer "Vertriebsstandort" oder auch "Entwicklungs- und Produktionsstätte" von neuen, innovativen Finanzdienstleistungen mit hochqualifizierten Dienstleistungsarbeitsplätzen bleibt beziehungsweise in neuen Marktsegmenten wird. Hier sind zunächst die oben genannten allgemeinen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen entscheidend.
Unterstützung durch Gesetzgeber und regulierende Behörden ist aber auch nötig, um Finanzinnovationen in Frankfurt anzusiedeln. Angesichts der relativ kurzen Innovationszyklen auf dem internationalen Kapitalmarkt sind rechtliche Rahmenbedingungen erforderlich, die schnelle Entscheidungen ermöglichen und Rechtssicherheit bieten.
Praktisch handhabbare Richtlinien sind gefragt
Die Aufsicht muss daher praktisch handhabbare Richtlinien erstellen; ihre Beurteilung von Produktinnovationen muss verlässlich und transparent sein. Klare Kommunikation zwischen den Beteiligten (Behörden, Wirtschaftsprüfer und Finanzinstitute) hilft, Sicherheit und Transparenz im Umgang mit neuen Finanzprodukten zu schaffen.
Aufgrund der hohen Bedeutung von EU-Richtlinien für den europäischen Kapitalmarkt ist deren unverzügliche und vor allem marktöffnende Umsetzung in das deutsche Recht von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland in Europa. So können auch "First-Mover-Advantages" entstehen. Andernfalls droht eine weitere Abwanderung von Geschäft und Kapital.
Das Beispiel der Hedgefonds
Zudem behindert der bestehende rechtliche Rahmen einschließlich des deutschen Steuerrechts die Ansiedlung neuer Marktsegmente. Als Beispiel mag die bisherige Regulierung von Hedge Fonds in Deutschland dienen.

Hedge Fonds sind global anerkannte Marktteilnehmer, die seit über 50 Jahren an den Finanzmärkten agieren. Wegen der für Hedge Fonds geltenden prohibitiven Einschränkungen in Deutschland werden diese für deutsche Anleger vor allem aus der Schweiz und Großbritannien angeboten. Nach unseren Schätzungen sind gegenwärtig fast zehn Milliarden Euro deutscher Anleger in ausländische Hedge Fonds Produkte investiert. Dabei bleiben Risiken und Chancen der Anlage selbstverständlich weiterhin beim deutschen Investor.
Das Wachstum geht an Deutschland vorbei
Mit anderen Worten, die Schutzvorschriften haben nicht dazu geführt, dass deutsche Anleger diese Anlageform nicht genutzt haben; lediglich die Wertschöpfung ist ins Ausland verlagert worden. Demzufolge ist der Finanzplatz Deutschland nicht am hohen Wachstum der Hedge Fonds beteiligt.
Zur Verdeutlichung: Das weltweite Hedge Fonds Eigenkapital-Bestandsvolumen hat sich seit 1995 mehr als verdreifacht und betrug Ende 2002 mehr als 600 Milliarden US Dollar. Während in Großbritannien rund 400 Hedge Fonds (70 Prozent aller europäischen Hedge Fonds) angesiedelt sind, sind es in Deutschland nur insgesamt drei Fonds. Frankreich mit 39 Fonds und die Schweiz mit 36 Fonds folgen Großbritannien in der Rangfolge.
Das BaFin könnte Vertrauen schaffen
Um den deutschen Finanzmarkt für Hedge Fonds attraktiv zu machen, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen einschließlich der steuerlichen Behandlung das Auflegen von Hedge Fonds und das Investieren in Hedge Fonds unterstützen. Dabei würde eine Regulierung durch die BaFin mit einem einfachen und schnellen Zulassungsverfahren wahrscheinlich das Vertrauen der Investoren und Hedge Fonds Manager stärken, was zunehmende Investitionen in diese Vermögensklasse am Finanzplatz Deutschland zur Folge haben könnte.
Die Nachteile gegenüber dem Finanzplatz London
Um mit etablierten Hedge Fonds Standorten bezüglich der Anziehung von Hedge Fonds Managern und Investoren konkurrieren zu können, ist es wichtig, dass die Gesetzgebung in Deutschland im Einklang mit globalen Praktiken steht und inländischen Hedge Fonds und Investoren keine unnötigen Restriktionen auferlegt werden. Der Verlust von Entwicklung und Produktion von Finanzdienstleistungen an London, insbesondere Emission, Handel und Analyse von Wertpapieren, Währungen und Derivaten über die letzten Jahre, ist kaum aufzuholen.
So wurde zum Beispiel durch die Einführung des Euro die Notwendigkeit, spezifisch deutsche Finanzdienstleistungen zu entwickeln, verringert, da nun in "Euroland" Finanzprodukte skalierbarer sind und dementsprechend kostengünstiger entwickelt werden können. Einfacher und kostengünstiger ist dies in London, wo die Steuern niedriger, die Regulierungen liberaler und das (in Finanzdienstleistungen geschulte) Humankapital reichlicher vorhanden sind. Steuersätze und Regulierungsdichte müssten also deutlich unter Londoner Niveaus gesenkt werden, um Nachteile hinsichtlich Infrastruktur, Sprache und Finanzmarktkultur auszugleichen.
Neue Rahmenbedinungen sind gefordert
Der Finanzplatz Frankfurt steht in direkter Konkurrenz mit anderen kontinentaleuropäischen Finanzplätzen wie Paris, Luxemburg oder Zürich, die sich zum Teil Marktnischen zumeist durch Steuer- und Regulierungsvorteile geschaffen haben. Dabei ist die relative Zahl der Beschäftigten im Finanzgewerbe auf diesen Plätzen vergleichbar mit der in Deutschland; Luxemburg liegt hier bekanntlich weit über dem Durchschnitt. So werden zum Beispiel internationale Anleihen deutscher Emittenten insbesondere aufgrund der Steuervorteile für Investoren und Emittenten fast ausschließlich über Luxemburg oder andere europäische Finanzplätze durchgeführt.
Im Unterschied zu diesen kontinentaleuropäischen Standorten ist Deutschland aber der wichtigste europäische Marktplatz für den Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Ziel der Politik sollte es daher sein, dieses auf der Nachfrageseite generierte Marktpotential durch Schaffung kapitalmarktfreundlicher Rahmenbedingungen für die Anbieter und Nachfrager dieser Finanzdienstleistungen auch für gesamtwirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung besser zu nutzen.
Der Erfolg der Deutsche Börse AG belegt, dass Innovationen und die konsequente Umsetzung zukunftsorientierter Strategien die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland erheblich steigern können.
These 2: Eine glaubwürdige und effektive Kapitalmarktaufsicht, hohe Markttransparenz und glaubwürdiger Anlegerschutz sind Voraussetzungen für die Überwindung der Vertrauenskrise am Kapitalmarkt.
Ein grundlegendes Problem, mit dem die Marktteilnehmer und die Kapitalmarktaufsichtsbehörden heute konfrontiert sind, ist die Wiederherstellung des Vertrauens der Anleger in die Integrität der Kapitalmärkte. Unternehmensskandale, der Umgang mit Interessenkonflikten und der rasante Kursverfall an den Aktienmärkten haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Die Anträge der Fraktionen belegen, dass die Bereitschaft zur Fortentwicklung des Finanzmarktes besteht und die wesentlichen Handlungsfelder identifiziert sind. Aus unserer Sicht sind dies insbesondere die folgenden vier Bereiche:
- die Weiterentwicklung der Kapitalmarktaufsicht,
- die Verantwortlichkeit von Abschlussprüfern gegenüber den Kapitalmärkten,
- eine Verbesserung der Qualität der Informationen, die dem Markt zur Verfügung gestellt werden und die Corporate Governance
Kapitalmarktaufsicht: Die Gründe für die Ineffizienz
Eine effektive Kapitalmarktaufsicht muss über ausreichende Ressourcen und Erfahrung verfügen, um Anlegerschutz gewährleisten zu können. Dies gilt sowohl bei der Begleitung von Wertpapieremissionen als auch der Überwachung des Handels und des Kapitalmarktes generell. Die Gründung der BaFin war in diesem Zusammenhang ein bedeutender Schritt; eine weitere Zusammenführung am Finanzplatz Frankfurt befürworten wir.
Gleichwohl bleibt das Aufsichtswesen für den Kapitalmarkt in Deutschland fragmentiert; es sollte vereinfacht, konzentriert und hinsichtlich der Ressourcen aufgestockt werden, um eine effiziente Beaufsichtigung sicherzustellen. Das Auseinanderfallen der Kompetenzen der BaFin, der Deutschen Bundesbank, der zuständigen Landesbehörden und der Handelsüberwachungsstellen bei der Beaufsichtigung der Finanzinstitute einerseits sowie der Marktüberwachung andererseits sind unübersichtlich, ineffizient und im Ausland schwer vermittelbar.
Mehr Personal und Schwerpunktstaatsanwaltschaft
In personeller Hinsicht werden zusätzliche erfahrene Prüfer benötigt, die eine sorgfältige materielle Prüfung der Unterlagen, die von Emittenten im Zusammenhang mit Kapitalaufnahmen offen gelegt werden, vornehmen können. Nur so kann gewährleistet werden, dass potenziellen Anlegern vollständige und ausgewogene Informationen für ihre Anlageentscheidungen zur Verfügung stehen. Die Aufsichtsbehörden sollten aber auch über entsprechende Befugnisse und Ressourcen verfügen, um die regelmäßig von Unternehmen veröffentlichten Informationen zu prüfen, damit die Anleger zeitnah qualitativ hochwertige Informationen erhalten.
Ohne eine glaubwürdige und effektive Durchsetzung bis hin zur Strafverfolgung laufen Kapitalmarktvorschriften leer. Dies ist nur dann zu erreichen, wenn diejenigen, die ihren Pflichten nicht nachkommen, identifiziert und entsprechende Maßnahmen gegen sie eingeleitet werden. Wir befürworten daher eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.
Abschlussprüfer müssen mehr Verantwortung tragen
In Deutschland sind Jahresabschlussprüfer in einem in anderen Ländern nicht bestehenden Maße vor Schadensersatzansprüchen von Aktionären geschützt. Namentlich in den USA und Großbritannien sind Abschlussprüfer unmittelbar den Aktionären gegenüber verantwortlich. In Deutschland beschränkt das HGB jedoch nicht nur die Verantwortung des Prüfers auf das geprüfte Unternehmen, sondern legt auch eine jedenfalls mit Bezug auf börsennotierte Unternehmen unverhältnismäßig niedrige Haftungsgrenze fest.
Die Wirtschaftsprüferkammern in den USA und Großbritannien treten am Kapitalmarkt aktiv in Erscheinung, um das Vertrauen in ihren Berufsstand und in die gleichbleibend hohe Qualität ihres Beitrags für den Kapitalmarkt zu fördern.
Wir halten es für erforderlich, die Wirtschaftsprüfer auch in Deutschland mehr in die Verantwortung zu nehmen, weil dies eine wichtige Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Qualität der von Unternehmen veröffentlichten Finanzinformationen bedeutet. Haftungsobergrenzen für Abschlussprüfer stehen diesem Ziel entgegen. Die durch den Wegfall von Haftungsgrenzen zusätzlich entstehenden Kosten der Wirtschaftsprüfung für die Unternehmen halten wir in Abwägung mit der hierdurch im Kapitalmarkt zusätzlich entstehenden Sicherheit für gerechtfertigt, zumal diese Kosten heute in Deutschland vergleichsweise niedrig sind.
Offenlegungsstandards: Der Unterschied ist erheblich
Die Verbesserung der Qualität sowie die Verfügbarkeit korrekter und klarer Informationen über börsennotierte Unternehmen muss in den Vordergrund gestellt werden. Dies gilt sowohl für regelmäßige Unternehmensbekanntmachungen (zum Beispiel Geschäftsberichte und Ad-hoc-Mitteilungen) als auch für Aktienanalysen. Gegenwärtig bestehen in der Praxis beträchtliche Unterschiede zwischen den Offenlegungsstandards von Unternehmen in Bezug auf Inhalte und Darstellung von Unternehmensberichten.
Die Einführung konkreter Offenlegungsvorschriften - so wie in der EU-Verordnung zur Transparenz für Geschäftsberichte und Zwischenberichte vorgesehen - wäre für die Aktionäre sehr förderlich. Auch die Einführung einer öffentlich zugänglichen Datenbank für Unternehmensinformationen wäre zu begrüßen. Anleger sollten besser in die Lage versetzt werden, die offen gelegten Informationen verschiedener Unternehmen zu vergleichen.
Integrität der Aktienanalysen erhöhen
Aktienanalysen und Berichte von Kreditbewertungsagenturen sind zwei weitere wichtige und unabhängige Informationsquellen. Aktienanalysen bieten eine eingehende Untersuchung und Bewertung von Unternehmen, die Unternehmensberichte nicht leisten können. Allerdings sind wir uns bewusst, dass das Vertrauen in Aktienanalysen auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Wir unterstützen deshalb nachdrücklich weitergehende Maßnahmen, um die Integrität von Aktienanalysen zu erhöhen, und befürworten eine internationale Zusammenarbeit zur Herstellung einer gemeinsamen europäischen Haltung.
Rating-Überwachung: Keine nationalen Alleingänge
Zudem ist die Zusammenarbeit mit den international anerkannten Kreditbewertungsagenturen für eine einheitliche und transparente Kreditbewertung für deutsche Emittenten sehr wichtig. Dabei finden insbesondere die Ratings der durch die amerikanischen Aufsichtsbehörden anerkannten National Recognized Statistical Rating Organizations (Standard & Poor`s, Moody`s Investor Service, Fitch Inc. und Dominion Bond Rating Services) breite internationale Anwendung.
Eine effiziente Überwachung der Grundlagen für Rating-Entscheidungen ist nach unserer Ansicht dabei ein wesentliches Element im Interesse des Anlegerschutzes. Die durch die jüngsten Finanzskandale ausgelösten Untersuchungen der amerikanischen Aufsichtsbehörden erhöhen dabei den externen Druck auf die Rating-Agenturen, die wichtige Maßnahmen zur Stärkung der Marktnähe, Verlässlichkeit und Transparenz der Rating-Entscheidungen angekündigt haben und umsetzen.
Eine darüber hinausgehende nationale Regulierung oder ein nationales System, die nicht zum Ziel einer Globalisierung und Harmonisierung unabhängiger Analysen beitragen, halten wir für kapitalmarktpolitisch wenig sinnvoll; sie würden nicht die Akzeptanz der eigentlichen Adressaten von Ratings, nämlich internationaler Kapitalmarktanleger, erzielen.
Im Bereich Corporate Governance sind in der Bundesrepublik erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Der gewählte Ansatz der Selbstregulierung ist richtig. Der Deutsche Corporate Governance Kodex unter Berücksichtigung der am 21. Mai dieses Jahres beschlossenen Änderungen entspricht weitgehend dem von der EU-Kommission am gleichen Tag vorgelegten Aktionsplan zum Gesellschaftsrecht und zur Corporate Governance. Damit wurden in Deutschland die Voraussetzungen für in den Kernpunkten auf europäischer Ebene vereinheitlichte Regelungen geschaffen.
Manager-Bezüge: Mehr Transparenz schafft Vertrauen
Transparenz bei den Bezügen von Vorständen und Aufsichtsräten und im Hinblick auf Interessenkonflikte sowie die Verantwortlichkeit für Informationen, die Unternehmen an die Kapitalmärkte weitergeben, sind notwendige Voraussetzung für eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit bei den Anlegern.
Vor allem auf den Gebieten Managerbezüge (Geld- und Sachleistungen) und Interessenkonflikte ist eine größere Transparenz gegenüber dem Markt erforderlich. In einer freien Marktwirtschaft kann der Gesetzgeber nicht Obergrenzen für Bezüge von Vorständen und Aufsichtsräten festlegen; allerdings ist eine detaillierte und inhaltlich klare Offenlegung der Gesamtbezüge der einzelnen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder - so wie dies beispielsweise in den USA und Großbritannien üblich ist - sinnvoll.
Zudem sollten potenzielle Interessenkonflikte - beispielsweise Kredite, die ein Unternehmen Vorständen oder Aufsichtsräten gewährt und Verträge zu nicht marktüblichen Bedingungen - ausgeschlossen beziehnungsweise vollständig offengelegt werden.
Daneben erscheint es uns als weitere vertrauensbildende Maßnahme erforderlich, eine persönliche Haftung von Organmitgliedern für Falschinformation des Kapitalmarktes einzuführen. Im Interesse der Rechtssicherheit sollte diese allerdings auf klar definierte Sachverhalte beschränkt sein und grundsätzlich nur Angaben in Jahresabschlüssen und anderen Pflichtmitteilungen erfassen, sofern nicht sonstige, insbesondere mündliche, Äußerungen gezielt zur Irreführung des Kapitalmarktes eingesetzt wurden.
Runter mit der Zahl der Aufsichtsräte
Zudem ist die Effizienz des Zusammenspiels von Aufsichtsrat und Vorstand einer Aktiengesellschaft zu prüfen. So sind zum Beispiel die aktienrechtlichen Bestimmungen sowie die Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes kritisch zu hinterfragen, die eine Höchstzahl von bis zu 21 Aufsichtsratsmitgliedern vorsehen. Der Zuwachs an Aufgaben und Verantwortung, den der Aufsichtsrat nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Änderungen erfahren hat, spricht nicht für, sondern gegen die Beibehaltung der vorgenannten Regeln. Wir halten es deshalb für sinnvoll, eine Herabsetzung der Zahl der Aufsichtsratmitglieder in Erwägung zu ziehen (zum Beispiel Halbierung, wie in der Debatte um das KonTraG von vielen Marktteilnehmern gefordert).
Weiterhin sollte überprüft werden, inwieweit Interessenkonflikte aus Doppelfunktionen von Aufsichtsratsmitgliedern die Funktionsfähigkeit eines Aufsichtsrates materiell einschränken. Solche Doppelfunktionen können zum Beispiel Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder eines Konkurrenten, betriebsfremde Gewerkschaftsvertreter sowie Vertreter der Hausbanken innehaben.
These 3: Die Globalisierung der Kapitalmärkte eröffnet die Chance einer Anpassung der Finanzierungsstruktur des privaten und des öffentlichen Sektors in Deutschland. Wirtschaftliche Dynamik sowie ein modernes rechtliches und steuerliches Umfeld sind erforderlich, um Kapital anzuziehen. Die Diversifizierung der Kapitalquellen führt zu einer Vertiefung und Verbreiterung des Kapitalmarktes und damit zu einer nachhaltigen Stärkung des Finanzplatzes Deutschland.
Der deutsche private wie der öffentliche Sektor stehen im globalen Wettbewerb um Kapital. Die Kapitalstruktur deutscher Unternehmen (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) weist eine im internationalen Vergleich sehr niedrige Eigenkapitalquote auf. Fremdkapitalanteile von über 80 Prozent und in der Spitze von teilweise mehr als 90 Prozent sind dabei nicht selten; sie sind damit wesentlich höher als bei Unternehmen in vergleichbaren Branchen im europäischen Ausland oder in den USA.
Die Schwäche der Finanzierungskultur in Deutschland
Diese Unterschiede sind Ergebnis einer spezifischen, langjährigen deutschen Finanzierungskultur, die vornehmlich auf Bankkreditfinanzierung basierte. Dies wurde nicht zuletzt dadurch gefördert, dass - relativ gesehen - Fremdmittel in Deutschland durch Banken zu billig angeboten wurden und deshalb die Eigenkapitalbildung nicht im Vordergrund stand. Diese Nutzung von Fremdkapital kann zwar für Unternehmen rendite erhöhend wirken; in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche steigt allerdings das Insolvenzrisiko erheblich.
Finanzmittel werden im globalen Wettbewerb dort angelegt, wo sie bei geringstmöglichem Risiko den höchsten Ertrag erzielen. Eine konsequente Steigerung der operativen Ertragskraft deutscher Unternehmen ist folglich Voraussetzung einer erhöhten Attraktivität für externe Eigenkapitalinvestitionen. Daneben ist die Steigerung unternehmerischer Innenfinanzierung erforderlich, die nur bei steuerlicher Neutralität von Fremd- und Eigenkapital stattfinden kann.
Die aktuelle Vertrauenskrise erschwert den Zugang zu Eigenkapital. Zu ihrer Überwindung halten wir insbesondere die in These 2 genannten Maßnahmen für erforderlich.
Stärkere Beteiligung der Mitarbeiter am Eigenkapital
Die notwendige Attraktivität für Eigenkapitalgeber kann auch durch eine mehr erfolgsorientierte Unternehmensführung verbessert werden: Stärkere Beteiligung des Top-Managements sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Eigenkapital des Unternehmens; Knüpfung signifikanter Anteile der Vergütung an das Erreichen operativer Performance-Ziele; Performance-abhängige und adäquate Vergütung von Aufsichtsräten und Beiräten, welche die Formulierung der Performance-Ziele vornehmen und deren Erreichen nachhalten.
Unternehmensübernahmen erleichtern
Auch die europäischen Übernahmevorschriften sollten darauf abzielen, einen Rahmen für Unternehmensübernahmen zu schaffen, der das Entscheidungsrecht der Aktionäre anerkennt. Wir unterstützen die EU-Übernahme-Richtlinie als wichtige Maßnahme zur Förderung des europäischen Binnenmarktes, weil sie größere Transparenz und Rechtssicherheit in den Übernahme-Prozess bringt.
Die Schaffung eines fairen und einheitlichen rechtlichen Rahmens in ganz Europa erleichtert einen ordnungsgemäß ablaufenden grenzüberschreitenden Umstrukturierungsprozess und stellt sicher, dass die Aktionäre als Eigentümer entscheiden, ob sie für ein Unternehmen einen angemessenen Wert erhalten. Dabei sind wir allerdings der Auffassung, dass die Richtlinie in ihrer jetzigen Form keine radikale Veränderung des Umfangs der M&A-Aktivitäten in Europa bewirken würde.
Eigenkapital: Die Rolle von Private Equity Fonds
Zudem können auch Private Equity Fonds eine noch wichtigere Rolle für den Standort Deutschland und den deutschen Kapitalmarkt spielen: Der Anteil von M&A-Transaktionen, den Private Equity Fonds am deutschen M&A-Markt insgesamt ausmachen, ist über die letzten vier Jahre kontinuierlich auf zuletzt knapp 30 Prozent per anno gestiegen.

In Deutschland wurden so im Jahr 2001 4,4 Milliarden Euro Eigenkapital durch Private Equity Fonds bereitgestellt und damit Investitionen im Wert von über 13 Milliarden Euro getätigt. Private Equity Fonds spielen auch eine wichtige Rolle bei zukünftigen Eigenkapitalemissionen, da ihre Beteiligungen typischerweise nach einigen Jahren an der Börse platziert werden sollen.
Diesen Investoren kommt im Übrigen auch eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Arbeitsplätzen zu. Die Private Equity Firmen beschäftigen selbst hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die eigentliche Bedeutung für die Beschäftigung wird jedoch an zwei Beispielen deutlich: Siemens hat für ein Portfolio von Tochterunternehmen einen Investor gewonnen, der allein aufgrund dieser Transaktion jetzt über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittelbar beschäftigt.
Eine der letzten großen Transaktionen im deutschen Markt, der Erwerb von Kabel Deutschland durch Private Equity Investoren, führte zu einer Investition von knapp zwei Milliarden Euro in ein Unternehmen, das in Deutschland etwa 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Vor diesem Hintergrund ist die anhaltende Ungewissheit hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen für die Private Equity Fonds, deren Investoren, deren Manager sowie deren Investments schädlich für den Finanzplatz Deutschland. Im Vergleich zu anderen Finanzplätzen nachteilige Steuerregelungen werden zur Abwanderung sowohl des Know-hows als auch des Kapitals der Private Equity Fonds ins Ausland führen.
Die Chancen des Mittelstandes am Kapitalmarkt
Aufgrund des hohen Fremdkapitalanteils insbesondere unserer mittelständischen Wirtschaft wird Basel II dazu führen, dass deutsche Unternehmen im Allgemeinen und der Mittelstand im Besonderen sich weniger stark auf Bankkreditfinanzierung verlassen können. Sie müssen vielmehr den Zugang zum Kapitalmarkt zu risikoadäquaten, marktgerechten Finanzierungskosten auf der Basis einer angemessenen Eigenkapitalquote suchen. Im Sinne wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ist dies sinnvoll.
Der US-amerikanische Kapitalmarkt hat gezeigt, dass eine Finanzierung auch des Mittelstandes am Kapitalmarkt keineswegs unrealistisch ist. In den USA sind auf dem Markt für Fremdkapitalfinanzierung deutlich mehr Unternehmen aktiv als in Deutschland, obwohl ihre durchschnittliche Bonität (Kredit-Rating) niedriger ist. Durch eine stärkere Kapitalmarktfinanzierung wird die Abhängigkeit mittelständischer Unternehmen von Bankdarlehen reduziert. Der Kapitalmarkt führt per definitionem zu einer besseren Verteilung des Risikos auf viele Marktteilnehmer und zu einem angemessenen Marktpreis.
Empirische Studien zeigen allerdings, dass es einer großen Zahl deutscher Unternehmen heute nicht gelingt, eine operative Kapitalrendite zu erwirtschaften, die unter Berücksichtigung der normalen Schwankungen im Geschäftsverlauf ausreicht, um die Kapitalkosten zu überdecken. Insbesondere Unternehmen mit schwankender Renditecharakteristik sollten stärker mit Eigenkapital finanziert werden, um etwaige Verluste besser kompensieren zu können. Auch ertragsstarke Unternehmen können bei unvorhergesehenen signifikanten Verschlechterungen ihrer Absatzmärkte kurzfristig in Insolvenzgefahr geraten.
Das Risiko einer unflexiblen Kostenstruktur
In jedem Fall müssen Unternehmen in die Lage versetzt werden, kurzfristig und flexibel Kostenstrukturen anzupassen. Die mangelnde Flexibilität, Ressourcen bedarfsgerecht anpassen zu können, stellt in Deutschland ein erhebliches Kapitalstrukturrisiko dar. Viele Kosten, die in anderen Ländern als variabel erachten werden, sind hier de facto fix.
Folgende Ansatzpunkte, die in der derzeitigen Debatte um die "Agenda 2010" der Bundesregierung wieder zu finden sind, bieten einen Weg, um Voraussetzungen für flexiblere Kostenstrukturen zu schaffen, und könnten so zu einer Stärkung der Eigenkapitaldecke führen: Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, deutliche Senkung von Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben; Schaffung steuerlicher Anreize für flexible Lohn- und Gehaltskomponenten.
Das Beispiel Japan zeigt, dass der Erhalt einer unrentablen Unternehmenslandschaft durch expansive Finanz- und Geldpolitik unter Vermeidung notwendiger Reformen sowie politischer Druck zur Fremdmittelvergabe durch das Bankensystem eine langfristige Systemkrise herbeiführen kann.
Die Finanzierung des öffentlichen Sektors hat durch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH einen wichtigen Impuls zu einem moderneren Schuldenmanagement bekommen. Einige Bundesländer haben damit begonnen, sich stärker auch am internationalen Kapitalmarkt zu finanzieren. Ein aktives Schuldenmanagement unter Einsatz moderner Finanzierungsinstrumente kann zu einer erheblichen Reduzierung der Finanzierungskosten der öffentlichen Hand beitragen. Hier sind insbesondere auch bei den Bundesländern zusätzliche personelle Ressourcen sinnvoll.
These 4: Die finanz- und steuerpolitischen Rahmenbedingung haben zur schwierigen Situation auch des Bankensektors beigetragen. Tiefgreifende Veränderungen sind notwendig. Hierzu gehört auch, den Bankensektor konsequent zu liberalisieren und das Drei-Säulenprinzip von privaten Geschäftsbanken, Genossenschafts- und Raiffeisenbanken und öffentlich-rechtlichen Banken zu öffnen. Die gegenwärtige Trennung führt in Deutschland nicht zu einer marktgerechten und volkswirtschaftlich effizienten Kapitalallokation.
Der deutsche Bankensektor hat im weltweiten wie auch im europäischen Vergleich bezogen auf die Einwohnerzahl eine zu hohe Anzahl von Banken mit einem zu dichtem Filialnetz. Diese häufig mit den Schlagworten "over-banked" und "over-branched" beschriebene Situation führt zu einer deutlich unterdurchschnittlichen Profitabilität und einer geringeren Innovationsfähigkeit. Dies liegt vor allem darin begründet, dass überregionale deutsche Wettbewerber zwar ein hohes Produktinnovationspotential innerhalb ihrer einzelnen Fachabteilungen vorweisen, es fehlt jedoch insbesondere im Retail-Bereich der deutschlandweit enge Bezug zur Kundenbasis.
Verteilung der Marktanteile lähmt Innovation
Marktanteile von deutlich unter zehn Prozent deutschlandweit (Top 5 Banken in Deutschland zusammen 19 Prozent Marktanteil versus 75 Prozent in Großbritannien) liefern keine ausreichende Basis, um hohe Innovationskosten zu rechtfertigen. Andererseits genießen regionale Marktteilnehmer oft Marktanteile von 50 Prozent und mehr in der jeweiligen Region, in der sie tätig sind. Das lokale Marktpotential rechtfertigt meist nicht entsprechend notwendige Innovationsausgaben für neue Produkte.
Da schließlich bisher nur sehr wenig Produkt- und Know-how-Transfer über die Sektorgrenzen des öffentlich-rechtlichen, genossenschaftlichen und privaten Bankgewerbes von Produzenten zu Distributoren stattgefunden hat, bleibt der Markt fragmentiert, einem hohen regionalen Risiko ausgesetzt, wenig profitabel und im internationalen Vergleich weniger innovativ. Dies ist weder im Interesse der Bankkunden noch der Banken selbst.
Zusammenschlüsse sind zu erleichtern
Im Sinne eines profitableren und innovativeren Finanzsystems, das in der Folge dann auch eine deutlich höhere Attraktivität für seine Kunden und für ausländisches Kapital hat, sollten Bankenzusammenschlüsse und -kooperationen auch über Sektorgrenzen ermöglicht und entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Auch wenn der öffentlich diskutierte Prozentsatz der notleidenden Kredite am gesamten deutschen Kreditvolumen gering erscheint, sind die potentiellen absoluten Zahlen und die daraus resultierenden möglichen Abschreibungen zulasten des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals der Banken für manche Institute nach unserer Auffassung signifikant. Hohe Kreditvolumina auf den Bilanzen der Banken lähmen aufgrund ihrer Eigenkapitalbindung die Möglichkeit der Neuvergabe von Krediten. Nach Basel II werden diese Kredite ab 2007 mit relativ mehr Eigenkapital zu unterlegen sein, so dass bereits Befürchtungen eines "Credit Crunch", das heißt, eines Mangels an Kreditvolumina zur Neuvergabe, im Markt zu hören sind.
Verstärkte Verbriefung von Krediten schafft Luft
Diese Probleme lassen sich grundsätzlich auf die historisch gewachsene Finanzierungsstruktur der deutschen Wirtschaft zurückführen. Im internationalen Vergleich spielen immer noch Bankenkredite eine bei weitem dominierende Rolle gegenüber einer Finanzierung über den Kapitalmarkt. Neben der generellen Forderung, dass die Finanzierungsstruktur deutscher Unternehmen zukünftig stärker auf Kapitalmarktprodukten aufgebaut und weniger auf Bankkrediten basiert sein sollte, ergibt sich aus der aktuellen Situation des deutschen Bankensektors die Notwendigkeit, Kredite stärker als bisher verbriefen und damit dem Kapitalmarkt zugänglich machen zu können.
Die daraus resultierende Eigenkapitalentlastung der deutschen Finanzinstitute eröffnet Raum für die Neuvergabe von Krediten insbesondere an jene Teile der deutschen Wirtschaft, die kurzfristig noch keinen oder nur sehr erschwerten Zugang zum Kapitalmarkt haben. Zudem führt die Verbriefung auch zu einer marktgerechteren Bewertung der Kreditportfolios der deutschen Banken und damit zu einer höheren Transparenz und Attraktivität für ausländische Investoren. Dabei sind allerdings die Folgen möglicher Abschreibungen bei Kreditinstituten zu berücksichtigen, würden sie in Folge der Verbriefung ihre Kreditportfolios zu Marktwerten anstatt zu Buchwerten ausweisen.
Diese Situation ist für hoch entwickelte Industrienationen nicht neu. So haben bereits Länder wie die USA, Italien oder Frankreich Lösungen für ähnliche Problemstellungen gefunden. Nur durch entsprechende regulatorische Anreizstrukturen werden diese Probleme nachhaltig gelöst. Beispiele wie Japan zeigen, dass ohne entsprechende regulatorische Maßnahmen fundamentale Probleme zum dauerhaften Nachteil der Volkswirtschaft nicht bereinigt werden können.
In diesem Zusammenhang sind die Planungen der Bundesregierung hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen für Asset Backed Securities Zweckgesellschaften sowie die "True Sales Initiative" der KfW und anderer Banken für sogenannte "performing loans" ein wichtiger erster Schritt zur Eröffnung eines neuen Marktsegments für die Verbriefung von Bankkrediten.
Beteiligungen: Rechtslage schreckt Investoren ab
Ein weiterer struktureller Nachteil des deutschen Bankensektors ergibt sich aus der Tatsache, dass Beteiligungen beziehungsweise die Absicht des Erwerbs einer Beteiligung an deutschen Finanzinstitutionen in Höhe von zehn Prozent oder mehr der BaFin anzuzeigen sind und von dieser untersagt werden können. Insbesondere die Anzeigepflicht der Erwerbsabsicht führt vor allem bei ausländischen Investoren zu großer Zurückhaltung. Zudem besteht Unsicherheit hinsichtlich der möglichen Untersagungsgründe. Angesichts der Konkurrenz um Investorenkapital sollte in diesem Bereich größere Rechtssicherheit geschaffen werden.
Ungeachtet der wohlverstandenen Schutzfunktion dieser Regelung sollte auch in Betracht gezogen werden, ob angesichts globalisierender Kapitalmärkte und entsprechender Finanzaufsicht eine solche Regelung generell noch erforderlich ist. Zu denken wäre zum Beispiel an die Schaffung eines Ausnahmetatbestandes, nach dem Investitionen in deutsche Finanzinstitutionen durch in- oder ausländische Kapitalgeber möglich wären, sofern diese selbst der Aufsicht einer international anerkannten Aufsichtsbehörde unterstehen. Ein solches Subsidiaritätsprinzip würde die Transparenz des deutschen Finanzsektors und damit seine Attraktivität und die Transaktionssicherheit für in- und ausländische Investoren erheblich verbessern.
These 5: Eine der zentralen Herausforderungen der öffentlichen Finanzen wie der Unternehmen und der Rentenversicherung, nämlich die Sicherung einer langfristig angemessenen Altersvorsorge, bietet zugleich ein erhebliches Potential für eine Vertiefung des deutschen Kapitalmarktes.
Der demographische Wandel macht die gegenwärtige Umlagenfinanzierung, im Englischen treffend "pay-as-you-go" genannt, als alleinige Grundlage zur Erfüllung von Renten- beziehungsweise Pensionsansprüchen hinfällig. Neben Fragen der Anpassung der Leistungen steht die Notwendigkeit einer zumindest teilweise kapitalgedeckten Finanzierung heute außer Zweifel.
Die öffentlichen Haushalte können die stark steigenden jährlichen Zuschüsse für die Rentenkassen nicht mehr verkraften und finanzieren. Letzte Schätzungen erwarten für Deutschland 2003 einen staatlichen Zuschuss in die Rentekasse von etwa 77 Milliarden Euro.
Zu den dringend benötigten Reformmaßnahmen zählen auch systemische Elemente, wie zum Beispiel: die Stärkung der kapitalgedeckten Elemente der Altersversorgung auf der Basis freiwilliger Systeme, die einheitliche steuerliche Behandlung (nachgelagerte Besteuerung) der unterschiedlichen Rentenarten sowie der Abbau administrativer und bürokratischer Hindernisse vor allem im Bereich der privaten Vorsorge (Riester-Rente).
Beitragsbezogene (zum Beispiel bis zehn Prozent des Gehalts per anno), nachgelagert besteuerte Altersvorsorgeverträge sollten genügend Möglichkeiten zur arbeitnehmerfinanzierten Altersvorsorge schaffen, unabhängig von der Wahl des jeweiligen Finanzproduktes (Investmentfonds, Lebensversicherung, Banksparplan etc.). Eine weitere Stärkung der betrieblichen Altersversorgung als effizienter und kostengünstiger Weg der Altersvorsorge schafft auch Freiräume zur Umstellung der Struktur der gesetzlichen Rentenversicherung.
Ungeahnte Dimensionen der Altersvorsorgevermögen
Um beispielsweise den Anteil der betrieblichen Altersversorgung am Alterseinkommen der Rentnerhaushalte von heute fünf Prozent auf immer noch international unterdurchschnittliche 15 Prozent zu steigern, müssten weitere Mittel in Höhe von circa 600 Milliarden Euro angesammelt werden. Altersvorsorgevermögen können bei diesen Gesamtvolumina eine volkwirtschaftliche bedeutende Quelle von langfristigem Eigenkapital für die deutsche Volkswirtschaft darstellen. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung der Dax30-Unternehmen beträgt gegenwärtig circa 400 Milliarden Euro.
Die Finanzierung der leistungsbezogenen Pensionszusagen (Direktzusagen) deutscher Unternehmen mit Hilfe von Pensionsrückstellungen ist eine über Jahrzehnte etablierte Methode. Die Summe der in Deutschland über Pensionsrückstellungen finanzierten betrieblichen Pensionsversprechen belief sich Ende 2002 auf circa 220 Milliarden Euro. Davon sind etwa 25 Prozent (55 Milliarden Euro) durch Finanzanlagen gedeckt. Die verbleibenden circa 165 Milliarden Euro sind traditionell im Wege der Innenfinanzierung in den Unternehmen reinvestiert. Nach internationalen Bilanzstandards erhöht sich dieser Betrag der ungedeckten Pensionsverbindlichkeiten ("unfunded pension liabilities") auf circa 230 Milliarden Euro, da nach diesen Regeln nur Finanzanlagen, welche extern verwaltet werden, den Status von Pensionsgeldern erlangen können.
"Pension Trusts": Die Vorteile für den Konzern
Daher haben vor allem große und international tätige deutsche Konzerne "Pension Trusts" zum Zwecke der externen Finanzierung von Pensionsverbindlichkeiten aufgelegt; Beispiele sind DaimlerChrysler, Siemens, Volkswagen, Schering und die Deutsche Bank.
Ein "Pension Trust" erlaubt den Unternehmen, eine verbesserte Bilanzstruktur zu erzielen (Saldierung der Verbindlichkeiten mit dem Planvermögen) und den Einfluss kapitalmarktfremder Überlegungen auf die Anlage des Planvermögens auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die von den internationalen beziehungsweise amerikanischen Pension Accounting Standards vorgesehenen Glättungsmechanismen ermöglichen es, die durch kurzfristige Schwankungen des Deckungsgrades verursachte Volatilität der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz zu reduzieren. Dadurch ist sichergestellt, dass sämtliche Asset-Klassen berücksichtigt werden können, und die Portfoliostruktur des Planvermögens sich besser an den langfristigen Verbindlichkeitsströmen ausrichten lässt (Asset-Liability-Management).
Deshalb können Unternehmen mit externen kapitalgedeckten Pensionsplänen langfristig höhere Kapitalerträge und somit eine kostengünstigere Finanzierung ihrer betrieblichen Pensionsverbindlichkeiten erwarten.
Die größten Pensionsfonds der Welt sind Versorgungswerke von öffentlichen Angestellten, zum Beispiel Calpers (USA, 150 Milliarden Dollar), ABP (Niederlande, 145 Milliarden Euro). Sie zählen zu den größten institutionellen Investoren der Welt und spiegeln eine andere Vorsorgephilosophie dieser Länder (USA, Niederlande, Schweiz, Großbritannien, Irland usw.) wider.
Auch in diesen Ländern wird die Sozialversicherung, obwohl sie oft nur den Charakter einer Grundversorgung hat, über ein Umlageverfahren finanziert. Aber die Pensionsverbindlichkeiten der eigenen Angestellten und deren Kosten sind durch kapitalgedeckte Versorgungswerke nicht auf Folgegenerationen von Steuerzahlern verlagert.
Die Zukunft des Beamten-Pensionssystems
In Deutschland treffen wir auf eine andere Situation. Die Versorgungsverbindlichkeiten für die Beamten werden im wesentlichen aus den Steuereinnahmen im Wege eines Umlageverfahrens finanziert. Kapitalstöcke sind über die Jahrzehnte nicht aufgebaut worden. Durch die demographische Entwicklung und die spezifische Einstellungspolitik des öffentlichen Sektors in den 60er und den 70er Jahren werden die öffentlichen Haushalte durch die Pensionslasten zukünftig außerordentlich belastet. Die Länderhaushalte stehen hier besonders unter Druck, da große Gruppen wie zum Beispiel Lehrer, Polizisten und Verwaltungsbeamte über die Länderhaushalte finanziert werden.
Um die Altersvorsorge der heute aktiven Beamten periodengerecht vorzufinanzieren, müssten die laufenden Besoldungen um einen Aufwandbeitrag von circa 25 Prozent bis 30 Prozent per anno erhöht werden. Da der Gesamtverpflichtungsumfang der nicht ausfinanzierten Altersversorgungszusagen für die Beamten des Bundes, der Länder und der Kommunen etwas mehr als 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt, ist es nicht vorstellbar, eine vollständige Kapitaldeckung aufzubauen.
Generationengerechte Finanzierung der Pensionslasten
Deshalb ist der Aufbau von teilkapitalgedeckten Vorsorgesystemen im öffentlichen Sektor der einzig gangbare Ansatz, die Finanzierung der Pensionslasten generationengerecht zu gestalten. Der öffentliche Sektor vollzöge zudem mit dem Einstieg in eine teilweise kapitalgedeckte Finanzierung seiner Pensionszusagen, was im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge mit erheblichem Aufwand gefördert wird.
Mit den zu erwartenden weiteren Vermögenswerten unter Treuhänderschaft (bei einer angenommenen Kapitaldeckung von 50 Prozent der Pensionsverbindlichkeiten für die Beamten mehr als 250 Milliarden Euro) könnte die öffentliche Hand selbst als Nachfrager ein Innovator von Anlageprodukten werden.
Allerdings kommt es entscheidend darauf an, dass Pensionsfonds der öffentlichen Hand dem Zugriff des jeweiligen laufenden Haushalts entzogen sind und die Anlagerichtlinien den Regeln der Risikodiversifizierung moderner Portfoliotheorie entsprechen. Durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen in Deutschland zum Aufbau entsprechender Versorgungswerke und effizienter Investitionsrahmenbedingungen ergibt sich hier eine bedeutende Chance. Öffentliche Versorgungswerke könnten zur mittelfristigen Entlastung der öffentlichen Haushalte sowie zur Sicherung der Pensionszusagen beitragen.
Der Finanzplatz Deutschland steht wie der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt vor großen Herausforderungen. Der aus den Anträgen der Fraktionen ablesbare Grad an Übereinstimmung in dem Bestreben zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ist ermutigend. Wie in der Gesamtwirtschaft erwarten die Marktteilnehmer eine zügige Umsetzung wachstums- und beschäftigungsfördernder Reformen.
manager-magazin.de, 10.06.2003
Redaktionelle Bearbeitung durch Lutz Reiche
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,252179,00.…
Post von Goldman Sachs:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
vielen Dank für die Einladung zur öffentlichen Anhörung zum Finanzplatz Deutschland am 4. Juni 2003 in Berlin. Hiermit senden wir Ihnen unsere schriftliche Stellungnahme zu den Anträgen der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Fraktion der CDU/CSU sowie der Fraktion der FDP zum Finanzplatz Deutschland (Drucksachen 15/930, 15/748, 16/369). Wir tun dies aus der Sicht einer internationalen Bank mit einer starken Bindung zu Deutschland und zum Standort Frankfurt.
Für Goldman Sachs stellt die Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer zentralen Stellung im europäischen Binnenmarkt mit mehr als 82 Millionen Konsumenten als zweitstärkste Exportnation der Welt den neben China weltweit wichtigsten Wachstumsmarkt für Finanzdienstleistungen außerhalb der USA dar. Dies begründet unseren eigenen strategischen Fokus auf Deutschland, reflektiert aber auch die Chancen und Zukunftsperspektiven für den hiesigen Finanzsektor insgesamt.
Wie von allen Fraktionen betont wird, sollte die Debatte über den Finanzplatz Deutschland im volkswirtschaftlichen Kontext geführt werden. Der Finanzsektor ist stärker von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig als andere Sektoren der deutschen Volkswirtschaft. Zudem kommt dem Finanzsektor eine wesentliche Rolle bei der Gesundung der heimischen Wirtschaft zu. Deshalb gilt gerade für die Attraktivität Deutschlands als Finanzplatz, dass Märkte und Standorte keine Erbhöfe sind.
Im Zuge der Globalisierung formiert sich der Finanzsektor ständig neu. Ein Finanzplatz muss seine Position stetig dynamisch fortentwickeln; Infrastruktur, Rahmenbedingungen und Regelwerke müssen auch im Wettbewerb mit anderen Finanzplätzen auf ihre Konkurrenzfähigkeit überprüft werden, um einfallsreiche, innovative und qualifizierte Menschen anzuziehen.
Die strukturellen Schwächen werden offensichtlicher
Der deutsche Finanzsektor wie die deutsche Wirtschaft insgesamt leiden seit längerem unter strukturellen Schwächen, die mit der weltweiten Korrektur an den Aktienmärkten wieder offensichtlicher geworden sind. Im Zentrum der strukturellen Schwächen stehen der demographische Wandel, der Arbeitsmarkt, die Sozialversicherungssysteme, das Steuersystem sowie die Tendenz zur Überregulierung und Bürokratisierung unternehmerischer Prozesse. Alle diese Themenkomplexe sind umfassend in den volkswirtschaftlichen Analysen der OECD, der Bundesbank und der Wirtschaftsforschungsinstitute beschrieben.
Die Bundesbank hat in ihrem im März diesen Jahres veröffentlichten Papier "Wege aus der Krise" darauf hingewiesen, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Vertrauens- und Wachstumskrise befindet: "Das Vertrauen lässt sich nur zurückgewinnen, wenn die Wirtschaftspolitik verlässliche, d.h. für den Planungshorizont der Unternehmen und privaten Haushalte bestandsfeste Rahmenbedingungen setzt." (Deutsche Bundesbank, Wege aus der Krise - Wirtschaftspolitische Denkanstöße für Deutschland, März 2003, S. 5). Dies gilt in besonderem Maße für den Finanzsektor.
Kapitalströme schaffen sich ihre eigenen Bahnen
Die Globalisierung hat zum Zusammenbruch nationaler Schutzräume geführt. Da, wo Gesetzgeber versuchen, diese zu erhalten, anstatt konsequent auf supranationale (im Falle Deutschlands insbesondere europäische) Regelungen zu setzen, schaffen sich Kapitalströme ihre eigenen Bahnen. Die Gestaltung des allgemeinen wirtschaftspolitischen Rahmens und der Finanzmarktordnung liegt in der Verantwortung der Politik, damit Frankfurt der wichtigste kontinentaleuropäische Finanzplatz bleibt, und nicht hinter Paris, Zürich und Luxemburg zurückfällt.
Deshalb ist es zu begrüßen, dass alle Fraktionen des Deutschen Bundestages in ihren Anträgen an der Kontinuität der früheren Finanzmarktförderungsgesetze festhalten und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes in den Vordergrund ihrer Anträge stellen.
These 1: Die Globalisierung der Finanzmärkte hat dazu geführt, dass Kapital weltweit nach Anlagemöglichkeiten sucht und Finanzdienstleistungen über nationale Grenzen hinweg angeboten werden können. Ziel nationaler Gesetzgebung kann es daher nur sein, die Wertschöpfungskette soweit als möglich im Land zu halten. Notwendige Maßnahmen zum Investorenschutz müssen europaweit abgestimmt sein.
Die Finanzdienstleistungsbranche ist die am weitesten globalisierte Industrie überhaupt, da die Dienstleistungsproduktion nicht an einen bestimmten Standort gebunden ist. Daher werden regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen in einem noch stärkeren Umfang als in anderen Sektoren zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor eines Finanzplatzes.
Wird dieser Zusammenhang nicht ausreichend berücksichtigt, führen fehlende oder relativ schlechtere Rahmenbedingungen zu einer Verlagerung von Angebot und Nachfrage und damit der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ins Ausland.
Deutschland darf nicht nur "Vertriebsstandort" bleiben
Plakativ gesprochen steht für den Gesetzgeber zur Disposition, ob Deutschland bloßer "Vertriebsstandort" oder auch "Entwicklungs- und Produktionsstätte" von neuen, innovativen Finanzdienstleistungen mit hochqualifizierten Dienstleistungsarbeitsplätzen bleibt beziehungsweise in neuen Marktsegmenten wird. Hier sind zunächst die oben genannten allgemeinen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen entscheidend.
Unterstützung durch Gesetzgeber und regulierende Behörden ist aber auch nötig, um Finanzinnovationen in Frankfurt anzusiedeln. Angesichts der relativ kurzen Innovationszyklen auf dem internationalen Kapitalmarkt sind rechtliche Rahmenbedingungen erforderlich, die schnelle Entscheidungen ermöglichen und Rechtssicherheit bieten.
Praktisch handhabbare Richtlinien sind gefragt
Die Aufsicht muss daher praktisch handhabbare Richtlinien erstellen; ihre Beurteilung von Produktinnovationen muss verlässlich und transparent sein. Klare Kommunikation zwischen den Beteiligten (Behörden, Wirtschaftsprüfer und Finanzinstitute) hilft, Sicherheit und Transparenz im Umgang mit neuen Finanzprodukten zu schaffen.
Aufgrund der hohen Bedeutung von EU-Richtlinien für den europäischen Kapitalmarkt ist deren unverzügliche und vor allem marktöffnende Umsetzung in das deutsche Recht von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland in Europa. So können auch "First-Mover-Advantages" entstehen. Andernfalls droht eine weitere Abwanderung von Geschäft und Kapital.
Das Beispiel der Hedgefonds
Zudem behindert der bestehende rechtliche Rahmen einschließlich des deutschen Steuerrechts die Ansiedlung neuer Marktsegmente. Als Beispiel mag die bisherige Regulierung von Hedge Fonds in Deutschland dienen.

Hedge Fonds sind global anerkannte Marktteilnehmer, die seit über 50 Jahren an den Finanzmärkten agieren. Wegen der für Hedge Fonds geltenden prohibitiven Einschränkungen in Deutschland werden diese für deutsche Anleger vor allem aus der Schweiz und Großbritannien angeboten. Nach unseren Schätzungen sind gegenwärtig fast zehn Milliarden Euro deutscher Anleger in ausländische Hedge Fonds Produkte investiert. Dabei bleiben Risiken und Chancen der Anlage selbstverständlich weiterhin beim deutschen Investor.
Das Wachstum geht an Deutschland vorbei
Mit anderen Worten, die Schutzvorschriften haben nicht dazu geführt, dass deutsche Anleger diese Anlageform nicht genutzt haben; lediglich die Wertschöpfung ist ins Ausland verlagert worden. Demzufolge ist der Finanzplatz Deutschland nicht am hohen Wachstum der Hedge Fonds beteiligt.
Zur Verdeutlichung: Das weltweite Hedge Fonds Eigenkapital-Bestandsvolumen hat sich seit 1995 mehr als verdreifacht und betrug Ende 2002 mehr als 600 Milliarden US Dollar. Während in Großbritannien rund 400 Hedge Fonds (70 Prozent aller europäischen Hedge Fonds) angesiedelt sind, sind es in Deutschland nur insgesamt drei Fonds. Frankreich mit 39 Fonds und die Schweiz mit 36 Fonds folgen Großbritannien in der Rangfolge.
Das BaFin könnte Vertrauen schaffen
Um den deutschen Finanzmarkt für Hedge Fonds attraktiv zu machen, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen einschließlich der steuerlichen Behandlung das Auflegen von Hedge Fonds und das Investieren in Hedge Fonds unterstützen. Dabei würde eine Regulierung durch die BaFin mit einem einfachen und schnellen Zulassungsverfahren wahrscheinlich das Vertrauen der Investoren und Hedge Fonds Manager stärken, was zunehmende Investitionen in diese Vermögensklasse am Finanzplatz Deutschland zur Folge haben könnte.
Die Nachteile gegenüber dem Finanzplatz London
Um mit etablierten Hedge Fonds Standorten bezüglich der Anziehung von Hedge Fonds Managern und Investoren konkurrieren zu können, ist es wichtig, dass die Gesetzgebung in Deutschland im Einklang mit globalen Praktiken steht und inländischen Hedge Fonds und Investoren keine unnötigen Restriktionen auferlegt werden. Der Verlust von Entwicklung und Produktion von Finanzdienstleistungen an London, insbesondere Emission, Handel und Analyse von Wertpapieren, Währungen und Derivaten über die letzten Jahre, ist kaum aufzuholen.
So wurde zum Beispiel durch die Einführung des Euro die Notwendigkeit, spezifisch deutsche Finanzdienstleistungen zu entwickeln, verringert, da nun in "Euroland" Finanzprodukte skalierbarer sind und dementsprechend kostengünstiger entwickelt werden können. Einfacher und kostengünstiger ist dies in London, wo die Steuern niedriger, die Regulierungen liberaler und das (in Finanzdienstleistungen geschulte) Humankapital reichlicher vorhanden sind. Steuersätze und Regulierungsdichte müssten also deutlich unter Londoner Niveaus gesenkt werden, um Nachteile hinsichtlich Infrastruktur, Sprache und Finanzmarktkultur auszugleichen.
Neue Rahmenbedinungen sind gefordert
Der Finanzplatz Frankfurt steht in direkter Konkurrenz mit anderen kontinentaleuropäischen Finanzplätzen wie Paris, Luxemburg oder Zürich, die sich zum Teil Marktnischen zumeist durch Steuer- und Regulierungsvorteile geschaffen haben. Dabei ist die relative Zahl der Beschäftigten im Finanzgewerbe auf diesen Plätzen vergleichbar mit der in Deutschland; Luxemburg liegt hier bekanntlich weit über dem Durchschnitt. So werden zum Beispiel internationale Anleihen deutscher Emittenten insbesondere aufgrund der Steuervorteile für Investoren und Emittenten fast ausschließlich über Luxemburg oder andere europäische Finanzplätze durchgeführt.
Im Unterschied zu diesen kontinentaleuropäischen Standorten ist Deutschland aber der wichtigste europäische Marktplatz für den Vertrieb von Finanzdienstleistungen. Ziel der Politik sollte es daher sein, dieses auf der Nachfrageseite generierte Marktpotential durch Schaffung kapitalmarktfreundlicher Rahmenbedingungen für die Anbieter und Nachfrager dieser Finanzdienstleistungen auch für gesamtwirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung besser zu nutzen.
Der Erfolg der Deutsche Börse AG belegt, dass Innovationen und die konsequente Umsetzung zukunftsorientierter Strategien die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland erheblich steigern können.
These 2: Eine glaubwürdige und effektive Kapitalmarktaufsicht, hohe Markttransparenz und glaubwürdiger Anlegerschutz sind Voraussetzungen für die Überwindung der Vertrauenskrise am Kapitalmarkt.
Ein grundlegendes Problem, mit dem die Marktteilnehmer und die Kapitalmarktaufsichtsbehörden heute konfrontiert sind, ist die Wiederherstellung des Vertrauens der Anleger in die Integrität der Kapitalmärkte. Unternehmensskandale, der Umgang mit Interessenkonflikten und der rasante Kursverfall an den Aktienmärkten haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Die Anträge der Fraktionen belegen, dass die Bereitschaft zur Fortentwicklung des Finanzmarktes besteht und die wesentlichen Handlungsfelder identifiziert sind. Aus unserer Sicht sind dies insbesondere die folgenden vier Bereiche:
- die Weiterentwicklung der Kapitalmarktaufsicht,
- die Verantwortlichkeit von Abschlussprüfern gegenüber den Kapitalmärkten,
- eine Verbesserung der Qualität der Informationen, die dem Markt zur Verfügung gestellt werden und die Corporate Governance
Kapitalmarktaufsicht: Die Gründe für die Ineffizienz
Eine effektive Kapitalmarktaufsicht muss über ausreichende Ressourcen und Erfahrung verfügen, um Anlegerschutz gewährleisten zu können. Dies gilt sowohl bei der Begleitung von Wertpapieremissionen als auch der Überwachung des Handels und des Kapitalmarktes generell. Die Gründung der BaFin war in diesem Zusammenhang ein bedeutender Schritt; eine weitere Zusammenführung am Finanzplatz Frankfurt befürworten wir.
Gleichwohl bleibt das Aufsichtswesen für den Kapitalmarkt in Deutschland fragmentiert; es sollte vereinfacht, konzentriert und hinsichtlich der Ressourcen aufgestockt werden, um eine effiziente Beaufsichtigung sicherzustellen. Das Auseinanderfallen der Kompetenzen der BaFin, der Deutschen Bundesbank, der zuständigen Landesbehörden und der Handelsüberwachungsstellen bei der Beaufsichtigung der Finanzinstitute einerseits sowie der Marktüberwachung andererseits sind unübersichtlich, ineffizient und im Ausland schwer vermittelbar.
Mehr Personal und Schwerpunktstaatsanwaltschaft
In personeller Hinsicht werden zusätzliche erfahrene Prüfer benötigt, die eine sorgfältige materielle Prüfung der Unterlagen, die von Emittenten im Zusammenhang mit Kapitalaufnahmen offen gelegt werden, vornehmen können. Nur so kann gewährleistet werden, dass potenziellen Anlegern vollständige und ausgewogene Informationen für ihre Anlageentscheidungen zur Verfügung stehen. Die Aufsichtsbehörden sollten aber auch über entsprechende Befugnisse und Ressourcen verfügen, um die regelmäßig von Unternehmen veröffentlichten Informationen zu prüfen, damit die Anleger zeitnah qualitativ hochwertige Informationen erhalten.
Ohne eine glaubwürdige und effektive Durchsetzung bis hin zur Strafverfolgung laufen Kapitalmarktvorschriften leer. Dies ist nur dann zu erreichen, wenn diejenigen, die ihren Pflichten nicht nachkommen, identifiziert und entsprechende Maßnahmen gegen sie eingeleitet werden. Wir befürworten daher eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.
Abschlussprüfer müssen mehr Verantwortung tragen
In Deutschland sind Jahresabschlussprüfer in einem in anderen Ländern nicht bestehenden Maße vor Schadensersatzansprüchen von Aktionären geschützt. Namentlich in den USA und Großbritannien sind Abschlussprüfer unmittelbar den Aktionären gegenüber verantwortlich. In Deutschland beschränkt das HGB jedoch nicht nur die Verantwortung des Prüfers auf das geprüfte Unternehmen, sondern legt auch eine jedenfalls mit Bezug auf börsennotierte Unternehmen unverhältnismäßig niedrige Haftungsgrenze fest.
Die Wirtschaftsprüferkammern in den USA und Großbritannien treten am Kapitalmarkt aktiv in Erscheinung, um das Vertrauen in ihren Berufsstand und in die gleichbleibend hohe Qualität ihres Beitrags für den Kapitalmarkt zu fördern.
Wir halten es für erforderlich, die Wirtschaftsprüfer auch in Deutschland mehr in die Verantwortung zu nehmen, weil dies eine wichtige Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Qualität der von Unternehmen veröffentlichten Finanzinformationen bedeutet. Haftungsobergrenzen für Abschlussprüfer stehen diesem Ziel entgegen. Die durch den Wegfall von Haftungsgrenzen zusätzlich entstehenden Kosten der Wirtschaftsprüfung für die Unternehmen halten wir in Abwägung mit der hierdurch im Kapitalmarkt zusätzlich entstehenden Sicherheit für gerechtfertigt, zumal diese Kosten heute in Deutschland vergleichsweise niedrig sind.
Offenlegungsstandards: Der Unterschied ist erheblich
Die Verbesserung der Qualität sowie die Verfügbarkeit korrekter und klarer Informationen über börsennotierte Unternehmen muss in den Vordergrund gestellt werden. Dies gilt sowohl für regelmäßige Unternehmensbekanntmachungen (zum Beispiel Geschäftsberichte und Ad-hoc-Mitteilungen) als auch für Aktienanalysen. Gegenwärtig bestehen in der Praxis beträchtliche Unterschiede zwischen den Offenlegungsstandards von Unternehmen in Bezug auf Inhalte und Darstellung von Unternehmensberichten.
Die Einführung konkreter Offenlegungsvorschriften - so wie in der EU-Verordnung zur Transparenz für Geschäftsberichte und Zwischenberichte vorgesehen - wäre für die Aktionäre sehr förderlich. Auch die Einführung einer öffentlich zugänglichen Datenbank für Unternehmensinformationen wäre zu begrüßen. Anleger sollten besser in die Lage versetzt werden, die offen gelegten Informationen verschiedener Unternehmen zu vergleichen.
Integrität der Aktienanalysen erhöhen
Aktienanalysen und Berichte von Kreditbewertungsagenturen sind zwei weitere wichtige und unabhängige Informationsquellen. Aktienanalysen bieten eine eingehende Untersuchung und Bewertung von Unternehmen, die Unternehmensberichte nicht leisten können. Allerdings sind wir uns bewusst, dass das Vertrauen in Aktienanalysen auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Wir unterstützen deshalb nachdrücklich weitergehende Maßnahmen, um die Integrität von Aktienanalysen zu erhöhen, und befürworten eine internationale Zusammenarbeit zur Herstellung einer gemeinsamen europäischen Haltung.
Rating-Überwachung: Keine nationalen Alleingänge
Zudem ist die Zusammenarbeit mit den international anerkannten Kreditbewertungsagenturen für eine einheitliche und transparente Kreditbewertung für deutsche Emittenten sehr wichtig. Dabei finden insbesondere die Ratings der durch die amerikanischen Aufsichtsbehörden anerkannten National Recognized Statistical Rating Organizations (Standard & Poor`s, Moody`s Investor Service, Fitch Inc. und Dominion Bond Rating Services) breite internationale Anwendung.
Eine effiziente Überwachung der Grundlagen für Rating-Entscheidungen ist nach unserer Ansicht dabei ein wesentliches Element im Interesse des Anlegerschutzes. Die durch die jüngsten Finanzskandale ausgelösten Untersuchungen der amerikanischen Aufsichtsbehörden erhöhen dabei den externen Druck auf die Rating-Agenturen, die wichtige Maßnahmen zur Stärkung der Marktnähe, Verlässlichkeit und Transparenz der Rating-Entscheidungen angekündigt haben und umsetzen.
Eine darüber hinausgehende nationale Regulierung oder ein nationales System, die nicht zum Ziel einer Globalisierung und Harmonisierung unabhängiger Analysen beitragen, halten wir für kapitalmarktpolitisch wenig sinnvoll; sie würden nicht die Akzeptanz der eigentlichen Adressaten von Ratings, nämlich internationaler Kapitalmarktanleger, erzielen.
Im Bereich Corporate Governance sind in der Bundesrepublik erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Der gewählte Ansatz der Selbstregulierung ist richtig. Der Deutsche Corporate Governance Kodex unter Berücksichtigung der am 21. Mai dieses Jahres beschlossenen Änderungen entspricht weitgehend dem von der EU-Kommission am gleichen Tag vorgelegten Aktionsplan zum Gesellschaftsrecht und zur Corporate Governance. Damit wurden in Deutschland die Voraussetzungen für in den Kernpunkten auf europäischer Ebene vereinheitlichte Regelungen geschaffen.
Manager-Bezüge: Mehr Transparenz schafft Vertrauen
Transparenz bei den Bezügen von Vorständen und Aufsichtsräten und im Hinblick auf Interessenkonflikte sowie die Verantwortlichkeit für Informationen, die Unternehmen an die Kapitalmärkte weitergeben, sind notwendige Voraussetzung für eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit bei den Anlegern.
Vor allem auf den Gebieten Managerbezüge (Geld- und Sachleistungen) und Interessenkonflikte ist eine größere Transparenz gegenüber dem Markt erforderlich. In einer freien Marktwirtschaft kann der Gesetzgeber nicht Obergrenzen für Bezüge von Vorständen und Aufsichtsräten festlegen; allerdings ist eine detaillierte und inhaltlich klare Offenlegung der Gesamtbezüge der einzelnen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder - so wie dies beispielsweise in den USA und Großbritannien üblich ist - sinnvoll.
Zudem sollten potenzielle Interessenkonflikte - beispielsweise Kredite, die ein Unternehmen Vorständen oder Aufsichtsräten gewährt und Verträge zu nicht marktüblichen Bedingungen - ausgeschlossen beziehnungsweise vollständig offengelegt werden.
Daneben erscheint es uns als weitere vertrauensbildende Maßnahme erforderlich, eine persönliche Haftung von Organmitgliedern für Falschinformation des Kapitalmarktes einzuführen. Im Interesse der Rechtssicherheit sollte diese allerdings auf klar definierte Sachverhalte beschränkt sein und grundsätzlich nur Angaben in Jahresabschlüssen und anderen Pflichtmitteilungen erfassen, sofern nicht sonstige, insbesondere mündliche, Äußerungen gezielt zur Irreführung des Kapitalmarktes eingesetzt wurden.
Runter mit der Zahl der Aufsichtsräte
Zudem ist die Effizienz des Zusammenspiels von Aufsichtsrat und Vorstand einer Aktiengesellschaft zu prüfen. So sind zum Beispiel die aktienrechtlichen Bestimmungen sowie die Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes kritisch zu hinterfragen, die eine Höchstzahl von bis zu 21 Aufsichtsratsmitgliedern vorsehen. Der Zuwachs an Aufgaben und Verantwortung, den der Aufsichtsrat nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Änderungen erfahren hat, spricht nicht für, sondern gegen die Beibehaltung der vorgenannten Regeln. Wir halten es deshalb für sinnvoll, eine Herabsetzung der Zahl der Aufsichtsratmitglieder in Erwägung zu ziehen (zum Beispiel Halbierung, wie in der Debatte um das KonTraG von vielen Marktteilnehmern gefordert).
Weiterhin sollte überprüft werden, inwieweit Interessenkonflikte aus Doppelfunktionen von Aufsichtsratsmitgliedern die Funktionsfähigkeit eines Aufsichtsrates materiell einschränken. Solche Doppelfunktionen können zum Beispiel Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder eines Konkurrenten, betriebsfremde Gewerkschaftsvertreter sowie Vertreter der Hausbanken innehaben.
These 3: Die Globalisierung der Kapitalmärkte eröffnet die Chance einer Anpassung der Finanzierungsstruktur des privaten und des öffentlichen Sektors in Deutschland. Wirtschaftliche Dynamik sowie ein modernes rechtliches und steuerliches Umfeld sind erforderlich, um Kapital anzuziehen. Die Diversifizierung der Kapitalquellen führt zu einer Vertiefung und Verbreiterung des Kapitalmarktes und damit zu einer nachhaltigen Stärkung des Finanzplatzes Deutschland.
Der deutsche private wie der öffentliche Sektor stehen im globalen Wettbewerb um Kapital. Die Kapitalstruktur deutscher Unternehmen (Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) weist eine im internationalen Vergleich sehr niedrige Eigenkapitalquote auf. Fremdkapitalanteile von über 80 Prozent und in der Spitze von teilweise mehr als 90 Prozent sind dabei nicht selten; sie sind damit wesentlich höher als bei Unternehmen in vergleichbaren Branchen im europäischen Ausland oder in den USA.
Die Schwäche der Finanzierungskultur in Deutschland
Diese Unterschiede sind Ergebnis einer spezifischen, langjährigen deutschen Finanzierungskultur, die vornehmlich auf Bankkreditfinanzierung basierte. Dies wurde nicht zuletzt dadurch gefördert, dass - relativ gesehen - Fremdmittel in Deutschland durch Banken zu billig angeboten wurden und deshalb die Eigenkapitalbildung nicht im Vordergrund stand. Diese Nutzung von Fremdkapital kann zwar für Unternehmen rendite erhöhend wirken; in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche steigt allerdings das Insolvenzrisiko erheblich.
Finanzmittel werden im globalen Wettbewerb dort angelegt, wo sie bei geringstmöglichem Risiko den höchsten Ertrag erzielen. Eine konsequente Steigerung der operativen Ertragskraft deutscher Unternehmen ist folglich Voraussetzung einer erhöhten Attraktivität für externe Eigenkapitalinvestitionen. Daneben ist die Steigerung unternehmerischer Innenfinanzierung erforderlich, die nur bei steuerlicher Neutralität von Fremd- und Eigenkapital stattfinden kann.
Die aktuelle Vertrauenskrise erschwert den Zugang zu Eigenkapital. Zu ihrer Überwindung halten wir insbesondere die in These 2 genannten Maßnahmen für erforderlich.
Stärkere Beteiligung der Mitarbeiter am Eigenkapital
Die notwendige Attraktivität für Eigenkapitalgeber kann auch durch eine mehr erfolgsorientierte Unternehmensführung verbessert werden: Stärkere Beteiligung des Top-Managements sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Eigenkapital des Unternehmens; Knüpfung signifikanter Anteile der Vergütung an das Erreichen operativer Performance-Ziele; Performance-abhängige und adäquate Vergütung von Aufsichtsräten und Beiräten, welche die Formulierung der Performance-Ziele vornehmen und deren Erreichen nachhalten.
Unternehmensübernahmen erleichtern
Auch die europäischen Übernahmevorschriften sollten darauf abzielen, einen Rahmen für Unternehmensübernahmen zu schaffen, der das Entscheidungsrecht der Aktionäre anerkennt. Wir unterstützen die EU-Übernahme-Richtlinie als wichtige Maßnahme zur Förderung des europäischen Binnenmarktes, weil sie größere Transparenz und Rechtssicherheit in den Übernahme-Prozess bringt.
Die Schaffung eines fairen und einheitlichen rechtlichen Rahmens in ganz Europa erleichtert einen ordnungsgemäß ablaufenden grenzüberschreitenden Umstrukturierungsprozess und stellt sicher, dass die Aktionäre als Eigentümer entscheiden, ob sie für ein Unternehmen einen angemessenen Wert erhalten. Dabei sind wir allerdings der Auffassung, dass die Richtlinie in ihrer jetzigen Form keine radikale Veränderung des Umfangs der M&A-Aktivitäten in Europa bewirken würde.
Eigenkapital: Die Rolle von Private Equity Fonds
Zudem können auch Private Equity Fonds eine noch wichtigere Rolle für den Standort Deutschland und den deutschen Kapitalmarkt spielen: Der Anteil von M&A-Transaktionen, den Private Equity Fonds am deutschen M&A-Markt insgesamt ausmachen, ist über die letzten vier Jahre kontinuierlich auf zuletzt knapp 30 Prozent per anno gestiegen.

In Deutschland wurden so im Jahr 2001 4,4 Milliarden Euro Eigenkapital durch Private Equity Fonds bereitgestellt und damit Investitionen im Wert von über 13 Milliarden Euro getätigt. Private Equity Fonds spielen auch eine wichtige Rolle bei zukünftigen Eigenkapitalemissionen, da ihre Beteiligungen typischerweise nach einigen Jahren an der Börse platziert werden sollen.
Diesen Investoren kommt im Übrigen auch eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Arbeitsplätzen zu. Die Private Equity Firmen beschäftigen selbst hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die eigentliche Bedeutung für die Beschäftigung wird jedoch an zwei Beispielen deutlich: Siemens hat für ein Portfolio von Tochterunternehmen einen Investor gewonnen, der allein aufgrund dieser Transaktion jetzt über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittelbar beschäftigt.
Eine der letzten großen Transaktionen im deutschen Markt, der Erwerb von Kabel Deutschland durch Private Equity Investoren, führte zu einer Investition von knapp zwei Milliarden Euro in ein Unternehmen, das in Deutschland etwa 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Vor diesem Hintergrund ist die anhaltende Ungewissheit hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen für die Private Equity Fonds, deren Investoren, deren Manager sowie deren Investments schädlich für den Finanzplatz Deutschland. Im Vergleich zu anderen Finanzplätzen nachteilige Steuerregelungen werden zur Abwanderung sowohl des Know-hows als auch des Kapitals der Private Equity Fonds ins Ausland führen.
Die Chancen des Mittelstandes am Kapitalmarkt
Aufgrund des hohen Fremdkapitalanteils insbesondere unserer mittelständischen Wirtschaft wird Basel II dazu führen, dass deutsche Unternehmen im Allgemeinen und der Mittelstand im Besonderen sich weniger stark auf Bankkreditfinanzierung verlassen können. Sie müssen vielmehr den Zugang zum Kapitalmarkt zu risikoadäquaten, marktgerechten Finanzierungskosten auf der Basis einer angemessenen Eigenkapitalquote suchen. Im Sinne wirtschaftlicher Nachhaltigkeit ist dies sinnvoll.
Der US-amerikanische Kapitalmarkt hat gezeigt, dass eine Finanzierung auch des Mittelstandes am Kapitalmarkt keineswegs unrealistisch ist. In den USA sind auf dem Markt für Fremdkapitalfinanzierung deutlich mehr Unternehmen aktiv als in Deutschland, obwohl ihre durchschnittliche Bonität (Kredit-Rating) niedriger ist. Durch eine stärkere Kapitalmarktfinanzierung wird die Abhängigkeit mittelständischer Unternehmen von Bankdarlehen reduziert. Der Kapitalmarkt führt per definitionem zu einer besseren Verteilung des Risikos auf viele Marktteilnehmer und zu einem angemessenen Marktpreis.
Empirische Studien zeigen allerdings, dass es einer großen Zahl deutscher Unternehmen heute nicht gelingt, eine operative Kapitalrendite zu erwirtschaften, die unter Berücksichtigung der normalen Schwankungen im Geschäftsverlauf ausreicht, um die Kapitalkosten zu überdecken. Insbesondere Unternehmen mit schwankender Renditecharakteristik sollten stärker mit Eigenkapital finanziert werden, um etwaige Verluste besser kompensieren zu können. Auch ertragsstarke Unternehmen können bei unvorhergesehenen signifikanten Verschlechterungen ihrer Absatzmärkte kurzfristig in Insolvenzgefahr geraten.
Das Risiko einer unflexiblen Kostenstruktur
In jedem Fall müssen Unternehmen in die Lage versetzt werden, kurzfristig und flexibel Kostenstrukturen anzupassen. Die mangelnde Flexibilität, Ressourcen bedarfsgerecht anpassen zu können, stellt in Deutschland ein erhebliches Kapitalstrukturrisiko dar. Viele Kosten, die in anderen Ländern als variabel erachten werden, sind hier de facto fix.
Folgende Ansatzpunkte, die in der derzeitigen Debatte um die "Agenda 2010" der Bundesregierung wieder zu finden sind, bieten einen Weg, um Voraussetzungen für flexiblere Kostenstrukturen zu schaffen, und könnten so zu einer Stärkung der Eigenkapitaldecke führen: Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, deutliche Senkung von Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben; Schaffung steuerlicher Anreize für flexible Lohn- und Gehaltskomponenten.
Das Beispiel Japan zeigt, dass der Erhalt einer unrentablen Unternehmenslandschaft durch expansive Finanz- und Geldpolitik unter Vermeidung notwendiger Reformen sowie politischer Druck zur Fremdmittelvergabe durch das Bankensystem eine langfristige Systemkrise herbeiführen kann.
Die Finanzierung des öffentlichen Sektors hat durch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH einen wichtigen Impuls zu einem moderneren Schuldenmanagement bekommen. Einige Bundesländer haben damit begonnen, sich stärker auch am internationalen Kapitalmarkt zu finanzieren. Ein aktives Schuldenmanagement unter Einsatz moderner Finanzierungsinstrumente kann zu einer erheblichen Reduzierung der Finanzierungskosten der öffentlichen Hand beitragen. Hier sind insbesondere auch bei den Bundesländern zusätzliche personelle Ressourcen sinnvoll.
These 4: Die finanz- und steuerpolitischen Rahmenbedingung haben zur schwierigen Situation auch des Bankensektors beigetragen. Tiefgreifende Veränderungen sind notwendig. Hierzu gehört auch, den Bankensektor konsequent zu liberalisieren und das Drei-Säulenprinzip von privaten Geschäftsbanken, Genossenschafts- und Raiffeisenbanken und öffentlich-rechtlichen Banken zu öffnen. Die gegenwärtige Trennung führt in Deutschland nicht zu einer marktgerechten und volkswirtschaftlich effizienten Kapitalallokation.
Der deutsche Bankensektor hat im weltweiten wie auch im europäischen Vergleich bezogen auf die Einwohnerzahl eine zu hohe Anzahl von Banken mit einem zu dichtem Filialnetz. Diese häufig mit den Schlagworten "over-banked" und "over-branched" beschriebene Situation führt zu einer deutlich unterdurchschnittlichen Profitabilität und einer geringeren Innovationsfähigkeit. Dies liegt vor allem darin begründet, dass überregionale deutsche Wettbewerber zwar ein hohes Produktinnovationspotential innerhalb ihrer einzelnen Fachabteilungen vorweisen, es fehlt jedoch insbesondere im Retail-Bereich der deutschlandweit enge Bezug zur Kundenbasis.
Verteilung der Marktanteile lähmt Innovation
Marktanteile von deutlich unter zehn Prozent deutschlandweit (Top 5 Banken in Deutschland zusammen 19 Prozent Marktanteil versus 75 Prozent in Großbritannien) liefern keine ausreichende Basis, um hohe Innovationskosten zu rechtfertigen. Andererseits genießen regionale Marktteilnehmer oft Marktanteile von 50 Prozent und mehr in der jeweiligen Region, in der sie tätig sind. Das lokale Marktpotential rechtfertigt meist nicht entsprechend notwendige Innovationsausgaben für neue Produkte.
Da schließlich bisher nur sehr wenig Produkt- und Know-how-Transfer über die Sektorgrenzen des öffentlich-rechtlichen, genossenschaftlichen und privaten Bankgewerbes von Produzenten zu Distributoren stattgefunden hat, bleibt der Markt fragmentiert, einem hohen regionalen Risiko ausgesetzt, wenig profitabel und im internationalen Vergleich weniger innovativ. Dies ist weder im Interesse der Bankkunden noch der Banken selbst.
Zusammenschlüsse sind zu erleichtern
Im Sinne eines profitableren und innovativeren Finanzsystems, das in der Folge dann auch eine deutlich höhere Attraktivität für seine Kunden und für ausländisches Kapital hat, sollten Bankenzusammenschlüsse und -kooperationen auch über Sektorgrenzen ermöglicht und entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Auch wenn der öffentlich diskutierte Prozentsatz der notleidenden Kredite am gesamten deutschen Kreditvolumen gering erscheint, sind die potentiellen absoluten Zahlen und die daraus resultierenden möglichen Abschreibungen zulasten des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals der Banken für manche Institute nach unserer Auffassung signifikant. Hohe Kreditvolumina auf den Bilanzen der Banken lähmen aufgrund ihrer Eigenkapitalbindung die Möglichkeit der Neuvergabe von Krediten. Nach Basel II werden diese Kredite ab 2007 mit relativ mehr Eigenkapital zu unterlegen sein, so dass bereits Befürchtungen eines "Credit Crunch", das heißt, eines Mangels an Kreditvolumina zur Neuvergabe, im Markt zu hören sind.
Verstärkte Verbriefung von Krediten schafft Luft
Diese Probleme lassen sich grundsätzlich auf die historisch gewachsene Finanzierungsstruktur der deutschen Wirtschaft zurückführen. Im internationalen Vergleich spielen immer noch Bankenkredite eine bei weitem dominierende Rolle gegenüber einer Finanzierung über den Kapitalmarkt. Neben der generellen Forderung, dass die Finanzierungsstruktur deutscher Unternehmen zukünftig stärker auf Kapitalmarktprodukten aufgebaut und weniger auf Bankkrediten basiert sein sollte, ergibt sich aus der aktuellen Situation des deutschen Bankensektors die Notwendigkeit, Kredite stärker als bisher verbriefen und damit dem Kapitalmarkt zugänglich machen zu können.
Die daraus resultierende Eigenkapitalentlastung der deutschen Finanzinstitute eröffnet Raum für die Neuvergabe von Krediten insbesondere an jene Teile der deutschen Wirtschaft, die kurzfristig noch keinen oder nur sehr erschwerten Zugang zum Kapitalmarkt haben. Zudem führt die Verbriefung auch zu einer marktgerechteren Bewertung der Kreditportfolios der deutschen Banken und damit zu einer höheren Transparenz und Attraktivität für ausländische Investoren. Dabei sind allerdings die Folgen möglicher Abschreibungen bei Kreditinstituten zu berücksichtigen, würden sie in Folge der Verbriefung ihre Kreditportfolios zu Marktwerten anstatt zu Buchwerten ausweisen.
Diese Situation ist für hoch entwickelte Industrienationen nicht neu. So haben bereits Länder wie die USA, Italien oder Frankreich Lösungen für ähnliche Problemstellungen gefunden. Nur durch entsprechende regulatorische Anreizstrukturen werden diese Probleme nachhaltig gelöst. Beispiele wie Japan zeigen, dass ohne entsprechende regulatorische Maßnahmen fundamentale Probleme zum dauerhaften Nachteil der Volkswirtschaft nicht bereinigt werden können.
In diesem Zusammenhang sind die Planungen der Bundesregierung hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen für Asset Backed Securities Zweckgesellschaften sowie die "True Sales Initiative" der KfW und anderer Banken für sogenannte "performing loans" ein wichtiger erster Schritt zur Eröffnung eines neuen Marktsegments für die Verbriefung von Bankkrediten.
Beteiligungen: Rechtslage schreckt Investoren ab
Ein weiterer struktureller Nachteil des deutschen Bankensektors ergibt sich aus der Tatsache, dass Beteiligungen beziehungsweise die Absicht des Erwerbs einer Beteiligung an deutschen Finanzinstitutionen in Höhe von zehn Prozent oder mehr der BaFin anzuzeigen sind und von dieser untersagt werden können. Insbesondere die Anzeigepflicht der Erwerbsabsicht führt vor allem bei ausländischen Investoren zu großer Zurückhaltung. Zudem besteht Unsicherheit hinsichtlich der möglichen Untersagungsgründe. Angesichts der Konkurrenz um Investorenkapital sollte in diesem Bereich größere Rechtssicherheit geschaffen werden.
Ungeachtet der wohlverstandenen Schutzfunktion dieser Regelung sollte auch in Betracht gezogen werden, ob angesichts globalisierender Kapitalmärkte und entsprechender Finanzaufsicht eine solche Regelung generell noch erforderlich ist. Zu denken wäre zum Beispiel an die Schaffung eines Ausnahmetatbestandes, nach dem Investitionen in deutsche Finanzinstitutionen durch in- oder ausländische Kapitalgeber möglich wären, sofern diese selbst der Aufsicht einer international anerkannten Aufsichtsbehörde unterstehen. Ein solches Subsidiaritätsprinzip würde die Transparenz des deutschen Finanzsektors und damit seine Attraktivität und die Transaktionssicherheit für in- und ausländische Investoren erheblich verbessern.
These 5: Eine der zentralen Herausforderungen der öffentlichen Finanzen wie der Unternehmen und der Rentenversicherung, nämlich die Sicherung einer langfristig angemessenen Altersvorsorge, bietet zugleich ein erhebliches Potential für eine Vertiefung des deutschen Kapitalmarktes.
Der demographische Wandel macht die gegenwärtige Umlagenfinanzierung, im Englischen treffend "pay-as-you-go" genannt, als alleinige Grundlage zur Erfüllung von Renten- beziehungsweise Pensionsansprüchen hinfällig. Neben Fragen der Anpassung der Leistungen steht die Notwendigkeit einer zumindest teilweise kapitalgedeckten Finanzierung heute außer Zweifel.
Die öffentlichen Haushalte können die stark steigenden jährlichen Zuschüsse für die Rentenkassen nicht mehr verkraften und finanzieren. Letzte Schätzungen erwarten für Deutschland 2003 einen staatlichen Zuschuss in die Rentekasse von etwa 77 Milliarden Euro.
Zu den dringend benötigten Reformmaßnahmen zählen auch systemische Elemente, wie zum Beispiel: die Stärkung der kapitalgedeckten Elemente der Altersversorgung auf der Basis freiwilliger Systeme, die einheitliche steuerliche Behandlung (nachgelagerte Besteuerung) der unterschiedlichen Rentenarten sowie der Abbau administrativer und bürokratischer Hindernisse vor allem im Bereich der privaten Vorsorge (Riester-Rente).
Beitragsbezogene (zum Beispiel bis zehn Prozent des Gehalts per anno), nachgelagert besteuerte Altersvorsorgeverträge sollten genügend Möglichkeiten zur arbeitnehmerfinanzierten Altersvorsorge schaffen, unabhängig von der Wahl des jeweiligen Finanzproduktes (Investmentfonds, Lebensversicherung, Banksparplan etc.). Eine weitere Stärkung der betrieblichen Altersversorgung als effizienter und kostengünstiger Weg der Altersvorsorge schafft auch Freiräume zur Umstellung der Struktur der gesetzlichen Rentenversicherung.
Ungeahnte Dimensionen der Altersvorsorgevermögen
Um beispielsweise den Anteil der betrieblichen Altersversorgung am Alterseinkommen der Rentnerhaushalte von heute fünf Prozent auf immer noch international unterdurchschnittliche 15 Prozent zu steigern, müssten weitere Mittel in Höhe von circa 600 Milliarden Euro angesammelt werden. Altersvorsorgevermögen können bei diesen Gesamtvolumina eine volkwirtschaftliche bedeutende Quelle von langfristigem Eigenkapital für die deutsche Volkswirtschaft darstellen. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung der Dax30-Unternehmen beträgt gegenwärtig circa 400 Milliarden Euro.
Die Finanzierung der leistungsbezogenen Pensionszusagen (Direktzusagen) deutscher Unternehmen mit Hilfe von Pensionsrückstellungen ist eine über Jahrzehnte etablierte Methode. Die Summe der in Deutschland über Pensionsrückstellungen finanzierten betrieblichen Pensionsversprechen belief sich Ende 2002 auf circa 220 Milliarden Euro. Davon sind etwa 25 Prozent (55 Milliarden Euro) durch Finanzanlagen gedeckt. Die verbleibenden circa 165 Milliarden Euro sind traditionell im Wege der Innenfinanzierung in den Unternehmen reinvestiert. Nach internationalen Bilanzstandards erhöht sich dieser Betrag der ungedeckten Pensionsverbindlichkeiten ("unfunded pension liabilities") auf circa 230 Milliarden Euro, da nach diesen Regeln nur Finanzanlagen, welche extern verwaltet werden, den Status von Pensionsgeldern erlangen können.
"Pension Trusts": Die Vorteile für den Konzern
Daher haben vor allem große und international tätige deutsche Konzerne "Pension Trusts" zum Zwecke der externen Finanzierung von Pensionsverbindlichkeiten aufgelegt; Beispiele sind DaimlerChrysler, Siemens, Volkswagen, Schering und die Deutsche Bank.
Ein "Pension Trust" erlaubt den Unternehmen, eine verbesserte Bilanzstruktur zu erzielen (Saldierung der Verbindlichkeiten mit dem Planvermögen) und den Einfluss kapitalmarktfremder Überlegungen auf die Anlage des Planvermögens auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die von den internationalen beziehungsweise amerikanischen Pension Accounting Standards vorgesehenen Glättungsmechanismen ermöglichen es, die durch kurzfristige Schwankungen des Deckungsgrades verursachte Volatilität der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz zu reduzieren. Dadurch ist sichergestellt, dass sämtliche Asset-Klassen berücksichtigt werden können, und die Portfoliostruktur des Planvermögens sich besser an den langfristigen Verbindlichkeitsströmen ausrichten lässt (Asset-Liability-Management).
Deshalb können Unternehmen mit externen kapitalgedeckten Pensionsplänen langfristig höhere Kapitalerträge und somit eine kostengünstigere Finanzierung ihrer betrieblichen Pensionsverbindlichkeiten erwarten.
Die größten Pensionsfonds der Welt sind Versorgungswerke von öffentlichen Angestellten, zum Beispiel Calpers (USA, 150 Milliarden Dollar), ABP (Niederlande, 145 Milliarden Euro). Sie zählen zu den größten institutionellen Investoren der Welt und spiegeln eine andere Vorsorgephilosophie dieser Länder (USA, Niederlande, Schweiz, Großbritannien, Irland usw.) wider.
Auch in diesen Ländern wird die Sozialversicherung, obwohl sie oft nur den Charakter einer Grundversorgung hat, über ein Umlageverfahren finanziert. Aber die Pensionsverbindlichkeiten der eigenen Angestellten und deren Kosten sind durch kapitalgedeckte Versorgungswerke nicht auf Folgegenerationen von Steuerzahlern verlagert.
Die Zukunft des Beamten-Pensionssystems
In Deutschland treffen wir auf eine andere Situation. Die Versorgungsverbindlichkeiten für die Beamten werden im wesentlichen aus den Steuereinnahmen im Wege eines Umlageverfahrens finanziert. Kapitalstöcke sind über die Jahrzehnte nicht aufgebaut worden. Durch die demographische Entwicklung und die spezifische Einstellungspolitik des öffentlichen Sektors in den 60er und den 70er Jahren werden die öffentlichen Haushalte durch die Pensionslasten zukünftig außerordentlich belastet. Die Länderhaushalte stehen hier besonders unter Druck, da große Gruppen wie zum Beispiel Lehrer, Polizisten und Verwaltungsbeamte über die Länderhaushalte finanziert werden.
Um die Altersvorsorge der heute aktiven Beamten periodengerecht vorzufinanzieren, müssten die laufenden Besoldungen um einen Aufwandbeitrag von circa 25 Prozent bis 30 Prozent per anno erhöht werden. Da der Gesamtverpflichtungsumfang der nicht ausfinanzierten Altersversorgungszusagen für die Beamten des Bundes, der Länder und der Kommunen etwas mehr als 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt, ist es nicht vorstellbar, eine vollständige Kapitaldeckung aufzubauen.
Generationengerechte Finanzierung der Pensionslasten
Deshalb ist der Aufbau von teilkapitalgedeckten Vorsorgesystemen im öffentlichen Sektor der einzig gangbare Ansatz, die Finanzierung der Pensionslasten generationengerecht zu gestalten. Der öffentliche Sektor vollzöge zudem mit dem Einstieg in eine teilweise kapitalgedeckte Finanzierung seiner Pensionszusagen, was im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge mit erheblichem Aufwand gefördert wird.
Mit den zu erwartenden weiteren Vermögenswerten unter Treuhänderschaft (bei einer angenommenen Kapitaldeckung von 50 Prozent der Pensionsverbindlichkeiten für die Beamten mehr als 250 Milliarden Euro) könnte die öffentliche Hand selbst als Nachfrager ein Innovator von Anlageprodukten werden.
Allerdings kommt es entscheidend darauf an, dass Pensionsfonds der öffentlichen Hand dem Zugriff des jeweiligen laufenden Haushalts entzogen sind und die Anlagerichtlinien den Regeln der Risikodiversifizierung moderner Portfoliotheorie entsprechen. Durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen in Deutschland zum Aufbau entsprechender Versorgungswerke und effizienter Investitionsrahmenbedingungen ergibt sich hier eine bedeutende Chance. Öffentliche Versorgungswerke könnten zur mittelfristigen Entlastung der öffentlichen Haushalte sowie zur Sicherung der Pensionszusagen beitragen.
Der Finanzplatz Deutschland steht wie der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt vor großen Herausforderungen. Der aus den Anträgen der Fraktionen ablesbare Grad an Übereinstimmung in dem Bestreben zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ist ermutigend. Wie in der Gesamtwirtschaft erwarten die Marktteilnehmer eine zügige Umsetzung wachstums- und beschäftigungsfördernder Reformen.
manager-magazin.de, 10.06.2003
Redaktionelle Bearbeitung durch Lutz Reiche
http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,252179,00.…
.
Gold`s versatility shines through
By Kevin Morrison / FINANCIAL TIMES
Gold to the Pharaohs of Ancient Egypt was "flesh of the gods" to the early Christians it was a symbol of heavenly light and divine glory, but today the world is not quite sure what to make of the precious metal.
Gold is no longer the jewellery metal of choice to many well-heeled young people in the United States, Britain and China, who prefer instead to to wear platinum.
Most investors still value it as a currency, a role it has played for most of its history, although some see it like any other metal where the price is determined by supply and demand trends.
Steve Matthews, a commodities strategist at hedge fund manager Tudor Investment Corp, is clear what he thinks about gold. "For us as a trading institution, gold behaves as a foreign exchange instrument, not as a regular commodity like wheat or live cattle," Mr Matthews told the London Bullion Market Association gold conference this week.
"The fundamentals put it outside the range of commodity trading for us. Which doesn`t mean we don`t trade it, we do, but it`s as a foreign exchange, not as a commodity," Mr Matthew told the conference, which was held in Lisbon.
This view, if correct, should bode well for gold in the forseeable future.
Given that most of gold`s 40 per cent rise since reaching a 21-year nadir of $252.85 in July 1999 to the current level of about $367 a troy ounce has happened since the beginning of last year, over the same time the US dollar has fallen by about a third.
This performance reinforces the perception that gold has an inverse relationship with the world`s most traded currency.
Based on Tudor`s supply and demand assumptions, Matthews says there is enough gold above the ground that would supply 6,677 days of current demand, or more than 18 years. On this premise, Mr Matthews says demand issues should not influence the gold price.
All other commodities had less than a year`s supply, ranging from soybean meal at less than three days to platinum at almost 300 days, and therefore should be valued as a commodity, Mr Matthews said.
Trevor Steel, partner at London-based specialist natural resources fund manager Baker Steel Capital Managers also likens gold to a currency.
"Where do investors go if they want to get out of the dollar? The Japanese government wants to weaken the yen, the euro is a new currency underpinned by economies that have already broken their own rules on budget deficits, designed to give the currency credibility. So you really have to pick the best of a bad bunch and that`s where gold is starting to get a look in," said Mr Steel.
Many economists predict the dollar will slide further against the euro with estimates varying between $1.2 to $1.4 from the existing $1.18 level.
"If gold prices were to only track currencies, and the dollar were to reach $1.35 that would equate to a $419 gold price," said Allan Williamson, precious metals analyst at HSBC - the world`s largest bullion bank.
HSBC forecasts the US dollar to reach $1.35 against the single currency by the end of next year.
Fund managers are betting $3.6bn that gold prices will rise further, largely at the expense of the dollar.
Investors in gold futures contracts on the Commodity Metals Exchange (Comex) in New York held net long positions, an indication by investors that prices will rise, of 9.8m ounces - more than all of the gold produced last year in the United States. This is about 50 per cent above the average net long position since funds started positioning themselves for higher prices in May 2001.
This is not too far off the record net long position on Comex gold of 12m ounces, which almost equates to total output from the world`s largest producer South Africa, in early February when the gold price hit $388.50 a troy ounce, its highest level in more than six years.
Economists predict that next year will also see the US dollar reach its low point before turning around again, which will then test gold resilience. The gold industry is hoping that by this stage the gold price will revert to behaving like a commodity.
The World Gold Council, the industry lobby group backed by gold miners, hopes to list low cost exchange traded gold funds on the New York, London, Tokyo, Toronto and Johannesburg exchanges opening up gold investment to a wider audience. At present gold investors are the mainly funds and wealthy private investors.
The council is also promoting the gold funds as a prudent risk management tool to fund managers, given that the metalcan act as a natural hedge in any portfoilio, as it rises when times are bad and hence most funds are performing poorly, although it may clip returns in better economic times.
The industry is devising new initiatives in jewellery, and hopes to double industrial demand over the next decade. Last year gold usage in dentistry, electronics and other industrial applications accounted for about 8 per cent of total supply.
FT – 09.06.2003
---
Analysten heben ihre Prognosen für Goldpreis an
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Heftige Diskussionen über die künftige Entwicklung des Goldpreises bestimmten Anfang vergangener Woche die Jahreskonferenz der London Bullion Market Association (LBMA) in Lissabon.
Einig waren sich die Experten, dass der Anstieg der Notierungen in den vergangenen 18 Monaten zu einem erheblichen Teil auf die Rückkäufe von Terminabsicherungsgeschäften durch die Minen zurückzuführen war, die in Erwartung eines steigenden Goldpreises allein 2002 fast 500 Tonnen Gold und damit ein Sechstel der gesamten Nachfrage zurückgekauft haben. Daneben stützte der Kursrückgang des Dollar zum Euro den Goldpreis. Eine ganze Reihe institutioneller und zu einem kleineren Teil auch private Investoren außerhalb der USA haben sich mit dem Kauf von Gold in günstiger lokaler Währung abgesichert.
Dieser Faktor wird den Goldmarkt auch in Zukunft beeinflussen. Die Devisenanalysten von Dresdner Kleinwort Wasserstein rechnen damit, dass der Euro in den nächsten zwölf Monaten die Marke von 1,35 $ erreicht. Sollte die hohe Korrelation zwischen dem Goldkurs und der Euro-Entwicklung in diesem Zeitraum anhalten und der Preis von etwa 310 Euro je Feinunze gehalten werden, würde dies einen Dollar-Preis von deutlich über 400 $ je Unze bedeuten.
In diesem Umfeld hat auch die Deutsche Bank ihre Goldpreisprognose deutlich angehoben. Im Durchschnitt erwartet Analyst Peter Richardson für dieses Jahr Preise von 357 $ je Unze. Für 2004 und 2005 sagt er durchschnittlich bis zu 380 $ je Unze voraus.
Enge Marge
Vergangene Woche schwankte das Edelmetall in einer relativ engen Preisspanne von 360 bis 370 $ je Unze. Auch für diese Woche erwarten Händler keinen Ausbruch aus diesem Band.
Deutlicher als von vielen Marktteilnehmern erwartet stieg Platin, das die charttechnische Widerstandslinie von 650 $ je Unze übersprang und in der Spitze bis auf 673 $ je Unze kletterte. Ein Grund hierfür waren Spekulanten in Japan. Einen fundamentalen Grund lieferte in Lissabon Alan Williamson, Rohstoff-Analyst bei HSBC, der die russischen Platinvorräte auf nur noch 200.000 bis 300.000 Unzen bezifferte. Die hohen, in den 80er und 90er Jahren aufgebauten Vorräte seien weitgehend abgebaut. Dies sei die Erklärung dafür, warum die russischen Verkäufe in den vergangenen Jahren trotz hoher Platinpreise kaum über den Produktionsziffern gelegen hätten.
Williamson sieht eine Rückkehr des Platinpreises auf das 23-Jahres-Hoch bei 710 $, das Anfang 2003 erreicht worden war, als sehr wahrscheinlich an. Mit einem darüber weiteren Anstieg auf das Rekordhoch von rund 1000 $ je Unze rechnet er derzeit aber nicht.
SARS drückt auch auf Platin
Ohne zusätzliche Nachfrage der Investoren würden weitere Kursgewinne ohnehin nur schwer zu halten sein. Die physische Nachfrage ist momentan eher unter Druck. In China haben die Verkäufe an Platinschmuck in den letzten Monaten unter der Lungenkrankheit SARS gelitten, und auch die Industrie hält sich weltweit wegen des hohen Preisniveaus mit größeren Käufen zurück. Das hat zur Folge, dass relativ viele Firmen das Metall heute am Kassamarkt kaufen müssen, was das Rückschlagspotenzial einschränkt.
Institutionelle Investoren sehen den Platinmarkt trotz der von allen Edelmetallen besten fundamentalen Bedingungen als schwierig an. Sie verweisen, wie zuletzt in Lissabon Steve Matthews von Tudor Investments, auf die geringe Liquidität des Marktes. Bei einer Weltjahresproduktion im Wert von nur 4 Mrd. $ würde ein vergleichsweise geringes Engagement ausreichen, um den Markt nach oben zu drücken. Diese geringe Markttiefe erschwert außerdem Gewinnmitnahmen.
FTD - 10.06.2003
Gold`s versatility shines through
By Kevin Morrison / FINANCIAL TIMES
Gold to the Pharaohs of Ancient Egypt was "flesh of the gods" to the early Christians it was a symbol of heavenly light and divine glory, but today the world is not quite sure what to make of the precious metal.
Gold is no longer the jewellery metal of choice to many well-heeled young people in the United States, Britain and China, who prefer instead to to wear platinum.
Most investors still value it as a currency, a role it has played for most of its history, although some see it like any other metal where the price is determined by supply and demand trends.
Steve Matthews, a commodities strategist at hedge fund manager Tudor Investment Corp, is clear what he thinks about gold. "For us as a trading institution, gold behaves as a foreign exchange instrument, not as a regular commodity like wheat or live cattle," Mr Matthews told the London Bullion Market Association gold conference this week.
"The fundamentals put it outside the range of commodity trading for us. Which doesn`t mean we don`t trade it, we do, but it`s as a foreign exchange, not as a commodity," Mr Matthew told the conference, which was held in Lisbon.
This view, if correct, should bode well for gold in the forseeable future.
Given that most of gold`s 40 per cent rise since reaching a 21-year nadir of $252.85 in July 1999 to the current level of about $367 a troy ounce has happened since the beginning of last year, over the same time the US dollar has fallen by about a third.
This performance reinforces the perception that gold has an inverse relationship with the world`s most traded currency.
Based on Tudor`s supply and demand assumptions, Matthews says there is enough gold above the ground that would supply 6,677 days of current demand, or more than 18 years. On this premise, Mr Matthews says demand issues should not influence the gold price.
All other commodities had less than a year`s supply, ranging from soybean meal at less than three days to platinum at almost 300 days, and therefore should be valued as a commodity, Mr Matthews said.
Trevor Steel, partner at London-based specialist natural resources fund manager Baker Steel Capital Managers also likens gold to a currency.
"Where do investors go if they want to get out of the dollar? The Japanese government wants to weaken the yen, the euro is a new currency underpinned by economies that have already broken their own rules on budget deficits, designed to give the currency credibility. So you really have to pick the best of a bad bunch and that`s where gold is starting to get a look in," said Mr Steel.
Many economists predict the dollar will slide further against the euro with estimates varying between $1.2 to $1.4 from the existing $1.18 level.
"If gold prices were to only track currencies, and the dollar were to reach $1.35 that would equate to a $419 gold price," said Allan Williamson, precious metals analyst at HSBC - the world`s largest bullion bank.
HSBC forecasts the US dollar to reach $1.35 against the single currency by the end of next year.
Fund managers are betting $3.6bn that gold prices will rise further, largely at the expense of the dollar.
Investors in gold futures contracts on the Commodity Metals Exchange (Comex) in New York held net long positions, an indication by investors that prices will rise, of 9.8m ounces - more than all of the gold produced last year in the United States. This is about 50 per cent above the average net long position since funds started positioning themselves for higher prices in May 2001.
This is not too far off the record net long position on Comex gold of 12m ounces, which almost equates to total output from the world`s largest producer South Africa, in early February when the gold price hit $388.50 a troy ounce, its highest level in more than six years.
Economists predict that next year will also see the US dollar reach its low point before turning around again, which will then test gold resilience. The gold industry is hoping that by this stage the gold price will revert to behaving like a commodity.
The World Gold Council, the industry lobby group backed by gold miners, hopes to list low cost exchange traded gold funds on the New York, London, Tokyo, Toronto and Johannesburg exchanges opening up gold investment to a wider audience. At present gold investors are the mainly funds and wealthy private investors.
The council is also promoting the gold funds as a prudent risk management tool to fund managers, given that the metalcan act as a natural hedge in any portfoilio, as it rises when times are bad and hence most funds are performing poorly, although it may clip returns in better economic times.
The industry is devising new initiatives in jewellery, and hopes to double industrial demand over the next decade. Last year gold usage in dentistry, electronics and other industrial applications accounted for about 8 per cent of total supply.
FT – 09.06.2003
---
Analysten heben ihre Prognosen für Goldpreis an
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Heftige Diskussionen über die künftige Entwicklung des Goldpreises bestimmten Anfang vergangener Woche die Jahreskonferenz der London Bullion Market Association (LBMA) in Lissabon.
Einig waren sich die Experten, dass der Anstieg der Notierungen in den vergangenen 18 Monaten zu einem erheblichen Teil auf die Rückkäufe von Terminabsicherungsgeschäften durch die Minen zurückzuführen war, die in Erwartung eines steigenden Goldpreises allein 2002 fast 500 Tonnen Gold und damit ein Sechstel der gesamten Nachfrage zurückgekauft haben. Daneben stützte der Kursrückgang des Dollar zum Euro den Goldpreis. Eine ganze Reihe institutioneller und zu einem kleineren Teil auch private Investoren außerhalb der USA haben sich mit dem Kauf von Gold in günstiger lokaler Währung abgesichert.
Dieser Faktor wird den Goldmarkt auch in Zukunft beeinflussen. Die Devisenanalysten von Dresdner Kleinwort Wasserstein rechnen damit, dass der Euro in den nächsten zwölf Monaten die Marke von 1,35 $ erreicht. Sollte die hohe Korrelation zwischen dem Goldkurs und der Euro-Entwicklung in diesem Zeitraum anhalten und der Preis von etwa 310 Euro je Feinunze gehalten werden, würde dies einen Dollar-Preis von deutlich über 400 $ je Unze bedeuten.
In diesem Umfeld hat auch die Deutsche Bank ihre Goldpreisprognose deutlich angehoben. Im Durchschnitt erwartet Analyst Peter Richardson für dieses Jahr Preise von 357 $ je Unze. Für 2004 und 2005 sagt er durchschnittlich bis zu 380 $ je Unze voraus.
Enge Marge
Vergangene Woche schwankte das Edelmetall in einer relativ engen Preisspanne von 360 bis 370 $ je Unze. Auch für diese Woche erwarten Händler keinen Ausbruch aus diesem Band.
Deutlicher als von vielen Marktteilnehmern erwartet stieg Platin, das die charttechnische Widerstandslinie von 650 $ je Unze übersprang und in der Spitze bis auf 673 $ je Unze kletterte. Ein Grund hierfür waren Spekulanten in Japan. Einen fundamentalen Grund lieferte in Lissabon Alan Williamson, Rohstoff-Analyst bei HSBC, der die russischen Platinvorräte auf nur noch 200.000 bis 300.000 Unzen bezifferte. Die hohen, in den 80er und 90er Jahren aufgebauten Vorräte seien weitgehend abgebaut. Dies sei die Erklärung dafür, warum die russischen Verkäufe in den vergangenen Jahren trotz hoher Platinpreise kaum über den Produktionsziffern gelegen hätten.
Williamson sieht eine Rückkehr des Platinpreises auf das 23-Jahres-Hoch bei 710 $, das Anfang 2003 erreicht worden war, als sehr wahrscheinlich an. Mit einem darüber weiteren Anstieg auf das Rekordhoch von rund 1000 $ je Unze rechnet er derzeit aber nicht.
SARS drückt auch auf Platin
Ohne zusätzliche Nachfrage der Investoren würden weitere Kursgewinne ohnehin nur schwer zu halten sein. Die physische Nachfrage ist momentan eher unter Druck. In China haben die Verkäufe an Platinschmuck in den letzten Monaten unter der Lungenkrankheit SARS gelitten, und auch die Industrie hält sich weltweit wegen des hohen Preisniveaus mit größeren Käufen zurück. Das hat zur Folge, dass relativ viele Firmen das Metall heute am Kassamarkt kaufen müssen, was das Rückschlagspotenzial einschränkt.
Institutionelle Investoren sehen den Platinmarkt trotz der von allen Edelmetallen besten fundamentalen Bedingungen als schwierig an. Sie verweisen, wie zuletzt in Lissabon Steve Matthews von Tudor Investments, auf die geringe Liquidität des Marktes. Bei einer Weltjahresproduktion im Wert von nur 4 Mrd. $ würde ein vergleichsweise geringes Engagement ausreichen, um den Markt nach oben zu drücken. Diese geringe Markttiefe erschwert außerdem Gewinnmitnahmen.
FTD - 10.06.2003
.
Bernd Niquet:
Marktberichte sind Bullenfallen
Man kann eigentlich immer nur noch staunen, mit welchem Irrsinn die Marktkommentatoren manchmal die Börsen begleiten. Da bekommen die Redakteure ihre Vorgaben, 1.000, 2.000 oder 3.000 Zeichen über das Marktgeschehen zu schreiben – und schon ist die Vernunft ausgeklinkt wie weiland Möllemanns Fallschirm. Denn wie soll man auch so viele Zeichen über etwas schreiben, über das sich gar nicht schreiben lässt?
Deswegen wird also munter loserfunden. Warum könnten die Kurse in der letzten Woche so gestiegen sein? Natürlich, es gab ja eine Zinsentscheidung der EZB. Bei allen anderen Zinsentscheidungen der letzten Zeit sind die Kurse zwar niemals gestiegen, doch das macht ja gar nichts. Dann ruft man eben ein neues Paradigma aus. Oder noch besser die Rückkehr eines alten. Jetzt wird alles wieder gut! Und warum sind die Kurse nicht am Donnerstag gestiegen, sondern erst am Freitag? Ein völlig neuer und geheimnisvoller Time-lag möglicherweise?!
Kostolany-Schüler werden jetzt sicherlich gelangweilt gähnen, denn zu offensichtlich ist es, dass hier die Kurse die Nachrichten machen und nicht umgekehrt. Und ich weiß auch nicht, warum ich mich so ärgere. Vielleicht deshalb, weil es einem regelrecht ins Gesicht springt, dass hier und jetzt erneut die Arglosen abgezockt werden. "Mit eintägiger Verspätung feierten die Anleger den großen Zinsschritt der EZB." Wer so etwas schreibt, glaubt auch daran, dass der Pfingstdurchfall von der Currywurst verursacht worden ist, die man an Himmelfahrt gegessen hat.
Beim Dax von 2.200 Punkten habe ich geschrieben: "Wer jetzt keine Aktien kauft, der sollte sich schwören, niemals wieder welche zu kaufen." Diesen Spruch sollte der potentielle Anleger heute mehr denn je beherzigen. Die Welt hat sich in den letzten Wochen nur unwesentlich geändert – das Kursniveau jedoch erheblich. Eine Welle des Pessimismus ist durch eine Welle des Optimismus abgelöst worden. Und warum diese steigenden Kurse? Ich bin mir sicher, dass das viel eher mit dem Stuhlgang der Marktteilnehmer als mit der EZB oder sonstigem Voodoo zu tun hat.
Der Antizykliker sollte also ganz langsam daran denken, seine Positionen wieder abzubauen. Denn der Antizykliker hat die Panik gekauft – und muss nun spiegelbildlich natürlich die Euphorie verkaufen.
10.06.2003
Bernd Niquet:
Marktberichte sind Bullenfallen
Man kann eigentlich immer nur noch staunen, mit welchem Irrsinn die Marktkommentatoren manchmal die Börsen begleiten. Da bekommen die Redakteure ihre Vorgaben, 1.000, 2.000 oder 3.000 Zeichen über das Marktgeschehen zu schreiben – und schon ist die Vernunft ausgeklinkt wie weiland Möllemanns Fallschirm. Denn wie soll man auch so viele Zeichen über etwas schreiben, über das sich gar nicht schreiben lässt?
Deswegen wird also munter loserfunden. Warum könnten die Kurse in der letzten Woche so gestiegen sein? Natürlich, es gab ja eine Zinsentscheidung der EZB. Bei allen anderen Zinsentscheidungen der letzten Zeit sind die Kurse zwar niemals gestiegen, doch das macht ja gar nichts. Dann ruft man eben ein neues Paradigma aus. Oder noch besser die Rückkehr eines alten. Jetzt wird alles wieder gut! Und warum sind die Kurse nicht am Donnerstag gestiegen, sondern erst am Freitag? Ein völlig neuer und geheimnisvoller Time-lag möglicherweise?!
Kostolany-Schüler werden jetzt sicherlich gelangweilt gähnen, denn zu offensichtlich ist es, dass hier die Kurse die Nachrichten machen und nicht umgekehrt. Und ich weiß auch nicht, warum ich mich so ärgere. Vielleicht deshalb, weil es einem regelrecht ins Gesicht springt, dass hier und jetzt erneut die Arglosen abgezockt werden. "Mit eintägiger Verspätung feierten die Anleger den großen Zinsschritt der EZB." Wer so etwas schreibt, glaubt auch daran, dass der Pfingstdurchfall von der Currywurst verursacht worden ist, die man an Himmelfahrt gegessen hat.
Beim Dax von 2.200 Punkten habe ich geschrieben: "Wer jetzt keine Aktien kauft, der sollte sich schwören, niemals wieder welche zu kaufen." Diesen Spruch sollte der potentielle Anleger heute mehr denn je beherzigen. Die Welt hat sich in den letzten Wochen nur unwesentlich geändert – das Kursniveau jedoch erheblich. Eine Welle des Pessimismus ist durch eine Welle des Optimismus abgelöst worden. Und warum diese steigenden Kurse? Ich bin mir sicher, dass das viel eher mit dem Stuhlgang der Marktteilnehmer als mit der EZB oder sonstigem Voodoo zu tun hat.
Der Antizykliker sollte also ganz langsam daran denken, seine Positionen wieder abzubauen. Denn der Antizykliker hat die Panik gekauft – und muss nun spiegelbildlich natürlich die Euphorie verkaufen.
10.06.2003
.
für Goldbugs könnte es langsam eng werden ...
Anleger wetten auf Fortsetzung der US-Rallye
Experten: Schwacher Dollar gibt Hoffnung auf gute Quartalszahlen - Präsidenten-Zyklus spricht für steigende Kurse
von Daniel Eckert
Berlin - Verweile doch, du bist so schön! Dieser Seufzer dürfte derzeit dem Mund so manchen Börsianers entfahren. Denn zum ersten Mal seit drei Jahren scheinen die Aktienmärkte sich in einer Hausse zu befinden, die den Namen verdient. Auch gestern setzte der Dax mit einem Plus von 1,2 Prozent die freundliche Börsentendenz der vergangenen Wochen fort. Seit seinem Jahrestief hat das deutsche Standardwertebarometer bereits mehr als 40 Prozent gewonnen. Doch auch jenseits des großen Teiches war mit Aktien Geld zu verdienen. Der Dow Jones legte seit März knapp 20 Prozent zu.
Viele Marktbeobachter glauben, dass sich der Aufschwung fortsetzt. "Mittelfristig sieht es vor allem an den amerikanischen Aktienmärkten sehr gut aus", sagt Klaus Aulbach, Stratege bei der ING BHF-Bank. Treibstoff für die Rallye seien Bushs Steuersenkungen, das robuste US-Wachstum und die hohe Liquidität.
Für steigende Notierungen sprächen zudem börsenhistorische Erfahrungen: "Der US-Markt bewegen sich traditionell in einem Vierjahresrhythmus. Zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten - in diesem Fall 2002/03 - erreichen die Kurse ein zyklisches Tief, gegen Ende der Amtszeit steigen sie wieder kräftig an." Dies sei darauf zurückzuführen, dass wirtschafts- und kapitalmarktfreundliche Maßnahmen rechtzeitig zum Wahlkampf zu greifen beginnen. Aulbachs Szenario: Dem Sommerhoch folgt eine Herbstkorrektur, die schließlich in eine Jahresendrallye mündet. Für 2004 sieht Aulbach den Dow Jones dann alte Höchststände von über 11 000 Zählern anpeilen.
Auch Thomas Radinger, Fondsmanager bei Activest, ist für die US-Börsen optimistisch gestimmt: "Die anstehenden Quartalszahlen von Boeing, McDonald`s, Altria oder Pfizer dürften nach Marktmeinung nach oben ziehen." Ein Grund für Radingers Optimismus ist der schwache Dollar, der US-Produkte auf dem Weltmarkt verbilligt und dadurch die Position der amerikanischen Exporteure stärkt. "Bei vielen Unternehmen wird sich der Währungseffekt erst in den Ergebnissen des zweiten Quartals positiv niederschlagen", sagt Radinger. Das könne den Kursen einen neuen Schub geben. Der Effekt wird sich sogar verstärken, wenn der Dollar weitere zwanzig Prozent an Wert verliert, wovon viele Devisenexperten ausgehen.
Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Denn während der schwache Dollar für die Gewinne der US-Gesellschaften förderlich ist, wirkt er in der Alten Welt umgekehrt. "Hier könnten schlechte Quartalszahlen bald einen Rückschlag auslösen und den Dax auf 2850 Punkte drücken", befürchtet Matthias Jörss, Stratege bei Sal. Oppenheim. Aber auch für Dow Jones, Nasdaq & Co. sieht Jörss Gefahren: "Derzeit herrscht ein breiter Konsens, dass die US-Firmen gute Zahlen vorlegen werden - eine solche Erwartung macht die Börse anfällig für Enttäuschungen." Trotz seines Kurzfrist-Pessimismus ist jedoch auch Jörss für Aktien mittelfristig "recht positiv" eingestellt.
DIE WELT - 11. Jun 2003
für Goldbugs könnte es langsam eng werden ...

Anleger wetten auf Fortsetzung der US-Rallye
Experten: Schwacher Dollar gibt Hoffnung auf gute Quartalszahlen - Präsidenten-Zyklus spricht für steigende Kurse
von Daniel Eckert
Berlin - Verweile doch, du bist so schön! Dieser Seufzer dürfte derzeit dem Mund so manchen Börsianers entfahren. Denn zum ersten Mal seit drei Jahren scheinen die Aktienmärkte sich in einer Hausse zu befinden, die den Namen verdient. Auch gestern setzte der Dax mit einem Plus von 1,2 Prozent die freundliche Börsentendenz der vergangenen Wochen fort. Seit seinem Jahrestief hat das deutsche Standardwertebarometer bereits mehr als 40 Prozent gewonnen. Doch auch jenseits des großen Teiches war mit Aktien Geld zu verdienen. Der Dow Jones legte seit März knapp 20 Prozent zu.
Viele Marktbeobachter glauben, dass sich der Aufschwung fortsetzt. "Mittelfristig sieht es vor allem an den amerikanischen Aktienmärkten sehr gut aus", sagt Klaus Aulbach, Stratege bei der ING BHF-Bank. Treibstoff für die Rallye seien Bushs Steuersenkungen, das robuste US-Wachstum und die hohe Liquidität.
Für steigende Notierungen sprächen zudem börsenhistorische Erfahrungen: "Der US-Markt bewegen sich traditionell in einem Vierjahresrhythmus. Zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten - in diesem Fall 2002/03 - erreichen die Kurse ein zyklisches Tief, gegen Ende der Amtszeit steigen sie wieder kräftig an." Dies sei darauf zurückzuführen, dass wirtschafts- und kapitalmarktfreundliche Maßnahmen rechtzeitig zum Wahlkampf zu greifen beginnen. Aulbachs Szenario: Dem Sommerhoch folgt eine Herbstkorrektur, die schließlich in eine Jahresendrallye mündet. Für 2004 sieht Aulbach den Dow Jones dann alte Höchststände von über 11 000 Zählern anpeilen.
Auch Thomas Radinger, Fondsmanager bei Activest, ist für die US-Börsen optimistisch gestimmt: "Die anstehenden Quartalszahlen von Boeing, McDonald`s, Altria oder Pfizer dürften nach Marktmeinung nach oben ziehen." Ein Grund für Radingers Optimismus ist der schwache Dollar, der US-Produkte auf dem Weltmarkt verbilligt und dadurch die Position der amerikanischen Exporteure stärkt. "Bei vielen Unternehmen wird sich der Währungseffekt erst in den Ergebnissen des zweiten Quartals positiv niederschlagen", sagt Radinger. Das könne den Kursen einen neuen Schub geben. Der Effekt wird sich sogar verstärken, wenn der Dollar weitere zwanzig Prozent an Wert verliert, wovon viele Devisenexperten ausgehen.
Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Denn während der schwache Dollar für die Gewinne der US-Gesellschaften förderlich ist, wirkt er in der Alten Welt umgekehrt. "Hier könnten schlechte Quartalszahlen bald einen Rückschlag auslösen und den Dax auf 2850 Punkte drücken", befürchtet Matthias Jörss, Stratege bei Sal. Oppenheim. Aber auch für Dow Jones, Nasdaq & Co. sieht Jörss Gefahren: "Derzeit herrscht ein breiter Konsens, dass die US-Firmen gute Zahlen vorlegen werden - eine solche Erwartung macht die Börse anfällig für Enttäuschungen." Trotz seines Kurzfrist-Pessimismus ist jedoch auch Jörss für Aktien mittelfristig "recht positiv" eingestellt.
DIE WELT - 11. Jun 2003
.
21 JAHRE UNSICHTBAR
Aus Angst vor dem Galgen sperrte sich ein Iraker selbst ein
Von Thomas Hüetlin

Etwa 130 Kilometer südöstlich von Bagdad liegt der Bezirk Numanija, ein Ort, wo das Wasser des Tigris blau in der Nachmittagssonne funkelt und der Wind das kräftige, grüne Schilf umhertanzen lässt wie ein Ballett.
Es ist ein Anblick, bei dem Dschawad Amir al-Schimari früher oft die Augen zusammenkniff und murmelte: "Allahu akbar" - Gott ist groß. Früher, das war vor 21 Jahren, als Dschawad noch ein junger Mann war, das dichte Haar zurückgekämmt, die Gesichtszüge glatt wie eine Sanddüne. Vor 21 Jahren, das war, als Dschawad beschloss, sich selbst einzumauern, in ein Verlies eng wie ein Kleiderschrank, 80 Zentimeter breit, 2 Meter lang. Saddams Männer hatten 15 von Dschawads Freunden aufgehängt. Dschawad wollte nicht Nummer 16 sein.
Wo sollte er sich verstecken in dieser Gegend, wo die Leute von Wasser und Weizen und Hühnern leben? Viele Möglichkeiten zu verschwinden gibt es hier nicht, wenn der Galgen auf einen wartet.
Deshalb wurde Dschawad unsichtbar. Er zog zwischen dem Zimmer seiner Mutter Asisa und der Küche eine Wand. Zu erreichen durch ein Loch im Boden, 50 Zentimeter tief, 30 Zentimeter breit. Auf dem Loch ein gemauerter Deckel, darüber ein Pappkarton. Darüber das rostige Bett der Mutter, das vor einem halben Jahrhundert einmal gelb war.
Dschawad war sein eigener politischer Gefangener, er hatte sich selbst lebend begraben, in seinem Verlies, von dem ein wenig Licht durch eine Ritze unterhalb der Decke fällt, im Kerker ein Brunnen, ein Abfluss für die Exkremente. Ein schwarzer Ventilator für den Sommer. Eine Decke für den Winter. Ein blauer Wecker, ein großer Sack Reis, ein Sack Waschpulver, eine Kleiderbürste, ein Löffel, ein Topf. Als Verzierung an der Wand: eine leere Dose Pepsi-Cola. Daneben ein Regal, auf dem zwei Bücher liegen - in Blau gebunden der Koran, in Schwarz Schriften über den Propheten Mohammed. In der Ecke eine gelbe Streichholzschachtel. "Nil Match" steht darauf geschrieben. Dschawad zieht die Schachtel auf. Sie ist voller Zähne. Dann deutet er auf seinen Mund, in dem keine Zähne mehr sind.
"Es war nie langweilig", sagt Dschawad über seine 21 Jahre in der Höhle. Er schlief sieben Stunden, stand jeden Tag gegen 4.30 Uhr auf, knipste sein Radio, ein weißes Panasonic R-338B, an und stülpte sich einen Kopfhörer über. Niemand draußen sollte ihn hören. Er betete fünfmal vorschriftsmäßig nach Südwesten ausgerichtet, auch, wenn das bedeutete, dass sein Kopf damit über der selbst gebauten Toilette hing. Er machte Klimmzüge an einer Art Paketgriff, welchen er an der Decke festgebunden hatte. Er kochte Reis. Er malte Bilder von seinen Freunden und seiner Familie. Und er dachte an Allah. "Allah ist groß", sagt Dschawad. "Er lehrt uns Geduld. Ich hatte 21 Jahre lang Geduld."
Wenn er nicht betete, Radio hörte oder Geduld hatte, dann hatte Dschawad vor allem eins: Angst. So viel Angst, dass er sein Gefängnis nur alle paar Wochen nachts verließ, für fünf Minuten, um im Schlafzimmer seiner Mutter zu stehen. So viel Angst, dass er 1991, als er im Radio hörte, dass die Amerikaner nicht den Aufstand der Schiiten unterstützten, vor Wut mit der Hand auf den Fußboden schlagen wollte, ihn aber aus Angst vor Lärm nur streichelte. So viel Angst schließlich, dass er seinem Bruder bei dessen Heirat vor vier Jahren verbat, der Gemahlin seine Existenz zu verraten.
Die Angst hatte Dschawad geerbt, schon als Kind spürte er sie. Und als er zur Armee musste, zu einer Zeit, als einer seiner Brüder im Krieg gegen den Iran als "Märtyrer" starb, versteckte sich Dschawad für ein paar Jahre hinter einem Funkgerät. Er wollte kein Held sein. Nur ein Schiit, der sich fünfmal am Tag auf den Boden legte und Richtung Mekka betete.
Das war nicht viel - aber unter Saddam reichte es für ein Todesurteil. Vor allem Ende der siebziger Jahre, als einer der höchsten Würdenträger der Schiiten, Ajatollah Bakir al-Sadr, dem Diktator erklärte, dass ihn das "irakische Volk nicht mehr ertrage". Saddam antwortete mit wahllosen Hinrichtungen.
Dschawad verschwand und wartete auf seine Befreier. Er sagt, er habe stets gewusst, dass es die Iraker nicht aus eigener Kraft schaffen würden. Dass sie Hilfe brauchten von Iran. Von den Amerikanern. Bei jedem Krieg, den Saddam begann, hoffte Dschawad, dass sein Peiniger ihn verlieren würde. Immer wieder hoffte er, immer wieder wurde er enttäuscht.
Als er am 10. April im Radio hörte, dass die Menschen in Bagdad Saddams Standbild niedergerissen hatten, beschloss er, tags darauf seine Höhle zu verlassen. Um 10 Uhr war es so weit. Er kroch heraus, und die Sonne traf ihn wie eine Laserkanone. Seine 77-jährige Mutter musste eine Sonnenbrille holen. Dann sah er den kleinen Innenhof: ein rostiges Fass Benzin, die drei rostigen Bettgestelle, auf denen die Großfamilie im Sommer schlief. Dasselbe Fass, dieselben Betten. Nichts hatte sich verändert. Nur er selbst. Aus einem jungen Mann war ein 49-jähriger Greis geworden, die Brust schmal wie ein Brotkasten, die Zähne in einer Streichholzschachtel.
DER SPIEGEL 24/2003 - 07. Juni 2003
21 JAHRE UNSICHTBAR
Aus Angst vor dem Galgen sperrte sich ein Iraker selbst ein
Von Thomas Hüetlin

Etwa 130 Kilometer südöstlich von Bagdad liegt der Bezirk Numanija, ein Ort, wo das Wasser des Tigris blau in der Nachmittagssonne funkelt und der Wind das kräftige, grüne Schilf umhertanzen lässt wie ein Ballett.
Es ist ein Anblick, bei dem Dschawad Amir al-Schimari früher oft die Augen zusammenkniff und murmelte: "Allahu akbar" - Gott ist groß. Früher, das war vor 21 Jahren, als Dschawad noch ein junger Mann war, das dichte Haar zurückgekämmt, die Gesichtszüge glatt wie eine Sanddüne. Vor 21 Jahren, das war, als Dschawad beschloss, sich selbst einzumauern, in ein Verlies eng wie ein Kleiderschrank, 80 Zentimeter breit, 2 Meter lang. Saddams Männer hatten 15 von Dschawads Freunden aufgehängt. Dschawad wollte nicht Nummer 16 sein.
Wo sollte er sich verstecken in dieser Gegend, wo die Leute von Wasser und Weizen und Hühnern leben? Viele Möglichkeiten zu verschwinden gibt es hier nicht, wenn der Galgen auf einen wartet.
Deshalb wurde Dschawad unsichtbar. Er zog zwischen dem Zimmer seiner Mutter Asisa und der Küche eine Wand. Zu erreichen durch ein Loch im Boden, 50 Zentimeter tief, 30 Zentimeter breit. Auf dem Loch ein gemauerter Deckel, darüber ein Pappkarton. Darüber das rostige Bett der Mutter, das vor einem halben Jahrhundert einmal gelb war.
Dschawad war sein eigener politischer Gefangener, er hatte sich selbst lebend begraben, in seinem Verlies, von dem ein wenig Licht durch eine Ritze unterhalb der Decke fällt, im Kerker ein Brunnen, ein Abfluss für die Exkremente. Ein schwarzer Ventilator für den Sommer. Eine Decke für den Winter. Ein blauer Wecker, ein großer Sack Reis, ein Sack Waschpulver, eine Kleiderbürste, ein Löffel, ein Topf. Als Verzierung an der Wand: eine leere Dose Pepsi-Cola. Daneben ein Regal, auf dem zwei Bücher liegen - in Blau gebunden der Koran, in Schwarz Schriften über den Propheten Mohammed. In der Ecke eine gelbe Streichholzschachtel. "Nil Match" steht darauf geschrieben. Dschawad zieht die Schachtel auf. Sie ist voller Zähne. Dann deutet er auf seinen Mund, in dem keine Zähne mehr sind.
"Es war nie langweilig", sagt Dschawad über seine 21 Jahre in der Höhle. Er schlief sieben Stunden, stand jeden Tag gegen 4.30 Uhr auf, knipste sein Radio, ein weißes Panasonic R-338B, an und stülpte sich einen Kopfhörer über. Niemand draußen sollte ihn hören. Er betete fünfmal vorschriftsmäßig nach Südwesten ausgerichtet, auch, wenn das bedeutete, dass sein Kopf damit über der selbst gebauten Toilette hing. Er machte Klimmzüge an einer Art Paketgriff, welchen er an der Decke festgebunden hatte. Er kochte Reis. Er malte Bilder von seinen Freunden und seiner Familie. Und er dachte an Allah. "Allah ist groß", sagt Dschawad. "Er lehrt uns Geduld. Ich hatte 21 Jahre lang Geduld."
Wenn er nicht betete, Radio hörte oder Geduld hatte, dann hatte Dschawad vor allem eins: Angst. So viel Angst, dass er sein Gefängnis nur alle paar Wochen nachts verließ, für fünf Minuten, um im Schlafzimmer seiner Mutter zu stehen. So viel Angst, dass er 1991, als er im Radio hörte, dass die Amerikaner nicht den Aufstand der Schiiten unterstützten, vor Wut mit der Hand auf den Fußboden schlagen wollte, ihn aber aus Angst vor Lärm nur streichelte. So viel Angst schließlich, dass er seinem Bruder bei dessen Heirat vor vier Jahren verbat, der Gemahlin seine Existenz zu verraten.
Die Angst hatte Dschawad geerbt, schon als Kind spürte er sie. Und als er zur Armee musste, zu einer Zeit, als einer seiner Brüder im Krieg gegen den Iran als "Märtyrer" starb, versteckte sich Dschawad für ein paar Jahre hinter einem Funkgerät. Er wollte kein Held sein. Nur ein Schiit, der sich fünfmal am Tag auf den Boden legte und Richtung Mekka betete.
Das war nicht viel - aber unter Saddam reichte es für ein Todesurteil. Vor allem Ende der siebziger Jahre, als einer der höchsten Würdenträger der Schiiten, Ajatollah Bakir al-Sadr, dem Diktator erklärte, dass ihn das "irakische Volk nicht mehr ertrage". Saddam antwortete mit wahllosen Hinrichtungen.
Dschawad verschwand und wartete auf seine Befreier. Er sagt, er habe stets gewusst, dass es die Iraker nicht aus eigener Kraft schaffen würden. Dass sie Hilfe brauchten von Iran. Von den Amerikanern. Bei jedem Krieg, den Saddam begann, hoffte Dschawad, dass sein Peiniger ihn verlieren würde. Immer wieder hoffte er, immer wieder wurde er enttäuscht.
Als er am 10. April im Radio hörte, dass die Menschen in Bagdad Saddams Standbild niedergerissen hatten, beschloss er, tags darauf seine Höhle zu verlassen. Um 10 Uhr war es so weit. Er kroch heraus, und die Sonne traf ihn wie eine Laserkanone. Seine 77-jährige Mutter musste eine Sonnenbrille holen. Dann sah er den kleinen Innenhof: ein rostiges Fass Benzin, die drei rostigen Bettgestelle, auf denen die Großfamilie im Sommer schlief. Dasselbe Fass, dieselben Betten. Nichts hatte sich verändert. Nur er selbst. Aus einem jungen Mann war ein 49-jähriger Greis geworden, die Brust schmal wie ein Brotkasten, die Zähne in einer Streichholzschachtel.
DER SPIEGEL 24/2003 - 07. Juni 2003
.
Dieser Niquet macht mich noch irre ...
Milton Friedman widerruft
Die wirklich entscheidenden Veränderungen erkennt man meistens nur an den kleinen Fußnoten der Geschichte. Wohingegen um die unwichtigen Dinge gemeinhin eines großes Tam-Tam und Bla-Bla gemacht wird.
Eine dieser kleinen Fußnoten ist ein Restaurantbesuch eines Mitarbeiters der Internetseite der Financial Times mit dem Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, Milton Friedman, in San Francisco in der letzten Woche. Friedman hat Generationen von Ökonomen und Börsianern mit seinem Monetarismus gequält, im dem behauptet wird, Änderungen der Geldmenge durch die Zentralbank hätten einen kausalen Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität einer Volkswirtschaft.
Für die Zentralbankpolitik bedeutet das, die Geldmenge als entscheidenden Indikator der Geldpolitik zu betrachten, und für die Börsianer resultiert aus dieser Lehrmeinung die Auffassung, dass das von den Zentralbanken geschaffene Geld „an die Märkte fließt“ und dort „die Kurse nach oben treibt.“
Ich habe in diesem Zusammenhang immer geschrieben, dass, wenn die Geldmenge tatsächlich die Kurse treiben würde, der Nikkei-Index in Japan jetzt nicht bei 9.000, sondern bei 90.000 stehen müsste. Auch Alan Greenspan ist ja bekanntlich schon lange vom Geldmengenziel abgerückt, und selbst die Europäische Zentralbank hat sich hierbei gegen das Erbe der Deutschen Bundesbank durchsetzen können.
Und jetzt sagt plötzlich der Vater des Monetarismus bei diesem Essen: „ The use of quantity of money as a target has not been a success. I`m not sure I would as of today push it as hard as I once did." Das Geldmengenkonzept war kein Erfolg, sagt Friedman. Man möchte auf die Knie fallen und ein Dankgebet sprechen. Endlich scheint die Theorie die Realität wieder eingeholt zu haben. Das Dogma der Geldmenge ist tot – und bald können wir wieder alle frei denken!
Bernd Niquet / WO 11.06.2003
Dieser Niquet macht mich noch irre ...

Milton Friedman widerruft
Die wirklich entscheidenden Veränderungen erkennt man meistens nur an den kleinen Fußnoten der Geschichte. Wohingegen um die unwichtigen Dinge gemeinhin eines großes Tam-Tam und Bla-Bla gemacht wird.
Eine dieser kleinen Fußnoten ist ein Restaurantbesuch eines Mitarbeiters der Internetseite der Financial Times mit dem Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften, Milton Friedman, in San Francisco in der letzten Woche. Friedman hat Generationen von Ökonomen und Börsianern mit seinem Monetarismus gequält, im dem behauptet wird, Änderungen der Geldmenge durch die Zentralbank hätten einen kausalen Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität einer Volkswirtschaft.
Für die Zentralbankpolitik bedeutet das, die Geldmenge als entscheidenden Indikator der Geldpolitik zu betrachten, und für die Börsianer resultiert aus dieser Lehrmeinung die Auffassung, dass das von den Zentralbanken geschaffene Geld „an die Märkte fließt“ und dort „die Kurse nach oben treibt.“
Ich habe in diesem Zusammenhang immer geschrieben, dass, wenn die Geldmenge tatsächlich die Kurse treiben würde, der Nikkei-Index in Japan jetzt nicht bei 9.000, sondern bei 90.000 stehen müsste. Auch Alan Greenspan ist ja bekanntlich schon lange vom Geldmengenziel abgerückt, und selbst die Europäische Zentralbank hat sich hierbei gegen das Erbe der Deutschen Bundesbank durchsetzen können.
Und jetzt sagt plötzlich der Vater des Monetarismus bei diesem Essen: „ The use of quantity of money as a target has not been a success. I`m not sure I would as of today push it as hard as I once did." Das Geldmengenkonzept war kein Erfolg, sagt Friedman. Man möchte auf die Knie fallen und ein Dankgebet sprechen. Endlich scheint die Theorie die Realität wieder eingeholt zu haben. Das Dogma der Geldmenge ist tot – und bald können wir wieder alle frei denken!
Bernd Niquet / WO 11.06.2003
.
Neues von unseren Gurus...
bis auf die "Nummer mit dem Gold" sind sie sich ja fast einig ....
Bernd Niquet:
Gesellschaftsspiel Deflationsangst
Wer glaubt, dass es an der Börse und an den Finanzmärkten mit Logik und gesundem Menschenverstand zugeht, ist dort sicherlich gänzlich fehl am Platz. Nein, hier geht es vielmehr ebenso wie im sonstigen Leben primär um Geld, um Macht, um Mode und natürlich um Gesellschaftsspiele. Ziel dieser Gesellschaftsspiele ist es, eine neue Mode zu etablieren, mit der man den Anlegern das Geld aus der Tasche ziehen, den eigenen Geldbeutel sanieren und die eigene Macht ausbauen kann.
Beliebte Gesellschaftsspiele der Vergangenheit hießen beispielsweise „Gold ist ein Inflationsschutz“ und „Aktien muss man haben“. Viele Anleger sind dabei erfolgreich geschröpft worden, doch es gibt immer noch welche, die noch nicht das letzte Hemd verloren haben. Ein Spiele-Zyklus ist jedoch immer erst dann vorüber, wenn auch der letzte nackt dasteht. Doch mit welchem Vehikel kommt man an den letzten Kragen heran?
Die Goldnummer scheint nicht mehr zu ziehen, da eine Inflation weit und breit nicht zu sehen ist. Die Aktien-Wunde ist noch viel zu frisch und den fallenden Dollar kann man kaum als Traumanlage verkaufen. Bleibt alleine der Rentenmarkt. Doch wie will man es schaffen, die Anleger massenweise in diese vergleichsweise träge Anlage hinein zu manövrieren? Es ist schwer, doch es scheint zu funktionieren. Clevere Finanzmarktstrategen haben hierzu die neuen Modebegriffe „Deflation“ und „Deflationsangst“ erfunden.
Deflation ist eine Inflation, die auf dem Kopf steht, und bei der alle Preise sich nach unten bewegen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen fallen, die Aktien fallen und die Lohnzuwächse geraten ins Stocken. Und das Einzige, was real an Wert zulegt, ist das Bargeld. Nur Bargeldhaltung verspricht Gewinn, da die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die man sich für einen bestimmten Geldbetrag kaufen kann, bei sinkenden Preisen zunimmt. Doch den Anlegern nur Geldmarktfonds zu verkaufen, stärkt weder den Geldbeutel noch die Macht der Finanzhäuser – vom Ego und der Libido einmal ganz abgesehen.
Aus diesem Grunde hat man die Blase am Rentenmarkt erfunden. Denn Rentenfonds bringen viel bessere Provisionen als Geldmarktfonds. Dass in einer wirklichen Deflation jedoch die Rentenmärkte ebenfalls zusammenbrechen müssten, stört in der Finanzbranche niemanden. Schließlich wären die Provisionen dann ja bereits vereinnahmt.
12.06.2003
Roland Leuschel
Eine deftige Kurskorrektur droht !
Noch ist der dritte Aufschwung seit dem Platzen der Blase im Frühjahr 2000 im Gang, und die Aktieneuphorie wächst täglich, wobei das Bemerkenswerteste seit drei Monaten der gleichzeitige Anstieg der Aktien und Anleihenkurse ist. Die Aktienkurse steigen, weil die Anleger glauben, die Unternehmensgewinne sind im Begriff zu steigen, und die Anleihenkurse steigen, das heisst die Renditen fallen, weil die Anleger befürchten, eine Rezession steht vor der Tür, ja sogar eine Deflation wird befürchtet. Beide Lager können nicht recht haben. Entweder kommt der von vielen Optimisten vorhergesagten Wirtschaftsaufschwung, dann steigen die langfristigen Zinsen, auch wenn Alan Greenspan angekündigt hat, er kaufe Staatsanleihen, um die langfristigen Zinsen niedrig zu halten, und es gibt Turbulenzen auf den Anleihemärkten.
« Wenn Sie berechnen, dass der faire Wert (fair value) für Anleihen zwischen 5 und 5,5% liegt, dann ist der Bondmarkt reif für Gewinnmitnahmen. », erklärt Mike Lenhoff, Chefstratege bei Brewin Dolphin Securities in der Financial Times. Wenn aber die Wirtschaftserholung nicht kommt, dann ist die Gefahr einer Deflation real, und ein Anstieg der Unternehmensgewinne reines Wunschdenken. Dann kommt es zu einem Mini-Crash am Aktienmarkt.
« Die amerikanische Notenbank versucht die Blase wieder aufzupumpen », erklärt James Montier, Chefstratege bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Meine Schlussfolgerung ist klar und eindeutig : In Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Schweiz, Portugal etc.) sind wir bereits in einer Wirtschaftsrezession, da beisst die Maus keinen Faden ab. Gleichzeitig geht die Rezession in Japan weiter, und die USA riskieren grössere Probleme mit der Finanzierung ihres Leistungsbilanzdefizits (inzwischen 6% des BSP).
Das heisst, wegen der Furcht vor einem fallenden Dollar gehen auch die Kapitalströme nach Amerika zurück. Da gleichzeitig der US-Staatshaushalt auf ein Rekorddefizit von 400 Milliarden Dollar (rund 4% des BSP) in diesem Jahr zusteuert (nach Schätzungen des Congressional Budget Office), wird es für die USA langsam gefährlich, da Staat, Unternehmen und Haushalte zusammen eine Rekordverschuldung von über 30 Billionen Dollar aufgetürmt haben. Vergessen wir nicht, noch vor drei Jahren wies der amerikanische Staatsetat einen Überschuss von 236 Milliarden Dollar auf. Die Geschwindigkeit, mit der sich heute solch fundamentale Grössen verändern, ist wirklich atemberaubend, und lässt nichts Gutes ahnen.
Wenn es auch schwer fällt, nehmen Sie Ihre Gewinne mit, die Sie in amerikanischen und europäischen Aktien seit dem März dieses Jahres erzielt haben, und die stattlich sein können. (Die « jungen Aktien » aus der Kapitalerhöhung der Allianz haben sich in weniger als 2 Monaten verdoppelt !). Wir sind noch für einige Jahre in einer Seitwärtsbewegung, und da herrschen andere Spielregeln. Also geben Sie Ihrem Herz einen Stoss und verkaufen zumindest Teilpositionen Ihrer Allianz, Münchener Rück, Siemens etc., die hier an dieser Stelle zu erheblich tieferen Kursen empfohlen wurden.
Die amerikanische Aktienbewertung ist nach wie vor schwindelerregend hoch (Standard & Poors 500 P/E = 35) , und in Europa kann ich mir keine steigenden Börsen vorstellen, wenn wir in Amerika eine starke Kurskorrektur haben. Der Dax hat seit seinem Tiefstpunkt im März dieses Jahres nun fast 45% zugelegt. Er liegt inzwischen über dem Durchschnitt der 200 Tage (3.000), der noch leicht im Fallen begriffen ist. Optimisten bemerken zu Recht, wenn der Dax noch bis Mitte Juli steigt, dann wird aus der fallenden 200-Tageslinie eine steigende, und dies würde ein Kaufsignal auslösen, da die Trendwende « statistisch gesichert » ist . [ ]
]
Vergessen Sie nicht, dass auch in den letzten 30 bzw. 20 Jahren Rentensparpläne eine höhere Rendite abwarfen als Aktiensparpläne. Wie oft haben wir in Werbespots etc. anhören müssen, dass Aktien langfristig besser seien als Anleihen. Das stimmt aber nur, wenn die Betonung auf langfristig liegt, und das bedeutet, wie ich hier öfters dargelegt habe, rund 100 Jahre.
Jetzt haben Sie es amtlich : Nach der vor kurzem veröffentlichten Statistik des Bundesverbandes Asset Management (BVI) wird auch der kühnste Aktienoptimist kleinlaut.
Der BVI errechnete, dass ein Sparplan in europäischen Aktien auf 30 Jahre eine jährliche Rendite von 6,3% abwarf, während eine in EU-weiten Rentenfonds gesparte Anlage 6,8% jährlich brachte. Noch dramatischer wird es bei einer Periode von 20 Jahren : Da hätte ein Sparplan in europäischen Aktien 4,2% erbracht, der Anleihe-Sparer hätte aber 6,1% p.a. verdient.
« Wer zum Ende seines Berufslebens eine reale Minusrendite erwirtschaftet, den tröstet es wenig, dass die Theorie auf lange Frist Recht behält. », meint die FAZ zu dieser Tatsache. Auf jeden Fall sind wir langfristig alle tot, wie der grösste Ökonom des vergangenen Jahrhunderts, Keynes, dazu trocken bemerkte. (Wohlgemerkt sind alle Angaben nominal und nicht real, das heisst nach Abzug der Inflationsraten.)
Vergessen Sie nicht, einen Teil Ihres Wertpapier-Portefeuilles (je nach Temperament 5 bis 10%) in Gold anzulegen. Wie Sie wissen, hat die chinesische Regierung angekündigt, ihre Goldreserven kräftig aufzustocken, ausserdem darf seit Beginn dieses Jahres der chinesische Staatsbürger zum ersten Male seit der kommunistischen Revolution wieder physisches Gold besitzen. China wird in rund 10 Jahren eine Wirtschaftsgrossmacht und wird mit einer eigenen Währung Machtpolitik treiben wollen…
In ein bis zwei Jahren werden wir uns wieder mit der Inflation beschäftigen, sie allein kann das Problem der insolventen Rentensysteme und der hohen Verschuldung « politisch lösen ».
12.06.2003
Neues von unseren Gurus...

bis auf die "Nummer mit dem Gold" sind sie sich ja fast einig ....

Bernd Niquet:
Gesellschaftsspiel Deflationsangst
Wer glaubt, dass es an der Börse und an den Finanzmärkten mit Logik und gesundem Menschenverstand zugeht, ist dort sicherlich gänzlich fehl am Platz. Nein, hier geht es vielmehr ebenso wie im sonstigen Leben primär um Geld, um Macht, um Mode und natürlich um Gesellschaftsspiele. Ziel dieser Gesellschaftsspiele ist es, eine neue Mode zu etablieren, mit der man den Anlegern das Geld aus der Tasche ziehen, den eigenen Geldbeutel sanieren und die eigene Macht ausbauen kann.
Beliebte Gesellschaftsspiele der Vergangenheit hießen beispielsweise „Gold ist ein Inflationsschutz“ und „Aktien muss man haben“. Viele Anleger sind dabei erfolgreich geschröpft worden, doch es gibt immer noch welche, die noch nicht das letzte Hemd verloren haben. Ein Spiele-Zyklus ist jedoch immer erst dann vorüber, wenn auch der letzte nackt dasteht. Doch mit welchem Vehikel kommt man an den letzten Kragen heran?
Die Goldnummer scheint nicht mehr zu ziehen, da eine Inflation weit und breit nicht zu sehen ist. Die Aktien-Wunde ist noch viel zu frisch und den fallenden Dollar kann man kaum als Traumanlage verkaufen. Bleibt alleine der Rentenmarkt. Doch wie will man es schaffen, die Anleger massenweise in diese vergleichsweise träge Anlage hinein zu manövrieren? Es ist schwer, doch es scheint zu funktionieren. Clevere Finanzmarktstrategen haben hierzu die neuen Modebegriffe „Deflation“ und „Deflationsangst“ erfunden.
Deflation ist eine Inflation, die auf dem Kopf steht, und bei der alle Preise sich nach unten bewegen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen fallen, die Aktien fallen und die Lohnzuwächse geraten ins Stocken. Und das Einzige, was real an Wert zulegt, ist das Bargeld. Nur Bargeldhaltung verspricht Gewinn, da die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die man sich für einen bestimmten Geldbetrag kaufen kann, bei sinkenden Preisen zunimmt. Doch den Anlegern nur Geldmarktfonds zu verkaufen, stärkt weder den Geldbeutel noch die Macht der Finanzhäuser – vom Ego und der Libido einmal ganz abgesehen.
Aus diesem Grunde hat man die Blase am Rentenmarkt erfunden. Denn Rentenfonds bringen viel bessere Provisionen als Geldmarktfonds. Dass in einer wirklichen Deflation jedoch die Rentenmärkte ebenfalls zusammenbrechen müssten, stört in der Finanzbranche niemanden. Schließlich wären die Provisionen dann ja bereits vereinnahmt.
12.06.2003
Roland Leuschel
Eine deftige Kurskorrektur droht !
Noch ist der dritte Aufschwung seit dem Platzen der Blase im Frühjahr 2000 im Gang, und die Aktieneuphorie wächst täglich, wobei das Bemerkenswerteste seit drei Monaten der gleichzeitige Anstieg der Aktien und Anleihenkurse ist. Die Aktienkurse steigen, weil die Anleger glauben, die Unternehmensgewinne sind im Begriff zu steigen, und die Anleihenkurse steigen, das heisst die Renditen fallen, weil die Anleger befürchten, eine Rezession steht vor der Tür, ja sogar eine Deflation wird befürchtet. Beide Lager können nicht recht haben. Entweder kommt der von vielen Optimisten vorhergesagten Wirtschaftsaufschwung, dann steigen die langfristigen Zinsen, auch wenn Alan Greenspan angekündigt hat, er kaufe Staatsanleihen, um die langfristigen Zinsen niedrig zu halten, und es gibt Turbulenzen auf den Anleihemärkten.
« Wenn Sie berechnen, dass der faire Wert (fair value) für Anleihen zwischen 5 und 5,5% liegt, dann ist der Bondmarkt reif für Gewinnmitnahmen. », erklärt Mike Lenhoff, Chefstratege bei Brewin Dolphin Securities in der Financial Times. Wenn aber die Wirtschaftserholung nicht kommt, dann ist die Gefahr einer Deflation real, und ein Anstieg der Unternehmensgewinne reines Wunschdenken. Dann kommt es zu einem Mini-Crash am Aktienmarkt.
« Die amerikanische Notenbank versucht die Blase wieder aufzupumpen », erklärt James Montier, Chefstratege bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Meine Schlussfolgerung ist klar und eindeutig : In Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Schweiz, Portugal etc.) sind wir bereits in einer Wirtschaftsrezession, da beisst die Maus keinen Faden ab. Gleichzeitig geht die Rezession in Japan weiter, und die USA riskieren grössere Probleme mit der Finanzierung ihres Leistungsbilanzdefizits (inzwischen 6% des BSP).
Das heisst, wegen der Furcht vor einem fallenden Dollar gehen auch die Kapitalströme nach Amerika zurück. Da gleichzeitig der US-Staatshaushalt auf ein Rekorddefizit von 400 Milliarden Dollar (rund 4% des BSP) in diesem Jahr zusteuert (nach Schätzungen des Congressional Budget Office), wird es für die USA langsam gefährlich, da Staat, Unternehmen und Haushalte zusammen eine Rekordverschuldung von über 30 Billionen Dollar aufgetürmt haben. Vergessen wir nicht, noch vor drei Jahren wies der amerikanische Staatsetat einen Überschuss von 236 Milliarden Dollar auf. Die Geschwindigkeit, mit der sich heute solch fundamentale Grössen verändern, ist wirklich atemberaubend, und lässt nichts Gutes ahnen.
Wenn es auch schwer fällt, nehmen Sie Ihre Gewinne mit, die Sie in amerikanischen und europäischen Aktien seit dem März dieses Jahres erzielt haben, und die stattlich sein können. (Die « jungen Aktien » aus der Kapitalerhöhung der Allianz haben sich in weniger als 2 Monaten verdoppelt !). Wir sind noch für einige Jahre in einer Seitwärtsbewegung, und da herrschen andere Spielregeln. Also geben Sie Ihrem Herz einen Stoss und verkaufen zumindest Teilpositionen Ihrer Allianz, Münchener Rück, Siemens etc., die hier an dieser Stelle zu erheblich tieferen Kursen empfohlen wurden.
Die amerikanische Aktienbewertung ist nach wie vor schwindelerregend hoch (Standard & Poors 500 P/E = 35) , und in Europa kann ich mir keine steigenden Börsen vorstellen, wenn wir in Amerika eine starke Kurskorrektur haben. Der Dax hat seit seinem Tiefstpunkt im März dieses Jahres nun fast 45% zugelegt. Er liegt inzwischen über dem Durchschnitt der 200 Tage (3.000), der noch leicht im Fallen begriffen ist. Optimisten bemerken zu Recht, wenn der Dax noch bis Mitte Juli steigt, dann wird aus der fallenden 200-Tageslinie eine steigende, und dies würde ein Kaufsignal auslösen, da die Trendwende « statistisch gesichert » ist . [
 ]
]Vergessen Sie nicht, dass auch in den letzten 30 bzw. 20 Jahren Rentensparpläne eine höhere Rendite abwarfen als Aktiensparpläne. Wie oft haben wir in Werbespots etc. anhören müssen, dass Aktien langfristig besser seien als Anleihen. Das stimmt aber nur, wenn die Betonung auf langfristig liegt, und das bedeutet, wie ich hier öfters dargelegt habe, rund 100 Jahre.
Jetzt haben Sie es amtlich : Nach der vor kurzem veröffentlichten Statistik des Bundesverbandes Asset Management (BVI) wird auch der kühnste Aktienoptimist kleinlaut.
Der BVI errechnete, dass ein Sparplan in europäischen Aktien auf 30 Jahre eine jährliche Rendite von 6,3% abwarf, während eine in EU-weiten Rentenfonds gesparte Anlage 6,8% jährlich brachte. Noch dramatischer wird es bei einer Periode von 20 Jahren : Da hätte ein Sparplan in europäischen Aktien 4,2% erbracht, der Anleihe-Sparer hätte aber 6,1% p.a. verdient.
« Wer zum Ende seines Berufslebens eine reale Minusrendite erwirtschaftet, den tröstet es wenig, dass die Theorie auf lange Frist Recht behält. », meint die FAZ zu dieser Tatsache. Auf jeden Fall sind wir langfristig alle tot, wie der grösste Ökonom des vergangenen Jahrhunderts, Keynes, dazu trocken bemerkte. (Wohlgemerkt sind alle Angaben nominal und nicht real, das heisst nach Abzug der Inflationsraten.)
Vergessen Sie nicht, einen Teil Ihres Wertpapier-Portefeuilles (je nach Temperament 5 bis 10%) in Gold anzulegen. Wie Sie wissen, hat die chinesische Regierung angekündigt, ihre Goldreserven kräftig aufzustocken, ausserdem darf seit Beginn dieses Jahres der chinesische Staatsbürger zum ersten Male seit der kommunistischen Revolution wieder physisches Gold besitzen. China wird in rund 10 Jahren eine Wirtschaftsgrossmacht und wird mit einer eigenen Währung Machtpolitik treiben wollen…
In ein bis zwei Jahren werden wir uns wieder mit der Inflation beschäftigen, sie allein kann das Problem der insolventen Rentensysteme und der hohen Verschuldung « politisch lösen ».
12.06.2003
Ja, der Leuschel!
Predigt schon seit 20 Jahren den kommenden Crash!
Und manchmal hat er sogar recht!
Predigt schon seit 20 Jahren den kommenden Crash!
Und manchmal hat er sogar recht!

.
Kaufen, bis der Abschleppwagen kommt
Trotz Rezession und Arbeitslosigkeit verschulden sich die amerikanischen Verbraucher munter weiter. Und die Fachleute streiten: Rettet der Kaufrausch die Wirtschaft – oder macht er alles nur schlimmer?
Von Thomas Fischermann
Sergio Costa hat einen krisensicheren Job: Der Mann stiehlt Autos. „Am liebsten arbeite ich nachts“, erzählt er, „der Sicherheit wegen. Aber im Moment gibt es so viel zu tun, dass ich quasi 24 Stunden im Einsatz bin.“ Costa schaltet Alarmanlagen mit wenigen Handgriffen aus, öffnet lautlos Hochsicherheitsschlösser, und manchmal karrt er Fahrzeuge gleich komplett mit seinem Abschleppwagen weg, ohne überhaupt auszusteigen. Vergangenen Monat hat er 402 Autos entwendet, meist BMW oder Toyota.
Doch Costa ist kein gewöhnlicher Autodieb. Bevor er einen Wagen stiehlt, sagt er der Polizei Bescheid – und am Ende bringt er die Fahrzeuge ihren wahren Eigentümern zurück. Costa ist ein so genannter Repo Man, er ist Betriebsmanager bei der Firma Elite Collateral Recovery and Investigations in Elizabeth, New Jersey, die auf Pump gekaufte Fahrzeuge von säumigen Schuldnern zurückholt. Das Unternehmen erhält seine Aufträge von Automobilfirmen und Banken, und die Umsätze steigen seit Monaten.
„Wenn unsere Branche boomt, ist das ein ganz hervorragender Index für Konjunkturkrisen“, spottet Harvey Altes, Chef des Branchenverbandes Time Finance Adjusters. Und tatsächlich: Im vergangenen Jahr „stahlen“ seine Mitgliedsunternehmen die Rekordzahl von zwei Millionen Fahrzeugen von ihren zahlungsunwilligen Besitzern – „eine wirklich gewaltige Menge“, wie Altes sagt. Die Zahl passt zu einer Reihe besorgniserregender ökonomischer Trends. Viele amerikanische Privathaushalte haben ihre Kreditrahmen bei Banken und Kreditkartenfirmen ausgeschöpft, etliche von ihnen können ihre Raten nicht mehr zahlen. Der durchschnittliche Schuldendienst eines US-Haushalts hat inzwischen den Rekordwert von 14 Prozent des verfügbaren Einkommens erreicht, insgesamt stieg die Privatschuld amerikanischer Haushalte auf ein historisches Hoch von 1,7 Trillionen Dollar, und die Zahl der persönlichen Bankrotte stieg im vergangenen Jahr um fünf Prozent. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Verschuldung der Privathaushalte nicht mehr durchzuhalten ist“, urteilt Dimitri Papadimitriou, Präsident des Levy Institute. „Das wird den Leuten gerade klar – womöglich mit schweren Folgen für die Konjunktur.“
„Einmalig in der Geschichte“
Nun ist die Freude an Krediten in den USA nicht gerade neu. Die Amerikaner leben traditionell auf Pump und sparen weniger als die meisten anderen Industrienationen. Allerdings hat sich der Trend zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Legten die US-Bürger Anfang der neunziger Jahre noch knapp neun Prozent ihres verfügbaren Einkommens beiseite, lag die Sparquote am Ende des Jahrzehnts bei weniger als zwei Prozent. Der Aktienboom und der vermeintliche Reichtum hatte viele Leute angestachelt, jetzt erst recht ihre Kreditkarten, Bankdarlehen und die Finanzierungsangebote von Einzelhändlern auszuschöpfen. Manche Ökonomen glauben sogar, dass weniger das Internet als diese Kredit- und Konsumwelle den Wachstumsschub der späten Neunziger ausgelöst hatte.
Doch bis heute ist Ökonomen und Psychologen ein Rätsel, warum diese Mentalität sich seit dem Platzen der Aktienblase nicht geändert hat – im Gegensatz zu früheren Rezessionen. Nach der Wirtschaftskrise von 1991 zum Beispiel sank die Kreditaufnahme der Amerikaner drastisch. Diesmal dagegen nahmen die Amerikaner fröhlich weiter Kredite auf, sogar schneller als zuvor, wenn man den Anteil am verfügbaren Einkommen zum Maßstab nimmt. „Eine solche Beschleunigung ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig“, sagt Jan Hatzius, Ökonom bei der Investmentbank Goldman Sachs in New York.
Das Resultat: Der Schuldenstand der amerikanischen Privathaushalte bricht alle Rekorde, inzwischen liegen die Schulden eines amerikanischen Durchschnittshaushalts über seinem Nettojahreseinkommen.
Etliche Kreditinstitute bekommen bereits kalte Füße. Finanzierungsfirmen großer Autokonzerne wie Ford Motor verzeichneten in den vergangenen drei Jahren einen Zuwachs ihrer Kreditausfälle um ein Drittel. Eine Studie der Schuldnerberatungsfirma Myvesta ergab im November, dass ein Amerikaner heutzutage im Durchschnitt 3250 Dollar Schulden auf zwei bis drei Kreditkarten mit sich herumträgt – ein Anstieg um fast 1000 Dollar gegenüber dem Vorjahr. Die Kreditkartenfirmen berichten, dass immer mehr Amerikaner am Maximum ihrer Kreditrahmen angelangt sind und mit ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen, zumal etliche dieser Firmen in den vergangenen Jahren den so genannten Sub-Prime-Lending-Markt erschlossen hatten. Ihre Kunden sind Leute, die keine einwandfreie Kreditgeschichte vorweisen konnten. Jetzt sind die Kreditkartenfirmen nervöser denn je: Einige rufen bei unzuverlässigen Kunden schon vor dem Rechnungsdatum an, um vorsorglich zur Bezahlung zu mahnen. Die Gebühren und Zinsen für säumige Schuldner sind drastisch gestiegen.
Längst geraten auch Leute in die Schuldenfalle, die früher kaum gefährdet schienen. Der Verband der Repo Men etwa stellte zuletzt fest, dass immer mehr Leute ihre Autos gleich freiwillig hergeben. „Die wollen den Ärger nicht“, sagt der Branchensprecher Altes, „das sind im Grunde ehrliche Leute aus dem bürgerlichen Mittelstand in einer außergewöhnlichen Lebenslage.“ Leute wie Mantell Sponder aus Brooklyn zum Beispiel, der als Computerexperte an der Wall Street einst 150000 Dollar im Jahr verdiente und sich nach einem Jahr Arbeitslosigkeit inzwischen rüde Telefonmanieren angewöhnt hat. „Die Kreditkartenfirmen und Gläubiger rufen hier quasi täglich an“, sagt Sponder und zuckt mit den Schultern. „Es ist einfach kein Geld da – und ich habe mir angewöhnt, gar nicht erst mit denen zu reden. Ich knalle dann gleich den Hörer auf die Gabel.“
Die Hausbesitzer fühlen sich reich
Es gibt freilich auch etliche Ökonomen, die von einer privaten Schuldenkrise nichts wissen wollen. Die Schuldenmacherei, so ihr Argument, könnte sich als gewonnene Wette auf eine bessere Zukunft herausstellen. Schließlich profitiert die Wirtschaft vom starken Konsum der Amerikaner. So könnte die kollektive Kreditaufnahme zur sich selbst erfüllenden Prophezeihung werden. Wer behält Recht – die Schwarzmaler oder die Optimisten?
Die Rechnung geht nur auf, wenn mit der Nachfrage auch der Arbeitsmarkt anspringt. Zwar sind im vergangenen Jahr die Einkommen um 4,5 Prozent gestiegen – nach nur 1,8 Prozent im Vorjahr –, aber zu einem großen Teil lag das an Steuerkürzungen aus Washington. Außerdem hat die Arbeitslosenquote in den USA gerade wieder die Sechsprozentmarke überschritten.
Entscheidend ist auch die Entwicklung der Zinsen und der Hauspreise. Notenbankchef Alan Greenspan hält die Leitzinsen zurzeit auf einem Rekordtief und macht keine Anstalten, sie bald wieder steigen zu lassen. Den Großteil ihrer neuen Kredite haben sich die Amerikaner in den vergangenen Monaten besorgt, indem sie zu diesen günstigen Zinssätzen Hypothekenkredite auf ihre Häuser aufnahmen – oder ihre bestehenden Hypotheken umschuldeten. Ein besonders gutes Geschäft machten dabei Hausbesitzer, die in Gegenden eines boomenden Immobilienmarktes leben, zum Beispiel in Sacramento oder in New York City: Einige Hauspreise sind in den vergangenen Jahren um 30, 50, gar 100 Prozent gestiegen, sodass bei der Umschuldung Extra-Cash anfiel und sich die Hausbesitzer umso reicher fühlten. Doch etliche Ökonomen sehen inzwischen die Hauspreise auf einem Hoch angelangt, einige Schwarzseher warnen sogar vor einem Kollaps der Immobilienpreise in einigen Regionen. Die Zinsen können zudem kaum weiter fallen. Mit dieser Art des Schuldenmachens dürfte es also bald vorbei sein. Weil aber niemand so richtig weiß, wie ernst die Lage wirklich ist, erreichen die amerikanischen Verbraucher in diesen Tagen höchst unterschiedliche Signale. „Leben Sie reich“, rät die Citibank auf Plakaten an Hauswänden und in Spots im Fernsehen: Die Bankiers wollen ihrer Kundschaft gern einreden, dass es auch in Krisenzeiten „keine gute Idee ist, sich aus Sparsamkeit selbst die Haare zu schneiden“. Und dass Amerikaner sozusagen „mit dem Recht auf akzeptierte Kreditanträge geboren“ seien. Umgekehrt werden Schuldenratgeber wie Überleben Sie die Ferien ohne Bankrott zu Bestsellern.
Beratungsseminare für überschuldete Amerikaner sind gefragt, und auch halbseidene Angebote („So bekommen Sie eine neue Kredit-Identität“) finden immer mehr verzweifelte Interessenten. Das American Bankruptcy Institute sorgt sich inzwischen darum, dass „die steigenden Zahlen der Zahlungsunfähigkeiten in den Haushalten auch die finanzielle Gesundheit der Kreditgeber-Institutionen gefährden“ könne. Und die sonst so optimistische Bankenwirtschaft unternimmt in Washington eine gewaltige Lobby-Anstrengung, um die Gesetze rings um den persönlichen Bankrott zu reformieren. Wer Pleite geht, darf in den Vereinigten Staaten in der Regel eine Menge behalten – oft das Haus und hohe Freibeträge auf Autos, Juwelen und die Hauseinrichtung. Die neue Gesetzgebung soll nach dem Wunsch der Kreditinstitute deutlich härter durchgreifen.
Böse Zeiten also für säumige Schuldner, und gute Zeiten für Leute wie die Repo Men? Vielleicht auch nicht. „Der Mai war ein ganz merkwürdiger Monat“, klagt in diesen Tagen der Branchensprecher Harvey Altes. „Die Autofirmen haben in den vergangenen Monaten so viele Autos mit Nullzinsen und Sonderrabatten verkauft, dass sie sowieso einen Verlust machen“, sagt Altes. „So ist der neueste Trend, dass sie die Fahrzeuge gar nicht mehr zurückhaben wollen.“
DIE ZEIT - 05.06.2003
Kaufen, bis der Abschleppwagen kommt
Trotz Rezession und Arbeitslosigkeit verschulden sich die amerikanischen Verbraucher munter weiter. Und die Fachleute streiten: Rettet der Kaufrausch die Wirtschaft – oder macht er alles nur schlimmer?
Von Thomas Fischermann
Sergio Costa hat einen krisensicheren Job: Der Mann stiehlt Autos. „Am liebsten arbeite ich nachts“, erzählt er, „der Sicherheit wegen. Aber im Moment gibt es so viel zu tun, dass ich quasi 24 Stunden im Einsatz bin.“ Costa schaltet Alarmanlagen mit wenigen Handgriffen aus, öffnet lautlos Hochsicherheitsschlösser, und manchmal karrt er Fahrzeuge gleich komplett mit seinem Abschleppwagen weg, ohne überhaupt auszusteigen. Vergangenen Monat hat er 402 Autos entwendet, meist BMW oder Toyota.
Doch Costa ist kein gewöhnlicher Autodieb. Bevor er einen Wagen stiehlt, sagt er der Polizei Bescheid – und am Ende bringt er die Fahrzeuge ihren wahren Eigentümern zurück. Costa ist ein so genannter Repo Man, er ist Betriebsmanager bei der Firma Elite Collateral Recovery and Investigations in Elizabeth, New Jersey, die auf Pump gekaufte Fahrzeuge von säumigen Schuldnern zurückholt. Das Unternehmen erhält seine Aufträge von Automobilfirmen und Banken, und die Umsätze steigen seit Monaten.
„Wenn unsere Branche boomt, ist das ein ganz hervorragender Index für Konjunkturkrisen“, spottet Harvey Altes, Chef des Branchenverbandes Time Finance Adjusters. Und tatsächlich: Im vergangenen Jahr „stahlen“ seine Mitgliedsunternehmen die Rekordzahl von zwei Millionen Fahrzeugen von ihren zahlungsunwilligen Besitzern – „eine wirklich gewaltige Menge“, wie Altes sagt. Die Zahl passt zu einer Reihe besorgniserregender ökonomischer Trends. Viele amerikanische Privathaushalte haben ihre Kreditrahmen bei Banken und Kreditkartenfirmen ausgeschöpft, etliche von ihnen können ihre Raten nicht mehr zahlen. Der durchschnittliche Schuldendienst eines US-Haushalts hat inzwischen den Rekordwert von 14 Prozent des verfügbaren Einkommens erreicht, insgesamt stieg die Privatschuld amerikanischer Haushalte auf ein historisches Hoch von 1,7 Trillionen Dollar, und die Zahl der persönlichen Bankrotte stieg im vergangenen Jahr um fünf Prozent. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Verschuldung der Privathaushalte nicht mehr durchzuhalten ist“, urteilt Dimitri Papadimitriou, Präsident des Levy Institute. „Das wird den Leuten gerade klar – womöglich mit schweren Folgen für die Konjunktur.“
„Einmalig in der Geschichte“
Nun ist die Freude an Krediten in den USA nicht gerade neu. Die Amerikaner leben traditionell auf Pump und sparen weniger als die meisten anderen Industrienationen. Allerdings hat sich der Trend zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Legten die US-Bürger Anfang der neunziger Jahre noch knapp neun Prozent ihres verfügbaren Einkommens beiseite, lag die Sparquote am Ende des Jahrzehnts bei weniger als zwei Prozent. Der Aktienboom und der vermeintliche Reichtum hatte viele Leute angestachelt, jetzt erst recht ihre Kreditkarten, Bankdarlehen und die Finanzierungsangebote von Einzelhändlern auszuschöpfen. Manche Ökonomen glauben sogar, dass weniger das Internet als diese Kredit- und Konsumwelle den Wachstumsschub der späten Neunziger ausgelöst hatte.
Doch bis heute ist Ökonomen und Psychologen ein Rätsel, warum diese Mentalität sich seit dem Platzen der Aktienblase nicht geändert hat – im Gegensatz zu früheren Rezessionen. Nach der Wirtschaftskrise von 1991 zum Beispiel sank die Kreditaufnahme der Amerikaner drastisch. Diesmal dagegen nahmen die Amerikaner fröhlich weiter Kredite auf, sogar schneller als zuvor, wenn man den Anteil am verfügbaren Einkommen zum Maßstab nimmt. „Eine solche Beschleunigung ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig“, sagt Jan Hatzius, Ökonom bei der Investmentbank Goldman Sachs in New York.
Das Resultat: Der Schuldenstand der amerikanischen Privathaushalte bricht alle Rekorde, inzwischen liegen die Schulden eines amerikanischen Durchschnittshaushalts über seinem Nettojahreseinkommen.
Etliche Kreditinstitute bekommen bereits kalte Füße. Finanzierungsfirmen großer Autokonzerne wie Ford Motor verzeichneten in den vergangenen drei Jahren einen Zuwachs ihrer Kreditausfälle um ein Drittel. Eine Studie der Schuldnerberatungsfirma Myvesta ergab im November, dass ein Amerikaner heutzutage im Durchschnitt 3250 Dollar Schulden auf zwei bis drei Kreditkarten mit sich herumträgt – ein Anstieg um fast 1000 Dollar gegenüber dem Vorjahr. Die Kreditkartenfirmen berichten, dass immer mehr Amerikaner am Maximum ihrer Kreditrahmen angelangt sind und mit ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen, zumal etliche dieser Firmen in den vergangenen Jahren den so genannten Sub-Prime-Lending-Markt erschlossen hatten. Ihre Kunden sind Leute, die keine einwandfreie Kreditgeschichte vorweisen konnten. Jetzt sind die Kreditkartenfirmen nervöser denn je: Einige rufen bei unzuverlässigen Kunden schon vor dem Rechnungsdatum an, um vorsorglich zur Bezahlung zu mahnen. Die Gebühren und Zinsen für säumige Schuldner sind drastisch gestiegen.
Längst geraten auch Leute in die Schuldenfalle, die früher kaum gefährdet schienen. Der Verband der Repo Men etwa stellte zuletzt fest, dass immer mehr Leute ihre Autos gleich freiwillig hergeben. „Die wollen den Ärger nicht“, sagt der Branchensprecher Altes, „das sind im Grunde ehrliche Leute aus dem bürgerlichen Mittelstand in einer außergewöhnlichen Lebenslage.“ Leute wie Mantell Sponder aus Brooklyn zum Beispiel, der als Computerexperte an der Wall Street einst 150000 Dollar im Jahr verdiente und sich nach einem Jahr Arbeitslosigkeit inzwischen rüde Telefonmanieren angewöhnt hat. „Die Kreditkartenfirmen und Gläubiger rufen hier quasi täglich an“, sagt Sponder und zuckt mit den Schultern. „Es ist einfach kein Geld da – und ich habe mir angewöhnt, gar nicht erst mit denen zu reden. Ich knalle dann gleich den Hörer auf die Gabel.“
Die Hausbesitzer fühlen sich reich
Es gibt freilich auch etliche Ökonomen, die von einer privaten Schuldenkrise nichts wissen wollen. Die Schuldenmacherei, so ihr Argument, könnte sich als gewonnene Wette auf eine bessere Zukunft herausstellen. Schließlich profitiert die Wirtschaft vom starken Konsum der Amerikaner. So könnte die kollektive Kreditaufnahme zur sich selbst erfüllenden Prophezeihung werden. Wer behält Recht – die Schwarzmaler oder die Optimisten?
Die Rechnung geht nur auf, wenn mit der Nachfrage auch der Arbeitsmarkt anspringt. Zwar sind im vergangenen Jahr die Einkommen um 4,5 Prozent gestiegen – nach nur 1,8 Prozent im Vorjahr –, aber zu einem großen Teil lag das an Steuerkürzungen aus Washington. Außerdem hat die Arbeitslosenquote in den USA gerade wieder die Sechsprozentmarke überschritten.
Entscheidend ist auch die Entwicklung der Zinsen und der Hauspreise. Notenbankchef Alan Greenspan hält die Leitzinsen zurzeit auf einem Rekordtief und macht keine Anstalten, sie bald wieder steigen zu lassen. Den Großteil ihrer neuen Kredite haben sich die Amerikaner in den vergangenen Monaten besorgt, indem sie zu diesen günstigen Zinssätzen Hypothekenkredite auf ihre Häuser aufnahmen – oder ihre bestehenden Hypotheken umschuldeten. Ein besonders gutes Geschäft machten dabei Hausbesitzer, die in Gegenden eines boomenden Immobilienmarktes leben, zum Beispiel in Sacramento oder in New York City: Einige Hauspreise sind in den vergangenen Jahren um 30, 50, gar 100 Prozent gestiegen, sodass bei der Umschuldung Extra-Cash anfiel und sich die Hausbesitzer umso reicher fühlten. Doch etliche Ökonomen sehen inzwischen die Hauspreise auf einem Hoch angelangt, einige Schwarzseher warnen sogar vor einem Kollaps der Immobilienpreise in einigen Regionen. Die Zinsen können zudem kaum weiter fallen. Mit dieser Art des Schuldenmachens dürfte es also bald vorbei sein. Weil aber niemand so richtig weiß, wie ernst die Lage wirklich ist, erreichen die amerikanischen Verbraucher in diesen Tagen höchst unterschiedliche Signale. „Leben Sie reich“, rät die Citibank auf Plakaten an Hauswänden und in Spots im Fernsehen: Die Bankiers wollen ihrer Kundschaft gern einreden, dass es auch in Krisenzeiten „keine gute Idee ist, sich aus Sparsamkeit selbst die Haare zu schneiden“. Und dass Amerikaner sozusagen „mit dem Recht auf akzeptierte Kreditanträge geboren“ seien. Umgekehrt werden Schuldenratgeber wie Überleben Sie die Ferien ohne Bankrott zu Bestsellern.
Beratungsseminare für überschuldete Amerikaner sind gefragt, und auch halbseidene Angebote („So bekommen Sie eine neue Kredit-Identität“) finden immer mehr verzweifelte Interessenten. Das American Bankruptcy Institute sorgt sich inzwischen darum, dass „die steigenden Zahlen der Zahlungsunfähigkeiten in den Haushalten auch die finanzielle Gesundheit der Kreditgeber-Institutionen gefährden“ könne. Und die sonst so optimistische Bankenwirtschaft unternimmt in Washington eine gewaltige Lobby-Anstrengung, um die Gesetze rings um den persönlichen Bankrott zu reformieren. Wer Pleite geht, darf in den Vereinigten Staaten in der Regel eine Menge behalten – oft das Haus und hohe Freibeträge auf Autos, Juwelen und die Hauseinrichtung. Die neue Gesetzgebung soll nach dem Wunsch der Kreditinstitute deutlich härter durchgreifen.
Böse Zeiten also für säumige Schuldner, und gute Zeiten für Leute wie die Repo Men? Vielleicht auch nicht. „Der Mai war ein ganz merkwürdiger Monat“, klagt in diesen Tagen der Branchensprecher Harvey Altes. „Die Autofirmen haben in den vergangenen Monaten so viele Autos mit Nullzinsen und Sonderrabatten verkauft, dass sie sowieso einen Verlust machen“, sagt Altes. „So ist der neueste Trend, dass sie die Fahrzeuge gar nicht mehr zurückhaben wollen.“
DIE ZEIT - 05.06.2003
.
Goldsuche in Deutschland ...

Gibt es hier im Forum eigentlich jemand, der als Hobby Goldwaschen betreibt ?
Zu diesem Thema gibt es eine Reihe interessanter Seiten im Web. Letzte Woche fand zum Beispiel in Riedenburg (Landkreis Kelheim, Niederbayern) eine "Deutsche Meisterschaft im Goldwaschen" statt. Goldschürfer werden fündig am Rhein, bei Korbach in Hessen, an der Thüringer Schwarze, entlang der Donau und im Bayerischen Wald.
Als Einstieg zum Thema empfiehlt sich die website: www.goldsucher.de
Im August 1997 machte die Schweiz erneut von sich Reden. Ein Hobbygoldsucher, der erst kurz zuvor in die Geheimnisse dieses Hobbys eingeweiht worden war, fand den bislang größten Flußgoldklumpen der Schweiz. Das gute Stück wog sagenhafte 123,1 Gramm und war natürlich “unverkäuflich”. Peter Bölsterli fand es im Disentis, südöstlich des Vierwaldstädter Sees, im Bereich des Vorderrheins...

Goldsuche in der Schweiz: Disentisgold
Jedes Jahr nach, spätestens nach der Schneeschmelze, pilgern die Abenteuerlustigen wieder in die Surselva, um ihr Glück herauszufordern. Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Schaufel, Goldwaschpfanne und einem Gläschen für die Goldnuggets, die jeder zu finden hofft, stehen die Goldschürfer im noch wasserreichen Vorderrhein. Wen das Goldfieber erst einmal gepackt hat, der kommt immer wieder. Seit im Herbst 2000 ein Schürfer den in Europa wohl bisher grössten Goldfund machte, rüstet man sich in Disentis während der Sommermonate für einen grossen Ansturm Gold suchender Feriengäste. Viele von ihnen werden die Hoffnung im Herzen tragen, ebenfalls zu den glücklichen Findern zu zählen.
Der Fundort der bisher grössten Gold-in-Quarz-Stufe mit einer Grösse von 35 mal 24 mal 3 Zentimetern und einem Goldgewicht von 396 Gramm wird indes auch weiterhin geheim gehalten, da in der besagten Goldader nach wie vor gegraben wird. Besichtigen können dürfte man den aussergewähnlichen Goldfund aber bald schon einmal im Bändner Naturmuseum in Chur. Man werde die Stufe mit grösster Sicherheit kaufen, bestätigte Museumsdirektor Jörg P. Müller. Die Verhandlungen seien auf bestem Wege, genauso wie die Lösung der Finanzierungsfrage. Müller plant für den Herbst in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Bern, welches das zweitgrößte Goldfundstück käuflich erwerben will, eine kleine Gold-Ausstellung, in deren Mittelpunkt die rund 250 000 Franken teure Stufe stehen wird. Der 2000-er Fund, der von Experten als echtes Gold aus der Surselva zertifiziert worden war, umfasste gesamthaft rund zwei Dutzend Nuggets. Bruno Higgins brachte die Funde in die USA zur diffizilen Reinigung und stellte die grössten Goldstufen während der Wintersaison bereits in seinem Laden in Arosa in einer gut gesicherten Vitrine aus.
Schon 1997 hatten Goldwäscher in Disentis für Aufsehen gesorgt, als sie einen 123 Gramm schweren Goldnugget gefunden hatten, der damals als Schweizer Rekord taxiert worden war. Da der Medelser Rhein bei Disentis als goldreichste Stelle in der ganzen Schweiz gilt, bleiben die Chancen auf weitere Goldfunde vermutlich intakt. In Disentis werden von Mai bis Oktober Halbtages- und Tagesexkursionen für Einzelpersonen, Familien und Gruppen angeboten, um eine professionelle Goldsuche zu ermöglichen. Neuen Schüfern wird dabei nicht nur erklärt, wie man die Goldwaschpfanne richtig benützt und wo sich die besten Schichten im Flussgeschiebe befinden. Sie erfahren gleichzeitig Grundlegendes über die Erzlagerstättentypen. Tagesexkursionen für 70 Franken werden jeweils donnerstags und samstags von 10 bis 16 Uhr, Halbtagesexkursionen für 35 Franken sonntags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr durchgeführt.

Erst ein Jahr zuvor war ebenfalls im Land der Eidgenossen ein ein Unzen schweres Nugget gefunden worden. Das war natürlich ein absolut seltener Fund und den Goldwäschern geht es auch nicht kaummit ihrer Suche reich zu werden, sondern eher um den Spaß an der Sache
Das Zentralschweizer Städtchen Willisau lädt vom 12 bis 17. August 2003 die Hobby-Digger zur Weltmeisterschaft im Goldwaschen 2003 ein.
Näheres: http://www.goldwaschen.ch/gold2003/program-d.htm
weitere Links:
http://www.goldsucher.de/forum/
http://www.goldwaschen.ch/cgi-bin/board/xboard.cgi?varfile=g…
http://minifossi.pcom.de/Default.htm
http://www.helvetisches-goldmuseum.ch/
http://www.goldwaschen.cc/
http://www.goldwaschen.ch/
http://www.goldprospector.ch/
http://www.goldminer.at/
http://www.goldcentrum.pl/land%20of%20gold/index.php3
http://www.wga.bbk.pl/

Waschgold
Die einfachste, unkomplizierteste und billigste Goldgewinnung ist die aus sogenannten "Seifenlagerstätten". Sie benötigen hierzu weder teure Gerätschaften noch Maschinen. Alles, was Sie brauchen, ist Geduld, Kondition, eine flache Schüssel in der Form einer Bratpfanne und einen goldführenden Fluß. An bestimmten Stellen konzentriert sich das Gold besonders häufig, vermengt sich mit Sanden und Kiesen und bilden mit anderen Schwermineralien "Seifen". Je nach Entfernung der Seife zur ursprünglichen, primären Lagerstätte wechseln Größe und Grad der Abschleifungen einzelner Goldkörnchen. Naturgemäß sind die Flitterchen dort am größten, wo in nächster Nähe auch das Muttergestein zu finden ist.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Seifen: Einmal die "buried placers", auch "begrabene Seifen" genannt, und zweitens die "bench placers", die "Terrassenseifen". Ungefähr drei Viertel des Seifengoldes findet sich als kleinstes Blattgold, das so dünn ist, daß es grünlich erscheint. Nur der geringste Teil kommt in Klumpen und Körnchen (Nuggets) vor.
Jeder Goldsucher, der mehrmals erfolgreich nach dem blinkendenMetall am Ufer eines Flusses wusch, kennt die wenigen Stellen, an denen er auch im nächsten Jahr mit Aussicht auf Erfolg den Sand wäscht. Denn die wiederkehrenden Hochwasser bilden an bestimmten stellen neue Seifen.
Als wichtigste Eigenart des Goldes sollte man sich daher merken, daß es sich um ein schweres, träges Element handelt: Gold ist mehr als 19,3-mal schwerer als dieselbe Menge Wasser. Daraus lassen sich einige Regeln ableiten, die von Goldwäschern auf allen Kontinenten und dies seit vielen Jahrhunderten genutzt werden:
Geröllbänke: Gold, ob als Nuggets (Körnchen, Klumpen) oder Flitterchen, findet sich im Geröll von Kieselanhäufungen, sofern diese bereits seit längerer Zeit an derselben Stelle liegen.
Sandbänke: In der Regel handelt es sich hierbei um Anhäufungen leichter Mineralienbestandteile; infolgedessen sind Schwermineralien (darunter Gold) nicht vertreten. Hat sich allerdings Sand im Innern einer Flußkrümmung angesammelt, sind mitunter auch Mineralien höherer spezifischer Gewichte zu finden.
Mulden: In Mulden und anderen Vertiefungen bilden sich bei Hochwasser lohnenswerte Goldkonzentrationen, meist in Verbindung mit dunklem Sand (Magnetit = magnetisch!).
Hindernisse: Ebenfalls findet sich Gold vor Flußhindernissen, vor grossen Steinen, aber auch im Moos und im Wurzelgeflecht ins Wasser ragender Bäume an goldführenden Gebirgsbächen und Flüssen.

Bekannteste Vorkommen in Deutschland:
Aftersteg in Baden-Württemberg
Bodenmais in Bayern
Dorfweil in Hessen
St. Andreasberg im Harz
Kartzhütte in Thüringen
.
Goldsuche in Deutschland ...

Gibt es hier im Forum eigentlich jemand, der als Hobby Goldwaschen betreibt ?
Zu diesem Thema gibt es eine Reihe interessanter Seiten im Web. Letzte Woche fand zum Beispiel in Riedenburg (Landkreis Kelheim, Niederbayern) eine "Deutsche Meisterschaft im Goldwaschen" statt. Goldschürfer werden fündig am Rhein, bei Korbach in Hessen, an der Thüringer Schwarze, entlang der Donau und im Bayerischen Wald.
Als Einstieg zum Thema empfiehlt sich die website: www.goldsucher.de
Im August 1997 machte die Schweiz erneut von sich Reden. Ein Hobbygoldsucher, der erst kurz zuvor in die Geheimnisse dieses Hobbys eingeweiht worden war, fand den bislang größten Flußgoldklumpen der Schweiz. Das gute Stück wog sagenhafte 123,1 Gramm und war natürlich “unverkäuflich”. Peter Bölsterli fand es im Disentis, südöstlich des Vierwaldstädter Sees, im Bereich des Vorderrheins...

Goldsuche in der Schweiz: Disentisgold
Jedes Jahr nach, spätestens nach der Schneeschmelze, pilgern die Abenteuerlustigen wieder in die Surselva, um ihr Glück herauszufordern. Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Schaufel, Goldwaschpfanne und einem Gläschen für die Goldnuggets, die jeder zu finden hofft, stehen die Goldschürfer im noch wasserreichen Vorderrhein. Wen das Goldfieber erst einmal gepackt hat, der kommt immer wieder. Seit im Herbst 2000 ein Schürfer den in Europa wohl bisher grössten Goldfund machte, rüstet man sich in Disentis während der Sommermonate für einen grossen Ansturm Gold suchender Feriengäste. Viele von ihnen werden die Hoffnung im Herzen tragen, ebenfalls zu den glücklichen Findern zu zählen.
Der Fundort der bisher grössten Gold-in-Quarz-Stufe mit einer Grösse von 35 mal 24 mal 3 Zentimetern und einem Goldgewicht von 396 Gramm wird indes auch weiterhin geheim gehalten, da in der besagten Goldader nach wie vor gegraben wird. Besichtigen können dürfte man den aussergewähnlichen Goldfund aber bald schon einmal im Bändner Naturmuseum in Chur. Man werde die Stufe mit grösster Sicherheit kaufen, bestätigte Museumsdirektor Jörg P. Müller. Die Verhandlungen seien auf bestem Wege, genauso wie die Lösung der Finanzierungsfrage. Müller plant für den Herbst in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum Bern, welches das zweitgrößte Goldfundstück käuflich erwerben will, eine kleine Gold-Ausstellung, in deren Mittelpunkt die rund 250 000 Franken teure Stufe stehen wird. Der 2000-er Fund, der von Experten als echtes Gold aus der Surselva zertifiziert worden war, umfasste gesamthaft rund zwei Dutzend Nuggets. Bruno Higgins brachte die Funde in die USA zur diffizilen Reinigung und stellte die grössten Goldstufen während der Wintersaison bereits in seinem Laden in Arosa in einer gut gesicherten Vitrine aus.
Schon 1997 hatten Goldwäscher in Disentis für Aufsehen gesorgt, als sie einen 123 Gramm schweren Goldnugget gefunden hatten, der damals als Schweizer Rekord taxiert worden war. Da der Medelser Rhein bei Disentis als goldreichste Stelle in der ganzen Schweiz gilt, bleiben die Chancen auf weitere Goldfunde vermutlich intakt. In Disentis werden von Mai bis Oktober Halbtages- und Tagesexkursionen für Einzelpersonen, Familien und Gruppen angeboten, um eine professionelle Goldsuche zu ermöglichen. Neuen Schüfern wird dabei nicht nur erklärt, wie man die Goldwaschpfanne richtig benützt und wo sich die besten Schichten im Flussgeschiebe befinden. Sie erfahren gleichzeitig Grundlegendes über die Erzlagerstättentypen. Tagesexkursionen für 70 Franken werden jeweils donnerstags und samstags von 10 bis 16 Uhr, Halbtagesexkursionen für 35 Franken sonntags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr durchgeführt.
Erst ein Jahr zuvor war ebenfalls im Land der Eidgenossen ein ein Unzen schweres Nugget gefunden worden. Das war natürlich ein absolut seltener Fund und den Goldwäschern geht es auch nicht kaummit ihrer Suche reich zu werden, sondern eher um den Spaß an der Sache
Das Zentralschweizer Städtchen Willisau lädt vom 12 bis 17. August 2003 die Hobby-Digger zur Weltmeisterschaft im Goldwaschen 2003 ein.
Näheres: http://www.goldwaschen.ch/gold2003/program-d.htm
weitere Links:
http://www.goldsucher.de/forum/
http://www.goldwaschen.ch/cgi-bin/board/xboard.cgi?varfile=g…
http://minifossi.pcom.de/Default.htm
http://www.helvetisches-goldmuseum.ch/
http://www.goldwaschen.cc/
http://www.goldwaschen.ch/
http://www.goldprospector.ch/
http://www.goldminer.at/
http://www.goldcentrum.pl/land%20of%20gold/index.php3
http://www.wga.bbk.pl/

Waschgold
Die einfachste, unkomplizierteste und billigste Goldgewinnung ist die aus sogenannten "Seifenlagerstätten". Sie benötigen hierzu weder teure Gerätschaften noch Maschinen. Alles, was Sie brauchen, ist Geduld, Kondition, eine flache Schüssel in der Form einer Bratpfanne und einen goldführenden Fluß. An bestimmten Stellen konzentriert sich das Gold besonders häufig, vermengt sich mit Sanden und Kiesen und bilden mit anderen Schwermineralien "Seifen". Je nach Entfernung der Seife zur ursprünglichen, primären Lagerstätte wechseln Größe und Grad der Abschleifungen einzelner Goldkörnchen. Naturgemäß sind die Flitterchen dort am größten, wo in nächster Nähe auch das Muttergestein zu finden ist.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Seifen: Einmal die "buried placers", auch "begrabene Seifen" genannt, und zweitens die "bench placers", die "Terrassenseifen". Ungefähr drei Viertel des Seifengoldes findet sich als kleinstes Blattgold, das so dünn ist, daß es grünlich erscheint. Nur der geringste Teil kommt in Klumpen und Körnchen (Nuggets) vor.
Jeder Goldsucher, der mehrmals erfolgreich nach dem blinkendenMetall am Ufer eines Flusses wusch, kennt die wenigen Stellen, an denen er auch im nächsten Jahr mit Aussicht auf Erfolg den Sand wäscht. Denn die wiederkehrenden Hochwasser bilden an bestimmten stellen neue Seifen.
Als wichtigste Eigenart des Goldes sollte man sich daher merken, daß es sich um ein schweres, träges Element handelt: Gold ist mehr als 19,3-mal schwerer als dieselbe Menge Wasser. Daraus lassen sich einige Regeln ableiten, die von Goldwäschern auf allen Kontinenten und dies seit vielen Jahrhunderten genutzt werden:
Geröllbänke: Gold, ob als Nuggets (Körnchen, Klumpen) oder Flitterchen, findet sich im Geröll von Kieselanhäufungen, sofern diese bereits seit längerer Zeit an derselben Stelle liegen.
Sandbänke: In der Regel handelt es sich hierbei um Anhäufungen leichter Mineralienbestandteile; infolgedessen sind Schwermineralien (darunter Gold) nicht vertreten. Hat sich allerdings Sand im Innern einer Flußkrümmung angesammelt, sind mitunter auch Mineralien höherer spezifischer Gewichte zu finden.
Mulden: In Mulden und anderen Vertiefungen bilden sich bei Hochwasser lohnenswerte Goldkonzentrationen, meist in Verbindung mit dunklem Sand (Magnetit = magnetisch!).
Hindernisse: Ebenfalls findet sich Gold vor Flußhindernissen, vor grossen Steinen, aber auch im Moos und im Wurzelgeflecht ins Wasser ragender Bäume an goldführenden Gebirgsbächen und Flüssen.

Bekannteste Vorkommen in Deutschland:
Aftersteg in Baden-Württemberg
Bodenmais in Bayern
Dorfweil in Hessen
St. Andreasberg im Harz
Kartzhütte in Thüringen
.
Wahrheitssuche in Amerika.
Der Autor hat auch Gold gefunden. http://www.sundaytimes.co.za/2003/06/15/business/markets/mar…
http://www.sundaytimes.co.za/2003/06/15/business/markets/mar…
J2
Der Autor hat auch Gold gefunden.
 http://www.sundaytimes.co.za/2003/06/15/business/markets/mar…
http://www.sundaytimes.co.za/2003/06/15/business/markets/mar… J2
.
Pflichtlektüre für Goldbugs:
www.wellenreiter-invest.de
Wellenreiter-Invest kann man grob in die Reihe der wenigen deutschsprachigen Investorenforen einordnen, die sich mit dem Goldmarkt befassen.
Der Initiator und Herausgeber Robert Rethfeld veröffentlicht auf der Startseite von Wallstreet-Online regelmäßig Kommentare zum Marktgeschehen, aktuell z.B. heute:
http://www.wallstreet-online.de/ws/news/news/main.php?&actio…
Rethfelds Beiträge zeichnen sich durch eigenständiges Denken aus und sind frei von jedwedem institutionellen "Maulkorberlaß"

Mit Sicherheit ist er auch in diesem Forum aktiv ( - ich habe auch einen "Verdacht" unter welchem "nickname" er sich verbirgt ... )
- er sei hiermit herzlich gegrüßt ...
Hier noch zwei Links:
http://www.wellenreiter-invest.de/WellenreiterWoche/wellenre…
http://www.wellenreiter-invest.de/WellenreiterWoche/Wellenre…
.
Pflichtlektüre für Goldbugs:
www.wellenreiter-invest.de
Wellenreiter-Invest kann man grob in die Reihe der wenigen deutschsprachigen Investorenforen einordnen, die sich mit dem Goldmarkt befassen.
Der Initiator und Herausgeber Robert Rethfeld veröffentlicht auf der Startseite von Wallstreet-Online regelmäßig Kommentare zum Marktgeschehen, aktuell z.B. heute:
http://www.wallstreet-online.de/ws/news/news/main.php?&actio…
Rethfelds Beiträge zeichnen sich durch eigenständiges Denken aus und sind frei von jedwedem institutionellen "Maulkorberlaß"


Mit Sicherheit ist er auch in diesem Forum aktiv ( - ich habe auch einen "Verdacht" unter welchem "nickname" er sich verbirgt ... )
- er sei hiermit herzlich gegrüßt ...

Hier noch zwei Links:
http://www.wellenreiter-invest.de/WellenreiterWoche/wellenre…
http://www.wellenreiter-invest.de/WellenreiterWoche/Wellenre…
.
.
Srebrenica schon vergessen ? –

und die UNO schaut wieder tatenlos zu ...
KONGO : "Willkommen im Wahnwitz"
von Thilo Thielke
Ungehemmt geht das Gemetzel im Bezirk Ituri weiter, auch wenn jetzt französische Soldaten eingetroffen sind. Statt die Gewaltorgien zu beenden, fährt die Eingreiftruppe Streife.
Die Vereinten Nationen bieten wieder mal ein Bild des Jammers. Seit Stunden bereits liefern sich durchgeknallte Kindersoldaten mit Kalaschnikows, Mörsern und 82-Millimeter-Kanonen in Bunias Stadtzentrum ein wüstes Gefecht. Und die Uruguayer von der Uno? Sie kriechen blau behelmt und in schusssicheren Westen schildkrötengleich auf dem Fußboden ihres Hauptquartiers herum und beten das Ave-Maria.
Gerade einmal zehn Mann karren sie im Verlauf dieses unheimlichen Vormittags zur Verstärkung heran, obwohl 700 bewaffnete Uno-Soldaten am Flughafen kampieren. Dass der Schießerei schließlich nicht mehr als ein Dutzend Beteiligte zum Opfer fallen, verdankt der von knapp 400 Lendu-Kindern angegriffene Hema-Nachwuchs lediglich seinen besseren Waffen. Die Vertreter der Weltgemeinschaft bleiben praktisch tatenlos.
Oberst Daniel Vollot, französischer Chef der Uno-Mission, doch zu seinem Leidwesen weitgehend ohne Befugnisse, flüchtet sich angesichts der schier unaufhörlichen Gewaltexzesse im Osten des Kongo schon lange nur noch in Zynismus. Wie beim Tennis woge die Schlacht hin und her, erklärt er im Garten des Uno-Hauptquartiers: "Mal von links nach rechts, dann wieder umgekehrt. Wie langweilig!" Und dazu lacht der Fallschirmjäger, während durch die Nachbarstraße Salven von Schnellfeuergewehren peitschen.
Er genieße nun die Sonne, sagt Vollot; das Krachen der einschlagenden Granaten, das Rattern der MG sei für ihn wie Musik. Ändern könne man ohnehin nicht viel: "Wer Krieg will, der bekommt ihn auch." Ungläubig starrt einer vom "Uru-Batt", dem Uno-Bataillon aus Südamerika, herüber, der sich hinter einem Mäuerchen verschanzt hat.
Auch Johannes Wedenig vom Kinderhilfswerk Unicef kann die Ungeheuerlichkeiten des Kriegsalltags nur noch schwer ertragen. "Willkommen im Wahnwitz", stöhnt er. Wedenig hat sich Jugendarbeit zum Ziel gesetzt, aber der Mann kann froh sein, dass ihn noch keines der kongolesischen Kinder ermordet hat, die von afrikanischen Kriegsherren gewissenlos instrumentalisiert werden. Denn das Gemetzel geht unvermindert weiter - allen gut gemeinten Resolutionen und allen zusätzlichen europäischen Soldaten zum Trotz, die unter französischem Kommando jetzt in Bunia einrücken.

Ihre Mission ist zwar nach der griechischen Jagdgöttin Artemis benannt, und die vermag der Mythologie zufolge außer Pest und Tod auch Eintracht und ein langes Leben zu bringen. Doch das EU-Mandat ist an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Den Flugplatz und die Stadt, einschließlich ihrer zwei Flüchtlingslager, sollen die Franzosen sichern. Mehr nicht. Dabei ist Bunia längst unter der Kontrolle der Hema, nur wenige Lendu halten sich noch im Ort auf. Unvorstellbare Gräuel ereignen sich unterdessen in den Bergen Ituris - außerhalb des kleinen Radius der Friedenstruppen.
So sind Zehntausende längst nach Süden geflüchtet: 150 Kilometer zu Fuß durch den Urwald bis in die Stadt Beni, die von regierungstreuen Soldaten kontrolliert wird. Sie sind dem Horror ihrer Heimat Ituri entronnen und könnten doch bald wieder in der Falle sitzen. Denn von Süden rücken ruandische Soldaten vor und attackieren Beni. Sie sind Verbündete der Hema-Milizen und beuten für ihre Regierung in Kigali die Bodenschätze des Kongo nach Kräften aus.
"Wenn in den riesigen Flüchtlingslagern die Cholera ausbricht, könnten wir schnell eine Katastrophe erleben", befürchtet Pascal Vignier von Ärzte ohne Grenzen: "Es sind zu viele Menschen auf zu engem Raum, und wir haben zu wenig Wasser." Die Seuchengefahr steige mit jedem Ankömmling. Die ersten sechs Cholera-Verdachtsfälle sind bereits gemeldet worden.
In einem Zelt am Rande des Lagers dokumentieren Vignier und seine Kollegen, was die aus Ituri Vertriebenen berichten. Es sind Protokolle, die an den Genozid in Ruanda 1994 erinnern. Von "systematischem Morden" erzählen die Menschen, von ganzen Familien, die mit Buschmessern ("Pangas" ) zerstückelt wurden, von ritualisiertem Kannibalismus und abgeschnittenen Genitalien. "Sie essen die Herzen ihrer Feinde, um sich deren Kraft anzueignen", sagt der Franzose. Er hat erkennbar Mühe, Worte für diesen Irrsinn zu finden.
Im Lager von Eringeti sind bis Ende vergangener Woche 55 275 Flüchtlinge registriert worden. Michelle Brown von der Hilfsorganisation Merlin schätzt die Gesamtzahl in der Region auf 130 000. Der Helfer Eugène Kasongo von World Vision, seit Jahren in der Gegend aktiv, glaubt: "Die Menschen sind nur vorübergehend in Sicherheit. Das hier ist erst der Anfang."
Der Familienvater Jean-Pierre Lubondo zum Beispiel ist zweimal auf der Flucht von Hema-Milizen überfallen worden. In einem Dorf, 15 Kilometer von Bunia entfernt, hat er ein Massaker überlebt. Er sah die zerstückelten Leichen seiner Nachbarn. Jetzt versucht er, sich und seine Familie im Lager zu ernähren und nebenbei noch zwei Kinder, die ihre Eltern verloren haben und im Wald herumirrten. "Die Hema haben gesagt, dass sie uns alle töten wollen. Niemand geht so schnell zurück."
Doch schon bald könnte Lubondo in den mörderischen Strudel zurückgeworfen werden. Schon werden aus Butembo Kämpfe gemeldet. Das ist nur 40 Kilometer entfernt. Sollten die ruandischen Soldaten und ihre kongolesischen Verbündeten Beni einnehmen, dann würden die Flüchtlingsmassen wieder nach Norden getrieben, direkt vor die Kalaschnikows der Killer von Ituri.
Derartige Sorgen scheinen den Sonderbeauftragten der Europäischen Union für das Gebiet der zentralafrikanischen Großen Seen, den Italiener Aldo Ajello, noch nicht umzutreiben. Er landet zur Stippvisite auf dem Flughafen von Bunia, lässt sich von den Kanonen des 3. französischen Marineinfanterie-Regiments beschützen und droht den kongolesischen Milizionären mit einem internationalen Kriegsverbrechertribunal.
Wie die demnächst 1400 Mann starke EU-Friedenstruppe das Morden beenden kann, wenn sie nur die Straßen und den Flughafen Bunias sichert, will er nicht verraten.
Lieber erzählt Ajello, wie stolz er darauf sei, dass "dieser Einsatz unter der Flagge der Europäischen Union" zu Stande gekommen ist. Europa unterstütze mit dem ersten militärischen Auftritt auf einem anderen Kontinent jetzt einen Friedensprozess, an dem sich auch die Nachbarländer und Kriegstreiber Uganda und Ruanda beteiligen wollten.
Viel mehr ist auch dem einsilbigen Kommandeur der internationalen Eingreiftruppe, General Jean-Paul Thonier, nicht zu entlocken. Sicher sei lediglich, dass man Bunia nicht verlassen werde und nicht daran denke, die Milizen zu entwaffnen. Außerdem sei die Truppe erst in einigen Wochen vollzählig, und in drei Monaten laufe das Mandat schon wieder aus. Blauhelme aus Bangladesch, so ist es geplant, sollen dann die kongolesischen Bürgerkriegsregionen befrieden.
Trübe Aussichten sind das trotz des martialischen Auftriebs auf dem Flughafen von Bunia, über den ostentativ "Mirage"-Kampfflieger donnern. "Die Hema sind dabei, die Lendu auszulöschen, und nichts wird dagegen unternommen", sagt Rüdiger Sterz von der Deutschen Welthungerhilfe. Sollten die Lendu nämlich erneut Versuche unternehmen, die Stadt wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen, würden die Franzosen wohl im Zweifelsfall die Hema-Milizen des Führers Thomas Lubanga unterstützen müssen und so einen schrecklichen Status quo aufrechterhalten.
80 Zivilisten sollen an diesem Tag massakriert worden sein in einem Dorf nur 20 Kilometer von Bunia entfernt. Zur gleichen Zeit haben die Franzosen ihre Unterkünfte errichtet und sind in der Stadt Streife gefahren. Einen Auftrag, gegen das Morden einzuschreiten, hatten sie nicht.
DER SPIEGEL –17.06.2003

Die Killer aus der Okapi-Bar
Von Alwin Schröder
Mit der Operation "Artemis" sollen EU-Soldaten den Völkermord im Kongo stoppen. Doch noch müssen Flüchtlingshelfer dem Grauen in der Stadt Bunia tatenlos zusehen. 200 Kilometer südlich bahnt sich indes schon das nächste Drama an.
Bunia - Bier und Beef werden in der Okapi-Bar überwiegend nur noch für die neue Kundschaft serviert. Denn die Milizen der UPC (Union kongolesischer Patrioten) haben sich auch des einzigen Restaurants bemächtigt, das es in Bunia noch gibt. "Sie trinken sich dort stark und schwingen große Reden", berichtet Rüdiger Sterz, der seit einem Jahr als Projektleiter für die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) in der umkämpften Stadt im Nordosten des Kongo arbeitet.
Die UPC-Milizen haben die Macht in Bunia übernommen. Von den einst 130.000 Einwohnern sind viele in Flüchtlingscamps in den Bergen der Provinz Ituri geflüchtet - aus Angst vor den grauenvollen Kämpfen zwischen den verfeindeten Stämmen der Hema, die von den Killern der UPC unterstützt werden, und der Lendu. Vielleicht kommen die Einwohner von Bunia zurück, wenn jetzt europäische Soldaten in der Stadt präsent sind. Aber Sterz mag noch nicht daran glauben: "Viele bleiben noch in den Camps, weil die Männer Angst um ihre Familie haben. Sie haben Angst davor, dass ihre Töchter vergewaltigt werden."
Grauenhaftes hat Sterz erlebt. "Man sieht viel Elend in den Krankenhäusern", berichtet er gegenüber SPIEGEL ONLINE. "Männer, denen mit der Machete das Gesicht zerfetzt wurde, Kinder mit abgehackten Armen." Die Brutalität der verfeindeten Stämme sei unvorstellbar: "Der eine will dem anderen nicht mehr vergeben. Als einzige Lösung bleibt in ihren Augen nur das Ausradieren des Gegners."
Mindestens 50.000 Tote hat der Konflikt zwischen Hema und Lendu in der jüngeren Vergangenheit gefordert, ohne dass die überforderten Blauhelm-Soldaten aus Uruguay und Uno-Mitarbeiter eingreifen konnten. Im Gegenteil: Sie waren selbst Opfer von Übergriffen. Beobachter der Vereinten Nationen gerieten kürzlich in die Hände von Milizen, die sie folterten, kastrierten und schließlich zerstückelten. Eine Uno-Mitarbeiterin bezeichnete die verfeindeten Stämme als "außer Kontrolle geratene Irre".
Franzosen sind erst in 50 Tagen einsatzfähig
130.000 Menschen sind in der Region auf der Flucht. Eskaliert war die Situation Anfang Mai, nachdem Uganda seine 6000 Soldaten aus der Ituri-Provinz abgezogen hatte. In Bunia waren bislang 625 Uno-Soldaten stationiert, ihnen stehen schätzungsweise 25.000 bis 28.000 Kämpfer der Lendu und der Hema gegenüber.
Alle Hoffnung der internationalen Helfer in Bunia ruht nun auf die Operation "Artemis" der EU, auf 1400 überwiegend französischen Soldaten, die nach und nach in dem Krisengebiet eintreffen. Der Auftakt verlief jedoch alles andere als viel versprechend für Sterz und seine Kollegen. "Der französische General hat uns berichtet, dass seine Soldaten erst in 50 Tagen voll einsatzfähig sein werden. Das hat uns ziemlich schockiert." Denn erst wenn die EU-Soldaten die Kontrolle in der Stadt übernehmen, könnten die Helfer in Viertel gelangen, zu denen sie jetzt noch keinen Zutritt haben.
Die EU-Eingreiftruppe wird es mit Thomas Lubanga zu tun bekommen, dem selbst ernannten Chef der UPC-Milizen in Bunia. "Er möchte die Stadt zusammen mit den Franzosen kontrollieren, aber das ist ja wohl indiskutabel", meint Sterz. "Eine Entwaffnung dürfte wohl schwierig werden", glaubt er. Denn Lubanga hat schon klargestellt, dass seine Soldaten auf keinen Fall ihre Kalaschnikows abgeben werden. Sonst gebe es Ärger.
"Wir sind nicht das Afrikakorps"
Seinen in den letzten Wochen rücksichtslos mordenden Kindersoldaten hat Lubanga inzwischen offenbar etwas Zurückhaltung befohlen. "Sie fahren zwar nicht mehr in den Pick-ups durch die Stadt, sind aber immer noch präsent", berichtet Sterz. Eine Kontaktaufnahme mit den oft mit Drogen voll gepumpten Acht- oder Neunjährigen zwar möglich, aber nur sehr vorsichtig anzugehen: "Sie kommen sich natürlich sehr stark vor mit ihren Waffen. Es sind halt Kinder."
Doch während in Bunia durch die Ankunft der europäischen Eingreiftruppe Hoffnung aufkommt, wird 200 Kilometer südlich schon das nächste Kapitel des blutigen Stammeskonflikts eröffnet: In Butembo mit seinen 500.000 Einwohnern kommt es bereits zu schweren Kämpfen zwischen Truppen, die von der Zentralregierung in Kinshasa unterstützt werden, und Einheiten der mit der UPC verbündeten RCD, die von Ruanda unterstützt wird und den ganzen Osten vom Rest der Republik abspalten will. Rund 150.000 Flüchtlinge sind dort zwischen den Fronten eingekesselt. "Uns fehlen die Nahrungsmittel, um diesen Menschen zu helfen", berichtet Kai Grulich, der dortige Projektleiter der Deutschen Welthungerhilfe. "Die Lage ist ziemlich prekär." Der politische Druck auf die in den Konflikt verwickelten Länder wie Uganda und Ruanda müsse verstärkt werden.

Denn Hema und Lendu führen auch einen Stellvertreter-Krieg in Ituri. Es geht Uganda und Ruanda um die Bodenschätze, um Gold, Diamanten - und um Coltan, ein seltenes Mineral, das von Handy-Herstellern aus Europa, Asien und den USA benötigt wird.
Alle Helfer sind sich deshalb einig, dass 1400 EU-Soldaten nicht ausreichen, um für Frieden in der Krisenregion zu sorgen. Mindestens 2000 bis 3000 Mann seien notwendig, um die Milizen zu entwaffnen, sagt Marcus Sack, ebenfalls DWHH-Projektleiter im Kongo. Doch davon will EU-Chefdiplomat Javier Solana nichts wissen. Der Einsatz bleibe streng auf Bunia begrenzt: "Wir sind nicht das Afrikakorps."
DER SPIEGEL 13.06.2003
Im Vorhof der Hölle
von Thilo Thielke
Kindersoldaten und marodierende Milizionäre haben in der Region Ituri Tausende Zivilisten massakriert. Hunderttausende sind auf der Flucht. Ein neuer Völkermord droht unter den Augen der Welt - aber die Uno-Blauhelme sehen nahezu tatenlos zu.

Dem Missionar Jan Mol droht langsam der Glaube abhanden zu kommen. Wenn der Geistliche über Schlaglöcher hinweg zu seinem Gemeindehaus in Bunias zerschossenem Zentrum stolpert, muss er einen entwürdigenden Spießrutenlauf über sich ergehen lassen. Schon mittags stöckeln betrunkene Siebenjährige auf hohen Damenabsätzen um den 67-Jährigen herum, schwenken Kalaschnikows, blasen ihm respektlos Zigarettenrauch ins Gesicht und fuchteln vor dem "Mzungu" aus Holland drohend mit Brotmessern und Handgranaten herum.
Diese Minderjährigen sind die neuen Herren der Straße. Sie "morden und plündern und folgen nicht dem Gesetz des Herrn, sondern nur noch dem der Gewalt", hat Mol erkannt und wähnt sich schon im Vorhof der Hölle. "Wenn hier nicht bald Soldaten der Vereinten Nationen dazwischengehen, dann erleben wir eine wahre Katastrophe", sagt der Priester und verfolgt fassungslos, wie sich auf dem Boulevard de la Libération ein Blauhelm aus Uruguay von einem schwer bewaffneten Knirps mit Zöpfchenperücke auf dem Kopf, Bierflasche im Hosenbund und Brotbeutel um den Hals schikanieren lässt. Der Holländer ist überzeugt: "Wir erleben einen Genozid, und die Uno steht tatenlos daneben."
Vor gut zwei Wochen haben Kindermilizen der Union der kongolesischen Patrioten, die dem Stamm der Hema angehören, die Kontrolle in der 300 000-Einwohner-Stadt Bunia übernommen und ihre Widersacher vom Stamm der Lendu vertrieben, mit Macheten erschlagen oder erschossen. Zerhackte Leichen faulten tagelang auf den Straßen von Bunia vor sich hin. Mol, der seit 1971 dort lebt, sieht ein "Desaster wie in Bosnien oder Ruanda" heraufziehen, wo unter den Augen der Welt Hunderttausende erschlagen, erschossen und verscharrt wurden: "Es ist das nackte Grauen."
Als das Schlachten in der Hauptstadt der kongolesischen Region Ituri begann, hatte der Gottesmann immer wieder versucht, die Kommandeure der 625 Blauhelme aus Uruguay, die dort stationiert sind, zum Eingreifen zu bewegen. Doch als sich endlich ein paar bis an die Zähne bewaffnete Uno-Männer auf den Weg machten, lagen Mols Kollegen Aimé Ndjabu und François Mateso bereits in ihrem eigenen Blut. Der eine mit durchgeschnittener Kehle, der andere durchsiebt von Garben aus Schnellfeuergewehren.
Um die Leichen der Geistlichen und zwölf weiterer Opfer tobten feixend ihre jugendlichen Mörder. Sie riefen Mol zu: "Wir werden unsere Feinde alle töten." Die Blauhelme zogen wieder ab, um das Verbrechen lediglich zu notieren. Sie ließen sich zu Zaungästen des Massenmordes machen wie einst im bosnischen Srebrenica, wo Serben-Milizen 1995 mehr als 7500 Muslime abschlachteten.

Nach ein paar Tagen zählen die Uno-Soldaten allein im Zentrum von Bunia bereits rund 300 Leichen. Wie viele es insgesamt sind, weiß niemand, denn die internationalen Friedenssoldaten wagen sich nicht einmal im Panzer aus der Stadt heraus. "In der Provinz Ituri leben 2,4 Millionen Menschen", sagt Marcus Sack von der Deutschen Welthungerhilfe, "eine Million ist auf der Flucht: Was sich in den Bergen abspielt, ist der reinste Horror."
Erst vergangene Woche wurden die Leichen zweier Uno-Beobachter 70 Kilometer von Bunia entfernt gefunden. Sie waren mit Buschmessern in Stücke gehackt worden.
Im Krankenhaus der Stadt hat Sack die Überlebenden des "Infernos" ("The Economist" ) gesehen: Frauen und Kinder mit abgetrennten Gliedmaßen und Opfer mit Schusswunden, um die sich jetzt Mediziner der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" kümmern.
"Wir haben außerdem diverse glaubwürdige Hinweise auf Kannibalismus", räumt Uno-Mann Amos Namanga Ngongi ein und spricht von "einer unglaublichen Barbarei: Im Kongo rennen Menschen mit Amuletten aus menschlichen Knochen herum". Der Kameruner ist der Sonderbeauftragte des Uno-Generalsekretärs für die Demokratische Republik Kongo und nur auf Kurzbesuch in Bunia.
Die skandalöse Untätigkeit seiner Soldaten erklärt er damit, dass man nicht vorbereitet gewesen sei auf "derartige kriegerische Handlungen". Dabei sieht das Mandat der Blauhelme ausdrücklich den Schutz der Zivilbevölkerung vor. Dennoch ist Ngongi guten Mutes: "Killer können zu Nichtkillern werden", gibt er seinen Leuten noch mit auf den Weg. Dann muss er sich sputen, das Flugzeug wartet.
Mit seinem Optimismus steht Ngongi ziemlich allein da. Seit Ausbruch der Kämpfe vor fünf Jahren sind im Kongo nach Schätzungen der Organisation International Rescue Committee zwischen 3 und 4,7 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Niemals seit Ende des Zweiten Weltkriegs war die Sterblichkeitsrate in einem Konflikt derart hoch.
60 000 Tote, schätzt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, sollen allein die Stammeskämpfe zwischen den Vieh züchtenden Hema und den Ackerbau treibenden Lendu im Nordosten des riesigen Landes gefordert haben. Und ein Ende der "Blutorgien" ("Neue Zürcher Zeitung" ) ist in Ituri nicht in Sicht.
Ganz im Gegenteil: Gerade einmal vier Kilometer vor der von Hema-Milizen kontrollierten Stadt überwachen verwegen kostümierte Lendu-Kämpfer die wichtigen Ausfallstraßen und sinnen auf Rache. Nicht nur Entwicklungshelfer Sack ist sich sicher, "dass sie auf Waffen aus dem Ausland warten und dann möglichst bald zurückschlagen".
Maßgeblichen Anteil an den 1999 ausgebrochenen ethnischen Kämpfen haben Kongos Nachbarländer Ruanda und Uganda. Nach einem im April veröffentlichten Amnesty-Bericht haben sie "die Region in einem unermesslichen Umfang systematisch ausgeplündert" und dabei "innerethnische Konflikte und Massenmorde gefördert", um die wichtigen Bodenschätze des Kongo auszubeuten: Gold, Holz und das für die Handy-Produktion wichtige Coltan. Die verwahrlosten Kindermilizionäre verrichteten in "der sich immer noch ausweitenden Tragödie" lediglich die schmutzige Arbeit der Profiteure im ugandischen Kampala und ruandischen Kigali.
Während die ruandische Armee in die Provinz Kivu einmarschierte und über die Kongolesische Sammlungsbewegung für Demokratie die Region bis heute kontrolliert, sicherte sich die ugandische Armee die weiter nördlich gelegene Ituri-Provinz, in der große Mengen Gold gewonnen werden.
In den Uferregionen des Albert-Sees werden zudem bedeutende Ölvorkommen vermutet. Die könnten nach Schätzungen der kanadischen Firma Heritage Oil sogar "mehrere Milliarden Barrel" ausmachen.
Anfangs unterstützte die vergleichsweise gut ausgebildete ugandische Armee Milizen der Hema. Diese fühlen sich jedoch den Tutsi aus Ruanda näher und verbündeten sich mit der Regierung in Kigali. Uganda wandte sich daraufhin den Lendu zu und versorgt sie derzeit mit Waffen.
Die Folge der wechselnden Allianzen waren ständige Front- und Machtverschiebungen und unvorstellbare Grausamkeiten, die beide Bevölkerungsgruppen einander zufügten. Das Geschehen lässt selbst die Uno-Chefanklägerin für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien, Carla Del Ponte, mittlerweile von einem "drohenden Genozid" sprechen.
Denn in Ituri wird immer hemmungsloser gemordet. Seit die ugandische Armee gemäß eines Abkommens mit der Regierung in Kinshasa am 7. Mai ihre letzten Truppen aus Ituri abzog, herrscht ein Zustand der Rechtlosigkeit. Ihre Waffen übergaben die Ugander in Bunia den Lendu-Kämpfern, die reichlich davon Gebrauch machten. Sie nutzten die Abwesenheit der Ordnungsmacht dazu, massenweise Hema abzuschlachten.
Wenige Tage später übten dann die von Ruanda ausgerüsteten Hema grausige Rache und nahmen die Stadt ein. Seitdem sind die Lendu von Bunia entweder tot oder geflüchtet: Mindestens 50 000 sollen die Grenzen nach Uganda überschritten haben. Dessen Präsident Yoweri Museveni passen das mörderische Chaos und die Unfähigkeit der Vereinten Nationen indes gut ins Konzept.

Verfeindete Milizionäre Kisembo und Ngudjoli
Kaum hatte seine Armee das Nachbarland verlassen und das hemmungslose Morden begann, höhnte der Präsident, die Uno-Soldaten im Kongo seien "gefährliche Touristen". Und der Chef des ugandischen Militärgeheimdienstes, Oberst Noble Mayombo, erzählte einem Reporter der kenianischen Tageszeitung "Daily Nation", man erwäge angesichts der Gewalttaten, wieder in den Kongo einzumarschieren, um "unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten".
"Flüchten, Plündern, Töten", nennt Helfer Marcus Sack die schreckliche Dreifaltigkeit des Kongo, und es hat nicht den Anschein, dass sich daran so schnell etwas ändern wird. "Wir haben Informationen, dass sich kongolesische Regierungstruppen von Süden auf Bunia zubewegen", sagt der französische Chef der Blauhelm-Mission, Daniel Vollot, und ihm schwant Böses. Dabei hätten sie doch gerade erst Fortschritte gemacht bei der Annäherung der Kriegsgegner.
Zwei davon stehen gerade neben Vollot unter einem Mangobaum: ein Führer der Hema-Miliz, Floribert Kisembo, und der "Generalstabschef" der Lendu-Krieger, Mathieu Ngudjolo. Treuherzig versichern die beiden Kommandeure der Kindersoldaten, sie wollten nun dem Uno-Vorschlag folgen und gemeinsame Patrouillen durch die gebeutelte Stadt schicken.
Kisembo trägt grüne Gummistiefel, hat als Symbol seiner Macht einen Schuhanzieher mit Löwenkopf als Knauf mitgebracht und guckt ziemlich grimmig. Ngudjolo muss zu seiner Sicherheit im Panzerwagen durch die Straßen chauffiert werden.
Während in Bunia hilflos versucht wird, so etwas wie Ordnung aufrechtzuerhalten, scheint Uno-Generalsekretär Kofi Annan bereits das Vertrauen in seine eigenen bewaffneten Kräfte verloren zu haben. Nach über einer Woche des Mordens kam der Uno-Sicherheitsrat seinem Vorschlag nach, der Entsendung einer internationalen Friedenstruppe zuzustimmen. Und obwohl im Juli Blauhelme aus Bangladesch in dem Kriegsgebiet erwartet werden, ist Annan an die Europäische Union herangetreten mit der Bitte, Soldaten zur Verfügung zu stellen.
Bislang hat sich nur Frankreich bereit erklärt, 1000 Soldaten für eine solche Mission zur Verfügung zu stellen. Dies auch nur unter der Bedingung, dass sowohl Uganda als auch Ruanda dem Einmarsch französischer Soldaten zustimmen. Daran könnte jedoch der Versuch scheitern, den Genozid zu stoppen.
Während des Völkermordes in Ruanda 1994 hatten französische Soldaten eine unrühmliche Rolle gespielt und Hutu-Milizen unterstützt. Nach 100 Tagen des Mordens hatten rund 800 000 Menschen ihr Leben verloren. Schon jetzt kündigte die Regierung in Kigali Widerstand gegen ein französisches Engagement an.
Und so wird sich wohl nicht allzu viel ändern im Kongo, den der Schriftsteller Joseph Conrad schon 1899 als einen "Todeshain" bezeichnet hat. Seinen Protagonisten Kurtz ließ er entsetzt ausrufen: "Das Grauen! Das Grauen!"
DER SPIEGEL – 26.05.2003
Srebrenica schon vergessen ? –

und die UNO schaut wieder tatenlos zu ...
KONGO : "Willkommen im Wahnwitz"
von Thilo Thielke
Ungehemmt geht das Gemetzel im Bezirk Ituri weiter, auch wenn jetzt französische Soldaten eingetroffen sind. Statt die Gewaltorgien zu beenden, fährt die Eingreiftruppe Streife.
Die Vereinten Nationen bieten wieder mal ein Bild des Jammers. Seit Stunden bereits liefern sich durchgeknallte Kindersoldaten mit Kalaschnikows, Mörsern und 82-Millimeter-Kanonen in Bunias Stadtzentrum ein wüstes Gefecht. Und die Uruguayer von der Uno? Sie kriechen blau behelmt und in schusssicheren Westen schildkrötengleich auf dem Fußboden ihres Hauptquartiers herum und beten das Ave-Maria.
Gerade einmal zehn Mann karren sie im Verlauf dieses unheimlichen Vormittags zur Verstärkung heran, obwohl 700 bewaffnete Uno-Soldaten am Flughafen kampieren. Dass der Schießerei schließlich nicht mehr als ein Dutzend Beteiligte zum Opfer fallen, verdankt der von knapp 400 Lendu-Kindern angegriffene Hema-Nachwuchs lediglich seinen besseren Waffen. Die Vertreter der Weltgemeinschaft bleiben praktisch tatenlos.
Oberst Daniel Vollot, französischer Chef der Uno-Mission, doch zu seinem Leidwesen weitgehend ohne Befugnisse, flüchtet sich angesichts der schier unaufhörlichen Gewaltexzesse im Osten des Kongo schon lange nur noch in Zynismus. Wie beim Tennis woge die Schlacht hin und her, erklärt er im Garten des Uno-Hauptquartiers: "Mal von links nach rechts, dann wieder umgekehrt. Wie langweilig!" Und dazu lacht der Fallschirmjäger, während durch die Nachbarstraße Salven von Schnellfeuergewehren peitschen.
Er genieße nun die Sonne, sagt Vollot; das Krachen der einschlagenden Granaten, das Rattern der MG sei für ihn wie Musik. Ändern könne man ohnehin nicht viel: "Wer Krieg will, der bekommt ihn auch." Ungläubig starrt einer vom "Uru-Batt", dem Uno-Bataillon aus Südamerika, herüber, der sich hinter einem Mäuerchen verschanzt hat.
Auch Johannes Wedenig vom Kinderhilfswerk Unicef kann die Ungeheuerlichkeiten des Kriegsalltags nur noch schwer ertragen. "Willkommen im Wahnwitz", stöhnt er. Wedenig hat sich Jugendarbeit zum Ziel gesetzt, aber der Mann kann froh sein, dass ihn noch keines der kongolesischen Kinder ermordet hat, die von afrikanischen Kriegsherren gewissenlos instrumentalisiert werden. Denn das Gemetzel geht unvermindert weiter - allen gut gemeinten Resolutionen und allen zusätzlichen europäischen Soldaten zum Trotz, die unter französischem Kommando jetzt in Bunia einrücken.

Ihre Mission ist zwar nach der griechischen Jagdgöttin Artemis benannt, und die vermag der Mythologie zufolge außer Pest und Tod auch Eintracht und ein langes Leben zu bringen. Doch das EU-Mandat ist an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Den Flugplatz und die Stadt, einschließlich ihrer zwei Flüchtlingslager, sollen die Franzosen sichern. Mehr nicht. Dabei ist Bunia längst unter der Kontrolle der Hema, nur wenige Lendu halten sich noch im Ort auf. Unvorstellbare Gräuel ereignen sich unterdessen in den Bergen Ituris - außerhalb des kleinen Radius der Friedenstruppen.
So sind Zehntausende längst nach Süden geflüchtet: 150 Kilometer zu Fuß durch den Urwald bis in die Stadt Beni, die von regierungstreuen Soldaten kontrolliert wird. Sie sind dem Horror ihrer Heimat Ituri entronnen und könnten doch bald wieder in der Falle sitzen. Denn von Süden rücken ruandische Soldaten vor und attackieren Beni. Sie sind Verbündete der Hema-Milizen und beuten für ihre Regierung in Kigali die Bodenschätze des Kongo nach Kräften aus.
"Wenn in den riesigen Flüchtlingslagern die Cholera ausbricht, könnten wir schnell eine Katastrophe erleben", befürchtet Pascal Vignier von Ärzte ohne Grenzen: "Es sind zu viele Menschen auf zu engem Raum, und wir haben zu wenig Wasser." Die Seuchengefahr steige mit jedem Ankömmling. Die ersten sechs Cholera-Verdachtsfälle sind bereits gemeldet worden.
In einem Zelt am Rande des Lagers dokumentieren Vignier und seine Kollegen, was die aus Ituri Vertriebenen berichten. Es sind Protokolle, die an den Genozid in Ruanda 1994 erinnern. Von "systematischem Morden" erzählen die Menschen, von ganzen Familien, die mit Buschmessern ("Pangas" ) zerstückelt wurden, von ritualisiertem Kannibalismus und abgeschnittenen Genitalien. "Sie essen die Herzen ihrer Feinde, um sich deren Kraft anzueignen", sagt der Franzose. Er hat erkennbar Mühe, Worte für diesen Irrsinn zu finden.
Im Lager von Eringeti sind bis Ende vergangener Woche 55 275 Flüchtlinge registriert worden. Michelle Brown von der Hilfsorganisation Merlin schätzt die Gesamtzahl in der Region auf 130 000. Der Helfer Eugène Kasongo von World Vision, seit Jahren in der Gegend aktiv, glaubt: "Die Menschen sind nur vorübergehend in Sicherheit. Das hier ist erst der Anfang."
Der Familienvater Jean-Pierre Lubondo zum Beispiel ist zweimal auf der Flucht von Hema-Milizen überfallen worden. In einem Dorf, 15 Kilometer von Bunia entfernt, hat er ein Massaker überlebt. Er sah die zerstückelten Leichen seiner Nachbarn. Jetzt versucht er, sich und seine Familie im Lager zu ernähren und nebenbei noch zwei Kinder, die ihre Eltern verloren haben und im Wald herumirrten. "Die Hema haben gesagt, dass sie uns alle töten wollen. Niemand geht so schnell zurück."
Doch schon bald könnte Lubondo in den mörderischen Strudel zurückgeworfen werden. Schon werden aus Butembo Kämpfe gemeldet. Das ist nur 40 Kilometer entfernt. Sollten die ruandischen Soldaten und ihre kongolesischen Verbündeten Beni einnehmen, dann würden die Flüchtlingsmassen wieder nach Norden getrieben, direkt vor die Kalaschnikows der Killer von Ituri.
Derartige Sorgen scheinen den Sonderbeauftragten der Europäischen Union für das Gebiet der zentralafrikanischen Großen Seen, den Italiener Aldo Ajello, noch nicht umzutreiben. Er landet zur Stippvisite auf dem Flughafen von Bunia, lässt sich von den Kanonen des 3. französischen Marineinfanterie-Regiments beschützen und droht den kongolesischen Milizionären mit einem internationalen Kriegsverbrechertribunal.
Wie die demnächst 1400 Mann starke EU-Friedenstruppe das Morden beenden kann, wenn sie nur die Straßen und den Flughafen Bunias sichert, will er nicht verraten.
Lieber erzählt Ajello, wie stolz er darauf sei, dass "dieser Einsatz unter der Flagge der Europäischen Union" zu Stande gekommen ist. Europa unterstütze mit dem ersten militärischen Auftritt auf einem anderen Kontinent jetzt einen Friedensprozess, an dem sich auch die Nachbarländer und Kriegstreiber Uganda und Ruanda beteiligen wollten.
Viel mehr ist auch dem einsilbigen Kommandeur der internationalen Eingreiftruppe, General Jean-Paul Thonier, nicht zu entlocken. Sicher sei lediglich, dass man Bunia nicht verlassen werde und nicht daran denke, die Milizen zu entwaffnen. Außerdem sei die Truppe erst in einigen Wochen vollzählig, und in drei Monaten laufe das Mandat schon wieder aus. Blauhelme aus Bangladesch, so ist es geplant, sollen dann die kongolesischen Bürgerkriegsregionen befrieden.
Trübe Aussichten sind das trotz des martialischen Auftriebs auf dem Flughafen von Bunia, über den ostentativ "Mirage"-Kampfflieger donnern. "Die Hema sind dabei, die Lendu auszulöschen, und nichts wird dagegen unternommen", sagt Rüdiger Sterz von der Deutschen Welthungerhilfe. Sollten die Lendu nämlich erneut Versuche unternehmen, die Stadt wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen, würden die Franzosen wohl im Zweifelsfall die Hema-Milizen des Führers Thomas Lubanga unterstützen müssen und so einen schrecklichen Status quo aufrechterhalten.
80 Zivilisten sollen an diesem Tag massakriert worden sein in einem Dorf nur 20 Kilometer von Bunia entfernt. Zur gleichen Zeit haben die Franzosen ihre Unterkünfte errichtet und sind in der Stadt Streife gefahren. Einen Auftrag, gegen das Morden einzuschreiten, hatten sie nicht.
DER SPIEGEL –17.06.2003

Die Killer aus der Okapi-Bar
Von Alwin Schröder
Mit der Operation "Artemis" sollen EU-Soldaten den Völkermord im Kongo stoppen. Doch noch müssen Flüchtlingshelfer dem Grauen in der Stadt Bunia tatenlos zusehen. 200 Kilometer südlich bahnt sich indes schon das nächste Drama an.
Bunia - Bier und Beef werden in der Okapi-Bar überwiegend nur noch für die neue Kundschaft serviert. Denn die Milizen der UPC (Union kongolesischer Patrioten) haben sich auch des einzigen Restaurants bemächtigt, das es in Bunia noch gibt. "Sie trinken sich dort stark und schwingen große Reden", berichtet Rüdiger Sterz, der seit einem Jahr als Projektleiter für die Deutsche Welthungerhilfe (DWHH) in der umkämpften Stadt im Nordosten des Kongo arbeitet.
Die UPC-Milizen haben die Macht in Bunia übernommen. Von den einst 130.000 Einwohnern sind viele in Flüchtlingscamps in den Bergen der Provinz Ituri geflüchtet - aus Angst vor den grauenvollen Kämpfen zwischen den verfeindeten Stämmen der Hema, die von den Killern der UPC unterstützt werden, und der Lendu. Vielleicht kommen die Einwohner von Bunia zurück, wenn jetzt europäische Soldaten in der Stadt präsent sind. Aber Sterz mag noch nicht daran glauben: "Viele bleiben noch in den Camps, weil die Männer Angst um ihre Familie haben. Sie haben Angst davor, dass ihre Töchter vergewaltigt werden."
Grauenhaftes hat Sterz erlebt. "Man sieht viel Elend in den Krankenhäusern", berichtet er gegenüber SPIEGEL ONLINE. "Männer, denen mit der Machete das Gesicht zerfetzt wurde, Kinder mit abgehackten Armen." Die Brutalität der verfeindeten Stämme sei unvorstellbar: "Der eine will dem anderen nicht mehr vergeben. Als einzige Lösung bleibt in ihren Augen nur das Ausradieren des Gegners."
Mindestens 50.000 Tote hat der Konflikt zwischen Hema und Lendu in der jüngeren Vergangenheit gefordert, ohne dass die überforderten Blauhelm-Soldaten aus Uruguay und Uno-Mitarbeiter eingreifen konnten. Im Gegenteil: Sie waren selbst Opfer von Übergriffen. Beobachter der Vereinten Nationen gerieten kürzlich in die Hände von Milizen, die sie folterten, kastrierten und schließlich zerstückelten. Eine Uno-Mitarbeiterin bezeichnete die verfeindeten Stämme als "außer Kontrolle geratene Irre".
Franzosen sind erst in 50 Tagen einsatzfähig
130.000 Menschen sind in der Region auf der Flucht. Eskaliert war die Situation Anfang Mai, nachdem Uganda seine 6000 Soldaten aus der Ituri-Provinz abgezogen hatte. In Bunia waren bislang 625 Uno-Soldaten stationiert, ihnen stehen schätzungsweise 25.000 bis 28.000 Kämpfer der Lendu und der Hema gegenüber.
Alle Hoffnung der internationalen Helfer in Bunia ruht nun auf die Operation "Artemis" der EU, auf 1400 überwiegend französischen Soldaten, die nach und nach in dem Krisengebiet eintreffen. Der Auftakt verlief jedoch alles andere als viel versprechend für Sterz und seine Kollegen. "Der französische General hat uns berichtet, dass seine Soldaten erst in 50 Tagen voll einsatzfähig sein werden. Das hat uns ziemlich schockiert." Denn erst wenn die EU-Soldaten die Kontrolle in der Stadt übernehmen, könnten die Helfer in Viertel gelangen, zu denen sie jetzt noch keinen Zutritt haben.
Die EU-Eingreiftruppe wird es mit Thomas Lubanga zu tun bekommen, dem selbst ernannten Chef der UPC-Milizen in Bunia. "Er möchte die Stadt zusammen mit den Franzosen kontrollieren, aber das ist ja wohl indiskutabel", meint Sterz. "Eine Entwaffnung dürfte wohl schwierig werden", glaubt er. Denn Lubanga hat schon klargestellt, dass seine Soldaten auf keinen Fall ihre Kalaschnikows abgeben werden. Sonst gebe es Ärger.
"Wir sind nicht das Afrikakorps"
Seinen in den letzten Wochen rücksichtslos mordenden Kindersoldaten hat Lubanga inzwischen offenbar etwas Zurückhaltung befohlen. "Sie fahren zwar nicht mehr in den Pick-ups durch die Stadt, sind aber immer noch präsent", berichtet Sterz. Eine Kontaktaufnahme mit den oft mit Drogen voll gepumpten Acht- oder Neunjährigen zwar möglich, aber nur sehr vorsichtig anzugehen: "Sie kommen sich natürlich sehr stark vor mit ihren Waffen. Es sind halt Kinder."
Doch während in Bunia durch die Ankunft der europäischen Eingreiftruppe Hoffnung aufkommt, wird 200 Kilometer südlich schon das nächste Kapitel des blutigen Stammeskonflikts eröffnet: In Butembo mit seinen 500.000 Einwohnern kommt es bereits zu schweren Kämpfen zwischen Truppen, die von der Zentralregierung in Kinshasa unterstützt werden, und Einheiten der mit der UPC verbündeten RCD, die von Ruanda unterstützt wird und den ganzen Osten vom Rest der Republik abspalten will. Rund 150.000 Flüchtlinge sind dort zwischen den Fronten eingekesselt. "Uns fehlen die Nahrungsmittel, um diesen Menschen zu helfen", berichtet Kai Grulich, der dortige Projektleiter der Deutschen Welthungerhilfe. "Die Lage ist ziemlich prekär." Der politische Druck auf die in den Konflikt verwickelten Länder wie Uganda und Ruanda müsse verstärkt werden.

Denn Hema und Lendu führen auch einen Stellvertreter-Krieg in Ituri. Es geht Uganda und Ruanda um die Bodenschätze, um Gold, Diamanten - und um Coltan, ein seltenes Mineral, das von Handy-Herstellern aus Europa, Asien und den USA benötigt wird.
Alle Helfer sind sich deshalb einig, dass 1400 EU-Soldaten nicht ausreichen, um für Frieden in der Krisenregion zu sorgen. Mindestens 2000 bis 3000 Mann seien notwendig, um die Milizen zu entwaffnen, sagt Marcus Sack, ebenfalls DWHH-Projektleiter im Kongo. Doch davon will EU-Chefdiplomat Javier Solana nichts wissen. Der Einsatz bleibe streng auf Bunia begrenzt: "Wir sind nicht das Afrikakorps."
DER SPIEGEL 13.06.2003
Im Vorhof der Hölle
von Thilo Thielke
Kindersoldaten und marodierende Milizionäre haben in der Region Ituri Tausende Zivilisten massakriert. Hunderttausende sind auf der Flucht. Ein neuer Völkermord droht unter den Augen der Welt - aber die Uno-Blauhelme sehen nahezu tatenlos zu.

Dem Missionar Jan Mol droht langsam der Glaube abhanden zu kommen. Wenn der Geistliche über Schlaglöcher hinweg zu seinem Gemeindehaus in Bunias zerschossenem Zentrum stolpert, muss er einen entwürdigenden Spießrutenlauf über sich ergehen lassen. Schon mittags stöckeln betrunkene Siebenjährige auf hohen Damenabsätzen um den 67-Jährigen herum, schwenken Kalaschnikows, blasen ihm respektlos Zigarettenrauch ins Gesicht und fuchteln vor dem "Mzungu" aus Holland drohend mit Brotmessern und Handgranaten herum.
Diese Minderjährigen sind die neuen Herren der Straße. Sie "morden und plündern und folgen nicht dem Gesetz des Herrn, sondern nur noch dem der Gewalt", hat Mol erkannt und wähnt sich schon im Vorhof der Hölle. "Wenn hier nicht bald Soldaten der Vereinten Nationen dazwischengehen, dann erleben wir eine wahre Katastrophe", sagt der Priester und verfolgt fassungslos, wie sich auf dem Boulevard de la Libération ein Blauhelm aus Uruguay von einem schwer bewaffneten Knirps mit Zöpfchenperücke auf dem Kopf, Bierflasche im Hosenbund und Brotbeutel um den Hals schikanieren lässt. Der Holländer ist überzeugt: "Wir erleben einen Genozid, und die Uno steht tatenlos daneben."
Vor gut zwei Wochen haben Kindermilizen der Union der kongolesischen Patrioten, die dem Stamm der Hema angehören, die Kontrolle in der 300 000-Einwohner-Stadt Bunia übernommen und ihre Widersacher vom Stamm der Lendu vertrieben, mit Macheten erschlagen oder erschossen. Zerhackte Leichen faulten tagelang auf den Straßen von Bunia vor sich hin. Mol, der seit 1971 dort lebt, sieht ein "Desaster wie in Bosnien oder Ruanda" heraufziehen, wo unter den Augen der Welt Hunderttausende erschlagen, erschossen und verscharrt wurden: "Es ist das nackte Grauen."
Als das Schlachten in der Hauptstadt der kongolesischen Region Ituri begann, hatte der Gottesmann immer wieder versucht, die Kommandeure der 625 Blauhelme aus Uruguay, die dort stationiert sind, zum Eingreifen zu bewegen. Doch als sich endlich ein paar bis an die Zähne bewaffnete Uno-Männer auf den Weg machten, lagen Mols Kollegen Aimé Ndjabu und François Mateso bereits in ihrem eigenen Blut. Der eine mit durchgeschnittener Kehle, der andere durchsiebt von Garben aus Schnellfeuergewehren.
Um die Leichen der Geistlichen und zwölf weiterer Opfer tobten feixend ihre jugendlichen Mörder. Sie riefen Mol zu: "Wir werden unsere Feinde alle töten." Die Blauhelme zogen wieder ab, um das Verbrechen lediglich zu notieren. Sie ließen sich zu Zaungästen des Massenmordes machen wie einst im bosnischen Srebrenica, wo Serben-Milizen 1995 mehr als 7500 Muslime abschlachteten.

Nach ein paar Tagen zählen die Uno-Soldaten allein im Zentrum von Bunia bereits rund 300 Leichen. Wie viele es insgesamt sind, weiß niemand, denn die internationalen Friedenssoldaten wagen sich nicht einmal im Panzer aus der Stadt heraus. "In der Provinz Ituri leben 2,4 Millionen Menschen", sagt Marcus Sack von der Deutschen Welthungerhilfe, "eine Million ist auf der Flucht: Was sich in den Bergen abspielt, ist der reinste Horror."
Erst vergangene Woche wurden die Leichen zweier Uno-Beobachter 70 Kilometer von Bunia entfernt gefunden. Sie waren mit Buschmessern in Stücke gehackt worden.
Im Krankenhaus der Stadt hat Sack die Überlebenden des "Infernos" ("The Economist" ) gesehen: Frauen und Kinder mit abgetrennten Gliedmaßen und Opfer mit Schusswunden, um die sich jetzt Mediziner der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" kümmern.
"Wir haben außerdem diverse glaubwürdige Hinweise auf Kannibalismus", räumt Uno-Mann Amos Namanga Ngongi ein und spricht von "einer unglaublichen Barbarei: Im Kongo rennen Menschen mit Amuletten aus menschlichen Knochen herum". Der Kameruner ist der Sonderbeauftragte des Uno-Generalsekretärs für die Demokratische Republik Kongo und nur auf Kurzbesuch in Bunia.
Die skandalöse Untätigkeit seiner Soldaten erklärt er damit, dass man nicht vorbereitet gewesen sei auf "derartige kriegerische Handlungen". Dabei sieht das Mandat der Blauhelme ausdrücklich den Schutz der Zivilbevölkerung vor. Dennoch ist Ngongi guten Mutes: "Killer können zu Nichtkillern werden", gibt er seinen Leuten noch mit auf den Weg. Dann muss er sich sputen, das Flugzeug wartet.
Mit seinem Optimismus steht Ngongi ziemlich allein da. Seit Ausbruch der Kämpfe vor fünf Jahren sind im Kongo nach Schätzungen der Organisation International Rescue Committee zwischen 3 und 4,7 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Niemals seit Ende des Zweiten Weltkriegs war die Sterblichkeitsrate in einem Konflikt derart hoch.
60 000 Tote, schätzt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, sollen allein die Stammeskämpfe zwischen den Vieh züchtenden Hema und den Ackerbau treibenden Lendu im Nordosten des riesigen Landes gefordert haben. Und ein Ende der "Blutorgien" ("Neue Zürcher Zeitung" ) ist in Ituri nicht in Sicht.
Ganz im Gegenteil: Gerade einmal vier Kilometer vor der von Hema-Milizen kontrollierten Stadt überwachen verwegen kostümierte Lendu-Kämpfer die wichtigen Ausfallstraßen und sinnen auf Rache. Nicht nur Entwicklungshelfer Sack ist sich sicher, "dass sie auf Waffen aus dem Ausland warten und dann möglichst bald zurückschlagen".
Maßgeblichen Anteil an den 1999 ausgebrochenen ethnischen Kämpfen haben Kongos Nachbarländer Ruanda und Uganda. Nach einem im April veröffentlichten Amnesty-Bericht haben sie "die Region in einem unermesslichen Umfang systematisch ausgeplündert" und dabei "innerethnische Konflikte und Massenmorde gefördert", um die wichtigen Bodenschätze des Kongo auszubeuten: Gold, Holz und das für die Handy-Produktion wichtige Coltan. Die verwahrlosten Kindermilizionäre verrichteten in "der sich immer noch ausweitenden Tragödie" lediglich die schmutzige Arbeit der Profiteure im ugandischen Kampala und ruandischen Kigali.
Während die ruandische Armee in die Provinz Kivu einmarschierte und über die Kongolesische Sammlungsbewegung für Demokratie die Region bis heute kontrolliert, sicherte sich die ugandische Armee die weiter nördlich gelegene Ituri-Provinz, in der große Mengen Gold gewonnen werden.
In den Uferregionen des Albert-Sees werden zudem bedeutende Ölvorkommen vermutet. Die könnten nach Schätzungen der kanadischen Firma Heritage Oil sogar "mehrere Milliarden Barrel" ausmachen.
Anfangs unterstützte die vergleichsweise gut ausgebildete ugandische Armee Milizen der Hema. Diese fühlen sich jedoch den Tutsi aus Ruanda näher und verbündeten sich mit der Regierung in Kigali. Uganda wandte sich daraufhin den Lendu zu und versorgt sie derzeit mit Waffen.
Die Folge der wechselnden Allianzen waren ständige Front- und Machtverschiebungen und unvorstellbare Grausamkeiten, die beide Bevölkerungsgruppen einander zufügten. Das Geschehen lässt selbst die Uno-Chefanklägerin für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien, Carla Del Ponte, mittlerweile von einem "drohenden Genozid" sprechen.
Denn in Ituri wird immer hemmungsloser gemordet. Seit die ugandische Armee gemäß eines Abkommens mit der Regierung in Kinshasa am 7. Mai ihre letzten Truppen aus Ituri abzog, herrscht ein Zustand der Rechtlosigkeit. Ihre Waffen übergaben die Ugander in Bunia den Lendu-Kämpfern, die reichlich davon Gebrauch machten. Sie nutzten die Abwesenheit der Ordnungsmacht dazu, massenweise Hema abzuschlachten.
Wenige Tage später übten dann die von Ruanda ausgerüsteten Hema grausige Rache und nahmen die Stadt ein. Seitdem sind die Lendu von Bunia entweder tot oder geflüchtet: Mindestens 50 000 sollen die Grenzen nach Uganda überschritten haben. Dessen Präsident Yoweri Museveni passen das mörderische Chaos und die Unfähigkeit der Vereinten Nationen indes gut ins Konzept.

Verfeindete Milizionäre Kisembo und Ngudjoli
Kaum hatte seine Armee das Nachbarland verlassen und das hemmungslose Morden begann, höhnte der Präsident, die Uno-Soldaten im Kongo seien "gefährliche Touristen". Und der Chef des ugandischen Militärgeheimdienstes, Oberst Noble Mayombo, erzählte einem Reporter der kenianischen Tageszeitung "Daily Nation", man erwäge angesichts der Gewalttaten, wieder in den Kongo einzumarschieren, um "unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten".
"Flüchten, Plündern, Töten", nennt Helfer Marcus Sack die schreckliche Dreifaltigkeit des Kongo, und es hat nicht den Anschein, dass sich daran so schnell etwas ändern wird. "Wir haben Informationen, dass sich kongolesische Regierungstruppen von Süden auf Bunia zubewegen", sagt der französische Chef der Blauhelm-Mission, Daniel Vollot, und ihm schwant Böses. Dabei hätten sie doch gerade erst Fortschritte gemacht bei der Annäherung der Kriegsgegner.
Zwei davon stehen gerade neben Vollot unter einem Mangobaum: ein Führer der Hema-Miliz, Floribert Kisembo, und der "Generalstabschef" der Lendu-Krieger, Mathieu Ngudjolo. Treuherzig versichern die beiden Kommandeure der Kindersoldaten, sie wollten nun dem Uno-Vorschlag folgen und gemeinsame Patrouillen durch die gebeutelte Stadt schicken.
Kisembo trägt grüne Gummistiefel, hat als Symbol seiner Macht einen Schuhanzieher mit Löwenkopf als Knauf mitgebracht und guckt ziemlich grimmig. Ngudjolo muss zu seiner Sicherheit im Panzerwagen durch die Straßen chauffiert werden.
Während in Bunia hilflos versucht wird, so etwas wie Ordnung aufrechtzuerhalten, scheint Uno-Generalsekretär Kofi Annan bereits das Vertrauen in seine eigenen bewaffneten Kräfte verloren zu haben. Nach über einer Woche des Mordens kam der Uno-Sicherheitsrat seinem Vorschlag nach, der Entsendung einer internationalen Friedenstruppe zuzustimmen. Und obwohl im Juli Blauhelme aus Bangladesch in dem Kriegsgebiet erwartet werden, ist Annan an die Europäische Union herangetreten mit der Bitte, Soldaten zur Verfügung zu stellen.
Bislang hat sich nur Frankreich bereit erklärt, 1000 Soldaten für eine solche Mission zur Verfügung zu stellen. Dies auch nur unter der Bedingung, dass sowohl Uganda als auch Ruanda dem Einmarsch französischer Soldaten zustimmen. Daran könnte jedoch der Versuch scheitern, den Genozid zu stoppen.
Während des Völkermordes in Ruanda 1994 hatten französische Soldaten eine unrühmliche Rolle gespielt und Hutu-Milizen unterstützt. Nach 100 Tagen des Mordens hatten rund 800 000 Menschen ihr Leben verloren. Schon jetzt kündigte die Regierung in Kigali Widerstand gegen ein französisches Engagement an.
Und so wird sich wohl nicht allzu viel ändern im Kongo, den der Schriftsteller Joseph Conrad schon 1899 als einen "Todeshain" bezeichnet hat. Seinen Protagonisten Kurtz ließ er entsetzt ausrufen: "Das Grauen! Das Grauen!"
DER SPIEGEL – 26.05.2003
@konradi - 450
Wirklich schade um das viele schöne Gold, das da im Boden liegt und nur darauf wartet gefördert zu werden...
Können die sich nicht irgendwo bekriegen, wo es keine Bodenschätze zu holen gibt? So eine Faktorverschwendung...
Wenn im Kongo Frieden herrschen würde, dann wäre die Kilo-Moto-Lizenz von Ashanti sehr werthaltig und für einen möglichen Übernahmepreis durch AngloGold würde das glatt 2 $ die Aktie mehr bedeuten....ein Jammer sowas! Oder wie Deine "Spiegelquelle" richtig aus Conrads "Heart of Darkness" zitiert: "Das Grauen! Das Grauen!"
Gruß
Sovereign
Mongbwalu ist dabei nur der klägliche, 2.200 Quadratkilometer große Rest eines Goldreiches aus der belgischen Kolonialzeit. Kilo-Moto, so heißt das Areal insgesamt, erstreckt sich eigentlich über 86.000 Quadratkilometer bis an die Grenzen von Uganda und Sudan und ist gut für 90 Prozent der kongolesischen Goldproduktion. Während der Mobutu-Diktatur 1965-97, als der Kongo noch Zaire hieß, wurde Kilo-Moto verstaatlicht und wie alle Bergbaubetriebe des Landes ruiniert; dennoch hielt das Gold von Kilo-Moto den informellen Handel der Region am Leben. Über 350 Tonnen Gold sind aus Kilo-Moto gefördert worden. Theoretisch, so der belgische Geologe Luc Rombouts, könnte industrieller Bergbau jährlich Gold im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar aus der Konzession holen.
Das Schicksal von Mongbwalu ist typisch für den Niedergang des kongolesischen Bergbaus. Der industrielle Goldbergbau ist eingestellt, und nur noch Schürfer graben in den Ruinen ehemaliger Tagebauminen. Die von Belgien gebauten Verwaltungsgebäude der Betreibergesellschaft Kimin sind verwaist, die noch 1.900 Angestellten des Betriebs sind zu rechtlosen Schürfern geworden und leben im Elend. Sie haben kaum alle drei Tage etwas zu essen, und wenn einer stirbt, bleibt die Familie völlig mittellos zurück. Bauern der Umgebung ziehen auf der Suche nach Einkommen in die Minen. Weil es keinerlei Gesundheitsversorung gibt, können Tropenseuchen wie Ebola ungehindert wüten.
Aber die Kimin-Angestellten nehmen ihr Schicksal nicht einfach hin. Sie haben sich in einem "Arbeiterkomitee" organisiert und ziehen mit Hilfe eines belgischen Anwalts weltweit vor Gericht. Noch nie haben sich Bevölkerungen der Bergbauregionen auf diese Weise per Selbstorganisation Gehör verschafft. Wenn das Erfolg hat, könnte es die Situation der Menschen im Ostkongo mehr ändern als sämtliche Friedensabkommen zusammen genommen.
Um das zu verstehen, muss man die Geschichte Mongbwalus während des Kongokrieges kennen. Bis zum 2. Januar 1997, als die Kabila-Rebellen während ihres Krieges gegen Mobutu Mongbwalu mit Hilfe ugandischer Truppen einnahmen, war alles noch relativ klar. Die Kimin war ein Joint Venture der Staatsfirma Okimo, Erbin des belgischen Kolonialbetreibers, und der belgisch-kanadischen Bergbaugesellschaft Mindev. Weil Mobutus Soldateska die Minen mehrfach geplündert hatte, wurden Kabilas Truppen als Befreier begrüßt. Und Kabila weckte Hoffnungen auf einen Aufschwung, indem er Investoren warb.
Den größten, aber auch unproduktivsten Teil der Kilo-Moto-Konzession bekam die kanadische Firma Barrick Gold, zweitgrößte Goldfirma der Welt, in deren Vorstand unter anderem Ex-US-Präsident George Bush sitzt. 300 Millionen Dollar wollte Barrick Gold auf seinen 82.000 Quadratkilometern investieren - aber die reale Förderung von Kilo-Moto findet außerhalb dieses Bereiches statt: auf den 2.200 Quadratkilometern der Kimin. Dies versprach Kabila der "Ashanti Goldfields", einem der führenden Bergbauunternehmen Afrikas.

Wirklich schade um das viele schöne Gold, das da im Boden liegt und nur darauf wartet gefördert zu werden...

Können die sich nicht irgendwo bekriegen, wo es keine Bodenschätze zu holen gibt? So eine Faktorverschwendung...
Wenn im Kongo Frieden herrschen würde, dann wäre die Kilo-Moto-Lizenz von Ashanti sehr werthaltig und für einen möglichen Übernahmepreis durch AngloGold würde das glatt 2 $ die Aktie mehr bedeuten....ein Jammer sowas! Oder wie Deine "Spiegelquelle" richtig aus Conrads "Heart of Darkness" zitiert: "Das Grauen! Das Grauen!"
Gruß
Sovereign
Mongbwalu ist dabei nur der klägliche, 2.200 Quadratkilometer große Rest eines Goldreiches aus der belgischen Kolonialzeit. Kilo-Moto, so heißt das Areal insgesamt, erstreckt sich eigentlich über 86.000 Quadratkilometer bis an die Grenzen von Uganda und Sudan und ist gut für 90 Prozent der kongolesischen Goldproduktion. Während der Mobutu-Diktatur 1965-97, als der Kongo noch Zaire hieß, wurde Kilo-Moto verstaatlicht und wie alle Bergbaubetriebe des Landes ruiniert; dennoch hielt das Gold von Kilo-Moto den informellen Handel der Region am Leben. Über 350 Tonnen Gold sind aus Kilo-Moto gefördert worden. Theoretisch, so der belgische Geologe Luc Rombouts, könnte industrieller Bergbau jährlich Gold im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar aus der Konzession holen.
Das Schicksal von Mongbwalu ist typisch für den Niedergang des kongolesischen Bergbaus. Der industrielle Goldbergbau ist eingestellt, und nur noch Schürfer graben in den Ruinen ehemaliger Tagebauminen. Die von Belgien gebauten Verwaltungsgebäude der Betreibergesellschaft Kimin sind verwaist, die noch 1.900 Angestellten des Betriebs sind zu rechtlosen Schürfern geworden und leben im Elend. Sie haben kaum alle drei Tage etwas zu essen, und wenn einer stirbt, bleibt die Familie völlig mittellos zurück. Bauern der Umgebung ziehen auf der Suche nach Einkommen in die Minen. Weil es keinerlei Gesundheitsversorung gibt, können Tropenseuchen wie Ebola ungehindert wüten.
Aber die Kimin-Angestellten nehmen ihr Schicksal nicht einfach hin. Sie haben sich in einem "Arbeiterkomitee" organisiert und ziehen mit Hilfe eines belgischen Anwalts weltweit vor Gericht. Noch nie haben sich Bevölkerungen der Bergbauregionen auf diese Weise per Selbstorganisation Gehör verschafft. Wenn das Erfolg hat, könnte es die Situation der Menschen im Ostkongo mehr ändern als sämtliche Friedensabkommen zusammen genommen.
Um das zu verstehen, muss man die Geschichte Mongbwalus während des Kongokrieges kennen. Bis zum 2. Januar 1997, als die Kabila-Rebellen während ihres Krieges gegen Mobutu Mongbwalu mit Hilfe ugandischer Truppen einnahmen, war alles noch relativ klar. Die Kimin war ein Joint Venture der Staatsfirma Okimo, Erbin des belgischen Kolonialbetreibers, und der belgisch-kanadischen Bergbaugesellschaft Mindev. Weil Mobutus Soldateska die Minen mehrfach geplündert hatte, wurden Kabilas Truppen als Befreier begrüßt. Und Kabila weckte Hoffnungen auf einen Aufschwung, indem er Investoren warb.
Den größten, aber auch unproduktivsten Teil der Kilo-Moto-Konzession bekam die kanadische Firma Barrick Gold, zweitgrößte Goldfirma der Welt, in deren Vorstand unter anderem Ex-US-Präsident George Bush sitzt. 300 Millionen Dollar wollte Barrick Gold auf seinen 82.000 Quadratkilometern investieren - aber die reale Förderung von Kilo-Moto findet außerhalb dieses Bereiches statt: auf den 2.200 Quadratkilometern der Kimin. Dies versprach Kabila der "Ashanti Goldfields", einem der führenden Bergbauunternehmen Afrikas.

.
@ Sovereign
man glaubt ja schon in alle Abgründe der menschlichen Existenz geschaut zu haben, aber wenn man liest, daß 20.000 Kinder von ihren eigenen Familien als "verhext" auf die Straßen von Kinshasa geprügelt werden
( Die Hexenkinder von Kinshasa - http://kurier.at/ausland/242346.php)
dann ahnt man, das die "Apocalypse Now" genauso real ist, wie sie Joseph Conrads in seiner Reise zum "Herz der Finsternis" beschrieben hat.
Zu den aktuellen Ereignissen noch ein Kommentar von Peter Scholl-Latour:
Der Kongo-Einsatz gibt keinerlei Anlass, "Heia Safari" zu singen
Auch die Bundeswehr könnte eines Tages auf Kindersoldaten schießen müssen –
von Peter Scholl-Latour
Beim Militäreinsatz der Europäischen Union im Ost-Kongo besteht kein Anlass, "Heia Safari" zu singen. Wer in Amerika von den "Euro-Feiglingen" redet, sollte bedenken, dass die überwiegend französische Truppe des Unternehmens "Artemis" im tückischen Savannen- und Dschungel-Krieg Afrikas ungleich schrecklicheren Gefahren ausgesetzt ist als die US-Marines im Irak, die mit Hilfe hervorragender Technologie die demoralisierten Heerhaufen Saddam Husseins zu Paaren trieben.
Was aber verspricht sich Europa beziehungsweise vor allem Frankreich von diesem Unternehmen im "Herzen der Finsternis"? Was vermögen 1400 europäische Soldaten gegen die Krieger des Hema- oder Lengulengu-Stammes auszurichten, die im Umkreis von Bunia mit modernen Infanteriewaffen ein Gemetzel veranstalten, das nicht zu Unrecht mit dem Genozid von Ruanda verglichen wird?
1994 hatte der Völkermord mit dem Abschlachten einer halben Million Tutsi durch ihre Erbfeinde vom Volk der Hutu begonnen. Seitdem wurden etwa vier Millionen Afrikaner des Kongo-Beckens auf grauenhafte Weise umgebracht. Gerade das schändliche Versagen der viel gepriesenen "Völkergemeinschaft" im Fall Ruanda, die sich immer wieder erweisende Unfähigkeit der UN-Blauhelme, den schrecklichsten Massakern anders als in der Rolle passiver Zuschauer beizuwohnen, hat diesen "robusten" Auftrag an die EU motiviert. Hätte man sich vor zehn Jahren im Weltsicherheitsrat aufraffen können, ein Aufgebot von nur 5000 Elite-Soldaten mit eindeutigem Schießbefehl nach Kigali zu entsenden, wäre zumindest das Ausmaß des Massakers erheblich reduziert worden.
Was ist das für eine "globalisierte" Gesellschaft, in der alle Menschen angeblich gleich sind, wenn der verbrecherische Mord an dreitausend New Yorkern im World Trade Center einen unbegrenzten Antiterror-Feldzug auslöst, das Abschlachten von Millionen Afrikanern hingegen von unseren Medien weitgehend ignoriert wird?
Es wäre illusorisch, sich von der Operation "Artemis" eine dauerhafte Befriedung Zentralafrikas zu versprechen. Es darf auch nicht verschwiegen werden, dass sich im Distrikt Ituri nicht nur die Republiken Uganda und Ruanda einen Stellvertreterkrieg um die Ausbeutung von Gold, Diamanten, Erdöl und vor allem um den Verkauf des unentbehrlichen Minerals Coltan liefern, auf das auch die militärische Elektronik angewiesen ist. Der substanzielle Profit dieser Raubzüge fließt heute wieder jenen internationalen Konzernen zu, die nicht nur belgisch-französische Interessen vertreten, sondern ebenso angelsächsische Ansprüche durchsetzen.
Man erwähne nur die Firmen-Namen Sonex oder Barrick Gold. Man denke auch an die im Juni 2000 erfolgte Weisung der US-Unterstaatssekretärin Susan Rice - nicht zu verwechseln mit Condoleezza -, die die Regierungen von Ruanda und Uganda aufforderte, die Lieferung von Coltan sofort wieder auf den vereinbarten Stand zu bringen, sonst müsse Washington seine Militär- und Wirtschaftshilfe einstellen.
Eine "Mission impossible" im Ost-Kongo? Immerhin ist es einem Bataillon britischer Royal Marines in Sierra Leone unter dem Beifall der einheimischen Bevölkerung gelungen, den schlimmsten Gräueln in dieser westafrikanischen Republik ein Ende zu setzen, nachdem ein Bataillon von Blauhelmen aus Sambia mitsamt seinen Panzerfahrzeugen vor den entfesselten Urwald-Banden kapituliert hatte. Und 3000 französische Paras und Legionäre dämmten an der Elfenbeinküste den gnadenlosen Bürgerkrieg zumindest ein, während gleichzeitig in der Nachbar-Republik Liberia französische Spezial-Kommandos die um ihr Leben fürchtenden Staatsangehörigen aus den USA und Europa per Hubschrauber auf rettende Schiffe evakuierten.
Deutschland wird sich an der europäischen Rettungsaktion von Bunia logistisch beteiligen. Dass deutsche Soldaten nicht im Kampfgebiet selbst eingesetzt werden, ist gut so. Denn Erfahrungen im tückischen Dschungel-Kampf hat die Bundeswehr bisher nicht sammeln können. Aber es sollte sich zumindest ein Trupp Elite-Soldaten des KSK an Ort und Stelle mit solch exotischen Einsätzen vertraut machen, weil in absehbarer Zukunft im südlichen Afrika ähnliche Krisenherde aufflackern und die Intervention deutscher Einheiten erfordern könnten.
Gegen einen Kampfeinsatz der Bundeswehrsoldaten wurde in Berlin auch ins Feld geführt, man könne ihnen nicht zumuten, auf "Kindersoldaten" zu schießen. Als ob die Briten oder Franzosen keine Skrupel empfänden, wenn sie auf diese kleinen, von Drogen aufgeputschten "Killer-Monster" das Feuer eröffnen müssen. Aber was blieb den Royal Marines beim Überfall der "West-Side-Boys", jener Kindersoldaten von Freetown in Sierra Leone, denn anderes übrig als zu schießen? Auch Deutschland muss zur Kenntnis nehmen, dass wir in einem zunehmend unerbittlichen Zeitalter leben.
Welt am Sonntag - 15.06.2003
@ Sovereign
man glaubt ja schon in alle Abgründe der menschlichen Existenz geschaut zu haben, aber wenn man liest, daß 20.000 Kinder von ihren eigenen Familien als "verhext" auf die Straßen von Kinshasa geprügelt werden
( Die Hexenkinder von Kinshasa - http://kurier.at/ausland/242346.php)
dann ahnt man, das die "Apocalypse Now" genauso real ist, wie sie Joseph Conrads in seiner Reise zum "Herz der Finsternis" beschrieben hat.
Zu den aktuellen Ereignissen noch ein Kommentar von Peter Scholl-Latour:
Der Kongo-Einsatz gibt keinerlei Anlass, "Heia Safari" zu singen
Auch die Bundeswehr könnte eines Tages auf Kindersoldaten schießen müssen –
von Peter Scholl-Latour
Beim Militäreinsatz der Europäischen Union im Ost-Kongo besteht kein Anlass, "Heia Safari" zu singen. Wer in Amerika von den "Euro-Feiglingen" redet, sollte bedenken, dass die überwiegend französische Truppe des Unternehmens "Artemis" im tückischen Savannen- und Dschungel-Krieg Afrikas ungleich schrecklicheren Gefahren ausgesetzt ist als die US-Marines im Irak, die mit Hilfe hervorragender Technologie die demoralisierten Heerhaufen Saddam Husseins zu Paaren trieben.
Was aber verspricht sich Europa beziehungsweise vor allem Frankreich von diesem Unternehmen im "Herzen der Finsternis"? Was vermögen 1400 europäische Soldaten gegen die Krieger des Hema- oder Lengulengu-Stammes auszurichten, die im Umkreis von Bunia mit modernen Infanteriewaffen ein Gemetzel veranstalten, das nicht zu Unrecht mit dem Genozid von Ruanda verglichen wird?
1994 hatte der Völkermord mit dem Abschlachten einer halben Million Tutsi durch ihre Erbfeinde vom Volk der Hutu begonnen. Seitdem wurden etwa vier Millionen Afrikaner des Kongo-Beckens auf grauenhafte Weise umgebracht. Gerade das schändliche Versagen der viel gepriesenen "Völkergemeinschaft" im Fall Ruanda, die sich immer wieder erweisende Unfähigkeit der UN-Blauhelme, den schrecklichsten Massakern anders als in der Rolle passiver Zuschauer beizuwohnen, hat diesen "robusten" Auftrag an die EU motiviert. Hätte man sich vor zehn Jahren im Weltsicherheitsrat aufraffen können, ein Aufgebot von nur 5000 Elite-Soldaten mit eindeutigem Schießbefehl nach Kigali zu entsenden, wäre zumindest das Ausmaß des Massakers erheblich reduziert worden.
Was ist das für eine "globalisierte" Gesellschaft, in der alle Menschen angeblich gleich sind, wenn der verbrecherische Mord an dreitausend New Yorkern im World Trade Center einen unbegrenzten Antiterror-Feldzug auslöst, das Abschlachten von Millionen Afrikanern hingegen von unseren Medien weitgehend ignoriert wird?
Es wäre illusorisch, sich von der Operation "Artemis" eine dauerhafte Befriedung Zentralafrikas zu versprechen. Es darf auch nicht verschwiegen werden, dass sich im Distrikt Ituri nicht nur die Republiken Uganda und Ruanda einen Stellvertreterkrieg um die Ausbeutung von Gold, Diamanten, Erdöl und vor allem um den Verkauf des unentbehrlichen Minerals Coltan liefern, auf das auch die militärische Elektronik angewiesen ist. Der substanzielle Profit dieser Raubzüge fließt heute wieder jenen internationalen Konzernen zu, die nicht nur belgisch-französische Interessen vertreten, sondern ebenso angelsächsische Ansprüche durchsetzen.
Man erwähne nur die Firmen-Namen Sonex oder Barrick Gold. Man denke auch an die im Juni 2000 erfolgte Weisung der US-Unterstaatssekretärin Susan Rice - nicht zu verwechseln mit Condoleezza -, die die Regierungen von Ruanda und Uganda aufforderte, die Lieferung von Coltan sofort wieder auf den vereinbarten Stand zu bringen, sonst müsse Washington seine Militär- und Wirtschaftshilfe einstellen.
Eine "Mission impossible" im Ost-Kongo? Immerhin ist es einem Bataillon britischer Royal Marines in Sierra Leone unter dem Beifall der einheimischen Bevölkerung gelungen, den schlimmsten Gräueln in dieser westafrikanischen Republik ein Ende zu setzen, nachdem ein Bataillon von Blauhelmen aus Sambia mitsamt seinen Panzerfahrzeugen vor den entfesselten Urwald-Banden kapituliert hatte. Und 3000 französische Paras und Legionäre dämmten an der Elfenbeinküste den gnadenlosen Bürgerkrieg zumindest ein, während gleichzeitig in der Nachbar-Republik Liberia französische Spezial-Kommandos die um ihr Leben fürchtenden Staatsangehörigen aus den USA und Europa per Hubschrauber auf rettende Schiffe evakuierten.
Deutschland wird sich an der europäischen Rettungsaktion von Bunia logistisch beteiligen. Dass deutsche Soldaten nicht im Kampfgebiet selbst eingesetzt werden, ist gut so. Denn Erfahrungen im tückischen Dschungel-Kampf hat die Bundeswehr bisher nicht sammeln können. Aber es sollte sich zumindest ein Trupp Elite-Soldaten des KSK an Ort und Stelle mit solch exotischen Einsätzen vertraut machen, weil in absehbarer Zukunft im südlichen Afrika ähnliche Krisenherde aufflackern und die Intervention deutscher Einheiten erfordern könnten.
Gegen einen Kampfeinsatz der Bundeswehrsoldaten wurde in Berlin auch ins Feld geführt, man könne ihnen nicht zumuten, auf "Kindersoldaten" zu schießen. Als ob die Briten oder Franzosen keine Skrupel empfänden, wenn sie auf diese kleinen, von Drogen aufgeputschten "Killer-Monster" das Feuer eröffnen müssen. Aber was blieb den Royal Marines beim Überfall der "West-Side-Boys", jener Kindersoldaten von Freetown in Sierra Leone, denn anderes übrig als zu schießen? Auch Deutschland muss zur Kenntnis nehmen, dass wir in einem zunehmend unerbittlichen Zeitalter leben.
Welt am Sonntag - 15.06.2003
.
We`re re-infected by the Gold Bug
World calamities once again resurrect bullion believers
Diane Francis
Gold analyst Kamal Naqvi, with Australia`s Macquarie Bank, wryly suggested at a recent European conference that Saddam Hussein`s former Information Minister, Mohammed Saeed al-Sahaf, would do a great job as a gold analyst.
The Financial Times quoted Mr. Naqvi`s explanation for the job suggestion: "He had the right qualities for the job: a willingness to step into the spotlight when most rational people have pulled back; the ability to speak confidently about the past and the future but with only the slightest grasp on the present; and a tendency towards a colourful turn of phrase, regardless of its relevance. The greatest asset is absolute and total commitment to the cause despite all facts to the contrary."
"Gold, after all, has been in a 20-year bear market, since hitting US$850 in January, 1980. Ah, if only al-Sahaf were around to say: `There is no slump in gold prices. Never.` "
Despite such reality, the Gold Bugs are out in full force once more, encouraged by the increase in gold bullion prices and emboldened by the troubles facing markets, economies and currencies.
(Anyone remember the Gold Bug blockbuster The Great Reckoning: Protect yourself in the coming depression by Lord William Rees-Mogg and James Davidson a decade ago that forecast gold at something like US$8,000 an ounce by now?)
Most investors agree the world is having some serious difficulties, but the Gold Bugs love catastrophe. They are poised for the end, snapping up bullion, bullion funds and shares in gold mining outfits in the belief the world`s economy and currencies will collapse.
The well known James Dines newsletter forecasts between US$3,000 and US$5,000 an ounce, saying: "The world, in general, seems to be tiring of paper currencies as saving vehicles, and rightfully so. The world also, seems to be tiring of their various governments, which love to get them into wars, debase currencies, and lie continually to their citizenry. The world also seems to be getting weary of the millions of stock offerings, because of lies, lack of profits, and terrible P/E ratios. What else is there other than gold and silver?"
Still other Gold Bugs like to trot out that old chestnut, the Kondratieff cycle, as immutable "economic" evidence of looming catastrophe and the need to hold gold.
"When the Dow Jones hits 500 it will be a disaster," said Kondratieff maven Ian Gordon, vice-president with Canaccord Capital Corp. in an interview last week.
Nikolai Kondratieff was an economist who worked for communist dictator Joseph Stalin and claimed that capitalism was afflicted with 70-year cycles that begin with a beneficial spring, terrific summer, slowing down of autumn and culminating with a disastrous "winter" meltdown involving hideous deflation, massive unemployment and economic ruination. Mr. Gordon said the last winter ended in 1949 and the current winter began in 2000 and will end in 2016.
"Everything will fall in price except gold, which will hit up to US$2,000 an ounce before winter is over," Mr. Gordon said. "These cycles happen once in a lifetime and we are at the fear and concern stage. We need the fear to turn to panic."
We "need" this like we need SARs, I tell Mr. Gordon, but he doesn`t skip a beat.
The "winter" is needed to cleanse the horrid indebtedness of the world and things aren`t worse already only because Federal Reserve chairman Alan Greenspan is postponing the crisis by flooding the world with money supply.
It won`t work and Mr. Gordon said next year the United States will deflate and panic and gold will soar.
Why gold and gold shares?
"Gold`s the antithesis to paper," he said.
So why didn`t gold soar during the last winter?
"Because gold was fixed by Washington at US$ 20.67 an ounce until 1933 and then it was increased to US$ 35 an ounce," he said.
Fixed prices propped up the U.S. dollar and so did the ban preventing American citizens from buying and selling the stuff. But by 1971, U.S. debts from the Vietnam war forced Washington to remove its gold standard. Then in 1975 Americans were legally allowed to buy and sell gold.
All of which brings me to my final, skeptical point.
If the Gold Bugs are correct, as to the grim consequences that loom for the world`s governments, notably the United States, then how can anyone possibly profit?
If everything implodes, why wouldn`t governments once more step in and remove the benefit of owning bullion or gold stocks to shore up their currencies?
Why wouldn`t they once again make it illegal for individuals to buy, sell and hold gold bullion? And why wouldn`t they shut down stock markets indefinitely, then make buying and selling shares outside markets also illegal?
Just asking.
Financial Post (Canada) – 17.06.2003
---
Auswege aus der finanziellen Apokalypse
boerse.de Interview mit Axel Retz
boerse.de:
Herr Retz, mit „Auswege aus der finanziellen Apokalypse" haben Sie gerade Ihren ersten Sonderreport geschrieben. Und Ihre Prognosen sind alles andere als ermutigend, oder?
Retz:
Das ist richtig.
boerse.de:
Meinen Sie nicht, dass die „finanzielle Apokalypse" mit über drei Jahren Baisse und Kurseinbrüchen von über 70 Prozent im Dax und über 95 Prozent im Nemax 50 bereits hinter uns liegt? Oder anders gefragt: Hätten Sie nicht besser vor drei Jahren gewarnt statt heute?
Retz:
Lesen Sie meine für boerse.de am 08. März 2000 geschriebene „Expertenkolumne" und auch die Folge-Kolumnen Dass meine Warnung vor dem Zusammenbruch des Neuen Marktes so exakt am Top kam, war sicherlich Zufall. Aber abgesehen von den notorischen Schwarzsehern, die eigentlich immer nur von Katastrophen reden, wüsste ich niemanden, der damals deutlicher gewarnt hätte als ich
boerse.de:
Dennoch - können Sie sich nicht vorstellen, dass nun das Schlimmste hinter uns liegt?
Retz:
Uns allen und auch mir würde ich das aufrichtig wünschen! Von einer sich positiver als erwartet entwickelnden Wirklichkeit überrascht zu werden, ist immer eine gute Sache. Und einen neuen Bullenmarkt von Beginn an mitzumachen, ist eine verlockende Geschichte!
boerse.de:
Worauf gründet sich dann Ihr Pessimismus?
Retz:
Ob es wirklich Pessimismus ist, wird die Zukunft zeigen. Pessimist wäre ich, wenn ich befürchten müsste, bei der von mir prognostizierten Kursentwicklung Geld zu verlieren. Tatsächlich zeigt mein Report, wie sich auch an der kommenden Krise kräftig verdienen lässt.
Meine Prognosen gründen sich auf genau die Säulen, die mir auch 1987 und im März 2000 konkrete Alarmsignale gegeben haben: Einen gesunden, bestmöglich gegen die Medien abgeschotteten Menschenverstand, die Einordnung von Einzelfakten in Zusammenhänge, den Abgleich dieser Zusammenhänge mit historischen Mustern und Charts, Charts und noch einmal Charts!
boerse.de:
Sie betonen so sehr die Charts. Halten Sie die Fundamentals für unwesentlich?
Retz:
Keineswegs. Wenn sie den Report lesen, werden Sie feststellen, dass er außerordentlich viele volkswirtschaftliche Aspekte bespricht. Vielleicht in einer Form, die viele so nicht gewohnt sind. Nur: Mit Lehrbuch-Plattitüden allein lässt sich an der Börse kein Geld verdienen. Wichtiger als alle nackten Zahlen ist immer, was die Märkte aus ihnen machen, ganz gleich, ob es irgendwelchen Theorien gerecht wird oder nicht. Das ist Psychologie. Und Charts sind nichts anderes als in Geld und Kurse gegossene Psychologie.
boerse.de:
Unter anderem prognostizieren Sie einen Dow Jones von unter 1.000 Punkten, zumindest aber von 3.500 - 5.000 Punkten. Ist das nicht doch Pessimismus pur - und nicht Realismus?
Retz:
Um 5.000 oder 3.500 Punkte zu erreichen, müsste der Dow nicht einmal aus seinem langfristigen, seit der 30ern des letzten Jahrhunderts bestehenden Aufwärtstrendkanal nach unten durchbrechen, d. h. eine derartige Zielmarke könnte der Index sogar innerhalb eines intakten Aufwärtstrends ansteuern. Und um auf 1.000 Punkte einzubrechen, müsste dieser Index lediglich dem Verlaufsmuster folgen, das in der Vergangenheit der letzten Jahrhunderte alle spekulativen Bubbles beendet hat. Wir reden also hier eher von historischen „Normal"-Entwicklungen, nicht von irgendetwas ganz Neuem.
boerse.de:
Das klingt wenig erfreulich. Rechnen Sie wirklich mit einem derartigen Zusammenbruch? Und würde das nicht eine Weltwirtschaftskrise bedeuten?
Retz:
Zweimal ja.
boerse.de:
Bitte etwas ausführlicher, wenn es geht!
Retz:
Bis vermutlich 2006 sollte die Baisse durch sein. Für viele Blue Chips wird das das Aus bedeuten. Die Sozialsysteme in ihrer heutigen Form wird es dann nicht mehr geben. Die USA werden alles unternehmen, um China als neue Wirtschaftsweltmacht Nummer eins in Schach zu halten. Immobilien werden zum nächsten großen Crashmarkt. Die neue Weltwirtschaftskurse wird alles umkrempeln. „Alte", vermeintlich überlebte Werte werden eine Renaissance erleben, die Gesellschaften werden neue Formen des Zusammenlebens entwickeln müssen. Der größte Risikofaktor liegt im in derartigen Konstellationen stets latent vorhandenen Rechtsruck der Politik, dem Rückzug in Nationalismen, dem Aufbau von Feindbildern und damit letztlich in neuen Kriegen.
boerse.de:
Was ist Ihrer Meinung nach zu tun?
Retz:
Lesen Sie meinen Report! Sie können sich sicher sein, dass ich ihn nicht geschrieben habe, um mich als Prophet des Untergangs lächerlich zu machen. Sondern um auch Ihr Geld zu schützen. Und um es Ihnen zu ermöglichen, in wenigen Jahren zu wirklichen Tiefstpreisen Aktien, Immobilien und anderes mehr kaufen zu können - während um Sie herum das finanzielle Chaos herrscht. Mehr kann ich nicht tun.
boerse.de:
Und wenn es doch nicht so schlimm kommt?
Retz:
Dann sollten wir uns gemeinsam freuen! Offen gestanden, ist es mein zweitgrößter Wunsch, dass meine jetzigen Prognosen anders als ihre beiden großen Vorgänger nicht in Erfüllung gehen.
boerse.de:
Herr Retz, wir danken Ihnen für dieses Interview.
Axel Retz ist leitender Redakteur des Optionsbriefes, dem führenden Börsendienst für die Terminbörse in Deutschland
.
We`re re-infected by the Gold Bug
World calamities once again resurrect bullion believers
Diane Francis
Gold analyst Kamal Naqvi, with Australia`s Macquarie Bank, wryly suggested at a recent European conference that Saddam Hussein`s former Information Minister, Mohammed Saeed al-Sahaf, would do a great job as a gold analyst.
The Financial Times quoted Mr. Naqvi`s explanation for the job suggestion: "He had the right qualities for the job: a willingness to step into the spotlight when most rational people have pulled back; the ability to speak confidently about the past and the future but with only the slightest grasp on the present; and a tendency towards a colourful turn of phrase, regardless of its relevance. The greatest asset is absolute and total commitment to the cause despite all facts to the contrary."
"Gold, after all, has been in a 20-year bear market, since hitting US$850 in January, 1980. Ah, if only al-Sahaf were around to say: `There is no slump in gold prices. Never.` "
Despite such reality, the Gold Bugs are out in full force once more, encouraged by the increase in gold bullion prices and emboldened by the troubles facing markets, economies and currencies.
(Anyone remember the Gold Bug blockbuster The Great Reckoning: Protect yourself in the coming depression by Lord William Rees-Mogg and James Davidson a decade ago that forecast gold at something like US$8,000 an ounce by now?)
Most investors agree the world is having some serious difficulties, but the Gold Bugs love catastrophe. They are poised for the end, snapping up bullion, bullion funds and shares in gold mining outfits in the belief the world`s economy and currencies will collapse.
The well known James Dines newsletter forecasts between US$3,000 and US$5,000 an ounce, saying: "The world, in general, seems to be tiring of paper currencies as saving vehicles, and rightfully so. The world also, seems to be tiring of their various governments, which love to get them into wars, debase currencies, and lie continually to their citizenry. The world also seems to be getting weary of the millions of stock offerings, because of lies, lack of profits, and terrible P/E ratios. What else is there other than gold and silver?"
Still other Gold Bugs like to trot out that old chestnut, the Kondratieff cycle, as immutable "economic" evidence of looming catastrophe and the need to hold gold.
"When the Dow Jones hits 500 it will be a disaster," said Kondratieff maven Ian Gordon, vice-president with Canaccord Capital Corp. in an interview last week.
Nikolai Kondratieff was an economist who worked for communist dictator Joseph Stalin and claimed that capitalism was afflicted with 70-year cycles that begin with a beneficial spring, terrific summer, slowing down of autumn and culminating with a disastrous "winter" meltdown involving hideous deflation, massive unemployment and economic ruination. Mr. Gordon said the last winter ended in 1949 and the current winter began in 2000 and will end in 2016.
"Everything will fall in price except gold, which will hit up to US$2,000 an ounce before winter is over," Mr. Gordon said. "These cycles happen once in a lifetime and we are at the fear and concern stage. We need the fear to turn to panic."
We "need" this like we need SARs, I tell Mr. Gordon, but he doesn`t skip a beat.
The "winter" is needed to cleanse the horrid indebtedness of the world and things aren`t worse already only because Federal Reserve chairman Alan Greenspan is postponing the crisis by flooding the world with money supply.
It won`t work and Mr. Gordon said next year the United States will deflate and panic and gold will soar.
Why gold and gold shares?
"Gold`s the antithesis to paper," he said.
So why didn`t gold soar during the last winter?
"Because gold was fixed by Washington at US$ 20.67 an ounce until 1933 and then it was increased to US$ 35 an ounce," he said.
Fixed prices propped up the U.S. dollar and so did the ban preventing American citizens from buying and selling the stuff. But by 1971, U.S. debts from the Vietnam war forced Washington to remove its gold standard. Then in 1975 Americans were legally allowed to buy and sell gold.
All of which brings me to my final, skeptical point.
If the Gold Bugs are correct, as to the grim consequences that loom for the world`s governments, notably the United States, then how can anyone possibly profit?
If everything implodes, why wouldn`t governments once more step in and remove the benefit of owning bullion or gold stocks to shore up their currencies?
Why wouldn`t they once again make it illegal for individuals to buy, sell and hold gold bullion? And why wouldn`t they shut down stock markets indefinitely, then make buying and selling shares outside markets also illegal?
Just asking.
Financial Post (Canada) – 17.06.2003
---
Auswege aus der finanziellen Apokalypse
boerse.de Interview mit Axel Retz
boerse.de:
Herr Retz, mit „Auswege aus der finanziellen Apokalypse" haben Sie gerade Ihren ersten Sonderreport geschrieben. Und Ihre Prognosen sind alles andere als ermutigend, oder?
Retz:
Das ist richtig.
boerse.de:
Meinen Sie nicht, dass die „finanzielle Apokalypse" mit über drei Jahren Baisse und Kurseinbrüchen von über 70 Prozent im Dax und über 95 Prozent im Nemax 50 bereits hinter uns liegt? Oder anders gefragt: Hätten Sie nicht besser vor drei Jahren gewarnt statt heute?
Retz:
Lesen Sie meine für boerse.de am 08. März 2000 geschriebene „Expertenkolumne" und auch die Folge-Kolumnen Dass meine Warnung vor dem Zusammenbruch des Neuen Marktes so exakt am Top kam, war sicherlich Zufall. Aber abgesehen von den notorischen Schwarzsehern, die eigentlich immer nur von Katastrophen reden, wüsste ich niemanden, der damals deutlicher gewarnt hätte als ich
boerse.de:
Dennoch - können Sie sich nicht vorstellen, dass nun das Schlimmste hinter uns liegt?
Retz:
Uns allen und auch mir würde ich das aufrichtig wünschen! Von einer sich positiver als erwartet entwickelnden Wirklichkeit überrascht zu werden, ist immer eine gute Sache. Und einen neuen Bullenmarkt von Beginn an mitzumachen, ist eine verlockende Geschichte!
boerse.de:
Worauf gründet sich dann Ihr Pessimismus?
Retz:
Ob es wirklich Pessimismus ist, wird die Zukunft zeigen. Pessimist wäre ich, wenn ich befürchten müsste, bei der von mir prognostizierten Kursentwicklung Geld zu verlieren. Tatsächlich zeigt mein Report, wie sich auch an der kommenden Krise kräftig verdienen lässt.
Meine Prognosen gründen sich auf genau die Säulen, die mir auch 1987 und im März 2000 konkrete Alarmsignale gegeben haben: Einen gesunden, bestmöglich gegen die Medien abgeschotteten Menschenverstand, die Einordnung von Einzelfakten in Zusammenhänge, den Abgleich dieser Zusammenhänge mit historischen Mustern und Charts, Charts und noch einmal Charts!
boerse.de:
Sie betonen so sehr die Charts. Halten Sie die Fundamentals für unwesentlich?
Retz:
Keineswegs. Wenn sie den Report lesen, werden Sie feststellen, dass er außerordentlich viele volkswirtschaftliche Aspekte bespricht. Vielleicht in einer Form, die viele so nicht gewohnt sind. Nur: Mit Lehrbuch-Plattitüden allein lässt sich an der Börse kein Geld verdienen. Wichtiger als alle nackten Zahlen ist immer, was die Märkte aus ihnen machen, ganz gleich, ob es irgendwelchen Theorien gerecht wird oder nicht. Das ist Psychologie. Und Charts sind nichts anderes als in Geld und Kurse gegossene Psychologie.
boerse.de:
Unter anderem prognostizieren Sie einen Dow Jones von unter 1.000 Punkten, zumindest aber von 3.500 - 5.000 Punkten. Ist das nicht doch Pessimismus pur - und nicht Realismus?
Retz:
Um 5.000 oder 3.500 Punkte zu erreichen, müsste der Dow nicht einmal aus seinem langfristigen, seit der 30ern des letzten Jahrhunderts bestehenden Aufwärtstrendkanal nach unten durchbrechen, d. h. eine derartige Zielmarke könnte der Index sogar innerhalb eines intakten Aufwärtstrends ansteuern. Und um auf 1.000 Punkte einzubrechen, müsste dieser Index lediglich dem Verlaufsmuster folgen, das in der Vergangenheit der letzten Jahrhunderte alle spekulativen Bubbles beendet hat. Wir reden also hier eher von historischen „Normal"-Entwicklungen, nicht von irgendetwas ganz Neuem.
boerse.de:
Das klingt wenig erfreulich. Rechnen Sie wirklich mit einem derartigen Zusammenbruch? Und würde das nicht eine Weltwirtschaftskrise bedeuten?
Retz:
Zweimal ja.
boerse.de:
Bitte etwas ausführlicher, wenn es geht!
Retz:
Bis vermutlich 2006 sollte die Baisse durch sein. Für viele Blue Chips wird das das Aus bedeuten. Die Sozialsysteme in ihrer heutigen Form wird es dann nicht mehr geben. Die USA werden alles unternehmen, um China als neue Wirtschaftsweltmacht Nummer eins in Schach zu halten. Immobilien werden zum nächsten großen Crashmarkt. Die neue Weltwirtschaftskurse wird alles umkrempeln. „Alte", vermeintlich überlebte Werte werden eine Renaissance erleben, die Gesellschaften werden neue Formen des Zusammenlebens entwickeln müssen. Der größte Risikofaktor liegt im in derartigen Konstellationen stets latent vorhandenen Rechtsruck der Politik, dem Rückzug in Nationalismen, dem Aufbau von Feindbildern und damit letztlich in neuen Kriegen.
boerse.de:
Was ist Ihrer Meinung nach zu tun?
Retz:
Lesen Sie meinen Report! Sie können sich sicher sein, dass ich ihn nicht geschrieben habe, um mich als Prophet des Untergangs lächerlich zu machen. Sondern um auch Ihr Geld zu schützen. Und um es Ihnen zu ermöglichen, in wenigen Jahren zu wirklichen Tiefstpreisen Aktien, Immobilien und anderes mehr kaufen zu können - während um Sie herum das finanzielle Chaos herrscht. Mehr kann ich nicht tun.
boerse.de:
Und wenn es doch nicht so schlimm kommt?
Retz:
Dann sollten wir uns gemeinsam freuen! Offen gestanden, ist es mein zweitgrößter Wunsch, dass meine jetzigen Prognosen anders als ihre beiden großen Vorgänger nicht in Erfüllung gehen.
boerse.de:
Herr Retz, wir danken Ihnen für dieses Interview.
Axel Retz ist leitender Redakteur des Optionsbriefes, dem führenden Börsendienst für die Terminbörse in Deutschland
.
.
Otmar Issing zu den Möglichkeiten und Instrumentarien der EZB:
...wir können - falls dies geldpolitisch geboten erscheint - am Sekundärmarkt quasi unbegrenzt aktiv werden, das potenzielle Volumen ginge in die Billionen Euro...
Gibt es da etwa Parallelen zur Federal Reserve Bank ...?
Die interessanteste Passage ist kursiv markiert)
"WIR NEHMEN RISIKEN ERNST"
Otmar Issing, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, über historisch niedrige Zinsen,
Deflationsängste und die Zukunft des europäischen Stabilitätspakts
SPIEGEL: Herr Issing, die Zinsen in Europa sind so niedrig wie nie, aber immer noch höher als in den Vereinigten Staaten. Warum eigentlich?
Issing: In den USA war der Einbruch der Wirtschaftsentwicklung viel stärker. Wir haben ein Mandat, die Preisstabilität im Euro-Raum zu erhalten ...
SPIEGEL: ... während die US-Notenbank Fed sich nicht nur für die Inflationsrate, sondern auch für das Wirtschaftswachstum verantwortlich fühlt.
Issing: Wir sind der Meinung, dass die Erhaltung der Preisstabilität die beste Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung ist. Nur auf Basis stabiler Preise können Sparer und Investoren sicher planen. Zudem: Wenn zum Beispiel die Preise steigen, leidet die Nachfrage. Den Leuten fehlt die Kaufkraft.
SPIEGEL: Im Moment ist Inflation kein Thema, bei einer Preissteigerungsrate von 0,7 Prozent in Deutschland warnen Experten eher vor einer deflatorischen Entwicklung wie in Japan, wo ein stetiger Preisverfall die Wirtschaft lähmt.
Issing: Ich kenne keine einzige Prognose, die einen Preisverfall vorhersagt. Selbst wenn die Preise für ein oder zwei Quartale einmal sinken würden, dann wäre das weder ungewöhnlich noch Besorgnis erregend. Das hatten wir in der Bundesrepublik 1986 schon einmal. Damals hat kein Mensch über Deflationsgefahren gesprochen. Besorgnis erregend wäre es, wenn es im Währungsraum insgesamt die Erwartung stetig sinkender Preise gäbe. Das könnte zu Kaufzurückhaltung führen und einen Abschwung verstärken. Für die Gefahr einer solchen Deflationsspirale sehe ich im Euro-Raum nicht die geringsten Anzeichen.
SPIEGEL: Und in Deutschland?
Issing: Es ist etwas ganz anderes, ob die Preise in einem Teilgebiet einer Währungsunion oder im gesamten Währungsgebiet sinken. Man spricht auch nicht davon, dass Deflationsgefahren in Kalifornien oder in Ohio bestehen. So wenig gilt das für Luxemburg oder Deutschland.
SPIEGEL: Erklären Sie uns den Unterschied?
Issing: Wenn in Deutschland die Preise weniger steigen als im übrigen Währungsgebiet - das gilt natürlich erst recht, wenn sie in Deutschland absolut fallen und im Durchschnitt des Euro-Raums zwischen ein und zwei Prozent liegen -, dann wird diese Region, Deutschland, im Verhältnis zu den anderen Gebieten automatisch preisgünstiger. Die entsprechenden Produzenten können ihre Produkte leichter absetzen, es entstehen Wettbewerbsvorteile. Wegen der erhöhten Nachfrage steigen die Preise schließlich wieder. Eine solche Entwicklung kann sich auch auf den Tourismus auswirken. Das sind stabilisierende Elemente. Die Gefahr, dass es zu der für eine Deflation typischen Abwärtsspirale kommt, ist nicht gegeben. Insofern ist die Währungsunion geradezu eine Versicherung gegen eine lang anhaltende Deflation in einem ihrer Teilgebiete.
SPIEGEL: Es kommt also zu einer Art Abwertung?
Issing: Die Wirkung ist vergleichbar, obwohl es ja keine Wechselkurse und deshalb auch keine Abwertungen innerhalb der Währungsunion mehr gibt.
SPIEGEL: Deutschland ist allerdings nicht Ohio, sondern erwirtschaftet immerhin ein Drittel des gesamten Bruttoinlandsprodukts im Euro-Raum. Könnte eine Deflation in diesem wichtigen Land nicht das gesamte Euro-Gebiet anstecken?
Issing: Nicht, solange die EZB eine angemessene Politik macht. Und das werden wir tun. Darauf können Sie sich verlassen. Im Übrigen bezog sich der Vergleich eher auf Kalifornien, Ohio stand für Luxemburg.
SPIEGEL: Was macht Sie so sicher? Die Konsumenten halten sich zurück, die Banken stecken in der Krise, und die Unternehmen haben Mühe, Kredite zu bekommen - sind das nicht die besten Voraussetzungen für eine Deflation?
Issing: Dass es in Deutschland Probleme gibt, ist unbestritten. Die Banken haben erhebliche Ertragsprobleme, und wir wissen auch, warum. Die Aktienkurse sind 2001 und 2002 stark zurückgegangen. Das hat sich natürlich in den Bilanzen der Banken und der Versicherungen niedergeschlagen. Und dass bei den vielen unerfreulichen Meldungen, die es über die Wirtschaft in Deutschland gibt, auf der Konsumentenseite nicht gerade Euphorie herrscht, ist verständlich, da müssen Sie nicht Deflationsängste bemühen. Außerdem ist die Lage im Euro-Raum insgesamt deutlich besser.
SPIEGEL: Dennoch: Die Parallelen zu Japan sind verblüffend. Da begann die Deflation, als Ende der achtziger Jahre eine Spekulationsblase platzte. Bis Mitte der neunziger Jahre hinein sagten jedoch alle Ökonomen ein höheres Wachstum voraus, als tatsächlich eintrat, die japanische Notenbank senkte nicht rechtzeitig die Zinsen. Was spricht dagegen, dass es bei uns auch so kommt?
Issing: Wenn Sie die makroökonomischen Daten von Japan und Deutschland vergleichen, werden Sie eine ganze Reihe von ähnlichen Entwicklungen feststellen - aber auch große Unterschiede. Anfang der neunziger Jahre hat mir in Japan ein Offizieller das Gebiet des Kaiserpalastes gezeigt. Dazu hat er mir stolz erzählt, dass dieses Gelände mitten in Tokio zu Marktpreisen denselben Wert hat wie Kalifornien. Mich hat sehr überrascht, dass darüber offenbar niemand besorgt war. An diesem Beispiel sehen Sie, wie meilenweit entfernt die Entwicklung in Deutschland von der Entwicklung in Japan ist. Denn auf der Basis dieser Grundstückspreise haben die Banken in Japan Kredite vergeben. Auf der Basis dieser Entwicklung der Bau- und Grundstückspreise sind viele Aktienkurse nach oben geschnellt. Das Ganze hat in der Tat zu einer Blase geführt, die platzen musste.
SPIEGEL: Hier war es die Blase der Hightech-Aktien, die platzte. Auch hier wurden riesige Vermögenswerte vernichtet. Wo ist der Unterschied?
Issing: Eine Immobilienblase ist noch viel gefährlicher als eine Aktienblase, weil viel mehr Haushalte betroffen sind und weil Banken und Versicherungsgesellschaften noch stärker getroffen werden. Wenn die Blase platzt, kommt es in beiden Fällen zu Anpassungsproblemen. Ich bin der Letzte, der das bestreitet. Aber dabei das Schwergewicht auf Deflationsgefahren zu legen lenkt von den Problemen ab, die Deutschland wirklich hat.
SPIEGEL: Immerhin gab es hier zu Lande schon einmal eine Deflation.
Issing: Die Reaktionen in Deutschland sind fast schon von Pawlowscher Natur. Sobald das Wort "Krise" oder gar "Deflation" auftaucht, erscheinen sofort die Bilder von 1929/30. Dieser Vergleich ist in meinen Augen genauso abwegig wie der mit Japan. In Deutschland fielen die Konsumentenpreise in den Jahren von 1929 bis 1932 um 25 Prozent, die Großhandelspreise um nicht weniger als 33 Prozent, vom Anstieg der Arbeitslosigkeit und den politischen Folgen gar nicht zu sprechen. Wir wissen alle, welche politisch katastrophalen Folgen damals Deflation und Depression gehabt haben. Damals hat die Politik gravierende Fehler begangen, das wird sich nicht wiederholen. Wir nehmen Risiken ernst, wenn wir sie ausmachen. Aber Notenbanken handeln nicht auf Verdacht hin, sie haben sorgfältig zu prüfen, in welcher Situation wir uns befinden und mit welcher Entwicklung zu rechnen ist. Daraufhin haben sie zu agieren, und zwar rechtzeitig und entschlossen.
SPIEGEL: Wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine Deflation befürchteten?
Issing: Wir sind mit den gleichen Instrumenten ausgestattet wie jede andere Notenbank auch. Die Fed hat eine große Studie veröffentlicht, was sie tun würde, wenn. Wir veröffentlichen keine Studien, was wir tun würden, wenn.
SPIEGEL: Aber Sie haben eine.
Issing: Wir wissen, was wir zu tun hätten. Es gibt ganz abwegige Äußerungen, dass wir von unserem Mandat und von unserem Statut her gehindert wären, etwa Wertpapiere anzukaufen. Das ist blanker Unsinn. Wir dürfen nicht direkt den Regierungen Kredit geben, aber wir können - falls dies geldpolitisch geboten erscheint - am Sekundärmarkt quasi unbegrenzt aktiv werden, das potenzielle Volumen ginge in die Billionen Euro.
SPIEGEL: Sie könnten zum Beispiel auch unbegrenzt Dollar kaufen, um Geld in den Markt zu pumpen?
Issing: Da gibt es zumindest technisch keine Grenze. Aber noch einmal: Das Letzte, was wir tun sollten, wäre, zu dem Eindruck beizutragen, die EZB steht hier sozusagen schon Gewehr bei Fuß, in der Erwartung, dass diese schlimme Entwicklung eintreten könnte. Dafür gibt es nicht die geringsten Anzeichen.
SPIEGEL: In den dreißiger Jahren heizte der deutsche Reichskanzler Heinrich Brüning die Deflation mit einer falschen Politik erst richtig an. Kann sich das wiederholen?
Issing: Nein, das sehe ich nicht. Ganz nebenbei bemerkt, unterhalten wir uns in Deutschland und in Europa ja darüber, dass der Stabilitätspakt missachtet wird, und nicht darüber, dass er als ein Korsett für die öffentlichen Finanzen wirkt. Nirgendwo wird so gespart, dass die Ausgaben zurückgeführt werden. Es gibt allenfalls Diskussionen, in welchem Ausmaß die Defizite ansteigen.
SPIEGEL: Obwohl der Stabilitätspakt fast nicht mehr ernst genommen wird, sind die Zinsen und die Inflationsrate so niedrig und der Euro so stark wie nie. Wie passt das zusammen?
Issing: Die Inflationsentwicklung ist ja nicht allein von der Finanzpolitik abhängig. Die jetzigen Überschreitungen der Haushaltspläne haben vor allem mit der schwachen Wirtschaftslage zu tun. Der Stabilitätspakt spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, und er wird das weiter tun.
SPIEGEL: Wird er nicht durch die ständigen Verstöße zunehmend ausgehöhlt?
Issing: Die Gefahr ist nicht zu leugnen. Die Entwicklung wird aber wieder in die andere Richtung gehen. Sobald die Wirtschaft wieder besser läuft, werden die Steuereinnahmen wieder steigen. Dann kommt es entscheidend darauf an, dass diesmal die gute Konjunkturlage für den Abbau der Defizite genutzt wird und nach Möglichkeit sogar Überschüsse erzielt werden. Dann haben Sie im nächsten Abschwung einen langen Spielraum hin zur Defizitgrenze von drei Prozent.
SPIEGEL: Der Euro steigt und steigt. Macht Ihnen das Sorge?
Issing: Ich erinnere mich noch sehr wohl an die Zeiten vor zwei Jahren, als der Euro so schwach war und ich gesagt habe, ich werde es während meiner Amtszeit noch erleben, dass die umgekehrten Klagen kommen. Davon war ich fest überzeugt. Wir haben damals gesagt: Nach unserer Meinung ist der Euro deutlich unterbewertet. Insofern ist das, was wir bisher gesehen haben, vor allem eine Korrektur einer Unterbewertung.
SPIEGEL: Wann hört die Korrektur einer Unterbewertung auf und schlägt in eine Überbewertung um?
Issing: Die genaue Linie kann kein Mensch bestimmen.
SPIEGEL: Haben wir denn eine Euro-Stärke oder eine Dollar-Schwäche?
Issing: Der Euro hat sich generell zu einer starken Währung entwickelt, weil die Aufwertung sich auch gegenüber anderen Währungen vollzogen hat. Aber es gibt auch Elemente, die für eine Dollar-Schwäche sprechen.
SPIEGEL: Trägt der amerikanische Finanzminister auch eine gewisse Verantwortung für die rasante Aufwertung des Euro, weil er den Dollar schwachgeredet hat?
Issing: Zu der Geschicklichkeit amerikanischer Finanzminister in ihrer Kommunikation zum Dollar will ich mich nicht äußern.
SPIEGEL: Müssen die Amerikaner auf Grund ihres Leistungsbilanzdefizits nicht an einem starken Dollar interessiert sein, um ausländisches Kapital ins Land zu locken?
Issing: Das hohe Leistungsbilanzdefizit und der hohe Kapitalimport gehören zusammen wie die beiden Seiten einer Münze.
Die Amerikaner werden immer fähig sein, das nötige Kapital zu importieren. Die Frage wird sein, zu welchem Preis das in der Zukunft möglich sein wird. Wenn ein Land auf Dauer Kapitalimporte benötigt, muss es ja Anreize geben für Investoren aus der ganzen Welt, ihr Geld dort anzulegen.
SPIEGEL: Was ist der Preis - höhere Zinsen?
Issing: So könnte es kommen. Falls jedoch das Vertrauen der Anleger gestärkt wird, ist auch eine ganz andere Entwicklung denkbar.
SPIEGEL: Herr Issing, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Otmar Issing
gilt als Verfechter einer strikten Anti-Inflations-Politik innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Professor für Volkswirtschaft war Mitglied des Sachverständigenrats, als er 1990 in das Direktorium der Bundesbank berufen wurde. Seit 1998 gehört Issing, 67, dem Direktorium der EZB an, deren Kurs er als Chefvolkswirt des Hauses wesentlich mitbestimmt.
DER SPIEGEL - 25/2003
Otmar Issing zu den Möglichkeiten und Instrumentarien der EZB:
...wir können - falls dies geldpolitisch geboten erscheint - am Sekundärmarkt quasi unbegrenzt aktiv werden, das potenzielle Volumen ginge in die Billionen Euro...
Gibt es da etwa Parallelen zur Federal Reserve Bank ...?
Die interessanteste Passage ist kursiv markiert)
"WIR NEHMEN RISIKEN ERNST"
Otmar Issing, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, über historisch niedrige Zinsen,
Deflationsängste und die Zukunft des europäischen Stabilitätspakts
SPIEGEL: Herr Issing, die Zinsen in Europa sind so niedrig wie nie, aber immer noch höher als in den Vereinigten Staaten. Warum eigentlich?
Issing: In den USA war der Einbruch der Wirtschaftsentwicklung viel stärker. Wir haben ein Mandat, die Preisstabilität im Euro-Raum zu erhalten ...
SPIEGEL: ... während die US-Notenbank Fed sich nicht nur für die Inflationsrate, sondern auch für das Wirtschaftswachstum verantwortlich fühlt.
Issing: Wir sind der Meinung, dass die Erhaltung der Preisstabilität die beste Voraussetzung für Wachstum und Beschäftigung ist. Nur auf Basis stabiler Preise können Sparer und Investoren sicher planen. Zudem: Wenn zum Beispiel die Preise steigen, leidet die Nachfrage. Den Leuten fehlt die Kaufkraft.
SPIEGEL: Im Moment ist Inflation kein Thema, bei einer Preissteigerungsrate von 0,7 Prozent in Deutschland warnen Experten eher vor einer deflatorischen Entwicklung wie in Japan, wo ein stetiger Preisverfall die Wirtschaft lähmt.
Issing: Ich kenne keine einzige Prognose, die einen Preisverfall vorhersagt. Selbst wenn die Preise für ein oder zwei Quartale einmal sinken würden, dann wäre das weder ungewöhnlich noch Besorgnis erregend. Das hatten wir in der Bundesrepublik 1986 schon einmal. Damals hat kein Mensch über Deflationsgefahren gesprochen. Besorgnis erregend wäre es, wenn es im Währungsraum insgesamt die Erwartung stetig sinkender Preise gäbe. Das könnte zu Kaufzurückhaltung führen und einen Abschwung verstärken. Für die Gefahr einer solchen Deflationsspirale sehe ich im Euro-Raum nicht die geringsten Anzeichen.
SPIEGEL: Und in Deutschland?
Issing: Es ist etwas ganz anderes, ob die Preise in einem Teilgebiet einer Währungsunion oder im gesamten Währungsgebiet sinken. Man spricht auch nicht davon, dass Deflationsgefahren in Kalifornien oder in Ohio bestehen. So wenig gilt das für Luxemburg oder Deutschland.
SPIEGEL: Erklären Sie uns den Unterschied?
Issing: Wenn in Deutschland die Preise weniger steigen als im übrigen Währungsgebiet - das gilt natürlich erst recht, wenn sie in Deutschland absolut fallen und im Durchschnitt des Euro-Raums zwischen ein und zwei Prozent liegen -, dann wird diese Region, Deutschland, im Verhältnis zu den anderen Gebieten automatisch preisgünstiger. Die entsprechenden Produzenten können ihre Produkte leichter absetzen, es entstehen Wettbewerbsvorteile. Wegen der erhöhten Nachfrage steigen die Preise schließlich wieder. Eine solche Entwicklung kann sich auch auf den Tourismus auswirken. Das sind stabilisierende Elemente. Die Gefahr, dass es zu der für eine Deflation typischen Abwärtsspirale kommt, ist nicht gegeben. Insofern ist die Währungsunion geradezu eine Versicherung gegen eine lang anhaltende Deflation in einem ihrer Teilgebiete.
SPIEGEL: Es kommt also zu einer Art Abwertung?
Issing: Die Wirkung ist vergleichbar, obwohl es ja keine Wechselkurse und deshalb auch keine Abwertungen innerhalb der Währungsunion mehr gibt.
SPIEGEL: Deutschland ist allerdings nicht Ohio, sondern erwirtschaftet immerhin ein Drittel des gesamten Bruttoinlandsprodukts im Euro-Raum. Könnte eine Deflation in diesem wichtigen Land nicht das gesamte Euro-Gebiet anstecken?
Issing: Nicht, solange die EZB eine angemessene Politik macht. Und das werden wir tun. Darauf können Sie sich verlassen. Im Übrigen bezog sich der Vergleich eher auf Kalifornien, Ohio stand für Luxemburg.
SPIEGEL: Was macht Sie so sicher? Die Konsumenten halten sich zurück, die Banken stecken in der Krise, und die Unternehmen haben Mühe, Kredite zu bekommen - sind das nicht die besten Voraussetzungen für eine Deflation?
Issing: Dass es in Deutschland Probleme gibt, ist unbestritten. Die Banken haben erhebliche Ertragsprobleme, und wir wissen auch, warum. Die Aktienkurse sind 2001 und 2002 stark zurückgegangen. Das hat sich natürlich in den Bilanzen der Banken und der Versicherungen niedergeschlagen. Und dass bei den vielen unerfreulichen Meldungen, die es über die Wirtschaft in Deutschland gibt, auf der Konsumentenseite nicht gerade Euphorie herrscht, ist verständlich, da müssen Sie nicht Deflationsängste bemühen. Außerdem ist die Lage im Euro-Raum insgesamt deutlich besser.
SPIEGEL: Dennoch: Die Parallelen zu Japan sind verblüffend. Da begann die Deflation, als Ende der achtziger Jahre eine Spekulationsblase platzte. Bis Mitte der neunziger Jahre hinein sagten jedoch alle Ökonomen ein höheres Wachstum voraus, als tatsächlich eintrat, die japanische Notenbank senkte nicht rechtzeitig die Zinsen. Was spricht dagegen, dass es bei uns auch so kommt?
Issing: Wenn Sie die makroökonomischen Daten von Japan und Deutschland vergleichen, werden Sie eine ganze Reihe von ähnlichen Entwicklungen feststellen - aber auch große Unterschiede. Anfang der neunziger Jahre hat mir in Japan ein Offizieller das Gebiet des Kaiserpalastes gezeigt. Dazu hat er mir stolz erzählt, dass dieses Gelände mitten in Tokio zu Marktpreisen denselben Wert hat wie Kalifornien. Mich hat sehr überrascht, dass darüber offenbar niemand besorgt war. An diesem Beispiel sehen Sie, wie meilenweit entfernt die Entwicklung in Deutschland von der Entwicklung in Japan ist. Denn auf der Basis dieser Grundstückspreise haben die Banken in Japan Kredite vergeben. Auf der Basis dieser Entwicklung der Bau- und Grundstückspreise sind viele Aktienkurse nach oben geschnellt. Das Ganze hat in der Tat zu einer Blase geführt, die platzen musste.
SPIEGEL: Hier war es die Blase der Hightech-Aktien, die platzte. Auch hier wurden riesige Vermögenswerte vernichtet. Wo ist der Unterschied?
Issing: Eine Immobilienblase ist noch viel gefährlicher als eine Aktienblase, weil viel mehr Haushalte betroffen sind und weil Banken und Versicherungsgesellschaften noch stärker getroffen werden. Wenn die Blase platzt, kommt es in beiden Fällen zu Anpassungsproblemen. Ich bin der Letzte, der das bestreitet. Aber dabei das Schwergewicht auf Deflationsgefahren zu legen lenkt von den Problemen ab, die Deutschland wirklich hat.
SPIEGEL: Immerhin gab es hier zu Lande schon einmal eine Deflation.
Issing: Die Reaktionen in Deutschland sind fast schon von Pawlowscher Natur. Sobald das Wort "Krise" oder gar "Deflation" auftaucht, erscheinen sofort die Bilder von 1929/30. Dieser Vergleich ist in meinen Augen genauso abwegig wie der mit Japan. In Deutschland fielen die Konsumentenpreise in den Jahren von 1929 bis 1932 um 25 Prozent, die Großhandelspreise um nicht weniger als 33 Prozent, vom Anstieg der Arbeitslosigkeit und den politischen Folgen gar nicht zu sprechen. Wir wissen alle, welche politisch katastrophalen Folgen damals Deflation und Depression gehabt haben. Damals hat die Politik gravierende Fehler begangen, das wird sich nicht wiederholen. Wir nehmen Risiken ernst, wenn wir sie ausmachen. Aber Notenbanken handeln nicht auf Verdacht hin, sie haben sorgfältig zu prüfen, in welcher Situation wir uns befinden und mit welcher Entwicklung zu rechnen ist. Daraufhin haben sie zu agieren, und zwar rechtzeitig und entschlossen.
SPIEGEL: Wie würden Sie reagieren, wenn Sie eine Deflation befürchteten?
Issing: Wir sind mit den gleichen Instrumenten ausgestattet wie jede andere Notenbank auch. Die Fed hat eine große Studie veröffentlicht, was sie tun würde, wenn. Wir veröffentlichen keine Studien, was wir tun würden, wenn.
SPIEGEL: Aber Sie haben eine.
Issing: Wir wissen, was wir zu tun hätten. Es gibt ganz abwegige Äußerungen, dass wir von unserem Mandat und von unserem Statut her gehindert wären, etwa Wertpapiere anzukaufen. Das ist blanker Unsinn. Wir dürfen nicht direkt den Regierungen Kredit geben, aber wir können - falls dies geldpolitisch geboten erscheint - am Sekundärmarkt quasi unbegrenzt aktiv werden, das potenzielle Volumen ginge in die Billionen Euro.
SPIEGEL: Sie könnten zum Beispiel auch unbegrenzt Dollar kaufen, um Geld in den Markt zu pumpen?
Issing: Da gibt es zumindest technisch keine Grenze. Aber noch einmal: Das Letzte, was wir tun sollten, wäre, zu dem Eindruck beizutragen, die EZB steht hier sozusagen schon Gewehr bei Fuß, in der Erwartung, dass diese schlimme Entwicklung eintreten könnte. Dafür gibt es nicht die geringsten Anzeichen.
SPIEGEL: In den dreißiger Jahren heizte der deutsche Reichskanzler Heinrich Brüning die Deflation mit einer falschen Politik erst richtig an. Kann sich das wiederholen?
Issing: Nein, das sehe ich nicht. Ganz nebenbei bemerkt, unterhalten wir uns in Deutschland und in Europa ja darüber, dass der Stabilitätspakt missachtet wird, und nicht darüber, dass er als ein Korsett für die öffentlichen Finanzen wirkt. Nirgendwo wird so gespart, dass die Ausgaben zurückgeführt werden. Es gibt allenfalls Diskussionen, in welchem Ausmaß die Defizite ansteigen.
SPIEGEL: Obwohl der Stabilitätspakt fast nicht mehr ernst genommen wird, sind die Zinsen und die Inflationsrate so niedrig und der Euro so stark wie nie. Wie passt das zusammen?
Issing: Die Inflationsentwicklung ist ja nicht allein von der Finanzpolitik abhängig. Die jetzigen Überschreitungen der Haushaltspläne haben vor allem mit der schwachen Wirtschaftslage zu tun. Der Stabilitätspakt spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, und er wird das weiter tun.
SPIEGEL: Wird er nicht durch die ständigen Verstöße zunehmend ausgehöhlt?
Issing: Die Gefahr ist nicht zu leugnen. Die Entwicklung wird aber wieder in die andere Richtung gehen. Sobald die Wirtschaft wieder besser läuft, werden die Steuereinnahmen wieder steigen. Dann kommt es entscheidend darauf an, dass diesmal die gute Konjunkturlage für den Abbau der Defizite genutzt wird und nach Möglichkeit sogar Überschüsse erzielt werden. Dann haben Sie im nächsten Abschwung einen langen Spielraum hin zur Defizitgrenze von drei Prozent.
SPIEGEL: Der Euro steigt und steigt. Macht Ihnen das Sorge?
Issing: Ich erinnere mich noch sehr wohl an die Zeiten vor zwei Jahren, als der Euro so schwach war und ich gesagt habe, ich werde es während meiner Amtszeit noch erleben, dass die umgekehrten Klagen kommen. Davon war ich fest überzeugt. Wir haben damals gesagt: Nach unserer Meinung ist der Euro deutlich unterbewertet. Insofern ist das, was wir bisher gesehen haben, vor allem eine Korrektur einer Unterbewertung.
SPIEGEL: Wann hört die Korrektur einer Unterbewertung auf und schlägt in eine Überbewertung um?
Issing: Die genaue Linie kann kein Mensch bestimmen.
SPIEGEL: Haben wir denn eine Euro-Stärke oder eine Dollar-Schwäche?
Issing: Der Euro hat sich generell zu einer starken Währung entwickelt, weil die Aufwertung sich auch gegenüber anderen Währungen vollzogen hat. Aber es gibt auch Elemente, die für eine Dollar-Schwäche sprechen.
SPIEGEL: Trägt der amerikanische Finanzminister auch eine gewisse Verantwortung für die rasante Aufwertung des Euro, weil er den Dollar schwachgeredet hat?
Issing: Zu der Geschicklichkeit amerikanischer Finanzminister in ihrer Kommunikation zum Dollar will ich mich nicht äußern.
SPIEGEL: Müssen die Amerikaner auf Grund ihres Leistungsbilanzdefizits nicht an einem starken Dollar interessiert sein, um ausländisches Kapital ins Land zu locken?
Issing: Das hohe Leistungsbilanzdefizit und der hohe Kapitalimport gehören zusammen wie die beiden Seiten einer Münze.
Die Amerikaner werden immer fähig sein, das nötige Kapital zu importieren. Die Frage wird sein, zu welchem Preis das in der Zukunft möglich sein wird. Wenn ein Land auf Dauer Kapitalimporte benötigt, muss es ja Anreize geben für Investoren aus der ganzen Welt, ihr Geld dort anzulegen.
SPIEGEL: Was ist der Preis - höhere Zinsen?
Issing: So könnte es kommen. Falls jedoch das Vertrauen der Anleger gestärkt wird, ist auch eine ganz andere Entwicklung denkbar.
SPIEGEL: Herr Issing, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Otmar Issing
gilt als Verfechter einer strikten Anti-Inflations-Politik innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Professor für Volkswirtschaft war Mitglied des Sachverständigenrats, als er 1990 in das Direktorium der Bundesbank berufen wurde. Seit 1998 gehört Issing, 67, dem Direktorium der EZB an, deren Kurs er als Chefvolkswirt des Hauses wesentlich mitbestimmt.
DER SPIEGEL - 25/2003
So sieht es aus und mit Trichet bekommt Europa einen etwas agressiveren EZB-Präsidenten.

.
US-Zinssenkung dürfte Goldpreis treiben
Von Alexander Zumpfe
Die Aufregung der Märkte vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch macht vor dem Goldpreis nicht Halt. Sollte sich die Fed zu einer Zinssenkung entschließen, könnte das positive Folgen für das Edelmetall haben.
Analysten schließen nach einem leichten Anstieg in der vergangenen Woche auf gut 357 $ für die kommenden Tage Preisschwankungen von 5 bis 10 $ Dollar in einer Handelsspanne zwischen 355 und 365 $ je Unze nicht aus. Ob diese Spanne halten wird, bestimmt vor allem der Devisenmarkt.
Grundsätzlich gilt, dass ein schwächerer Dollar-Kurs mit einem festeren Goldpreis einhergeht. Sollte sich die Fed - wie die Mehrheit der Analysten erwartet - zu einer Zinssenkung entschließen, könnte das positive Folgen für das Edelmetall haben. Neben den Auswirkungen auf die Devisenmärkte begünstigt es das Interesse der Investoren. Da ein Investment in Gold keine Zinsen abwirft, wird das gelbe Metall desto attraktiver für Investoren, je weniger Zinsen andere Anlagen abwerfen.
In der vergangenen Woche wurde auch Platin stark beachtet. Nach positiven US-Wirtschaftsdaten kehrten Fonds zurück. Ihre Nachfrage trieb den Preis für das Industriemetall bis auf 682 $ je Unze. Umfangreiche - auf diesem Niveau platzierte - Verkaufsorders sollten Händlern zufolge allerdings in dieser Woche eine weitere Aufwärtsbewegung zunächst abbremsen.
Die nächste Unterstützung findet Platin bei 660 $.
Positive Impulse könnten mittelfristig von der Automobilindustrie ausgehen. Nicht zuletzt wegen eines umfangreichen Modellwechsels geht eine zunehmende Anzahl von Analysten davon aus, dass die Autonachfrage in diesem Jahr ihren Tiefststand erreicht hat. Sollte die Zahl der Neuzulassungen zunehmen, rechnen Marktbeobachter mit positiven Auswirkungen auf die Platinnachfrage. Das Industriemetall findet Verwendung in Katalysatoren.
Der Silberpreis scheint unterdessen sein vorläufiges Tief gefunden zu haben und verabschiedete sich aus seinem Mitte Mai gebildeten Abwärtstrend.
Alexander Zumpfe ist Händler für Edelmetalle und Rohstoffe bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
FTD –23.06.2003
US-Zinssenkung dürfte Goldpreis treiben
Von Alexander Zumpfe
Die Aufregung der Märkte vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch macht vor dem Goldpreis nicht Halt. Sollte sich die Fed zu einer Zinssenkung entschließen, könnte das positive Folgen für das Edelmetall haben.
Analysten schließen nach einem leichten Anstieg in der vergangenen Woche auf gut 357 $ für die kommenden Tage Preisschwankungen von 5 bis 10 $ Dollar in einer Handelsspanne zwischen 355 und 365 $ je Unze nicht aus. Ob diese Spanne halten wird, bestimmt vor allem der Devisenmarkt.
Grundsätzlich gilt, dass ein schwächerer Dollar-Kurs mit einem festeren Goldpreis einhergeht. Sollte sich die Fed - wie die Mehrheit der Analysten erwartet - zu einer Zinssenkung entschließen, könnte das positive Folgen für das Edelmetall haben. Neben den Auswirkungen auf die Devisenmärkte begünstigt es das Interesse der Investoren. Da ein Investment in Gold keine Zinsen abwirft, wird das gelbe Metall desto attraktiver für Investoren, je weniger Zinsen andere Anlagen abwerfen.
In der vergangenen Woche wurde auch Platin stark beachtet. Nach positiven US-Wirtschaftsdaten kehrten Fonds zurück. Ihre Nachfrage trieb den Preis für das Industriemetall bis auf 682 $ je Unze. Umfangreiche - auf diesem Niveau platzierte - Verkaufsorders sollten Händlern zufolge allerdings in dieser Woche eine weitere Aufwärtsbewegung zunächst abbremsen.
Die nächste Unterstützung findet Platin bei 660 $.
Positive Impulse könnten mittelfristig von der Automobilindustrie ausgehen. Nicht zuletzt wegen eines umfangreichen Modellwechsels geht eine zunehmende Anzahl von Analysten davon aus, dass die Autonachfrage in diesem Jahr ihren Tiefststand erreicht hat. Sollte die Zahl der Neuzulassungen zunehmen, rechnen Marktbeobachter mit positiven Auswirkungen auf die Platinnachfrage. Das Industriemetall findet Verwendung in Katalysatoren.
Der Silberpreis scheint unterdessen sein vorläufiges Tief gefunden zu haben und verabschiedete sich aus seinem Mitte Mai gebildeten Abwärtstrend.
Alexander Zumpfe ist Händler für Edelmetalle und Rohstoffe bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
FTD –23.06.2003
.
Gold Stocks -- Nearing Breaking Out?
By Dave Skarica
"However, gold seems to be having difficulty with the 370-375 area. The HUI (Amex Gold Bugs Index) seems to be having difficulty with 145 and the XAU (Philadelphia Gold Index) 75. We maybe due for a breather. The stocks continue to lag. It is our feeling that gold could decline back to 350 dollars an ounce and enter a range of 350-370 as the dollar sees a bear market rally. However, we expect that after any such decline gold to resume its upward course and the stocks to begin to outperform. As always look to purchase mid-tiers on any dips." Dave Skarica, Addicted to Proits June 2003 Issue
We usually do not like to tout our own predictions but the above has come to be, even if it came to be a bit faster than we thought it would. Gold did pullback to the 350 area and the stocks have (finally) begun to outperform on the most recent climb upwards.
Our reasoning for believing this was two fold-
Gold stocks were/are undervalued with in comparison to the metal
- For example, when gold stocks topped out last June gold was trading at approximately 330 dollars an ounce, the HUI was 155 and XAU 90. As recently as last week gold was trading at 355 dollars an ounce yet the HUI was only 147 and the XAU 77. Granted, gold stocks were very overvalued in comparison to the metal last June. However, those recent prices represented a bargain in gold stocks. Therefore, it was our opinion that when gold began to rise again gold stocks would play catch.
The 1993 Bull Market in Gold and Gold Stocks was/is showing us the way
- Gold and Gold stocks both bottomed in the first quarter of 1993 before enduring on a rip roaring run into the summer. Gold rallied from 325 to over 400-dollars an ounce, while the XAU (note: our preferred gold index the HUI did not exist at this time) rallied from around 65 to 130. Gold then pulled back to 345 dollars an ounce, at the same time the XAU pulled back to just over 90. After the pullback gold rallied back to 390 dollars an ounce. However, on the secondary rally the stocks began to outperform and the XAU traded up to nearly 145. Therefore, the XAU traded nearly 15 points higher, despite the fact that gold was trading nearly 15 dollars lower. After a short, sharp correction the gold stocks outperformed! We expected the same thing after gold’s short, sharp correction to 320 dollars an ounce. This is just now beginning to occur. Charts of the 1993 trading in both gold and gold stocks can be found below:


The Amex Gold Bugs Index (HUI – an index of unhedged gold stocks such as GG, GFI and AEM) only pulled back a few points on the last 20-dollar dip in gold and is now breaking out.
As we have noted many times over the past few months the key resistance level on the HUI is 155. This was the intra-day high in both June 2002 and January 2003. In each case when the HUI rose to the 155 level was smacked down. Therefore, 155 had become HUGE resistance. Whenever, such a level becomes large resistance when it breaks it usually does viciously. You can see the current charts of the HUI, XAU and Gold below:


While we will have to call it as we see it we feel that today’s close over 155 in the HUI should mean that gold stocks are due for another large run, probably 25-50%. An example of this can be seen in the 2002 run in gold stocks. Gold stocks peaked in June 2001, with the HUI topping out at a level of approximately 80. The HUI then quickly corrected. The HUI tried to rally back to the June high in September before failing and falling back into late November. Finally, in February 2002 the HUI broke above the key resistance level of 80 and rallied all the way to previous mentioned 155 level in June 2003. When the HUI finally broke its key resistance it exploded upwards. While nothing occurs exactly the same we suspect that gold stocks could see similar in the coming weeks and months.

Dave Skarica - www.addictedtoprofits.com - 18.06.2003
Gold Stocks -- Nearing Breaking Out?
By Dave Skarica
"However, gold seems to be having difficulty with the 370-375 area. The HUI (Amex Gold Bugs Index) seems to be having difficulty with 145 and the XAU (Philadelphia Gold Index) 75. We maybe due for a breather. The stocks continue to lag. It is our feeling that gold could decline back to 350 dollars an ounce and enter a range of 350-370 as the dollar sees a bear market rally. However, we expect that after any such decline gold to resume its upward course and the stocks to begin to outperform. As always look to purchase mid-tiers on any dips." Dave Skarica, Addicted to Proits June 2003 Issue
We usually do not like to tout our own predictions but the above has come to be, even if it came to be a bit faster than we thought it would. Gold did pullback to the 350 area and the stocks have (finally) begun to outperform on the most recent climb upwards.
Our reasoning for believing this was two fold-
Gold stocks were/are undervalued with in comparison to the metal
- For example, when gold stocks topped out last June gold was trading at approximately 330 dollars an ounce, the HUI was 155 and XAU 90. As recently as last week gold was trading at 355 dollars an ounce yet the HUI was only 147 and the XAU 77. Granted, gold stocks were very overvalued in comparison to the metal last June. However, those recent prices represented a bargain in gold stocks. Therefore, it was our opinion that when gold began to rise again gold stocks would play catch.
The 1993 Bull Market in Gold and Gold Stocks was/is showing us the way
- Gold and Gold stocks both bottomed in the first quarter of 1993 before enduring on a rip roaring run into the summer. Gold rallied from 325 to over 400-dollars an ounce, while the XAU (note: our preferred gold index the HUI did not exist at this time) rallied from around 65 to 130. Gold then pulled back to 345 dollars an ounce, at the same time the XAU pulled back to just over 90. After the pullback gold rallied back to 390 dollars an ounce. However, on the secondary rally the stocks began to outperform and the XAU traded up to nearly 145. Therefore, the XAU traded nearly 15 points higher, despite the fact that gold was trading nearly 15 dollars lower. After a short, sharp correction the gold stocks outperformed! We expected the same thing after gold’s short, sharp correction to 320 dollars an ounce. This is just now beginning to occur. Charts of the 1993 trading in both gold and gold stocks can be found below:


The Amex Gold Bugs Index (HUI – an index of unhedged gold stocks such as GG, GFI and AEM) only pulled back a few points on the last 20-dollar dip in gold and is now breaking out.
As we have noted many times over the past few months the key resistance level on the HUI is 155. This was the intra-day high in both June 2002 and January 2003. In each case when the HUI rose to the 155 level was smacked down. Therefore, 155 had become HUGE resistance. Whenever, such a level becomes large resistance when it breaks it usually does viciously. You can see the current charts of the HUI, XAU and Gold below:


While we will have to call it as we see it we feel that today’s close over 155 in the HUI should mean that gold stocks are due for another large run, probably 25-50%. An example of this can be seen in the 2002 run in gold stocks. Gold stocks peaked in June 2001, with the HUI topping out at a level of approximately 80. The HUI then quickly corrected. The HUI tried to rally back to the June high in September before failing and falling back into late November. Finally, in February 2002 the HUI broke above the key resistance level of 80 and rallied all the way to previous mentioned 155 level in June 2003. When the HUI finally broke its key resistance it exploded upwards. While nothing occurs exactly the same we suspect that gold stocks could see similar in the coming weeks and months.

Dave Skarica - www.addictedtoprofits.com - 18.06.2003
.

FISCH MUSS SCHWIMMEN
Von Dimitri Ladischensky
José ist 76 Jahre alt und Lotse in Brasilien. Er führt Frachter hinaus aufs offene Meer. Nie würde er ein Boot zurück in den Hafen nehmen. Er krault lieber. Kilometerweit, stundenlang.
Er hatte zwei Träume. Den einen trugen ihm die Wellen zu, eines Nachts, als er wach dalag und die Wogen an die Mauer seines Hauses klatschten. Er öffnete die Luke über seinem Bett und schaute. Zuerst verschwamm der Himmel vor lauter Tränen. Dann tauchten Sterne auf, der Mond. Er träumte sich die Nacht hell wie den Tag und die See glatt wie einen Spiegel. Er sah Wolken darin schwimmen, klar und ruhig. Er träumte, dass ihm Kiemen und Fischschwanz wuchsen, träumte, wie die Wellen ihn mitnahmen, weit hinaus aufs Meer, bis sie schließlich über seinem Kopf zusammenschlugen und über ihn hinweggingen. Alles verstummte, nichts war mehr zu hören. Nicht die Worte der Mutter, nicht das Gelächter der anderen. Nur das Murmeln von Wasser. Er lauschte. Da hörte er seinen kranken Bruder rufen. Und damit war der Traum dann auch irgendwie immer zu Ende.
Diesen Traum behielt er ganz für sich, nur die Wellen wussten, dass er fortschwimmen will. Den anderen wollte niemand hören, die Mutter nicht, der Vater nicht. Dabei war es doch ein anständiger Traum. Ein guter Traum. Er sah ihn zuerst an der Wand der Stadtbehörde hängen: Ein Rauschebart, der Gott sein soll, wacht auf einem Segelschiff hinter dem Rücken des Steuermanns und greift ihm über die Schulter ins Ruder.
José Martins Ribeiro Nunes, geboren am 5. Januar 1927, fiel mit drei Jahren in den Fluss vor seiner Haustüre. Der Rio Sergipe trägt Baumstämme fort wie Zündhölzchen, ein mächtiger Fluss. José ertrank nicht, obwohl es ihm damals schon verboten war, Fisch zu sein. Seine Mutter Vectúria Martins war Lehrerin für Mathematik, sein Vater Nicanor Ribeiro Nunes Justizbeamter und beiden das Meer nicht geheuer. Sie lebten mit ihren fünf Kindern in Aracaju, nördlich von Salvador, an der Mündung des Rio Sergipe in den Atlantik. Die Avenida Ivo do Prado liegt am Ufersaum. Bei Sturmflut schlug das Wasser an die Hauswände.
Keiner verstand, wieso er schwamm. Fische schwimmen, sagten seine Eltern. In Brasilien stellen die Menschen Tische und Stühle ins Meer, plaudern stundenlang, die Füße im Wasser. Aber schwimmen? "Für einen Fisch hast du viel zu lange Wimpern", sagten seine Eltern. José ließ die Wellen über seinen Kopf hinweggehen, wenn er nichts hören wollte. Die anderen Jungen nahmen das Kanu zur Praia de Atalaia, er schwamm. Wenn seine Eltern zürnten, weil er nicht aus dem Wasser wollte, bat er, dem Nachbarn helfen zu dürfen, der seinen Schlüssel im Fluss verloren hatte, oder dem Fischer das Netz zu holen, das draußen trieb. Wollte ihm aber auch gar nichts einfallen, dann blieb ihm nur, am Strand den Schiffen hinterher zu schauen.
Ein Strich zum Horizont, von dem Wellen abzweigen. Wenn er allein gewesen wäre, ja, dann wäre er vielleicht aufs Meer geschwommen, weit hinaus. José, der Fisch. Und hätte selbst Spuren gezogen. So aber musste er zurück. Zu seinen Eltern, die meinten, Vergnügen sei Sünde. Und Schwimmen zweifelhaft genug, sonst wäre Jesus nicht über das Wasser gegangen. Was aber, dachte sich José, was aber ist, wenn man nun Menschen zu Hilfe schwimmt?

Gemeinsam mit seiner Schwester hüpfte er von einem Trampolin in den Fluss. José sagte Rita nicht, dass er deshalb mit ihr schwamm, weil man sich abends die Schelte teilen konnte. Als sich die Stadt über ihre achtjährige Tochter empörte, dass sie die Unverfrorenheit besäße, nicht nur als einzige Frau von Aracaju schwimmen zu gehen, sondern auch noch im Badeanzug die Promenade zu betreten, nahmen ihr der Vater und die Mutter die Schwimmsachen weg. Fortan schwamm Rita in ihrer Schuluniform und trocknete die Kleider heimlich hinter dem Haus.
Glücklich war José, als die Leute ihn zum ersten Mal Zé Peixe, Fisch- Josef riefen. Jetzt konnten sie kommen, die Eltern. Was brauchte er noch Badehosen? Fische tragen eh keine. Und außerdem: Er schwamm doch nur im Dienst. Das Bild in der Behörde vom Lotsengott. Er sah es tags, er träumte es nachts. Er fuhr mit den Schiffen hinaus, zeigte den Kapitänen, wo die Strömung am tückischsten war, und dann, auf hoher See, sprang er von Bord und kraulte zurück.
Die Leute der Stadt lobten sein vorbildliches Verhalten, der Pastor sprach am Samstag von einem Mitbürger, der für andere einsteht. Das war und war doch nicht, was seine Eltern hören wollten. "Hausaufgaben soll er machen", sagte die Mutter. Aber wann immer sie ihm über die Schulter schaute, sah sie ihn Schiffe malen. "Studieren soll er", sagte sein Vater. Aber wann immer er ein Machtwort sprach, dachte José an den, der alle Macht der Welt, des Himmels und der Meere hat. Er dachte an den Allmächtigen, wie er hinter dem Vater steht und ihm ins Ruder greift.
1947, als er 20 Jahre alt war, ließ sein Vater ihn ziehen, und so wurde er Lotse. Die Mündung des Rio Sergipe ist gefährlich, die Flut drängt hinein, der Fluss hinaus. Wo sie im Widerstreit liegen, werfen sich Wellen auf, viele Meter hoch. Schiffe kentern, andere laufen auf Grund. Nur einer wusste, wohin die Dünen über Nacht wanderten. Geleitete Zé Peixe die Schiffe aufs offene Meer, sprang er von Bord und schwamm den Weg zurück. Zwölf Kilometer waren es von der großen roten Boje, dort verließ der Lotse das Schiff. Manchmal dauerte es sechs Stunden oder länger, bis er die Praia de Atalaia erreichte. War ein Schiff in Empfang zu nehmen, schwamm er hinaus, kettete sich an die Boje, harrte bei Sturm, bei Nacht, verfluchte das Schiff, das sich verspätete, und wartete.

Am Tag, als seine Frau starb, trugen ihn die Wellen hinaus zur Boje und er tanzte mit ihr. Dann schwamm er zurück und wachte am Bett der Toten. Es war die erste gemeinsame Nacht, seit er sie vor 25 Jahren geheiratet hatte. Maria Augusta Oliviera Nunes starb als Jungfrau.
Sie war Angestellte bei der Post und ihm am Strand begegnet. Er brachte ihr Schwimmen bei, nahm sie auf die Schultern und die Angst vor dem Wasser. Sie liebte ihn, er wollte ihr einen Gefallen tun. Also heirateten sie. Nach der Trauung zog er seinen schwarzen Anzug aus, gab die Schuhe zurück, die er sich geliehen hatte, und schwamm zu den Schiffen aufs Meer. Sie wartete vergeblich auf ihn. Sie wartete all die Nächte all die Jahre. Er baute ihr ein Haus, fuhr jeden Tag mit dem Rad bei ihr vorbei. Aber über Nacht blieb er nie. Die Leute in Aracaju erzählen sich, dass sie einmal Fenster und Türen versperrte; da entkam er durch den Kamin.
Sie feierten noch silberne Hochzeit, dann wurde sie auf einmal sehr krank. Geblieben ist nur ihr Bild in der Schrankvitrine. Alle sind sie tot, seine Mutter, sein Vater, die meisten der Geschwister. Auf einem Grabstein des Cemitério São Benedito steht geschrieben: "Du besitzt nur das, was du mitnimmst, wenn du gehst von dieser Welt" Mutter ist gegangen und hat einfach dagelassen, was ihr gehört, ihre Worte stehen im Raum. Noch immer schwimmt er nur im Dienst.
Auf dem Meer spuckt er in die Luft und liest dann aus dem Wind, wo er gerade ist. An Land fällt die Orientierung schwerer. Jeden Samstag radelt er zur Kirche, auch wenn die Glocken neuerdings vom Tonband läuten. Wegweisendes kommt von oben, von der Kanzel, vom Himmel. Bescheidenheit, Enthaltsamkeit - Himmelsrichtungen gibt es mehr als vier. Vielleicht hat er deshalb nie mit einer Frau geschlafen.
Vielleicht zwei Mal die Woche kommt der Anruf. Der Auftrag zum Lotsen. Er schläft im Wohnzimmer neben dem Telefon. Nie geht er aus. Kein Kino, kein Theater. Nicht auszudenken, was wäre, wenn das Telefon klingelt und er nicht da ist. Er isst Früchte, sonst nichts. Er trinkt nichts. Was in den Früchten ist, muss reichen. Er nimmt sie in den Mund, zerquetscht sie, spuckt sie wieder aus. Auf hoher See muss man genügsam sein. Der Notfall lauert. Er schwimmt ja nicht zum Vergnügen.

"Ein Fisch bist du, aber ein gebrechlicher. Du bist 76, du darfst nicht mehr schwimmen" Wollen ihm die Kapitäne das Leben verbieten? Einer hielt ihn, packte ihn am Arm. Das Meer war stärker. Er entwischte über die Reling. Nie drischt José auf das Wasser ein. Gäbe es einen Grund zu kämpfen? Er krault behutsam, den Kopf über Wasser, und schaut. Wo bricht die Welle, die ans Ufer trägt? Wo fließt die Strömung, die heimwärts zieht?
Die fünf Lotsen von Aracaju teilen sich Aufträge und Lohn. Umgerechnet 1300 Euro erhält jeder im Monat, sehr viel Geld in Brasilien. José will nur schwimmen, das Geld gibt er seinen Neffen oder dem Bettler Patrizio, der jeden Mittwoch an seiner Tür klopft. Die anderen Lotsen sind sauer auf den Fischmenschen, weil er sie nicht bei ihren Forderungen unterstützt. Er will keinen Sonntagszuschlag, keinen Feiertagszuschlag, kein Schlechtwettergeld. Der Auftrag allein ist ihm Bezahlung genug.
Die anderen nehmen das Lotsenboot. Manchmal, wenn es blitzt und donnert, drehen die Kutter bei, und die Fischer fragen, ob sie ihn mitnehmen können. "Wozu brauche ich ein Schiff, wenn ich doch schwimmen kann? "
Das waren auch die einzigen Worte, die er sprach, als man ihm den Prozess machte. Vor zehn Jahren kam der russische Frachter "Cheremkhovo"in die Gewässer von Aracaju. Der Kapitän hatte den seltsamen, 1,60 Meter kleinen Mann noch nie zuvor gesehen. Als sie das Delta hinter sich hatten, kletterte das Männchen auf die Reling der Kommandobrücke, und den Kapitän durchfuhr es, dass die Lotsenvereinigung ihm einen Irren geschickt hat. "Haltet ihn, ein Selbstmörder!" Der Kapitän ließ ein Boot zu Wasser und nach ihm suchen. Das kostete die Reederei viel Zeit und Geld. Man klagte auf Schadenersatz. Das Gericht sprach ihn frei. Er habe doch nur schwimmen wollen.
Von allen Lotsen kennt nur noch Zé Peixe die Tücken des Rio Sergipe. Vor ein paar Jahren ist ein größerer Hafen direkt an der Küste gebaut worden. Die meisten Schiffe müssen jetzt nicht mehr den Fluss hinauffahren, nach Aracaju. Auch die Boje gibt es nicht mehr. Wo sie einst stand, warten heute Lotsenboote. Schwimmen kann José nur noch, wenn er ein Schiff aus dem Delta führt. "Kein Kahn kommt ohne ihn rein oder raus", sagt ein Kapitän, "wenn er stirbt, dann stirbt auch die Schifffahrt auf dem Fluss"
Sein Rücken hat sich schon in Meer aufgelöst. Im Nacken kräuselt sich die Haut, auf den Schultern wirft sie Wellen. In Reihen gehen sie ab von jener Spur, die über jeden Rücken führt – als hätte ein Schiff der Wirbelsäule den Weg geebnet. Es sind Furchen und Falten vom Salz. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat er kein Bad mehr genommen.
Noch darf er nicht fortschwimmen. Neben dem Schlafzimmer von José kauert sein Bruder Antonio im Sessel, wirft den Kopf schweißnass hin und her. Er kam schon krank zur Welt. Blutschande. Josés Großmütter Malvina und Emilia waren Schwestern.
Im Kreis der Lieben hat die Liebe zu bleiben. Schiffen schaute José hinterher, Mädchen nicht. Mal war es der Bruder, mal die Mutter, die er abends nicht sich selbst überlassen mochte. So liegt er jede Nacht allein in seinem Bett und hört den Wellen zu. Er hatte zwei Träume. Jetzt gibt es keinen mehr. Der eine wurde sein Leben, der andere ist sein Tod. Eines Nachts, wenn die Wogen nicht schlafen und der Himmel vor lauter Tränen verschwimmt, werden ihm Kiemen und Fischschwanz wachsen. Die Wellen werden ihn mitnehmen, weit hinaus, und dort, wo früher einmal eine rote Boje war, werden sie ohne ihn weiterziehen.
.

FISCH MUSS SCHWIMMEN
Von Dimitri Ladischensky
José ist 76 Jahre alt und Lotse in Brasilien. Er führt Frachter hinaus aufs offene Meer. Nie würde er ein Boot zurück in den Hafen nehmen. Er krault lieber. Kilometerweit, stundenlang.
Er hatte zwei Träume. Den einen trugen ihm die Wellen zu, eines Nachts, als er wach dalag und die Wogen an die Mauer seines Hauses klatschten. Er öffnete die Luke über seinem Bett und schaute. Zuerst verschwamm der Himmel vor lauter Tränen. Dann tauchten Sterne auf, der Mond. Er träumte sich die Nacht hell wie den Tag und die See glatt wie einen Spiegel. Er sah Wolken darin schwimmen, klar und ruhig. Er träumte, dass ihm Kiemen und Fischschwanz wuchsen, träumte, wie die Wellen ihn mitnahmen, weit hinaus aufs Meer, bis sie schließlich über seinem Kopf zusammenschlugen und über ihn hinweggingen. Alles verstummte, nichts war mehr zu hören. Nicht die Worte der Mutter, nicht das Gelächter der anderen. Nur das Murmeln von Wasser. Er lauschte. Da hörte er seinen kranken Bruder rufen. Und damit war der Traum dann auch irgendwie immer zu Ende.
Diesen Traum behielt er ganz für sich, nur die Wellen wussten, dass er fortschwimmen will. Den anderen wollte niemand hören, die Mutter nicht, der Vater nicht. Dabei war es doch ein anständiger Traum. Ein guter Traum. Er sah ihn zuerst an der Wand der Stadtbehörde hängen: Ein Rauschebart, der Gott sein soll, wacht auf einem Segelschiff hinter dem Rücken des Steuermanns und greift ihm über die Schulter ins Ruder.
José Martins Ribeiro Nunes, geboren am 5. Januar 1927, fiel mit drei Jahren in den Fluss vor seiner Haustüre. Der Rio Sergipe trägt Baumstämme fort wie Zündhölzchen, ein mächtiger Fluss. José ertrank nicht, obwohl es ihm damals schon verboten war, Fisch zu sein. Seine Mutter Vectúria Martins war Lehrerin für Mathematik, sein Vater Nicanor Ribeiro Nunes Justizbeamter und beiden das Meer nicht geheuer. Sie lebten mit ihren fünf Kindern in Aracaju, nördlich von Salvador, an der Mündung des Rio Sergipe in den Atlantik. Die Avenida Ivo do Prado liegt am Ufersaum. Bei Sturmflut schlug das Wasser an die Hauswände.
Keiner verstand, wieso er schwamm. Fische schwimmen, sagten seine Eltern. In Brasilien stellen die Menschen Tische und Stühle ins Meer, plaudern stundenlang, die Füße im Wasser. Aber schwimmen? "Für einen Fisch hast du viel zu lange Wimpern", sagten seine Eltern. José ließ die Wellen über seinen Kopf hinweggehen, wenn er nichts hören wollte. Die anderen Jungen nahmen das Kanu zur Praia de Atalaia, er schwamm. Wenn seine Eltern zürnten, weil er nicht aus dem Wasser wollte, bat er, dem Nachbarn helfen zu dürfen, der seinen Schlüssel im Fluss verloren hatte, oder dem Fischer das Netz zu holen, das draußen trieb. Wollte ihm aber auch gar nichts einfallen, dann blieb ihm nur, am Strand den Schiffen hinterher zu schauen.
Ein Strich zum Horizont, von dem Wellen abzweigen. Wenn er allein gewesen wäre, ja, dann wäre er vielleicht aufs Meer geschwommen, weit hinaus. José, der Fisch. Und hätte selbst Spuren gezogen. So aber musste er zurück. Zu seinen Eltern, die meinten, Vergnügen sei Sünde. Und Schwimmen zweifelhaft genug, sonst wäre Jesus nicht über das Wasser gegangen. Was aber, dachte sich José, was aber ist, wenn man nun Menschen zu Hilfe schwimmt?

Gemeinsam mit seiner Schwester hüpfte er von einem Trampolin in den Fluss. José sagte Rita nicht, dass er deshalb mit ihr schwamm, weil man sich abends die Schelte teilen konnte. Als sich die Stadt über ihre achtjährige Tochter empörte, dass sie die Unverfrorenheit besäße, nicht nur als einzige Frau von Aracaju schwimmen zu gehen, sondern auch noch im Badeanzug die Promenade zu betreten, nahmen ihr der Vater und die Mutter die Schwimmsachen weg. Fortan schwamm Rita in ihrer Schuluniform und trocknete die Kleider heimlich hinter dem Haus.
Glücklich war José, als die Leute ihn zum ersten Mal Zé Peixe, Fisch- Josef riefen. Jetzt konnten sie kommen, die Eltern. Was brauchte er noch Badehosen? Fische tragen eh keine. Und außerdem: Er schwamm doch nur im Dienst. Das Bild in der Behörde vom Lotsengott. Er sah es tags, er träumte es nachts. Er fuhr mit den Schiffen hinaus, zeigte den Kapitänen, wo die Strömung am tückischsten war, und dann, auf hoher See, sprang er von Bord und kraulte zurück.
Die Leute der Stadt lobten sein vorbildliches Verhalten, der Pastor sprach am Samstag von einem Mitbürger, der für andere einsteht. Das war und war doch nicht, was seine Eltern hören wollten. "Hausaufgaben soll er machen", sagte die Mutter. Aber wann immer sie ihm über die Schulter schaute, sah sie ihn Schiffe malen. "Studieren soll er", sagte sein Vater. Aber wann immer er ein Machtwort sprach, dachte José an den, der alle Macht der Welt, des Himmels und der Meere hat. Er dachte an den Allmächtigen, wie er hinter dem Vater steht und ihm ins Ruder greift.
1947, als er 20 Jahre alt war, ließ sein Vater ihn ziehen, und so wurde er Lotse. Die Mündung des Rio Sergipe ist gefährlich, die Flut drängt hinein, der Fluss hinaus. Wo sie im Widerstreit liegen, werfen sich Wellen auf, viele Meter hoch. Schiffe kentern, andere laufen auf Grund. Nur einer wusste, wohin die Dünen über Nacht wanderten. Geleitete Zé Peixe die Schiffe aufs offene Meer, sprang er von Bord und schwamm den Weg zurück. Zwölf Kilometer waren es von der großen roten Boje, dort verließ der Lotse das Schiff. Manchmal dauerte es sechs Stunden oder länger, bis er die Praia de Atalaia erreichte. War ein Schiff in Empfang zu nehmen, schwamm er hinaus, kettete sich an die Boje, harrte bei Sturm, bei Nacht, verfluchte das Schiff, das sich verspätete, und wartete.

Am Tag, als seine Frau starb, trugen ihn die Wellen hinaus zur Boje und er tanzte mit ihr. Dann schwamm er zurück und wachte am Bett der Toten. Es war die erste gemeinsame Nacht, seit er sie vor 25 Jahren geheiratet hatte. Maria Augusta Oliviera Nunes starb als Jungfrau.
Sie war Angestellte bei der Post und ihm am Strand begegnet. Er brachte ihr Schwimmen bei, nahm sie auf die Schultern und die Angst vor dem Wasser. Sie liebte ihn, er wollte ihr einen Gefallen tun. Also heirateten sie. Nach der Trauung zog er seinen schwarzen Anzug aus, gab die Schuhe zurück, die er sich geliehen hatte, und schwamm zu den Schiffen aufs Meer. Sie wartete vergeblich auf ihn. Sie wartete all die Nächte all die Jahre. Er baute ihr ein Haus, fuhr jeden Tag mit dem Rad bei ihr vorbei. Aber über Nacht blieb er nie. Die Leute in Aracaju erzählen sich, dass sie einmal Fenster und Türen versperrte; da entkam er durch den Kamin.
Sie feierten noch silberne Hochzeit, dann wurde sie auf einmal sehr krank. Geblieben ist nur ihr Bild in der Schrankvitrine. Alle sind sie tot, seine Mutter, sein Vater, die meisten der Geschwister. Auf einem Grabstein des Cemitério São Benedito steht geschrieben: "Du besitzt nur das, was du mitnimmst, wenn du gehst von dieser Welt" Mutter ist gegangen und hat einfach dagelassen, was ihr gehört, ihre Worte stehen im Raum. Noch immer schwimmt er nur im Dienst.
Auf dem Meer spuckt er in die Luft und liest dann aus dem Wind, wo er gerade ist. An Land fällt die Orientierung schwerer. Jeden Samstag radelt er zur Kirche, auch wenn die Glocken neuerdings vom Tonband läuten. Wegweisendes kommt von oben, von der Kanzel, vom Himmel. Bescheidenheit, Enthaltsamkeit - Himmelsrichtungen gibt es mehr als vier. Vielleicht hat er deshalb nie mit einer Frau geschlafen.
Vielleicht zwei Mal die Woche kommt der Anruf. Der Auftrag zum Lotsen. Er schläft im Wohnzimmer neben dem Telefon. Nie geht er aus. Kein Kino, kein Theater. Nicht auszudenken, was wäre, wenn das Telefon klingelt und er nicht da ist. Er isst Früchte, sonst nichts. Er trinkt nichts. Was in den Früchten ist, muss reichen. Er nimmt sie in den Mund, zerquetscht sie, spuckt sie wieder aus. Auf hoher See muss man genügsam sein. Der Notfall lauert. Er schwimmt ja nicht zum Vergnügen.

"Ein Fisch bist du, aber ein gebrechlicher. Du bist 76, du darfst nicht mehr schwimmen" Wollen ihm die Kapitäne das Leben verbieten? Einer hielt ihn, packte ihn am Arm. Das Meer war stärker. Er entwischte über die Reling. Nie drischt José auf das Wasser ein. Gäbe es einen Grund zu kämpfen? Er krault behutsam, den Kopf über Wasser, und schaut. Wo bricht die Welle, die ans Ufer trägt? Wo fließt die Strömung, die heimwärts zieht?
Die fünf Lotsen von Aracaju teilen sich Aufträge und Lohn. Umgerechnet 1300 Euro erhält jeder im Monat, sehr viel Geld in Brasilien. José will nur schwimmen, das Geld gibt er seinen Neffen oder dem Bettler Patrizio, der jeden Mittwoch an seiner Tür klopft. Die anderen Lotsen sind sauer auf den Fischmenschen, weil er sie nicht bei ihren Forderungen unterstützt. Er will keinen Sonntagszuschlag, keinen Feiertagszuschlag, kein Schlechtwettergeld. Der Auftrag allein ist ihm Bezahlung genug.
Die anderen nehmen das Lotsenboot. Manchmal, wenn es blitzt und donnert, drehen die Kutter bei, und die Fischer fragen, ob sie ihn mitnehmen können. "Wozu brauche ich ein Schiff, wenn ich doch schwimmen kann? "
Das waren auch die einzigen Worte, die er sprach, als man ihm den Prozess machte. Vor zehn Jahren kam der russische Frachter "Cheremkhovo"in die Gewässer von Aracaju. Der Kapitän hatte den seltsamen, 1,60 Meter kleinen Mann noch nie zuvor gesehen. Als sie das Delta hinter sich hatten, kletterte das Männchen auf die Reling der Kommandobrücke, und den Kapitän durchfuhr es, dass die Lotsenvereinigung ihm einen Irren geschickt hat. "Haltet ihn, ein Selbstmörder!" Der Kapitän ließ ein Boot zu Wasser und nach ihm suchen. Das kostete die Reederei viel Zeit und Geld. Man klagte auf Schadenersatz. Das Gericht sprach ihn frei. Er habe doch nur schwimmen wollen.
Von allen Lotsen kennt nur noch Zé Peixe die Tücken des Rio Sergipe. Vor ein paar Jahren ist ein größerer Hafen direkt an der Küste gebaut worden. Die meisten Schiffe müssen jetzt nicht mehr den Fluss hinauffahren, nach Aracaju. Auch die Boje gibt es nicht mehr. Wo sie einst stand, warten heute Lotsenboote. Schwimmen kann José nur noch, wenn er ein Schiff aus dem Delta führt. "Kein Kahn kommt ohne ihn rein oder raus", sagt ein Kapitän, "wenn er stirbt, dann stirbt auch die Schifffahrt auf dem Fluss"
Sein Rücken hat sich schon in Meer aufgelöst. Im Nacken kräuselt sich die Haut, auf den Schultern wirft sie Wellen. In Reihen gehen sie ab von jener Spur, die über jeden Rücken führt – als hätte ein Schiff der Wirbelsäule den Weg geebnet. Es sind Furchen und Falten vom Salz. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat er kein Bad mehr genommen.
Noch darf er nicht fortschwimmen. Neben dem Schlafzimmer von José kauert sein Bruder Antonio im Sessel, wirft den Kopf schweißnass hin und her. Er kam schon krank zur Welt. Blutschande. Josés Großmütter Malvina und Emilia waren Schwestern.
Im Kreis der Lieben hat die Liebe zu bleiben. Schiffen schaute José hinterher, Mädchen nicht. Mal war es der Bruder, mal die Mutter, die er abends nicht sich selbst überlassen mochte. So liegt er jede Nacht allein in seinem Bett und hört den Wellen zu. Er hatte zwei Träume. Jetzt gibt es keinen mehr. Der eine wurde sein Leben, der andere ist sein Tod. Eines Nachts, wenn die Wogen nicht schlafen und der Himmel vor lauter Tränen verschwimmt, werden ihm Kiemen und Fischschwanz wachsen. Die Wellen werden ihn mitnehmen, weit hinaus, und dort, wo früher einmal eine rote Boje war, werden sie ohne ihn weiterziehen.
.
.
UBS ups 2003/05 gold price forecasts on weak dollar
UBS Investment Bank said on Monday it had upgraded its gold price forecasts for the next three years due to expectations of further dollar weakness.
In a daily report it said the new average forecast for gold in 2003 had been increased by two percent to $358 a troy ounce.
"It is important to note that our positive outlook on gold is based only on our forecast that the dollar will continue to weaken," the report said.
The 2004 forecast rose 5.4 percent to $375 an ounce from a previous $356, while 2005 average prices were increased by 3.8 percent to $380 an ounce. (…)
(…)
Reuters - 23.06.2003
---
Australian Gold Output To Edge Up In 03-04,Surge In 04-05
DJ Australian Gold Output To Edge Up In 03-04,Surge In 04-05
Australian gold output will edge a little higher to 271 metric tons next fiscal year, then jump to 304 tons in fiscal 2004-05, and 313 tons in fiscal 2005-06, the government`s Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics forecast Monday.
Mine output this fiscal year ended June 30, 2003, is projected at 269 tons, up from an actual 265 tons in fiscal 2001-02, it said. Australia is the world`s third largest producer of gold. Production from Newcrest Mining Ltd.`s new Telfer mine alone will boost national gold output by 24 tons a year from fiscal 2004-05, Abare said.
Total exports of gold from Australia are forecast at 323 tons next fiscal year valued at A$5.66 billion compared with estimated exports this fiscal year of 284 tons valued at A$5.26 billion, Abare said. Exports exceed local production because gold from Southeast Asia, Pacific nations and elsewhere is imported into Australia for refining and re-export. Meanwhile,
Abare forecast the world spot price of gold will average US$353 an ounce in calendar 2003 before declining to average US$335/oz in 2004.
Gold averaged US$310/oz in 2002, it said. Broadly, Abare believes current global economic uncertainty is supporting gold,
but it expects the world economy to improve significantly in or by 2004 ,
,
moderating demand for gold as a safe-haven asset. An improvement in the global economy will unwind recent support for gold from a relatively weak U.S. dollar, it said.
The expected stronger economic growth and higher interest rates also will reduce the incentive for producers to unwind hedge positions and increase the incentive to hedge production, it said.
As economic growth picks up, so will demand for gold for jewelry, it said.
Dow Jones Newswires – 23.06.2003
UBS ups 2003/05 gold price forecasts on weak dollar
UBS Investment Bank said on Monday it had upgraded its gold price forecasts for the next three years due to expectations of further dollar weakness.
In a daily report it said the new average forecast for gold in 2003 had been increased by two percent to $358 a troy ounce.
"It is important to note that our positive outlook on gold is based only on our forecast that the dollar will continue to weaken," the report said.
The 2004 forecast rose 5.4 percent to $375 an ounce from a previous $356, while 2005 average prices were increased by 3.8 percent to $380 an ounce.
 (…)
(…)Reuters - 23.06.2003
---
Australian Gold Output To Edge Up In 03-04,Surge In 04-05

DJ Australian Gold Output To Edge Up In 03-04,Surge In 04-05
Australian gold output will edge a little higher to 271 metric tons next fiscal year, then jump to 304 tons in fiscal 2004-05, and 313 tons in fiscal 2005-06, the government`s Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics forecast Monday.
Mine output this fiscal year ended June 30, 2003, is projected at 269 tons, up from an actual 265 tons in fiscal 2001-02, it said. Australia is the world`s third largest producer of gold. Production from Newcrest Mining Ltd.`s new Telfer mine alone will boost national gold output by 24 tons a year from fiscal 2004-05, Abare said.
Total exports of gold from Australia are forecast at 323 tons next fiscal year valued at A$5.66 billion compared with estimated exports this fiscal year of 284 tons valued at A$5.26 billion, Abare said. Exports exceed local production because gold from Southeast Asia, Pacific nations and elsewhere is imported into Australia for refining and re-export. Meanwhile,
Abare forecast the world spot price of gold will average US$353 an ounce in calendar 2003 before declining to average US$335/oz in 2004.

Gold averaged US$310/oz in 2002, it said. Broadly, Abare believes current global economic uncertainty is supporting gold,
but it expects the world economy to improve significantly in or by 2004
 ,
,moderating demand for gold as a safe-haven asset. An improvement in the global economy will unwind recent support for gold from a relatively weak U.S. dollar, it said.
The expected stronger economic growth and higher interest rates also will reduce the incentive for producers to unwind hedge positions and increase the incentive to hedge production, it said.

As economic growth picks up, so will demand for gold for jewelry, it said.
Dow Jones Newswires – 23.06.2003
aktueller CBS-MarketWatch Kommentar:
http://cbs.marketwatch.com/news/story.asp?guid=%7B60E2E918%2…
http://cbs.marketwatch.com/news/story.asp?guid=%7B60E2E918%2…
.
Bernd Niquet´s heutiger Marktkommentar -
1929-1933: Das Ende der Parallelen ist erreicht !
Was in den vergangenen Jahren finanziell hinter uns liegt, findet in der jüngeren Geschichte eigentlich nur eine einzige Parallele, nämlich in etwa in der Zeit zwischen 1925 und 1935 (und 1929 bis 1933 im engeren Sinne). Nach einer großen Inflation/inflationären Phase gab es dort wie vor kurzem auch bei uns eine extreme Wirtschaftsblüte. Sinkende Zinsen aufgrund eines Abbaus der Inflationserwartungen wurden begleitet von stark steigenden Aktienkursen. Dabei erzielten die breiten Indices Kursgewinne von etwa 250 Prozent binnen weniger Jahre. Dann jedoch kam der plötzliche Absturz der Aktienkurse um etwa zwei Drittel und ein Umschwenken der Wirtschaft hinsichtlich von Stagnation in Verbindung mit ersten deflationären Anzeichen.
Hier jedoch endet die Parallele mit der Entwicklung der Jahre 1925 bis 1935 glücklicherweise. Denn damals stürzte die Wirtschaft in eine deflationäre Abwärtsspirale mit extrem fallenden Preisen und sprunghaft steigenden Zinsen, die jegliche Vermögenswerte außer Bargeld in heute beinahe unvorstellbarer Weise entwertete. Doch genau das wird es heute nicht geben. Wir werden keine Deflation bekommen.
Aus meiner Sicht wird es zwar noch einen kleineren Crash am Rentenmarkt geben, um die enorm hohen Erwartungen wieder abzubauen, doch ansonsten werden wir uns in den nächsten Jahren mit manchmal ansteigenden und manchmal wieder fallenden Aktienkursen, Güterpreisen und Zinsen so durchwursteln – ohne dass etwa sehr Spektakuläres passieren wird. Exogene Schocks kann es natürlich immer geben, so etwas ist niemals vorherzusehen, doch von innen heraus wird das Wirtschafts- und Finanzsystem nicht zum Kollaps neigen.
Woher kommt meine Zuversicht? Weil es die Mechanismen, die das System damals kaputt gemacht haben, heute nicht mehr existieren. Eine sehr anschauliche Schilderung der Situation in den 30er Jahren habe ich kürzlich in J. Irving Weiss´ Schilderungen über den Börsencrash 1929 und seine Folgen gefunden (Quelle: Weiss, M. Verdoppeln Sie ihr Vermögen in der Geldpanik 2003!, Bonn 2002/2003, ISBN 3-932017-15-3, historisch interessant, taugt jedoch nicht als Ratgeber und liegt mit 49,80 Euro jenseits jeglicher Schmerzgrenze.)
Weiss schreibt: "Wie erwartet waren die Zinssätze während des Crashs am Aktienmarkt stark gefallen. Dann passierte etwas absolut Überraschendes. Obwohl wir uns noch mitten in einer Deflation befanden und die wirtschaftliche Entwicklung immer noch auf Talfahrt war, zogen die Zinssätze dramatisch an. Der unmittelbare Grund hierfür: Die Anleihemärkte brachen zusammen."
Und warum brachen die Anleihemärkte zusammen? Weil jeder, Banken, Versicherungen, ja die ganze Wirtschaft Bargeld brauchte. Weiss schildert das sehr anschaulich an folgendem Dialog:
"Was ist das?" fragten die Unternehmenschefs ihre Finanzabteilungen.
"Das sind Anleihen", lautete die Antwort. "Anleihen sind solide Investitionen – nicht wie Aktien."
"Können Sie die verkaufen?"
"Sicherlich können wir das. Aber Anleihen sind vor allem für schlechte Zeiten gut. Sie sollten sie jetzt nicht verkaufen, weil ..."
"Ist mir völlig egal, ob sie gut, schlecht oder mittelmäßig sind. Verkaufen Sie sie. Holen Sie Bargeld rein!"
"Ich fragte einige meiner Geschäftsklienten", so Weiss weiter, " warum sie Anleihen verkaufen wollten. Sie redeten daraufhin über eine "zurückkehrende Inflation", über die Gefahr einer "Reflation", wie sie es nannten. Später erkannte ich, dass die Inflation bloß eine Entschuldigung war. Der wirkliche Grund, warum sie Anleihen verkauften, war, dass sie schlicht und einfach Bargeld brauchten."
Hier sieht man also sehr deutlich, warum sich das damalige Szenario heute nicht wiederholen wird:
Damals mussten Vermögenswerte verkauft werden, um Bargeld zu beschaffen. Bargeld war so knapp, dass es (gemessen an den Preisen für Güter, die man dafür kaufen konnte) ständig an Wert zunahm. Heute hingegen müssen Banken keine Vermögenswerte verkaufen, um sich Bargeld zu beschaffen, sondern sie können sie gegen 2 Prozent Zins bei der EZB in Pension geben, und erhalten dafür Bargeld.
Bargeld ist dadurch kein derart knappes Gut, dass es zu immer weiter steigenden Preisen und Zinsen (=weiter fallenden Güterpreisen) gesucht wird, sondern es ist aufgrund einer weitsichtigen Zentralbankpolitik überall in genügendem Maße vorhanden.
Aus diesem Grund wird es folglich kein Abkippen in die Deflation geben, wo alle Preise in den Keller rauschen, die Zinsen sprunghaft in die Höhe schnellen und nur die Bargeldhaltung einen Gewinn erbringt.
Bernd Niquet - 25.06.2003
Bernd Niquet´s heutiger Marktkommentar -

1929-1933: Das Ende der Parallelen ist erreicht !
Was in den vergangenen Jahren finanziell hinter uns liegt, findet in der jüngeren Geschichte eigentlich nur eine einzige Parallele, nämlich in etwa in der Zeit zwischen 1925 und 1935 (und 1929 bis 1933 im engeren Sinne). Nach einer großen Inflation/inflationären Phase gab es dort wie vor kurzem auch bei uns eine extreme Wirtschaftsblüte. Sinkende Zinsen aufgrund eines Abbaus der Inflationserwartungen wurden begleitet von stark steigenden Aktienkursen. Dabei erzielten die breiten Indices Kursgewinne von etwa 250 Prozent binnen weniger Jahre. Dann jedoch kam der plötzliche Absturz der Aktienkurse um etwa zwei Drittel und ein Umschwenken der Wirtschaft hinsichtlich von Stagnation in Verbindung mit ersten deflationären Anzeichen.
Hier jedoch endet die Parallele mit der Entwicklung der Jahre 1925 bis 1935 glücklicherweise. Denn damals stürzte die Wirtschaft in eine deflationäre Abwärtsspirale mit extrem fallenden Preisen und sprunghaft steigenden Zinsen, die jegliche Vermögenswerte außer Bargeld in heute beinahe unvorstellbarer Weise entwertete. Doch genau das wird es heute nicht geben. Wir werden keine Deflation bekommen.
Aus meiner Sicht wird es zwar noch einen kleineren Crash am Rentenmarkt geben, um die enorm hohen Erwartungen wieder abzubauen, doch ansonsten werden wir uns in den nächsten Jahren mit manchmal ansteigenden und manchmal wieder fallenden Aktienkursen, Güterpreisen und Zinsen so durchwursteln – ohne dass etwa sehr Spektakuläres passieren wird. Exogene Schocks kann es natürlich immer geben, so etwas ist niemals vorherzusehen, doch von innen heraus wird das Wirtschafts- und Finanzsystem nicht zum Kollaps neigen.
Woher kommt meine Zuversicht? Weil es die Mechanismen, die das System damals kaputt gemacht haben, heute nicht mehr existieren. Eine sehr anschauliche Schilderung der Situation in den 30er Jahren habe ich kürzlich in J. Irving Weiss´ Schilderungen über den Börsencrash 1929 und seine Folgen gefunden (Quelle: Weiss, M. Verdoppeln Sie ihr Vermögen in der Geldpanik 2003!, Bonn 2002/2003, ISBN 3-932017-15-3, historisch interessant, taugt jedoch nicht als Ratgeber und liegt mit 49,80 Euro jenseits jeglicher Schmerzgrenze.)
Weiss schreibt: "Wie erwartet waren die Zinssätze während des Crashs am Aktienmarkt stark gefallen. Dann passierte etwas absolut Überraschendes. Obwohl wir uns noch mitten in einer Deflation befanden und die wirtschaftliche Entwicklung immer noch auf Talfahrt war, zogen die Zinssätze dramatisch an. Der unmittelbare Grund hierfür: Die Anleihemärkte brachen zusammen."
Und warum brachen die Anleihemärkte zusammen? Weil jeder, Banken, Versicherungen, ja die ganze Wirtschaft Bargeld brauchte. Weiss schildert das sehr anschaulich an folgendem Dialog:
"Was ist das?" fragten die Unternehmenschefs ihre Finanzabteilungen.
"Das sind Anleihen", lautete die Antwort. "Anleihen sind solide Investitionen – nicht wie Aktien."
"Können Sie die verkaufen?"
"Sicherlich können wir das. Aber Anleihen sind vor allem für schlechte Zeiten gut. Sie sollten sie jetzt nicht verkaufen, weil ..."
"Ist mir völlig egal, ob sie gut, schlecht oder mittelmäßig sind. Verkaufen Sie sie. Holen Sie Bargeld rein!"
"Ich fragte einige meiner Geschäftsklienten", so Weiss weiter, " warum sie Anleihen verkaufen wollten. Sie redeten daraufhin über eine "zurückkehrende Inflation", über die Gefahr einer "Reflation", wie sie es nannten. Später erkannte ich, dass die Inflation bloß eine Entschuldigung war. Der wirkliche Grund, warum sie Anleihen verkauften, war, dass sie schlicht und einfach Bargeld brauchten."
Hier sieht man also sehr deutlich, warum sich das damalige Szenario heute nicht wiederholen wird:
Damals mussten Vermögenswerte verkauft werden, um Bargeld zu beschaffen. Bargeld war so knapp, dass es (gemessen an den Preisen für Güter, die man dafür kaufen konnte) ständig an Wert zunahm. Heute hingegen müssen Banken keine Vermögenswerte verkaufen, um sich Bargeld zu beschaffen, sondern sie können sie gegen 2 Prozent Zins bei der EZB in Pension geben, und erhalten dafür Bargeld.
Bargeld ist dadurch kein derart knappes Gut, dass es zu immer weiter steigenden Preisen und Zinsen (=weiter fallenden Güterpreisen) gesucht wird, sondern es ist aufgrund einer weitsichtigen Zentralbankpolitik überall in genügendem Maße vorhanden.
Aus diesem Grund wird es folglich kein Abkippen in die Deflation geben, wo alle Preise in den Keller rauschen, die Zinsen sprunghaft in die Höhe schnellen und nur die Bargeldhaltung einen Gewinn erbringt.
Bernd Niquet - 25.06.2003
Dann ist ja alles prima - also weiter, schneller, höher - unbegrenztes Wachstum. Der Crash kommt schon allen deshalb, weil es keine "artgerechte Menschenhaltug" mehr gibt. Als ob die Grenzen der Belastbarkeit von Verschuldung, Ökologie und "mesnchlichem Maß" von der Geldmenge abhingen!
# 462 Fachidiotie!
# 462 Fachidiotie!
Den gleichen Artikel hat er vor einiger Zeit schon mal veröffentlicht.
Dem fällt auch nichts Neues mehr ein.
CU Jodie

Dem fällt auch nichts Neues mehr ein.
CU Jodie
@ stormwatch
Der Crash kommt schon allein deshalb, weil es keine "artgerechte Menschenhaltug" mehr gibt
tja, das mag schon richtig sein, und so gesehen ist das "Deflationsproblem" sicher auch nur nur eine Fußnote in der Wirtschaftsgeschichte.
Wir sitzen aber nun mal auf dieser verdammten "Titanic", und zum Abbremsen bzw. Ändern der Fahrtrichtung braucht dies schwergewichtige Schiff Jahrzehnte. Der Eisberg ist in Sicht, das ist richtig, aber es macht wenig Sinn ins Wasser springen, bevor es kracht.
- Oder mit Hoimar von Dithfurt: "So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit".
Gruß Konradi
Der Crash kommt schon allein deshalb, weil es keine "artgerechte Menschenhaltug" mehr gibt
tja, das mag schon richtig sein, und so gesehen ist das "Deflationsproblem" sicher auch nur nur eine Fußnote in der Wirtschaftsgeschichte.
Wir sitzen aber nun mal auf dieser verdammten "Titanic", und zum Abbremsen bzw. Ändern der Fahrtrichtung braucht dies schwergewichtige Schiff Jahrzehnte. Der Eisberg ist in Sicht, das ist richtig, aber es macht wenig Sinn ins Wasser springen, bevor es kracht.
- Oder mit Hoimar von Dithfurt: "So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit".
Gruß Konradi
.
Fed rate cut may be good for gold
The Federal Reserve`s decision Wednesday to cut overnight interest rates to their lowest level in 45 years had little effect on major metals and mining shares, but it may have a positive long-term impact on gold prices, analysts said. (…)
Gold futures fell in after-hours trading, after ending the regular session on the New York Mercantile Exchange up nearly $3 an ounce before the Federal Reserve`s announcement.
Investors will be buying gold in the longer term on "prospects that the Fed will succeed in fighting deflation by helping to create inflation, and that is the catalyst which is bullish for gold," said John Person, head financial analyst at Infinity Brokerage Services.
Todd Hultman, president of Dailyfutures.com, a commodity information provider, said that for gold, "the lower the interest rates, the better."
Traders didn`t get the half-point cut many wanted, but "until the economy can show better strength, gold prices should continue to do well and easily be able to maintain their uptrend," he said. (…)
Gold futures fell fractionally in after-hours trading, but remained near $348 an ounce as the dollar regained some lost ground against the yen. In Wednesday`s foreign-exchange trading, the dollar rose against the yen, but fell against the euro and Canadian dollar. Foreign traders pay close attention to fluctuations in the greenback since they must swap out of their local currencies to buy dollar-denominated gold on U.S. markets. Often, gold is also seen as a currency itself. (…)
The rate cut will likely be factored into the gold market soon after the start of Thursday`s regular session, said Erik Gebhard, president of Altavest Worldwide Trading. The cut was within expectations. (…)
CBS Marketwatch – 25.03.2003
Central Bank Buying Helps Lift Gold In Asia
Gold buying by a central bank has helped support gold in Asian trading Wednesday and for the past several trading days into last week, according to a Sydney-based trader. (…)
A trader said he also has seen a lot of Japanese buying, without speculating a reason for the Japanese interest. "The interest over the past few sessions has been on (the Tokyo Commodity Exchange)," the trader told Dow Jones Newswires. "That also has been compounded by central bank buying, which we`ve been seeing," he added. "I don`t think the movements we`ve seen in gold in this time zone have too much to do with the U.S. (dollar)."
The trader refused to identify the central bank he said has been buying gold.
Demand from this source has certainly been sufficient to steady spot gold after the overnight fall and push prices up a little Wednesday, he said.
"It`s been a feature of this week and also of last week," he said, noting a recent pattern of modest price gains in Asian trading in recent sessions. (…)
CBS Marketwatch - 24.06.2003
INDIA - Mutual Funds, banks plan gold-backed schemes
Two large mutual funds are approaching the Securities and Exchange Board of India (Sebi) and the Forward Markets Commission to come out with gold-backed exchange-traded funds, reports The Economic Times. Depending on the nature of the fund, the retail investor will get assayed gold on redemption or an amount which is closely linked to the prevailing price of gold, if he sells it in the market.
Apparently, the fund managers and bankers are playing on the Indian investors` craving for gold which is a comparatively less price volatile commodity. They want to cash in on the average Indian`s urge to buy gold, either as a wedding gift or a buffer in difficult times.
A large bank has sought the Reserve Bank of India`s approval to float what it calls a `gold recurring deposit scheme`. Under this scheme, the retail investor will deposit a fixed amount like any other recurring scheme. The difference is, the amount will be used by the bank to buy gold for him at the price prevailing on the day he deposits the money. Over the term of the deposit, he pays an average price which is derived from the price he locks in with the bank every month.
Sources said the banks are in touch with the National Commodities & Derivatives Exchange (NCDEX), which is awaiting the FMC`s permission to allow futures in nine commodities, including gold. `Banks naturally will not keep idle the gold they buy. They can lend it in the wholesale market, and get a return. They can also directly enter the futures market with no underlying spot positions,` said a banker.
www.myiris.com - 24.06.2003
Fed rate cut may be good for gold
The Federal Reserve`s decision Wednesday to cut overnight interest rates to their lowest level in 45 years had little effect on major metals and mining shares, but it may have a positive long-term impact on gold prices, analysts said. (…)
Gold futures fell in after-hours trading, after ending the regular session on the New York Mercantile Exchange up nearly $3 an ounce before the Federal Reserve`s announcement.
Investors will be buying gold in the longer term on "prospects that the Fed will succeed in fighting deflation by helping to create inflation, and that is the catalyst which is bullish for gold," said John Person, head financial analyst at Infinity Brokerage Services.
Todd Hultman, president of Dailyfutures.com, a commodity information provider, said that for gold, "the lower the interest rates, the better."
Traders didn`t get the half-point cut many wanted, but "until the economy can show better strength, gold prices should continue to do well and easily be able to maintain their uptrend," he said. (…)
Gold futures fell fractionally in after-hours trading, but remained near $348 an ounce as the dollar regained some lost ground against the yen. In Wednesday`s foreign-exchange trading, the dollar rose against the yen, but fell against the euro and Canadian dollar. Foreign traders pay close attention to fluctuations in the greenback since they must swap out of their local currencies to buy dollar-denominated gold on U.S. markets. Often, gold is also seen as a currency itself. (…)
The rate cut will likely be factored into the gold market soon after the start of Thursday`s regular session, said Erik Gebhard, president of Altavest Worldwide Trading. The cut was within expectations. (…)
CBS Marketwatch – 25.03.2003
Central Bank Buying Helps Lift Gold In Asia
Gold buying by a central bank has helped support gold in Asian trading Wednesday and for the past several trading days into last week, according to a Sydney-based trader. (…)
A trader said he also has seen a lot of Japanese buying, without speculating a reason for the Japanese interest. "The interest over the past few sessions has been on (the Tokyo Commodity Exchange)," the trader told Dow Jones Newswires. "That also has been compounded by central bank buying, which we`ve been seeing," he added. "I don`t think the movements we`ve seen in gold in this time zone have too much to do with the U.S. (dollar)."
The trader refused to identify the central bank he said has been buying gold.
Demand from this source has certainly been sufficient to steady spot gold after the overnight fall and push prices up a little Wednesday, he said.
"It`s been a feature of this week and also of last week," he said, noting a recent pattern of modest price gains in Asian trading in recent sessions. (…)
CBS Marketwatch - 24.06.2003
INDIA - Mutual Funds, banks plan gold-backed schemes
Two large mutual funds are approaching the Securities and Exchange Board of India (Sebi) and the Forward Markets Commission to come out with gold-backed exchange-traded funds, reports The Economic Times. Depending on the nature of the fund, the retail investor will get assayed gold on redemption or an amount which is closely linked to the prevailing price of gold, if he sells it in the market.
Apparently, the fund managers and bankers are playing on the Indian investors` craving for gold which is a comparatively less price volatile commodity. They want to cash in on the average Indian`s urge to buy gold, either as a wedding gift or a buffer in difficult times.
A large bank has sought the Reserve Bank of India`s approval to float what it calls a `gold recurring deposit scheme`. Under this scheme, the retail investor will deposit a fixed amount like any other recurring scheme. The difference is, the amount will be used by the bank to buy gold for him at the price prevailing on the day he deposits the money. Over the term of the deposit, he pays an average price which is derived from the price he locks in with the bank every month.
Sources said the banks are in touch with the National Commodities & Derivatives Exchange (NCDEX), which is awaiting the FMC`s permission to allow futures in nine commodities, including gold. `Banks naturally will not keep idle the gold they buy. They can lend it in the wholesale market, and get a return. They can also directly enter the futures market with no underlying spot positions,` said a banker.
www.myiris.com - 24.06.2003
.
Wirklich schon zurück?
Der Eindruck von der Wiederkehr des Bullen täuscht. Für eine anhaltende Hausse am Aktienmarkt ist es viel zu früh
Von Robert von Heusinger
Finger weg von Aktien. Oder etwas technischer ausgedrückt: „Aktienquote auf null reduzieren!“ Diese Warnung signalisiert seit zwei Wochen das „Gefühlsbarometer“ der schnieken Kölner Privatbank Sal. Oppenheim. Warum? Weil zurzeit alle Börsianer optimistisch sind, zu optimistisch. Sie träumen vom Bullenmarkt mit steigenden Kursen. Das Gefühlsbarometer misst anhand verschiedener Indikatoren die Stimmung der Investoren an den weltweiten Aktienmärkten. Als Daumenregel gilt: Je ausgeprägter der Pessimismus, desto besser entwickeln sich kurzfristig die Kurse an der Börse und umgekehrt. Auch die wöchentliche Auswertung von 130 amerikanischen Börsenbriefen durch Investors’ Intelligence verheißt nichts Gutes: Nur 16,1Prozent der Artikel warnen vor fallenden Kursen. Einen so niedrigen Stand haben die Analysten von Sal. Oppenheim noch nie notiert – immerhin erfassen sie die Quoten seit Juni 1989.
Das ist wenig erstaunlich. Schließlich kennen Dax, Dow Jones und EuroStoxx seit 15Wochen nur eine Richtung: nach oben. Es ist der dritte und kräftigste Versuch, den seit März 2000 andauernden Abwärtstrend bei Aktien wieder umzukehren. In der Spitze fast 50 Prozent Kursgewinne bei den deutschen Standardwerten, 24 bei den amerikanischen und gut 35 bei den europäischen machen offenbar viele übermütig und nervös. So niedrig wie derzeit waren die Aktienquoten der professionellen Investoren, Versicherungen und Pensionsfonds lange nicht mehr. Und die immer als Letzte auf den Zug aufspringende Gruppe, die Privatanleger, ist noch gar nicht richtig mit von der Partie. Sind damit die Aktienmärkte aber nicht auf weitere Kursgewinne programmiert? Ist das gar die Trendwende?, fragen immer mehr Investoren.
Tatsächlich ist der rasante Anstieg nichts anderes als die Korrektur der übertriebenen Talfahrt Anfang des Jahres. Damals dominierte die Angst vor dem Irak-Krieg, teurem Öl und einer globalen Depression. Die Schreckensszenarien eines politischen Flächenbrandes im Nahen Osten sind genauso ausgeblieben wie ein Ölpreis von 80 Dollar je Fass. Das hat die kräftige Erholung bei Aktien ausgelöst. Zusätzlichen Schwung erhalten sie von den Notenbanken, die das Thema Deflation, also die Gefahr fallender Preise, ernst nehmen und das globale Finanzsystem mit Geld fluten. „Aggressiv“ nennt die Investmentbank Goldman Sachs diese Strategie der amerikanischen, europäischen und japanischen Notenbanken, parallel Überschussliquidität zu erzeugen, um die Konjunktur zu stützen:
In Japan wächst das Geldangebot der Notenbank im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt so schnell wie seit 1980 nicht mehr, in Amerika so stark wie zuletzt während der Asienkrise 1998und in Euroland so kräftig wie noch nie, seit es die Europäische Zentralbank (EZB) gibt. Und überall auf der Welt stehen weitere Zinssenkungen auf der Tagesordnung. Von der EZB erwartet die Mehrzahl der Analysten nach der Sommerpause einen Notenbankzins von nur noch 1,5 Prozent.
Schon heute liegt er mit 2 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Mit den Minizinsen wollen die Notenbanker die Finanzierung von Unternehmen verbilligen, um deren Investitionen anzukurbeln und auch den Konsum. Sparen wird so nämlich immer unattraktiver. In Amerika sorgen sich deshalb bereits die Manager von Geldmarktfonds um ihren Job. Bei Verwaltungsgebühren von rund 0,5 Prozentpunkten bleibt bei Leitzinsen von weniger als einem Prozent für den Anleger nominal praktisch nichts mehr übrig.
Das Wachstum fehlt
Nicht viel besser sieht es bei Staatsanleihen aus. Zehnjährige Papiere bringen in Amerika gerade noch eine Rendite von 3 Prozent, in Euroland von 3,5 Prozent. Zieht man die Inflationrate von rund 1,5 Prozent ab, bleibt hier real ebenfalls kaum etwas übrig. Würden sich die professionellen Anleger eingestehen, sie kauften Aktien, weil sie keine andere Wahl hätten, verdienten sie Respekt. Ihre erneut zur Schau gestellte Begeisterung für die Risikopapiere aber ist lächerlich. Denn die konzertierte Aktion der drei großen Zentralbanken macht eines deutlich: Der Weltwirtschaft geht es hundsmiserabel.
Deflation, Überkapazitäten, Überschuldung und ein daraus resultierendes schwaches Wachstum sind die Hauptprobleme. Die Geldpolitik verspricht in erster Linie Erfolg beim Vorgehen gegen die Deflation. „Der entschlossene Kampf dagegen wird zumindest dieses Übel verhindern“, sagt John Butler, Analyst der Investmentbank Dresdner Kleinwort Wasserstein. „Ob die Politik der Notenbanken auch der Konjunktur hilft, steht auf einem anderen Blatt.“ Zurzeit spricht zwar einiges dafür: Nicht nur die Aktienkurse steigen, sondern – wichtiger noch – die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen sinken kräftig, das heißt, Geld wird für Betriebe billiger.
Und durch die neuerlichen Gewinne am Aktienmarkt fühlen sich Haushalte wieder reicher – mehr Konsum könnte die Folge sein.
Optimisten unter den Volkswirten rechnen deshalb damit, dass diese Politik der Notenbanken und Regierungen die Weltwirtschaft vor einer Rezession bewahrt. Die beiden größten Probleme – die Überschuldung der US-Verbraucher und das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten – könnten in diesem Fall geräuschlos gelöst werden.
Doch es gibt auch andere Szenarien. So hält beispielsweise Stephen Roach von Morgan Stanley einen Dollar-Crash – gepaart mit einem Kollaps der internationalen Finanzmärkte – für immer wahrscheinlicher. Seine These: Die Luft aus der Aktienblase habe sich vom Aktien- in den US-Immobilienmarkt verlagert. Die Konsumenten hätten sich angesichts steigender Eigenheimpreise zu hoch verschuldet und könnten unter ihrem Schuldendienst zusammenbrechen.
Zudem falle die ohnehin niedrige nationale Sparrate durch die hohe Staatsverschuldung der US-Regierung weiter von 1,3 Prozent in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auf null in den kommenden 12 bis 18 Monaten. Damit dürfte das Leistungsbilanzdefizit von derzeit rekordträchtigen 5,1 auf 6,5 bis 7 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt,, steigen.
Vergleicht man den Stand des Aktienindex Dax mit dem am Ende vergangenen Jahres, relativiert sich denn auch der spektakuläre Anstieg seit März. In den ersten sechs Monaten ist er nämlich lediglich um 10 Prozent gestiegen – das allerdings, obwohl die Aussichten für die Weltwirtschaft schlechter sind als vor einem halben Jahr. So hat die Europäische Zentralbank ihre Wachstumsprognose für Euroland gerade für dieses Jahr auf 0,7 und 1,6 Prozent für 2004 gesenkt.
Das aber bedeutet nichts Gutes für die Unternehmensgewinne. Unverdrossen gehen die Aktienanalysten gleichwohl noch immer im Schnitt von einem Gewinnanstieg der größten europäischen Unternehmen um knapp 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. „Das ist nicht zu erreichen“, ist sich Rolf Elgeti sicher. Der Aktienstratege von Commerzbank Securities erwartet ein böses Erwachen, wenn die europäischen Blue Chips ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.
Flaute trotz Null-Zinsen
Ralf Zimmermann, Analyst von Sal. Oppenheim, ist ebenfalls skeptisch mit Blick auf das Wirtschaftswachstum. „Es sind vor allem Kostensenkungen in den Unternehmen, die die Gewinne auf mittlere Sicht treiben“, sagt er. Das sage einiges über die Aussichten aus. Auch Klaus Schlote von Solventis Research traut den europäischen Aktien nicht mehr viel zu. „Wenn Sie Japanern erzählen, dass eine lockere Geldpolitik mit stetig sinkenden Leitzinsen gut für Aktien sein soll, lachen sie sich kaputt“ , sagt Schlote in Anspielung auf die japanische Erfahrung. Dort hat es die Notenbank nicht geschafft, nach dem Platzen der Blase am Aktienmarkt die Deflation zu verhindern.
Obwohl die Notenbankzinsen seit Jahren bei null Prozent liegen, durchlebt der Aktienmarkt Nippons sein dreizehntes Baissejahr. Der Leitindex Nikkei notiert gerade mal bei 9000 Yen. Ende 1989 waren es knapp 40000 Yen. Selbst wenn Europa nicht zwingend das Schicksal Japans teilen muss: Für einen echten Aufschwung am Aktienmarkt, der das Ende der Baisse einläutet, ist es noch viel zu früh.
DIE ZEIT - 26.06.2003
Wirklich schon zurück?
Der Eindruck von der Wiederkehr des Bullen täuscht. Für eine anhaltende Hausse am Aktienmarkt ist es viel zu früh
Von Robert von Heusinger
Finger weg von Aktien. Oder etwas technischer ausgedrückt: „Aktienquote auf null reduzieren!“ Diese Warnung signalisiert seit zwei Wochen das „Gefühlsbarometer“ der schnieken Kölner Privatbank Sal. Oppenheim. Warum? Weil zurzeit alle Börsianer optimistisch sind, zu optimistisch. Sie träumen vom Bullenmarkt mit steigenden Kursen. Das Gefühlsbarometer misst anhand verschiedener Indikatoren die Stimmung der Investoren an den weltweiten Aktienmärkten. Als Daumenregel gilt: Je ausgeprägter der Pessimismus, desto besser entwickeln sich kurzfristig die Kurse an der Börse und umgekehrt. Auch die wöchentliche Auswertung von 130 amerikanischen Börsenbriefen durch Investors’ Intelligence verheißt nichts Gutes: Nur 16,1Prozent der Artikel warnen vor fallenden Kursen. Einen so niedrigen Stand haben die Analysten von Sal. Oppenheim noch nie notiert – immerhin erfassen sie die Quoten seit Juni 1989.
Das ist wenig erstaunlich. Schließlich kennen Dax, Dow Jones und EuroStoxx seit 15Wochen nur eine Richtung: nach oben. Es ist der dritte und kräftigste Versuch, den seit März 2000 andauernden Abwärtstrend bei Aktien wieder umzukehren. In der Spitze fast 50 Prozent Kursgewinne bei den deutschen Standardwerten, 24 bei den amerikanischen und gut 35 bei den europäischen machen offenbar viele übermütig und nervös. So niedrig wie derzeit waren die Aktienquoten der professionellen Investoren, Versicherungen und Pensionsfonds lange nicht mehr. Und die immer als Letzte auf den Zug aufspringende Gruppe, die Privatanleger, ist noch gar nicht richtig mit von der Partie. Sind damit die Aktienmärkte aber nicht auf weitere Kursgewinne programmiert? Ist das gar die Trendwende?, fragen immer mehr Investoren.
Tatsächlich ist der rasante Anstieg nichts anderes als die Korrektur der übertriebenen Talfahrt Anfang des Jahres. Damals dominierte die Angst vor dem Irak-Krieg, teurem Öl und einer globalen Depression. Die Schreckensszenarien eines politischen Flächenbrandes im Nahen Osten sind genauso ausgeblieben wie ein Ölpreis von 80 Dollar je Fass. Das hat die kräftige Erholung bei Aktien ausgelöst. Zusätzlichen Schwung erhalten sie von den Notenbanken, die das Thema Deflation, also die Gefahr fallender Preise, ernst nehmen und das globale Finanzsystem mit Geld fluten. „Aggressiv“ nennt die Investmentbank Goldman Sachs diese Strategie der amerikanischen, europäischen und japanischen Notenbanken, parallel Überschussliquidität zu erzeugen, um die Konjunktur zu stützen:
In Japan wächst das Geldangebot der Notenbank im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt so schnell wie seit 1980 nicht mehr, in Amerika so stark wie zuletzt während der Asienkrise 1998und in Euroland so kräftig wie noch nie, seit es die Europäische Zentralbank (EZB) gibt. Und überall auf der Welt stehen weitere Zinssenkungen auf der Tagesordnung. Von der EZB erwartet die Mehrzahl der Analysten nach der Sommerpause einen Notenbankzins von nur noch 1,5 Prozent.
Schon heute liegt er mit 2 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Mit den Minizinsen wollen die Notenbanker die Finanzierung von Unternehmen verbilligen, um deren Investitionen anzukurbeln und auch den Konsum. Sparen wird so nämlich immer unattraktiver. In Amerika sorgen sich deshalb bereits die Manager von Geldmarktfonds um ihren Job. Bei Verwaltungsgebühren von rund 0,5 Prozentpunkten bleibt bei Leitzinsen von weniger als einem Prozent für den Anleger nominal praktisch nichts mehr übrig.
Das Wachstum fehlt
Nicht viel besser sieht es bei Staatsanleihen aus. Zehnjährige Papiere bringen in Amerika gerade noch eine Rendite von 3 Prozent, in Euroland von 3,5 Prozent. Zieht man die Inflationrate von rund 1,5 Prozent ab, bleibt hier real ebenfalls kaum etwas übrig. Würden sich die professionellen Anleger eingestehen, sie kauften Aktien, weil sie keine andere Wahl hätten, verdienten sie Respekt. Ihre erneut zur Schau gestellte Begeisterung für die Risikopapiere aber ist lächerlich. Denn die konzertierte Aktion der drei großen Zentralbanken macht eines deutlich: Der Weltwirtschaft geht es hundsmiserabel.
Deflation, Überkapazitäten, Überschuldung und ein daraus resultierendes schwaches Wachstum sind die Hauptprobleme. Die Geldpolitik verspricht in erster Linie Erfolg beim Vorgehen gegen die Deflation. „Der entschlossene Kampf dagegen wird zumindest dieses Übel verhindern“, sagt John Butler, Analyst der Investmentbank Dresdner Kleinwort Wasserstein. „Ob die Politik der Notenbanken auch der Konjunktur hilft, steht auf einem anderen Blatt.“ Zurzeit spricht zwar einiges dafür: Nicht nur die Aktienkurse steigen, sondern – wichtiger noch – die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen sinken kräftig, das heißt, Geld wird für Betriebe billiger.
Und durch die neuerlichen Gewinne am Aktienmarkt fühlen sich Haushalte wieder reicher – mehr Konsum könnte die Folge sein.
Optimisten unter den Volkswirten rechnen deshalb damit, dass diese Politik der Notenbanken und Regierungen die Weltwirtschaft vor einer Rezession bewahrt. Die beiden größten Probleme – die Überschuldung der US-Verbraucher und das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten – könnten in diesem Fall geräuschlos gelöst werden.
Doch es gibt auch andere Szenarien. So hält beispielsweise Stephen Roach von Morgan Stanley einen Dollar-Crash – gepaart mit einem Kollaps der internationalen Finanzmärkte – für immer wahrscheinlicher. Seine These: Die Luft aus der Aktienblase habe sich vom Aktien- in den US-Immobilienmarkt verlagert. Die Konsumenten hätten sich angesichts steigender Eigenheimpreise zu hoch verschuldet und könnten unter ihrem Schuldendienst zusammenbrechen.
Zudem falle die ohnehin niedrige nationale Sparrate durch die hohe Staatsverschuldung der US-Regierung weiter von 1,3 Prozent in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auf null in den kommenden 12 bis 18 Monaten. Damit dürfte das Leistungsbilanzdefizit von derzeit rekordträchtigen 5,1 auf 6,5 bis 7 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt,, steigen.
Vergleicht man den Stand des Aktienindex Dax mit dem am Ende vergangenen Jahres, relativiert sich denn auch der spektakuläre Anstieg seit März. In den ersten sechs Monaten ist er nämlich lediglich um 10 Prozent gestiegen – das allerdings, obwohl die Aussichten für die Weltwirtschaft schlechter sind als vor einem halben Jahr. So hat die Europäische Zentralbank ihre Wachstumsprognose für Euroland gerade für dieses Jahr auf 0,7 und 1,6 Prozent für 2004 gesenkt.
Das aber bedeutet nichts Gutes für die Unternehmensgewinne. Unverdrossen gehen die Aktienanalysten gleichwohl noch immer im Schnitt von einem Gewinnanstieg der größten europäischen Unternehmen um knapp 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. „Das ist nicht zu erreichen“, ist sich Rolf Elgeti sicher. Der Aktienstratege von Commerzbank Securities erwartet ein böses Erwachen, wenn die europäischen Blue Chips ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen.
Flaute trotz Null-Zinsen
Ralf Zimmermann, Analyst von Sal. Oppenheim, ist ebenfalls skeptisch mit Blick auf das Wirtschaftswachstum. „Es sind vor allem Kostensenkungen in den Unternehmen, die die Gewinne auf mittlere Sicht treiben“, sagt er. Das sage einiges über die Aussichten aus. Auch Klaus Schlote von Solventis Research traut den europäischen Aktien nicht mehr viel zu. „Wenn Sie Japanern erzählen, dass eine lockere Geldpolitik mit stetig sinkenden Leitzinsen gut für Aktien sein soll, lachen sie sich kaputt“ , sagt Schlote in Anspielung auf die japanische Erfahrung. Dort hat es die Notenbank nicht geschafft, nach dem Platzen der Blase am Aktienmarkt die Deflation zu verhindern.
Obwohl die Notenbankzinsen seit Jahren bei null Prozent liegen, durchlebt der Aktienmarkt Nippons sein dreizehntes Baissejahr. Der Leitindex Nikkei notiert gerade mal bei 9000 Yen. Ende 1989 waren es knapp 40000 Yen. Selbst wenn Europa nicht zwingend das Schicksal Japans teilen muss: Für einen echten Aufschwung am Aktienmarkt, der das Ende der Baisse einläutet, ist es noch viel zu früh.
DIE ZEIT - 26.06.2003
.
... und hier die für Goldbugs eher pessimistische Gegenposition:
Die Börse ist noch für weitere Überraschung gut
Wer die Spur verloren hat, sollte sich hüten, den Weg zu weisen. Aber zumindest darf man ja versuchen, die Spur wiederzufinden.
Das alte Szenario einer weiteren Börsenkorrektur im Sommer und einem starken zweiten Halbjahr bleibt zwar vernünftig, wird aber unwahrscheinlicher. Denn daran glauben ja nun die meisten, und der Konsens liegt fast immer falsch.
Grundlegend geändert hat sich die Situation im Grunde seit der Fed-Zinssitzung am 6. Mai, als Alan Greenspan den Deflationsscheck ausgeschrieben hat. Seither haben sich die monetären Konditionen (Aktien, Zinsen, Risikoprämien) grundlegend verbessert. Garniert wurde das durch den Zinsschritt der EZB, der die realen Geldmarktsätze gen null senkte, und durch die quantitativ äußerst lockeren Zentralbanken von Japan und China. Die Welt schwimmt nicht nur in Geld, nach der jahrelangen Liquiditätshausse ersäuft sie langsam darin.

Nun sind US-Aktien im Gegensatz zu europäischen und japanischen zwar nach fast allen Kriterien viel zu teuer, aber eben nur nach fast allen. Im Vergleich zu den 1,7 Prozent, die zehnjährige inflationsindexierte US-Bonds einbringen, scheint selbst die mickrige Dividendenrendite des S&P 500 von 1,65 Prozent attraktiv.
Natürlich wäre der Bondmarkt seinerseits völlig überbewertet, wenn die Gewinnschätzungen der Analysten nur halbwegs aufgingen. Bloß hat Greenspan ja am 6. Mai klargestellt, dass die Zinsen niedrig bleiben, bis die Wirtschaft auf ihren Wachstumspfad zurückgekehrt ist; daran hat sich nach der jüngsten Zinsentscheidung nichts geändert, obgleich einige mit beherzteren Worten und Taten gerechnet hatten.
Und da die US-Produktionslücke derzeit bei gut zwei Prozent liegt, könnte die Wirtschaft theoretisch bis 2005 um vier Prozent wachsen, ohne dass sich realwirtschaftlich gesehen ein Inflationspotenzial aufbaute. In der Tat werden die Zinsen also noch lange auf Depressionsniveau verharren. Unterdessen wird die US-Wirtschaft aber im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen einen mächtigen Zwischenspurt einlegen, nicht nur wegen der monetären Konditionen. Das neue Fiskalprogramm wird die verfügbaren Einkommen allein in den nächsten vier Quartalen um rund 1,5 Prozent beflügeln. Dazu noch die derzeit extrem niedrigen Netto-Investitionen berücksichtigt, und der Aufschwung ist so gut wie ausgemacht.
Daher ist es an der Zeit, zumindest zu erwägen, dass - erstens - die Korrektur viel später kommt als gedacht und - zweitens –die Börse per saldo wenigstens bis zum Frühjahr 2004 ganz nett laufen könnte.
Dass die völlig ungleichgewichtige US-Wirtschaft spätestens 2005 wieder unter ihr Potenzialwachstum zurückfällt, werden die Anleger jedenfalls schon vor der Präsidentschaftswahl antizipieren.
Denn schon im zweiten Halbjahr 2004 werden die fiskalischen Impulse nachlassen, während die konsumgierigen Verbraucher ihre Verschuldung selbst bei niedrigsten Zinsen nicht dauerhaft um zehn Prozent ausweiten können, wie im ersten Quartal. Die Anpassung wird derzeit eben nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das gilt für die US-Wirtschaft wie für die US-Börse. Dass Europa deutlich besser dasteht, müssen die Anleger erst noch begreifen.
(...)
FTD - 27.6.2003
... und hier die für Goldbugs eher pessimistische Gegenposition:
Die Börse ist noch für weitere Überraschung gut
Wer die Spur verloren hat, sollte sich hüten, den Weg zu weisen. Aber zumindest darf man ja versuchen, die Spur wiederzufinden.
Das alte Szenario einer weiteren Börsenkorrektur im Sommer und einem starken zweiten Halbjahr bleibt zwar vernünftig, wird aber unwahrscheinlicher. Denn daran glauben ja nun die meisten, und der Konsens liegt fast immer falsch.
Grundlegend geändert hat sich die Situation im Grunde seit der Fed-Zinssitzung am 6. Mai, als Alan Greenspan den Deflationsscheck ausgeschrieben hat. Seither haben sich die monetären Konditionen (Aktien, Zinsen, Risikoprämien) grundlegend verbessert. Garniert wurde das durch den Zinsschritt der EZB, der die realen Geldmarktsätze gen null senkte, und durch die quantitativ äußerst lockeren Zentralbanken von Japan und China. Die Welt schwimmt nicht nur in Geld, nach der jahrelangen Liquiditätshausse ersäuft sie langsam darin.

Nun sind US-Aktien im Gegensatz zu europäischen und japanischen zwar nach fast allen Kriterien viel zu teuer, aber eben nur nach fast allen. Im Vergleich zu den 1,7 Prozent, die zehnjährige inflationsindexierte US-Bonds einbringen, scheint selbst die mickrige Dividendenrendite des S&P 500 von 1,65 Prozent attraktiv.
Natürlich wäre der Bondmarkt seinerseits völlig überbewertet, wenn die Gewinnschätzungen der Analysten nur halbwegs aufgingen. Bloß hat Greenspan ja am 6. Mai klargestellt, dass die Zinsen niedrig bleiben, bis die Wirtschaft auf ihren Wachstumspfad zurückgekehrt ist; daran hat sich nach der jüngsten Zinsentscheidung nichts geändert, obgleich einige mit beherzteren Worten und Taten gerechnet hatten.
Und da die US-Produktionslücke derzeit bei gut zwei Prozent liegt, könnte die Wirtschaft theoretisch bis 2005 um vier Prozent wachsen, ohne dass sich realwirtschaftlich gesehen ein Inflationspotenzial aufbaute. In der Tat werden die Zinsen also noch lange auf Depressionsniveau verharren. Unterdessen wird die US-Wirtschaft aber im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen einen mächtigen Zwischenspurt einlegen, nicht nur wegen der monetären Konditionen. Das neue Fiskalprogramm wird die verfügbaren Einkommen allein in den nächsten vier Quartalen um rund 1,5 Prozent beflügeln. Dazu noch die derzeit extrem niedrigen Netto-Investitionen berücksichtigt, und der Aufschwung ist so gut wie ausgemacht.
Daher ist es an der Zeit, zumindest zu erwägen, dass - erstens - die Korrektur viel später kommt als gedacht und - zweitens –die Börse per saldo wenigstens bis zum Frühjahr 2004 ganz nett laufen könnte.
Dass die völlig ungleichgewichtige US-Wirtschaft spätestens 2005 wieder unter ihr Potenzialwachstum zurückfällt, werden die Anleger jedenfalls schon vor der Präsidentschaftswahl antizipieren.
Denn schon im zweiten Halbjahr 2004 werden die fiskalischen Impulse nachlassen, während die konsumgierigen Verbraucher ihre Verschuldung selbst bei niedrigsten Zinsen nicht dauerhaft um zehn Prozent ausweiten können, wie im ersten Quartal. Die Anpassung wird derzeit eben nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das gilt für die US-Wirtschaft wie für die US-Börse. Dass Europa deutlich besser dasteht, müssen die Anleger erst noch begreifen.
(...)
FTD - 27.6.2003
.
Edelmetalle: Keine Signale für Erholung der Goldnotierungen
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Nachdem der Goldpreis auf ein Sieben-Wochen-Tief gefallen ist, sind die Aussichten für eine Erholung in dieser Woche nicht sehr rosig. Die Entwicklung wird weiter vor allem vom Dollar-Kurs und den Aktien- und Rentenmärkten bestimmt.
Der Goldpreis fiel gleich zu Beginn der vergangenen Woche auf 355 $ je Unze. Am Mittwoch beflügelte die mit 25 Basispunkten überraschend niedrige Zinssenkung der US-Notenbank dann den Dollar und setzte den Goldpreis zusätzlich unter Druck. Am Donnerstag durchbrach die Notierung die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 347 $ pro Unze nach unten. Das Edelmetall testete mit 343 $ in der zweiten Wochenhälfte mehrmals ein Sieben-Wochen-Tief.
Verkäufer waren vor allem spekulativ orientierte Marktteilnehmer, die auf steigende Notierungen gesetzt hatten. Zudem sollen einige Fonds neue Minuspositionen eingegangen sein, womit sie zusätzlichen Druck auf den Preis ausübten.
Auch gegen andere Währungen wie den australischen Dollar und den Euro geriet der Preis unter Druck. Zum ersten Mal in diesem Jahr waren aber auf dem niedrigeren Niveau keine Produzentenrückkäufe zur Schließung von Absicherungspositionen zu beobachten. Diese Rückkäufe waren in den vergangenen Monaten wesentlich für die Goldnachfrage verantwortlich. Nachdem aber Newmont Mining seine Rückkäufe einstellt, befürchten Analysten nun einen massiven Einbruch der Nachfrage auch anderer Produzenten.
Verkaufsdruck nimmt zu
Analysten schließen nicht aus, dass der Verkaufsdruck diese Woche trotz der technischen Erholung am Freitag wieder zunimmt. Allerdings müsste es zu erheblichen Abgaben kommen, um das Edelmetall in den kommenden Tagen bis auf 340 $ je Unze und damit den 200-Tage-Durchschnitt zu drücken. Sollte dieses Niveau nicht behauptet werden, sehen Händler die nächste Unterstützung bei 335 $.Nach oben sind 348,70 und darüber 351,50 $ pro Unze Widerstände.
Platin handelte nach anfänglichen Abgaben im Wochenverlauf in einer zunächst engen Spanne zwischen 664 und 673 $ je Feinunze. Ein Einbruch folgte dann am Donnerstag. Offene Optionspositionen sorgten für starke Verkäufe, nachdem Platin unter 665 $ fiel. Danach sackte der Preis schnell bis auf 653 $ ab. Eine überraschende Trendwende gab es dann am Freitag. Unterstützt von industrieller Nachfrage stieg der Preis beim Morgenfixing auf 664 $ pro Unze.
Fundamental erwarten Händler eine weitere Beruhigung in den nächsten Wochen und eine Handelsspanne zwischen 650 und 670 $. Während der Sommerferien sinkt die industrielle Nachfrage in den wichtigen Industrienationen. Palladium notierte kaum verändert zwischen 175 und 180 $ je Unze. Silber verharrte zwischen 4,48 und 4,57 $ pro Unze.
Wolfgang Wrzesniok-Rossbach ist Produktmanager für Edelmetalle und Rohstoffe bei Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt
---
Den Rentenmärkten droht ein Orkan
Die jüngsten Turbulenzen am langen Ende des Rentenmarktes sind höchstens ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was sich im zweiten Halbjahr noch abspielen dürfte. Der Bund-Future ist seit dem 16. Juni um fast 400 Stellen geplumpst.

Zwar gehört zu der unerhört aggressiven geldpolitischen Strategie von Alan Greenspan, die langfristigen Zinsen vermittels rhetorischer Feinsteuerung so lange künstlich zu drücken, bis sich ein selbsttragender Aufschwung abzeichnet - wobei die massiven Ungleichgewichte die US-Wirtschaft noch auf Jahre hin hemmen der EZB wird das auch den hiesigen Rentenmärkten zugute kommen. Aber die Zeichen für eine zyklische Konjunkturerholung sind inzwischen unübersehbar, in den USA wie in Europa. Sogar den schwachen US-Kern-Preisdeflator für Konsumausgaben im Mai, der weitere Deflationssorgen geschürt hat, haben die Rentenmärkte am Freitag abgeschüttelt wie nichts.
In den USA steigen die Nettovermögen der Haushalte seit dem dritten Quartal, wobei Hauspreis- sowie Börsenwicklung darauf hindeuten, dass das Nettovermögen im zweiten Quartal erstmals wieder höher lag als im Vorjahr. Derweil sind die angekündigten Stellenstreichungen im Mai auf ein neues zyklisches Tief gefallen. Wegen der niedrigen Hypothekenzinsen bleibt Wohneigentum erschwinglich, und gemessen an den Verkäufen sind die Vorräte an neuen Häusern niedriger denn je.
Durch das Steuerpaket werden die Einkommen vor der Präsidentschaftswahl um 1,5 Prozent aufgepäppelt. Gleichzeitig ist die Differenz zwischen Kapitalrenditen und -kosten der Firmen heftig gestiegen, während die Bilanzen repariert wurden und die sehr niedrigen Nettoinvestitionen auf Ersatzbedarf schließen lassen.
In Europa sind die realen Geldmarktzinsen derweil auf null gefallen; anders als allenthalben kolportiert sind sie selbst in Deutschland so niedrig wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Die Stimmung ist schlechter als die Lage, und der Abstand zwischen dem OECD-Frühindikator und der deutschen Industrieproduktion ist mit knapp zehn Prozent so hoch wie während des Wiedervereinigungsbooms. Die deutsche Regierung ist endlich auf dem richtigen Weg; abgesehen von der Umsetzung ihres Reform- und Steuerpakets fehlt es nur noch an visionärer Überzeugungskraft, um den Menschen die bereits geplanten und weitere Reformen schmackhaft zu machen.
Unterdessen sind Bonds sogar im Vergleich zu US-Aktien so teuer wie seit den 70er Jahren nicht mehr - und zwar an den VGR-Gewinn-Reihen gemessen. Und wenn die Frühindikatoren anspringen, ist es für die Rentenanleger vermutlich bereits zu spät. Schon jetzt sollten sie jedwede Erholung langsam als Ausstiegschance begreifen.
(...)
FTD - 30.06.2003
Edelmetalle: Keine Signale für Erholung der Goldnotierungen
Von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach
Nachdem der Goldpreis auf ein Sieben-Wochen-Tief gefallen ist, sind die Aussichten für eine Erholung in dieser Woche nicht sehr rosig. Die Entwicklung wird weiter vor allem vom Dollar-Kurs und den Aktien- und Rentenmärkten bestimmt.
Der Goldpreis fiel gleich zu Beginn der vergangenen Woche auf 355 $ je Unze. Am Mittwoch beflügelte die mit 25 Basispunkten überraschend niedrige Zinssenkung der US-Notenbank dann den Dollar und setzte den Goldpreis zusätzlich unter Druck. Am Donnerstag durchbrach die Notierung die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 347 $ pro Unze nach unten. Das Edelmetall testete mit 343 $ in der zweiten Wochenhälfte mehrmals ein Sieben-Wochen-Tief.
Verkäufer waren vor allem spekulativ orientierte Marktteilnehmer, die auf steigende Notierungen gesetzt hatten. Zudem sollen einige Fonds neue Minuspositionen eingegangen sein, womit sie zusätzlichen Druck auf den Preis ausübten.
Auch gegen andere Währungen wie den australischen Dollar und den Euro geriet der Preis unter Druck. Zum ersten Mal in diesem Jahr waren aber auf dem niedrigeren Niveau keine Produzentenrückkäufe zur Schließung von Absicherungspositionen zu beobachten. Diese Rückkäufe waren in den vergangenen Monaten wesentlich für die Goldnachfrage verantwortlich. Nachdem aber Newmont Mining seine Rückkäufe einstellt, befürchten Analysten nun einen massiven Einbruch der Nachfrage auch anderer Produzenten.
Verkaufsdruck nimmt zu
Analysten schließen nicht aus, dass der Verkaufsdruck diese Woche trotz der technischen Erholung am Freitag wieder zunimmt. Allerdings müsste es zu erheblichen Abgaben kommen, um das Edelmetall in den kommenden Tagen bis auf 340 $ je Unze und damit den 200-Tage-Durchschnitt zu drücken. Sollte dieses Niveau nicht behauptet werden, sehen Händler die nächste Unterstützung bei 335 $.Nach oben sind 348,70 und darüber 351,50 $ pro Unze Widerstände.
Platin handelte nach anfänglichen Abgaben im Wochenverlauf in einer zunächst engen Spanne zwischen 664 und 673 $ je Feinunze. Ein Einbruch folgte dann am Donnerstag. Offene Optionspositionen sorgten für starke Verkäufe, nachdem Platin unter 665 $ fiel. Danach sackte der Preis schnell bis auf 653 $ ab. Eine überraschende Trendwende gab es dann am Freitag. Unterstützt von industrieller Nachfrage stieg der Preis beim Morgenfixing auf 664 $ pro Unze.
Fundamental erwarten Händler eine weitere Beruhigung in den nächsten Wochen und eine Handelsspanne zwischen 650 und 670 $. Während der Sommerferien sinkt die industrielle Nachfrage in den wichtigen Industrienationen. Palladium notierte kaum verändert zwischen 175 und 180 $ je Unze. Silber verharrte zwischen 4,48 und 4,57 $ pro Unze.
Wolfgang Wrzesniok-Rossbach ist Produktmanager für Edelmetalle und Rohstoffe bei Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt
---
Den Rentenmärkten droht ein Orkan
Die jüngsten Turbulenzen am langen Ende des Rentenmarktes sind höchstens ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was sich im zweiten Halbjahr noch abspielen dürfte. Der Bund-Future ist seit dem 16. Juni um fast 400 Stellen geplumpst.

Zwar gehört zu der unerhört aggressiven geldpolitischen Strategie von Alan Greenspan, die langfristigen Zinsen vermittels rhetorischer Feinsteuerung so lange künstlich zu drücken, bis sich ein selbsttragender Aufschwung abzeichnet - wobei die massiven Ungleichgewichte die US-Wirtschaft noch auf Jahre hin hemmen der EZB wird das auch den hiesigen Rentenmärkten zugute kommen. Aber die Zeichen für eine zyklische Konjunkturerholung sind inzwischen unübersehbar, in den USA wie in Europa. Sogar den schwachen US-Kern-Preisdeflator für Konsumausgaben im Mai, der weitere Deflationssorgen geschürt hat, haben die Rentenmärkte am Freitag abgeschüttelt wie nichts.
In den USA steigen die Nettovermögen der Haushalte seit dem dritten Quartal, wobei Hauspreis- sowie Börsenwicklung darauf hindeuten, dass das Nettovermögen im zweiten Quartal erstmals wieder höher lag als im Vorjahr. Derweil sind die angekündigten Stellenstreichungen im Mai auf ein neues zyklisches Tief gefallen. Wegen der niedrigen Hypothekenzinsen bleibt Wohneigentum erschwinglich, und gemessen an den Verkäufen sind die Vorräte an neuen Häusern niedriger denn je.
Durch das Steuerpaket werden die Einkommen vor der Präsidentschaftswahl um 1,5 Prozent aufgepäppelt. Gleichzeitig ist die Differenz zwischen Kapitalrenditen und -kosten der Firmen heftig gestiegen, während die Bilanzen repariert wurden und die sehr niedrigen Nettoinvestitionen auf Ersatzbedarf schließen lassen.
In Europa sind die realen Geldmarktzinsen derweil auf null gefallen; anders als allenthalben kolportiert sind sie selbst in Deutschland so niedrig wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Die Stimmung ist schlechter als die Lage, und der Abstand zwischen dem OECD-Frühindikator und der deutschen Industrieproduktion ist mit knapp zehn Prozent so hoch wie während des Wiedervereinigungsbooms. Die deutsche Regierung ist endlich auf dem richtigen Weg; abgesehen von der Umsetzung ihres Reform- und Steuerpakets fehlt es nur noch an visionärer Überzeugungskraft, um den Menschen die bereits geplanten und weitere Reformen schmackhaft zu machen.
Unterdessen sind Bonds sogar im Vergleich zu US-Aktien so teuer wie seit den 70er Jahren nicht mehr - und zwar an den VGR-Gewinn-Reihen gemessen. Und wenn die Frühindikatoren anspringen, ist es für die Rentenanleger vermutlich bereits zu spät. Schon jetzt sollten sie jedwede Erholung langsam als Ausstiegschance begreifen.
(...)
FTD - 30.06.2003

Trauer um Katherine Hepburn
Die viermalige Oscar-Gewinnerin starb im Alter von 96 Jahren. Zu Ehren der Toten sollen am Dienstagabend die Lichter auf dem New Yorker Broadway kurz gelöscht werden
Old Saybrook - Eine der größten Schauspielerinnen in der Filmgeschichte lebt nicht mehr: Im Alter von 96 starb Katharine Hepburn am Sonntag im Kreis ihrer Familie in ihrem Haus im US-Staat Connecticut. In den letzten Jahren hatte sich die viermalige Oscar-Gewinnerin aus gesundheitlichen Gründen immer stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
International bekannt wurde die Schauspielerin mit Filmen wie „The African Queen“ (mit Humphrey Bogart), „Philadelphia Story“ (mit Cary Grant und James Stewart) und „Die Frau, von der man spricht“. Dieser Film aus dem Jahr 1942 war auch die erste Zusammenarbeit Katharine Hepburns mit ihrem späteren langjährigen Lebenspartner Spencer Tracy. Mit ihm stand Hepburn für neun Filme vor der Kamera, in denen sie oft sich selbst spielen durfte: Eine willensstarke Frau, die auf den Überlegenheitsdusel so manchen Vertreters der Männerwelt frech und fröhlich pfeift.
Die Affäre mit dem labilen, wenngleich auf der Leinwand souverän wirkenden Trinker dauerte über 25 Jahre. Die beiden galten als Hollywood-Traumpaar. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt in „Rat mal, wer zum Essen kommt“, der den Rassendünkel des weißen Amerika an den Pranger stellte, geriet 1967 nach Kritikermeinung zu einem der wichtigsten US-Filme überhaupt. Im selben Jahr starb Tracy, bis zur letzten Stunde umhegt von seiner Geliebten. Die Scheidung von seiner Ehefrau hatte der Katholik Tracy auch unter Hinweis auf ihr behindertes Kind stets abgelehnt. Hepburn akzeptierte das. Sie sorgte auch dafür, dass der Alkoholkranke immer wieder Rollen erhielt.
In ihrer beispiellosen Karriere gewann Katharine Hepburn vier Oscars - so viel wie niemand sonst in der Schauspielergilde. Außerdem wurde sie insgesamt zwölf Mal für die Academy Awards nominiert - ein Rekord, der erst in diesem Jahr von Meryl Streep mit 13 Nominierungen übertroffen wurde.
„Sie war ein amerikanisches Original und wird es immer sein“, erklärte ihre langjährige Freundin und Testamentvollstreckerin Cynthia McFadden. „Sie starb, wie sie gelebt hat: mit Würde und Gnade.“ Hollywood-Diva Elizabeth Taylor erklärte: „Ich glaube, jede Schauspielerin auf der Welt hat zu ihr mit Verehrung und einem Gefühl aufgesehen wie: `oh Mann, wenn ich nur so sein könnte wie
sie`.“
Zu Ehren der Toten sollen am Dienstagabend um 20.00 Uhr (Ortszeit) die Lichter auf New Yorks Broadway kurz gelöscht werden. Einen Gedenkgottesdienst soll es nach dem Willen der Verstorbenen nicht geben, wie die Testamentsvollstreckerin erklärte.
Ausgezeichnet wurde Katharine Hepburn mit vier Oscars: 1932 für „Morning Glory“ (deutsch: Morgenrot des Ruhms), 1967 für „Guess Who`s Coming to Dinner?“ (“Rat mal wer zum Essen kommt“, 1968 für „The Lion in Winter“("Der Löwe im Winter" ) und 1981 für „On golden Pond“ ("Am goldenen See" ). Neben ihrer Filmkarriere zog es die Schauspielerin auch immer wieder auf die Theaterbühne.
1987 veröffentlichte die Hepburn ihr Erinnerungsbuch „The Making of The African Queen“ (deutsch 1988, African Queen oder wie ich mit Bogart, Bacall und Huston nach Afrika fuhr und fast den Verstand verlor). Lob gab es auch für die 1991 publizierten Memoiren „Me“, in denen sie erstmals über ihre Beziehung zu Spencer Tracy Auskunft gab. In einem Interview sagte sie 1990 über den Tod: „Ich fürchte mich nicht vor der nächsten Welt oder sonst etwas. Ich habe keine Angst vor der Hölle, und ich freue mich auch nicht auf den Himmel
.
Oh man die Beiden da auf dem Plakat!!!!!!!1
Das gibt es nie wieder
Die gespritzten Oberlippen mit den DiCaprios, Jammer.
J2
Das gibt es nie wieder

Die gespritzten Oberlippen mit den DiCaprios, Jammer.
J2
Jeffery, Du willst doch nicht etwa behaupten
die Hepburn ließ an sich eine "Schönheits"-Operation vornehmen ?
die Hepburn ließ an sich eine "Schönheits"-Operation vornehmen ?

Nee Konradi, umgekehrt, die war doch schön. Ich meine doch die Roberts usw.
Wird ohnehin mal lustig so in 25 Jahren, wenn die tätowierten und aufgspritzten Frauen alt und fett z.B. im Krankenhaus liegen, da kriegt der Arzt dann vor lachen den Blinddarm nicht gepackt.
J2
Wird ohnehin mal lustig so in 25 Jahren, wenn die tätowierten und aufgspritzten Frauen alt und fett z.B. im Krankenhaus liegen, da kriegt der Arzt dann vor lachen den Blinddarm nicht gepackt.

J2
Die Leichen müssten eigentlich als Sondermüll entsorgt werden.

.
@ jeffery,
na dann bin ich ja beruhigt, ich hatte schon Angst Du wolltest meine Göttin verunglimpfen ...

(mit Spencer Tracy)
... schaut mal ab und zu auf die Webseiten von
www.investor-verlag.de
- es lohnt sich ...!
Hier drei aktuelle Beitäge:
Dollar auf Abwärtskurs
von unserem Korrespondenten Bill Bonner
Ich bin beeindruckt und bestürzt.
In den USA liegen die Ausgaben des Bundes im zweiten Jahr der Regierung des Konservativen George W. Bush um 20 % über dem Niveau, das sie unter dem liberalen Bill Clinton lagen, der kein Problem mit Geldausgeben hatte.
Dennoch gab der gerade erwähnte Mr. Bush letzten Monat den amerikanischen Steuerzahlern eine Atempause – eine Steuersenkung von 350 Mrd. Dollar, verteilt über die nächsten Jahre, wurde als Gesetz unterzeichnet.
"Indem man sicherstellt, dass die Amerikaner mehr zum Ausgeben, Sparen und Investieren haben", so Mr. Bush, "gibt diese Administration der wirtschaftlichen Erholung Treibstoff. Wir haben aggressive Schritte unternommen, um die Fundamente unserer Wirtschaft zu stärken, so dass jeder Amerikaner, der arbeiten will, auch fähig ist, einen Job zu finden."
In was für einer wunderbaren Welt wir leben! George W. Bush, ehemals Besitzer eines Baseball-Teams und jetzt Herrscher praktisch der gesamten Welt – vom Euphrat bis zum Mond – tut sich mit einem anderen fabulösen Magier, Alan Greenspan, zusammen – und sie wollen Geld "aus dem Nichts" schaffen. Denn wie sonst könnte die US-Regierung mehr ausgeben ... und gleichzeitig weniger nehmen? Woher soll das Geld denn kommen?
"Die Bestände der ausländischen Zentralbanken an US-Anleihen ( ...) liegen um 21,9 % über dem Wert des letzten Jahres", erklärt James Grant. "Während die Fed US-Anleihen kauft, um den Zinssatz zu steuern, kaufen die ausländischen Zentralbanken diese Anleihen, um den Wechselkurs des Dollar zu steuern." Und sie finanzieren die Differenz zwischen dem, was die US-Regierung ausgibt, und dem, was sie an Steuern einnimmt.
Und so bin ich noch mehr beeindruckt und bestürzt. Während die ausländischen Investoren nervös werden und ihre Dollarbestände verkaufen ... kaufen ausländische Zentralbanken (besonders die in Asien) US-Anleihen, um den Kursverfall des Dollar zu stoppen, so dass ihre exportorientierten Volkswirtschaft im Geschäft bleiben können.
Die ausländischen Zentralbanken halten derzeit 935 Milliarden Dollar, und diese Bestände nähern sich der Marke von 1 Billion Dollar. "Sie müssen den Dollar stützen", so US-Volkswirte. "Denn wohin sonst sollten sie ihre Güter exportieren?
Diese amerikanischen Neo-Ökonomen sehen eine klare und glückliche Aufteilung der Arbeit in der Weltwirtschaft: Die Ausländer sparen das Geld, die Amerikaner geben es aus. Die Ausländer produzieren die Güter, die Amerikaner kaufen sie. Die Ausländer leihen; die Amerikaner verschulden sich. So ist es und so soll es für immer sein; zumindest können sie es sich nicht anders vorstellen.
Und so schleppt sich das monetäre System des Dollar-Standards in sein 32. Jahr.
Wenn es ein Jahr länger überlebt, dann wird es länger als Jesus Christus gelebt haben. Aber es trägt bereits jetzt ein sehr schweres Kreuz – zusätzlich zu den fast 1 Billion Dollar, die die ausländischen Zentralbanken halten, kommen 8 Billionen Dollar in den Händen privater Ausländer. Diese privaten Dollar-Besitzer sind nicht so dumm wie ihre Zentralbanken. Sie werden ihre Dollar verkaufen, wenn sie denken, dass es dafür Zeit ist.
Und sie haben bereits eine Menge Dollar verkauft ... Sie werden noch mehr verkaufen. Und nichts kann sie aufhalten. Die USA können ihre eigene Währung nicht verteidigen. Denn steigende Zinsen – die den Dollar attraktiver machen könnten – würden die Spekulationsblase am US-Immobilienmarkt platzen lassen ... von der die US-Wirtschaftslage und die nächste Amtszeit von George W. Bush abhängen.
"Da die US-Politiker nichts tun werden, um den Dollar zu verteidigen, kann er seinen Fall nur weitersetzen", so Dr. Kurt Richebächer. "Ich kann nicht sagen, was den Verfall des Dollar stoppen wird."
US-Wirtschaft sehr verletzlich gegenüber steigenden Zinsen
von unserem Korrespondenten Eric Fry in New York
Eine Bärenmarktrally ist ein perverses Vergnügen – wie ein Bananen Split-Eis zum Frühstück. Natürlich schmecken sie beide gut. Aber sie sind wohl kaum eine gesunde Basis für ein Diät-Frühstück bzw. für eine langfristige Investment-Diät. Ein bisschen "Bärenmarktrally" wird einen nicht töten, aber man sollte nicht versuchen, nur davon zu leben.
Ironischerweise sind die Kurse an den US-Börsen seit der jüngsten Zinssenkung von Alan Greenspan eher gefallen als gestiegen. Offensichtlich hat Alan Greenspan entweder seine Magie verloren – oder er hatte sie nie. Nicht nur, dass die Aktienkurse seit der Zinssenkung gefallen sind, auch die Anleihenkurse sind gefallen, was die langfristigen Zinssätze hat steigen lassen ... das ist kein Weg, eine Volkswirtschaft zu stimulieren.
"Vadim Zlotnikov, Analyst bei Sanford C. Bernstein, hat berechnet, dass ein halber Prozentpunkt Renditesteigerung bei den 10jährigen US-Anleihen ungefähr 3 Millionen potenzieller Hauskäufer davon abhält, sich für eine Hypothek für ein durchschnittlich teures Haus zu qualifizieren"so das Barron`s Magazin. "Höhere Zinsssätze kürzen auch die erwarteten 80 Mrd. Dollar, die in diesem Jahr laut Schätzungen aus der Erhöhung bestehender Hypotheken in den Konsum fließen sollen. Und die Rendite der 10jährigen Anleihen ist fast genau einen halben Prozentpunkt gestiegen, seit dem Tief von 3,08 % vor zwei Wochen." ,
"Die andere größere Frage für die Bullen, die in den letzten Monaten mutiger geworden sind, ist, ob die Stimmung der Investoren zu positiv geworden ist ( ...). Eine Umfrage von Investors Intelligence unter den Autoren amerikanischer Börsenbriefe hat gezeigt, dass von diesen in den letzten Wochen viele zu Bullen geworden sind, und eine Umfrage unter Kleinanleger (Quelle: American Association of Individual Investors) zeigt, dass der Anteil der Bullen bei 89 % liegt. All diese Dinge sind ein Beweis dafür, dass diese Aufwärtsbewegung gefährlich ist, da es mehr Abwärtsrisiko gibt als unmittelbares weiteres Aufwärtspotenzial."
Vielleicht wirken 13 Zinssenkungen in Folge zusammen mit einer explodierenden Geldmenge doch noch inflatorisch ... besonders am Immobilienmarkt. "Spekulationsblasen haben einen bestimmten Eigengeruch – und was gerade am Immobilien- und Hypothekenmarkt passiert, hat diesen Geruch; d.h., diese Märkte sind zum großen Teil wegen einem unhaltbaren, unwirtschaftlichen Verhalten gestiegen", so die Analysten von ContraryInvestor.
"Als die Zinssätze gefallen sind, haben alte und neue Hausbesitzer ihre Hypotheken erhöht, und von diesem frischen Geld typischerweise mehr als die Hälfte in den Konsum gesteckt. Zusätzlich dazu, dass sie ihre Hypotheken erhöhten, um den laufenden Konsum zu finanzieren, haben sie ihre fixen Hypothekenraten auch in variable Zinssätze geändert, weil diese niedriger sind ... was ihre Verletzbarkeit gegenüber steigenden Zinssätzen erhöht. Man bräuchte keine starke Erhöhung der Zinssätze oder keinen großen Rückgang der realen Einkommen, um große Ausfallprobleme bei den Hypotheken zu bekommen."
... und man bräuchte auch keine große Zinssenkung, um am Aktienmarkt größere Probleme zu bekommen!
Künstlich steigende Kurse?
vom "Mogambo Guru" – n i c h t g a n z e r n s t gemeint ...
Letzte Woche explodierte die Zahl der Futures auf den S&P 500 auf einen neuen Rekord – kurz bevor Fälligkeit. Ich glaube sehr an Verschwörungstheorien, weshalb ich besonders solche Ereignisse mit großem Interesse näher unter die Lupe nehme.
Dieses ganze Kaufen von Futures – wahrscheinlich besonders durch die Fed – mag uns ungewöhnlich erscheinen. Uns naiven Leuten, die immer noch glauben, dass die Märkte in Amerika frei sind. Aber man sollte nicht vergessen, dass die Fed gesagt hat, dass sie alles unternehmen wird, um die Wirtschaft zu stimulieren – egal, wie schmutzig, hinterhältig, legal oder vielleicht illegal es ist, egal, wie viele pornografische Webseiten dafür unterstützt werden müssen.
Ich denke, dass der Markt derzeit besonders für die ausländischen Investoren künstlich nach oben gezogen wird, denn diese sind wahrscheinlich schon seeeehhhrrr nervös. Und wollen verkaufen. Aber diese Leute haben solche riesigen Beträge an Dollar-Vermögenswerten, dass es seismische Nachwirkungen hätte, wenn sie verkaufen würden. Damit würden sie wahrscheinlich die Welt zerstören. Das wäre wie das Freilassen von Godzilla, der ja – wie ich mich erinnere – unter einem Berg außerhalb von Japan schlummert. Das oder das Freilassen einer anderen riesigen, destruktiven Kreatur ist das letzte, was die Wirtschaft jetzt braucht.
Nun, ich schreibe gerne über die Fehler, die die Verantwortlichen bei der Geld- und Fiskalpolitik machen, aus zwei Gründen. 1.) Möchte ich diese Jungs öffentlich lächerlich machen, denn das ist es, was sie verdienen, und mir macht es Spaß, und 2.) habe ich dann etwas zu tun und muss mich nicht den ganzen Tag in meinem Schrank verstecken und über die riesigen Fehler der Fiskal- und Geldpolitik nachdenken und weinen. [ ]
]
Tja, ich habe in meinem Wörterbuch nach einem Wort dafür gesucht: "Bewusst etwas Falsches tun, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil es immer falsch war, wenn eine Regierung das getan hat, während der gesamten Geschichte der Menschheit, aber jetzt wird es wieder versucht aus bizarren Gründen, die offensichtlich nichts mit der Realität zu tun haben, und jetzt wird erwartet, dass es dieses verdammte Mal irgendwie funktionieren wird, obwohl es noch nie funktioniert hat, was dann alle herrlich überraschen würde, und der schöne Prinz würde die schöne Prinzessin heiraten und sie würden bei Sonnenuntergang alle mit weißen Pferden weg reiten und von da an bis zu ihrem Lebensende glücklich leben." [ ]
]
In MEINEM Wörterbuch war das einmal eine Definition der amerikanischen Demokratischen Partei. Aber derzeit ist das überholt, denn die amerikanische Republikanische Partei handelt derzeit genauso, nur noch schlimmer, was mich für immer traurig und beschämt macht. Deshalb sollte es jetzt vielleicht eher auf "Politiker und Fed-Vorsitzende" passen – aber das ist ja kein einzelnes Wort, sondern eine Phrase. Ich werde mal jemanden fragen, um ein perfekt passendes Wort zu finden.
Wie auch immer – ein Kumpel von mir mit Namen Kevin, alias Dr. O. (nun, zumindest wird er wieder mein Kumpel sein, wenn ich ihm das Geld, das ich ihm schulde, zurückgezahlt habe. Die Chance dafür ist allerdings sehr klein, denn vorher werde ich wahrscheinlich einige Medikamente wieder auffüllen müssen und Rechnungen bezahlen müssen – vor allem die, die mit Gerichtsvollzieher drohen) hat meinen schlechten Rat genommen und das Buch "Fiat Money Inflation in France" gekauft. Und jetzt hasst er mich, weil er auch für Amerika eine solche negative Entwicklung befürchtet, wie sie in diesem Buch beschrieben ist.
Aber er hat Recht mit seiner Angst, denn das Buch passt. Der Autor Henry Hazlitt schrieb 1959 in der Einleitung zu diesem Buch: "Das breite Muster aller Inflationen, historisch wie modern, ist dasselbe. Es ist die Hartnäckigkeit von Illusionen. Die Argumente der Inflationisten sind – damals wie heute – grundsätzlich dieselben. Die Inflation im revolutionären Frankreich begann, um die Schulden zurückzuzahlen und das Haushaltsdefizit finanzieren zu können. Inflation schein ein kurzer Weg zum Reichtum zu sein."
Ich füge mit einer gewissen Genugtuung hinzu, dass es im Frankreich des 18. Jahrhunderts wir – das Proletariat – waren, die die Guillotine benutzten, um die Oberen zu köpfen. Die Jungs von der Fed sollten zittern.
... hängt wohl irgendwie mit dem Investo-Verlag zusammen:
"Zürich Club"
Wer der Werbung vertraut, kann sich in diesem antizyklisch ausgerichteten "Finanzclub" 30 Tage lang kostenlos umschauen:
Prosperitas, Securitas, Traditio ...
... das ist der Kanon klassischer Werte, an die wir im Zürich Club glauben, nämlich an Freiheit, persönlichen Wohlstand, Sicherheit und Tradition. Der ZÜRICH CLUB ist ein ausschließlich privater Club. Er ist die Schwester-Organisation des Oxford Club in den Vereinigten Staaten, dessen Idee im Jahre 1884 geboren wurde. Heute verzeichnet der Club an die 40.000 Mitglieder in über 100 Ländern weltweit.
http://www.the-bulls.de/produkt.php?p=ZC
http://www.zuerich-club.de/index2.html?return_to=http://www.…
.
@ jeffery,
na dann bin ich ja beruhigt, ich hatte schon Angst Du wolltest meine Göttin verunglimpfen ...


(mit Spencer Tracy)
... schaut mal ab und zu auf die Webseiten von
www.investor-verlag.de
- es lohnt sich ...!
Hier drei aktuelle Beitäge:
Dollar auf Abwärtskurs
von unserem Korrespondenten Bill Bonner
Ich bin beeindruckt und bestürzt.
In den USA liegen die Ausgaben des Bundes im zweiten Jahr der Regierung des Konservativen George W. Bush um 20 % über dem Niveau, das sie unter dem liberalen Bill Clinton lagen, der kein Problem mit Geldausgeben hatte.
Dennoch gab der gerade erwähnte Mr. Bush letzten Monat den amerikanischen Steuerzahlern eine Atempause – eine Steuersenkung von 350 Mrd. Dollar, verteilt über die nächsten Jahre, wurde als Gesetz unterzeichnet.
"Indem man sicherstellt, dass die Amerikaner mehr zum Ausgeben, Sparen und Investieren haben", so Mr. Bush, "gibt diese Administration der wirtschaftlichen Erholung Treibstoff. Wir haben aggressive Schritte unternommen, um die Fundamente unserer Wirtschaft zu stärken, so dass jeder Amerikaner, der arbeiten will, auch fähig ist, einen Job zu finden."
In was für einer wunderbaren Welt wir leben! George W. Bush, ehemals Besitzer eines Baseball-Teams und jetzt Herrscher praktisch der gesamten Welt – vom Euphrat bis zum Mond – tut sich mit einem anderen fabulösen Magier, Alan Greenspan, zusammen – und sie wollen Geld "aus dem Nichts" schaffen. Denn wie sonst könnte die US-Regierung mehr ausgeben ... und gleichzeitig weniger nehmen? Woher soll das Geld denn kommen?
"Die Bestände der ausländischen Zentralbanken an US-Anleihen ( ...) liegen um 21,9 % über dem Wert des letzten Jahres", erklärt James Grant. "Während die Fed US-Anleihen kauft, um den Zinssatz zu steuern, kaufen die ausländischen Zentralbanken diese Anleihen, um den Wechselkurs des Dollar zu steuern." Und sie finanzieren die Differenz zwischen dem, was die US-Regierung ausgibt, und dem, was sie an Steuern einnimmt.
Und so bin ich noch mehr beeindruckt und bestürzt. Während die ausländischen Investoren nervös werden und ihre Dollarbestände verkaufen ... kaufen ausländische Zentralbanken (besonders die in Asien) US-Anleihen, um den Kursverfall des Dollar zu stoppen, so dass ihre exportorientierten Volkswirtschaft im Geschäft bleiben können.
Die ausländischen Zentralbanken halten derzeit 935 Milliarden Dollar, und diese Bestände nähern sich der Marke von 1 Billion Dollar. "Sie müssen den Dollar stützen", so US-Volkswirte. "Denn wohin sonst sollten sie ihre Güter exportieren?
Diese amerikanischen Neo-Ökonomen sehen eine klare und glückliche Aufteilung der Arbeit in der Weltwirtschaft: Die Ausländer sparen das Geld, die Amerikaner geben es aus. Die Ausländer produzieren die Güter, die Amerikaner kaufen sie. Die Ausländer leihen; die Amerikaner verschulden sich. So ist es und so soll es für immer sein; zumindest können sie es sich nicht anders vorstellen.
Und so schleppt sich das monetäre System des Dollar-Standards in sein 32. Jahr.
Wenn es ein Jahr länger überlebt, dann wird es länger als Jesus Christus gelebt haben. Aber es trägt bereits jetzt ein sehr schweres Kreuz – zusätzlich zu den fast 1 Billion Dollar, die die ausländischen Zentralbanken halten, kommen 8 Billionen Dollar in den Händen privater Ausländer. Diese privaten Dollar-Besitzer sind nicht so dumm wie ihre Zentralbanken. Sie werden ihre Dollar verkaufen, wenn sie denken, dass es dafür Zeit ist.
Und sie haben bereits eine Menge Dollar verkauft ... Sie werden noch mehr verkaufen. Und nichts kann sie aufhalten. Die USA können ihre eigene Währung nicht verteidigen. Denn steigende Zinsen – die den Dollar attraktiver machen könnten – würden die Spekulationsblase am US-Immobilienmarkt platzen lassen ... von der die US-Wirtschaftslage und die nächste Amtszeit von George W. Bush abhängen.
"Da die US-Politiker nichts tun werden, um den Dollar zu verteidigen, kann er seinen Fall nur weitersetzen", so Dr. Kurt Richebächer. "Ich kann nicht sagen, was den Verfall des Dollar stoppen wird."
US-Wirtschaft sehr verletzlich gegenüber steigenden Zinsen
von unserem Korrespondenten Eric Fry in New York
Eine Bärenmarktrally ist ein perverses Vergnügen – wie ein Bananen Split-Eis zum Frühstück. Natürlich schmecken sie beide gut. Aber sie sind wohl kaum eine gesunde Basis für ein Diät-Frühstück bzw. für eine langfristige Investment-Diät. Ein bisschen "Bärenmarktrally" wird einen nicht töten, aber man sollte nicht versuchen, nur davon zu leben.
Ironischerweise sind die Kurse an den US-Börsen seit der jüngsten Zinssenkung von Alan Greenspan eher gefallen als gestiegen. Offensichtlich hat Alan Greenspan entweder seine Magie verloren – oder er hatte sie nie. Nicht nur, dass die Aktienkurse seit der Zinssenkung gefallen sind, auch die Anleihenkurse sind gefallen, was die langfristigen Zinssätze hat steigen lassen ... das ist kein Weg, eine Volkswirtschaft zu stimulieren.
"Vadim Zlotnikov, Analyst bei Sanford C. Bernstein, hat berechnet, dass ein halber Prozentpunkt Renditesteigerung bei den 10jährigen US-Anleihen ungefähr 3 Millionen potenzieller Hauskäufer davon abhält, sich für eine Hypothek für ein durchschnittlich teures Haus zu qualifizieren"so das Barron`s Magazin. "Höhere Zinsssätze kürzen auch die erwarteten 80 Mrd. Dollar, die in diesem Jahr laut Schätzungen aus der Erhöhung bestehender Hypotheken in den Konsum fließen sollen. Und die Rendite der 10jährigen Anleihen ist fast genau einen halben Prozentpunkt gestiegen, seit dem Tief von 3,08 % vor zwei Wochen." ,
"Die andere größere Frage für die Bullen, die in den letzten Monaten mutiger geworden sind, ist, ob die Stimmung der Investoren zu positiv geworden ist ( ...). Eine Umfrage von Investors Intelligence unter den Autoren amerikanischer Börsenbriefe hat gezeigt, dass von diesen in den letzten Wochen viele zu Bullen geworden sind, und eine Umfrage unter Kleinanleger (Quelle: American Association of Individual Investors) zeigt, dass der Anteil der Bullen bei 89 % liegt. All diese Dinge sind ein Beweis dafür, dass diese Aufwärtsbewegung gefährlich ist, da es mehr Abwärtsrisiko gibt als unmittelbares weiteres Aufwärtspotenzial."
Vielleicht wirken 13 Zinssenkungen in Folge zusammen mit einer explodierenden Geldmenge doch noch inflatorisch ... besonders am Immobilienmarkt. "Spekulationsblasen haben einen bestimmten Eigengeruch – und was gerade am Immobilien- und Hypothekenmarkt passiert, hat diesen Geruch; d.h., diese Märkte sind zum großen Teil wegen einem unhaltbaren, unwirtschaftlichen Verhalten gestiegen", so die Analysten von ContraryInvestor.
"Als die Zinssätze gefallen sind, haben alte und neue Hausbesitzer ihre Hypotheken erhöht, und von diesem frischen Geld typischerweise mehr als die Hälfte in den Konsum gesteckt. Zusätzlich dazu, dass sie ihre Hypotheken erhöhten, um den laufenden Konsum zu finanzieren, haben sie ihre fixen Hypothekenraten auch in variable Zinssätze geändert, weil diese niedriger sind ... was ihre Verletzbarkeit gegenüber steigenden Zinssätzen erhöht. Man bräuchte keine starke Erhöhung der Zinssätze oder keinen großen Rückgang der realen Einkommen, um große Ausfallprobleme bei den Hypotheken zu bekommen."
... und man bräuchte auch keine große Zinssenkung, um am Aktienmarkt größere Probleme zu bekommen!
Künstlich steigende Kurse?
vom "Mogambo Guru" – n i c h t g a n z e r n s t gemeint ...

Letzte Woche explodierte die Zahl der Futures auf den S&P 500 auf einen neuen Rekord – kurz bevor Fälligkeit. Ich glaube sehr an Verschwörungstheorien, weshalb ich besonders solche Ereignisse mit großem Interesse näher unter die Lupe nehme.
Dieses ganze Kaufen von Futures – wahrscheinlich besonders durch die Fed – mag uns ungewöhnlich erscheinen. Uns naiven Leuten, die immer noch glauben, dass die Märkte in Amerika frei sind. Aber man sollte nicht vergessen, dass die Fed gesagt hat, dass sie alles unternehmen wird, um die Wirtschaft zu stimulieren – egal, wie schmutzig, hinterhältig, legal oder vielleicht illegal es ist, egal, wie viele pornografische Webseiten dafür unterstützt werden müssen.
Ich denke, dass der Markt derzeit besonders für die ausländischen Investoren künstlich nach oben gezogen wird, denn diese sind wahrscheinlich schon seeeehhhrrr nervös. Und wollen verkaufen. Aber diese Leute haben solche riesigen Beträge an Dollar-Vermögenswerten, dass es seismische Nachwirkungen hätte, wenn sie verkaufen würden. Damit würden sie wahrscheinlich die Welt zerstören. Das wäre wie das Freilassen von Godzilla, der ja – wie ich mich erinnere – unter einem Berg außerhalb von Japan schlummert. Das oder das Freilassen einer anderen riesigen, destruktiven Kreatur ist das letzte, was die Wirtschaft jetzt braucht.
Nun, ich schreibe gerne über die Fehler, die die Verantwortlichen bei der Geld- und Fiskalpolitik machen, aus zwei Gründen. 1.) Möchte ich diese Jungs öffentlich lächerlich machen, denn das ist es, was sie verdienen, und mir macht es Spaß, und 2.) habe ich dann etwas zu tun und muss mich nicht den ganzen Tag in meinem Schrank verstecken und über die riesigen Fehler der Fiskal- und Geldpolitik nachdenken und weinen. [
 ]
]Tja, ich habe in meinem Wörterbuch nach einem Wort dafür gesucht: "Bewusst etwas Falsches tun, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil es immer falsch war, wenn eine Regierung das getan hat, während der gesamten Geschichte der Menschheit, aber jetzt wird es wieder versucht aus bizarren Gründen, die offensichtlich nichts mit der Realität zu tun haben, und jetzt wird erwartet, dass es dieses verdammte Mal irgendwie funktionieren wird, obwohl es noch nie funktioniert hat, was dann alle herrlich überraschen würde, und der schöne Prinz würde die schöne Prinzessin heiraten und sie würden bei Sonnenuntergang alle mit weißen Pferden weg reiten und von da an bis zu ihrem Lebensende glücklich leben." [
 ]
]In MEINEM Wörterbuch war das einmal eine Definition der amerikanischen Demokratischen Partei. Aber derzeit ist das überholt, denn die amerikanische Republikanische Partei handelt derzeit genauso, nur noch schlimmer, was mich für immer traurig und beschämt macht. Deshalb sollte es jetzt vielleicht eher auf "Politiker und Fed-Vorsitzende" passen – aber das ist ja kein einzelnes Wort, sondern eine Phrase. Ich werde mal jemanden fragen, um ein perfekt passendes Wort zu finden.
Wie auch immer – ein Kumpel von mir mit Namen Kevin, alias Dr. O. (nun, zumindest wird er wieder mein Kumpel sein, wenn ich ihm das Geld, das ich ihm schulde, zurückgezahlt habe. Die Chance dafür ist allerdings sehr klein, denn vorher werde ich wahrscheinlich einige Medikamente wieder auffüllen müssen und Rechnungen bezahlen müssen – vor allem die, die mit Gerichtsvollzieher drohen) hat meinen schlechten Rat genommen und das Buch "Fiat Money Inflation in France" gekauft. Und jetzt hasst er mich, weil er auch für Amerika eine solche negative Entwicklung befürchtet, wie sie in diesem Buch beschrieben ist.
Aber er hat Recht mit seiner Angst, denn das Buch passt. Der Autor Henry Hazlitt schrieb 1959 in der Einleitung zu diesem Buch: "Das breite Muster aller Inflationen, historisch wie modern, ist dasselbe. Es ist die Hartnäckigkeit von Illusionen. Die Argumente der Inflationisten sind – damals wie heute – grundsätzlich dieselben. Die Inflation im revolutionären Frankreich begann, um die Schulden zurückzuzahlen und das Haushaltsdefizit finanzieren zu können. Inflation schein ein kurzer Weg zum Reichtum zu sein."
Ich füge mit einer gewissen Genugtuung hinzu, dass es im Frankreich des 18. Jahrhunderts wir – das Proletariat – waren, die die Guillotine benutzten, um die Oberen zu köpfen. Die Jungs von der Fed sollten zittern.
... hängt wohl irgendwie mit dem Investo-Verlag zusammen:

"Zürich Club"
Wer der Werbung vertraut, kann sich in diesem antizyklisch ausgerichteten "Finanzclub" 30 Tage lang kostenlos umschauen:
Prosperitas, Securitas, Traditio ...
... das ist der Kanon klassischer Werte, an die wir im Zürich Club glauben, nämlich an Freiheit, persönlichen Wohlstand, Sicherheit und Tradition. Der ZÜRICH CLUB ist ein ausschließlich privater Club. Er ist die Schwester-Organisation des Oxford Club in den Vereinigten Staaten, dessen Idee im Jahre 1884 geboren wurde. Heute verzeichnet der Club an die 40.000 Mitglieder in über 100 Ländern weltweit.
http://www.the-bulls.de/produkt.php?p=ZC
http://www.zuerich-club.de/index2.html?return_to=http://www.…
.
@konradi und alle Interessierten
"African Queen" läuft heute ab 21:45 Uhr auf Bayern 3...keine Werbeblöcke, dazu einen staubtrockenen Gin-Tonic und die Goldaktien steigen heute ebenfalls...It`s a nice day!
"African Queen" läuft heute ab 21:45 Uhr auf Bayern 3...keine Werbeblöcke, dazu einen staubtrockenen Gin-Tonic und die Goldaktien steigen heute ebenfalls...It`s a nice day!

hallo liebe boarteilnehmer,
so langsam kommen wir nicht mehr mit und sind nicht mehr nachdenklich, sondern ratlos!!!
wenn man so heute mal die schlagzeilen der zeitungen auf sich wirken lässt, kommt man an einem sarkastischen grinsen wohl kaum vorbei. die situation wirkt auf uns mittlerweile grotesk:
Nicht, dass es genug sei, dass sich die weltwirtschaft auf einem absteigenden ast bewegt, die schuldenlast der westlichen welt täglich radikal anwächst und geopolitische risiken immer gegenwärtig sind.
nein, trotz der widriger umstände steigen die internationalen börsen.
da springen politiker mit fallschirm aus dem flugzeug und landen ohne, und einige tage später wird der besondere freund desjenigen des drogenkonsums beschuldigt. nein, aber auch das wir noch besser. der anwalt des besonderen freundes schickt versehentlich streng vertrauliche unterlagen an ein pizzeria und eine bild-ende zeitung sagt, es sein die staatsanwaltschaft gewesen.
da gibt es den neuen eu-ratspräsidenten b-cuoni der aus spd politikern kz-aufseher macht - und das im eu-parlament.
da gibt es revolten im irak, obwohl der krieg per dekret von schoosch doppel u beendet ist, ja selbst die deutsche bahn führt wieder die alte bahncard ein.
zigarette kosten bald 10 dm und die inflationsrate liegt bei rund 1,8 prozent.
der deutsche finanzminister legt mal ganz locker einen verfassungswiedrigen haushaltsentwurf vor und fliegen ist günstiger als zug fahren .
krankenkassen und rentenkassen stehen vor der pleite –werden es aber doch irgendwie nicht. Kfw und protektor helfen den banken – obwohl es keine bad-bank gibt...
leben wir in der welt der pappe?
sind freundschaft, hilfsbereitschaft, achtung, ehrlichkeit und ‚nachhaltigkeit’ keine werte mehr, die zumindest erstrebenswert scheinen?
den wein bei aldi gekauft und konsumiert, gold oder silber per put oder call im depot -
ja ist es denn das?
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER WELT AUS PAPPE!
einen schönen abend
svc
so langsam kommen wir nicht mehr mit und sind nicht mehr nachdenklich, sondern ratlos!!!
wenn man so heute mal die schlagzeilen der zeitungen auf sich wirken lässt, kommt man an einem sarkastischen grinsen wohl kaum vorbei. die situation wirkt auf uns mittlerweile grotesk:
Nicht, dass es genug sei, dass sich die weltwirtschaft auf einem absteigenden ast bewegt, die schuldenlast der westlichen welt täglich radikal anwächst und geopolitische risiken immer gegenwärtig sind.
nein, trotz der widriger umstände steigen die internationalen börsen.
da springen politiker mit fallschirm aus dem flugzeug und landen ohne, und einige tage später wird der besondere freund desjenigen des drogenkonsums beschuldigt. nein, aber auch das wir noch besser. der anwalt des besonderen freundes schickt versehentlich streng vertrauliche unterlagen an ein pizzeria und eine bild-ende zeitung sagt, es sein die staatsanwaltschaft gewesen.
da gibt es den neuen eu-ratspräsidenten b-cuoni der aus spd politikern kz-aufseher macht - und das im eu-parlament.
da gibt es revolten im irak, obwohl der krieg per dekret von schoosch doppel u beendet ist, ja selbst die deutsche bahn führt wieder die alte bahncard ein.
zigarette kosten bald 10 dm und die inflationsrate liegt bei rund 1,8 prozent.
der deutsche finanzminister legt mal ganz locker einen verfassungswiedrigen haushaltsentwurf vor und fliegen ist günstiger als zug fahren .
krankenkassen und rentenkassen stehen vor der pleite –werden es aber doch irgendwie nicht. Kfw und protektor helfen den banken – obwohl es keine bad-bank gibt...
leben wir in der welt der pappe?
sind freundschaft, hilfsbereitschaft, achtung, ehrlichkeit und ‚nachhaltigkeit’ keine werte mehr, die zumindest erstrebenswert scheinen?
den wein bei aldi gekauft und konsumiert, gold oder silber per put oder call im depot -
ja ist es denn das?
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER WELT AUS PAPPE!
einen schönen abend
svc
@svc
Mit anderen Worten: im Westen nichts Neues.
Mit anderen Worten: im Westen nichts Neues.

@svc
"HERZLICH WILLKOMMEN IN DER WELT AUS PAPPE"
Hast Du das auch schon gemerkt? Dann herzlichen Glückwunsch zur Erleuchtung....oder vielleicht auch herzliches Beileid.
Es ist manchmal besser, dem schönen Schein zu trauen, es ist Sommer, also schaltest Du nicht einfach das Gehirn aus und lässt Dich treiben wie die anderen 98,5 % der Deppen in unserer Gesellschaft.
Solltest Du Dich allerdings weiter von der "Pappwelt" abwenden, so lass Dir gesagt sein, daß Du fortan ein Outcast, ein Ausgestossener, ein Non-Konfirmist aka ein Goldbug sein wirst. Der Preis für diese Erkenntnis wird die Abkapselung von der Masse sein, Deine Gedankenwelt wird sich verdunkeln, versuche es mit Humor zu bekämpfen und Du wirst über das meiste in dieser Welt nur noch lachen können.
Das Wirtschaftssystem ist ein Witz, die Gesellschaft ist ein Witz, das ganze Sein ist absurd und sinnlos, ohne VErgangenheit und ohne Zukunft....Na, macht Diese Einsicht Spaß???
"HERZLICH WILLKOMMEN IN DER WELT AUS PAPPE"
Hast Du das auch schon gemerkt? Dann herzlichen Glückwunsch zur Erleuchtung....oder vielleicht auch herzliches Beileid.
Es ist manchmal besser, dem schönen Schein zu trauen, es ist Sommer, also schaltest Du nicht einfach das Gehirn aus und lässt Dich treiben wie die anderen 98,5 % der Deppen in unserer Gesellschaft.
Solltest Du Dich allerdings weiter von der "Pappwelt" abwenden, so lass Dir gesagt sein, daß Du fortan ein Outcast, ein Ausgestossener, ein Non-Konfirmist aka ein Goldbug sein wirst. Der Preis für diese Erkenntnis wird die Abkapselung von der Masse sein, Deine Gedankenwelt wird sich verdunkeln, versuche es mit Humor zu bekämpfen und Du wirst über das meiste in dieser Welt nur noch lachen können.
Das Wirtschaftssystem ist ein Witz, die Gesellschaft ist ein Witz, das ganze Sein ist absurd und sinnlos, ohne VErgangenheit und ohne Zukunft....Na, macht Diese Einsicht Spaß???

ja bitte, liebe kollegen - das ist keine neue erkenntnis - aber heute war wieder einer dieser besonderen tage.
wir sind schon einige tage dabei - und alter haase sg und alle anderen nicks, wir mögen dein zitat aus der rocky hooror picture show:
`und sinnlos, ohne VErgangenheit und ohne Zukunft....` und mögen es eränzen:
some insects, called the human race, lost in time and lost in space and without any meaning`.
unser posting war nicht ernst sonder unsere art lustig zu sein. wenn wir lachen wollen schaun mer mal in www.zyn.de.
svc
wir sind schon einige tage dabei - und alter haase sg und alle anderen nicks, wir mögen dein zitat aus der rocky hooror picture show:
`und sinnlos, ohne VErgangenheit und ohne Zukunft....` und mögen es eränzen:
some insects, called the human race, lost in time and lost in space and without any meaning`.
unser posting war nicht ernst sonder unsere art lustig zu sein. wenn wir lachen wollen schaun mer mal in www.zyn.de.
svc
Der Magambu lief mir schon im Wahnsinn von America über den Weg.
Woher kommt er Original


Culo.....und es stinkt an den Märkten.....es werden die Renten sein über die alles hochgeht


Woher kommt er Original



Culo.....und es stinkt an den Märkten.....es werden die Renten sein über die alles hochgeht



@ sov
Danke für den Tipp mit der "African Queen" - hab´s gerade noch geschafft die Kiste anzuschmeißen - war auch ohne Gordon Dry Gin köstlich...
@ culo
"Mogambo Guru" ist der in US-finance-sites recht bekannte Richard Daughty Seine bissigen Kommentare werden publiziert u.a. von Barron´s, www.dailyreckoning.com, www.federalobserver.com, www.goldseek.com usw.
Gruß Konradi
Danke für den Tipp mit der "African Queen" - hab´s gerade noch geschafft die Kiste anzuschmeißen - war auch ohne Gordon Dry Gin köstlich...

@ culo
"Mogambo Guru" ist der in US-finance-sites recht bekannte Richard Daughty Seine bissigen Kommentare werden publiziert u.a. von Barron´s, www.dailyreckoning.com, www.federalobserver.com, www.goldseek.com usw.
Gruß Konradi
@konradi
Na ja, Gordon Dry mit brackigem Flusswasser...ich weiß nicht ob sowas genießbar ist...
Tanqueray oder Bombay Sapphire sollten es zum Tonic schon sein, sonst bleibe ich lieber gleich beim Malt...
Na ja, Gordon Dry mit brackigem Flusswasser...ich weiß nicht ob sowas genießbar ist...

Tanqueray oder Bombay Sapphire sollten es zum Tonic schon sein, sonst bleibe ich lieber gleich beim Malt...

.
Bombay Sapphire ? - sorry, Sovereign, ich bin ja erbärmlicher Dilettant auf dem Gebiet, kommt das Zeugs aus Indien ?
Gin wird doch, wenn ich mich recht erinnere, mit Wacholder gewürzt ?
@ svc -
nur noch aus Pappe sind wohl bald unsere Innenstädte...
Sichtbare Rezession
von Jochen Steffens
Mir wurde etwas mulmig zu Mute, als ich heute morgen durch die Kölner Innenstand lief. Vor ein paar Wochen hatte ich Ihnen schon von den Industriegebieten rund um Köln erzählt, die langsam den Charakter von Geisterstädten bzw. Geister-Industriegebieten haben. Überall Gewerbeflächen zu vermieten, große Schilder, noch größere Schilder. Mich würde interessieren, wie sehr die Mieten dort bereits gefallen sind. Auch die vielen Büroflächen, die in Köln freistehen, waren mir bereits bei meiner Wohnungssuche aufgefallen.
Doch heute war ich etwas bestürzt. Ich entdeckte viele leerstehende Ladenlokale mit dem Schild "zu vermieten". Läden, an denen ich jahrelang vorbeigegangen bin, die für mich zum Stadtbild dazu gehörten (Ich wohne nun seit mehr als 15 Jahren in Köln). Der Supermarkt um die Ecke, leer, das Sonnenstudio, leer, das Fahrradgeschäft an der Ecke, leer – das Lederwarengeschäft weg. Die Boutique nicht mehr da. Das Schild "zu vermieten" drängte sich förmlich auf.
Ich weiß nicht, wie es in anderen Großstädten aussieht, aber ich vermute mal ähnlich. Vielleicht schreiben Sie mir mal etwas dazu. Das Bestürzende dabei ist, dass sich die Situation in den letzten Wochen wohl dramatisch zugespitzt haben muss. Denn ich bin eigentlich häufiger in der Stadt, oder habe ich die ganze Zeit dran vorbei gesehen?
Sicher, es war ja angekündigt: wenn dieses Jahr die Einzelhandelsumsätze nicht dramatisch anziehen, wird vielen Einzelhändlern die Puste ausgehen (ich hatte davon berichtet). Genau das scheint nun einzutreten. Und obwohl man darüber geschrieben hat, ist es in der Realität doch wieder erschreckend. Die Folgen dieser Rezession sind deutlich zu erkennen. Im Moment sind es nur die kleinen Geschäfte in den Seitenstraßen und noch sind auch einige Geschäftslokale wieder schnell vermietet. Aber wenn es noch ein, zwei Jahre so weiter geht ... Viele dieser Geschäfte werden durch "Ramsch-Geschäfte" ersetzt. "Billig-Schuhe", Lagerverkäufe und "alles für einen Euro" Geschäfte. Auch eine Form der Deflation.
Wenn Sie in Immobilien selbst, Immobilien-Fonds oder ähnlichem investiert sein sollten, dann gebe ich Ihnen den guten Rat genau zu überlegen, ob Sie ihr Geld nicht doch anders investieren wollen. Denn nicht zu vermietbare Ladenlokale und Büroräume werden die Preise für Immobilien bald drastisch sinken lassen. Schon jetzt scheint es schwierig zu sein, Immobilien an den Mann zu bringen, die Preise werden nicht mehr erzielt.
Noch ist wenigstens der Wohnungsmarkt in Köln unverändert überlaufen, aber einige teure Wohnungen stehen auch schon leer. Wenn immer mehr Arbeitslose immer billigere Wohnungen brauchen, dann werden auch irgendwann diese Mieten drastisch fallen müssen.
Denn auch die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird immer kritischer. Im Juni soll die Arbeitslosigkeit nach Angaben der "Welt" auf 4,3 Mio. angestiegen sein. Das ist die höchste Juni Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 350.000 Erwerbslose.
Trotzdem: die Börsen steigen. Sie steigen, weil gestern in Amerika ein starkes Kaufsignal generiert wurde. Das hatte wohl einige Kaufprogramme ausgelöst, so dass es zum Schluss hin zu weiter steigenden Kursen gekommen ist. Die Börsen steigen trotz (im Sinne von trotzig) der vielen schlechten Konjunkturdaten und sie steigen – nicht mehr lange. Heute werden die Auftragseingänge veröffentlicht, morgen die Arbeitsmarktdaten. Wenn sich beide Zahlen besser entwickeln, sehen wir vielleicht noch einmal einen Versuch die Hochs zu erreichen. Doch ich befürchte, wir haben die Höchstkurse in diesem Jahr gesehen.
Zum Ende dieser Woche wird es an den Börsen etwas mau werden, denn der Independence Day naht. Deswegen kommt es am Donnerstag schon zu verkürzten US-Handelszeiten. Am Freitag ruht dann der Handel in Amerika ganz. Die europäischen Börsen werden wie gewohnt ohne Impulse aus Amerika umsatzschwach mit leicht fallender Tendenz vor sich hindümpeln.
Eine Zahl noch kurz: China hat nun Japan als wichtigster deutscher Handelspartner in Asien abgelöst. So stieg der Export nach China um 20 % auf ein Volumen von 14,5 Mrd. Euro. Dagegen verringerte sich das Volumen der Exporte nach Japan um 7 % auf 12,2 Mrd. Euro
www.investor-verlag.de -02.06.03
Bombay Sapphire ? - sorry, Sovereign, ich bin ja erbärmlicher Dilettant auf dem Gebiet, kommt das Zeugs aus Indien ?
Gin wird doch, wenn ich mich recht erinnere, mit Wacholder gewürzt ?
@ svc -
nur noch aus Pappe sind wohl bald unsere Innenstädte...

Sichtbare Rezession
von Jochen Steffens
Mir wurde etwas mulmig zu Mute, als ich heute morgen durch die Kölner Innenstand lief. Vor ein paar Wochen hatte ich Ihnen schon von den Industriegebieten rund um Köln erzählt, die langsam den Charakter von Geisterstädten bzw. Geister-Industriegebieten haben. Überall Gewerbeflächen zu vermieten, große Schilder, noch größere Schilder. Mich würde interessieren, wie sehr die Mieten dort bereits gefallen sind. Auch die vielen Büroflächen, die in Köln freistehen, waren mir bereits bei meiner Wohnungssuche aufgefallen.
Doch heute war ich etwas bestürzt. Ich entdeckte viele leerstehende Ladenlokale mit dem Schild "zu vermieten". Läden, an denen ich jahrelang vorbeigegangen bin, die für mich zum Stadtbild dazu gehörten (Ich wohne nun seit mehr als 15 Jahren in Köln). Der Supermarkt um die Ecke, leer, das Sonnenstudio, leer, das Fahrradgeschäft an der Ecke, leer – das Lederwarengeschäft weg. Die Boutique nicht mehr da. Das Schild "zu vermieten" drängte sich förmlich auf.
Ich weiß nicht, wie es in anderen Großstädten aussieht, aber ich vermute mal ähnlich. Vielleicht schreiben Sie mir mal etwas dazu. Das Bestürzende dabei ist, dass sich die Situation in den letzten Wochen wohl dramatisch zugespitzt haben muss. Denn ich bin eigentlich häufiger in der Stadt, oder habe ich die ganze Zeit dran vorbei gesehen?
Sicher, es war ja angekündigt: wenn dieses Jahr die Einzelhandelsumsätze nicht dramatisch anziehen, wird vielen Einzelhändlern die Puste ausgehen (ich hatte davon berichtet). Genau das scheint nun einzutreten. Und obwohl man darüber geschrieben hat, ist es in der Realität doch wieder erschreckend. Die Folgen dieser Rezession sind deutlich zu erkennen. Im Moment sind es nur die kleinen Geschäfte in den Seitenstraßen und noch sind auch einige Geschäftslokale wieder schnell vermietet. Aber wenn es noch ein, zwei Jahre so weiter geht ... Viele dieser Geschäfte werden durch "Ramsch-Geschäfte" ersetzt. "Billig-Schuhe", Lagerverkäufe und "alles für einen Euro" Geschäfte. Auch eine Form der Deflation.
Wenn Sie in Immobilien selbst, Immobilien-Fonds oder ähnlichem investiert sein sollten, dann gebe ich Ihnen den guten Rat genau zu überlegen, ob Sie ihr Geld nicht doch anders investieren wollen. Denn nicht zu vermietbare Ladenlokale und Büroräume werden die Preise für Immobilien bald drastisch sinken lassen. Schon jetzt scheint es schwierig zu sein, Immobilien an den Mann zu bringen, die Preise werden nicht mehr erzielt.
Noch ist wenigstens der Wohnungsmarkt in Köln unverändert überlaufen, aber einige teure Wohnungen stehen auch schon leer. Wenn immer mehr Arbeitslose immer billigere Wohnungen brauchen, dann werden auch irgendwann diese Mieten drastisch fallen müssen.
Denn auch die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird immer kritischer. Im Juni soll die Arbeitslosigkeit nach Angaben der "Welt" auf 4,3 Mio. angestiegen sein. Das ist die höchste Juni Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 350.000 Erwerbslose.
Trotzdem: die Börsen steigen. Sie steigen, weil gestern in Amerika ein starkes Kaufsignal generiert wurde. Das hatte wohl einige Kaufprogramme ausgelöst, so dass es zum Schluss hin zu weiter steigenden Kursen gekommen ist. Die Börsen steigen trotz (im Sinne von trotzig) der vielen schlechten Konjunkturdaten und sie steigen – nicht mehr lange. Heute werden die Auftragseingänge veröffentlicht, morgen die Arbeitsmarktdaten. Wenn sich beide Zahlen besser entwickeln, sehen wir vielleicht noch einmal einen Versuch die Hochs zu erreichen. Doch ich befürchte, wir haben die Höchstkurse in diesem Jahr gesehen.
Zum Ende dieser Woche wird es an den Börsen etwas mau werden, denn der Independence Day naht. Deswegen kommt es am Donnerstag schon zu verkürzten US-Handelszeiten. Am Freitag ruht dann der Handel in Amerika ganz. Die europäischen Börsen werden wie gewohnt ohne Impulse aus Amerika umsatzschwach mit leicht fallender Tendenz vor sich hindümpeln.
Eine Zahl noch kurz: China hat nun Japan als wichtigster deutscher Handelspartner in Asien abgelöst. So stieg der Export nach China um 20 % auf ein Volumen von 14,5 Mrd. Euro. Dagegen verringerte sich das Volumen der Exporte nach Japan um 7 % auf 12,2 Mrd. Euro
www.investor-verlag.de -02.06.03
@konradi
Dir fehlt mehr Praxis auf dem Gebiet der Feldversuche des klassischen Ethanol-Konsums Merke: "Gordon Dry" ist kein anständiger Gin, OK er mag besser als "Beefeater" sein, aber wenn man einen klassisch leicht gewürzten Gin haben will, dann Tanqueray aus London. Wenn`s etwas aromatsicher sein soll, dann Bombay Sapphire (hellblaue Flasche mit nem Bildnis von Queen Victoria drauf). Das zeug wird seit 200 Jahren in London hergestellt (außer Wacholder ca. 10 sonstige Indigrenzien) und ist mit Tonic für heisse Sommertage geeignet, wenn ein Malt einfach zu "schwer" erscheint...
Merke: "Gordon Dry" ist kein anständiger Gin, OK er mag besser als "Beefeater" sein, aber wenn man einen klassisch leicht gewürzten Gin haben will, dann Tanqueray aus London. Wenn`s etwas aromatsicher sein soll, dann Bombay Sapphire (hellblaue Flasche mit nem Bildnis von Queen Victoria drauf). Das zeug wird seit 200 Jahren in London hergestellt (außer Wacholder ca. 10 sonstige Indigrenzien) und ist mit Tonic für heisse Sommertage geeignet, wenn ein Malt einfach zu "schwer" erscheint...

So jetzt ist es 19:00 Uhr, seit 12 Stunden werd ich andauernd angequatscht, das Wochenende kann ich diesmal auch vergessen, genau richtig um sich heute abend gepflegt einen reinzulöten...(aber nicht zu viel den Morgen früh geht der ganze Zirkus von vorne los).
Gruß
Sovereign
Dir fehlt mehr Praxis auf dem Gebiet der Feldversuche des klassischen Ethanol-Konsums
 Merke: "Gordon Dry" ist kein anständiger Gin, OK er mag besser als "Beefeater" sein, aber wenn man einen klassisch leicht gewürzten Gin haben will, dann Tanqueray aus London. Wenn`s etwas aromatsicher sein soll, dann Bombay Sapphire (hellblaue Flasche mit nem Bildnis von Queen Victoria drauf). Das zeug wird seit 200 Jahren in London hergestellt (außer Wacholder ca. 10 sonstige Indigrenzien) und ist mit Tonic für heisse Sommertage geeignet, wenn ein Malt einfach zu "schwer" erscheint...
Merke: "Gordon Dry" ist kein anständiger Gin, OK er mag besser als "Beefeater" sein, aber wenn man einen klassisch leicht gewürzten Gin haben will, dann Tanqueray aus London. Wenn`s etwas aromatsicher sein soll, dann Bombay Sapphire (hellblaue Flasche mit nem Bildnis von Queen Victoria drauf). Das zeug wird seit 200 Jahren in London hergestellt (außer Wacholder ca. 10 sonstige Indigrenzien) und ist mit Tonic für heisse Sommertage geeignet, wenn ein Malt einfach zu "schwer" erscheint...

So jetzt ist es 19:00 Uhr, seit 12 Stunden werd ich andauernd angequatscht, das Wochenende kann ich diesmal auch vergessen, genau richtig um sich heute abend gepflegt einen reinzulöten...(aber nicht zu viel den Morgen früh geht der ganze Zirkus von vorne los).
Gruß
Sovereign

@konradi: der Mogamba ist schon eine Marke...werde ihn verfolgen.
Zu Gin: da hat sov recht...ein Tanqueray in der komisch grünen Pulle ist gut ...aber ein Saphire...mit einem P in seiner saphirblauen Aufmachung ist ganz was feines ...mach dir daraus mal Gimlet...ist in D sauteuer...in San Marino um 10 T€uronen.
@Sov: die Buben haben alle keinen Stil...können sich nicht mal anständig zusaufen.
Culo....und die Lemmingpusher sind göttlich


Zu Gin: da hat sov recht...ein Tanqueray in der komisch grünen Pulle ist gut ...aber ein Saphire...mit einem P in seiner saphirblauen Aufmachung ist ganz was feines ...mach dir daraus mal Gimlet...ist in D sauteuer...in San Marino um 10 T€uronen.
@Sov: die Buben haben alle keinen Stil...können sich nicht mal anständig zusaufen.
Culo....und die Lemmingpusher sind göttlich



@moin


gruss drag


gruss drag
Wer sich für die ganze "Miesmacherbande" interessiert, klickt einfach mal http://www.dailyreckoning.com/body_index6.cfm?
J2
J2



He, so heiss ist es doch gar nicht, oder hat es dich in den Süden verschlagen.
Gruß Basic
Gruß Basic
sag mal sov, wo ist eigentlich der Start "Thread" vom Stosstrupp geblieben? Wurde der wieder gesperrt?
.
aahhh !
das Goldminenforum ist doch wirklich eine Schule für´s Leben ...
Aber was den Beefeater angeht: ´ne ganz miese Plörre kann´s ja wohl nicht sein:

Tributes to the Queen Mother
Gin memorial at Clarence House
A Beefeater gin bottle joins the floral tributes to Britain`s Queen Elizabeth, the Queen Mother, outside her residence at Clarence House in London. The Queen Mother, who was reputedly fond of gin and tonic, died on March 30 aged 101, and her funeral will take place on April 9
Allen ein schönes Wochenende
Konradi
.
aahhh !

das Goldminenforum ist doch wirklich eine Schule für´s Leben ...
Aber was den Beefeater angeht: ´ne ganz miese Plörre kann´s ja wohl nicht sein:

Tributes to the Queen Mother
Gin memorial at Clarence House
A Beefeater gin bottle joins the floral tributes to Britain`s Queen Elizabeth, the Queen Mother, outside her residence at Clarence House in London. The Queen Mother, who was reputedly fond of gin and tonic, died on March 30 aged 101, and her funeral will take place on April 9
Allen ein schönes Wochenende
Konradi

.
@konradi
Ich sage ja nicht, daß Beefeater mies ist, es gibt aber Besseres! Wenn Du einen miesen Gin suchst nimm Finsbury...
Außerdem sagt Dein Bild alleine noch nichts aus...auch beim Grabschmuck wird heutzutage gespart...
Ich sage ja nicht, daß Beefeater mies ist, es gibt aber Besseres! Wenn Du einen miesen Gin suchst nimm Finsbury...
Außerdem sagt Dein Bild alleine noch nichts aus...auch beim Grabschmuck wird heutzutage gespart...

guten abend,
da ist sie nun, die deutsche `bad-bank` in form des bank-leguans kfw. so werden die umts-erlöse nun wieder unter das volk gebracht.
übrigens gibt es eine neue einschätzung von malik, in welcher er, welcher von einem rückfall des pog auf unter 300 usd philosophiert hat, nun vermutungen anstellt , dass die korrektur nun evtl, beendet sein. durchaus lesenswert.
nun zur bad-bank
04.07.2003 - 14:40 Uhr
KfW und Banken unterzeichnen True-Sale am Mittwoch
Frankfurt (vwd) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und 13 Kreditinstitute werden am kommenden Mittwoch ihre gemeinsame Verbriefungsinitiative besiegeln. Wie aus einer Einladung der KfW am Freitag hervorgeht, soll dann ein entspechender "Letter of Intent" von den Beteiligten unterzeichnet werden. Neben der KfW nehmen die Bayerische Landesbank, Citibank, Commerzbank, Dresdner Bank, Deutsche Bank, DekaBank, DZ Bank, Eurohypo, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, HSH Nordbank, die HypoVereinsbank und die WestLB teil.
Die Unterzeichnung der Absichtserklärung werde jeweils von einem Vorstand geleistet, hieß es weiter. An der True-Sale-Initiative sind damit Institute aus allen drei Segmenten des deutschen Bankensystems beteiligt. Die Institute können mit dem Instrument der True-Sale-Verbriefungen Kredite ausplatzieren. Dadurch soll den Banken Spielraum zur Ausreichung weiterer Kredite an den Mittelstand gegeben werden. Die erste Transaktion soll früheren Angaben zufolge noch in diesem Jahr stattfinden.
+++ Christian Streckert
vwd/4.7.2003/ces/ip
svc
da ist sie nun, die deutsche `bad-bank` in form des bank-leguans kfw. so werden die umts-erlöse nun wieder unter das volk gebracht.
übrigens gibt es eine neue einschätzung von malik, in welcher er, welcher von einem rückfall des pog auf unter 300 usd philosophiert hat, nun vermutungen anstellt , dass die korrektur nun evtl, beendet sein. durchaus lesenswert.
nun zur bad-bank
04.07.2003 - 14:40 Uhr
KfW und Banken unterzeichnen True-Sale am Mittwoch
Frankfurt (vwd) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und 13 Kreditinstitute werden am kommenden Mittwoch ihre gemeinsame Verbriefungsinitiative besiegeln. Wie aus einer Einladung der KfW am Freitag hervorgeht, soll dann ein entspechender "Letter of Intent" von den Beteiligten unterzeichnet werden. Neben der KfW nehmen die Bayerische Landesbank, Citibank, Commerzbank, Dresdner Bank, Deutsche Bank, DekaBank, DZ Bank, Eurohypo, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, HSH Nordbank, die HypoVereinsbank und die WestLB teil.
Die Unterzeichnung der Absichtserklärung werde jeweils von einem Vorstand geleistet, hieß es weiter. An der True-Sale-Initiative sind damit Institute aus allen drei Segmenten des deutschen Bankensystems beteiligt. Die Institute können mit dem Instrument der True-Sale-Verbriefungen Kredite ausplatzieren. Dadurch soll den Banken Spielraum zur Ausreichung weiterer Kredite an den Mittelstand gegeben werden. Die erste Transaktion soll früheren Angaben zufolge noch in diesem Jahr stattfinden.
+++ Christian Streckert
vwd/4.7.2003/ces/ip
svc
.
Der Kotti kommt vom Tropf

Berlin-Kreuzberg, Kottbusser Tor: Deutschlands älteste Sanierungs-Story geht nach fast vier Jahrzehnten zu Ende. Die Hoffnung, mit Städtebau Sozialpolitik betreiben zu können, ist gescheitert. Spaziergang durch ein aufgegebenes Biotop
Von Andreas Molitor
Der Hausbesetzer Schorsch wohnt jetzt in Brieselang. Falkensee war zu teuer, wer will schon 300000 Euro für ein Reihenhaus bezahlen? Also ist Schorsch mit seiner Frau noch ein paar Kilometer weiter hinaus ins märkische Land gezogen. Brieselang liegt zwanzig Kilometer Luftlinie von Berlin-Kreuzberg entfernt, Lichtjahre weg. Der Weg zu Schorschs Doppelhaushälfte, mit offener Küche und Kamin im Wohnzimmer, führt zuerst über Asphalt, dann über Kopfsteinpflaster, schließlich über Schlammwege. Im Hausflur reicht Schorsch Filzpantoffeln. Der Holzfußboden, sagt er, sei so empfindlich.
Georg „Schorsch“ Uehlein, 47 Jahre, alter Kreuzberger Hausbesetzeradel, kam vor sieben Jahren im Einfamilienhausidyll an. Er hat Berlin-Kreuzberg verlassen, wie so viele der Weggefährten aus alten Kampftagen, die nun an die fünfzig Jahre alt sind. Am Nachmittag kommt einer von ihnen zum Kaffee vorbei, der wohnt in Kleinmachnow. Einen hat es nach Lichtenrade verschlagen, einen anderen nach Frohnau. Und Ulrike, ach, die wohnt irgendwo hinter Pankow, Schorsch hat vergessen, wie das Dorf heißt. Sie haben Abschied genommen von Kreuzberg, von wilden Zeiten und krausen Träumen, von alledem.
1980, im Februar, besetzte Schorsch mit seinen Kumpeln das Haus in der Kohlfurter Straße 46. Es war die achte Hausbesetzung in Kreuzberg, vielleicht auch die neunte, wer weiß das noch? Schorsch, heute Politiklehrer an einem Gymnasium, stand damals „eher gegen die Gesellschaft“. Gegen die Spekulanten und die Abrissbagger natürlich. Ein paar Jahre lang führte er ein Leben zwischen Blockrat, Blockkasse und Blockfesten, Nachtwachen und Funkwachen, Barrikadenausschuss und Handwerkerausschuss. Manche Aktionen waren „bisschen kriminell“, sagt Schorsch heute grienend. Da gab es die „Frühstücksguerilla“, die sich beim Sekt fantasievolle Anschläge überlegte, Pudding-Attentate auf Politiker, die aber nie realisiert wurden.
Daheim hat Schorsch noch die alten Agitprop-Broschüren, mit Schreibmaschine verfasst und zu DIN-A4-Heften geklammert. Zwischen den Broschüren steht ein Buch des Berliner Architekturkritikers Dieter Hoffmann-Axthelm. Es heißt Straßenschlachtung und beschreibt, was damals passierte in Schorschs Revier, dem Viertel rund um den U-Bahnhof Kottbusser Tor: Ganze Straßen wurden hingerichtet, planmäßig exekutiert. Hier standen Schorsch und die Seinen, dort Politik und Wohnungsbau mit ihrer Logik von Abriss und Neubau. Fast zwei Jahrzehnte hatten die Schlächter damals schon gewütet und ihre geschichts- und gesichtslosen Wohnwürfel tief in die Kreuzberger Stadtlandschaft gerammt. „Sanierung“ nannte man das.
Jetzt, noch einmal zwei Jahrzehnte später, herrscht wieder Frieden am Kottbusser Tor. Die Abrissbagger sind lange abgezogen, der Feind ist irgendwie abhanden gekommen. Frühere Hausbesetzer wohnen in behutsam modernisierten Altbauten, man trifft sich gegen Mittag zum Frühstück im Café und geht anschließend zur Weinhandlung Suff, um einen Rosso Toscano für den Abend zu kaufen. Die neue Kreuzberger Welt ist postmodern, weltoffen und multikulturell. Einerseits.
Andererseits ist Kreuzberg und besonders das Viertel am Kottbusser Tor die ärmste Gegend von ganz Berlin – mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen, den meisten Sozialhilfeempfängern und der höchsten Arbeitslosenquote. Und Schorsch, der seinerzeit gegen die „soziale Durchmischung“ und die „Schickimickisierung“ des Viertels kämpfte, „weil die parasitär ist“, sitzt in Brieselang, ein Lupo steht in der Einfahrt, und drinnen duftet es nach Apfelkuchen. „Na ja, nur Armutsbevölkerung bringt’s irgendwie auch nicht“, sagt er. Das ist wohl die Brieselanger Sicht der Dinge. „Dass Leute nach Kreuzberg kommen, die genug soziales Potenzial haben, das Viertel nach vorn zu bringen, da bin ich nicht mehr so dagegen.“
Kein anderer Stadtwinkel im ehemaligen West-Berlin ist so symbolträchtig wie Schorschs früheres Biotop rund um das Kottbusser Tor, das „wirkliche“ Kreuzberg: Kiezidyll und Turkish Town, Betontristesse und Drogensumpf, kaputte und reparierte Stadt, Szene-Boheme und deutsche Bierdimpfligkeit. Am Kottbusser Tor wurde alles ausprobiert, was irgendwann einmal als Sanierung galt – man hat abgerissen und neu gebaut, zerstört und repariert, modernisiert und verschönert, mal brachial, mal behutsam. Nirgendwo sonst in Deutschland lassen sich die verschiedenen Phasen, Philosophien und Strategien von Stadtsanierung mitsamt allen Irrwegen und in Beton verewigten Paradigmenwechseln auf so engem Raum erleben.
Die wohl endgültig letzte Kehrtwendung erfolgte im vergangenen Jahr: Nach fast vier Jahrzehnten wurde Deutschlands ältestes und berühmtestes Stadterneuerungsgebiet „aus der Sanierung entlassen“, wie es im Planungsdeutsch heißt. 39 Jahre Staatshilfe sind genug, fand Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (SPD) und beschied: „Schluss mit dem Sozialismus in Kreuzberg!“
Das Kreuzberg Museum in der Adalbertstraße95 ist eine Art Grenzkontrollpunkt. Genau bis hierhin ist die Kahlschlagsanierung Mitte der Siebziger geschwappt, von Süden die Straße hoch, und hat ihr Treibgut angespült: uniforme Neubauten in Quadern und Zeilen. Das wohl eindrucksvollste Zeugnis des Machbarkeitswahns jener Jahre, ein Wohnlindwurm für tausend Menschen, dem man seinerzeit den Namen Neues Kreuzberger Zentrum (NZK) verpasste, liegt wie ein Riegel quer über der Straße. Direkt im Schatten dieses architektonischen Sündenfalls zeigt das Kreuzberg Museum derzeit eine Ausstellung über die lange Geschichte der Sanierung rund ums Kottbusser Tor, von manchen liebevoll-schnoddrig „Kotti“ genannt.
In der Ausstellung erinnert ein elektrischer Zimmerspringbrunnen aus Vollplastik daran, dass es am Kotti einmal Dutzende von Kleinfabriken gab. Tränengasdose und Autonomen-Lederkluft als Reminiszenz an vergangene Krawallzeiten dürfen natürlich nicht fehlen. Zwischen all den Reliquien hängt auch die erste Single der Rockband Ton, Steine, Scherben, Macht kaputt, was euch kaputt macht, 1970 in einem Hinterhofstudio ein paar Straßenzüge weiter aufgenommen.
Die Sanierung am Kotti ist nur noch ein Fall fürs Museum. 23 Sanierungsgebiete konnte sich das bankrotte Berlin nicht länger leisten. Anderthalb Milliarden Euro öffentlicher Mittel wurden am Kottbusser Tor verbaut, 30000 Wohnungen abgerissen, neu gebaut oder modernisiert. Mit welchem Erfolg? „Eine Abfolge von Vergeblichkeiten“ könne man am Kottbusser Tor studieren, urteilt der Berliner Architekt Erhart Pfotenhauer, der hier fast jeden Hinterhof kennt. „Bei mir kommt immer wieder Empörung hoch, wie der träge Berliner Apparat jahrzehntelang plant und plant und am Ende Ruinen dabei rauskommen.“
Der zuständige Senator, der Kreuzberg nicht länger alimentieren will, sieht das naturgemäß völlig anders. „Ohne Zweifel war die Sanierung erfolgreich“, sagt Peter Strieder. Aber hätte man mit dem vielen Geld nicht Besseres zuwege bringen können? „Ach, was sind anderthalb Milliarden Euro“, entgegnet Strieder, „wenn Sie dafür einen Stadtteil retten?“
Wie sieht ein Stadtviertel aus, dem man fast vier Jahrzehnte Sanierung hat angedeihen lassen und von dem nun behauptet wird, es sei gerettet worden? Erfolgreich saniert – was heißt das? Gibt es einen Wohnviertel-Zufriedenheitsindex? Misst man den Erfolg einer Sanierung an der Zahl modernisierter Wohnungen, an der Quote eingebauter Innenklos, der Versorgung mit Kita-Plätzen, dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen, der Kriminalitätsrate, der Anzahl blumenkübelgeschmückter Spielstraßen? Wird man zusätzlich die Sushi- und Cocktailbar-Dichte als Indikator heranziehen?

Am Anfang stand die Vision von der neuen, zeitgerechten Stadt. Gemäß dem städtebaulichen Leitbild von Licht, Luft und Sonne war geplant, die Altbauquartiere im Mietskasernengürtel um die Berliner Innenstadt weitgehend abzureißen und durch moderne Großwohnanlagen zu ersetzen. 1963 wurden zehn Viertel im Westteil der Stadt zu Sanierungsgebieten erklärt – darunter das am Kottbusser Tor. Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister, sah in der Sanierung eine „unaufschiebbare Verpflichtung, mit deren Erfüllung auch nicht einen Tag zu früh begonnen wird“. Mit Sanierung im großen Stil gab es in Deutschland bis dahin keine Erfahrungen. Fasziniert schauten die Städteplaner und Architekten nach Amerika. Dort wurden zu jener Zeit etliche der verfemten Elendsquartiere weggefräst, neue Wohngebirge für Zehntausende geschaffen. In Chicago entstand mit den Robert Taylor Homes damals die größte Sozialsiedlung der Welt.
Das im Schatten der erst zwei Jahre zuvor errichteten Mauer dahindämmernde Viertel Kottbusser Tor in Berlin, mit 37000 Einwohnern und 17000 Wohnungen das größte Sanierungsgebiet der geteilten Stadt, war eine tote Zone. Wer von „Mietskasernen“ sprach, meinte solche Gegenden: enge, uniforme Korridorstraßen mit düsteren Hinterhöfen und verschatteten Seitenflügeln, Bombenkrater dazwischen. Dieses Kreuzberg sollte untergehen. Einen Vorgeschmack auf das neue Kreuzberg, warm, sauber und bequem, lieferte das erste neue Hochhaus am Kottbusser Tor, bereits 1955 errichtet. Mit Müllschlucker, Teppichabsauganlage und Waschzentrale – vorbildlich.
Herzstück der Sanierungspläne war der Bau eines Tangentensystems von Stadtautobahnen um das alte, im Osten gelegene Berliner Zentrum herum. Zwei Trassen sollten quer durch Kreuzberg geschlagen werden, größtenteils als Viadukte über dichter Bebauung. So sahen es die Planungen für die „Hauptstadt Berlin“ aus den fünfziger Jahren vor. Auch nach dem Mauerbau hielt man an dem Konzept einer von Asphaltpisten durchschnittenen, autogerechten Stadtlandschaft fest. „Jede zweite Wohnung erhält einen Parkplatz“, heißt es Anfang der Siebziger in einer Sanierungsbroschüre, „entweder unterirdisch oder in einem Parkhaus. Sollte später einmal zu jeder Wohnung ein Auto gehören, kann die fehlende Hälfte der Parkplätze nachgebaut werden.“ So rückten die Bagger an.
Neue Sünden wurden begangen, frische Wunden in das Fleisch der Stadt gerissen. Die „Straßenschlachtung“ begann, jene „historisch einmalige Großaktion der vorsätzlichen Stadtzerstörung“, wie der Kritiker Dieter Hoffmann-Axthelm schrieb, und zwar „langsam, bei lebendigem Leibe“. Die Sanierungsträger, in der Mehrzahl gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften, entwickelten sich zu Abriss- und Neubaumaschinen. Ihr Werk verrichteten sie zu Preisen, die im Schnitt 40 Prozent über dem westdeutschen Niveau lagen. Sanierung hieß vor allem Selbstbedienung. Es gab keine Synthese zwischen Alt und Neu. Wie Hohn klingt aus heutiger Sicht folgende Passage aus einer Broschüre des Senats von 1974: „Nicht jedes Haus wird abgerissen. Die Neubauten bleiben grundsätzlich erhalten.“
Die Altbauquartiere lagen in Agonie. In einem Block durften amerikanische Soldaten im neunundsiebziger Herbst Häuserkampf trainieren. Nachts standen die Panzer mit laufendem Motor auf der Straße. Nicht selten erging es Bewohnern so wie den Mietern in der Skalitzer Straße 114. Eines Morgens wurden sie wach, weil die Wände zitterten und der Fußboden bebte. Sie schauten aus dem Fenster und sahen gerade noch, wie das Nachbarhaus unter den Schlägen der Abrissbirne in einer Staubwolke zusammenfiel.

Rollkommandos halfen nach, als Altbaumieter sich sträubten
Die Mieter in den Abrisshäusern waren variable Masse im Kalkül der Sanierungsträger. Zu gegebener Zeit teilte man ihnen den Auszugstermin mit. Irgendwo mussten sie ja untergebracht werden, bis die Neubauten fertig waren. Viele zogen auch ganz weg aus Kreuzberg. Die Wohnungsbaugesellschaften spendierten Bus-Schnupperfahrten nach Gropiusstadt oder ins Märkische Viertel, um den Menschen aus den Altbauten das Wohnen in der modernen Trabantenstadt schmackhaft zu machen. An manchen Tagen standen die Mieter vor den Büros der „Umsetzer“ Schlange.
Von einer adretten Wohnung träumte damals auch Horst Wiessner. Mit seiner Frau lebte er in einer großen Altbauwohnung in der Oranienstraße in Kreuzberg. Genau vor seinem Wohnzimmerfenster, hatte man ihm gesagt, würde künftig der stete Strom von Blechkarossen auf dem Autobahnviadukt entlangfließen. Die Wiessners zogen aus.
Ihr neues Domizil lag nur wenige Schritte entfernt. Jene Trutzburg des sozialen Wohnungsbaus, die gerade direkt am U-Bahnhof Kottbusser Tor emporwuchs, faszinierte Horst Wiessner. Neues Kreuzberger Zentrum, das klang modern, nach Aufbruch und Zukunft. „NKZ“ dagegen, das bald geläufigere Kürzel, verhieß bereits Unheilvolles.
Der 1970 vorgestellte Komplex, seinerzeit geplant mit Lesehof, Schwimmbad, Terrassencafé und Kino, sollte das Meisterstück der Sanierung werden. „Handels-, Kultur- und Wohnbereich bilden eine zwanglose Einheit mit Künstlern, Hofsängern, Leierkastenmännern und Büchereibesuchern“, versprachen die Bauherren. Niemand hätte damals geglaubt, dass ernst zu nehmende Politiker knapp 30 Jahre später fordern würden, das NKZ abzureißen. Am allerwenigsten wohl jene Ärzte und Anwälte aus Westdeutschland, die ihr Geld in das Projekt gesteckt hatten, angelockt von sagenhaften 200 Prozent Abschreibequote.
Am Bau des NKZ entflammte erstmals Kritik gegen die Stadterneuerung per Abrissbirne. Zehn Sanierungsjahre waren vergangen und mit ihnen die Euphorie vom Bau der neuen Stadt. So mancher Kreuzberger begann beim Anblick der Planungen für das Betonband mit 295 Wohnungen daran zu zweifeln, dass es tatsächlich keine Alternative zum Abriss eines ganzen Stadtviertels geben könnte.
Schon bald kursierten die ersten Flugblätter gegen Sanierungsträger und Spekulanten. Etwa jenes, das den Chef der Neues Kreuzberger Zentrum GmbH als „Feind der Bevölkerung Kreuzbergs“ anprangerte, verantwortlich „für die Vertreibung von 250 Arbeitern, Rentnern und kleinen Ladenbesitzern“ und außerdem schuld an der „Verteuerung der Lebensmittel in der Zukunft, weil sich seine hohen Mieten auf die Lebensmittelpreise auswirken werden“.
Auch Horst Wiessner zahlte nun deutlich mehr Miete – 345 Mark statt wie bisher 75. Von seiner Terrasse aus beobachtete er, wie Rollkommandos der Sanierer nachhalfen, wenn Altbaumieter sich gegen den Abriss sträubten. „Von hier oben sahen wir Rauch, und wir hörten es scheppern. Die haben einfach die Dachstühle angezündet und in den Häusern die Sanitäranlagen kaputtgeschlagen.“ Wiessner wurde Zeuge des rapiden Verfalls seines kleinen Garten Eden. Mit den Jahren zogen immer mehr anständige Mieter weg. Für sie kamen neue Leute, die den Abfall manchmal aus dem Fenster schmissen.
Der Platz im Schatten des NKZ verkam zur Niststätte des Elends. Die vielen Winkel dienten den neonbleichen Heroinsüchtigen vom Kottbusser Tor als Unterschlupf. Morgens trat man auf den Treppen in Kot, Erbrochenes und gebrauchte Spritzen. Hin und wieder lag auch eine Leiche im Hausflur. Schon 15 Jahre nach seiner Fertigstellung war das Prunkstück der Sanierung selbst schon wieder ein Sanierungsfall und wurde von der Presse als „verkommenes Monstrum“ gegeißelt. Direkt gegenüber sekundierte die Aufschrift auf einer Hauswand symbolträchtig: „Revolution ist die einzige Lösung!“
Vor fünf Jahren verlangte der damalige Berliner CDU-Fraktionschef Klaus Landowsky, man müsse „den Mut haben, das Neue Kreuzberger Zentrum zu sprengen“. In dem Gebäude lebe „nur noch Restbevölkerung, die nicht mehr stadttypisch ist“. Statt des Sprengmeisters kam Peter Ackermann. Der damals 59-jährige Wirtschaftsanwalt mit Büro in bester Lage am Kurfürstendamm übernahm 1999 die soziale Intensivstation NKZ und begab sich daran, das „Burgghetto der Sozialfälle“ umzukrempeln. Der Kotti soll wieder Eingangstor zum hinteren Kreuzberg werden – und das meistgehasste Gebäude Berlins sich zu dem Modell-Sanierungsbau mausern, den seine Schöpfer sich einst erträumt hatten. Wenn auch ohne Hofsänger.
Ökonomisch gesehen, führt Ackermann einen fast aussichtslos erscheinenden Kampf. Der mit rund 20 Millionen Euro verschuldete Komplex „ist nichts wert, nicht mal die Kosten des Abrisses“. Allein die Mieteinnahmen, knapp zweieinhalb Millionen Euro jährlich, lassen sich gegen die Schulden aufrechnen. Seit Jahren managt er eine Firma am Rande der Insolvenz. Manchmal haben seine Hausmeister nicht mal Geld für ein paar Eimer Farbe.
Wer seine Miete nicht zahlen kann, fliegt raus
Umso wichtiger waren anfangs symbolische Schritte. Als Erstes verpasste Ackermann dem NKZ einen neuen Namen. „Zentrum Kreuzberg – Kreuzberg Merkezi“, steht jetzt mit Leuchtschrift auf der bordeauxviolett gestrichenen Betonbrücke über der Adalbertstraße. „Das Gebäude ist wie ein Engel mit ausgebreiteten Armen“, hat Ackermann früher gesagt, „ein Engel, der hier steht und den Platz umfasst.“ Er ließ 150 Abfallkörbe aufstellen, die täglich geleert werden, stellte zwei neue Hausmeister ein, eine Architektin, einen Elektriker und eine Ingenieurin. Ackermann ist froh, wenn die Heizungsanlage mal wieder einen Winter überstanden hat. An der Platzspitze würde sich ein Straßencafé gut machen, meint Ackermann, ein schicker Italiener könnte die triste Galerie aufwerten. Es kursierten sogar schon Pläne mit Gucci- und Cartier-Läden.
Ohne Leute wie Horst Wiessner stünde Peter Ackermann auf verlorenem Posten. Der mittlerweile 80-Jährige, die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, ließ sich nicht zur „Restbevölkerung“ aussortieren, sondern entwickelte sich zum Chef-Kümmerer des Hauses. Wiessner übernahm den Vorsitz des Mieterbeirats, putzte die Hausflure, machte jeden Tag stundenlang den neuen Spielplatz sauber, räumte den Müll weg, beseitigte Heroinspritzen, Kanülen und Kot.
Aber schon wieder ist der Friede gefährdet. Im Zentrum Kreuzberg ist die Zeit des gemütlichen Kotti-Kapitalismus jetzt vorbei. Nachdem der Komplex 30 Jahre am Subventionstropf gehangen hat, muss er es ab Anfang 2005 ohne öffentliche Finanzhilfen schaffen. Das Land Berlin kann sich die Hilfe nicht mehr leisten. Für Peter Ackermann bedeutet das: Er muss jeden Euro eintreiben, der ihm zusteht, und die Szene schimpft auf ihn wie einst auf die Spekulanten.
Vor zwei Wochen hat ihm die Landesbank Berlin mit einer Zinsstundung Luft verschafft. Ackermann kann in den nächsten anderthalb Jahren 600000 Euro in das Gebäude investieren und einige Ladenlokale überhaupt erst in einen vermietbaren Zustand bringen.
Das Fürsorgliche ist ihm abhanden gekommen, die Strenge ist geblieben. Konsequent treibt er Mietrückstände ein. Wer nicht zahlen kann, fliegt raus. Schon bei einem Monat Mietrückstand lässt Ackermann den Strom abstellen, pfänden und räumen. Auch wer gegen vereinbarte Nutzungen verstößt, beispielsweise Dosenbier verkauft statt Bücher, erhält sofort die Kündigung. Sogar mit Horst Wiessner hat sich Ackermann jetzt überworfen. Wiessner, der Ackermanns Sanierungskurs jahrelang unterstützt hatte, empörte sich derart über eine Betriebskosten-Nachzahlung, dass er alle Mieter zum Boykott aufrief. Ackermann konterte mit einer Klage. Nun reden die beiden nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander.
Im Zentrum Kreuzberg steht selten eine Wohnung leer. Peter Ackermann weiß trotzdem, dass er dringend neue Mieter braucht – andere als jene, die alte Kühlschränke und Waschmaschinen einfach in den Aufzug stellen und dann auf „EG“ drücken. Es fehlen Menschen, denen es nicht egal ist, wie es in ihrem Haus aussieht. Und Leute, die das Wohnen im Beton en vogue finden.
Niemand bezweifelt heute, dass Bauten wie das Zentrum Kreuzberg Modell stehen für das totale Scheitern der in den Siebzigern praktizierten Kahlschlagsanierung. In den fast drei Jahrzehnten nach seiner Fertigstellung war man unablässig – und meist vergeblich – bemüht, die städtebaulichen und sozialen Folgeschäden einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Vieles blieb irreparabel. Angesichts einer derart vernichtenden Bilanz wundert man sich fast, wie viel Normalität das Zentrum Kreuzberg trotz allem beherbergt. Isabella Scheel, eine junge Fotografin, hat für die Kotti-Ausstellung im Kreuzberg Museum Mieter mitsamt ihres Wohnzimmer-Interieurs abgelichtet. Fast über-all fand sie Einlass.
Die Fotos zeugen vom rührenden Bemühen, einen guten Schuss Behaglichkeit in das Innere der abgenutzten Betonästhetik zu injizieren. Vor allem die Migrantenfamilien klotzen mit schweren Clubgarnituren und beleuchteten Schrankwänden aus dem Mitnahmemarkt. Erstaunlich, wie sauber und sortiert es aussieht. Auf keinem Tisch fehlt ein Deckchen. Eine türkische Familie hat sich teures Parkett legen lassen, auf eigene Kosten. „Ich lasse meine Tochter unten nicht spielen“, sagt die Mutter. Sie hat Angst, das Kind könnte sich an einer weggeworfenen Heroinspritze verletzen. „Es ist so schade“, sagt sie zum Abschied, „dass fast alle anständigen Deutschen von hier weggezogen sind.“
Ende der Siebziger glaubte niemand mehr an jene Visionen, die einst als raison d’être der Stadterneuerung hergehalten hatten. Trotzdem drehte sich das Sanierungskarussell immer schneller – ohne Frage nach dem Sinn.
Die stellte ein Mann, der sich als Zweifler aus Prinzip schon einen Ruf erworben hatte: Hardt-Waltherr Hämer, volksnaher Architekt und Stadtplaner. Nach einem vergeblichen Versuch im Berliner Stadtteil Wedding Ende der Sechziger war es ihm zehn Jahre später erstmals gelungen, das Interessenkartell aus Politik, Bauverwaltung und Sanierungsträgern auszuhebeln und in Charlottenburg einen Altbaublock mit 415 Wohnungen vor den Abriss-baggern zu retten. Der Block 118 am Klausener Platz war seine Generalprobe. Hämer hatte die „behutsame Stadterneuerung“ erfunden und bewiesen, dass sein Credo „Altbausanierung vor Abriss“ in der Praxis funktioniert – auch ökonomisch: Die vorsichtige Modernisierung kostete ein Drittel weniger als Abriss und Neubau.
Die Sanierung sorgte für neue Innenklos und dichte Dächer
Was Hämer dann am Kottbusser Tor vorfand, nannte er „kaputte Stadt“. Unter seiner Leitung nahm Ende 1979 die Internationale Bauausstellung (IBA) Berlin ihre Arbeit auf. Hämers Leute hatten einen einzigen Auftrag: „Kaputte Stadt retten!“ Er forderte die totale Kehrtwende in der Sanierungspolitik. Behutsame Modernisierung in enger Abstimmung mit den Mietern, statt sie zu vertreiben oder anschließend mit horrenden Mieterhöhungen zu drangsalieren. Hämer, der „Beteiligungsarchitekt“, versuchte die Wünsche der Bewohner zu erspüren, verstand Sanierung als einen auf Konsens beruhenden Prozess. Der kettenrauchende einäugige 81-Jährige mit der Einstein-Frisur und dem knarrenden Vornamen übernahm selbst den Part des Inkubators. Mit der Verve eines guten Staubsaugervertreters warb er für Kreuzberg.
Ohne den Druck der Straße wäre sein Traum von der Rettung Kreuzbergs allerdings an den Betonmauern der Sanierungsfraktion zerschellt. Anfang 1979 wurde in Kreuzberg das erste Haus „instandbesetzt“, bis Ende 1981 mehr als weitere 80 Häuser. Die Besetzer warteten nicht auf gute Einsicht bei den Sanierern, irgendwann, sondern nahmen sich, wovon sie dachten, dass es ihnen zustand: Häuser, die auf der Abrissliste standen. Der Rest ist bekannt. Der Traum von der „Freien Republik Kreuzberg“ blühte. Eine eigene Szene-Infrastruktur wuchs heran, mit Besetzer-Bauhof, Kinderbauernhof, Frauenstadtteilzentrum. Manche Blocks organisierten einen Finanzausgleich zwischen den Hausgemeinschaften. Das funktionierte allerdings nicht mit den Punkerhäusern, weil ihre Insassen jede Mark gleich in Dosenbier umsetzten.

Im Juli 1981 verkündete der Berliner Senat die neue Sanierungslinie: „Instandsetzung vor Modernisierung und Modernisierung vor Abriss und Neubau“. Nach fast zwei Jahrzehnten und dem Abriss von 42 Prozent der Wohnungen am Kottbusser Tor wurde die bisherige Sanierung für gescheitert erklärt. Ihre Resultate – etwa das NKZ – trugen jetzt den offiziellen Makel des sozialen und städtebaulichen Irrwegs. Das Zeitalter der behutsamen Stadtsanierung begann. Sie brachte dem Kotti ungezählte neue Badezimmer, Innenklos, Etagenheizungen, dichte Dächer und Fenster.
„Ein Drittel Wracks in ’nem Haus, das geht so gerade noch“
Hämers IBA-Leute und die Besetzer bildeten durchaus keine Einheitsfront. Im Gegenteil: Die Hardliner unter den Besetzern witterten Verrat an der Idee. Weil die IBA auf Verhandlungslösungen setzte und die Besetzer zu legalen Mietern machen wollte, galt sie bei manchen aus der Szene als „Agentur der gewaltsamen Umstrukturierung Kreuzbergs“. Eine Besetzer-„Kiezpolizei“ kämpfte mit wüsten Methoden gegen alles, was nach „sozialer Durchmischung“ aussah.
Dass sie es nicht nur bei Drohungen beließen, lässt sich in alten Besetzer-Pamphleten nachlesen. Unter der Schlagzeile Weg mit die Scheiße! wird dort die Frage aufgeworfen: „15 Liter edelwürzige Scheisse-Pisse! Wohin damit?“ Die Antwort lieferte die „Kiezpolizei“ selbst: ins Feinschmecker-Restaurant Maxwell in der Oranienstraße, „wo sich betuchte Architekten und edle Schickis ein Stelldichein geben“. Drei Eimer Fäkalien kippten die Maskierten im Lokal aus, das danach nicht mehr öffnete.
Im Sommer 2003 haben die Exbesetzer in den einst okkupierten Häusern ganz andere Probleme. Dass es keine Fahrstühle gibt, zum Beispiel. Andreas Büsching, Geschäftsführer der „Luisenstadt“, zu der 270 Wohnungen und Gewerbeeinheiten gehören, sagt: „Als vor 20 Jahren modernisiert wurde, wollten die Mieter Podestklo und Ofenheizung unbedingt behalten, weil sie weiter billig wohnen wollten. Jetzt sind sie knapp 50, und der eine oder andere hat Probleme, die Treppe zum fünften Stock hochzukommen. Da wär ein Aufzug schon eine feine Sache.“
Behutsame Stadterneuerung ist ein Prozess, der nie zu Ende geht. Viele erleben ihre ganz persönliche Sanierung – als Abfolge sozialer Häutungen. Anfangs hat die Luisenstadt noch Großküchen für bis zu 40 Leute eingerichtet, später wurden wieder Zwischenwände eingezogen, der Rückzug ins Private stand an, der Weg vom Wir zum Ich. Statt Lambrusco für alle nun Barolo für mich und meine Liebste.
In manchen Häusern, erzählt Büsching, seien Leute, die sozial stabil waren, schnell wieder ausgezogen, weil sie nicht „bei den Wracks“ wohnen wollten. „Ein Drittel Wracks in ’nem Haus“, sagt Büsching, „das geht so gerade noch.“ Mit den Flüchtenden zerbröckelte auch der Traum von der klassenlosen Republik Kreuzberg. „Die sozial Starken haben es geschafft, ihr Leben in den Griff zu kriegen und ihr Geld nicht gleich in die nächste Kneipe zu tragen“, sagt Büsching. Ein paar Punks wurden Kleinunternehmer, andere bekamen nichts hin.
„Das Zwischenergebnis erzeugt die Illusion, nun sei alles gelaufen.“ Nicht einmal zehn Jahre waren seit Beginn der behutsamen Stadtsanierung vergangen, als Hardt-Waltherr Hämer sich zu dieser Warnung genötigt sah. „Es ist doch heiter geworden! Also muss es in Ordnung sein! Das Bild wird für die Wahrheit genommen.“ Wiederum 15 Jahre später ist die Wahrheit amtlich, statistisch belegt und mit dem Stempel der zuständigen Senatorin versehen. Das seit jeher arme Kreuzberg ist – trotz 40 Jahren teurer Sanierung! – im Vergleich zum Rest der Stadt noch ärmer geworden. Unter allen Berliner Stadtteilen ist Kreuzberg heute jener mit dem höchsten Armutsanteil (26,4 Prozent) und den kümmerlichsten Haushaltseinkommen. Die Menschen im vornehmen Berlin-Zehlendorf etwa verdienen im Schnitt doppelt so viel. Mit einer Arbeitslosenquote von 24 Prozent hält Kreuzberg einen weiteren Negativrekord. Vor allem die Türken, die mehr als ein Drittel der Einwohner Kreuzbergs ausmachen, haben nach 1990 ihre Jobs zu Tausenden an die billigeren Kollegen aus dem Ostteil der Stadt und dem Umland verloren. 42 Prozent der Kreuzberger Türken sind ohne Arbeit.
Im Kerngebiet der Sanierung am Kottbusser Tor findet sich sozusagen das Konzentrat aller Probleme: Beim Vergleich der sozialen Situation zwischen allen 171 Wohngebieten Berlins landet das Viertel auf Platz 171. Im zuerst brachial und später sanft sanierten Kotti-Viertel scheinen also die Armseligen zu hausen, die Überflüssigen, die Habenichtse; jene also, die den Anschluss verloren haben.

In sozialer Hinsicht erscheint die Sanierung als Desaster. Die kühne Hoffnung von einst, den Städtebau als Instrument der Sozialpolitik zu nutzen, social engineering zu betreiben, wurde enttäuscht. Aber konnte man ernsthaft erwarten, dass soziale Benachteiligung, Arbeitslosigkeit und Armut sich durch das Wirken von Architekten und Bauarbeitern abschaffen lassen? „Eine naive Vorstellung“, urteilt Peter Strieder, der für die Sanierung verantwortliche Senator.
Strieder, als ehemaliger Kreuzberger Bezirksbürgermeister mit der Lage vertraut, vermisst „arrivierte Mittelschichtleute“. Er meint damit Menschen, die ein Quartier wie den Kotti sozial stabilisieren. „Man ist keine offensive Strategie gefahren, die soziale Mischung in Kreuzberg zu verbessern.“ Recht hat er: All die Jahre hat seine Partei, die SPD, gut verdienende Mieter in Sozialwohnungen kräftig Fehlbelegungsabgaben zahlen lassen und dadurch vertrieben. Das hat aber nichts mit Sanierung zu tun, sondern mit falsch verstandener Sozialpolitik. Manche Experten in Strieders Senatsverwaltung sticheln, man habe „irre viel Geld für Nichtmobile ausgegeben“, für „sozial schwache Deutsche und für Ausländer mit Großfamilien“. Denen habe man es hübsch gemacht, sie zum Bleiben ermuntert und „sich gescheut zu definieren, ob eine Bevölkerungsstruktur gut oder schlecht ist“. Die Kritisierten reagieren empört: „Was ist denn die Alternative?“, fragt ein zorniger Hardt-Waltherr Hämer, „die Schwachen wegräumen? Das hat man doch damals von uns erwartet. Wir sollten schicke Wohnungen für die Mittelschicht bauen.“
Möglicherweise erscheint die sanfte Sanierung der Achtziger und frühen Neunziger heute auch deshalb in so mildem Licht, weil die vorangegangenen Sanierungsdekaden nichts dauerhaft Präsentables hervorgebracht hatten. Zur Kehrtwende gab es nur eine Alternative: die endgültige städtebauliche und soziale Zerstörung des gesamten Stadtviertels. So gesehen ist die behutsame Sanierung natürlich ein Erfolg – weil sie Schlimmeres verhindert und die Bewohner wieder an den Entscheidungen über ihr Wohnviertel beteiligt hat.
Jedes nicht abgerissene Gründerzeithaus war ein kleiner Sieg. „Sozial aufbessern“ ließ sich die Gegend dadurch trotzdem nicht, jedenfalls nicht statistisch nachvollziehbar. Darf man, soll man, kann man das überhaupt? Gibt es „falsche“ Bevölkerung? Wenn ja, wie sieht denn eine „ideale“ Einwohnerschaft aus? Und wer soll ihn spielen, den weisen Oberaufseher über die Sozialstruktur, auf dass er das Kleine-Leute-Quartier am Kottbusser Tor zu dem mache, was es nie war: einem Viertel, so clean wie aus der Waschmittelwerbung.
Der gestrenge Herr über das Zentrum Kreuzberg hält die Debatte über die unheilverkündende Sozialstatistik ohnehin für völlig überzogen. Die Wirklichkeit am Kotti sei ganz anders als die Horrorzahlen vermuten lassen, glaubt Peter Ackermann. „Mein Kiez ist der reichste in Berlin“, sagt er lapidar. Wo immer er hinschaut, sehe er Geld in Hülle und Fülle. Der versteckte Wohlstand ist Folge der Ladenstruktur im Schatten des Zentrums Kreuzberg, wo man alles mit Bargeld regelt. Viele seiner Gewerbemieter hätten nicht mal eine Registrierkasse, behauptet Ackermann, aber trügen große Geldscheine stoßweise mit sich herum. „Ich rede nicht über 50 Euro“, sagt er, „ich rede darüber, dass sie ihre Miete für ein halbes Jahr bar bezahlen.“ Und er zeigt mit Daumen und Zeigefinger, welche Bündel er meint: gut anderthalb Zentimeter. Einer seiner Dönerbudenbesitzer habe sich erst kürzlich einen dicken Mercedes gekauft, „so ’n Geländepanzer, und den Kaufpreis dem Händler zack, zack auf den Tisch geblättert“.
Die Sanierung sanieren – das kann niemand bezahlen
Die Statistik stimmt – und Ackermann hat trotzdem Recht. Niemand bestreitet, dass in Kreuzberg sehr viele Menschen wohnen, die sehr wenig Geld haben. Andererseits ermöglicht eine Miete von fünf Euro kalt pro Quadratmeter in hübsch sanierten Altbauten einer bestimmten Klientel einen gemütlichen Lebensstil: Gemeint sind Menschen, die einst der Widerstand gegen die Kahlschlagsanierung nach Kreuzberg gespült hat und die jetzt mittags bei einem Glas O-Saft frühstücken in einem Café. Diese Szene ist ein Produkt der Sanierung – Antithese und Synthese gleichermaßen. Man kauft getrocknete Tomaten und Süßkartoffelpaste bei „Knofi“, den Wein dazu bei „Suff“ und Salami bei Feinkost-Hillmann. Auch die vielen Restaurants auf der Oranienstraße sind durch Sozialhilfeempfänger allein nicht finanzierbar. Kinder sind beim Essen dabei, Hunde auch. Heute schon gearbeitet?
Kreuzberg ist eine wunderbare Nische für Menschen geblieben, die mit wenig Geld auskommen und trotzdem gut leben wollen, das Lieblingswohnrevier des linksalternativen Bürgertums. Das Viertel am Kottbusser Tor ist ein Idealbiotop für jene, die man früher „verkrachte Existenzen“ genannt hätte. Hier ist es gesellschaftlich akzeptiert, wenn man seine Miete nicht pünktlich zahlt. Außerdem wählt man hier Hans-Christian Ströbele, den grünen Rebellen. Nirgendwo holte der Altlinke so viele Stimmen wie in den Wahllokalen des Sanierungsgebiets zwischen Bethaniendamm und Fraenkelufer – über 60 Prozent. Die New Economy und ihre Highflyer dagegen haben hier nie Fuß gefasst, www.schnellerreich.de blühte und verblühte im hippen Berlin-Mitte, weit weg.
Nach vier Jahrzehnten hat die Politik entschieden, Deutschlands älteste Sanierungs-Story zu beenden. Die Zeit der großen teuren Sanierungsentwürfe zur Beglückung der Kreuzberger ist endgültig vorbei. Geblieben ist ein Viertel mit der höchsten Sozialprojekt-Dichte der Stadt – derzeit noch großzügig gesponsert vom Senat. 925 Einzelinitiativen, öffentlich bezuschusst, wurden einmal gezählt. Das Viertel am Kottbusser Tor ist gewissermaßen von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt worden. Wenn der Berliner Senat demnächst die Sparschraube weiter anzieht, wird der dauerkranke Patient möglicherweise ganz aus der Fürsorgeklinik entlassen. Aber ist er dann genesen? Was hätte man noch mit diesem Kranken anstellen können? Weitersanieren, bis vielleicht doch alle glücklich sind und keiner mehr arm oder arbeitslos? Natürlich könnte man die Bausünden aus der Pionierzeit der Sanierung, den städtebaulichen Schrott der Sechziger und frühen Siebziger, wieder abreißen, die Sanierung sanieren. Aber das kann niemand bezahlen.
Am Kottbusser Tor sind anderthalb Milliarden Euro Staatsgeld verbaut worden. Wer das Viertel jetzt völlig sich selbst überlässt, der gestattet, dass nach und nach alles verrottet. So wie in den Robert Taylor Homes in Chicago. Das größte Sozialquartier der Welt, einst Vorbild für die Sanierung am Kottbusser Tor, ließ man im Lauf der Jahrzehnte zum Nistplatz von Elend, Kriminalität und Drogen verkommen. Schließlich half nur der Bagger. Im vergangenen Jahr wurde das letzte der 28 Hochhäuser abgerissen.

Unter dem Titel „Geschichte wird gemacht. Berlin am Kottbusser Tor“ ist bis zum 28. September im Kreuzberg Museum, Adalbertstraße 95/96, 10999 Berlin, eine Ausstellung zu sehen; Mittwoch bis Sonntag 12–18 Uhr - www.kreuzbergmuseum.de
DIE ZEIT - 03.07.2003
Der Kotti kommt vom Tropf

Berlin-Kreuzberg, Kottbusser Tor: Deutschlands älteste Sanierungs-Story geht nach fast vier Jahrzehnten zu Ende. Die Hoffnung, mit Städtebau Sozialpolitik betreiben zu können, ist gescheitert. Spaziergang durch ein aufgegebenes Biotop
Von Andreas Molitor
Der Hausbesetzer Schorsch wohnt jetzt in Brieselang. Falkensee war zu teuer, wer will schon 300000 Euro für ein Reihenhaus bezahlen? Also ist Schorsch mit seiner Frau noch ein paar Kilometer weiter hinaus ins märkische Land gezogen. Brieselang liegt zwanzig Kilometer Luftlinie von Berlin-Kreuzberg entfernt, Lichtjahre weg. Der Weg zu Schorschs Doppelhaushälfte, mit offener Küche und Kamin im Wohnzimmer, führt zuerst über Asphalt, dann über Kopfsteinpflaster, schließlich über Schlammwege. Im Hausflur reicht Schorsch Filzpantoffeln. Der Holzfußboden, sagt er, sei so empfindlich.
Georg „Schorsch“ Uehlein, 47 Jahre, alter Kreuzberger Hausbesetzeradel, kam vor sieben Jahren im Einfamilienhausidyll an. Er hat Berlin-Kreuzberg verlassen, wie so viele der Weggefährten aus alten Kampftagen, die nun an die fünfzig Jahre alt sind. Am Nachmittag kommt einer von ihnen zum Kaffee vorbei, der wohnt in Kleinmachnow. Einen hat es nach Lichtenrade verschlagen, einen anderen nach Frohnau. Und Ulrike, ach, die wohnt irgendwo hinter Pankow, Schorsch hat vergessen, wie das Dorf heißt. Sie haben Abschied genommen von Kreuzberg, von wilden Zeiten und krausen Träumen, von alledem.
1980, im Februar, besetzte Schorsch mit seinen Kumpeln das Haus in der Kohlfurter Straße 46. Es war die achte Hausbesetzung in Kreuzberg, vielleicht auch die neunte, wer weiß das noch? Schorsch, heute Politiklehrer an einem Gymnasium, stand damals „eher gegen die Gesellschaft“. Gegen die Spekulanten und die Abrissbagger natürlich. Ein paar Jahre lang führte er ein Leben zwischen Blockrat, Blockkasse und Blockfesten, Nachtwachen und Funkwachen, Barrikadenausschuss und Handwerkerausschuss. Manche Aktionen waren „bisschen kriminell“, sagt Schorsch heute grienend. Da gab es die „Frühstücksguerilla“, die sich beim Sekt fantasievolle Anschläge überlegte, Pudding-Attentate auf Politiker, die aber nie realisiert wurden.
Daheim hat Schorsch noch die alten Agitprop-Broschüren, mit Schreibmaschine verfasst und zu DIN-A4-Heften geklammert. Zwischen den Broschüren steht ein Buch des Berliner Architekturkritikers Dieter Hoffmann-Axthelm. Es heißt Straßenschlachtung und beschreibt, was damals passierte in Schorschs Revier, dem Viertel rund um den U-Bahnhof Kottbusser Tor: Ganze Straßen wurden hingerichtet, planmäßig exekutiert. Hier standen Schorsch und die Seinen, dort Politik und Wohnungsbau mit ihrer Logik von Abriss und Neubau. Fast zwei Jahrzehnte hatten die Schlächter damals schon gewütet und ihre geschichts- und gesichtslosen Wohnwürfel tief in die Kreuzberger Stadtlandschaft gerammt. „Sanierung“ nannte man das.
Jetzt, noch einmal zwei Jahrzehnte später, herrscht wieder Frieden am Kottbusser Tor. Die Abrissbagger sind lange abgezogen, der Feind ist irgendwie abhanden gekommen. Frühere Hausbesetzer wohnen in behutsam modernisierten Altbauten, man trifft sich gegen Mittag zum Frühstück im Café und geht anschließend zur Weinhandlung Suff, um einen Rosso Toscano für den Abend zu kaufen. Die neue Kreuzberger Welt ist postmodern, weltoffen und multikulturell. Einerseits.
Andererseits ist Kreuzberg und besonders das Viertel am Kottbusser Tor die ärmste Gegend von ganz Berlin – mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen, den meisten Sozialhilfeempfängern und der höchsten Arbeitslosenquote. Und Schorsch, der seinerzeit gegen die „soziale Durchmischung“ und die „Schickimickisierung“ des Viertels kämpfte, „weil die parasitär ist“, sitzt in Brieselang, ein Lupo steht in der Einfahrt, und drinnen duftet es nach Apfelkuchen. „Na ja, nur Armutsbevölkerung bringt’s irgendwie auch nicht“, sagt er. Das ist wohl die Brieselanger Sicht der Dinge. „Dass Leute nach Kreuzberg kommen, die genug soziales Potenzial haben, das Viertel nach vorn zu bringen, da bin ich nicht mehr so dagegen.“
Kein anderer Stadtwinkel im ehemaligen West-Berlin ist so symbolträchtig wie Schorschs früheres Biotop rund um das Kottbusser Tor, das „wirkliche“ Kreuzberg: Kiezidyll und Turkish Town, Betontristesse und Drogensumpf, kaputte und reparierte Stadt, Szene-Boheme und deutsche Bierdimpfligkeit. Am Kottbusser Tor wurde alles ausprobiert, was irgendwann einmal als Sanierung galt – man hat abgerissen und neu gebaut, zerstört und repariert, modernisiert und verschönert, mal brachial, mal behutsam. Nirgendwo sonst in Deutschland lassen sich die verschiedenen Phasen, Philosophien und Strategien von Stadtsanierung mitsamt allen Irrwegen und in Beton verewigten Paradigmenwechseln auf so engem Raum erleben.
Die wohl endgültig letzte Kehrtwendung erfolgte im vergangenen Jahr: Nach fast vier Jahrzehnten wurde Deutschlands ältestes und berühmtestes Stadterneuerungsgebiet „aus der Sanierung entlassen“, wie es im Planungsdeutsch heißt. 39 Jahre Staatshilfe sind genug, fand Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (SPD) und beschied: „Schluss mit dem Sozialismus in Kreuzberg!“
Das Kreuzberg Museum in der Adalbertstraße95 ist eine Art Grenzkontrollpunkt. Genau bis hierhin ist die Kahlschlagsanierung Mitte der Siebziger geschwappt, von Süden die Straße hoch, und hat ihr Treibgut angespült: uniforme Neubauten in Quadern und Zeilen. Das wohl eindrucksvollste Zeugnis des Machbarkeitswahns jener Jahre, ein Wohnlindwurm für tausend Menschen, dem man seinerzeit den Namen Neues Kreuzberger Zentrum (NZK) verpasste, liegt wie ein Riegel quer über der Straße. Direkt im Schatten dieses architektonischen Sündenfalls zeigt das Kreuzberg Museum derzeit eine Ausstellung über die lange Geschichte der Sanierung rund ums Kottbusser Tor, von manchen liebevoll-schnoddrig „Kotti“ genannt.
In der Ausstellung erinnert ein elektrischer Zimmerspringbrunnen aus Vollplastik daran, dass es am Kotti einmal Dutzende von Kleinfabriken gab. Tränengasdose und Autonomen-Lederkluft als Reminiszenz an vergangene Krawallzeiten dürfen natürlich nicht fehlen. Zwischen all den Reliquien hängt auch die erste Single der Rockband Ton, Steine, Scherben, Macht kaputt, was euch kaputt macht, 1970 in einem Hinterhofstudio ein paar Straßenzüge weiter aufgenommen.
Die Sanierung am Kotti ist nur noch ein Fall fürs Museum. 23 Sanierungsgebiete konnte sich das bankrotte Berlin nicht länger leisten. Anderthalb Milliarden Euro öffentlicher Mittel wurden am Kottbusser Tor verbaut, 30000 Wohnungen abgerissen, neu gebaut oder modernisiert. Mit welchem Erfolg? „Eine Abfolge von Vergeblichkeiten“ könne man am Kottbusser Tor studieren, urteilt der Berliner Architekt Erhart Pfotenhauer, der hier fast jeden Hinterhof kennt. „Bei mir kommt immer wieder Empörung hoch, wie der träge Berliner Apparat jahrzehntelang plant und plant und am Ende Ruinen dabei rauskommen.“
Der zuständige Senator, der Kreuzberg nicht länger alimentieren will, sieht das naturgemäß völlig anders. „Ohne Zweifel war die Sanierung erfolgreich“, sagt Peter Strieder. Aber hätte man mit dem vielen Geld nicht Besseres zuwege bringen können? „Ach, was sind anderthalb Milliarden Euro“, entgegnet Strieder, „wenn Sie dafür einen Stadtteil retten?“
Wie sieht ein Stadtviertel aus, dem man fast vier Jahrzehnte Sanierung hat angedeihen lassen und von dem nun behauptet wird, es sei gerettet worden? Erfolgreich saniert – was heißt das? Gibt es einen Wohnviertel-Zufriedenheitsindex? Misst man den Erfolg einer Sanierung an der Zahl modernisierter Wohnungen, an der Quote eingebauter Innenklos, der Versorgung mit Kita-Plätzen, dem durchschnittlichen Haushaltseinkommen, der Kriminalitätsrate, der Anzahl blumenkübelgeschmückter Spielstraßen? Wird man zusätzlich die Sushi- und Cocktailbar-Dichte als Indikator heranziehen?

Am Anfang stand die Vision von der neuen, zeitgerechten Stadt. Gemäß dem städtebaulichen Leitbild von Licht, Luft und Sonne war geplant, die Altbauquartiere im Mietskasernengürtel um die Berliner Innenstadt weitgehend abzureißen und durch moderne Großwohnanlagen zu ersetzen. 1963 wurden zehn Viertel im Westteil der Stadt zu Sanierungsgebieten erklärt – darunter das am Kottbusser Tor. Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister, sah in der Sanierung eine „unaufschiebbare Verpflichtung, mit deren Erfüllung auch nicht einen Tag zu früh begonnen wird“. Mit Sanierung im großen Stil gab es in Deutschland bis dahin keine Erfahrungen. Fasziniert schauten die Städteplaner und Architekten nach Amerika. Dort wurden zu jener Zeit etliche der verfemten Elendsquartiere weggefräst, neue Wohngebirge für Zehntausende geschaffen. In Chicago entstand mit den Robert Taylor Homes damals die größte Sozialsiedlung der Welt.
Das im Schatten der erst zwei Jahre zuvor errichteten Mauer dahindämmernde Viertel Kottbusser Tor in Berlin, mit 37000 Einwohnern und 17000 Wohnungen das größte Sanierungsgebiet der geteilten Stadt, war eine tote Zone. Wer von „Mietskasernen“ sprach, meinte solche Gegenden: enge, uniforme Korridorstraßen mit düsteren Hinterhöfen und verschatteten Seitenflügeln, Bombenkrater dazwischen. Dieses Kreuzberg sollte untergehen. Einen Vorgeschmack auf das neue Kreuzberg, warm, sauber und bequem, lieferte das erste neue Hochhaus am Kottbusser Tor, bereits 1955 errichtet. Mit Müllschlucker, Teppichabsauganlage und Waschzentrale – vorbildlich.
Herzstück der Sanierungspläne war der Bau eines Tangentensystems von Stadtautobahnen um das alte, im Osten gelegene Berliner Zentrum herum. Zwei Trassen sollten quer durch Kreuzberg geschlagen werden, größtenteils als Viadukte über dichter Bebauung. So sahen es die Planungen für die „Hauptstadt Berlin“ aus den fünfziger Jahren vor. Auch nach dem Mauerbau hielt man an dem Konzept einer von Asphaltpisten durchschnittenen, autogerechten Stadtlandschaft fest. „Jede zweite Wohnung erhält einen Parkplatz“, heißt es Anfang der Siebziger in einer Sanierungsbroschüre, „entweder unterirdisch oder in einem Parkhaus. Sollte später einmal zu jeder Wohnung ein Auto gehören, kann die fehlende Hälfte der Parkplätze nachgebaut werden.“ So rückten die Bagger an.
Neue Sünden wurden begangen, frische Wunden in das Fleisch der Stadt gerissen. Die „Straßenschlachtung“ begann, jene „historisch einmalige Großaktion der vorsätzlichen Stadtzerstörung“, wie der Kritiker Dieter Hoffmann-Axthelm schrieb, und zwar „langsam, bei lebendigem Leibe“. Die Sanierungsträger, in der Mehrzahl gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften, entwickelten sich zu Abriss- und Neubaumaschinen. Ihr Werk verrichteten sie zu Preisen, die im Schnitt 40 Prozent über dem westdeutschen Niveau lagen. Sanierung hieß vor allem Selbstbedienung. Es gab keine Synthese zwischen Alt und Neu. Wie Hohn klingt aus heutiger Sicht folgende Passage aus einer Broschüre des Senats von 1974: „Nicht jedes Haus wird abgerissen. Die Neubauten bleiben grundsätzlich erhalten.“
Die Altbauquartiere lagen in Agonie. In einem Block durften amerikanische Soldaten im neunundsiebziger Herbst Häuserkampf trainieren. Nachts standen die Panzer mit laufendem Motor auf der Straße. Nicht selten erging es Bewohnern so wie den Mietern in der Skalitzer Straße 114. Eines Morgens wurden sie wach, weil die Wände zitterten und der Fußboden bebte. Sie schauten aus dem Fenster und sahen gerade noch, wie das Nachbarhaus unter den Schlägen der Abrissbirne in einer Staubwolke zusammenfiel.

Rollkommandos halfen nach, als Altbaumieter sich sträubten
Die Mieter in den Abrisshäusern waren variable Masse im Kalkül der Sanierungsträger. Zu gegebener Zeit teilte man ihnen den Auszugstermin mit. Irgendwo mussten sie ja untergebracht werden, bis die Neubauten fertig waren. Viele zogen auch ganz weg aus Kreuzberg. Die Wohnungsbaugesellschaften spendierten Bus-Schnupperfahrten nach Gropiusstadt oder ins Märkische Viertel, um den Menschen aus den Altbauten das Wohnen in der modernen Trabantenstadt schmackhaft zu machen. An manchen Tagen standen die Mieter vor den Büros der „Umsetzer“ Schlange.
Von einer adretten Wohnung träumte damals auch Horst Wiessner. Mit seiner Frau lebte er in einer großen Altbauwohnung in der Oranienstraße in Kreuzberg. Genau vor seinem Wohnzimmerfenster, hatte man ihm gesagt, würde künftig der stete Strom von Blechkarossen auf dem Autobahnviadukt entlangfließen. Die Wiessners zogen aus.
Ihr neues Domizil lag nur wenige Schritte entfernt. Jene Trutzburg des sozialen Wohnungsbaus, die gerade direkt am U-Bahnhof Kottbusser Tor emporwuchs, faszinierte Horst Wiessner. Neues Kreuzberger Zentrum, das klang modern, nach Aufbruch und Zukunft. „NKZ“ dagegen, das bald geläufigere Kürzel, verhieß bereits Unheilvolles.
Der 1970 vorgestellte Komplex, seinerzeit geplant mit Lesehof, Schwimmbad, Terrassencafé und Kino, sollte das Meisterstück der Sanierung werden. „Handels-, Kultur- und Wohnbereich bilden eine zwanglose Einheit mit Künstlern, Hofsängern, Leierkastenmännern und Büchereibesuchern“, versprachen die Bauherren. Niemand hätte damals geglaubt, dass ernst zu nehmende Politiker knapp 30 Jahre später fordern würden, das NKZ abzureißen. Am allerwenigsten wohl jene Ärzte und Anwälte aus Westdeutschland, die ihr Geld in das Projekt gesteckt hatten, angelockt von sagenhaften 200 Prozent Abschreibequote.
Am Bau des NKZ entflammte erstmals Kritik gegen die Stadterneuerung per Abrissbirne. Zehn Sanierungsjahre waren vergangen und mit ihnen die Euphorie vom Bau der neuen Stadt. So mancher Kreuzberger begann beim Anblick der Planungen für das Betonband mit 295 Wohnungen daran zu zweifeln, dass es tatsächlich keine Alternative zum Abriss eines ganzen Stadtviertels geben könnte.
Schon bald kursierten die ersten Flugblätter gegen Sanierungsträger und Spekulanten. Etwa jenes, das den Chef der Neues Kreuzberger Zentrum GmbH als „Feind der Bevölkerung Kreuzbergs“ anprangerte, verantwortlich „für die Vertreibung von 250 Arbeitern, Rentnern und kleinen Ladenbesitzern“ und außerdem schuld an der „Verteuerung der Lebensmittel in der Zukunft, weil sich seine hohen Mieten auf die Lebensmittelpreise auswirken werden“.
Auch Horst Wiessner zahlte nun deutlich mehr Miete – 345 Mark statt wie bisher 75. Von seiner Terrasse aus beobachtete er, wie Rollkommandos der Sanierer nachhalfen, wenn Altbaumieter sich gegen den Abriss sträubten. „Von hier oben sahen wir Rauch, und wir hörten es scheppern. Die haben einfach die Dachstühle angezündet und in den Häusern die Sanitäranlagen kaputtgeschlagen.“ Wiessner wurde Zeuge des rapiden Verfalls seines kleinen Garten Eden. Mit den Jahren zogen immer mehr anständige Mieter weg. Für sie kamen neue Leute, die den Abfall manchmal aus dem Fenster schmissen.
Der Platz im Schatten des NKZ verkam zur Niststätte des Elends. Die vielen Winkel dienten den neonbleichen Heroinsüchtigen vom Kottbusser Tor als Unterschlupf. Morgens trat man auf den Treppen in Kot, Erbrochenes und gebrauchte Spritzen. Hin und wieder lag auch eine Leiche im Hausflur. Schon 15 Jahre nach seiner Fertigstellung war das Prunkstück der Sanierung selbst schon wieder ein Sanierungsfall und wurde von der Presse als „verkommenes Monstrum“ gegeißelt. Direkt gegenüber sekundierte die Aufschrift auf einer Hauswand symbolträchtig: „Revolution ist die einzige Lösung!“
Vor fünf Jahren verlangte der damalige Berliner CDU-Fraktionschef Klaus Landowsky, man müsse „den Mut haben, das Neue Kreuzberger Zentrum zu sprengen“. In dem Gebäude lebe „nur noch Restbevölkerung, die nicht mehr stadttypisch ist“. Statt des Sprengmeisters kam Peter Ackermann. Der damals 59-jährige Wirtschaftsanwalt mit Büro in bester Lage am Kurfürstendamm übernahm 1999 die soziale Intensivstation NKZ und begab sich daran, das „Burgghetto der Sozialfälle“ umzukrempeln. Der Kotti soll wieder Eingangstor zum hinteren Kreuzberg werden – und das meistgehasste Gebäude Berlins sich zu dem Modell-Sanierungsbau mausern, den seine Schöpfer sich einst erträumt hatten. Wenn auch ohne Hofsänger.
Ökonomisch gesehen, führt Ackermann einen fast aussichtslos erscheinenden Kampf. Der mit rund 20 Millionen Euro verschuldete Komplex „ist nichts wert, nicht mal die Kosten des Abrisses“. Allein die Mieteinnahmen, knapp zweieinhalb Millionen Euro jährlich, lassen sich gegen die Schulden aufrechnen. Seit Jahren managt er eine Firma am Rande der Insolvenz. Manchmal haben seine Hausmeister nicht mal Geld für ein paar Eimer Farbe.
Wer seine Miete nicht zahlen kann, fliegt raus
Umso wichtiger waren anfangs symbolische Schritte. Als Erstes verpasste Ackermann dem NKZ einen neuen Namen. „Zentrum Kreuzberg – Kreuzberg Merkezi“, steht jetzt mit Leuchtschrift auf der bordeauxviolett gestrichenen Betonbrücke über der Adalbertstraße. „Das Gebäude ist wie ein Engel mit ausgebreiteten Armen“, hat Ackermann früher gesagt, „ein Engel, der hier steht und den Platz umfasst.“ Er ließ 150 Abfallkörbe aufstellen, die täglich geleert werden, stellte zwei neue Hausmeister ein, eine Architektin, einen Elektriker und eine Ingenieurin. Ackermann ist froh, wenn die Heizungsanlage mal wieder einen Winter überstanden hat. An der Platzspitze würde sich ein Straßencafé gut machen, meint Ackermann, ein schicker Italiener könnte die triste Galerie aufwerten. Es kursierten sogar schon Pläne mit Gucci- und Cartier-Läden.
Ohne Leute wie Horst Wiessner stünde Peter Ackermann auf verlorenem Posten. Der mittlerweile 80-Jährige, die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, ließ sich nicht zur „Restbevölkerung“ aussortieren, sondern entwickelte sich zum Chef-Kümmerer des Hauses. Wiessner übernahm den Vorsitz des Mieterbeirats, putzte die Hausflure, machte jeden Tag stundenlang den neuen Spielplatz sauber, räumte den Müll weg, beseitigte Heroinspritzen, Kanülen und Kot.
Aber schon wieder ist der Friede gefährdet. Im Zentrum Kreuzberg ist die Zeit des gemütlichen Kotti-Kapitalismus jetzt vorbei. Nachdem der Komplex 30 Jahre am Subventionstropf gehangen hat, muss er es ab Anfang 2005 ohne öffentliche Finanzhilfen schaffen. Das Land Berlin kann sich die Hilfe nicht mehr leisten. Für Peter Ackermann bedeutet das: Er muss jeden Euro eintreiben, der ihm zusteht, und die Szene schimpft auf ihn wie einst auf die Spekulanten.
Vor zwei Wochen hat ihm die Landesbank Berlin mit einer Zinsstundung Luft verschafft. Ackermann kann in den nächsten anderthalb Jahren 600000 Euro in das Gebäude investieren und einige Ladenlokale überhaupt erst in einen vermietbaren Zustand bringen.
Das Fürsorgliche ist ihm abhanden gekommen, die Strenge ist geblieben. Konsequent treibt er Mietrückstände ein. Wer nicht zahlen kann, fliegt raus. Schon bei einem Monat Mietrückstand lässt Ackermann den Strom abstellen, pfänden und räumen. Auch wer gegen vereinbarte Nutzungen verstößt, beispielsweise Dosenbier verkauft statt Bücher, erhält sofort die Kündigung. Sogar mit Horst Wiessner hat sich Ackermann jetzt überworfen. Wiessner, der Ackermanns Sanierungskurs jahrelang unterstützt hatte, empörte sich derart über eine Betriebskosten-Nachzahlung, dass er alle Mieter zum Boykott aufrief. Ackermann konterte mit einer Klage. Nun reden die beiden nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander.
Im Zentrum Kreuzberg steht selten eine Wohnung leer. Peter Ackermann weiß trotzdem, dass er dringend neue Mieter braucht – andere als jene, die alte Kühlschränke und Waschmaschinen einfach in den Aufzug stellen und dann auf „EG“ drücken. Es fehlen Menschen, denen es nicht egal ist, wie es in ihrem Haus aussieht. Und Leute, die das Wohnen im Beton en vogue finden.
Niemand bezweifelt heute, dass Bauten wie das Zentrum Kreuzberg Modell stehen für das totale Scheitern der in den Siebzigern praktizierten Kahlschlagsanierung. In den fast drei Jahrzehnten nach seiner Fertigstellung war man unablässig – und meist vergeblich – bemüht, die städtebaulichen und sozialen Folgeschäden einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Vieles blieb irreparabel. Angesichts einer derart vernichtenden Bilanz wundert man sich fast, wie viel Normalität das Zentrum Kreuzberg trotz allem beherbergt. Isabella Scheel, eine junge Fotografin, hat für die Kotti-Ausstellung im Kreuzberg Museum Mieter mitsamt ihres Wohnzimmer-Interieurs abgelichtet. Fast über-all fand sie Einlass.
Die Fotos zeugen vom rührenden Bemühen, einen guten Schuss Behaglichkeit in das Innere der abgenutzten Betonästhetik zu injizieren. Vor allem die Migrantenfamilien klotzen mit schweren Clubgarnituren und beleuchteten Schrankwänden aus dem Mitnahmemarkt. Erstaunlich, wie sauber und sortiert es aussieht. Auf keinem Tisch fehlt ein Deckchen. Eine türkische Familie hat sich teures Parkett legen lassen, auf eigene Kosten. „Ich lasse meine Tochter unten nicht spielen“, sagt die Mutter. Sie hat Angst, das Kind könnte sich an einer weggeworfenen Heroinspritze verletzen. „Es ist so schade“, sagt sie zum Abschied, „dass fast alle anständigen Deutschen von hier weggezogen sind.“
Ende der Siebziger glaubte niemand mehr an jene Visionen, die einst als raison d’être der Stadterneuerung hergehalten hatten. Trotzdem drehte sich das Sanierungskarussell immer schneller – ohne Frage nach dem Sinn.
Die stellte ein Mann, der sich als Zweifler aus Prinzip schon einen Ruf erworben hatte: Hardt-Waltherr Hämer, volksnaher Architekt und Stadtplaner. Nach einem vergeblichen Versuch im Berliner Stadtteil Wedding Ende der Sechziger war es ihm zehn Jahre später erstmals gelungen, das Interessenkartell aus Politik, Bauverwaltung und Sanierungsträgern auszuhebeln und in Charlottenburg einen Altbaublock mit 415 Wohnungen vor den Abriss-baggern zu retten. Der Block 118 am Klausener Platz war seine Generalprobe. Hämer hatte die „behutsame Stadterneuerung“ erfunden und bewiesen, dass sein Credo „Altbausanierung vor Abriss“ in der Praxis funktioniert – auch ökonomisch: Die vorsichtige Modernisierung kostete ein Drittel weniger als Abriss und Neubau.
Die Sanierung sorgte für neue Innenklos und dichte Dächer
Was Hämer dann am Kottbusser Tor vorfand, nannte er „kaputte Stadt“. Unter seiner Leitung nahm Ende 1979 die Internationale Bauausstellung (IBA) Berlin ihre Arbeit auf. Hämers Leute hatten einen einzigen Auftrag: „Kaputte Stadt retten!“ Er forderte die totale Kehrtwende in der Sanierungspolitik. Behutsame Modernisierung in enger Abstimmung mit den Mietern, statt sie zu vertreiben oder anschließend mit horrenden Mieterhöhungen zu drangsalieren. Hämer, der „Beteiligungsarchitekt“, versuchte die Wünsche der Bewohner zu erspüren, verstand Sanierung als einen auf Konsens beruhenden Prozess. Der kettenrauchende einäugige 81-Jährige mit der Einstein-Frisur und dem knarrenden Vornamen übernahm selbst den Part des Inkubators. Mit der Verve eines guten Staubsaugervertreters warb er für Kreuzberg.
Ohne den Druck der Straße wäre sein Traum von der Rettung Kreuzbergs allerdings an den Betonmauern der Sanierungsfraktion zerschellt. Anfang 1979 wurde in Kreuzberg das erste Haus „instandbesetzt“, bis Ende 1981 mehr als weitere 80 Häuser. Die Besetzer warteten nicht auf gute Einsicht bei den Sanierern, irgendwann, sondern nahmen sich, wovon sie dachten, dass es ihnen zustand: Häuser, die auf der Abrissliste standen. Der Rest ist bekannt. Der Traum von der „Freien Republik Kreuzberg“ blühte. Eine eigene Szene-Infrastruktur wuchs heran, mit Besetzer-Bauhof, Kinderbauernhof, Frauenstadtteilzentrum. Manche Blocks organisierten einen Finanzausgleich zwischen den Hausgemeinschaften. Das funktionierte allerdings nicht mit den Punkerhäusern, weil ihre Insassen jede Mark gleich in Dosenbier umsetzten.

Im Juli 1981 verkündete der Berliner Senat die neue Sanierungslinie: „Instandsetzung vor Modernisierung und Modernisierung vor Abriss und Neubau“. Nach fast zwei Jahrzehnten und dem Abriss von 42 Prozent der Wohnungen am Kottbusser Tor wurde die bisherige Sanierung für gescheitert erklärt. Ihre Resultate – etwa das NKZ – trugen jetzt den offiziellen Makel des sozialen und städtebaulichen Irrwegs. Das Zeitalter der behutsamen Stadtsanierung begann. Sie brachte dem Kotti ungezählte neue Badezimmer, Innenklos, Etagenheizungen, dichte Dächer und Fenster.
„Ein Drittel Wracks in ’nem Haus, das geht so gerade noch“
Hämers IBA-Leute und die Besetzer bildeten durchaus keine Einheitsfront. Im Gegenteil: Die Hardliner unter den Besetzern witterten Verrat an der Idee. Weil die IBA auf Verhandlungslösungen setzte und die Besetzer zu legalen Mietern machen wollte, galt sie bei manchen aus der Szene als „Agentur der gewaltsamen Umstrukturierung Kreuzbergs“. Eine Besetzer-„Kiezpolizei“ kämpfte mit wüsten Methoden gegen alles, was nach „sozialer Durchmischung“ aussah.
Dass sie es nicht nur bei Drohungen beließen, lässt sich in alten Besetzer-Pamphleten nachlesen. Unter der Schlagzeile Weg mit die Scheiße! wird dort die Frage aufgeworfen: „15 Liter edelwürzige Scheisse-Pisse! Wohin damit?“ Die Antwort lieferte die „Kiezpolizei“ selbst: ins Feinschmecker-Restaurant Maxwell in der Oranienstraße, „wo sich betuchte Architekten und edle Schickis ein Stelldichein geben“. Drei Eimer Fäkalien kippten die Maskierten im Lokal aus, das danach nicht mehr öffnete.
Im Sommer 2003 haben die Exbesetzer in den einst okkupierten Häusern ganz andere Probleme. Dass es keine Fahrstühle gibt, zum Beispiel. Andreas Büsching, Geschäftsführer der „Luisenstadt“, zu der 270 Wohnungen und Gewerbeeinheiten gehören, sagt: „Als vor 20 Jahren modernisiert wurde, wollten die Mieter Podestklo und Ofenheizung unbedingt behalten, weil sie weiter billig wohnen wollten. Jetzt sind sie knapp 50, und der eine oder andere hat Probleme, die Treppe zum fünften Stock hochzukommen. Da wär ein Aufzug schon eine feine Sache.“
Behutsame Stadterneuerung ist ein Prozess, der nie zu Ende geht. Viele erleben ihre ganz persönliche Sanierung – als Abfolge sozialer Häutungen. Anfangs hat die Luisenstadt noch Großküchen für bis zu 40 Leute eingerichtet, später wurden wieder Zwischenwände eingezogen, der Rückzug ins Private stand an, der Weg vom Wir zum Ich. Statt Lambrusco für alle nun Barolo für mich und meine Liebste.
In manchen Häusern, erzählt Büsching, seien Leute, die sozial stabil waren, schnell wieder ausgezogen, weil sie nicht „bei den Wracks“ wohnen wollten. „Ein Drittel Wracks in ’nem Haus“, sagt Büsching, „das geht so gerade noch.“ Mit den Flüchtenden zerbröckelte auch der Traum von der klassenlosen Republik Kreuzberg. „Die sozial Starken haben es geschafft, ihr Leben in den Griff zu kriegen und ihr Geld nicht gleich in die nächste Kneipe zu tragen“, sagt Büsching. Ein paar Punks wurden Kleinunternehmer, andere bekamen nichts hin.
„Das Zwischenergebnis erzeugt die Illusion, nun sei alles gelaufen.“ Nicht einmal zehn Jahre waren seit Beginn der behutsamen Stadtsanierung vergangen, als Hardt-Waltherr Hämer sich zu dieser Warnung genötigt sah. „Es ist doch heiter geworden! Also muss es in Ordnung sein! Das Bild wird für die Wahrheit genommen.“ Wiederum 15 Jahre später ist die Wahrheit amtlich, statistisch belegt und mit dem Stempel der zuständigen Senatorin versehen. Das seit jeher arme Kreuzberg ist – trotz 40 Jahren teurer Sanierung! – im Vergleich zum Rest der Stadt noch ärmer geworden. Unter allen Berliner Stadtteilen ist Kreuzberg heute jener mit dem höchsten Armutsanteil (26,4 Prozent) und den kümmerlichsten Haushaltseinkommen. Die Menschen im vornehmen Berlin-Zehlendorf etwa verdienen im Schnitt doppelt so viel. Mit einer Arbeitslosenquote von 24 Prozent hält Kreuzberg einen weiteren Negativrekord. Vor allem die Türken, die mehr als ein Drittel der Einwohner Kreuzbergs ausmachen, haben nach 1990 ihre Jobs zu Tausenden an die billigeren Kollegen aus dem Ostteil der Stadt und dem Umland verloren. 42 Prozent der Kreuzberger Türken sind ohne Arbeit.
Im Kerngebiet der Sanierung am Kottbusser Tor findet sich sozusagen das Konzentrat aller Probleme: Beim Vergleich der sozialen Situation zwischen allen 171 Wohngebieten Berlins landet das Viertel auf Platz 171. Im zuerst brachial und später sanft sanierten Kotti-Viertel scheinen also die Armseligen zu hausen, die Überflüssigen, die Habenichtse; jene also, die den Anschluss verloren haben.

In sozialer Hinsicht erscheint die Sanierung als Desaster. Die kühne Hoffnung von einst, den Städtebau als Instrument der Sozialpolitik zu nutzen, social engineering zu betreiben, wurde enttäuscht. Aber konnte man ernsthaft erwarten, dass soziale Benachteiligung, Arbeitslosigkeit und Armut sich durch das Wirken von Architekten und Bauarbeitern abschaffen lassen? „Eine naive Vorstellung“, urteilt Peter Strieder, der für die Sanierung verantwortliche Senator.
Strieder, als ehemaliger Kreuzberger Bezirksbürgermeister mit der Lage vertraut, vermisst „arrivierte Mittelschichtleute“. Er meint damit Menschen, die ein Quartier wie den Kotti sozial stabilisieren. „Man ist keine offensive Strategie gefahren, die soziale Mischung in Kreuzberg zu verbessern.“ Recht hat er: All die Jahre hat seine Partei, die SPD, gut verdienende Mieter in Sozialwohnungen kräftig Fehlbelegungsabgaben zahlen lassen und dadurch vertrieben. Das hat aber nichts mit Sanierung zu tun, sondern mit falsch verstandener Sozialpolitik. Manche Experten in Strieders Senatsverwaltung sticheln, man habe „irre viel Geld für Nichtmobile ausgegeben“, für „sozial schwache Deutsche und für Ausländer mit Großfamilien“. Denen habe man es hübsch gemacht, sie zum Bleiben ermuntert und „sich gescheut zu definieren, ob eine Bevölkerungsstruktur gut oder schlecht ist“. Die Kritisierten reagieren empört: „Was ist denn die Alternative?“, fragt ein zorniger Hardt-Waltherr Hämer, „die Schwachen wegräumen? Das hat man doch damals von uns erwartet. Wir sollten schicke Wohnungen für die Mittelschicht bauen.“
Möglicherweise erscheint die sanfte Sanierung der Achtziger und frühen Neunziger heute auch deshalb in so mildem Licht, weil die vorangegangenen Sanierungsdekaden nichts dauerhaft Präsentables hervorgebracht hatten. Zur Kehrtwende gab es nur eine Alternative: die endgültige städtebauliche und soziale Zerstörung des gesamten Stadtviertels. So gesehen ist die behutsame Sanierung natürlich ein Erfolg – weil sie Schlimmeres verhindert und die Bewohner wieder an den Entscheidungen über ihr Wohnviertel beteiligt hat.
Jedes nicht abgerissene Gründerzeithaus war ein kleiner Sieg. „Sozial aufbessern“ ließ sich die Gegend dadurch trotzdem nicht, jedenfalls nicht statistisch nachvollziehbar. Darf man, soll man, kann man das überhaupt? Gibt es „falsche“ Bevölkerung? Wenn ja, wie sieht denn eine „ideale“ Einwohnerschaft aus? Und wer soll ihn spielen, den weisen Oberaufseher über die Sozialstruktur, auf dass er das Kleine-Leute-Quartier am Kottbusser Tor zu dem mache, was es nie war: einem Viertel, so clean wie aus der Waschmittelwerbung.
Der gestrenge Herr über das Zentrum Kreuzberg hält die Debatte über die unheilverkündende Sozialstatistik ohnehin für völlig überzogen. Die Wirklichkeit am Kotti sei ganz anders als die Horrorzahlen vermuten lassen, glaubt Peter Ackermann. „Mein Kiez ist der reichste in Berlin“, sagt er lapidar. Wo immer er hinschaut, sehe er Geld in Hülle und Fülle. Der versteckte Wohlstand ist Folge der Ladenstruktur im Schatten des Zentrums Kreuzberg, wo man alles mit Bargeld regelt. Viele seiner Gewerbemieter hätten nicht mal eine Registrierkasse, behauptet Ackermann, aber trügen große Geldscheine stoßweise mit sich herum. „Ich rede nicht über 50 Euro“, sagt er, „ich rede darüber, dass sie ihre Miete für ein halbes Jahr bar bezahlen.“ Und er zeigt mit Daumen und Zeigefinger, welche Bündel er meint: gut anderthalb Zentimeter. Einer seiner Dönerbudenbesitzer habe sich erst kürzlich einen dicken Mercedes gekauft, „so ’n Geländepanzer, und den Kaufpreis dem Händler zack, zack auf den Tisch geblättert“.
Die Sanierung sanieren – das kann niemand bezahlen
Die Statistik stimmt – und Ackermann hat trotzdem Recht. Niemand bestreitet, dass in Kreuzberg sehr viele Menschen wohnen, die sehr wenig Geld haben. Andererseits ermöglicht eine Miete von fünf Euro kalt pro Quadratmeter in hübsch sanierten Altbauten einer bestimmten Klientel einen gemütlichen Lebensstil: Gemeint sind Menschen, die einst der Widerstand gegen die Kahlschlagsanierung nach Kreuzberg gespült hat und die jetzt mittags bei einem Glas O-Saft frühstücken in einem Café. Diese Szene ist ein Produkt der Sanierung – Antithese und Synthese gleichermaßen. Man kauft getrocknete Tomaten und Süßkartoffelpaste bei „Knofi“, den Wein dazu bei „Suff“ und Salami bei Feinkost-Hillmann. Auch die vielen Restaurants auf der Oranienstraße sind durch Sozialhilfeempfänger allein nicht finanzierbar. Kinder sind beim Essen dabei, Hunde auch. Heute schon gearbeitet?
Kreuzberg ist eine wunderbare Nische für Menschen geblieben, die mit wenig Geld auskommen und trotzdem gut leben wollen, das Lieblingswohnrevier des linksalternativen Bürgertums. Das Viertel am Kottbusser Tor ist ein Idealbiotop für jene, die man früher „verkrachte Existenzen“ genannt hätte. Hier ist es gesellschaftlich akzeptiert, wenn man seine Miete nicht pünktlich zahlt. Außerdem wählt man hier Hans-Christian Ströbele, den grünen Rebellen. Nirgendwo holte der Altlinke so viele Stimmen wie in den Wahllokalen des Sanierungsgebiets zwischen Bethaniendamm und Fraenkelufer – über 60 Prozent. Die New Economy und ihre Highflyer dagegen haben hier nie Fuß gefasst, www.schnellerreich.de blühte und verblühte im hippen Berlin-Mitte, weit weg.
Nach vier Jahrzehnten hat die Politik entschieden, Deutschlands älteste Sanierungs-Story zu beenden. Die Zeit der großen teuren Sanierungsentwürfe zur Beglückung der Kreuzberger ist endgültig vorbei. Geblieben ist ein Viertel mit der höchsten Sozialprojekt-Dichte der Stadt – derzeit noch großzügig gesponsert vom Senat. 925 Einzelinitiativen, öffentlich bezuschusst, wurden einmal gezählt. Das Viertel am Kottbusser Tor ist gewissermaßen von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt worden. Wenn der Berliner Senat demnächst die Sparschraube weiter anzieht, wird der dauerkranke Patient möglicherweise ganz aus der Fürsorgeklinik entlassen. Aber ist er dann genesen? Was hätte man noch mit diesem Kranken anstellen können? Weitersanieren, bis vielleicht doch alle glücklich sind und keiner mehr arm oder arbeitslos? Natürlich könnte man die Bausünden aus der Pionierzeit der Sanierung, den städtebaulichen Schrott der Sechziger und frühen Siebziger, wieder abreißen, die Sanierung sanieren. Aber das kann niemand bezahlen.
Am Kottbusser Tor sind anderthalb Milliarden Euro Staatsgeld verbaut worden. Wer das Viertel jetzt völlig sich selbst überlässt, der gestattet, dass nach und nach alles verrottet. So wie in den Robert Taylor Homes in Chicago. Das größte Sozialquartier der Welt, einst Vorbild für die Sanierung am Kottbusser Tor, ließ man im Lauf der Jahrzehnte zum Nistplatz von Elend, Kriminalität und Drogen verkommen. Schließlich half nur der Bagger. Im vergangenen Jahr wurde das letzte der 28 Hochhäuser abgerissen.

Unter dem Titel „Geschichte wird gemacht. Berlin am Kottbusser Tor“ ist bis zum 28. September im Kreuzberg Museum, Adalbertstraße 95/96, 10999 Berlin, eine Ausstellung zu sehen; Mittwoch bis Sonntag 12–18 Uhr - www.kreuzbergmuseum.de
DIE ZEIT - 03.07.2003
@ stormwatch .... - Gruß K.
- Gruß K.
 - Gruß K.
- Gruß K.
.
immer wieder Montags: Dresdner Kleinwort Wasserstein...:
Edelmetalle: Stabiler Dollar stoppt Gold-Abwärtstrend
Von Alexander Zumpfe
Durchwachsene US-Wirtschaftsdaten haben dem kurzfristigen Abwärtstrend des Goldpreises in der vergangenen Woche ein Ende gesetzt. Auch andere Edelmetalle legten eine erfolgreiche Woche hin.
Der Preis für das Edelmetall legte vorübergehend bis auf 352,85 $ je Feinunze zu und beendete die Woche im europäischen Handel mit 350,85 $ je Unze. An der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage dürfte sich aber kurzfristig kaum sehr viel ändern. Devisenanalysten erwarten, dass der Euro kurzfristig zwischen 1,14 $ und 1,17 $ pendeln wird. Davon ausgehend, dass die Devisenmärkte ihren Einfluss auf das gelbe Edelmetall zurückgewinnen, sollte dies zu begrenzten Schwankungen des Goldpreises beitragen. Der Euro beendete die vergangene Woche einen halben Cent fester bei 1,1490 $.
Eine erste Unterstützung liegt bei 348 $ und dann wieder bei 342 $ bis 343 $ je Unze. Zur Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends muss die Goldnotierung zunächst die Widerstandsmarken bei 353 $ und 355 $ nachhaltig nach oben durchbrechen.
Kanada verkauft ein Viertel der Goldreserven
Die kanadische Zentralbank hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie im Juni ein Viertel (114.064 Unzen) ihrer offiziellen Goldreserven verkauft hat. Auf Grund der im Monatsvergleich gefallenen Goldnotierung hat die Bank damit 2 Mio. $
Bewertungsverluste realisiert, teilte ein Regierungsvertreter weiter mit. Am Stichtag 30. Juni hielt die Notenbank nach der Transaktion noch 300.000 Unzen.
Ausgesprochen positiv verlief die vergangene Handelswoche auch für Silber. Das Edelmetall notierte mit 4,68 $ je Unze zeitweise auf dem höchsten Stand seit dem 27. Mai. Analysten sehen Käufe spekulativer Investoren als Hauptgrund für diese Bewegung und schließen einen weiteren Anstieg bis auf 4,85 $ nicht aus.
Fondskäufe treiben Platinpreis
Auch Platin hat eine Woche steigender Preise hinter sich: Der Preis für das Edel- und Industriemetall arbeitete sich sukzessive von einem Wochentief bei 659 $ am Montag bis auf 677 $ je Unze am Freitag hoch. Auslöser für den Preisanstieg waren auch hier Fondskäufe.
Hinzu kam die Schließung von Minuspositionen. Die industrielle Nachfrage - insbesondere aus den USA - hält sich derzeit in Grenzen. Der Widerstand bei 680 $ sollte auch in den nächsten Tagen eine stabile Hürde darstellen. Spekulatives Kaufinteresse unterstützte auch den Preis des Schwesternmetalls Palladium. Mit 188 $ je Unze fixierte das Metall am Mittwochnachmittag so fest wie seit dem 4. Juni nicht mehr. Analysten schließen einen Anstieg bis auf 195 $ je Unze nicht aus.
Alexander Zumpfe ist Händler im Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
FTD - 07.07.2003
und:
http://www.new-sense.net/wirtschaft/sonstiges/boerseninfo21… !!!
immer wieder Montags: Dresdner Kleinwort Wasserstein...:
Edelmetalle: Stabiler Dollar stoppt Gold-Abwärtstrend
Von Alexander Zumpfe
Durchwachsene US-Wirtschaftsdaten haben dem kurzfristigen Abwärtstrend des Goldpreises in der vergangenen Woche ein Ende gesetzt. Auch andere Edelmetalle legten eine erfolgreiche Woche hin.
Der Preis für das Edelmetall legte vorübergehend bis auf 352,85 $ je Feinunze zu und beendete die Woche im europäischen Handel mit 350,85 $ je Unze. An der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage dürfte sich aber kurzfristig kaum sehr viel ändern. Devisenanalysten erwarten, dass der Euro kurzfristig zwischen 1,14 $ und 1,17 $ pendeln wird. Davon ausgehend, dass die Devisenmärkte ihren Einfluss auf das gelbe Edelmetall zurückgewinnen, sollte dies zu begrenzten Schwankungen des Goldpreises beitragen. Der Euro beendete die vergangene Woche einen halben Cent fester bei 1,1490 $.
Eine erste Unterstützung liegt bei 348 $ und dann wieder bei 342 $ bis 343 $ je Unze. Zur Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends muss die Goldnotierung zunächst die Widerstandsmarken bei 353 $ und 355 $ nachhaltig nach oben durchbrechen.
Kanada verkauft ein Viertel der Goldreserven
Die kanadische Zentralbank hat am Freitag bekannt gegeben, dass sie im Juni ein Viertel (114.064 Unzen) ihrer offiziellen Goldreserven verkauft hat. Auf Grund der im Monatsvergleich gefallenen Goldnotierung hat die Bank damit 2 Mio. $
Bewertungsverluste realisiert, teilte ein Regierungsvertreter weiter mit. Am Stichtag 30. Juni hielt die Notenbank nach der Transaktion noch 300.000 Unzen.
Ausgesprochen positiv verlief die vergangene Handelswoche auch für Silber. Das Edelmetall notierte mit 4,68 $ je Unze zeitweise auf dem höchsten Stand seit dem 27. Mai. Analysten sehen Käufe spekulativer Investoren als Hauptgrund für diese Bewegung und schließen einen weiteren Anstieg bis auf 4,85 $ nicht aus.
Fondskäufe treiben Platinpreis
Auch Platin hat eine Woche steigender Preise hinter sich: Der Preis für das Edel- und Industriemetall arbeitete sich sukzessive von einem Wochentief bei 659 $ am Montag bis auf 677 $ je Unze am Freitag hoch. Auslöser für den Preisanstieg waren auch hier Fondskäufe.
Hinzu kam die Schließung von Minuspositionen. Die industrielle Nachfrage - insbesondere aus den USA - hält sich derzeit in Grenzen. Der Widerstand bei 680 $ sollte auch in den nächsten Tagen eine stabile Hürde darstellen. Spekulatives Kaufinteresse unterstützte auch den Preis des Schwesternmetalls Palladium. Mit 188 $ je Unze fixierte das Metall am Mittwochnachmittag so fest wie seit dem 4. Juni nicht mehr. Analysten schließen einen Anstieg bis auf 195 $ je Unze nicht aus.
Alexander Zumpfe ist Händler im Edelmetall- und Rohstoffhandel bei Dresdner Kleinwort Wasserstein.
FTD - 07.07.2003
und:
http://www.new-sense.net/wirtschaft/sonstiges/boerseninfo21… !!!
... Kanada verkauft ein Viertel der Goldreserven...
Tönt nach soo viel Gold - und ist soo wenig, wenn man nachrechnet. Das kommmt daher, dass Kanada einfach nicht mehr viel Gold hatte.
Aber es tönt nach viel und es tönt danach, dass die zitierte Bank seeehr gerne niedrige Goldpreise hätte.
Oh, ihr armen shorter, arm an Gold und an Geist
TFischer
Tönt nach soo viel Gold - und ist soo wenig, wenn man nachrechnet. Das kommmt daher, dass Kanada einfach nicht mehr viel Gold hatte.
Aber es tönt nach viel und es tönt danach, dass die zitierte Bank seeehr gerne niedrige Goldpreise hätte.
Oh, ihr armen shorter, arm an Gold und an Geist
TFischer
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Investoren beobachten auch:
| Wertpapier | Perf. % |
|---|---|
| -1,16 | |
| -2,00 | |
| -1,41 | |
| -0,99 | |
| +8,83 | |
| -0,40 | |
| -2,11 | |
| -0,20 | |
| -3,22 | |
| -3,23 |
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 107 | ||
| 62 | ||
| 49 | ||
| 38 | ||
| 36 | ||
| 30 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 22 | ||
| 22 |
00:15 Uhr · Swiss Resource Capital AG · OceanaGoldAnzeige |
23.05.24 · Redaktion dts · Dow Jones |
23.05.24 · Gold-Silber-Rohstofftrends · Barrick Gold Corporation |
23.05.24 · wallstreetONLINE Redaktion · Barrick Gold Corporation |
23.05.24 · Redaktion dts · Gold |
23.05.24 · EQS Group AG · Gold |
| Zeit | Titel |
|---|---|
| 23.05.24 | |
| 23.05.24 | |
| 23.05.24 | |
| 21.05.24 | |
| 15.05.24 | |
| 07.05.24 | |
| 18.04.24 | |
| 16.04.24 | |
| 12.04.24 | |
| 01.04.24 |





















