Der Wahnsinn von Amerika Teil 5 - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 21.03.03 15:39:06 von
neuester Beitrag 19.06.04 14:18:00 von
neuester Beitrag 19.06.04 14:18:00 von
Beiträge: 707
ID: 710.884
ID: 710.884
Aufrufe heute: 1
Gesamt: 23.682
Gesamt: 23.682
Aktive User: 0
Top-Diskussionen
| Titel | letzter Beitrag | Aufrufe |
|---|---|---|
| vor 1 Stunde | 3103 | |
| heute 17:47 | 2253 | |
| heute 13:08 | 1646 | |
| heute 19:36 | 1580 | |
| heute 20:33 | 1474 | |
| vor 50 Minuten | 1356 | |
| vor 1 Stunde | 1345 | |
| heute 19:41 | 1304 |
Meistdiskutierte Wertpapiere
| Platz | vorher | Wertpapier | Kurs | Perf. % | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 18.497,94 | +0,01 | 177 | |||
| 2. | 2. | 178,08 | -0,40 | 71 | |||
| 3. | 14. | 5,5260 | -1,11 | 48 | |||
| 4. | 6. | 4,1500 | +0,24 | 43 | |||
| 5. | 9. | 0,6906 | +12,73 | 38 | |||
| 6. | 4. | 0,1925 | 0,00 | 32 | |||
| 7. | 30. | 0,3340 | +76,72 | 31 | |||
| 8. | 39. | 6,4260 | +1,39 | 30 |
http://medizin.freepage.de/cgi-bin/feets/freepage_ext/41030x…
Wohin geht America?
Wirtschaftliche und politische Perspektiven unter der Administration George W. Bush
Aus der EIRNA-Studie Hyperinflation und Weltfinanzkrise, 2. erweiterte Auflage, Februar 2001
Warum stellen wir diesen Artikel in den EIRNA-"Brennpunkt"?
Michael Liebig analysierte darin vor acht Monaten die höchst prekäre Wirtschaftslage der Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt des Amtsantritts von George Bush jun.: die enorme Verschuldung, das riesige Handelsbilanzdefizit, die kalifornische Energiekrise und die untauglichen Mittel, womit die neue Administration von George W. Bush dagegen vorzugehen begann.
Im zweiten Teil äußert er die Befürchtung, daß mit dem Scheitern des herkömmlichen Krisenmanagements die Bereitschaft zu "unkonventionellen" Mitteln des Krisenmanagements immer mehr wächst. Er erinnert an den mehrfach perfektionierten Notstandsapparat der USA und an diverse "Kriegsspiele" des Council on Foreign Relations im Herbst 1999 und im Januar 2000, bei denen die Auswirkungen einer globalen finanziellen Kernschmelze auf die amerikanische Sicherheit simuliert wurden. Und er warnt vor jähen Wendungen im Gefolge von verheerenden Terroranschlägen wie 1993 in Oklahoma City oder auf das World Trade Center...
Erinnern Sie sich noch, was im September 2000, zwei Monate bevor George W. Bush in das Präsidentenamt gehievt wurde, das Bild war, das inner- und außerhalb der Vereinigten Staaten von der amerikanischen Wirtschaft gezeichnet wurde? Damals hieß es, die US-Wirtschaft befinde sich im "längsten und robustesten Wirtschaftsboom" aller Zeiten. In den USA seien mit dem erfolgreichen Übergang zur "New Economy" die Probleme und die Krisenanfälligkeit der "alten Wirtschaft" des Industriezeitalters überwunden worden. Beispielloses Wirtschaftswachstum und nie gekannte Produktivitätszuwächse seien nun selbstverständlich. Stets steigende Unternehmensprofite und Kapitalgewinne auf den Aktienmärkten hätten einen beispiellosen "Wohlstandseffekt" erzeugt, der sich in stets wachsenden Konsumausgaben der Haushalte (von denen rund 50% Aktienanlagen besitzen) ausdrücke. Inflation sei kein ernsthaftes Problem mehr. Das Vertrauen der Welt in das amerikanische "Wirtschaftswunder" bezeugten der starke Dollar und die hohen ausländischen Kapitalzuflüsse, während der dahinschwächelnde Euro demonstriere, wie rückständig und unbeweglich die europäische Wirtschaft sei. Das Schlimmste, was der US-Wirtschaft je passieren könnte, wäre eine gewisse - "völlig unproblematische", geradezu "gesunde" - Abflachung der hohen Wachstumsraten von Bruttosozialprodukt, Aktiengewinnen oder Unternehmensprofiten. Nach einer solchen "weichen Landung" könne sogleich zum nächsten wirtschaftlichen Höhenflug der amerikanischen Wirtschaft durchgestartet werden.
Wir haben Sie gewarnt
Eine kleine Minderheit von Ökonomen, darunter der Amerikaner Lyndon LaRouche an hervorragender Stelle, sagten demgegenüber: Das "amerikanische Wirtschaftswunder" ist schlicht eine Fiktion, deren "Grundlage" eine in der Tat beispiellose monetäre und Kreditexpansion sowie eine beispiellose Verschuldung der privaten Haushalte, der Banken, der Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt (Handels- und Zahlungsbilanzdefizit) ist. LaRouche betonte, daß sich die Schere zwischen realwirtschaftlicher Substanz und den monetären und finanziellen Aggregaten in den USA (allerdings nicht nur dort) soweit geöffnet hat, daß ein geordnetes, graduelles "Ablassen heißer Luft" aus der Finanzblase nicht mehr möglich ist, sondern eine kontraktive Implosion bzw. inflationäre Explosion im Finanzsystem unvermeidbar wird. Der angebliche wirtschaftliche und finanzielle "Boom" in den USA, sagte LaRouche, existiert wohl in der Vorstellungswelt der "Marktteilnehmer", aber nicht in der Realität. Der "Boom" ist primär ein "Glaubensgut", das mit einer heftigen Dosis Massenhysterie unterlegt ist, das wiederum das Ergebnis einer in der Tat beispiellosen "konzertierten Aktion" von Regierung, Notenbank, Finanzwirtschaft und Medien seit Mitte der 90er Jahre ist.
Nach den Präsidentschaftswahlen am 7. November 2000, so LaRouches Prognose, werden die wirtschaftlichen Tatsachen schnell und auf höchst unangenehme Weise zur Geltung kommen. Den Vereinigten Staaten steht im Jahre 2001 weder eine "weiche" noch eine "harte Landung" der Wirtschaft bevor, sondern eine systemische Finanz- und Wirtschaftskrise. Diese Großkrise wird das Schicksal der Bush-Administration bestimmen. Dabei werden nicht die wirtschaftspolitischen Absichten und Pläne des "Bush-Teams" ausschlaggebend sein, vielmehr wird die Realität der Krise das politische Verhalten der Bush-Administration bestimmen.
Ein Blick hinter die Fassade
Im einzelnen wies LaRouche auf die folgenden wirtschaftlichen und finanziellen Fakten hin: Nach Angaben der Federal Reserve wuchsen die Schulden in den Vereinigten Staaten in den 90er Jahren dreimal so schnell wie das Bruttoinlandsprodukt: Ende 1999 betrug das amerikanische BIP 9,5 Bio. Dollar, während sich die Gesamtverschuldung auf 25,6 Bio. Dollar belief. In den 90er Jahren stieg das BIP um 3,9 Bio. Dollar, während sich die Schulden um 12,8 Bio. Dollar vermehrten. Auf jeden Dollar nominellen Wirtschaftswachstums kommen 3,27 Dollar zusätzlicher Schulden! Die Schulden der nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen stiegen in den letzten fünf Jahren um 67% auf 4,5 Bio. Dollar, während die Schulden der Haushalte sich um 60% auf 6,5 Bio. Dollar vermehrten.
In den USA sind "Ramschanleihen" (Junk Bonds) im Wert von 529 Mrd. Dollar im Umlauf - gegenüber 173 Mrd. Dollar vor zehn Jahren. Im Durchschnitt hat jeder amerikanische Haushalt inzwischen 13 Kreditkarten und 7500 Dollar an Kreditkartenschulden - gegenüber 3000 Dollar im Jahr 1990. Die Schulden der Privathaushalte belaufen sich jetzt auf 101% ihres Einkommens (1990: 84%).
Die Unternehmensschulden belaufen sich jetzt auf 46% des amerikanischen BIP - der höchste Stand, der je erreicht wurde.
Die Verschuldung des amerikanischen Finanzsektors wird vom ehemaligen Chefvolkswirt der Dresdner Bank, Kurt Richebächer, sogar auf rund 25 Bio. Dollar geschätzt, was deutlich über den in den USA zirkulierenden Schätzungen liegt. (Wahrscheinlich wegen der "Grauzone" der Derivate.) Aber auch amerikanische Zahlen belegen, daß die Schulden der Finanzunternehmen die am schnellsten wachsende Kategorie der Schulden darstellen: Seit 1993 wuchsen sie um 132%! In den heutigen USA fällt die dramatische Kreditausweitung mit einem vollständigen Zusammenbruch der privaten Ersparnisbildung zusammen. Wie refinanzieren sich also die amerikanischen Banken? In immer stärkerem Maße dadurch, daß sie sich selbst, im Inland wie im Ausland, verschulden. Im Jahre 1999 erreichte die jährliche Neuverschuldung des US-Finanzsektors bereits den schwindelerregenden Wert von 1087 Milliarden Dollar.
Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen der Federal Reserve hatten 1998 die amerikanischen Familien 53,9% ihres Geldvermögens in Aktien angelegt - 1989 waren es nur 27,8%! In dieser Zeit stieg der Nominalwert des privaten Aktienbesitzes von 2,13 Billionen Dollar auf mehr als das Dreifache - 7,39 Bio. Dollar. Das Einkommen von 48,5% aller Haushalte hängt von Aktiengewinnen ab! Die Scheinprosperität der US-Wirtschaft seit 1995 beruhte hauptsächlich darauf, daß steigende Aktienpreise einen nominellen "Wohlstandseffekt" erzeugten, der zu expandierenden Konsumausgaben - und Konsumentenschulden - führte. Die steigenden Konsumausgaben wurden aber nicht durch eine entsprechende Steigerung der Produktionsleistung der amerikanischen Wirtschaft gedeckt, sondern mehrheitlich durch stetig steigende Importe. Dies führte zwangsläufig zu dem Monat um Monat wachsenden Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten.
1999 investierten ausländische Investoren täglich rund 1 Mrd. Dollar in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2000 floß nach den Angaben des US-Handelsministeriums ausländisches Kapital in noch größeren Mengen ins Land: durchschnittlich 1,9 Mrd. Dollar pro Tag, fast doppelt soviel wie 1999. Die Finanzmärkte in den USA wurden weiter dereguliert, wobei die Abschaffung des Glass-Steagall-Gesetzes, durch das bislang Kredit-, Wertpapier- und Versicherungsgeschäfte im US-Finanzsystem getrennt waren, von besonderer Bedeutung ist. Hinzu kommt der weitere Abbau von Beschränkungen im Handel mit Finanzderivaten. Mit einer stetig anschwellenden Welle von Megafusionen wurde die Kartellisierung im Finanz- und fast allen anderen Wirtschaftssektoren vorangetrieben. Immer öfter wurde die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, die durch geschickte "statistische Anpassungen" - vor allem bei Inflations- und Produktivitätszahlen - frisiert werden, dazu benutzt, das Wirtschaftswachstum zu überzeichnen und so ein "positives Klima" an den Finanzmärkten zu erzeugen. Immer öfters kam bei Turbulenzen auf den Finanzmärkten das sogenannte "Plunge Protection Team" (Absturz-Verhinderungsteam) zum Einsatz. Diese "Arbeitsgruppe Finanzmärkte beim Präsidenten" - so der offizielle Name des "Plunge Protection Team" - umfaßt Spitzenleute des Finanzministeriums, der Federal Reserve und Vertreter der führenden privaten Finanzhäuser und Banken, um bei Einbrüchen auf den Finanzmärkten durch gezielte Marktinterventionen "gegenzusteuern". Ein Veteran unter den Volkswirten äußert sich Im Anschluß an diese Einschätzung LaRouches möchte ich kurz den früheren Chefvolkswirt der Dresdner Bank, Dr. Kurt Richebächer, zu Wort kommen lassen. Richebächer ist ein höchst erfahrener Wirtschaftsanalyst und steht in der Tradition von Dr. Wilhelm Lautenbach, des wohl herausragendsten deutschen Ökonomen des 20. Jahrhunderts. In der November 2000-Ausgabe seines in den USA erscheinenden Richebaecher Letter veröffentlichte Richebächer eine Einschätzung der US-Wirtschaft, der er den Titel "Nach uns die Sintflut" gab. Richebächer schrieb, daß "Ausschläge auf den Aktienmärkten immer wilder werden", was dem nüchternen Analysten signalisiert, daß die Aktienhausse zu Ende geht. Sehr bald werde man "geschockt" sein, "wie schnell die ,Stärke` der US-Wirtschaft einfach verschwunden sein wird". Dann werde man auch erkennen, daß die angeblichen Errungenschaften der "New Economy" in der Realität "niemals existiert haben".
Schon ein Blick auf die offiziellen Statistiken über "National Income and Product Accounts" (NIPA) der amerikanischen Regierung und Notenbank zeigten, daß das tatsächliche Gewinnwachstum in der US-Wirtschaft zwischen 1996-2000 bestenfalls moderat war und in der Industrie nur einen Jahresdurchschnitt von 3,4% erreicht hat. Dabei ist die weitverbreitete "kreative Buchführung" bei US-Unternehmen noch genausowenig berücksichtigt wie die Entlohnung von Mitarbeitern durch "Aktienoptionen" statt Geld oder die Schrumpfung der Ausgaben für die betriebliche Altersversorgung, die durch Aktiengewinne der Pensionsfonds weitgehend "überflüssig" geworden seien.
Die angeblichen enormen Produktivitätssteigerungen der US-Wirtschaft beruhten hauptsächlich auf statistischen Tricks der amerikanischen Behörden, die laufende Betriebskosten bei der Datenverarbeitung als "Kapitalinvestitionen" der Firmen ausgeben. Der Faktor "Qualitätsanpassung" in der amerikanischen Wirtschaftsstatistik führt dazu, daß bei gleichbleibenden Produktionszahlen und Verkaufspreisen die Leistungssteigerungen von Computern und Telekommunikationsausrüstungen dahingehend kalkuliert werden, daß der "Ausstoß" dieser Produkte um den Faktor ihrer Leistungssteigerung vervielfacht wird (hedonic calculus). Dadurch läßt sich natürlich der Produktivitätszuwachs kräftig erhöhen. Gleichzeitig wird von den tatsächlichen Verkaufspreisen der Faktor Leistungssteigerung substrahiert, womit sich in der Statistik die Inflationszahlen sehr schön drücken lassen.
Die schwache Gewinnentwicklung in der US-Wirtschaft während der 90er Jahre, schreibt Richebächer, "ist keineswegs ein zufälliger Ausrutscher, sondern sie ist endemisch und strukturell. Diese Ertragsschwäche hat zwei leicht zu erkennende Ursachen. Ironischerweise entspringen sie genau den beiden Hauptcharakteristika des ,Neuen Paradigmas` der US-Wirtschaft, die üblicherweise als die Hauptquellen des überlegenen Wirtschafts- und Produktivitätswachstums ausgegeben werden. Das eine ist das ,Shareholder Value`-Modell, das andere ist die neue Informationstechnologie."
Die "alten Ökonomen" aber hätten diese beiden Dinge als "anti-kapitalistisch" eingestuft, schreibt Richebächer, denn Shareholder Value sei nur ein "nebulöser Euphemismus" für "kurzfristige Maßnahmen zur Kosteneinsparung und zum betrieblichen Potentialabbau", wozu noch Firmenübernahmen, Aktienrückkäufe und ähnliches kommen. Shareholder Value bedeutet also das Gegenteil von langfristiger Investition und Kapitalbildung. Ähnliches gilt für das "New Economy"-Paradigma, mit dem angeblich volkswirtschaftlicher Reichtum ohne langfristige Kapitalbildung erreicht werden kann, das aber tatsächlich "massive Kapitalvernichtung" bedeutet.
Vor diesem Hintergrund fragt Richebächer: "Welchen Kapitalismus haben wir also tatsächlich in den Vereinigten Staaten? Unsere Antwort lautet: Statt eines neuen und effizienteren Kapitalismus haben wir es mit einem ,niedergehenden und degenerierten` Kapitalismus zu tun. Die Substanz des klassischen Kapitalismus war langfristig orientierte Kapitalbildung aus Ersparnisbildung mit einem starken Bewußtsein der Verantwortung für künftige Generationen. Und was ist der Kern des ,neu-amerikanischen` Modells des Kapitalismus der 90er Jahre? Es ist die hektische Jagd der Firmenbosse nach dem schnellen und leichten Profit auf dem Aktienmarkt. Das geschieht durch Finanzgeschäfte und Aktienrückkäufe und wird ermöglicht durch eine Öffentlichkeit, die aufgehört hat zu sparen, während im Finanzsystem eine zügellose Kreditschöpfung stattfindet. Dabei zielt alles auf Konsum und Spekulation. Die Verantwortung der Firmenchefs in diesem ,Neuen Kapitalismus` beginnt und endet mit dem kurzfristigen Aktienkurs. Das ist niedergehender und degenerierter Kapitalismus, in dem Sinne, daß Ersparnisbildung und Kapitalakkumulation, die Wesenszüge einer kapitalistischen Wirtschaft, völlig verschwunden sind. Schlimmer noch, hier haben wir einen Kapitalismus, dessen sich jede gebildete Nation schämen sollte, denn die auf ihm basierenden Unternehmensstrategien kommen aus einer mikroökonomischen Logik, die ausschließlich auf der Maximierung des aktuellen Shareholder Value hinausläuft und damit zwangsläufig immer negativere makroökonomische Konsequenzen - bezüglich Wirtschaftswachstum, Einkommens- und Gewinnentwicklung - hervorbringt. Tatsächlich geht es hier um ungezügelten Überkonsum auf Kosten der künftigen Generationen, die einen ausgelaugten Kapitalstock, einen Berg von Auslandsschulden und jede Menge wertloses Papier (Aktien und Anleihen) erben werden. Man könnte von einem ,Beggar-Thy-Children`-Kapitalismus sprechen. Das Motto dieses Kapitalismus lautet ,Nach uns die Sintflut`".
Richebächer betont, die "wirtschaftlichen Ungleichgewichte und Finanzexzesse nie dagewesenen Ausmaßes", welche die US-Wirtschaft "verwundbar wie noch nie" machen, könnten niemandem entgehen, der willens sei, den Tatsachen ins Auge zu sehen. "Überall gibt es schwerwiegende Probleme: auf den Kreditmärkten und im Bankensektor, bei den Aktienbewertungen, bei der Gewinnentwicklung, bei der Schuldenbelastung von Unternehmen und Konsumenten, bei der negativen Sparrate, beim riesigen Handelsdefizit und beim massiv überbewerteten Dollar. Das Vertrauen in den Dollar ist bislang der Faktor gewesen, der das auseinanderfallende System noch zusammengehalten hat." Aber "die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft ist völlig fehl am Platze. Wir haben es schließlich mit der schlimmsten Finanzblase der Geschichte zu tun."
Das "Bush-Team" und die Finanzblase
George W. Bush wie Al Gore beanspruchten für sich die Urheberschaft für die als "Wirtschaftswunder" ausgegebene "schlimmste Finanzblase der Geschichte". Bush behauptete, der "Boom der 90er Jahre" sei die Frucht der "radikalen Reformen" - Deregulierung, Privatisierung, Steuersenkungen und "Freihandel" - der 80er Jahre während der Reagan-Bush-Ära. Gore behauptete, das amerikanische "Wirtschaftswunder" sei erst in der Clinton-Ära möglich gemacht worden, in der (hatte er nicht das Internet "erfunden"?) Alan Greenspan, Robert Rubin und Larry Summers das wirtschafts- und finanzpolitische Sagen hatten. Einig waren sich Bush Jr. und Gore in ihren hymnischen Lobpreisungen für "Chairman Greenspan". In der republikanischen Wahlplattform hieß es: "Inspiriert von den Präsidenten Reagan und Bush legten die Republikaner die Grundlage für die heutige Prosperität und Überschüsse. Wir senkten die Steuern, vereinfachten die Steuergesetze, deregulierten die Industrie und öffneten US-Firmen die Weltmärkte. Das Resultat war das erstaunliche Wachstum der 80er Jahre, das unternehmerisches Kapital für die Technologie-Revolution der 90er Jahre bildete. Das ist der Ursprung der heutigen New Economy: der längste Boom des 20. Jahrhunderts... Wir haben diese Revolution während der Regierungen Reagan und Bush eingeleitet. Nun werden wir sie vollenden: amerikanische Führung in einer globalen Wirtschaft... Für die amerikanischen Produzenten wie Konsumenten sind die Vorteile des Freihandels schon jetzt enorm. In naher Zukunft werden sie unkalkulierbar sein." (Dies stimmt, aber in ganz anderem Sinne, als die Autoren meinen.)
Für den Wirtschaftsteil der Wahlplattform zeichnete Lawrence Lindsey verantwortlich. Das ehemalige Mitglied des Federal Reserve Board in den 80er Jahren wurde Anfang Januar 2001 zum "Sonderberater des Präsidenten für Wirtschaftsfragen" im Weißen Haus ernannt. Lindseys Wirtschaftspolitik ist ganz einfach: Schnell und massiv die Steuern senken, dann kommt angeblich die Prosperität ganz von selbst.
Der neue Finanzminister ist Paul O`Neill, der bisherige Chef des Aluminiumriesen Alcoa, in dessen Vorstand Greenspan saß, bevor er 1987 Federal Reserve Chairman wurde. O`Neill ist wie Vize-Präsident Dick Cheney oder der neue Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ein Veteran der Nixon- und Ford-Administrationen der 70er Jahre. Neuer Handelsminister wurde Don Evans, der aus der texanischen Ölindustrie kommt. Man darf aber nicht übersehen, was Bush jun. sagte, als er in einer Fernsehdebatte mit Gore während des Wahlkampfes gefragt wurde, was er täte, wenn es zu einer Finanz- oder Wirtschaftskrise kommen sollte? Bush antwortete, er werde Chairman Greenspan um Rat fragen und dann dessen Rat befolgen.
Nach den Wahlen platzt der trügerische Schein
Dazu hatte er schnell Gelegenheit. Noch bevor das Oberste Gericht - beziehungsweise dessen Mehrheit - am 13. Dezember 2000 Bush ins Präsidentenamt hievte, mußte der designierte Vizepräsident Dick Cheney einräumen, daß die US-Wirtschaft "am Rande einer Rezession" stehe. In der Tat, der Dezember 2000 wurde zum mens horribilis der amerikanischen Wirtschaft: Statt der erhofften "Bush-Rallye" schmolzen die Kurse der am NASDAQ notierten Technologieunternehmen dahin. Fast täglich gab es neue Gewinnwarnungen, hauptsächlich von Unternehmen der "New Economy". Bis Ende Dezember hatte der NASDAQ-Index im Jahresvergleich 40% verloren, der schlimmste Einbruch seiner dreißigjährigen Geschichte. Als der NASDAQ am ersten Handelstag des neuen Jahres 7,2% verlor, geriet Alan Greenspan in Panik. Zum ersten Mal in seiner 13jährigen Amtszeit berief Greenspan eine Notkonferenz der Fed-Gouverneure per Telefon-Konferenzschaltung ein, bei der die kurzfristige Zinsrate (Fed Funds) und die Diskontrate um 0,5% gesenkt wurde. Eine Zinssenkung außerhalb der planmäßigen Fed-Treffen hatte es zuletzt im Herbst 1998 gegeben, als das Weltfinanzsystem nach dem Bankrott des Hedge Funds LTCM unmittelbar vor dem Zusammenbruch stand. Aber selbst damals war die Zinssenkung nur in der üblichen Größenordnung von einem Viertelprozentpunkt erfolgt. Jetzt verabreichte Greenspan den Märkten gleich die doppelte Portion. Und obendrein ließ er durchblicken, daß er nicht zögern werde, noch mehr draufzulegen, falls die US-Wirtschaft weiter einbreche.
In der gegenwärtigen Lage mag die Verabreichung von mehr und billigerem Zentralbankgeld kurzfristig den Abwärtstrend auf den Finanzmärkten etwas unterbrechen, aber damit wird keine Trendwende mehr zustande gebracht - was schon ein Blick auf die Aktienkurse im vierten Quartal 2000 zeigt -, während die Inflationsdynamik weiter verstärkt wird. Bezüglich des tatsächlichen Zustandes der US-Wirtschaft wurden allein in den Tagen um Weihnachten und Neujahr die folgenden Hiobsbotschaften verbreitet:
Am 3. Januar berichtete die Nationale Vereinigung der Einkaufsmanager (NAPM), daß ihr vielbeachteter Index für die industrielle Aktivität in der US-Wirtschaft im Dezember 2000 auf den niedrigsten Wert seit dem April 1991 gefallen ist. Im November betrug der entsprechende Wert 47,7, im Dezember waren es nur noch 43,7. Ein Wert unterhalb von 50 bedeutet eine Kontraktion der Wirtschaft. Der NAPM-Index für die Auftragseingänge fiel innerhalb eines Monats sogar von 48,4 auf 42,0. Der mit 18 000 Beschäftigen viertgrößte US-Stahlhersteller LTV Corp. mußte Konkurs anmelden. Wegen mangelnder Nachfrage verfallen die Stahlpreise, während die Energiepreise in die Höhe schießen. Im November ging die Stahlproduktion in den USA um 12,4% zurück. Im Telekommunikationsektor kündigte Lucent Corp. die Entlassung von mehr als 10 000 Beschäftigen an. Yahoo und AOL Time Warner werden mehrere tausend Stellen abbauen. Die Zahl der Entlassungen in der US-Internetbranche ist im zweiten Halbjahr 2000 gegenüber dem ersten Halbjahr um 600% angestiegen. Im Dezember gingen die Entlassungen gegenüber dem Vormonat um 19% in die Höhe. Im gesamten Jahr 2000 waren 210 Internetfirmen mit insgesamt 15 000 Beschäftigten zusammengebrochen. Seit Oktober sind die Verkäufe der US-Autombilkonzerne rückläufig, deren Lagerbestände trotz massiver Rabatte seit Sommer zunahmen. Im Dezember sanken die Verkaufszahlen bei Ford um 14,6%, bei Chrysler um 14,8% und bei General Motors um 18,1%. General Motors will 15 000 Arbeitsplätze streichen. Ford und DaimlerChrysler hatten schon vor Weihnachten Produktionssenkungen und Betriebsstillegungen angekündigt. Die traditionsreiche Kaufhauskette Montgomery Ward mußte ihre Zahlungsunfähigkeit bekanntgeben. Rund 32 000 Beschäftigte werden ihren Arbeitsplatz verlieren und 258 Niederlassungen geschlossen. Auch die Kaufhauskette Bradlees meldete Konkurs an. Wal-Mart und Sears Roebuck meldeten ein stagnierendes oder rückläufiges Weihnachtsgeschäft. Für den Einzelhandel insgesamt war das vierte Quartal 2000 das schlechteste seit 1990. Im Dezember kündigten Großunternehmen den Abbau von 150 000 Arbeitsplätzen an; der Gesamtverlust an Arbeitsplätzen liegt ein Vielfaches darüber. Auch im Finanzsektor stehen Entlassungen an, nicht nur wegen der Kartellisierung bei Banken und Versicherungen, sondern weil das hochprofitable Geschäft mit Neuemissionen (IPOs) und Unternehmensfusionen außerhalb des Finanzsektors stark gelitten hat. Die Branche, die nach eigenen Angaben glänzende Aussichten für das laufende Jahr besitzt, sind die auf Unternehmensbankrotte spezialisierten Anwaltsbüros.
In Kalifornien gehen die Lichter aus
Am 16. Januar verhängte Gouverneur Gray Davis in Kalifornien den Notstand, weil die beiden führenden Stromversorger Kaliforniens Pacific Gas & Electric (PG&E) und South California Edison (SCE) vor den Bankrott standen und die Stromversorgung zusammenzubrechen drohte. Für Westeuropäer unbegreiflich, mußten aus Indien oder Afrika bekannte "rotierende Stromabschaltungen" im bevölkerungsreichsten und wohlhabensten Bundesstaat der USA eingeführt werden. (Die internationale Gemeinde der glühenden Bewunderer des "amerikanischen Wirtschaftsmodells" verhielt sich mucksmäuschenstill.) 1996 hatte Kaliforniens Parlament ein Gesetz zur "Deregulierung" der Stromversorgung verabschiedet. Damit wurde die unter Präsident F.D. Roosevelt eingeführte Strommarktordnung aufgehoben, in deren Rahmen die privaten Versorger seit den 30er Jahren zuverlässig und zu stabilen Preisen Strom in stets ausreichender Menge geliefert hatten. Nun wurden die Stromerzeugung und -verteilung aufgespalten; die integrierten Stromversorger mußten ihre eigenen Kraftwerke an meist in anderen Bundesstaaten ansässige "unabhängige" Stromproduzenten verkaufen.
Die Deregulierungsbefürworter argumentierten, wenn man die privaten Stromversorger zwinge, den Strom von "konkurrierenden" Stromgroßhändlern einzukaufen, käme der Verbraucher dank des Wirkens der "Marktkräfte" in den Genuß billigeren Stroms. Doch das Gegenteil war der Fall. Der Deregulierungsprozeß führte - nicht überraschend - zu einem fast völligen Baustopp neuer Kraftwerke, weil behauptet wurde, es gäbe wegen mangelnder "Markteffizienz" ein "Überangebot von überteuertem Strom". Die minimale Ausweitung der Kraftwerkskapazität in den letzten Jahren betraf kleine Einheiten, die mit - bis 1998 - noch billigem Erdgas betrieben werden. Inzwischen hat auch beim Erdgas eine gewaltige Preisexplosion eingesetzt, denn auch die Erdgaserzeugung stagniert seit sieben Jahren. Teure Investitionen bei der Erdgasförderung in Nordamerika wurden kaum getätigt, während die Nachfrage auf dem ebenfalls deregulierten Erdgasmarkt deutlich anstieg.
Im Laufe der letzten Jahre kam es deshalb in Kalifornien zu einer immer größeren Lücke zwischen Nachfrage und Lieferkapazität bei Strom. Die "Marktkräfte" förderten keineswegs kostspielige und langfristige Investitionen in neue Kraftwerke, wohl aber einen stetig wachsenden Preisdruck bei Strom, der bald die Form spekulativer Erpressung annahm. Das Stromdefizit betrug im Januar 2001 rund 15% des Verbrauchs in Kalifornien. Der weitverbreitete Hinweis auf die strengen Umweltauflagen in Kalifornien als angebliche Ursache des Strommangels geht an den tatsächlichen ökonomisch begründeten Ursachen für nicht getätigte Kraftwerkinvestitionen vorbei.
Die katastrophale Energiekrise in Kalifornien ist nur das eklatanteste Beispiel der inkompetenten, ja korrupten Maßnahmen des amerikanischen Kongresses seit Anfang der 90er Jahre, mit denen zunächst der Erdgasmarkt und dann der Strommarkt dereguliert wurde. Dabei überließ es der Kongreß den 50 Bundesstaaten, wie sie die Deregulierung durchführen wollten. Kalifornien war seit 1996 der Vorreiter der Deregulierung; 25 weitere Bundesstaaten deregulierten oder wollten dies tun, bis die Krise in Kalifornien ausbrach. Schon im Frühjahr 2000 hatte LaRouche vor einer akuten Energiekrise in Amerika gewarnt, weil "Deregulierung und Disinvestment" das US-Elektrizitätsnetz auf ein "Dritte-Welt-Niveau" gebracht hätten. Er forderte die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung des von Roosevelt geschaffenen Ordnungsrahmens für die amerikanische Stromwirtschaft und ein zügiges Investitionsprogramm, vor allem für Kernkraftwerke.
Das kalifornische Deregulierungsgesetz von 1996 legt eine Obergrenze für den Tarif fest, den die Stromversorger (SCE und PG&E) vom Verbraucher fordern dürfen, bis die Trennung von Produktion und Verteilung juristisch abgeschlossen ist. Eine Obergrenze für die Preise, die der Stromversorger seinem Großhändler zahlen muß, wurde aber nicht festgesetzt. In den letzten Monaten haben die Stromgroßhändler die Stromverknappung in Kalifornien vor dem Hintergrund des generellen spekulativen Preisanstiegs für Energie gnadenlos ausgenutzt, um die Preise nach oben zu treiben. Noch vor drei Jahren konnte die SCE den Strom aus den damals noch ihr gehörenden Kraftwerken für 31 $/MWh verkaufen und dabei noch einen Gewinn machen. Mitte Dezember 2000 mußte SCE bis zu 1000 $/MWh für den Strom von Fremdlieferanten bezahlen, den sie ihren Kunden für 31 $/MWh weiterverkaufen mußte
Die für die Großhandelspreise von Strom zuständige Bundeskommission zur Energieregulierung (FERC) in Washington weigerte sich, Preiskontrollen einzuführen - sowohl unter der bisherigen Clinton-Administration wie unter der neuen Bush-Administration. Daß Stromerzeuger, die nach Kalifornien liefern, 800% oder 900% Profit machen, scheint nicht zu stören. Besonders George W. Bush wird sich wohl kaum für Preiskontrollen bei Strom oder Erdgas einsetzen, denn der größte Stromgroßhändler der USA ist die in Houston (Texas) ansässige Enron Corp., die eng mit dem Bush-Clan verbunden ist und der größte Wahlkampfspender für den neuen Präsidenten war. Andere Stromgroßhändler, die nach Kalifornien liefern, wie Reliant Energy oder Dynegy, sind auch in Texas ansässig und gehören zum geschäftlichen und politischen "Umfeld" des Bush-Clans.
Aus der rasant wachsenden Diskrepanz von Großhandels- und Endpreisen summierten sich bis Januar 2001 bei den Stromversorgern PG&E und SCE zusätzliche Kosten von rund 13 Mrd. Dollar. Die Banken, die ihnen das Geld zur Finanzierung der Stromkäufe geliehen hatten, weigerten sich, weiteres Geld vorzuschießen, und die Finanzunternehmen der Wall Street blockierten die Ausgabe von neuen Bonds, mit denen die Stromerzeuger an frische Finanzmittel kommen wollten. Nun stehen die beiden größten Stromversorger in Kalifornien vor dem Bankrott. Ende Januar waren beide Firmen bei der Bedienung von Krediten und Anleihen bereits mit mehr als 1,2 Mrd. Dollar in Verzug. Aufgrund des Zahlungsverzugs stuften Moody`s und Standard & Poors die Milliardenanleihen der beiden Unternehmen auf den Status von "Ramschanleihen" herab.
Die Krise wirft ihren Schatten auf das ganze amerikanische Finanzsystem und droht mehrere Großbanken - darunter Bank of America, Wells Fargo und BankOne - in den finanziellen Abgrund zu reißen. Bereits am 27. Dezember war der kalifornische Gouverneur Davis zu Notstandssitzungen mit Notenbankchef Alan Greenspan, Finanzminister Larry Summers, Präsident Clinton und George W. Bush nach Washington geflogen. Daß Greenspan eingeschaltet werden mußte, beweist allein schon, daß es nicht nur um Kalifornien geht, sondern Gefahr für das gesamte Finanzsystem droht.
Schließlich sollte man nicht unterschätzen, welche Auswirkungen die Stromkrise in Kalifornien und die Preisexplosion bei Erdgas und Treibstoff (Benzin, Diesel/Heizöl) auf die amerikanische Realwirtschaft insgesamt hat. Am 17. Januar hielt der Nationale Verband der gewerblichen Produzenten (NAM) eine Pressekonferenz ab, um in dramatischer Weise zu warnen, daß "Tausende von Betrieben" wegen der Energiekrise vor Produktionskürzungen, Entlassungen und sogar Fabrikschließungen stünden. NAM-Präsident Jasinowski sprach von "verheerenden Auswirkungen" auf die US-Wirtschaft. Die explodierenden Energiepreise hätten die US-Wirtschaft im Laufe des vergangenen Jahres mehr als 115 Mrd. Dollar gekostet; das ist immerhin 1% des BIP.
Das Ende des "Importeurs der letzten Instanz"
Daß die amerikanische Wirtschaft seit dem 4. Quartal 2000 in eine schwere Kontraktion abtaucht, zeigen, wie oben skizziert, auch die offiziellen Wirtschaftsstatistiken. Und das bestreitet inzwischen nicht einmal mehr Alan Greenspan. In den amerikanischen Haushalten und Unternehmen muß man das Ausmaß der Verschuldung zur Kenntnis nehmen, die sich während der wirtschaftlichen Scheinblüte der 90er Jahre aufgetürmt hat, während gleichzeitig der auf inflationierten Aktienpreisen beruhende "Wohlstandseffekt" dahinschmilzt. Die Folge ist eine rasant zurückgehende Konsum- und Investitionsbereitschaft. Dies hat nun dramatische Auswirkungen auf die übrige Weltwirtschaft, aus der fieberhaft in den US-Markt hineinexportiert wurde. Ab Mitte der 90er Jahre hatte die US-Wirtschaft die Rolle des "Importeurs der letzten Instanz" für die Weltwirtschaft übernommen. Wenn die US-Wirtschaft aufhört, sozusagen als "Staubsauger" für die Exportgüter der restlichen Welt zu fungieren, so muß das zu schwerwiegenden realwirtschaftlichen Erschütterungen und Einbrüchen in den exportabhängigen Wirtschaften Asiens, Lateinamerikas und auch Europas führen, wenn sie nicht schnell auf neue regionale Handels- und wirtschaftliche Kooperationsstrukturen umsteuern.
Der Grund dafür, daß die US-Wirtschaft während der letzten Jahre die Produkte der übrigen Weltwirtschaft geradezu aufgesogen hat, war nicht nur der trügerische, zum Konsum aufreizende "Wohlstandseffekt" oder der überbewertete Dollar, sondern auch die abnehmende industrielle Leistungsfähigkeit Amerikas. Während der "Bretton Woods"-Ära - vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu den späten 60er Jahren - verfügten die Vereinigten Staaten über eine höchst leistungsfähige und exportstarke Industrie. Seit Anfang der 70er Jahre erfolgte der Marsch in die "nachindustrielle Gesellschaft". Immer mehr Industriezweige in Amerika wurden eingeschrumpft, fast ganz beseitigt oder in "Niedriglohnländer" ausgelagert.
Nun könnte man sagen, daß die Importabhängigkeit der USA bei Gütern "niedriger Technologie" - Konsumgüter wie Textilien, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik oder Grundstoffe wie Stahl oder Baumaterialien - nicht weiter beunruhigend sei. Doch in technologisch hochstehenden Schlüsselbereichen der Industrie sieht es nicht viel anders aus. Die bis in die 70er Jahre weltweit führende Werkzeugmaschinenindustrie Amerikas wurde radikal abgebaut, was modisch mit dem Ausdruck "downsizing" verbrämt wird. Das blieb natürlich nicht ohne Folgen für die technologische Leistungsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der übrigen amerikanischen Hochtechnologiebranchen wie beispielsweise der Luft- und Raumfahrt.
Zu Beginn der 80er Jahre stürzte das Produktionsvolumen der amerikanischen Werkzeugmaschinenbauer abrupt von 5,5 Mrd. auf 2,1 Mrd. Dollar ab. Die Stückzahlen der Produktion von Werkzeugmaschinen schrumpften von 350 000 auf 150 000. 1970 wurden lediglich 9,5% aller von US-Unternehmen nachgefragten Werkzeugmaschinen im Ausland bestellt. 1986 war der Importanteil bereits auf 49,8% hochgeschossen, und heute kommen 59,4% aller in den USA gekauften Werkzeugmaschinen aus dem Ausland. Ähnlich ist die Lage im Anlagenbau und in der Elektroindustrie. Bei der Produktion von elektrischen Ausrüstungen und Maschinen - von Transformatoren über Turbinen bis hin zu Generatoren - ist die Importabhängigkeit der US-Wirtschaft zwischen 1972 und 1999 von 3,2% auf 25,1% angestiegen.
Dieser Trend hat sich in den 90er Jahren im Verein mit den ideologischen Utopien von einer sogenannten "Dienstleistungs"- oder "Informationsgesellschaft" noch weiter beschleunigt. So müssen heute immer mehr Waren, die in den USA nicht mehr hergestellt werden können, aus dem Ausland beschafft werden. Zwischen 1981 und 1990 ist das jährliche Volumen der US-Importe von 265 Mrd. auf 498 Mrd. Dollar angestiegen. Die 90er Jahre brachten dann eine weitere Vervielfachung der US-Importe auf nunmehr 1215 Mrd. Dollar pro Jahr. In der Folge explodierte das Handelsdefizit, Leistungsbilanzdefizit sowie notwendigerweise die Auslandsverschuldung der USA.
Parallel dazu sind in den vergangenen Jahren vor allem in Asien und Lateinamerika zahlreiche "Volkswirtschaften" fast vollständig auf den Export von Gütern in die USA umgestellt worden. Auch die Wirtschaft in Europa - in und außerhalb der Europäischen Union - ist sehr stark vom kreditfinanzierten Importsog aus den Vereinigten Staaten abhängig geworden. Besonders extrem ist die Abhängigkeit von Exporten nach Amerika in Südostasien, wo man nach den Finanzkrisen der Jahre 1997-99 glaubte, nur mit den auf diese Weise verdienten Dollars den Hals aus der finanziellen Schlinge ziehen zu können. In Ländern wie Japan, Taiwan, den Philippinen, Malaysia oder Thailand gehen längst 25% bis 40% aller Exporte in die USA. Im Falle Chinas geht 41,9% des gesamten Exportvolumens in die USA. Wenn man Mexiko nicht berücksichtigt, gehen 36,5% aller Exporte Lateinamerikas in die Vereinigten Staaten. Rechnet man Mexiko hinzu, sind es sogar 56,6%. Für Mexiko liegt die Abhängigkeit vom Exportmarkt USA sogar jenseits von 80%.
Was das "Bush-Team" vorhat und warum es nicht funktioniert
Was kann man nun angesichts der realwirtschaftlichen Kontraktion und der hyperfragilen finanziellen Lage in den USA von der neuen Bush-Administration erwarten? Die Antwort ist recht einfach: Krisenmangement. Bush selbst, Lindsey, O`Neill, Evans und die republikanischen Führer im Kongreß haben sich zu ihren Zielen mehrfach und recht deutlich geäußert: Weitere Senkungen des Zinsniveaus durch die Federal Reserve. Durch die damit bereitgestellte zusätzliche Liquidität sollen vor allem die Aktienmärkte "bei Laune" gehalten werden, wobei es höchst fraglich ist, ob das auch nur auf Zeit gelingt. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, so bedeutet das künstliche Hochhalten der Börsenkurse durch Liquiditätspumpen doch nur die Fortführung und Ausweitung der gigantischen Wertpapierinflation der vergangenen Jahre, die sich zwangsläufig auf das gesamtwirtschaftliche Preisniveau auswirken muß, wie man es bei den Energie- und Immobilienpreisen bereits sehen kann. Zugleich gefährden aber niedrige Zinsraten den Wechselkurs des überbewerteten Dollar und die Kapitalzuflüsse aus Übersee. Damit würde das monströse Zahlungsbilanzdefit der USA vollends außer Kontrolle geraten. Schließlich offenbart jede zusätzliche Zinssenkung der Federal Reserve dem In- und Ausland, wie stark tatsächlich die Angst, ja Panik über einen Wirtschaftseinbruch bei der Notenbank und der Regierung ausgeprägt ist.
Schnelle und umfangreiche Steuersenkungen. Damit hofft man die Konsumausgaben der Haushalte und Unternehmensinvestitionen zu ermuntern. Angesichts der extremen Verschuldung von Haushalten und Unternehmen dürften diese aber zunächst an die Rückführung des Verschuldungsniveaus denken, bevor irgendwelche zusätzlichen Ausgaben getätigt werden. Die Kombination aus rückläufigen Steuereinnahmen - wegen der sinkenden Wertpapierpreise (capital gains tax) und der schrumpfenden Gesamtwirtschaft - und zusätzlichen Steuersenkungen dürfte den "Haushaltsüberschüssen" und selbst einem "ausgeglichenen Haushalt" ein schnelles Ende bereiten. (Die Frage der Verrechnung der Social Security-Gelder im regulären Haushalt lassen wir hier außen acht.) Es droht also wieder die Ausweitung der öffentlichen Verschuldung, zusätzlich zu der monströsen privaten und Unternehmensverschuldung. Eine schnelle und umfängliche Ausweitung der Rüstungsausgaben. Dabei dürfte der Raketenabwehr (NMD) eine besondere Rolle zukommen. Es ist nicht auszuschließen, daß eine Art Crash-Programm für NMD aufgelegt wird, das auch aus der SDI der frühen 80er Jahre bekannte Strahlenwaffentechnologien umfaßt, die durchaus der Gesamtwirtschaft technologisch-industrielle Impulse verleihen können. Angesichts schrumpfender Steuereinnahmen stellt sich jetzt aber wieder die Frage der Finanzierung von großen Rüstungsprogrammen. Die durch eine enorme Ausweitung der Staatsverschuldung erreichte Aufrüstung der Reagan-Ära erfolgte vor dem Hintergrund einer US-Wirtschaft, die im Vergleich zu heute weit gesünder war. Damals war die realwirtschaftliche Substanz weit weniger zusammengeschrumpft und das volkswirtschaftliche Schuldenniveau weit geringer. Schließlich darf man den enormen Kompetenzverlust während der letzten Dekade in der amerikanischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie nicht unterschätzen, wie das die geradezu unglaublichen Probleme beispielsweise bei Boeing oder Lockheed-Martin zeigen.
Vom "Krisenmanagement"...
Die Schlußfolgerung, die sich aus der Bewertung der zentralen "Anti-Krisen-Maßnahmen" der Bush-Administration aufdrängt, ist, daß sie nicht greifen werden. Die Prognose lautet also, daß der Abwärtssog auf den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft und/oder eine galoppierende Inflationsdynamik die Wirtschaftspolitik des "Krisenmanagements" der Bush-Administration überrollen werden. Wahrscheinlich wird Alan Greenspan samt seiner angeblich "magischen" Fähigkeiten das erste Opfer dieser Lageentwicklung.
Man muß also realistischerweise befürchten, daß in dem Maße, wie die Unfähigkeit der Bush-Administration zur Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise offenbar wird, die Bereitschaft wächst, zu "unkonventionellen" Mitteln des Krisenmanagements zu greifen. Zu denken ist dabei an eine amerikanische Variante des Regimes der "Notverordnungen" in Deutschland zwischen 1930 und 1933.
...zum "Notstandsregime"?
In den USA besteht seit 1979 ein seither mehrfach perfektionierter Apparat für ein "Notstandsregime" in Gestalt der Federal Emergency Management Agency (FEMA), deren Aufgabe folgendermaßen definiert ist: The implementation of emergency actions both above and below the threshold of declared national emergencies and war. Letzteres - also Notstandsmaßnahmen "unterhalb" des formell ausgerufen nationalen Notstandes oder des Verteidigungsfalls - ist hier für uns von besonderem Interesse. Wirtschafts- und Finanzfragen spielen im FEMA-Apparat, in den praktisch alle Regierungsorgane und die Judikative integriert sind, eine herausragende Rolle. Im Rahmen der FEMA hat es eine Vielzahl von Stabsrahmenübungen gegeben, deren Schwerpunkt eine schwere Finanz- und/oder Wirtschaftskrise waren. Über die FEMA-Übung Rex 84 Alpha im Jahre 1984 ist einiges bekannt geworden. Es ging um "Krisenmanagement"/"Notstandsmaßnahmen" angesichts einer weltweiten Finanzkrise mit nachfolgenden schweren Wirtschaftserschütterungen und sozialen Unruhen inner- und außerhalb der Vereinigten Staaten.
Beim "privaten" New Yorker Council on Foreign Relations (CFR) fand am 12./13. Juli 2000 eine Konferenz statt, deren Thema lautete: "Die nächste Finanzkrise: Warnzeichen, Schadensbegrenzung und Wirkung". Daran nahmen etwa 250 handverlesene Bankiers, Manager, höhere Beamte und Politiker teil. Die Konferenz war Teil des "Projekts Finanzielle Verwundbarkeit" des CFR, der seit 1999 hinter verschlossenen Türen computergestützte "Kriegsspiele" organisierte, in denen finanzielle Großkrisen simuliert werden. Das "Kriegsspiel" vom 29. September 1999 beruhte auf der Prämisse, "daß die vielleicht gefährlichste kurzfristige Bedrohung der US-Weltführerschaft und somit indirekt der amerikanischen Sicherheit ein Absturz der US-Wertpapiermärkte wäre, der eine weltweite Finanzkrise auslöst".
Am 22. Januar 2000 veranstaltete der CFR dann ein "Kriegsspiel" über eine globale finanzielle Kernschmelze. An dieser achtstündigen Übung, bei der ein "14tägiger Zeitraum im Juli 2000" simuliert wurde, waren 75 Personen beteiligt, darunter führende Bankiers und hochrangige ehemalige Regierungsbeamte. Die Teilnehmer bildeten vier Teams und wurden auf vier Räume verteilt, in denen sie per Computer untereinander und mit einer "Kommandozentrale" verbunden waren. Diese Teams "spielten" den Vorstand der Federal Reserve, das amerikanische Finanz- und Handelsministerium, die Leitung der Finanzaufsichtsbehörden sowie die mit der inneren und äußeren Sicherheit der USA befaßten Behörden. Das dem "Kriegsspiel" zugrundeliegende Szenario beinhaltete einen Kollaps der wichtigsten Aktienmärkte, der im Laufe der acht Stunden um sich griff. Dabei wurde angenommen, daß der Dow-Jones-Index von 10 000 auf 7100 Punkte abstürzt, der Ölpreis auf 36 Dollar pro Barrel ansteigt, der Dollarkurs gegenüber Euro und Yen abstürzt und eine größere Pleite auf den Derivatmärkten eintritt.
Die "Wahlkrise" im Schatten Carl Schmitts
Wem die Möglichkeit eines "Notstandsregimes" unter Bedingungen einer Großkrise in Wirtschaft und Finanzen als abstruse Übertreibung erscheint, der sollte bedenken, daß ja bereits die Installierung der Bush-Administration jenseits jeder Wahl-"Normalität" erfolgte. Durch eine politische Entscheidung der Mehrheit des Obersten Gerichtes wurde George W. Bush zum Präsidenten gemacht. Diese Entscheidung beruhte in der Substanz auf der Begründung, daß die "Wahlkrise" von Anfang November bis Mitte Dezember eine nicht länger hinnehmbare faktische Notstandssituation geschaffen hatte, die unverzüglich durch die Installierung Bushs als Präsidenten beendet werden müßte. Die von den Richtern William Rehnquist und Antonin Scalia geführte Mehrheit im Supreme Court bewegt sich in rechtspolitischen Bahnen, die der Rechtsideologie Carl Schmitts ähneln. Carl Schmitt - der sich übrigens in der anglo-amerikanischen Rechtsdebatte großen Interesses erfreut - postulierte, daß "der Staat" unter wie immer gearteten Notstandsbedingungen rücksichtslos gegen seine "Feinde" vorzugehen hat, wobei den Ursachen des Notstandes und übergeordnetem Recht (Naturrecht) keine Bedeutung zukommt. Daraus folgte konsequenterweise Carl Schmitts juristisch-politische Apologie für Hitlers "Ermächtigungsgesetz" vom Februar 1933.
Der Chef des Supreme Court William Rehnquist hatte sich bereits während der Nixon-Präsidentschaft dadurch hervorgetan, daß er bezüglich der Proteste gegen den Vietnam-Krieg und der Rassenunruhen die Verhängung eines "qualifizierten Kriegsrechtes" (qualified martial law) für angemessen erklärte. Hier wäre noch der designierte Justizminister John Ashcroft zu erwähnen, der aus seiner Begeisterung für die Ideologie und Politik der konföderierten Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg keinen Hehl macht. Bei Ashcroft kommen kaum verbrämter Rassismus, pseudo-"christlicher Fundamentalismus" und Sozialdarwinismus zusammen. Er verficht genauso radikal die Todesstrafe wie er die Abtreibung ablehnt.
Schließlich steht der Oberste Gerichtshof genauso wie das gesamte "Bush-Team" hinter der "Thornburgh-Doktrin" von 1989 (benannt nach George Bushs Justizminister), die die nationale Souveränität anderer Staaten für rechtlich irrelevant erklärt, wenn die Interessen der USA substantiell tangiert werden. Wie ein Justizminister Ashcroft die "Thornburgh-Doktrin" handhaben würde, dürfte selbst hartgesottenen "Atlantikern" in Europa Alpträume bereiten.
Die Zentralfiguren des "Bush-Teams" - Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul O`Neill - sind allesamt Veteranen der Nixon-, Ford-, Reagan- und Bush-Administrationen. Hier ist auf die Debatte im US-Establishment über die "Krise der Demokratie" im Kontext der wirtschaftlichen Krisenerscheinungen nach der Ölkrise von 1973 hinzuweisen, deren Resultat ja die Schaffung der FEMA war. In einer gleichnamigen Studie des New Yorker Council of Foreign Relations (CFR) Mitte der 70er Jahre wurde betont, daß eine Verschärfung der Wirtschaftskrise vom Staat Maßnahmen erfordern könnten, die außerhalb des Rahmens einer "normalen" demokratischen Ordnung liegen, da Mehrheitsentscheidungen üblicherweise "notwendige" wirtschaftliche, soziale und rechtliche Einschnitte und Einschränkungen blockierten.
Die Schwere der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise läßt die Probleme der 70er Jahre als ziemlich harmlos erscheinen. Doch die damals in den USA geschaffenen rechtlichen und administrativen Strukturen für Notstandslagen könnten in der heutigen Lage eine höchst ominöse Bedeutung gewinnen.
Wirtschaftskrise und strategische Brennpunkte
Die Wirtschafts- und Finanzkrise in den Vereinigten Staaten existiert selbstverständlich nicht an sich, sondern vermengt sich mit politischen und strategischen Faktoren, auch wenn die wirtschaftlich-finanzielle Dynamik die primäre Triebkraft - positiv oder negativ - der strategischen Gesamtentwicklung bleibt. Die deutsche Erfahrung der frühen 30er Jahre zeigt, wohin der wirtschaftliche Abwärtssog die politische und strategische Lage treibt. Daß die Entwicklung in den Vereinigten Staaten damals unter vergleichbaren wirtschaftlichen Bedingungen glücklicherweise anders verlaufen ist, ist hauptsächlich das Verdienst einer politischen Ausnahmepersönlichkeit - Franklin Delano Roosevelt.
Dennoch müssen wir uns heute fragen, was etwa geschähe, wenn es in naher Zukunft bei einer dramatischen Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage in den USA zu ähnlichen Terroranschlägen käme wie im Frühjahr 1993. Man erinnere an die verheerenden Anschläge in Oklahoma City oder beim New Yorker World Trade Center. Oder wenn es, was keineswegs unwahrscheinlich ist, zum Ausbruch eines offenen Krieges im Nahen Osten oder sogar der gesamten Mittel-Ost-Region käme. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Lageentwicklung Amerikas unter der Bush-Administration muß man, meiner Meinung nach, in eine solche Richtung vordenken.
LaRouche über "den Umgang mit Bush"
Wie die Vereinigten Staaten und die Welt mit der Präsidentschaft von George W. Bush umgehen sollten, war das Thema eines EIR-Seminars, das am 3. Januar in Washington stattfand. Wir zitieren aus der Rede Lyndon LaRouches, die im Internet live übertragen wurde:
"Das Problem heute ist nicht nur George W. Bush. Meines Erachtens hat George W. Bush von all dem - dem Ausmaß der wirtschaftlich- finanziellen und strategischen Krise - keine Ahnung und kann es auch nicht im entferntesten begreifen. Um ihn herum sind einige Leute, die geistig mehr auf dem Kasten haben. Aber sie sind als politischer Apparat auf die Politik festgelegt, die sich Schritt für Schritt seit Nixon unter Kissinger, unter Carter, unter Brzezinski, unter George Bush als Vizepräsident und Präsident bis heute verfestigt hat...
Das Problem ist also nicht, daß es keine Lösungen gäbe. Wir könnten uns sehr wohl mit anderen Nationen darauf verständigen, daß wir uns in einer wirtschaftlichen Depression befinden und deshalb gemeinsam eine neue Weltwährungskonferenz für ein Neues Bretton Woods einberufen, um ein System mit festen Wechselkursen einzuführen, wie es uns in der Nachkriegszeit aus der Depression herausgeholt hat... Es stimmt, die heutige Krise ist viel schlimmer als diejenige, mit der Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren konfrontiert war. Aber die Lehren, die wir aus Roosevelts Erfolgen ziehen können, zeigen uns, wie wir heute mit den Problemen umgehen müssen...
Die Vereinigten Staaten erholten sich dank Franklin Roosevelt von der Depression, die durch die Politik von Teddy Roosevelt, Wilson und Coolidge verursacht worden war. Roosevelt erkannte das Problem und rettete die USA aus der Depression, ohne eine Diktatur zu errichten, die unsere Verfassung außer Kraft gesetzt hätte. Er hat uns sicher durch den Krieg geführt, und obwohl seine Politik nach seinem Tod stark beschnitten wurden, half sie den USA und Westeuropa, sich von den Auswirkungen von Krieg und Depression zu erholen. Amerika war von 1933-65 trotz aller seiner Fehler das wirtschaftliche Vorbild für die Welt.
Wir würden uns also der Lehren der Vergangenheit besinnen und sagen: ,Das hat sich bewährt, und wir werden es heute auch so machen.`... Nur müssen wir diesmal auch die Teile der Welt berücksichtigen, die in der Nachkriegszeit zu kurz kamen, die sogenannten Entwicklungsländer. Wir müssen die Nationen einen für das Vorhaben, diesen Planeten vor der schlimmsten Depression seit vielen Jahrhunderten zu bewahren. Die meisten Länder werden zustimmen. Es gibt viele Länder, die auch heute noch den USA bei einem solchen Vorhaben folgen werden. Wenn wir der Welt, wenn wir Europa, Asien usw. sagen: ,Das Amerika Roosevelts und Kennedys ist wieder da`, werden sie sehr froh sein. Wenn wir ihnen vorschlagen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Probleme auf der Grundlage früherer Erfahrungen zu lösen, werden sie mitmachen. Die USA haben immer noch eine große moralische Autorität wegen ihrer früheren Leistungen - nicht aus der jüngsten Vergangenheit, sondern aus der Zeit Roosevelts und Kennedys...
Das Problem ist, daß die politische Ausrichtung [der neuen Administration] - und der neue Präsident selbst - gegen diese Dinge aus der Vergangenheit sind, die allein unser Problem lösen könnten. Es ist zu bezweifeln, ob die USA als Nation eine Regierung Bush jun. lange aushalten können, wenn es nicht zu einem völligen Umschwung kommt...
Genau hier liegt meine Rolle: als eine Art Katalysator zu wirken, zur Einigung all derer, welche die Überzeugung teilen, daß die konsequente Förderung des Gemeinwohls die einzige legitime Grundlage für die Autorität einer Regierung ist. Denn alles andere läuft unter Krisenbedingungen auf ein Notstandsregime und Diktatur hinaus, wie wir sie in Deutschland hatten, als es dort versäumt wurde, dem Rooseveltschen Weg aus der Wirtschaftskrise zu folgen. Das ist die Lage und das, was ich tun werde.
Was George W. Bush angeht, so werden wir alles versuchen, was möglich ist. Aber wir werden unter keinen Umständen versuchen, einen ,Konsens` mit ihm zu finden. Denn für einen Konsens muß der andere ein Mindestmaß an Vernunft haben. Ansonsten macht das keinen Sinn. Es gibt aber Leute in seiner Umgebung, die nicht ganz unintelligent sind. Wir brauchen nur genügend politischen Einfluß und Mitstreiter. Wir werden George W. Bush durch Versuche, ihn zu erziehen, kaum bessern können - ich halte ihn für ziemlich schwer erziehbar. Aber ich glaube, wir könnten genug Druck aufbauen, so daß er zu der Überzeugung kommt, es wäre besser, mit guter Miene mitzumachen. Aber dafür müssen wir ein gewaltiger politischer Machtfaktor sein. Und dabei wird uns die Krise helfen. Wenn die Krise voll zuschlägt, wird Bush Alan Greenspan anrufen, der wird sich aber irgendwo verstecken und nicht ans Telefon gehen. Denn auch Alan Greenspan wird dann nicht mehr wissen, was er tun soll. Es wird eine Lage entstehen, wo man feststellt, daß ,nichts mehr funktioniert`. Aber wir wissen dann, was man tun kann..."
Ausblick
Es ist also nicht so, daß in den Vereinigten Staaten ein Notstandsregime oder Schlimmeres im Kontext einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise sozusagen "vorprogrammiert" wäre. Schließlich gibt es viele Imponderabilien in der amerikanischen Politik, die unter Krisenbedingungen ein weit weniger "geschlossenes System" sein wird als dies heute noch der Fall zu sein scheint. In der Demokratischen Partei brodelt es schon heftig, wobei die wirtschaftspolitischen Konzepte LaRouches eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die Wirtschafts- und Finanzkrise ist zugleich der Offenbarungseid des neoliberalen Paradigmas der vergangenen 20 Jahre. In den USA und weltweit hat eine - wenn auch erst tastende - Rückbesinnung auf wirtschaftspolitische Grundsätze eingesetzt, die sich, auf die heutigen Verhältnisse zugeschnitten, an der Wirtschaftspolitik eines F.D. Roosevelt oder des deutschen Ökonomen Wilhelm Lautenbach orientieren. Dennoch wäre es das Fatalste, sich über die mögliche Lageentwicklung in den Vereinigten Staaten selbstbesänftigende Illusionen zu machen.
27. Januar 2001
Michael Liebig
Wohin geht America?
Wirtschaftliche und politische Perspektiven unter der Administration George W. Bush
Aus der EIRNA-Studie Hyperinflation und Weltfinanzkrise, 2. erweiterte Auflage, Februar 2001
Warum stellen wir diesen Artikel in den EIRNA-"Brennpunkt"?
Michael Liebig analysierte darin vor acht Monaten die höchst prekäre Wirtschaftslage der Vereinigten Staaten zum Zeitpunkt des Amtsantritts von George Bush jun.: die enorme Verschuldung, das riesige Handelsbilanzdefizit, die kalifornische Energiekrise und die untauglichen Mittel, womit die neue Administration von George W. Bush dagegen vorzugehen begann.
Im zweiten Teil äußert er die Befürchtung, daß mit dem Scheitern des herkömmlichen Krisenmanagements die Bereitschaft zu "unkonventionellen" Mitteln des Krisenmanagements immer mehr wächst. Er erinnert an den mehrfach perfektionierten Notstandsapparat der USA und an diverse "Kriegsspiele" des Council on Foreign Relations im Herbst 1999 und im Januar 2000, bei denen die Auswirkungen einer globalen finanziellen Kernschmelze auf die amerikanische Sicherheit simuliert wurden. Und er warnt vor jähen Wendungen im Gefolge von verheerenden Terroranschlägen wie 1993 in Oklahoma City oder auf das World Trade Center...
Erinnern Sie sich noch, was im September 2000, zwei Monate bevor George W. Bush in das Präsidentenamt gehievt wurde, das Bild war, das inner- und außerhalb der Vereinigten Staaten von der amerikanischen Wirtschaft gezeichnet wurde? Damals hieß es, die US-Wirtschaft befinde sich im "längsten und robustesten Wirtschaftsboom" aller Zeiten. In den USA seien mit dem erfolgreichen Übergang zur "New Economy" die Probleme und die Krisenanfälligkeit der "alten Wirtschaft" des Industriezeitalters überwunden worden. Beispielloses Wirtschaftswachstum und nie gekannte Produktivitätszuwächse seien nun selbstverständlich. Stets steigende Unternehmensprofite und Kapitalgewinne auf den Aktienmärkten hätten einen beispiellosen "Wohlstandseffekt" erzeugt, der sich in stets wachsenden Konsumausgaben der Haushalte (von denen rund 50% Aktienanlagen besitzen) ausdrücke. Inflation sei kein ernsthaftes Problem mehr. Das Vertrauen der Welt in das amerikanische "Wirtschaftswunder" bezeugten der starke Dollar und die hohen ausländischen Kapitalzuflüsse, während der dahinschwächelnde Euro demonstriere, wie rückständig und unbeweglich die europäische Wirtschaft sei. Das Schlimmste, was der US-Wirtschaft je passieren könnte, wäre eine gewisse - "völlig unproblematische", geradezu "gesunde" - Abflachung der hohen Wachstumsraten von Bruttosozialprodukt, Aktiengewinnen oder Unternehmensprofiten. Nach einer solchen "weichen Landung" könne sogleich zum nächsten wirtschaftlichen Höhenflug der amerikanischen Wirtschaft durchgestartet werden.
Wir haben Sie gewarnt
Eine kleine Minderheit von Ökonomen, darunter der Amerikaner Lyndon LaRouche an hervorragender Stelle, sagten demgegenüber: Das "amerikanische Wirtschaftswunder" ist schlicht eine Fiktion, deren "Grundlage" eine in der Tat beispiellose monetäre und Kreditexpansion sowie eine beispiellose Verschuldung der privaten Haushalte, der Banken, der Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt (Handels- und Zahlungsbilanzdefizit) ist. LaRouche betonte, daß sich die Schere zwischen realwirtschaftlicher Substanz und den monetären und finanziellen Aggregaten in den USA (allerdings nicht nur dort) soweit geöffnet hat, daß ein geordnetes, graduelles "Ablassen heißer Luft" aus der Finanzblase nicht mehr möglich ist, sondern eine kontraktive Implosion bzw. inflationäre Explosion im Finanzsystem unvermeidbar wird. Der angebliche wirtschaftliche und finanzielle "Boom" in den USA, sagte LaRouche, existiert wohl in der Vorstellungswelt der "Marktteilnehmer", aber nicht in der Realität. Der "Boom" ist primär ein "Glaubensgut", das mit einer heftigen Dosis Massenhysterie unterlegt ist, das wiederum das Ergebnis einer in der Tat beispiellosen "konzertierten Aktion" von Regierung, Notenbank, Finanzwirtschaft und Medien seit Mitte der 90er Jahre ist.
Nach den Präsidentschaftswahlen am 7. November 2000, so LaRouches Prognose, werden die wirtschaftlichen Tatsachen schnell und auf höchst unangenehme Weise zur Geltung kommen. Den Vereinigten Staaten steht im Jahre 2001 weder eine "weiche" noch eine "harte Landung" der Wirtschaft bevor, sondern eine systemische Finanz- und Wirtschaftskrise. Diese Großkrise wird das Schicksal der Bush-Administration bestimmen. Dabei werden nicht die wirtschaftspolitischen Absichten und Pläne des "Bush-Teams" ausschlaggebend sein, vielmehr wird die Realität der Krise das politische Verhalten der Bush-Administration bestimmen.
Ein Blick hinter die Fassade
Im einzelnen wies LaRouche auf die folgenden wirtschaftlichen und finanziellen Fakten hin: Nach Angaben der Federal Reserve wuchsen die Schulden in den Vereinigten Staaten in den 90er Jahren dreimal so schnell wie das Bruttoinlandsprodukt: Ende 1999 betrug das amerikanische BIP 9,5 Bio. Dollar, während sich die Gesamtverschuldung auf 25,6 Bio. Dollar belief. In den 90er Jahren stieg das BIP um 3,9 Bio. Dollar, während sich die Schulden um 12,8 Bio. Dollar vermehrten. Auf jeden Dollar nominellen Wirtschaftswachstums kommen 3,27 Dollar zusätzlicher Schulden! Die Schulden der nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen stiegen in den letzten fünf Jahren um 67% auf 4,5 Bio. Dollar, während die Schulden der Haushalte sich um 60% auf 6,5 Bio. Dollar vermehrten.
In den USA sind "Ramschanleihen" (Junk Bonds) im Wert von 529 Mrd. Dollar im Umlauf - gegenüber 173 Mrd. Dollar vor zehn Jahren. Im Durchschnitt hat jeder amerikanische Haushalt inzwischen 13 Kreditkarten und 7500 Dollar an Kreditkartenschulden - gegenüber 3000 Dollar im Jahr 1990. Die Schulden der Privathaushalte belaufen sich jetzt auf 101% ihres Einkommens (1990: 84%).
Die Unternehmensschulden belaufen sich jetzt auf 46% des amerikanischen BIP - der höchste Stand, der je erreicht wurde.
Die Verschuldung des amerikanischen Finanzsektors wird vom ehemaligen Chefvolkswirt der Dresdner Bank, Kurt Richebächer, sogar auf rund 25 Bio. Dollar geschätzt, was deutlich über den in den USA zirkulierenden Schätzungen liegt. (Wahrscheinlich wegen der "Grauzone" der Derivate.) Aber auch amerikanische Zahlen belegen, daß die Schulden der Finanzunternehmen die am schnellsten wachsende Kategorie der Schulden darstellen: Seit 1993 wuchsen sie um 132%! In den heutigen USA fällt die dramatische Kreditausweitung mit einem vollständigen Zusammenbruch der privaten Ersparnisbildung zusammen. Wie refinanzieren sich also die amerikanischen Banken? In immer stärkerem Maße dadurch, daß sie sich selbst, im Inland wie im Ausland, verschulden. Im Jahre 1999 erreichte die jährliche Neuverschuldung des US-Finanzsektors bereits den schwindelerregenden Wert von 1087 Milliarden Dollar.
Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen der Federal Reserve hatten 1998 die amerikanischen Familien 53,9% ihres Geldvermögens in Aktien angelegt - 1989 waren es nur 27,8%! In dieser Zeit stieg der Nominalwert des privaten Aktienbesitzes von 2,13 Billionen Dollar auf mehr als das Dreifache - 7,39 Bio. Dollar. Das Einkommen von 48,5% aller Haushalte hängt von Aktiengewinnen ab! Die Scheinprosperität der US-Wirtschaft seit 1995 beruhte hauptsächlich darauf, daß steigende Aktienpreise einen nominellen "Wohlstandseffekt" erzeugten, der zu expandierenden Konsumausgaben - und Konsumentenschulden - führte. Die steigenden Konsumausgaben wurden aber nicht durch eine entsprechende Steigerung der Produktionsleistung der amerikanischen Wirtschaft gedeckt, sondern mehrheitlich durch stetig steigende Importe. Dies führte zwangsläufig zu dem Monat um Monat wachsenden Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten.
1999 investierten ausländische Investoren täglich rund 1 Mrd. Dollar in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2000 floß nach den Angaben des US-Handelsministeriums ausländisches Kapital in noch größeren Mengen ins Land: durchschnittlich 1,9 Mrd. Dollar pro Tag, fast doppelt soviel wie 1999. Die Finanzmärkte in den USA wurden weiter dereguliert, wobei die Abschaffung des Glass-Steagall-Gesetzes, durch das bislang Kredit-, Wertpapier- und Versicherungsgeschäfte im US-Finanzsystem getrennt waren, von besonderer Bedeutung ist. Hinzu kommt der weitere Abbau von Beschränkungen im Handel mit Finanzderivaten. Mit einer stetig anschwellenden Welle von Megafusionen wurde die Kartellisierung im Finanz- und fast allen anderen Wirtschaftssektoren vorangetrieben. Immer öfter wurde die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, die durch geschickte "statistische Anpassungen" - vor allem bei Inflations- und Produktivitätszahlen - frisiert werden, dazu benutzt, das Wirtschaftswachstum zu überzeichnen und so ein "positives Klima" an den Finanzmärkten zu erzeugen. Immer öfters kam bei Turbulenzen auf den Finanzmärkten das sogenannte "Plunge Protection Team" (Absturz-Verhinderungsteam) zum Einsatz. Diese "Arbeitsgruppe Finanzmärkte beim Präsidenten" - so der offizielle Name des "Plunge Protection Team" - umfaßt Spitzenleute des Finanzministeriums, der Federal Reserve und Vertreter der führenden privaten Finanzhäuser und Banken, um bei Einbrüchen auf den Finanzmärkten durch gezielte Marktinterventionen "gegenzusteuern". Ein Veteran unter den Volkswirten äußert sich Im Anschluß an diese Einschätzung LaRouches möchte ich kurz den früheren Chefvolkswirt der Dresdner Bank, Dr. Kurt Richebächer, zu Wort kommen lassen. Richebächer ist ein höchst erfahrener Wirtschaftsanalyst und steht in der Tradition von Dr. Wilhelm Lautenbach, des wohl herausragendsten deutschen Ökonomen des 20. Jahrhunderts. In der November 2000-Ausgabe seines in den USA erscheinenden Richebaecher Letter veröffentlichte Richebächer eine Einschätzung der US-Wirtschaft, der er den Titel "Nach uns die Sintflut" gab. Richebächer schrieb, daß "Ausschläge auf den Aktienmärkten immer wilder werden", was dem nüchternen Analysten signalisiert, daß die Aktienhausse zu Ende geht. Sehr bald werde man "geschockt" sein, "wie schnell die ,Stärke` der US-Wirtschaft einfach verschwunden sein wird". Dann werde man auch erkennen, daß die angeblichen Errungenschaften der "New Economy" in der Realität "niemals existiert haben".
Schon ein Blick auf die offiziellen Statistiken über "National Income and Product Accounts" (NIPA) der amerikanischen Regierung und Notenbank zeigten, daß das tatsächliche Gewinnwachstum in der US-Wirtschaft zwischen 1996-2000 bestenfalls moderat war und in der Industrie nur einen Jahresdurchschnitt von 3,4% erreicht hat. Dabei ist die weitverbreitete "kreative Buchführung" bei US-Unternehmen noch genausowenig berücksichtigt wie die Entlohnung von Mitarbeitern durch "Aktienoptionen" statt Geld oder die Schrumpfung der Ausgaben für die betriebliche Altersversorgung, die durch Aktiengewinne der Pensionsfonds weitgehend "überflüssig" geworden seien.
Die angeblichen enormen Produktivitätssteigerungen der US-Wirtschaft beruhten hauptsächlich auf statistischen Tricks der amerikanischen Behörden, die laufende Betriebskosten bei der Datenverarbeitung als "Kapitalinvestitionen" der Firmen ausgeben. Der Faktor "Qualitätsanpassung" in der amerikanischen Wirtschaftsstatistik führt dazu, daß bei gleichbleibenden Produktionszahlen und Verkaufspreisen die Leistungssteigerungen von Computern und Telekommunikationsausrüstungen dahingehend kalkuliert werden, daß der "Ausstoß" dieser Produkte um den Faktor ihrer Leistungssteigerung vervielfacht wird (hedonic calculus). Dadurch läßt sich natürlich der Produktivitätszuwachs kräftig erhöhen. Gleichzeitig wird von den tatsächlichen Verkaufspreisen der Faktor Leistungssteigerung substrahiert, womit sich in der Statistik die Inflationszahlen sehr schön drücken lassen.
Die schwache Gewinnentwicklung in der US-Wirtschaft während der 90er Jahre, schreibt Richebächer, "ist keineswegs ein zufälliger Ausrutscher, sondern sie ist endemisch und strukturell. Diese Ertragsschwäche hat zwei leicht zu erkennende Ursachen. Ironischerweise entspringen sie genau den beiden Hauptcharakteristika des ,Neuen Paradigmas` der US-Wirtschaft, die üblicherweise als die Hauptquellen des überlegenen Wirtschafts- und Produktivitätswachstums ausgegeben werden. Das eine ist das ,Shareholder Value`-Modell, das andere ist die neue Informationstechnologie."
Die "alten Ökonomen" aber hätten diese beiden Dinge als "anti-kapitalistisch" eingestuft, schreibt Richebächer, denn Shareholder Value sei nur ein "nebulöser Euphemismus" für "kurzfristige Maßnahmen zur Kosteneinsparung und zum betrieblichen Potentialabbau", wozu noch Firmenübernahmen, Aktienrückkäufe und ähnliches kommen. Shareholder Value bedeutet also das Gegenteil von langfristiger Investition und Kapitalbildung. Ähnliches gilt für das "New Economy"-Paradigma, mit dem angeblich volkswirtschaftlicher Reichtum ohne langfristige Kapitalbildung erreicht werden kann, das aber tatsächlich "massive Kapitalvernichtung" bedeutet.
Vor diesem Hintergrund fragt Richebächer: "Welchen Kapitalismus haben wir also tatsächlich in den Vereinigten Staaten? Unsere Antwort lautet: Statt eines neuen und effizienteren Kapitalismus haben wir es mit einem ,niedergehenden und degenerierten` Kapitalismus zu tun. Die Substanz des klassischen Kapitalismus war langfristig orientierte Kapitalbildung aus Ersparnisbildung mit einem starken Bewußtsein der Verantwortung für künftige Generationen. Und was ist der Kern des ,neu-amerikanischen` Modells des Kapitalismus der 90er Jahre? Es ist die hektische Jagd der Firmenbosse nach dem schnellen und leichten Profit auf dem Aktienmarkt. Das geschieht durch Finanzgeschäfte und Aktienrückkäufe und wird ermöglicht durch eine Öffentlichkeit, die aufgehört hat zu sparen, während im Finanzsystem eine zügellose Kreditschöpfung stattfindet. Dabei zielt alles auf Konsum und Spekulation. Die Verantwortung der Firmenchefs in diesem ,Neuen Kapitalismus` beginnt und endet mit dem kurzfristigen Aktienkurs. Das ist niedergehender und degenerierter Kapitalismus, in dem Sinne, daß Ersparnisbildung und Kapitalakkumulation, die Wesenszüge einer kapitalistischen Wirtschaft, völlig verschwunden sind. Schlimmer noch, hier haben wir einen Kapitalismus, dessen sich jede gebildete Nation schämen sollte, denn die auf ihm basierenden Unternehmensstrategien kommen aus einer mikroökonomischen Logik, die ausschließlich auf der Maximierung des aktuellen Shareholder Value hinausläuft und damit zwangsläufig immer negativere makroökonomische Konsequenzen - bezüglich Wirtschaftswachstum, Einkommens- und Gewinnentwicklung - hervorbringt. Tatsächlich geht es hier um ungezügelten Überkonsum auf Kosten der künftigen Generationen, die einen ausgelaugten Kapitalstock, einen Berg von Auslandsschulden und jede Menge wertloses Papier (Aktien und Anleihen) erben werden. Man könnte von einem ,Beggar-Thy-Children`-Kapitalismus sprechen. Das Motto dieses Kapitalismus lautet ,Nach uns die Sintflut`".
Richebächer betont, die "wirtschaftlichen Ungleichgewichte und Finanzexzesse nie dagewesenen Ausmaßes", welche die US-Wirtschaft "verwundbar wie noch nie" machen, könnten niemandem entgehen, der willens sei, den Tatsachen ins Auge zu sehen. "Überall gibt es schwerwiegende Probleme: auf den Kreditmärkten und im Bankensektor, bei den Aktienbewertungen, bei der Gewinnentwicklung, bei der Schuldenbelastung von Unternehmen und Konsumenten, bei der negativen Sparrate, beim riesigen Handelsdefizit und beim massiv überbewerteten Dollar. Das Vertrauen in den Dollar ist bislang der Faktor gewesen, der das auseinanderfallende System noch zusammengehalten hat." Aber "die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft ist völlig fehl am Platze. Wir haben es schließlich mit der schlimmsten Finanzblase der Geschichte zu tun."
Das "Bush-Team" und die Finanzblase
George W. Bush wie Al Gore beanspruchten für sich die Urheberschaft für die als "Wirtschaftswunder" ausgegebene "schlimmste Finanzblase der Geschichte". Bush behauptete, der "Boom der 90er Jahre" sei die Frucht der "radikalen Reformen" - Deregulierung, Privatisierung, Steuersenkungen und "Freihandel" - der 80er Jahre während der Reagan-Bush-Ära. Gore behauptete, das amerikanische "Wirtschaftswunder" sei erst in der Clinton-Ära möglich gemacht worden, in der (hatte er nicht das Internet "erfunden"?) Alan Greenspan, Robert Rubin und Larry Summers das wirtschafts- und finanzpolitische Sagen hatten. Einig waren sich Bush Jr. und Gore in ihren hymnischen Lobpreisungen für "Chairman Greenspan". In der republikanischen Wahlplattform hieß es: "Inspiriert von den Präsidenten Reagan und Bush legten die Republikaner die Grundlage für die heutige Prosperität und Überschüsse. Wir senkten die Steuern, vereinfachten die Steuergesetze, deregulierten die Industrie und öffneten US-Firmen die Weltmärkte. Das Resultat war das erstaunliche Wachstum der 80er Jahre, das unternehmerisches Kapital für die Technologie-Revolution der 90er Jahre bildete. Das ist der Ursprung der heutigen New Economy: der längste Boom des 20. Jahrhunderts... Wir haben diese Revolution während der Regierungen Reagan und Bush eingeleitet. Nun werden wir sie vollenden: amerikanische Führung in einer globalen Wirtschaft... Für die amerikanischen Produzenten wie Konsumenten sind die Vorteile des Freihandels schon jetzt enorm. In naher Zukunft werden sie unkalkulierbar sein." (Dies stimmt, aber in ganz anderem Sinne, als die Autoren meinen.)
Für den Wirtschaftsteil der Wahlplattform zeichnete Lawrence Lindsey verantwortlich. Das ehemalige Mitglied des Federal Reserve Board in den 80er Jahren wurde Anfang Januar 2001 zum "Sonderberater des Präsidenten für Wirtschaftsfragen" im Weißen Haus ernannt. Lindseys Wirtschaftspolitik ist ganz einfach: Schnell und massiv die Steuern senken, dann kommt angeblich die Prosperität ganz von selbst.
Der neue Finanzminister ist Paul O`Neill, der bisherige Chef des Aluminiumriesen Alcoa, in dessen Vorstand Greenspan saß, bevor er 1987 Federal Reserve Chairman wurde. O`Neill ist wie Vize-Präsident Dick Cheney oder der neue Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ein Veteran der Nixon- und Ford-Administrationen der 70er Jahre. Neuer Handelsminister wurde Don Evans, der aus der texanischen Ölindustrie kommt. Man darf aber nicht übersehen, was Bush jun. sagte, als er in einer Fernsehdebatte mit Gore während des Wahlkampfes gefragt wurde, was er täte, wenn es zu einer Finanz- oder Wirtschaftskrise kommen sollte? Bush antwortete, er werde Chairman Greenspan um Rat fragen und dann dessen Rat befolgen.
Nach den Wahlen platzt der trügerische Schein
Dazu hatte er schnell Gelegenheit. Noch bevor das Oberste Gericht - beziehungsweise dessen Mehrheit - am 13. Dezember 2000 Bush ins Präsidentenamt hievte, mußte der designierte Vizepräsident Dick Cheney einräumen, daß die US-Wirtschaft "am Rande einer Rezession" stehe. In der Tat, der Dezember 2000 wurde zum mens horribilis der amerikanischen Wirtschaft: Statt der erhofften "Bush-Rallye" schmolzen die Kurse der am NASDAQ notierten Technologieunternehmen dahin. Fast täglich gab es neue Gewinnwarnungen, hauptsächlich von Unternehmen der "New Economy". Bis Ende Dezember hatte der NASDAQ-Index im Jahresvergleich 40% verloren, der schlimmste Einbruch seiner dreißigjährigen Geschichte. Als der NASDAQ am ersten Handelstag des neuen Jahres 7,2% verlor, geriet Alan Greenspan in Panik. Zum ersten Mal in seiner 13jährigen Amtszeit berief Greenspan eine Notkonferenz der Fed-Gouverneure per Telefon-Konferenzschaltung ein, bei der die kurzfristige Zinsrate (Fed Funds) und die Diskontrate um 0,5% gesenkt wurde. Eine Zinssenkung außerhalb der planmäßigen Fed-Treffen hatte es zuletzt im Herbst 1998 gegeben, als das Weltfinanzsystem nach dem Bankrott des Hedge Funds LTCM unmittelbar vor dem Zusammenbruch stand. Aber selbst damals war die Zinssenkung nur in der üblichen Größenordnung von einem Viertelprozentpunkt erfolgt. Jetzt verabreichte Greenspan den Märkten gleich die doppelte Portion. Und obendrein ließ er durchblicken, daß er nicht zögern werde, noch mehr draufzulegen, falls die US-Wirtschaft weiter einbreche.
In der gegenwärtigen Lage mag die Verabreichung von mehr und billigerem Zentralbankgeld kurzfristig den Abwärtstrend auf den Finanzmärkten etwas unterbrechen, aber damit wird keine Trendwende mehr zustande gebracht - was schon ein Blick auf die Aktienkurse im vierten Quartal 2000 zeigt -, während die Inflationsdynamik weiter verstärkt wird. Bezüglich des tatsächlichen Zustandes der US-Wirtschaft wurden allein in den Tagen um Weihnachten und Neujahr die folgenden Hiobsbotschaften verbreitet:
Am 3. Januar berichtete die Nationale Vereinigung der Einkaufsmanager (NAPM), daß ihr vielbeachteter Index für die industrielle Aktivität in der US-Wirtschaft im Dezember 2000 auf den niedrigsten Wert seit dem April 1991 gefallen ist. Im November betrug der entsprechende Wert 47,7, im Dezember waren es nur noch 43,7. Ein Wert unterhalb von 50 bedeutet eine Kontraktion der Wirtschaft. Der NAPM-Index für die Auftragseingänge fiel innerhalb eines Monats sogar von 48,4 auf 42,0. Der mit 18 000 Beschäftigen viertgrößte US-Stahlhersteller LTV Corp. mußte Konkurs anmelden. Wegen mangelnder Nachfrage verfallen die Stahlpreise, während die Energiepreise in die Höhe schießen. Im November ging die Stahlproduktion in den USA um 12,4% zurück. Im Telekommunikationsektor kündigte Lucent Corp. die Entlassung von mehr als 10 000 Beschäftigen an. Yahoo und AOL Time Warner werden mehrere tausend Stellen abbauen. Die Zahl der Entlassungen in der US-Internetbranche ist im zweiten Halbjahr 2000 gegenüber dem ersten Halbjahr um 600% angestiegen. Im Dezember gingen die Entlassungen gegenüber dem Vormonat um 19% in die Höhe. Im gesamten Jahr 2000 waren 210 Internetfirmen mit insgesamt 15 000 Beschäftigten zusammengebrochen. Seit Oktober sind die Verkäufe der US-Autombilkonzerne rückläufig, deren Lagerbestände trotz massiver Rabatte seit Sommer zunahmen. Im Dezember sanken die Verkaufszahlen bei Ford um 14,6%, bei Chrysler um 14,8% und bei General Motors um 18,1%. General Motors will 15 000 Arbeitsplätze streichen. Ford und DaimlerChrysler hatten schon vor Weihnachten Produktionssenkungen und Betriebsstillegungen angekündigt. Die traditionsreiche Kaufhauskette Montgomery Ward mußte ihre Zahlungsunfähigkeit bekanntgeben. Rund 32 000 Beschäftigte werden ihren Arbeitsplatz verlieren und 258 Niederlassungen geschlossen. Auch die Kaufhauskette Bradlees meldete Konkurs an. Wal-Mart und Sears Roebuck meldeten ein stagnierendes oder rückläufiges Weihnachtsgeschäft. Für den Einzelhandel insgesamt war das vierte Quartal 2000 das schlechteste seit 1990. Im Dezember kündigten Großunternehmen den Abbau von 150 000 Arbeitsplätzen an; der Gesamtverlust an Arbeitsplätzen liegt ein Vielfaches darüber. Auch im Finanzsektor stehen Entlassungen an, nicht nur wegen der Kartellisierung bei Banken und Versicherungen, sondern weil das hochprofitable Geschäft mit Neuemissionen (IPOs) und Unternehmensfusionen außerhalb des Finanzsektors stark gelitten hat. Die Branche, die nach eigenen Angaben glänzende Aussichten für das laufende Jahr besitzt, sind die auf Unternehmensbankrotte spezialisierten Anwaltsbüros.
In Kalifornien gehen die Lichter aus
Am 16. Januar verhängte Gouverneur Gray Davis in Kalifornien den Notstand, weil die beiden führenden Stromversorger Kaliforniens Pacific Gas & Electric (PG&E) und South California Edison (SCE) vor den Bankrott standen und die Stromversorgung zusammenzubrechen drohte. Für Westeuropäer unbegreiflich, mußten aus Indien oder Afrika bekannte "rotierende Stromabschaltungen" im bevölkerungsreichsten und wohlhabensten Bundesstaat der USA eingeführt werden. (Die internationale Gemeinde der glühenden Bewunderer des "amerikanischen Wirtschaftsmodells" verhielt sich mucksmäuschenstill.) 1996 hatte Kaliforniens Parlament ein Gesetz zur "Deregulierung" der Stromversorgung verabschiedet. Damit wurde die unter Präsident F.D. Roosevelt eingeführte Strommarktordnung aufgehoben, in deren Rahmen die privaten Versorger seit den 30er Jahren zuverlässig und zu stabilen Preisen Strom in stets ausreichender Menge geliefert hatten. Nun wurden die Stromerzeugung und -verteilung aufgespalten; die integrierten Stromversorger mußten ihre eigenen Kraftwerke an meist in anderen Bundesstaaten ansässige "unabhängige" Stromproduzenten verkaufen.
Die Deregulierungsbefürworter argumentierten, wenn man die privaten Stromversorger zwinge, den Strom von "konkurrierenden" Stromgroßhändlern einzukaufen, käme der Verbraucher dank des Wirkens der "Marktkräfte" in den Genuß billigeren Stroms. Doch das Gegenteil war der Fall. Der Deregulierungsprozeß führte - nicht überraschend - zu einem fast völligen Baustopp neuer Kraftwerke, weil behauptet wurde, es gäbe wegen mangelnder "Markteffizienz" ein "Überangebot von überteuertem Strom". Die minimale Ausweitung der Kraftwerkskapazität in den letzten Jahren betraf kleine Einheiten, die mit - bis 1998 - noch billigem Erdgas betrieben werden. Inzwischen hat auch beim Erdgas eine gewaltige Preisexplosion eingesetzt, denn auch die Erdgaserzeugung stagniert seit sieben Jahren. Teure Investitionen bei der Erdgasförderung in Nordamerika wurden kaum getätigt, während die Nachfrage auf dem ebenfalls deregulierten Erdgasmarkt deutlich anstieg.
Im Laufe der letzten Jahre kam es deshalb in Kalifornien zu einer immer größeren Lücke zwischen Nachfrage und Lieferkapazität bei Strom. Die "Marktkräfte" förderten keineswegs kostspielige und langfristige Investitionen in neue Kraftwerke, wohl aber einen stetig wachsenden Preisdruck bei Strom, der bald die Form spekulativer Erpressung annahm. Das Stromdefizit betrug im Januar 2001 rund 15% des Verbrauchs in Kalifornien. Der weitverbreitete Hinweis auf die strengen Umweltauflagen in Kalifornien als angebliche Ursache des Strommangels geht an den tatsächlichen ökonomisch begründeten Ursachen für nicht getätigte Kraftwerkinvestitionen vorbei.
Die katastrophale Energiekrise in Kalifornien ist nur das eklatanteste Beispiel der inkompetenten, ja korrupten Maßnahmen des amerikanischen Kongresses seit Anfang der 90er Jahre, mit denen zunächst der Erdgasmarkt und dann der Strommarkt dereguliert wurde. Dabei überließ es der Kongreß den 50 Bundesstaaten, wie sie die Deregulierung durchführen wollten. Kalifornien war seit 1996 der Vorreiter der Deregulierung; 25 weitere Bundesstaaten deregulierten oder wollten dies tun, bis die Krise in Kalifornien ausbrach. Schon im Frühjahr 2000 hatte LaRouche vor einer akuten Energiekrise in Amerika gewarnt, weil "Deregulierung und Disinvestment" das US-Elektrizitätsnetz auf ein "Dritte-Welt-Niveau" gebracht hätten. Er forderte die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung des von Roosevelt geschaffenen Ordnungsrahmens für die amerikanische Stromwirtschaft und ein zügiges Investitionsprogramm, vor allem für Kernkraftwerke.
Das kalifornische Deregulierungsgesetz von 1996 legt eine Obergrenze für den Tarif fest, den die Stromversorger (SCE und PG&E) vom Verbraucher fordern dürfen, bis die Trennung von Produktion und Verteilung juristisch abgeschlossen ist. Eine Obergrenze für die Preise, die der Stromversorger seinem Großhändler zahlen muß, wurde aber nicht festgesetzt. In den letzten Monaten haben die Stromgroßhändler die Stromverknappung in Kalifornien vor dem Hintergrund des generellen spekulativen Preisanstiegs für Energie gnadenlos ausgenutzt, um die Preise nach oben zu treiben. Noch vor drei Jahren konnte die SCE den Strom aus den damals noch ihr gehörenden Kraftwerken für 31 $/MWh verkaufen und dabei noch einen Gewinn machen. Mitte Dezember 2000 mußte SCE bis zu 1000 $/MWh für den Strom von Fremdlieferanten bezahlen, den sie ihren Kunden für 31 $/MWh weiterverkaufen mußte
Die für die Großhandelspreise von Strom zuständige Bundeskommission zur Energieregulierung (FERC) in Washington weigerte sich, Preiskontrollen einzuführen - sowohl unter der bisherigen Clinton-Administration wie unter der neuen Bush-Administration. Daß Stromerzeuger, die nach Kalifornien liefern, 800% oder 900% Profit machen, scheint nicht zu stören. Besonders George W. Bush wird sich wohl kaum für Preiskontrollen bei Strom oder Erdgas einsetzen, denn der größte Stromgroßhändler der USA ist die in Houston (Texas) ansässige Enron Corp., die eng mit dem Bush-Clan verbunden ist und der größte Wahlkampfspender für den neuen Präsidenten war. Andere Stromgroßhändler, die nach Kalifornien liefern, wie Reliant Energy oder Dynegy, sind auch in Texas ansässig und gehören zum geschäftlichen und politischen "Umfeld" des Bush-Clans.
Aus der rasant wachsenden Diskrepanz von Großhandels- und Endpreisen summierten sich bis Januar 2001 bei den Stromversorgern PG&E und SCE zusätzliche Kosten von rund 13 Mrd. Dollar. Die Banken, die ihnen das Geld zur Finanzierung der Stromkäufe geliehen hatten, weigerten sich, weiteres Geld vorzuschießen, und die Finanzunternehmen der Wall Street blockierten die Ausgabe von neuen Bonds, mit denen die Stromerzeuger an frische Finanzmittel kommen wollten. Nun stehen die beiden größten Stromversorger in Kalifornien vor dem Bankrott. Ende Januar waren beide Firmen bei der Bedienung von Krediten und Anleihen bereits mit mehr als 1,2 Mrd. Dollar in Verzug. Aufgrund des Zahlungsverzugs stuften Moody`s und Standard & Poors die Milliardenanleihen der beiden Unternehmen auf den Status von "Ramschanleihen" herab.
Die Krise wirft ihren Schatten auf das ganze amerikanische Finanzsystem und droht mehrere Großbanken - darunter Bank of America, Wells Fargo und BankOne - in den finanziellen Abgrund zu reißen. Bereits am 27. Dezember war der kalifornische Gouverneur Davis zu Notstandssitzungen mit Notenbankchef Alan Greenspan, Finanzminister Larry Summers, Präsident Clinton und George W. Bush nach Washington geflogen. Daß Greenspan eingeschaltet werden mußte, beweist allein schon, daß es nicht nur um Kalifornien geht, sondern Gefahr für das gesamte Finanzsystem droht.
Schließlich sollte man nicht unterschätzen, welche Auswirkungen die Stromkrise in Kalifornien und die Preisexplosion bei Erdgas und Treibstoff (Benzin, Diesel/Heizöl) auf die amerikanische Realwirtschaft insgesamt hat. Am 17. Januar hielt der Nationale Verband der gewerblichen Produzenten (NAM) eine Pressekonferenz ab, um in dramatischer Weise zu warnen, daß "Tausende von Betrieben" wegen der Energiekrise vor Produktionskürzungen, Entlassungen und sogar Fabrikschließungen stünden. NAM-Präsident Jasinowski sprach von "verheerenden Auswirkungen" auf die US-Wirtschaft. Die explodierenden Energiepreise hätten die US-Wirtschaft im Laufe des vergangenen Jahres mehr als 115 Mrd. Dollar gekostet; das ist immerhin 1% des BIP.
Das Ende des "Importeurs der letzten Instanz"
Daß die amerikanische Wirtschaft seit dem 4. Quartal 2000 in eine schwere Kontraktion abtaucht, zeigen, wie oben skizziert, auch die offiziellen Wirtschaftsstatistiken. Und das bestreitet inzwischen nicht einmal mehr Alan Greenspan. In den amerikanischen Haushalten und Unternehmen muß man das Ausmaß der Verschuldung zur Kenntnis nehmen, die sich während der wirtschaftlichen Scheinblüte der 90er Jahre aufgetürmt hat, während gleichzeitig der auf inflationierten Aktienpreisen beruhende "Wohlstandseffekt" dahinschmilzt. Die Folge ist eine rasant zurückgehende Konsum- und Investitionsbereitschaft. Dies hat nun dramatische Auswirkungen auf die übrige Weltwirtschaft, aus der fieberhaft in den US-Markt hineinexportiert wurde. Ab Mitte der 90er Jahre hatte die US-Wirtschaft die Rolle des "Importeurs der letzten Instanz" für die Weltwirtschaft übernommen. Wenn die US-Wirtschaft aufhört, sozusagen als "Staubsauger" für die Exportgüter der restlichen Welt zu fungieren, so muß das zu schwerwiegenden realwirtschaftlichen Erschütterungen und Einbrüchen in den exportabhängigen Wirtschaften Asiens, Lateinamerikas und auch Europas führen, wenn sie nicht schnell auf neue regionale Handels- und wirtschaftliche Kooperationsstrukturen umsteuern.
Der Grund dafür, daß die US-Wirtschaft während der letzten Jahre die Produkte der übrigen Weltwirtschaft geradezu aufgesogen hat, war nicht nur der trügerische, zum Konsum aufreizende "Wohlstandseffekt" oder der überbewertete Dollar, sondern auch die abnehmende industrielle Leistungsfähigkeit Amerikas. Während der "Bretton Woods"-Ära - vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu den späten 60er Jahren - verfügten die Vereinigten Staaten über eine höchst leistungsfähige und exportstarke Industrie. Seit Anfang der 70er Jahre erfolgte der Marsch in die "nachindustrielle Gesellschaft". Immer mehr Industriezweige in Amerika wurden eingeschrumpft, fast ganz beseitigt oder in "Niedriglohnländer" ausgelagert.
Nun könnte man sagen, daß die Importabhängigkeit der USA bei Gütern "niedriger Technologie" - Konsumgüter wie Textilien, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik oder Grundstoffe wie Stahl oder Baumaterialien - nicht weiter beunruhigend sei. Doch in technologisch hochstehenden Schlüsselbereichen der Industrie sieht es nicht viel anders aus. Die bis in die 70er Jahre weltweit führende Werkzeugmaschinenindustrie Amerikas wurde radikal abgebaut, was modisch mit dem Ausdruck "downsizing" verbrämt wird. Das blieb natürlich nicht ohne Folgen für die technologische Leistungsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der übrigen amerikanischen Hochtechnologiebranchen wie beispielsweise der Luft- und Raumfahrt.
Zu Beginn der 80er Jahre stürzte das Produktionsvolumen der amerikanischen Werkzeugmaschinenbauer abrupt von 5,5 Mrd. auf 2,1 Mrd. Dollar ab. Die Stückzahlen der Produktion von Werkzeugmaschinen schrumpften von 350 000 auf 150 000. 1970 wurden lediglich 9,5% aller von US-Unternehmen nachgefragten Werkzeugmaschinen im Ausland bestellt. 1986 war der Importanteil bereits auf 49,8% hochgeschossen, und heute kommen 59,4% aller in den USA gekauften Werkzeugmaschinen aus dem Ausland. Ähnlich ist die Lage im Anlagenbau und in der Elektroindustrie. Bei der Produktion von elektrischen Ausrüstungen und Maschinen - von Transformatoren über Turbinen bis hin zu Generatoren - ist die Importabhängigkeit der US-Wirtschaft zwischen 1972 und 1999 von 3,2% auf 25,1% angestiegen.
Dieser Trend hat sich in den 90er Jahren im Verein mit den ideologischen Utopien von einer sogenannten "Dienstleistungs"- oder "Informationsgesellschaft" noch weiter beschleunigt. So müssen heute immer mehr Waren, die in den USA nicht mehr hergestellt werden können, aus dem Ausland beschafft werden. Zwischen 1981 und 1990 ist das jährliche Volumen der US-Importe von 265 Mrd. auf 498 Mrd. Dollar angestiegen. Die 90er Jahre brachten dann eine weitere Vervielfachung der US-Importe auf nunmehr 1215 Mrd. Dollar pro Jahr. In der Folge explodierte das Handelsdefizit, Leistungsbilanzdefizit sowie notwendigerweise die Auslandsverschuldung der USA.
Parallel dazu sind in den vergangenen Jahren vor allem in Asien und Lateinamerika zahlreiche "Volkswirtschaften" fast vollständig auf den Export von Gütern in die USA umgestellt worden. Auch die Wirtschaft in Europa - in und außerhalb der Europäischen Union - ist sehr stark vom kreditfinanzierten Importsog aus den Vereinigten Staaten abhängig geworden. Besonders extrem ist die Abhängigkeit von Exporten nach Amerika in Südostasien, wo man nach den Finanzkrisen der Jahre 1997-99 glaubte, nur mit den auf diese Weise verdienten Dollars den Hals aus der finanziellen Schlinge ziehen zu können. In Ländern wie Japan, Taiwan, den Philippinen, Malaysia oder Thailand gehen längst 25% bis 40% aller Exporte in die USA. Im Falle Chinas geht 41,9% des gesamten Exportvolumens in die USA. Wenn man Mexiko nicht berücksichtigt, gehen 36,5% aller Exporte Lateinamerikas in die Vereinigten Staaten. Rechnet man Mexiko hinzu, sind es sogar 56,6%. Für Mexiko liegt die Abhängigkeit vom Exportmarkt USA sogar jenseits von 80%.
Was das "Bush-Team" vorhat und warum es nicht funktioniert
Was kann man nun angesichts der realwirtschaftlichen Kontraktion und der hyperfragilen finanziellen Lage in den USA von der neuen Bush-Administration erwarten? Die Antwort ist recht einfach: Krisenmangement. Bush selbst, Lindsey, O`Neill, Evans und die republikanischen Führer im Kongreß haben sich zu ihren Zielen mehrfach und recht deutlich geäußert: Weitere Senkungen des Zinsniveaus durch die Federal Reserve. Durch die damit bereitgestellte zusätzliche Liquidität sollen vor allem die Aktienmärkte "bei Laune" gehalten werden, wobei es höchst fraglich ist, ob das auch nur auf Zeit gelingt. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, so bedeutet das künstliche Hochhalten der Börsenkurse durch Liquiditätspumpen doch nur die Fortführung und Ausweitung der gigantischen Wertpapierinflation der vergangenen Jahre, die sich zwangsläufig auf das gesamtwirtschaftliche Preisniveau auswirken muß, wie man es bei den Energie- und Immobilienpreisen bereits sehen kann. Zugleich gefährden aber niedrige Zinsraten den Wechselkurs des überbewerteten Dollar und die Kapitalzuflüsse aus Übersee. Damit würde das monströse Zahlungsbilanzdefit der USA vollends außer Kontrolle geraten. Schließlich offenbart jede zusätzliche Zinssenkung der Federal Reserve dem In- und Ausland, wie stark tatsächlich die Angst, ja Panik über einen Wirtschaftseinbruch bei der Notenbank und der Regierung ausgeprägt ist.
Schnelle und umfangreiche Steuersenkungen. Damit hofft man die Konsumausgaben der Haushalte und Unternehmensinvestitionen zu ermuntern. Angesichts der extremen Verschuldung von Haushalten und Unternehmen dürften diese aber zunächst an die Rückführung des Verschuldungsniveaus denken, bevor irgendwelche zusätzlichen Ausgaben getätigt werden. Die Kombination aus rückläufigen Steuereinnahmen - wegen der sinkenden Wertpapierpreise (capital gains tax) und der schrumpfenden Gesamtwirtschaft - und zusätzlichen Steuersenkungen dürfte den "Haushaltsüberschüssen" und selbst einem "ausgeglichenen Haushalt" ein schnelles Ende bereiten. (Die Frage der Verrechnung der Social Security-Gelder im regulären Haushalt lassen wir hier außen acht.) Es droht also wieder die Ausweitung der öffentlichen Verschuldung, zusätzlich zu der monströsen privaten und Unternehmensverschuldung. Eine schnelle und umfängliche Ausweitung der Rüstungsausgaben. Dabei dürfte der Raketenabwehr (NMD) eine besondere Rolle zukommen. Es ist nicht auszuschließen, daß eine Art Crash-Programm für NMD aufgelegt wird, das auch aus der SDI der frühen 80er Jahre bekannte Strahlenwaffentechnologien umfaßt, die durchaus der Gesamtwirtschaft technologisch-industrielle Impulse verleihen können. Angesichts schrumpfender Steuereinnahmen stellt sich jetzt aber wieder die Frage der Finanzierung von großen Rüstungsprogrammen. Die durch eine enorme Ausweitung der Staatsverschuldung erreichte Aufrüstung der Reagan-Ära erfolgte vor dem Hintergrund einer US-Wirtschaft, die im Vergleich zu heute weit gesünder war. Damals war die realwirtschaftliche Substanz weit weniger zusammengeschrumpft und das volkswirtschaftliche Schuldenniveau weit geringer. Schließlich darf man den enormen Kompetenzverlust während der letzten Dekade in der amerikanischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie nicht unterschätzen, wie das die geradezu unglaublichen Probleme beispielsweise bei Boeing oder Lockheed-Martin zeigen.
Vom "Krisenmanagement"...
Die Schlußfolgerung, die sich aus der Bewertung der zentralen "Anti-Krisen-Maßnahmen" der Bush-Administration aufdrängt, ist, daß sie nicht greifen werden. Die Prognose lautet also, daß der Abwärtssog auf den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft und/oder eine galoppierende Inflationsdynamik die Wirtschaftspolitik des "Krisenmanagements" der Bush-Administration überrollen werden. Wahrscheinlich wird Alan Greenspan samt seiner angeblich "magischen" Fähigkeiten das erste Opfer dieser Lageentwicklung.
Man muß also realistischerweise befürchten, daß in dem Maße, wie die Unfähigkeit der Bush-Administration zur Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise offenbar wird, die Bereitschaft wächst, zu "unkonventionellen" Mitteln des Krisenmanagements zu greifen. Zu denken ist dabei an eine amerikanische Variante des Regimes der "Notverordnungen" in Deutschland zwischen 1930 und 1933.
...zum "Notstandsregime"?
In den USA besteht seit 1979 ein seither mehrfach perfektionierter Apparat für ein "Notstandsregime" in Gestalt der Federal Emergency Management Agency (FEMA), deren Aufgabe folgendermaßen definiert ist: The implementation of emergency actions both above and below the threshold of declared national emergencies and war. Letzteres - also Notstandsmaßnahmen "unterhalb" des formell ausgerufen nationalen Notstandes oder des Verteidigungsfalls - ist hier für uns von besonderem Interesse. Wirtschafts- und Finanzfragen spielen im FEMA-Apparat, in den praktisch alle Regierungsorgane und die Judikative integriert sind, eine herausragende Rolle. Im Rahmen der FEMA hat es eine Vielzahl von Stabsrahmenübungen gegeben, deren Schwerpunkt eine schwere Finanz- und/oder Wirtschaftskrise waren. Über die FEMA-Übung Rex 84 Alpha im Jahre 1984 ist einiges bekannt geworden. Es ging um "Krisenmanagement"/"Notstandsmaßnahmen" angesichts einer weltweiten Finanzkrise mit nachfolgenden schweren Wirtschaftserschütterungen und sozialen Unruhen inner- und außerhalb der Vereinigten Staaten.
Beim "privaten" New Yorker Council on Foreign Relations (CFR) fand am 12./13. Juli 2000 eine Konferenz statt, deren Thema lautete: "Die nächste Finanzkrise: Warnzeichen, Schadensbegrenzung und Wirkung". Daran nahmen etwa 250 handverlesene Bankiers, Manager, höhere Beamte und Politiker teil. Die Konferenz war Teil des "Projekts Finanzielle Verwundbarkeit" des CFR, der seit 1999 hinter verschlossenen Türen computergestützte "Kriegsspiele" organisierte, in denen finanzielle Großkrisen simuliert werden. Das "Kriegsspiel" vom 29. September 1999 beruhte auf der Prämisse, "daß die vielleicht gefährlichste kurzfristige Bedrohung der US-Weltführerschaft und somit indirekt der amerikanischen Sicherheit ein Absturz der US-Wertpapiermärkte wäre, der eine weltweite Finanzkrise auslöst".
Am 22. Januar 2000 veranstaltete der CFR dann ein "Kriegsspiel" über eine globale finanzielle Kernschmelze. An dieser achtstündigen Übung, bei der ein "14tägiger Zeitraum im Juli 2000" simuliert wurde, waren 75 Personen beteiligt, darunter führende Bankiers und hochrangige ehemalige Regierungsbeamte. Die Teilnehmer bildeten vier Teams und wurden auf vier Räume verteilt, in denen sie per Computer untereinander und mit einer "Kommandozentrale" verbunden waren. Diese Teams "spielten" den Vorstand der Federal Reserve, das amerikanische Finanz- und Handelsministerium, die Leitung der Finanzaufsichtsbehörden sowie die mit der inneren und äußeren Sicherheit der USA befaßten Behörden. Das dem "Kriegsspiel" zugrundeliegende Szenario beinhaltete einen Kollaps der wichtigsten Aktienmärkte, der im Laufe der acht Stunden um sich griff. Dabei wurde angenommen, daß der Dow-Jones-Index von 10 000 auf 7100 Punkte abstürzt, der Ölpreis auf 36 Dollar pro Barrel ansteigt, der Dollarkurs gegenüber Euro und Yen abstürzt und eine größere Pleite auf den Derivatmärkten eintritt.
Die "Wahlkrise" im Schatten Carl Schmitts
Wem die Möglichkeit eines "Notstandsregimes" unter Bedingungen einer Großkrise in Wirtschaft und Finanzen als abstruse Übertreibung erscheint, der sollte bedenken, daß ja bereits die Installierung der Bush-Administration jenseits jeder Wahl-"Normalität" erfolgte. Durch eine politische Entscheidung der Mehrheit des Obersten Gerichtes wurde George W. Bush zum Präsidenten gemacht. Diese Entscheidung beruhte in der Substanz auf der Begründung, daß die "Wahlkrise" von Anfang November bis Mitte Dezember eine nicht länger hinnehmbare faktische Notstandssituation geschaffen hatte, die unverzüglich durch die Installierung Bushs als Präsidenten beendet werden müßte. Die von den Richtern William Rehnquist und Antonin Scalia geführte Mehrheit im Supreme Court bewegt sich in rechtspolitischen Bahnen, die der Rechtsideologie Carl Schmitts ähneln. Carl Schmitt - der sich übrigens in der anglo-amerikanischen Rechtsdebatte großen Interesses erfreut - postulierte, daß "der Staat" unter wie immer gearteten Notstandsbedingungen rücksichtslos gegen seine "Feinde" vorzugehen hat, wobei den Ursachen des Notstandes und übergeordnetem Recht (Naturrecht) keine Bedeutung zukommt. Daraus folgte konsequenterweise Carl Schmitts juristisch-politische Apologie für Hitlers "Ermächtigungsgesetz" vom Februar 1933.
Der Chef des Supreme Court William Rehnquist hatte sich bereits während der Nixon-Präsidentschaft dadurch hervorgetan, daß er bezüglich der Proteste gegen den Vietnam-Krieg und der Rassenunruhen die Verhängung eines "qualifizierten Kriegsrechtes" (qualified martial law) für angemessen erklärte. Hier wäre noch der designierte Justizminister John Ashcroft zu erwähnen, der aus seiner Begeisterung für die Ideologie und Politik der konföderierten Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg keinen Hehl macht. Bei Ashcroft kommen kaum verbrämter Rassismus, pseudo-"christlicher Fundamentalismus" und Sozialdarwinismus zusammen. Er verficht genauso radikal die Todesstrafe wie er die Abtreibung ablehnt.
Schließlich steht der Oberste Gerichtshof genauso wie das gesamte "Bush-Team" hinter der "Thornburgh-Doktrin" von 1989 (benannt nach George Bushs Justizminister), die die nationale Souveränität anderer Staaten für rechtlich irrelevant erklärt, wenn die Interessen der USA substantiell tangiert werden. Wie ein Justizminister Ashcroft die "Thornburgh-Doktrin" handhaben würde, dürfte selbst hartgesottenen "Atlantikern" in Europa Alpträume bereiten.
Die Zentralfiguren des "Bush-Teams" - Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul O`Neill - sind allesamt Veteranen der Nixon-, Ford-, Reagan- und Bush-Administrationen. Hier ist auf die Debatte im US-Establishment über die "Krise der Demokratie" im Kontext der wirtschaftlichen Krisenerscheinungen nach der Ölkrise von 1973 hinzuweisen, deren Resultat ja die Schaffung der FEMA war. In einer gleichnamigen Studie des New Yorker Council of Foreign Relations (CFR) Mitte der 70er Jahre wurde betont, daß eine Verschärfung der Wirtschaftskrise vom Staat Maßnahmen erfordern könnten, die außerhalb des Rahmens einer "normalen" demokratischen Ordnung liegen, da Mehrheitsentscheidungen üblicherweise "notwendige" wirtschaftliche, soziale und rechtliche Einschnitte und Einschränkungen blockierten.
Die Schwere der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzkrise läßt die Probleme der 70er Jahre als ziemlich harmlos erscheinen. Doch die damals in den USA geschaffenen rechtlichen und administrativen Strukturen für Notstandslagen könnten in der heutigen Lage eine höchst ominöse Bedeutung gewinnen.
Wirtschaftskrise und strategische Brennpunkte
Die Wirtschafts- und Finanzkrise in den Vereinigten Staaten existiert selbstverständlich nicht an sich, sondern vermengt sich mit politischen und strategischen Faktoren, auch wenn die wirtschaftlich-finanzielle Dynamik die primäre Triebkraft - positiv oder negativ - der strategischen Gesamtentwicklung bleibt. Die deutsche Erfahrung der frühen 30er Jahre zeigt, wohin der wirtschaftliche Abwärtssog die politische und strategische Lage treibt. Daß die Entwicklung in den Vereinigten Staaten damals unter vergleichbaren wirtschaftlichen Bedingungen glücklicherweise anders verlaufen ist, ist hauptsächlich das Verdienst einer politischen Ausnahmepersönlichkeit - Franklin Delano Roosevelt.
Dennoch müssen wir uns heute fragen, was etwa geschähe, wenn es in naher Zukunft bei einer dramatischen Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage in den USA zu ähnlichen Terroranschlägen käme wie im Frühjahr 1993. Man erinnere an die verheerenden Anschläge in Oklahoma City oder beim New Yorker World Trade Center. Oder wenn es, was keineswegs unwahrscheinlich ist, zum Ausbruch eines offenen Krieges im Nahen Osten oder sogar der gesamten Mittel-Ost-Region käme. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Lageentwicklung Amerikas unter der Bush-Administration muß man, meiner Meinung nach, in eine solche Richtung vordenken.
LaRouche über "den Umgang mit Bush"
Wie die Vereinigten Staaten und die Welt mit der Präsidentschaft von George W. Bush umgehen sollten, war das Thema eines EIR-Seminars, das am 3. Januar in Washington stattfand. Wir zitieren aus der Rede Lyndon LaRouches, die im Internet live übertragen wurde:
"Das Problem heute ist nicht nur George W. Bush. Meines Erachtens hat George W. Bush von all dem - dem Ausmaß der wirtschaftlich- finanziellen und strategischen Krise - keine Ahnung und kann es auch nicht im entferntesten begreifen. Um ihn herum sind einige Leute, die geistig mehr auf dem Kasten haben. Aber sie sind als politischer Apparat auf die Politik festgelegt, die sich Schritt für Schritt seit Nixon unter Kissinger, unter Carter, unter Brzezinski, unter George Bush als Vizepräsident und Präsident bis heute verfestigt hat...
Das Problem ist also nicht, daß es keine Lösungen gäbe. Wir könnten uns sehr wohl mit anderen Nationen darauf verständigen, daß wir uns in einer wirtschaftlichen Depression befinden und deshalb gemeinsam eine neue Weltwährungskonferenz für ein Neues Bretton Woods einberufen, um ein System mit festen Wechselkursen einzuführen, wie es uns in der Nachkriegszeit aus der Depression herausgeholt hat... Es stimmt, die heutige Krise ist viel schlimmer als diejenige, mit der Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren konfrontiert war. Aber die Lehren, die wir aus Roosevelts Erfolgen ziehen können, zeigen uns, wie wir heute mit den Problemen umgehen müssen...
Die Vereinigten Staaten erholten sich dank Franklin Roosevelt von der Depression, die durch die Politik von Teddy Roosevelt, Wilson und Coolidge verursacht worden war. Roosevelt erkannte das Problem und rettete die USA aus der Depression, ohne eine Diktatur zu errichten, die unsere Verfassung außer Kraft gesetzt hätte. Er hat uns sicher durch den Krieg geführt, und obwohl seine Politik nach seinem Tod stark beschnitten wurden, half sie den USA und Westeuropa, sich von den Auswirkungen von Krieg und Depression zu erholen. Amerika war von 1933-65 trotz aller seiner Fehler das wirtschaftliche Vorbild für die Welt.
Wir würden uns also der Lehren der Vergangenheit besinnen und sagen: ,Das hat sich bewährt, und wir werden es heute auch so machen.`... Nur müssen wir diesmal auch die Teile der Welt berücksichtigen, die in der Nachkriegszeit zu kurz kamen, die sogenannten Entwicklungsländer. Wir müssen die Nationen einen für das Vorhaben, diesen Planeten vor der schlimmsten Depression seit vielen Jahrhunderten zu bewahren. Die meisten Länder werden zustimmen. Es gibt viele Länder, die auch heute noch den USA bei einem solchen Vorhaben folgen werden. Wenn wir der Welt, wenn wir Europa, Asien usw. sagen: ,Das Amerika Roosevelts und Kennedys ist wieder da`, werden sie sehr froh sein. Wenn wir ihnen vorschlagen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Probleme auf der Grundlage früherer Erfahrungen zu lösen, werden sie mitmachen. Die USA haben immer noch eine große moralische Autorität wegen ihrer früheren Leistungen - nicht aus der jüngsten Vergangenheit, sondern aus der Zeit Roosevelts und Kennedys...
Das Problem ist, daß die politische Ausrichtung [der neuen Administration] - und der neue Präsident selbst - gegen diese Dinge aus der Vergangenheit sind, die allein unser Problem lösen könnten. Es ist zu bezweifeln, ob die USA als Nation eine Regierung Bush jun. lange aushalten können, wenn es nicht zu einem völligen Umschwung kommt...
Genau hier liegt meine Rolle: als eine Art Katalysator zu wirken, zur Einigung all derer, welche die Überzeugung teilen, daß die konsequente Förderung des Gemeinwohls die einzige legitime Grundlage für die Autorität einer Regierung ist. Denn alles andere läuft unter Krisenbedingungen auf ein Notstandsregime und Diktatur hinaus, wie wir sie in Deutschland hatten, als es dort versäumt wurde, dem Rooseveltschen Weg aus der Wirtschaftskrise zu folgen. Das ist die Lage und das, was ich tun werde.
Was George W. Bush angeht, so werden wir alles versuchen, was möglich ist. Aber wir werden unter keinen Umständen versuchen, einen ,Konsens` mit ihm zu finden. Denn für einen Konsens muß der andere ein Mindestmaß an Vernunft haben. Ansonsten macht das keinen Sinn. Es gibt aber Leute in seiner Umgebung, die nicht ganz unintelligent sind. Wir brauchen nur genügend politischen Einfluß und Mitstreiter. Wir werden George W. Bush durch Versuche, ihn zu erziehen, kaum bessern können - ich halte ihn für ziemlich schwer erziehbar. Aber ich glaube, wir könnten genug Druck aufbauen, so daß er zu der Überzeugung kommt, es wäre besser, mit guter Miene mitzumachen. Aber dafür müssen wir ein gewaltiger politischer Machtfaktor sein. Und dabei wird uns die Krise helfen. Wenn die Krise voll zuschlägt, wird Bush Alan Greenspan anrufen, der wird sich aber irgendwo verstecken und nicht ans Telefon gehen. Denn auch Alan Greenspan wird dann nicht mehr wissen, was er tun soll. Es wird eine Lage entstehen, wo man feststellt, daß ,nichts mehr funktioniert`. Aber wir wissen dann, was man tun kann..."
Ausblick
Es ist also nicht so, daß in den Vereinigten Staaten ein Notstandsregime oder Schlimmeres im Kontext einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise sozusagen "vorprogrammiert" wäre. Schließlich gibt es viele Imponderabilien in der amerikanischen Politik, die unter Krisenbedingungen ein weit weniger "geschlossenes System" sein wird als dies heute noch der Fall zu sein scheint. In der Demokratischen Partei brodelt es schon heftig, wobei die wirtschaftspolitischen Konzepte LaRouches eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die Wirtschafts- und Finanzkrise ist zugleich der Offenbarungseid des neoliberalen Paradigmas der vergangenen 20 Jahre. In den USA und weltweit hat eine - wenn auch erst tastende - Rückbesinnung auf wirtschaftspolitische Grundsätze eingesetzt, die sich, auf die heutigen Verhältnisse zugeschnitten, an der Wirtschaftspolitik eines F.D. Roosevelt oder des deutschen Ökonomen Wilhelm Lautenbach orientieren. Dennoch wäre es das Fatalste, sich über die mögliche Lageentwicklung in den Vereinigten Staaten selbstbesänftigende Illusionen zu machen.
27. Januar 2001
Michael Liebig
wie wahr
Nur leider wird es keiner lesen ;-)
Nur leider wird es keiner lesen ;-)
Was ist die Quintessenz aus o.g. Artikel? Bitte in drei kurzen Sätzen, der es gelesen hat. 

#3
aktueller Spiegel Seite 128.
aktueller Spiegel Seite 128.
klasse Artikel, sollte zur Pflichtlektüre in Politik- und Wirtschaftskreisen erklärt werden.
http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/regionen/Irak/lohaus.h…
Irak: Krieg um die Ölrente des Nahen Ostens
Eine Analyse von Dieter Lohaus
Die USA werden in den nächsten Monaten den Irak bombardieren, Menschen töten, das Land verwüsten, in Bagdad einmarschieren und die Ölfelder besetzen. Waren die beiden letzten Jahre der ideologischen Vorbereitung und der Präparierung der westlichen Massenpsyche gewidmet (Hollywood steuerte von Three Kings über Private Ryan bis zu Der Anschlag, aus Washington angeleitet, eifrig dazu bei), so sind jetzt die konkreten militärisch-logistischen Vorbereitungen angelaufen. Die amerikanischen Ölreserven sind bis zum Anschlag aufgefüllt. Die Briten absolvieren gerade die letzten vorbereitenden Manöver. Frankreichs Außenministerin sagt: Unser Militär (inklusive Flugzeugträger) ist jederzeit einsatzbereit (vorausgesetzt, wir machen mit!). Sogar die Bundeswehr ist bereits mit Spürpanzern in Kuwait sowie mit Marine am Horn von Afrika im Bereich des Geschehens - daran ändern auch die pazifistischen Bekundungen des Bundeskanzlers während des Wahlkampfes nichts.
Die US-Rüstungskonzerne Raytheon und Boeing erhielten in letzter Zeit neue Aufträge für Bomben (Joint Direct Attack Munition) für über eine Milliarde US-$. Boeing baut für diesen Munitionstyp gerade in St. Louis, Missouri, eine neue Fabrikationslinie, wodurch die Kapazität von derzeit gut 1 500 pro Monat auf 2 000 am Ende diesen Jahres und auf 2 800 Bomben im August 2003 erhöht wird. Das Pentagon, das bei Einführung der neuen zielgenauen Bomben im Jahre 1999 geplant hatte, davon 87 500 zu bestellen, hat den Auftrag inzwischen fast verdreifacht, auf nunmehr 238 000 Stück. Darüber hinaus bestätigte das Pentagon vor kurzem einen 200 Mio. US-$-Auftrag für lasergeleitete Bomben, sowie einen Auftrag über weitere 400 Tomahawk Cruise Missiles im Wert von mehr als 250 Mio. US-$. (Mark Odell, Boeing builds ´smart bomb´ plant as US demand rises, in Financial Times (FT), 9. September 2002) Ökonomisch ist das angesichts des etwa 400-Milliarden US-$ ausmachenden Etats des US-Rüstungshaushalts nicht so sehr bedeutungsvoll, es ist aber kriegerisches Verbrauchsmaterial für die heißen Kriegsphasen. Am Montag, den 16. September erklärte der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld - unbeeindruckt von der zeitnahen Mitteilung des UN-Generalsekretärs, dass der Irak sich bereit erklärt, die UN-Waffeninspektoren wieder in das Land zu lassen -, dass US-Piloten bereits begonnen hätten, Befehls- und Kommunikationseinrichtungen der irakischen Luftverteidigung anzugreifen, und nicht nur (wie bisher) Flugabwehr-Waffen und Radar. (Brian Knowlton, US-jets targeting Iraqi air control, Rumsfeld announces change in tactics; Saudis hint they will allow use of bases, International Herald Tribune (IHT), 17. September 2002)
Bush verspricht Kanonen und Butter
Die Teile der amerikanischen Wirtschaft, die nicht vom Krieg profitieren werden, werden von Washington beruhigt: "Der Präsident hat ein klares Signal an die Öffentlichkeit gesandt, dass beides zu haben ist, sowohl Krieg als auch Business as usual." (Countdown to a collision, Leitartikel der New York Times (NYT) vom 9. September 2002) Und Jackie Calmes überschreibt ihren wöchentlichen Bericht aus dem Büro der amerikanischen Hauptstadt: "Ökonomen des Weißen Hauses rechnen damit, dass der Krieg gegen den Irak wahrscheinlich keine Rezession auslösen wird", wenngleich im selben Artikel die Kriegskosten konkret angesprochen werden: "Die Beraterfirma G7Group veranschlagt die Kosten für das erste Kriegsjahr auf 80 Milliarden US-$." (Jackie Calmes, White House Economists figure war with Iraq wouldn`t likely spark recession, in Wall Street Journal Europe, 6.-8. September 2002)
Lange vor den Anschlägen vom 11. September 2001, und spätestens mit dem Regierungsantritt von Bush jr., war erkennbar, dass der Kampf der USA gegen den Irak in ein neues Stadium treten würde. Der Zermürbungstaktik durch Luftangriffe und ökonomische Knebelung, Ausplünderung und Embargo, durch die die Widerstandskraft des Volkes unterminiert werden sollte, musste ein direkterer Zugriff auf das irakische Öl folgen. Dazu ist eine heiße Kriegsphase notwendig, damit für die amerikanischen und britischen Ölkonzerne der Weg zum irakischen Öl frei wird. Die bis zum Frühsommer in den maßgeblichen amerikanischen Medien intensiv geführte Debatte, wie man die nächste Kriegsetappe gestalten sollte, sollte eine Antwort auf die Frage erarbeiten, wen man (außer den Briten, deren Beteiligung für die USA zu keinem Zeitpunkt in Frage stand) noch, und zu welchen Bedingungen, mit ins Kriegsbündnis aufnehmen sollte. Z. B.: Wenn sich Frankreich aktiv beteiligt, welchen Anteil vom irakischen Ölkuchen soll man Elf-Total einräumen. Wie schwierig diese Verhandlungen waren, zeigt sich daran, dass sich Frankreich lange geziert hat, eine Kriegsbeteiligung zuzusagen. Oder bezüglich Russlands: Reicht Russland, damit es bei einem Angriff auf den Irak stillhält und auf ein Veto im UN-Sicherheitsrat verzichtet, freie Hand in Tschetschenien/Georgien, oder muss man dem Land noch zusätzlich ökonomische Versprechungen bzgl. der Erfüllung bestimmter irakisch-russischer (Vor-)Verträge und/oder der Tilgung(Bezahlung) irakischer Verbindlichkeiten gegenüber Russland durch die Nach-Saddam-Regierung machen. Für die Zustimmung Spaniens reichten vermutlich kleine Versprechungen für Repsol, bei Italien für ENI, bei den Niederlanden für Royal Dutch. Der mächtigste Hebel der Amerikaner gegen China bleibt sicherlich (trotz WTO-Mitgliedschaft Chinas) der Zugang zum amerikanischen Markt. Bei den arabischen Golfstaaten dürfte die Überlegung bestimmend sein, möglichst lange zu vermeiden, obenan auf die wirkliche Schurkenliste gesetzt zu werden, nach der die realen Aggressionsziele der USA bestimmt werden. Diese Überlegungen ließen sich weiter fortsetzen. Das Ergebnis der veröffentlichten Überlegungen war, dass die USA notfalls auch alleine handeln könnten, dass man jedoch lieber - wie in 91 - wieder ein Bündnis zusammenzimmern würde. Der militärische Aspekt spielt hierfür, im Gegensatz zum politisch-moralischen, nur eine völlig untergeordnete Rolle.
Die Wahl Bush´s war bereits Teil der Strategie des Öl-Militärkomplexes, der heute in den USA dominiert. Zwar hatten sich auch die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Gore und Lieberman, zur Zeit von Bush sen. - anders als die Mehrheit der Demokraten im Kongress - für den "Wüstensturm" ausgesprochen. Gleichwohl traute ihnen das Kapital nicht zu, den beabsichtigten neuen Krieg konsequent vorzubereiten und umzusetzen.
Je näher nun der Zeitpunkt des Hauptangriffs rückt, desto deutlicher wird, dass das irakische Öl nur ein Teil dessen ist, was der arabischen Welt geraubt werden soll. Das weitergehende Ziel ist das Öl Saudi-Arabiens und das der gesamten Region des Nahen Ostens. Kuwait und die VAE werden in diesem Zusammenhang selten extra erwähnt, sie würden militärisch-politisch kein großes Problem darstellen, anders als der Iran, der ein sehr großes, für die USA vielleicht kaum lösbares Problem darstellen würde, wie die Vergangenheit gezeigt hat. (Zur Argumentation, diese weitergehende Zielsetzung betreffend, vergleiche die Ausführungen des Autors: D. L., Nächste Station Bagdad - übernächste Riad, Zum Kampf ums Öl im Nahen Osten, in Marxistische Blätter (MB) 3-02, S.73ff.)
"Der Krieg rechnet sich nicht"(?)
In der Süddeutschen Zeitung trägt nun Marc Hujer ökonomische Argumente gegen den Krieg gegen den Irak vor. Ein Krieg "gegen das Ölland Irak" sei "nicht unbedingt im Sinne der US-Volkswirtschaft. Die möglichen Gewinne sind klein, sagen die Experten, die Risiken aber sind groß." Er beruft sich u. a. auf das wirtschaftsliberale Cato Institute, das von einem sinnlosen Engagement spreche. "Die US-Regierung gebe in der Golfregion jährlich bis zu 60 Milliarden Dollar für militärische Stabilisierung aus, um Importe von sechs Milliarden Dollar zu sichern." (Marc Hujer, Der Krieg, der sich nicht rechnet, Wirtschaftliche Gründe für einen Feldzug gegen den Irak fehlen, SZ vom 23. September) Richtig ist, dass es in den USA breite Wirtschaftskreise gibt, die über die Kampagne im Nahen Osten aus wirtschaftlichen Gründen nicht glücklich sind, weil es die eigenen Geschäftsaussichten verschlechtert. Dazu gehören z. B. Handelsfirmen, Fluggesellschaften, die Touristikbranche, die Autoindustrie, die chemische Industrie.
Hatten diese Kräfte während der Clinton-Administration noch das politische Übergewicht gegenüber dem Öl-Rüstungskomplex, der von der Bush-Administration vertreten wird - wenngleich das Irak-Gesetz von 1998 bereits politisch-deklaratorisch die Vorstellungen der Wahlsieger von 2000 verkörpert: dort wurde bereits "regime change, die Beseitigung der Herrschaft Saddam Husseins im Irak, als strategisches Ziel der USA" benannt. Die Benennung eines Ziels ist eine Sache. Zur praktischen Verwirklichung gehört sehr viel mehr. Zur Umsetzung ihrer Absichten im Nahen Osten setzte das Militär-Öl-Lager auf Bush/Cheney. Seit der letzten Präsidentschaftswahl im Herbst 2000 wird das Vorhaben konsequent angegangen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt lautet das "volkswirtschaftliche" Kalkül nicht: Was bringt ein Krieg der "amerikanischen Wirtschaft insgesamt" für Vorteile - die ökonomischen Interessen der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung sind für solche Überlegungen nicht von primärer Bedeutung -, sondern vielmehr: Welche ökonomischen Vorteile (in anderen Worten: Profitaussichten) sind durch einen solchen Krieg für den herrschenden Militär-Rüstungs-Komplex der USA zu erwarten. Bei der Überprüfung des Kalküls gilt es auch zu berücksichtigen, dass sogar bescheidene Profite attraktiv für die sein können, die die hierfür notwendigen (in unserem Fall Kriegs-) Kosten nicht selber tragen müssen.
Hauptgewinn oder Niete?
Unter Aufwand/Ertrag-Gesichtspunkten wollen wir einmal zwei gegensätzliche historische Beispiele betrachten.
Beispiel 1: Vor gut hundert Jahren eroberte England Tibet: Tibet war so arm, dass die erobernden Vertreter der europäischen Kolonialmacht sich nicht in der Lage sahen, aus dem Land einen nennenswerten Mehrwert herauszusaugen. Die Kosten waren für die ausländischen Ausbeuter nachhaltig höher als der mögliche Nutzen. Das ganze war also ein Flop. Man zog wieder ab.
Beispiel 2: Gelohnt für die imperialistischen Ausbeuter hat sich hingegen China: Militärisch abgerungen wurden dem Land nach der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands, ebenfalls vor hundert Jahren, gewaltige "Entschädigungs"- (indemnity) Zahlungen, die in heutiger Währung gerechnet etwa 6,5 Mrd. US-$ ausmachten und den gesamten Staatseinnahmen der Qing-Regierung für den Zeitraum von 12 Jahren entsprachen. (Vgl. hierzu D. L.: Nächste Station Bagdad - übernächste Riad, Zum Kampf ums Öl im Nahen Osten, in MB 3-2002, S. 73ff.) Man benötigt nicht allzu großen ökonomischen Sachverstand, um zu begreifen: Die Entsprechung für Beispiel II im 21. Jahrhundert ist der Nahe Osten mit seinem Ölreichtum (im Wert von mindestens 10 000 Mrd. US-$, vgl. weiter unten) als Objekt der imperialistischen Begierde. Beispiel I entspricht heute Gebieten wie Afghanistan oder Kosovo, die aus mancherlei Gründen Gegenstand von Aggression sein mögen, nicht jedoch, weil aus ihnen ein nennenswerter Mehrwert herauszupressen wäre; ganz im Gegenteil.
US- und britische Konzerne brauchen das Öl
Um langfristig ihre Existenz als führende Konzerne der Weltwirtschaft zu sichern, benötigen die US- und britischen Ölmultis unbedingt den Zutritt zur Ölförderung im Nahen Osten. Am Beispiel von Royal Dutch/Shell wurde das von diesem Autor bereits einmal aufgezeigt. Die Darlegung kommt zu der folgenden Einschätzung: "In 2000 stellte das im gesamten Mittleren Osten von Shell geförderte Erdöl gerade mal einen Anteil von etwas über 20 Prozent der Gesamtförderung des Unternehmens dar. Wenn man bedenkt, dass zweidrittel aller Erdölreserven in dieser Region liegen, dass dagegen in Gebieten wie der Nordsee (der in Europa wichtigsten Förderstätte Shells) die Reserven kaum noch über die nächste Dekade hinaus reichen werden, dann wird verständlich, dass sich die Ölmultis wie Shell Gedanken um ihre Zukunft machen und von Bush und Blair erwarten, dass sie das Problem lösen, dass die ihre Förderung gegenüber dem ausländischen Kapital abschottenden OPEC-Staaten darstellen." (MB 3-02, S. 75) Das hier Gesagte gilt analog genau so für EXXON, BP/AMOCO, CHEVRON/TEXACO und CONOCO.
Aber werfen wir nun doch einmal einen etwas genaueren Blick auf das, was aus dem Irak herauszuholen ist. Das Besondere in den Ländern des Nahen Ostens besteht darin, dass der Wert der Ölreserven - hier von uns überschlägig geschätzt als Produkt der sicher nachgewiesenen Mengen und dem heutigen OPEC-Richtpreis von 25 US-$ - wegen der in dieser Region der Erde bestehenden u. a. geologischen Besonderheiten annähernd identisch ist mit der Rente, die man bei Förderung des Öls realisieren kann. Bei dynamischer Betrachtungsweise, wenn man sich den historischen Verlauf über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten vorstellt, können sich bei realistischer Betrachtung Werte ergeben, die beträchtlich höher anzusetzen sind, nämlich dann, wenn es den US-Konzernen gelingen würde, sich die Ölrechte im gesamten Raum anzueignen, und sie, wenn in ein bis zwei Jahrzehnten die Ölquellen in der übrigen Welt zunehmend unergiebig werden, als privatkapitalistische Marktregulierer in einer dann veränderten Angebotssituation den Ölpreis nachhaltig monopolistisch in bisher nicht gekannte Höhen treiben würden. Ein Missvertändnis besteht bei Teilen (auch der amerikanischen) Öffentlichkeit darin zu glauben, dass die Kampagne gegen die Länder des Nahen Ostens den Konsumenten billigeres Öl bringen wird. Das Gegenteil wird der Fall sein, gerade auch langfristig. Und nicht der Fiskus des jeweiligen Landes, wie etwa im Fall der westeuropäischen Benzinpreise, sackt sich dann die größten Teile des Wertes ein, sondern der Haupttransfer geht dann in Richtung der Schatullen der US-britischen Ölkonzerne, bzw. in die Taschen ihrer Aktionäre und leitenden Mitarbeiter. Die Ursache hierfür liegt einerseits im durch die bevorstehenden Kriege unmittelbar möglich werdenden Zugriff auf die Hauptmenge des verbleibenden Öls der Welt sowie in der sich daraus ergebenden immensen Marktmacht der US-britischen Ölkonzerne.
--------------------------------------------------------------------------------
Wert der Ölreserven ausgewählter Länder
[Wert der Ölreserven bei 25 $/Fass in Mrd. $ (1995)]
USA: 519
GB: 96
Russ. Föderation: 1.055
Kuwait: 2.302
Irak: 2.003
Iran: 1.946
Vereinigte Arabische Emirate: 1.936
Saudi-Arabien: 5.345
Quellen: Eigene Berechnung des Werts der Olreserven nach Angaben aus: 1995 Energy Statistics Yearbook, United Nations, New York 1997. Übrige Angaben: Der Fischer Weltalmanach 2001, Frankfurt 2000.
Lesehinweis zur Tabelle: Eine aktuellere Quelle (Dan Morgan, David B. Ottaway; When it´s over, who gets the oil?, The Washington Post vom 16. September 2002, in IHT vom gleichen Tag.) gibt Iraks Reserven mit 112 Mrd. Fass an. Entsprechend unserer Rechnung ergibt sich daraus ein noch höherer Wert für das irakische Öl, nämlich 2,8 Billionen (2.800 Mrd.) US-$. Die irakischen Reserven gelten heute zudem - abweichend von der oben benutzten Quelle aus dem Jahre 1997 - als größer im Vergleich zu den kuwaitischen. Die zugrunde gelegten Zahlen enthalten natürlich immer ein Element der Unsicherheit. Für unser Argument entscheidend ist nicht so sehr das exakte Rechenergebnis, sondern vielmehr die Größenordnung, die damit angezeigt wird. Auf dieser Grundlage sind Überlegungen zur Rente zwingend, wie sie vom Autor im August 2001 formuliert wurden: "Die Differenz zwischen Förderkosten und Marktpreis ist eine Rente. Diese Rente beträgt für das Öl im Mittleren Osten bei Ölpreisen von 25 US-$ durchschnittlich gut 20 US.$ (pro Fass). Multipliziert mit der Ölmenge im Boden der Länder des Mittleren Ostens ergibt sich für die Region ein Gesamtwert der Renten von weit über 10.000 Mrd. US-$. Das ist der Preis, um den die USA sowie ihre imperialistischen Konkurrenten mit Saudi-Arabien, Kuwait, Irak, Iran, etc. ringen. Diese 10.000 Mrd. US-$ sind im Wesentlichen auch der Fonds, aus dem u.a. die Kriege in der Region, die Rüstung der jeweiligen Angreifer und Verteidiger, die Besatzungen, der Einfluss in anderen Ländern dieser Region etc bezahlt werden. (D. L., Ein unerledigtes Geschäft - Die USA und das Öl der Verweigerer Iran und Irak, MB 5-2001
--------------------------------------------------------------------------------
Die Kriegsbeute wird verteilt "Wenn alles vorbei ist, wer kriegt dann das Öl?" Diese rhetorische Frage wird bereits im ersten Satz des Artikels der Washington Post, der die erste Seite der IHT vom 16. September 2002 ziert, von den Autoren Morgan und Ottaway so beantwortet: Der US-geführte Sturz von Saddam könnte für die lange aus dem Irak verbannten amerikanischen Ölgesellschaften ein "Bonanza" (Silbermine) darstellen, bestehende Verträge zwischen Bagdad und Russland, Frankreich und anderen Ländern würden jedoch den (im Westen lebenden) Führern der (sogenannten) irakischen Opposition zufolge schleunigst aufgehoben.
Insgesamt steht im Irak ein Wertvolumen von (beim heutigen Preisniveau für Erdöl) zwei bis drei Billionen US-$ (2 000 bis 3 000 Mrd. US-$) zur Verteilung an. Der Artikel weist darauf hin, dass Teile der irakischen Ölrechte auch bei den Verhandlungen der Amerikaner um die Zustimmung zu ihrem geplanten Krieg gegen den Irak im UN-Sicherheitsrat eingesetzt werden können. "Alle fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates - die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China - haben internationale Ölgesellschaften mit großen Interessen hinsichtlich einer Veränderung der Führung in Bagdad." Seit dem Golfkrieg von 1991 hätten Gesellschaften von mehr als einem Dutzend Länder, darunter Frankreich, Russland, China, Indien, Italien, Vietnam und Algerien, Vereinbarungen getroffen, um irakische Ölfelder zu erschließen, Anlagen zu erneuern oder unentwickelte Gebiete zu explorieren. Die Vertreter der irakischen Opposition erklärten, dass sie sich an keines dieser Geschäftsabkommen gebunden fühlten. Stattdessen sagte Ahmed Chalabi, der Führer des Iraqi National Congress, einer Gruppe von irakischen Oppositionellen, er "favorisiere die Schaffung eines US-geführten Konsortiums zwecks Entwicklung der irakischen Ölfelder ... Amerikanische Gesellschaften werden einen großen Anteil am irakischen Öl haben, sagte Chalabi." (Dan Morgan, David B. Ottaway, When it´s over, who gets the oil?, The Washington Post, in IHT vom 16. September 2002)
Die imperialistische Zahnbürste
Ein in der Frage des bevorstehenden Krieges eigenartig idyllisches Bild trat dem Leser der Süddeutschen Zeitung hingegen noch bis Ende August diesen Jahres entgegen. Man las da z. B.: "Die Entscheidung für einen Irak-Krieg steht nicht an." (Stefan Kornelius, Projektion statt Politik, SZ vom 13. August 2002), oder etwa: "Der Feldzug gegen den Irak scheint sich als große Luftblase zu entpuppen. ... der US-Präsident (beruhigte) das Biest (!) von Bagdad. Hatte Präsident Teddy Roosevelt einst empfohlen: ´Sprich leise, aber nimm einen großen Stock mit´, so drehte Bush, der gerne mit Roosevelt verglichen würde, das Motto um: Er polterte laut gegen Saddam Hussein, doch in der Hand hielt er höchstens eine Zahnbürste." (Wolfgang Koydl, Der Sommer des Missvergnügens, SZ vom 28. August 2002)
Nur ganze zwei Tage, nachdem Koydl seine Zahnbürstenthese vertreten hatte, stellte Jakob Heilbrunn, gestützt auf die unmittelbare Beobachtung des amerikanischen Mediengeschehens, in der gleichen Süddeutschen Zeitung klar: "Die große Frage des Sommers ist, wann und wie der Angriff gegen den Irak erfolgen wird. ... Achtzig Milliarden Dollar würde der Krieg kosten, schätzt die New York Times, doch die fetten Haushaltsüberschüsse der Clinton-Jahre hat Bush bereits komplett verpulvert. Seine konservativen Berater wie Richard Perle und Paul Wolfowitz ficht das nicht an. Sie schmieden schon Pläne, nach dem Irak auch gegen den Iran vorzugehen sowie die Ölfelder in Saudi-Arabien zu besetzen." (Jakob Heilbrunn, Das Jahr danach, SZ-Magazin Nr. 35 vom 30. August 2002, S. 23)
Wenige Tage darauf revidiert Koydl seine bisherige Ansicht und behauptet nun genau das Gegenteil von dem, was er zuvor vertreten hatte: "Alles nach Plan / George Bush geht in seiner Politik gegen Bagdad zielstrebig vor - man muss nur zuhören." (SZ, 6. September 2002)
Was ist die Ursache für diese Fehlbeurteilung? Außer den Gründen, die bei den Rezipienten liegen und eventuell dem von bestimmten Kreisen infizierten Interesse an einem Herunterspielen der imperialistischen Kriegsabsichten, spielte hierbei vielleicht auch das Bild einer starken inneramerikanischen Opposition eine Rolle, die die Kriegsstrategie der rechten Kriegsvorbereiter um Wolfowitz, Rumsfeld und Cheney nicht zum Tragen kommen lassen könnte. Wie berechtigt ist diese Auffassung?
Die Frage ist also: Gibt es eine amerikanische Opposition gegen den Irak-Feldzug? Sicher. Z. B. u. a. die Kommunisten und der Kreis um Chomsky. Und innerhalb des Establishments? Gibt es eine politisch relevante Opposition, die gegen den Krieg eingestellt ist und ihn eventuell noch verhindern könnte?
Schwäche der Opposition
Amity Shlaes geht in ihrer regelmäßigen Kolumne in der FT ausführlich auf diese Frage ein. Sie konstatiert, es gebe im Lande eine Opposition gegen den Krieg. "Aber die Opposition von Republikanern und Demokraten ist relativ gedämpft. Die Wahrheit über Amerika ist der Konsens innerhalb der US-Führung in Bezug auf die Frage des Sturzes von Saddam Hussein." Shlaes vergleicht die Opposition gegen ein militärisches Vorgehen nach der irakischen Invasion in Kuwait mit der Stärke der heutigen Opposition. Sie erinnert daran, dass Bush senior nicht nur mit Skeptikern in den eigenen Reihen zu tun hatte (darunter auch General Powell), sondern dass er auch im Kongress eine starke Opposition von Demokraten gegen sich hatte, und nach einer Umfrage von USA Today wurde seine Politik nur von 51 Prozent der Bevölkerung unterstützt. Eine Erhebung der New York Times vom September 2002 dagegen zeigte, dass 68 Prozent der Amerikaner die Irak-Politik Bushs unterstützen. Richard Gebhardt, der damals die Opposition anführte, ist heute ein deutlich vernehmbarer Befürworter. "Erst im vergangenen Monat, noch bevor klar wurde, dass sich das Weiße Haus um die Zustimmung des Kongresses für ein militärisches Handeln bemühen würde, sagte Mr. Gebhardt, der heute Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus ist: ´Präsident Bush hatte Recht, als er am Sonnabend sagte, dass wir einen neuen Krieg führen und dass wir bereit sein müssen loszuschlagen, wenn das notwendig ist.´" Es gebe unter den Republikanern zwar Abweichler, wie General Powell, Dick Armey und Brent Scowcroft, aber, abgesehen von Powell, handele es sich dabei nicht um "big ´players´", es sind also politische Leichtgewichte ohne große eigene Machtbasis. Die Demokraten erinnerten sich daran, was es seinerzeit bedeutete, zu der Verliereropposition gegen den Golfkrieg zu gehören. "Die beiden wichtigen Mitglieder der Demokratischen Partei (jedoch), die frühzeitig mit der Mehrheit in ihrer Partei brachen und die Administration dabei unterstützten, den Wüstensturm zu lancieren - Senator Al Gore und Senator Joseph Lieberman - wurden sechs Jahre später mit der Chance belohnt, für das Amt des Präsidenten bzw. des Stellvertretenden Präsidenten zu kandidieren." (Amity Shlaes, Democrats fall in line against the Iraqi tyrant, George W. Bush faces little of the partisan friction that surrounded the Gulf war, with his critics lacking a strong power base. FT, 10. September 2002.)
Die Opposition zur Irakpolitik der amerikanischen Administration wird bisweilen mit Hilfe der Kategorien Multilateralismus/Unilateralismus gedeutet. Robert Kagan weist mit Recht darauf hin, "dass die meisten Amerikaner keine prinzipienfesten Multilateralisten sind". Im Grunde seien die amerikanischen multilateralistischen Argumente pragmatischer Natur. Er fährt fort: "Anders als manche glauben, gibt es heute in den USA in Wirklichkeit keine Debatte zwischen Multilateralisten und Unilateralisten. Ebenso wie es wenige prinzipienfeste Multilateralisten gibt, gibt es wenige echte Unilateralisten. Nur wenige innerhalb und außerhalb der Bush-Administration halten es für vorteilhaft für die Vereinigten Staaten, in der Welt allein voranzugehen. Die meisten hätten lieber Verbündete. Sie wollen nur nicht, dass die Vereinigten Staaten daran gehindert werden, allein zu handeln, falls die Verbündeten sich weigern, den Weg mitzugehen. Die wirkliche Debatte in den Vereinigten Staaten dreht sich um Fragen des Stils und der Taktik." (Robert Kagan, Targeting Iraq I, Multilateralism, American Style, The Washington Post, in IHT vom 14.-15. September 2002)
Let´s make war
Sehen wir uns doch einmal unterschiedliche Positionen an, wie sie in den maßgeblichen amerikanischen Medien vorgetragen werden. Beginnen wir mit einer Position der sogenannten Rechten. Unter der offenherzigen Überschrift: "Lasst uns Krieg führen! Cheney legt die Sache unheimlich gut dar", führt Maureen Dowd aus:
"Cheney möchte in den Irak einmarschieren, solange wir über ein strategisches Fenster zum Handeln verfügen, während Saddams Armee noch am Taumeln ist. Aber die Saudis anzugreifen wäre sogar noch einfacher. Sie sind verweichlicht und verwöhnt. ... Eine Invasion in Saudi-Aabien würde der Panama-Invasion während der Amtszeit von Bush I ähneln. ... Sobald wir Saudi-Arabien in unsere Selbstbedienungstankstelle (für Benzin) verwandelt haben, werden seine Nachbarn den Demokratie-Virus bekommen." (Maureen Dowd, Let´s Make war! Cheney puts the case uncannily well, NYT, zitiert nach IHT vom 29. August 2002)
Diese nicht gerade pazifistischen Ausführungen erschienen gleichzeitig mit einem Leitartikel (Cheney fails to convince, Leitartikel der NYT, in IHT vom 29. August 2002), der Vorbehalte gegenüber Cheney´s Plädoyer für einen Krieg gegen den Irak - das in Dowd´s Artikel den begeisterten Widerhall fand - äußert und die Bush-Administration auffordert, noch mehr dafür zu tun, das Land von der Notwendigkeit für ein militärisches Vorgehen gegen den Irak zu überzeugen. Nur fünf Tage zuvor hatte der Chefredakteur der IHT, David Ignatius, die New York Times gegenüber dem "Diktat der Gedankenpolizei der Rechten, der Leitartikelseite des Wall Street Journal", vor dem Vorwurf in Schutz genommen, (zu) ausführlich über Strategie und Taktik hinsichtlich der Ziele, "mehr Demokratie in den Nahen Osten zu tragen, inklusive eines Regimewechsels im Irak und politischer Reformen in Saudi-Arabien" zu debattieren. Damit hatte die New York Times sozusagen als liberale Abweichlerin denunziert werden sollen. Ignatius vertritt die Ansicht, dass eine gründliche Debatte nützlich ist. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen beschäftigt er sich kritisch mit den Auslassungen des Laurent Murawiec von der Rand Corporation, der dem Defense Policy Board gegenüber gesagt hatte, "die Strategie der USA sollte ´ein Ultimatum an das Haus Saud (sein) ... andernfalls.´ Er definierte das ´Andernfalls´ als ´Das saudische Öl, Geld und die heiligen Stätten ins Visier zu nehmen´." Dies ist für Ignatius ein typisches Beispiel für die heutige Diskussion der Rechten zum Thema Naher Osten, die er als mit Großspurigkeit behaftet charakterisiert. Mit seiner eigenen Meinung zur politischen Hauptfrage hält er nicht hinterm Berg zurück: "Lasst uns ehrlich sein: Im Nahen Osten alles auf eine Karte zu setzen - auf Regimewechsel im Irak, im Iran, in Ägypten, Syrien und Saudi-Arabien zu drängen: so handeln nur Spieler. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, sondern dass es riskant ist - und aus diesem Grund verdient es eine besonders sorgfältige Debatte." Und als Chefredakteur einer der wichtigsten Publikationen der USA findet er gegen Ende seiner Ausführungen selbstverständlich politisch korrekte Phrasen für die Vorhaben des US-Imperialismus im Nahen Osten, indem er sich auf den "Idealismus" von Präsident Wilson beruft: "Die Befreiung des Nahen Ostens würde die Grenzen von Demokratie und Menschenrechten erweitern, wenngleich mit großen Kosten für die nationalen Interessen Amerikas, wie sie traditionell definiert sind."
Große Visionen fordert auch William Pfaff und merkt an: "Die Amerikaner fühlen sich unwohl bei einer Außenpolitik, die nicht in visionären und idealistischen Formulierungen vorgetragen wird." Als Rechtfertigung für den Krieg gegen Irak benötige Bush "einen erwiesenen ernsten Grund (nicht Spekulation darüber, was der Irak in Zukunft tun könnte), vernünftige Erfolgsaussichten und die Legitimierung in der amerikanischen öffentlichen Meinung und in der seiner Verbündeten." (William Pfaff, Targeting Iraq II, Bush needs a vision to justify war, IHT, 24-25. September 2002)
Von großen Visionen ist denn auch in dem Strategie-Papier der Bush-Administration die Rede, das dem Kongress am 20. September unterbreitet wurde, in dem der "präventive" Erstschlag, der Angriffskrieg, als militärpolitisches Konzept der USA eingeführt wird. Es gehe den USA überall in der Welt um "Freiheit" und "Gerechtigkeit"; und "Wir nutzen unsere Stärke nicht, um uns einseitigen Vorteil zu erpressen." Dennoch: "Es ist an der Zeit, die entscheidende Rolle der amerikanischen militärischen Stärke zu bekräftigen." Und: "Wenn nötig, werden wir nicht zögern, alleine zu handeln, um unser Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, indem wir in Form eines präventiven Erstschlags gegen solche Terroristen vorgehen." (America´s Security Strategy, How US will lead "freedom´s triumph", Edited extracts of President Bush´s new national security strategy, FT vom 21./22. September 2002)
Erst einen Tag zuvor wurde dem Kongress eine Gesetzesvorlage zugeleitet, die in expliziter Fortschreibung des "Iraq liberation act" (Gesetz bezüglich der Befreiung des Irak) aus dem Jahre 1998 den Präsidenten in dem (Haupt-)Abschnitt 2, "Autorisierung der Anwendung der Bewaffneten Streitkräfte der USA" überschrieben, ermächtigt, "alle ihm geeignet erscheinenden Mittel, einschließlich Waffengewalt" ... "gegen die vom Irak ausgehende Bedrohung" "anzuwenden", "und den internationalen Frieden und die Sicherheit in der Region (Hervorhebung durch uns) wieder herzustellen." (Bush´s resolution on Iraq: the text, IHT vom 20. September 2002) Bei der Behandlung dieser Vorlage am 25. September gab sich Daschle, der Sprecher der Demokraten im Senat, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, empört vor allem darüber, dass ihnen von der Regierungsseite mangelnder Patriotismus unterstellt worden sei. In der Sache, so deutete sich an, wird der Öl- und Rüstungs-Präsident Bush mit seinen Nahostplänen im Kongress auf wenig Widerstand stoßen.
Der Beitrag erschien in zwei Teilen in der Wochenzeitung "unsere zeit" am 4. und 11. Oktober 2002.
Irak: Krieg um die Ölrente des Nahen Ostens
Eine Analyse von Dieter Lohaus
Die USA werden in den nächsten Monaten den Irak bombardieren, Menschen töten, das Land verwüsten, in Bagdad einmarschieren und die Ölfelder besetzen. Waren die beiden letzten Jahre der ideologischen Vorbereitung und der Präparierung der westlichen Massenpsyche gewidmet (Hollywood steuerte von Three Kings über Private Ryan bis zu Der Anschlag, aus Washington angeleitet, eifrig dazu bei), so sind jetzt die konkreten militärisch-logistischen Vorbereitungen angelaufen. Die amerikanischen Ölreserven sind bis zum Anschlag aufgefüllt. Die Briten absolvieren gerade die letzten vorbereitenden Manöver. Frankreichs Außenministerin sagt: Unser Militär (inklusive Flugzeugträger) ist jederzeit einsatzbereit (vorausgesetzt, wir machen mit!). Sogar die Bundeswehr ist bereits mit Spürpanzern in Kuwait sowie mit Marine am Horn von Afrika im Bereich des Geschehens - daran ändern auch die pazifistischen Bekundungen des Bundeskanzlers während des Wahlkampfes nichts.
Die US-Rüstungskonzerne Raytheon und Boeing erhielten in letzter Zeit neue Aufträge für Bomben (Joint Direct Attack Munition) für über eine Milliarde US-$. Boeing baut für diesen Munitionstyp gerade in St. Louis, Missouri, eine neue Fabrikationslinie, wodurch die Kapazität von derzeit gut 1 500 pro Monat auf 2 000 am Ende diesen Jahres und auf 2 800 Bomben im August 2003 erhöht wird. Das Pentagon, das bei Einführung der neuen zielgenauen Bomben im Jahre 1999 geplant hatte, davon 87 500 zu bestellen, hat den Auftrag inzwischen fast verdreifacht, auf nunmehr 238 000 Stück. Darüber hinaus bestätigte das Pentagon vor kurzem einen 200 Mio. US-$-Auftrag für lasergeleitete Bomben, sowie einen Auftrag über weitere 400 Tomahawk Cruise Missiles im Wert von mehr als 250 Mio. US-$. (Mark Odell, Boeing builds ´smart bomb´ plant as US demand rises, in Financial Times (FT), 9. September 2002) Ökonomisch ist das angesichts des etwa 400-Milliarden US-$ ausmachenden Etats des US-Rüstungshaushalts nicht so sehr bedeutungsvoll, es ist aber kriegerisches Verbrauchsmaterial für die heißen Kriegsphasen. Am Montag, den 16. September erklärte der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld - unbeeindruckt von der zeitnahen Mitteilung des UN-Generalsekretärs, dass der Irak sich bereit erklärt, die UN-Waffeninspektoren wieder in das Land zu lassen -, dass US-Piloten bereits begonnen hätten, Befehls- und Kommunikationseinrichtungen der irakischen Luftverteidigung anzugreifen, und nicht nur (wie bisher) Flugabwehr-Waffen und Radar. (Brian Knowlton, US-jets targeting Iraqi air control, Rumsfeld announces change in tactics; Saudis hint they will allow use of bases, International Herald Tribune (IHT), 17. September 2002)
Bush verspricht Kanonen und Butter
Die Teile der amerikanischen Wirtschaft, die nicht vom Krieg profitieren werden, werden von Washington beruhigt: "Der Präsident hat ein klares Signal an die Öffentlichkeit gesandt, dass beides zu haben ist, sowohl Krieg als auch Business as usual." (Countdown to a collision, Leitartikel der New York Times (NYT) vom 9. September 2002) Und Jackie Calmes überschreibt ihren wöchentlichen Bericht aus dem Büro der amerikanischen Hauptstadt: "Ökonomen des Weißen Hauses rechnen damit, dass der Krieg gegen den Irak wahrscheinlich keine Rezession auslösen wird", wenngleich im selben Artikel die Kriegskosten konkret angesprochen werden: "Die Beraterfirma G7Group veranschlagt die Kosten für das erste Kriegsjahr auf 80 Milliarden US-$." (Jackie Calmes, White House Economists figure war with Iraq wouldn`t likely spark recession, in Wall Street Journal Europe, 6.-8. September 2002)
Lange vor den Anschlägen vom 11. September 2001, und spätestens mit dem Regierungsantritt von Bush jr., war erkennbar, dass der Kampf der USA gegen den Irak in ein neues Stadium treten würde. Der Zermürbungstaktik durch Luftangriffe und ökonomische Knebelung, Ausplünderung und Embargo, durch die die Widerstandskraft des Volkes unterminiert werden sollte, musste ein direkterer Zugriff auf das irakische Öl folgen. Dazu ist eine heiße Kriegsphase notwendig, damit für die amerikanischen und britischen Ölkonzerne der Weg zum irakischen Öl frei wird. Die bis zum Frühsommer in den maßgeblichen amerikanischen Medien intensiv geführte Debatte, wie man die nächste Kriegsetappe gestalten sollte, sollte eine Antwort auf die Frage erarbeiten, wen man (außer den Briten, deren Beteiligung für die USA zu keinem Zeitpunkt in Frage stand) noch, und zu welchen Bedingungen, mit ins Kriegsbündnis aufnehmen sollte. Z. B.: Wenn sich Frankreich aktiv beteiligt, welchen Anteil vom irakischen Ölkuchen soll man Elf-Total einräumen. Wie schwierig diese Verhandlungen waren, zeigt sich daran, dass sich Frankreich lange geziert hat, eine Kriegsbeteiligung zuzusagen. Oder bezüglich Russlands: Reicht Russland, damit es bei einem Angriff auf den Irak stillhält und auf ein Veto im UN-Sicherheitsrat verzichtet, freie Hand in Tschetschenien/Georgien, oder muss man dem Land noch zusätzlich ökonomische Versprechungen bzgl. der Erfüllung bestimmter irakisch-russischer (Vor-)Verträge und/oder der Tilgung(Bezahlung) irakischer Verbindlichkeiten gegenüber Russland durch die Nach-Saddam-Regierung machen. Für die Zustimmung Spaniens reichten vermutlich kleine Versprechungen für Repsol, bei Italien für ENI, bei den Niederlanden für Royal Dutch. Der mächtigste Hebel der Amerikaner gegen China bleibt sicherlich (trotz WTO-Mitgliedschaft Chinas) der Zugang zum amerikanischen Markt. Bei den arabischen Golfstaaten dürfte die Überlegung bestimmend sein, möglichst lange zu vermeiden, obenan auf die wirkliche Schurkenliste gesetzt zu werden, nach der die realen Aggressionsziele der USA bestimmt werden. Diese Überlegungen ließen sich weiter fortsetzen. Das Ergebnis der veröffentlichten Überlegungen war, dass die USA notfalls auch alleine handeln könnten, dass man jedoch lieber - wie in 91 - wieder ein Bündnis zusammenzimmern würde. Der militärische Aspekt spielt hierfür, im Gegensatz zum politisch-moralischen, nur eine völlig untergeordnete Rolle.
Die Wahl Bush´s war bereits Teil der Strategie des Öl-Militärkomplexes, der heute in den USA dominiert. Zwar hatten sich auch die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Gore und Lieberman, zur Zeit von Bush sen. - anders als die Mehrheit der Demokraten im Kongress - für den "Wüstensturm" ausgesprochen. Gleichwohl traute ihnen das Kapital nicht zu, den beabsichtigten neuen Krieg konsequent vorzubereiten und umzusetzen.
Je näher nun der Zeitpunkt des Hauptangriffs rückt, desto deutlicher wird, dass das irakische Öl nur ein Teil dessen ist, was der arabischen Welt geraubt werden soll. Das weitergehende Ziel ist das Öl Saudi-Arabiens und das der gesamten Region des Nahen Ostens. Kuwait und die VAE werden in diesem Zusammenhang selten extra erwähnt, sie würden militärisch-politisch kein großes Problem darstellen, anders als der Iran, der ein sehr großes, für die USA vielleicht kaum lösbares Problem darstellen würde, wie die Vergangenheit gezeigt hat. (Zur Argumentation, diese weitergehende Zielsetzung betreffend, vergleiche die Ausführungen des Autors: D. L., Nächste Station Bagdad - übernächste Riad, Zum Kampf ums Öl im Nahen Osten, in Marxistische Blätter (MB) 3-02, S.73ff.)
"Der Krieg rechnet sich nicht"(?)
In der Süddeutschen Zeitung trägt nun Marc Hujer ökonomische Argumente gegen den Krieg gegen den Irak vor. Ein Krieg "gegen das Ölland Irak" sei "nicht unbedingt im Sinne der US-Volkswirtschaft. Die möglichen Gewinne sind klein, sagen die Experten, die Risiken aber sind groß." Er beruft sich u. a. auf das wirtschaftsliberale Cato Institute, das von einem sinnlosen Engagement spreche. "Die US-Regierung gebe in der Golfregion jährlich bis zu 60 Milliarden Dollar für militärische Stabilisierung aus, um Importe von sechs Milliarden Dollar zu sichern." (Marc Hujer, Der Krieg, der sich nicht rechnet, Wirtschaftliche Gründe für einen Feldzug gegen den Irak fehlen, SZ vom 23. September) Richtig ist, dass es in den USA breite Wirtschaftskreise gibt, die über die Kampagne im Nahen Osten aus wirtschaftlichen Gründen nicht glücklich sind, weil es die eigenen Geschäftsaussichten verschlechtert. Dazu gehören z. B. Handelsfirmen, Fluggesellschaften, die Touristikbranche, die Autoindustrie, die chemische Industrie.
Hatten diese Kräfte während der Clinton-Administration noch das politische Übergewicht gegenüber dem Öl-Rüstungskomplex, der von der Bush-Administration vertreten wird - wenngleich das Irak-Gesetz von 1998 bereits politisch-deklaratorisch die Vorstellungen der Wahlsieger von 2000 verkörpert: dort wurde bereits "regime change, die Beseitigung der Herrschaft Saddam Husseins im Irak, als strategisches Ziel der USA" benannt. Die Benennung eines Ziels ist eine Sache. Zur praktischen Verwirklichung gehört sehr viel mehr. Zur Umsetzung ihrer Absichten im Nahen Osten setzte das Militär-Öl-Lager auf Bush/Cheney. Seit der letzten Präsidentschaftswahl im Herbst 2000 wird das Vorhaben konsequent angegangen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt lautet das "volkswirtschaftliche" Kalkül nicht: Was bringt ein Krieg der "amerikanischen Wirtschaft insgesamt" für Vorteile - die ökonomischen Interessen der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung sind für solche Überlegungen nicht von primärer Bedeutung -, sondern vielmehr: Welche ökonomischen Vorteile (in anderen Worten: Profitaussichten) sind durch einen solchen Krieg für den herrschenden Militär-Rüstungs-Komplex der USA zu erwarten. Bei der Überprüfung des Kalküls gilt es auch zu berücksichtigen, dass sogar bescheidene Profite attraktiv für die sein können, die die hierfür notwendigen (in unserem Fall Kriegs-) Kosten nicht selber tragen müssen.
Hauptgewinn oder Niete?
Unter Aufwand/Ertrag-Gesichtspunkten wollen wir einmal zwei gegensätzliche historische Beispiele betrachten.
Beispiel 1: Vor gut hundert Jahren eroberte England Tibet: Tibet war so arm, dass die erobernden Vertreter der europäischen Kolonialmacht sich nicht in der Lage sahen, aus dem Land einen nennenswerten Mehrwert herauszusaugen. Die Kosten waren für die ausländischen Ausbeuter nachhaltig höher als der mögliche Nutzen. Das ganze war also ein Flop. Man zog wieder ab.
Beispiel 2: Gelohnt für die imperialistischen Ausbeuter hat sich hingegen China: Militärisch abgerungen wurden dem Land nach der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstands, ebenfalls vor hundert Jahren, gewaltige "Entschädigungs"- (indemnity) Zahlungen, die in heutiger Währung gerechnet etwa 6,5 Mrd. US-$ ausmachten und den gesamten Staatseinnahmen der Qing-Regierung für den Zeitraum von 12 Jahren entsprachen. (Vgl. hierzu D. L.: Nächste Station Bagdad - übernächste Riad, Zum Kampf ums Öl im Nahen Osten, in MB 3-2002, S. 73ff.) Man benötigt nicht allzu großen ökonomischen Sachverstand, um zu begreifen: Die Entsprechung für Beispiel II im 21. Jahrhundert ist der Nahe Osten mit seinem Ölreichtum (im Wert von mindestens 10 000 Mrd. US-$, vgl. weiter unten) als Objekt der imperialistischen Begierde. Beispiel I entspricht heute Gebieten wie Afghanistan oder Kosovo, die aus mancherlei Gründen Gegenstand von Aggression sein mögen, nicht jedoch, weil aus ihnen ein nennenswerter Mehrwert herauszupressen wäre; ganz im Gegenteil.
US- und britische Konzerne brauchen das Öl
Um langfristig ihre Existenz als führende Konzerne der Weltwirtschaft zu sichern, benötigen die US- und britischen Ölmultis unbedingt den Zutritt zur Ölförderung im Nahen Osten. Am Beispiel von Royal Dutch/Shell wurde das von diesem Autor bereits einmal aufgezeigt. Die Darlegung kommt zu der folgenden Einschätzung: "In 2000 stellte das im gesamten Mittleren Osten von Shell geförderte Erdöl gerade mal einen Anteil von etwas über 20 Prozent der Gesamtförderung des Unternehmens dar. Wenn man bedenkt, dass zweidrittel aller Erdölreserven in dieser Region liegen, dass dagegen in Gebieten wie der Nordsee (der in Europa wichtigsten Förderstätte Shells) die Reserven kaum noch über die nächste Dekade hinaus reichen werden, dann wird verständlich, dass sich die Ölmultis wie Shell Gedanken um ihre Zukunft machen und von Bush und Blair erwarten, dass sie das Problem lösen, dass die ihre Förderung gegenüber dem ausländischen Kapital abschottenden OPEC-Staaten darstellen." (MB 3-02, S. 75) Das hier Gesagte gilt analog genau so für EXXON, BP/AMOCO, CHEVRON/TEXACO und CONOCO.
Aber werfen wir nun doch einmal einen etwas genaueren Blick auf das, was aus dem Irak herauszuholen ist. Das Besondere in den Ländern des Nahen Ostens besteht darin, dass der Wert der Ölreserven - hier von uns überschlägig geschätzt als Produkt der sicher nachgewiesenen Mengen und dem heutigen OPEC-Richtpreis von 25 US-$ - wegen der in dieser Region der Erde bestehenden u. a. geologischen Besonderheiten annähernd identisch ist mit der Rente, die man bei Förderung des Öls realisieren kann. Bei dynamischer Betrachtungsweise, wenn man sich den historischen Verlauf über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten vorstellt, können sich bei realistischer Betrachtung Werte ergeben, die beträchtlich höher anzusetzen sind, nämlich dann, wenn es den US-Konzernen gelingen würde, sich die Ölrechte im gesamten Raum anzueignen, und sie, wenn in ein bis zwei Jahrzehnten die Ölquellen in der übrigen Welt zunehmend unergiebig werden, als privatkapitalistische Marktregulierer in einer dann veränderten Angebotssituation den Ölpreis nachhaltig monopolistisch in bisher nicht gekannte Höhen treiben würden. Ein Missvertändnis besteht bei Teilen (auch der amerikanischen) Öffentlichkeit darin zu glauben, dass die Kampagne gegen die Länder des Nahen Ostens den Konsumenten billigeres Öl bringen wird. Das Gegenteil wird der Fall sein, gerade auch langfristig. Und nicht der Fiskus des jeweiligen Landes, wie etwa im Fall der westeuropäischen Benzinpreise, sackt sich dann die größten Teile des Wertes ein, sondern der Haupttransfer geht dann in Richtung der Schatullen der US-britischen Ölkonzerne, bzw. in die Taschen ihrer Aktionäre und leitenden Mitarbeiter. Die Ursache hierfür liegt einerseits im durch die bevorstehenden Kriege unmittelbar möglich werdenden Zugriff auf die Hauptmenge des verbleibenden Öls der Welt sowie in der sich daraus ergebenden immensen Marktmacht der US-britischen Ölkonzerne.
--------------------------------------------------------------------------------
Wert der Ölreserven ausgewählter Länder
[Wert der Ölreserven bei 25 $/Fass in Mrd. $ (1995)]
USA: 519
GB: 96
Russ. Föderation: 1.055
Kuwait: 2.302
Irak: 2.003
Iran: 1.946
Vereinigte Arabische Emirate: 1.936
Saudi-Arabien: 5.345
Quellen: Eigene Berechnung des Werts der Olreserven nach Angaben aus: 1995 Energy Statistics Yearbook, United Nations, New York 1997. Übrige Angaben: Der Fischer Weltalmanach 2001, Frankfurt 2000.
Lesehinweis zur Tabelle: Eine aktuellere Quelle (Dan Morgan, David B. Ottaway; When it´s over, who gets the oil?, The Washington Post vom 16. September 2002, in IHT vom gleichen Tag.) gibt Iraks Reserven mit 112 Mrd. Fass an. Entsprechend unserer Rechnung ergibt sich daraus ein noch höherer Wert für das irakische Öl, nämlich 2,8 Billionen (2.800 Mrd.) US-$. Die irakischen Reserven gelten heute zudem - abweichend von der oben benutzten Quelle aus dem Jahre 1997 - als größer im Vergleich zu den kuwaitischen. Die zugrunde gelegten Zahlen enthalten natürlich immer ein Element der Unsicherheit. Für unser Argument entscheidend ist nicht so sehr das exakte Rechenergebnis, sondern vielmehr die Größenordnung, die damit angezeigt wird. Auf dieser Grundlage sind Überlegungen zur Rente zwingend, wie sie vom Autor im August 2001 formuliert wurden: "Die Differenz zwischen Förderkosten und Marktpreis ist eine Rente. Diese Rente beträgt für das Öl im Mittleren Osten bei Ölpreisen von 25 US-$ durchschnittlich gut 20 US.$ (pro Fass). Multipliziert mit der Ölmenge im Boden der Länder des Mittleren Ostens ergibt sich für die Region ein Gesamtwert der Renten von weit über 10.000 Mrd. US-$. Das ist der Preis, um den die USA sowie ihre imperialistischen Konkurrenten mit Saudi-Arabien, Kuwait, Irak, Iran, etc. ringen. Diese 10.000 Mrd. US-$ sind im Wesentlichen auch der Fonds, aus dem u.a. die Kriege in der Region, die Rüstung der jeweiligen Angreifer und Verteidiger, die Besatzungen, der Einfluss in anderen Ländern dieser Region etc bezahlt werden. (D. L., Ein unerledigtes Geschäft - Die USA und das Öl der Verweigerer Iran und Irak, MB 5-2001
--------------------------------------------------------------------------------
Die Kriegsbeute wird verteilt "Wenn alles vorbei ist, wer kriegt dann das Öl?" Diese rhetorische Frage wird bereits im ersten Satz des Artikels der Washington Post, der die erste Seite der IHT vom 16. September 2002 ziert, von den Autoren Morgan und Ottaway so beantwortet: Der US-geführte Sturz von Saddam könnte für die lange aus dem Irak verbannten amerikanischen Ölgesellschaften ein "Bonanza" (Silbermine) darstellen, bestehende Verträge zwischen Bagdad und Russland, Frankreich und anderen Ländern würden jedoch den (im Westen lebenden) Führern der (sogenannten) irakischen Opposition zufolge schleunigst aufgehoben.
Insgesamt steht im Irak ein Wertvolumen von (beim heutigen Preisniveau für Erdöl) zwei bis drei Billionen US-$ (2 000 bis 3 000 Mrd. US-$) zur Verteilung an. Der Artikel weist darauf hin, dass Teile der irakischen Ölrechte auch bei den Verhandlungen der Amerikaner um die Zustimmung zu ihrem geplanten Krieg gegen den Irak im UN-Sicherheitsrat eingesetzt werden können. "Alle fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates - die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China - haben internationale Ölgesellschaften mit großen Interessen hinsichtlich einer Veränderung der Führung in Bagdad." Seit dem Golfkrieg von 1991 hätten Gesellschaften von mehr als einem Dutzend Länder, darunter Frankreich, Russland, China, Indien, Italien, Vietnam und Algerien, Vereinbarungen getroffen, um irakische Ölfelder zu erschließen, Anlagen zu erneuern oder unentwickelte Gebiete zu explorieren. Die Vertreter der irakischen Opposition erklärten, dass sie sich an keines dieser Geschäftsabkommen gebunden fühlten. Stattdessen sagte Ahmed Chalabi, der Führer des Iraqi National Congress, einer Gruppe von irakischen Oppositionellen, er "favorisiere die Schaffung eines US-geführten Konsortiums zwecks Entwicklung der irakischen Ölfelder ... Amerikanische Gesellschaften werden einen großen Anteil am irakischen Öl haben, sagte Chalabi." (Dan Morgan, David B. Ottaway, When it´s over, who gets the oil?, The Washington Post, in IHT vom 16. September 2002)
Die imperialistische Zahnbürste
Ein in der Frage des bevorstehenden Krieges eigenartig idyllisches Bild trat dem Leser der Süddeutschen Zeitung hingegen noch bis Ende August diesen Jahres entgegen. Man las da z. B.: "Die Entscheidung für einen Irak-Krieg steht nicht an." (Stefan Kornelius, Projektion statt Politik, SZ vom 13. August 2002), oder etwa: "Der Feldzug gegen den Irak scheint sich als große Luftblase zu entpuppen. ... der US-Präsident (beruhigte) das Biest (!) von Bagdad. Hatte Präsident Teddy Roosevelt einst empfohlen: ´Sprich leise, aber nimm einen großen Stock mit´, so drehte Bush, der gerne mit Roosevelt verglichen würde, das Motto um: Er polterte laut gegen Saddam Hussein, doch in der Hand hielt er höchstens eine Zahnbürste." (Wolfgang Koydl, Der Sommer des Missvergnügens, SZ vom 28. August 2002)
Nur ganze zwei Tage, nachdem Koydl seine Zahnbürstenthese vertreten hatte, stellte Jakob Heilbrunn, gestützt auf die unmittelbare Beobachtung des amerikanischen Mediengeschehens, in der gleichen Süddeutschen Zeitung klar: "Die große Frage des Sommers ist, wann und wie der Angriff gegen den Irak erfolgen wird. ... Achtzig Milliarden Dollar würde der Krieg kosten, schätzt die New York Times, doch die fetten Haushaltsüberschüsse der Clinton-Jahre hat Bush bereits komplett verpulvert. Seine konservativen Berater wie Richard Perle und Paul Wolfowitz ficht das nicht an. Sie schmieden schon Pläne, nach dem Irak auch gegen den Iran vorzugehen sowie die Ölfelder in Saudi-Arabien zu besetzen." (Jakob Heilbrunn, Das Jahr danach, SZ-Magazin Nr. 35 vom 30. August 2002, S. 23)
Wenige Tage darauf revidiert Koydl seine bisherige Ansicht und behauptet nun genau das Gegenteil von dem, was er zuvor vertreten hatte: "Alles nach Plan / George Bush geht in seiner Politik gegen Bagdad zielstrebig vor - man muss nur zuhören." (SZ, 6. September 2002)
Was ist die Ursache für diese Fehlbeurteilung? Außer den Gründen, die bei den Rezipienten liegen und eventuell dem von bestimmten Kreisen infizierten Interesse an einem Herunterspielen der imperialistischen Kriegsabsichten, spielte hierbei vielleicht auch das Bild einer starken inneramerikanischen Opposition eine Rolle, die die Kriegsstrategie der rechten Kriegsvorbereiter um Wolfowitz, Rumsfeld und Cheney nicht zum Tragen kommen lassen könnte. Wie berechtigt ist diese Auffassung?
Die Frage ist also: Gibt es eine amerikanische Opposition gegen den Irak-Feldzug? Sicher. Z. B. u. a. die Kommunisten und der Kreis um Chomsky. Und innerhalb des Establishments? Gibt es eine politisch relevante Opposition, die gegen den Krieg eingestellt ist und ihn eventuell noch verhindern könnte?
Schwäche der Opposition
Amity Shlaes geht in ihrer regelmäßigen Kolumne in der FT ausführlich auf diese Frage ein. Sie konstatiert, es gebe im Lande eine Opposition gegen den Krieg. "Aber die Opposition von Republikanern und Demokraten ist relativ gedämpft. Die Wahrheit über Amerika ist der Konsens innerhalb der US-Führung in Bezug auf die Frage des Sturzes von Saddam Hussein." Shlaes vergleicht die Opposition gegen ein militärisches Vorgehen nach der irakischen Invasion in Kuwait mit der Stärke der heutigen Opposition. Sie erinnert daran, dass Bush senior nicht nur mit Skeptikern in den eigenen Reihen zu tun hatte (darunter auch General Powell), sondern dass er auch im Kongress eine starke Opposition von Demokraten gegen sich hatte, und nach einer Umfrage von USA Today wurde seine Politik nur von 51 Prozent der Bevölkerung unterstützt. Eine Erhebung der New York Times vom September 2002 dagegen zeigte, dass 68 Prozent der Amerikaner die Irak-Politik Bushs unterstützen. Richard Gebhardt, der damals die Opposition anführte, ist heute ein deutlich vernehmbarer Befürworter. "Erst im vergangenen Monat, noch bevor klar wurde, dass sich das Weiße Haus um die Zustimmung des Kongresses für ein militärisches Handeln bemühen würde, sagte Mr. Gebhardt, der heute Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus ist: ´Präsident Bush hatte Recht, als er am Sonnabend sagte, dass wir einen neuen Krieg führen und dass wir bereit sein müssen loszuschlagen, wenn das notwendig ist.´" Es gebe unter den Republikanern zwar Abweichler, wie General Powell, Dick Armey und Brent Scowcroft, aber, abgesehen von Powell, handele es sich dabei nicht um "big ´players´", es sind also politische Leichtgewichte ohne große eigene Machtbasis. Die Demokraten erinnerten sich daran, was es seinerzeit bedeutete, zu der Verliereropposition gegen den Golfkrieg zu gehören. "Die beiden wichtigen Mitglieder der Demokratischen Partei (jedoch), die frühzeitig mit der Mehrheit in ihrer Partei brachen und die Administration dabei unterstützten, den Wüstensturm zu lancieren - Senator Al Gore und Senator Joseph Lieberman - wurden sechs Jahre später mit der Chance belohnt, für das Amt des Präsidenten bzw. des Stellvertretenden Präsidenten zu kandidieren." (Amity Shlaes, Democrats fall in line against the Iraqi tyrant, George W. Bush faces little of the partisan friction that surrounded the Gulf war, with his critics lacking a strong power base. FT, 10. September 2002.)
Die Opposition zur Irakpolitik der amerikanischen Administration wird bisweilen mit Hilfe der Kategorien Multilateralismus/Unilateralismus gedeutet. Robert Kagan weist mit Recht darauf hin, "dass die meisten Amerikaner keine prinzipienfesten Multilateralisten sind". Im Grunde seien die amerikanischen multilateralistischen Argumente pragmatischer Natur. Er fährt fort: "Anders als manche glauben, gibt es heute in den USA in Wirklichkeit keine Debatte zwischen Multilateralisten und Unilateralisten. Ebenso wie es wenige prinzipienfeste Multilateralisten gibt, gibt es wenige echte Unilateralisten. Nur wenige innerhalb und außerhalb der Bush-Administration halten es für vorteilhaft für die Vereinigten Staaten, in der Welt allein voranzugehen. Die meisten hätten lieber Verbündete. Sie wollen nur nicht, dass die Vereinigten Staaten daran gehindert werden, allein zu handeln, falls die Verbündeten sich weigern, den Weg mitzugehen. Die wirkliche Debatte in den Vereinigten Staaten dreht sich um Fragen des Stils und der Taktik." (Robert Kagan, Targeting Iraq I, Multilateralism, American Style, The Washington Post, in IHT vom 14.-15. September 2002)
Let´s make war
Sehen wir uns doch einmal unterschiedliche Positionen an, wie sie in den maßgeblichen amerikanischen Medien vorgetragen werden. Beginnen wir mit einer Position der sogenannten Rechten. Unter der offenherzigen Überschrift: "Lasst uns Krieg führen! Cheney legt die Sache unheimlich gut dar", führt Maureen Dowd aus:
"Cheney möchte in den Irak einmarschieren, solange wir über ein strategisches Fenster zum Handeln verfügen, während Saddams Armee noch am Taumeln ist. Aber die Saudis anzugreifen wäre sogar noch einfacher. Sie sind verweichlicht und verwöhnt. ... Eine Invasion in Saudi-Aabien würde der Panama-Invasion während der Amtszeit von Bush I ähneln. ... Sobald wir Saudi-Arabien in unsere Selbstbedienungstankstelle (für Benzin) verwandelt haben, werden seine Nachbarn den Demokratie-Virus bekommen." (Maureen Dowd, Let´s Make war! Cheney puts the case uncannily well, NYT, zitiert nach IHT vom 29. August 2002)
Diese nicht gerade pazifistischen Ausführungen erschienen gleichzeitig mit einem Leitartikel (Cheney fails to convince, Leitartikel der NYT, in IHT vom 29. August 2002), der Vorbehalte gegenüber Cheney´s Plädoyer für einen Krieg gegen den Irak - das in Dowd´s Artikel den begeisterten Widerhall fand - äußert und die Bush-Administration auffordert, noch mehr dafür zu tun, das Land von der Notwendigkeit für ein militärisches Vorgehen gegen den Irak zu überzeugen. Nur fünf Tage zuvor hatte der Chefredakteur der IHT, David Ignatius, die New York Times gegenüber dem "Diktat der Gedankenpolizei der Rechten, der Leitartikelseite des Wall Street Journal", vor dem Vorwurf in Schutz genommen, (zu) ausführlich über Strategie und Taktik hinsichtlich der Ziele, "mehr Demokratie in den Nahen Osten zu tragen, inklusive eines Regimewechsels im Irak und politischer Reformen in Saudi-Arabien" zu debattieren. Damit hatte die New York Times sozusagen als liberale Abweichlerin denunziert werden sollen. Ignatius vertritt die Ansicht, dass eine gründliche Debatte nützlich ist. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen beschäftigt er sich kritisch mit den Auslassungen des Laurent Murawiec von der Rand Corporation, der dem Defense Policy Board gegenüber gesagt hatte, "die Strategie der USA sollte ´ein Ultimatum an das Haus Saud (sein) ... andernfalls.´ Er definierte das ´Andernfalls´ als ´Das saudische Öl, Geld und die heiligen Stätten ins Visier zu nehmen´." Dies ist für Ignatius ein typisches Beispiel für die heutige Diskussion der Rechten zum Thema Naher Osten, die er als mit Großspurigkeit behaftet charakterisiert. Mit seiner eigenen Meinung zur politischen Hauptfrage hält er nicht hinterm Berg zurück: "Lasst uns ehrlich sein: Im Nahen Osten alles auf eine Karte zu setzen - auf Regimewechsel im Irak, im Iran, in Ägypten, Syrien und Saudi-Arabien zu drängen: so handeln nur Spieler. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, sondern dass es riskant ist - und aus diesem Grund verdient es eine besonders sorgfältige Debatte." Und als Chefredakteur einer der wichtigsten Publikationen der USA findet er gegen Ende seiner Ausführungen selbstverständlich politisch korrekte Phrasen für die Vorhaben des US-Imperialismus im Nahen Osten, indem er sich auf den "Idealismus" von Präsident Wilson beruft: "Die Befreiung des Nahen Ostens würde die Grenzen von Demokratie und Menschenrechten erweitern, wenngleich mit großen Kosten für die nationalen Interessen Amerikas, wie sie traditionell definiert sind."
Große Visionen fordert auch William Pfaff und merkt an: "Die Amerikaner fühlen sich unwohl bei einer Außenpolitik, die nicht in visionären und idealistischen Formulierungen vorgetragen wird." Als Rechtfertigung für den Krieg gegen Irak benötige Bush "einen erwiesenen ernsten Grund (nicht Spekulation darüber, was der Irak in Zukunft tun könnte), vernünftige Erfolgsaussichten und die Legitimierung in der amerikanischen öffentlichen Meinung und in der seiner Verbündeten." (William Pfaff, Targeting Iraq II, Bush needs a vision to justify war, IHT, 24-25. September 2002)
Von großen Visionen ist denn auch in dem Strategie-Papier der Bush-Administration die Rede, das dem Kongress am 20. September unterbreitet wurde, in dem der "präventive" Erstschlag, der Angriffskrieg, als militärpolitisches Konzept der USA eingeführt wird. Es gehe den USA überall in der Welt um "Freiheit" und "Gerechtigkeit"; und "Wir nutzen unsere Stärke nicht, um uns einseitigen Vorteil zu erpressen." Dennoch: "Es ist an der Zeit, die entscheidende Rolle der amerikanischen militärischen Stärke zu bekräftigen." Und: "Wenn nötig, werden wir nicht zögern, alleine zu handeln, um unser Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, indem wir in Form eines präventiven Erstschlags gegen solche Terroristen vorgehen." (America´s Security Strategy, How US will lead "freedom´s triumph", Edited extracts of President Bush´s new national security strategy, FT vom 21./22. September 2002)
Erst einen Tag zuvor wurde dem Kongress eine Gesetzesvorlage zugeleitet, die in expliziter Fortschreibung des "Iraq liberation act" (Gesetz bezüglich der Befreiung des Irak) aus dem Jahre 1998 den Präsidenten in dem (Haupt-)Abschnitt 2, "Autorisierung der Anwendung der Bewaffneten Streitkräfte der USA" überschrieben, ermächtigt, "alle ihm geeignet erscheinenden Mittel, einschließlich Waffengewalt" ... "gegen die vom Irak ausgehende Bedrohung" "anzuwenden", "und den internationalen Frieden und die Sicherheit in der Region (Hervorhebung durch uns) wieder herzustellen." (Bush´s resolution on Iraq: the text, IHT vom 20. September 2002) Bei der Behandlung dieser Vorlage am 25. September gab sich Daschle, der Sprecher der Demokraten im Senat, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, empört vor allem darüber, dass ihnen von der Regierungsseite mangelnder Patriotismus unterstellt worden sei. In der Sache, so deutete sich an, wird der Öl- und Rüstungs-Präsident Bush mit seinen Nahostplänen im Kongress auf wenig Widerstand stoßen.
Der Beitrag erschien in zwei Teilen in der Wochenzeitung "unsere zeit" am 4. und 11. Oktober 2002.



http://www.zeit.de/2003/13/B_9arse
Börse
Und sie zittern auf der Stelle
Großanleger halten sich zurück, Analysten verstehen die Aktienwelt nicht mehr, Tagesspekulanten und Trendjäger beherrschen die Börse. Eine echte Erholung wird noch Jahre dauern
Von Marc Brost und Robert von Heusinger
Als die Börse so tief gefallen war wie seit acht Jahren nicht mehr, gab Andreas Utermann eine ungewöhnliche Anweisung: Der Chefinvestor der Allianz Dresdner Asset Management (Adam) ließ die Computerschirme ausschalten. Mehr als 350 Milliarden Euro steuert Utermann von seinen Büros in London, Frankfurt oder New York aus, mehr als 330 Portfolio-Manager der Allianz berichten ihm täglich, in welchen Aktien sie das Geld der Versicherten oder Fondskunden anlegen. Ihr wichtigstes Hilfsmittel sind die Kursinformationen der Computerterminals, ihre wichtigste Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben. Doch von Ruhe kann an der Börse in diesen Tagen keine Rede sein.
Rot, rot, rot, meldeten die Computer in der vergangenen Woche, sieben Tage hintereinander krachten die Börsen weltweit – und niemand wusste, warum. „We can’t bear watching these screens anymore“, stöhnten die Londoner Adam-Manager, „wir können es einfach nicht mehr sehen“. Ungläubiges Erstaunen über den Absturz der Kurse, fassungsloses Bangen, wie tief die Aktien noch fallen werden. Wenn selbst Finanzprofis den Mut verlieren, muss eine Entscheidung her. Also: Computer aus. Und wenn es nur symbolisch ist. Das war am Mittwoch.
Grün, grün, grün, melden die Terminals seit Donnerstag vergangener Woche. Die Kurse steigen, und zwar rasant. Der europäische Aktienindex EuroStoxx 50 gewann binnen vier Tagen mehr als 20 Prozent, der deutsche Dax mehr als 15. Gut möglich, dass die Börse auch in den kommenden Tagen zulegt. Zu tief sind vor allem die deutschen Aktien gefallen.
Allerdings: Nichts spricht dafür, dass es nach einem schnellen Anstieg genauso schnell weitergeht. Im Gegenteil. Die Aktionäre werden sich an magere Jahre gewöhnen müssen.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken
Es gibt zwei unterschiedliche Erklärungen für das Jojo der Kurse. Die erste: Die Angst vor einem Krieg im Irak hat die Kurse zu stark abstürzen lassen. Nun sehen die Börsianer, wie tief die Aktien vor allem in Europa stehen, sie spekulieren auf die Zeit nach einem Krieg. Die Dividendenrendite der Unternehmen in den großen europäischen Indizes übersteigt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen, das gab es zuletzt in den fünfziger Jahren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Analystenschätzungen für 2004 liegt für den Dax bei neun – so niedrig wie seit Anfang der Achtziger nicht mehr. Würde man die großen deutschen Unternehmen in ihre Einzelteile zerlegen und verkaufen, wären sie mehr wert, als sie als Ganzes derzeit an der Börse kosten. Günstige Bewertungen locken Börsianer immer. Also werden jetzt Aktien gekauft. Also steigen jetzt die Kurse.
Es ist das Szenario der Optimisten.
Die zweite Erklärung für das dramatische Ab und Auf: Selbst die Finanzprofis haben den Überblick verloren. Sie haben resigniert und wissen nicht, worauf sie sich verlassen sollen. Der Markt ist in der Hand von Spekulanten. Diese haben auf einen langwierigen Konflikt gewettet, mit steigenden Ölpreisen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Deshalb krachten die Kurse, deshalb erreichte der Index der Investmentbank Credit Suisse First Boston, die wöchentlich den Risikoappetit der globalen Investoren misst, zuletzt fast Panikniveau.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken – dann steigen die Kurse plötzlich kräftig. Vergangenen Donnerstag hieß es, die Vereinigten Staaten stünden in Geheimverhandlungen mit irakischen Generälen. Es war das Zeichen zum Kauf. Langfristig orientierte Investoren dagegen, die sonst die hektischen Kursausschläge ausgleichen – also Versicherer, Fondsgesellschaften oder Privatanleger –, bleiben dem Aktienmarkt fern. So wie nach der Ölkrise 1973/74: Damals brauchte die Börse fast eine Anlegergeneration, um sich zu erholen. Wegen des niedrigen Handelsvolumens schwankten die Kurse heftig, starken Einbrüchen folgten regelmäßig kräftige Gewinne. Bis die Kurse wieder krachten.
Es ist das Szenario der Pessimisten. Und es ist ziemlich nah an der Realität.
An der Börse herrscht eine Situation wie in den letzten Tagen vor dem Platzen der großen Spekulationsblase am Aktienmarkt – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Im Frühjahr 2000 schwärmten die Ökonomen von den Segnungen der New Economy mit ihrem unendlichen Wachstum. Die Kurse kletterten und kletterten, obwohl sie schon so hoch waren wie nie zuvor. Fondsmanager und Analysten starrten auf ihre Computerschirme und verstanden die Welt nicht mehr. Drei Jahre später sind sie ebenso ratlos.
Die Fondsmanager und Analysten haben den Glauben an die Bewertungsrelationen verloren. „Die haben Ende der neunziger Jahre als Richtschnur versagt, warum sollte man sich jetzt auf sie verlassen?“, fragt Conrad Mattern, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Activest. Die Aktienanalysten von ABN Amro stellen ihren verunsicherten Kunden gar die provokante Frage, ob Aktien überhaupt noch fundamental zu bewerten seien. Die meisten Anleger handelten nur noch nach schnell entworfenen Taktiken, wie Währungsspekulanten.
„Seit 1997 können Investoren mit Trendfolgemodellen die Aktienindizes schlagen“, sagt Jürgen Callies, Leiter Research bei der Fondsgesellschaft MEAG. Während früher die Unternehmensgewinne die Hauptrolle spielten, seien seit sechs Jahren prozyklische Strategien immer erfolgreicher. Das heißt: Man kauft, wenn die Kurse steigen, und verkauft, wenn die Kurse fallen. Damit ähneln Aktien tatsächlich Devisen: Bis heute gibt es keine Theorie, die erklärt, warum sich Währungen über Jahre anders entwickeln, als volkswirtschaftliche Daten vorgeben.
Vor allem mit deutschen Aktien wird gern gezockt. „Wenn große Investoren schnell Aktien verkaufen wollen, suchen sie sich den deutschen Markt aus“, sagt Peter Knacke, Wertpapierstratege der Commerzbank. Das hat verschiedene Gründe: In Deutschland haben die Verkäufer nach zwei Tagen das Geld auf dem Konto, in anderen Ländern gelten zum Teil längere Fristen. Und: Die deutsch-schweizerische Terminbörse Eurex ist mittlerweile der größte Handelsplatz für Optionsgeschäfte, mit denen sich die Finanzprofis gegen Kursschwankungen absichern. Je größer das Handelsvolumen an der Terminbörse, desto größer sind auch die Kursschwankungen am normalen Aktienmarkt.
Das Ratespiel heißt: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien?
Mehr als 70 Prozent hat der Dax seit dem Höchststand vor drei Jahren verloren. Der japanische Topix, der ebenfalls 70 Prozent verlor, hat dafür 13 Jahre gebraucht. Der britische Footsie wiederum ist seit dem Hoch vom März 2000 um 50 Prozent gefallen, der amerikanische Dow Jones gar nur um 30.
Die kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Tage haben im besten Fall die Wende markiert. Im schlechtesten Fall waren sie nur die fünfte Gegenbewegung in dem seit drei Jahren gültigen Abwärtstrend. Auf alle Fälle sind sie kein Aufbruchsignal, dafür bleiben die Rahmenbedingungen zu schlecht – ganz unabhängig vom Ausgang des Irak-Konflikts.
So sind die krisengeschüttelten Banken und Versicherer im Dax – im Gegensatz zu anderen Indizes – überproportional vertreten. Die Banken aber leiden unter der Rekordzahl an Firmenpleiten, sie müssen so viele Kredite abschreiben wie selten zuvor. Die Versicherer wiederum leiden, weil sie so viele Aktien besitzen, speziell Bankwerte. Die Verflechtung der Geldhäuser ist ein Teufelskreis. Kein Wunder, dass drei der vier schlechtesten Dax-Werte der vergangenen zwölf Monate Finanzwerte sind: HypoVereinsbank (minus 80 Prozent), Allianz (minus 80 Prozent), Münchener Rück (minus 75 Prozent).
Nur mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen. Dann steigen die Gewinne der Unternehmen, gehen die Pleiten zurück und schreiben die Banken weniger Kredite ab. Dann steigen die Gewinne der Geldhäuser, und damit steigt der Aktienmarkt insgesamt. Doch danach sieht es nicht aus.
„Warum fallen die Renditen der Staatsanleihen auf ein 40-Jahres-Tief und die der Unternehmensanleihen auf ein 35-Jahres-Tief, während gleichzeitig die Aktienkurse krachen?“, fragt Michael Hartnett, Aktienstratege bei Merrill Lynch. „Weil alle die Deflation erwarten“ – also fallende Preise, gepaart mit Rezession. Es sind die Nachwehen der gigantischen Aktienblase: Das wachsende Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten und der Verfall des Dollarkurses, die Zurückhaltung der amerikanischen Verbraucher und der überteuerte US-Immobilienmarkt. All das spricht nicht gerade für Impulse aus Amerika. Und dass Europa aus sich heraus Wachstum entfalten könnte, wagt niemand zu hoffen.
So lautet das beliebteste Ratespiel unter den Geldmanagern derzeit: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien? Die Privatanleger sind immer nur Trendverstärker, nie Initiatoren einer Wende. Und institutionelle Investoren wie Versicherer oder Pensionsfonds überdenken im Augenblick ihr Engagement an der Börse. So ist die Aktienquote der latent aktienbegeisterten britischen Lebensversicherer auf 50 Prozent gesunken, das niedrigste Niveau seit zwei Jahrzehnten. „Wahrscheinlich wird der Gesetzgeber in einigen Ländern künftig für Altersvorsorgeprodukte sogar niedrigere Quoten vorschreiben“, vermutet Adam-Chefinvestor Utermann. Viele Unternehmen hätten einen zu großen Teil ihrer Reserven in Aktien angelegt. „Jetzt gibt es bei den Pensionsverpflichtungen große Deckungslücken.“ Wenn die langfristigen Investoren fehlen, fällt es den Hegdefonds leichter, mit ihren Wetten den Markt zu dominieren.
Selbst ohne diese Probleme müssten sich Altaktionäre lange gedulden. Langfristig wachsen die Gewinne der Unternehmen nicht schneller als die Volkswirtschaft an sich – im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte um drei bis vier Prozent jährlich. Rechnet man noch die Inflation und eine Zitterprämie hinzu, die jeder Käufer verlangt, um überhaupt in riskante Aktien zu investieren und nicht in sichere Staatsanleihen, kommt eine Rendite von sieben bis acht Prozent im Jahr heraus. Jedoch: Selbst bei Steigerungen von acht Prozent jährlich würde der Dax 16 Jahre benötigen, um sein Allzeithoch von 8136 Punkten überhaupt wieder zu erreichen.
Anderthalb Jahrzehnte hat es in der Vergangenheit im Schnitt gedauert, bis die Aktienkurse nach großen Crashs wieder ihr altes Niveau erreichten. Nach dem Crash 1929 waren es sogar fast 30 Jahre.
(c) DIE ZEIT 13/2003
--------
alle suchen was!
Börse
Und sie zittern auf der Stelle
Großanleger halten sich zurück, Analysten verstehen die Aktienwelt nicht mehr, Tagesspekulanten und Trendjäger beherrschen die Börse. Eine echte Erholung wird noch Jahre dauern
Von Marc Brost und Robert von Heusinger
Als die Börse so tief gefallen war wie seit acht Jahren nicht mehr, gab Andreas Utermann eine ungewöhnliche Anweisung: Der Chefinvestor der Allianz Dresdner Asset Management (Adam) ließ die Computerschirme ausschalten. Mehr als 350 Milliarden Euro steuert Utermann von seinen Büros in London, Frankfurt oder New York aus, mehr als 330 Portfolio-Manager der Allianz berichten ihm täglich, in welchen Aktien sie das Geld der Versicherten oder Fondskunden anlegen. Ihr wichtigstes Hilfsmittel sind die Kursinformationen der Computerterminals, ihre wichtigste Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben. Doch von Ruhe kann an der Börse in diesen Tagen keine Rede sein.
Rot, rot, rot, meldeten die Computer in der vergangenen Woche, sieben Tage hintereinander krachten die Börsen weltweit – und niemand wusste, warum. „We can’t bear watching these screens anymore“, stöhnten die Londoner Adam-Manager, „wir können es einfach nicht mehr sehen“. Ungläubiges Erstaunen über den Absturz der Kurse, fassungsloses Bangen, wie tief die Aktien noch fallen werden. Wenn selbst Finanzprofis den Mut verlieren, muss eine Entscheidung her. Also: Computer aus. Und wenn es nur symbolisch ist. Das war am Mittwoch.
Grün, grün, grün, melden die Terminals seit Donnerstag vergangener Woche. Die Kurse steigen, und zwar rasant. Der europäische Aktienindex EuroStoxx 50 gewann binnen vier Tagen mehr als 20 Prozent, der deutsche Dax mehr als 15. Gut möglich, dass die Börse auch in den kommenden Tagen zulegt. Zu tief sind vor allem die deutschen Aktien gefallen.
Allerdings: Nichts spricht dafür, dass es nach einem schnellen Anstieg genauso schnell weitergeht. Im Gegenteil. Die Aktionäre werden sich an magere Jahre gewöhnen müssen.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken
Es gibt zwei unterschiedliche Erklärungen für das Jojo der Kurse. Die erste: Die Angst vor einem Krieg im Irak hat die Kurse zu stark abstürzen lassen. Nun sehen die Börsianer, wie tief die Aktien vor allem in Europa stehen, sie spekulieren auf die Zeit nach einem Krieg. Die Dividendenrendite der Unternehmen in den großen europäischen Indizes übersteigt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen, das gab es zuletzt in den fünfziger Jahren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Analystenschätzungen für 2004 liegt für den Dax bei neun – so niedrig wie seit Anfang der Achtziger nicht mehr. Würde man die großen deutschen Unternehmen in ihre Einzelteile zerlegen und verkaufen, wären sie mehr wert, als sie als Ganzes derzeit an der Börse kosten. Günstige Bewertungen locken Börsianer immer. Also werden jetzt Aktien gekauft. Also steigen jetzt die Kurse.
Es ist das Szenario der Optimisten.
Die zweite Erklärung für das dramatische Ab und Auf: Selbst die Finanzprofis haben den Überblick verloren. Sie haben resigniert und wissen nicht, worauf sie sich verlassen sollen. Der Markt ist in der Hand von Spekulanten. Diese haben auf einen langwierigen Konflikt gewettet, mit steigenden Ölpreisen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Deshalb krachten die Kurse, deshalb erreichte der Index der Investmentbank Credit Suisse First Boston, die wöchentlich den Risikoappetit der globalen Investoren misst, zuletzt fast Panikniveau.
Schon ein einziges Gerücht lässt die Spekulanten umschwenken – dann steigen die Kurse plötzlich kräftig. Vergangenen Donnerstag hieß es, die Vereinigten Staaten stünden in Geheimverhandlungen mit irakischen Generälen. Es war das Zeichen zum Kauf. Langfristig orientierte Investoren dagegen, die sonst die hektischen Kursausschläge ausgleichen – also Versicherer, Fondsgesellschaften oder Privatanleger –, bleiben dem Aktienmarkt fern. So wie nach der Ölkrise 1973/74: Damals brauchte die Börse fast eine Anlegergeneration, um sich zu erholen. Wegen des niedrigen Handelsvolumens schwankten die Kurse heftig, starken Einbrüchen folgten regelmäßig kräftige Gewinne. Bis die Kurse wieder krachten.
Es ist das Szenario der Pessimisten. Und es ist ziemlich nah an der Realität.
An der Börse herrscht eine Situation wie in den letzten Tagen vor dem Platzen der großen Spekulationsblase am Aktienmarkt – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Im Frühjahr 2000 schwärmten die Ökonomen von den Segnungen der New Economy mit ihrem unendlichen Wachstum. Die Kurse kletterten und kletterten, obwohl sie schon so hoch waren wie nie zuvor. Fondsmanager und Analysten starrten auf ihre Computerschirme und verstanden die Welt nicht mehr. Drei Jahre später sind sie ebenso ratlos.
Die Fondsmanager und Analysten haben den Glauben an die Bewertungsrelationen verloren. „Die haben Ende der neunziger Jahre als Richtschnur versagt, warum sollte man sich jetzt auf sie verlassen?“, fragt Conrad Mattern, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Activest. Die Aktienanalysten von ABN Amro stellen ihren verunsicherten Kunden gar die provokante Frage, ob Aktien überhaupt noch fundamental zu bewerten seien. Die meisten Anleger handelten nur noch nach schnell entworfenen Taktiken, wie Währungsspekulanten.
„Seit 1997 können Investoren mit Trendfolgemodellen die Aktienindizes schlagen“, sagt Jürgen Callies, Leiter Research bei der Fondsgesellschaft MEAG. Während früher die Unternehmensgewinne die Hauptrolle spielten, seien seit sechs Jahren prozyklische Strategien immer erfolgreicher. Das heißt: Man kauft, wenn die Kurse steigen, und verkauft, wenn die Kurse fallen. Damit ähneln Aktien tatsächlich Devisen: Bis heute gibt es keine Theorie, die erklärt, warum sich Währungen über Jahre anders entwickeln, als volkswirtschaftliche Daten vorgeben.
Vor allem mit deutschen Aktien wird gern gezockt. „Wenn große Investoren schnell Aktien verkaufen wollen, suchen sie sich den deutschen Markt aus“, sagt Peter Knacke, Wertpapierstratege der Commerzbank. Das hat verschiedene Gründe: In Deutschland haben die Verkäufer nach zwei Tagen das Geld auf dem Konto, in anderen Ländern gelten zum Teil längere Fristen. Und: Die deutsch-schweizerische Terminbörse Eurex ist mittlerweile der größte Handelsplatz für Optionsgeschäfte, mit denen sich die Finanzprofis gegen Kursschwankungen absichern. Je größer das Handelsvolumen an der Terminbörse, desto größer sind auch die Kursschwankungen am normalen Aktienmarkt.
Das Ratespiel heißt: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien?
Mehr als 70 Prozent hat der Dax seit dem Höchststand vor drei Jahren verloren. Der japanische Topix, der ebenfalls 70 Prozent verlor, hat dafür 13 Jahre gebraucht. Der britische Footsie wiederum ist seit dem Hoch vom März 2000 um 50 Prozent gefallen, der amerikanische Dow Jones gar nur um 30.
Die kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Tage haben im besten Fall die Wende markiert. Im schlechtesten Fall waren sie nur die fünfte Gegenbewegung in dem seit drei Jahren gültigen Abwärtstrend. Auf alle Fälle sind sie kein Aufbruchsignal, dafür bleiben die Rahmenbedingungen zu schlecht – ganz unabhängig vom Ausgang des Irak-Konflikts.
So sind die krisengeschüttelten Banken und Versicherer im Dax – im Gegensatz zu anderen Indizes – überproportional vertreten. Die Banken aber leiden unter der Rekordzahl an Firmenpleiten, sie müssen so viele Kredite abschreiben wie selten zuvor. Die Versicherer wiederum leiden, weil sie so viele Aktien besitzen, speziell Bankwerte. Die Verflechtung der Geldhäuser ist ein Teufelskreis. Kein Wunder, dass drei der vier schlechtesten Dax-Werte der vergangenen zwölf Monate Finanzwerte sind: HypoVereinsbank (minus 80 Prozent), Allianz (minus 80 Prozent), Münchener Rück (minus 75 Prozent).
Nur mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen. Dann steigen die Gewinne der Unternehmen, gehen die Pleiten zurück und schreiben die Banken weniger Kredite ab. Dann steigen die Gewinne der Geldhäuser, und damit steigt der Aktienmarkt insgesamt. Doch danach sieht es nicht aus.
„Warum fallen die Renditen der Staatsanleihen auf ein 40-Jahres-Tief und die der Unternehmensanleihen auf ein 35-Jahres-Tief, während gleichzeitig die Aktienkurse krachen?“, fragt Michael Hartnett, Aktienstratege bei Merrill Lynch. „Weil alle die Deflation erwarten“ – also fallende Preise, gepaart mit Rezession. Es sind die Nachwehen der gigantischen Aktienblase: Das wachsende Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten und der Verfall des Dollarkurses, die Zurückhaltung der amerikanischen Verbraucher und der überteuerte US-Immobilienmarkt. All das spricht nicht gerade für Impulse aus Amerika. Und dass Europa aus sich heraus Wachstum entfalten könnte, wagt niemand zu hoffen.
So lautet das beliebteste Ratespiel unter den Geldmanagern derzeit: Wer kauft auf Dauer überhaupt noch Aktien? Die Privatanleger sind immer nur Trendverstärker, nie Initiatoren einer Wende. Und institutionelle Investoren wie Versicherer oder Pensionsfonds überdenken im Augenblick ihr Engagement an der Börse. So ist die Aktienquote der latent aktienbegeisterten britischen Lebensversicherer auf 50 Prozent gesunken, das niedrigste Niveau seit zwei Jahrzehnten. „Wahrscheinlich wird der Gesetzgeber in einigen Ländern künftig für Altersvorsorgeprodukte sogar niedrigere Quoten vorschreiben“, vermutet Adam-Chefinvestor Utermann. Viele Unternehmen hätten einen zu großen Teil ihrer Reserven in Aktien angelegt. „Jetzt gibt es bei den Pensionsverpflichtungen große Deckungslücken.“ Wenn die langfristigen Investoren fehlen, fällt es den Hegdefonds leichter, mit ihren Wetten den Markt zu dominieren.
Selbst ohne diese Probleme müssten sich Altaktionäre lange gedulden. Langfristig wachsen die Gewinne der Unternehmen nicht schneller als die Volkswirtschaft an sich – im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte um drei bis vier Prozent jährlich. Rechnet man noch die Inflation und eine Zitterprämie hinzu, die jeder Käufer verlangt, um überhaupt in riskante Aktien zu investieren und nicht in sichere Staatsanleihen, kommt eine Rendite von sieben bis acht Prozent im Jahr heraus. Jedoch: Selbst bei Steigerungen von acht Prozent jährlich würde der Dax 16 Jahre benötigen, um sein Allzeithoch von 8136 Punkten überhaupt wieder zu erreichen.
Anderthalb Jahrzehnte hat es in der Vergangenheit im Schnitt gedauert, bis die Aktienkurse nach großen Crashs wieder ihr altes Niveau erreichten. Nach dem Crash 1929 waren es sogar fast 30 Jahre.
(c) DIE ZEIT 13/2003
--------
alle suchen was!

KRIEG ALS STIMULANS
US-Ökonom prophezeit zehnjährigen Wirtschaftsboom

Der amerikanische Volkswirt Fred Bergsten erwartet, dass der Preis je Barrel Öl um weitere 10 bis 15 Dollar fällt. Das werde in den USA einen lang anhaltenden Wirtschaftsboom auslösen.
Berlin - Nach dem Golfkrieg 1991 sei der Ölpreis um ein Drittel gefallen: "Das war der Beginn eines zehnjährigen Booms in den USA. Ich glaube, wir werden dieses Mal ein ähnliches Ergebnis sehen."


Der Wirtschaft in den USA sagte Bergsten im "Tagesspiegel" unter dieser Annahme im zweiten Halbjahr ein Wachstum zwischen vier und fünf Prozent voraus . Voraussetzung für das Ende der weltweiten Konjunkturflaute sei aber auch, dass sich die durch den Krieg belasteten Beziehungen zwischen Europa und den USA wieder normalisierten, so Bergsten weiter.
. Voraussetzung für das Ende der weltweiten Konjunkturflaute sei aber auch, dass sich die durch den Krieg belasteten Beziehungen zwischen Europa und den USA wieder normalisierten, so Bergsten weiter.
Die Partner würden sich sehr stark bemühen, "den Scherbenhaufen so schnell wie möglich zusammenzufegen". Auch die Bush-Regierung werde erkennen, "dass sie sich mildern muss. Im Moment mag die US-Regierung eher verletzt oder rachsüchtig sein. Aber wenn der Krieg vorbei ist und sie mit der Realität der Nachkriegsphase konfrontiert ist, wird sie sich ebenfalls um eine Aussöhnung bemühen".
Fred Bergsten leitet das Washingtoner "Institute for International Economics" (IIE) seit dessen Gründung 1981. Das IIE gehört zu den führenden Denkfabriken der USA. In der Vergangenheit hatte Bergsten verschiedene Positionen in der US-Regierung inne: Für Henry Kissinger koordinierte er von 1969 bis 1971 die internationale Wirtschaftspolitik der USA, unter Jimmy Carter leitete er vier Jahre lang die Abteilung für Internationale Angelegenheiten.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,241837,00.html


syr
US-Ökonom prophezeit zehnjährigen Wirtschaftsboom


Der amerikanische Volkswirt Fred Bergsten erwartet, dass der Preis je Barrel Öl um weitere 10 bis 15 Dollar fällt. Das werde in den USA einen lang anhaltenden Wirtschaftsboom auslösen.
Berlin - Nach dem Golfkrieg 1991 sei der Ölpreis um ein Drittel gefallen: "Das war der Beginn eines zehnjährigen Booms in den USA. Ich glaube, wir werden dieses Mal ein ähnliches Ergebnis sehen."



Der Wirtschaft in den USA sagte Bergsten im "Tagesspiegel" unter dieser Annahme im zweiten Halbjahr ein Wachstum zwischen vier und fünf Prozent voraus
 . Voraussetzung für das Ende der weltweiten Konjunkturflaute sei aber auch, dass sich die durch den Krieg belasteten Beziehungen zwischen Europa und den USA wieder normalisierten, so Bergsten weiter.
. Voraussetzung für das Ende der weltweiten Konjunkturflaute sei aber auch, dass sich die durch den Krieg belasteten Beziehungen zwischen Europa und den USA wieder normalisierten, so Bergsten weiter. Die Partner würden sich sehr stark bemühen, "den Scherbenhaufen so schnell wie möglich zusammenzufegen". Auch die Bush-Regierung werde erkennen, "dass sie sich mildern muss. Im Moment mag die US-Regierung eher verletzt oder rachsüchtig sein. Aber wenn der Krieg vorbei ist und sie mit der Realität der Nachkriegsphase konfrontiert ist, wird sie sich ebenfalls um eine Aussöhnung bemühen".
Fred Bergsten leitet das Washingtoner "Institute for International Economics" (IIE) seit dessen Gründung 1981. Das IIE gehört zu den führenden Denkfabriken der USA. In der Vergangenheit hatte Bergsten verschiedene Positionen in der US-Regierung inne: Für Henry Kissinger koordinierte er von 1969 bis 1971 die internationale Wirtschaftspolitik der USA, unter Jimmy Carter leitete er vier Jahre lang die Abteilung für Internationale Angelegenheiten.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,241837,00.html


syr
http://www.ftd.de/pw/in/1048234725554.html?nv=cd-divnews
ftd.de, Mo, 24.3.2003, 11:32
Irakische Bauern schießen angeblich US-Helikopter ab
Irak hat nach eigenen Angaben zwei US-Kampfhubschrauber abgeschossen und zwei Piloten gefangen genommen. Der irakische Informationsminister Mohammed Said al Sahhaf sagte, Bauern hätten die beiden Hubschrauber getroffen.
"Vielleicht zeigen wir noch Bilder der Piloten", sagte al Sahhaf. Das US-Oberkommando Mitte wollte sich zunächst nicht äußern. "Gestern war ein schwarzer Tag, und es wird noch mehr schwarze Tage geben", sagte ein Sprecher lediglich. Zuvor hatte das irakische Fernsehen Bilder von einem gelandeten US-Hubschrauber gezeigt. Männer mit Kalaschnikow-Sturmgewehren tanzten um die Maschine. Der Kampfhubschrauber des Typs Apache schien noch weitgehend intakt zu sein, auch die Raketen waren noch montiert. Der Hubschrauber stand den Angaben zufolge auf einem Feld bei Kerbela rund 80 Kilometer südlich von Bagdad.
© 2003 Financial Times Deutschland
--------
jetzt holen bauern schon hightec-gerät vom himmel.
ich mach mir gleich in die hose
ftd.de, Mo, 24.3.2003, 11:32
Irakische Bauern schießen angeblich US-Helikopter ab
Irak hat nach eigenen Angaben zwei US-Kampfhubschrauber abgeschossen und zwei Piloten gefangen genommen. Der irakische Informationsminister Mohammed Said al Sahhaf sagte, Bauern hätten die beiden Hubschrauber getroffen.
"Vielleicht zeigen wir noch Bilder der Piloten", sagte al Sahhaf. Das US-Oberkommando Mitte wollte sich zunächst nicht äußern. "Gestern war ein schwarzer Tag, und es wird noch mehr schwarze Tage geben", sagte ein Sprecher lediglich. Zuvor hatte das irakische Fernsehen Bilder von einem gelandeten US-Hubschrauber gezeigt. Männer mit Kalaschnikow-Sturmgewehren tanzten um die Maschine. Der Kampfhubschrauber des Typs Apache schien noch weitgehend intakt zu sein, auch die Raketen waren noch montiert. Der Hubschrauber stand den Angaben zufolge auf einem Feld bei Kerbela rund 80 Kilometer südlich von Bagdad.
© 2003 Financial Times Deutschland
--------
jetzt holen bauern schon hightec-gerät vom himmel.
ich mach mir gleich in die hose

Bush`s gedanken als er von Saddams Eliteeinheiten erfahren het, welche die Apaches vom Himmel geholt hatten:

Gerüchten zufolge soll die Abwehr mittels Tonnen von Kameldung erfolg sein, gepresst und von altbabylonischen Katapulten abgeschossen !
!
syr

Gerüchten zufolge soll die Abwehr mittels Tonnen von Kameldung erfolg sein, gepresst und von altbabylonischen Katapulten abgeschossen
 !
!syr
Bild geht nicht mehr 

*Amerikan Missile Misfire Section* updated daily as the Idiot Usurping Lying Dictatorial Weasel bumbles and stumbles.
Errant U.S. missile kills 5 Syrians, injures 10 Bus carrying Syrians was fleeing Iraq fighting --A U.S. missile hit a passenger bus carrying Syrian civilians fleeing the war in Iraq, killing five and injuring 10, Syria`s official news agency reported today.
US cruise missiles misfire, land in Turkey Two US cruise missiles misfired on Turkish territory, without causing any reported victims, the Pentagon said late Sunday.
U.S. patriot missile may have shot down Royal Air Force aircraft, British officials say A Royal Air Force aircraft was reported missing Sunday, and British officials said it may have been shot down by a U.S. Patriot missile.
Pentagon Confirms Missiles May Have Struck Iran Two Pentagon officials now confirm that three U.S. cruise missiles may have gone astray in Iran. The officials say U.S. and Iranian officials are discussing the matter and that Iran realizes that any hit was unintentional.

Donald Rumsfeld and Saddam Hussein in happier times
http://www.legitgov.org
syr


*Amerikan Missile Misfire Section* updated daily as the Idiot Usurping Lying Dictatorial Weasel bumbles and stumbles.
Errant U.S. missile kills 5 Syrians, injures 10 Bus carrying Syrians was fleeing Iraq fighting --A U.S. missile hit a passenger bus carrying Syrian civilians fleeing the war in Iraq, killing five and injuring 10, Syria`s official news agency reported today.
US cruise missiles misfire, land in Turkey Two US cruise missiles misfired on Turkish territory, without causing any reported victims, the Pentagon said late Sunday.
U.S. patriot missile may have shot down Royal Air Force aircraft, British officials say A Royal Air Force aircraft was reported missing Sunday, and British officials said it may have been shot down by a U.S. Patriot missile.
Pentagon Confirms Missiles May Have Struck Iran Two Pentagon officials now confirm that three U.S. cruise missiles may have gone astray in Iran. The officials say U.S. and Iranian officials are discussing the matter and that Iran realizes that any hit was unintentional.

Donald Rumsfeld and Saddam Hussein in happier times
http://www.legitgov.org
syr
rumsi at his best ! 







http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,241910,00.html
SPANNUNGEN MIT USA
Kreml bestreitet Störsender-Export in den Irak
Der Irak-Krieg eskaliert zur Krise der amerikanisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Außenminister Iwanow persönlich dementierte US-Vorwürfe, russische Firmen hätten brisantes Militärmaterial gen Bagdad geliefert. Nicht nur Russlands Öl-Konzerne fürchten derweil Milliardeneinbußen - und erste Unternehmer verlangen, den Dollar zu boykottieren.
Washington/Moskau - Das Dementi kam von allerhöchster Stelle und klang so deutlich wie ungehalten: Der russische Chefdiplomat, Igor Iwanow, trat am Montag vor Journalisten in Moskau, um einen Bericht der "Washington Post" zurückzuweisen. Denn dieser Bericht, sollte er sich als korrekt erweisen, könnte sich rasch zu einer schweren diplomatischen Krise auswachsen. Laut "Post" vom Montag und anderen US-Medienberichten soll die russische Elektronikfirma Awijakonwersija erst jüngst Störsender an den Irak geliefert haben. Diese Geräte sollen angeblich die Zielgeräte der amerikanischen Marschflugkörper und der "intelligenten" Bomben durch Elektrosignale "verwirren". Zwei andere Betriebe hätten Panzerabwehrraketen und Tausende Nachtsichtgeräte geliefert, so die "Post", die sich auf Regierungsquellen berief.
Lieferungen vor allem kurz vor dem Krieg?
"Wir haben keine Güter geschickt, auch keine militärischen, die die Sanktionen verletzen", beteuerte dagegen Iwanow. Indes hat auch das US-Außenministerium protestiert, weil die mutmaßlichen Lieferungen der Russen gegen Uno-Sanktionen verstießen. Iwanow bestätigte, die USA hätten seit Oktober mehrfach Berichte über die angeblichen Lieferungen angefordert - den letzten entsprechenden Report habe Russland am 17. März angefertigt. Es hätten sich aber keine Belege für die amerikanischen Befürchtungen gefunden. Auch der Vize-Stabschef der russischen Regierung, Alexej Wolin, erklärte, die Beschuldigungen seien frei erfunden.
Das US-Außenministerium indes verschärfte seine Vorwürfe nur noch: Die beschuldigten Firmen, so die amerikanischen Diplomaten, sollen den Irak vor allem in den letzten beiden Wochen vor dem Krieg beliefert haben. Die gelieferten Ausrüstungen könnten eine erhebliche Bedrohung für die alliierten Truppen am Golf darstellen. Die Reaktion der russischen Regierung sei bislang nicht ausreichend.
"Die Amerikaner waren entsetzt"
Auch die Firma Awijakonwersija selbst hatte die Berichte kategorisch dementiert. Man habe niemals Störsender an Bagdad verkauft, sagte Firmenchef Oleg Antonow in Moskau. Wahr sei hingegen, dass die Amerikaner die Geräte gekauft hätten, um deren Wirkung auf ihre Waffen zu testen.
Die Ergebnisse waren angeblich beunruhigend: Durch die Störsender würden die amerikanischen Präzisionswaffen ihre Effektivität vollständig verlieren, so Antonow: "Die Amerikaner waren völlig entsetzt darüber, dass ihre Doktrin der nicht-nuklearen Strategie dadurch völlig zusammengebrochen ist", lobte der Unternehmenschef seine Technologie.
Der Firmenchef wollte indessen nicht ausschließen, dass die Störtechnik über Umwege nach Bagdad gelangt sein könnte. Möglich sei etwa, dass jugoslawische Militärs auf der Basis der Awijakonwersija-Technologie einen elektronischen Schutzschild aufgebaut hätten.
Milliarden-Verluste in der Ölbranche erwartet
Die möglichen Militärgeschäfte sind indes nicht der einzige Faktor, der die russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen belastet. Nach Darstellung des Iwanow-Stellvertreters Juri Fedotow könnte die russische Wirtschaft durch den Krieg Milliardeneinbußen erleiden. Russland werde daher alle Versuche ablehnen, im Uno-Sicherheitsrat Beschlüsse durchzusetzen, die die Militäraktion legitimieren sollte.
Bereits am Wochenende hatte das russische Ölunternehmen Tatneft mitgeteilt, durch den Krieg werde ihm ein Gewinn in Größenordnung von knapp einer Milliarde Dollar entgehen. Nach Angaben von Tatneft-Vizegeneraldirektor Chamit Kawejew war bereits ein Vertrag mit dem Irak unterzeichnet, der 33 Öl-Bohrungen vorsah. Ein anderes Abkommen über weitere 60 Bohrungen sei unterschriftsreif gewesen.
Zahllose Verträge wertlos
Auch die russischen Außenhandelsfirmen Maschinoimport und Sarubeschneft, die aktiv am Uno-Programm "Öl gegen Lebensmittel" teilgenommen haben, rechnen mit schweren Einbußen. Die Schulden des Irak bei Maschinoimport summieren sich nach aktuellen Angaben auf 800 Millionen Dollar. Der St. Petersburger Maschinenbaukonzern Silowyje Maschiny wiederum hat mit dem Irak Verträge über 345 Millionen Dollar geschlossen, die vorerst auf Eis gelegt wurden.
Auch die Repräsentanten der Autoindustrie machen sich Sorgen. "Der Irak-Krieg bedeutet für russische Automobilproduzenten den Verlust eines großen Absatzmarktes", klagte Wadim Schwezow, Generaldirektor des Konzerns Sewerstal-Awto. Allein der größte russische Lkw-Produzent KamAS habe im vergangenen Jahr 2500 Lastwagen an den Irak geliefert, vier Mal so viel wie noch 2001.
"Auf den Dollar verzichten"
Die Uno werde keine Kompensationen für diese Verluste auszahlen, spekulierte die Zeitung "Kommersant", weil alle Verträge im Rahmen des Uno-Programms Artikel über Umstände der höheren Gewalt enthielten, spekulierte die Zeitung "Kommersant". Der Krieg könnte als ein solcher Umstand gewertet werden. Insgesamt haben der Irak und Russland im Rahmen des Uno-Programmes seit 1996 Verträge im Gesamtwert von sechs Milliarden Dollar geschlossen. Die Uno hat ihr Programm am 16. März eingestellt. Es erlaubte dem Irak, eine beschränkte Menge Rohöl zu exportieren und die Erlöse für humanitäre Zwecke zu nutzen.
Erste russische Wirtschaftsvertreter haben sich vor dem Hintergrund der Spannungen dafür ausgesprochen, den Dollar zu meiden und amerikanische Waren zu boykottieren. Der Unternehmerverband in Taganrog aus der Region am Asowschen Meer rief die russische Regierung auf, die Dollar-Bestände in der Währungsreserve auf andere Währungen umzustellen, so die Agentur Interfax.
"Wir empfehlen auch Bürgern Russlands, auf den Dollar als Sparmittel zu verzichten, und ihre Guthaben in andere Aktiva anzulegen, ohne auf den Sturz der US-Devise zu warten", sagte der Verbandsvertreter Alexander Ponomarjow. Der Verband hält es für sicher, dass der Krieg ausschließlich dem Schutz der ökonomischen Interessen der USA und der Festigung des Dollar als weltweiter Reservewährung diene.
----------
Was ist denn da los?



SPANNUNGEN MIT USA
Kreml bestreitet Störsender-Export in den Irak
Der Irak-Krieg eskaliert zur Krise der amerikanisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Außenminister Iwanow persönlich dementierte US-Vorwürfe, russische Firmen hätten brisantes Militärmaterial gen Bagdad geliefert. Nicht nur Russlands Öl-Konzerne fürchten derweil Milliardeneinbußen - und erste Unternehmer verlangen, den Dollar zu boykottieren.
Washington/Moskau - Das Dementi kam von allerhöchster Stelle und klang so deutlich wie ungehalten: Der russische Chefdiplomat, Igor Iwanow, trat am Montag vor Journalisten in Moskau, um einen Bericht der "Washington Post" zurückzuweisen. Denn dieser Bericht, sollte er sich als korrekt erweisen, könnte sich rasch zu einer schweren diplomatischen Krise auswachsen. Laut "Post" vom Montag und anderen US-Medienberichten soll die russische Elektronikfirma Awijakonwersija erst jüngst Störsender an den Irak geliefert haben. Diese Geräte sollen angeblich die Zielgeräte der amerikanischen Marschflugkörper und der "intelligenten" Bomben durch Elektrosignale "verwirren". Zwei andere Betriebe hätten Panzerabwehrraketen und Tausende Nachtsichtgeräte geliefert, so die "Post", die sich auf Regierungsquellen berief.
Lieferungen vor allem kurz vor dem Krieg?
"Wir haben keine Güter geschickt, auch keine militärischen, die die Sanktionen verletzen", beteuerte dagegen Iwanow. Indes hat auch das US-Außenministerium protestiert, weil die mutmaßlichen Lieferungen der Russen gegen Uno-Sanktionen verstießen. Iwanow bestätigte, die USA hätten seit Oktober mehrfach Berichte über die angeblichen Lieferungen angefordert - den letzten entsprechenden Report habe Russland am 17. März angefertigt. Es hätten sich aber keine Belege für die amerikanischen Befürchtungen gefunden. Auch der Vize-Stabschef der russischen Regierung, Alexej Wolin, erklärte, die Beschuldigungen seien frei erfunden.
Das US-Außenministerium indes verschärfte seine Vorwürfe nur noch: Die beschuldigten Firmen, so die amerikanischen Diplomaten, sollen den Irak vor allem in den letzten beiden Wochen vor dem Krieg beliefert haben. Die gelieferten Ausrüstungen könnten eine erhebliche Bedrohung für die alliierten Truppen am Golf darstellen. Die Reaktion der russischen Regierung sei bislang nicht ausreichend.
"Die Amerikaner waren entsetzt"
Auch die Firma Awijakonwersija selbst hatte die Berichte kategorisch dementiert. Man habe niemals Störsender an Bagdad verkauft, sagte Firmenchef Oleg Antonow in Moskau. Wahr sei hingegen, dass die Amerikaner die Geräte gekauft hätten, um deren Wirkung auf ihre Waffen zu testen.

Die Ergebnisse waren angeblich beunruhigend: Durch die Störsender würden die amerikanischen Präzisionswaffen ihre Effektivität vollständig verlieren, so Antonow: "Die Amerikaner waren völlig entsetzt darüber, dass ihre Doktrin der nicht-nuklearen Strategie dadurch völlig zusammengebrochen ist", lobte der Unternehmenschef seine Technologie.
Der Firmenchef wollte indessen nicht ausschließen, dass die Störtechnik über Umwege nach Bagdad gelangt sein könnte. Möglich sei etwa, dass jugoslawische Militärs auf der Basis der Awijakonwersija-Technologie einen elektronischen Schutzschild aufgebaut hätten.
Milliarden-Verluste in der Ölbranche erwartet
Die möglichen Militärgeschäfte sind indes nicht der einzige Faktor, der die russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen belastet. Nach Darstellung des Iwanow-Stellvertreters Juri Fedotow könnte die russische Wirtschaft durch den Krieg Milliardeneinbußen erleiden. Russland werde daher alle Versuche ablehnen, im Uno-Sicherheitsrat Beschlüsse durchzusetzen, die die Militäraktion legitimieren sollte.
Bereits am Wochenende hatte das russische Ölunternehmen Tatneft mitgeteilt, durch den Krieg werde ihm ein Gewinn in Größenordnung von knapp einer Milliarde Dollar entgehen. Nach Angaben von Tatneft-Vizegeneraldirektor Chamit Kawejew war bereits ein Vertrag mit dem Irak unterzeichnet, der 33 Öl-Bohrungen vorsah. Ein anderes Abkommen über weitere 60 Bohrungen sei unterschriftsreif gewesen.
Zahllose Verträge wertlos
Auch die russischen Außenhandelsfirmen Maschinoimport und Sarubeschneft, die aktiv am Uno-Programm "Öl gegen Lebensmittel" teilgenommen haben, rechnen mit schweren Einbußen. Die Schulden des Irak bei Maschinoimport summieren sich nach aktuellen Angaben auf 800 Millionen Dollar. Der St. Petersburger Maschinenbaukonzern Silowyje Maschiny wiederum hat mit dem Irak Verträge über 345 Millionen Dollar geschlossen, die vorerst auf Eis gelegt wurden.
Auch die Repräsentanten der Autoindustrie machen sich Sorgen. "Der Irak-Krieg bedeutet für russische Automobilproduzenten den Verlust eines großen Absatzmarktes", klagte Wadim Schwezow, Generaldirektor des Konzerns Sewerstal-Awto. Allein der größte russische Lkw-Produzent KamAS habe im vergangenen Jahr 2500 Lastwagen an den Irak geliefert, vier Mal so viel wie noch 2001.
"Auf den Dollar verzichten"
Die Uno werde keine Kompensationen für diese Verluste auszahlen, spekulierte die Zeitung "Kommersant", weil alle Verträge im Rahmen des Uno-Programms Artikel über Umstände der höheren Gewalt enthielten, spekulierte die Zeitung "Kommersant". Der Krieg könnte als ein solcher Umstand gewertet werden. Insgesamt haben der Irak und Russland im Rahmen des Uno-Programmes seit 1996 Verträge im Gesamtwert von sechs Milliarden Dollar geschlossen. Die Uno hat ihr Programm am 16. März eingestellt. Es erlaubte dem Irak, eine beschränkte Menge Rohöl zu exportieren und die Erlöse für humanitäre Zwecke zu nutzen.
Erste russische Wirtschaftsvertreter haben sich vor dem Hintergrund der Spannungen dafür ausgesprochen, den Dollar zu meiden und amerikanische Waren zu boykottieren. Der Unternehmerverband in Taganrog aus der Region am Asowschen Meer rief die russische Regierung auf, die Dollar-Bestände in der Währungsreserve auf andere Währungen umzustellen, so die Agentur Interfax.
"Wir empfehlen auch Bürgern Russlands, auf den Dollar als Sparmittel zu verzichten, und ihre Guthaben in andere Aktiva anzulegen, ohne auf den Sturz der US-Devise zu warten", sagte der Verbandsvertreter Alexander Ponomarjow. Der Verband hält es für sicher, dass der Krieg ausschließlich dem Schutz der ökonomischen Interessen der USA und der Festigung des Dollar als weltweiter Reservewährung diene.
----------
Was ist denn da los?




Dienstag, 25. März 2003
Strategiewechsel
Häuserkampf um Basra droht
Amerikanische und britische Truppen werden voraussichtlich in die südirakische Stadt Basra eindringen. Ein britischer Militärsprecher sagte dem n-tv Partnersender CNN, die Stadt werde zu einem militärischen Ziel. Damit habe es einen Strategiewandel gegeben.
Die Entscheidung sei gefallen, nachdem irakische Einheiten mit Panzern, Artillerie und Infanterie in die Stadt zurückgekehrt seien, berichteten CNN. Die Einheiten hätten den britischen Truppen innerhalb von 24 Stunden rund ein Dutzend Gefechte geliefert.
Zuvor hatte CNN britische Offiziere mit den Worten zitiert: "Das ist nicht nur eine Veränderung unserer Strategie, sondern eine hoch riskante Operation". Britische Truppen haben die Stadt umringt, wollten einen Einmarsch allerdings vermeiden.
Dementi aus Katar
Ein britischer Armeesprecher in Katar dementierte allerdings, dass die Briten in Basra einmarschieren wollen. "Wir gehen nicht nach Basra hinein", sagte der Sprecher des Zentralkommandos. Basra sei lediglich zu einem militärischen Ziel erklärt worden.
Bisher war es die Absicht der amerikanischen und britischen Truppen, die Millionenstadt zu umgehen und sich nicht in einen Häuserkampf hineinziehen zu lassen. Anlass für den Strategiewandel sei der andauernde heftige Widerstand aus der Stadt und die Tatsache, dass sich große Teile der lokalen irakischen Truppen ins Innere der Stadt zurückgezogen hätten.
Basra wurde auch in der Nacht zum Dienstag bombardiert. Das Rote Kreuz befürchtet für die Stadt eine humanitäre Krise. Die Menschen seien durch den Stromausfall zwei Tage lang komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Durch Notmaßnahmen hätten nun etwa 40 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Wasservorräten.
US-Truppen sollen Nasirija durchquert haben
Schwere Kämpfe meldete der arabische Fernsehsender El Dschasira erneut um die strategisch wichtige Stadt Nasarija rund 150 Kilometer südlich von Bagdad. Dabei habe es schwere Artillerie-Duelle gegeben. Auch Kampfhubschrauber seien eingesetzt worden.
Einem "eingebetteten" Reuters-Korrespondenten zufolge haben US-Truppen am Dienstag unter heftigem Beschuss Nasirija durchquert und sich weiter vom Südosten her auf Bagdad zubewegt.
"Der Konvoi ist jetzt durch", berichtete Reuters-Reporter Sean Maguire. Unter strategischen Gesichtspunkten könnte die Truppe vom Südosten her Teil einer Zangenbewegung sein, mit der die von den USA geführten Einheiten Bagdad einschnüren könnten. Südwestlich Bagdads sind die Truppen Militärangaben zufolge bis auf hundert Kilometer an die Hauptstadt herangerückt. "Nasirija scheint noch immer feindlich gesonnen", sagte Maguire. "Aber die Amerikaner haben jetzt die Wasserwege überquert und bewegen sich weiter nach Norden."
Sandsturm behindert Vormarsch
In der Nähe von Nadschaf, etwa 160 Kilometer südlich von Bagdad, behinderte am Dienstagmorgen ein Sandsturm den Vormarsch der US-Truppen. "Der Wind ist über Nacht stärker geworden und heute Morgen beträgt die Sichtweite nur noch rund 500 Meter", sagte Reuters-Reporter Luke Baker, der die 3. US-Infanteriedivision begleitet. Die Offiziere erwarteten, dass sich das Wetter weiter verschlechtere.
"Der Krieg braucht Zeit"
Großbritannien plant nach Angaben des Kommandeurs des britischen Kontingents am Golf, Luftmarschall Brian Burridge, keine Truppenverstärkungen im Irak-Krieg. Burridge sagte am Dienstag der BBC, dem Krieg müsse Zeit eingeräumt werden. Ein schneller Sieg sei nie vorhergesagt worden.
http://www.n-tv.de/3148572.html
Dabei soll doch seit zwei Tagen alles unter Kontrolle sein? Wie das nur rauskommt, stehen 90 km vor Baghdad und haben 50 km von der kuweitischen Grenze noch Probleme
 ...
...
syr
Strategiewechsel
Häuserkampf um Basra droht
Amerikanische und britische Truppen werden voraussichtlich in die südirakische Stadt Basra eindringen. Ein britischer Militärsprecher sagte dem n-tv Partnersender CNN, die Stadt werde zu einem militärischen Ziel. Damit habe es einen Strategiewandel gegeben.
Die Entscheidung sei gefallen, nachdem irakische Einheiten mit Panzern, Artillerie und Infanterie in die Stadt zurückgekehrt seien, berichteten CNN. Die Einheiten hätten den britischen Truppen innerhalb von 24 Stunden rund ein Dutzend Gefechte geliefert.
Zuvor hatte CNN britische Offiziere mit den Worten zitiert: "Das ist nicht nur eine Veränderung unserer Strategie, sondern eine hoch riskante Operation". Britische Truppen haben die Stadt umringt, wollten einen Einmarsch allerdings vermeiden.
Dementi aus Katar
Ein britischer Armeesprecher in Katar dementierte allerdings, dass die Briten in Basra einmarschieren wollen. "Wir gehen nicht nach Basra hinein", sagte der Sprecher des Zentralkommandos. Basra sei lediglich zu einem militärischen Ziel erklärt worden.
Bisher war es die Absicht der amerikanischen und britischen Truppen, die Millionenstadt zu umgehen und sich nicht in einen Häuserkampf hineinziehen zu lassen. Anlass für den Strategiewandel sei der andauernde heftige Widerstand aus der Stadt und die Tatsache, dass sich große Teile der lokalen irakischen Truppen ins Innere der Stadt zurückgezogen hätten.
Basra wurde auch in der Nacht zum Dienstag bombardiert. Das Rote Kreuz befürchtet für die Stadt eine humanitäre Krise. Die Menschen seien durch den Stromausfall zwei Tage lang komplett von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Durch Notmaßnahmen hätten nun etwa 40 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Wasservorräten.
US-Truppen sollen Nasirija durchquert haben
Schwere Kämpfe meldete der arabische Fernsehsender El Dschasira erneut um die strategisch wichtige Stadt Nasarija rund 150 Kilometer südlich von Bagdad. Dabei habe es schwere Artillerie-Duelle gegeben. Auch Kampfhubschrauber seien eingesetzt worden.
Einem "eingebetteten" Reuters-Korrespondenten zufolge haben US-Truppen am Dienstag unter heftigem Beschuss Nasirija durchquert und sich weiter vom Südosten her auf Bagdad zubewegt.
"Der Konvoi ist jetzt durch", berichtete Reuters-Reporter Sean Maguire. Unter strategischen Gesichtspunkten könnte die Truppe vom Südosten her Teil einer Zangenbewegung sein, mit der die von den USA geführten Einheiten Bagdad einschnüren könnten. Südwestlich Bagdads sind die Truppen Militärangaben zufolge bis auf hundert Kilometer an die Hauptstadt herangerückt. "Nasirija scheint noch immer feindlich gesonnen", sagte Maguire. "Aber die Amerikaner haben jetzt die Wasserwege überquert und bewegen sich weiter nach Norden."
Sandsturm behindert Vormarsch
In der Nähe von Nadschaf, etwa 160 Kilometer südlich von Bagdad, behinderte am Dienstagmorgen ein Sandsturm den Vormarsch der US-Truppen. "Der Wind ist über Nacht stärker geworden und heute Morgen beträgt die Sichtweite nur noch rund 500 Meter", sagte Reuters-Reporter Luke Baker, der die 3. US-Infanteriedivision begleitet. Die Offiziere erwarteten, dass sich das Wetter weiter verschlechtere.
"Der Krieg braucht Zeit"
Großbritannien plant nach Angaben des Kommandeurs des britischen Kontingents am Golf, Luftmarschall Brian Burridge, keine Truppenverstärkungen im Irak-Krieg. Burridge sagte am Dienstag der BBC, dem Krieg müsse Zeit eingeräumt werden. Ein schneller Sieg sei nie vorhergesagt worden.
http://www.n-tv.de/3148572.html
Dabei soll doch seit zwei Tagen alles unter Kontrolle sein? Wie das nur rauskommt, stehen 90 km vor Baghdad und haben 50 km von der kuweitischen Grenze noch Probleme

 ...
...syr
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
25.03. 13:28
Yahoo: $40 Mio. Gewinn oder $440 Mio. Verlust?
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie Yahoo (WKN: 900103, US: YHOO) in seinem Geschäftsbericht am Freitag bekanntgab, lag der Nettogewinn im Jahr 2002 bei $42.8 Millionen – hätte der Internetportalbetreiber jedoch wie eine wachsende Zahl von Technologieunternehmen eine Bilanzierungsmethode übernommen, die die Kosten für Aktienoptionen mit einrechnet, so hätte das Unternehmen einen Verlust von $440.1 Millionen ausweisen müssen. Dies zeigt, wie stark die Art und Weise der Bilanzführung den Gewinnausweis eines Unternehmens beeinflussen kann. Laut Patrick McGurn, dem Senior Vice President des Beratungsunternehmens Institutional Shareholder Services, beleuchtet der massive Unterschied der zwei Ergebnisdaten die Dringlichkeit einer einheitlichen Lösung bei der Buchführung. Die Kosten für Aktienoptionen sollen zukünftig im gemeldeten Ergebnis für den Anleger offen ersichtlich sein, und nicht nur im Kleingedruckten erläutert werden, fordert McGurn.

Yahoo: $40 Mio. Gewinn oder $440 Mio. Verlust?
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie Yahoo (WKN: 900103, US: YHOO) in seinem Geschäftsbericht am Freitag bekanntgab, lag der Nettogewinn im Jahr 2002 bei $42.8 Millionen – hätte der Internetportalbetreiber jedoch wie eine wachsende Zahl von Technologieunternehmen eine Bilanzierungsmethode übernommen, die die Kosten für Aktienoptionen mit einrechnet, so hätte das Unternehmen einen Verlust von $440.1 Millionen ausweisen müssen. Dies zeigt, wie stark die Art und Weise der Bilanzführung den Gewinnausweis eines Unternehmens beeinflussen kann. Laut Patrick McGurn, dem Senior Vice President des Beratungsunternehmens Institutional Shareholder Services, beleuchtet der massive Unterschied der zwei Ergebnisdaten die Dringlichkeit einer einheitlichen Lösung bei der Buchführung. Die Kosten für Aktienoptionen sollen zukünftig im gemeldeten Ergebnis für den Anleger offen ersichtlich sein, und nicht nur im Kleingedruckten erläutert werden, fordert McGurn.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0%2C1518%2C242037%2C00.html
WÄHRUNGSREVOLTE
Airbus will den Dollar abschaffen
Der Ton zwischen den konkurrierenden Luftfahrt- und Rüstungskonzernen aus Europa und den USA wird rauer. Der Co-Vorstand des Airbus-Herstellers EADS hat gefordert, die Geschäfte künftig in Euro abzuwickeln: Damit wäre ein Wettbewerbsvorteil des US-Konzerns Boeing dahin.

London - Im Wettbewerb um Aufträge des US-Verteidigungsministeriums ist der deutsch-französische Konzern EADS derzeit ohnehin abgemeldet. Während Boeing vom wachsenden US-Rüstungsgeschäft profitiert, bleibt die europäische EADS vor allem auf das zivile Luftfahrtgeschäft angewiesen. Doch auch in diesem Geschäftsbereich profitiert Boeing derzeit vom schwachen US-Dollar.
Um die Wettbewerbsnachteile gegenüber Boeing auszugleichen, hat der Co-Vorstandschef von EADS, Philippe Camus, eine Währungsumstellung in der Branche gefordert. "Währungen sind ein Wettbewerbsfaktor und wir wollen Boeing dazu bringen, unsere Währungsstruktur zu übernehmen", sagte Camus der britischen "Financial Times". Ebenso wie der Ölpreis werden auch die Geschäfte der zivilen Luftfahrtbranche bislang in US-Dollar abgerechnet. Die Abwertung des Dollar gegenüber dem Euro kommt Boeing dabei sehr entgegen.
Konzern der "Unwilligen"
Der EADS-Konzern war erst vor drei Jahren durch den Zusammenschluss deutscher, französischer und spanischer Unternehmen gegründet worden mit dem Ziel, ein Gegengewicht zu den US-amerikanischen Konzernen Boeing und Lockheed Martin zu schaffen. Die Hoffnung, als Anbieter auf Augenhöhe mit Boeing einen Teil der Aufträge des amerikanischen Verteidigungsministeriums zu ergattern, ist nach ersten Erfolgen jetzt wieder deutlich abgekühlt.
In den USA wird EADS in erster Linie als deutsch-französischer Konzern und damit als Vertreter der "Unwilligen" wahrgenommen. Damit werde es deutlich schwerer, auf dem US-Markt Fuß zu fassen, hatte Camus in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin "Newsweek" eingeräumt.

WÄHRUNGSREVOLTE
Airbus will den Dollar abschaffen
Der Ton zwischen den konkurrierenden Luftfahrt- und Rüstungskonzernen aus Europa und den USA wird rauer. Der Co-Vorstand des Airbus-Herstellers EADS hat gefordert, die Geschäfte künftig in Euro abzuwickeln: Damit wäre ein Wettbewerbsvorteil des US-Konzerns Boeing dahin.

London - Im Wettbewerb um Aufträge des US-Verteidigungsministeriums ist der deutsch-französische Konzern EADS derzeit ohnehin abgemeldet. Während Boeing vom wachsenden US-Rüstungsgeschäft profitiert, bleibt die europäische EADS vor allem auf das zivile Luftfahrtgeschäft angewiesen. Doch auch in diesem Geschäftsbereich profitiert Boeing derzeit vom schwachen US-Dollar.
Um die Wettbewerbsnachteile gegenüber Boeing auszugleichen, hat der Co-Vorstandschef von EADS, Philippe Camus, eine Währungsumstellung in der Branche gefordert. "Währungen sind ein Wettbewerbsfaktor und wir wollen Boeing dazu bringen, unsere Währungsstruktur zu übernehmen", sagte Camus der britischen "Financial Times". Ebenso wie der Ölpreis werden auch die Geschäfte der zivilen Luftfahrtbranche bislang in US-Dollar abgerechnet. Die Abwertung des Dollar gegenüber dem Euro kommt Boeing dabei sehr entgegen.
Konzern der "Unwilligen"
Der EADS-Konzern war erst vor drei Jahren durch den Zusammenschluss deutscher, französischer und spanischer Unternehmen gegründet worden mit dem Ziel, ein Gegengewicht zu den US-amerikanischen Konzernen Boeing und Lockheed Martin zu schaffen. Die Hoffnung, als Anbieter auf Augenhöhe mit Boeing einen Teil der Aufträge des amerikanischen Verteidigungsministeriums zu ergattern, ist nach ersten Erfolgen jetzt wieder deutlich abgekühlt.
In den USA wird EADS in erster Linie als deutsch-französischer Konzern und damit als Vertreter der "Unwilligen" wahrgenommen. Damit werde es deutlich schwerer, auf dem US-Markt Fuß zu fassen, hatte Camus in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin "Newsweek" eingeräumt.

http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0%2C2828%2C242019…
"Trudelt Amerika, stürzen wir mit"
Von Kai Lange
Anlageprofis ziehen Geld aus den USA ab. Dies trifft die US-Wirtschaft zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Das milliardenschwere Defizit wird durch die Kriegskosten und Steuersenkungen weiter ansteigen. Experten warnen vor den Folgen auch für Europa.
Fondsmanager sind ein vorsichtiges Volk. Nur nicht auffallen, lautet eine der wichtigsten Regeln in schwachen Börsenzeiten. Verluste in den Depots sind schmerzlich, aber nur halb so schlimm, solange auch der Vergleichsindex nach unten rauscht. Sich an die Benchmark zu halten, sichert in Zeiten schwankender Märkte den Job.
Im wichtigsten Vergleichsindex für weltweit anlegende Aktienfonds, dem MSCI World, sind US-Aktien mit rund 58 Prozent deutlich stärker gewichtet als europäische Papiere (28 Prozent). Bemerkenswert, dass ausgerechnet jetzt einige Anlageprofis den Ausbruch wagen und mehr Geld in Europa investieren: Nach Angaben des auf Fonds spezialisierten Analystenhauses Morningstar stecken weltweit anlegende Aktienfonds derzeit rund 43 Prozent ihres Geldes in europäische Aktien. Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten - der alte Kontinent holt auf.
US-Image ist angekratzt
"Wir haben Europa deutlich übergewichtet", sagt Thomas Meier, der mit dem UniGlobal einen rund drei Milliarden Euro schweren Fonds der Gesellschaft Union Investment betreut. Das liege nicht nur daran, dass die europäischen Aktienmärkte stärker als die Wall Street gefallen sind und größeres Erholungspotenzial bieten. "Viele Risiken, die auf den Finanzmärkten lasten, haben ihren Ursprung in den USA", sagt Meier.
Dazu zählt der Fondsmanager zum Beispiel die teuren Aktienoptionspläne für Topmanager sowie die Nachwehen der Bilanzskandale, die das Vertrauen der Anleger erschüttert haben. Im Vergleich zu asiatischen und europäischen Papieren seien US-Aktien noch immer hoch bewertet. Das Image der USA als weltweit bester Anlageplatz ist jedoch angekratzt.
Kapital im großen Stil aufgesogen
Dies trifft die US-Wirtschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn sowohl das Haushaltsdefizit als auch das Defizit in der Leistungsbilanz steigen rasant. "In den vergangenen Jahren haben die USA wie ein Staubsauger ausländisches Kapital aufgesogen", sagt Meier. Solange ein Haushalt Überschüsse ausweise und Investoren mit ordentlichen Renditen befriedigt werden, gehe diese Strategie auch auf.
Doch innerhalb von zwei Jahren hat US-Präsident George W. Bush einen grundsoliden Haushalt tief in die roten Zahlen getrieben. Die Kosten für den Irak-Feldzug sowie die massiven Steuersenkungen werden das Haushaltsdefizit nach jüngsten Schätzungen deutlich über die Marke von 300 Milliarden Dollar steigen lassen. Hinzu kommt ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 500 Milliarden Dollar: Die US-Bürger geben deutlich mehr Geld aus, als sie selbst erwirtschaften. "Da kommen einige Investoren ins Grübeln – sie sehen sich nach Anlage-Alternativen um", sagt Meier.
Abhängig wie nie zuvor
Sogar bei US-Ökonomen wachsen die Sorgen. "Die USA sind so abhängig von ausländischem Kapital wie niemals zuvor", warnt Steven Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley. Das hohe Defizit in der Leistungsbilanz werde nach seiner Einschätzung zu einer weiteren Abwertung des Dollar führen. Das Risiko: Sollten internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen, dürften Wall Street, US-Staatsanleihen und Dollar im Gleichschritt nach unten marschieren.
Anleger, die in den USA investiert haben, klammern sich an die Hoffnung, dass der private Konsum endlich wieder anzieht. Doch die amerikanischen Verbraucher zeigen sich durch Irak-Krise und Börsentalfahrt stark verunsichert, wie die jüngsten Daten zum Verbrauchervertrauen belegen. Betrachte man den privaten Sektor, nehmen die Konjunkturrisiken in den USA nach Einschätzung von Union Investment eher noch zu.
Auch Michael Fraikin, Fondsmanager des Global Dynamic bei Invesco, ist derzeit nicht in amerikanischen Einzeltiteln investiert. "Europa hat derzeit das größere Aufholpotenzial", bestätigt Fraikin. Die höhere Attraktivität europäischer Werte liege jedoch nicht an der wirtschaftlichen Dynamik Eurolands, sondern an dem tiefen Sturz der europäischen Werte. "Sie sind stärker gefallen als US-Aktien und dürften im Fall einer Erholung stärker steigen", stellt Fraikin fest.
"Trudelt Amerika, stürzen wir mit"
Anleger spekulieren bereits über eine Neuverteilung des internationalen, extrem beweglichen Kapitals. Besonders die Wachstumsregionen in Asien und auch Europa dürften schon bald aus dem Schatten der USA heraustreten und ihr weitere Anteile abjagen. Doch besonders für den alten Kontinent birgt diese Entwicklung auch Risiken: "Europäer haben keinen Grund, sich über Schwierigkeiten der USA zu freuen", sagt Philipp Vorndran, Leiter globale Strategie bei Credit Suisse Asset Management. "Kommt Amerika ins Trudeln, stürzen wir mit."
Mit knapp drei Prozent geschätztem Wachstum für dieses Jahr sei die US-Wirtschaft noch immer der wichtigste Treiber für die Weltwirtschaft – jeder Rückschlag in den USA werde auf das konjunkturlahme Europa doppelt durchschlagen. "Wir sollten das Defizit der USA lieben und auch künftig weiter finanzieren – denn ohne dieses Defizit wird der europäische Export nicht funktionieren", sagt Vorndran.
Arabische Investoren im Blick
Besonders Deutschland habe keinen Anlass, mit dem Finger auf die tiefroten Bilanzen der Bush-Regierung zu zeigen. "In den USA läuft der Konsum auf Pump, in Deutschland die Altersversorgung und die Sozialsysteme – das ist noch schwieriger zu korrigieren." Wegen fehlender Reformen seien deutsche Aktien derzeit zwar günstiger bewertet als die Emerging Markets in Asien – doch Vorndran sieht im Gegensatz zu vielen europäischen Kollegen keinen Grund, den Anteil seiner vergleichsweise teuren US-Aktien aufzugeben.
Kurzfristig hole Europa vielleicht etwas auf – doch mittelfristig werde die USA auf Grund der höheren Flexibilität stärker wachsen. Nur "deutliche politische Veränderungen" würden den Aktienstrategen von Credit Suisse zu einer Neugewichtung des Fondsvermögens bewegen. "Zum Beispiel, wenn die Europäische Zentralbank ihre Strategie ändert. Wenn der Ölpreis nicht mehr in Dollar, sondern in Euro abgerechnet wird. Oder wenn Großinvestoren aus dem arabischen Raum im großen Stil amerikanische Aktien verkaufen." Doch danach sehe es im Moment nicht aus.
------------
Einige überschätzen die Amis immer noch!
Der europäische Privatmann und -frau ist bei weitem nicht so verschuldet wie die aus den USA.
Und die durchschnittlichen US-Löhne sprechen auch nicht gerade für einen kommenden Overkill Boom!

"Trudelt Amerika, stürzen wir mit"
Von Kai Lange
Anlageprofis ziehen Geld aus den USA ab. Dies trifft die US-Wirtschaft zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Das milliardenschwere Defizit wird durch die Kriegskosten und Steuersenkungen weiter ansteigen. Experten warnen vor den Folgen auch für Europa.
Fondsmanager sind ein vorsichtiges Volk. Nur nicht auffallen, lautet eine der wichtigsten Regeln in schwachen Börsenzeiten. Verluste in den Depots sind schmerzlich, aber nur halb so schlimm, solange auch der Vergleichsindex nach unten rauscht. Sich an die Benchmark zu halten, sichert in Zeiten schwankender Märkte den Job.
Im wichtigsten Vergleichsindex für weltweit anlegende Aktienfonds, dem MSCI World, sind US-Aktien mit rund 58 Prozent deutlich stärker gewichtet als europäische Papiere (28 Prozent). Bemerkenswert, dass ausgerechnet jetzt einige Anlageprofis den Ausbruch wagen und mehr Geld in Europa investieren: Nach Angaben des auf Fonds spezialisierten Analystenhauses Morningstar stecken weltweit anlegende Aktienfonds derzeit rund 43 Prozent ihres Geldes in europäische Aktien. Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten - der alte Kontinent holt auf.
US-Image ist angekratzt
"Wir haben Europa deutlich übergewichtet", sagt Thomas Meier, der mit dem UniGlobal einen rund drei Milliarden Euro schweren Fonds der Gesellschaft Union Investment betreut. Das liege nicht nur daran, dass die europäischen Aktienmärkte stärker als die Wall Street gefallen sind und größeres Erholungspotenzial bieten. "Viele Risiken, die auf den Finanzmärkten lasten, haben ihren Ursprung in den USA", sagt Meier.
Dazu zählt der Fondsmanager zum Beispiel die teuren Aktienoptionspläne für Topmanager sowie die Nachwehen der Bilanzskandale, die das Vertrauen der Anleger erschüttert haben. Im Vergleich zu asiatischen und europäischen Papieren seien US-Aktien noch immer hoch bewertet. Das Image der USA als weltweit bester Anlageplatz ist jedoch angekratzt.
Kapital im großen Stil aufgesogen
Dies trifft die US-Wirtschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn sowohl das Haushaltsdefizit als auch das Defizit in der Leistungsbilanz steigen rasant. "In den vergangenen Jahren haben die USA wie ein Staubsauger ausländisches Kapital aufgesogen", sagt Meier. Solange ein Haushalt Überschüsse ausweise und Investoren mit ordentlichen Renditen befriedigt werden, gehe diese Strategie auch auf.
Doch innerhalb von zwei Jahren hat US-Präsident George W. Bush einen grundsoliden Haushalt tief in die roten Zahlen getrieben. Die Kosten für den Irak-Feldzug sowie die massiven Steuersenkungen werden das Haushaltsdefizit nach jüngsten Schätzungen deutlich über die Marke von 300 Milliarden Dollar steigen lassen. Hinzu kommt ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 500 Milliarden Dollar: Die US-Bürger geben deutlich mehr Geld aus, als sie selbst erwirtschaften. "Da kommen einige Investoren ins Grübeln – sie sehen sich nach Anlage-Alternativen um", sagt Meier.
Abhängig wie nie zuvor
Sogar bei US-Ökonomen wachsen die Sorgen. "Die USA sind so abhängig von ausländischem Kapital wie niemals zuvor", warnt Steven Roach, Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley. Das hohe Defizit in der Leistungsbilanz werde nach seiner Einschätzung zu einer weiteren Abwertung des Dollar führen. Das Risiko: Sollten internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen, dürften Wall Street, US-Staatsanleihen und Dollar im Gleichschritt nach unten marschieren.
Anleger, die in den USA investiert haben, klammern sich an die Hoffnung, dass der private Konsum endlich wieder anzieht. Doch die amerikanischen Verbraucher zeigen sich durch Irak-Krise und Börsentalfahrt stark verunsichert, wie die jüngsten Daten zum Verbrauchervertrauen belegen. Betrachte man den privaten Sektor, nehmen die Konjunkturrisiken in den USA nach Einschätzung von Union Investment eher noch zu.
Auch Michael Fraikin, Fondsmanager des Global Dynamic bei Invesco, ist derzeit nicht in amerikanischen Einzeltiteln investiert. "Europa hat derzeit das größere Aufholpotenzial", bestätigt Fraikin. Die höhere Attraktivität europäischer Werte liege jedoch nicht an der wirtschaftlichen Dynamik Eurolands, sondern an dem tiefen Sturz der europäischen Werte. "Sie sind stärker gefallen als US-Aktien und dürften im Fall einer Erholung stärker steigen", stellt Fraikin fest.
"Trudelt Amerika, stürzen wir mit"
Anleger spekulieren bereits über eine Neuverteilung des internationalen, extrem beweglichen Kapitals. Besonders die Wachstumsregionen in Asien und auch Europa dürften schon bald aus dem Schatten der USA heraustreten und ihr weitere Anteile abjagen. Doch besonders für den alten Kontinent birgt diese Entwicklung auch Risiken: "Europäer haben keinen Grund, sich über Schwierigkeiten der USA zu freuen", sagt Philipp Vorndran, Leiter globale Strategie bei Credit Suisse Asset Management. "Kommt Amerika ins Trudeln, stürzen wir mit."
Mit knapp drei Prozent geschätztem Wachstum für dieses Jahr sei die US-Wirtschaft noch immer der wichtigste Treiber für die Weltwirtschaft – jeder Rückschlag in den USA werde auf das konjunkturlahme Europa doppelt durchschlagen. "Wir sollten das Defizit der USA lieben und auch künftig weiter finanzieren – denn ohne dieses Defizit wird der europäische Export nicht funktionieren", sagt Vorndran.
Arabische Investoren im Blick
Besonders Deutschland habe keinen Anlass, mit dem Finger auf die tiefroten Bilanzen der Bush-Regierung zu zeigen. "In den USA läuft der Konsum auf Pump, in Deutschland die Altersversorgung und die Sozialsysteme – das ist noch schwieriger zu korrigieren." Wegen fehlender Reformen seien deutsche Aktien derzeit zwar günstiger bewertet als die Emerging Markets in Asien – doch Vorndran sieht im Gegensatz zu vielen europäischen Kollegen keinen Grund, den Anteil seiner vergleichsweise teuren US-Aktien aufzugeben.
Kurzfristig hole Europa vielleicht etwas auf – doch mittelfristig werde die USA auf Grund der höheren Flexibilität stärker wachsen. Nur "deutliche politische Veränderungen" würden den Aktienstrategen von Credit Suisse zu einer Neugewichtung des Fondsvermögens bewegen. "Zum Beispiel, wenn die Europäische Zentralbank ihre Strategie ändert. Wenn der Ölpreis nicht mehr in Dollar, sondern in Euro abgerechnet wird. Oder wenn Großinvestoren aus dem arabischen Raum im großen Stil amerikanische Aktien verkaufen." Doch danach sehe es im Moment nicht aus.
------------
Einige überschätzen die Amis immer noch!
Der europäische Privatmann und -frau ist bei weitem nicht so verschuldet wie die aus den USA.
Und die durchschnittlichen US-Löhne sprechen auch nicht gerade für einen kommenden Overkill Boom!


http://www.ftd.de/pw/in/1048234732836.html?nv=hptn
Aus der FTD vom 26.3.2003
US-Senat kürzt Bushs Steuerpläne
Von Yvonne Esterhazy
Der US-Senat hat überraschend dafür gestimmt, dass Steuerpakte von US-Präsident George W. Bush um die Hälfte zu kürzen. Mit 51 zu 48 Stimmen sprach sich die zweite Kammer des Kongresses am Dienstag für Steuersenkungen im Umfang von 350 Mrd. $ aus.
Bush hatte im Januar vorgeschlagen die Steuern in den nächsten zehn Jahren um insgesamt 726 Mrd. $ zu reduzieren. Bush hatte argumentiert, dass sein Steuerpaket, dessen Löwenanteil aus einer Senkung der Dividenensteuer bestanden hätte, der lahmenden US-Konjunktur wieder auf die Sprünge helfen würde.
Im Senat haben die Republikaner eine knappe Mehrheit. Deshalb stellt das Abstimmungsergebnis einen wichtigen politischen Sieg der oppositionellen Demokraten dar. Ihnen gelang es, einige Mitglieder aus Bushs eigener Partei auf ihre Seite zu ziehen. Eine ganze Reihe von Republikanern glauben, dass Steuersenkungen angesichts der wachsenden Haushaltsdefizite derzeit nicht zu verantworten sind.
© 2003 Financial Times Deutschland
---------
Sind ja zum Glück doch nicht alle so blöd!
Aus der FTD vom 26.3.2003
US-Senat kürzt Bushs Steuerpläne
Von Yvonne Esterhazy
Der US-Senat hat überraschend dafür gestimmt, dass Steuerpakte von US-Präsident George W. Bush um die Hälfte zu kürzen. Mit 51 zu 48 Stimmen sprach sich die zweite Kammer des Kongresses am Dienstag für Steuersenkungen im Umfang von 350 Mrd. $ aus.
Bush hatte im Januar vorgeschlagen die Steuern in den nächsten zehn Jahren um insgesamt 726 Mrd. $ zu reduzieren. Bush hatte argumentiert, dass sein Steuerpaket, dessen Löwenanteil aus einer Senkung der Dividenensteuer bestanden hätte, der lahmenden US-Konjunktur wieder auf die Sprünge helfen würde.
Im Senat haben die Republikaner eine knappe Mehrheit. Deshalb stellt das Abstimmungsergebnis einen wichtigen politischen Sieg der oppositionellen Demokraten dar. Ihnen gelang es, einige Mitglieder aus Bushs eigener Partei auf ihre Seite zu ziehen. Eine ganze Reihe von Republikanern glauben, dass Steuersenkungen angesichts der wachsenden Haushaltsdefizite derzeit nicht zu verantworten sind.
© 2003 Financial Times Deutschland
---------
Sind ja zum Glück doch nicht alle so blöd!

US/Auftragseingang langl Güter Februar -1,2 (PROG: -1,7) Proz
Washington (vwd) - Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter ist in den USA im Februar nicht ganz so stark wie erwartet zurückgegangen Wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte, sank der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent auf 170,24 Mrd USD Von vwd befragte Volkswirte hatten im Durchschnitt einen Rückgang um 1,7 Prozent erwartet, nachdem im Vormonat ein Anstieg von revidiert 1,9 (vorläufig: 3,3) Prozent verzeichnet worden war.
vwd/DJ/26.3.2003/hab
Tabelle: US-Auftragseingang langlebiger Güter Februar
Auftragseingang
langl. Güter ex Transport ex Rüstung
Monat absolut +/- % absolut +/- % absolut +/- %
Februar 170,24 -1,2 119,35 -2,1 160,33 -2,7
PROGNOSE -1,7
Januar (R) 172,34 +1,9 121,91 +1,2 164,71 +2,2
Januar* 174,03 +2,9
Januar (V) 174,78 +3,3 123,56 +2,5 167,07 +3,6
Dezember 169,16 -0,4 120,42 +0,9 161,21 -0,8
Investitionsgüter
Nichtrüstungsgüter Rüstungsgüter
Monat absolut +/- % absolut +/- %
Februar 53,45 -5,2 8,62 +28,0
Januar (R) 56,40 +1,0 6,73 -3,4
Januar (V) 57,01 +2,1 6,80 -2,3
Dezember 55,84 +2,4 6,97 +17,6
- * = revidiert im Rahmen der Veröffentlichung der
Auftragseingänge für die US-Industrie am 6. März
- Angaben in Mrd USD
- saisonbereinigt
- V = vorläufig, R = revidiert
- Quelle Daten: US-Handelsministerium
- Quelle Prognose: vwd Umfrage
vwd/DJ/26.3.2003/hab

Washington (vwd) - Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter ist in den USA im Februar nicht ganz so stark wie erwartet zurückgegangen Wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte, sank der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent auf 170,24 Mrd USD Von vwd befragte Volkswirte hatten im Durchschnitt einen Rückgang um 1,7 Prozent erwartet, nachdem im Vormonat ein Anstieg von revidiert 1,9 (vorläufig: 3,3) Prozent verzeichnet worden war.
vwd/DJ/26.3.2003/hab
Tabelle: US-Auftragseingang langlebiger Güter Februar
Auftragseingang
langl. Güter ex Transport ex Rüstung
Monat absolut +/- % absolut +/- % absolut +/- %
Februar 170,24 -1,2 119,35 -2,1 160,33 -2,7
PROGNOSE -1,7
Januar (R) 172,34 +1,9 121,91 +1,2 164,71 +2,2
Januar* 174,03 +2,9
Januar (V) 174,78 +3,3 123,56 +2,5 167,07 +3,6
Dezember 169,16 -0,4 120,42 +0,9 161,21 -0,8
Investitionsgüter
Nichtrüstungsgüter Rüstungsgüter
Monat absolut +/- % absolut +/- %
Februar 53,45 -5,2 8,62 +28,0
Januar (R) 56,40 +1,0 6,73 -3,4
Januar (V) 57,01 +2,1 6,80 -2,3
Dezember 55,84 +2,4 6,97 +17,6
- * = revidiert im Rahmen der Veröffentlichung der
Auftragseingänge für die US-Industrie am 6. März
- Angaben in Mrd USD
- saisonbereinigt
- V = vorläufig, R = revidiert
- Quelle Daten: US-Handelsministerium
- Quelle Prognose: vwd Umfrage
vwd/DJ/26.3.2003/hab

http://nachrichten.boerse.de/anzeige.php3?id=59d2b5ff
Roland Leuschel
Das Universum und die Dummheit der Menschen
Auch die Leser der boerse.de Kolumnen dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die Augen, Ohren und Nasen voll haben mit Bildern der Fernsehkanäle, auf denen geschossen und gebombt wird, auf denen explodierende Raketen und schreiende Kinder zu sehen sind, von Experten die eine Erfolgsmeldung nach der anderen geben und uns die Kriegstaktiken erklären, und wir sind erstaunt, dass anscheinend die ganze Welt von Nahost-Militärexperten wimmelt. Die TV-Zuschauer dürften aber vor allem die Nase voll haben von dem Gestank, den all die Lügen verbreiten, die auf uns einprasseln. Einer der wenigen Augenblicke der Wahrheit : Im ZDF wurde der wohl bekannteste Nahost-Spezialist, Peter Scholl-Latour, gefragt, wie er erklären kann, dass die Amerikaner wohl tatsächlich daran geglaubt hatten, sie würden bei den Schijten in Basra willkommen sein, nachdem sie vor 12 Jahren von den Amerikanern im Stich gelassen worden waren ? Scholl-Latour antwortete : « Die Dummheit der Menschen kennt keine Grenzen. » Eine klare und präzise Antwort, sie erinnert an einen Ausspruch eines der intelligentesten Wesen, das die Menschheit hervorgebracht hat, Albert Einstein, der sagte : « Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschheit, wobei das erste noch nicht endgültig bewiesen ist. » Diese Antwort hätte Albert Einstein auch heute gegeben, wenn jemand ihn nach dem Sinn und der Berechtigung dieses Krieges gefragt hätte.
Die Aktienbörsen haben am 12. März dieses Jahres einen neuen Tiefstpunkt erreicht (Dax 2.198), und als der Kriegsbeginn für jeden Anleger sichtbar wurde, setzte eine allgemeine Kursrallye ein, da die « Unsicherheit aus dem Markt war » (auch hier scheinen Einsteins Worte zu gelten). Ich würde sagen, mit Kriegsbeginn entstanden enorm viele neue Unsicherheiten, die auch die Wirtschaft und damit die Börsen belasten werden. Viele Experten sahen in der fulminanten Börsenerholung (in einer Woche stiegen Dax um 23%, Dow Jones um 9% etc.), bereits das Ende der dreijährigen Baisseperiode und animierten die Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Daueroptimist Heiko Thieme schrieb in der FAZ vom 24.3. : « Eine solche achttätige Rekordsträhne ohne Unterbrechung hat es in der fast 107 Jahre alten Geschichte des Dow Jones bisher noch nie gebeben. »… und er las den Realisten unter den Experten die Leviten : « Die jüngste Entwicklung hat die Pessimisten, die drei Jahre lang die Oberhand hielten, in ihre Schranken verwiesen. », gerade Heiko Thieme, der den Anlegern und der Börsenwelt bewiesen hat, wohin blinder Daueroptimismus bei Aktien führen kann. Still und leise hat er seinen in Luxemburg aufgelegten Fonds, den Thieme Fonds International, geschlossen. Er war im vergangenen Jahr der schlechteste globale Aktienfonds. « Heiko Thieme gilt in Branchenkreisen als einer der schlechtesten Fondsmanager der USA. 2002 verlor sein Fonds fast 70%. Das ist doppelt so viel wie der MSCI World. », so der Originalton von BoerseOnline Nr : 12/2003.
Auch eine der grössten amerikanischen Investmentbanken, Morgan Stanley, trompetete mit Vehemenz ins optimistische Horn : « Der Beginn der Kampfhandlungen hat die zuvor verzeichnete Ungewissheit über die Entwicklung des Irak-Konflikts beseitigt. Die Risikoscheu der Anleger sinkt, und der Ölpreis fällt. » Nach dem eigenen MS-Modell sollte das Kursniveau in Europa noch um weitere 20% steigen, auch wenn die Rendite von Staatsanleihen im Euroraum auf 4,75 anziehen sollte. Ich könnte die Liste der Techniker und Volkswirte weiterführen, die in ihrer ersten Etappe eine Erholung des Daxes bis mindestens 3.500 erwarten (gegenüber dem Tiefstpunkt vom 12.03 wären das immerhin +60% !).
Ich schlage vor, in solch unsicheren Zeiten sollte der Anleger sich an einige fundamentale Fakten halten und versuchen mit Hilfe seines gesunden Menschenverstandes eine Anlagepolitik zu finden, die sein Kapital erhält, und wenn er etwas Glück hat, um 4 bis 6% per annum erhöht. Die Fakten :
Weltweit wurden seit dem Frühjahr 2000 Aktienvermögen von über 12.000 Milliarden Dollar vernichtet (entspricht einem Drittel des augenblicklichen, weltweiten Jahres-Bruttosozialproduktes). Wir haben die grösste Aktienbaisse erlebt, seitdem es Aktien gibt, und sie ist mittlerweile auch die Längste, sie dauerte 36 Monate, gegenüber 34 Monaten in den Jahren 1929 bis 1932. Wer glaubt, eine derartige Kapitalvernichtung hätte keine realwirtschaftlichen Folgen, der irrt gewaltig, zumal aufgrund der Medien und der Banken die Aktienanlage in den 90er Jahren als die rentabelste Anlageinvestition überhaupt angepriesen wurde, und die Anleger nicht nur im Privatsektor sondern auch bei Versicherungen und Pensionskassen die Aktienbestände auf nie gekannte Höhen getrieben hatten. Der renommierte amerikanische Broker, Goldman Sachs, fasste in seiner Studie « Lessons from the Boom and Bust » fünf Schlussfolgerungen zusammen, deren vierte heisst : « Börse und Realwirtschaft wirken so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven, selbstverstärkenden Prozessen, als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge. » Sie kennen die von mir in dieser Kolumne schon öfters vertretene Meinung, dass die Weltwirtschaftskrise II droht. Auch Goldman Sachs schreibt, dass diese Börsenbaisse eine Grössenordnung erreicht hat, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft darstellt.
Der Anleger hat in den drei Jahren der Aktienbaisse eine Risikoaversion gegenüber Aktien und im Gegensatz dazu ein völlig fehlendes Risikobewustsein bei Anleihen entwickelt, sodass er jetzt Gefahr läuft, bei einem Rentenmarktcrash ein zweites mal auf die Nase zu fallen, so schreibt der Chefredakteur von BoerseOnline Johannes Scherer in der letzten Ausgabe : « Deshalb schichten Aktienanleger bereits seit Monaten ihr Kapital in Rentenwerte um und kommen jetzt womöglich vom Regen in die Traufe ; denn die Flucht in länger laufende Zinspapiere hat deren Kurse dermassen nach oben gejagt, dass die Blase zu platzen droht. »
Fazit für den Anleger : Die augenblickliche Kurserholung ist eine zeitlich begrenzte (2 bis 3 Wochen ?) in einem Baissemarkt, der noch einige Jahre andauern wird (2000 bis 2012). Wer seine Kauflimite bei Qualitätsaktien im vergangenen Monat gelegt hat, hat diese Aktien bekommen und kann sie mit 20 bis 30% Kursgewinn verkaufen. Er sollte also nach wie vor Trading mit Aktien machen, aber schon heute die nächsten Kaufkurse in den Markt legen. Insgesamt sollte aber der Anteil der Aktien eines Portefeuilles nicht 20 bis 30% überschreiten, der Rest sollte wie gehabt in Triple A Kurzläufern angelegt sein, und vergessen Sie nicht 5 bis 10% in Gold zu legen. Die jetzige Kursschwäche (330 Dollar) ist ein günstiger Einsteigspreis, da die nächste Inflationswelle mit Sicherheit kommt. Schliesslich kostet der Krieg viel viel Geld.
Wieweit die Aktienkrise in Japan bereits fortgeschritten ist, zeigt der in einer einberufenen Krisensitzung der Bank of Japan in Tokio beschlossene Aktienkauf von 24 Milliarden Euro aus dem Beteiligungsbesitz finanziell angeschlagener Banken. Es steht sehr schlecht um das Bankensystem in Japan, und ein Kollaps würde mit Sicherheit Rückwirkungen auf das gesamte internationale Bankensystem haben.
Roland Leuschel
27.03.2003
Roland Leuschel
Das Universum und die Dummheit der Menschen
Auch die Leser der boerse.de Kolumnen dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die Augen, Ohren und Nasen voll haben mit Bildern der Fernsehkanäle, auf denen geschossen und gebombt wird, auf denen explodierende Raketen und schreiende Kinder zu sehen sind, von Experten die eine Erfolgsmeldung nach der anderen geben und uns die Kriegstaktiken erklären, und wir sind erstaunt, dass anscheinend die ganze Welt von Nahost-Militärexperten wimmelt. Die TV-Zuschauer dürften aber vor allem die Nase voll haben von dem Gestank, den all die Lügen verbreiten, die auf uns einprasseln. Einer der wenigen Augenblicke der Wahrheit : Im ZDF wurde der wohl bekannteste Nahost-Spezialist, Peter Scholl-Latour, gefragt, wie er erklären kann, dass die Amerikaner wohl tatsächlich daran geglaubt hatten, sie würden bei den Schijten in Basra willkommen sein, nachdem sie vor 12 Jahren von den Amerikanern im Stich gelassen worden waren ? Scholl-Latour antwortete : « Die Dummheit der Menschen kennt keine Grenzen. » Eine klare und präzise Antwort, sie erinnert an einen Ausspruch eines der intelligentesten Wesen, das die Menschheit hervorgebracht hat, Albert Einstein, der sagte : « Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschheit, wobei das erste noch nicht endgültig bewiesen ist. » Diese Antwort hätte Albert Einstein auch heute gegeben, wenn jemand ihn nach dem Sinn und der Berechtigung dieses Krieges gefragt hätte.
Die Aktienbörsen haben am 12. März dieses Jahres einen neuen Tiefstpunkt erreicht (Dax 2.198), und als der Kriegsbeginn für jeden Anleger sichtbar wurde, setzte eine allgemeine Kursrallye ein, da die « Unsicherheit aus dem Markt war » (auch hier scheinen Einsteins Worte zu gelten). Ich würde sagen, mit Kriegsbeginn entstanden enorm viele neue Unsicherheiten, die auch die Wirtschaft und damit die Börsen belasten werden. Viele Experten sahen in der fulminanten Börsenerholung (in einer Woche stiegen Dax um 23%, Dow Jones um 9% etc.), bereits das Ende der dreijährigen Baisseperiode und animierten die Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Daueroptimist Heiko Thieme schrieb in der FAZ vom 24.3. : « Eine solche achttätige Rekordsträhne ohne Unterbrechung hat es in der fast 107 Jahre alten Geschichte des Dow Jones bisher noch nie gebeben. »… und er las den Realisten unter den Experten die Leviten : « Die jüngste Entwicklung hat die Pessimisten, die drei Jahre lang die Oberhand hielten, in ihre Schranken verwiesen. », gerade Heiko Thieme, der den Anlegern und der Börsenwelt bewiesen hat, wohin blinder Daueroptimismus bei Aktien führen kann. Still und leise hat er seinen in Luxemburg aufgelegten Fonds, den Thieme Fonds International, geschlossen. Er war im vergangenen Jahr der schlechteste globale Aktienfonds. « Heiko Thieme gilt in Branchenkreisen als einer der schlechtesten Fondsmanager der USA. 2002 verlor sein Fonds fast 70%. Das ist doppelt so viel wie der MSCI World. », so der Originalton von BoerseOnline Nr : 12/2003.
Auch eine der grössten amerikanischen Investmentbanken, Morgan Stanley, trompetete mit Vehemenz ins optimistische Horn : « Der Beginn der Kampfhandlungen hat die zuvor verzeichnete Ungewissheit über die Entwicklung des Irak-Konflikts beseitigt. Die Risikoscheu der Anleger sinkt, und der Ölpreis fällt. » Nach dem eigenen MS-Modell sollte das Kursniveau in Europa noch um weitere 20% steigen, auch wenn die Rendite von Staatsanleihen im Euroraum auf 4,75 anziehen sollte. Ich könnte die Liste der Techniker und Volkswirte weiterführen, die in ihrer ersten Etappe eine Erholung des Daxes bis mindestens 3.500 erwarten (gegenüber dem Tiefstpunkt vom 12.03 wären das immerhin +60% !).
Ich schlage vor, in solch unsicheren Zeiten sollte der Anleger sich an einige fundamentale Fakten halten und versuchen mit Hilfe seines gesunden Menschenverstandes eine Anlagepolitik zu finden, die sein Kapital erhält, und wenn er etwas Glück hat, um 4 bis 6% per annum erhöht. Die Fakten :
Weltweit wurden seit dem Frühjahr 2000 Aktienvermögen von über 12.000 Milliarden Dollar vernichtet (entspricht einem Drittel des augenblicklichen, weltweiten Jahres-Bruttosozialproduktes). Wir haben die grösste Aktienbaisse erlebt, seitdem es Aktien gibt, und sie ist mittlerweile auch die Längste, sie dauerte 36 Monate, gegenüber 34 Monaten in den Jahren 1929 bis 1932. Wer glaubt, eine derartige Kapitalvernichtung hätte keine realwirtschaftlichen Folgen, der irrt gewaltig, zumal aufgrund der Medien und der Banken die Aktienanlage in den 90er Jahren als die rentabelste Anlageinvestition überhaupt angepriesen wurde, und die Anleger nicht nur im Privatsektor sondern auch bei Versicherungen und Pensionskassen die Aktienbestände auf nie gekannte Höhen getrieben hatten. Der renommierte amerikanische Broker, Goldman Sachs, fasste in seiner Studie « Lessons from the Boom and Bust » fünf Schlussfolgerungen zusammen, deren vierte heisst : « Börse und Realwirtschaft wirken so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven, selbstverstärkenden Prozessen, als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge. » Sie kennen die von mir in dieser Kolumne schon öfters vertretene Meinung, dass die Weltwirtschaftskrise II droht. Auch Goldman Sachs schreibt, dass diese Börsenbaisse eine Grössenordnung erreicht hat, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft darstellt.
Der Anleger hat in den drei Jahren der Aktienbaisse eine Risikoaversion gegenüber Aktien und im Gegensatz dazu ein völlig fehlendes Risikobewustsein bei Anleihen entwickelt, sodass er jetzt Gefahr läuft, bei einem Rentenmarktcrash ein zweites mal auf die Nase zu fallen, so schreibt der Chefredakteur von BoerseOnline Johannes Scherer in der letzten Ausgabe : « Deshalb schichten Aktienanleger bereits seit Monaten ihr Kapital in Rentenwerte um und kommen jetzt womöglich vom Regen in die Traufe ; denn die Flucht in länger laufende Zinspapiere hat deren Kurse dermassen nach oben gejagt, dass die Blase zu platzen droht. »
Fazit für den Anleger : Die augenblickliche Kurserholung ist eine zeitlich begrenzte (2 bis 3 Wochen ?) in einem Baissemarkt, der noch einige Jahre andauern wird (2000 bis 2012). Wer seine Kauflimite bei Qualitätsaktien im vergangenen Monat gelegt hat, hat diese Aktien bekommen und kann sie mit 20 bis 30% Kursgewinn verkaufen. Er sollte also nach wie vor Trading mit Aktien machen, aber schon heute die nächsten Kaufkurse in den Markt legen. Insgesamt sollte aber der Anteil der Aktien eines Portefeuilles nicht 20 bis 30% überschreiten, der Rest sollte wie gehabt in Triple A Kurzläufern angelegt sein, und vergessen Sie nicht 5 bis 10% in Gold zu legen. Die jetzige Kursschwäche (330 Dollar) ist ein günstiger Einsteigspreis, da die nächste Inflationswelle mit Sicherheit kommt. Schliesslich kostet der Krieg viel viel Geld.
Wieweit die Aktienkrise in Japan bereits fortgeschritten ist, zeigt der in einer einberufenen Krisensitzung der Bank of Japan in Tokio beschlossene Aktienkauf von 24 Milliarden Euro aus dem Beteiligungsbesitz finanziell angeschlagener Banken. Es steht sehr schlecht um das Bankensystem in Japan, und ein Kollaps würde mit Sicherheit Rückwirkungen auf das gesamte internationale Bankensystem haben.
Roland Leuschel
27.03.2003

Geldmenge M3




na - fühlst Du Dich jetzt wieder wohl bei WO ? 

ja niemandweiss 
der server funkt hier immer

der server funkt hier immer

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,242403,00.html
WIEDERAUFBAU À LA RUMSFELD
Das Ausland soll die Zeche zahlen
Donald Rumsfeld hat klare Vorstellungen, wer die für den Wiederaufbau des Iraks notwendigen Milliarden aufbringen soll. Der US-Verteidigunsminister möchte die internationale Gemeinschaft und den Irak selbst zur Kasse bitten, den amerikanische Steuerzahler will er wenn möglich verschonen.
Washington - Bei einer Anhörung vor dem Kongress sagte Rumsfeld: "Wenn es zum Wiederaufbau kommt, werden wir zunächst die Ressourcen der internationalen Gemeinschaft und der irakischen Regierung anzapfen, bevor wir uns an den amerikanischen Steuerzahler wenden." Das Weiße Haus plane unter anderem, eingefrorenes Vermögen des Regimes von Saddam Hussein für den Wiederaufbau zu verwenden.
Für die Zeit nach dem Krieg hat die US-Regierung in ihrer Finanzplanung bisher kaum vorgesorgt. In dem Finanzpaket von 75 Milliarden Dollar, das Präsident George W. Bush beim Kongress beantragt hat, sind lediglich 2,5 Milliarden für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau enthalten. Experten halten diese Summe für viel zu niedrig.
So geht etwa der Yale-Ökonom William Nordhaus davon aus, dass eine funktionsfähige irakische Ölindustrie pro Jahr etwa 25 Milliarden Dollar erwirtschaften könnte. "Das ist nicht viel für Wiederaufbau, Erneuerung der Ölindustrie und Erschließung neuer Ölfelder", so der Wirtschaftswissenschaftler. "Wenn all die Dinge passieren sollen, die die US-Regierung angekündigt hat, also auch Nationbuilding und eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung, dann braucht das Land Hilfe - die Öleinnahmen werden nicht ausreichen."
Unilateraler Krieg, multilateraler Wiederaufbau
Die US-Regierung behauptet indes, der Irak sei in der Lage, sich selbst zu helfen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz behauptet, der Irak könne in zwei bis drei Jahren durch den Export von Erdöl bis zu 100 Milliarden Dollar einnehmen. "Wir haben es hier mit einem Land zu tun, das seinen Wiederaufbau selbst finanzieren kann", so der Politiker.
Wolfowitz` Schätzung erscheint äußerst optimistisch, wenn man berücksichtigt, dass die ohnehin marode irakische Ölindustrie nach dem Krieg Monate brauchen dürfte, bis sie wieder halbwegs funktionsfähig ist. Erst am Donnerstag hatte ein britischer Armeesprecher gesagt, die Ölfelder im Südirak würde nach dem Ende des Kriegs noch gut drei Monate brach liegen.
Rumsfeld sagte vor dem Kongress, der Wiederaufbau werde eine "erhebliche internationale Anstrengung erfordern". Um das notwendige Geld aufzutreiben, will der Chef des Pentagons eine internationale Geberkonferenz einberufen.
Von Thomas Hillenbrand
WIEDERAUFBAU À LA RUMSFELD
Das Ausland soll die Zeche zahlen
Donald Rumsfeld hat klare Vorstellungen, wer die für den Wiederaufbau des Iraks notwendigen Milliarden aufbringen soll. Der US-Verteidigunsminister möchte die internationale Gemeinschaft und den Irak selbst zur Kasse bitten, den amerikanische Steuerzahler will er wenn möglich verschonen.
Washington - Bei einer Anhörung vor dem Kongress sagte Rumsfeld: "Wenn es zum Wiederaufbau kommt, werden wir zunächst die Ressourcen der internationalen Gemeinschaft und der irakischen Regierung anzapfen, bevor wir uns an den amerikanischen Steuerzahler wenden." Das Weiße Haus plane unter anderem, eingefrorenes Vermögen des Regimes von Saddam Hussein für den Wiederaufbau zu verwenden.
Für die Zeit nach dem Krieg hat die US-Regierung in ihrer Finanzplanung bisher kaum vorgesorgt. In dem Finanzpaket von 75 Milliarden Dollar, das Präsident George W. Bush beim Kongress beantragt hat, sind lediglich 2,5 Milliarden für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau enthalten. Experten halten diese Summe für viel zu niedrig.
So geht etwa der Yale-Ökonom William Nordhaus davon aus, dass eine funktionsfähige irakische Ölindustrie pro Jahr etwa 25 Milliarden Dollar erwirtschaften könnte. "Das ist nicht viel für Wiederaufbau, Erneuerung der Ölindustrie und Erschließung neuer Ölfelder", so der Wirtschaftswissenschaftler. "Wenn all die Dinge passieren sollen, die die US-Regierung angekündigt hat, also auch Nationbuilding und eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung, dann braucht das Land Hilfe - die Öleinnahmen werden nicht ausreichen."
Unilateraler Krieg, multilateraler Wiederaufbau
Die US-Regierung behauptet indes, der Irak sei in der Lage, sich selbst zu helfen. Der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz behauptet, der Irak könne in zwei bis drei Jahren durch den Export von Erdöl bis zu 100 Milliarden Dollar einnehmen. "Wir haben es hier mit einem Land zu tun, das seinen Wiederaufbau selbst finanzieren kann", so der Politiker.
Wolfowitz` Schätzung erscheint äußerst optimistisch, wenn man berücksichtigt, dass die ohnehin marode irakische Ölindustrie nach dem Krieg Monate brauchen dürfte, bis sie wieder halbwegs funktionsfähig ist. Erst am Donnerstag hatte ein britischer Armeesprecher gesagt, die Ölfelder im Südirak würde nach dem Ende des Kriegs noch gut drei Monate brach liegen.
Rumsfeld sagte vor dem Kongress, der Wiederaufbau werde eine "erhebliche internationale Anstrengung erfordern". Um das notwendige Geld aufzutreiben, will der Chef des Pentagons eine internationale Geberkonferenz einberufen.
Von Thomas Hillenbrand
moin dolby 
stock channel scheinen "sie" plattgemacht zu haben.

stock channel scheinen "sie" plattgemacht zu haben.

hi optim 
jo SCN wieder

und? was geht?

jo SCN wieder


und? was geht?

gut! 
kommst du zurück oder kommen alle zurück nach wo???

kommst du zurück oder kommen alle zurück nach wo???

ich bleib nun hier ! 

@dolby
ich werde nix mehr pro gold und auch nix mehr
gegen die usa schreiben.
glaube so kann ich mir das schreiben sparen!
viel glück!
ich werde nix mehr pro gold und auch nix mehr
gegen die usa schreiben.
glaube so kann ich mir das schreiben sparen!
viel glück!

bei SCN darfst du alles schreiben, was im disclaimer (oder wie das heisst) steht 

http://www.sueddeutsche.de/index.php?url=/wirtschaft/aktuell…
28.03.2003
Saddams Geld
USA räumen irakische Konten
US-Präsident George Bush bläst zur Jagd auf Saddams Geld. Banken werden zur Herausgabe des sogenannten „blood money“ gezwungen.
Von Marc Hujer
(SZ vom 29.03.03) - Saddam Hussein ist in jedem Fall reich. Wie reich, weiß niemand genau, aber die Schätzungen genügen, um die amerikanischen Geheimdienste in ernste Sorgen zu stürzen.
Saddam Hussein hat jedenfalls ausreichend Geld, um sich wie Osama bin Laden ein bequemes Versteck zu besorgen, eines, das weitgehend sicher vor Spionen der US-Geheimdienste ist.
US-Präsident George W. Bush hat deshalb schon vor Beginn des Krieges die Jagd nach dem Vermögen des irakischen Diktators ausrufen lassen. Unter dem neuen Patriot Act, dem Heimatschutzgesetz, lässt er konsequent Konten sperren, Vermögen konfiszieren und unkooperativen Banken mit Geschäftsentzug drohen.
„Blood money“
Die Jagd nach dem „blood money“, wie er es nennt, nach dem „blutigen Geld“ Saddams, hat begonnen.
Es macht die Geheimdienste keineswegs ruhiger, dass die vergangenen Jahre Saddam Hussein ärmer gemacht haben. Denn was ist schon ärmer, wenn einer einmal zu den reichsten Menschen der Welt zählte?
1991, als der erste Golfkrieg begann, wurde sein Vermögen auf zehn Milliarden Dollar geschätzt. Inzwischen hat es aufgrund von Kontosperrungen und Wirtschaftssanktionen gegen den Irak um ein paar Milliarden Dollar abgenommen.
Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes kommt mit einer vorsichtigen Schätzung auf zwei Milliarden Dollar, aber das US-Außenministerium geht immer noch von einem Vermögen von sieben Milliarden Dollar aus.
„Saddams Versicherungspolitik“
„Geld ist ganz wichtig für Saddam“, sagt Jerrold Post, ein früherer CIA-Mitarbeiter, „es ist ein Mittel, um zu manipulieren und Macht auszuüben, aber es ist auch Saddams Versicherungspolitik“.
In den Vereinigten Staaten ist seit dem 11. September fast alles erlaubt. Und alles, was erlaubt ist, wird auch getan. Erst zweimal in der Geschichte griff die Regierung so hart durch wie jetzt und konfiszierte Vermögen: Einmal im Zweiten Weltkrieg und zuletzt 1996, als sie kubanische Konten plünderte, um die Castro-Regierung für abgestürzte Piloten zahlen zu lassen.
Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 ist es der Regierung nach dem Heimatschutzgesetz sogar erlaubt, auch ausländische Banken zur Kooperation zu zwingen.
Laut Gesetz kann die Regierung den Instituten das Geschäft in den USA verbieten, sollten sie sich weigern, bei der Jagd nach dem „blutigen Geld“ mitzumachen.
Überweisung nach kurzem Zögern
Die Schweizer Bank UBS erklärte sich nur nach kurzem Zögern bereit, die seit 1990 eingefrorenen Vermögen von Irakis an die USA zu überweisen.
In den Vereinigten Staaten haben 17 Banken die irakischen Konten freigegeben, unter ihnen die großen Institute wie die Citigroup und die Bank of America, aber auch Töchter ausländischer Banken wie die der Deutschen Bank, der Arab Banking Corporation und der Commercial Bank of Kuwait.
Nach einer kuwaitischen Studie befindet sich ein großer Teil des Vermögens außerhalb der USA in der ganzen Welt verteilt, meist als gut getarnte Investitionen.
Aber selbst an die Vermögen, die offen liegen, ist nicht immer leicht heranzukommen. Das französische Verlagshaus Hachette, das unter anderem das bekannte Frauenmagazin Elle verlegt, ist zu 8,4 Prozent in irakischer Hand. Die UN-Sanktionen sehen bisher lediglich vor, dass irakische Unternehmensbeteiligungen nicht mit den üblichen Stimmrechten verbunden sind und keine Dividenden ausgezahlt werden.
Illegale Kommissionen
Bis vor kurzem noch waren die Vereinigten Staaten die wichtigste Einnahmequelle Saddam Husseins. Nach Schätzungen des Rechnungshofes des US-Kongresses nutzte Saddam das Oil-for-Food-Programm der Vereinten Nationen, um illegale Kommissionen von bis zu 6,6 Milliarden Dollar abzuzweigen.
Dabei schaltete Saddam die UN-Kontrolle aus, indem er irakisches Öl unterhalb des Marktpreises anbot. Der Preis musste zwar von der UN genehmigt werden, Saddam aber suchte sich für seine Geschäfte weniger bekannte Broker aus, die ihm als Gegenleistung für den günstigen Preis heimlich eine Kommission auf eines seiner Konten überwiesen.
Diese Broker verkauften das Öl schließlich an etablierte Konzerne weiter, vor allem an welche in den Vereinigten Staaten. Zuletzt waren die USA mit 75 Prozent der größte Ölkunde des Irak.
Das Geld hätte Bush nun gerne zurück, nicht nur um Saddams Vermögen zu schmälern, sondern auch um vor weiteren Haushaltsproblemen verschont zu bleiben.
Die 74,7 Milliarden Dollar, die er als Kriegskosten veranschlagt hat, gelten bei Experten nur als eine Anzahlung für ein eigentlich viel teureres Unterfangen.
„Da draußen gibt es eine Menge Geld“
Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz erklärte im Februar vor dem Kongress, das Geld, das man finde, werde in den Wiederaufbau gesteckt und verringere die Kosten für die Vereinigten Staaten. Anzunehmen, die Vereinigten Staaten würden die gesamten Kriegskosten allein bezahlen, sei schlichtweg falsch, denn „da draußen gibt es eine Menge Geld zu holen“.
28.03.2003
Saddams Geld
USA räumen irakische Konten
US-Präsident George Bush bläst zur Jagd auf Saddams Geld. Banken werden zur Herausgabe des sogenannten „blood money“ gezwungen.
Von Marc Hujer
(SZ vom 29.03.03) - Saddam Hussein ist in jedem Fall reich. Wie reich, weiß niemand genau, aber die Schätzungen genügen, um die amerikanischen Geheimdienste in ernste Sorgen zu stürzen.
Saddam Hussein hat jedenfalls ausreichend Geld, um sich wie Osama bin Laden ein bequemes Versteck zu besorgen, eines, das weitgehend sicher vor Spionen der US-Geheimdienste ist.
US-Präsident George W. Bush hat deshalb schon vor Beginn des Krieges die Jagd nach dem Vermögen des irakischen Diktators ausrufen lassen. Unter dem neuen Patriot Act, dem Heimatschutzgesetz, lässt er konsequent Konten sperren, Vermögen konfiszieren und unkooperativen Banken mit Geschäftsentzug drohen.
„Blood money“
Die Jagd nach dem „blood money“, wie er es nennt, nach dem „blutigen Geld“ Saddams, hat begonnen.
Es macht die Geheimdienste keineswegs ruhiger, dass die vergangenen Jahre Saddam Hussein ärmer gemacht haben. Denn was ist schon ärmer, wenn einer einmal zu den reichsten Menschen der Welt zählte?
1991, als der erste Golfkrieg begann, wurde sein Vermögen auf zehn Milliarden Dollar geschätzt. Inzwischen hat es aufgrund von Kontosperrungen und Wirtschaftssanktionen gegen den Irak um ein paar Milliarden Dollar abgenommen.
Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes kommt mit einer vorsichtigen Schätzung auf zwei Milliarden Dollar, aber das US-Außenministerium geht immer noch von einem Vermögen von sieben Milliarden Dollar aus.
„Saddams Versicherungspolitik“
„Geld ist ganz wichtig für Saddam“, sagt Jerrold Post, ein früherer CIA-Mitarbeiter, „es ist ein Mittel, um zu manipulieren und Macht auszuüben, aber es ist auch Saddams Versicherungspolitik“.
In den Vereinigten Staaten ist seit dem 11. September fast alles erlaubt. Und alles, was erlaubt ist, wird auch getan. Erst zweimal in der Geschichte griff die Regierung so hart durch wie jetzt und konfiszierte Vermögen: Einmal im Zweiten Weltkrieg und zuletzt 1996, als sie kubanische Konten plünderte, um die Castro-Regierung für abgestürzte Piloten zahlen zu lassen.
Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 ist es der Regierung nach dem Heimatschutzgesetz sogar erlaubt, auch ausländische Banken zur Kooperation zu zwingen.
Laut Gesetz kann die Regierung den Instituten das Geschäft in den USA verbieten, sollten sie sich weigern, bei der Jagd nach dem „blutigen Geld“ mitzumachen.
Überweisung nach kurzem Zögern
Die Schweizer Bank UBS erklärte sich nur nach kurzem Zögern bereit, die seit 1990 eingefrorenen Vermögen von Irakis an die USA zu überweisen.
In den Vereinigten Staaten haben 17 Banken die irakischen Konten freigegeben, unter ihnen die großen Institute wie die Citigroup und die Bank of America, aber auch Töchter ausländischer Banken wie die der Deutschen Bank, der Arab Banking Corporation und der Commercial Bank of Kuwait.
Nach einer kuwaitischen Studie befindet sich ein großer Teil des Vermögens außerhalb der USA in der ganzen Welt verteilt, meist als gut getarnte Investitionen.
Aber selbst an die Vermögen, die offen liegen, ist nicht immer leicht heranzukommen. Das französische Verlagshaus Hachette, das unter anderem das bekannte Frauenmagazin Elle verlegt, ist zu 8,4 Prozent in irakischer Hand. Die UN-Sanktionen sehen bisher lediglich vor, dass irakische Unternehmensbeteiligungen nicht mit den üblichen Stimmrechten verbunden sind und keine Dividenden ausgezahlt werden.
Illegale Kommissionen
Bis vor kurzem noch waren die Vereinigten Staaten die wichtigste Einnahmequelle Saddam Husseins. Nach Schätzungen des Rechnungshofes des US-Kongresses nutzte Saddam das Oil-for-Food-Programm der Vereinten Nationen, um illegale Kommissionen von bis zu 6,6 Milliarden Dollar abzuzweigen.
Dabei schaltete Saddam die UN-Kontrolle aus, indem er irakisches Öl unterhalb des Marktpreises anbot. Der Preis musste zwar von der UN genehmigt werden, Saddam aber suchte sich für seine Geschäfte weniger bekannte Broker aus, die ihm als Gegenleistung für den günstigen Preis heimlich eine Kommission auf eines seiner Konten überwiesen.
Diese Broker verkauften das Öl schließlich an etablierte Konzerne weiter, vor allem an welche in den Vereinigten Staaten. Zuletzt waren die USA mit 75 Prozent der größte Ölkunde des Irak.
Das Geld hätte Bush nun gerne zurück, nicht nur um Saddams Vermögen zu schmälern, sondern auch um vor weiteren Haushaltsproblemen verschont zu bleiben.
Die 74,7 Milliarden Dollar, die er als Kriegskosten veranschlagt hat, gelten bei Experten nur als eine Anzahlung für ein eigentlich viel teureres Unterfangen.
„Da draußen gibt es eine Menge Geld“
Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz erklärte im Februar vor dem Kongress, das Geld, das man finde, werde in den Wiederaufbau gesteckt und verringere die Kosten für die Vereinigten Staaten. Anzunehmen, die Vereinigten Staaten würden die gesamten Kriegskosten allein bezahlen, sei schlichtweg falsch, denn „da draußen gibt es eine Menge Geld zu holen“.
@dolby
bei WO war ich früher öfter gesperrt als mir lieb war.
im augenblick scheint man hier alle schreiben zu dürfen.
pass auf!
alles bleibt gut!
bei WO war ich früher öfter gesperrt als mir lieb war.
im augenblick scheint man hier alle schreiben zu dürfen.
pass auf!
alles bleibt gut!

Hajo, so isch des ! 

@dolby
komm zum nächsten stock treffen im juni oder so.
wird sicherlich kein fehler sein!
komm zum nächsten stock treffen im juni oder so.
wird sicherlich kein fehler sein!

endlich kommste wieder 

ach so 
ich soll kommen.

ich soll kommen.

@dolby
jo.
1 mal quatschen o. big brother!
hoffe ich doch!
jo.

1 mal quatschen o. big brother!
hoffe ich doch!

@dolby
10 min für ne antwort?
datt wars dann wohl mit dem treffen.
viel glück und N 8
10 min für ne antwort?
datt wars dann wohl mit dem treffen.
viel glück und N 8

sorry 
ich surf noch wo anders

ich surf noch wo anders

@dolby
und, haste die weiber für heute nacht schon klar gemacht??
schau einfach vorbei!
am besten mit nem carrera und nicht mit dem wo.
immer schneller als der feind!
und, haste die weiber für heute nacht schon klar gemacht??

schau einfach vorbei!

am besten mit nem carrera und nicht mit dem wo.
immer schneller als der feind!




Hallo Dolby 
Alles sauber bei AOL ... ooops , was ist mit diese $400 Mill ...
...
AOL Time Warner indicates more financial restatement may be ahead
Friday March 28, 5:31 pm ET
By Lisa Singhania, AP Business Writer
NEW YORK (AP) -- AOL Time Warner Inc. indicated Friday that it might have to restate its financial results as much as another $400 million because of accounting improprieties at its America Online division.
According to papers filed with the Securities and Exchange Commission, the SEC has notified the media company that it believes that two transactions involving America Online and Bertelsmann AG were accounted for improperly. Those transactions involve the dispensation of Bertelsmann`s stake in AOL Europe.
The company responded in the filing that it believes the deal was done correctly, and is "engaged in ongoing discussions" with the SEC.
Such a restatement would be on top of the $190 million adjustment the company announced in October because of incorrect accounting practices at the online division.


Alles sauber bei AOL ... ooops , was ist mit diese $400 Mill
 ...
...AOL Time Warner indicates more financial restatement may be ahead
Friday March 28, 5:31 pm ET
By Lisa Singhania, AP Business Writer
NEW YORK (AP) -- AOL Time Warner Inc. indicated Friday that it might have to restate its financial results as much as another $400 million because of accounting improprieties at its America Online division.
According to papers filed with the Securities and Exchange Commission, the SEC has notified the media company that it believes that two transactions involving America Online and Bertelsmann AG were accounted for improperly. Those transactions involve the dispensation of Bertelsmann`s stake in AOL Europe.
The company responded in the filing that it believes the deal was done correctly, and is "engaged in ongoing discussions" with the SEC.
Such a restatement would be on top of the $190 million adjustment the company announced in October because of incorrect accounting practices at the online division.

jetzt kommt Mr. Duden auch noch 

was sagst du zu MO vetinari?
strong auf 20 dollar runter
strong auf 20 dollar runter

moin vetinari 
deine kaufkurse sind langsam erschreckend!

deine kaufkurse sind langsam erschreckend!

MO  ... frage Nasi10K
... frage Nasi10K 

S&P billig ... alle rein
S&P Price Earnings Ratio At 34.97, Down From 35.18
Friday March 28, 4:59 pm ET
NEW YORK -(Dow Jones)- The price/earnings ratio of the Standard & Poor`s 500 index at the close of trading Friday was 34.97. On Thursday, the ratio was 35.18.
Over the past 12 months, the price/earnings ratio has ranged from a low of 31.46 on Oct. 9 to a high of 46.99 on March 19, 2001.
The price/earnings ratio for the S&P 500 measures the index`s closing average divided by the index`s total earnings, as reported under generally accepted accounting principles for the most recent year.
In 2001, the most recently reported year, the S&P 500 companies reported total earnings of $24.69 a share.
S&P KGV 35 ... am boden sollte es bei 8 liegen
... am boden sollte es bei 8 liegen 
 ... frage Nasi10K
... frage Nasi10K 

S&P billig ... alle rein

S&P Price Earnings Ratio At 34.97, Down From 35.18
Friday March 28, 4:59 pm ET
NEW YORK -(Dow Jones)- The price/earnings ratio of the Standard & Poor`s 500 index at the close of trading Friday was 34.97. On Thursday, the ratio was 35.18.
Over the past 12 months, the price/earnings ratio has ranged from a low of 31.46 on Oct. 9 to a high of 46.99 on March 19, 2001.
The price/earnings ratio for the S&P 500 measures the index`s closing average divided by the index`s total earnings, as reported under generally accepted accounting principles for the most recent year.
In 2001, the most recently reported year, the S&P 500 companies reported total earnings of $24.69 a share.
S&P KGV 35
 ... am boden sollte es bei 8 liegen
... am boden sollte es bei 8 liegen 
kgv von 35 wäre in ordnung, wenns mal gewinne geben würde 

.... frage Nasi10K
der sagt immer kaufen !
der sagt immer kaufen !

@dolby
wer ist na 10000???
wer ist na 10000???


Gute Nacht 

@dolby
na ja, nen na 10000 kann es wohl nicht geben.
mit dem nik würde er ja zugeben, daß er sich
verdammt verzockt hat!
na ja, nen na 10000 kann es wohl nicht geben.
mit dem nik würde er ja zugeben, daß er sich
verdammt verzockt hat!

28/03/2003 12:40
US-Patrioten ziehen gegen deutsche Produkte zu Felde
- von Peter Wübben -
Frankfurt, 28. Mär (Reuters) - Mit markigen Sprüchen, viel
Polemik und teilweise offenem Hass ziehen derzeit einige
Amerikaner gegen deutsche Firmen und Produkte zu Felde.
Vor allem im Internet wird in den USA zum Boykott deutscher
und französischer Waren aufgerufen, da die Regierungen beider
Länder sich nicht am Krieg gegen den Irak beteiligen. Doch - ob
Porsche, Adidas, Nivea oder Beck`s Bier: Die Hersteller typisch
deutscher Exportartikel spüren nach eigenen Angaben bisher keine
Ablehnung durch die amerikanischen Verbraucher.
"AMERIKANISCHE ANTWORT AUF ACHSE DER WIESEL"
Als "Amerikanische Antwort auf die Achse der Wiesel" wird
auf der Internetseite "GermanyStinks" ("Deutschland stinkt" )
geraten, keine deutschen Autos mehr zu fahren und französischen
Wein zu meiden. In Amerika werden Petzen oder Verräter als
Wiesel bezeichnet, und das Wortspiel "Axis of Weasels" zielt auf
den deutsch-französischen Widerstand gegen den Irak-Krieg ab,
nachdem die US-Regierung die Länder Irak, Iran und Nordkorea
"Achse des Bösen" nannte. Ultrakonservative Verbände wie
"Citizens United" oder patriotische Medien wie das Online-Blatt
"NewsMax" werfen Deutschen und Franzosen unter Verweis auf die
US-Hilfen nach dem Zweiten Weltkrieg Undankbarkeit vor, da sie
sich nun nicht am Feldzug gegen Saddam Hussein beteiligen. "Als
Amerikaner sollten wir den Deutschen und Franzosen ihre
Illoyalität mit dem Boykott ihrer Waren heimzahlen", heißt es.
Auch einige US-Politiker tun sich mit Forderungen wie etwa
nach der Umbenennung von "French Fries" in "Freedom Fries"
(Freiheitsfritten) hervor. Und angeblich überprüft das
US-Verteidigungsministerium derzeit, ob es für seinen Anstrich
weiterhin die Farbe eines deutschen Herstellers oder doch lieber
ein amerikanisches Produkt verwenden soll. "Das ist nur Show",
meint der Präsident der amerikanischen Handelskammer in
Deutschland (AmCham), Fred Irwin. Etwas kritischer sieht es der
Bundesverband des deutschen Groß- und Außenhandels (BGA): "Das
Thema Boykott ist ernst zu nehmen, aber mit Sicherheit bisher
noch nicht wirklich störend", urteilte BGA-Chef Anton Börner.
Immerhin geht es bei den deutsch-amerikanischen
Handelsbeziehungen um ein gigantisches Geschäft: Auf rund 67
Milliarden Euro beliefen sich vergangenes Jahr die deutschen
Ausfuhren nach Amerika, während die US-Importe knapp 40
Milliarden Euro betrugen. Insofern warnen Branchenverbände auch
zusehends vor einer schädlichen Eintrübung der transatlantischen
Wirtschaftsbeziehungen. "Das Umfeld ist schwieriger geworden für
die Verhandlungen, das Klima ist gestört", so BGA-Chef Börner.
"KUNDEN KÖNNEN DIFFERENZIEREN"
Wie die Aufrufe in Deutschland zum Boykott amerikanischer
sind die Kampagnen in den USA gegen deutsche Waren und Firmen
jedoch wohl eher nur Randerscheinungen: "Wir spüren keine
Absatzschwierigkeiten auf Grund des angespannten
deutsch-amerikanischen Verhältnisses", sagte ein Sprecher des
Sportwagenherstellers Porsche [POR3.GER] . "Unsere Kunden in
Amerika wissen in dieser Sache grundsätzlich zu unterscheiden."
Ähnliches war bei BMW [BMW.GER] zu vernehmen: "Noch am Wochenende
hatten wir einen hervorragenden Besuch unserer Show-Rooms in den
USA", betonte eine Sprecherin des Münchener Autobauers.
Auch bei Hugo Boss oder Adidas-Salomon - deren Namen auf den
Boykott-Listen ebenso auftauchen wie Haribo, Lufthansa, Tchibo,
Rodenstock, Ferrero, Bertelsmann, Steiff, Birkenstock, Osram,
Solingen-Messer, Deutsche Bank oder Aldi - hat man bisher nicht
vernommen, in den USA gemieden zu werden. Branchenbeobachter
nehmen das Thema Boykott gar nicht erst ernst: "Ich würde sagen,
dass die ganze Sache in Deutschland aufgebauscht wird", urteilt
Analyst Roger Entner von der Bostoner Yankee Group, der auch die
Telekom-Tochter [DTE.GER] T-Mobile betreut. "Die meisten Leute
hier interessiert die Sache eigentlich nicht so sehr."
KEIN NACHHALTIGER SCHADEN FÜR "MADE IN GERMANY"
Einen nachhaltigen Schaden für Produkte "Made in Germany"
ist indes nicht unbedingt zu erwarten. "In ein paar Wochen kann
sich das legen", glaubt Nik Stucky von der Marketing-Firma
Interbrand in Zürich. "Eine Marke ist ein stabiler Wert. Den
können Sie nicht opportunistisch oder kurzfristig dem Zeitgeist
gemäß ändern." Wenn sich ein Produkt stark an die nationale
Herkunft lehne, bestehe zwar immer die Gefahr, dass es "unter
Beschuss" gerate, wenn das Land in der Kritik stehe. "Aber sie
haben ja eben auch die Vorteile", sagt Stucky. "Die deutschen
Marken sind immer gut gefahren mit ihrem Image."
Bei vielen deutsche Produkten scheint die nationale Herkunft
indes gar nicht bekannt: "Es ist in der Regel so, dass jeder in
den einzelnen Ländern denkt, dass das eine nationale Marke ist",
sagte ein Sprecher des Nivea-Herstellers Beiersdorf [BEI.GER] .
Ähnliches gilt für Adidas: "Wir werden als globale Marke
gesehen, so dass wir momentan keine negativen Effekte merken."
Andersherum taucht ein Produkt auf den Boykott-Listen immer
wieder auf, das hierzulande kaum jemand kennt: "St. Paul
Girl"-Bier aus dem Hause Beck`s. Die Brauerei ist allerdings
mittlerweile belgisch. In die falsche Richtung geht wohl auch
der Boykott von Shampoos der Wella AG: Der Konzern wurde jüngst
vom US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble geschluckt.
pew/wes
--------------
Man kann ja Autos aus Deutschland nicht mit den Amischlitten vergleichen!
Und das was die Amis sich da so unter dem Begriff "Essen" reinschieben, ist doch grad für´n Arsch

US-Patrioten ziehen gegen deutsche Produkte zu Felde
- von Peter Wübben -
Frankfurt, 28. Mär (Reuters) - Mit markigen Sprüchen, viel
Polemik und teilweise offenem Hass ziehen derzeit einige
Amerikaner gegen deutsche Firmen und Produkte zu Felde.
Vor allem im Internet wird in den USA zum Boykott deutscher
und französischer Waren aufgerufen, da die Regierungen beider
Länder sich nicht am Krieg gegen den Irak beteiligen. Doch - ob
Porsche, Adidas, Nivea oder Beck`s Bier: Die Hersteller typisch
deutscher Exportartikel spüren nach eigenen Angaben bisher keine
Ablehnung durch die amerikanischen Verbraucher.
"AMERIKANISCHE ANTWORT AUF ACHSE DER WIESEL"
Als "Amerikanische Antwort auf die Achse der Wiesel" wird
auf der Internetseite "GermanyStinks" ("Deutschland stinkt" )
geraten, keine deutschen Autos mehr zu fahren und französischen
Wein zu meiden. In Amerika werden Petzen oder Verräter als
Wiesel bezeichnet, und das Wortspiel "Axis of Weasels" zielt auf
den deutsch-französischen Widerstand gegen den Irak-Krieg ab,
nachdem die US-Regierung die Länder Irak, Iran und Nordkorea
"Achse des Bösen" nannte. Ultrakonservative Verbände wie
"Citizens United" oder patriotische Medien wie das Online-Blatt
"NewsMax" werfen Deutschen und Franzosen unter Verweis auf die
US-Hilfen nach dem Zweiten Weltkrieg Undankbarkeit vor, da sie
sich nun nicht am Feldzug gegen Saddam Hussein beteiligen. "Als
Amerikaner sollten wir den Deutschen und Franzosen ihre
Illoyalität mit dem Boykott ihrer Waren heimzahlen", heißt es.
Auch einige US-Politiker tun sich mit Forderungen wie etwa
nach der Umbenennung von "French Fries" in "Freedom Fries"
(Freiheitsfritten) hervor. Und angeblich überprüft das
US-Verteidigungsministerium derzeit, ob es für seinen Anstrich
weiterhin die Farbe eines deutschen Herstellers oder doch lieber
ein amerikanisches Produkt verwenden soll. "Das ist nur Show",
meint der Präsident der amerikanischen Handelskammer in
Deutschland (AmCham), Fred Irwin. Etwas kritischer sieht es der
Bundesverband des deutschen Groß- und Außenhandels (BGA): "Das
Thema Boykott ist ernst zu nehmen, aber mit Sicherheit bisher
noch nicht wirklich störend", urteilte BGA-Chef Anton Börner.
Immerhin geht es bei den deutsch-amerikanischen
Handelsbeziehungen um ein gigantisches Geschäft: Auf rund 67
Milliarden Euro beliefen sich vergangenes Jahr die deutschen
Ausfuhren nach Amerika, während die US-Importe knapp 40
Milliarden Euro betrugen. Insofern warnen Branchenverbände auch
zusehends vor einer schädlichen Eintrübung der transatlantischen
Wirtschaftsbeziehungen. "Das Umfeld ist schwieriger geworden für
die Verhandlungen, das Klima ist gestört", so BGA-Chef Börner.
"KUNDEN KÖNNEN DIFFERENZIEREN"
Wie die Aufrufe in Deutschland zum Boykott amerikanischer
sind die Kampagnen in den USA gegen deutsche Waren und Firmen
jedoch wohl eher nur Randerscheinungen: "Wir spüren keine
Absatzschwierigkeiten auf Grund des angespannten
deutsch-amerikanischen Verhältnisses", sagte ein Sprecher des
Sportwagenherstellers Porsche [POR3.GER] . "Unsere Kunden in
Amerika wissen in dieser Sache grundsätzlich zu unterscheiden."
Ähnliches war bei BMW [BMW.GER] zu vernehmen: "Noch am Wochenende
hatten wir einen hervorragenden Besuch unserer Show-Rooms in den
USA", betonte eine Sprecherin des Münchener Autobauers.
Auch bei Hugo Boss oder Adidas-Salomon - deren Namen auf den
Boykott-Listen ebenso auftauchen wie Haribo, Lufthansa, Tchibo,
Rodenstock, Ferrero, Bertelsmann, Steiff, Birkenstock, Osram,
Solingen-Messer, Deutsche Bank oder Aldi - hat man bisher nicht
vernommen, in den USA gemieden zu werden. Branchenbeobachter
nehmen das Thema Boykott gar nicht erst ernst: "Ich würde sagen,
dass die ganze Sache in Deutschland aufgebauscht wird", urteilt
Analyst Roger Entner von der Bostoner Yankee Group, der auch die
Telekom-Tochter [DTE.GER] T-Mobile betreut. "Die meisten Leute
hier interessiert die Sache eigentlich nicht so sehr."
KEIN NACHHALTIGER SCHADEN FÜR "MADE IN GERMANY"
Einen nachhaltigen Schaden für Produkte "Made in Germany"
ist indes nicht unbedingt zu erwarten. "In ein paar Wochen kann
sich das legen", glaubt Nik Stucky von der Marketing-Firma
Interbrand in Zürich. "Eine Marke ist ein stabiler Wert. Den
können Sie nicht opportunistisch oder kurzfristig dem Zeitgeist
gemäß ändern." Wenn sich ein Produkt stark an die nationale
Herkunft lehne, bestehe zwar immer die Gefahr, dass es "unter
Beschuss" gerate, wenn das Land in der Kritik stehe. "Aber sie
haben ja eben auch die Vorteile", sagt Stucky. "Die deutschen
Marken sind immer gut gefahren mit ihrem Image."
Bei vielen deutsche Produkten scheint die nationale Herkunft
indes gar nicht bekannt: "Es ist in der Regel so, dass jeder in
den einzelnen Ländern denkt, dass das eine nationale Marke ist",
sagte ein Sprecher des Nivea-Herstellers Beiersdorf [BEI.GER] .
Ähnliches gilt für Adidas: "Wir werden als globale Marke
gesehen, so dass wir momentan keine negativen Effekte merken."
Andersherum taucht ein Produkt auf den Boykott-Listen immer
wieder auf, das hierzulande kaum jemand kennt: "St. Paul
Girl"-Bier aus dem Hause Beck`s. Die Brauerei ist allerdings
mittlerweile belgisch. In die falsche Richtung geht wohl auch
der Boykott von Shampoos der Wella AG: Der Konzern wurde jüngst
vom US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble geschluckt.
pew/wes
--------------
Man kann ja Autos aus Deutschland nicht mit den Amischlitten vergleichen!
Und das was die Amis sich da so unter dem Begriff "Essen" reinschieben, ist doch grad für´n Arsch

@ Dolby Digital 5.1
absolut lächerlich das ganze hier. Und was hast du gelacht/gehetzt über WO bei SCN. Aber je nachdem ... dreht man den Mantel halt nach dem Wind. Solange du deinem Threadtitel noch treu bleibst

absolut lächerlich das ganze hier. Und was hast du gelacht/gehetzt über WO bei SCN. Aber je nachdem ... dreht man den Mantel halt nach dem Wind. Solange du deinem Threadtitel noch treu bleibst


lese die postings von gestern abend mit optim, dann sollteste im bilde sein 

p.s.
das ist ein archiv-thread.
ich brauche also hin und wieder die komplettansicht.
das ging bei scn ne weile, wurde dann aber abgeschaltet.
seit monaten wird man hingehalten und schlussendlich verarscht.
nicht mit mir
das ist ein archiv-thread.
ich brauche also hin und wieder die komplettansicht.
das ging bei scn ne weile, wurde dann aber abgeschaltet.
seit monaten wird man hingehalten und schlussendlich verarscht.
nicht mit mir

p.p.s
das sind doch nur boards und keine religiösen weltanschauchungen


das sind doch nur boards und keine religiösen weltanschauchungen



SOLDATENLOHN
Für 1064,70 Dollar in die Wüste
Im Irak kämpfen die amerikanischen Truppen mit widrigsten Bedingungen und einem hartnäckigen Gegner. Wofür? Auf das Geld kann es den GIs nicht ankommen, wie ein Blick auf die Soldlisten des US-Militärs zeigt.
Washington - Der "Private" als unterste Charge im amerikanischen Militärapparat kommt demnach auf ein Bruttomonatsgehalt von 1064,70 Dollar. Das US-Büro für Labour Statistics listet nur noch fünf weitere Berufe auf, die weniger verdienen, darunter Butler und Putzfrauen. Ein General hat immerhin 11.874,90 Dollar in der Lohntüte. Verglichen mit den Gehältern, die in der freien Wirtschaft an der Konzernspitze verteilt werden, fällt diese Summe aber immer noch vergleichsweise lächerlich aus.
Versüßt wird der Truppe das karge Salär durch allerlei Zuschüsse, das in der Regel in den unteren Rängen höher ausfällt als weiter oben. 284 Dollar bekommt ein männlicher Army-Soldat monatlich für Kleidung. Ein Sergeant erhält im Monat einen Essenszuschuss von 263 Dollar. Auf besonders unbeliebte Jobs entfällt ebenfalls ein Bonus. So bekommt ein U-Boot-Fahrer je nach Rang und Dienstzeit bis zu 425 Dollar zusätzlich.



Flüchtlinge schenken hungernden US-Soldaten Lebensmittel
ZENTRAL-IRAK (ag.). Während im Süden des Irak erste westliche Hilfsgüter für die irakische Bevölkerung eintreffen, kamen im Landesinneren mehrere Iraker einer Einheit hungriger US-Soldaten zu Hilfe: Auf ihrer Flucht in den Süden teilten die Iraker großzügig ihre Vorräte mit dem ausgehungerten Trupp, wie US-Unteroffizier Kenneth Wilson berichtete. Frauen hätten den Soldaten aus Bus-Fenstern gekochte Eier und Kartoffeln gereicht. "Das ist eine sehr nette Geste gewesen", sagte US-Soldat Tony Garcia. "Ich glaube, dass uns die örtliche Bevölkerung dankbar ist."
Die Marineinfanteristen waren seit einigen Tagen von ihrem Versorgungstrupp abgeschnitten und mussten ihre Lebensmittel streng rationieren. Zudem hatte die rund 250 Kilometer vor Bagdad liegende Einheit nicht mehr genügend Wasser. Ein US-Militärarzt warnte die Soldaten noch davor, dass die geschenkten Lebensmittel vergiftet sein könnten - aber der Hunger war größer als die Angst: "Oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass ein gekochtes Ei so gut schmecken kann", sagte einer der US-Soldaten.
29.03.2003 Quelle: Online-Presse
-----------
Und daheim nageln die Frauen andere Männer
Für 1064,70 Dollar in die Wüste
Im Irak kämpfen die amerikanischen Truppen mit widrigsten Bedingungen und einem hartnäckigen Gegner. Wofür? Auf das Geld kann es den GIs nicht ankommen, wie ein Blick auf die Soldlisten des US-Militärs zeigt.
Washington - Der "Private" als unterste Charge im amerikanischen Militärapparat kommt demnach auf ein Bruttomonatsgehalt von 1064,70 Dollar. Das US-Büro für Labour Statistics listet nur noch fünf weitere Berufe auf, die weniger verdienen, darunter Butler und Putzfrauen. Ein General hat immerhin 11.874,90 Dollar in der Lohntüte. Verglichen mit den Gehältern, die in der freien Wirtschaft an der Konzernspitze verteilt werden, fällt diese Summe aber immer noch vergleichsweise lächerlich aus.
Versüßt wird der Truppe das karge Salär durch allerlei Zuschüsse, das in der Regel in den unteren Rängen höher ausfällt als weiter oben. 284 Dollar bekommt ein männlicher Army-Soldat monatlich für Kleidung. Ein Sergeant erhält im Monat einen Essenszuschuss von 263 Dollar. Auf besonders unbeliebte Jobs entfällt ebenfalls ein Bonus. So bekommt ein U-Boot-Fahrer je nach Rang und Dienstzeit bis zu 425 Dollar zusätzlich.



Flüchtlinge schenken hungernden US-Soldaten Lebensmittel
ZENTRAL-IRAK (ag.). Während im Süden des Irak erste westliche Hilfsgüter für die irakische Bevölkerung eintreffen, kamen im Landesinneren mehrere Iraker einer Einheit hungriger US-Soldaten zu Hilfe: Auf ihrer Flucht in den Süden teilten die Iraker großzügig ihre Vorräte mit dem ausgehungerten Trupp, wie US-Unteroffizier Kenneth Wilson berichtete. Frauen hätten den Soldaten aus Bus-Fenstern gekochte Eier und Kartoffeln gereicht. "Das ist eine sehr nette Geste gewesen", sagte US-Soldat Tony Garcia. "Ich glaube, dass uns die örtliche Bevölkerung dankbar ist."
Die Marineinfanteristen waren seit einigen Tagen von ihrem Versorgungstrupp abgeschnitten und mussten ihre Lebensmittel streng rationieren. Zudem hatte die rund 250 Kilometer vor Bagdad liegende Einheit nicht mehr genügend Wasser. Ein US-Militärarzt warnte die Soldaten noch davor, dass die geschenkten Lebensmittel vergiftet sein könnten - aber der Hunger war größer als die Angst: "Oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass ein gekochtes Ei so gut schmecken kann", sagte einer der US-Soldaten.
29.03.2003 Quelle: Online-Presse
-----------
Und daheim nageln die Frauen andere Männer

12:28pm 03/29/03 NEWSWEEK POLL: BUSH APPROVAL RATING RISES TO 68%
12:27pm 03/29/03 NEWSWEEK: 49% BACK A WAR LASTING MORE THAN A YEAR
12:26pm 03/29/03 NEWSWEEK POLL: 63% SAY IRAQ WAR STARTED AT RIGHT TIME












































































12:27pm 03/29/03 NEWSWEEK: 49% BACK A WAR LASTING MORE THAN A YEAR
12:26pm 03/29/03 NEWSWEEK POLL: 63% SAY IRAQ WAR STARTED AT RIGHT TIME












































































http://www.ftd.de/pw/in/1048931524342.html?nv=cd-divnews
Aus der FTD vom 31.3.2003 www.ftd.de/keese
Kolumne: Amerika verspielt seinen Nimbus
Von Christoph Keese
Der Irak-Krieg dauert erst zehn Tage, doch durch die ständige Fernsehpräsenz erscheint er dem Publikum länger. Großbritanniens Premier Tony Blair hat Recht, wenn er aufzählt, wie viel in diesen wenigen Tagen erreicht wurde, und der Öffentlichkeit vorhält, durch den Medienkonsum ihr Zeitgefühl zu verlieren.
Noch ist es zu früh für eine Prognose über den Ausgang des Konflikts. Die Alliierten haben weder gewonnen noch verloren, Saddam Hussein ist nicht der moralische oder politische Sieger. Der Krieg kann noch Monate, vielleicht Jahre dauern - ebenso gut kann er schon bald vorbei sein. Auch in Afghanistan sah es in den ersten Kriegswochen nach einem Dauerkonflikt aus, dann aber kam der Durchbruch sehr schnell.
Bereits jetzt steht aber fest, dass die Amerikaner mit einem Verlust rechnen müssen: Sie verlieren ihren Nimbus als unbezwingbare Supermacht. Frankreichs ehemaliger Außenminister Hubert Védrine hat die Vereinigten Staaten "Hyperpuissance" genannt, da sie so überwältigend mächtig schienen, dass "Supermacht" als Bezeichnung nicht mehr reichte. Diese Hypermacht reklamierte lange für sich, zwei große, weit voneinander entfernte Kriege gleichzeitig führen zu können. Sie glaubte, ihre überlegene Militärtechnik werde Mann-zu-Mann-Kämpfe unnötig machen.
Wehrmacht als Vorbild
Niemand propagierte diesen Anspruch so laut wie Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Im Mai 2002 empfahl er in einem Grundsatzartikel für "Foreign Affairs" den deutschen Blitzkrieg als militärisches Vorbild: "Deutschlands tödliche Kombination bestand aus schnellen Panzern, motorisierter Infanterie und Artillerie sowie Stukas - alles konzentriert auf einen Abschnitt der gegnerischen Linie. Die Wirkung war vernichtend." Er verwarf die traditionelle Zwei-Kriege-Strategie und gab als Ziel aus, künftig vier kleinere Schauplätze beherrschen zu können. Irak gilt in solchen Szenarien als kleines "theater of war".
Außerdem kündigte er an, die amerikanische Armee auf Blitzkrieg-Taktik umzustellen - nicht ganz, aber zu wichtigen Teilen. Begeistert schilderte er ein Erlebnis vom Frontbesuch in Afghanistan: Seine Special Forces ritten auf Lasteseln hinter die gegnerischen Linien und dirigierten von dort aus US-Bomber ins Ziel. Einzelkämpfer auf dem Boden, Hightech in der Luft, motorisierte Blitzattacken - dieses Szenario wurde später zur Grundlage der Planung für den Irak-Krieg, obgleich der Unterschied zu Hitlers Blitzkrieg auf der Hand liegt. Saddam Hussein verweigert die offene Feldschlacht, deswegen gelten andere Regeln als im Zweiten Weltkrieg.
Für den Beweis seiner Doktrin setzte Rumsfeld den Nimbus der Unbesiegbarkeit aufs Spiel. Nur mühsam ließ er sich vor Kriegsbeginn zusätzliche Truppen abringen. Er hielt sie nicht für nötig. So fiel die Aufstockung allzu klein aus. Rumsfeld will ein weitaus größeres Territorium als Kuwait mit dem Bruchteil der Invasionsarmee von 1991 erobern. Außerdem experimentiert sein Pentagon mit neuen Formen der Kriegsführung. Erstmals liegen die Versorgungslager nicht direkt hinter der Front, sondern Hunderte von Kilometern entfernt in Kuwait. Prompt geriet die Nachschublinie unter Beschuss.
Schwere logistische Fehler
Viele Panzer und Lastwagen fahren wegen Spritmangels auf Reserve, die Lebensmittel der kämpfenden Soldaten sind rationiert. Diese Fehler notdürftig zu beheben, kostet wertvolle Ressourcen: Das US-Heer hat nur etwas mehr als zwei Divisionen im Einsatz. Davon sind drei Brigaden - zahlenmäßig etwa so viel wie eine Division - laut New York Times nur damit beschäftigt, die Verbindung zwischen Kuwait und Nadschaf zu schützen.
Weil Rumsfeld fast jeden denkbaren Partner vergrätzt hat, ist jetzt kaum jemand da, der ihm militärisch helfen kann. Wohl oder übel muss er den Vorstoß auf Bagdad bremsen, bis Verstärkung eintrifft. Das kann Wochen dauern. Vor den Augen der Welt zieht er Truppen von anderen Standorten ab. Dass die USA in der Lage sein könnten, zwei oder gar vier Kriege gleichzeitig zu führen, ist pure Illusion. Fast alle Flugzeugträger liegen vor Irak. Panzer, Lastwagen, Diesel und sogar warme Mahlzeiten gelten plötzlich als Mangelware. Dadurch entsteht ein gefährliches Vakuum: Jeder Staat der Welt weiß, dass sich Washington um nichts anderes kümmern kann als um Saddam. Das ist ein Freibrief für Abenteurer.
Abschreckung ist eine unverzichtbare politische Größe. Sie verhindert Kriege. Je mächtiger ein Hegemon, desto geringer die Bereitschaft seiner Gegner, sich ihm zu widersetzen. Aus Sicht des Mächtigen funktioniert Abschreckung nach dem Muster von Hackordnungskämpfen im Tierreich: Möglichst vielen Konflikten ausweichen, um eigene Kräfte zu schonen. Aggressive Rivalen jedoch müssen souverän besiegt werden, damit das Rudel sieht, wer der Stärkste ist. Alphatiere leben von ihrem Nimbus. Er sichert ihre Stellung und schützt sie vor zu vielen Kämpfen.
Rumsfeld hätte auf Außenminister Colin Powell hören sollen. Als dieser Generalstabschef war, galt die Powell-Doktrin: Angriffe finden nur mit absolut überlegener Streitmacht statt. Es darf nie ein Zweifel an der eigenen Unbesiegbarkeit aufkommen. Egal, wie der Irak-Krieg ausgeht: Die Welt wird nicht vergessen, wie den Amerikanern nach einer Woche die Puste ausgegangen ist und sie dann unter Zeitdruck Nachschub aus allen Ecken zusammenkratzen mussten.
© 2003 Financial Times Deutschland

Aus der FTD vom 31.3.2003 www.ftd.de/keese
Kolumne: Amerika verspielt seinen Nimbus
Von Christoph Keese
Der Irak-Krieg dauert erst zehn Tage, doch durch die ständige Fernsehpräsenz erscheint er dem Publikum länger. Großbritanniens Premier Tony Blair hat Recht, wenn er aufzählt, wie viel in diesen wenigen Tagen erreicht wurde, und der Öffentlichkeit vorhält, durch den Medienkonsum ihr Zeitgefühl zu verlieren.
Noch ist es zu früh für eine Prognose über den Ausgang des Konflikts. Die Alliierten haben weder gewonnen noch verloren, Saddam Hussein ist nicht der moralische oder politische Sieger. Der Krieg kann noch Monate, vielleicht Jahre dauern - ebenso gut kann er schon bald vorbei sein. Auch in Afghanistan sah es in den ersten Kriegswochen nach einem Dauerkonflikt aus, dann aber kam der Durchbruch sehr schnell.
Bereits jetzt steht aber fest, dass die Amerikaner mit einem Verlust rechnen müssen: Sie verlieren ihren Nimbus als unbezwingbare Supermacht. Frankreichs ehemaliger Außenminister Hubert Védrine hat die Vereinigten Staaten "Hyperpuissance" genannt, da sie so überwältigend mächtig schienen, dass "Supermacht" als Bezeichnung nicht mehr reichte. Diese Hypermacht reklamierte lange für sich, zwei große, weit voneinander entfernte Kriege gleichzeitig führen zu können. Sie glaubte, ihre überlegene Militärtechnik werde Mann-zu-Mann-Kämpfe unnötig machen.
Wehrmacht als Vorbild
Niemand propagierte diesen Anspruch so laut wie Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Im Mai 2002 empfahl er in einem Grundsatzartikel für "Foreign Affairs" den deutschen Blitzkrieg als militärisches Vorbild: "Deutschlands tödliche Kombination bestand aus schnellen Panzern, motorisierter Infanterie und Artillerie sowie Stukas - alles konzentriert auf einen Abschnitt der gegnerischen Linie. Die Wirkung war vernichtend." Er verwarf die traditionelle Zwei-Kriege-Strategie und gab als Ziel aus, künftig vier kleinere Schauplätze beherrschen zu können. Irak gilt in solchen Szenarien als kleines "theater of war".
Außerdem kündigte er an, die amerikanische Armee auf Blitzkrieg-Taktik umzustellen - nicht ganz, aber zu wichtigen Teilen. Begeistert schilderte er ein Erlebnis vom Frontbesuch in Afghanistan: Seine Special Forces ritten auf Lasteseln hinter die gegnerischen Linien und dirigierten von dort aus US-Bomber ins Ziel. Einzelkämpfer auf dem Boden, Hightech in der Luft, motorisierte Blitzattacken - dieses Szenario wurde später zur Grundlage der Planung für den Irak-Krieg, obgleich der Unterschied zu Hitlers Blitzkrieg auf der Hand liegt. Saddam Hussein verweigert die offene Feldschlacht, deswegen gelten andere Regeln als im Zweiten Weltkrieg.
Für den Beweis seiner Doktrin setzte Rumsfeld den Nimbus der Unbesiegbarkeit aufs Spiel. Nur mühsam ließ er sich vor Kriegsbeginn zusätzliche Truppen abringen. Er hielt sie nicht für nötig. So fiel die Aufstockung allzu klein aus. Rumsfeld will ein weitaus größeres Territorium als Kuwait mit dem Bruchteil der Invasionsarmee von 1991 erobern. Außerdem experimentiert sein Pentagon mit neuen Formen der Kriegsführung. Erstmals liegen die Versorgungslager nicht direkt hinter der Front, sondern Hunderte von Kilometern entfernt in Kuwait. Prompt geriet die Nachschublinie unter Beschuss.
Schwere logistische Fehler
Viele Panzer und Lastwagen fahren wegen Spritmangels auf Reserve, die Lebensmittel der kämpfenden Soldaten sind rationiert. Diese Fehler notdürftig zu beheben, kostet wertvolle Ressourcen: Das US-Heer hat nur etwas mehr als zwei Divisionen im Einsatz. Davon sind drei Brigaden - zahlenmäßig etwa so viel wie eine Division - laut New York Times nur damit beschäftigt, die Verbindung zwischen Kuwait und Nadschaf zu schützen.
Weil Rumsfeld fast jeden denkbaren Partner vergrätzt hat, ist jetzt kaum jemand da, der ihm militärisch helfen kann. Wohl oder übel muss er den Vorstoß auf Bagdad bremsen, bis Verstärkung eintrifft. Das kann Wochen dauern. Vor den Augen der Welt zieht er Truppen von anderen Standorten ab. Dass die USA in der Lage sein könnten, zwei oder gar vier Kriege gleichzeitig zu führen, ist pure Illusion. Fast alle Flugzeugträger liegen vor Irak. Panzer, Lastwagen, Diesel und sogar warme Mahlzeiten gelten plötzlich als Mangelware. Dadurch entsteht ein gefährliches Vakuum: Jeder Staat der Welt weiß, dass sich Washington um nichts anderes kümmern kann als um Saddam. Das ist ein Freibrief für Abenteurer.
Abschreckung ist eine unverzichtbare politische Größe. Sie verhindert Kriege. Je mächtiger ein Hegemon, desto geringer die Bereitschaft seiner Gegner, sich ihm zu widersetzen. Aus Sicht des Mächtigen funktioniert Abschreckung nach dem Muster von Hackordnungskämpfen im Tierreich: Möglichst vielen Konflikten ausweichen, um eigene Kräfte zu schonen. Aggressive Rivalen jedoch müssen souverän besiegt werden, damit das Rudel sieht, wer der Stärkste ist. Alphatiere leben von ihrem Nimbus. Er sichert ihre Stellung und schützt sie vor zu vielen Kämpfen.
Rumsfeld hätte auf Außenminister Colin Powell hören sollen. Als dieser Generalstabschef war, galt die Powell-Doktrin: Angriffe finden nur mit absolut überlegener Streitmacht statt. Es darf nie ein Zweifel an der eigenen Unbesiegbarkeit aufkommen. Egal, wie der Irak-Krieg ausgeht: Die Welt wird nicht vergessen, wie den Amerikanern nach einer Woche die Puste ausgegangen ist und sie dann unter Zeitdruck Nachschub aus allen Ecken zusammenkratzen mussten.
© 2003 Financial Times Deutschland



http://www.ftd.de/pw/in/1048931526488.html?nv=hptn
ftd.de, Mo, 31.3.2003, 5:56, aktualisiert: Mo, 31.3.2003, 14:11
Powell warnt Syrien und Iran
US-Außenminister Colin Powell hat Syrien und Iran unmissverständlich gewarnt, Irak zu unterstützen. Iran wies den Verbalangriff zurück. Während Powell kräftig austeilt, muss sein Kabinettskollege aus dem Pentagon, Donald Rumsfeld, harte Kritik einstecken.
Powell forderte am Sonntagabend (Ortszeit) die irakischen Nachbarstaaten Iran und Syrien auf, sich jetzt gegen den Terrorismus und für den Frieden zu entscheiden . Iran müsse sein Streben nach Massenvernichtungswaffen einstellen und seine "Opposition gegen alle Terrorgruppen erklären, die gegen den Friedensprozess im Nahen Osten arbeiten", sagte der Minister. Syrien stehe ebenfalls vor einer entscheidenden Wahl: Es müsse damit aufhören, Terroristen-Gruppen im "sterbenden Regime" des irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu unterstützen, sagte Powell.
. Iran müsse sein Streben nach Massenvernichtungswaffen einstellen und seine "Opposition gegen alle Terrorgruppen erklären, die gegen den Friedensprozess im Nahen Osten arbeiten", sagte der Minister. Syrien stehe ebenfalls vor einer entscheidenden Wahl: Es müsse damit aufhören, Terroristen-Gruppen im "sterbenden Regime" des irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu unterstützen, sagte Powell.
Die irakische Armee erhält nach einem CNN-Bericht Unterstützung von Exil-Irakern, die über die jordanische Grenze in ihr Heimatland zurückkehren, um gegen die Alliierten zu kämpfen. Bislang seien etwa 6000 Iraker zurückgekehrt, sagte eine CNN-Reporterin in Amman. Der britische Sender BBC berichtete unter Berufung auf US-Geheimdienstinformationen, militante Islamisten verstärkten die irakischen Truppen bei Nasirija im Süden des Landes. Dabei handele es sich unter anderem um Palästinenser, Jemeniten und Tschetschenen.
Iran kontert Powells Vorwurf
Iran wies Powells Warnungen entschieden zurück und warf Washington vor, eine Vormachtstellung im Nahen Osten anzustreben. Der iranische Parlamentsabgeordnete Ali Akbar Mohtashami sagte dem iranischen TV-Sender IRIB, das Hauptziel der Amerikaner im Irak-Krieg sei die Errichtung einer neuen Ordnung im Nahen Osten, "um das israelische Regime zu schützen und zu stärken".
Teheran hatte in der Vergangenheit immer wieder beteuert, sein Atomprogramm diene lediglich friedlichen Zwecken. Iran habe nicht die Absicht, Atomwaffen zu entwicklen. Am Sonntag betonte der iranische Außenminister Kamal Charrasi die neutrale Stellung Teherans zum Irak-Krieg.
Rumsfeld innenpolitisch in der Defensive
US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gerät zunehmend in die Defensive. Er sieht sich in der zweiten Kriegswoche mit Fragen konfrontiert, ob er nicht zu wenige Truppen an den Golf geschickt hat.
Rumsfeld sagte in einem TV-Interview: "Es ist ein bisschen zu früh, um Geschichtsbücher zu schreiben", beschied der Minister am Sonntag seinen Kritikern.
Die Strategie für den Irak-Krieg sei von General Tommy Franks entworfen und von der Militärführung bis hinauf zum politischen Oberbefehlshaber George W. Bush gebilligt worden, sagte Rumsfeld.
Der Präsident habe die Diplomatie in den Vereinten Nationen unterstützen wollen, deswegen habe sich die Stationierung von Truppen am Golf über einen längeren Zeitraum erstreckt, antwortete Rumsfeld auf Fragen, ob der Transport von Truppen und Material nicht zu langsam erfolgt sei.
Die Kritik aus den Streitkräften hatte sich am Donnerstag mit einem Zeitungsinterview von General William Wallace Bahn gebrochen. "Der Gegner, den wir bekämpfen, unterscheidet sich etwas von dem, den wir in unseren Kriegsspielen hatten", sagte der Kommandeur des 5. Korps in Zeitungsinterviews. Das Ausmaß des irakischen Widerstands sei daher für die Truppen unerwartet gekommen. Rumsfeld und US-Generalstabschef Richard Myers erwiderten, dass jeder Offizier oder Soldat, der über den hartnäckigen Widerstand der Iraker erstaunt sei, nur einen Teil des Krieges und nicht die Gesamtsituation sehe.
Verschlechtertes Verhältnis zu Russland
Die anhaltende Kritik Russlands am Krieg hat die zuletzt partnerschaftlichen Beziehungen zu den USA deutlich getrübt. "Unsere Beziehungen waren seit der Operation im Kosovo (1999) nicht mehr so angespannt", sagte US-Botschafter Alexander Vershbow in Moskau. Die USA warfen den Russen in den vergangenen Wochen wiederholt illegale Rüstungslieferungen an den Irak vor.
Präsident Wladimir Putin hatte in der Vorwoche die Kriegsführung der USA in Irak kritisiert und vor einer humanitären Katastrophe im Land gewarnt. Ungeachtet dessen seien gute Beziehungen zu Russland für die USA von großer Bedeutung, zitierte die Agentur Interfax am Montag aus einem Fernsehinterview Vershbows.
© 2003 Financial Times Deutschland
ftd.de, Mo, 31.3.2003, 5:56, aktualisiert: Mo, 31.3.2003, 14:11
Powell warnt Syrien und Iran
US-Außenminister Colin Powell hat Syrien und Iran unmissverständlich gewarnt, Irak zu unterstützen. Iran wies den Verbalangriff zurück. Während Powell kräftig austeilt, muss sein Kabinettskollege aus dem Pentagon, Donald Rumsfeld, harte Kritik einstecken.
Powell forderte am Sonntagabend (Ortszeit) die irakischen Nachbarstaaten Iran und Syrien auf, sich jetzt gegen den Terrorismus und für den Frieden zu entscheiden
 . Iran müsse sein Streben nach Massenvernichtungswaffen einstellen und seine "Opposition gegen alle Terrorgruppen erklären, die gegen den Friedensprozess im Nahen Osten arbeiten", sagte der Minister. Syrien stehe ebenfalls vor einer entscheidenden Wahl: Es müsse damit aufhören, Terroristen-Gruppen im "sterbenden Regime" des irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu unterstützen, sagte Powell.
. Iran müsse sein Streben nach Massenvernichtungswaffen einstellen und seine "Opposition gegen alle Terrorgruppen erklären, die gegen den Friedensprozess im Nahen Osten arbeiten", sagte der Minister. Syrien stehe ebenfalls vor einer entscheidenden Wahl: Es müsse damit aufhören, Terroristen-Gruppen im "sterbenden Regime" des irakischen Präsidenten Saddam Hussein zu unterstützen, sagte Powell. Die irakische Armee erhält nach einem CNN-Bericht Unterstützung von Exil-Irakern, die über die jordanische Grenze in ihr Heimatland zurückkehren, um gegen die Alliierten zu kämpfen. Bislang seien etwa 6000 Iraker zurückgekehrt, sagte eine CNN-Reporterin in Amman. Der britische Sender BBC berichtete unter Berufung auf US-Geheimdienstinformationen, militante Islamisten verstärkten die irakischen Truppen bei Nasirija im Süden des Landes. Dabei handele es sich unter anderem um Palästinenser, Jemeniten und Tschetschenen.
Iran kontert Powells Vorwurf
Iran wies Powells Warnungen entschieden zurück und warf Washington vor, eine Vormachtstellung im Nahen Osten anzustreben. Der iranische Parlamentsabgeordnete Ali Akbar Mohtashami sagte dem iranischen TV-Sender IRIB, das Hauptziel der Amerikaner im Irak-Krieg sei die Errichtung einer neuen Ordnung im Nahen Osten, "um das israelische Regime zu schützen und zu stärken".
Teheran hatte in der Vergangenheit immer wieder beteuert, sein Atomprogramm diene lediglich friedlichen Zwecken. Iran habe nicht die Absicht, Atomwaffen zu entwicklen. Am Sonntag betonte der iranische Außenminister Kamal Charrasi die neutrale Stellung Teherans zum Irak-Krieg.
Rumsfeld innenpolitisch in der Defensive
US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gerät zunehmend in die Defensive. Er sieht sich in der zweiten Kriegswoche mit Fragen konfrontiert, ob er nicht zu wenige Truppen an den Golf geschickt hat.
Rumsfeld sagte in einem TV-Interview: "Es ist ein bisschen zu früh, um Geschichtsbücher zu schreiben", beschied der Minister am Sonntag seinen Kritikern.
Die Strategie für den Irak-Krieg sei von General Tommy Franks entworfen und von der Militärführung bis hinauf zum politischen Oberbefehlshaber George W. Bush gebilligt worden, sagte Rumsfeld.
Der Präsident habe die Diplomatie in den Vereinten Nationen unterstützen wollen, deswegen habe sich die Stationierung von Truppen am Golf über einen längeren Zeitraum erstreckt, antwortete Rumsfeld auf Fragen, ob der Transport von Truppen und Material nicht zu langsam erfolgt sei.
Die Kritik aus den Streitkräften hatte sich am Donnerstag mit einem Zeitungsinterview von General William Wallace Bahn gebrochen. "Der Gegner, den wir bekämpfen, unterscheidet sich etwas von dem, den wir in unseren Kriegsspielen hatten", sagte der Kommandeur des 5. Korps in Zeitungsinterviews. Das Ausmaß des irakischen Widerstands sei daher für die Truppen unerwartet gekommen. Rumsfeld und US-Generalstabschef Richard Myers erwiderten, dass jeder Offizier oder Soldat, der über den hartnäckigen Widerstand der Iraker erstaunt sei, nur einen Teil des Krieges und nicht die Gesamtsituation sehe.
Verschlechtertes Verhältnis zu Russland
Die anhaltende Kritik Russlands am Krieg hat die zuletzt partnerschaftlichen Beziehungen zu den USA deutlich getrübt. "Unsere Beziehungen waren seit der Operation im Kosovo (1999) nicht mehr so angespannt", sagte US-Botschafter Alexander Vershbow in Moskau. Die USA warfen den Russen in den vergangenen Wochen wiederholt illegale Rüstungslieferungen an den Irak vor.
Präsident Wladimir Putin hatte in der Vorwoche die Kriegsführung der USA in Irak kritisiert und vor einer humanitären Katastrophe im Land gewarnt. Ungeachtet dessen seien gute Beziehungen zu Russland für die USA von großer Bedeutung, zitierte die Agentur Interfax am Montag aus einem Fernsehinterview Vershbows.
© 2003 Financial Times Deutschland
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,242795,00.html
WIEDERAUFBAU
Cheneys Ex-Firma ist aus dem Rennen
Beim Wiederaufbau des Irak bleiben US-Firmen lieber unter sich. Auch der ehemals von Vizepräsident Dick Cheney geleitete Konzern Halliburton hatte sich gute Chancen ausgerechnet, ist bei der Endauswahl jedoch nicht dabei.
Washington - Inzwischen seien nur noch zwei Firmen im Rennen. Halliburton gehöre nicht mehr dazu, bestätigte ein Sprecher der "Agency for International Development" (USAID) gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Newsweek". Der texanische Ölkonzern war von 1996 bis 2000 vom jetzigen amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney geleitet worden und erfreut sich bester Beziehungen zum US-Militär.
Für den millionenschweren Auftrag hatten sich neben Halliburton die US-Firmen Bechtel, Fluor, Parsons und Louis Berger beworben. Ob Halliburton freiwillig zurückgezogen hat, in der Endauswahl überflügelt wurde oder ob die US-Regierung den Konzern gebeten hat, seine Bewerbung zurückzuziehen, wollte der Sprecher nicht sagen.
US-Firmen only
Doch auch ohne Halliburton bleibt das Vergabeverfahren umstritten. Die Entscheidung der US-Regierung, lediglich heimische Firmen zu berücksichtigen, hatte für scharfe Kritik aus dem Ausland gesorgt. Obwohl britische Soldaten den irakischen Tiefseehafen von Umm Kasr sichern, wurde die US-Firma Stevedoring Services bereits mit dem Auftrag für den Wiederaufbau der Hafenanlagen bedacht. Nach Angaben der BBC hatte sich die britische Regierung dafür eingesetzt, als Geste des guten Willens ein irakisches Unternehmen zu beauftragen.
Halliburton-Tochter bleibt im Geschäft
Halliburton bleibt aber im Geschäft, zumindest über die Konzerntochter Kellog Brown and Root (KBR). Der private Militärdienstleister KBR hat kürzlich von der US-Regierung den Auftrag erhalten, brennende Ölfelder im Irak zu löschen. Außerdem ist KBR unter anderen für die Versorgung der US-Truppen im Mittleren Osten tätig.
Rund 600 Millionen Dollar will die US-Regierung über die Agentur USAID zunächst für den Wiederaufbau von Schulen, Krankenhäusern, Hospitälern, Häfen und Flughäfen im Irak ausgeben. Das Geld soll mittelfristig aus dem Irak zurückfließen: Der Irak könne seinen eigenen Wiederaufbau bald selbst finanzieren, hatte US-Sicherheitsberater Paul Wolfowitz gesagt.
------------
Das ist doch Leichenflederei
WIEDERAUFBAU
Cheneys Ex-Firma ist aus dem Rennen
Beim Wiederaufbau des Irak bleiben US-Firmen lieber unter sich. Auch der ehemals von Vizepräsident Dick Cheney geleitete Konzern Halliburton hatte sich gute Chancen ausgerechnet, ist bei der Endauswahl jedoch nicht dabei.
Washington - Inzwischen seien nur noch zwei Firmen im Rennen. Halliburton gehöre nicht mehr dazu, bestätigte ein Sprecher der "Agency for International Development" (USAID) gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Newsweek". Der texanische Ölkonzern war von 1996 bis 2000 vom jetzigen amerikanischen Vizepräsidenten Dick Cheney geleitet worden und erfreut sich bester Beziehungen zum US-Militär.
Für den millionenschweren Auftrag hatten sich neben Halliburton die US-Firmen Bechtel, Fluor, Parsons und Louis Berger beworben. Ob Halliburton freiwillig zurückgezogen hat, in der Endauswahl überflügelt wurde oder ob die US-Regierung den Konzern gebeten hat, seine Bewerbung zurückzuziehen, wollte der Sprecher nicht sagen.
US-Firmen only
Doch auch ohne Halliburton bleibt das Vergabeverfahren umstritten. Die Entscheidung der US-Regierung, lediglich heimische Firmen zu berücksichtigen, hatte für scharfe Kritik aus dem Ausland gesorgt. Obwohl britische Soldaten den irakischen Tiefseehafen von Umm Kasr sichern, wurde die US-Firma Stevedoring Services bereits mit dem Auftrag für den Wiederaufbau der Hafenanlagen bedacht. Nach Angaben der BBC hatte sich die britische Regierung dafür eingesetzt, als Geste des guten Willens ein irakisches Unternehmen zu beauftragen.
Halliburton-Tochter bleibt im Geschäft
Halliburton bleibt aber im Geschäft, zumindest über die Konzerntochter Kellog Brown and Root (KBR). Der private Militärdienstleister KBR hat kürzlich von der US-Regierung den Auftrag erhalten, brennende Ölfelder im Irak zu löschen. Außerdem ist KBR unter anderen für die Versorgung der US-Truppen im Mittleren Osten tätig.
Rund 600 Millionen Dollar will die US-Regierung über die Agentur USAID zunächst für den Wiederaufbau von Schulen, Krankenhäusern, Hospitälern, Häfen und Flughäfen im Irak ausgeben. Das Geld soll mittelfristig aus dem Irak zurückfließen: Der Irak könne seinen eigenen Wiederaufbau bald selbst finanzieren, hatte US-Sicherheitsberater Paul Wolfowitz gesagt.
------------
Das ist doch Leichenflederei

31.03. 10:28
AOL Time Warner: weitere Bilanzrevidierung?
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
AOL Time Warner (WKN: 502251, US: AOL) deutete am Freitag in einem Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC an, dass man nachträglich eine Revidierung des Bilanzergebnisses um bis zu $400 Millionen durchführen müsse. Die Revidierung könnte in Verbindung mit den Ergebnissen einer Ermittlung der Regierung America Online, der Internettochter von AOL Time Warner, stehen. Dabei handle es sich um zwei Transaktionen zwischen AOL und der deutschen Bertelsmann AG, die wahrscheinlich falsch verbucht wurden, so der SEC-Antrag. Bereits im Oktober 2002 revidierte AOL $190 Millionen, die falsch verbucht wurden. Nun befinde man sich mit der US-Behörde in „anhaltenden Gesprächen“, so AOL.



AOL Time Warner: weitere Bilanzrevidierung?
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
AOL Time Warner (WKN: 502251, US: AOL) deutete am Freitag in einem Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC an, dass man nachträglich eine Revidierung des Bilanzergebnisses um bis zu $400 Millionen durchführen müsse. Die Revidierung könnte in Verbindung mit den Ergebnissen einer Ermittlung der Regierung America Online, der Internettochter von AOL Time Warner, stehen. Dabei handle es sich um zwei Transaktionen zwischen AOL und der deutschen Bertelsmann AG, die wahrscheinlich falsch verbucht wurden, so der SEC-Antrag. Bereits im Oktober 2002 revidierte AOL $190 Millionen, die falsch verbucht wurden. Nun befinde man sich mit der US-Behörde in „anhaltenden Gesprächen“, so AOL.



USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex-März sinkt überraschend deutlich auf 48,4 Pkt
CHICAGO (dpa-AFX) - Der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago ist im März überraschend deutlich eingebrochen. Er sei von 54,9 Punkten im Vormonat auf 48,4 Punkte im März gefallen, teilte der regionale Einkaufsmanagerverband von Chicago am Montag mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 50,3 Punkte gerechnet.
Der Einkaufsmanagerindex von Chicago gilt als zuverlässiger Indikator für den nationalen ISM-Einkaufsmanagerindex. Ein Wert von über 50 Punkten deutet auf eine wirtschaftliche Expansion hin./FX/jh/jkr
--------
Mir so nem Schrott kommt die Kriegsrallye, genau wie der Krieg selbt, mächtig ins Stocken
CHICAGO (dpa-AFX) - Der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago ist im März überraschend deutlich eingebrochen. Er sei von 54,9 Punkten im Vormonat auf 48,4 Punkte im März gefallen, teilte der regionale Einkaufsmanagerverband von Chicago am Montag mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 50,3 Punkte gerechnet.
Der Einkaufsmanagerindex von Chicago gilt als zuverlässiger Indikator für den nationalen ISM-Einkaufsmanagerindex. Ein Wert von über 50 Punkten deutet auf eine wirtschaftliche Expansion hin./FX/jh/jkr
--------
Mir so nem Schrott kommt die Kriegsrallye, genau wie der Krieg selbt, mächtig ins Stocken

US/UBS: US-Wirtschaft sollte nach Irakkrieg wachsen
UBS Warburg geht von einer Belebung der US-Wirtschaft nach dem Ende des Irak-Kriegs aus. Die augenblickliche Schwäche sei insbesondere in den mit mit dem Krieg verbundenen Unsicherheiten begründet. UBS geht davon aus, dass der Krieg in ein bis zwei Monaten beendet sein wird. Neben dem Ende des Krieges dürfte sich auch das angekündigte Steuersenkungsprogramm der Bush-Regierung positiv auf die Wirtschaft auswirken. Die Analysten gehen von einem realen Wachstum des Bruttosozialproduktes auf Jahressicht von 2,5 Prozent aus. +++ Manuel Priego Thimmel
vwd/31.3.2003/mpt/tw
-------
Na Logo
UBS Warburg geht von einer Belebung der US-Wirtschaft nach dem Ende des Irak-Kriegs aus. Die augenblickliche Schwäche sei insbesondere in den mit mit dem Krieg verbundenen Unsicherheiten begründet. UBS geht davon aus, dass der Krieg in ein bis zwei Monaten beendet sein wird. Neben dem Ende des Krieges dürfte sich auch das angekündigte Steuersenkungsprogramm der Bush-Regierung positiv auf die Wirtschaft auswirken. Die Analysten gehen von einem realen Wachstum des Bruttosozialproduktes auf Jahressicht von 2,5 Prozent aus. +++ Manuel Priego Thimmel
vwd/31.3.2003/mpt/tw
-------
Na Logo

31/03/2003 17:18
Chicagoer Einkaufsmanagerindex unerwartet stark gesunken
Chicago, 31. Mär (Reuters) - Der Konjunkturindex der
Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago ist im März unerwartet
stark gesunken. Zugleich zeigt er erstmals seit fünf Monaten
wieder einen Geschäftsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe der
Region an.
Der an den Finanzmärkten viel beachtete Index fiel im März
auf 48,4 von 54,9 Punkten im Vormonat, wie die Vereinigung der
Chicagoer Einkaufsmanager am Montag mitteilte. Von Reuters
befragte Volkswirte hatten einen weniger starken Rückgang auf
50,7 Punkte erwartet.
Der Index lag zuletzt im September und im Oktober unterhalb
der Marke von 50 Zählern, unter der das Konjunkturbarometer eine
Schrumpfung im Verarbeitenden Gewerbe der für die US-Konjunktur
wichtigen Region im Mittleren Westen anzeigt. Der
Beschäftigungsindex fiel auf 45,1 von 46,6 Zählern und zeigt
damit einen beschleunigten Arbeitsplatzabbau an.
mer/bek
--------
So was!
Schuld ist natürlich der Krieg

Chicagoer Einkaufsmanagerindex unerwartet stark gesunken
Chicago, 31. Mär (Reuters) - Der Konjunkturindex der
Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago ist im März unerwartet
stark gesunken. Zugleich zeigt er erstmals seit fünf Monaten
wieder einen Geschäftsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe der
Region an.
Der an den Finanzmärkten viel beachtete Index fiel im März
auf 48,4 von 54,9 Punkten im Vormonat, wie die Vereinigung der
Chicagoer Einkaufsmanager am Montag mitteilte. Von Reuters
befragte Volkswirte hatten einen weniger starken Rückgang auf
50,7 Punkte erwartet.
Der Index lag zuletzt im September und im Oktober unterhalb
der Marke von 50 Zählern, unter der das Konjunkturbarometer eine
Schrumpfung im Verarbeitenden Gewerbe der für die US-Konjunktur
wichtigen Region im Mittleren Westen anzeigt. Der
Beschäftigungsindex fiel auf 45,1 von 46,6 Zählern und zeigt
damit einen beschleunigten Arbeitsplatzabbau an.
mer/bek
--------
So was!

Schuld ist natürlich der Krieg


http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0%2C2828%2C2428…
P E T E R A R N E T T
NBC feuert seinen Starreporter
Kritische Töne sind unerwünscht. Dem amerikanische Kriegsreporter wurden sie zum Verhängnis. Nachdem er im irakischen TV erklärte, die Strategie des US-Militärs sei fehlgeschlagen, machte sein Arbeitgeber NBC kurzen Prozess und entließ den Pulitzerpreisträger.
Washington - NBC hatte Peter Arnetts Auftritt im irakischen Fernsehen zunächst verteidigt. In dem TV-Auftritt hatte der Reporter erklärt, die US-Strategie sei wegen der überraschend starken Gegenwehr der Iraker fehlgeschlagen. Die Militärstrategen versuchten jetzt, "einen anderen Kriegsplan zu entwerfen".
Nach scharfer Kritik anderer Journalisten in den USA machte der Sender am Montag dann jedoch eine überraschende Kehrtwende. "Es war falsch, dass Arnett dem irakischen Staatsfernsehen - besonders in Kriegszeiten - ein Interview gegeben hat", erklärte ein Sprecher des Senders am Montag. "Und es war falsch, dass er seine persönlichen Beobachtungen und Meinungen zur Sprache brachte. Deshalb wird Peter Arnett nicht mehr für NBC und MSNBC berichten", hieß es in einer Mitteilung.
Arnett, der für seine Berichterstattung über den Vietnamkrieg den Pulitzerpreis erhielt, war im Golfkrieg vor zwölf Jahren weltweit bekannt geworden, weil er als einer von wenigen Korrespondenten - damals für CNN - aus Bagdad berichtet hatte. Auch im aktuellen Golfkrieg war er der erste, der vor knapp zwei Wochen aus Bagdad die ersten Raketeneinschläge und damit den Kriegsbeginn gemeldet hatte.
Schon 1991 hatte er sich mit seinen Berichten über den Golfkrieg bei der damaligen US-Regierung udn bei Präsident George Bush senior nachhaltig unbeliebt gemacht. Er hatte unter anderem über einen alliierten Bombenangriff auf eine Fabrik berichtet, die nach seiner Darstellung Babymilch, nach der Version des Pentagon jedoch biologische Waffen herstellte. Die Regierung beschuldigte Arnett daraufhin, Saddam Husseins Propaganda zu verbreiten.
Auch Arnetts Abschied von CNN erfolgte in Unfrieden. 1998 moderierte er einen Beitrag, der die US-Streitkräfte beschuldigte, gegen ein Dorf im südostasiatischen Staat Laos Sarin-Gas eingesetzt zu haben, um amerikanische Deserteure zu töten. CNN feuerte wenig später zwei Mitarbeiter und zog den Beitrag zurück. Arnett verließ den Sender daraufhin.

P E T E R A R N E T T
NBC feuert seinen Starreporter
Kritische Töne sind unerwünscht. Dem amerikanische Kriegsreporter wurden sie zum Verhängnis. Nachdem er im irakischen TV erklärte, die Strategie des US-Militärs sei fehlgeschlagen, machte sein Arbeitgeber NBC kurzen Prozess und entließ den Pulitzerpreisträger.
Washington - NBC hatte Peter Arnetts Auftritt im irakischen Fernsehen zunächst verteidigt. In dem TV-Auftritt hatte der Reporter erklärt, die US-Strategie sei wegen der überraschend starken Gegenwehr der Iraker fehlgeschlagen. Die Militärstrategen versuchten jetzt, "einen anderen Kriegsplan zu entwerfen".
Nach scharfer Kritik anderer Journalisten in den USA machte der Sender am Montag dann jedoch eine überraschende Kehrtwende. "Es war falsch, dass Arnett dem irakischen Staatsfernsehen - besonders in Kriegszeiten - ein Interview gegeben hat", erklärte ein Sprecher des Senders am Montag. "Und es war falsch, dass er seine persönlichen Beobachtungen und Meinungen zur Sprache brachte. Deshalb wird Peter Arnett nicht mehr für NBC und MSNBC berichten", hieß es in einer Mitteilung.
Arnett, der für seine Berichterstattung über den Vietnamkrieg den Pulitzerpreis erhielt, war im Golfkrieg vor zwölf Jahren weltweit bekannt geworden, weil er als einer von wenigen Korrespondenten - damals für CNN - aus Bagdad berichtet hatte. Auch im aktuellen Golfkrieg war er der erste, der vor knapp zwei Wochen aus Bagdad die ersten Raketeneinschläge und damit den Kriegsbeginn gemeldet hatte.
Schon 1991 hatte er sich mit seinen Berichten über den Golfkrieg bei der damaligen US-Regierung udn bei Präsident George Bush senior nachhaltig unbeliebt gemacht. Er hatte unter anderem über einen alliierten Bombenangriff auf eine Fabrik berichtet, die nach seiner Darstellung Babymilch, nach der Version des Pentagon jedoch biologische Waffen herstellte. Die Regierung beschuldigte Arnett daraufhin, Saddam Husseins Propaganda zu verbreiten.
Auch Arnetts Abschied von CNN erfolgte in Unfrieden. 1998 moderierte er einen Beitrag, der die US-Streitkräfte beschuldigte, gegen ein Dorf im südostasiatischen Staat Laos Sarin-Gas eingesetzt zu haben, um amerikanische Deserteure zu töten. CNN feuerte wenig später zwei Mitarbeiter und zog den Beitrag zurück. Arnett verließ den Sender daraufhin.

http://www.netzeitung.de/servlets/page?section=5&item=233206
US Airways erhält Milliardenkredit
Mit einem Milliardenkredit möchte US Airways ihr Insolvenzverfahren beenden. American Airlines dagegen hat offenbar die Insolvenz in letzter Minute abgewendet.
Die Fluggesellschaft US Airways schließt ihr Insolvenzverfahren am Montag nach rund acht Monaten ab. Die siebtgrößte US-Fluglinie erhielt einen Milliardenkredit zur wirtschaftlichen Sanierung. Das Darlehen in Höhe von einer Milliarde Dollar werde von einer Kreditgarantie der Regierung in Höhe von 900 Millionen Dollar untermauert, teilte die für die Genehmigung der Staatshilfe zuständige Behörde Air Transportation Stabilization Board (ATSB) am Montag in Washington mit. US Airways stand seit August 2002 unter Gläubigerschutz nach Kapitel elf des US-Konkursrechts. Seitdem senkte das Unternehmen seine Kosten deutlich. Die Airline will bis 2008 jährlich 1,9 Millionen Dollar einsparen, unter anderem durch Lohnkürzungen. Außerdem legte die Fluggesellschaft mehrere größere Maschinen still.
Irak-Krieg belastet auch US Airways
Das Ende der Insolvenzphase kommt für US Airways allerdings in einer schwierigen Zeit. Der Irak-Krieg und die damit einher gehende gestiegene Angst vor Terroranschlägen führten bei Fluggesellschaften weltweit zu Buchungsrückgängen. Auch US Airways kürzte seine Kapazitäten deshalb unlängst.
Die ATSB war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet worden, um den angeschlagenen Fluglinien aus der Krise zu helfen. Bisher hat die Behörde nur zwei Mal staatliche Kredithilfe gebilligt: für America West und America Trans Air.
American einigt sich mit Gewerkschaften
Die weltgrößte Fluggesellschaft American Airlines hat nach US-Medienberichten unterdessen die Insolvenz noch abgewendet. Nach stundenlangen Verhandlungen mit ihren Flugbegleitern, Piloten und Mechanikern seien Abkommen über deutliche Lohnkürzungen erreicht worden, hieß es. Bisher bestätigte die Fluggesellschaft aber nur eine Einigung mit der Mechaniker-Gewerkschaft TWU. Sollte die Einigung noch scheitern, könnte American Airlines noch am Montag Gläubigerschutz beantragen. (nz)
--------
Perlen vor die Säue
Die verbrennen die Kohle besser als die Profis im Nemax !
US Airways erhält Milliardenkredit
Mit einem Milliardenkredit möchte US Airways ihr Insolvenzverfahren beenden. American Airlines dagegen hat offenbar die Insolvenz in letzter Minute abgewendet.
Die Fluggesellschaft US Airways schließt ihr Insolvenzverfahren am Montag nach rund acht Monaten ab. Die siebtgrößte US-Fluglinie erhielt einen Milliardenkredit zur wirtschaftlichen Sanierung. Das Darlehen in Höhe von einer Milliarde Dollar werde von einer Kreditgarantie der Regierung in Höhe von 900 Millionen Dollar untermauert, teilte die für die Genehmigung der Staatshilfe zuständige Behörde Air Transportation Stabilization Board (ATSB) am Montag in Washington mit. US Airways stand seit August 2002 unter Gläubigerschutz nach Kapitel elf des US-Konkursrechts. Seitdem senkte das Unternehmen seine Kosten deutlich. Die Airline will bis 2008 jährlich 1,9 Millionen Dollar einsparen, unter anderem durch Lohnkürzungen. Außerdem legte die Fluggesellschaft mehrere größere Maschinen still.
Irak-Krieg belastet auch US Airways
Das Ende der Insolvenzphase kommt für US Airways allerdings in einer schwierigen Zeit. Der Irak-Krieg und die damit einher gehende gestiegene Angst vor Terroranschlägen führten bei Fluggesellschaften weltweit zu Buchungsrückgängen. Auch US Airways kürzte seine Kapazitäten deshalb unlängst.
Die ATSB war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet worden, um den angeschlagenen Fluglinien aus der Krise zu helfen. Bisher hat die Behörde nur zwei Mal staatliche Kredithilfe gebilligt: für America West und America Trans Air.
American einigt sich mit Gewerkschaften
Die weltgrößte Fluggesellschaft American Airlines hat nach US-Medienberichten unterdessen die Insolvenz noch abgewendet. Nach stundenlangen Verhandlungen mit ihren Flugbegleitern, Piloten und Mechanikern seien Abkommen über deutliche Lohnkürzungen erreicht worden, hieß es. Bisher bestätigte die Fluggesellschaft aber nur eine Einigung mit der Mechaniker-Gewerkschaft TWU. Sollte die Einigung noch scheitern, könnte American Airlines noch am Montag Gläubigerschutz beantragen. (nz)
--------
Perlen vor die Säue

Die verbrennen die Kohle besser als die Profis im Nemax !
Broaddus: Fed ist bereit, Zinsen notfalls auf Null zu senken
Baltimore (vwd) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ist nach den Worten des Präsidenten der Fed-Filiale Richmond, Alfred J. Broaddus, notfalls bereit, die Zinsen auf null Prozent zu senken. Die Chancen für eine "graduelle Erholung" im Jahresverlauf stünden trotz des Irak-Krieges nicht schlecht, und die Fed sei bereit, diese Chancen noch zu verbessern, sagte das stimmberechtigte Mitglied des Offenmarktausschusses (FOMC) am Dienstagmorgen in einer Rede vor der Johns Hopkins University. Selbst bei Leitzinsen bei oder nahe null Prozent blieben der Fed noch ausreichend andere Möglichkeiten, Wirtschaftswachstum zu unterstützen, sagte Broaddus.



Baltimore (vwd) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ist nach den Worten des Präsidenten der Fed-Filiale Richmond, Alfred J. Broaddus, notfalls bereit, die Zinsen auf null Prozent zu senken. Die Chancen für eine "graduelle Erholung" im Jahresverlauf stünden trotz des Irak-Krieges nicht schlecht, und die Fed sei bereit, diese Chancen noch zu verbessern, sagte das stimmberechtigte Mitglied des Offenmarktausschusses (FOMC) am Dienstagmorgen in einer Rede vor der Johns Hopkins University. Selbst bei Leitzinsen bei oder nahe null Prozent blieben der Fed noch ausreichend andere Möglichkeiten, Wirtschaftswachstum zu unterstützen, sagte Broaddus.



01.04. 10:56
WorldCom - Bilanzbetrug erreicht $11 Mrd.?
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die Summe des Bilanzbetrugs bei dem US-Telko WorldCom könnte laut dem Wall Street Journal (Dienstagsausgabe) ein Volumen von $11 Milliarden erreichen. Dies hätten situationsbetraute Personen dem Wall Street Journal mitgeteilt. Ursprünglich hatte Worldcom mit einer Summe von $3.7 Milliarden Insolvenz angemeldet. Auslöser für die Erhöhung der Summe, die illegal in den Bilanzen erfasst wurde, könnte einer geplante erneute Prüfung der Bücher Worldcoms sein, so das Wall Street Journal. Die letztendlich zur Revidierung stehende Summe könne jedoch nicht vor Sommer bekannt gegeben werden.



WorldCom - Bilanzbetrug erreicht $11 Mrd.?
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die Summe des Bilanzbetrugs bei dem US-Telko WorldCom könnte laut dem Wall Street Journal (Dienstagsausgabe) ein Volumen von $11 Milliarden erreichen. Dies hätten situationsbetraute Personen dem Wall Street Journal mitgeteilt. Ursprünglich hatte Worldcom mit einer Summe von $3.7 Milliarden Insolvenz angemeldet. Auslöser für die Erhöhung der Summe, die illegal in den Bilanzen erfasst wurde, könnte einer geplante erneute Prüfung der Bücher Worldcoms sein, so das Wall Street Journal. Die letztendlich zur Revidierung stehende Summe könne jedoch nicht vor Sommer bekannt gegeben werden.



10:01am 04/01/03 US MARCH ISM 46.2% VS. 50.5% IN FEBRUARY



waaaahnsinn !

TABELLE-US-Einkaufsmanagerindex unerwartet stark zurückgegangen
Tempe, 01. Apr (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel
beachtete ISM-Konjunkturindex ist im März überraschend stark
zurückgegangen. Das Institute for Supply Management (ISM) nannte
am Dienstag in Tempe (US-Bundesstaat Arizona) folgende Zahlen
für den Index über die Geschäftsaktivität des Verarbeitenden
Gewerbes in den USA und für seine Teilkomponenten:
MÄR FEB JAN DEZ NOV
2003 2003 2003 2002 2002
Gesamtindex 46,2 50,5 53,9 55,2 50,5
Auftragseingang 46,2 52,3 59,7 62,9 52,4
Produktion 46,3 55,4 56,3 56,6 54,9
Beschäftigung 42,1 42,8 47,6 48,2 45,1
Auslieferungen 53,8 53,3 52,6 52,6 51,8
Lagerbestände 42,3 43,8 45,4 46,2 43,0
Preise 70,0 65,5 57,5 56,9 55,7
Auftragsrückstand 41,5 49,0 45,0 46,5 42,5
Auftragseingang aus
dem Ausland 52,0 55,5 55,6 52,5 50,6
Importe 52,5 55,4 59,0 54,8 53,1
NOTE: Von Reuters befragte Analysten hatten für den
Berichtsmonat einen Rückgang des Indexes auf 48,6 Punkte
vorausgesagt. Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert eine
Verbesserung, ein Stand unter 50 Punkten dagegen eine
Verschlechterung der konjunkturellen Lage im Verarbeitenden
Gewerbe.

Tempe, 01. Apr (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel
beachtete ISM-Konjunkturindex ist im März überraschend stark
zurückgegangen. Das Institute for Supply Management (ISM) nannte
am Dienstag in Tempe (US-Bundesstaat Arizona) folgende Zahlen
für den Index über die Geschäftsaktivität des Verarbeitenden
Gewerbes in den USA und für seine Teilkomponenten:
MÄR FEB JAN DEZ NOV
2003 2003 2003 2002 2002
Gesamtindex 46,2 50,5 53,9 55,2 50,5
Auftragseingang 46,2 52,3 59,7 62,9 52,4
Produktion 46,3 55,4 56,3 56,6 54,9
Beschäftigung 42,1 42,8 47,6 48,2 45,1
Auslieferungen 53,8 53,3 52,6 52,6 51,8
Lagerbestände 42,3 43,8 45,4 46,2 43,0
Preise 70,0 65,5 57,5 56,9 55,7
Auftragsrückstand 41,5 49,0 45,0 46,5 42,5
Auftragseingang aus
dem Ausland 52,0 55,5 55,6 52,5 50,6
Importe 52,5 55,4 59,0 54,8 53,1
NOTE: Von Reuters befragte Analysten hatten für den
Berichtsmonat einen Rückgang des Indexes auf 48,6 Punkte
vorausgesagt. Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert eine
Verbesserung, ein Stand unter 50 Punkten dagegen eine
Verschlechterung der konjunkturellen Lage im Verarbeitenden
Gewerbe.

02/04/2003 17:04
TABELLE-US-Industrieauftragseingang im Februar minus 1,5 vH~
Washington, 02. Apr (Reuters) - Der Auftragseingang der
US-Industrie ist im Februar zum Vormonat um 1,5 Prozent
gesunken. Das Handelsministerium veröffentlichte am Mittwoch in
Washington folgende Zahlen (Veränderungen gegenüber Vormonat in
Prozent):
FEB 2003 JAN 2003
Industrieaufträge - 1,5 vH + 1,7 vH
(rev. v. + 2,1)
Industrieaufträge
ohne Rüstung - 2,2 vH + 1,9 vH
(rev. v. + 2,2)
NOTE - Von Reuters befragte Volkswirte hatten im
Durchschnitt beim Auftragseingang der Industrie für den
Berichtsmonat einen Rückgang um 0,6 Prozent vorausgesagt.
fri/nmk
----------
immer wieder zum kotzen
TABELLE-US-Industrieauftragseingang im Februar minus 1,5 vH~
Washington, 02. Apr (Reuters) - Der Auftragseingang der
US-Industrie ist im Februar zum Vormonat um 1,5 Prozent
gesunken. Das Handelsministerium veröffentlichte am Mittwoch in
Washington folgende Zahlen (Veränderungen gegenüber Vormonat in
Prozent):
FEB 2003 JAN 2003
Industrieaufträge - 1,5 vH + 1,7 vH
(rev. v. + 2,1)
Industrieaufträge
ohne Rüstung - 2,2 vH + 1,9 vH
(rev. v. + 2,2)
NOTE - Von Reuters befragte Volkswirte hatten im
Durchschnitt beim Auftragseingang der Industrie für den
Berichtsmonat einen Rückgang um 0,6 Prozent vorausgesagt.
fri/nmk
----------
immer wieder zum kotzen

Open Market Operations
Temporary Open Market Operations 04/03/2003
Total Money Value of Operation (In $Bil.) 10.75
Total Money Value of Operation (In $Bil.) 4
------
14.75 Mrd.


Temporary Open Market Operations 04/03/2003
Total Money Value of Operation (In $Bil.) 10.75
Total Money Value of Operation (In $Bil.) 4
------
14.75 Mrd.



TABELLE-ISM-Service-Index im März überraschend stark gesunken
Tempe, 03. Apr (Reuters) - Der Service-Index des Institute
for Supply Management (ISM) ist im März auf 47,9 Punkte von 53,9
Punkten im Februar gesunken. Das Institut nannte am Donnerstag
in Tempe im US-Bundesstaat Arizona folgende Zahlen für den Index
und seine Teilkomponenten:
MÄR FEB JAN DEZ NOV
2003 2003 2003 2002 2002
Gesamtindex 47,9 53,9 54,5 54,2 55,7
Auftragseingang 47,7 53,0 56,2 54,6 55,4
Auftragsbestand 47,5 50,0 48,0 51,5 50,5
Exportaufträge 48,5 58,5 53,0 54,0 58,5
Auslieferungen 66,0 66,5 64,5 63,0 61,0
Importe 55,0 51,5 56,5 51,8 55,1
Preise 62,0 60,9 57,0 55,3 57,5
Beschäftigung 47,9 49,0 50,3 46,9 46,3
NOTE: Von Reuters befragte Analysten hatten für den
Berichtsmonat einen Indexstand von 52,3 Punkten vorausgesagt.
Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert ein Wachstum,
ein Stand unter 50 Punkten dagegen ein Schrumpfen der
Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor.
twe/phi

Tempe, 03. Apr (Reuters) - Der Service-Index des Institute
for Supply Management (ISM) ist im März auf 47,9 Punkte von 53,9
Punkten im Februar gesunken. Das Institut nannte am Donnerstag
in Tempe im US-Bundesstaat Arizona folgende Zahlen für den Index
und seine Teilkomponenten:
MÄR FEB JAN DEZ NOV
2003 2003 2003 2002 2002
Gesamtindex 47,9 53,9 54,5 54,2 55,7
Auftragseingang 47,7 53,0 56,2 54,6 55,4
Auftragsbestand 47,5 50,0 48,0 51,5 50,5
Exportaufträge 48,5 58,5 53,0 54,0 58,5
Auslieferungen 66,0 66,5 64,5 63,0 61,0
Importe 55,0 51,5 56,5 51,8 55,1
Preise 62,0 60,9 57,0 55,3 57,5
Beschäftigung 47,9 49,0 50,3 46,9 46,3
NOTE: Von Reuters befragte Analysten hatten für den
Berichtsmonat einen Indexstand von 52,3 Punkten vorausgesagt.
Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert ein Wachstum,
ein Stand unter 50 Punkten dagegen ein Schrumpfen der
Geschäftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor.
twe/phi

03.04. 00:10
USA: Bush will volle Steuersenkung durchboxen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie der Sprecher von US-Präsident Bush, Ari Fleischer, am späten Mittwoch abend bekannt gab, will sich Bush nicht damit zufrieden geben, dass der Senat die geplanten Steuerersparnisse der kommenden 10 Jahre nun halbieren will. Bushs Pläne waren auf eine Steuererleichterung von 726 Milliarden $ in den kommenden 10 Jahren hinausgegangen und dies solle so auch durchgesetzt werden.
Aufgrund der massiven Kriegskosten hatte der Senat zuletzt entschieden, nur 350 Milliarden $ davon zu genehmigen. Das Repräsentantenhaus hatte der ursprünglichen Summe zugestimmt. Nun soll der Vermittlungsausschuss zwischen beiden Häusern zum Einsatz kommen.
-------------
Der blödeste Präsident den Amerika gesehen hat
USA: Bush will volle Steuersenkung durchboxen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie der Sprecher von US-Präsident Bush, Ari Fleischer, am späten Mittwoch abend bekannt gab, will sich Bush nicht damit zufrieden geben, dass der Senat die geplanten Steuerersparnisse der kommenden 10 Jahre nun halbieren will. Bushs Pläne waren auf eine Steuererleichterung von 726 Milliarden $ in den kommenden 10 Jahren hinausgegangen und dies solle so auch durchgesetzt werden.
Aufgrund der massiven Kriegskosten hatte der Senat zuletzt entschieden, nur 350 Milliarden $ davon zu genehmigen. Das Repräsentantenhaus hatte der ursprünglichen Summe zugestimmt. Nun soll der Vermittlungsausschuss zwischen beiden Häusern zum Einsatz kommen.
-------------
Der blödeste Präsident den Amerika gesehen hat

http://www.finanzen.net/news/news_detail.asp?NewsNr=108042
Morgan Stanley erwartet weltweite Rezession
04.04.2003 16:20:00
Die US-Investmentbank Morgan Stanley gab am Freitag bekannt, dass sie in ihrer aktuellen Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft nun eine Rezession sieht, was auf den Irak-Krieg, geopolitische Unsicherheiten sowie die Auswirkungen des SARS-Virus auf das Wachstum in Asien zurückgeführt wird. Dem Unternehmen zufolge ist man damit die erste Bank an der Wall Street, die eine weltweite Rezession prognostiziert.
Die übliche Definition für eine Rezession in einem einzelnen Land beschreibt zwei aufeinander folgende Quartale einer Kontraktion. Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass die gesamte Welt gleichzeitig einer Kontraktion unterliegt, sind Volkswirte der Ansicht, dass ein niedriges Level an globalem Wachstum bereits einer weltweiten Rezession entspricht.
Morgan Stanley konstatiert demzufolge eine weltweite Rezession, wenn das globale Wachstum unter 2,5 Prozent fällt.
Für 2003 korrigiert die Bank ihre Wachstumsprognose von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent nach unten, was somit eine Rezession bedeuten würde.
Die Aktie von Morgan Stanley verliert an der NYSE vorbörslich aktuell 2,01 Prozent auf 40,94 Dollar.
------------
lauter profis unterwegs
wenn ich 1 million kreditlinie hab, bin ich auch millionär
Morgan Stanley erwartet weltweite Rezession
04.04.2003 16:20:00
Die US-Investmentbank Morgan Stanley gab am Freitag bekannt, dass sie in ihrer aktuellen Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft nun eine Rezession sieht, was auf den Irak-Krieg, geopolitische Unsicherheiten sowie die Auswirkungen des SARS-Virus auf das Wachstum in Asien zurückgeführt wird. Dem Unternehmen zufolge ist man damit die erste Bank an der Wall Street, die eine weltweite Rezession prognostiziert.
Die übliche Definition für eine Rezession in einem einzelnen Land beschreibt zwei aufeinander folgende Quartale einer Kontraktion. Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass die gesamte Welt gleichzeitig einer Kontraktion unterliegt, sind Volkswirte der Ansicht, dass ein niedriges Level an globalem Wachstum bereits einer weltweiten Rezession entspricht.
Morgan Stanley konstatiert demzufolge eine weltweite Rezession, wenn das globale Wachstum unter 2,5 Prozent fällt.

Für 2003 korrigiert die Bank ihre Wachstumsprognose von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent nach unten, was somit eine Rezession bedeuten würde.
Die Aktie von Morgan Stanley verliert an der NYSE vorbörslich aktuell 2,01 Prozent auf 40,94 Dollar.
------------
lauter profis unterwegs

wenn ich 1 million kreditlinie hab, bin ich auch millionär

15:01 Uhr
US-Militär verteidigt Einsatz von Streu- und Splitterbomben
Doha (dpa) - Das US-Militär in Katar hat den Einsatz von Streu- und Splitterbomben verteidigt. Die Angriffsziele würden sorgfältig ausgewählt, sagte General Vincent Brooks im Zentralkommando in Doha. Solche Waffen würden aus taktischen Gründen eingesetzt, etwa, um den Vormarsch einer irakischen Einheit zu verhindern. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte Sorge über den Einsatz der Bomben geäußert. Das IKRK setzt sich dafür ein, dass solche Waffen nur weit außerhalb von Gegenden mit Zivilisten eingesetzt werden.

US-Militär verteidigt Einsatz von Streu- und Splitterbomben
Doha (dpa) - Das US-Militär in Katar hat den Einsatz von Streu- und Splitterbomben verteidigt. Die Angriffsziele würden sorgfältig ausgewählt, sagte General Vincent Brooks im Zentralkommando in Doha. Solche Waffen würden aus taktischen Gründen eingesetzt, etwa, um den Vormarsch einer irakischen Einheit zu verhindern. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte Sorge über den Einsatz der Bomben geäußert. Das IKRK setzt sich dafür ein, dass solche Waffen nur weit außerhalb von Gegenden mit Zivilisten eingesetzt werden.

Da wird immer vom hoch verschuldeten US-Bürger geschrieben!
Bei uns sieht´s aber auch nicht so pralle aus.
Viele Haushalte sind überschuldet
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/398629…
Gruß
Atze 2
Bei uns sieht´s aber auch nicht so pralle aus.

Viele Haushalte sind überschuldet
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/398629…
Gruß
Atze 2
atze
logo hammer auch viele die schulden ham.
die amis haben dann noch aktien die kaum was wert sind.
und viele sind per kredit rein.
bei uns ist die aktienqoute unter 10 prozent
logo hammer auch viele die schulden ham.
die amis haben dann noch aktien die kaum was wert sind.
und viele sind per kredit rein.
bei uns ist die aktienqoute unter 10 prozent

Ich denke, da findet nur eine Umverteilung der Besitzverhaeltnisse statt. Die Privaten verkaufen ihre Aktien und die, denen sowieso schon fast alles(grossteil der Staatsschulden) gehoert, kaufen eben die Aktien auch noch auf.
Was soll`s!
Dann sind bald alle bei den Grossbanken direkt oder indirekt verschuldet.
Wo soll das alles enden?
Was soll`s!
Dann sind bald alle bei den Grossbanken direkt oder indirekt verschuldet.
Wo soll das alles enden?
http://nachrichten.boerse.de/anzeige.php3?id=59d2b5ff
Roland Leuschel
Das Universum und die Dummheit der Menschen …
Auch die Leser der boerse.de Kolumnen dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die Augen, Ohren und Nasen voll haben mit Bildern der Fernsehkanäle, auf denen geschossen und gebombt wird, auf denen explodierende Raketen und schreiende Kinder zu sehen sind, von Experten die eine Erfolgsmeldung nach der anderen geben und uns die Kriegstaktiken erklären, und wir sind erstaunt, dass anscheinend die ganze Welt von Nahost-Militärexperten wimmelt. Die TV-Zuschauer dürften aber vor allem die Nase voll haben von dem Gestank, den all die Lügen verbreiten, die auf uns einprasseln. Einer der wenigen Augenblicke der Wahrheit : Im ZDF wurde der wohl bekannteste Nahost-Spezialist, Peter Scholl-Latour, gefragt, wie er erklären kann, dass die Amerikaner wohl tatsächlich daran geglaubt hatten, sie würden bei den Schijten in Basra willkommen sein, nachdem sie vor 12 Jahren von den Amerikanern im Stich gelassen worden waren ? Scholl-Latour antwortete : « Die Dummheit der Menschen kennt keine Grenzen. » Eine klare und präzise Antwort, sie erinnert an einen Ausspruch eines der intelligentesten Wesen, das die Menschheit hervorgebracht hat, Albert Einstein, der sagte : « Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschheit, wobei das erste noch nicht endgültig bewiesen ist. » Diese Antwort hätte Albert Einstein auch heute gegeben, wenn jemand ihn nach dem Sinn und der Berechtigung dieses Krieges gefragt hätte.
Die Aktienbörsen haben am 12. März dieses Jahres einen neuen Tiefstpunkt erreicht (Dax 2.198), und als der Kriegsbeginn für jeden Anleger sichtbar wurde, setzte eine allgemeine Kursrallye ein, da die « Unsicherheit aus dem Markt war » (auch hier scheinen Einsteins Worte zu gelten). Ich würde sagen, mit Kriegsbeginn entstanden enorm viele neue Unsicherheiten, die auch die Wirtschaft und damit die Börsen belasten werden. Viele Experten sahen in der fulminanten Börsenerholung (in einer Woche stiegen Dax um 23%, Dow Jones um 9% etc.), bereits das Ende der dreijährigen Baisseperiode und animierten die Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Daueroptimist Heiko Thieme schrieb in der FAZ vom 24.3. : « Eine solche achttätige Rekordsträhne ohne Unterbrechung hat es in der fast 107 Jahre alten Geschichte des Dow Jones bisher noch nie gebeben. »… und er las den Realisten unter den Experten die Leviten : « Die jüngste Entwicklung hat die Pessimisten, die drei Jahre lang die Oberhand hielten, in ihre Schranken verwiesen. », gerade Heiko Thieme, der den Anlegern und der Börsenwelt bewiesen hat, wohin blinder Daueroptimismus bei Aktien führen kann. Still und leise hat er seinen in Luxemburg aufgelegten Fonds, den Thieme Fonds International, geschlossen. Er war im vergangenen Jahr der schlechteste globale Aktienfonds. « Heiko Thieme gilt in Branchenkreisen als einer der schlechtesten Fondsmanager der USA. 2002 verlor sein Fonds fast 70%. Das ist doppelt so viel wie der MSCI World. », so der Originalton von BoerseOnline Nr : 12/2003.
Auch eine der grössten amerikanischen Investmentbanken, Morgan Stanley, trompetete mit Vehemenz ins optimistische Horn : « Der Beginn der Kampfhandlungen hat die zuvor verzeichnete Ungewissheit über die Entwicklung des Irak-Konflikts beseitigt. Die Risikoscheu der Anleger sinkt, und der Ölpreis fällt. » Nach dem eigenen MS-Modell sollte das Kursniveau in Europa noch um weitere 20% steigen, auch wenn die Rendite von Staatsanleihen im Euroraum auf 4,75 anziehen sollte. Ich könnte die Liste der Techniker und Volkswirte weiterführen, die in ihrer ersten Etappe eine Erholung des Daxes bis mindestens 3.500 erwarten (gegenüber dem Tiefstpunkt vom 12.03 wären das immerhin +60% !).
Ich schlage vor, in solch unsicheren Zeiten sollte der Anleger sich an einige fundamentale Fakten halten und versuchen mit Hilfe seines gesunden Menschenverstandes eine Anlagepolitik zu finden, die sein Kapital erhält, und wenn er etwas Glück hat, um 4 bis 6% per annum erhöht. Die Fakten :
Weltweit wurden seit dem Frühjahr 2000 Aktienvermögen von über 12.000 Milliarden Dollar vernichtet (entspricht einem Drittel des augenblicklichen, weltweiten Jahres-Bruttosozialproduktes). Wir haben die grösste Aktienbaisse erlebt, seitdem es Aktien gibt, und sie ist mittlerweile auch die Längste, sie dauerte 36 Monate, gegenüber 34 Monaten in den Jahren 1929 bis 1932. Wer glaubt, eine derartige Kapitalvernichtung hätte keine realwirtschaftlichen Folgen, der irrt gewaltig, zumal aufgrund der Medien und der Banken die Aktienanlage in den 90er Jahren als die rentabelste Anlageinvestition überhaupt angepriesen wurde, und die Anleger nicht nur im Privatsektor sondern auch bei Versicherungen und Pensionskassen die Aktienbestände auf nie gekannte Höhen getrieben hatten. Der renommierte amerikanische Broker, Goldman Sachs, fasste in seiner Studie « Lessons from the Boom and Bust » fünf Schlussfolgerungen zusammen, deren vierte heisst : « Börse und Realwirtschaft wirken so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven, selbstverstärkenden Prozessen, als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge. » Sie kennen die von mir in dieser Kolumne schon öfters vertretene Meinung, dass die Weltwirtschaftskrise II droht. Auch Goldman Sachs schreibt, dass diese Börsenbaisse eine Grössenordnung erreicht hat, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft darstellt.
Der Anleger hat in den drei Jahren der Aktienbaisse eine Risikoaversion gegenüber Aktien und im Gegensatz dazu ein völlig fehlendes Risikobewustsein bei Anleihen entwickelt, sodass er jetzt Gefahr läuft, bei einem Rentenmarktcrash ein zweites mal auf die Nase zu fallen, so schreibt der Chefredakteur von BoerseOnline Johannes Scherer in der letzten Ausgabe : « Deshalb schichten Aktienanleger bereits seit Monaten ihr Kapital in Rentenwerte um und kommen jetzt womöglich vom Regen in die Traufe ; denn die Flucht in länger laufende Zinspapiere hat deren Kurse dermassen nach oben gejagt, dass die Blase zu platzen droht. »
Fazit für den Anleger : Die augenblickliche Kurserholung ist eine zeitlich begrenzte (2 bis 3 Wochen ?) in einem Baissemarkt, der noch einige Jahre andauern wird (2000 bis 2012). Wer seine Kauflimite bei Qualitätsaktien im vergangenen Monat gelegt hat, hat diese Aktien bekommen und kann sie mit 20 bis 30% Kursgewinn verkaufen. Er sollte also nach wie vor Trading mit Aktien machen, aber schon heute die nächsten Kaufkurse in den Markt legen. Insgesamt sollte aber der Anteil der Aktien eines Portefeuilles nicht 20 bis 30% überschreiten, der Rest sollte wie gehabt in Triple A Kurzläufern angelegt sein, und vergessen Sie nicht 5 bis 10% in Gold zu legen. Die jetzige Kursschwäche (330 Dollar) ist ein günstiger Einsteigspreis, da die nächste Inflationswelle mit Sicherheit kommt. Schliesslich kostet der Krieg viel viel Geld.
Wieweit die Aktienkrise in Japan bereits fortgeschritten ist, zeigt der in einer einberufenen Krisensitzung der Bank of Japan in Tokio beschlossene Aktienkauf von 24 Milliarden Euro aus dem Beteiligungsbesitz finanziell angeschlagener Banken. Es steht sehr schlecht um das Bankensystem in Japan, und ein Kollaps würde mit Sicherheit Rückwirkungen auf das gesamte internationale Bankensystem haben.
Roland Leuschel
27.03.2003
Roland Leuschel
Das Universum und die Dummheit der Menschen …
Auch die Leser der boerse.de Kolumnen dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit die Augen, Ohren und Nasen voll haben mit Bildern der Fernsehkanäle, auf denen geschossen und gebombt wird, auf denen explodierende Raketen und schreiende Kinder zu sehen sind, von Experten die eine Erfolgsmeldung nach der anderen geben und uns die Kriegstaktiken erklären, und wir sind erstaunt, dass anscheinend die ganze Welt von Nahost-Militärexperten wimmelt. Die TV-Zuschauer dürften aber vor allem die Nase voll haben von dem Gestank, den all die Lügen verbreiten, die auf uns einprasseln. Einer der wenigen Augenblicke der Wahrheit : Im ZDF wurde der wohl bekannteste Nahost-Spezialist, Peter Scholl-Latour, gefragt, wie er erklären kann, dass die Amerikaner wohl tatsächlich daran geglaubt hatten, sie würden bei den Schijten in Basra willkommen sein, nachdem sie vor 12 Jahren von den Amerikanern im Stich gelassen worden waren ? Scholl-Latour antwortete : « Die Dummheit der Menschen kennt keine Grenzen. » Eine klare und präzise Antwort, sie erinnert an einen Ausspruch eines der intelligentesten Wesen, das die Menschheit hervorgebracht hat, Albert Einstein, der sagte : « Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschheit, wobei das erste noch nicht endgültig bewiesen ist. » Diese Antwort hätte Albert Einstein auch heute gegeben, wenn jemand ihn nach dem Sinn und der Berechtigung dieses Krieges gefragt hätte.
Die Aktienbörsen haben am 12. März dieses Jahres einen neuen Tiefstpunkt erreicht (Dax 2.198), und als der Kriegsbeginn für jeden Anleger sichtbar wurde, setzte eine allgemeine Kursrallye ein, da die « Unsicherheit aus dem Markt war » (auch hier scheinen Einsteins Worte zu gelten). Ich würde sagen, mit Kriegsbeginn entstanden enorm viele neue Unsicherheiten, die auch die Wirtschaft und damit die Börsen belasten werden. Viele Experten sahen in der fulminanten Börsenerholung (in einer Woche stiegen Dax um 23%, Dow Jones um 9% etc.), bereits das Ende der dreijährigen Baisseperiode und animierten die Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Daueroptimist Heiko Thieme schrieb in der FAZ vom 24.3. : « Eine solche achttätige Rekordsträhne ohne Unterbrechung hat es in der fast 107 Jahre alten Geschichte des Dow Jones bisher noch nie gebeben. »… und er las den Realisten unter den Experten die Leviten : « Die jüngste Entwicklung hat die Pessimisten, die drei Jahre lang die Oberhand hielten, in ihre Schranken verwiesen. », gerade Heiko Thieme, der den Anlegern und der Börsenwelt bewiesen hat, wohin blinder Daueroptimismus bei Aktien führen kann. Still und leise hat er seinen in Luxemburg aufgelegten Fonds, den Thieme Fonds International, geschlossen. Er war im vergangenen Jahr der schlechteste globale Aktienfonds. « Heiko Thieme gilt in Branchenkreisen als einer der schlechtesten Fondsmanager der USA. 2002 verlor sein Fonds fast 70%. Das ist doppelt so viel wie der MSCI World. », so der Originalton von BoerseOnline Nr : 12/2003.
Auch eine der grössten amerikanischen Investmentbanken, Morgan Stanley, trompetete mit Vehemenz ins optimistische Horn : « Der Beginn der Kampfhandlungen hat die zuvor verzeichnete Ungewissheit über die Entwicklung des Irak-Konflikts beseitigt. Die Risikoscheu der Anleger sinkt, und der Ölpreis fällt. » Nach dem eigenen MS-Modell sollte das Kursniveau in Europa noch um weitere 20% steigen, auch wenn die Rendite von Staatsanleihen im Euroraum auf 4,75 anziehen sollte. Ich könnte die Liste der Techniker und Volkswirte weiterführen, die in ihrer ersten Etappe eine Erholung des Daxes bis mindestens 3.500 erwarten (gegenüber dem Tiefstpunkt vom 12.03 wären das immerhin +60% !).
Ich schlage vor, in solch unsicheren Zeiten sollte der Anleger sich an einige fundamentale Fakten halten und versuchen mit Hilfe seines gesunden Menschenverstandes eine Anlagepolitik zu finden, die sein Kapital erhält, und wenn er etwas Glück hat, um 4 bis 6% per annum erhöht. Die Fakten :
Weltweit wurden seit dem Frühjahr 2000 Aktienvermögen von über 12.000 Milliarden Dollar vernichtet (entspricht einem Drittel des augenblicklichen, weltweiten Jahres-Bruttosozialproduktes). Wir haben die grösste Aktienbaisse erlebt, seitdem es Aktien gibt, und sie ist mittlerweile auch die Längste, sie dauerte 36 Monate, gegenüber 34 Monaten in den Jahren 1929 bis 1932. Wer glaubt, eine derartige Kapitalvernichtung hätte keine realwirtschaftlichen Folgen, der irrt gewaltig, zumal aufgrund der Medien und der Banken die Aktienanlage in den 90er Jahren als die rentabelste Anlageinvestition überhaupt angepriesen wurde, und die Anleger nicht nur im Privatsektor sondern auch bei Versicherungen und Pensionskassen die Aktienbestände auf nie gekannte Höhen getrieben hatten. Der renommierte amerikanische Broker, Goldman Sachs, fasste in seiner Studie « Lessons from the Boom and Bust » fünf Schlussfolgerungen zusammen, deren vierte heisst : « Börse und Realwirtschaft wirken so aufeinander zurück, dass es sowohl zu positiven, selbstverstärkenden Prozessen, als auch zu Teufelskreisen kommt. Übertreibungen an den Märkten und in der Realwirtschaft in beide Richtungen sind die Folge. » Sie kennen die von mir in dieser Kolumne schon öfters vertretene Meinung, dass die Weltwirtschaftskrise II droht. Auch Goldman Sachs schreibt, dass diese Börsenbaisse eine Grössenordnung erreicht hat, die eine ernsthafte Gefahr für die gesamte Weltwirtschaft darstellt.
Der Anleger hat in den drei Jahren der Aktienbaisse eine Risikoaversion gegenüber Aktien und im Gegensatz dazu ein völlig fehlendes Risikobewustsein bei Anleihen entwickelt, sodass er jetzt Gefahr läuft, bei einem Rentenmarktcrash ein zweites mal auf die Nase zu fallen, so schreibt der Chefredakteur von BoerseOnline Johannes Scherer in der letzten Ausgabe : « Deshalb schichten Aktienanleger bereits seit Monaten ihr Kapital in Rentenwerte um und kommen jetzt womöglich vom Regen in die Traufe ; denn die Flucht in länger laufende Zinspapiere hat deren Kurse dermassen nach oben gejagt, dass die Blase zu platzen droht. »
Fazit für den Anleger : Die augenblickliche Kurserholung ist eine zeitlich begrenzte (2 bis 3 Wochen ?) in einem Baissemarkt, der noch einige Jahre andauern wird (2000 bis 2012). Wer seine Kauflimite bei Qualitätsaktien im vergangenen Monat gelegt hat, hat diese Aktien bekommen und kann sie mit 20 bis 30% Kursgewinn verkaufen. Er sollte also nach wie vor Trading mit Aktien machen, aber schon heute die nächsten Kaufkurse in den Markt legen. Insgesamt sollte aber der Anteil der Aktien eines Portefeuilles nicht 20 bis 30% überschreiten, der Rest sollte wie gehabt in Triple A Kurzläufern angelegt sein, und vergessen Sie nicht 5 bis 10% in Gold zu legen. Die jetzige Kursschwäche (330 Dollar) ist ein günstiger Einsteigspreis, da die nächste Inflationswelle mit Sicherheit kommt. Schliesslich kostet der Krieg viel viel Geld.
Wieweit die Aktienkrise in Japan bereits fortgeschritten ist, zeigt der in einer einberufenen Krisensitzung der Bank of Japan in Tokio beschlossene Aktienkauf von 24 Milliarden Euro aus dem Beteiligungsbesitz finanziell angeschlagener Banken. Es steht sehr schlecht um das Bankensystem in Japan, und ein Kollaps würde mit Sicherheit Rückwirkungen auf das gesamte internationale Bankensystem haben.
Roland Leuschel
27.03.2003
http://www.sueddeutsche.de/index.php?url=/wirtschaft/aktuell…
04.04.2003
Arbeitslos im Silicon Valley
Qualifiziert, motiviert, überflüssig
Einst gut bezahlte Manager und Technologie-Experten schlagen sich durch einen neuen Alltag – mit geringer Aussicht auf neue Jobs und ohne staatliche Hilfe.
Von Antonie Bauer
(SZ vom 05.04.2003) — Wahrscheinlich sind es die Blumen, die ihr am meisten fehlen. Die Blumen in dem hübschen Gärtchen vor dem Fenster und die bunten Sträuße, die sich Jenn Accettola früher jede Woche auf dem Bauernmarkt holte. Früher hätten vier oder fünf Vasen mit duftenden Anemonen, Rosen und Narzissen die Wohnung geschmückt – der einzige Luxus, den sich die junge Kalifornierin regelmäßig leistete.
Früher war so manches anders. Damals hatte Jenn noch einen Job und eine komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung. Heute lebt sie mit ihrem schwarzen Kater Carmine in einem heruntergekommenen Block im Industrieviertel Soma, als Aussicht hat sie die Hauswand gegenüber und Tauben auf dem Fensterbrett.
Tisch, Stühle, Sessel und viele Bücher hat sie verschenkt, die verbliebenen Habseligkeiten aus besseren Zeiten drängen sich auf wenigen Quadratmetern. Doch selbst das ist heute Luxus. Demnächst muss die 33-Jährige hier ausziehen, weil sie nicht weiß, wie sie die monatliche Miete von 800 Dollar aufbringen soll. Unterschlupf findet sie dann wahrscheinlich im ausgebauten Keller eines Freundes.
Jenn Accettola ist seit November 2000 arbeitslos. Anfangs hat ihr das wenig Kopfschmerzen bereitet, denn üppig bezahlte Jobs für Projektmanager und Internetproduzenten wie sie gab es erfahrungsgemäß wie Sand am Meer. Also reiste sie erst einmal nach Jamaica und Cuba, bewarb sich dann im Januar – und hatte in kürzester Zeit ein halbes Dutzend Angebote.
Von einem Tag auf den anderen alles vorbei
Die Freude währte nicht lang. So schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden die Offerten. Einige Firmen hatten über Nacht ihre Budgets zusammengestrichen, andere schlossen innerhalb weniger Wochen ganz. Die Internet- und High-Tech-Blase, die San Francisco und dem Silicon Valley vorübergehend unglaublichen Reichtum und Vollbeschäftigung beschert hatte, war von einem Tag auf den anderen geplatzt.
Die offiziellen Arbeitslosenstatistiken geben nur einen reichlich verwässerten Eindruck der Katastrophe, die sich am hiesigen Stellenmarkt seither ereignet hat.
San Francisco hatte zuletzt eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent, im südlichen Silicon Valley um Santa Clara betrug sie 8,5 Prozent. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Von Ende 2000 bis Ende 2002 haben alleine die Großräume San Francisco und San Jose ein gutes Neuntel aller Stellen verloren, in Santa Clara ist Schätzungen zufolge fast jeder fünfte Job verschwunden.
Die Menschen, die so ihren Job verloren, finden sich in den offiziellen Statistiken oft nicht wieder. Wer etwa nach Hunderten von erfolglosen Bewerbungen die Suche aufgegeben hat oder sich mit Handlangerarbeiten über Wasser hält, während er weiter nach einer qualifizierten Stelle sucht, gilt nicht als arbeitslos. Andere packen ihre Koffer, denn die Region um San Francisco zählt zu den teuersten Flecken der Erde.
„Warten bis die Vernunft einkehrt“
Deshalb belastet auch Dan Jones die offiziellen Zahlen für San Francisco nicht. Als er vor zwei Jahren seinen gut sechsstellig dotierten Posten als Vizepräsident eines Technologie-Unternehmens an den Nagel hängte, um sich von einer aufwändigen Knieoperation zu erholen, zog er in seine Hütte im Skifahrerparadies Crested Butte – in der irrigen Annahme, dass er problemlos wieder einen Topjob im High-Tech-Mekka an Land ziehen würde. Doch das Telefon blieb still.
Die Headhunter, die ihn bis dahin mit Stellenangeboten förmlich bombardiert hatten, haben nichts mehr von sich hören lassen. Viele von ihnen haben selbst den Job verloren. Heute genießt der 55-Jährige immer noch den Blick auf die schneebedeckten Berge Colorados, verdient als freiberuflicher Berater ein paar Dollar dazu, fährt Ski und wartet, „bis in der Welt der Technologie wieder Vernunft einkehrt“ und seine Dienste wieder gefragt sind.
» Zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine Jobs mehr. «
Jones gehört wie Accettola zu einer ganz neuen Klasse von Langzeit-Arbeitslosen: hoch qualifiziert, hoch motiviert und dennoch kaum vermittelbar. Keiner will sie haben. Die Internet-Firmen, die einst den Markt für Internet-Designer und Technologie-Experten leergefegt haben, sind längst pleite; die High-Tech-Unternehmen, die einst gar nicht genug Informatiker und Marketingspezialisten bekommen konnten, sparen eisern und ringen mit Massenentlassungen ums Überleben.
Auch der Rest der Wirtschaft hat denkbar wenig Interesse. Anders als in früheren Jahren hat die jüngste Rezession vor allem die Oberschicht der Beschäftigten ihre Jobs gekostet; anders als ihre Kollegen im Blaumann tun sie sich sehr schwer, neue Stellen zu finden. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Hochqualifizierten, die länger als sechs Monate arbeitslos waren, verdoppelt.
Es gibt einfach keine Jobs mehr
Einer von ihnen ist der Computerexperte und Netzwerkspezialist Matt Pausa, bis Anfang Mai 2001 Manager bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers. Damals verlegte sein Arbeitgeber das Büro an die Ostküste und setzte den heute 44-Jährigen mit einem ansehnlichen Abfindungsscheck auf die Straße. Wie Accettola nahm sich Pausa erst einmal ein Weilchen frei und begann dann, sich nach einer neuen Stelle umzusehen.
Umsonst: „Zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine Jobs mehr.“ Pausa verschickte eine Bewerbung nach der anderen und bekam nie auch nur eine Absage. Langsam wurde er nervös. „Ich fragte mich immer wieder, warum ich keinen Job bekomme. Dabei habe ich doch einen Super-Lebenslauf.“ Schließlich rief er einen Personalmanager an und fragte nach.
Der erklärte ihm, dass sich fast 800 Kandidaten um eine Stelle rangelten. „Da wusste ich, dass etwas passieren muss“, sagt der blonde Computerexperte. Immerhin zahlt er monatlich alleine 2850 Dollar an Hypotheken für sein geräumiges Haus hoch auf einem Hügel in San Francisco.
Pausa kam seine handwerkliche Begabung zugute. Der Mann, der „von allem ein bisschen“ kann, begann, Bekannten bei Reparaturen zu helfen. „Das hat sich dann schnell herumgesprochen.“ Heute werkelt „Handy Matt“ von früh bis spät, klempnert, streicht Wände, schraubt Kleiderhaken an oder befestigt Scharniere.
Seinen Stundensatz hat er dank der großen Nachfrage auf 40 Dollar verdoppelt, die Hypotheken kann er in den meisten Monaten mühelos bedienen.
» Ich mache mir ständig Sorgen ums Geld. «
Die amerikanischen Arbeitslosen zeigen eine Flexibilität, von der deutsche Arbeitsämter nur träumen können. Freilich zwingen sie auch die harschen Rahmenbedingungen dazu.
Der schwierige Weg vom Manager zum Tellerwäscher
Accettola etwa bekam gerade mal acht Monate lang Arbeitslosengeld, 750 Dollar im Monat. Das reichte nicht mal für die Miete. Spar- und Rentenkonten sind längst geplündert, die Kreditkarten mit 15.000 Dollar im Minus. Die Existenzangst gehört zum Alltag: „Ich mache mir ständig Sorgen ums Geld.“
Was interessiert es da schon, dass sie studiert hat, Computer beherrscht und normalerweise zwischen 70.000 und 80.000 Dollar im Jahr verdient hat?
Die ehemalige Projektmanagerin ist sich für keinen Job zu schade. Vier Monate lang hat sie auf dem Bau geschuftet und Seite an Seite mit ehemaligen Strafgefangenen Plastikzylinder mit Zement herumgewuchtet, mehr als 20 Tonnen am Tag. Zuletzt hat sie für sieben Dollar fünfzig die Stunde den Eingang eines Geschäfts für Musikinstrumente bewacht, bis ihr der ständige ohrenbetäubende Lärm dann doch zu viel wurde.
Momentan ernährt sie sich vor allem von Aufträgen der Bostoner Unternehmensberatung Millennium. Rund 20 Stunden in der Woche sitzt Accettola an ihrem Computer, den sie in einen Einbauschrank gezwängt hat – für einen Schreibtisch fehlt der Platz – und arbeitet an Projekten wie einer Fallstudie zu Software-Problemen. Das bringt ihr im Monat gut 1000 Dollar ein.
Damit kann sie in San Francisco freilich nicht überleben. Zwischen 1700 und 2000 Dollar brauche sie im Monat mindestens, sagt Accettola, obwohl sie wirklich nicht auf großem Fuße lebe. Zu den 800 Dollar für die Miete kommen alleine schon 300 Dollar an Zinsen und Gebühren für ihre Kreditkartenschulden, außerdem die Ausgaben für Telefon, Lebensmittel und Bustickets.
Nicht zu vergessen die Kosten der Jobsuche: Nach wie vor schickt Accettola täglich ein bis zwei Bewerbungen raus. In letzter Zeit hatte sie sogar ein paar Vorstellungsgespräche. Herausgekommen ist dabei allerdings noch nichts. Dabei würde sie fast alles machen, was mehr als den Mindestlohn einbringt.
» Wenn ich Leute dazu bringen kann, Hunderttausende von Dollars für Web-Projekte auszugeben, dann sollte ich doch in der Lage sein, die Gäste zuvorkommend zu behandeln. «
Doch der Weg vom Manager zum Tellerwäscher ist nicht einfach. „Es ist schier unmöglich, beispielsweise einen Job als Bedienung im Restaurant zu bekommen, wenn man keine Erfahrung hat. Aber wenn ich Leute dazu bringen kann, Hunderttausende von Dollars für Web-Projekte auszugeben, dann sollte ich doch in der Lage sein, die Gäste zuvorkommend zu behandeln“, klagt die hoch gewachsene Kalifornierin.
Für ihre Bewerbungen auf einfache Bürojobs hat sie sogar eigens abgespeckte Lebensläufe verfasst. Ohne Erfolg: Es heiße immer noch, sie sei überqualifiziert und werde sich nur langweilen. Ihre größten Hoffnungen setzt Accettola derzeit auf die Online-Abteilung der Bekleidungskette Gap und den Auswärtigen Dienst. Die mündliche Prüfung dafür hat sie schon bestanden.
Vorsichtig in Zeiten der Krise
Manchmal hilft Flexibilität ja doch – vor allem, wenn gute Beziehungen dazukommen. Pausa ist jedenfalls seit einigen Tagen in heller Aufregung, denn er hat Aussicht auf eine feste Stelle. Ein Freund will ein populäres Straßencafe kaufen, der frühere IT-Manager soll die Geschäftsführung übernehmen.
Wenn alles glatt geht, wird er demnächst über 14 Mitarbeiter gebieten und sich den Kopf über einen einladenderen Eingang und die Qualität der Bratkartoffeln zerbrechen dürfen.
Seinen kleinen Handwerksbetrieb will er dennoch nach Feierabend und am Wochenende weiterführen. Denn nach fast zwei Jahren ohne Job ist Pausa vorsichtig geworden: „Wenn ich meine neue Stelle verlieren sollte, habe ich dann immer noch etwas, wovon ich leben kann.“

04.04.2003
Arbeitslos im Silicon Valley
Qualifiziert, motiviert, überflüssig
Einst gut bezahlte Manager und Technologie-Experten schlagen sich durch einen neuen Alltag – mit geringer Aussicht auf neue Jobs und ohne staatliche Hilfe.
Von Antonie Bauer
(SZ vom 05.04.2003) — Wahrscheinlich sind es die Blumen, die ihr am meisten fehlen. Die Blumen in dem hübschen Gärtchen vor dem Fenster und die bunten Sträuße, die sich Jenn Accettola früher jede Woche auf dem Bauernmarkt holte. Früher hätten vier oder fünf Vasen mit duftenden Anemonen, Rosen und Narzissen die Wohnung geschmückt – der einzige Luxus, den sich die junge Kalifornierin regelmäßig leistete.
Früher war so manches anders. Damals hatte Jenn noch einen Job und eine komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung. Heute lebt sie mit ihrem schwarzen Kater Carmine in einem heruntergekommenen Block im Industrieviertel Soma, als Aussicht hat sie die Hauswand gegenüber und Tauben auf dem Fensterbrett.
Tisch, Stühle, Sessel und viele Bücher hat sie verschenkt, die verbliebenen Habseligkeiten aus besseren Zeiten drängen sich auf wenigen Quadratmetern. Doch selbst das ist heute Luxus. Demnächst muss die 33-Jährige hier ausziehen, weil sie nicht weiß, wie sie die monatliche Miete von 800 Dollar aufbringen soll. Unterschlupf findet sie dann wahrscheinlich im ausgebauten Keller eines Freundes.
Jenn Accettola ist seit November 2000 arbeitslos. Anfangs hat ihr das wenig Kopfschmerzen bereitet, denn üppig bezahlte Jobs für Projektmanager und Internetproduzenten wie sie gab es erfahrungsgemäß wie Sand am Meer. Also reiste sie erst einmal nach Jamaica und Cuba, bewarb sich dann im Januar – und hatte in kürzester Zeit ein halbes Dutzend Angebote.
Von einem Tag auf den anderen alles vorbei
Die Freude währte nicht lang. So schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden die Offerten. Einige Firmen hatten über Nacht ihre Budgets zusammengestrichen, andere schlossen innerhalb weniger Wochen ganz. Die Internet- und High-Tech-Blase, die San Francisco und dem Silicon Valley vorübergehend unglaublichen Reichtum und Vollbeschäftigung beschert hatte, war von einem Tag auf den anderen geplatzt.
Die offiziellen Arbeitslosenstatistiken geben nur einen reichlich verwässerten Eindruck der Katastrophe, die sich am hiesigen Stellenmarkt seither ereignet hat.
San Francisco hatte zuletzt eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent, im südlichen Silicon Valley um Santa Clara betrug sie 8,5 Prozent. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Von Ende 2000 bis Ende 2002 haben alleine die Großräume San Francisco und San Jose ein gutes Neuntel aller Stellen verloren, in Santa Clara ist Schätzungen zufolge fast jeder fünfte Job verschwunden.
Die Menschen, die so ihren Job verloren, finden sich in den offiziellen Statistiken oft nicht wieder. Wer etwa nach Hunderten von erfolglosen Bewerbungen die Suche aufgegeben hat oder sich mit Handlangerarbeiten über Wasser hält, während er weiter nach einer qualifizierten Stelle sucht, gilt nicht als arbeitslos. Andere packen ihre Koffer, denn die Region um San Francisco zählt zu den teuersten Flecken der Erde.
„Warten bis die Vernunft einkehrt“
Deshalb belastet auch Dan Jones die offiziellen Zahlen für San Francisco nicht. Als er vor zwei Jahren seinen gut sechsstellig dotierten Posten als Vizepräsident eines Technologie-Unternehmens an den Nagel hängte, um sich von einer aufwändigen Knieoperation zu erholen, zog er in seine Hütte im Skifahrerparadies Crested Butte – in der irrigen Annahme, dass er problemlos wieder einen Topjob im High-Tech-Mekka an Land ziehen würde. Doch das Telefon blieb still.
Die Headhunter, die ihn bis dahin mit Stellenangeboten förmlich bombardiert hatten, haben nichts mehr von sich hören lassen. Viele von ihnen haben selbst den Job verloren. Heute genießt der 55-Jährige immer noch den Blick auf die schneebedeckten Berge Colorados, verdient als freiberuflicher Berater ein paar Dollar dazu, fährt Ski und wartet, „bis in der Welt der Technologie wieder Vernunft einkehrt“ und seine Dienste wieder gefragt sind.
» Zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine Jobs mehr. «
Jones gehört wie Accettola zu einer ganz neuen Klasse von Langzeit-Arbeitslosen: hoch qualifiziert, hoch motiviert und dennoch kaum vermittelbar. Keiner will sie haben. Die Internet-Firmen, die einst den Markt für Internet-Designer und Technologie-Experten leergefegt haben, sind längst pleite; die High-Tech-Unternehmen, die einst gar nicht genug Informatiker und Marketingspezialisten bekommen konnten, sparen eisern und ringen mit Massenentlassungen ums Überleben.
Auch der Rest der Wirtschaft hat denkbar wenig Interesse. Anders als in früheren Jahren hat die jüngste Rezession vor allem die Oberschicht der Beschäftigten ihre Jobs gekostet; anders als ihre Kollegen im Blaumann tun sie sich sehr schwer, neue Stellen zu finden. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Hochqualifizierten, die länger als sechs Monate arbeitslos waren, verdoppelt.
Es gibt einfach keine Jobs mehr
Einer von ihnen ist der Computerexperte und Netzwerkspezialist Matt Pausa, bis Anfang Mai 2001 Manager bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers. Damals verlegte sein Arbeitgeber das Büro an die Ostküste und setzte den heute 44-Jährigen mit einem ansehnlichen Abfindungsscheck auf die Straße. Wie Accettola nahm sich Pausa erst einmal ein Weilchen frei und begann dann, sich nach einer neuen Stelle umzusehen.
Umsonst: „Zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine Jobs mehr.“ Pausa verschickte eine Bewerbung nach der anderen und bekam nie auch nur eine Absage. Langsam wurde er nervös. „Ich fragte mich immer wieder, warum ich keinen Job bekomme. Dabei habe ich doch einen Super-Lebenslauf.“ Schließlich rief er einen Personalmanager an und fragte nach.
Der erklärte ihm, dass sich fast 800 Kandidaten um eine Stelle rangelten. „Da wusste ich, dass etwas passieren muss“, sagt der blonde Computerexperte. Immerhin zahlt er monatlich alleine 2850 Dollar an Hypotheken für sein geräumiges Haus hoch auf einem Hügel in San Francisco.
Pausa kam seine handwerkliche Begabung zugute. Der Mann, der „von allem ein bisschen“ kann, begann, Bekannten bei Reparaturen zu helfen. „Das hat sich dann schnell herumgesprochen.“ Heute werkelt „Handy Matt“ von früh bis spät, klempnert, streicht Wände, schraubt Kleiderhaken an oder befestigt Scharniere.
Seinen Stundensatz hat er dank der großen Nachfrage auf 40 Dollar verdoppelt, die Hypotheken kann er in den meisten Monaten mühelos bedienen.
» Ich mache mir ständig Sorgen ums Geld. «
Die amerikanischen Arbeitslosen zeigen eine Flexibilität, von der deutsche Arbeitsämter nur träumen können. Freilich zwingen sie auch die harschen Rahmenbedingungen dazu.
Der schwierige Weg vom Manager zum Tellerwäscher
Accettola etwa bekam gerade mal acht Monate lang Arbeitslosengeld, 750 Dollar im Monat. Das reichte nicht mal für die Miete. Spar- und Rentenkonten sind längst geplündert, die Kreditkarten mit 15.000 Dollar im Minus. Die Existenzangst gehört zum Alltag: „Ich mache mir ständig Sorgen ums Geld.“
Was interessiert es da schon, dass sie studiert hat, Computer beherrscht und normalerweise zwischen 70.000 und 80.000 Dollar im Jahr verdient hat?
Die ehemalige Projektmanagerin ist sich für keinen Job zu schade. Vier Monate lang hat sie auf dem Bau geschuftet und Seite an Seite mit ehemaligen Strafgefangenen Plastikzylinder mit Zement herumgewuchtet, mehr als 20 Tonnen am Tag. Zuletzt hat sie für sieben Dollar fünfzig die Stunde den Eingang eines Geschäfts für Musikinstrumente bewacht, bis ihr der ständige ohrenbetäubende Lärm dann doch zu viel wurde.
Momentan ernährt sie sich vor allem von Aufträgen der Bostoner Unternehmensberatung Millennium. Rund 20 Stunden in der Woche sitzt Accettola an ihrem Computer, den sie in einen Einbauschrank gezwängt hat – für einen Schreibtisch fehlt der Platz – und arbeitet an Projekten wie einer Fallstudie zu Software-Problemen. Das bringt ihr im Monat gut 1000 Dollar ein.
Damit kann sie in San Francisco freilich nicht überleben. Zwischen 1700 und 2000 Dollar brauche sie im Monat mindestens, sagt Accettola, obwohl sie wirklich nicht auf großem Fuße lebe. Zu den 800 Dollar für die Miete kommen alleine schon 300 Dollar an Zinsen und Gebühren für ihre Kreditkartenschulden, außerdem die Ausgaben für Telefon, Lebensmittel und Bustickets.
Nicht zu vergessen die Kosten der Jobsuche: Nach wie vor schickt Accettola täglich ein bis zwei Bewerbungen raus. In letzter Zeit hatte sie sogar ein paar Vorstellungsgespräche. Herausgekommen ist dabei allerdings noch nichts. Dabei würde sie fast alles machen, was mehr als den Mindestlohn einbringt.
» Wenn ich Leute dazu bringen kann, Hunderttausende von Dollars für Web-Projekte auszugeben, dann sollte ich doch in der Lage sein, die Gäste zuvorkommend zu behandeln. «
Doch der Weg vom Manager zum Tellerwäscher ist nicht einfach. „Es ist schier unmöglich, beispielsweise einen Job als Bedienung im Restaurant zu bekommen, wenn man keine Erfahrung hat. Aber wenn ich Leute dazu bringen kann, Hunderttausende von Dollars für Web-Projekte auszugeben, dann sollte ich doch in der Lage sein, die Gäste zuvorkommend zu behandeln“, klagt die hoch gewachsene Kalifornierin.
Für ihre Bewerbungen auf einfache Bürojobs hat sie sogar eigens abgespeckte Lebensläufe verfasst. Ohne Erfolg: Es heiße immer noch, sie sei überqualifiziert und werde sich nur langweilen. Ihre größten Hoffnungen setzt Accettola derzeit auf die Online-Abteilung der Bekleidungskette Gap und den Auswärtigen Dienst. Die mündliche Prüfung dafür hat sie schon bestanden.
Vorsichtig in Zeiten der Krise
Manchmal hilft Flexibilität ja doch – vor allem, wenn gute Beziehungen dazukommen. Pausa ist jedenfalls seit einigen Tagen in heller Aufregung, denn er hat Aussicht auf eine feste Stelle. Ein Freund will ein populäres Straßencafe kaufen, der frühere IT-Manager soll die Geschäftsführung übernehmen.
Wenn alles glatt geht, wird er demnächst über 14 Mitarbeiter gebieten und sich den Kopf über einen einladenderen Eingang und die Qualität der Bratkartoffeln zerbrechen dürfen.
Seinen kleinen Handwerksbetrieb will er dennoch nach Feierabend und am Wochenende weiterführen. Denn nach fast zwei Jahren ohne Job ist Pausa vorsichtig geworden: „Wenn ich meine neue Stelle verlieren sollte, habe ich dann immer noch etwas, wovon ich leben kann.“


http://www.n-tv.de/3151496.html
Freitag, 4. April 2003
Wall Street knickt ein
NYSE pfeift auf Anlegerschutz
Die New York Stock Exchange (NYSE) hat Pläne revidiert, wonach Analysten daran gehindert werden sollten, gegenüber solchen Fernseh-Sendern, Zeitungen oder Online-Medien Einschätzungen abzugeben, die nicht explizit auf mögliche Interessenkonflikte des Analysten hinweisen. Zugleich präsentierte die NYSE William J. McDonough als neues Vorstandsmitglied, nachdem Citibank-Chef Sanford I. Weill seine Kandidatur nach heftiger Kritik zurückgezogen hatte. Auch die Sanktion gegen den arabischen Sender "Al Dschasira" soll aufgehoben werden.
"Was die Medien mit den Analysen der Experten anfangen, ist ausschließlich deren Angelegenheit", sagte Börsen-Chef Richard Grasso. Durch den "Maulkorb" sollte der Anleger vor Manipulationen wie im Falle Citibank/Salomon Smith Barney geschützt werden. Weill und der ehemalige Staranalyst der zur Citigroup gehörenden Investmentbank Salomon Smith Barney, Jack Grubmann, war vorgeworfen worden, eine Heraufstufung des Telekommunikationskonzerns AT&T durch Salomon verabredet zu haben - mit dem Ziel, der Investmentbank einen lukrativen Konsortialauftrag von AT&T zu verschaffen. Gegen die Zahlung der Rekordgeldstrafe von 400 Mio. Dollar war das Untersuchungsverfahren schließlich eingestellt worden.
Noch vor zwei Wochen hatte Grasso versucht, Weill in den Vorstand der wichtigsten Börse der Welt zu hieven und damit den Zorn von Anlegerschützern und dem kampfeslustigen New Yorker Generalanwalt Eliot Spitzer auf sich gezogen. Er sei einem "Schlaganfall nahe" gewesen, als er von der Kandidatur gehört habe, erklärte Spitzer, der die Nominierung Weills zum Repräsentanten der Investorengemeinschaft zugleich als "krasse Fehlbeurteilung" und "Vertrauensmissbrauch " bezeichnete. Weill zog die Kandidatur daraufhin zurück. Jetzt ist der New Yorker Direktor der US-Zentralbank Federal Reserve, McDonough, vorgesehen.
Eine weitere Provokation war die Verbannung des arabischen Nachrichtensenders "Al Dschasira " von der Börsen-Berichterstattung, nachdem dieser die USA mit der Ausstrahlung von Bildern amerikanischer Kriegsgefangener auf die Palme gebracht hatte. Die Entziehung der Akkreditierung gelte dauerhaft, so die Erklärung der NYSE. Den Vorwurf der Beschneidung der Pressefreiheit, den die Börse jetzt selbst als Vorwand zur Rücknahme ihrer Analysten-Entscheidung erhebt, konnte man unter diesen Umständen schließlich nicht auf sich sitzen lassen.
Wie sich die Kehrtwende der NYSE auf andere Finanzplätze auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat jüngst den Paragraphen 34b des Wertpapierhandelsgestzes (WpHG) dahingehend konkretisiert, dass der Begriff der Wertpapieranalyse nicht nur schriftliche, sondern auch über das Fernsehen und andere Medien verbreitete Analysen umfasst. Auch die Überwachung von Verstößen gegen das WpHG nimmt die Anstalt ernst. In einem Auszug zur Begriffsauslegung heißt es:
Bestimmte Interessenkonflikte sind immer offen zu legen; dazu gehört die Teilnahme an einem Emissionskonsortium, die Betreuung der Wertpapiere an der Börse oder die Beteiligung des Wertpapierdienstleistungsunternehmens in Höhe von mindestens einem Prozent am Grundkapital der analysierten Gesellschaft. Darüber hinaus sollen Banken und Wertpapierhäuser auf einen möglichen Interessenkonflikt hinweisen, wenn sie in Aktien der analysierten Gesellschaft offene Verkaufspositionen ab 1 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten (...).


http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/400197
Grund zur Panik besteht nicht
EU sorgt sich um US-Defizit
Der Irak-Krieg wird den erhofften Wirtschaftsaufschwung vermutlich verzögern. Die Europäer könnten aber dennoch mit einem blauen Auge davonkommen - vorausgesetzt der Krieg am Golf kann noch im Frühjahr rechtzeitig beendet werden.
Von Thomas Gack, Athen
"Wir sehen einen gemeinsamen Boden für zurückhaltenden Optimismus", erklärte der griechische Finanzminister Nikos Christodoulakis, der am Wochenende Gastgeber des informellen Treffens der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in der Nähe von Athen war. Während der Krieg im Irak mit dem Kampf um Bagdad in seine entscheidende Phase trat, dachten die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union im Küstenort Vouliagmeni in der Nähe von Athen über die möglichen wirtschaftlichen Folgen für Europa nach und sahen am Ende keinen Anlass für Kassandrarufe - im Gegenteil. Wenn der Krieg am Golf nicht doch unerwartet lange dauert - und danach sieht es derzeit nicht aus -, dann halten sich die konjunkturellen Kriegsschäden für Europas Wirtschaft in Grenzen. "Trotz deutlicher Risiken sehen wir vorerst keinen Handlungsbedarf", meinte Bundesfinanzminister Hans Eichel. Wim Duisenberg, Präsident der Europäischen Zentralbank, und die nationalen Notenbankpräsidenten, die wie immer an den informellen Treffen der Finanzminister teilnahmen, widersprachen ihm nicht.
EU-Finanzkommissar Pedro Solbes erwartet in diesem Jahr zwar nur noch ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. "Die USA und die EU befinden sich seit sechs Monaten in einem stetigen wirtschaftlichen Abschwung", klagte auch der griechische EU-Ratspräsident Nikos Christodoulakis. Das ist zwar beunruhigend. Grund zur Panik besteht aber dennoch nicht. "Wir erwarten nicht eine Rezession", sind sich Solbes, die 15 Finanzminister und die Notgenbanker einig.
Bisher nämlich entwickelt sich der Ölpreis durchaus moderat und liegt noch "in der ruhigen Zone". "Unsere Wirtschaft ist in den Grundlagen gesund, und die Politik der Mitgliedstaaten geht mehr oder weniger in die richtige Richtung", behauptet EU-Ratspräsident Christodoulakis optimistisch. Im nächsten Jahr werde das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in der EU vermutlich wieder auf 2,25 Prozent steigen, prognostizierte auch EU-Finanzkommissar Solbes.
In dieser Woche wird er in Brüssel die Frühjahrsprognose mit den neuesten Konjunkturdaten der EU vorlegen, die ein gemischtes Bild zwischen Furcht und Hoffnung ergeben. "Die Konjunktur hängt vom Verlauf des Irak-Krieges ab", sagte Bundesfinanzminister Eichel. Vom Welthandel, vom Export in die USA und Asien könne man derzeit nicht eine entscheidende Konjunkturbelebung erwarten, fürchtet EU-Finanzkommissar Solbes.
Den Brüsseler Wirtschaftsexperten macht vor allem das "doppelte Defizit" in den USA große Sorgen: ein durch die explodierenden Kriegskosten schnell wachsendes Haushaltsdefizit von derzeit vier Prozent - weit jenseits der in der EU gesetzten Grenze - und ein weiter wachsendes Leistungsbilanzdefizit. Mit anderen Worten: die USA leben auf Pump. Dagegen setzt man in Brüssel inzwischen auf die Beitrittsländer, die ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum von durchschnittlich rund drei Prozent aufweisen. Als Handelspartner werden sie deshalb für die EU immer wichtiger. Der Krieg am Golf belaste zwar die Weltwirtschaft, sei aber keineswegs der einzige Grund für die schlechte Wirtschaftslage in Europa, warnen die Finanzminister in Athen.
Mehr noch macht ihnen der Verfall des Vertrauens von Verbrauchern, Anlegern und Investoren und die Reformblockade in einigen EU-Ländern Sorge. Die Finanzminister kommen deshalb zur Schlussfolgerung, dass alle EU-Mitgliedstaaten mit energischen Strukturreformen - zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt - ihre Leistungsfähigkeit steigern müssen.
Am Stabilitäts- und Wachstumspakt soll dabei nicht gerüttelt werden. Darüber waren sich alle Finanzminister einig. Auch der Krieg kann den größten Schuldenmachern Deutschland und Frankreich nicht als Alibi dienen. In Brüssel fürchtet man insgeheim, dass die Defizite der öffentlichen Hand bei anhaltend schwachem Wirtschaftswachstum in beiden Ländern in diesem Jahr wieder über der Grenze des Erlaubten von 3,0 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) liegen werden. Mit der kriegsbedingten Konjunkturschwäche allein kann man den zweiten Sündenfall in Folge nicht rechtfertigen. EU-Finanzkommissar Solbes jedenfalls will auch in etwas stürmischeren Gewässern Kurs halten: Der Stabilitätspakt enthalte ausreichend flexible Regelungen für wirtschaftspolitische Spielräume. Auch im Falle eines Krieges dürfe deshalb von einer "Aussetzung" oder "Lockerung" der Regeln nicht die Rede sein.

Grund zur Panik besteht nicht
EU sorgt sich um US-Defizit
Der Irak-Krieg wird den erhofften Wirtschaftsaufschwung vermutlich verzögern. Die Europäer könnten aber dennoch mit einem blauen Auge davonkommen - vorausgesetzt der Krieg am Golf kann noch im Frühjahr rechtzeitig beendet werden.
Von Thomas Gack, Athen
"Wir sehen einen gemeinsamen Boden für zurückhaltenden Optimismus", erklärte der griechische Finanzminister Nikos Christodoulakis, der am Wochenende Gastgeber des informellen Treffens der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in der Nähe von Athen war. Während der Krieg im Irak mit dem Kampf um Bagdad in seine entscheidende Phase trat, dachten die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union im Küstenort Vouliagmeni in der Nähe von Athen über die möglichen wirtschaftlichen Folgen für Europa nach und sahen am Ende keinen Anlass für Kassandrarufe - im Gegenteil. Wenn der Krieg am Golf nicht doch unerwartet lange dauert - und danach sieht es derzeit nicht aus -, dann halten sich die konjunkturellen Kriegsschäden für Europas Wirtschaft in Grenzen. "Trotz deutlicher Risiken sehen wir vorerst keinen Handlungsbedarf", meinte Bundesfinanzminister Hans Eichel. Wim Duisenberg, Präsident der Europäischen Zentralbank, und die nationalen Notenbankpräsidenten, die wie immer an den informellen Treffen der Finanzminister teilnahmen, widersprachen ihm nicht.
EU-Finanzkommissar Pedro Solbes erwartet in diesem Jahr zwar nur noch ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent. "Die USA und die EU befinden sich seit sechs Monaten in einem stetigen wirtschaftlichen Abschwung", klagte auch der griechische EU-Ratspräsident Nikos Christodoulakis. Das ist zwar beunruhigend. Grund zur Panik besteht aber dennoch nicht. "Wir erwarten nicht eine Rezession", sind sich Solbes, die 15 Finanzminister und die Notgenbanker einig.
Bisher nämlich entwickelt sich der Ölpreis durchaus moderat und liegt noch "in der ruhigen Zone". "Unsere Wirtschaft ist in den Grundlagen gesund, und die Politik der Mitgliedstaaten geht mehr oder weniger in die richtige Richtung", behauptet EU-Ratspräsident Christodoulakis optimistisch. Im nächsten Jahr werde das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in der EU vermutlich wieder auf 2,25 Prozent steigen, prognostizierte auch EU-Finanzkommissar Solbes.
In dieser Woche wird er in Brüssel die Frühjahrsprognose mit den neuesten Konjunkturdaten der EU vorlegen, die ein gemischtes Bild zwischen Furcht und Hoffnung ergeben. "Die Konjunktur hängt vom Verlauf des Irak-Krieges ab", sagte Bundesfinanzminister Eichel. Vom Welthandel, vom Export in die USA und Asien könne man derzeit nicht eine entscheidende Konjunkturbelebung erwarten, fürchtet EU-Finanzkommissar Solbes.
Den Brüsseler Wirtschaftsexperten macht vor allem das "doppelte Defizit" in den USA große Sorgen: ein durch die explodierenden Kriegskosten schnell wachsendes Haushaltsdefizit von derzeit vier Prozent - weit jenseits der in der EU gesetzten Grenze - und ein weiter wachsendes Leistungsbilanzdefizit. Mit anderen Worten: die USA leben auf Pump. Dagegen setzt man in Brüssel inzwischen auf die Beitrittsländer, die ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum von durchschnittlich rund drei Prozent aufweisen. Als Handelspartner werden sie deshalb für die EU immer wichtiger. Der Krieg am Golf belaste zwar die Weltwirtschaft, sei aber keineswegs der einzige Grund für die schlechte Wirtschaftslage in Europa, warnen die Finanzminister in Athen.
Mehr noch macht ihnen der Verfall des Vertrauens von Verbrauchern, Anlegern und Investoren und die Reformblockade in einigen EU-Ländern Sorge. Die Finanzminister kommen deshalb zur Schlussfolgerung, dass alle EU-Mitgliedstaaten mit energischen Strukturreformen - zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt - ihre Leistungsfähigkeit steigern müssen.
Am Stabilitäts- und Wachstumspakt soll dabei nicht gerüttelt werden. Darüber waren sich alle Finanzminister einig. Auch der Krieg kann den größten Schuldenmachern Deutschland und Frankreich nicht als Alibi dienen. In Brüssel fürchtet man insgeheim, dass die Defizite der öffentlichen Hand bei anhaltend schwachem Wirtschaftswachstum in beiden Ländern in diesem Jahr wieder über der Grenze des Erlaubten von 3,0 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) liegen werden. Mit der kriegsbedingten Konjunkturschwäche allein kann man den zweiten Sündenfall in Folge nicht rechtfertigen. EU-Finanzkommissar Solbes jedenfalls will auch in etwas stürmischeren Gewässern Kurs halten: Der Stabilitätspakt enthalte ausreichend flexible Regelungen für wirtschaftspolitische Spielräume. Auch im Falle eines Krieges dürfe deshalb von einer "Aussetzung" oder "Lockerung" der Regeln nicht die Rede sein.

http://62.146.24.165/news.php?show=111406
05.04. 18:11
Irak-Krieg weckt bei Vietnam-Veteranen Erinnerungen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Hanoi (dpa) - Es ist ein anderes Land, ein anderer Krieg und ein anderes Zeitalter. Aber wenn Chuck Searcy in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi den Fernseher anschaltet, um die neuesten Berichte über den Irak-Krieg zu sehen, kommen düstere Erinnerungen in ihm hoch. «Ich befürchte, dass die USA einige der Fehler wiederholen, die sie schon in Vietnam begangen haben», sagt der Mann, der während des Vietnam-Krieges in einer Aufklärungseinheit der US-Armee gedient hat.
Erneut müsse sich Washington «sehr anstrengen, diesen Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen», meint der 58-Jährige, der schon seit einigen Jahren eine Wohltätigkeitsstiftung in der Hauptstadt Hanoi leitet. Mehr als eine Million Menschenleben forderte der «Amerikanische Krieg» unter den Vietnamesen, wie er dort genannt wird, 58 000 Amerikaner starben. Nie gab es eine Kriegserklärung. Und obwohl die Truppen des kommunistischen Nordvietnams der haushohen Luftüberlegenheit der USA kein einziges Flugzeug entgegenzusetzen hatten, Washington den Dschungel mit Pflanzengift entlauben ließ und unendliche Tonnen von Bomben abwarf, musste sich die Weltmacht 1975 schmachvoll der Guerillataktik der Gegner geschlagen geben - das amerikanische Trauma von Vietnam war geboren und lebt bis heute.
«Ich denke, wir machen einen kolossalen Fehler, der uns Jahre um Jahre schmerzen wird», sagte der frühere Kommandant einer Einheit der US-Marineinfanterie in Vietnam, John Lancaster. Die beiden Kriege mache vergleichbar, dass «arrogante Leute an der Spitze mit wenig Ahnung über die Welt Entscheidungen treffen. Sehr viele Ähnlichkeiten gibt es nicht, aber diese eine Ähnlichkeit ist gewaltig.» Lancaster steht mit seiner Kritik nicht allein. Beobachter glauben, dass eine große Mehrheit der US-Veteranen in Hanoi den Irak-Krieg ablehnt.
Dass US-Truppen unvermutet auf heftigen Widerstand einheimischer Kämpfer treffen, hat Steve Sherlock schon einmal erlebt - in Vietnam. «In fast jedem Land der Welt wird sich die Bevölkerung gegen einen Eindringling auflehnen, egal wie moralisch begründet seine Motive auch sein mögen», sagt der Mann, der einst Leutnant der US-Armee war und nun medizinische Hilfsgüter nach Vietnam bringt. «Man muss kein Spitzenwissenschaftler sein, um das herauszufinden.» Pazifist sei er nicht. «Aber Krieg ist die letzte Option, nicht die erste.»
Chuck Searcy ist sich sicher, dass die US-Regierung die Bedrohung durch das Regime in Bagdad übertreibt, wie sie einst die Bedeutung des Angriffs auf ein amerikanisches Kriegsschiff im Golf von Tonkin übertrieben hat. «Die Situation mag in vielen Aspekten verschieden sein, aber die Ähnlichkeiten des politischen Vorgehens sind sehr gut vergleichbar», sagt Searcy, der für die «Vietnam Veterans of America Foundation» in den USA Geld für verschiedene Hilfsprojekte in dem südostasiatischen Land sammelt. «Diese Politik basiert auf einer engen Weltsicht und einem gewissen Maß an amerikanischer Arroganz.»
Je länger der Irak-Krieg dauert, desto größer werden die Sorgen der Vietnam-Veteranen. «Hoffentlich liege ich falsch, aber es scheint so, als würden sie (die US-Truppen) eine ganze Weile im Irak bleiben», meint Steve Sherlock. «Auch wenn Bagdad fällt, wird kein Ende des Krieges in Sicht sein.» Und John Lancaster sagt: «Mir tut es nur leid für all die Soldaten und Soldatinnen, die man dazu aufgefordert hat, ihr Leben für eine fehlgeschlagene US-Außenpolitik zu riskieren und eine Menge unschuldiger Menschen zu töten.»

05.04. 18:11
Irak-Krieg weckt bei Vietnam-Veteranen Erinnerungen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Hanoi (dpa) - Es ist ein anderes Land, ein anderer Krieg und ein anderes Zeitalter. Aber wenn Chuck Searcy in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi den Fernseher anschaltet, um die neuesten Berichte über den Irak-Krieg zu sehen, kommen düstere Erinnerungen in ihm hoch. «Ich befürchte, dass die USA einige der Fehler wiederholen, die sie schon in Vietnam begangen haben», sagt der Mann, der während des Vietnam-Krieges in einer Aufklärungseinheit der US-Armee gedient hat.
Erneut müsse sich Washington «sehr anstrengen, diesen Krieg gegen den Irak zu rechtfertigen», meint der 58-Jährige, der schon seit einigen Jahren eine Wohltätigkeitsstiftung in der Hauptstadt Hanoi leitet. Mehr als eine Million Menschenleben forderte der «Amerikanische Krieg» unter den Vietnamesen, wie er dort genannt wird, 58 000 Amerikaner starben. Nie gab es eine Kriegserklärung. Und obwohl die Truppen des kommunistischen Nordvietnams der haushohen Luftüberlegenheit der USA kein einziges Flugzeug entgegenzusetzen hatten, Washington den Dschungel mit Pflanzengift entlauben ließ und unendliche Tonnen von Bomben abwarf, musste sich die Weltmacht 1975 schmachvoll der Guerillataktik der Gegner geschlagen geben - das amerikanische Trauma von Vietnam war geboren und lebt bis heute.
«Ich denke, wir machen einen kolossalen Fehler, der uns Jahre um Jahre schmerzen wird», sagte der frühere Kommandant einer Einheit der US-Marineinfanterie in Vietnam, John Lancaster. Die beiden Kriege mache vergleichbar, dass «arrogante Leute an der Spitze mit wenig Ahnung über die Welt Entscheidungen treffen. Sehr viele Ähnlichkeiten gibt es nicht, aber diese eine Ähnlichkeit ist gewaltig.» Lancaster steht mit seiner Kritik nicht allein. Beobachter glauben, dass eine große Mehrheit der US-Veteranen in Hanoi den Irak-Krieg ablehnt.
Dass US-Truppen unvermutet auf heftigen Widerstand einheimischer Kämpfer treffen, hat Steve Sherlock schon einmal erlebt - in Vietnam. «In fast jedem Land der Welt wird sich die Bevölkerung gegen einen Eindringling auflehnen, egal wie moralisch begründet seine Motive auch sein mögen», sagt der Mann, der einst Leutnant der US-Armee war und nun medizinische Hilfsgüter nach Vietnam bringt. «Man muss kein Spitzenwissenschaftler sein, um das herauszufinden.» Pazifist sei er nicht. «Aber Krieg ist die letzte Option, nicht die erste.»
Chuck Searcy ist sich sicher, dass die US-Regierung die Bedrohung durch das Regime in Bagdad übertreibt, wie sie einst die Bedeutung des Angriffs auf ein amerikanisches Kriegsschiff im Golf von Tonkin übertrieben hat. «Die Situation mag in vielen Aspekten verschieden sein, aber die Ähnlichkeiten des politischen Vorgehens sind sehr gut vergleichbar», sagt Searcy, der für die «Vietnam Veterans of America Foundation» in den USA Geld für verschiedene Hilfsprojekte in dem südostasiatischen Land sammelt. «Diese Politik basiert auf einer engen Weltsicht und einem gewissen Maß an amerikanischer Arroganz.»
Je länger der Irak-Krieg dauert, desto größer werden die Sorgen der Vietnam-Veteranen. «Hoffentlich liege ich falsch, aber es scheint so, als würden sie (die US-Truppen) eine ganze Weile im Irak bleiben», meint Steve Sherlock. «Auch wenn Bagdad fällt, wird kein Ende des Krieges in Sicht sein.» Und John Lancaster sagt: «Mir tut es nur leid für all die Soldaten und Soldatinnen, die man dazu aufgefordert hat, ihr Leben für eine fehlgeschlagene US-Außenpolitik zu riskieren und eine Menge unschuldiger Menschen zu töten.»

http://www.n24.de/wirtschaft/branchen/index.php?a20030407095…
07. April 2003
Milliarden für irakische Ölanlagen
"Hoffnungslos veraltete Infrastsruktur"
Die in vielen Schreckensszenarien heraufbeschworenen verheerenden Öl-Brände im Irak sind ausgeblieben. Nur eine Hand voll der mehr als 1.100 irakischen Ölquellen brannten bislang, und die meisten Feuer sind von kuwaitischen und amerikanischen Spezialisten bereits unter Kontrolle gebracht worden. Dennoch dürfte der große Geldsegen nach der Wiederaufnahme der irakischen Produktion noch lange auf sich warten lassen.
In Rumaila, wo rund 60 Prozent des irakischen Öls gefördert wurden, sei vorerst nicht an ein Anfahren der Produktion zu denken, berichtete Brian Burridge, Kommandeur der britischen Truppen im Golf, die das Gebiet im Süden des Landes eingenommen hatten. "Die Felder sind in fürchterlichem Zustand. Es wird mindestens drei Monate dauern, bevor dort wieder gepumpt werden kann."
Dürfige Wartungsarbeiten haben Ölindustrie dahin siechen lassen
Die Ölindustrie hatte gehofft, dass die irakische Produktion in Kürze wieder angefahren wird. Das irakische Öl, rund drei Prozent des Weltverbrauchs, fällt seit Kriegsbeginn auf den Weltmärkten aus. Unruhen und Streiks haben die Produktion in Venezuela und Nigeria drastisch beeinträchtigt. Auch die US-Regierung setzt auf baldige Ölförderung im Irak, damit die Einnahmen für die Versorgung der Bevölkerung und den Wiederaufbau herangezogen werden können.
Die Anlagen sind dem ersten Augenschein nach rostiger und veralteter als erwartet. "Die Infrastruktur ist hoffnungslos veraltet", sagt Energieexperte Herman Franssen vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Die jahrelangen Sanktionen und dürftige Wartungsarbeiten haben die Industrie dahin siechen lassen. Weil Ersatzteile und Knowhow fehlten, fürchten viele Experten, dass die Felder bleibende Schäden erlitten haben.
Die Produktion auf das Niveau vor der irakischen Invasion Kuwaits zu bringen, rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag, brauche mindestens zwei bis drei Jahre, schätzt Franssen. "Die Produktion könnte zwar schneller wieder hochgefahren werden, doch die Iraker müssen die Anlagen zuerst modernisieren, damit die Reservoire nicht weiter geschädigt werden." Auf sechs Milliarden Dollar schätzt er die Investitionskosten.
Illusorisch: Summen aus den Öleinnahmen zu speisen
Diese Summe aus den Öleinnahmen selbst zu speisen, ist illusorisch. Mit dem Öleinnahmen müssen auch die Nahrungsversorgung, der Aufbau von Gesundheits- und Schulwesen und vieles andere finanziert werden. Die Iraker sind deshalb auf ausländische Partner angewiesen. Dafür stehen amerikanische Firmen bereits in den Startlöchern, argwöhnisch beobachtet von Russland und Frankreich.
Amerikanische Öl-Firmen sind seit Wochen in Kuwait. Mit kuwaitischen Feuerlösch-Spezialisten entbrannte schon ein Streit darüber, wer welche Ölquellen löschen darf. Die Kuwaiter, die zuerst vor Ort waren, sprachen von Nachbarschaftshilfe, die Amerikaner setzten auf ihre Beziehungen zum US-Militär. US-Ölfirmen und die britische BP hatten Soldaten, die für die Einnahme der Ölfelder vorgesehen waren, vor dem Krieg im Umgang mit Ölfeldern geschult.
Wiederaufbau soll nicht von den USA alleine bestritten werden
Moskau und Paris wollen verhindern, dass die Amerikaner den Wiederaufbau allein dirigieren und damit auch über die Vergabe von Verträgen entscheiden. Das erste US-Unternehmen hat aber bereits einen Vertrag für notdürftige Reparaturen in der Tasche.
Russische Firmen hatten jedoch bereits vor dem Krieg von den Vereinten Nationen abgesegnete Verträge über den Bau neuer Ölanlagen für die Zeit nach dem Ende der UN-Sanktionen abgeschlossen. "Wir arbeiten daran, dass die russischen Firmen so schnell wie möglich zu ihren Projekten zurückkehren und mit der Arbeit beginnen", zitierte das "Wall Street Journal" den russischen Energieminister Igor Jusufow.
(N24.de, dpa)
-----------
Die die glaubten das nun Weltfrieden und Hamburger in Bagdad herrschen, müssen sich doch so langsam aber sicher mächtig verarscht vorkommen, oder?
Und wegen 3 Prozent des Gesamtölvorkommen haben wir WOCHENLANG 15 cent´s mehr an der Tanke bezahlt?
07. April 2003
Milliarden für irakische Ölanlagen
"Hoffnungslos veraltete Infrastsruktur"
Die in vielen Schreckensszenarien heraufbeschworenen verheerenden Öl-Brände im Irak sind ausgeblieben. Nur eine Hand voll der mehr als 1.100 irakischen Ölquellen brannten bislang, und die meisten Feuer sind von kuwaitischen und amerikanischen Spezialisten bereits unter Kontrolle gebracht worden. Dennoch dürfte der große Geldsegen nach der Wiederaufnahme der irakischen Produktion noch lange auf sich warten lassen.
In Rumaila, wo rund 60 Prozent des irakischen Öls gefördert wurden, sei vorerst nicht an ein Anfahren der Produktion zu denken, berichtete Brian Burridge, Kommandeur der britischen Truppen im Golf, die das Gebiet im Süden des Landes eingenommen hatten. "Die Felder sind in fürchterlichem Zustand. Es wird mindestens drei Monate dauern, bevor dort wieder gepumpt werden kann."
Dürfige Wartungsarbeiten haben Ölindustrie dahin siechen lassen
Die Ölindustrie hatte gehofft, dass die irakische Produktion in Kürze wieder angefahren wird. Das irakische Öl, rund drei Prozent des Weltverbrauchs, fällt seit Kriegsbeginn auf den Weltmärkten aus. Unruhen und Streiks haben die Produktion in Venezuela und Nigeria drastisch beeinträchtigt. Auch die US-Regierung setzt auf baldige Ölförderung im Irak, damit die Einnahmen für die Versorgung der Bevölkerung und den Wiederaufbau herangezogen werden können.
Die Anlagen sind dem ersten Augenschein nach rostiger und veralteter als erwartet. "Die Infrastruktur ist hoffnungslos veraltet", sagt Energieexperte Herman Franssen vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington. Die jahrelangen Sanktionen und dürftige Wartungsarbeiten haben die Industrie dahin siechen lassen. Weil Ersatzteile und Knowhow fehlten, fürchten viele Experten, dass die Felder bleibende Schäden erlitten haben.
Die Produktion auf das Niveau vor der irakischen Invasion Kuwaits zu bringen, rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag, brauche mindestens zwei bis drei Jahre, schätzt Franssen. "Die Produktion könnte zwar schneller wieder hochgefahren werden, doch die Iraker müssen die Anlagen zuerst modernisieren, damit die Reservoire nicht weiter geschädigt werden." Auf sechs Milliarden Dollar schätzt er die Investitionskosten.
Illusorisch: Summen aus den Öleinnahmen zu speisen
Diese Summe aus den Öleinnahmen selbst zu speisen, ist illusorisch. Mit dem Öleinnahmen müssen auch die Nahrungsversorgung, der Aufbau von Gesundheits- und Schulwesen und vieles andere finanziert werden. Die Iraker sind deshalb auf ausländische Partner angewiesen. Dafür stehen amerikanische Firmen bereits in den Startlöchern, argwöhnisch beobachtet von Russland und Frankreich.
Amerikanische Öl-Firmen sind seit Wochen in Kuwait. Mit kuwaitischen Feuerlösch-Spezialisten entbrannte schon ein Streit darüber, wer welche Ölquellen löschen darf. Die Kuwaiter, die zuerst vor Ort waren, sprachen von Nachbarschaftshilfe, die Amerikaner setzten auf ihre Beziehungen zum US-Militär. US-Ölfirmen und die britische BP hatten Soldaten, die für die Einnahme der Ölfelder vorgesehen waren, vor dem Krieg im Umgang mit Ölfeldern geschult.
Wiederaufbau soll nicht von den USA alleine bestritten werden
Moskau und Paris wollen verhindern, dass die Amerikaner den Wiederaufbau allein dirigieren und damit auch über die Vergabe von Verträgen entscheiden. Das erste US-Unternehmen hat aber bereits einen Vertrag für notdürftige Reparaturen in der Tasche.
Russische Firmen hatten jedoch bereits vor dem Krieg von den Vereinten Nationen abgesegnete Verträge über den Bau neuer Ölanlagen für die Zeit nach dem Ende der UN-Sanktionen abgeschlossen. "Wir arbeiten daran, dass die russischen Firmen so schnell wie möglich zu ihren Projekten zurückkehren und mit der Arbeit beginnen", zitierte das "Wall Street Journal" den russischen Energieminister Igor Jusufow.
(N24.de, dpa)
-----------
Die die glaubten das nun Weltfrieden und Hamburger in Bagdad herrschen, müssen sich doch so langsam aber sicher mächtig verarscht vorkommen, oder?
Und wegen 3 Prozent des Gesamtölvorkommen haben wir WOCHENLANG 15 cent´s mehr an der Tanke bezahlt?

Guten Abend @all;
ich denke, auch dies paßt zum Threadthema:
http://www.google.de/search?q=%22Atomgefahr+USA%22&ie=ISO-88…
http://www.buchhaus.ch/luethy/nzz/nzz.asp
http://www.perlentaucher.de/buch/13716.html
Ich habe heute um kurz nach 19 Uhr eine ausführliche Buchbesprechung im Deutschlandradio gehört mit weiteren Hintergrundinfos - es war faszinierend und erschreckend zugleich.
Wer, nachdem er das gehört hat, noch an den Heiligenschein der jetzigen Regierung glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen.
Stichworte:
Ehemalige leitende Angestellte der Rüstungsindustrie, vor allem von Lockheed Martin, in großer Zahl in der Administration,
massiver Druck dieser Leute, bunker buster und andere "kleinere" Atomwaffen einzusetzen, vorrangig in Afghanistan,
Neuauflage eines Atomwaffenprogramms, das 5,8 Mrd.$ Kosten für jährliche Tests vorsieht (kurz vor dem Ende der Sowjetunion war es ein Drittel weniger),
Bruch des Atomwaffensperrvertrages und eines weiteren (Namen habe ich nicht behalten),
neue Pläne für Weltraumwaffen und weitere Spezialwaffen der ausgefallensten Art,
weitere Beschleunigung der Steigerung der Rüstungsausgaben usw.
Wir sollten uns alle sehr, sehr warm anziehen - wenn diese Regierung, sprich vor allem Bush, eine zweite Amtszeit erhalten sollte, dann werden wir Entwicklungen sehen, die auch zur Zeit noch unmöglich erscheinen (meine Meinung).
Vicco
ich denke, auch dies paßt zum Threadthema:
http://www.google.de/search?q=%22Atomgefahr+USA%22&ie=ISO-88…
http://www.buchhaus.ch/luethy/nzz/nzz.asp
http://www.perlentaucher.de/buch/13716.html
Ich habe heute um kurz nach 19 Uhr eine ausführliche Buchbesprechung im Deutschlandradio gehört mit weiteren Hintergrundinfos - es war faszinierend und erschreckend zugleich.
Wer, nachdem er das gehört hat, noch an den Heiligenschein der jetzigen Regierung glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen.
Stichworte:
Ehemalige leitende Angestellte der Rüstungsindustrie, vor allem von Lockheed Martin, in großer Zahl in der Administration,
massiver Druck dieser Leute, bunker buster und andere "kleinere" Atomwaffen einzusetzen, vorrangig in Afghanistan,
Neuauflage eines Atomwaffenprogramms, das 5,8 Mrd.$ Kosten für jährliche Tests vorsieht (kurz vor dem Ende der Sowjetunion war es ein Drittel weniger),
Bruch des Atomwaffensperrvertrages und eines weiteren (Namen habe ich nicht behalten),
neue Pläne für Weltraumwaffen und weitere Spezialwaffen der ausgefallensten Art,
weitere Beschleunigung der Steigerung der Rüstungsausgaben usw.
Wir sollten uns alle sehr, sehr warm anziehen - wenn diese Regierung, sprich vor allem Bush, eine zweite Amtszeit erhalten sollte, dann werden wir Entwicklungen sehen, die auch zur Zeit noch unmöglich erscheinen (meine Meinung).
Vicco
danke vicco 

Bush und Blair beraten über «die Zukunft der Welt»
Belfast (dpa) - Wenn konservative britische Zeitungen wie der «Sunday Telegraph» richtig liegen, dann entscheiden US-Präsident George W. Bush und der britische Premierminister Tony Blair in Belfast über nichts Geringeres als die «Zukunft der Welt». Die Blätter spielen damit auf die Frage an: Wird die Weltpolitik künftig von der Hegemonialmacht USA und einer jeweils ad hoc zusammengestellten «Koalition der Willigen» bestimmt oder lässt sich Washington doch wieder stärker in die internationale Gemeinschaft einbinden?
Das soll sich zeigen, wenn nun festgelegt wird, wie es im Irak weitergeht. Nach den Worten von Bushs Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice sollen die USA und ihre Verbündeten, die für den Irak «Leben und Blut geopfert» haben, auch die «leitende Rolle» in der ersten Phase nach Kriegsende übernehmen. Diese Phase wird nach den Worten des stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz mindestens ein halbes Jahr dauern.
Wolfowitz und andere «Falken» in der US-Regierung hoffen, dass ein «befreiter» Irak eine ganze Demokratisierungswelle im Nahen Osten auslösen wird. Es sei eine «gefährlich falsche Vorstellung», bei dieser historischen Aufgabe auch «Länder vom Schlage Syriens, Russlands, Chinas und Frankreichs» mitreden zu lassen, warnt der kürzlich zurückgetretene US-Verteidigungsberater Richard Perle im britischen «Spectator». «Saddam Husseins Terrorregime steht vor dem Ende. Er wird in Kürze abtreten - aber nicht allein: Die Vereinten Nationen wird er - welche Ironie! - im Sturz mit sich reißen.»
Von genau dieser Haltung hofft Blair seinen amerikanischen Gast in Belfast abbringen zu können. Der Brite wünscht, dass die geplante irakische Übergangsregierung möglichst schnell vom UN-Sicherheitsrat abgesegnet wird. Sonst könnte der Eindruck einer von Washington gelenkten Marionettenregierung entstehen, befürchtet man in London.
Nach Möglichkeit braucht Blair noch mehr als die Erfüllung dieser Mindestforderung, um seine Parteifreunde wieder einigermaßen geschlossen hinter sich zu scharen. Außenminister Jack Straw drängt auf eine UN-Konferenz - so wie «Joschka das damals in Bonn so schön gemacht hat», sagt er unter Verweis auf die Afghanistan-Konferenz nach der Vertreibung der Taliban. Der für Wales zuständige Minister Peter Hain bezeichnet eine UN-Rolle als «lebenswichtig». Ähnlich sehen es nach einer am Montag veröffentlichten Umfrage 64 Prozent der britischen Bevölkerung.
Doch ein Bruch zwischen Blair und Bush in dieser Frage gilt als ausgeschlossen. Blairs Vertraute sind eifrig bemüht, alle Differenzen herunterzuspielen. Es gebe gar «keine großen Unterschiede», versichert John Reid, der neue Fraktionsvorsitzende von Labour. Gerade jetzt, nachdem Blair im Interesse der «special relationship» (besonderen Beziehung) zu den USA sogar in den Krieg gezogen ist, wird er das Verhältnis auf keinen Fall gefährden wollen. Allein die Tatsache, dass der mächtigste Mann der Welt gewillt ist, sich persönlich nach Nordirland zu begeben, wird in Großbritannien schon als «enormer Erfolg» für Blair (The Times) gewertet.
-----
Vollidioten !
Belfast (dpa) - Wenn konservative britische Zeitungen wie der «Sunday Telegraph» richtig liegen, dann entscheiden US-Präsident George W. Bush und der britische Premierminister Tony Blair in Belfast über nichts Geringeres als die «Zukunft der Welt». Die Blätter spielen damit auf die Frage an: Wird die Weltpolitik künftig von der Hegemonialmacht USA und einer jeweils ad hoc zusammengestellten «Koalition der Willigen» bestimmt oder lässt sich Washington doch wieder stärker in die internationale Gemeinschaft einbinden?
Das soll sich zeigen, wenn nun festgelegt wird, wie es im Irak weitergeht. Nach den Worten von Bushs Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice sollen die USA und ihre Verbündeten, die für den Irak «Leben und Blut geopfert» haben, auch die «leitende Rolle» in der ersten Phase nach Kriegsende übernehmen. Diese Phase wird nach den Worten des stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz mindestens ein halbes Jahr dauern.
Wolfowitz und andere «Falken» in der US-Regierung hoffen, dass ein «befreiter» Irak eine ganze Demokratisierungswelle im Nahen Osten auslösen wird. Es sei eine «gefährlich falsche Vorstellung», bei dieser historischen Aufgabe auch «Länder vom Schlage Syriens, Russlands, Chinas und Frankreichs» mitreden zu lassen, warnt der kürzlich zurückgetretene US-Verteidigungsberater Richard Perle im britischen «Spectator». «Saddam Husseins Terrorregime steht vor dem Ende. Er wird in Kürze abtreten - aber nicht allein: Die Vereinten Nationen wird er - welche Ironie! - im Sturz mit sich reißen.»
Von genau dieser Haltung hofft Blair seinen amerikanischen Gast in Belfast abbringen zu können. Der Brite wünscht, dass die geplante irakische Übergangsregierung möglichst schnell vom UN-Sicherheitsrat abgesegnet wird. Sonst könnte der Eindruck einer von Washington gelenkten Marionettenregierung entstehen, befürchtet man in London.
Nach Möglichkeit braucht Blair noch mehr als die Erfüllung dieser Mindestforderung, um seine Parteifreunde wieder einigermaßen geschlossen hinter sich zu scharen. Außenminister Jack Straw drängt auf eine UN-Konferenz - so wie «Joschka das damals in Bonn so schön gemacht hat», sagt er unter Verweis auf die Afghanistan-Konferenz nach der Vertreibung der Taliban. Der für Wales zuständige Minister Peter Hain bezeichnet eine UN-Rolle als «lebenswichtig». Ähnlich sehen es nach einer am Montag veröffentlichten Umfrage 64 Prozent der britischen Bevölkerung.
Doch ein Bruch zwischen Blair und Bush in dieser Frage gilt als ausgeschlossen. Blairs Vertraute sind eifrig bemüht, alle Differenzen herunterzuspielen. Es gebe gar «keine großen Unterschiede», versichert John Reid, der neue Fraktionsvorsitzende von Labour. Gerade jetzt, nachdem Blair im Interesse der «special relationship» (besonderen Beziehung) zu den USA sogar in den Krieg gezogen ist, wird er das Verhältnis auf keinen Fall gefährden wollen. Allein die Tatsache, dass der mächtigste Mann der Welt gewillt ist, sich persönlich nach Nordirland zu begeben, wird in Großbritannien schon als «enormer Erfolg» für Blair (The Times) gewertet.
-----
Vollidioten !
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?eid=505270&id…
"Vieles ist einfach nur Cheerleading"
Orville Schell, 63, Dekan des Instituts für Publizistik an der Universität Berkeley, Kalifornien, über die Kriegsberichterstattung der US-Medien.
Herr Schell, wenn Sie den Irak-Krieg durch die Augen amerikanischer Fernsehzuschauer verfolgen was für einen Eindruck bekommen Sie?
Zunächst mal: Das, was Europäer sehen, was Amerikaner sehen und was Araber sehen, sind vollkommen verschiedene Kriege. Der Krieg im US-Fernsehen besteht zum Teil aus ordentlich gemachten Nachrichten, aber vieles ist einfach nur "Cheerleading" Anfeuerung für die Truppe. Die Fernsehsender berichten über diesen Krieg, als würden sie ein Football-Spiel übertragen mit atemloser Stimme, mit vielen Grafiken und Statistiken, aber völlig ohne Hintergrund. Keiner wagt, für 20 oder 30 Minuten vom Live-Bild wegzuschalten, um eine Dokumentation oder Analyse zu zeigen. 90 Prozent dessen, was ein intelligenter Mensch wissen müsste, um diesen Konflikt zu verstehen, fehlen einfach. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Amerikaner unter einer Million erklären könnte, wie Saddam Hussein an die Macht gekommen ist oder wie es um das Verhältnis zwischen dem Irak und Kuwait steht.
Es gibt ja noch andere Informationsquellen als das Fernsehen...
Die großen Tageszeitungen leisten im allgemeinen gute Arbeit allen voran Blätter wie die "New York Times" und die "Los Angeles Times", aber auch kleinere Zeitungen wie die "Chicago Tribune". Doch vergessen Sie nicht: Während 1,2 Millionen Menschen die "New York Times" abonnieren, beziehen 30 Millionen ihre Nachrichten aus dem Fernsehen. Fernsehen erdrückt alles andere, und die Qualität ist beschämend.
Bei Sendern wie "Fox News" und "MSNBC" treten ehemalige Politiker als Moderatoren auf, und notorische Krawallmacher wie Geraldo Rivera dürfen Reporter spielen. Ist das noch Journalismus?
Nein, es ist einfach nur Jahrmarktgeschrei. Im Kampf um Einschaltquoten schicken die Sender immer absurdere Figuren ins Rennen, Hauptsache provokant. Mit Nachrichten hat das nichts mehr zu tun, es ist mehr eine Art Wrestling.
Der erste Golfkrieg hat CNN bekannt gemacht. Sehen Sie diesmal einen ähnlichen Gewinner unter den Medien?
Al-Dschasira. Aber im Ernst: Es ist bezeichnend, dass viele Leute, die sich nach einer intelligenten Berichterstattung sehnen, zur BBC schalten.
...die man in den USA in einigen Kabelnetzen empfangen kann.
Ich hatte eine Art Erweckungserlebnis neulich Abend, als das Fernsehbild plötzlich still stand und die BBC ihr Radioprogramm im TV ausstrahlte. Ich saß da und dachte: "Das ist ein verdammt gutes Programm!" Und das ist ein schlimmes Zeichen, wenn ein Programm ohne Bilder das beste ist, das Sie empfangen können.
Was macht die BBC so viel besser?
Sie bringt eine ausgewogene, tiefgründige Berichterstattung. Ich denke, einige Medien in anderen europäischen Ländern zeigen genauso viel Schieflage wie das US-Fernsehen, nur in die andere Richtung. Auch da täte etwas mehr Hintergrund not. Die Herausforderung für alle besteht darin, diesen Konflikt jenseits nationaler Interessen darzustellen. Und das ist das Tragische an den US-Medien: Sie sind weltweite Nachrichtenlieferanten, vielleicht einflussreicher als alle anderen, aber sie benehmen sich, als hätten sie ein rein amerikanisches Publikum. Was wir brauchen, sind Reporter für die Welt, nicht Reporter für Amerika.
Das Internet ist das einzige wirklich globale Medium. Welche Rolle spielt es in diesem Krieg?
Das Internet ist eine fantastische Informationsquelle, und Websites wie etwa Salon.com sind enorm wichtig. Das Problem ist, dass bisher keiner einen Weg gefunden hat, im Netz Geld zu verdienen. Außerdem muss man im Internet aktiv nach Nachrichten suchen und man kann nicht erwarten, dass Leute, die den ganzen Tag hart arbeiten, abends auch noch für ihre Nachrichten hart arbeiten. Für die meisten gilt, und da schließe ich mich ein: Wenn ich nach Hause gehe, will ich nicht vor dem Computer sitzen. So kommt das Fernsehen an seine Gefangenen.
Mögen Sie noch hinsehen?
Aus professionellem Interesse und mit einer gewissen morbiden Faszination. Manchmal, wenn ich nicht fassen kann, wie schlecht etwas ist, schreie ich den Fernseher an ein interaktives Programm sozusagen. Aber es ist eben keine Game Show. Es geht um Menschenleben, und doch sitzen da diese lächerlichen Typen, und plötzlich kommt Werbung für Deospray und Steakmesser dazwischen. Es ist grotesk. Wenn Sie vom Mars kämen und das sähen, würden Sie glauben, Sie seien in einer Welt des totalen Irrsinns gelandet. Wir haben uns nur schon daran gewöhnt.
Interview: Karsten Lemm
"Vieles ist einfach nur Cheerleading"
Orville Schell, 63, Dekan des Instituts für Publizistik an der Universität Berkeley, Kalifornien, über die Kriegsberichterstattung der US-Medien.
Herr Schell, wenn Sie den Irak-Krieg durch die Augen amerikanischer Fernsehzuschauer verfolgen was für einen Eindruck bekommen Sie?
Zunächst mal: Das, was Europäer sehen, was Amerikaner sehen und was Araber sehen, sind vollkommen verschiedene Kriege. Der Krieg im US-Fernsehen besteht zum Teil aus ordentlich gemachten Nachrichten, aber vieles ist einfach nur "Cheerleading" Anfeuerung für die Truppe. Die Fernsehsender berichten über diesen Krieg, als würden sie ein Football-Spiel übertragen mit atemloser Stimme, mit vielen Grafiken und Statistiken, aber völlig ohne Hintergrund. Keiner wagt, für 20 oder 30 Minuten vom Live-Bild wegzuschalten, um eine Dokumentation oder Analyse zu zeigen. 90 Prozent dessen, was ein intelligenter Mensch wissen müsste, um diesen Konflikt zu verstehen, fehlen einfach. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Amerikaner unter einer Million erklären könnte, wie Saddam Hussein an die Macht gekommen ist oder wie es um das Verhältnis zwischen dem Irak und Kuwait steht.
Es gibt ja noch andere Informationsquellen als das Fernsehen...
Die großen Tageszeitungen leisten im allgemeinen gute Arbeit allen voran Blätter wie die "New York Times" und die "Los Angeles Times", aber auch kleinere Zeitungen wie die "Chicago Tribune". Doch vergessen Sie nicht: Während 1,2 Millionen Menschen die "New York Times" abonnieren, beziehen 30 Millionen ihre Nachrichten aus dem Fernsehen. Fernsehen erdrückt alles andere, und die Qualität ist beschämend.
Bei Sendern wie "Fox News" und "MSNBC" treten ehemalige Politiker als Moderatoren auf, und notorische Krawallmacher wie Geraldo Rivera dürfen Reporter spielen. Ist das noch Journalismus?
Nein, es ist einfach nur Jahrmarktgeschrei. Im Kampf um Einschaltquoten schicken die Sender immer absurdere Figuren ins Rennen, Hauptsache provokant. Mit Nachrichten hat das nichts mehr zu tun, es ist mehr eine Art Wrestling.
Der erste Golfkrieg hat CNN bekannt gemacht. Sehen Sie diesmal einen ähnlichen Gewinner unter den Medien?
Al-Dschasira. Aber im Ernst: Es ist bezeichnend, dass viele Leute, die sich nach einer intelligenten Berichterstattung sehnen, zur BBC schalten.
...die man in den USA in einigen Kabelnetzen empfangen kann.
Ich hatte eine Art Erweckungserlebnis neulich Abend, als das Fernsehbild plötzlich still stand und die BBC ihr Radioprogramm im TV ausstrahlte. Ich saß da und dachte: "Das ist ein verdammt gutes Programm!" Und das ist ein schlimmes Zeichen, wenn ein Programm ohne Bilder das beste ist, das Sie empfangen können.
Was macht die BBC so viel besser?
Sie bringt eine ausgewogene, tiefgründige Berichterstattung. Ich denke, einige Medien in anderen europäischen Ländern zeigen genauso viel Schieflage wie das US-Fernsehen, nur in die andere Richtung. Auch da täte etwas mehr Hintergrund not. Die Herausforderung für alle besteht darin, diesen Konflikt jenseits nationaler Interessen darzustellen. Und das ist das Tragische an den US-Medien: Sie sind weltweite Nachrichtenlieferanten, vielleicht einflussreicher als alle anderen, aber sie benehmen sich, als hätten sie ein rein amerikanisches Publikum. Was wir brauchen, sind Reporter für die Welt, nicht Reporter für Amerika.
Das Internet ist das einzige wirklich globale Medium. Welche Rolle spielt es in diesem Krieg?
Das Internet ist eine fantastische Informationsquelle, und Websites wie etwa Salon.com sind enorm wichtig. Das Problem ist, dass bisher keiner einen Weg gefunden hat, im Netz Geld zu verdienen. Außerdem muss man im Internet aktiv nach Nachrichten suchen und man kann nicht erwarten, dass Leute, die den ganzen Tag hart arbeiten, abends auch noch für ihre Nachrichten hart arbeiten. Für die meisten gilt, und da schließe ich mich ein: Wenn ich nach Hause gehe, will ich nicht vor dem Computer sitzen. So kommt das Fernsehen an seine Gefangenen.
Mögen Sie noch hinsehen?
Aus professionellem Interesse und mit einer gewissen morbiden Faszination. Manchmal, wenn ich nicht fassen kann, wie schlecht etwas ist, schreie ich den Fernseher an ein interaktives Programm sozusagen. Aber es ist eben keine Game Show. Es geht um Menschenleben, und doch sitzen da diese lächerlichen Typen, und plötzlich kommt Werbung für Deospray und Steakmesser dazwischen. Es ist grotesk. Wenn Sie vom Mars kämen und das sähen, würden Sie glauben, Sie seien in einer Welt des totalen Irrsinns gelandet. Wir haben uns nur schon daran gewöhnt.
Interview: Karsten Lemm
http://www.stern.de/politik/historie/index.html?id=506195&nv…
"Das kann in einem Debakel enden"
Professor Kennedy, Sie haben bereits 1988, noch vor dem Fall der Mauer, in Ihrem Buch "Aufstieg und Fall der großen Mächte" den Niedergang der USA vorausgesagt. Könnte Amerikas Irak-Krieg der Anfang vom Ende werden?
Nun, wir sind die letzte Supermacht. Das Militärbudget der USA ist so groß wie das der folgenden 14 Länder zusammen. Darin steckt eine Gefahr. Solche Überlegenheit kann zu imperialer Hybris führen. Der Irak-Krieg wäre der eine Krieg zu viel.
Aber will die Bush-Regierung mit diesem Krieg nicht gerade Amerikas Idee von Demokratie weiterverbreiten?
Nein. Dieser Krieg ist das Ergebnis einer vom stellvertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz im vergangenen Sommer entworfenen Strategie der nationalen Sicherheit. Doch die Bush-Regierung schob dauernd neue Gründe vor, weshalb wir Saddam Hussein besiegen müssen. Mal sind es seine Verbindungen zu al Qaeda, mal sind es die Massenvernichtungswaffen, mal seine Missachtung der UN-Sanktionen, mal die Brutalität des Regimes, mal die Gefahr für Israel. In Wahrheit geht es nicht um Demokratisierung, sondern darum, wer der Stärkste auf der Welt ist. Wolfowitz und sein Zirkel wollen jeden daran hindern, den Vereinigten Staaten gefährlich zu werden.
Wird ihnen das gelingen?
Längerfristig könnten sie die Unterstützung für diesen Kurs verlieren.
Was heißt längerfristig?
Zwei bis drei Jahre. Das hängt davon ab, ob die Falken sich durchsetzen und tatsächlich an ihr großes Projekt gehen können, den ganzen Nahen Osten umzukrempeln. Es ist bemerkenswert, wenn man ihnen zuhört, wie sie auch noch die Demokratie im Iran verwirklichen wollen, wie sie die allmähliche Öffnung Saudi-Arabiens unterstützen werden. Sie könnten schnell herausfinden, dass sie sich mit dem Irak schon genug auf den Teller geladen haben, mehr, als sie verdauen können. Dann hätten sich ihre expansiven Pläne schnell erledigt. Noch ist es zu früh für ein Urteil darüber.
Falls der Krieg so läuft, wie die Falken in Washington hoffen: keine riesigen Verluste für die USA, Saddam Hussein binnen Wochen erledigt - wäre der Irak dann nur ein erster Schritt?
Dann ist der Irak nicht die Endstation. Vorausgesetzt, dass das Unbehagen in der Bevölkerung nicht wächst und die Kritik im Kongress nicht wieder auflebt.
Sind die Kritiker dort nicht scheintot?
Ja, die liegen praktisch auf der Intensivstation. Wenn ein 85-jähriger Senator wie Robert Byrd der einzige ist, der grundlegende Kritik äußert, kann der Kongress wohl kaum in guter Verfassung sein. Die Falken können dann mit ihrem Programm fortfahren.
Könnte Amerika es sich wirklich erlauben, diesem Krieg weitere folgen zu lassen?
Das hängt von drei Variablen ab. Die eine ist die Unwägbarkeit des Krieges. Wenn es auf dem Schlachtfeld schief geht, wird es fürchterlich für das Weiße Haus. Die zweite ist die Angst vieler Amerikaner, demnächst keinen Job mehr zu haben. Die wirtschaftliche Lage des Landes spielt also eine Rolle. Die dritte Variable ist die öffentliche Meinung, die eng mit den ersten beiden zusammenhängt. Im Augenblick mögen sich die Menschen unter dem Sternenbanner versammeln. Aber das ist erfahrungsgemäß nicht von langer Dauer. Wenn sich die Ökonomie verschlechtert und das Abenteurertum in Übersee nicht nach Plan verläuft, sind die Leute in zwei Jahren nicht mehr da, die heute die Politik bestimmen.
Und wenn sie doch gewinnen?
Dann wäre das Thema des "imperial overstretch". Also ob sich die USA ein so teures Militär an so vielen Stellen der Welt, womöglich verstrickt in teure Kriege oder aufwendigen Wiederaufbau, überhaupt leisten können.
Zweifeln Sie daran?
Eine Regierung, die in einen Krieg zieht, gleichzeitig massiv die Steuern senkt, ein dramatisches Haushalts- und Außenhandelsdefizit anhäuft und sich außerdem mit fast allen überworfen hat, die normalerweise ihre Partner sind, spielt ein gefährliches Spiel. So etwas kann in einem Debakel enden.
Auch militärisch?
Wenn wir diesen Krieg nicht relativ schnell gewinnen, hat die Regierung eine Unmenge Steuergelder für nichts und wieder nichts vergeudet. Militärisch sollte es an sich kein Problem sein, auch wenn ich sicher bin, dass Saddam Hussein noch ein paar schmutzige Tricks auf Lager hat. Der Irak hat mehr Ingenieure ausgebildet als jedes andere Land im Nahen Osten. Manche sind eifrige Nationalisten, andere wissen immerhin, wie man mit chemischen und biologischen Kampfstoffen umgeht. Militärisch sollte die Sache in zwei Monaten erledigt sein. Aber das wäre eben nicht das Ende der Geschichte. Wir könnten in eine viel größere, kompliziertere Sache hineingezogen werden.
Und dann wäre die Weltmacht USA am Ende?
Militärisch kann uns auf absehbare Zeit niemand einholen. Aber wirtschaftlich sieht die Lage ganz anders aus. Die Europäische Union ist in etwa so stark wie die USA. Wenn man Japan, Südkorea und China zusammennimmt, reden wir bereits über drei große Konkurrenten. Und wenn wir auch noch Wissenschaft und Kultur berücksichtigen, erweitert sich die Zahl der Mitspieler nochmals. Ich habe nie geglaubt, dass sich die ganze Welt nur nach amerikanischer Kultur richtet, nach Blue Jeans und Silicon Valley. Die USA sind nur militärisch eine Hyper-Power. Aber Regierung und Volk scheinen sich doch darüber einig zu sein, dass Wohl und Wehe der Welt von den USA abhängen.
Auch das hat mit der mangelnden öffentlichen Debatte zu tun. Schauen Sie nur mal nach Großbritannien: wie sich Tony Blair im Unterhaus für seine Position rechtfertigen musste. Er argumentierte, wie Bush das niemals könnte. Wie Blair seine Entscheidung für den Krieg zur Abstimmung stellte und sich gegen großen Widerstand behauptete - da hat man Demokratie gespürt. Und hier? Unsere Senatoren sind intellektuelle Winzlinge. Ein Teil der amerikanischen Verfassung wurde ursprünglich gestaltet, um einen imperialen Präsidenten zu vereiteln: Dieser Teil funktioniert zurzeit nicht. Und darunter leidet nun die Welt.
Mit Ausnahme der Länder, die Amerika unterstützen?
Es ist schon sehr bedenklich, dass mit Ausnahme von Großbritannien und Australien kein entwickeltes demokratisches Land mit dem Irak-Krieg wirklich etwas zu tun haben wollte. Die Amerikaner müssen stattdessen auf Rumsfelds absurde Koalition der Willigen bauen, auf die Mongolei oder El Salvador oder Kolumbien.
Sie vergessen Polen und Litauen.
Polen, Tschechen und Litauer haben eine gemeinsame Geschichte. Sie wollen zu Marktwirtschaften wachsen und orientieren sich am Westen...
...und streben damit doch nach jener Art von Demokratie, die Amerika so gern verbreiten will.
Wir reden viel über Demokratie in anderen Ländern und fragen uns nicht, ob wir die Demokratie zu Hause ausreichend schützen.
Vor wem?
Wir erleben hier den Aufstieg der christlichen Rechten. Und der Lobbyisten wie der "National Rifle Association", der Waffennarren. Nun kommen konservative jüdische Interessengruppen dazu. Leute, die früher dem eher linken Spektrum angehörten. Die USA sind nach rechts gedriftet. Die große Mehrheit der Amerikaner wollte diesen Krieg nur unter der Bedingung, dass ihr Land starke Alliierte an seiner Seite hat. Aber die Regierung Bush kann es sich leisten, exakt das Gegenteil zu tun.
Und warum kann sie sich das leisten?
Weil die Liberalen so schwach sind. Sie zeigen keine Durchsetzungskraft. Außerdem sind die Konservativen ziemlich gut geschützt. Sie haben viel Geld und die rechtsgerichteten Think Tanks in Washington, die sie munitionieren.
Welche Auswirkungen hat das?
Es gibt keine Studie darüber, wie die konservative Rechte ihren langen Marsch durch die Institutionen seit den späten siebziger Jahren angetreten hat. Sie stellten damals fest, dass es nur liberale Think Tanks gab, und entschlossen sich, ihre eigenen zu gründen: das Cato Institute oder das American Enterprise Institute. Sie bekommen Geld von konservativen Stiftungen wie der Bradley Foundation. Sie sind eng verbunden mit reichen Personen wie den Besitzern der Brauerei-Gruppe Coors. Aus diesen Kreisen erhalten sie Millionen. Außerdem ziehen sie durch die Universitäten, um kluge junge Konservative zu ködern.
Scheint so, als hätten sie ganze Arbeit geleistet.
Ja. Sie reden nur noch untereinander. Und unter ihnen wächst die Abscheu für alle, die nicht zu ihrem Kreis gehören. Die gelten als liberale Waschlappen.
Gibt es keinen Dialog mehr zwischen ihnen und dem Rest des Landes?
Zumindest hat die Arroganz kräftig zugenommen. Wer mit ihnen über die Vereinten Nationen diskutieren will oder eine Reform internationaler Organisationen, erntet bestenfalls ein verächtliches Naserümpfen. Solche Ideen sind passee. Wir haben die Flugzeugträger. Wir haben die Marines. Die Vereinten Nationen haben uns nur enttäuscht. Das ist ihr Denken. Und es ist ihnen sogar gelungen, eine Reihe von Mythen als Wahrheiten darzustellen. Dass Mogadischu ein Versagen der UN gewesen sei zum Beispiel...
...der Einsatz von US-Soldaten in einer Blauhelm-Mission 1993 in Somalia, die mit dem Abschuss von zwei US-Hubschraubern endete. Die Anhänger des Warlords Aidid zerrten damals einen toten Soldaten nackt durch die Straßen von Mogadischu.
Ja. Dabei lag diesem Debakel in Wirklichkeit ein Versagen der militärischen Führung der USA zugrunde. Aber die Rechten basteln an so etwas Ähnlichem wie einer Dolchstoßlegende.
Sie klingen sehr pessimistisch.
Vielleicht. Auf der anderen Seite sollte man berücksichtigen, was mein Kollege Arthur Schlesinger die Zyklen in der amerikanischen Politik genannt hat. Wir mögen auf dem Höhepunkt konservativer Dominanz sein oder dem Tiefpunkt - je nachdem, welche Perspektive man bevorzugt. Aber womöglich kippt diese Kurve gerade zur anderen Seite. Und in zwei Jahren, nach den nächsten Präsidentschaftswahlen, haben wir wieder eine ganz andere politische Landschaft.
Sehen Sie irgendwelche Anzeichen dafür?
Die Leute fragen mich oft nach einer historischen Parallele. Mich erinnert Bushs Irak-Krieg an die britische Invasion Ägyptens 1882. Da ging es ursprünglich darum, dass eine ultranationalistische muslimische Bewegung in Kairo und Alexandria westliche Interessen bedrohte. Der Suez-Kanal war in Gefahr. Premierminister Gladstone schickte Soldaten, um die lokalen Fanatiker zu besiegen und die für den Westen wichtige Schifffahrtsstraße zu sichern. Gladstone versprach Großbritanniens Hilfe beim Wiederaufbau nach dem Krieg, und das ganze Engagement sollte nach einem Jahr beendet sein. Die Briten haben Ägypten 70 Jahre später verlassen. Das macht kein Amerikaner mit.
Interview: Hans-Hermann Klare und Michael Streck

"Das kann in einem Debakel enden"
Professor Kennedy, Sie haben bereits 1988, noch vor dem Fall der Mauer, in Ihrem Buch "Aufstieg und Fall der großen Mächte" den Niedergang der USA vorausgesagt. Könnte Amerikas Irak-Krieg der Anfang vom Ende werden?
Nun, wir sind die letzte Supermacht. Das Militärbudget der USA ist so groß wie das der folgenden 14 Länder zusammen. Darin steckt eine Gefahr. Solche Überlegenheit kann zu imperialer Hybris führen. Der Irak-Krieg wäre der eine Krieg zu viel.
Aber will die Bush-Regierung mit diesem Krieg nicht gerade Amerikas Idee von Demokratie weiterverbreiten?
Nein. Dieser Krieg ist das Ergebnis einer vom stellvertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz im vergangenen Sommer entworfenen Strategie der nationalen Sicherheit. Doch die Bush-Regierung schob dauernd neue Gründe vor, weshalb wir Saddam Hussein besiegen müssen. Mal sind es seine Verbindungen zu al Qaeda, mal sind es die Massenvernichtungswaffen, mal seine Missachtung der UN-Sanktionen, mal die Brutalität des Regimes, mal die Gefahr für Israel. In Wahrheit geht es nicht um Demokratisierung, sondern darum, wer der Stärkste auf der Welt ist. Wolfowitz und sein Zirkel wollen jeden daran hindern, den Vereinigten Staaten gefährlich zu werden.
Wird ihnen das gelingen?
Längerfristig könnten sie die Unterstützung für diesen Kurs verlieren.
Was heißt längerfristig?
Zwei bis drei Jahre. Das hängt davon ab, ob die Falken sich durchsetzen und tatsächlich an ihr großes Projekt gehen können, den ganzen Nahen Osten umzukrempeln. Es ist bemerkenswert, wenn man ihnen zuhört, wie sie auch noch die Demokratie im Iran verwirklichen wollen, wie sie die allmähliche Öffnung Saudi-Arabiens unterstützen werden. Sie könnten schnell herausfinden, dass sie sich mit dem Irak schon genug auf den Teller geladen haben, mehr, als sie verdauen können. Dann hätten sich ihre expansiven Pläne schnell erledigt. Noch ist es zu früh für ein Urteil darüber.
Falls der Krieg so läuft, wie die Falken in Washington hoffen: keine riesigen Verluste für die USA, Saddam Hussein binnen Wochen erledigt - wäre der Irak dann nur ein erster Schritt?
Dann ist der Irak nicht die Endstation. Vorausgesetzt, dass das Unbehagen in der Bevölkerung nicht wächst und die Kritik im Kongress nicht wieder auflebt.
Sind die Kritiker dort nicht scheintot?
Ja, die liegen praktisch auf der Intensivstation. Wenn ein 85-jähriger Senator wie Robert Byrd der einzige ist, der grundlegende Kritik äußert, kann der Kongress wohl kaum in guter Verfassung sein. Die Falken können dann mit ihrem Programm fortfahren.
Könnte Amerika es sich wirklich erlauben, diesem Krieg weitere folgen zu lassen?
Das hängt von drei Variablen ab. Die eine ist die Unwägbarkeit des Krieges. Wenn es auf dem Schlachtfeld schief geht, wird es fürchterlich für das Weiße Haus. Die zweite ist die Angst vieler Amerikaner, demnächst keinen Job mehr zu haben. Die wirtschaftliche Lage des Landes spielt also eine Rolle. Die dritte Variable ist die öffentliche Meinung, die eng mit den ersten beiden zusammenhängt. Im Augenblick mögen sich die Menschen unter dem Sternenbanner versammeln. Aber das ist erfahrungsgemäß nicht von langer Dauer. Wenn sich die Ökonomie verschlechtert und das Abenteurertum in Übersee nicht nach Plan verläuft, sind die Leute in zwei Jahren nicht mehr da, die heute die Politik bestimmen.
Und wenn sie doch gewinnen?
Dann wäre das Thema des "imperial overstretch". Also ob sich die USA ein so teures Militär an so vielen Stellen der Welt, womöglich verstrickt in teure Kriege oder aufwendigen Wiederaufbau, überhaupt leisten können.
Zweifeln Sie daran?
Eine Regierung, die in einen Krieg zieht, gleichzeitig massiv die Steuern senkt, ein dramatisches Haushalts- und Außenhandelsdefizit anhäuft und sich außerdem mit fast allen überworfen hat, die normalerweise ihre Partner sind, spielt ein gefährliches Spiel. So etwas kann in einem Debakel enden.
Auch militärisch?
Wenn wir diesen Krieg nicht relativ schnell gewinnen, hat die Regierung eine Unmenge Steuergelder für nichts und wieder nichts vergeudet. Militärisch sollte es an sich kein Problem sein, auch wenn ich sicher bin, dass Saddam Hussein noch ein paar schmutzige Tricks auf Lager hat. Der Irak hat mehr Ingenieure ausgebildet als jedes andere Land im Nahen Osten. Manche sind eifrige Nationalisten, andere wissen immerhin, wie man mit chemischen und biologischen Kampfstoffen umgeht. Militärisch sollte die Sache in zwei Monaten erledigt sein. Aber das wäre eben nicht das Ende der Geschichte. Wir könnten in eine viel größere, kompliziertere Sache hineingezogen werden.
Und dann wäre die Weltmacht USA am Ende?
Militärisch kann uns auf absehbare Zeit niemand einholen. Aber wirtschaftlich sieht die Lage ganz anders aus. Die Europäische Union ist in etwa so stark wie die USA. Wenn man Japan, Südkorea und China zusammennimmt, reden wir bereits über drei große Konkurrenten. Und wenn wir auch noch Wissenschaft und Kultur berücksichtigen, erweitert sich die Zahl der Mitspieler nochmals. Ich habe nie geglaubt, dass sich die ganze Welt nur nach amerikanischer Kultur richtet, nach Blue Jeans und Silicon Valley. Die USA sind nur militärisch eine Hyper-Power. Aber Regierung und Volk scheinen sich doch darüber einig zu sein, dass Wohl und Wehe der Welt von den USA abhängen.
Auch das hat mit der mangelnden öffentlichen Debatte zu tun. Schauen Sie nur mal nach Großbritannien: wie sich Tony Blair im Unterhaus für seine Position rechtfertigen musste. Er argumentierte, wie Bush das niemals könnte. Wie Blair seine Entscheidung für den Krieg zur Abstimmung stellte und sich gegen großen Widerstand behauptete - da hat man Demokratie gespürt. Und hier? Unsere Senatoren sind intellektuelle Winzlinge. Ein Teil der amerikanischen Verfassung wurde ursprünglich gestaltet, um einen imperialen Präsidenten zu vereiteln: Dieser Teil funktioniert zurzeit nicht. Und darunter leidet nun die Welt.
Mit Ausnahme der Länder, die Amerika unterstützen?
Es ist schon sehr bedenklich, dass mit Ausnahme von Großbritannien und Australien kein entwickeltes demokratisches Land mit dem Irak-Krieg wirklich etwas zu tun haben wollte. Die Amerikaner müssen stattdessen auf Rumsfelds absurde Koalition der Willigen bauen, auf die Mongolei oder El Salvador oder Kolumbien.
Sie vergessen Polen und Litauen.
Polen, Tschechen und Litauer haben eine gemeinsame Geschichte. Sie wollen zu Marktwirtschaften wachsen und orientieren sich am Westen...
...und streben damit doch nach jener Art von Demokratie, die Amerika so gern verbreiten will.
Wir reden viel über Demokratie in anderen Ländern und fragen uns nicht, ob wir die Demokratie zu Hause ausreichend schützen.
Vor wem?
Wir erleben hier den Aufstieg der christlichen Rechten. Und der Lobbyisten wie der "National Rifle Association", der Waffennarren. Nun kommen konservative jüdische Interessengruppen dazu. Leute, die früher dem eher linken Spektrum angehörten. Die USA sind nach rechts gedriftet. Die große Mehrheit der Amerikaner wollte diesen Krieg nur unter der Bedingung, dass ihr Land starke Alliierte an seiner Seite hat. Aber die Regierung Bush kann es sich leisten, exakt das Gegenteil zu tun.
Und warum kann sie sich das leisten?
Weil die Liberalen so schwach sind. Sie zeigen keine Durchsetzungskraft. Außerdem sind die Konservativen ziemlich gut geschützt. Sie haben viel Geld und die rechtsgerichteten Think Tanks in Washington, die sie munitionieren.
Welche Auswirkungen hat das?
Es gibt keine Studie darüber, wie die konservative Rechte ihren langen Marsch durch die Institutionen seit den späten siebziger Jahren angetreten hat. Sie stellten damals fest, dass es nur liberale Think Tanks gab, und entschlossen sich, ihre eigenen zu gründen: das Cato Institute oder das American Enterprise Institute. Sie bekommen Geld von konservativen Stiftungen wie der Bradley Foundation. Sie sind eng verbunden mit reichen Personen wie den Besitzern der Brauerei-Gruppe Coors. Aus diesen Kreisen erhalten sie Millionen. Außerdem ziehen sie durch die Universitäten, um kluge junge Konservative zu ködern.
Scheint so, als hätten sie ganze Arbeit geleistet.
Ja. Sie reden nur noch untereinander. Und unter ihnen wächst die Abscheu für alle, die nicht zu ihrem Kreis gehören. Die gelten als liberale Waschlappen.
Gibt es keinen Dialog mehr zwischen ihnen und dem Rest des Landes?
Zumindest hat die Arroganz kräftig zugenommen. Wer mit ihnen über die Vereinten Nationen diskutieren will oder eine Reform internationaler Organisationen, erntet bestenfalls ein verächtliches Naserümpfen. Solche Ideen sind passee. Wir haben die Flugzeugträger. Wir haben die Marines. Die Vereinten Nationen haben uns nur enttäuscht. Das ist ihr Denken. Und es ist ihnen sogar gelungen, eine Reihe von Mythen als Wahrheiten darzustellen. Dass Mogadischu ein Versagen der UN gewesen sei zum Beispiel...
...der Einsatz von US-Soldaten in einer Blauhelm-Mission 1993 in Somalia, die mit dem Abschuss von zwei US-Hubschraubern endete. Die Anhänger des Warlords Aidid zerrten damals einen toten Soldaten nackt durch die Straßen von Mogadischu.
Ja. Dabei lag diesem Debakel in Wirklichkeit ein Versagen der militärischen Führung der USA zugrunde. Aber die Rechten basteln an so etwas Ähnlichem wie einer Dolchstoßlegende.
Sie klingen sehr pessimistisch.
Vielleicht. Auf der anderen Seite sollte man berücksichtigen, was mein Kollege Arthur Schlesinger die Zyklen in der amerikanischen Politik genannt hat. Wir mögen auf dem Höhepunkt konservativer Dominanz sein oder dem Tiefpunkt - je nachdem, welche Perspektive man bevorzugt. Aber womöglich kippt diese Kurve gerade zur anderen Seite. Und in zwei Jahren, nach den nächsten Präsidentschaftswahlen, haben wir wieder eine ganz andere politische Landschaft.
Sehen Sie irgendwelche Anzeichen dafür?
Die Leute fragen mich oft nach einer historischen Parallele. Mich erinnert Bushs Irak-Krieg an die britische Invasion Ägyptens 1882. Da ging es ursprünglich darum, dass eine ultranationalistische muslimische Bewegung in Kairo und Alexandria westliche Interessen bedrohte. Der Suez-Kanal war in Gefahr. Premierminister Gladstone schickte Soldaten, um die lokalen Fanatiker zu besiegen und die für den Westen wichtige Schifffahrtsstraße zu sichern. Gladstone versprach Großbritanniens Hilfe beim Wiederaufbau nach dem Krieg, und das ganze Engagement sollte nach einem Jahr beendet sein. Die Briten haben Ägypten 70 Jahre später verlassen. Das macht kein Amerikaner mit.
Interview: Hans-Hermann Klare und Michael Streck

http://www.manager-magazin.de/ebusiness/artikel/0%2C2828%2C2…
Ellisons finstere Prophezeiungen
Oracle-Chef Larry Ellison glaubt, dass die goldene Phase der Computerindustrie unwiderruflich vorbei ist. Seiner düsteren Vision zufolge naht das Ende des kalifornischen Silicon Valley.
New York - "Was wir erleben … ist das Ende des Silicon Valley in seiner jetzigen Form", sagte Ellison in einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal". Der als exzentrisch geltende Milliardär hält die Vorstellung für überholt, dass sich die Informationstechnologie-Branche immer wieder neu erfinde und stetig weiter wachse. "Das nächste große Ding sind nicht Computer", so Ellison. Er sieht Biotechnologie als den kommenden Wachstumsmarkt.
Der Oracle-Chef prophezeit dem Wachstumssektor der vergangenen Jahrzehnte eine düstere Zukunft. Zunehmend standardisierte Produkte würden fortan von einer kleinen Zahl Unternehmen verkauft, dünne Gewinnmargen seien in Zukunft die Norm. "In der Computerindustrie gibt es die bizarre Vorstellung, dass wir nie eine reife Industrie sein werden." Dabei habe die Branche ihre maximale Größe bereits erreicht.
Weitere Vorhersagen der Internet-Kassandra: Die Hardware-Preise werden durch Billigrechner mit Linux als Betriebssystem weiter sinken. Die Entwicklung neuer Software werde in zunehmendem Maße außerhalb der USA stattfinden. Der Branche steht nach Ellisons Ansicht eine Konsolidierungsphase bevor, nach der nur ein paar große Mitspieler übrig bleiben werden, die dann eine breite Palette von Produkten anbieten.
Neidisch auf den großen Bill
Der einzige, der relativ unabhängig von der Branchenentwicklung agieren könne, sei der Betriebssystem-Anbieter Microsoft . "Wie hat Bill [Gates] die Rezession überstanden? Indem er die Preise erhöht hat! Warum ist das mir nicht eingefallen? Er ist ein Genie!" Ellison gesteht ein, dass er nicht ganz in der gleichen Liga spielt: "Wenn wir die Preise erhöhen, kaufen die Leute nichts mehr von uns. … Wir sind kein Monopolist, verdammt! … Dann hätte ich mehr Zeit zum Segeln."
Ellison ist sich zudem sicher, wer außer Microsoft und natürlich Oracle den langen kalten Winter überstehen wird und wer nicht. Cisco Systems , IBM , Dell , Intel , SAP und Amazon.com seien überlebensfähig. Spezialanbieter wie Ariba, Commerce One, BEA oder Siebel Systems trifft hingegen Ellisions Bannstrahl: Sie seien dem Untergang geweiht.
Ellisons pointierte Prognosen werden in der Technologiebranche stets mit Interesse und einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen. Seine bekannteste Prophezeiung ist der unmittelbar bevorstehende Tod des PCs (1995). Das Ereignis steht bekanntermaßen noch aus. Siebel-Chef Tom Siebel hat einen ganz eigenen Erklärungsansatz für Ellisons Valley-Vision: "Vielleicht hat er eine Sitzung mit seinem Therapeuten verpasst."



Ellisons finstere Prophezeiungen
Oracle-Chef Larry Ellison glaubt, dass die goldene Phase der Computerindustrie unwiderruflich vorbei ist. Seiner düsteren Vision zufolge naht das Ende des kalifornischen Silicon Valley.
New York - "Was wir erleben … ist das Ende des Silicon Valley in seiner jetzigen Form", sagte Ellison in einem Gespräch mit dem "Wall Street Journal". Der als exzentrisch geltende Milliardär hält die Vorstellung für überholt, dass sich die Informationstechnologie-Branche immer wieder neu erfinde und stetig weiter wachse. "Das nächste große Ding sind nicht Computer", so Ellison. Er sieht Biotechnologie als den kommenden Wachstumsmarkt.
Der Oracle-Chef prophezeit dem Wachstumssektor der vergangenen Jahrzehnte eine düstere Zukunft. Zunehmend standardisierte Produkte würden fortan von einer kleinen Zahl Unternehmen verkauft, dünne Gewinnmargen seien in Zukunft die Norm. "In der Computerindustrie gibt es die bizarre Vorstellung, dass wir nie eine reife Industrie sein werden." Dabei habe die Branche ihre maximale Größe bereits erreicht.
Weitere Vorhersagen der Internet-Kassandra: Die Hardware-Preise werden durch Billigrechner mit Linux als Betriebssystem weiter sinken. Die Entwicklung neuer Software werde in zunehmendem Maße außerhalb der USA stattfinden. Der Branche steht nach Ellisons Ansicht eine Konsolidierungsphase bevor, nach der nur ein paar große Mitspieler übrig bleiben werden, die dann eine breite Palette von Produkten anbieten.
Neidisch auf den großen Bill
Der einzige, der relativ unabhängig von der Branchenentwicklung agieren könne, sei der Betriebssystem-Anbieter Microsoft . "Wie hat Bill [Gates] die Rezession überstanden? Indem er die Preise erhöht hat! Warum ist das mir nicht eingefallen? Er ist ein Genie!" Ellison gesteht ein, dass er nicht ganz in der gleichen Liga spielt: "Wenn wir die Preise erhöhen, kaufen die Leute nichts mehr von uns. … Wir sind kein Monopolist, verdammt! … Dann hätte ich mehr Zeit zum Segeln."
Ellison ist sich zudem sicher, wer außer Microsoft und natürlich Oracle den langen kalten Winter überstehen wird und wer nicht. Cisco Systems , IBM , Dell , Intel , SAP und Amazon.com seien überlebensfähig. Spezialanbieter wie Ariba, Commerce One, BEA oder Siebel Systems trifft hingegen Ellisions Bannstrahl: Sie seien dem Untergang geweiht.
Ellisons pointierte Prognosen werden in der Technologiebranche stets mit Interesse und einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen. Seine bekannteste Prophezeiung ist der unmittelbar bevorstehende Tod des PCs (1995). Das Ereignis steht bekanntermaßen noch aus. Siebel-Chef Tom Siebel hat einen ganz eigenen Erklärungsansatz für Ellisons Valley-Vision: "Vielleicht hat er eine Sitzung mit seinem Therapeuten verpasst."



http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?id=506406&nv=…
Angriff auf Hotel
Journalistenverband: USA haben Journalisten absichtlich attackiert
Das Vorstandsmitglied des Deutschen Journalistenverbandes, Gustl Glattfelder, hat den USA vorgeworfen, die westlichen Journalisten im Palestine-Hotel in Bagdad absichtlich attackiert zu haben. Es liege im Interesse der USA, dass Journalisten nur das berichten, was die Amerikaner vorgeben, sagte Glattfelder am Mittwoch im DeutschlandRadio Berlin.
Glattfelder, auch Vizepräsident der Internationalen Journalistenföderation, räumte ein, dass Tod ein Berufsrisiko von Kriegsberichterstattern sei, sagte aber: "Das Risiko muss kalkulierbar bleiben, dass bei einem Krieg, an dem eine zivilisierte Macht wie die USA beteiligt sind, klar erkennbare Journalistenfahrzeuge und Gebäude nicht attackiert werden".
Beim Beschuss eines Journalisten-Hotels und des arabischen Senders El Dschasira waren am Dienstag drei Medienvertreter getötet und vier weitere verletzt worden. Das US-Verteidigungsministerium hat inzwischen den Tod von drei Journalisten bedauert.
Zum Tod der drei Journalisten, die ums Leben kamen, sagte US-Generalmajor Stanley McChrystal: "Wir sind im Krieg. Unsere Soldaten wurden beschossen. Sie machten von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch."
Staatsministerin Müller für Untersuchung nach Tod von Journalisten
Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller (Grüne), eine Untersuchung gefordert. Die Journalisten wüssten natürlich um die Gefahr ihrer Arbeit im Irak, sagte Müller am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Aber trotzdem sollten solche Vorgänge auf jeden Fall untersucht werden", denn sowohl das Hotel Palestine als auch der Standort des arabischen Senders El Dschasira seien dem amerikanischen Militär bekannt gewesen.
Beim Beschuss eines Journalisten-Hotels und des arabischen Senders in Bagdad wurden am Dienstag drei Medienvertreter getötet und weitere vier verletzt. Ein ukrainischer und ein spanischer Kameramann starben, als ein US-Panzer eine Granate auf das Hotel "Palestine" abfeuerte. Wenige Stunden vorher war der Korrespondent des arabischen Fernsehsenders El Dschasira ums Leben gekommen, als bei US- Luftangriffen zwei Raketen in dem Sendegebäude einschlugen.
"Aftenposten": US-Angriff gegen Medienzentren kann Terrorakt sein
Die konservative norwegische Tageszeitung "Aftenposten" (Oslo) meint am Mittwoch zum Tod von drei Journalisten in Bagdad als Folge von US-Angriffen:
"Krieg löst immer Leid aus, und in einer Stadt wie Bagdad werden die Zivilisten am härtesten getroffen. Journalisten halten sich dort aus eigenem freien Willen auf und haben bessere Möglichkeiten als die meisten Ortsansässigen. Diese Perspektive müssen auch wir Medienleute klar vor Augen haben. Dennoch muss man kräftig protestieren, wenn Medien angegriffen werden, weil so viele die unabhängigen und wachsamen Journalisten dort zum Schweigen bringen wollen. Nur unabhängige Medien können glaubwürdig berichten, was derzeit in Bagdad passiert.
Seriöse Journalisten konnten zu dem Angriff berichten, dass es keine militärischen Ziele gab, als zwei Medienzentren getroffen wurden. Die Amerikaner müssen sich der Frage stellen, ob dies ein Terrorbeschuss war, der internationale Zeugen aus Bagdad verjagen soll, ehe der abschließende Kampf um die Stadt beginnt. Es fällt schwer, an unglückliche Zufälle und tragische Fehlentscheidungen zu glauben. Wir erinnern daran, das die Amerikaner das Büro von El Dschasira auch während des Krieges in Afghanistan angegriffen haben, ohne dass sie den TV-Kanal damit zum Schweigen bringen konnten. Das wird auch jetzt nicht gelingen."
Meldung vom 09. April 2003
-------
Dann werden ein paar Heckenschützen erfunden und schon ist die Sache, die zum Himmel stinkt, gerechtfertigt

Angriff auf Hotel
Journalistenverband: USA haben Journalisten absichtlich attackiert
Das Vorstandsmitglied des Deutschen Journalistenverbandes, Gustl Glattfelder, hat den USA vorgeworfen, die westlichen Journalisten im Palestine-Hotel in Bagdad absichtlich attackiert zu haben. Es liege im Interesse der USA, dass Journalisten nur das berichten, was die Amerikaner vorgeben, sagte Glattfelder am Mittwoch im DeutschlandRadio Berlin.
Glattfelder, auch Vizepräsident der Internationalen Journalistenföderation, räumte ein, dass Tod ein Berufsrisiko von Kriegsberichterstattern sei, sagte aber: "Das Risiko muss kalkulierbar bleiben, dass bei einem Krieg, an dem eine zivilisierte Macht wie die USA beteiligt sind, klar erkennbare Journalistenfahrzeuge und Gebäude nicht attackiert werden".
Beim Beschuss eines Journalisten-Hotels und des arabischen Senders El Dschasira waren am Dienstag drei Medienvertreter getötet und vier weitere verletzt worden. Das US-Verteidigungsministerium hat inzwischen den Tod von drei Journalisten bedauert.
Zum Tod der drei Journalisten, die ums Leben kamen, sagte US-Generalmajor Stanley McChrystal: "Wir sind im Krieg. Unsere Soldaten wurden beschossen. Sie machten von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch."
Staatsministerin Müller für Untersuchung nach Tod von Journalisten
Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller (Grüne), eine Untersuchung gefordert. Die Journalisten wüssten natürlich um die Gefahr ihrer Arbeit im Irak, sagte Müller am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Aber trotzdem sollten solche Vorgänge auf jeden Fall untersucht werden", denn sowohl das Hotel Palestine als auch der Standort des arabischen Senders El Dschasira seien dem amerikanischen Militär bekannt gewesen.
Beim Beschuss eines Journalisten-Hotels und des arabischen Senders in Bagdad wurden am Dienstag drei Medienvertreter getötet und weitere vier verletzt. Ein ukrainischer und ein spanischer Kameramann starben, als ein US-Panzer eine Granate auf das Hotel "Palestine" abfeuerte. Wenige Stunden vorher war der Korrespondent des arabischen Fernsehsenders El Dschasira ums Leben gekommen, als bei US- Luftangriffen zwei Raketen in dem Sendegebäude einschlugen.
"Aftenposten": US-Angriff gegen Medienzentren kann Terrorakt sein
Die konservative norwegische Tageszeitung "Aftenposten" (Oslo) meint am Mittwoch zum Tod von drei Journalisten in Bagdad als Folge von US-Angriffen:
"Krieg löst immer Leid aus, und in einer Stadt wie Bagdad werden die Zivilisten am härtesten getroffen. Journalisten halten sich dort aus eigenem freien Willen auf und haben bessere Möglichkeiten als die meisten Ortsansässigen. Diese Perspektive müssen auch wir Medienleute klar vor Augen haben. Dennoch muss man kräftig protestieren, wenn Medien angegriffen werden, weil so viele die unabhängigen und wachsamen Journalisten dort zum Schweigen bringen wollen. Nur unabhängige Medien können glaubwürdig berichten, was derzeit in Bagdad passiert.
Seriöse Journalisten konnten zu dem Angriff berichten, dass es keine militärischen Ziele gab, als zwei Medienzentren getroffen wurden. Die Amerikaner müssen sich der Frage stellen, ob dies ein Terrorbeschuss war, der internationale Zeugen aus Bagdad verjagen soll, ehe der abschließende Kampf um die Stadt beginnt. Es fällt schwer, an unglückliche Zufälle und tragische Fehlentscheidungen zu glauben. Wir erinnern daran, das die Amerikaner das Büro von El Dschasira auch während des Krieges in Afghanistan angegriffen haben, ohne dass sie den TV-Kanal damit zum Schweigen bringen konnten. Das wird auch jetzt nicht gelingen."
Meldung vom 09. April 2003
-------
Dann werden ein paar Heckenschützen erfunden und schon ist die Sache, die zum Himmel stinkt, gerechtfertigt


http://www.bluebull.com/DE/ge/main.html?http://www.bluebull.…
Ressort: Blue News Deutschland Deutsch, 09.04.2003 12:36:41
Kolumne: Aufbäumen vor dem großen Fall?
Der Irak-Krieg scheint „gewonnen“, der Ölpreis ist massiv zurückgekommen, ebenso das Gold und die Bond-Kurse. Der psychologische Druck ist genommen, die Verbraucher werden nun zur alten Konsumfreude zurückkehren, der US-Dollar wieder steigen. Letzteres verkündet kein geringerer als der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman.
Ebenfalls von einem anerkannten Wirtschaftsnobelpreisträger stammen diese Worte: "In ein paar Monaten erwarte ich die Aktien sehr viel höher als heute". Dies sagte Amerikas angesehener Wirtschaftsprofessor Irving Fisher 14 Tage vor dem großen Crash am 29. Oktober 1929. Sollte Milton Friedman etwa ein ähnliches Schicksal ereilen?
Die US-Rezession kommt
Sämtliche Konjunkturdaten weisen darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft auf eine Rezession zu bewegt. Selbst wenn die US-Verbraucher durch ein „erfolgreiches“ Ende des Irak-Krieges tatsächlich mehr konsumieren würden – was angesichts der Verschuldungslage und der schwindenden Möglichkeit weiterer Refinanzierungen fraglich ist – würde sich dadurch wenig an der fundamental schwachen Lage ändern. Die Unternehmen sind weiterhin eher damit beschäftigt, Kosten zu drücken als zu investieren. Fehlende Investitionen des einen sind die fehlenden Umsätze und Erträge des anderen. Entlassungen führen zu verringerter Nachfrage. Ein Teufelskreis. Solange sich keine Wende in der Investitionsbereitschaft zeigt, wird sich auch die Wirtschaft nicht nachhaltig erholen.
Es kann nur einen geben!
Dieses Prinzip aus dem Fantasy-Film „Highlander“ kann man ohne weiteres auf die aktuelle Lage an den Märkten übertragen. In globalisierten Märkten, in denen Technologien wie das Internet Preisvergleiche binnen Sekunden ermöglichen, sind die Unternehmen einem brutalen Konkurrenzkampf ausgesetzt. Dies gilt umso mehr, je homogener die Produkte und Dienstleistungen sind. Kann es da verwundern, dass sich die Chippreise nicht nachhaltig erholen? Zu viele Kapazitäten wurden in den 90ern aufgebaut, zu sehr sind die Märkte bereits gesättigt. Wachstum wird es in einigen Technologiesektoren wie beispielsweise dem Handy-Markt kaum noch geben, bestenfalls Subsitution: Nokia setzt tendenziell nicht mehr um, sondern kann nur hoffen, durch neue Handy-Modelle das Umsatzniveau zu halten. Aus Technologieunternehmen sind Zykliker geworden! Nur wenige Unternehmen werden die Phase der Marktbereinigung überleben, das hat jüngst auch Oracle-Chef Larry Ellison verkündet.
Der DAX hat seinen sekundären Abwärtstrend gebrochen, der Dow Jones steht kurz davor, über seine 200-Tage-Linie zu steigen. Die Hoffnung der Anleger auf den finalen Boden zeigt sich auch in den Volatilitätsindizes, die jüngst deutlich zurückgekommen sind. Es ist denkbar, dass die Anleger den endgültigen „Sieg“ im Irak noch einige Wochen feiern werden, allerdings ist das die Annahme fast aller Investoren. Wenn dem so ist, werden sie sich womöglich schon vorher positionieren und vielleicht haben sie das jüngst bereits getan. Womöglich wird daher in nächster Zeit eine „gemeine Bullenfalle“ zuschnappen. Erinnert sei abermals an die SKS-Formation im Dow Jones, deren Auflösung einen schnellen Kursverfall auf zunächst 6.000 Punkte mit sich bringen würde. Es spricht weiterhin noch einiges dafür, dass wir gerade das letzte Aufbäumen vor einem nochmaligen Abfall erleben. Unklar ist, wie lange dieses Aufbäumen noch anhalten wird. /Marco Feiten/7P

Ressort: Blue News Deutschland Deutsch, 09.04.2003 12:36:41
Kolumne: Aufbäumen vor dem großen Fall?
Der Irak-Krieg scheint „gewonnen“, der Ölpreis ist massiv zurückgekommen, ebenso das Gold und die Bond-Kurse. Der psychologische Druck ist genommen, die Verbraucher werden nun zur alten Konsumfreude zurückkehren, der US-Dollar wieder steigen. Letzteres verkündet kein geringerer als der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman.
Ebenfalls von einem anerkannten Wirtschaftsnobelpreisträger stammen diese Worte: "In ein paar Monaten erwarte ich die Aktien sehr viel höher als heute". Dies sagte Amerikas angesehener Wirtschaftsprofessor Irving Fisher 14 Tage vor dem großen Crash am 29. Oktober 1929. Sollte Milton Friedman etwa ein ähnliches Schicksal ereilen?
Die US-Rezession kommt
Sämtliche Konjunkturdaten weisen darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft auf eine Rezession zu bewegt. Selbst wenn die US-Verbraucher durch ein „erfolgreiches“ Ende des Irak-Krieges tatsächlich mehr konsumieren würden – was angesichts der Verschuldungslage und der schwindenden Möglichkeit weiterer Refinanzierungen fraglich ist – würde sich dadurch wenig an der fundamental schwachen Lage ändern. Die Unternehmen sind weiterhin eher damit beschäftigt, Kosten zu drücken als zu investieren. Fehlende Investitionen des einen sind die fehlenden Umsätze und Erträge des anderen. Entlassungen führen zu verringerter Nachfrage. Ein Teufelskreis. Solange sich keine Wende in der Investitionsbereitschaft zeigt, wird sich auch die Wirtschaft nicht nachhaltig erholen.
Es kann nur einen geben!
Dieses Prinzip aus dem Fantasy-Film „Highlander“ kann man ohne weiteres auf die aktuelle Lage an den Märkten übertragen. In globalisierten Märkten, in denen Technologien wie das Internet Preisvergleiche binnen Sekunden ermöglichen, sind die Unternehmen einem brutalen Konkurrenzkampf ausgesetzt. Dies gilt umso mehr, je homogener die Produkte und Dienstleistungen sind. Kann es da verwundern, dass sich die Chippreise nicht nachhaltig erholen? Zu viele Kapazitäten wurden in den 90ern aufgebaut, zu sehr sind die Märkte bereits gesättigt. Wachstum wird es in einigen Technologiesektoren wie beispielsweise dem Handy-Markt kaum noch geben, bestenfalls Subsitution: Nokia setzt tendenziell nicht mehr um, sondern kann nur hoffen, durch neue Handy-Modelle das Umsatzniveau zu halten. Aus Technologieunternehmen sind Zykliker geworden! Nur wenige Unternehmen werden die Phase der Marktbereinigung überleben, das hat jüngst auch Oracle-Chef Larry Ellison verkündet.
Der DAX hat seinen sekundären Abwärtstrend gebrochen, der Dow Jones steht kurz davor, über seine 200-Tage-Linie zu steigen. Die Hoffnung der Anleger auf den finalen Boden zeigt sich auch in den Volatilitätsindizes, die jüngst deutlich zurückgekommen sind. Es ist denkbar, dass die Anleger den endgültigen „Sieg“ im Irak noch einige Wochen feiern werden, allerdings ist das die Annahme fast aller Investoren. Wenn dem so ist, werden sie sich womöglich schon vorher positionieren und vielleicht haben sie das jüngst bereits getan. Womöglich wird daher in nächster Zeit eine „gemeine Bullenfalle“ zuschnappen. Erinnert sei abermals an die SKS-Formation im Dow Jones, deren Auflösung einen schnellen Kursverfall auf zunächst 6.000 Punkte mit sich bringen würde. Es spricht weiterhin noch einiges dafür, dass wir gerade das letzte Aufbäumen vor einem nochmaligen Abfall erleben. Unklar ist, wie lange dieses Aufbäumen noch anhalten wird. /Marco Feiten/7P

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,244241,00.html
BLIX KRITISIERT USA
Irak-Krieg war von langer Hand geplant
Uno-Chefwaffeninspektor Hans Blix erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-Regierung: Washington habe den Krieg gegen den Irak lange geplant, kein Interesse an Massenvernichtungswaffen gehabt und durch den Krieg sogar zu deren Verbreitung beigetragen.
Madrid - "Ich glaube heute, dass die Suche nach Massenvernichtungswaffen für die USA und Großbritannien nur etwa an vierter Stelle kam", sagte Blix der spanischen Zeitung "El Pais". Das eigentliche Ziel des Krieges sei der Sturz Saddam Husseins gewesen.
US-Präsident George W. Bush habe ihm im Oktober vergangenen Jahres versichert, die Waffeninspektionen der Vereinten Nationen zu unterstützen, sagte Blix. Der Chefinspektor erklärte aber, er habe schon damals gewusst, dass Mitglieder der US-Regierung einen Sturz des irakischen Regimes planten. Spätestens im März seien die "Falken ungeduldig geworden".
Die Fälschung von Beweisen gegen Bagdad lasse sogar daran zweifeln, ob die USA jemals ernsthaft an die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen geglaubt hätten. Mittlerweile müsse Washington noch weniger als zuvor von seinen Behauptungen überzeugt sein. Die Verluste an Menschenleben und die "Zerstörung eines Landes" bezeichnete Blix als "äußerst hohen Preis, wenn die Gefahr der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen durch Uno-Inspektionen hätte eingedämmt werden können".
Der Angriff auf den Irak werde die Gefahr der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen nicht verringern, sondern verstärken, sagte Blix der Zeitung. Washington habe das falsche Signal gesendet: dass ein Land riskiert, angegriffen zu werden, wenn es keine biologischen, chemischen oder nuklearen Waffen besitzt. Das beweise die im Vegleich zum Irak eher zurückhaltende US-Politik gegenüber der Atommacht Nordkorea.
"Wenn ein Staat den Eindruck hat, dass seine Sicherheit garantiert ist, braucht er keine Massenvernichtungswaffen", sagte Blix. "Die Sicherheitsgarantie ist die erste Verteidigungslinie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen."
------
Würde mich nicht wundern wenn Blix in bälde einen Autounfall hat, oder einen Herzinfakt!
BLIX KRITISIERT USA
Irak-Krieg war von langer Hand geplant
Uno-Chefwaffeninspektor Hans Blix erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-Regierung: Washington habe den Krieg gegen den Irak lange geplant, kein Interesse an Massenvernichtungswaffen gehabt und durch den Krieg sogar zu deren Verbreitung beigetragen.
Madrid - "Ich glaube heute, dass die Suche nach Massenvernichtungswaffen für die USA und Großbritannien nur etwa an vierter Stelle kam", sagte Blix der spanischen Zeitung "El Pais". Das eigentliche Ziel des Krieges sei der Sturz Saddam Husseins gewesen.
US-Präsident George W. Bush habe ihm im Oktober vergangenen Jahres versichert, die Waffeninspektionen der Vereinten Nationen zu unterstützen, sagte Blix. Der Chefinspektor erklärte aber, er habe schon damals gewusst, dass Mitglieder der US-Regierung einen Sturz des irakischen Regimes planten. Spätestens im März seien die "Falken ungeduldig geworden".
Die Fälschung von Beweisen gegen Bagdad lasse sogar daran zweifeln, ob die USA jemals ernsthaft an die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen geglaubt hätten. Mittlerweile müsse Washington noch weniger als zuvor von seinen Behauptungen überzeugt sein. Die Verluste an Menschenleben und die "Zerstörung eines Landes" bezeichnete Blix als "äußerst hohen Preis, wenn die Gefahr der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen durch Uno-Inspektionen hätte eingedämmt werden können".
Der Angriff auf den Irak werde die Gefahr der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen nicht verringern, sondern verstärken, sagte Blix der Zeitung. Washington habe das falsche Signal gesendet: dass ein Land riskiert, angegriffen zu werden, wenn es keine biologischen, chemischen oder nuklearen Waffen besitzt. Das beweise die im Vegleich zum Irak eher zurückhaltende US-Politik gegenüber der Atommacht Nordkorea.
"Wenn ein Staat den Eindruck hat, dass seine Sicherheit garantiert ist, braucht er keine Massenvernichtungswaffen", sagte Blix. "Die Sicherheitsgarantie ist die erste Verteidigungslinie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen."
------
Würde mich nicht wundern wenn Blix in bälde einen Autounfall hat, oder einen Herzinfakt!

11/04/2003 16:04
US-Verbrauchervertrauens-Index unerwartet stark gestiegen
New York, 11. Apr (Reuters) - Das Vertrauen der
US-Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung ihres Landes
ist im April angesichts eines sich abzeichnenden Endes des
Irak-Krieges deutlich stärker als von Analysten erwartet
gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen der Universität
Michigan kletterte der Verbrauchervertrauens-Index im April auf
83,2 von 77,6 Zählern im März, wie am Freitag aus New Yorker
Finanzkreisen verlautete. Von Reuters befragte Volkswirte hatten
im Schnitt mit 78,1 Zählern gerechnet.
Der von Anlegern und Volkswirten stark beachtete Index gilt
als wichtiges Konjunkturbarometer, das die Stimmung und das
Kaufverhalten der US-Verbraucher im Voraus anzeigt. Die
Konsumausgaben machen rund zwei Drittel der Wirtschaftsleistung
der USA aus. Wegen des Irak-Krieges und der Sorgen über die
Folgen für die US-Wirtschaft war das Verbrauchervertrauen in den
vergangenen Wochen zurückgegangen.
Den Angaben aus Finanzkreisen zufolge zog der ebenfalls von
der Universität Michigan berechnete Index der gegenwärtigen
Bedingungen, der die Einschätzung der aktuellen finanziellen
Situation der Verbraucher wiedergibt, im April auf 94,8
(Vormonat 90,0) Punkte an. Der Index der Erwartungen für die
nächsten zwölf Monate stieg auf 75,7 von 69,6 Zählern.
Der vorläufige Index beruht auf einer landesweiten
telefonischen Befragung von rund 250 US-Bürgern. Für die
Ermittlung des endgültigen Indexes am Monatsende werden weitere
250 Bürger befragt.
ale



US-Verbrauchervertrauens-Index unerwartet stark gestiegen
New York, 11. Apr (Reuters) - Das Vertrauen der
US-Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung ihres Landes
ist im April angesichts eines sich abzeichnenden Endes des
Irak-Krieges deutlich stärker als von Analysten erwartet
gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen der Universität
Michigan kletterte der Verbrauchervertrauens-Index im April auf
83,2 von 77,6 Zählern im März, wie am Freitag aus New Yorker
Finanzkreisen verlautete. Von Reuters befragte Volkswirte hatten
im Schnitt mit 78,1 Zählern gerechnet.
Der von Anlegern und Volkswirten stark beachtete Index gilt
als wichtiges Konjunkturbarometer, das die Stimmung und das
Kaufverhalten der US-Verbraucher im Voraus anzeigt. Die
Konsumausgaben machen rund zwei Drittel der Wirtschaftsleistung
der USA aus. Wegen des Irak-Krieges und der Sorgen über die
Folgen für die US-Wirtschaft war das Verbrauchervertrauen in den
vergangenen Wochen zurückgegangen.
Den Angaben aus Finanzkreisen zufolge zog der ebenfalls von
der Universität Michigan berechnete Index der gegenwärtigen
Bedingungen, der die Einschätzung der aktuellen finanziellen
Situation der Verbraucher wiedergibt, im April auf 94,8
(Vormonat 90,0) Punkte an. Der Index der Erwartungen für die
nächsten zwölf Monate stieg auf 75,7 von 69,6 Zählern.
Der vorläufige Index beruht auf einer landesweiten
telefonischen Befragung von rund 250 US-Bürgern. Für die
Ermittlung des endgültigen Indexes am Monatsende werden weitere
250 Bürger befragt.
ale



http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,244297,00.html
KRIEGSGRUNDSUCHE
Das Geheimnis der verschwundenen Massenvernichtungswaffen
Von Holger Kulick
Der Kriegsverlauf hat bislang alle Vermutungen bestätigt, dass es der US-Regierung vordringlich um einen Machtwechsel im Irak ging. Vom eigentlichen Kriegsgrund, Saddams angeblichen Massenvernichtungsmitteln, fehlt dagegen jede Spur. Eine "Hauptkriegslüge" nennt das der SPD-Abgeordnete Hermann Scheer. Die Bundesregierung scheut dagegen solche offene Kritik.
Berlin/Washington - Die Szenerie hat sich in diesen Tagen mehrfach vor laufenden CNN-Kameras wiederholt. US-Soldaten stießen in vermeintlichen Lagern der irakischen Armee auf verdächtige Fässer mit einer chemischen Flüssigkeit oder verdächtigem weißen Pulver. Mitreisende US-Reporter wähnten schon den lang erwarteten Sensationsfund von Chemiewaffen Saddam Husseins, aber dann gaben Militärs ernüchtert Entwarnung.
Mal handelte es sich nur um Pestizide aus der Landwirtschaft, im anderen Fall um gewöhnlichen Sprengstoff. Selbst US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld warnte inzwischen kleinlaut vor voreiligem Triumphgeschrei in dieser Frage.
Dabei hatte Anfang März US-Verteidigungsminister Colin Powell steif und fest in der Uno geschworen, der Irak besitze mindestens 500 Tonnen chemischer Kampfstoffe, die ausreichen würden, um 16.000 Raketen zu bestücken. Dazu zeigte er Schaubilder rollender Chemielabore und schüttelte demonstrativ ein kleines Mustergiftfläschchen, das - enthielte es echte biologische Kampfstoffe - ausreichen würde, zigtausend Menschen zu töten.
22 Kriegstage sind inzwischen vorüber, doch noch immer wurde kein Depot von Massenvernichtungswaffen im Irak entdeckt. Auch keine Rakete mit Biogiften wurde abgeschossen, allenfalls Gasmasken und Gegenmittel gegen Giftgasangriffe fanden sich in verlassenen Schützengräben. Beweisen tut das nichts, denn genauso denkbar ist, dass die irakischen Soldaten Angst vor Betäubungsgasen der Alliierten hatten.
Doch noch immer spricht das Weiße Haus unbeirrt davon, dass die hochgefährliche Massenvernichtungswaffen trotzdem existieren. Kein Wunder, schließlich geht es um Beweise für die Berechtigung dieses Kriegs. Allzu oft hat Präsident Bush persönlich betont, dass bereits die Gefährdung Amerikas durch diese Waffen einen Krieg aus Notwehr gegen Saddam Husseins Regime rechtfertigen soll.
So beteuerte Donnerstagabend zum x-ten Mal US- Präsidentensprecher Ari Fleischer, dass der Irak die so genannten WMDs (Weapons of Mass Destruction) besitze und das Saddams Helfer Experten im Verstecken seien. Die US-Regierung sei "weiter höchst zuversichtlich, dass sie welche haben und sie gefunden werden."
"Immer der gleiche Vorwand"
Immer der gleiche Vorwand, stöhnt der SPD-Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer über die Argumentation der US-Regierung. Das sei eine "Beleidigung des politischen Verstands". Bislang habe der Kriegsverlauf eher bewiesen, dass die irakische Seite mit ihren Beteuerungen Recht gehabt habe, dass irakische Massenvernichtungswaffen nach dem letzten Golfkrieg vernichtet worden sind.
Selbst alte Restbestände könnten kaum mehr waffenfähig sein, schließlich hätten solche Gifte eine Verfallszeit von fünf Jahren. "Das ist virtuelles Spiel der Amerikaner mit der Angst und eine völlig verlogene Argumentation" schimpft Scheer. Nun gehe es der US-Regierung offensichtlich weiterhin darum, mit solchen Bedrohungslügen "ihren doppelten Völkerrechtsbruch zu kaschieren".
Weder die Uno-Resolution 1441 habe legitimiert, dass gegen nur angeblich vorhandene Vernichtungswaffen zu Felde gezogen werden darf, noch sei es völkerrechtlich abgedeckt, zivile Ziele gezielt zu bombardieren, wie es offenkundig mehrfach geschehen sei. "In Wahrheit ging es nur um Okkupation des Irak", sagt Scheer. Und im Hintergrund stehe nach wie vor der Zugriff auf die irakischen Ölvorräte, glaubt der Bundestagsabgeordnete. Schließlich habe US-Vizepräsident Cheney bereits im nationalen Energiereport der USA von 2001 als neue Militärdoktrin vorformuliert, Ressourcensicherung ins Zentrum amerikanischer Sicherheitspolitik zu stellen. Dies werde jetzt "in aus amerikanischer Sicht logischen Schritten" umgesetzt.
Was Amerika betreibe, so der SPD-Linksaußen und Energieexperte seiner Partei, sei also schlicht eine "konsequente Ressourcenstrategie", über die die Öffentlichkeit getäuscht werde. Doch nunmehr habe sich George W. Bushs Schutzbehauptung, dass das Saddam-Regime - so verabscheuenswürdig es auch sei - durch Massenvernichtungswaffen eine akute Bedrohung des Weltfriedens darstelle, als "Hauptkriegslüge" herausgestellt.
Schadensbegrenzung mit USA geht vor
Eine Rüge der USA ist aber weder in der Uno, noch durch eine Stellungnahme einzelner europäischer Regierungen vorstellbar, auch nicht seitens Bundeskanzler Schröder. "Es wird nicht alles verbalisiert, was gedacht wird", sagt Scheer. Dies sei derzeit die Devise, "um wieder zu einem relativ geordneten politischen Umgang mit den USA zu kommen". Kurzum: die Schadensbegrenzung auf dem diplomatischen Parkett ist wichtiger als Kriegskritik.
Daher werde die Bewertung, dass es sich bei diesem Krieg um einen Völkerrechtsbruch der USA handelt, "sorgsam umgangen", schildert Scheer. Aber es wäre falsch, wenn sich die gesamte politische Öffentlichkeit nun verhalten müsse wie ein Diplomat.
Denn es scheint nicht unwahrscheinlich, dass die USA mit gleicher Strategie ihr nächstes Ziel ins Visier nehmen: Syrien. Dort sei nach US-Vorstellungen eine Pipeline durch Land geplant, um andere Öllieferstränge "um bis zu drei Viertel abzukürzen", will Scheer erfahren haben. Sollte dies auf dem Verhandlungsweg nicht möglich werden, sei die erneute Vorwandsuche für eine Okkupation wahrscheinlich.
Mit seinem Verdacht steht der SPD-Politiker nicht allein. "Ich würde derzeit kein Geld in Damaskus anlegen", verkündete am Freitag freimütig der frühere NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark in der "Berliner Zeitung". Syrien müsse mit einem Angriff rechnen, wenn es seiner Regierung nicht gelinge, "die amerikanischen Bedenken auszuräumen". Dabei gehe es um die angebliche Unterstützung regimetreuer Iraker, Kontakten zu Terrorgruppen sowie den Besitz von Massenvernichtungswaffen.
Auch die CDU will keinen Syrien-Konflikt
Solche amerikanischen Droh-Szenarien gegenüber Syrien, beunruhigen nicht nur die SPD.
Auch der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Christian Schmidt, schloss sich am Freitag der Warnung von Bundeskanzler Gerhard Schröder vom Vortag vor weiteren Alleingängen der USA an. "Krieg kann und darf nie ein normales Mittel der Politik sein", sagte Schmidt der "Leipziger Volkszeitung". Der glimpfliche Ausgang des Irak-Krieges dürfe deshalb nicht dazu führen, "dass die USA glauben, auch andere Krisen militärisch lösen zu dürfen."
Der Irak habe zwei Mal Massenvernichtungswaffen eingesetzt und seit 1991 mit der Staatengemeinschaft und der Uno "Katz und Maus" gespielt, erinnerte Schmidt und schildert:
"Auf der Grundlage dieser Tatsache und mit Rücksicht auf die traumatische Erfahrung, die Amerika am 11. September 2001 gemacht hat, haben wir versucht, das Verhalten der Amerikaner nachzuvollziehen. Wenn aber absehbar werden sollte, dass die USA auch Waffengänge gegen Syrien und Iran vorbereiten, dann sieht die Sache anders aus." Eine solche Entscheidung der USA wäre auch für ihn nicht akzeptabel.
---------
Amerika hat einen Angriffskrieg vollzogen!
Und damit die mentale Messlatte für Krieg auf Null gesenkt.
Bush und das ganze Gesockse gehören vor ein Gericht
http://www.die-denker.de/straf.htm
KRIEGSGRUNDSUCHE
Das Geheimnis der verschwundenen Massenvernichtungswaffen
Von Holger Kulick
Der Kriegsverlauf hat bislang alle Vermutungen bestätigt, dass es der US-Regierung vordringlich um einen Machtwechsel im Irak ging. Vom eigentlichen Kriegsgrund, Saddams angeblichen Massenvernichtungsmitteln, fehlt dagegen jede Spur. Eine "Hauptkriegslüge" nennt das der SPD-Abgeordnete Hermann Scheer. Die Bundesregierung scheut dagegen solche offene Kritik.
Berlin/Washington - Die Szenerie hat sich in diesen Tagen mehrfach vor laufenden CNN-Kameras wiederholt. US-Soldaten stießen in vermeintlichen Lagern der irakischen Armee auf verdächtige Fässer mit einer chemischen Flüssigkeit oder verdächtigem weißen Pulver. Mitreisende US-Reporter wähnten schon den lang erwarteten Sensationsfund von Chemiewaffen Saddam Husseins, aber dann gaben Militärs ernüchtert Entwarnung.
Mal handelte es sich nur um Pestizide aus der Landwirtschaft, im anderen Fall um gewöhnlichen Sprengstoff. Selbst US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld warnte inzwischen kleinlaut vor voreiligem Triumphgeschrei in dieser Frage.
Dabei hatte Anfang März US-Verteidigungsminister Colin Powell steif und fest in der Uno geschworen, der Irak besitze mindestens 500 Tonnen chemischer Kampfstoffe, die ausreichen würden, um 16.000 Raketen zu bestücken. Dazu zeigte er Schaubilder rollender Chemielabore und schüttelte demonstrativ ein kleines Mustergiftfläschchen, das - enthielte es echte biologische Kampfstoffe - ausreichen würde, zigtausend Menschen zu töten.
22 Kriegstage sind inzwischen vorüber, doch noch immer wurde kein Depot von Massenvernichtungswaffen im Irak entdeckt. Auch keine Rakete mit Biogiften wurde abgeschossen, allenfalls Gasmasken und Gegenmittel gegen Giftgasangriffe fanden sich in verlassenen Schützengräben. Beweisen tut das nichts, denn genauso denkbar ist, dass die irakischen Soldaten Angst vor Betäubungsgasen der Alliierten hatten.
Doch noch immer spricht das Weiße Haus unbeirrt davon, dass die hochgefährliche Massenvernichtungswaffen trotzdem existieren. Kein Wunder, schließlich geht es um Beweise für die Berechtigung dieses Kriegs. Allzu oft hat Präsident Bush persönlich betont, dass bereits die Gefährdung Amerikas durch diese Waffen einen Krieg aus Notwehr gegen Saddam Husseins Regime rechtfertigen soll.
So beteuerte Donnerstagabend zum x-ten Mal US- Präsidentensprecher Ari Fleischer, dass der Irak die so genannten WMDs (Weapons of Mass Destruction) besitze und das Saddams Helfer Experten im Verstecken seien. Die US-Regierung sei "weiter höchst zuversichtlich, dass sie welche haben und sie gefunden werden."
"Immer der gleiche Vorwand"
Immer der gleiche Vorwand, stöhnt der SPD-Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer über die Argumentation der US-Regierung. Das sei eine "Beleidigung des politischen Verstands". Bislang habe der Kriegsverlauf eher bewiesen, dass die irakische Seite mit ihren Beteuerungen Recht gehabt habe, dass irakische Massenvernichtungswaffen nach dem letzten Golfkrieg vernichtet worden sind.
Selbst alte Restbestände könnten kaum mehr waffenfähig sein, schließlich hätten solche Gifte eine Verfallszeit von fünf Jahren. "Das ist virtuelles Spiel der Amerikaner mit der Angst und eine völlig verlogene Argumentation" schimpft Scheer. Nun gehe es der US-Regierung offensichtlich weiterhin darum, mit solchen Bedrohungslügen "ihren doppelten Völkerrechtsbruch zu kaschieren".
Weder die Uno-Resolution 1441 habe legitimiert, dass gegen nur angeblich vorhandene Vernichtungswaffen zu Felde gezogen werden darf, noch sei es völkerrechtlich abgedeckt, zivile Ziele gezielt zu bombardieren, wie es offenkundig mehrfach geschehen sei. "In Wahrheit ging es nur um Okkupation des Irak", sagt Scheer. Und im Hintergrund stehe nach wie vor der Zugriff auf die irakischen Ölvorräte, glaubt der Bundestagsabgeordnete. Schließlich habe US-Vizepräsident Cheney bereits im nationalen Energiereport der USA von 2001 als neue Militärdoktrin vorformuliert, Ressourcensicherung ins Zentrum amerikanischer Sicherheitspolitik zu stellen. Dies werde jetzt "in aus amerikanischer Sicht logischen Schritten" umgesetzt.
Was Amerika betreibe, so der SPD-Linksaußen und Energieexperte seiner Partei, sei also schlicht eine "konsequente Ressourcenstrategie", über die die Öffentlichkeit getäuscht werde. Doch nunmehr habe sich George W. Bushs Schutzbehauptung, dass das Saddam-Regime - so verabscheuenswürdig es auch sei - durch Massenvernichtungswaffen eine akute Bedrohung des Weltfriedens darstelle, als "Hauptkriegslüge" herausgestellt.
Schadensbegrenzung mit USA geht vor
Eine Rüge der USA ist aber weder in der Uno, noch durch eine Stellungnahme einzelner europäischer Regierungen vorstellbar, auch nicht seitens Bundeskanzler Schröder. "Es wird nicht alles verbalisiert, was gedacht wird", sagt Scheer. Dies sei derzeit die Devise, "um wieder zu einem relativ geordneten politischen Umgang mit den USA zu kommen". Kurzum: die Schadensbegrenzung auf dem diplomatischen Parkett ist wichtiger als Kriegskritik.
Daher werde die Bewertung, dass es sich bei diesem Krieg um einen Völkerrechtsbruch der USA handelt, "sorgsam umgangen", schildert Scheer. Aber es wäre falsch, wenn sich die gesamte politische Öffentlichkeit nun verhalten müsse wie ein Diplomat.
Denn es scheint nicht unwahrscheinlich, dass die USA mit gleicher Strategie ihr nächstes Ziel ins Visier nehmen: Syrien. Dort sei nach US-Vorstellungen eine Pipeline durch Land geplant, um andere Öllieferstränge "um bis zu drei Viertel abzukürzen", will Scheer erfahren haben. Sollte dies auf dem Verhandlungsweg nicht möglich werden, sei die erneute Vorwandsuche für eine Okkupation wahrscheinlich.
Mit seinem Verdacht steht der SPD-Politiker nicht allein. "Ich würde derzeit kein Geld in Damaskus anlegen", verkündete am Freitag freimütig der frühere NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark in der "Berliner Zeitung". Syrien müsse mit einem Angriff rechnen, wenn es seiner Regierung nicht gelinge, "die amerikanischen Bedenken auszuräumen". Dabei gehe es um die angebliche Unterstützung regimetreuer Iraker, Kontakten zu Terrorgruppen sowie den Besitz von Massenvernichtungswaffen.
Auch die CDU will keinen Syrien-Konflikt
Solche amerikanischen Droh-Szenarien gegenüber Syrien, beunruhigen nicht nur die SPD.
Auch der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Christian Schmidt, schloss sich am Freitag der Warnung von Bundeskanzler Gerhard Schröder vom Vortag vor weiteren Alleingängen der USA an. "Krieg kann und darf nie ein normales Mittel der Politik sein", sagte Schmidt der "Leipziger Volkszeitung". Der glimpfliche Ausgang des Irak-Krieges dürfe deshalb nicht dazu führen, "dass die USA glauben, auch andere Krisen militärisch lösen zu dürfen."
Der Irak habe zwei Mal Massenvernichtungswaffen eingesetzt und seit 1991 mit der Staatengemeinschaft und der Uno "Katz und Maus" gespielt, erinnerte Schmidt und schildert:
"Auf der Grundlage dieser Tatsache und mit Rücksicht auf die traumatische Erfahrung, die Amerika am 11. September 2001 gemacht hat, haben wir versucht, das Verhalten der Amerikaner nachzuvollziehen. Wenn aber absehbar werden sollte, dass die USA auch Waffengänge gegen Syrien und Iran vorbereiten, dann sieht die Sache anders aus." Eine solche Entscheidung der USA wäre auch für ihn nicht akzeptabel.
---------
Amerika hat einen Angriffskrieg vollzogen!
Und damit die mentale Messlatte für Krieg auf Null gesenkt.
Bush und das ganze Gesockse gehören vor ein Gericht

http://www.die-denker.de/straf.htm
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,244346,00.html
IRAKS BRENNENDE ÖLQUELLEN
Cheneys Sieben-Milliarden-Dollar-Feuerwehr
Den Auftrag zur Bekämpfung von Ölbränden im Irak, den das Pentagon ohne Ausschreibung an den Halliburton-Konzern vergeben hat, ist offenbar weitaus lukrativer als bisher bekannt. Der Deal soll für die Ex-Firma von US-Vizepräsident Dick Cheney mehr als sieben Milliarden Dollar wert sein.
Washington - Dies gehe aus einem Schreiben des Ingenieurkorps der amerikanischen Armee hervor, berichtet die "New York Times" am Freitag. Der Vertrag ermögliche es der Halliburton-Tochter Kellog Brown & Root, einen Reingewinn von knapp einer halben Milliarde Dollar zu machen. Die neuen Details seien in einem Schreiben an Henry A. Waxman veröffentlicht worden, einem demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Waxman habe eine Untersuchungsbehörde des Kongresses aufgefordert herauszufinden, wie die Regierung Bush Kontrakte für den Wiederaufbau des Irak vergebe. Waxman und ein anderer Abgeordneter verlangten, dass dabei "Vorwürfen einer Halliburton-Sonderbehandlung durch die Regierung" besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Beste Verbindungen
Der amerikanische Vizepräsident Dick Cheney war von 1995 bis 2000 Halliburton-Chef. Cheney habe laut Waxman mehr als 30 Millionen Dollar an Bezügen erhalten.
Das Weiße Haus habe keine Rolle bei der Auswahl einzelner Firmen gespielt, erklärte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates gegenüber der Zeitung. Kellog Brown & Root sei gewählt worden, weil es als einziges Unternehmen in der Lage gewesen sei, einen komplexen und geheimen Plan für den Irak-Einsatz zu entwickeln und ihn dann extrem kurzfristig umzusetzen, habe Generalleutnant Robert B. Flowers, der Leiter des Ingenieurkorps, in dem der "NYT" vorliegenden Schreiben erklärt.
Anderen Presseberichten zufolge hatte sich Halliburton bereits frühzeitig auf Einsätze im Irak eingestellt und in größerem Umfang neues Personal für diese Aufgabe rekrutiert.
America first
Das Verteidigungsministerium habe keine öffentlichen Vorschriften für die Auftragsvergabe einhalten können, weil die Kriegspläne und die Notwendigkeit zur Bekämpfung von Ölbränden im Irak Geheiminformationen gewesen seien, heißt es in dem Schreiben weiter. General Flowers versprach aber "umfassende Wettbewerbsmöglichkeiten" für die Wiederherstellung der irakischen Ölinfrastruktur.
Einer der derzeit gefragtesten Irak-Aufträge beläuft sich auf 600 Million Dollar und wird von der amerikanischen Entwicklungshilfebehörde USAID vergeben. Er beinhaltet erste Arbeiten zum Wiederaufbau irakischer Straßen, Wasser- und Stromversorgungssysteme sowie Krankenhäuser und Schulen. Die Ausschreibung für den Auftrag war auf fünf amerikanische Baukonzerne beschränkt worden. Dabei wurde ebenfalls die Notwendigkeit für Geheimhaltung und Schnelligkeit angeführt. Experten für die Vergabe von Regierungsaufträgen glauben jedoch, dass es Verstöße gegen internationale Handelsabkommen und staatliche Regeln gegeben haben könnte.
----------
ja ja
Das irakische Volk befreien heisst es doch ständig
IRAKS BRENNENDE ÖLQUELLEN
Cheneys Sieben-Milliarden-Dollar-Feuerwehr
Den Auftrag zur Bekämpfung von Ölbränden im Irak, den das Pentagon ohne Ausschreibung an den Halliburton-Konzern vergeben hat, ist offenbar weitaus lukrativer als bisher bekannt. Der Deal soll für die Ex-Firma von US-Vizepräsident Dick Cheney mehr als sieben Milliarden Dollar wert sein.
Washington - Dies gehe aus einem Schreiben des Ingenieurkorps der amerikanischen Armee hervor, berichtet die "New York Times" am Freitag. Der Vertrag ermögliche es der Halliburton-Tochter Kellog Brown & Root, einen Reingewinn von knapp einer halben Milliarde Dollar zu machen. Die neuen Details seien in einem Schreiben an Henry A. Waxman veröffentlicht worden, einem demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Waxman habe eine Untersuchungsbehörde des Kongresses aufgefordert herauszufinden, wie die Regierung Bush Kontrakte für den Wiederaufbau des Irak vergebe. Waxman und ein anderer Abgeordneter verlangten, dass dabei "Vorwürfen einer Halliburton-Sonderbehandlung durch die Regierung" besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Beste Verbindungen
Der amerikanische Vizepräsident Dick Cheney war von 1995 bis 2000 Halliburton-Chef. Cheney habe laut Waxman mehr als 30 Millionen Dollar an Bezügen erhalten.
Das Weiße Haus habe keine Rolle bei der Auswahl einzelner Firmen gespielt, erklärte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates gegenüber der Zeitung. Kellog Brown & Root sei gewählt worden, weil es als einziges Unternehmen in der Lage gewesen sei, einen komplexen und geheimen Plan für den Irak-Einsatz zu entwickeln und ihn dann extrem kurzfristig umzusetzen, habe Generalleutnant Robert B. Flowers, der Leiter des Ingenieurkorps, in dem der "NYT" vorliegenden Schreiben erklärt.
Anderen Presseberichten zufolge hatte sich Halliburton bereits frühzeitig auf Einsätze im Irak eingestellt und in größerem Umfang neues Personal für diese Aufgabe rekrutiert.
America first
Das Verteidigungsministerium habe keine öffentlichen Vorschriften für die Auftragsvergabe einhalten können, weil die Kriegspläne und die Notwendigkeit zur Bekämpfung von Ölbränden im Irak Geheiminformationen gewesen seien, heißt es in dem Schreiben weiter. General Flowers versprach aber "umfassende Wettbewerbsmöglichkeiten" für die Wiederherstellung der irakischen Ölinfrastruktur.
Einer der derzeit gefragtesten Irak-Aufträge beläuft sich auf 600 Million Dollar und wird von der amerikanischen Entwicklungshilfebehörde USAID vergeben. Er beinhaltet erste Arbeiten zum Wiederaufbau irakischer Straßen, Wasser- und Stromversorgungssysteme sowie Krankenhäuser und Schulen. Die Ausschreibung für den Auftrag war auf fünf amerikanische Baukonzerne beschränkt worden. Dabei wurde ebenfalls die Notwendigkeit für Geheimhaltung und Schnelligkeit angeführt. Experten für die Vergabe von Regierungsaufträgen glauben jedoch, dass es Verstöße gegen internationale Handelsabkommen und staatliche Regeln gegeben haben könnte.
----------
ja ja

Das irakische Volk befreien heisst es doch ständig

http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?id=506593&eid…
Saddam könnte Bin Ladens Beispiel folgen
Saddam Hussein habe nun seinen «rechtmäßigen Platz» neben Hitler, Stalin und anderen früheren Diktatoren eingenommen, erklärte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wenige Stunden nach dem Zusammenbruch des irakischen Regimes in Bagdad. Doch bislang scheint es eher so, als wolle Saddam dem Beispiel des untergetauchten Terroristendrahtziehers Osama bin Laden folgen, der in den internationalen Medien seit dem Sturm auf die afghanische Bergfestung Tora Bora im Dezember 2001 so oft totgesagt worden war wie er sich mit hasserfüllten Botschaften per Tonband zurückmeldete.
Vor allem wenn es nach der Einnahme von Saddams Geburtsstadt Tikrit immer noch keine heiße Spur des bisherigen Diktators geben sollte, könnte Washington in Erklärungsnot geraten. Denn bis auf Präsidentenberater Amir el Saadi, der sich den US-Soldaten am Samstag freiwillig gestellt hat, sollen bislang nur zwei von Saddams Halbbrüdern ausgeschaltet worden sein. Barsan Ibrahim el Hassan el Tikriti, soll vor einigen Tagen bei einem US-Angriff auf ein Bauernhaus getötet worden sein. Sein Bruder Watban, der eine Zeit lang Innenminister war, wurde angeblich am Sonntag bei einem Fluchtversuch nördlich von Mosul geschnappt.
USA warnen Syrien
Nach Auffassung der syrischen Regierung ist die Frustration der US-Regierung über das spurlose Verschwinden Saddam Husseins und seiner engsten Vertrauten auch einer der Gründe dafür, dass sich die Führung unter Präsident George W. Bush nun auf Damaskus eingeschossen hat. US-Außenminister Colin Powell warnte Syrien am Sonntag erneut davor, Saddam Hussein und seinen Gefolgsleuten Unterschlupf zu gewähren. «Es wäre sehr unklug, wenn Syrien plötzlich zu einem sicheren Hafen für alle diese Leute würde, die vor Gericht gehören und versuchen, aus Bagdad herauszukommen», drohte Powell. Dagegen sind fast alle arabischen Beobachter der Ansicht, dass weder Syrien noch irgendein anderes Nachbarland des Irak, die Führungsclique aus Bagdad ohne Zustimmung Washingtons aufgenommen hätte.
Präsident Baschar el Assad und seine Berater wissen wohl sehr genau, dass sie den Amerikanern durch Hilfe für Saddams Schergen eventuell eine Rechtfertigung für einen Angriff liefern könnten. Abgesehen davon gingen die Verbindungen zwischen den von rivalisierenden Fraktionen der arabischen Baath-Partei regierten Regime auch nach der Versöhnung vor rund zwei Jahren kaum über wirtschaftliche Kooperation hinaus. Eine politische Achse Damaskus- Bagdad existierte in der Ära Saddam Hussein nicht.
Damaskus wehrt sich
Auf jeden Fall will sich die syrische Regierung, die befürchtet, selbst eines Tages Opfer der amerikanischen Pläne für eine Neuordnung der Machtverhältnisse in Nahost zu werden, jetzt von Washington nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen. «Diese (Anschuldigungen) entbehren jeder Grundlage», sagt Außenminister Faruk el Scharaa und fügt hinzu, «wir haben den Amerikanern gesagt, los, gebt uns Beweise».
Unterdessen geht im Irak das Rätselraten über den Verbleib der einstigen Führung weiter. Einwohner von El Mansur, einem Stadtteil im Nordwesten Bagdads, berichten der arabischen Zeitung «Al-Sharq Al- Awsat», sie hätten Kusai, den jüngeren Sohn von Saddam Hussein, nach dem US-Bombenangriff vor einer Woche lebend in ihrem Stadtviertel gesehen. Ein 23 Jahre alter Kämpfer der Baath-Partei aus Bagdad erzählt, wie er und 80 seiner Parteigenossen am vergangenen Mittwoch plötzlich ohne ihre fünf Kommandeure dagestanden hatten. «Sie sind einfach nach Hause gegangen», sagt er. Daraufhin hätten auch die einfachen Kämpfer das Weite gesucht.
----------
Ob die Amis überhaupt fragen werden?
Saddam könnte Bin Ladens Beispiel folgen
Saddam Hussein habe nun seinen «rechtmäßigen Platz» neben Hitler, Stalin und anderen früheren Diktatoren eingenommen, erklärte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld wenige Stunden nach dem Zusammenbruch des irakischen Regimes in Bagdad. Doch bislang scheint es eher so, als wolle Saddam dem Beispiel des untergetauchten Terroristendrahtziehers Osama bin Laden folgen, der in den internationalen Medien seit dem Sturm auf die afghanische Bergfestung Tora Bora im Dezember 2001 so oft totgesagt worden war wie er sich mit hasserfüllten Botschaften per Tonband zurückmeldete.
Vor allem wenn es nach der Einnahme von Saddams Geburtsstadt Tikrit immer noch keine heiße Spur des bisherigen Diktators geben sollte, könnte Washington in Erklärungsnot geraten. Denn bis auf Präsidentenberater Amir el Saadi, der sich den US-Soldaten am Samstag freiwillig gestellt hat, sollen bislang nur zwei von Saddams Halbbrüdern ausgeschaltet worden sein. Barsan Ibrahim el Hassan el Tikriti, soll vor einigen Tagen bei einem US-Angriff auf ein Bauernhaus getötet worden sein. Sein Bruder Watban, der eine Zeit lang Innenminister war, wurde angeblich am Sonntag bei einem Fluchtversuch nördlich von Mosul geschnappt.
USA warnen Syrien
Nach Auffassung der syrischen Regierung ist die Frustration der US-Regierung über das spurlose Verschwinden Saddam Husseins und seiner engsten Vertrauten auch einer der Gründe dafür, dass sich die Führung unter Präsident George W. Bush nun auf Damaskus eingeschossen hat. US-Außenminister Colin Powell warnte Syrien am Sonntag erneut davor, Saddam Hussein und seinen Gefolgsleuten Unterschlupf zu gewähren. «Es wäre sehr unklug, wenn Syrien plötzlich zu einem sicheren Hafen für alle diese Leute würde, die vor Gericht gehören und versuchen, aus Bagdad herauszukommen», drohte Powell. Dagegen sind fast alle arabischen Beobachter der Ansicht, dass weder Syrien noch irgendein anderes Nachbarland des Irak, die Führungsclique aus Bagdad ohne Zustimmung Washingtons aufgenommen hätte.
Präsident Baschar el Assad und seine Berater wissen wohl sehr genau, dass sie den Amerikanern durch Hilfe für Saddams Schergen eventuell eine Rechtfertigung für einen Angriff liefern könnten. Abgesehen davon gingen die Verbindungen zwischen den von rivalisierenden Fraktionen der arabischen Baath-Partei regierten Regime auch nach der Versöhnung vor rund zwei Jahren kaum über wirtschaftliche Kooperation hinaus. Eine politische Achse Damaskus- Bagdad existierte in der Ära Saddam Hussein nicht.
Damaskus wehrt sich
Auf jeden Fall will sich die syrische Regierung, die befürchtet, selbst eines Tages Opfer der amerikanischen Pläne für eine Neuordnung der Machtverhältnisse in Nahost zu werden, jetzt von Washington nicht den Schwarzen Peter zuschieben lassen. «Diese (Anschuldigungen) entbehren jeder Grundlage», sagt Außenminister Faruk el Scharaa und fügt hinzu, «wir haben den Amerikanern gesagt, los, gebt uns Beweise».
Unterdessen geht im Irak das Rätselraten über den Verbleib der einstigen Führung weiter. Einwohner von El Mansur, einem Stadtteil im Nordwesten Bagdads, berichten der arabischen Zeitung «Al-Sharq Al- Awsat», sie hätten Kusai, den jüngeren Sohn von Saddam Hussein, nach dem US-Bombenangriff vor einer Woche lebend in ihrem Stadtviertel gesehen. Ein 23 Jahre alter Kämpfer der Baath-Partei aus Bagdad erzählt, wie er und 80 seiner Parteigenossen am vergangenen Mittwoch plötzlich ohne ihre fünf Kommandeure dagestanden hatten. «Sie sind einfach nach Hause gegangen», sagt er. Daraufhin hätten auch die einfachen Kämpfer das Weite gesucht.
----------
Ob die Amis überhaupt fragen werden?
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/newsticker/100851.html
Montag, 14. April 2003
12:10 -- Newsticker Schweiz
Couchepin soll Treffen mit Bush in Genf absagen
BERN - Pascal Couchepin soll sein für den 1. Juni geplantes Treffen mit US-Präsident George W. Bush in Genf absagen. Das fordern über 30 Organisationen in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten.
Die Einladung sei politisch und moralisch inakzeptabel, heisst es in dem Brief. George W. Bush zu empfangen sei in der aktuellen politischen Situation eine Provokation für breite Bevölkerungskreise in der Schweiz.
Die USA und ihre Verbündeten führten einen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Sie seien direkt verantwortlich für den Tod und das Leiden von tausenden von Menschen in Irak. Die Kritik bedeute aber nicht im Entferntesten eine Unterstützung des irakischen Diktators Saddam Hussein.
Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem die Grüne Partei der Schweiz, die Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI), die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) und die Erklärung von Bern.
Das Treffen zwischen Couchepin und Bush soll am Rande des G-8-Gipfels von Evian auf dem Flughafen von Genf-Cointrin stattfinden. (sda)



Montag, 14. April 2003
12:10 -- Newsticker Schweiz
Couchepin soll Treffen mit Bush in Genf absagen
BERN - Pascal Couchepin soll sein für den 1. Juni geplantes Treffen mit US-Präsident George W. Bush in Genf absagen. Das fordern über 30 Organisationen in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten.
Die Einladung sei politisch und moralisch inakzeptabel, heisst es in dem Brief. George W. Bush zu empfangen sei in der aktuellen politischen Situation eine Provokation für breite Bevölkerungskreise in der Schweiz.
Die USA und ihre Verbündeten führten einen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Sie seien direkt verantwortlich für den Tod und das Leiden von tausenden von Menschen in Irak. Die Kritik bedeute aber nicht im Entferntesten eine Unterstützung des irakischen Diktators Saddam Hussein.
Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem die Grüne Partei der Schweiz, die Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI), die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) und die Erklärung von Bern.
Das Treffen zwischen Couchepin und Bush soll am Rande des G-8-Gipfels von Evian auf dem Flughafen von Genf-Cointrin stattfinden. (sda)



US/Lagerbestände Februar +0,6 (PROG: +0,3) Proz gg Vormonat
Washington (vwd) - Die Lagerbestände in der US-Wirtschaft sind im Fegruar im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 0,6 Prozent auf 1,16 Bill USD gestiegen. Von vwd befragte Ökonomen hatten im Durchschnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Wie das US-Handelsministerium am Montag berichtete, wurden zugleich die Angaben für Januar auf plus 0,3 Prozent revidiert, nachdem zuvor ein Plus um 0,2 Prozent gemeldet worden war. Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen veränderte sich im Februar auf 1,38, während der Wert für den Vormonat auf 1,36 beziffert worden war.
vwd/DJ/14.4.2003/cv

Washington (vwd) - Die Lagerbestände in der US-Wirtschaft sind im Fegruar im Vergleich zum Vormonat saisonbereinigt um 0,6 Prozent auf 1,16 Bill USD gestiegen. Von vwd befragte Ökonomen hatten im Durchschnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Wie das US-Handelsministerium am Montag berichtete, wurden zugleich die Angaben für Januar auf plus 0,3 Prozent revidiert, nachdem zuvor ein Plus um 0,2 Prozent gemeldet worden war. Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen veränderte sich im Februar auf 1,38, während der Wert für den Vormonat auf 1,36 beziffert worden war.
vwd/DJ/14.4.2003/cv

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,244748,00.html
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN IM IRAK
Uno-Inspektoren halten US-Beweise für falsch
Die angeblichen amerikanischen Beweise über irakische Massenvernichtungswaffen und deren Verstecke sind nach Aussage zweier Uno-Waffenkontrolleure zum großen Teil falsch gewesen. In einem Fernsehinterview machten die beiden den USA jetzt schwere Vorwürfe, die mit diesen Beweisen den Krieg gegen Saddam Hussein gerechtfertigt hatten.
Mainz - Die beiden waren drei Monate lang in der Uno-Waffenkontrollkommission (Unmovic) im Irak im Einsatz. Sie hatten kurz vor Kriegsbeginn am 20. März das Land verlassen. Zu ihren Aufgaben gehörte die Überprüfung von US-Geheimdienstinformationen über angeblich versteckte irakische Massenvernichtungswaffen. Bei den Inspektoren handelt es sich um einen deutschen Computerexperten, der namentlich nicht genannt werden wollte, und um den Norweger Jörn Siljeholm, zu dessen Fachgebiet biologische und chemische Waffen zählen. Übereinstimmend bezeichneten beide in einem Interview des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" eine Vielzahl der US-Informationen über Massenvernichtungswaffen und deren vermutete Verstecke als Fehlinformationen.
So habe US-Außenminister Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat am 5. Februar 2003 Satellitenfotos präsentiert, die irakische Fahrzeuge mit Spezialgeräten zur Entgiftung eigener Truppen nach einem Giftgaseinsatz zeigen sollten. Damit habe bewiesen werden sollen, dass der Irak tatsächlich verbotene C-Waffen besitze. Es habe sich aber nicht um Spezialfahrzeuge gehandelt. "Es war eben nicht so, dass wir die Lastwagen nicht gefunden hätten. Wir haben sie gefunden. (...) Es war (aber) nie ein Dekontaminationslaster, auch wenn die CIA dies behauptet hat."
Auch Ventilationssysteme auf Fabrikdächern, die laut US-Regierung Rückschlusse auf die Produktion von Chemiewaffen zulassen, hätten sich als harmlos herausgestellt. Eine Produktion verbotener Waffen habe in den betreffenden Gebäuden nicht stattgefunden. "Wir haben gesucht nach den Dingen auf den Fotos, und dann stellte sich heraus, dass es nichts mit Massenvernichtungswaffen zu tun hatte", sagte Siljeholm. Powells Rede bewertete er als "irreführend" und "hochgradig falsch".
------
Wer stellt denn nun Amerika vor ein Gericht?
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN IM IRAK
Uno-Inspektoren halten US-Beweise für falsch
Die angeblichen amerikanischen Beweise über irakische Massenvernichtungswaffen und deren Verstecke sind nach Aussage zweier Uno-Waffenkontrolleure zum großen Teil falsch gewesen. In einem Fernsehinterview machten die beiden den USA jetzt schwere Vorwürfe, die mit diesen Beweisen den Krieg gegen Saddam Hussein gerechtfertigt hatten.
Mainz - Die beiden waren drei Monate lang in der Uno-Waffenkontrollkommission (Unmovic) im Irak im Einsatz. Sie hatten kurz vor Kriegsbeginn am 20. März das Land verlassen. Zu ihren Aufgaben gehörte die Überprüfung von US-Geheimdienstinformationen über angeblich versteckte irakische Massenvernichtungswaffen. Bei den Inspektoren handelt es sich um einen deutschen Computerexperten, der namentlich nicht genannt werden wollte, und um den Norweger Jörn Siljeholm, zu dessen Fachgebiet biologische und chemische Waffen zählen. Übereinstimmend bezeichneten beide in einem Interview des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" eine Vielzahl der US-Informationen über Massenvernichtungswaffen und deren vermutete Verstecke als Fehlinformationen.
So habe US-Außenminister Colin Powell vor dem Weltsicherheitsrat am 5. Februar 2003 Satellitenfotos präsentiert, die irakische Fahrzeuge mit Spezialgeräten zur Entgiftung eigener Truppen nach einem Giftgaseinsatz zeigen sollten. Damit habe bewiesen werden sollen, dass der Irak tatsächlich verbotene C-Waffen besitze. Es habe sich aber nicht um Spezialfahrzeuge gehandelt. "Es war eben nicht so, dass wir die Lastwagen nicht gefunden hätten. Wir haben sie gefunden. (...) Es war (aber) nie ein Dekontaminationslaster, auch wenn die CIA dies behauptet hat."
Auch Ventilationssysteme auf Fabrikdächern, die laut US-Regierung Rückschlusse auf die Produktion von Chemiewaffen zulassen, hätten sich als harmlos herausgestellt. Eine Produktion verbotener Waffen habe in den betreffenden Gebäuden nicht stattgefunden. "Wir haben gesucht nach den Dingen auf den Fotos, und dann stellte sich heraus, dass es nichts mit Massenvernichtungswaffen zu tun hatte", sagte Siljeholm. Powells Rede bewertete er als "irreführend" und "hochgradig falsch".
------
Wer stellt denn nun Amerika vor ein Gericht?
US/Industrieproduktion März -0,5 (PROG: -0,3) Prozent gg Vm
Washington (vwd) - Die Industrieproduktion in den USA ist im März um 0,5 Prozent gesunken. Zugleich fiel die Kapazitätsauslastung auf 74,8 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2001, teilte die Federal Reserve am Dienstag weiter mit. Im Vorfeld hatten Analysten im Durchschnitt einen Rückgang der Produktion um 0,3 Prozent prognostiziert, für die Kapazitätsauslastung war ein Wert von 75,3 Prozent vorhergesagt worden. Im Vormonat hat sich die Industrieproduktion um revidiert 0,1 (vorläufig: plus 0,1) Prozent verringert. Die Kapazitätsauslastung wurde für Februar auf 75,3 (75,6) Prozent revidiert.
Beim Verarbeitenden Gewerbe wurde im März ein Produktionsminus von 0,2 (Februar: minus 0,3) Prozent verzeichnet. Hier verringerte sich die Kapazitätsauslastung auf 72,9 Prozent, nachdem im Vormonat ein Niveau von 73,1 Prozent gemeldet worden war. Vor allem eine rückläufige Produktion von Metallen, Automobilen und Maschinen habe zu dem Minus beigetragen, erläuterte die Fed.
vwd/DJ/15.4.2003/cv
Washington (vwd) - Die Industrieproduktion in den USA ist im März um 0,5 Prozent gesunken. Zugleich fiel die Kapazitätsauslastung auf 74,8 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2001, teilte die Federal Reserve am Dienstag weiter mit. Im Vorfeld hatten Analysten im Durchschnitt einen Rückgang der Produktion um 0,3 Prozent prognostiziert, für die Kapazitätsauslastung war ein Wert von 75,3 Prozent vorhergesagt worden. Im Vormonat hat sich die Industrieproduktion um revidiert 0,1 (vorläufig: plus 0,1) Prozent verringert. Die Kapazitätsauslastung wurde für Februar auf 75,3 (75,6) Prozent revidiert.
Beim Verarbeitenden Gewerbe wurde im März ein Produktionsminus von 0,2 (Februar: minus 0,3) Prozent verzeichnet. Hier verringerte sich die Kapazitätsauslastung auf 72,9 Prozent, nachdem im Vormonat ein Niveau von 73,1 Prozent gemeldet worden war. Vor allem eine rückläufige Produktion von Metallen, Automobilen und Maschinen habe zu dem Minus beigetragen, erläuterte die Fed.
vwd/DJ/15.4.2003/cv
RATING: S&P prüft Herabstufung von US-Konzernen wegen Pensionsproblemen
Die Ratingagentur Standard & Poor`s (S&P) prüft bei einer Reihe von US-Konzernen eine Herabstufung wegen Pensions-Unsicherheiten. Vor allem die Schwäche an den Aktienmärkte habe die Lage in den aktienbasierten Pensionsfonds verschärft, teilte S&P am Dienstag in New York mit.
Betroffen von der Überprüfung sind unter anderem Alcoa (derzeitige Einstufung: `A`), Caterpillar (`A+`), Delphi (`BBB`), Kimberly-Clark (`AA`) und SBC Communications (`AA-`).
Die Analysten senkten den Ausblick von "stabil" auf "negativ" bei DuPont (`AA-`) , Eastman Kodak (`BBB+`) und Rockwell Automation (`A`)./mur/hi
15.04.2003 - 18:50
Quelle: dpa-AFX
Die Ratingagentur Standard & Poor`s (S&P) prüft bei einer Reihe von US-Konzernen eine Herabstufung wegen Pensions-Unsicherheiten. Vor allem die Schwäche an den Aktienmärkte habe die Lage in den aktienbasierten Pensionsfonds verschärft, teilte S&P am Dienstag in New York mit.
Betroffen von der Überprüfung sind unter anderem Alcoa (derzeitige Einstufung: `A`), Caterpillar (`A+`), Delphi (`BBB`), Kimberly-Clark (`AA`) und SBC Communications (`AA-`).
Die Analysten senkten den Ausblick von "stabil" auf "negativ" bei DuPont (`AA-`) , Eastman Kodak (`BBB+`) und Rockwell Automation (`A`)./mur/hi
15.04.2003 - 18:50
Quelle: dpa-AFX
US: Philly Fed Index fällt erneut
Die Aktivität an Fabriken in Philadelphia ist laut der Federal Reserve Bank of Philadelphia Anfang April erneut zurückgegangen. Der Philly Fed Index fiel von -8 im März auf -8.8. Daten unter Null deuten darauf hin, dass eine größere Zahl von Unternehmen mit einer rückläufigen oder stagnierenden Wirtschaftslage rechnen. Die Auftragseingangskomponente fiel von -4.3 auf -11.2, währen die Auftragsausgangskomponente von 0.9 auf -5.7 fiel. Die Erwartungskomponente fiel von 46.4 auf 45.8.
© BörseGo
----
Der Markt ist momentan dick im Plus
Die Aktivität an Fabriken in Philadelphia ist laut der Federal Reserve Bank of Philadelphia Anfang April erneut zurückgegangen. Der Philly Fed Index fiel von -8 im März auf -8.8. Daten unter Null deuten darauf hin, dass eine größere Zahl von Unternehmen mit einer rückläufigen oder stagnierenden Wirtschaftslage rechnen. Die Auftragseingangskomponente fiel von -4.3 auf -11.2, währen die Auftragsausgangskomponente von 0.9 auf -5.7 fiel. Die Erwartungskomponente fiel von 46.4 auf 45.8.
© BörseGo
----
Der Markt ist momentan dick im Plus

12:01pm 04/17/03 APRIL PHILLY FED NEW ORDERS -11.2 VS. -4.3
12:02pm 04/17/03 APRIL PHILLY FED SHIPMENTS -5.7 VS. 0.9 MARCH
12:01pm 04/17/03 APRIL PHILLY FED -8.8 VS. -8.0 IN MARCH
-----
Das Plus in Amerika wird immer grösser


12:02pm 04/17/03 APRIL PHILLY FED SHIPMENTS -5.7 VS. 0.9 MARCH
12:01pm 04/17/03 APRIL PHILLY FED -8.8 VS. -8.0 IN MARCH
-----
Das Plus in Amerika wird immer grösser



moin dolby
deine erklärung für meine sperrung bei stock war genial.
börse ist sooo einfach.
viel glück!

deine erklärung für meine sperrung bei stock war genial.

börse ist sooo einfach.

viel glück!

http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/wirtschaft/272862.html
17:15 -- Tages-Anzeiger Online
Grossauftrag für Iraks Wiederaufbau vergeben
Die USA haben einen ersten Grossauftrag zum Wiederaufbau Iraks an die kalifornische Baufirma Bechtel vergeben. Wie die US-Administration mitteilte, beläuft sich der Wert des Vertrags zunächst auf rund 35 Millionen Dollar.
Der Auftrag kann aber innerhalb der nächsten 18 Monate bis auf 680 Millionen Dollar ausgeweitet werden, falls der US-Kongress zustimmt. Die «New York Times» berichtete am Freitag, die Gesamtkosten für den Wiederaufbau Iraks würden auf 25 bis 100 Milliarden Dollar geschätzt.
Der Vertrag sieht die Reparatur der wichtigsten Teile der irakischen Infrastruktur vor. Dazu gehören das Stromnetz und die Wasserversorgung sowie der Wiederaufbau der Flughäfen.
Im Ausland war kritisiert worden, dass nur eine begrenzte Auswahl von US-Firmen überhaupt Offerten für die Wiederaufbau- Aufträge einreichen durften. Allerdings ist es möglich, dass die US- Firmen Teile ihrer Aufträge von ausländische Firmen erledigen lassen können, wie die US-Behörde für Entwicklungshilfe mitteilte.
Bechtel ist eine der grössten Baufirmen der Welt und hat seit Jahrzehnten beste Kontakte nach Washington. Zu den Beratern oder Direktoren gehörten unter anderem George Shultz und Caspar Weinberger, die Minister unter dem früheren Präsidenten Ronald Reagan waren.
Der heutige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hatte sich in den 80er Jahren bei einem persönlichen Treffen mit Saddam Hussein für den Bau einer Ölpipeline durch Bechtel eingesetzt.
Die für den Wiederaufbau Iraks zuständige Behörde für Entwicklungshilfe hat bereits mehrere Verträge mit US-Firmen unterzeichnet. Mehrere begünstigte US-Firmen haben enge Verbindungen zu ranghohen Vertretern der US-Regierung. So ist der frühere Chef der Halliburton-Gruppe Dick Cheney heute US-Vizepräsident. (sda)

17:15 -- Tages-Anzeiger Online
Grossauftrag für Iraks Wiederaufbau vergeben
Die USA haben einen ersten Grossauftrag zum Wiederaufbau Iraks an die kalifornische Baufirma Bechtel vergeben. Wie die US-Administration mitteilte, beläuft sich der Wert des Vertrags zunächst auf rund 35 Millionen Dollar.
Der Auftrag kann aber innerhalb der nächsten 18 Monate bis auf 680 Millionen Dollar ausgeweitet werden, falls der US-Kongress zustimmt. Die «New York Times» berichtete am Freitag, die Gesamtkosten für den Wiederaufbau Iraks würden auf 25 bis 100 Milliarden Dollar geschätzt.
Der Vertrag sieht die Reparatur der wichtigsten Teile der irakischen Infrastruktur vor. Dazu gehören das Stromnetz und die Wasserversorgung sowie der Wiederaufbau der Flughäfen.
Im Ausland war kritisiert worden, dass nur eine begrenzte Auswahl von US-Firmen überhaupt Offerten für die Wiederaufbau- Aufträge einreichen durften. Allerdings ist es möglich, dass die US- Firmen Teile ihrer Aufträge von ausländische Firmen erledigen lassen können, wie die US-Behörde für Entwicklungshilfe mitteilte.
Bechtel ist eine der grössten Baufirmen der Welt und hat seit Jahrzehnten beste Kontakte nach Washington. Zu den Beratern oder Direktoren gehörten unter anderem George Shultz und Caspar Weinberger, die Minister unter dem früheren Präsidenten Ronald Reagan waren.
Der heutige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hatte sich in den 80er Jahren bei einem persönlichen Treffen mit Saddam Hussein für den Bau einer Ölpipeline durch Bechtel eingesetzt.
Die für den Wiederaufbau Iraks zuständige Behörde für Entwicklungshilfe hat bereits mehrere Verträge mit US-Firmen unterzeichnet. Mehrere begünstigte US-Firmen haben enge Verbindungen zu ranghohen Vertretern der US-Regierung. So ist der frühere Chef der Halliburton-Gruppe Dick Cheney heute US-Vizepräsident. (sda)

http://finanzen.tiscali.de/press/news/open/index.jsp?id=OLDE…
18/04/2003 20:11
USA-Aufhebung der UNO-Sanktionen Schlüssel für Iraks Wirtschaft
Kuwait, 18. Apr (Reuters) - Eine baldige Aufhebung der
UNO-Sanktionen ist nach Darstellung von US-Vertretern der
Schlüssel für die Wiederbelebung der wirtschaftlichen
Aktivitäten und den Wiederaufbau des Irak nach dem Krieg.
Wenn die Vereinten Nationen nicht binnen Wochen die 1990
wegen der irakischen Besetzung Kuwaits verhängten Sanktionen
aufhöben, würden die wirtschaftlichen Aktivitäten behindert und
es bestünde die Gefahr einer ernsthaften Inflation, sagten drei
US-Vertreter in Kuwait, die namentlich nicht genannt werden
wollten, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die UNO
müsse in weniger als einem Monat handeln.
"Wenn die Sanktionen nicht so schnell wie erforderlich
aufgehoben werden, wird es ein sehr großes Problem geben", sagte
ein Mitarbeiter des bis zur Übernahme einer irakischen Führung
als Chef der US-Verwaltung eingesetzten ehemaligen US-Generals
Jay Garner. "Wir werden nicht in der Lage sein, zu tun was wir
beim Wiederaufbau der Wirtschaft tun sollten und sicherlich wird
die Inflation ein Problem darstellen, ebenso wie die Behinderung
beim Start der wirtschaftlichen Aktivitäten", sagte er.
Die USA ihrerseits wollen den Vertretern zufolge bereits in
der nächsten Woche an bis zu 2,5 Millionen öffentlichen
Bediensteten des Irak eine Nothilfe von 20 Dollar pro Kopf
auszahlen, um Kaufkraft in die Wirtschaft des Landes zu pumpen.
Zudem wollen sie irakische Subunternehmer beim Wiederaufbau des
Landes und bei humanitären Programmen beschäftigen, um die
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Darüber hinaus würde die Aufhebung der Sanktionen der von
Garner geführten Verwaltung erlauben, die Grenzen 90 Tage lang
für bislang nicht genehmigte und zollfreie Importe zu öffnen,
sagten die US-Vertreter. Der freie Zustrom von Gütern würde es
den Irakern erlauben, ihre Lager nach zwei Kriegen in zwei
Jahrzehnten und zwölf Jahren Sanktionen aufzufüllen.
Der US-Plan sehe zudem eine Wiederaufstockung der irakischen
Devisenreserven durch eine Freigabe im Ausland eingefrorener
Guthaben und volle Staatsgarantien vor. Dies sei zur Deckung
einer irakischen Landeswährung von wesentlicher Bedeutung.
Allein die USA haben irakische Guthaben über 1,7 Milliarden
Dollar eingefroren. Durch die Aufhebung der Sanktionen würden
auch andere Länder ermutigt, eingefrorene Guthaben des Irak
freizugeben.
Den US-Vertretern zufolge dürfe der Irak, der über die
weltweit zweitgrößten nachgewiesenen Ölreserven verfügt,
zumindest für ein Jahr keinen Nutzen aus seinen Öleinnahmen
haben. Diese dürften für die Bedienung der Schulden des Landes
benötigt werden, die nach unabhängigen Schätzungen 103,4
Milliarden bis 129,4 Milliarden Dollar ausmachen, sowie für
Reparationszahlungen für Schäden bei der Besetzung Kuwaits von
bis zu 300 Milliarden Dollar. Darüber hinaus habe das Land
Verträge über 57 Milliarden Dollar abgeschlossen, die vermutlich
alle gerichtlich eingeklagt werden können. Allein das Volumen
der Schulden sei vier mal so groß wie die gesamte Wirtschaft des
Irak.
Die US-Vertreter kündigten an, sobald als möglich nach
Bagdad zu reisen, um dort ihre Arbeit aufzunehmen. Es sei jedoch
schwierig, die Leistung und den Umfang der Wirtschaft oder sonst
irgend etwas in einem bislang verschlossenen Land zu schätzen,
das weder Daten veröffentlicht noch gesammelt habe. Es gebe
aber keine Pläne, irgendwelche Subventionen aufzuheben, da
schätzungsweise 60 Prozent der Bevölkerung des Irak von
Lebensmittelhilfen der UNO abhängig seien.
fgc/rkr
-------
Kriegswirtschaft
18/04/2003 20:11
USA-Aufhebung der UNO-Sanktionen Schlüssel für Iraks Wirtschaft
Kuwait, 18. Apr (Reuters) - Eine baldige Aufhebung der
UNO-Sanktionen ist nach Darstellung von US-Vertretern der
Schlüssel für die Wiederbelebung der wirtschaftlichen
Aktivitäten und den Wiederaufbau des Irak nach dem Krieg.
Wenn die Vereinten Nationen nicht binnen Wochen die 1990
wegen der irakischen Besetzung Kuwaits verhängten Sanktionen
aufhöben, würden die wirtschaftlichen Aktivitäten behindert und
es bestünde die Gefahr einer ernsthaften Inflation, sagten drei
US-Vertreter in Kuwait, die namentlich nicht genannt werden
wollten, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die UNO
müsse in weniger als einem Monat handeln.
"Wenn die Sanktionen nicht so schnell wie erforderlich
aufgehoben werden, wird es ein sehr großes Problem geben", sagte
ein Mitarbeiter des bis zur Übernahme einer irakischen Führung
als Chef der US-Verwaltung eingesetzten ehemaligen US-Generals
Jay Garner. "Wir werden nicht in der Lage sein, zu tun was wir
beim Wiederaufbau der Wirtschaft tun sollten und sicherlich wird
die Inflation ein Problem darstellen, ebenso wie die Behinderung
beim Start der wirtschaftlichen Aktivitäten", sagte er.
Die USA ihrerseits wollen den Vertretern zufolge bereits in
der nächsten Woche an bis zu 2,5 Millionen öffentlichen
Bediensteten des Irak eine Nothilfe von 20 Dollar pro Kopf
auszahlen, um Kaufkraft in die Wirtschaft des Landes zu pumpen.
Zudem wollen sie irakische Subunternehmer beim Wiederaufbau des
Landes und bei humanitären Programmen beschäftigen, um die
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Darüber hinaus würde die Aufhebung der Sanktionen der von
Garner geführten Verwaltung erlauben, die Grenzen 90 Tage lang
für bislang nicht genehmigte und zollfreie Importe zu öffnen,
sagten die US-Vertreter. Der freie Zustrom von Gütern würde es
den Irakern erlauben, ihre Lager nach zwei Kriegen in zwei
Jahrzehnten und zwölf Jahren Sanktionen aufzufüllen.
Der US-Plan sehe zudem eine Wiederaufstockung der irakischen
Devisenreserven durch eine Freigabe im Ausland eingefrorener
Guthaben und volle Staatsgarantien vor. Dies sei zur Deckung
einer irakischen Landeswährung von wesentlicher Bedeutung.
Allein die USA haben irakische Guthaben über 1,7 Milliarden
Dollar eingefroren. Durch die Aufhebung der Sanktionen würden
auch andere Länder ermutigt, eingefrorene Guthaben des Irak
freizugeben.
Den US-Vertretern zufolge dürfe der Irak, der über die
weltweit zweitgrößten nachgewiesenen Ölreserven verfügt,
zumindest für ein Jahr keinen Nutzen aus seinen Öleinnahmen
haben. Diese dürften für die Bedienung der Schulden des Landes
benötigt werden, die nach unabhängigen Schätzungen 103,4
Milliarden bis 129,4 Milliarden Dollar ausmachen, sowie für
Reparationszahlungen für Schäden bei der Besetzung Kuwaits von
bis zu 300 Milliarden Dollar. Darüber hinaus habe das Land
Verträge über 57 Milliarden Dollar abgeschlossen, die vermutlich
alle gerichtlich eingeklagt werden können. Allein das Volumen
der Schulden sei vier mal so groß wie die gesamte Wirtschaft des
Irak.
Die US-Vertreter kündigten an, sobald als möglich nach
Bagdad zu reisen, um dort ihre Arbeit aufzunehmen. Es sei jedoch
schwierig, die Leistung und den Umfang der Wirtschaft oder sonst
irgend etwas in einem bislang verschlossenen Land zu schätzen,
das weder Daten veröffentlicht noch gesammelt habe. Es gebe
aber keine Pläne, irgendwelche Subventionen aufzuheben, da
schätzungsweise 60 Prozent der Bevölkerung des Irak von
Lebensmittelhilfen der UNO abhängig seien.
fgc/rkr
-------
Kriegswirtschaft

http://finanzen.focus.msn.de/D/DS/DSF/dsf.htm?pfad=kursliste…
US-Handelsbilanzdefizit März sinkt überraschend auf 58,7 Milliarden Dollar
Das US-Handelsbilanzdefizit hat sich im März überraschend zurückgebildet. Es sei von 64,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresmonat auf 58,7 Milliarden Dollar gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Von der Nachrichtenagentur AFX News befragte Volkswirte hatten im Durchschnitt hingegen mit einem Anstieg auf 65 Milliarden Dollar gerechnet./FX/kro
18.04.2003 - 20:14
Quelle: dpa-AFX
---------
seit ende märz 2003 waren 97,75 Mrd. im open market, was juckt das da noch?
US-Handelsbilanzdefizit März sinkt überraschend auf 58,7 Milliarden Dollar
Das US-Handelsbilanzdefizit hat sich im März überraschend zurückgebildet. Es sei von 64,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresmonat auf 58,7 Milliarden Dollar gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Von der Nachrichtenagentur AFX News befragte Volkswirte hatten im Durchschnitt hingegen mit einem Anstieg auf 65 Milliarden Dollar gerechnet./FX/kro
18.04.2003 - 20:14
Quelle: dpa-AFX
---------
seit ende märz 2003 waren 97,75 Mrd. im open market, was juckt das da noch?

http://www.welt.de/data/2003/04/19/75225.html
"Bush tut nichts gegen die Rezession"
Der Ökonom John Kenneth Galbraith hält den Kurs der US-Regierung für gefährlich. Der 94-Jährige plädiert dagegen für eine neue Sozialpolitik
Schon 1933 mischte er bei Roosevelts New Deal mit, 1960 inspirierte er John F. Kennedys Sozialpolitik, und viele Jahre kabbelte er sich im Sommerurlaub mit Milton Friedman über Freiheit, Gleichheit und Wirtschaftspolitik. Jetzt ist John Kenneth Galbraith 94 Jahre alt und meint, dass früher alles besser war - denn nichts kann so schlimm sein wie George W. Bush. Andrea Seibel traf das Urgestein des Keynesianismus in Harvard.
DIE WELT: Sie müssen sich recht zufrieden fühlen dieser Tage. Wieder einmal haben sich Ihre Prognosen bewahrheitet, oder?
John Kenneth Galbraith: Ich habe es mir vor vielen Jahren abgewöhnt, Prognosen abzugeben. Aber manches überrascht mich mehr und manches weniger. Da ich nicht glaube, dass Konjunkturzyklen abgeschafft werden können, hat es mich auch nicht überrascht, dass wir wieder Rezession haben. Überrascht hat mich jedoch, dass die US-Regierung nichts unternimmt.
DIE WELT: Ihre Regierung sieht das anders.
Galbraith: Aber was tut sie? Von ihren Gesetzesinitiativen würden die Großkonzerne profitieren - und die Steuern würden nicht nur für die Reichen gesenkt, sondern vor allem für die Superreichen. Zurzeit geht die Tendenz dahin, alles den wundertätigen Kräften des Marktes zu überlassen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Aber auch der Versuch des Staates, über die Steuer- und Ausgabenpolitik die oberen Einkommensgruppen besser zu stellen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Bush-Regierung unternimmt nichts, was den Verlauf der Rezession abschwächen könnte. Das beunruhigt mich.
DIE WELT: Beim Scheitern des Staates denkt man heute eher daran, der Wohlfahrtsstaat sei eine zu große finanzielle Last geworden.
Galbraith: In den Jahren der Großen Depression hatten wir eine bessere Wirtschaftspolitik als heute. Damals hat die Wirtschaftspolitik Roosevelts eine Gruppe neuer Ökonomen angezogen, die alte Garde trat den Rückzug an. Die Stimmung dieser "affirmative economics" der Roosevelt-Ära, dieser Wirtschaftspolitik zu Gunsten der Benachteiligten, ist längst Vergangenheit. Wir, diejenigen, die damals und in den Jahren danach Verantwortung trugen, haben uns in einem Punkt geirrt. Wir dachten, mit der kontrazyklischen Konjunkturpolitik und insbesondere mit den ökonomischen Anreizen für die Armen und Bedürftigen hätten wir einen Standard gesetzt, hinter den keine Wirtschaftspolitik mehr zurückfallen kann. Inzwischen ist leider klar geworden, dass sie das doch kann. Bei Ronald Reagan war noch ein Schimmer der "affirmative economics" zu erkennen - George W. Bush ist tief ins 19. Jahrhundert abgesunken.
DIE WELT: Zwischen Reagan und Bush II gab es auch noch Clinton.
Galbraith: In dessen Amtszeit haben wir es nicht geschafft, die Wirtschaftspolitik an die modernen Formen des Konjunkturzyklus anzupassen. Clinton hatte etwas in dieser Richtung vor, wir haben das diskutiert. Aber die Topmanager, die sich jetzt in Washington und um Präsident Bush herum tummeln, werden damit wohl kaum etwas anfangen können.
DIE WELT: Der Markt ist heute stärker als je zuvor. Müssen Sie nicht eingestehen, dass Milton Friedman gewonnen hat?
Galbraith: Meine Sorge ist, dass wohl noch geraume Zeit eine Politik fortgesetzt wird, die die Verantwortung für die Wirtschaft dem Markt, also den großen Konzernen, überlässt. Ich habe nicht vorausgesehen, wie entschieden die Konzerne dabei vorgehen würden - Enron und Konsorten kamen in meinen Gedanken nicht vor. Demnächst erscheint ein Buch von mir, in dem ich vor den Gefahren warne, die mit der totalen Machtübernahme des Managements in den Unternehmen verbunden sind. Die Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung und zur unkontrollierten Spekulation, die Unternehmen heute bieten, stellten, so mein Argument, eine zu große Versuchung dar. Und während ich noch argumentierte, trat genau das ein!
DIE WELT: Was sollte, was kann eine Regierung überhaupt tun, um die Manager zu kontrollieren, wenn diese selbst es nicht fertig bringen?
Galbraith: Da stehen wir vor zwei Problemen. Das erste ist in den USA weit stärker ausgeprägt als in Europa: eine Regierung, die aus ideologischen Gründen Kontrollen ablehnt. Deshalb sieht sie nicht ein, wie groß die Gefahren sind, die aus dem Missbrauch unternehmerischer Macht erwachsen - und sie wird das auch nicht mehr einsehen. Das zweite Problem ist die schiere Größe der Aufgabe. Es ist einfach, diese Unternehmen zu kritisieren, die Worldcoms, die Enrons und all die anderen bis hin zu General Electric. Aber es ist viel schwieriger, dort korrigierend einzugreifen.
DIE WELT: Alle nationalen Regierungen müssen mit dem zentralen Problem der Globalisierung fertig werden: Konzerne agieren global und können auf nationaler Ebene nicht mehr kontrolliert werden.
Galbraith: Zentrales Problem - das klingt mir zu monokausal. Ich bin dagegen, alles in eine einfache Formel zu packen. Es gibt viele Gründe, wahrscheinlich eher kulturelle als ökonomische, warum ich mir eine Weltgemeinschaft wünsche. Ich habe einige der lehrreichsten Abschnitte meines Lebens in Deutschland und in Europa, vor allem aber in Indien und in Asien verbracht. Für mich ist die ganze Welt eine ökonomische Gemeinschaft, aber ich gehe dabei nicht so weit, nationale Wirtschaftspolitik für unnötig zu halten. Sie ist notwendig, um ökonomische Verwerfungen zu beseitigen und um die jeweils spezifischen wirtschaftlichen Gefahren im Auge zu behalten. Wir brauchen staatliche Wirtschaftspolitik genauso wie Harmonie zwischen den Ländern.
DIE WELT: Schumpeter sagt: Kapitalismus ist ebenso schöpferisch wie zerstörerisch. Sollte die Wirtschaftspolitik den Kapitalismus zivilisieren?
Galbraith: Schumpeter würde Ihnen hier nicht widersprechen. Ich war in Harvard einige Jahre lang ein Kollege Schumpeters - da sehen Sie mal, wie alt ich bin. In der Innenpolitik hatten wir unterschiedliche Ansichten, und für ihn war ich einer der Ironiker der Harvard-Community. Er war einer der ersten Wissenschaftler, der die Bedeutung der Großkonzerne erkannte. Und an noch etwas erinnere ich mich ganz besonders: Er liebte Streit und Widerspruch.
DIE WELT: Einen Begriff stellen Milton Friedman und alle anderen Verteidiger der liberalen Sache in den Mittelpunkt: Freiheit.
Galbraith: Ich möchte wieder mit zweierlei antworten. Einerseits gibt es keinen ökonomischen Grund, der hinreichen würde, um Menschen an der Ausübung ihrer individuellen Freiheitsrechte zu hindern. Die Meinungsfreiheit und die Freiheit zu ungehinderter politischer Betätigung gehören zu den Voraussetzungen zivilisierten Lebens. Die Achtung der individuellen Freiheitsrechte ist der einzige Weg, um den Menschen die freie Wahl zwischen den unterschiedlichsten Ideen zu ermöglichen.
DIE WELT: Soweit noch kein Dissens . . .
Galbraith: Andererseits sollte ein Freund der Freiheit aber auch nicht behaupten, dass Freiheit den Verzicht auf jedes staatliche Handeln bedeutet, dass Freiheit verlangt, die Hände in den Schoß zu legen, wenn öffentliches Handeln notwendig ist. Ich bin kein Freund dieser Art von Freiheit. Eine meiner Debatten mit meinem alten Freund Milton betrifft genau diesen Punkt. Seit 40 Jahren verbringe ich regelmäßig den Sommer im US-Bundesstaat Vermont. Auch Milton hat das viele Jahre lang getan. Wir trafen uns dort praktisch jeden Sommer, um jeweils den anderen zu überzeugen. Aber keiner von uns hatte Erfolg.
DIE WELT: Der Markt ist fast eine Art Heiligtum in Amerika. Wer so Kritik übt wie Sie, gilt wohl schon fast als Antikapitalist.
Galbraith: (lächelt) Ich selbst würde mich nicht als Antikapitalisten bezeichnen. Aber ich bin in meinem Leben immer wieder so oder noch härter persönlich angegriffen worden. Im Zweiten Weltkrieg war ich einer der drei oder vier großen Feinde des freien Marktes - und hatte Erfolg. Wir haben diese Zeit voller enormer Belastungen und Gefahren ohne jede Inflation überstanden. Und dafür war ich so lange verantwortlich, bis die Zahl meiner Feinde größer wurde als die meiner Freunde.
DIE WELT: Stimmen Sie Hobsbawm zu, der das 20. Jahrhundert als Zeitalter der Extreme bezeichnet?
Galbraith: Ganz und gar nicht. Mir kommt es immer höchst verdächtig vor, wenn jemand versucht, die gesamte Zukunft oder Vergangenheit in einen Satz zu packen. Das geht nicht. Niemand kann das. Ich jedenfalls habe lieber im 20. Jahrhundert gelebt als in irgendeinem der Jahrhunderte davor. Und dabei geht es nicht nur um materielle, sondern auch um alle anderen Werte: Kultur, Gesundheit, Glück. Und über allem: Frieden, die noch immer nicht beendete Aufgabe der entwickelten Staaten.
DIE WELT: Sie waren immer nah am Zentrum der politischen Macht
Galbraith: aber nie im Zentrum.
DIE WELT: Worauf sind Sie besonders stolz?
Galbraith: Mein größter Erfolg? Die Wirtschaftspolitik der Kriegsjahre. Ich war damals für die Inflationsbekämpfung zuständig. Und ich bin stolz darauf, dass ich damals alles an orthodoxer Politik beiseite gelassen habe, inklusive der Währungspolitik, inklusive der Notenbank.
DIE WELT: Krieg und Frieden haben Ihr Leben begleitet. Ihre größten Erfolge hatten Sie in Kriegszeiten, aber 1968 waren Sie strikt gegen den Vietnamkrieg, was Sie damals auf die Titelseite der Zeitschrift "Time" gebracht hat.
Galbraith: Ja, ich war strikt gegen den Krieg in Vietnam, weil ich ein friedliches Zusammenleben aller Menschen der Erde anstrebe; ein Grundmotiv, das mich immer wieder angetrieben hat. Ich war in Vietnam, ich habe einige Jahre in Asien verbracht und habe miterlebt, welche Rolle dort all das Gerede über Kapitalismus und Kommunismus spielte - es war so wundervoll irrelevant. Das Vorgehen der USA gegen Vietnam war brutal und aussichtslos.
DIE WELT: Sie jetzt zum Irak zu befragen wird wahrscheinlich zu einer ähnlichen Antwort führen.
Galbraith: Sie sagen es. Ich bin genau so strikt gegen jede Intervention im Irak.
DIE WELT: Sie sind 94 und schreiben ein neues Buch. Gibt es für Denker keinen Ruhestand?
Galbraith: Zugegeben, ich bin alt. Aber nicht zu alt. Man kann nicht mehr so viel tun, aber bei einigen Dingen ist ein hohes Alter sogar von Vorteil.
DIE WELT: Bei welchen?
Galbraith: Ich habe von Ihnen kein einziges Wort der Kritik an meinen ökonomischen oder politischen Ansichten gehört. (lächelt)
Artikel erschienen am 19. Apr 2003

"Bush tut nichts gegen die Rezession"
Der Ökonom John Kenneth Galbraith hält den Kurs der US-Regierung für gefährlich. Der 94-Jährige plädiert dagegen für eine neue Sozialpolitik
Schon 1933 mischte er bei Roosevelts New Deal mit, 1960 inspirierte er John F. Kennedys Sozialpolitik, und viele Jahre kabbelte er sich im Sommerurlaub mit Milton Friedman über Freiheit, Gleichheit und Wirtschaftspolitik. Jetzt ist John Kenneth Galbraith 94 Jahre alt und meint, dass früher alles besser war - denn nichts kann so schlimm sein wie George W. Bush. Andrea Seibel traf das Urgestein des Keynesianismus in Harvard.
DIE WELT: Sie müssen sich recht zufrieden fühlen dieser Tage. Wieder einmal haben sich Ihre Prognosen bewahrheitet, oder?
John Kenneth Galbraith: Ich habe es mir vor vielen Jahren abgewöhnt, Prognosen abzugeben. Aber manches überrascht mich mehr und manches weniger. Da ich nicht glaube, dass Konjunkturzyklen abgeschafft werden können, hat es mich auch nicht überrascht, dass wir wieder Rezession haben. Überrascht hat mich jedoch, dass die US-Regierung nichts unternimmt.
DIE WELT: Ihre Regierung sieht das anders.
Galbraith: Aber was tut sie? Von ihren Gesetzesinitiativen würden die Großkonzerne profitieren - und die Steuern würden nicht nur für die Reichen gesenkt, sondern vor allem für die Superreichen. Zurzeit geht die Tendenz dahin, alles den wundertätigen Kräften des Marktes zu überlassen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Aber auch der Versuch des Staates, über die Steuer- und Ausgabenpolitik die oberen Einkommensgruppen besser zu stellen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Bush-Regierung unternimmt nichts, was den Verlauf der Rezession abschwächen könnte. Das beunruhigt mich.
DIE WELT: Beim Scheitern des Staates denkt man heute eher daran, der Wohlfahrtsstaat sei eine zu große finanzielle Last geworden.
Galbraith: In den Jahren der Großen Depression hatten wir eine bessere Wirtschaftspolitik als heute. Damals hat die Wirtschaftspolitik Roosevelts eine Gruppe neuer Ökonomen angezogen, die alte Garde trat den Rückzug an. Die Stimmung dieser "affirmative economics" der Roosevelt-Ära, dieser Wirtschaftspolitik zu Gunsten der Benachteiligten, ist längst Vergangenheit. Wir, diejenigen, die damals und in den Jahren danach Verantwortung trugen, haben uns in einem Punkt geirrt. Wir dachten, mit der kontrazyklischen Konjunkturpolitik und insbesondere mit den ökonomischen Anreizen für die Armen und Bedürftigen hätten wir einen Standard gesetzt, hinter den keine Wirtschaftspolitik mehr zurückfallen kann. Inzwischen ist leider klar geworden, dass sie das doch kann. Bei Ronald Reagan war noch ein Schimmer der "affirmative economics" zu erkennen - George W. Bush ist tief ins 19. Jahrhundert abgesunken.
DIE WELT: Zwischen Reagan und Bush II gab es auch noch Clinton.
Galbraith: In dessen Amtszeit haben wir es nicht geschafft, die Wirtschaftspolitik an die modernen Formen des Konjunkturzyklus anzupassen. Clinton hatte etwas in dieser Richtung vor, wir haben das diskutiert. Aber die Topmanager, die sich jetzt in Washington und um Präsident Bush herum tummeln, werden damit wohl kaum etwas anfangen können.
DIE WELT: Der Markt ist heute stärker als je zuvor. Müssen Sie nicht eingestehen, dass Milton Friedman gewonnen hat?
Galbraith: Meine Sorge ist, dass wohl noch geraume Zeit eine Politik fortgesetzt wird, die die Verantwortung für die Wirtschaft dem Markt, also den großen Konzernen, überlässt. Ich habe nicht vorausgesehen, wie entschieden die Konzerne dabei vorgehen würden - Enron und Konsorten kamen in meinen Gedanken nicht vor. Demnächst erscheint ein Buch von mir, in dem ich vor den Gefahren warne, die mit der totalen Machtübernahme des Managements in den Unternehmen verbunden sind. Die Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung und zur unkontrollierten Spekulation, die Unternehmen heute bieten, stellten, so mein Argument, eine zu große Versuchung dar. Und während ich noch argumentierte, trat genau das ein!
DIE WELT: Was sollte, was kann eine Regierung überhaupt tun, um die Manager zu kontrollieren, wenn diese selbst es nicht fertig bringen?
Galbraith: Da stehen wir vor zwei Problemen. Das erste ist in den USA weit stärker ausgeprägt als in Europa: eine Regierung, die aus ideologischen Gründen Kontrollen ablehnt. Deshalb sieht sie nicht ein, wie groß die Gefahren sind, die aus dem Missbrauch unternehmerischer Macht erwachsen - und sie wird das auch nicht mehr einsehen. Das zweite Problem ist die schiere Größe der Aufgabe. Es ist einfach, diese Unternehmen zu kritisieren, die Worldcoms, die Enrons und all die anderen bis hin zu General Electric. Aber es ist viel schwieriger, dort korrigierend einzugreifen.
DIE WELT: Alle nationalen Regierungen müssen mit dem zentralen Problem der Globalisierung fertig werden: Konzerne agieren global und können auf nationaler Ebene nicht mehr kontrolliert werden.
Galbraith: Zentrales Problem - das klingt mir zu monokausal. Ich bin dagegen, alles in eine einfache Formel zu packen. Es gibt viele Gründe, wahrscheinlich eher kulturelle als ökonomische, warum ich mir eine Weltgemeinschaft wünsche. Ich habe einige der lehrreichsten Abschnitte meines Lebens in Deutschland und in Europa, vor allem aber in Indien und in Asien verbracht. Für mich ist die ganze Welt eine ökonomische Gemeinschaft, aber ich gehe dabei nicht so weit, nationale Wirtschaftspolitik für unnötig zu halten. Sie ist notwendig, um ökonomische Verwerfungen zu beseitigen und um die jeweils spezifischen wirtschaftlichen Gefahren im Auge zu behalten. Wir brauchen staatliche Wirtschaftspolitik genauso wie Harmonie zwischen den Ländern.
DIE WELT: Schumpeter sagt: Kapitalismus ist ebenso schöpferisch wie zerstörerisch. Sollte die Wirtschaftspolitik den Kapitalismus zivilisieren?
Galbraith: Schumpeter würde Ihnen hier nicht widersprechen. Ich war in Harvard einige Jahre lang ein Kollege Schumpeters - da sehen Sie mal, wie alt ich bin. In der Innenpolitik hatten wir unterschiedliche Ansichten, und für ihn war ich einer der Ironiker der Harvard-Community. Er war einer der ersten Wissenschaftler, der die Bedeutung der Großkonzerne erkannte. Und an noch etwas erinnere ich mich ganz besonders: Er liebte Streit und Widerspruch.
DIE WELT: Einen Begriff stellen Milton Friedman und alle anderen Verteidiger der liberalen Sache in den Mittelpunkt: Freiheit.
Galbraith: Ich möchte wieder mit zweierlei antworten. Einerseits gibt es keinen ökonomischen Grund, der hinreichen würde, um Menschen an der Ausübung ihrer individuellen Freiheitsrechte zu hindern. Die Meinungsfreiheit und die Freiheit zu ungehinderter politischer Betätigung gehören zu den Voraussetzungen zivilisierten Lebens. Die Achtung der individuellen Freiheitsrechte ist der einzige Weg, um den Menschen die freie Wahl zwischen den unterschiedlichsten Ideen zu ermöglichen.
DIE WELT: Soweit noch kein Dissens . . .
Galbraith: Andererseits sollte ein Freund der Freiheit aber auch nicht behaupten, dass Freiheit den Verzicht auf jedes staatliche Handeln bedeutet, dass Freiheit verlangt, die Hände in den Schoß zu legen, wenn öffentliches Handeln notwendig ist. Ich bin kein Freund dieser Art von Freiheit. Eine meiner Debatten mit meinem alten Freund Milton betrifft genau diesen Punkt. Seit 40 Jahren verbringe ich regelmäßig den Sommer im US-Bundesstaat Vermont. Auch Milton hat das viele Jahre lang getan. Wir trafen uns dort praktisch jeden Sommer, um jeweils den anderen zu überzeugen. Aber keiner von uns hatte Erfolg.
DIE WELT: Der Markt ist fast eine Art Heiligtum in Amerika. Wer so Kritik übt wie Sie, gilt wohl schon fast als Antikapitalist.
Galbraith: (lächelt) Ich selbst würde mich nicht als Antikapitalisten bezeichnen. Aber ich bin in meinem Leben immer wieder so oder noch härter persönlich angegriffen worden. Im Zweiten Weltkrieg war ich einer der drei oder vier großen Feinde des freien Marktes - und hatte Erfolg. Wir haben diese Zeit voller enormer Belastungen und Gefahren ohne jede Inflation überstanden. Und dafür war ich so lange verantwortlich, bis die Zahl meiner Feinde größer wurde als die meiner Freunde.
DIE WELT: Stimmen Sie Hobsbawm zu, der das 20. Jahrhundert als Zeitalter der Extreme bezeichnet?
Galbraith: Ganz und gar nicht. Mir kommt es immer höchst verdächtig vor, wenn jemand versucht, die gesamte Zukunft oder Vergangenheit in einen Satz zu packen. Das geht nicht. Niemand kann das. Ich jedenfalls habe lieber im 20. Jahrhundert gelebt als in irgendeinem der Jahrhunderte davor. Und dabei geht es nicht nur um materielle, sondern auch um alle anderen Werte: Kultur, Gesundheit, Glück. Und über allem: Frieden, die noch immer nicht beendete Aufgabe der entwickelten Staaten.
DIE WELT: Sie waren immer nah am Zentrum der politischen Macht
Galbraith: aber nie im Zentrum.
DIE WELT: Worauf sind Sie besonders stolz?
Galbraith: Mein größter Erfolg? Die Wirtschaftspolitik der Kriegsjahre. Ich war damals für die Inflationsbekämpfung zuständig. Und ich bin stolz darauf, dass ich damals alles an orthodoxer Politik beiseite gelassen habe, inklusive der Währungspolitik, inklusive der Notenbank.
DIE WELT: Krieg und Frieden haben Ihr Leben begleitet. Ihre größten Erfolge hatten Sie in Kriegszeiten, aber 1968 waren Sie strikt gegen den Vietnamkrieg, was Sie damals auf die Titelseite der Zeitschrift "Time" gebracht hat.
Galbraith: Ja, ich war strikt gegen den Krieg in Vietnam, weil ich ein friedliches Zusammenleben aller Menschen der Erde anstrebe; ein Grundmotiv, das mich immer wieder angetrieben hat. Ich war in Vietnam, ich habe einige Jahre in Asien verbracht und habe miterlebt, welche Rolle dort all das Gerede über Kapitalismus und Kommunismus spielte - es war so wundervoll irrelevant. Das Vorgehen der USA gegen Vietnam war brutal und aussichtslos.
DIE WELT: Sie jetzt zum Irak zu befragen wird wahrscheinlich zu einer ähnlichen Antwort führen.
Galbraith: Sie sagen es. Ich bin genau so strikt gegen jede Intervention im Irak.
DIE WELT: Sie sind 94 und schreiben ein neues Buch. Gibt es für Denker keinen Ruhestand?
Galbraith: Zugegeben, ich bin alt. Aber nicht zu alt. Man kann nicht mehr so viel tun, aber bei einigen Dingen ist ein hohes Alter sogar von Vorteil.
DIE WELT: Bei welchen?
Galbraith: Ich habe von Ihnen kein einziges Wort der Kritik an meinen ökonomischen oder politischen Ansichten gehört. (lächelt)
Artikel erschienen am 19. Apr 2003

http://www.sueddeutsche.de/aktuell/sz/getArticleSZ.php?artik…
George W. Arabicus
Das Ende des Irak-Krieges ist nicht der Beginn des Friedens
Als die Römer vor 2149 Jahren Karthago eroberten, sah die Neuordnung des Landes so aus: Publius Cornelius Scipio der Jüngere, fortan Africanus genannt, ließ die Stadt dem Erdboden gleich machen. Seine Soldaten erledigten das nach einem blutigen und grausamen Häuserkampf so gründlich, das an diesem Ort niemals mehr eine menschliche Ansiedlung entstehen sollte. Angesichts des gewaltigen Zerstörungswerks wurde der römische Feldherr sentimental: Es kamen ihm, so berichtet Appian, die Tränen, und er dachte über die Wechselhaftigkeit des Glücks und über die Vergänglichkeit der Reiche nach. Das hinderte ihn freilich nicht daran, in Karthago keinen Stein auf dem anderen zu lassen und die überlebende Hälfte der Einwohner in die Sklaverei zu verkaufen. Das karthagische Land aber wurde römische Provinz unter einem militärischen Oberbefehlshaber.
George Bush der Jüngere hat, so weit bekannt, über die Zerstörungen, die seine 24 000 Bomben und Sprengsätze im Irak angerichtet haben, nicht geweint; er hat ja auch Bagdad nicht so gründlich zerstört wie Scipio einst Karthago. Auch philosophische Gedanken über die Vergänglichkeit des Ruhms sind von Bush nicht bekannt geworden. Im Gegenteil: Er fühlt sich auf dem Höhepunkt seiner Präsidentschaft, die Zustimmung der US-Amerikaner ist noch weiter gewachsen, und seine Außenpolitik spielt schon wieder mit den Muskeln. Im neuen Rom herrscht Zufriedenheit über einen schnellen und vermeintlich leichten Sieg. Es verdankt zwar diesen schnellen Sieg nicht zuletzt der Tatsache, dass die angeblich diabolische Gefährlichkeit der Waffenprogramme Saddam Husseins, die den Kriegsgrund geliefert hatte, sich als US-Zwecklüge entlarvt hat. Doch genauso behende, wie Bush vor einem Jahr Osama bin Laden als Oberterroristen gegen Saddam Hussein ausgetauscht hat, hat er jetzt den Kriegsgrund gewechselt: Es sei um die Befreiung der Iraker von Saddam gegangen, heißt es jetzt.
Diese Substitution der Kriegsgründe funktioniert nur deswegen einigermaßen, weil der ursprüngliche Kriegsgrund irreal war und in Folge dessen im Irak-Krieg weniger Menschen krepierten als befürchtet: Das große Schlachten fand nicht statt, es kam jedenfalls nicht ins Bewusstsein derWeltöffentlichkeit. Der vermeintlich glimpflichen Folgen wegen ist aber die Kriegs-Ablehnung nicht mehr so groß, wie sie es war. Von einem britischen Offizier stammt zwar die Angabe, es seien dreißigtausend irakische Soldaten getötet worden. Und wie viele Zivilisten? Das wird nie bekannt werden. Bush kann deshalb den Amerikanern einen glänzenden Sieg präsentieren und vor der Welt so tun, als habe es sich beim Krieg nur um eine Hobelaktion mit den dabei allfälligen Spänen gehandelt.
Dumm. Dumdum
Die Invasoren halten sich für Samariter, weil sie aus Bagdad kein Karthago gemacht haben – und in der westlichen Staatenwelt ist man gerade deshalb schon wieder ein wenig geneigt, den Völkerrechtsbruch von Bush und Blair als lässliche Sünde zu bewerten und nolens volens als Preis für den Sturz eines Diktators zu betrachten. Von den Bellizisten in den Feuilletons werden die Kriegsgegner, die vor einer Katastrophe und einem Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten gewarnt hatten, schon jetzt als Propheten des Untergangs belächelt – als ob die Gefahren schon aus der Welt wären. In der FAZ meldet sich ein großer deutscher Dichter zu Wort, der sich im Alter in einen Jünger verwandelt hat, um aus dem Schaukelstuhl heraus der Schwertmission der Briten und Amerikaner zu akklamieren. Und all diese tun so, als sei mit dem Ende des Krieges auch schon der Frieden gekommen – und sehen die Gefahr nicht, dass mit diesem Frieden der Krieg schon wieder neu beginnt.
Finis belli pax est: Vor diesem Irrglauben hat Karl Kraus schon 1918 gewarnt. Er lässt einen Kriegsfreund, den er „Optimist“, und einen Kriegsgegner, den er „Nörgler“ nennt, miteinander streiten. Der Dialog geht so. Der Optimist: „Aber wenn einmal der Frieden kommt – “. Der Nörgler: „– so wird der Krieg beginnen“. Der Optimist: „Jeder Krieg wird doch noch durch einen Frieden beendigt“. Der Nörgler: „Dieser nicht. Er hat sich nicht an der Oberfläche abgespielt, sondern im Leben selbst gewütet. Die Front ist ins Hinterland hineingewachsen...Darum wird er nicht aufhören“. Der Optimist: „Aber wenn nur erst der Frieden da ist – “. Der Nörgler: „ – so wird man vom Krieg nicht genug kriegen können!“ Der Optimist: „Sie nörgeln selbst an der Zukunft. Ich bin und bleibe Optimist. Die Völker werden durch Schaden – “. Der Nörgler: „ – dumm. Dumdum.“ Im den letzten Kriegstagen im Irak befinden wir uns exakt in dieser 49. Szene des Stückes „Die letzten Tage der Menschheit“.
Zwar wird es keinen formalen Friedensschluss geben, weil nach der Debellation des Irak niemand mehr da ist, mit dem ein solcher möglich wäre; einen Friedens-Formalakt mit dem Saddam-Irak hatten die Amerikaner auch nicht im Sinn. Aber sie reden gleichwohl wie der Optimist bei Karl Kraus, sie tun so, als folge auf den Krieg nun naturgegeben der Frieden oder gar Demokratie. Es ist dies ein wenig makaber: Auf einmal bewegen sich die US-Völkerrechtsbrecher in der klassischen alten europäischen Denktradition, wonach sich das politische und gesellschaftliche Leben gleichsam ohne Rest in Zustände entweder von Krieg oder Frieden aufspalten lasse – dass es dazwischen also nichts Mittleres gebe. „Inter bellum et pacem nihil medium“, sagt Cicero. Ähnlich Thomas Hobbes im Leviathan: „Die Zeit aber, in der kein Krieg herrscht, heißt Frieden“.
So einfach machen es sich die Irak-Invasoren auch, aber exakt das stimmt längst nicht mehr: Krieg und Frieden sind (wie jüngst der Hamburger Historiker Bernd Wegner in einem Sammelband mit dem Titel „Wie Kriege enden“ festgestellt hat) keine festen Aggregatzustände mehr, die Übergänge sind fließend, und dies nicht nur deshalb, weil es kaum noch Kriegserklärungen und formale Friedensschlüsse gibt. An die Stelle der formalen Kriegsbeendigung tritt ein Friedensprozess, der geplant und gesteuert werden muss. Es zeigt sich freilich im Irak exemplarisch, dass Planung und Steuerung sich nur auf den Krieg erstrecken. Die Sieger erwarten quasi, dass der Frieden sich irgendwie schüttelt, dass er sich also als status naturalis einstellt, wenn man nur den Diktator beseitigt hat. Es ist dies eine leichtfertige und gefährliche Erwartung, eine, die den Krieg von neuem diskreditiert.
Und deshalb ist die Situation des Irak im vermeintlichen Frieden ähnlich explosiv wie die im Krieg. Die Gewalt wird sich, so ist zu befürchten, jetzt nur auf andere Weise und an anderen Orten verdichten als in den Kriegswochen. Die Bush-Regierung glaubt, dass es im Irak irgendwie so läuft, wie nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland oder in Japan, man sucht also nach dem Adenauer von Bagdad, findet ihn aber nicht. Für die bisherige irakische Opposition gilt, was auch für die US-Amerikaner gilt: Sie wollten Saddam stürzen, aber eine gemeinsame Vision für die Zeit nach dem autoritären Regime haben sie nicht. Schon gehen irakische Oppositionelle auf Distanz zu Washington. Selbst der vom Pentagon finanzierte und für eine Führungsrolle im neuen Irak vorgesehen Chef des Irakischen Nationalkongresses wollte sich auf der ersten Konferenz für eine Nachkriegsordnung nicht blicken lassen. Die wichtigste schiitische Oppositiongruppe fehlte auch. Der Jubel derer, die sich palmwedelschwenkend von Saddam befreit fühlen, kann alsbald umschlagen in den Hass gegen die ungläubigen Besatzer. Einer der vielen Unterschiede zur Situation im Nachkriegsdeutschland ist nämlich der: es gab dort eine Bereitschaft zur Aufnahme der Besatzer, weil der Krieg nicht nur als militärische, sondern auch als moralische Katastrophe zu Ende gegangen war. Für den Irak-Krieg gilt das nicht. Eine moralisches Debakel war und ist er eher für die Bush-Amerikaner: Sie haben Prestige, Respekt, Autorität und Legitimität verloren; der Krieg hat die antiamerikanische Solidarisierung der arabischen Welt forciert.
Zweitausend Jahre Fortschritt? Weil es in Karthago gut geklappt hatte, machte sich Scipio Africanus dreizehn Jahre später noch einmal wieder über eine Stadt her und zerstörte Numantia. George W. Bush, dem dann sein Land den Namen Arabicus verleihen darf, wird, so ist zu befürchten, nicht so lange warten. Numantia liegt heute in Syrien und im Iran.

George W. Arabicus
Das Ende des Irak-Krieges ist nicht der Beginn des Friedens
Als die Römer vor 2149 Jahren Karthago eroberten, sah die Neuordnung des Landes so aus: Publius Cornelius Scipio der Jüngere, fortan Africanus genannt, ließ die Stadt dem Erdboden gleich machen. Seine Soldaten erledigten das nach einem blutigen und grausamen Häuserkampf so gründlich, das an diesem Ort niemals mehr eine menschliche Ansiedlung entstehen sollte. Angesichts des gewaltigen Zerstörungswerks wurde der römische Feldherr sentimental: Es kamen ihm, so berichtet Appian, die Tränen, und er dachte über die Wechselhaftigkeit des Glücks und über die Vergänglichkeit der Reiche nach. Das hinderte ihn freilich nicht daran, in Karthago keinen Stein auf dem anderen zu lassen und die überlebende Hälfte der Einwohner in die Sklaverei zu verkaufen. Das karthagische Land aber wurde römische Provinz unter einem militärischen Oberbefehlshaber.
George Bush der Jüngere hat, so weit bekannt, über die Zerstörungen, die seine 24 000 Bomben und Sprengsätze im Irak angerichtet haben, nicht geweint; er hat ja auch Bagdad nicht so gründlich zerstört wie Scipio einst Karthago. Auch philosophische Gedanken über die Vergänglichkeit des Ruhms sind von Bush nicht bekannt geworden. Im Gegenteil: Er fühlt sich auf dem Höhepunkt seiner Präsidentschaft, die Zustimmung der US-Amerikaner ist noch weiter gewachsen, und seine Außenpolitik spielt schon wieder mit den Muskeln. Im neuen Rom herrscht Zufriedenheit über einen schnellen und vermeintlich leichten Sieg. Es verdankt zwar diesen schnellen Sieg nicht zuletzt der Tatsache, dass die angeblich diabolische Gefährlichkeit der Waffenprogramme Saddam Husseins, die den Kriegsgrund geliefert hatte, sich als US-Zwecklüge entlarvt hat. Doch genauso behende, wie Bush vor einem Jahr Osama bin Laden als Oberterroristen gegen Saddam Hussein ausgetauscht hat, hat er jetzt den Kriegsgrund gewechselt: Es sei um die Befreiung der Iraker von Saddam gegangen, heißt es jetzt.
Diese Substitution der Kriegsgründe funktioniert nur deswegen einigermaßen, weil der ursprüngliche Kriegsgrund irreal war und in Folge dessen im Irak-Krieg weniger Menschen krepierten als befürchtet: Das große Schlachten fand nicht statt, es kam jedenfalls nicht ins Bewusstsein derWeltöffentlichkeit. Der vermeintlich glimpflichen Folgen wegen ist aber die Kriegs-Ablehnung nicht mehr so groß, wie sie es war. Von einem britischen Offizier stammt zwar die Angabe, es seien dreißigtausend irakische Soldaten getötet worden. Und wie viele Zivilisten? Das wird nie bekannt werden. Bush kann deshalb den Amerikanern einen glänzenden Sieg präsentieren und vor der Welt so tun, als habe es sich beim Krieg nur um eine Hobelaktion mit den dabei allfälligen Spänen gehandelt.
Dumm. Dumdum
Die Invasoren halten sich für Samariter, weil sie aus Bagdad kein Karthago gemacht haben – und in der westlichen Staatenwelt ist man gerade deshalb schon wieder ein wenig geneigt, den Völkerrechtsbruch von Bush und Blair als lässliche Sünde zu bewerten und nolens volens als Preis für den Sturz eines Diktators zu betrachten. Von den Bellizisten in den Feuilletons werden die Kriegsgegner, die vor einer Katastrophe und einem Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten gewarnt hatten, schon jetzt als Propheten des Untergangs belächelt – als ob die Gefahren schon aus der Welt wären. In der FAZ meldet sich ein großer deutscher Dichter zu Wort, der sich im Alter in einen Jünger verwandelt hat, um aus dem Schaukelstuhl heraus der Schwertmission der Briten und Amerikaner zu akklamieren. Und all diese tun so, als sei mit dem Ende des Krieges auch schon der Frieden gekommen – und sehen die Gefahr nicht, dass mit diesem Frieden der Krieg schon wieder neu beginnt.
Finis belli pax est: Vor diesem Irrglauben hat Karl Kraus schon 1918 gewarnt. Er lässt einen Kriegsfreund, den er „Optimist“, und einen Kriegsgegner, den er „Nörgler“ nennt, miteinander streiten. Der Dialog geht so. Der Optimist: „Aber wenn einmal der Frieden kommt – “. Der Nörgler: „– so wird der Krieg beginnen“. Der Optimist: „Jeder Krieg wird doch noch durch einen Frieden beendigt“. Der Nörgler: „Dieser nicht. Er hat sich nicht an der Oberfläche abgespielt, sondern im Leben selbst gewütet. Die Front ist ins Hinterland hineingewachsen...Darum wird er nicht aufhören“. Der Optimist: „Aber wenn nur erst der Frieden da ist – “. Der Nörgler: „ – so wird man vom Krieg nicht genug kriegen können!“ Der Optimist: „Sie nörgeln selbst an der Zukunft. Ich bin und bleibe Optimist. Die Völker werden durch Schaden – “. Der Nörgler: „ – dumm. Dumdum.“ Im den letzten Kriegstagen im Irak befinden wir uns exakt in dieser 49. Szene des Stückes „Die letzten Tage der Menschheit“.
Zwar wird es keinen formalen Friedensschluss geben, weil nach der Debellation des Irak niemand mehr da ist, mit dem ein solcher möglich wäre; einen Friedens-Formalakt mit dem Saddam-Irak hatten die Amerikaner auch nicht im Sinn. Aber sie reden gleichwohl wie der Optimist bei Karl Kraus, sie tun so, als folge auf den Krieg nun naturgegeben der Frieden oder gar Demokratie. Es ist dies ein wenig makaber: Auf einmal bewegen sich die US-Völkerrechtsbrecher in der klassischen alten europäischen Denktradition, wonach sich das politische und gesellschaftliche Leben gleichsam ohne Rest in Zustände entweder von Krieg oder Frieden aufspalten lasse – dass es dazwischen also nichts Mittleres gebe. „Inter bellum et pacem nihil medium“, sagt Cicero. Ähnlich Thomas Hobbes im Leviathan: „Die Zeit aber, in der kein Krieg herrscht, heißt Frieden“.
So einfach machen es sich die Irak-Invasoren auch, aber exakt das stimmt längst nicht mehr: Krieg und Frieden sind (wie jüngst der Hamburger Historiker Bernd Wegner in einem Sammelband mit dem Titel „Wie Kriege enden“ festgestellt hat) keine festen Aggregatzustände mehr, die Übergänge sind fließend, und dies nicht nur deshalb, weil es kaum noch Kriegserklärungen und formale Friedensschlüsse gibt. An die Stelle der formalen Kriegsbeendigung tritt ein Friedensprozess, der geplant und gesteuert werden muss. Es zeigt sich freilich im Irak exemplarisch, dass Planung und Steuerung sich nur auf den Krieg erstrecken. Die Sieger erwarten quasi, dass der Frieden sich irgendwie schüttelt, dass er sich also als status naturalis einstellt, wenn man nur den Diktator beseitigt hat. Es ist dies eine leichtfertige und gefährliche Erwartung, eine, die den Krieg von neuem diskreditiert.
Und deshalb ist die Situation des Irak im vermeintlichen Frieden ähnlich explosiv wie die im Krieg. Die Gewalt wird sich, so ist zu befürchten, jetzt nur auf andere Weise und an anderen Orten verdichten als in den Kriegswochen. Die Bush-Regierung glaubt, dass es im Irak irgendwie so läuft, wie nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland oder in Japan, man sucht also nach dem Adenauer von Bagdad, findet ihn aber nicht. Für die bisherige irakische Opposition gilt, was auch für die US-Amerikaner gilt: Sie wollten Saddam stürzen, aber eine gemeinsame Vision für die Zeit nach dem autoritären Regime haben sie nicht. Schon gehen irakische Oppositionelle auf Distanz zu Washington. Selbst der vom Pentagon finanzierte und für eine Führungsrolle im neuen Irak vorgesehen Chef des Irakischen Nationalkongresses wollte sich auf der ersten Konferenz für eine Nachkriegsordnung nicht blicken lassen. Die wichtigste schiitische Oppositiongruppe fehlte auch. Der Jubel derer, die sich palmwedelschwenkend von Saddam befreit fühlen, kann alsbald umschlagen in den Hass gegen die ungläubigen Besatzer. Einer der vielen Unterschiede zur Situation im Nachkriegsdeutschland ist nämlich der: es gab dort eine Bereitschaft zur Aufnahme der Besatzer, weil der Krieg nicht nur als militärische, sondern auch als moralische Katastrophe zu Ende gegangen war. Für den Irak-Krieg gilt das nicht. Eine moralisches Debakel war und ist er eher für die Bush-Amerikaner: Sie haben Prestige, Respekt, Autorität und Legitimität verloren; der Krieg hat die antiamerikanische Solidarisierung der arabischen Welt forciert.
Zweitausend Jahre Fortschritt? Weil es in Karthago gut geklappt hatte, machte sich Scipio Africanus dreizehn Jahre später noch einmal wieder über eine Stadt her und zerstörte Numantia. George W. Bush, dem dann sein Land den Namen Arabicus verleihen darf, wird, so ist zu befürchten, nicht so lange warten. Numantia liegt heute in Syrien und im Iran.

http://www.zeit.de/2003/17/Irak-Aufbau
Irak-wiederaufbau
Basar Bagdad
Öl, Straßen, Telefonanlagen: Regierungen und Konzerne feilschen um die größten Aufträge im Irak ? und darum, wer sie bezahlt
Von Petra Pinzler und Joachim Fritz-Vannahme
Zwei Tage, und dann war das Seminar Arabisch verstehen beim Hamburger Nah- und Mittelost-Verein der deutschen Wirtschaft ausverkauft. In London erfreuen sich die Irak-Informationsabende der Trade Partners UK ähnlicher Beliebtheit. Und in Washington kann das Forschungsinstitut CSIS dieser Tage sogar 1000 Dollar für ein Seminar verlangen, auf dem Senatoren, ehemalige Generäle und Staatssekretäre reden. Thema: Aufbau Irak – Die Herausforderung für Unternehmen.
Rund um die Welt sprießen die Hoffnungen aufs schnelle Geschäft in Bagdad. Obwohl die letzten Bomben noch nicht gefallen und die Toten nicht begraben sind, schnüren auf den Philippinen die Wanderarbeiter bereits ihr Säckchen. Kaum jemand arbeitet so billig in der Montage wie sie und versteht dabei noch Englisch.
In Minnesota träumen die Farmer davon, „die Freundschaft mit den irakischen Müllern zu erneuern“, so Alan Tracy, Präsident des amerikanischen Weizenverbandes. In Kuwait hoffen die Ölfachleute darauf, bald auch an den Quellen des ehemaligen Feindes bohren zu dürfen. Und in Spanien versucht die Regierung Aznar, ihren Unternehmen durch geheime Absprachen und eilfertige Reisen nach Washington einen Startvorteil zu sichern.
Doch wer wird wirklich das große Geschäft in Bagdad machen? Wer wird es bezahlen? Und wer wird das liefern, was die Iraker wirklich brauchen?
In Deutschland gibt man sich derzeit pessimistisch. „Bei der Vergabe der Aufträge wird sich deutlich bemerkbar machen, dass Deutschland die USA im Krieg nicht unterstützt hat“, fürchtet Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels. „Wenig zu bestellen“ hätten die Deutschen, glaubt auch VDMA-Hauptgeschäftsführer Hannes Hesse. Ähnliche Prognosen sind in Frankreich zu hören.
Von der Zeitung La Tribune befragt, fürchten zwei Drittel der Leser eine Benachteiligung der heimischen Wirtschaft. Viele denken wie der erstaunte Vertreter des Pariser Wirtschaftsministeriums: „Die Art, wie die Amerikaner ihre Unternehmen durchsetzen und dabei jene bevorzugen, die der Regierung nahe stehen, ist einfach atemberaubend.“ Oder sie reagieren verärgert wie Claude Schneider vom Bauunternehmen Case Poclin: „Wir waren seit 35 Jahren im Irak vertreten. Doch nun sollen alle Aufträge an die Amerikaner gehen.“
Missmut auch in Russland, bei dem dritten mächtigen Verbündeten der Friedensachse. Dort hat Nikolaj Tokarew, der Direktor der russischen Ölfirma Zaroubenjneft, seine Verträge zur Ausbeutung irakischer Ölfelder innerlich bereits abgeschrieben. Er nennt das schwarze Gold kurz „die Kriegsbeute der Amis“.
Amerikanische Kapitalisten gegen russische Ölbarone? Deutsche Bauunternehmen gegen britische Consultants?
Jahrelang predigten Ökonomen, Manager und Politiker aller Länder, dass Nationalitäten in der Weltwirtschaft keine Rolle mehr spielten, die Globalisierung die Grenzen schleife, Kapital keine Heimat kenne und frei und ungebunden nach den lukrativsten Anlagemöglichkeiten suche – zum Wohle aller. Sie hatten ihren Marx gelernt und predigten wie er, dass „nationale Einseitigkeit und Beschränktheit mehr und mehr unmöglich“ und „Produktion und Konsumption global“ gestaltet werden. Nationale Verbundenheit, patriotische Pflicht, Vorzugsbehandlung heimischer Unternehmen, all das klang altmodisch.
Auf einmal aber ist das alte Denken wieder da.
Am klarsten formuliert Richard Perle, der ungekrönte Vordenker des amerikanischen Verteidigungsministeriums, den neuen Trend. „Warum sollten die Franzosen, die nicht zum Club gehören, zum Abendessen kommen“, ätzte er, während in Bagdad noch die Bomben fielen. Doch nicht nur der nassforsche Polemiker weckt in Europa die Angst, beim Wirtschaftswunder im Land von Tausendundeiner Nacht ausgeschlossen zu werden. Genährt wird die Furcht durch Fakten, die die amerikanische Regierung längst geschaffen hat (siehe auch Seite 20).
Bislang finanzieren die Amerikaner als Einzige den Wiederaufbau in großem Maße aus eigener Tasche: Zwei Milliarden Dollar hat der US-Kongress bereitgestellt, und die gehen nun seit Tagen in kleineren oder größeren Aufträgen vor allem an amerikanische Unternehmen. Während Europas Regierungen noch debattieren, ob sie sich überhaupt am Wiederaufbau beteiligen wollen, und die Europäische Kommission hilflos die amerikanische Vergabepraxis ob ihrer „Konformität mit den Regeln der Welthandelsorganisation“ prüft, löschen die Amerikaner bereits Ölbrände, sichern Häfen und heuern Polizisten an.
Mehr als 200 Beamte aus den verschiedenen amerikanischen Ministerien hat der pensionierte US-General Jay Garner unter sich; mit ihnen soll er die Verwaltung des Iraks möglich bald wieder zum Laufen bringen: Es geht um die Haushalts- und Finanzaufsicht, den Ausbau des Autobahnnetzes, ein funktionsfähiges Zollamt, die Verteilung der Sendefrequenzen für Telefone, das Bankensystem.
Während die Amerikaner handeln, läuft dem Rest der Welt langsam die Zeit davon. Bei einer Krisensitzung mit Vertretern des französischen Wirtschaftsministeriums Anfang April warnte Jean-Marie Aouste vom Unternehmerverband Medef, dass die französische Wirtschaft viel zu spät komme. „Beim Wiederaufbau des Kosovo waren wir bereits drei, vier Monate vor dem Ende des Konfliktes am Ort.“ Und diesmal?
Auch in Tschechien, von US-Präsident George W. Bush immer zu den „Willigen“ gezählt, mahnte der Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdik mit Blick auf den Irak: „Unsere Unternehmen schaffen es nicht, den guten tschechischen Ruf angemessen zu nutzen.“
Selbst in England hoffte die Industrie bislang vergeblich, dass sich die politische und militärische Loyalität ihrer Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten auszahlt. Inzwischen erfleht das British Consultants and Construction Bureau (BCCB), eine Dachorganisation von 300 britischen Konstruktions- und Beratungsfirmen, verzweifelt von der eigenen Regierung, „Beihilfen oder Darlehen für Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu stellen, welche britische Firmen dann ausführen können, um dem irakischen Volk langfristig zu helfen“.
Vor allem in jenen Märkten, wo Standards gesetzt werden, könnte das Rennen schon bald entschieden sein.
Beispiel Telekommunikation: Der europäische GSM-Standard wird heute von mehr als 800 Millionen Telefonkunden in 193 Ländern verwendet. Marktführer beim Bau von Geräten und Netzen sind Nokia, Ericsson, Siemens und Alcatel. Doch es besteht kein Zweifel, dass die Amerikaner mit ihrem im kommenden Herbst einsatzbereiten Standard namens DCMA 2000 aufholen wollen.
In Rumänien und Polen haben amerikanische Firmen ihre Technik, die einfacher und billiger, aber auch weniger leistungsfähig ist, bereits durchgesetzt. Wenn es nach dem kalifornischen Kongress-Abgeordneten und Industrielobbyisten Darrell Issa geht, soll die US-Norm bald die derzeitige europäische Dominanz im Nahen und Mittleren Osten brechen. Obwohl die ganze Nachbarschaft des Iraks per GSM telefoniert, fordert Industriefreund Issa: „Unsere Regierung darf keine europäischen Firmen mit dem Aufbau des irakischen Netzes beauftragen.“
Kann eine Besatzungsmacht das einfach tun? Dürfen die USA Standards setzen, möglicherweise gar langfristige Verträge vergeben und die Einkünfte selbst verwalten?
Der stellvertretende UN-Generalsekretär Shashi Tharoor gibt eine klare Antwort: „Die Besatzungsmacht hat nach der Genfer Konvention kein Recht, die Ressourcen eines Landes langfristig auszubeuten.“ Die Vereinten Nationen stehen mit dieser Interpretation des Völkerrechtes nicht allein, ihr eilen Unternehmervertreter aller Herren Länder zur Seite. „Die deutsche Wirtschaft unterstützt die Politik bei ihrer Forderung, dass der Wiederaufbau unter der Koordination der Vereinten Nationen stehen soll“, sagt Michael Rogowski, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie – natürlich von der Hoffnung getrieben, dass deutsche Firmen bei einer internationalen Verwaltung eher zum Zug kommen.
In der Pariser Zentrale des Energiekonzerns TotalFinaElf pocht man noch aus einem anderen Grund auf das Völkerrecht und eine schnelle Übergabe der Verwaltung an eine irakische Führung. „Ohne repräsentative Regierung geht langfristig nichts. Solange die nicht existiert, wird keine Gesellschaft der Welt im Irak arbeiten, auch Exxon, ChevronTexaco oder Shell nicht“, sagt der Konzernsprecher Paul Florin. Man wolle daher die eigenen Verträge auch „nicht mit einem amerikanischen General, sondern mit einer neuen irakischen Regierung“ besprechen.
Tatsächlich zählt bei Großprojekten internationales Recht. So werden in der Erdölindustrie Verträge in Milliardenhöhe mit bis zu 25 Jahren Laufzeit geschlossen. Solche Summen könne man nur investieren, wenn die Stabilität eines Landes langfristig gesichert sei, sagt Florin und mutmaßt: „Keine internationale Firma wird bereit sein, unter einem vorübergehenden US-Protektorat oder auch unter einem UN-Mandat einen Vertrag zu unterzeichnen.“
Ähnlich argumentiert Alexander Görbing von der Walter-Bau AG, einem international aktiven Bauunternehmen. „Wir brauchen Verlässlichkeit“, sagt er stellvertretend für viele Unternehmen, die Brücken, Straßen, Häfen bauen, die Förderanlagen modernisieren oder neue Ölfelder erschließen. Schließlich kann ein Investor bei Problemen nicht einfach gehen und die halbe Brücke mitnehmen.
Ob das internationale Recht tatsächlich auf dem Basar von Bagdad hilft? Vielleicht über einen Umweg: So können die Amerikaner zwar relativ unangefochten von internationalen Regeln ihr eigenes Geld im Irak durch eigene Firmen ausgeben – aber der Wiederaufbau wird sich damit kaum finanzieren lassen. 2,4 Milliarden Dollar hat Washington als Aufbauhilfe ausgewiesen – immerhin mehr als für den Balkan oder Afghanistan. Mit Sicherheit aber zu wenig Mittel für ein Land, das von Kriegen, von Diktatur und Embargo tief gezeichnet ist. Jede zusätzliche Hilfe, beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, setze aber eine völkerrechtliche Legitimation der irakischen Verwaltung voraus. „Nur auf der Basis eines neuen Mandates“, so Weltbank-Chef James Wolfensohn, könne man aktiv werden.
Die wirklich großen Summen für den Wiederaufbau sollen allerdings ganz anders erwirtschaftet werden: durch Öl.
Die Optimisten hoffen, dass schon in zwei bis drei Jahren Öl im Wert von 15 bis 20 Milliarden Dollar jährlich gefördert werden kann. Derzeit ist man davon allerdings weit entfernt, weil die Anlagen zum Teil veraltet oder verrottet und etliche durch den Krieg beschädigt sind. Allein für die Notreparaturen könnten drei Milliarden Dollar nötig sein, und auch hier hemmt die verworrene Rechtslage.
Noch verwaltet die UN mit ihrem „Oil-for-Food“ Programm die Einkünfte. Konservative US-Politiker würden die Quellen gerne privatisieren – und mit einem Teil der Erlöse die Besatzungskosten decken. Das aber würde weltweit zu einem politischen Aufschrei führen, zudem hat die Bush-Regierung den Irakern ihre Ölmilliarden versprochen.
Auf 78 Milliarden Barrel schätzt die Internationale Energieagentur die Ölreserven des Landes, von 112 Milliarden geht das angesehene Oil and Gas Journal aus. Bis dieser Reichtum allerdings dem Land zugute kommt, wird noch viel Zeit vergehen, weil es ihm schlicht an Aufnahmefähigkeit fehlt.
„Wie ist es um die irakische Wirtschaft bestellt?“, fragt das Washingtoner Council on Foreign Relations und gibt sich selbst die knappe Antwort: „Entsetzlich.“ Die wichtigsten Industrien, von der Ölförderung bis zur Textilherstellung, seien in der Hand der Regierung und ineffizient, so seine Studie The Day After. Allein der zivile Staatsapparat hält jeden fünften Beschäftigten in Arbeit und Brot, mehr als vierzig Prozent der Haushalte hängen am Tropf des Regimes, rechnete das Atlantic Council im Januar vor. Die Weltbank schätzt das Pro-Kopf-Einkommen auf 1200 Dollar, kaum ein Drittel dessen, was ein Iraker vor zwanzig Jahren nach Hause trug.
Genaueres über den Zustand der Ökonomie im Zweistromland werden westliche Fachleute frühestens in einigen Monaten wissen. „Wir haben keinerlei Vorstellung, was wir an ökonomischen Daten vorfinden werden“, sagt Weltbank-Vize Jean Louis Sarbib. Kein Wunder in einem Land voller Staatsgeheimnisse, dessen letztes Budget 1978, dessen letzte Karte von Staats wegen 1973 veröffentlicht wurden. Der Internationale Währungsfonds setzt das Einkommen noch niedriger an, irgendwo zwischen 700 und 1200 Dollar, weniger als das Durchschnittseinkommen auf dem westlichen Balkan. Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt liefert die Weltbank lieber gar nicht, der britische Economist spricht von 26 Milliarden, das Weiße Haus taxiert es auf 59 Milliarden Dollar. Die Lebenserwartung ist auf 61 Jahre gesunken, jedes fünfte Kind ist ungenügend ernährt.
Das müsste nicht sein, lässt sich aber so schnell nicht ändern: Seit den siebziger Jahren lebt der Irak vom Öl, was dazu geführt hat, dass es zu einer massiven Abwanderung in die Städte gekommen ist. Deshalb wird kaum noch die Hälfte des kultivierbaren Bodens beackert.
Wo also anfangen? „Man kann nicht alles zur selben Zeit, die Schulden tilgen, die Kriegskosten erstatten, den Wiederaufbau bezahlen, wirtschaftliche Verbesserungen bezahlen, die Demokratisierung zum Erfolg machen. Man muss sich entscheiden. Und diese Entscheidung ist nun mal politisch“, sagt Jean-François Giannesini vom Pariser Institut français du pétrole.
Das wäre ein Grund, die Iraker schon bald selbst die Wahl treffen zu lassen – auch darüber, wie sie ihre Öleinnahmen verwenden wollen. Das meint übrigens auch das Forschungsinstitut von James Baker III., dem ehemaligen Außenminister von Präsident Bush senior. Eine Studie aus seinem Haus kommt zu dem klaren Schluss: „Man sollte unterstreichen, dass die Iraker fähig sind, über die Zukunft ihrer Ölindustrie zu entscheiden.“
Bei einem aber wollen die Amerikaner auf jeden Fall auch künftig helfen: Der Krieg sei ein Werbefeldzug für die amerikanische Rüstungsindustrie gewesen, lässt sich der pensionierte amerikanische General David Daker von der Herald Tribune zitieren. Und schon bittet das Weiße Haus in Washington den Kongress um die Genehmigung, bestimmte Lieferbeschränkungen für Rüstungsgeschäfte in den befreiten Irak aufzuheben. Aus dem Feind von eben soll ein „bevorzugter Kunde“ werden.
Mitarbeit: Thomas Fischermann, John F. Jungclaussen, Michael Mönninger,
Stefanie Müller, Frank Schulte
(c) DIE ZEIT 16.04.2003 Nr.17

Irak-wiederaufbau
Basar Bagdad
Öl, Straßen, Telefonanlagen: Regierungen und Konzerne feilschen um die größten Aufträge im Irak ? und darum, wer sie bezahlt
Von Petra Pinzler und Joachim Fritz-Vannahme
Zwei Tage, und dann war das Seminar Arabisch verstehen beim Hamburger Nah- und Mittelost-Verein der deutschen Wirtschaft ausverkauft. In London erfreuen sich die Irak-Informationsabende der Trade Partners UK ähnlicher Beliebtheit. Und in Washington kann das Forschungsinstitut CSIS dieser Tage sogar 1000 Dollar für ein Seminar verlangen, auf dem Senatoren, ehemalige Generäle und Staatssekretäre reden. Thema: Aufbau Irak – Die Herausforderung für Unternehmen.
Rund um die Welt sprießen die Hoffnungen aufs schnelle Geschäft in Bagdad. Obwohl die letzten Bomben noch nicht gefallen und die Toten nicht begraben sind, schnüren auf den Philippinen die Wanderarbeiter bereits ihr Säckchen. Kaum jemand arbeitet so billig in der Montage wie sie und versteht dabei noch Englisch.
In Minnesota träumen die Farmer davon, „die Freundschaft mit den irakischen Müllern zu erneuern“, so Alan Tracy, Präsident des amerikanischen Weizenverbandes. In Kuwait hoffen die Ölfachleute darauf, bald auch an den Quellen des ehemaligen Feindes bohren zu dürfen. Und in Spanien versucht die Regierung Aznar, ihren Unternehmen durch geheime Absprachen und eilfertige Reisen nach Washington einen Startvorteil zu sichern.
Doch wer wird wirklich das große Geschäft in Bagdad machen? Wer wird es bezahlen? Und wer wird das liefern, was die Iraker wirklich brauchen?
In Deutschland gibt man sich derzeit pessimistisch. „Bei der Vergabe der Aufträge wird sich deutlich bemerkbar machen, dass Deutschland die USA im Krieg nicht unterstützt hat“, fürchtet Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels. „Wenig zu bestellen“ hätten die Deutschen, glaubt auch VDMA-Hauptgeschäftsführer Hannes Hesse. Ähnliche Prognosen sind in Frankreich zu hören.
Von der Zeitung La Tribune befragt, fürchten zwei Drittel der Leser eine Benachteiligung der heimischen Wirtschaft. Viele denken wie der erstaunte Vertreter des Pariser Wirtschaftsministeriums: „Die Art, wie die Amerikaner ihre Unternehmen durchsetzen und dabei jene bevorzugen, die der Regierung nahe stehen, ist einfach atemberaubend.“ Oder sie reagieren verärgert wie Claude Schneider vom Bauunternehmen Case Poclin: „Wir waren seit 35 Jahren im Irak vertreten. Doch nun sollen alle Aufträge an die Amerikaner gehen.“
Missmut auch in Russland, bei dem dritten mächtigen Verbündeten der Friedensachse. Dort hat Nikolaj Tokarew, der Direktor der russischen Ölfirma Zaroubenjneft, seine Verträge zur Ausbeutung irakischer Ölfelder innerlich bereits abgeschrieben. Er nennt das schwarze Gold kurz „die Kriegsbeute der Amis“.
Amerikanische Kapitalisten gegen russische Ölbarone? Deutsche Bauunternehmen gegen britische Consultants?
Jahrelang predigten Ökonomen, Manager und Politiker aller Länder, dass Nationalitäten in der Weltwirtschaft keine Rolle mehr spielten, die Globalisierung die Grenzen schleife, Kapital keine Heimat kenne und frei und ungebunden nach den lukrativsten Anlagemöglichkeiten suche – zum Wohle aller. Sie hatten ihren Marx gelernt und predigten wie er, dass „nationale Einseitigkeit und Beschränktheit mehr und mehr unmöglich“ und „Produktion und Konsumption global“ gestaltet werden. Nationale Verbundenheit, patriotische Pflicht, Vorzugsbehandlung heimischer Unternehmen, all das klang altmodisch.
Auf einmal aber ist das alte Denken wieder da.
Am klarsten formuliert Richard Perle, der ungekrönte Vordenker des amerikanischen Verteidigungsministeriums, den neuen Trend. „Warum sollten die Franzosen, die nicht zum Club gehören, zum Abendessen kommen“, ätzte er, während in Bagdad noch die Bomben fielen. Doch nicht nur der nassforsche Polemiker weckt in Europa die Angst, beim Wirtschaftswunder im Land von Tausendundeiner Nacht ausgeschlossen zu werden. Genährt wird die Furcht durch Fakten, die die amerikanische Regierung längst geschaffen hat (siehe auch Seite 20).
Bislang finanzieren die Amerikaner als Einzige den Wiederaufbau in großem Maße aus eigener Tasche: Zwei Milliarden Dollar hat der US-Kongress bereitgestellt, und die gehen nun seit Tagen in kleineren oder größeren Aufträgen vor allem an amerikanische Unternehmen. Während Europas Regierungen noch debattieren, ob sie sich überhaupt am Wiederaufbau beteiligen wollen, und die Europäische Kommission hilflos die amerikanische Vergabepraxis ob ihrer „Konformität mit den Regeln der Welthandelsorganisation“ prüft, löschen die Amerikaner bereits Ölbrände, sichern Häfen und heuern Polizisten an.
Mehr als 200 Beamte aus den verschiedenen amerikanischen Ministerien hat der pensionierte US-General Jay Garner unter sich; mit ihnen soll er die Verwaltung des Iraks möglich bald wieder zum Laufen bringen: Es geht um die Haushalts- und Finanzaufsicht, den Ausbau des Autobahnnetzes, ein funktionsfähiges Zollamt, die Verteilung der Sendefrequenzen für Telefone, das Bankensystem.
Während die Amerikaner handeln, läuft dem Rest der Welt langsam die Zeit davon. Bei einer Krisensitzung mit Vertretern des französischen Wirtschaftsministeriums Anfang April warnte Jean-Marie Aouste vom Unternehmerverband Medef, dass die französische Wirtschaft viel zu spät komme. „Beim Wiederaufbau des Kosovo waren wir bereits drei, vier Monate vor dem Ende des Konfliktes am Ort.“ Und diesmal?
Auch in Tschechien, von US-Präsident George W. Bush immer zu den „Willigen“ gezählt, mahnte der Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdik mit Blick auf den Irak: „Unsere Unternehmen schaffen es nicht, den guten tschechischen Ruf angemessen zu nutzen.“
Selbst in England hoffte die Industrie bislang vergeblich, dass sich die politische und militärische Loyalität ihrer Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten auszahlt. Inzwischen erfleht das British Consultants and Construction Bureau (BCCB), eine Dachorganisation von 300 britischen Konstruktions- und Beratungsfirmen, verzweifelt von der eigenen Regierung, „Beihilfen oder Darlehen für Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu stellen, welche britische Firmen dann ausführen können, um dem irakischen Volk langfristig zu helfen“.
Vor allem in jenen Märkten, wo Standards gesetzt werden, könnte das Rennen schon bald entschieden sein.
Beispiel Telekommunikation: Der europäische GSM-Standard wird heute von mehr als 800 Millionen Telefonkunden in 193 Ländern verwendet. Marktführer beim Bau von Geräten und Netzen sind Nokia, Ericsson, Siemens und Alcatel. Doch es besteht kein Zweifel, dass die Amerikaner mit ihrem im kommenden Herbst einsatzbereiten Standard namens DCMA 2000 aufholen wollen.
In Rumänien und Polen haben amerikanische Firmen ihre Technik, die einfacher und billiger, aber auch weniger leistungsfähig ist, bereits durchgesetzt. Wenn es nach dem kalifornischen Kongress-Abgeordneten und Industrielobbyisten Darrell Issa geht, soll die US-Norm bald die derzeitige europäische Dominanz im Nahen und Mittleren Osten brechen. Obwohl die ganze Nachbarschaft des Iraks per GSM telefoniert, fordert Industriefreund Issa: „Unsere Regierung darf keine europäischen Firmen mit dem Aufbau des irakischen Netzes beauftragen.“
Kann eine Besatzungsmacht das einfach tun? Dürfen die USA Standards setzen, möglicherweise gar langfristige Verträge vergeben und die Einkünfte selbst verwalten?
Der stellvertretende UN-Generalsekretär Shashi Tharoor gibt eine klare Antwort: „Die Besatzungsmacht hat nach der Genfer Konvention kein Recht, die Ressourcen eines Landes langfristig auszubeuten.“ Die Vereinten Nationen stehen mit dieser Interpretation des Völkerrechtes nicht allein, ihr eilen Unternehmervertreter aller Herren Länder zur Seite. „Die deutsche Wirtschaft unterstützt die Politik bei ihrer Forderung, dass der Wiederaufbau unter der Koordination der Vereinten Nationen stehen soll“, sagt Michael Rogowski, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie – natürlich von der Hoffnung getrieben, dass deutsche Firmen bei einer internationalen Verwaltung eher zum Zug kommen.
In der Pariser Zentrale des Energiekonzerns TotalFinaElf pocht man noch aus einem anderen Grund auf das Völkerrecht und eine schnelle Übergabe der Verwaltung an eine irakische Führung. „Ohne repräsentative Regierung geht langfristig nichts. Solange die nicht existiert, wird keine Gesellschaft der Welt im Irak arbeiten, auch Exxon, ChevronTexaco oder Shell nicht“, sagt der Konzernsprecher Paul Florin. Man wolle daher die eigenen Verträge auch „nicht mit einem amerikanischen General, sondern mit einer neuen irakischen Regierung“ besprechen.
Tatsächlich zählt bei Großprojekten internationales Recht. So werden in der Erdölindustrie Verträge in Milliardenhöhe mit bis zu 25 Jahren Laufzeit geschlossen. Solche Summen könne man nur investieren, wenn die Stabilität eines Landes langfristig gesichert sei, sagt Florin und mutmaßt: „Keine internationale Firma wird bereit sein, unter einem vorübergehenden US-Protektorat oder auch unter einem UN-Mandat einen Vertrag zu unterzeichnen.“
Ähnlich argumentiert Alexander Görbing von der Walter-Bau AG, einem international aktiven Bauunternehmen. „Wir brauchen Verlässlichkeit“, sagt er stellvertretend für viele Unternehmen, die Brücken, Straßen, Häfen bauen, die Förderanlagen modernisieren oder neue Ölfelder erschließen. Schließlich kann ein Investor bei Problemen nicht einfach gehen und die halbe Brücke mitnehmen.
Ob das internationale Recht tatsächlich auf dem Basar von Bagdad hilft? Vielleicht über einen Umweg: So können die Amerikaner zwar relativ unangefochten von internationalen Regeln ihr eigenes Geld im Irak durch eigene Firmen ausgeben – aber der Wiederaufbau wird sich damit kaum finanzieren lassen. 2,4 Milliarden Dollar hat Washington als Aufbauhilfe ausgewiesen – immerhin mehr als für den Balkan oder Afghanistan. Mit Sicherheit aber zu wenig Mittel für ein Land, das von Kriegen, von Diktatur und Embargo tief gezeichnet ist. Jede zusätzliche Hilfe, beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, setze aber eine völkerrechtliche Legitimation der irakischen Verwaltung voraus. „Nur auf der Basis eines neuen Mandates“, so Weltbank-Chef James Wolfensohn, könne man aktiv werden.
Die wirklich großen Summen für den Wiederaufbau sollen allerdings ganz anders erwirtschaftet werden: durch Öl.
Die Optimisten hoffen, dass schon in zwei bis drei Jahren Öl im Wert von 15 bis 20 Milliarden Dollar jährlich gefördert werden kann. Derzeit ist man davon allerdings weit entfernt, weil die Anlagen zum Teil veraltet oder verrottet und etliche durch den Krieg beschädigt sind. Allein für die Notreparaturen könnten drei Milliarden Dollar nötig sein, und auch hier hemmt die verworrene Rechtslage.
Noch verwaltet die UN mit ihrem „Oil-for-Food“ Programm die Einkünfte. Konservative US-Politiker würden die Quellen gerne privatisieren – und mit einem Teil der Erlöse die Besatzungskosten decken. Das aber würde weltweit zu einem politischen Aufschrei führen, zudem hat die Bush-Regierung den Irakern ihre Ölmilliarden versprochen.
Auf 78 Milliarden Barrel schätzt die Internationale Energieagentur die Ölreserven des Landes, von 112 Milliarden geht das angesehene Oil and Gas Journal aus. Bis dieser Reichtum allerdings dem Land zugute kommt, wird noch viel Zeit vergehen, weil es ihm schlicht an Aufnahmefähigkeit fehlt.
„Wie ist es um die irakische Wirtschaft bestellt?“, fragt das Washingtoner Council on Foreign Relations und gibt sich selbst die knappe Antwort: „Entsetzlich.“ Die wichtigsten Industrien, von der Ölförderung bis zur Textilherstellung, seien in der Hand der Regierung und ineffizient, so seine Studie The Day After. Allein der zivile Staatsapparat hält jeden fünften Beschäftigten in Arbeit und Brot, mehr als vierzig Prozent der Haushalte hängen am Tropf des Regimes, rechnete das Atlantic Council im Januar vor. Die Weltbank schätzt das Pro-Kopf-Einkommen auf 1200 Dollar, kaum ein Drittel dessen, was ein Iraker vor zwanzig Jahren nach Hause trug.
Genaueres über den Zustand der Ökonomie im Zweistromland werden westliche Fachleute frühestens in einigen Monaten wissen. „Wir haben keinerlei Vorstellung, was wir an ökonomischen Daten vorfinden werden“, sagt Weltbank-Vize Jean Louis Sarbib. Kein Wunder in einem Land voller Staatsgeheimnisse, dessen letztes Budget 1978, dessen letzte Karte von Staats wegen 1973 veröffentlicht wurden. Der Internationale Währungsfonds setzt das Einkommen noch niedriger an, irgendwo zwischen 700 und 1200 Dollar, weniger als das Durchschnittseinkommen auf dem westlichen Balkan. Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt liefert die Weltbank lieber gar nicht, der britische Economist spricht von 26 Milliarden, das Weiße Haus taxiert es auf 59 Milliarden Dollar. Die Lebenserwartung ist auf 61 Jahre gesunken, jedes fünfte Kind ist ungenügend ernährt.
Das müsste nicht sein, lässt sich aber so schnell nicht ändern: Seit den siebziger Jahren lebt der Irak vom Öl, was dazu geführt hat, dass es zu einer massiven Abwanderung in die Städte gekommen ist. Deshalb wird kaum noch die Hälfte des kultivierbaren Bodens beackert.
Wo also anfangen? „Man kann nicht alles zur selben Zeit, die Schulden tilgen, die Kriegskosten erstatten, den Wiederaufbau bezahlen, wirtschaftliche Verbesserungen bezahlen, die Demokratisierung zum Erfolg machen. Man muss sich entscheiden. Und diese Entscheidung ist nun mal politisch“, sagt Jean-François Giannesini vom Pariser Institut français du pétrole.
Das wäre ein Grund, die Iraker schon bald selbst die Wahl treffen zu lassen – auch darüber, wie sie ihre Öleinnahmen verwenden wollen. Das meint übrigens auch das Forschungsinstitut von James Baker III., dem ehemaligen Außenminister von Präsident Bush senior. Eine Studie aus seinem Haus kommt zu dem klaren Schluss: „Man sollte unterstreichen, dass die Iraker fähig sind, über die Zukunft ihrer Ölindustrie zu entscheiden.“
Bei einem aber wollen die Amerikaner auf jeden Fall auch künftig helfen: Der Krieg sei ein Werbefeldzug für die amerikanische Rüstungsindustrie gewesen, lässt sich der pensionierte amerikanische General David Daker von der Herald Tribune zitieren. Und schon bittet das Weiße Haus in Washington den Kongress um die Genehmigung, bestimmte Lieferbeschränkungen für Rüstungsgeschäfte in den befreiten Irak aufzuheben. Aus dem Feind von eben soll ein „bevorzugter Kunde“ werden.
Mitarbeit: Thomas Fischermann, John F. Jungclaussen, Michael Mönninger,
Stefanie Müller, Frank Schulte
(c) DIE ZEIT 16.04.2003 Nr.17

http://www.zeit.de/2003/17/page_01_Leit__1
Demokratisierung
Moral unter Waffen
Der Irak als Testfall für Amerikas neue demokratische Erlösungspolitik
Von Jan Ross
Am Sonntag wird der Papst auf dem Petersplatz in Rom die Osterbotschaft verkündigen, das Evangelium der Zuversicht. Er muss zugleich einer Niederlage ins Auge blicken. Johannes PaulII. war der ehrwürdigste Gegner des Feldzugs im Irak, und er konnte ihn nicht verhindern. Nach einem Religionskrieg und einem Kampf der Kulturen, wie vom Papst befürchtet, sieht es im Nahen Osten vorerst nicht aus. Aber liegt nicht doch etwas davon in der Luft? Mit nachgerade messianischem Eifer und Erlösungspathos scheinen sich George W. Bushs Vereinigte Staaten zur Neuordnung der Welt anzuschicken. Muss das Angst machen, vor allem Angst, womöglich nur Angst? Oder gibt es Grund zur Zuversicht? Johannes PaulII. ist tief misstrauisch gegen den Materialismus einer amerikanisierten Zivilisation. Doch jetzt geht es um Amerikas Idealismus, um seinen Glauben und sein Sendungsbewusstsein, die Sorge oder Hoffnung beflügeln mögen, man weiß es nicht recht. Da sind wir gespalten, untereinander und jeder für sich, und daher die bange Spannung des historischen Moments.
Das moralische Geschütz, das Amerikaner und Briten im Vorfeld und während des Kampfes aufgefahren haben, war schwer: Gut gegen Böse, Freiheit gegen Tyrannei. Weil im Irak bisher keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden, hat das Befreiungsmotiv an Gewicht sogar noch gewonnen. Die Legitimität des Feldzugs ruht einstweilen auf den Bildern von fallenden Saddam-Statuen und zerrissenen Herrscherporträts. Und was eben noch als Fantasterei neokonservativer Ideologen gelten konnte, die Vision eines demokratisierten Iraks mit Ausstrahlung in die gesamte arabische und muslimische Welt, das wird eine skeptische globale Öffentlichkeit jetzt ernst nehmen und zum Maßstab für Recht und Erfolg des amerikanischen Eingreifens machen. Dies war kein den Vereinigten Staaten aufgezwungener, sondern ein gewollter und gewählter Krieg. Umso genauer wird man hinsehen, ob die Prinzipien einer solchen Politik mehr als Rhetorik sind und ob ihre Verheißungen in Erfüllung gehen.
Interessenpolitik mit Idealen
Der hohe Anspruch der Supermacht löst vielerorts Befremden, wenn nicht Entsetzen aus. Da ist der Zweifel an der Reinheit der Motive, der Vorwurf der Heuchelei: In Wahrheit gehe es nicht um Freiheit und Menschenrechte, sondern ums Öl, um geostrategische Positionen, um die Weltherrschaft. Es wäre bizarr, die Rolle des nationalen Interesses und der imperialen Ambition in der Politik der Vereinigten Staaten zu leugnen. Der Irak-Krieg ist eine massive Machtdemonstration, eine Einschüchterungsgeste, die Wohlverhalten erzwingen soll, von Damaskus bis Pjöngjang. Aber schwerlich würde sich Amerika zu solchen Kraftakten aufgerufen und imstande sehen, wenn es nicht im Kern vom Wert seiner Sache und von der Universalität seiner Mission überzeugt wäre, davon, dass seine Ideale echt und allgemein gültig sind.
Das aber irritiert und erschreckt vielleicht noch mehr als der Verdacht der Verlogenheit. Wenn Bush und Blair wirklich meinen, was sie sagen, wenn es ihnen nicht ums Öl geht, sondern um das Gute – ist das dann nicht noch viel abenteuerlicher und gefährlicher? Das „alte Europa“, mit seinen leeren Kirchen, seiner Geschichte von Glaubenskriegen und seiner frischen Erinnerung an ein halbes Jahrhundert Ideologiekonflikt, will von militantem Überzeugungstätertum nichts wissen. Schwarzweiß-Denken, Fundamentalismus, Kreuzritterei – die Formeln sind allgegenwärtig, in denen sich die Angst vor einer moralisch überhitzten, fanatisierten Politik ausspricht.
Schreckliche Bekenntniskriege
Nicht nur von Bush und den Seinen, auch von liberalen amerikanischen Intellektuellen ist zu hören, der radikale Islamismus mit seinem Terrorpotenzial sei die dritte totalitäre Herausforderung der Moderne, der Nachfolger von Faschismus und Kommunismus als Todfeind des Westens. Gerade so aber, als Entscheidungsschlacht zwischen Licht und Finsternis, als Weltgegensatz mit dem Zwang zur Parteinahme wollen die meisten Europäer und wohl überhaupt die Mehrheit der Zeitgenossen die Szenerie des beginnenden 21. Jahrhunderts um keinen Preis angelegt und gedeutet wissen.
Die Aversion gegen allzu viel Glaubensstärke in der Politik ist nicht unbegründet. Nichts kann so sehr enthemmen wie ein reines Gewissen, und in der Regel waren jene Kriege besonders blutig und ausweglos, die um Bekenntnisse geführt wurden. Es ist kein Zufall, dass der Widerstand gegen die neuen amerikanischen Weltverbesserungsideen sich um den Begriff des Völkerrechts und in seinem Namen formiert. Die Moral ist nicht an sich schon das Gute; das Recht ist auch ein Gut. Seine Spielregeln können frustrierend sein – für den Mächtigen, der sich von Papier- und Formelkram gefesselt findet, aber auch für den, der die Gerechtigkeit auf seiner Seite sieht und sich um ihren glatten Vollzug betrogen fühlt. Die Vereinigten Staaten sind beides, mächtig und von ihrer Sache überzeugt, und so ist die Versuchung besonders groß, das lästige Prozeduralwesen beiseite zu schieben und zur Selbstjustiz zu schreiten. Doch ein bedenklicher Weg bleibt es. Nicht so sehr, wie es oft heißt, weil weniger respektable Länder und Regime sich daran ein schlechtes Beispiel nehmen könnten. Die Störenfriede der internationalen Ordnung werden schwerlich vom Völkerrecht im Zaum gehalten, sondern von der Drohung handfester Sanktionen, notfalls mit Gewalt. Es ist schon Amerika selbst, um das es hier geht, und das Risiko des Durchdrehens im Hochgefühl von innerer und äußerer Überlegenheit.
George W. Bushs Umtriebe
Trotzdem wird einem beim verbreiteten Selbstlob der europäischen Rechtskultur als Gegenmodell zur US-Draufgängerei nicht recht wohl. Es liegt etwas missgünstig Unproduktives darin, die Verhinderungsfreude der Antriebslosen, eine seltsame Mixtur von illusionärer Paragrafenfrömmigkeit und ungerührter Realpolitik. Hinter dem Völkerrecht, den Vereinten Nationen und den Tugenden des Multilateralismus kann trefflich Deckung nehmen, wer in Wahrheit vor allem einmal den Amerikanern ordentlich eins auswischen will. Der Rückfall in eine kalte Staatsräson ist die eine Gefahr bei der Abwehr von George W. Bushs revolutionären Umtrieben. Die andere ist die Flucht in ein Wolkenkuckucksheim internationaler Verständigungsbürokratie, als sei das Schicksal des Erdballs bei Kofi Annan bereits in festen und sicheren Händen.
Es wird sich jedoch eine rechtliche Weltordnung nicht herausbilden lassen ohne die Ressourcen an Überzeugungsglauben und Durchsetzungskraft, über die derzeit allein die Vereinigten Staaten gebieten. Eine Supermacht mit moralischem Anspruch ist keine Garantie für das Gute, aber ein Potenzial zum Guten ist sie und wenn noch nicht Grund zur Zuversicht, dann immerhin Anlass zur Hoffnung. Schon wahr, dass Macht und Moral der Bändigung bedürfen, doch erst einmal muss etwas zum Bändigen da sein. Man kann das anerkennen, ohne deswegen den Amerikanern politische Blankoschecks auszustellen. Tony Blair macht es alle Tage vor. Womöglich wäre sein Erfolg mit etwas mehr Unterstützung noch ein bisschen größer. Wenn er das nächste Mal den Papst besucht, sollten die beiden vielleicht darüber sprechen.
(c) DIE ZEIT 17/2003
Demokratisierung
Moral unter Waffen
Der Irak als Testfall für Amerikas neue demokratische Erlösungspolitik
Von Jan Ross
Am Sonntag wird der Papst auf dem Petersplatz in Rom die Osterbotschaft verkündigen, das Evangelium der Zuversicht. Er muss zugleich einer Niederlage ins Auge blicken. Johannes PaulII. war der ehrwürdigste Gegner des Feldzugs im Irak, und er konnte ihn nicht verhindern. Nach einem Religionskrieg und einem Kampf der Kulturen, wie vom Papst befürchtet, sieht es im Nahen Osten vorerst nicht aus. Aber liegt nicht doch etwas davon in der Luft? Mit nachgerade messianischem Eifer und Erlösungspathos scheinen sich George W. Bushs Vereinigte Staaten zur Neuordnung der Welt anzuschicken. Muss das Angst machen, vor allem Angst, womöglich nur Angst? Oder gibt es Grund zur Zuversicht? Johannes PaulII. ist tief misstrauisch gegen den Materialismus einer amerikanisierten Zivilisation. Doch jetzt geht es um Amerikas Idealismus, um seinen Glauben und sein Sendungsbewusstsein, die Sorge oder Hoffnung beflügeln mögen, man weiß es nicht recht. Da sind wir gespalten, untereinander und jeder für sich, und daher die bange Spannung des historischen Moments.
Das moralische Geschütz, das Amerikaner und Briten im Vorfeld und während des Kampfes aufgefahren haben, war schwer: Gut gegen Böse, Freiheit gegen Tyrannei. Weil im Irak bisher keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden, hat das Befreiungsmotiv an Gewicht sogar noch gewonnen. Die Legitimität des Feldzugs ruht einstweilen auf den Bildern von fallenden Saddam-Statuen und zerrissenen Herrscherporträts. Und was eben noch als Fantasterei neokonservativer Ideologen gelten konnte, die Vision eines demokratisierten Iraks mit Ausstrahlung in die gesamte arabische und muslimische Welt, das wird eine skeptische globale Öffentlichkeit jetzt ernst nehmen und zum Maßstab für Recht und Erfolg des amerikanischen Eingreifens machen. Dies war kein den Vereinigten Staaten aufgezwungener, sondern ein gewollter und gewählter Krieg. Umso genauer wird man hinsehen, ob die Prinzipien einer solchen Politik mehr als Rhetorik sind und ob ihre Verheißungen in Erfüllung gehen.
Interessenpolitik mit Idealen
Der hohe Anspruch der Supermacht löst vielerorts Befremden, wenn nicht Entsetzen aus. Da ist der Zweifel an der Reinheit der Motive, der Vorwurf der Heuchelei: In Wahrheit gehe es nicht um Freiheit und Menschenrechte, sondern ums Öl, um geostrategische Positionen, um die Weltherrschaft. Es wäre bizarr, die Rolle des nationalen Interesses und der imperialen Ambition in der Politik der Vereinigten Staaten zu leugnen. Der Irak-Krieg ist eine massive Machtdemonstration, eine Einschüchterungsgeste, die Wohlverhalten erzwingen soll, von Damaskus bis Pjöngjang. Aber schwerlich würde sich Amerika zu solchen Kraftakten aufgerufen und imstande sehen, wenn es nicht im Kern vom Wert seiner Sache und von der Universalität seiner Mission überzeugt wäre, davon, dass seine Ideale echt und allgemein gültig sind.
Das aber irritiert und erschreckt vielleicht noch mehr als der Verdacht der Verlogenheit. Wenn Bush und Blair wirklich meinen, was sie sagen, wenn es ihnen nicht ums Öl geht, sondern um das Gute – ist das dann nicht noch viel abenteuerlicher und gefährlicher? Das „alte Europa“, mit seinen leeren Kirchen, seiner Geschichte von Glaubenskriegen und seiner frischen Erinnerung an ein halbes Jahrhundert Ideologiekonflikt, will von militantem Überzeugungstätertum nichts wissen. Schwarzweiß-Denken, Fundamentalismus, Kreuzritterei – die Formeln sind allgegenwärtig, in denen sich die Angst vor einer moralisch überhitzten, fanatisierten Politik ausspricht.
Schreckliche Bekenntniskriege
Nicht nur von Bush und den Seinen, auch von liberalen amerikanischen Intellektuellen ist zu hören, der radikale Islamismus mit seinem Terrorpotenzial sei die dritte totalitäre Herausforderung der Moderne, der Nachfolger von Faschismus und Kommunismus als Todfeind des Westens. Gerade so aber, als Entscheidungsschlacht zwischen Licht und Finsternis, als Weltgegensatz mit dem Zwang zur Parteinahme wollen die meisten Europäer und wohl überhaupt die Mehrheit der Zeitgenossen die Szenerie des beginnenden 21. Jahrhunderts um keinen Preis angelegt und gedeutet wissen.
Die Aversion gegen allzu viel Glaubensstärke in der Politik ist nicht unbegründet. Nichts kann so sehr enthemmen wie ein reines Gewissen, und in der Regel waren jene Kriege besonders blutig und ausweglos, die um Bekenntnisse geführt wurden. Es ist kein Zufall, dass der Widerstand gegen die neuen amerikanischen Weltverbesserungsideen sich um den Begriff des Völkerrechts und in seinem Namen formiert. Die Moral ist nicht an sich schon das Gute; das Recht ist auch ein Gut. Seine Spielregeln können frustrierend sein – für den Mächtigen, der sich von Papier- und Formelkram gefesselt findet, aber auch für den, der die Gerechtigkeit auf seiner Seite sieht und sich um ihren glatten Vollzug betrogen fühlt. Die Vereinigten Staaten sind beides, mächtig und von ihrer Sache überzeugt, und so ist die Versuchung besonders groß, das lästige Prozeduralwesen beiseite zu schieben und zur Selbstjustiz zu schreiten. Doch ein bedenklicher Weg bleibt es. Nicht so sehr, wie es oft heißt, weil weniger respektable Länder und Regime sich daran ein schlechtes Beispiel nehmen könnten. Die Störenfriede der internationalen Ordnung werden schwerlich vom Völkerrecht im Zaum gehalten, sondern von der Drohung handfester Sanktionen, notfalls mit Gewalt. Es ist schon Amerika selbst, um das es hier geht, und das Risiko des Durchdrehens im Hochgefühl von innerer und äußerer Überlegenheit.
George W. Bushs Umtriebe
Trotzdem wird einem beim verbreiteten Selbstlob der europäischen Rechtskultur als Gegenmodell zur US-Draufgängerei nicht recht wohl. Es liegt etwas missgünstig Unproduktives darin, die Verhinderungsfreude der Antriebslosen, eine seltsame Mixtur von illusionärer Paragrafenfrömmigkeit und ungerührter Realpolitik. Hinter dem Völkerrecht, den Vereinten Nationen und den Tugenden des Multilateralismus kann trefflich Deckung nehmen, wer in Wahrheit vor allem einmal den Amerikanern ordentlich eins auswischen will. Der Rückfall in eine kalte Staatsräson ist die eine Gefahr bei der Abwehr von George W. Bushs revolutionären Umtrieben. Die andere ist die Flucht in ein Wolkenkuckucksheim internationaler Verständigungsbürokratie, als sei das Schicksal des Erdballs bei Kofi Annan bereits in festen und sicheren Händen.
Es wird sich jedoch eine rechtliche Weltordnung nicht herausbilden lassen ohne die Ressourcen an Überzeugungsglauben und Durchsetzungskraft, über die derzeit allein die Vereinigten Staaten gebieten. Eine Supermacht mit moralischem Anspruch ist keine Garantie für das Gute, aber ein Potenzial zum Guten ist sie und wenn noch nicht Grund zur Zuversicht, dann immerhin Anlass zur Hoffnung. Schon wahr, dass Macht und Moral der Bändigung bedürfen, doch erst einmal muss etwas zum Bändigen da sein. Man kann das anerkennen, ohne deswegen den Amerikanern politische Blankoschecks auszustellen. Tony Blair macht es alle Tage vor. Womöglich wäre sein Erfolg mit etwas mehr Unterstützung noch ein bisschen größer. Wenn er das nächste Mal den Papst besucht, sollten die beiden vielleicht darüber sprechen.
(c) DIE ZEIT 17/2003
moin dolby 
bei germa um 21 uhr 15 der letze eintrag.
bei stock schlafen einem auch nur noch die füße ein.
liegt wohl an dem japan gefasel.
N 9

bei germa um 21 uhr 15 der letze eintrag.

bei stock schlafen einem auch nur noch die füße ein.
liegt wohl an dem japan gefasel.

N 9

@dolby
na ja, germanasti hat sich mit sich selbst und 2 lemmungen
noch bis 23 uhr xx unterhalten.
da kam vieeel info rüber!!! :laugh
hier gibt es leider keine editieren taste.
gebe mir auf stock ne neue id. und meinem computer ne
neue erkennungsnummer.
die haben meinen computer gesperrt.
aurum
bis zur nächsten sperrung!
na ja, germanasti hat sich mit sich selbst und 2 lemmungen
noch bis 23 uhr xx unterhalten.
da kam vieeel info rüber!!! :laugh
hier gibt es leider keine editieren taste.

gebe mir auf stock ne neue id. und meinem computer ne
neue erkennungsnummer.
die haben meinen computer gesperrt.

aurum

bis zur nächsten sperrung!

Zum Papst:
Denkt ihr demnächst wird ein kath. Priester exkommuniziert,
weil er mit Protestanten das gemeinsame Abendmahl feiert?
Darf der Priester aber nicht. Denn bei den Protestanten gilt
es nur als Symbol,
während bei Katholiken aus Wein das Blut Christi und
aus der Hostie der echte, reale Leib Christi wird.
Aaaaaa, solange die Religionen nicht von solchem Wahn
wegkommen und sich den Werten zuwenden, sehe ich schlimm
für die Menschheit. Religionen, die zerimoniellen Wahn
höher stellen, als alle Werte, müssen doch zwansläufig
immer wieder Bush´s und Inquisis hervorbringen.
mfg
thefarmer
Denkt ihr demnächst wird ein kath. Priester exkommuniziert,
weil er mit Protestanten das gemeinsame Abendmahl feiert?
Darf der Priester aber nicht. Denn bei den Protestanten gilt
es nur als Symbol,
während bei Katholiken aus Wein das Blut Christi und
aus der Hostie der echte, reale Leib Christi wird.
Aaaaaa, solange die Religionen nicht von solchem Wahn
wegkommen und sich den Werten zuwenden, sehe ich schlimm
für die Menschheit. Religionen, die zerimoniellen Wahn
höher stellen, als alle Werte, müssen doch zwansläufig
immer wieder Bush´s und Inquisis hervorbringen.
mfg
thefarmer
sorry optim 
hab den thread hier total vergessen!
das ist aber auch ein ärger mit deinem computer

hab den thread hier total vergessen!
das ist aber auch ein ärger mit deinem computer

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,245591,00.html
AFFÄRE
Britischer Kriegsgegner Galloway von Saddam bezahlt?
Der britische Parlamentarier George Galloway war einer der schärfsten Gegner des Kriegskurses von Großbritanniens Premier Tony Blair. Nun sind in Bagdad Dokumente aufgetaucht, die nahelegen, dass der Mann von Saddam Hussein geschmiert wurde. Der Politiker vom linken Labour-Flügel bestreitet dies vehement.
London - Galloway habe vom Regime Saddam Husseins jährlich mindestens umgerechnet 563.000 Euro aus dem "Öl für Lebensmittel"-Programm der Uno bekommen, berichtet der "Daily Telegraph". Reporter der Zeitung hätten irakische Geheimdienstdokumente im ausgeplünderten Außenministerium in Bagdad gefunden. Der Chef des irakischen Geheimdienstes habe im Jahr 2000 einen Brief an Saddam geschrieben, aus dem hervorgehe, dass Galloway das Geld aus Einnahmen des Programms der Vereinten Nationen erhielt. Der "Daily Telegraph" druckte die gefundenen Dokumente in seiner Dienstagausgabe ab. Galloway sei eine Partnerschaft mit einem irakischen Ölhändler eingegangen, um das Öl auf dem internationalen Markt zu verkaufen.
Galloway, bekannt für seinen Einsatz gegen einen Krieg und die Sanktionen gegen den Irak, nannte die Vorwürfe in einem Interview mit dem britischen Rundfunksender BBC "verleumderisch" und kündigte rechtliche Schritte gegen die Zeitung an. "Ich habe den Irak weder um Geld gebeten noch Geld von ihm für unsere Kampagne gegen den Krieg und die Sanktionen erhalten", sagte der schottische Parlamentarier: "Ich habe niemals ein Barrel Öl gesehen, niemals eines besessen, gekauft oder verkauft."
Galloway sprach von einer "Schmierenkampagne gegen diejenigen, die sich gegen den illegalen und blutigen Krieg im Irak und gegen die Besetzung durch ausländische Truppen engagiert haben". Er habe niemals Kontakte zu Mitgliedern des irakischen Geheimdienstes gehabt, wie dies in dem Zeitungsbericht behauptet werde. Er habe über die Jahre lediglich Mitglieder der politischen Führung des Landes getroffen. Die von der Zeitung vorgelegten Dokumente seien gefälscht oder manipuliert worden, um ihn zu diskreditieren, sagte der Abgeordnete.

AFFÄRE
Britischer Kriegsgegner Galloway von Saddam bezahlt?
Der britische Parlamentarier George Galloway war einer der schärfsten Gegner des Kriegskurses von Großbritanniens Premier Tony Blair. Nun sind in Bagdad Dokumente aufgetaucht, die nahelegen, dass der Mann von Saddam Hussein geschmiert wurde. Der Politiker vom linken Labour-Flügel bestreitet dies vehement.
London - Galloway habe vom Regime Saddam Husseins jährlich mindestens umgerechnet 563.000 Euro aus dem "Öl für Lebensmittel"-Programm der Uno bekommen, berichtet der "Daily Telegraph". Reporter der Zeitung hätten irakische Geheimdienstdokumente im ausgeplünderten Außenministerium in Bagdad gefunden. Der Chef des irakischen Geheimdienstes habe im Jahr 2000 einen Brief an Saddam geschrieben, aus dem hervorgehe, dass Galloway das Geld aus Einnahmen des Programms der Vereinten Nationen erhielt. Der "Daily Telegraph" druckte die gefundenen Dokumente in seiner Dienstagausgabe ab. Galloway sei eine Partnerschaft mit einem irakischen Ölhändler eingegangen, um das Öl auf dem internationalen Markt zu verkaufen.
Galloway, bekannt für seinen Einsatz gegen einen Krieg und die Sanktionen gegen den Irak, nannte die Vorwürfe in einem Interview mit dem britischen Rundfunksender BBC "verleumderisch" und kündigte rechtliche Schritte gegen die Zeitung an. "Ich habe den Irak weder um Geld gebeten noch Geld von ihm für unsere Kampagne gegen den Krieg und die Sanktionen erhalten", sagte der schottische Parlamentarier: "Ich habe niemals ein Barrel Öl gesehen, niemals eines besessen, gekauft oder verkauft."
Galloway sprach von einer "Schmierenkampagne gegen diejenigen, die sich gegen den illegalen und blutigen Krieg im Irak und gegen die Besetzung durch ausländische Truppen engagiert haben". Er habe niemals Kontakte zu Mitgliedern des irakischen Geheimdienstes gehabt, wie dies in dem Zeitungsbericht behauptet werde. Er habe über die Jahre lediglich Mitglieder der politischen Führung des Landes getroffen. Die von der Zeitung vorgelegten Dokumente seien gefälscht oder manipuliert worden, um ihn zu diskreditieren, sagte der Abgeordnete.

dpa-AFX-Nachricht (Deutschland)
Mittwoch, 23.04.2003, 12:58
GoingPublic Kolumne: Das Kapital
WOLFRATSHAUSEN (GoingPublic.de) - Deutschland und die USA haben mehr gemeinsame Wirtschaftsprobleme als man denken sollte. Wenn der Besitz von Enteignung bedroht ist - in welcher Form auch immer -, schaudert es Investoren beim Gedanken an Investments.
Investoren lieben Planungssicherheit, und sie verabscheuen schleichenden Verfall ihrer Vermögensteile sowie jede Form von Zufälligkeiten. Nun ist es kein Geheimnis, dass sich in Deutschland die Wegnahme durch den Einsatz jedweder mehr oder minder subtiler oder offensichtlicher Methoden fast zur Perfektion weiterentwickelt hat. Wenig bis nichts bleibt unangetastet: Gewinnbesteuerung (Minderung von Veräußerungsgewinnen), Vermögensbesteuerung (Attacke auf den Besitz) und Einkommensbesteuerung (Angriff auf die Nutzung) sind die gängigsten Methodika. Freilich unterscheiden sich die Instrumente von Regierung zu Regierung, aber das ist nur Kosmetik.
Auch wenn die Vereinigten Staaten in Bezug auf ihre Steuerpolitik oftmals als Vorzeigeobjekt in Sachen Liberalität herhalten müssen, so schleicht auch dort eine fast unsichtbare Enteignung voran. Sie macht dem Nimbus der unbegrenzten Möglichkeiten alle Ehre. Die Rechtspraxis sucht ihresgleichen, und, um es vorweg zu nehmen, mit einer offenen Gesellschaft verträgt sie sich schon längst nicht mehr. Doch das mit der offenen Gesellschaft scheint auch schon Vergangenheit.
Das US-Rechtssystem ist zu einem Konstrukt systematischer Erpressungsmöglichkeiten mutiert. Unter der Androhung absurder Klagesummen können Eigentümer so weit eingeschüchtert werden, dass sich hohe Beträge allein durch Vergleiche freipressen lassen. Das Resultat ist ein von unfassbarer Willkür geprägtes System, in dem Besitz im ureigensten Sinne eben nicht mehr "sicher" ist. Die US-Wirtschaft hat somit eine bestimmte Art von Sondersteuer zu schultern, die vor allem eines ist: völlig unvorhersehbar. Hier schließt sich der Kreis für Investoren, denn Zufälligkeiten sind der Gegenpol von Planungssicherheit.
Deutschland ist für Investoren ein im wahrsten Sinne rotes Tuch geworden. Doch das erodierende Vertrauen in den US-Kapitalmarkt (auch hier variiert der Grad unter Einfluss der jeweiligen Regierung) wird auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten weiter gängeln. Wer also auf den jeweils anderen oberlehrerhaft mit dem Finger zeigt, sollte erst einmal seine eigenen Hausaufgaben angehen.
Die GoingPublic Kolumne ist ein Service des GoingPublic Magazins, Deutschlands führendem Börsenmagazin zu Neuemissionen und dem Neuen Markt. Bezogen werden kann das Magazin unter www.goingpublic.de. GoingPublic ist allein für die Inhalte der Kolumne verantwortlich. Informationen zu einzelnen Unternehmen stellen keine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Aktien dar. Die Kolumne erscheint zweimal wöchentlich in Zusammenarbeit mit dpa-AFX.
info@dpa-AFX.de

Mittwoch, 23.04.2003, 12:58
GoingPublic Kolumne: Das Kapital
WOLFRATSHAUSEN (GoingPublic.de) - Deutschland und die USA haben mehr gemeinsame Wirtschaftsprobleme als man denken sollte. Wenn der Besitz von Enteignung bedroht ist - in welcher Form auch immer -, schaudert es Investoren beim Gedanken an Investments.
Investoren lieben Planungssicherheit, und sie verabscheuen schleichenden Verfall ihrer Vermögensteile sowie jede Form von Zufälligkeiten. Nun ist es kein Geheimnis, dass sich in Deutschland die Wegnahme durch den Einsatz jedweder mehr oder minder subtiler oder offensichtlicher Methoden fast zur Perfektion weiterentwickelt hat. Wenig bis nichts bleibt unangetastet: Gewinnbesteuerung (Minderung von Veräußerungsgewinnen), Vermögensbesteuerung (Attacke auf den Besitz) und Einkommensbesteuerung (Angriff auf die Nutzung) sind die gängigsten Methodika. Freilich unterscheiden sich die Instrumente von Regierung zu Regierung, aber das ist nur Kosmetik.
Auch wenn die Vereinigten Staaten in Bezug auf ihre Steuerpolitik oftmals als Vorzeigeobjekt in Sachen Liberalität herhalten müssen, so schleicht auch dort eine fast unsichtbare Enteignung voran. Sie macht dem Nimbus der unbegrenzten Möglichkeiten alle Ehre. Die Rechtspraxis sucht ihresgleichen, und, um es vorweg zu nehmen, mit einer offenen Gesellschaft verträgt sie sich schon längst nicht mehr. Doch das mit der offenen Gesellschaft scheint auch schon Vergangenheit.
Das US-Rechtssystem ist zu einem Konstrukt systematischer Erpressungsmöglichkeiten mutiert. Unter der Androhung absurder Klagesummen können Eigentümer so weit eingeschüchtert werden, dass sich hohe Beträge allein durch Vergleiche freipressen lassen. Das Resultat ist ein von unfassbarer Willkür geprägtes System, in dem Besitz im ureigensten Sinne eben nicht mehr "sicher" ist. Die US-Wirtschaft hat somit eine bestimmte Art von Sondersteuer zu schultern, die vor allem eines ist: völlig unvorhersehbar. Hier schließt sich der Kreis für Investoren, denn Zufälligkeiten sind der Gegenpol von Planungssicherheit.
Deutschland ist für Investoren ein im wahrsten Sinne rotes Tuch geworden. Doch das erodierende Vertrauen in den US-Kapitalmarkt (auch hier variiert der Grad unter Einfluss der jeweiligen Regierung) wird auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten weiter gängeln. Wer also auf den jeweils anderen oberlehrerhaft mit dem Finger zeigt, sollte erst einmal seine eigenen Hausaufgaben angehen.
Die GoingPublic Kolumne ist ein Service des GoingPublic Magazins, Deutschlands führendem Börsenmagazin zu Neuemissionen und dem Neuen Markt. Bezogen werden kann das Magazin unter www.goingpublic.de. GoingPublic ist allein für die Inhalte der Kolumne verantwortlich. Informationen zu einzelnen Unternehmen stellen keine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Aktien dar. Die Kolumne erscheint zweimal wöchentlich in Zusammenarbeit mit dpa-AFX.
info@dpa-AFX.de

23.04. 14:00
Fed´s Perry: US-Notenbank hat noch "Munition"
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Der Präsident der Notenbank von San Francisco Robert Parry betonte in einer Rede am Mittwoch, dass die US-Notenbank noch weiteren Spielraum besitze, den Leitzins zu senken, sollte dies nötig sein. Damit bläst er in dasselbe Horn, wie schon viele seiner Kollegen, die in den vergangenen Wochen ähnliche Aussagen trafen. Sollten sich die Dinge in der Wirtschaft nicht wieder sammeln, so habe man weiteren Spielraum, um sie anzukurbeln, so Perry. Sollte die US-Notenbank ihre „Munition“ mit kurzfristigen Zinssätzen verschossen habe, so bestehe durch den Kauf von Staatsanleihen die Möglichkeit, auch die langfristigen Zinsen zu manipulieren. Perry ist zurzeit ein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses, der über den Stand der Fed Funds Target Rate, also dem Leitzins, in den Vereinigten Staaten entscheidet. Die Target Rate steht derzeit auf einem 40-Jahrestief bei 1.25%.

Fed´s Perry: US-Notenbank hat noch "Munition"
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Der Präsident der Notenbank von San Francisco Robert Parry betonte in einer Rede am Mittwoch, dass die US-Notenbank noch weiteren Spielraum besitze, den Leitzins zu senken, sollte dies nötig sein. Damit bläst er in dasselbe Horn, wie schon viele seiner Kollegen, die in den vergangenen Wochen ähnliche Aussagen trafen. Sollten sich die Dinge in der Wirtschaft nicht wieder sammeln, so habe man weiteren Spielraum, um sie anzukurbeln, so Perry. Sollte die US-Notenbank ihre „Munition“ mit kurzfristigen Zinssätzen verschossen habe, so bestehe durch den Kauf von Staatsanleihen die Möglichkeit, auch die langfristigen Zinsen zu manipulieren. Perry ist zurzeit ein stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses, der über den Stand der Fed Funds Target Rate, also dem Leitzins, in den Vereinigten Staaten entscheidet. Die Target Rate steht derzeit auf einem 40-Jahrestief bei 1.25%.

gebe mir auf stock ne neue id. und meinem computer ne
neue erkennungsnummer.
O3: Was war denn der Grund für die Sperrung bei stock?
neue erkennungsnummer.
O3: Was war denn der Grund für die Sperrung bei stock?
hi na 10000
keine ahnung.
weder riva noch ein anderer mod. hat es nötig auf
meine bordmails zu antworten.
ist wohl ne warnung für mich und den
rest der "freien denker"
ev. passt auch germanasti meine witze über japan und über
sein timing nicht.
ev. meine meinung zum gold?!?!

keine ahnung.
weder riva noch ein anderer mod. hat es nötig auf
meine bordmails zu antworten.
ist wohl ne warnung für mich und den
rest der "freien denker"
ev. passt auch germanasti meine witze über japan und über
sein timing nicht.
ev. meine meinung zum gold?!?!

jetzt aber genug stammtisch hier 

seit alle in meinem kosto/dolby thread eingeladen



seit alle in meinem kosto/dolby thread eingeladen


Powell droht Frankreich mit Konsequenzen
Washington (dpa) - Mit ungewöhnlicher Schärfe hat US-Außenminister Colin Powell Frankreich für seinen Widerstand gegen den Irak-Krieg kritisiert und Konsequenzen angedroht. Ein Regierungssprecher in Paris spielte die Drohung aus Washington herunter. Außenminister Dominique de Villepin betonte allerdings, Paris werde seinen Kurs «unter allen Umständen» fortsetzen. Powell hatte in einem Fernsehinterview angekündigt, «alle Aspekte der Beziehung zu Frankreich im Lichte dieser Situation zu beleuchten».

Washington (dpa) - Mit ungewöhnlicher Schärfe hat US-Außenminister Colin Powell Frankreich für seinen Widerstand gegen den Irak-Krieg kritisiert und Konsequenzen angedroht. Ein Regierungssprecher in Paris spielte die Drohung aus Washington herunter. Außenminister Dominique de Villepin betonte allerdings, Paris werde seinen Kurs «unter allen Umständen» fortsetzen. Powell hatte in einem Fernsehinterview angekündigt, «alle Aspekte der Beziehung zu Frankreich im Lichte dieser Situation zu beleuchten».

noch eine warnung 
USA warnen Iran vor Einmischung in Nachkriegs-Irak
Washington (vwd) - Die Vereinigten Staaten haben Iran in scharfen Worten
vor einer Einflussnahme nach dem Krieg in Irak gewarnt. Die US-Regierung
habe Teheran über wohlbekannte Kanäle deutlich gemacht, dass jede
äußere
Einmischung auf dem Weg Iraks zur Demokratie nicht geduldet werde, sagte
der Sprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer, am Mittwoch in Washington.
Dies betreffe insbesondere die Einschleusung von Agenten in die schiitische
Bevölkerung im Süden Iraks. Von entsprechenden Versuchen berichtete zuvor
die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsbeamte.
Die von Iran beeinflussten Schiiten stellten derzeit generell allerdings
keine offene Bedrohung dar, sagte der Kommandeur der
US-Bodentruppen in
Irak, Generalleutnant David McKiernan, derweil vor Journalisten. Dennoch
beobachte das Militär den Machtkampf zwischen Schiiten, Sunniten und anderen
Interessengruppen genau. Bei der schiitischen Pilgerfahrt in Kerbela hätten
sich die US-Soldaten herausgehalten, weil die Gläubigen diese selbst
sehr
gut organisiert hätten, sagte McKiernan weiter. Hunderttausende Pilger
der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit in Irak hatten in Kerbela am Dienstag und
Mittwoch ihres Märtyrers Hussein gedacht.
vwd/A

USA warnen Iran vor Einmischung in Nachkriegs-Irak
Washington (vwd) - Die Vereinigten Staaten haben Iran in scharfen Worten
vor einer Einflussnahme nach dem Krieg in Irak gewarnt. Die US-Regierung
habe Teheran über wohlbekannte Kanäle deutlich gemacht, dass jede
äußere
Einmischung auf dem Weg Iraks zur Demokratie nicht geduldet werde, sagte
der Sprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer, am Mittwoch in Washington.
Dies betreffe insbesondere die Einschleusung von Agenten in die schiitische
Bevölkerung im Süden Iraks. Von entsprechenden Versuchen berichtete zuvor
die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsbeamte.
Die von Iran beeinflussten Schiiten stellten derzeit generell allerdings
keine offene Bedrohung dar, sagte der Kommandeur der
US-Bodentruppen in
Irak, Generalleutnant David McKiernan, derweil vor Journalisten. Dennoch
beobachte das Militär den Machtkampf zwischen Schiiten, Sunniten und anderen
Interessengruppen genau. Bei der schiitischen Pilgerfahrt in Kerbela hätten
sich die US-Soldaten herausgehalten, weil die Gläubigen diese selbst
sehr
gut organisiert hätten, sagte McKiernan weiter. Hunderttausende Pilger
der
schiitischen Bevölkerungsmehrheit in Irak hatten in Kerbela am Dienstag und
Mittwoch ihres Märtyrers Hussein gedacht.
vwd/A
am puls der zeit, diese amis 
http://www.welt.de/data/2003/04/26/78938.html
"Kein Blut für Öl", sagen auch die Amerikaner
Herfried Münkler enthüllt die wahren Bewegggründe der Irak-Invasion
von Thomas Speckmann
Es sind die schmalen Bände eines Robert Kagan oder eines Joseph P. Nye, die in letzter Zeit die Diskussion über Krieg und Frieden bestimmen. Doch dafür muss der Autor die Dinge auf den Punkt bringen können. Ein Vorhaben, das häufig misslingt, wenn "pointiert" mit "holzschnittartig" verwechselt wird. Nur wer seine Materie tief durchdrungen hat, kann mit ihr scheinbar spielerisch umgehen, in kurzer und prägnanter Form. Herfried Münkler ist so ein Spieler. Seine Werke durchweht der Hauch von Jahrhunderten. Angefangen bei Aristophanes, Thukydides und Platon - über Machiavelli, Fichte und Clausewitz - bis hin zu Engels, Carl Schmitt, Enzensberger und schließlich Huntington hat sich Münkler schon in "Über den Krieg" mit den Stationen der Kriegsgeschichte befasst. Seine Betrachtungen über "Die neuen Kriege" sind bereits ein Bestseller. Nun könnte ein weiterer folgen.
"Der neue Golfkrieg" ist nicht nur die Fortsetzung von Münklers zahlreichen Essays und Analysen mit anderen Mitteln, seine Darstellung ist auch der Versuch, ein Fazit unter die monatelange Debatte über das Für und Wider einer militärischen Intervention im Irak zu ziehen. Ein Versuch, der schon allein aufgrund der globalen Weite der Thematik beeindruckt.
Münkler gelingt es, in einfachen und klaren Worten das Kernmotiv des amerikanischen Engagements am Golf freizulegen. Die Entscheidung der USA, die von den Briten aufgegebene Rolle des Stabilitäts- und Sicherheitsgaranten zumindest teilweise zu übernehmen, versteht der Berliner Politologe nicht als Ausdruck imperialistischer Politik im klassischen Sinne. Keinesfalls gehe es Washington um die direkte Kontrolle von Ölförderquoten und Ölpreisbildung, sondern bloß darum, nicht zuzulassen, dass sich ein anderer die direkte Kontrollposition erobert: Das Weiße Haus in der Rolle des Lückenbüßers.
Da die USA Mitte der achtziger Jahre auf dem Höhepunkt des Ersten Golfkrieges von der indirekten zur direkten Kontrolle der Region übergegangen sind, verbunden mit Stationierungskosten der eigenen Streitkräfte von zuletzt jährlich 70 Milliarden Dollar, sieht Münkler eine Erklärung für den strikten Kriegskurs der Amerikaner darin, dass auch der einzig verbliebenen Supermacht die aus einer starken militärischen Präsenz erwachsenden Kosten auf Dauer zu hoch sind. Der Krieg soll sie aus einem "imperial overstretch" - einer imperialen Überdehnung - befreien, die sie bereits vor dem Sturm auf Bagdad überfordert hat.
Der unmittelbar nach dem Ende der größeren Kampfhandlungen begonnene Abzug amerikanischer Einheiten aus dem Irak und seiner Peripherie spricht für Münklers Deutung. "Kein Blut für Öl" ist nicht nur die Maxime der Friedensbewegung. Auch Washington will möglichst wenig investieren und hat im Konflikt mit Saddam Hussein auf die militärische Option gesetzt, um am Golf auf mittlere Sicht Verhältnisse herzustellen, die eine dauerhafte Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz erlauben. So gesehen ist Angriff die billigste Verteidigung. Darum entlarvt Münkler die europäische Neigung, die jüngste Irak-Politik der USA als Eigenheit des republikanischen Lagers anzusehen und auf grundlegende Änderungen der amerikanischen Außenpolitik unter einem demokratischen Präsidenten zu hoffen, als das, was sie ist - eine Utopie.
Münkler geht vielmehr davon aus, dass völkerrechtliche Bindungen auch künftig zunehmend durch die Strategie des angekündigten Krieges unterhöhlt und geschwächt werden. Der dramatische Auftritt von US-Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lässt ihn dies ahnen. Institutionelle Regelungen und Bindungen werden durch die Inszenierung von Medienkampagnen ausgehebelt. Eine Entwicklung, die auf dem innenpolitischen Parkett der westlichen Staaten längst zu beobachten ist. Münkler spricht deshalb von einer Tribunalisierung der internationalen Politik, um militärische Interventionen zu legitimieren.
Große Erfolge prognostiziert Münkler den Amerikanern jedoch nicht. "Es ist zu befürchten, dass am Ende die politische Ohnmacht des militärisch allmächtigen Hegemon stehen wird." Eine Prognose, die sich angesichts der Rückschläge Washingtons im "Krieg gegen den Terror", vor allem in Afghanistan und in Südostasien, bereits als Realität abzeichnet.
Während die deutsche Debatte über den neuen Golfkrieg überwiegend mit der Ressource Moral geführt wurde und wird, hat Herfried Münkler einen Band vorgelegt, der eine nüchterne Analyse der weltpolitischen Entwicklung erlaubt. Eine rationale Diskussion ist ihm zu wünschen.


http://www.welt.de/data/2003/04/26/78938.html
"Kein Blut für Öl", sagen auch die Amerikaner
Herfried Münkler enthüllt die wahren Bewegggründe der Irak-Invasion
von Thomas Speckmann
Es sind die schmalen Bände eines Robert Kagan oder eines Joseph P. Nye, die in letzter Zeit die Diskussion über Krieg und Frieden bestimmen. Doch dafür muss der Autor die Dinge auf den Punkt bringen können. Ein Vorhaben, das häufig misslingt, wenn "pointiert" mit "holzschnittartig" verwechselt wird. Nur wer seine Materie tief durchdrungen hat, kann mit ihr scheinbar spielerisch umgehen, in kurzer und prägnanter Form. Herfried Münkler ist so ein Spieler. Seine Werke durchweht der Hauch von Jahrhunderten. Angefangen bei Aristophanes, Thukydides und Platon - über Machiavelli, Fichte und Clausewitz - bis hin zu Engels, Carl Schmitt, Enzensberger und schließlich Huntington hat sich Münkler schon in "Über den Krieg" mit den Stationen der Kriegsgeschichte befasst. Seine Betrachtungen über "Die neuen Kriege" sind bereits ein Bestseller. Nun könnte ein weiterer folgen.
"Der neue Golfkrieg" ist nicht nur die Fortsetzung von Münklers zahlreichen Essays und Analysen mit anderen Mitteln, seine Darstellung ist auch der Versuch, ein Fazit unter die monatelange Debatte über das Für und Wider einer militärischen Intervention im Irak zu ziehen. Ein Versuch, der schon allein aufgrund der globalen Weite der Thematik beeindruckt.
Münkler gelingt es, in einfachen und klaren Worten das Kernmotiv des amerikanischen Engagements am Golf freizulegen. Die Entscheidung der USA, die von den Briten aufgegebene Rolle des Stabilitäts- und Sicherheitsgaranten zumindest teilweise zu übernehmen, versteht der Berliner Politologe nicht als Ausdruck imperialistischer Politik im klassischen Sinne. Keinesfalls gehe es Washington um die direkte Kontrolle von Ölförderquoten und Ölpreisbildung, sondern bloß darum, nicht zuzulassen, dass sich ein anderer die direkte Kontrollposition erobert: Das Weiße Haus in der Rolle des Lückenbüßers.
Da die USA Mitte der achtziger Jahre auf dem Höhepunkt des Ersten Golfkrieges von der indirekten zur direkten Kontrolle der Region übergegangen sind, verbunden mit Stationierungskosten der eigenen Streitkräfte von zuletzt jährlich 70 Milliarden Dollar, sieht Münkler eine Erklärung für den strikten Kriegskurs der Amerikaner darin, dass auch der einzig verbliebenen Supermacht die aus einer starken militärischen Präsenz erwachsenden Kosten auf Dauer zu hoch sind. Der Krieg soll sie aus einem "imperial overstretch" - einer imperialen Überdehnung - befreien, die sie bereits vor dem Sturm auf Bagdad überfordert hat.
Der unmittelbar nach dem Ende der größeren Kampfhandlungen begonnene Abzug amerikanischer Einheiten aus dem Irak und seiner Peripherie spricht für Münklers Deutung. "Kein Blut für Öl" ist nicht nur die Maxime der Friedensbewegung. Auch Washington will möglichst wenig investieren und hat im Konflikt mit Saddam Hussein auf die militärische Option gesetzt, um am Golf auf mittlere Sicht Verhältnisse herzustellen, die eine dauerhafte Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz erlauben. So gesehen ist Angriff die billigste Verteidigung. Darum entlarvt Münkler die europäische Neigung, die jüngste Irak-Politik der USA als Eigenheit des republikanischen Lagers anzusehen und auf grundlegende Änderungen der amerikanischen Außenpolitik unter einem demokratischen Präsidenten zu hoffen, als das, was sie ist - eine Utopie.
Münkler geht vielmehr davon aus, dass völkerrechtliche Bindungen auch künftig zunehmend durch die Strategie des angekündigten Krieges unterhöhlt und geschwächt werden. Der dramatische Auftritt von US-Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lässt ihn dies ahnen. Institutionelle Regelungen und Bindungen werden durch die Inszenierung von Medienkampagnen ausgehebelt. Eine Entwicklung, die auf dem innenpolitischen Parkett der westlichen Staaten längst zu beobachten ist. Münkler spricht deshalb von einer Tribunalisierung der internationalen Politik, um militärische Interventionen zu legitimieren.
Große Erfolge prognostiziert Münkler den Amerikanern jedoch nicht. "Es ist zu befürchten, dass am Ende die politische Ohnmacht des militärisch allmächtigen Hegemon stehen wird." Eine Prognose, die sich angesichts der Rückschläge Washingtons im "Krieg gegen den Terror", vor allem in Afghanistan und in Südostasien, bereits als Realität abzeichnet.
Während die deutsche Debatte über den neuen Golfkrieg überwiegend mit der Ressource Moral geführt wurde und wird, hat Herfried Münkler einen Band vorgelegt, der eine nüchterne Analyse der weltpolitischen Entwicklung erlaubt. Eine rationale Diskussion ist ihm zu wünschen.

26/04/2003 19:37
Bush verteidigt Steuerpläne gegen Kritik aus dem Kongress
- von Adam Entous -
Washington, 26. Apr (Reuters) - Nach dem Ende der
Kampfhandlungen im Irak konzentriert sich US-Präsident George W.
Bush wieder verstärkt auf das von ihm geplante milliardenschwere
Steuersenkungsprogramm.
In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache verteidigte Bush
am Samstag sein innenpolitisches Hauptanliegen gegen Kritik aus
dem Kongress, der am Montag nach einer längeren Sitzungspause
erstmals wieder zusammenkommt. Das Wort "Irak" kam in der
Ansprache zum ersten Mal seit Februar nicht vor.
"Wir wissen, dass die amerikanische Wirtschaft ihr volles
Potenzial nicht ausschöpft", sagte Bush. "Wir wissen, dass
unsere Wirtschaft schneller wachsen und schneller Arbeitsplätze
schaffen kann." Zur Ankurbelung der Konjunktur will der
Präsident weit reichende Steuersenkungen durchsetzen. Kernstück
des Pakets ist eine Abschaffung der Dividendenbesteuerung. Bush
sprach von einem handfesten Vorhaben, das zur Schaffung von über
einer Million neuer Stellen bis Ende 2004 beitragen werde.
Gegnern seiner Steuerpläne im Kongress warf der Präsident vor,
den Kontakt zu ihren Wählern verloren zu haben, die sehr wohl
verstanden hätten, dass es Handlungsbedarf gebe.
Kritiker des Vorhabens, die sich auch in Bushs eigener
Republikanischen Partei finden, weisen die Pläne als sozial
unausgewogen zurück, da diese ihrer Einschätzung nach vor allem
einer Minderheit von Reichen zugute kommen. Vor allem wird dem
Präsidenten vorgeworfen, das Ausmaß der Steuersenkungen schade
der Volkswirtschaft letztlich, weil es das Haushaltsdefizit auf
weitere Rekordstände treibe. Selbst US-Notenbankchef Alan
Greenspan hatte sich kritisch zu Bushs Konjunkturpaket geäußert.
Dieses sah ursprünglich Steuersenkungen von 726 Milliarden
Dollar vor. Der von den Republikanern dominierte Kongress hält
dieses Volumen jedoch für zu hoch. So will das
Repräsentantenhaus Erleichterungen von höchstens 550 Milliarden
Dollar akzeptieren. Dieser Umfang ist Bush zufolge jedoch
mindestens erforderlich, um den stotternden Konjunkturmotor
wieder auf Touren zu bringen. Der Senat gar will die
Steuersenkungen auf 350 Milliarden Dollar beschränken.
Beobachtern zufolge will Bush mit seinem Konjunkturprogramm
verhindern, wie sein Vater als Präsident nicht wiedergewählt zu
werden. George Bush hatte nach dem Sieg gegen den Irak im
Golfkrieg 1991 an Popularität eingebüßt und war bei den Wahlen
1992 Bill Clinton unterlegen, was vor allem auf Bushs
Wirtschaftspolitik zurückgeführt wurde.
mer/bek

Bush verteidigt Steuerpläne gegen Kritik aus dem Kongress
- von Adam Entous -
Washington, 26. Apr (Reuters) - Nach dem Ende der
Kampfhandlungen im Irak konzentriert sich US-Präsident George W.
Bush wieder verstärkt auf das von ihm geplante milliardenschwere
Steuersenkungsprogramm.
In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache verteidigte Bush
am Samstag sein innenpolitisches Hauptanliegen gegen Kritik aus
dem Kongress, der am Montag nach einer längeren Sitzungspause
erstmals wieder zusammenkommt. Das Wort "Irak" kam in der
Ansprache zum ersten Mal seit Februar nicht vor.
"Wir wissen, dass die amerikanische Wirtschaft ihr volles
Potenzial nicht ausschöpft", sagte Bush. "Wir wissen, dass
unsere Wirtschaft schneller wachsen und schneller Arbeitsplätze
schaffen kann." Zur Ankurbelung der Konjunktur will der
Präsident weit reichende Steuersenkungen durchsetzen. Kernstück
des Pakets ist eine Abschaffung der Dividendenbesteuerung. Bush
sprach von einem handfesten Vorhaben, das zur Schaffung von über
einer Million neuer Stellen bis Ende 2004 beitragen werde.
Gegnern seiner Steuerpläne im Kongress warf der Präsident vor,
den Kontakt zu ihren Wählern verloren zu haben, die sehr wohl
verstanden hätten, dass es Handlungsbedarf gebe.
Kritiker des Vorhabens, die sich auch in Bushs eigener
Republikanischen Partei finden, weisen die Pläne als sozial
unausgewogen zurück, da diese ihrer Einschätzung nach vor allem
einer Minderheit von Reichen zugute kommen. Vor allem wird dem
Präsidenten vorgeworfen, das Ausmaß der Steuersenkungen schade
der Volkswirtschaft letztlich, weil es das Haushaltsdefizit auf
weitere Rekordstände treibe. Selbst US-Notenbankchef Alan
Greenspan hatte sich kritisch zu Bushs Konjunkturpaket geäußert.
Dieses sah ursprünglich Steuersenkungen von 726 Milliarden
Dollar vor. Der von den Republikanern dominierte Kongress hält
dieses Volumen jedoch für zu hoch. So will das
Repräsentantenhaus Erleichterungen von höchstens 550 Milliarden
Dollar akzeptieren. Dieser Umfang ist Bush zufolge jedoch
mindestens erforderlich, um den stotternden Konjunkturmotor
wieder auf Touren zu bringen. Der Senat gar will die
Steuersenkungen auf 350 Milliarden Dollar beschränken.
Beobachtern zufolge will Bush mit seinem Konjunkturprogramm
verhindern, wie sein Vater als Präsident nicht wiedergewählt zu
werden. George Bush hatte nach dem Sieg gegen den Irak im
Golfkrieg 1991 an Popularität eingebüßt und war bei den Wahlen
1992 Bill Clinton unterlegen, was vor allem auf Bushs
Wirtschaftspolitik zurückgeführt wurde.
mer/bek

17:20 Uhr
Mehr als 40 Hollywood-Stars wegen Irak auf Schwarzer Liste
Washington (dpa) - Mehr als 40 Hollywood-Stars sind wegen ihrer Kritik am Irak-Krieg im Internet auf eine «Schwarze Liste» gesetzt worden. Diese Prominenten hätten sich durch anti-amerikanische Erklärungen so beleidigend verhalten, dass das Publikum sie boykottieren sollte, heißt es eingangs der «Celebrity Liberal Blacklist». Die Schwarze Liste liest sich wie ein «Who is Who» der Film- und Showbranche. Sie reicht von Alec Baldwin und Barbra Streisand über George Clooney, Michael Moore bis Robert Altman.
------
Schindlers Liste war eine wichtige liste!
diese ami-liste geht der welt am arsch vorbei
Mehr als 40 Hollywood-Stars wegen Irak auf Schwarzer Liste
Washington (dpa) - Mehr als 40 Hollywood-Stars sind wegen ihrer Kritik am Irak-Krieg im Internet auf eine «Schwarze Liste» gesetzt worden. Diese Prominenten hätten sich durch anti-amerikanische Erklärungen so beleidigend verhalten, dass das Publikum sie boykottieren sollte, heißt es eingangs der «Celebrity Liberal Blacklist». Die Schwarze Liste liest sich wie ein «Who is Who» der Film- und Showbranche. Sie reicht von Alec Baldwin und Barbra Streisand über George Clooney, Michael Moore bis Robert Altman.
------
Schindlers Liste war eine wichtige liste!
diese ami-liste geht der welt am arsch vorbei

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,246377,00.html
GEFANGENE IM IRAK
Nackt durch den Park
Amnesty International zeigt sich besorgt über mögliche Misshandlungen von Irakern durch US-Soldaten. "Eine erniedrigende Behandlung ist ein klarer Verstoß gegen die Pflichten der Besatzungsmächte", erklärte die Menschenrechtsorganisation.
London - In einem Bericht der norwegischen Zeitung "Dagbladet" hieß es, vier Iraker seien beim Betreten eines Parks in Bagdad von US-Soldaten angewiesen worden, sich auszuziehen. Die Männer seien dann nackt durch den Park geführt und auf eine Straße gedrängt worden. Die Zeitung veröffentlichte dazu drei Fotos, die den Zwischenfall zeigen sollen.
Das US-Oberkommando Mitte erklärte, der Bericht werde überprüft. Korvettenkapitän Charles Owens sagte, sollte der Bericht wahr sein, würden die Soldaten bestraft. Eine Zurschaustellung Gefangener verstoße gegen die Genfer Konventionen. Amnesty International erklärte in London, sollten die Fotos richtig sein, wäre dies eine entsetzliche Art, Gefangene zu behandeln. "Solch eine erniedrigende Behandlung ist ein klarer Verstoß gegen die Pflichten der Besatzungsmächte", erklärte die Menschenrechtsorganisation.
Auf einem der Fotos ist ein Mann zu sehen, auf dessen Brust auf Arabisch die Wörter "Ali Baba - Räuber" stehen. Ein weiteres Bild zeigt drei nackte Männer im Park, hinter denen Soldaten gehen. Ihre Uniformen sind nur undeutlich zu erkennen.
-------
sind die 1000 dollar soldaten schwul geworden?
GEFANGENE IM IRAK
Nackt durch den Park
Amnesty International zeigt sich besorgt über mögliche Misshandlungen von Irakern durch US-Soldaten. "Eine erniedrigende Behandlung ist ein klarer Verstoß gegen die Pflichten der Besatzungsmächte", erklärte die Menschenrechtsorganisation.
London - In einem Bericht der norwegischen Zeitung "Dagbladet" hieß es, vier Iraker seien beim Betreten eines Parks in Bagdad von US-Soldaten angewiesen worden, sich auszuziehen. Die Männer seien dann nackt durch den Park geführt und auf eine Straße gedrängt worden. Die Zeitung veröffentlichte dazu drei Fotos, die den Zwischenfall zeigen sollen.
Das US-Oberkommando Mitte erklärte, der Bericht werde überprüft. Korvettenkapitän Charles Owens sagte, sollte der Bericht wahr sein, würden die Soldaten bestraft. Eine Zurschaustellung Gefangener verstoße gegen die Genfer Konventionen. Amnesty International erklärte in London, sollten die Fotos richtig sein, wäre dies eine entsetzliche Art, Gefangene zu behandeln. "Solch eine erniedrigende Behandlung ist ein klarer Verstoß gegen die Pflichten der Besatzungsmächte", erklärte die Menschenrechtsorganisation.
Auf einem der Fotos ist ein Mann zu sehen, auf dessen Brust auf Arabisch die Wörter "Ali Baba - Räuber" stehen. Ein weiteres Bild zeigt drei nackte Männer im Park, hinter denen Soldaten gehen. Ihre Uniformen sind nur undeutlich zu erkennen.
-------
sind die 1000 dollar soldaten schwul geworden?



http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/14682/1.html
Der Euro als Wunderwaffe
Bernd Kling 28.04.2003
Ein Umstieg vom Petro-Dollar zum Petro-Euro könnte die Weltordnung verändern
Die militärische und wirtschaftliche Hegemonie steht seit dem neuen Irak-Krieg außer Zweifel. Vor diesem Krieg gab es noch eine vage Hoffnung, die von vielen im Rest der Welt inzwischen als Schurken-Supermacht gesehenen USA mit den Mitteln der Diplomatie zumindest einzudämmen. Doch seither haben die Vordenker der Bush-Regierung entdeckt, dass sie einen Krieg auch ohne Deckung der Vereinten Nationen führen können und ihre eigene Wählerschaft dennoch bei guter Laune bleibt.
Der Zugriff auf den Ölhahn, der sich aus der erfolgten Besetzung des Irak ergibt, erlaubt es den USA, eine Zwickmühle für den Rest der Welt zu öffnen. Ein weit geöffneter Ölhahn sorgt für fallende Preise und gefährdet damit die wirtschaftliche und politische Stabilität Russlands, die auf ihren eigenen Ölexporten beruht. Ein reduzierter Ölfluss hingegen bewirkt steigende Preise und setzt damit Volkswirtschaften wie Frankreich, Deutschland, Japan und China unter Druck, die stark von Ölimporten abhängig sind. Allein dieses Drohpotential kann schon ausreichen, um die erwünschte Vasallentreue zu sichern.
Der kommende Einfluss auf den Ölpreis addiert sich zur bestehenden wirtschaftlichen Vormachtsstellung. Weltweit steigen und fallen die Börsen, wie es der Takt der Wall Street vorgibt. Der US-Dollar bildet die Reservewährung für die meisten Staaten der Welt. Internationale Vereinbarungen gelten schon lange nichts mehr, wenn sie den Interessen der USA zu widersprechen scheinen. Kann es überhaupt noch Widerstand geben gegen dieses Wirtschaftsimperium, das zudem gewillt und in der Lage ist, seine Interessen mit militärischen Mitteln zu sichern?
Die Gallier der Welt
Hoffnung macht der britische Kolumnist George Monbiot im Guardian. Er schlägt seinen Euro-kritischen Landsleuten dringend vor, den Euro durch den englischen Beitritt zum Währungsgebiet zu stärken, um die US-Hegemonie zu bekämpfen. Er argumentiert, dass insbesondere der Euro-Beitritt von Norwegen und Großbritannien bedeutsame Wirkung hätten, da sie mit dem Preis für Brent-Öl eine Preismarke im internationalen Ölmarkt setzen.
Monbiot beruft sich auf einen führenden OPEC-Mitarbeiter, der es für erstrebenswert halte, wenn die OPEC-Länder ihre Ware nicht mehr gegen Dollar, sondern gegen Euro anbieten. Das ergäbe laut Monbiot eine regelrechte Domino-Reaktion: Der Dollarpreis rutscht ab. Wenn er aber seine relative Stabilität im Vergleich zu anderen Währungen erst einmal verloren hat, stürzt er erst recht ab, weil andere Länder nicht mehr gezwungen sein werden, ihn als Währungsreserve zu nutzen. Die überbewertete und ungleichgewichtige US-Wirtschaft kippt und damit auch die militärische Macht der USA.
Monbiot bezieht sich offenbar auf die Überlegungen von William Clark, der sich schon im Januar 2003 in einem umfangreichen Dossier mit The Real Reasons for the Upcoming War With Iraq mit dem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund des Irak-Kriegs beschäftigte. Clark zitierte einen ungenannten früheren Regierungsbeamten und Makroökonomen, der den absehbaren Krieg sogar im Zusammenhang mit der durch den Irak bereits Ende 2000 durchgeführten Währungsumstellung vom Dollar zum Euro sah:
"Saddam sealed his fate when he decided to switch to the euro in late 2000 (and later converted his $10 billion reserve fund at the U.N. to euros) -- at that point, another manufactured Gulf War become inevitable under Bush II. Only the most extreme circumstances could possibly stop that now and I strongly doubt anything can -- short of Saddam getting replaced with a pliant regime.
Big Picture Perspective: Everything else aside from the reserve currency and the Saudi/Iran oil issues (i.e. domestic political issues and international criticism) is peripheral and of marginal consequence to this administration. Further, the dollar-euro threat is powerful enough that they will rather risk much of the economic backlash in the short-term to stave off the long-term dollar crash of an OPEC transaction standard change from dollars to euros. All of this fits into the broader Great Game that encompasses Russia, India, China."
Die gut geölte Dollar-Presse
"Wann werden wir Öl in Euros bezahlen?" fragt auch Faisal Islam im Wirtschaftsteil des Oberserver. Er führt aus, dass die üblichen wirtschaftlichen Regeln für die USA außer Kraft gesetzt sind durch die internationale Rolle des Dollars. Denn etwa drei Billionen Dollar sind weltweit in Umlauf und ermöglichen den USA ihr praktisch permanentes Handelsdefizit. Zwei Drittel des Welthandels werden in Dollar abgewickelt. Zwei Drittel der Devisenreserven der Zentralbanken in aller Welt lauten ebenfalls auf die grünen Scheine.
Die meisten Länder benötigen Dollars, um Öl zu kaufen. Die Öl-Exporteure halten aus diesem Grund Milliarden der Währung, in der sie bezahlt werden, als Währungsreserve. Für sie besteht praktisch auch kein Währungsrisiko, wenn sie diese Petro-Dollar gleich wieder in die US-Wirtschaft investieren. So brauchen die USA dann ständig nur weiter Geld zu drucken wie eine Art von Schuldscheinen, um sich damit Steuererleichterungen, erhöhte Militärausgaben und wachsenden Konsum zugleich leisten zu können, ohne dadurch Inflation oder eine Rückforderung der Schulden befürchten zu müssen. Als Hüter der weltweiten Währung können sie im Notfall jederzeit den Dollar abwerten und die Exporteure anderer Länder für ihre angewachsenen wirtschaftlichen Probleme bezahlen lassen.
Doch nun kommt der Euro, der nach seinem Fehlstart zunehmend an Wertschätzung gewinnt. Sein Währungsgebiet bekommt mit der EU-Erweiterung eine vergleichbare wirtschaftliche Grundlage wie der US-Dollar. Der zunehmende Vertrauensverlust gegenüber der amerikanischen Wirtschaft stärkt den Euro. Die Euro-Zone ist der größte Öl-Importeur der Welt, und der Nahe Osten bezieht 45 Prozent seiner Importe aus Europa. Die Parlamente von Iran und Russland haben über eine mögliche Übernahme des Euro für Ölverkäufe debattiert. Die meisten Länder der OPEC haben ein überwiegendes Interesse am Euro als Ölwährung. Verhindert hat die Ablösung des Dollars bislang vor allem Saudi-Arabien. Der frühere US-Botschafter in Saudi-Arabien erklärte im Jahr 2002 einem Kongress-Komitee:
"One of the major things the Saudis have historically done, in part out of friendship with the United States, is to insist that oil continues to be priced in dollars. Therefore, the US Treasury can print money and buy oil, which is an advantage no other country has. With the emergence of other currencies and with strains in the relationship, I wonder whether there will not again be, as there have been in the past, people in Saudi Arabia who raise the question of why they should be so kind to the United States."
Was macht die OPEC?
Eine Schlüsselrolle spielt jetzt neben der Euroland-Entwicklung das Ölkartell OPEC, das mit der erfolgten Besetzung des Irak einem erhöhten Druck der USA ausgesetzt ist. Werden die OPEC-Länder sich dem Druck beugen oder auf ihre Weise wehren?
Entscheidend wird sein, wie sich Saudi-Arabien in Zukunft verhält, das neokonservative US-Falken ja auch bereits ins Visier genommen haben. Was kann und wird die künftige Währungsstrategie der OPEC-Länder beeinflussen? Überlegungen zu einem Wechsel zum Petro-Euro jedenfalls gibt es auch bei der OPEC schon länger. In einem seinerzeit nur wenig beachteten Vortrag The Choice of Currency for the Denomination of the Oil Bill in Spanien während der spanischen EU-Präsidentschaft im April 2002 sah Javad Yarjani, Leiter des Petroleum Market Analysis Department der OPEC, einen Währungsumstieg allerdings aufgrund der damaligen Euroschwäche noch eher in der mittleren oder fernen Zukunft:
"However, while the euro has the potential to be a viable competitor and possible alternative to the dollar in international financial and commodity markets in the medium to long term, its external weakness to date has meant it has been unable to gain inroads in the last two years. From the time the euro was floated in January 1999, the currency drifted downwards, losing by October 2000 about 30 per cent of its initial value against the dollar. It has since regained some of this lost ground, but is still far removed from parity with the dollar and even further removed from its starting value."
Das Argument mit dem im Vergleich zum Dollar schwachen Euro ist inzwischen offensichtlich erledigt. Der Euro darf in absehbarer Zukunft als stabilere Währung im Vergleich zum Dollar gelten. Einen möglicherweise entscheidenden Anstoß zum Petro-Euro sah der OPEC-Analyst im offiziellen Nennwert der Nordseesorte Brent-Öl, die mit einem Wechsel der Öl-Produzenten Norwegen und Großbritannien zum Euro kommen könnte:
"Of major importance to the ultimate success of the euro, in terms of the oil pricing, will be if Europe`s two major oil producers - the United Kingdom and Norway join the single currency. Naturally, the future integration of these two countries into the Euro-zone and Europe will be important considering they are the region`s two major oil producers in the North Sea, which is home to the international crude oil benchmark, Brent. This might create a momentum to shift the oil pricing system to euros."
Aus genau diesem Grund nun ruft der eingangs erwähnte George Monbiot insbesondere auch seine globalisierungskritischen Landsleute auf, zu denen er sich selbst zählt, sich für die bisher eher kritisch gesehene Übernahme des Euro einzusetzen. Er sieht sogar eine moralische Verpflichtung darin, sich zusammen mit dem Rest der Welt der Hegemonialmacht USA zu widersetzen:
"To defend our sovereignty - and that of the rest of the world - from the US, we must yield some of our sovereignty to Europe."

Der Euro als Wunderwaffe
Bernd Kling 28.04.2003
Ein Umstieg vom Petro-Dollar zum Petro-Euro könnte die Weltordnung verändern
Die militärische und wirtschaftliche Hegemonie steht seit dem neuen Irak-Krieg außer Zweifel. Vor diesem Krieg gab es noch eine vage Hoffnung, die von vielen im Rest der Welt inzwischen als Schurken-Supermacht gesehenen USA mit den Mitteln der Diplomatie zumindest einzudämmen. Doch seither haben die Vordenker der Bush-Regierung entdeckt, dass sie einen Krieg auch ohne Deckung der Vereinten Nationen führen können und ihre eigene Wählerschaft dennoch bei guter Laune bleibt.
Der Zugriff auf den Ölhahn, der sich aus der erfolgten Besetzung des Irak ergibt, erlaubt es den USA, eine Zwickmühle für den Rest der Welt zu öffnen. Ein weit geöffneter Ölhahn sorgt für fallende Preise und gefährdet damit die wirtschaftliche und politische Stabilität Russlands, die auf ihren eigenen Ölexporten beruht. Ein reduzierter Ölfluss hingegen bewirkt steigende Preise und setzt damit Volkswirtschaften wie Frankreich, Deutschland, Japan und China unter Druck, die stark von Ölimporten abhängig sind. Allein dieses Drohpotential kann schon ausreichen, um die erwünschte Vasallentreue zu sichern.
Der kommende Einfluss auf den Ölpreis addiert sich zur bestehenden wirtschaftlichen Vormachtsstellung. Weltweit steigen und fallen die Börsen, wie es der Takt der Wall Street vorgibt. Der US-Dollar bildet die Reservewährung für die meisten Staaten der Welt. Internationale Vereinbarungen gelten schon lange nichts mehr, wenn sie den Interessen der USA zu widersprechen scheinen. Kann es überhaupt noch Widerstand geben gegen dieses Wirtschaftsimperium, das zudem gewillt und in der Lage ist, seine Interessen mit militärischen Mitteln zu sichern?
Die Gallier der Welt
Hoffnung macht der britische Kolumnist George Monbiot im Guardian. Er schlägt seinen Euro-kritischen Landsleuten dringend vor, den Euro durch den englischen Beitritt zum Währungsgebiet zu stärken, um die US-Hegemonie zu bekämpfen. Er argumentiert, dass insbesondere der Euro-Beitritt von Norwegen und Großbritannien bedeutsame Wirkung hätten, da sie mit dem Preis für Brent-Öl eine Preismarke im internationalen Ölmarkt setzen.
Monbiot beruft sich auf einen führenden OPEC-Mitarbeiter, der es für erstrebenswert halte, wenn die OPEC-Länder ihre Ware nicht mehr gegen Dollar, sondern gegen Euro anbieten. Das ergäbe laut Monbiot eine regelrechte Domino-Reaktion: Der Dollarpreis rutscht ab. Wenn er aber seine relative Stabilität im Vergleich zu anderen Währungen erst einmal verloren hat, stürzt er erst recht ab, weil andere Länder nicht mehr gezwungen sein werden, ihn als Währungsreserve zu nutzen. Die überbewertete und ungleichgewichtige US-Wirtschaft kippt und damit auch die militärische Macht der USA.
Monbiot bezieht sich offenbar auf die Überlegungen von William Clark, der sich schon im Januar 2003 in einem umfangreichen Dossier mit The Real Reasons for the Upcoming War With Iraq mit dem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund des Irak-Kriegs beschäftigte. Clark zitierte einen ungenannten früheren Regierungsbeamten und Makroökonomen, der den absehbaren Krieg sogar im Zusammenhang mit der durch den Irak bereits Ende 2000 durchgeführten Währungsumstellung vom Dollar zum Euro sah:
"Saddam sealed his fate when he decided to switch to the euro in late 2000 (and later converted his $10 billion reserve fund at the U.N. to euros) -- at that point, another manufactured Gulf War become inevitable under Bush II. Only the most extreme circumstances could possibly stop that now and I strongly doubt anything can -- short of Saddam getting replaced with a pliant regime.
Big Picture Perspective: Everything else aside from the reserve currency and the Saudi/Iran oil issues (i.e. domestic political issues and international criticism) is peripheral and of marginal consequence to this administration. Further, the dollar-euro threat is powerful enough that they will rather risk much of the economic backlash in the short-term to stave off the long-term dollar crash of an OPEC transaction standard change from dollars to euros. All of this fits into the broader Great Game that encompasses Russia, India, China."
Die gut geölte Dollar-Presse
"Wann werden wir Öl in Euros bezahlen?" fragt auch Faisal Islam im Wirtschaftsteil des Oberserver. Er führt aus, dass die üblichen wirtschaftlichen Regeln für die USA außer Kraft gesetzt sind durch die internationale Rolle des Dollars. Denn etwa drei Billionen Dollar sind weltweit in Umlauf und ermöglichen den USA ihr praktisch permanentes Handelsdefizit. Zwei Drittel des Welthandels werden in Dollar abgewickelt. Zwei Drittel der Devisenreserven der Zentralbanken in aller Welt lauten ebenfalls auf die grünen Scheine.
Die meisten Länder benötigen Dollars, um Öl zu kaufen. Die Öl-Exporteure halten aus diesem Grund Milliarden der Währung, in der sie bezahlt werden, als Währungsreserve. Für sie besteht praktisch auch kein Währungsrisiko, wenn sie diese Petro-Dollar gleich wieder in die US-Wirtschaft investieren. So brauchen die USA dann ständig nur weiter Geld zu drucken wie eine Art von Schuldscheinen, um sich damit Steuererleichterungen, erhöhte Militärausgaben und wachsenden Konsum zugleich leisten zu können, ohne dadurch Inflation oder eine Rückforderung der Schulden befürchten zu müssen. Als Hüter der weltweiten Währung können sie im Notfall jederzeit den Dollar abwerten und die Exporteure anderer Länder für ihre angewachsenen wirtschaftlichen Probleme bezahlen lassen.
Doch nun kommt der Euro, der nach seinem Fehlstart zunehmend an Wertschätzung gewinnt. Sein Währungsgebiet bekommt mit der EU-Erweiterung eine vergleichbare wirtschaftliche Grundlage wie der US-Dollar. Der zunehmende Vertrauensverlust gegenüber der amerikanischen Wirtschaft stärkt den Euro. Die Euro-Zone ist der größte Öl-Importeur der Welt, und der Nahe Osten bezieht 45 Prozent seiner Importe aus Europa. Die Parlamente von Iran und Russland haben über eine mögliche Übernahme des Euro für Ölverkäufe debattiert. Die meisten Länder der OPEC haben ein überwiegendes Interesse am Euro als Ölwährung. Verhindert hat die Ablösung des Dollars bislang vor allem Saudi-Arabien. Der frühere US-Botschafter in Saudi-Arabien erklärte im Jahr 2002 einem Kongress-Komitee:
"One of the major things the Saudis have historically done, in part out of friendship with the United States, is to insist that oil continues to be priced in dollars. Therefore, the US Treasury can print money and buy oil, which is an advantage no other country has. With the emergence of other currencies and with strains in the relationship, I wonder whether there will not again be, as there have been in the past, people in Saudi Arabia who raise the question of why they should be so kind to the United States."
Was macht die OPEC?
Eine Schlüsselrolle spielt jetzt neben der Euroland-Entwicklung das Ölkartell OPEC, das mit der erfolgten Besetzung des Irak einem erhöhten Druck der USA ausgesetzt ist. Werden die OPEC-Länder sich dem Druck beugen oder auf ihre Weise wehren?
Entscheidend wird sein, wie sich Saudi-Arabien in Zukunft verhält, das neokonservative US-Falken ja auch bereits ins Visier genommen haben. Was kann und wird die künftige Währungsstrategie der OPEC-Länder beeinflussen? Überlegungen zu einem Wechsel zum Petro-Euro jedenfalls gibt es auch bei der OPEC schon länger. In einem seinerzeit nur wenig beachteten Vortrag The Choice of Currency for the Denomination of the Oil Bill in Spanien während der spanischen EU-Präsidentschaft im April 2002 sah Javad Yarjani, Leiter des Petroleum Market Analysis Department der OPEC, einen Währungsumstieg allerdings aufgrund der damaligen Euroschwäche noch eher in der mittleren oder fernen Zukunft:
"However, while the euro has the potential to be a viable competitor and possible alternative to the dollar in international financial and commodity markets in the medium to long term, its external weakness to date has meant it has been unable to gain inroads in the last two years. From the time the euro was floated in January 1999, the currency drifted downwards, losing by October 2000 about 30 per cent of its initial value against the dollar. It has since regained some of this lost ground, but is still far removed from parity with the dollar and even further removed from its starting value."
Das Argument mit dem im Vergleich zum Dollar schwachen Euro ist inzwischen offensichtlich erledigt. Der Euro darf in absehbarer Zukunft als stabilere Währung im Vergleich zum Dollar gelten. Einen möglicherweise entscheidenden Anstoß zum Petro-Euro sah der OPEC-Analyst im offiziellen Nennwert der Nordseesorte Brent-Öl, die mit einem Wechsel der Öl-Produzenten Norwegen und Großbritannien zum Euro kommen könnte:
"Of major importance to the ultimate success of the euro, in terms of the oil pricing, will be if Europe`s two major oil producers - the United Kingdom and Norway join the single currency. Naturally, the future integration of these two countries into the Euro-zone and Europe will be important considering they are the region`s two major oil producers in the North Sea, which is home to the international crude oil benchmark, Brent. This might create a momentum to shift the oil pricing system to euros."
Aus genau diesem Grund nun ruft der eingangs erwähnte George Monbiot insbesondere auch seine globalisierungskritischen Landsleute auf, zu denen er sich selbst zählt, sich für die bisher eher kritisch gesehene Übernahme des Euro einzusetzen. Er sieht sogar eine moralische Verpflichtung darin, sich zusammen mit dem Rest der Welt der Hegemonialmacht USA zu widersetzen:
"To defend our sovereignty - and that of the rest of the world - from the US, we must yield some of our sovereignty to Europe."


Bilanzskandale
Enron und Worldcom wollen Steuern auf getürkte Gewinne zurück
02. Mai 2003 Amerikanische Unternehmen, die im Zuge der Bilanzskandale im vergangenen Jahr negative Schlagzeilen machten, wollen Steuern zurückfordern, die sie auf ihre fälschlich aufgeblasenen Gewinne gezahlt haben. Das berichtete das „Wall Street Journal“ am Freitag.
Der Telekomkonzern Worldcom, der sich gerade in MCI umgenannt hat, wolle mindestens 300 Millionen Dollar zurückverlangen. Worldcom mußte im vergangenen Jahr Gläubigerschutz beantragen, nachdem ans Licht kam, daß das Unternehmen mit illegalen Bilanztricks seine Einnahmen weit übertrieben hatte. Die Finanzmanager wollten damit die Erwartungen von Analysten nicht enttäuschen, was den Aktienpreis belastet hätte.
Auch das Energieunternehmen Enron, das als erstes vor 16 Monaten in einem Bilanzskandal unterging, wolle Rückzahlungen beantragen. Das Unternehmen hatte allerdings von 1996 bis 2001 ohnehin nur 63 Millionen Dollar an Steuern gezahlt. Enron befinde sich in „Diskussionen“ mit den Steuerbehörden, sagte ein Sprecher der Zeitung.
dpa

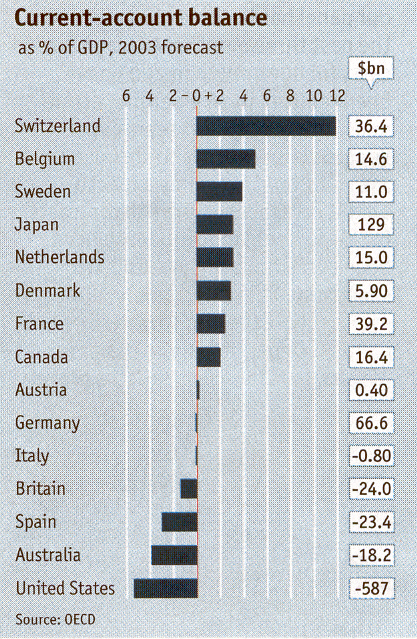

Passt hier ebenfalls sehr schön rein, deshalb eine Kopie auch an Dich, damit ich mir die ganze Mühe nicht umsonst machte.
Das amerikanische Betrügersystem - hier: so agiert und manipuliert das Plunge Protection Team die Wall Street etc.
Hier die Hauptdarsteller (oder sollte man sagen: Verbrecher) dieser schlechten Initierung:
1. Alan Greenspan (Chearman der amerikanischen Federal Reserve = Fed)
2. Finanzminister John Snow
3. Goldman-Sachs-Boss Henry M. Pauson
4. Merrill-Lynch-Chef Stanley O`Neil
5. Wall-Street-Einpeicherin und Goldman-Sachs-Staranalystin Abby Cohen
Vorgehensweise - Operation "Markteingriff" - wie das Plunge Protection Team funktioniert und Aktienmärkte manipuliert:
1. Das Treffen
Das Plunge Protection Team aus Notenbankern, Finanzpolitikern und Wall-Street-Größen tagt regelmäßig. Informationen erhält das Team reichlich. Behörden, so die Verfügung 12631, "sollen", unter Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse, der Gruppe alle Informationen zuleiten, die sie benötigen."
2. Die Abstimmung
"Wir haben die Festnetz und Handy-Nummern der anderen Teilnehmer", sagt ein ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe. Kommt es zu einer finanziellen Krise, startet das Team durch. Alle Behörden des Plunge Protection Team, so berichten Insider, greifen dann auf einen Notfallplan zurück.
3. Der Einsatzbeginn
Das Plunge Protection Team nutzt frisches gedrucktes Geld der US-Notenbank, um den Aktienmärkt zu stabilisieren. Gewöhnlich beginnen die Interventionen um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. (Eigener Gedanke: Mittlerweile wird das Spiel bereits vorbörsich über Dollar-Interventionen und Käufe im Terminhandel über Terminkontrakte eröffnet, um eine positive Grundhaltung bei den Lemmingen zu erzeugen und um Shorts zu verhindern, da als Folge des 11. September 2001 das Shorten in den USA nicht mehr auf fallende Kurse gestattet ist - nur noch bei steigenden oder stagnierenden Kursen!) Die Notenbank und die verbündeten Investmentbanken kaufen Terminkontrakte und Aktien - etwa von ängstlichen Aktienfondsmanagern.
4. Die Deals
Die Investmentbanken des Plunge Protection Teams kaufen massiv Aktienindex-Futures. Zu erahnen an den Blocktrades, die immer wieder im Future - wie z.B. bei www.d-traderz.com, dann Link "US-Trading Charts- und RT-Kurse, auftauchen. Trotz relativ geringen Kapitaleinsatz erzielen sie so maximale Wirkung. Die Börsen stabilisieren sich. Zu dem Einsatz dieser Derivate riet schon 1989 der ehemalige Notenbank-Gouverneur Robert Heller.
5. Die Wirkung
Schnell sickert durch, dass bedeutende Investmentbanken kaufen. Andere Banken und Broker-Häuser ziehen nach - die Aktienindizes schiessen nach oben. Verstärkt wird dieser Effekt durch optimistischer Stimmen einflussreicher Analysten wie beispielsweise Goldman-Sachs-Staranalystin Abby Cohen. Bei der Nasdaq gestaltete sich das Unterfangen allerdings schwieriger.
6. Die Einpeicherin der Wall Street und die Lemminge
Goldman-Sachs-Analystin Abby Cohen´s unheimliche Trefferquote. Was hat es mit ihrem Mythos auf sich? Welche Rolle spielt sie in diesem ominösen Spiel?
Die Staranalystin Abby Cohen von Goldman Sachs, gilt als die staatliche Einpeicherin der Wall-Street-Optimisten. Selbst in den vergangen drei Jahren der Tristesse geriet sie nie in Panik. Das begründen manche mit ihrer Nähe zum Plunge Protection Team.
"Steht auf! Zeit, Aktien zu kaufen", schreib sie etwa am 24. September 2001 an wichtige Kunden. Tags zuvor hatte der Dow Jones mit Mühe und Not die 8.000er Marke gehalten.
Am 22. Juli 2002 begeisterte Cohen ihre Anhänger erneut. "Aktien sind zu billig." Auch diese Äußerung fiel mit einem Dow-Tief und einer möglichen Intervention des Plunge Protection Team zusammen.
Das unsichtbare Netz
Es war einer dieser Tage, die auch Fachleute ratlos hinterlassen. In den ersten vier Handelsstunden des 4. Apirls 2000 verlor der Dow Jones fünf und der Nasdaq sogar 15 Prozent. Zwei Stunden später beendete der Schlussgong der New Yorker Börsen eine Aufholjagd, die beide Barometer fast noch ins Plus gehievt hätte - ohne einen nenneswerten Grund. "Als ob Gott selbst interveniert hätte", staunte tags darauf die "New York Post".
Koordinierte Aktionen.
Manche vermuten eine andere Instituion in der in solchen Augenblicken die Drähte heiß glühen. "Plunge Protection Team" (= eingreifende Schutzmannschaft) heißt im Finanzjargon ein Zusammenschluss von Notenbankern, Finanzpolitikern und Wall-Street-Größen. Die Gruppe, so vermuten immer mehr Insider, ziehe die Märkte mit gezielten, eng koordinierten Stützungsaktionen wie etwa am 4. April 2000 nach oben. Das Team geht auf die Direktive 12631 zurück, die der damalige US-Präsident Ronald Reagan im März 19888 als Antwort auf den Crash 1987 erließ. Der Finanzministe, der Chef der US-Notenbank und die Vorzitzenden der Wertpapieraufsichtsbehörde und der Terminmarkt-Handels-Kommission treffen sich seitdem in regelmäßigen Abständen in einer "Arbeitsgruppe für die Finanzmärkte".
Schon vor der Reagan-Regierung wurde das Ziel der Gruppe formuliert: Das Vertrauen des US-Investoren bewahren." Inzwischen soll das Anti-Absturz-Team auf 35 Mitglieder angeschwollen sein, darunter einflusssreiche Banker wie Goldman-Sachs-Chef Henry Paulson und Merrill-Lynch-Boss Stanley O`Neal (die - welch´ Zufall - ja erst unlängst "das Ende der Baisse" ausriefen) die die schnellen Eingreiftruppen in den Handelsräumen der Wall Street steuern. "Den Amerikanern soll gezeigt werden, dass die Flagge noch über der Wall Street weht", sagt der US-Finanzanalyst Robin Aspinall.
Finanzspritze für die Shopper. Nicht nur der Dow, auch die US-Wirtschaft und ihre Bürger erhalten Hilfe. Sprichen will über die Kreditspirale, die sich im halbstaatlichen Kreditsektor immer schneller dreht (dazu später noch viel aufschlussreiches), offiziell niemand. Doch in den Bilanzen der unter Staatseinfluss stehenden Hpyothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac finden sich ihre Spuren: Die beiden Institute haben ihre Kredite seit 1997 auf knapp 1,4 Billionen Dollar fast verdreifacht (wobei das Eigenkapital, was dem entgegensteht, aberwitzigerweise in dem gleichen Zeitraum bei "nur" lächerlichen 20 Milliarden stagniert). Der Clou: Dank ihrer Staatsnähe können die Hypotkenbanken die Ausleihung zu US-Regierungskonditionen refinanzieren. Mit Hilfe dieser Finanzspritzen können die Verbraucher ihre teuren Kreditkartenkonten umschulden und zum Wohl der amerikanischen Wirtschaft wieder auf Einkaufstour gehen - vorerst.
Die Stützungsaktionen im Immobilien- und Aktienmarkt zeigen Wirkung. Der Dow Jones verlor seit Anfang 2000 lediglich 20 Prozent. Die US-Immobilien verteuerten sich seit Anfang 2000 sogar um 22 Prozent - trotz Konjunkturflaute und New-Economy-Krise. (Droht hier eine Immobilienblase? Denn wehe, wenn die Immobilienpreise fallen...) Durch den Hausboom, den die lockere Kreditpolitik von Fannie Mae und Freddie Mac erst ermöglichste, fühlen sich viele US-Bürger weit reicher, als sie tatsächlich sind - eine psychologische Unterstützung für Aktienmärkte und Konsumklima.
Auch das Plunge Protection Team leistet bisher solide Arbeit. Das Schema ist immer das gleiche. Mit der Notenbank im Boot stellt die Gruppe Milliarden neue US-Dollar für den Einsatz an der Börse zur Verfügung. Massive Käufe von Aktienindex-Futures durch die Investementbanken bringen dann die Wende. Mit diesen Derivaten setzen Profis nur einen Bruchteil der Summe ein, die zum Kauf des Index notwendig wäre. Trittbrettfahrer springen auf und treiben das Börsenbarometer nach oben. Die Banken erschweren gleichzeitig den Leerverkauf von Aktien, etwa durch ene Vergrößerung der An- und Verkaufsspanne. Dieses Verfahren funktionierte beim Kollaps des Hedge-Fonds-Giganten LTCM 1998 offenbar genauso wie kürzlich beim Ausbruch des Irak-Kriegs. Außerdem ist das Shorten an der Wall Street und im Nasdaq nur noch auf steigende oder stagnierende Kurse erlaubt, nicht mehr auf fallende Kurse, als Folge des 11. September 2001.
Doch die Risiken sind enorm. Scheitert die Investition, sitzen Investmentbanken (denen ein Bankrott drohen) und Notenbank auf einem Berg von (Buch-) Verlusten. (Werden wir dies noch erleben?)
Um weitere Einbußen zu vermeiden, müssen sie auf fallende Kurse wetten, um ihre Spekulationen auf die Hausse zu neutralisieren. Mit diesem Glattstellen beschleunigen sie aber ungewollt die Abwärtsbewegung.
Enorme Bonitätsrisiken. Dazu kommen die Gefahren aus dem Immobliliengeschäft. Fannie Mae und Freddie Mac tragen jetzt die Bonitätsrisiken für die Hälfte des US-Immobilienmarkts - mit wachsender Tendenz. Rund 71 Prozent aller Neukredite an Private gehen inzwischen auf ihr Konto. Die Gegenfinanzierung der wuchernden Kredite läuft über neue Anleihen. Brisant: Ausländische Versicherer und Banken kauften allein in den vergangenen drei Jahren Papiere im Wert von rund 500 Milliarden Dollar und vertrauten dabei auf den Status von Fannie und Freddie als "Goverment Sponsored Enterprises". Tatsächlich fehlt jedoch die explizite Staatsgarantie.
Noch scheint das US-Establishment entschlossen, an den marktfremden Eingriffen unter allen Umständen festzuhalten. "Die Regierung besitzt die Hochtechnologie, so viele Dollars wie gewünscht zu drucken - die Druckpresse", verkündigte Ben Bernanke, US-Notenbank-Gouverneur, erst im November 2002. Noch deutlicher wurde ein leitender Greenspan-Mitarbeiter wenige Monate zuvor: "Die Notenbank könnte theoretisch alles kaufen, um Geld ins System zu pumpen." (Eigene Amerkung: Völlig falsch, da ab einem bestimmten Zeitpunkt das Geld keinen Gegenwert mehr besitzt, dank der Notenbank-Deppen! Dazu hat man offensichtlich nicht gesehen, was die US-Hochtechnologie des Turbo-Kapitalismus um die TMT-und Internet-Aktienhausse für Folgen in der Realwirtschaft mit sich brach? Und über die Folgen des eigenen Tuens und Handelns scheint man sich seitens der Notenbank auch nicht im klaren zu sein. Denn nichts bleibt ohne Folgen und ohne Risiken und Nebenwirkungen in der Wirtschaft!)
Dazu läuft die US-Geldmenge seit einigen Monaten aus dem Ruder: statt der üblichen Geldmengenausweitung von ca. 2 Prozent beläuft sich die Geldmengenausweitung jetzt schon auf 8 Prozent!!!
Doch die Nervosität wächst, ungeachtet des öffentlich zur Schau gestellten Zweckoptimismus. Armando Falcon, Chef der Aufsicht über die Hypothekenbanken und damit auch Wächter über Fannie Mae und Freddie Mac, erhielt am 5. Februar überraschend die Kündigung. Der Rauswurf kam nur Stunden vor einer Rede Falcons in New York. Thema: Risiken für das US-Finanzsystem durch die beiden Immoblilienbanken.
Und dies sind die Risiken und Nebenwirkungen der beiden unter Staatseinfluss stehenden ypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac, die sage und schreibe 71 Prozent aller Neukredite an Private vergeben: Bisher finden Fannie- und Freddie-Anleihen, und mit denen die Kredite gegenfinanziert werden, reißenden Absatz. Wegen der Regierungsnähe gehen Versicherungen und Banken von einer Staatsgarantie aus. Tatsächlich fehlt jedoch die explizite Garantie. William Poole, US-Notenbank-Gouverneur von St. Louis, warnt: "Beide Häuser könnten zu einem Systemrisiko für die internationalen Kapitalmärkte werden! Zumal der Kreditvergabe von sage und schreibe 1,4 Billiarden US-Dollar "nur" einer Deckung von lächerlichen 20 Milliarden US-Dollar gegenübersteht. Dabei ging dem eine Verdreichfachung der Kreditvergabe seit 1997 voraus, während die Eigenkapitalquote im gleichen Zeitraum stagnierte.
Quelle: Focus Money 15/2003 vom 3. April 2003, S. 14 ff
ENDE
PS.: (Eigene Anmerkung) KGV der im S&P gelisteten Aktien beträgt absurde 27 für 2003, während im historischen Vergleich gerade mal 15 als angemessen erachtet wird. Sagt wohl alles über die US-Manipulationsmaschinerie und das zukünftige Aufwärtspotential an der Wall Street aus.
Das amerikanische Betrügersystem - hier: so agiert und manipuliert das Plunge Protection Team die Wall Street etc.
Hier die Hauptdarsteller (oder sollte man sagen: Verbrecher) dieser schlechten Initierung:
1. Alan Greenspan (Chearman der amerikanischen Federal Reserve = Fed)
2. Finanzminister John Snow
3. Goldman-Sachs-Boss Henry M. Pauson
4. Merrill-Lynch-Chef Stanley O`Neil
5. Wall-Street-Einpeicherin und Goldman-Sachs-Staranalystin Abby Cohen
Vorgehensweise - Operation "Markteingriff" - wie das Plunge Protection Team funktioniert und Aktienmärkte manipuliert:
1. Das Treffen
Das Plunge Protection Team aus Notenbankern, Finanzpolitikern und Wall-Street-Größen tagt regelmäßig. Informationen erhält das Team reichlich. Behörden, so die Verfügung 12631, "sollen", unter Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse, der Gruppe alle Informationen zuleiten, die sie benötigen."
2. Die Abstimmung
"Wir haben die Festnetz und Handy-Nummern der anderen Teilnehmer", sagt ein ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe. Kommt es zu einer finanziellen Krise, startet das Team durch. Alle Behörden des Plunge Protection Team, so berichten Insider, greifen dann auf einen Notfallplan zurück.
3. Der Einsatzbeginn
Das Plunge Protection Team nutzt frisches gedrucktes Geld der US-Notenbank, um den Aktienmärkt zu stabilisieren. Gewöhnlich beginnen die Interventionen um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. (Eigener Gedanke: Mittlerweile wird das Spiel bereits vorbörsich über Dollar-Interventionen und Käufe im Terminhandel über Terminkontrakte eröffnet, um eine positive Grundhaltung bei den Lemmingen zu erzeugen und um Shorts zu verhindern, da als Folge des 11. September 2001 das Shorten in den USA nicht mehr auf fallende Kurse gestattet ist - nur noch bei steigenden oder stagnierenden Kursen!) Die Notenbank und die verbündeten Investmentbanken kaufen Terminkontrakte und Aktien - etwa von ängstlichen Aktienfondsmanagern.
4. Die Deals
Die Investmentbanken des Plunge Protection Teams kaufen massiv Aktienindex-Futures. Zu erahnen an den Blocktrades, die immer wieder im Future - wie z.B. bei www.d-traderz.com, dann Link "US-Trading Charts- und RT-Kurse, auftauchen. Trotz relativ geringen Kapitaleinsatz erzielen sie so maximale Wirkung. Die Börsen stabilisieren sich. Zu dem Einsatz dieser Derivate riet schon 1989 der ehemalige Notenbank-Gouverneur Robert Heller.
5. Die Wirkung
Schnell sickert durch, dass bedeutende Investmentbanken kaufen. Andere Banken und Broker-Häuser ziehen nach - die Aktienindizes schiessen nach oben. Verstärkt wird dieser Effekt durch optimistischer Stimmen einflussreicher Analysten wie beispielsweise Goldman-Sachs-Staranalystin Abby Cohen. Bei der Nasdaq gestaltete sich das Unterfangen allerdings schwieriger.
6. Die Einpeicherin der Wall Street und die Lemminge
Goldman-Sachs-Analystin Abby Cohen´s unheimliche Trefferquote. Was hat es mit ihrem Mythos auf sich? Welche Rolle spielt sie in diesem ominösen Spiel?
Die Staranalystin Abby Cohen von Goldman Sachs, gilt als die staatliche Einpeicherin der Wall-Street-Optimisten. Selbst in den vergangen drei Jahren der Tristesse geriet sie nie in Panik. Das begründen manche mit ihrer Nähe zum Plunge Protection Team.
"Steht auf! Zeit, Aktien zu kaufen", schreib sie etwa am 24. September 2001 an wichtige Kunden. Tags zuvor hatte der Dow Jones mit Mühe und Not die 8.000er Marke gehalten.
Am 22. Juli 2002 begeisterte Cohen ihre Anhänger erneut. "Aktien sind zu billig." Auch diese Äußerung fiel mit einem Dow-Tief und einer möglichen Intervention des Plunge Protection Team zusammen.
Das unsichtbare Netz
Es war einer dieser Tage, die auch Fachleute ratlos hinterlassen. In den ersten vier Handelsstunden des 4. Apirls 2000 verlor der Dow Jones fünf und der Nasdaq sogar 15 Prozent. Zwei Stunden später beendete der Schlussgong der New Yorker Börsen eine Aufholjagd, die beide Barometer fast noch ins Plus gehievt hätte - ohne einen nenneswerten Grund. "Als ob Gott selbst interveniert hätte", staunte tags darauf die "New York Post".
Koordinierte Aktionen.
Manche vermuten eine andere Instituion in der in solchen Augenblicken die Drähte heiß glühen. "Plunge Protection Team" (= eingreifende Schutzmannschaft) heißt im Finanzjargon ein Zusammenschluss von Notenbankern, Finanzpolitikern und Wall-Street-Größen. Die Gruppe, so vermuten immer mehr Insider, ziehe die Märkte mit gezielten, eng koordinierten Stützungsaktionen wie etwa am 4. April 2000 nach oben. Das Team geht auf die Direktive 12631 zurück, die der damalige US-Präsident Ronald Reagan im März 19888 als Antwort auf den Crash 1987 erließ. Der Finanzministe, der Chef der US-Notenbank und die Vorzitzenden der Wertpapieraufsichtsbehörde und der Terminmarkt-Handels-Kommission treffen sich seitdem in regelmäßigen Abständen in einer "Arbeitsgruppe für die Finanzmärkte".
Schon vor der Reagan-Regierung wurde das Ziel der Gruppe formuliert: Das Vertrauen des US-Investoren bewahren." Inzwischen soll das Anti-Absturz-Team auf 35 Mitglieder angeschwollen sein, darunter einflusssreiche Banker wie Goldman-Sachs-Chef Henry Paulson und Merrill-Lynch-Boss Stanley O`Neal (die - welch´ Zufall - ja erst unlängst "das Ende der Baisse" ausriefen) die die schnellen Eingreiftruppen in den Handelsräumen der Wall Street steuern. "Den Amerikanern soll gezeigt werden, dass die Flagge noch über der Wall Street weht", sagt der US-Finanzanalyst Robin Aspinall.
Finanzspritze für die Shopper. Nicht nur der Dow, auch die US-Wirtschaft und ihre Bürger erhalten Hilfe. Sprichen will über die Kreditspirale, die sich im halbstaatlichen Kreditsektor immer schneller dreht (dazu später noch viel aufschlussreiches), offiziell niemand. Doch in den Bilanzen der unter Staatseinfluss stehenden Hpyothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac finden sich ihre Spuren: Die beiden Institute haben ihre Kredite seit 1997 auf knapp 1,4 Billionen Dollar fast verdreifacht (wobei das Eigenkapital, was dem entgegensteht, aberwitzigerweise in dem gleichen Zeitraum bei "nur" lächerlichen 20 Milliarden stagniert). Der Clou: Dank ihrer Staatsnähe können die Hypotkenbanken die Ausleihung zu US-Regierungskonditionen refinanzieren. Mit Hilfe dieser Finanzspritzen können die Verbraucher ihre teuren Kreditkartenkonten umschulden und zum Wohl der amerikanischen Wirtschaft wieder auf Einkaufstour gehen - vorerst.
Die Stützungsaktionen im Immobilien- und Aktienmarkt zeigen Wirkung. Der Dow Jones verlor seit Anfang 2000 lediglich 20 Prozent. Die US-Immobilien verteuerten sich seit Anfang 2000 sogar um 22 Prozent - trotz Konjunkturflaute und New-Economy-Krise. (Droht hier eine Immobilienblase? Denn wehe, wenn die Immobilienpreise fallen...) Durch den Hausboom, den die lockere Kreditpolitik von Fannie Mae und Freddie Mac erst ermöglichste, fühlen sich viele US-Bürger weit reicher, als sie tatsächlich sind - eine psychologische Unterstützung für Aktienmärkte und Konsumklima.
Auch das Plunge Protection Team leistet bisher solide Arbeit. Das Schema ist immer das gleiche. Mit der Notenbank im Boot stellt die Gruppe Milliarden neue US-Dollar für den Einsatz an der Börse zur Verfügung. Massive Käufe von Aktienindex-Futures durch die Investementbanken bringen dann die Wende. Mit diesen Derivaten setzen Profis nur einen Bruchteil der Summe ein, die zum Kauf des Index notwendig wäre. Trittbrettfahrer springen auf und treiben das Börsenbarometer nach oben. Die Banken erschweren gleichzeitig den Leerverkauf von Aktien, etwa durch ene Vergrößerung der An- und Verkaufsspanne. Dieses Verfahren funktionierte beim Kollaps des Hedge-Fonds-Giganten LTCM 1998 offenbar genauso wie kürzlich beim Ausbruch des Irak-Kriegs. Außerdem ist das Shorten an der Wall Street und im Nasdaq nur noch auf steigende oder stagnierende Kurse erlaubt, nicht mehr auf fallende Kurse, als Folge des 11. September 2001.
Doch die Risiken sind enorm. Scheitert die Investition, sitzen Investmentbanken (denen ein Bankrott drohen) und Notenbank auf einem Berg von (Buch-) Verlusten. (Werden wir dies noch erleben?)
Um weitere Einbußen zu vermeiden, müssen sie auf fallende Kurse wetten, um ihre Spekulationen auf die Hausse zu neutralisieren. Mit diesem Glattstellen beschleunigen sie aber ungewollt die Abwärtsbewegung.
Enorme Bonitätsrisiken. Dazu kommen die Gefahren aus dem Immobliliengeschäft. Fannie Mae und Freddie Mac tragen jetzt die Bonitätsrisiken für die Hälfte des US-Immobilienmarkts - mit wachsender Tendenz. Rund 71 Prozent aller Neukredite an Private gehen inzwischen auf ihr Konto. Die Gegenfinanzierung der wuchernden Kredite läuft über neue Anleihen. Brisant: Ausländische Versicherer und Banken kauften allein in den vergangenen drei Jahren Papiere im Wert von rund 500 Milliarden Dollar und vertrauten dabei auf den Status von Fannie und Freddie als "Goverment Sponsored Enterprises". Tatsächlich fehlt jedoch die explizite Staatsgarantie.
Noch scheint das US-Establishment entschlossen, an den marktfremden Eingriffen unter allen Umständen festzuhalten. "Die Regierung besitzt die Hochtechnologie, so viele Dollars wie gewünscht zu drucken - die Druckpresse", verkündigte Ben Bernanke, US-Notenbank-Gouverneur, erst im November 2002. Noch deutlicher wurde ein leitender Greenspan-Mitarbeiter wenige Monate zuvor: "Die Notenbank könnte theoretisch alles kaufen, um Geld ins System zu pumpen." (Eigene Amerkung: Völlig falsch, da ab einem bestimmten Zeitpunkt das Geld keinen Gegenwert mehr besitzt, dank der Notenbank-Deppen! Dazu hat man offensichtlich nicht gesehen, was die US-Hochtechnologie des Turbo-Kapitalismus um die TMT-und Internet-Aktienhausse für Folgen in der Realwirtschaft mit sich brach? Und über die Folgen des eigenen Tuens und Handelns scheint man sich seitens der Notenbank auch nicht im klaren zu sein. Denn nichts bleibt ohne Folgen und ohne Risiken und Nebenwirkungen in der Wirtschaft!)
Dazu läuft die US-Geldmenge seit einigen Monaten aus dem Ruder: statt der üblichen Geldmengenausweitung von ca. 2 Prozent beläuft sich die Geldmengenausweitung jetzt schon auf 8 Prozent!!!
Doch die Nervosität wächst, ungeachtet des öffentlich zur Schau gestellten Zweckoptimismus. Armando Falcon, Chef der Aufsicht über die Hypothekenbanken und damit auch Wächter über Fannie Mae und Freddie Mac, erhielt am 5. Februar überraschend die Kündigung. Der Rauswurf kam nur Stunden vor einer Rede Falcons in New York. Thema: Risiken für das US-Finanzsystem durch die beiden Immoblilienbanken.
Und dies sind die Risiken und Nebenwirkungen der beiden unter Staatseinfluss stehenden ypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac, die sage und schreibe 71 Prozent aller Neukredite an Private vergeben: Bisher finden Fannie- und Freddie-Anleihen, und mit denen die Kredite gegenfinanziert werden, reißenden Absatz. Wegen der Regierungsnähe gehen Versicherungen und Banken von einer Staatsgarantie aus. Tatsächlich fehlt jedoch die explizite Garantie. William Poole, US-Notenbank-Gouverneur von St. Louis, warnt: "Beide Häuser könnten zu einem Systemrisiko für die internationalen Kapitalmärkte werden! Zumal der Kreditvergabe von sage und schreibe 1,4 Billiarden US-Dollar "nur" einer Deckung von lächerlichen 20 Milliarden US-Dollar gegenübersteht. Dabei ging dem eine Verdreichfachung der Kreditvergabe seit 1997 voraus, während die Eigenkapitalquote im gleichen Zeitraum stagnierte.
Quelle: Focus Money 15/2003 vom 3. April 2003, S. 14 ff
ENDE
PS.: (Eigene Anmerkung) KGV der im S&P gelisteten Aktien beträgt absurde 27 für 2003, während im historischen Vergleich gerade mal 15 als angemessen erachtet wird. Sagt wohl alles über die US-Manipulationsmaschinerie und das zukünftige Aufwärtspotential an der Wall Street aus.
Original geschrieben von RIVA
Macht das was? Bei der Gewinndynamik?
Weicher Dollar bringt US-Firmen auf Trab
Europas Quartalssaison fällt dagegen weit weniger glorreich aus - Kritische Euro-Marke liegt bei über 1,15 Dollar
von Holger Zschäpitz
Berlin - Der Euro macht den Unterschied. Während US-Unternehmen einen leichteren Dollar willkommen heißen, verhagelt die starke europäische Gemeinschaftswährung den Gesellschaften des alten Kontinents die Bilanzen. Einen ersten Vorgeschmack lieferte bereits die laufende Quartalssaison. Die amerikanischen Unternehmen schnitten in den ersten drei Monaten dieses Jahres überraschend gut ab, in Europa waren die Gewinnausweise dagegen gemischt.
"Die europäischen Konzerne sind hinter ihren US-Konkurrenten weit zurückgeblieben", sagt Gary Dugan, Stratege bei J.P. Morgan Fleming Asset Management, der die Quartalsberichte beiderseits des Atlantiks unter die Lupe genommen hat. "In den USA haben fast 80 Prozent der Unternehmen positiv überrascht. In Europa war das Verhältnis zwischen positiven und negativen Überraschungen nur ausgeglichen." Und nicht nur das. Auch beim Ausblick sieht es so aus, als ob amerikanische und europäische Unternehmen in unterschiedlichen Galaxien Geschäfte machten. Bei den US-Gesellschaften mussten die Analysten nach dem ersten Quartal 2003 ihre Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr nur noch leicht nach unten anpassen, für europäische Firmen ist der Revisionsbedarf noch wesentlich größer. Hier wurden die Ertragsprognosen allein Anfang Mai noch einmal um drei Prozent gekürzt.
Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist der Euro. Innerhalb eines Jahres hat die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar rund 29 Prozent an Wert gewonnen. Erst am Donnerstag markierte der Euro bei 1,1248 Dollar ein Vier-Jahreshoch. Doch nicht nur gegenüber dem Greenback lässt der Euro seine Muskeln spielen. Auch gegenüber dem Yen kletterte er auf ein Vier-Jahreshoch. Damit können viele europäische Exportfirmen ihre Gewinnprognosen über den Haufen schmeißen. Denn nicht nur die in Übersee, sondern auch die in Japan erwirtschafteten Gewinne sind bei der Umrechnung in Euro nun weniger wert. Gleichzeitig werden Euro-Produkte in Amerika und Asien teurer und damit verschlechtert sich die Wettbewerbsfähigkeit immens. Probleme bereitet den europäischen Gesellschaften dabei nicht nur der Anstieg an sich. Die Wucht, mit der der Euro nach oben schoss, ließ vielen Firmen keine Chance, sich rechtzeitig abzusichern. Als kritische Marke nennen viele Experten 1,15 Dollar. Viele hiesige Unternehmen haben einen Teil ihrer US-Gewinne zu diesem Kurs abgesichert. "Sollte der Euro auf 1,16 Dollar oder gar 1,20 Dollar klettern, brennt bei vielen Unternehmen die Hütte", sagt Hans Günter Redeker, Währungsstratege bei BNP Paribas.
Des einen Leid ist des andern Freud. Spiegelbildlich konnten die US-Konzerne ihre Gewinne durch den schwachen Dollar im ersten Quartal deutlich nach oben treiben. "Die Analysten haben die positiven Auswirkungen für die US-Konzerne unterschätzt", begründet Shaun Roache, Stratege der Citigroup die vielen positiven Überraschungen an der Wall Street. Beispiel Fast-Food-Weltmarktführer McDonalds: Allein der starke Euro bescherte der Hamburger-Kette einen zusätzlichen Gewinn von 127 Mio. Dollar - Analysten hatten ihre durchschnittlichen Prognosen genau diese Summe tiefer angesetzt.
Noch deutlicher zeigt sich der Euro-Einfluss bei europäischen und US-Unternehmen der gleichen Branche. So erntete der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft im ersten Quartal währungsbedingt einen Extra-Gewinn von 210 Mio. Dollar. Branchenzweiter SAP hatte dagegen Einbußen von 15 Mio. Euro zu verkraften.
Der starke Euro hat auch Einfluss auf die globalen Investitionen. "Wegen der starken Währungsverschiebungen dürfen US-Aktien auch höher bewertet sein", sagt Citigroup-Experte Roache. Und auch Stephen Lewis, Stratege bei Monumentum Securities, favorisiert im globalen Kontext US-Aktien: "Meines Erachtens ist der Euro-Anstieg noch nicht zu Ende."
Artikel erschienen am 3. Mai 2003, http://www.welt.de/data/2003/05/03/83180.html?search=Zsch%E4…
Weicher Dollar bringt US-Firmen auf Trab
das ist das mit abstand dümmste hohlste geschwätz das man momentan bringen kann.
die DM stand viel höher als der euro momentan und da ging´s auch.
nun heulen die deppen rum, die bei 80 cent die 65 cent sahen.
als die DM stark war, pushten sich die tollen amis mittels bilanztricks in die gewinnzone.
ziel für 1.18 im euro steht felsenfest
das ist das mit abstand dümmste hohlste geschwätz das man momentan bringen kann.
die DM stand viel höher als der euro momentan und da ging´s auch.
nun heulen die deppen rum, die bei 80 cent die 65 cent sahen.

als die DM stark war, pushten sich die tollen amis mittels bilanztricks in die gewinnzone.
ziel für 1.18 im euro steht felsenfest

http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/14737/1.html
Ist es Zufall?
Ronda Hauben 06.05.2003
Die Nationale Kommission zur Untersuchung der Ereignisse vom 11.9. hat die ersten Anhörungen durchgeführt, die Bush-Regierung blockiert weiter die Aufklärung
Seit der Tragödie vom 11. September sind fast 20 Monate vergangen. Die Fragen, die durch diese Ereignisse entstehen, müssen in den USA erst noch durch eine öffentliche Untersuchung geklärt werden. Der Widerstand der Bush-Administration gegenüber der notwendigen öffentlichen Untersuchung hatte ein bedeutendes Hindernis dargestellt. Das ist desto mehr eine Anklage der Bush-Regierung, da sie das Mantra des 11. Septembers verwendet hatte, um einen Krieg gegen Dissidenten und Bürgerrechte im Land und gegen die Zivilbevölkerungen und Regierungen im Ausland zu führen.
Ein aktueller Artikel in Newsweek mit dem Titel Die Geheimnisse des 11. Septembers fragt, warum der 800seitige Bericht des gemeinsamen Ausschusses des Senats und des Repräsentantenhauses noch nicht veröffentlicht wurde. Der Bericht liegt seit dem 27. November 2002 vor. Er wurde einer Arbeitsgruppe der Bush-Regierung zur Überprüfung übergeben. Nach dem Newsweek-Artikel bereiten der demokratische Senator Bob Graham and der republikanische Abgeordnete Porter Goss, die Vorsitzenden der beiden Geheimdienste-Ausschüsse, die für die Untersuchung eingetreten sind, einen Beschwerdebrief an Vizepräsident Dick Cheney vor.
Es besteht auch die Sorge, ob der Bericht überhaupt der neuen Kommission, die zur Untersuchung der Ereignisse vom 11. September einberufen wurde, zugänglich gemacht werden wird. Die Nationale Kommission über die Terrorangriffe auf die Vereinigten Staaten wurde erst eingerichtet, nachdem Familienangehörige von Getöteten von der US-Regierung eine öffentliche Untersuchung verlangt hatten. Die Familien waren von der fehlenden Unterstützung durch die Regierung oder der fehlenden Finanzierung für die Untersuchung kalt gestellt worden. Während 40 Millionen US-Dollar für die Aufklärung der Columbia-Katastrophe bewilligt wurden, wurden für die Nationale Kommission zur Untersuchung der Terrorangriffe nur 3 Millionen zur Verfügung gestellt. Auch die Untersuchung des Senats und des Repräsentantenhauses hatte nur ein Budget von 3 Millionen US-Dollar.
Die erste öffentliche Anhörung am 31. März und am 1. April 2003 wurde vom Irak-Krieg überschattet. Mindy Kleinberg, deren Mann beim Anschlag auf das World Trade Center getötet wurde, zählte bei der Anhörung eine Reihe von Fragen auf und bat die Kommission, diese zu untersuchen. In ihrer Aussage fragte sie:
"Ist es ein Zufall, dass abweichende Wertpapiergeschäfte nicht beobachtet wurden? Ist es ein Zufall, dass 14 Visa aufgrund unvollständig angegebener Daten ausgegeben wurden? Ist es ein Zufall, wenn die Sicherheitsüberprüfung am Flugplatz es den Entführern ermöglichte, Flugzeuge mit Teppichmessern und Pfefferspray zu besteigen? Ist es ein Zufall, wenn Notfallmeldungen der Flugsicherheitsbehörde FAA und NORAD-Protokollen nicht nachgegangen wird? Ist es Zufall, wenn ein nationaler Notstand nicht rechtzeitig an hohe Regierungsangehörige berichtet wird? Für mich ist Zufall etwas, das einmal geschieht. Wenn man dieses wiederholte Muster von misslungenen Protokollen, Gesetzen und Kommunikationen betrachtet, dann lässt sich das nicht mehr als Zufall verstehen. Wenn wir nicht ab einem gewissen Punkt die Personen verantwortlich zu machen suchen, die ihre Aufgabe nicht ordentlich erfüllt haben, wie können wir dann jemals erwarten, dass Terroristen nicht wieder ihren Zufall finden? Wir müssen die Antworten auf das finden, was an diesem Tag geschehen ist, um sicher zu stellen, dass ein weiterer 11. September nicht wieder geschehen kann."
Es gibt weiterhin Forderungen von den Familien der Opfer des 11.9. und von Bürgern nach einer öffentlichen Untersuchung und nach einer Publikation des 800seitigen Berichts. Die Autoren des Newsweek-Artikels dokumentieren jedoch die andauernden Bemühungen der Bush-Administration, jede öffentliche Untersuchung der Ereignisse vom 11.9. und die Nachforschung zu verhindern, ob Regierungsaktivitäten vor und am 11.September 2001 einen Beitrag zu der Tragödie geleistet haben.
Eine Online-Petition mit über 19.000 Unterschriften stellte diese Fragen und weitere. Diese Petition an den US-Senat fordert eine Untersuchung der möglichen Kenntnis der Angriffe vor dem 11.9. von George W. Bush, der Aktivitäten der Carlyle Corporation und Unocal im Laufe des Versuchs, vor dem 11.9. eine Pipeline durch Afghanistan zu bauen, und anderer damit zusammenhängender Dinge.
Online-Diskussionen, Websites und Petitionen stellen Fragen und untersuchen die Beweise, sie helfen der Öffentlichkeit die vielen Widersprüche der Darstellung der Regierungsaktivitäten bis zum und am 11. September seitens der Bush-Administration. Die fehlende offizielle Unterstützung der Regierung, ihre eigenen Fehler untersuchen zu lassen, spricht der Verwendung des 11.9. zur Legitimierung ihres angeblichen "Kriegs gegen den Terrorismus" durch die Bush-Administration Hohn. Mit ihrem andauernden Widerstand gegen die erforderliche Untersuchung stärkt die Bush-Administration bei mehr und mehr Menschen in den USA und in der Welt die Vermutung, dass die US-Regierung mit den Ereignissen vom 11. September 2001 verwoben ist.
----------
Bush´s erste Tat als Massenmörder
Ist es Zufall?
Ronda Hauben 06.05.2003
Die Nationale Kommission zur Untersuchung der Ereignisse vom 11.9. hat die ersten Anhörungen durchgeführt, die Bush-Regierung blockiert weiter die Aufklärung
Seit der Tragödie vom 11. September sind fast 20 Monate vergangen. Die Fragen, die durch diese Ereignisse entstehen, müssen in den USA erst noch durch eine öffentliche Untersuchung geklärt werden. Der Widerstand der Bush-Administration gegenüber der notwendigen öffentlichen Untersuchung hatte ein bedeutendes Hindernis dargestellt. Das ist desto mehr eine Anklage der Bush-Regierung, da sie das Mantra des 11. Septembers verwendet hatte, um einen Krieg gegen Dissidenten und Bürgerrechte im Land und gegen die Zivilbevölkerungen und Regierungen im Ausland zu führen.
Ein aktueller Artikel in Newsweek mit dem Titel Die Geheimnisse des 11. Septembers fragt, warum der 800seitige Bericht des gemeinsamen Ausschusses des Senats und des Repräsentantenhauses noch nicht veröffentlicht wurde. Der Bericht liegt seit dem 27. November 2002 vor. Er wurde einer Arbeitsgruppe der Bush-Regierung zur Überprüfung übergeben. Nach dem Newsweek-Artikel bereiten der demokratische Senator Bob Graham and der republikanische Abgeordnete Porter Goss, die Vorsitzenden der beiden Geheimdienste-Ausschüsse, die für die Untersuchung eingetreten sind, einen Beschwerdebrief an Vizepräsident Dick Cheney vor.
Es besteht auch die Sorge, ob der Bericht überhaupt der neuen Kommission, die zur Untersuchung der Ereignisse vom 11. September einberufen wurde, zugänglich gemacht werden wird. Die Nationale Kommission über die Terrorangriffe auf die Vereinigten Staaten wurde erst eingerichtet, nachdem Familienangehörige von Getöteten von der US-Regierung eine öffentliche Untersuchung verlangt hatten. Die Familien waren von der fehlenden Unterstützung durch die Regierung oder der fehlenden Finanzierung für die Untersuchung kalt gestellt worden. Während 40 Millionen US-Dollar für die Aufklärung der Columbia-Katastrophe bewilligt wurden, wurden für die Nationale Kommission zur Untersuchung der Terrorangriffe nur 3 Millionen zur Verfügung gestellt. Auch die Untersuchung des Senats und des Repräsentantenhauses hatte nur ein Budget von 3 Millionen US-Dollar.
Die erste öffentliche Anhörung am 31. März und am 1. April 2003 wurde vom Irak-Krieg überschattet. Mindy Kleinberg, deren Mann beim Anschlag auf das World Trade Center getötet wurde, zählte bei der Anhörung eine Reihe von Fragen auf und bat die Kommission, diese zu untersuchen. In ihrer Aussage fragte sie:
"Ist es ein Zufall, dass abweichende Wertpapiergeschäfte nicht beobachtet wurden? Ist es ein Zufall, dass 14 Visa aufgrund unvollständig angegebener Daten ausgegeben wurden? Ist es ein Zufall, wenn die Sicherheitsüberprüfung am Flugplatz es den Entführern ermöglichte, Flugzeuge mit Teppichmessern und Pfefferspray zu besteigen? Ist es ein Zufall, wenn Notfallmeldungen der Flugsicherheitsbehörde FAA und NORAD-Protokollen nicht nachgegangen wird? Ist es Zufall, wenn ein nationaler Notstand nicht rechtzeitig an hohe Regierungsangehörige berichtet wird? Für mich ist Zufall etwas, das einmal geschieht. Wenn man dieses wiederholte Muster von misslungenen Protokollen, Gesetzen und Kommunikationen betrachtet, dann lässt sich das nicht mehr als Zufall verstehen. Wenn wir nicht ab einem gewissen Punkt die Personen verantwortlich zu machen suchen, die ihre Aufgabe nicht ordentlich erfüllt haben, wie können wir dann jemals erwarten, dass Terroristen nicht wieder ihren Zufall finden? Wir müssen die Antworten auf das finden, was an diesem Tag geschehen ist, um sicher zu stellen, dass ein weiterer 11. September nicht wieder geschehen kann."
Es gibt weiterhin Forderungen von den Familien der Opfer des 11.9. und von Bürgern nach einer öffentlichen Untersuchung und nach einer Publikation des 800seitigen Berichts. Die Autoren des Newsweek-Artikels dokumentieren jedoch die andauernden Bemühungen der Bush-Administration, jede öffentliche Untersuchung der Ereignisse vom 11.9. und die Nachforschung zu verhindern, ob Regierungsaktivitäten vor und am 11.September 2001 einen Beitrag zu der Tragödie geleistet haben.
Eine Online-Petition mit über 19.000 Unterschriften stellte diese Fragen und weitere. Diese Petition an den US-Senat fordert eine Untersuchung der möglichen Kenntnis der Angriffe vor dem 11.9. von George W. Bush, der Aktivitäten der Carlyle Corporation und Unocal im Laufe des Versuchs, vor dem 11.9. eine Pipeline durch Afghanistan zu bauen, und anderer damit zusammenhängender Dinge.
Online-Diskussionen, Websites und Petitionen stellen Fragen und untersuchen die Beweise, sie helfen der Öffentlichkeit die vielen Widersprüche der Darstellung der Regierungsaktivitäten bis zum und am 11. September seitens der Bush-Administration. Die fehlende offizielle Unterstützung der Regierung, ihre eigenen Fehler untersuchen zu lassen, spricht der Verwendung des 11.9. zur Legitimierung ihres angeblichen "Kriegs gegen den Terrorismus" durch die Bush-Administration Hohn. Mit ihrem andauernden Widerstand gegen die erforderliche Untersuchung stärkt die Bush-Administration bei mehr und mehr Menschen in den USA und in der Welt die Vermutung, dass die US-Regierung mit den Ereignissen vom 11. September 2001 verwoben ist.
----------
Bush´s erste Tat als Massenmörder

http://home.hamptonroads.com/stories/print.cfm?story=53519&r…
Paying cash triggers alert for terrorism in new world
The Virginian-Pilot
© May 2, 2003
Last updated: 11:18 PM
Usually, if you hear somebody say, ``Your money`s no good here, pal,`` it`s a nice thing. It means the barkeep is buying you a drink, or some friend or business associate has decided to pick up the dinner tab.
Journalists seldom hear that phrase, and they speak it even less. Barkeeps know that we`re always broke, and if you want to see a klatch of newspaper reporters disappear into the vapor, just toss a dinner check onto their table. It`s like waving a cross in front of Dracula.
But a polite equivalent of ``Your money`s no good here`` arrived in the mail the other day in the form of a note from the Saks department-store folks. (The only reason we have an account with them is that my wife once said she wanted to get more from Saks, and I heartily agreed -- only to learn that, as a mutant Midwesterner, I`d once again misinterpreted her soft Virginia accent.)
Anyway, the note from Saks said that, henceforth, it would not accept cash as a form of payment on store accounts in any amount over $350. Checks and money orders and online payments and such are fine, it said, but no bills or change totaling more than $350 in any one-month billing cycle.
New federal government regulations, Saks said, made this necessary. That aroused our curiosity, as no other company with which we do credit business had advised us of any such policy. Also, as far as we could tell, the currency that the government prints still says on it, ``This note is legal tender for all debts, public and private.``
A call to the hotline number that Saks provided resulted in one of those long, oily recorded messages in which the guy pretty much repeated what Saks already had said in the note that came in the mail.
At the end of the recording it said I could ``Push 1`` if I wanted to speak to a human about it. When I did, it said no humans were available and that I should call back during normal business hours. As it was 10 a.m., I`m now as confused about their definition of ``normal`` as I am about their cash policies.
My best guess, from a day`s research, is that Saks is referring to elements of the USA Patriot Act, which was passed in the wake of 9/11. Sections of that law provide new powers for tracking the flow of terrorists` money.
Under a little-discussed element of the USA Patriot Act, any business that accepts cash in the amount of $2,000 or more from a customer must file a ``Suspicious Activities Report`` with the Treasury Department if the business suspects that the customer might be involved in some illegal activity.
The definitions of ``suspicious`` and ``illegal`` are wildly, wondrously vague. The business can also report you if you do multiple cash transactions on the same day that total more than $2,000.
As someone who travels a good bit, I learned long ago that the best interpreter you can have while abroad is a fistful of crisp U.S. currency. Abroad, banks aren`t always where you need them, and they are prone to give you large piles of colorful local bills rather than the greenbacks you`re accustomed to.
So it`s not uncommon for me to board an aircraft, as I did just two weeks ago, with a couple of thousand dollars in cash stuffed into my nooks and crannies. (The nooks, mostly, as the crannies can be painful.)
But as someone who`s short, stocky, swarthy, bearded and in possession of an oddly Middle Eastern-sounding name (it`s actually Welsh), I didn`t realize until now that a bank clerk might be compelled to send the Treasury Department a ``Suspicious Activities Report`` on me just for moving a mere $2,000 in cash into or out of my checking account.
I suspect that Saks self-imposed a $350 cash-payment limit because it just doesn`t want to get near the $2,000 limit at which someone must make a judgment as to whether the customer is a terrorist, or just a guy who prefers to deal in cash rather than paying the banks` interest charges and transaction fees.
I`m not one of those paranoids who see black helicopters in the night, or are prone to bore you with long explanations of the ``real meaning`` of that ``seeing-eye`` thingy that floats above the pyramid on our one-dollar bills. But some of the minor invasions we`ve accepted under the government`s definition of the word ``patriot`` are downright spooky.
For decades, Second Amendment enthusiasts sported bumper-stickers that said, ``When guns are outlawed, only outlaws will have guns.`` I wonder how long it will be until we see stickers that say, ``When cash is outlawed, only outlaws will have cash.``
Contact Dave at 446-2726, or dave.addis@cox.net



Paying cash triggers alert for terrorism in new world
The Virginian-Pilot
© May 2, 2003
Last updated: 11:18 PM
Usually, if you hear somebody say, ``Your money`s no good here, pal,`` it`s a nice thing. It means the barkeep is buying you a drink, or some friend or business associate has decided to pick up the dinner tab.
Journalists seldom hear that phrase, and they speak it even less. Barkeeps know that we`re always broke, and if you want to see a klatch of newspaper reporters disappear into the vapor, just toss a dinner check onto their table. It`s like waving a cross in front of Dracula.
But a polite equivalent of ``Your money`s no good here`` arrived in the mail the other day in the form of a note from the Saks department-store folks. (The only reason we have an account with them is that my wife once said she wanted to get more from Saks, and I heartily agreed -- only to learn that, as a mutant Midwesterner, I`d once again misinterpreted her soft Virginia accent.)
Anyway, the note from Saks said that, henceforth, it would not accept cash as a form of payment on store accounts in any amount over $350. Checks and money orders and online payments and such are fine, it said, but no bills or change totaling more than $350 in any one-month billing cycle.
New federal government regulations, Saks said, made this necessary. That aroused our curiosity, as no other company with which we do credit business had advised us of any such policy. Also, as far as we could tell, the currency that the government prints still says on it, ``This note is legal tender for all debts, public and private.``
A call to the hotline number that Saks provided resulted in one of those long, oily recorded messages in which the guy pretty much repeated what Saks already had said in the note that came in the mail.
At the end of the recording it said I could ``Push 1`` if I wanted to speak to a human about it. When I did, it said no humans were available and that I should call back during normal business hours. As it was 10 a.m., I`m now as confused about their definition of ``normal`` as I am about their cash policies.
My best guess, from a day`s research, is that Saks is referring to elements of the USA Patriot Act, which was passed in the wake of 9/11. Sections of that law provide new powers for tracking the flow of terrorists` money.
Under a little-discussed element of the USA Patriot Act, any business that accepts cash in the amount of $2,000 or more from a customer must file a ``Suspicious Activities Report`` with the Treasury Department if the business suspects that the customer might be involved in some illegal activity.
The definitions of ``suspicious`` and ``illegal`` are wildly, wondrously vague. The business can also report you if you do multiple cash transactions on the same day that total more than $2,000.
As someone who travels a good bit, I learned long ago that the best interpreter you can have while abroad is a fistful of crisp U.S. currency. Abroad, banks aren`t always where you need them, and they are prone to give you large piles of colorful local bills rather than the greenbacks you`re accustomed to.
So it`s not uncommon for me to board an aircraft, as I did just two weeks ago, with a couple of thousand dollars in cash stuffed into my nooks and crannies. (The nooks, mostly, as the crannies can be painful.)
But as someone who`s short, stocky, swarthy, bearded and in possession of an oddly Middle Eastern-sounding name (it`s actually Welsh), I didn`t realize until now that a bank clerk might be compelled to send the Treasury Department a ``Suspicious Activities Report`` on me just for moving a mere $2,000 in cash into or out of my checking account.
I suspect that Saks self-imposed a $350 cash-payment limit because it just doesn`t want to get near the $2,000 limit at which someone must make a judgment as to whether the customer is a terrorist, or just a guy who prefers to deal in cash rather than paying the banks` interest charges and transaction fees.
I`m not one of those paranoids who see black helicopters in the night, or are prone to bore you with long explanations of the ``real meaning`` of that ``seeing-eye`` thingy that floats above the pyramid on our one-dollar bills. But some of the minor invasions we`ve accepted under the government`s definition of the word ``patriot`` are downright spooky.
For decades, Second Amendment enthusiasts sported bumper-stickers that said, ``When guns are outlawed, only outlaws will have guns.`` I wonder how long it will be until we see stickers that say, ``When cash is outlawed, only outlaws will have cash.``
Contact Dave at 446-2726, or dave.addis@cox.net



http://www.ftd.de/pw/in/1052037829318.html?nv=cd-divnews
ftd.de, Mi, 7.5.2003
Pentagon meldet Fund von Waffenlabor in Irak
US-Truppen haben nach offiziellen Angaben im Irak ein mobiles Biowaffen-Labor entdeckt. Die vermutete Existenz von Massenvernichtungswaffen war ein Kriegsgrund gewesen.
Wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Washington mitteilte, wurde ein Anhänger entdeckt, den die gestürzte Regierung von Präsident Saddam Hussein als mobiles Biowaffenlabor genutzt habe. Die USA hatten den Krieg gegen Irak unter anderem damit begründet, dass die Regierung in Bagdad über Massenvernichtungswaffen verfüge, die an Extremisten weitergegeben werden könnten.
"Ob es sich dabei um den schlagenden Beweis handelt, weiß ich nicht", sagte Stephen Cambone, Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium. Es handele sich um die Art von mobilem Waffenlabor, die Außenminister Colin Powell in seinem Bericht vor dem Weltsicherheitsrat beschrieb. Man habe keinen anderen plausiblen Nutzen für den Container gefunden.
An dem Anhänger, der am 19. April an einem kurdischen Kontrollpunkt in Nordirak gefunden worden sei, wurden bereits erste Tests durchgeführt. Weitere Tests seien jedoch erforderlich.
In Tarnfarben gestrichen
Der Container sei in Tarnfarben angestrichen und habe sich auf einem Transporter befunden, der gewöhnlich für Panzer verwendet werde, sagte Cambone weiter. Er verfüge über einen Fermentor und ein System zum Absaugen von Abgasen. Ebendiese Gerätschaften hätten sich nach Angaben von übergelaufenen irakischen Waffenexperten in mobilen irakischen Laboren befunden.
Nach Ansicht eines US-Kommandeurs in Bagdad versteckten die irakischen Soldaten ihre mutmaßlichen Massenvernichtungswaffen vor Kriegsbeginn zu gut, um sie gegen das Invasionsheer einzusetzen. "Die Uno-Inspekteure verließen Bagdad erst wenige Tage vor den Angriffen", erklärte Generalleutnant William Wallace am Mittwoch. "Weil die Iraker die Waffen so clever versteckten und so tief vergruben, hatten sie dann selbst ein Problem, sie rechtzeitig wieder rauszuholen."
Gleichwohl sagte Wallace, man verfüge mittlerweile über "reichlich aktenmäßige Hinweise" auf ein aktives Programm für Massenvernichtungswaffen. Die Sichtung des Materials werde eine Weile dauern: "Ein Großteil der Informationen, die wir nun bekommen, stammt von Irakern, die nur ein bisschen bescheid wussten, aber nicht das ganze Programm kannten." Weitere Ausführungen machte Wallace nicht.
© 2003 Financial Times Deutschland
--------
ein anhänger?


ftd.de, Mi, 7.5.2003
Pentagon meldet Fund von Waffenlabor in Irak
US-Truppen haben nach offiziellen Angaben im Irak ein mobiles Biowaffen-Labor entdeckt. Die vermutete Existenz von Massenvernichtungswaffen war ein Kriegsgrund gewesen.
Wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Washington mitteilte, wurde ein Anhänger entdeckt, den die gestürzte Regierung von Präsident Saddam Hussein als mobiles Biowaffenlabor genutzt habe. Die USA hatten den Krieg gegen Irak unter anderem damit begründet, dass die Regierung in Bagdad über Massenvernichtungswaffen verfüge, die an Extremisten weitergegeben werden könnten.
"Ob es sich dabei um den schlagenden Beweis handelt, weiß ich nicht", sagte Stephen Cambone, Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium. Es handele sich um die Art von mobilem Waffenlabor, die Außenminister Colin Powell in seinem Bericht vor dem Weltsicherheitsrat beschrieb. Man habe keinen anderen plausiblen Nutzen für den Container gefunden.
An dem Anhänger, der am 19. April an einem kurdischen Kontrollpunkt in Nordirak gefunden worden sei, wurden bereits erste Tests durchgeführt. Weitere Tests seien jedoch erforderlich.
In Tarnfarben gestrichen
Der Container sei in Tarnfarben angestrichen und habe sich auf einem Transporter befunden, der gewöhnlich für Panzer verwendet werde, sagte Cambone weiter. Er verfüge über einen Fermentor und ein System zum Absaugen von Abgasen. Ebendiese Gerätschaften hätten sich nach Angaben von übergelaufenen irakischen Waffenexperten in mobilen irakischen Laboren befunden.
Nach Ansicht eines US-Kommandeurs in Bagdad versteckten die irakischen Soldaten ihre mutmaßlichen Massenvernichtungswaffen vor Kriegsbeginn zu gut, um sie gegen das Invasionsheer einzusetzen. "Die Uno-Inspekteure verließen Bagdad erst wenige Tage vor den Angriffen", erklärte Generalleutnant William Wallace am Mittwoch. "Weil die Iraker die Waffen so clever versteckten und so tief vergruben, hatten sie dann selbst ein Problem, sie rechtzeitig wieder rauszuholen."
Gleichwohl sagte Wallace, man verfüge mittlerweile über "reichlich aktenmäßige Hinweise" auf ein aktives Programm für Massenvernichtungswaffen. Die Sichtung des Materials werde eine Weile dauern: "Ein Großteil der Informationen, die wir nun bekommen, stammt von Irakern, die nur ein bisschen bescheid wussten, aber nicht das ganze Programm kannten." Weitere Ausführungen machte Wallace nicht.
© 2003 Financial Times Deutschland
--------
ein anhänger?



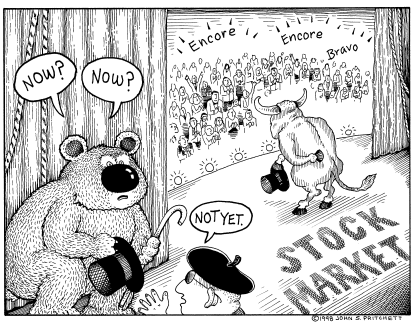



Jeder dritte Deutsche: Die USA sind ein "Schurkenstaat"
Berlin (pts, 8. Mai 2003 14:00) - Irak, Iran, Südkorea - USA? Immerhin rund ein Drittel der Deutschen (32 Prozent) zählt die Vereinigten Staaten selbst zu den "Schurkenstaaten". So das Ergebnis einer von der allgemeinen Demoskopischen Nachrichtenagentur (ADP) aktuell in Auftrag gegebenen repräsentativen Telefonumfrage mit insgesamt 1.006 Befragten. Die US-Regierung bezeichnet seit den 90er Jahren mit dem Ausdruck "Schurkenstaaten" Länder, die sie als besonders unberechenbar und gefährlich einstuft - sowie als mögliche Ziele von Sanktionen oder Militäraktionen. Zuletzt war Syrien als heißer Kandidat gehandelt worden.
"Sind die USA Ihrer Meinung nach ein ,Schurkenstaat`?" lautete die genaue Frage. Besonders hoch schnellten die Zustimmungsraten dabei in den östlichen Bundesländern. Dort mochte nur eine hauchdünne Mehrheit den Nordamerikanern jenen wenig schmeichelhaften Begriff ersparen: 43 Prozent "Ja" zu 46 Prozent "Nein". Unter den PDS-Anhängern (Ost und West) findet sich gar ein klares Votum für das harsche Urteil "Schurkenstaat": 50 Prozent halten es für angemessen, nur 30 Prozent nicht. Bemerkenswerter allerdings als das Weltbild der schmalen PDS-Anhängerschaft ist das der zahlreicheren Nichtwähler: Auch hier plädiert eine Mehrheit für die Eingemeindung der USA unter die "rogue countries", wie "Schurkenstaat" auf Amerikanisch heißt: 46 Prozent Ja-Stimmen zu 45 Prozent Nein. Politische Heimatlosigkeit geht offensichtlich mit Antipathien gegen das Gebaren der letzten Weltmacht einher - und mit der Neigung zu kräftigen Ansichten.
Als weniger, aber doch nicht unempfänglich für ausgeprägt amerikakritische Haltungen erwiesen sich neben Sympathisanten der Unionsparteien und der FDP (23 bzw. 28 % Ja) auch Rentner/Pensionäre, Besserverdienende - und Mitbürger ohne abgeschlossene Ausbildung. Etwas überraschend: Grünen-Wähler wollten seltener als der Durchschnitt so weit gehen, die USA unter die Schurkenstaaten zu reihen (29 Prozent); offenbar sind die Ökologen milde geworden. SPD-Wähler zeigen sich da weniger zimperlich - 38 Prozent erklären frank und frei: Ja, die USA sind ein Schurkenstaat.
Während sich zwischen Männern und Frauen bei dieser Frage kaum Unterschiede auftun, tendieren junge Leute unter Dreißig doch stärker zu markigen Urteilen: 40 Prozent Ja-Anteile. Genauso radikal denken freilich die 40-bis 49-Jährigen, wohingegen sich die Altersstufe darüber (50 bis 59 Jahre) am stärksten zurückhält mit nur 23 Prozent Befürwortern der USA-Schurkenstaat-These.
Durch einfache Registrierung mittels Mouse-Click auf:
http://www.adp.tv/servlet/de.at12.shop.servlet.Index können Sie sich die vollständigen Erhebungsdaten dieser und 17 weiterer spannender aktueller Meinungsumfragen kostenfrei als PDF zusenden lassen!
Eine kompakte Schnellübersicht der kostenfreien Umfragergebnisse erhalten Sie unter:
http://www.adp.tv/servlet/de.at12.shop.servlet.ShowPage/info…
Um zunächst mehr über ADP zu erfahren, klicken Sie:
http://www.adp.tv/servlet/de.at12.shop.servlet.ShowPage/info…
Kontakt:
ADP allgemeine Demoskopische Presseagentur GmbH
Berliner Straße 54, 10713 Berlin
Tel: 01804/ 80 50 80, Fax: 01804/ 80 50 88
mailto: [email]info@ADP.tv[/email]
http://www.ADP.tv (Ende)
--------
Von Saddam ging nie eine ernsthafte Bedrohung aus.
Von seiner Identität fehlt bis heute jede Spur.
Genau wie von Bin Laden.
Jeder der halbwegs denken kann, muss zu dem Schluss kommen das Bush ein Massenmörder ist!
Berlin (pts, 8. Mai 2003 14:00) - Irak, Iran, Südkorea - USA? Immerhin rund ein Drittel der Deutschen (32 Prozent) zählt die Vereinigten Staaten selbst zu den "Schurkenstaaten". So das Ergebnis einer von der allgemeinen Demoskopischen Nachrichtenagentur (ADP) aktuell in Auftrag gegebenen repräsentativen Telefonumfrage mit insgesamt 1.006 Befragten. Die US-Regierung bezeichnet seit den 90er Jahren mit dem Ausdruck "Schurkenstaaten" Länder, die sie als besonders unberechenbar und gefährlich einstuft - sowie als mögliche Ziele von Sanktionen oder Militäraktionen. Zuletzt war Syrien als heißer Kandidat gehandelt worden.
"Sind die USA Ihrer Meinung nach ein ,Schurkenstaat`?" lautete die genaue Frage. Besonders hoch schnellten die Zustimmungsraten dabei in den östlichen Bundesländern. Dort mochte nur eine hauchdünne Mehrheit den Nordamerikanern jenen wenig schmeichelhaften Begriff ersparen: 43 Prozent "Ja" zu 46 Prozent "Nein". Unter den PDS-Anhängern (Ost und West) findet sich gar ein klares Votum für das harsche Urteil "Schurkenstaat": 50 Prozent halten es für angemessen, nur 30 Prozent nicht. Bemerkenswerter allerdings als das Weltbild der schmalen PDS-Anhängerschaft ist das der zahlreicheren Nichtwähler: Auch hier plädiert eine Mehrheit für die Eingemeindung der USA unter die "rogue countries", wie "Schurkenstaat" auf Amerikanisch heißt: 46 Prozent Ja-Stimmen zu 45 Prozent Nein. Politische Heimatlosigkeit geht offensichtlich mit Antipathien gegen das Gebaren der letzten Weltmacht einher - und mit der Neigung zu kräftigen Ansichten.
Als weniger, aber doch nicht unempfänglich für ausgeprägt amerikakritische Haltungen erwiesen sich neben Sympathisanten der Unionsparteien und der FDP (23 bzw. 28 % Ja) auch Rentner/Pensionäre, Besserverdienende - und Mitbürger ohne abgeschlossene Ausbildung. Etwas überraschend: Grünen-Wähler wollten seltener als der Durchschnitt so weit gehen, die USA unter die Schurkenstaaten zu reihen (29 Prozent); offenbar sind die Ökologen milde geworden. SPD-Wähler zeigen sich da weniger zimperlich - 38 Prozent erklären frank und frei: Ja, die USA sind ein Schurkenstaat.
Während sich zwischen Männern und Frauen bei dieser Frage kaum Unterschiede auftun, tendieren junge Leute unter Dreißig doch stärker zu markigen Urteilen: 40 Prozent Ja-Anteile. Genauso radikal denken freilich die 40-bis 49-Jährigen, wohingegen sich die Altersstufe darüber (50 bis 59 Jahre) am stärksten zurückhält mit nur 23 Prozent Befürwortern der USA-Schurkenstaat-These.
Durch einfache Registrierung mittels Mouse-Click auf:
http://www.adp.tv/servlet/de.at12.shop.servlet.Index können Sie sich die vollständigen Erhebungsdaten dieser und 17 weiterer spannender aktueller Meinungsumfragen kostenfrei als PDF zusenden lassen!
Eine kompakte Schnellübersicht der kostenfreien Umfragergebnisse erhalten Sie unter:
http://www.adp.tv/servlet/de.at12.shop.servlet.ShowPage/info…
Um zunächst mehr über ADP zu erfahren, klicken Sie:
http://www.adp.tv/servlet/de.at12.shop.servlet.ShowPage/info…
Kontakt:
ADP allgemeine Demoskopische Presseagentur GmbH
Berliner Straße 54, 10713 Berlin
Tel: 01804/ 80 50 80, Fax: 01804/ 80 50 88
mailto: [email]info@ADP.tv[/email]
http://www.ADP.tv (Ende)
--------
Von Saddam ging nie eine ernsthafte Bedrohung aus.
Von seiner Identität fehlt bis heute jede Spur.
Genau wie von Bin Laden.
Jeder der halbwegs denken kann, muss zu dem Schluss kommen das Bush ein Massenmörder ist!


08/05/2003 17:11
Greenspan - Einsatz von Finanzderivaten Segen für US-Wirtschaft
Chicago, 08. Mai (Reuters) - Der gesteigerte Einsatz von
hoch entwickelten Finanzinstrumenten, die als Derivate
bezeichnet werden, hat sich nach den Worten des Chefs der
US-Notenbank (Fed), Alan Greenspan, in Zeiten ungewöhnlicher
Belastungen als Segen für die US-Wirtschaft erwiesen.
Bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank von Chicago
sagte Greenspan am Donnerstag laut Redetext: "Obwohl die Nutzen
und Kosten von Derivaten weiterhin Gegenstand lebhafter Debatten
sind, lässt die Entwicklung der Wirtschaft und des Finanzsystems
in den vergangenen Jahren darauf schließen, dass der Nutzen die
Kosten bei weitem überwogen hat". Zwar habe sich die
US-Wirtschaft seit einiger Zeit abgeschwächt, doch habe sie sich
als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen angesichts schwerer
Schocks, wie des Einbruchs der Aktienkurse, von Anschlägen und
weltweiter Turbulenzen. Dies sei teilweise darin begründet, dass
das US-Bankensystem stabil geblieben sei.
fgc/brs


08.05. 17:50
Bush und Blair für Friedensnobelpreis nominiert
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Externe Quelle:
Origininal Reutersmeldung.
Oslo, 08. Mai (Reuters) - Ein norwegischer Parlamentarier hat US-Präsident George W. Bush und den britischen Premierminister Tony Blair für den Friedensnobelpreis nominiert. Er lobte am Donnerstag die beiden Staatsmänner für den Sieg über Saddam Hussein im Irak-Krieg.
"Es ist manchmal notwendig, einen kleinen und effektiven Krieg zu führen, um einen viel gefährlicheren Krieg in der Zukunft vorzubeugen", sagte Jan Simonsen, ein unabhängiges Mitglied des norwegischen Parlaments in Oslo. "Wenn niemand gehandelt hätte, dann hätte Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen herstellen und diese in fünf oder zehn Jahren gegen Israel einsetzen können", fügte er hinzu.
Der Direktor des Nobel Insitute, Geir Lundestad, sagte, der Vorschlag von Simonsen müsse bis 2004 warten, da die Frist für die Nominierung für den diesjährigen Nobelpreis der 1. Februar 2003 gewesen sei.
Simonsen sagte, er sei nicht sehr optimistisch, dass Bush und Blair den Friedensnobelpreis erhalten würden. "Ich glaube aber, es ist der Mühe wert, dies zu versuchen". Das aus fünf Mitgliedern bestehende Nobelpreis-Komitee, das im Nobel Institute tagt, gibt die Nobelpreisträger Mitte Oktober bekannt. Für den Friedensnobelpreis 2003 sind mehr als 160 Personen und Organisation nominiert worden, darunter der Papst Johannes Paul II., der irische Rockstar Bono und der kubanische Regimekritiker Oaswaldo Paya.
Vorschläge für die Auszeichnung mit einem Nobelpreis können etwa Parlamentarier oder Wissenschaftler sowie frühere Nobelpreisträger unterbreiten.

Bush und Blair für Friedensnobelpreis nominiert
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Externe Quelle:
Origininal Reutersmeldung.
Oslo, 08. Mai (Reuters) - Ein norwegischer Parlamentarier hat US-Präsident George W. Bush und den britischen Premierminister Tony Blair für den Friedensnobelpreis nominiert. Er lobte am Donnerstag die beiden Staatsmänner für den Sieg über Saddam Hussein im Irak-Krieg.
"Es ist manchmal notwendig, einen kleinen und effektiven Krieg zu führen, um einen viel gefährlicheren Krieg in der Zukunft vorzubeugen", sagte Jan Simonsen, ein unabhängiges Mitglied des norwegischen Parlaments in Oslo. "Wenn niemand gehandelt hätte, dann hätte Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen herstellen und diese in fünf oder zehn Jahren gegen Israel einsetzen können", fügte er hinzu.
Der Direktor des Nobel Insitute, Geir Lundestad, sagte, der Vorschlag von Simonsen müsse bis 2004 warten, da die Frist für die Nominierung für den diesjährigen Nobelpreis der 1. Februar 2003 gewesen sei.
Simonsen sagte, er sei nicht sehr optimistisch, dass Bush und Blair den Friedensnobelpreis erhalten würden. "Ich glaube aber, es ist der Mühe wert, dies zu versuchen". Das aus fünf Mitgliedern bestehende Nobelpreis-Komitee, das im Nobel Institute tagt, gibt die Nobelpreisträger Mitte Oktober bekannt. Für den Friedensnobelpreis 2003 sind mehr als 160 Personen und Organisation nominiert worden, darunter der Papst Johannes Paul II., der irische Rockstar Bono und der kubanische Regimekritiker Oaswaldo Paya.
Vorschläge für die Auszeichnung mit einem Nobelpreis können etwa Parlamentarier oder Wissenschaftler sowie frühere Nobelpreisträger unterbreiten.

Sprecher: Bush will Freihandelszone USA-Naher Osten
Washington (vwd) - US-Präsident George W. Bush wird nach Angaben eines Sprechers am Freitag die Schaffung einer Freihandelszone USA-Naher Osten binnen zehn Jahren vorschlagen. Eine Ära der Prosperität in dieser Region sei wichtig für die Sicherheit der USA, werde Bush bei einer Rede vor University of South Carolina sagen. Kernaussage der Rede werde sein, dass Freiheit gleichbdeutend sei mit Frieden und Sicherheit, sagte der Sprecher in der Nacht zum Freitag. vwd/9.5.2003/hab
------
Osterweiterung

Washington (vwd) - US-Präsident George W. Bush wird nach Angaben eines Sprechers am Freitag die Schaffung einer Freihandelszone USA-Naher Osten binnen zehn Jahren vorschlagen. Eine Ära der Prosperität in dieser Region sei wichtig für die Sicherheit der USA, werde Bush bei einer Rede vor University of South Carolina sagen. Kernaussage der Rede werde sein, dass Freiheit gleichbdeutend sei mit Frieden und Sicherheit, sagte der Sprecher in der Nacht zum Freitag. vwd/9.5.2003/hab
------
Osterweiterung


09.05. 11:09
Greenspan warnt vor Gefahr von Derivaten
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
US-Notenbankchef Alan Greenspan hat sich am späten Donnerstag über die Risiken geäußert, die die Derivate im Wert von $142 Billionen in der Hand von wenigen Investmentbanken für die Wirtschaft bedeuten. Jedoch seien Derivate durchaus sinnvoll. Sie hätten die Finanzindustrie von dem Aktienmarktcrash und der schwachen Wirtschaftslage abgeschirmt, so Greenspans gewohnte Befürwortung dieser Finanzinstrumente. Erstmals aber wies Greenspan auf die Gefahr hin, die durch die Entscheidung einer Investmentbank herrühren könnte, die sich entscheiden würde, das Derivategeschäft zu schließen. Jedoch sei er gegen eine Regulierung des Sektors – die hohe Konzentration des Derivategeschäftes gebe aber zu denken, so Greenspan.
Auch der Multimilliardär und bekannte Wall Street Investor Warren Buffett warnte auf der Jahreshauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway vor dem immensen Risiko, dass von dem Derivategeschäft auf die Finanzindustrie ausgehe. Buffett sagte, dass ein Fehltritt eines Marktteilnehmers in diesem Sektor einen Schock auf die gesamte Wirtschaft auslösen könnte (BörseGO.de berichtete).
Derivate verbriefen das Recht auf alle Art von Wertpapiere oder Rohstoffe – wie Währungen, Aktien oder Gold – und ermöglichen mit einem überdurchschnittlichen Hebel an den Kursschwankungen – sowohl nach oben als auch nach unten – zu partizipieren. Somit kann man z.B. Kursgewinne gegen Kursverluste absichern.
--------
falls der markt unter dünnen umsätze 2 prozent ins plus rennt und das wie immer zum wochenende, dann hat die meldung damit bestimmt nichts zu tun
amerika wird in den dollar´s die sie drucken untergehen!
Greenspan warnt vor Gefahr von Derivaten
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
US-Notenbankchef Alan Greenspan hat sich am späten Donnerstag über die Risiken geäußert, die die Derivate im Wert von $142 Billionen in der Hand von wenigen Investmentbanken für die Wirtschaft bedeuten. Jedoch seien Derivate durchaus sinnvoll. Sie hätten die Finanzindustrie von dem Aktienmarktcrash und der schwachen Wirtschaftslage abgeschirmt, so Greenspans gewohnte Befürwortung dieser Finanzinstrumente. Erstmals aber wies Greenspan auf die Gefahr hin, die durch die Entscheidung einer Investmentbank herrühren könnte, die sich entscheiden würde, das Derivategeschäft zu schließen. Jedoch sei er gegen eine Regulierung des Sektors – die hohe Konzentration des Derivategeschäftes gebe aber zu denken, so Greenspan.
Auch der Multimilliardär und bekannte Wall Street Investor Warren Buffett warnte auf der Jahreshauptversammlung seines Unternehmens Berkshire Hathaway vor dem immensen Risiko, dass von dem Derivategeschäft auf die Finanzindustrie ausgehe. Buffett sagte, dass ein Fehltritt eines Marktteilnehmers in diesem Sektor einen Schock auf die gesamte Wirtschaft auslösen könnte (BörseGO.de berichtete).
Derivate verbriefen das Recht auf alle Art von Wertpapiere oder Rohstoffe – wie Währungen, Aktien oder Gold – und ermöglichen mit einem überdurchschnittlichen Hebel an den Kursschwankungen – sowohl nach oben als auch nach unten – zu partizipieren. Somit kann man z.B. Kursgewinne gegen Kursverluste absichern.
--------
falls der markt unter dünnen umsätze 2 prozent ins plus rennt und das wie immer zum wochenende, dann hat die meldung damit bestimmt nichts zu tun

amerika wird in den dollar´s die sie drucken untergehen!

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,248199,00.html
US-NUKLEARSTRATEGIE
Politik der kleinen Atom-Schläge
Mit Macht läßt US-Präsident Bush die Nuklear-Tabus des kalten Kriegs abschaffen. Jetzt hat ein Komitee des US-Senates einen Gesetzes-Entwurf passieren lassen, der die bisher verbotene Entwicklung von Mini-Atombomben erlauben soll. Die neuen Waffen, mit denen der Präsident Schurkenstaaten droht, sollen den begrenzten Atomkrieg ermöglichen.
Washington - Die Schlacht gegen den Irak ist geschlagen, doch die amerikanische Kriegs-Maschinerie kommt nicht zum Stillstand. Seit Monaten drängt die US-Regierung auf eine Neuorientierung der Nuklear-Waffen-Politik. Nun soll es ernst werden. Am Freitag verabschiedete ein einflussreiches Senats-Komitee eine Gesetzes-Initiative, die einen zehn Jahre alten Bann zur Entwicklung von Mini-Atombomben aufhebt. Das Paket stellt einen Betrag von 15,5 Millionen Dollar bereit, der zur Entwicklung einer so genannten Bunker-Knacker-Bombe dienen soll. Die neue Atom-Waffe bohrt sich durch eine spezielle Ummantelung extrem tief in die Erde, um dann zu explodieren. Eine solche Waffe könnte die bis zu sechsfache Vernichtungskraft der Hiroshima-Bombe entfalten.
Weiterhin schlägt das Komitee vor, das Atomwaffen-Testgelände in Nevada mit 25 Millionen Dollar aufzurüsten und so die Vorbereitungszeit für einen Atomtest von 36 Monaten zu halbieren. Die Maßnahmen werden innerhalb der nächsten zwei Wochen dem Senat und dem Repräsentantenhaus zugeleitet, deren Mitglieder die Initiative endgültig beschließen müssen. Wegen der republikanischen Mehrheit rechnen Beobachter damit, dass die Initiative ohne größere Änderungen verabschiedet werden könnte.
Atom-Drohungen gegen Syrien und den Iran
Die Initiative bedeutet einen dramatischen Schritt hin zu einer Neuorientierung der amerikanischen Nuklear-Politik. Statt wie zu Zeiten des kalten Krieges ein strategisches Nuklear-Potenzial zur Abschreckung zu unterhalten, drängt die Administration unter Präsident Bush auf die Entwicklung kleiner taktischer Nuklear-Waffen. Bereits vor über einem Jahr waren erstmals Pläne bekannt geworden, die Nuklear-Doktrin zu ändern. Ein Regierungs-Papier, die "Nuclear Posture Review" forderte die Entwicklung neuer Mini- Atomwaffen und drohte deren Einsatz gegen Staaten wie Syrien, Libyen, den Iran oder den Irak an. Später gab das Weiße Haus eine Präsidenten-Direktive heraus, die deutlich machte, dass die USA Atomwaffen einsetzen könnten, wenn ihre Streitkräfte mit chemischen oder biologischen Waffen angegriffen würden.
Noch, so betonen Mitglieder der US-Regierung, ist nicht beschlossen, ob die neuen Waffen tatsächlich hergestellt werden. Die Maßnahmen dienten lediglich der Forschung. Dennoch sind Kritiker aufs äußerste alarmiert: "Wir haben 50 Jahre gekämpft, um solche Waffen undenkbar zu machen", sagte der demokratische Senator Jack Reed, "und nun reden wir darüber, ihnen eine taktische Bedeutung zu geben. Das ist ein gefährlicher Schritt."
Kritiker wie Reed warnen davor, dass die neuen Mini-Bomben die Welt keinesfalls sicherer machen würden. Im Gegenteil: Zahlreiche politisch instabile Staaten könnten sich die neuen Waffen besorgen, sie verbreiten und wegen der herabgesetzten Hemmschwelle auch einsetzen. "Das unterminiert unsere gesamte Argumentation", sagt Carl Levin, Senator aus Michigan und ebenfalls Gegner der Nuklear-Initiative: "Wir schlagen gedankenlos einen Weg ein, von dem wir andere stets abgehalten haben."
"Amerika vor Feinden sichern"
Die Befürworter der Freigabe, überwiegend Republikaner, halten die Mini-Bomben für eine unabdingbare Waffe im Kampf gegen Schurken-Staaten und Terroristen-Nester. Sie würden es erlauben, Produktionsanlagen und Lager für Biowaffen, Chemiewaffen oder Nuklearbomben zu treffen, ohne die Atmosphäre in verheerendem Ausmaß zu verseuchen. Forschungsarbeiten für Mini-Bomben seien ein wichtiger Schritt, um "Amerika vor Feinden zu sichern, die sich immer tiefer unter der Erde vergraben", sagt John Warner, republikanischer Senator aus dem Bundesstaat Virginia.
Die neuen Waffen sollen die Abschreckungswirkung von Atom-Waffen wieder herstellen. Die Atombomben aus der Zeit des kalten Krieges mit ihrer gigantischen Zerstörungskraft hätten paradoxerweise einen Teil ihres Schreckens verloren, argumentieren die Protagonisten. Kaum ein Land würde ernsthaft damit rechnen, dass die USA die für ganze Weltregionen verheerenden Waffen einsetzen würden. Das wäre bei den Mini-Bomben anders, ihr Einsatz würde Diktatoren und Terror-Führern sehr viel wahrscheinlicher erscheinen.
------
Mit Stolz und Freude werde ich die Attentatmeldung auf G.W Bush aufnehmen!
Wenn sie denn kommt.
US-NUKLEARSTRATEGIE
Politik der kleinen Atom-Schläge
Mit Macht läßt US-Präsident Bush die Nuklear-Tabus des kalten Kriegs abschaffen. Jetzt hat ein Komitee des US-Senates einen Gesetzes-Entwurf passieren lassen, der die bisher verbotene Entwicklung von Mini-Atombomben erlauben soll. Die neuen Waffen, mit denen der Präsident Schurkenstaaten droht, sollen den begrenzten Atomkrieg ermöglichen.
Washington - Die Schlacht gegen den Irak ist geschlagen, doch die amerikanische Kriegs-Maschinerie kommt nicht zum Stillstand. Seit Monaten drängt die US-Regierung auf eine Neuorientierung der Nuklear-Waffen-Politik. Nun soll es ernst werden. Am Freitag verabschiedete ein einflussreiches Senats-Komitee eine Gesetzes-Initiative, die einen zehn Jahre alten Bann zur Entwicklung von Mini-Atombomben aufhebt. Das Paket stellt einen Betrag von 15,5 Millionen Dollar bereit, der zur Entwicklung einer so genannten Bunker-Knacker-Bombe dienen soll. Die neue Atom-Waffe bohrt sich durch eine spezielle Ummantelung extrem tief in die Erde, um dann zu explodieren. Eine solche Waffe könnte die bis zu sechsfache Vernichtungskraft der Hiroshima-Bombe entfalten.
Weiterhin schlägt das Komitee vor, das Atomwaffen-Testgelände in Nevada mit 25 Millionen Dollar aufzurüsten und so die Vorbereitungszeit für einen Atomtest von 36 Monaten zu halbieren. Die Maßnahmen werden innerhalb der nächsten zwei Wochen dem Senat und dem Repräsentantenhaus zugeleitet, deren Mitglieder die Initiative endgültig beschließen müssen. Wegen der republikanischen Mehrheit rechnen Beobachter damit, dass die Initiative ohne größere Änderungen verabschiedet werden könnte.
Atom-Drohungen gegen Syrien und den Iran
Die Initiative bedeutet einen dramatischen Schritt hin zu einer Neuorientierung der amerikanischen Nuklear-Politik. Statt wie zu Zeiten des kalten Krieges ein strategisches Nuklear-Potenzial zur Abschreckung zu unterhalten, drängt die Administration unter Präsident Bush auf die Entwicklung kleiner taktischer Nuklear-Waffen. Bereits vor über einem Jahr waren erstmals Pläne bekannt geworden, die Nuklear-Doktrin zu ändern. Ein Regierungs-Papier, die "Nuclear Posture Review" forderte die Entwicklung neuer Mini- Atomwaffen und drohte deren Einsatz gegen Staaten wie Syrien, Libyen, den Iran oder den Irak an. Später gab das Weiße Haus eine Präsidenten-Direktive heraus, die deutlich machte, dass die USA Atomwaffen einsetzen könnten, wenn ihre Streitkräfte mit chemischen oder biologischen Waffen angegriffen würden.
Noch, so betonen Mitglieder der US-Regierung, ist nicht beschlossen, ob die neuen Waffen tatsächlich hergestellt werden. Die Maßnahmen dienten lediglich der Forschung. Dennoch sind Kritiker aufs äußerste alarmiert: "Wir haben 50 Jahre gekämpft, um solche Waffen undenkbar zu machen", sagte der demokratische Senator Jack Reed, "und nun reden wir darüber, ihnen eine taktische Bedeutung zu geben. Das ist ein gefährlicher Schritt."
Kritiker wie Reed warnen davor, dass die neuen Mini-Bomben die Welt keinesfalls sicherer machen würden. Im Gegenteil: Zahlreiche politisch instabile Staaten könnten sich die neuen Waffen besorgen, sie verbreiten und wegen der herabgesetzten Hemmschwelle auch einsetzen. "Das unterminiert unsere gesamte Argumentation", sagt Carl Levin, Senator aus Michigan und ebenfalls Gegner der Nuklear-Initiative: "Wir schlagen gedankenlos einen Weg ein, von dem wir andere stets abgehalten haben."
"Amerika vor Feinden sichern"
Die Befürworter der Freigabe, überwiegend Republikaner, halten die Mini-Bomben für eine unabdingbare Waffe im Kampf gegen Schurken-Staaten und Terroristen-Nester. Sie würden es erlauben, Produktionsanlagen und Lager für Biowaffen, Chemiewaffen oder Nuklearbomben zu treffen, ohne die Atmosphäre in verheerendem Ausmaß zu verseuchen. Forschungsarbeiten für Mini-Bomben seien ein wichtiger Schritt, um "Amerika vor Feinden zu sichern, die sich immer tiefer unter der Erde vergraben", sagt John Warner, republikanischer Senator aus dem Bundesstaat Virginia.
Die neuen Waffen sollen die Abschreckungswirkung von Atom-Waffen wieder herstellen. Die Atombomben aus der Zeit des kalten Krieges mit ihrer gigantischen Zerstörungskraft hätten paradoxerweise einen Teil ihres Schreckens verloren, argumentieren die Protagonisten. Kaum ein Land würde ernsthaft damit rechnen, dass die USA die für ganze Weltregionen verheerenden Waffen einsetzen würden. Das wäre bei den Mini-Bomben anders, ihr Einsatz würde Diktatoren und Terror-Führern sehr viel wahrscheinlicher erscheinen.
------
Mit Stolz und Freude werde ich die Attentatmeldung auf G.W Bush aufnehmen!
Wenn sie denn kommt.
"Amerika vor Feinden zu sichern, die sich immer tiefer unter der Erde vergraben", sagt John Warner, republikanischer Senator aus dem Bundesstaat Virginia.
Die Lächerlichkeit kennt keine Grenzen, und die Dummheit offensichtlich auch nicht.
M.
Die Lächerlichkeit kennt keine Grenzen, und die Dummheit offensichtlich auch nicht.
M.
ein maikäfer im wonnemonat mai 

http://www.faz.net/s/Rub3B5979848A5C48F18F2FF729A7211ACE/Doc…
Interview
"Aktien sind nicht immer die beste Anlageform"
11. März 2003 Robert J. Shiller hat ein Buch über die Narrheit der Anleger geschrieben. Als Professor für Finanzen an der Yale University ist Shiller überzeugt, dass am Aktienmarkt eine lang andauernde Periode niedriger Renditen und hoher Risiken begonnen hat.
Seine Ansichten sollte man nicht ignorieren, denn Shiller ist der Autor eines Bestsellers über die Maßlosigkeiten des Aktienmarktes mit dem Titel „Irrational Exuberance“. In diesem Buch prophezeite er im Wesentlichen den Marktzusammenbruch, der kurz nach der Veröffentlichung Anfang 2000 tatsächlich eintrat.
In seinem Buch „Irrational Exuberance“ beschreibt Shiller, wie sich Aktionäre in etwas verfangen, was er als naturgemäß auftretendes Ponzi-Schema (exponentielles Pyramidensystem) beschreibt: an der Börse notierte Unternehmen, Emissionsbanken an der Wall Street, die Medien und die Anleger steigern gegenseitig ihren Enthusiasmus und treiben die Aktienkurse so weit in die Höhe, dass sie unvermeidlich zusammenbrechen müssen.
Shiller ist nicht der Überzeugung, dass sich Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen immer überdurchschnittlich entwickeln. Marcia Vickers, Redakteurin bei BusinessWeek, hat vor kurzem Shiller interviewt, um seine Gedanken über den heutigen und zukünftigen Markt zu erfahren. Es folgen einige überarbeitete Auszüge aus ihrem Gespräch:
Herr Shiller, sind die Anleger in Hinsicht auf den Aktienmarkt immer noch zu vertrauensselig?
Es scheint, als ob das Vertrauen abnimmt. Die Anleger sind gerade dabei, eine harte Lektion zu lernen, nämlich dass Aktien nicht immer die beste Anlageform darstellen und sich konsistent überdurchschnittlich entwickeln.
Aber auch wenn das Vertrauen der Anleger schwindet, sobald eine Blase zerplatzt, braucht das ganze doch seine Zeit. Das ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Leute gewöhnlich ihre Meinung nicht eigenständig ändern, bevor sie nicht wahrgenommen haben, dass andere ihre Ansichten ebenfalls geändert haben. Beschreiben wir es so: Ein Investor muss erst auf eine Grillparty gehen, bei der drei seiner oder ihrer Freunde sagen, dass sie vom Markt und den Aktienanalysten genug haben - das ist der Moment, wenn ein Anleger wirklich damit beginnt, den Markt zu überdenken.
Die Leute reden immer noch die ganze Zeit über Kapitulation. Ich glaube nicht, dass wir diesen Punkt bereits erreicht haben. 80 Prozent der Leute sind nach wie vor sicher, dass der Markt in diesem Jahr steigen wird. Die Ansicht, dass Aktien immer die beste Anlageform darstellen, ist bis jetzt noch nicht ersetzt worden. Es klingt zwar ironisch, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das Anlegervertrauen schwindet, sagen die Experten, dies sei erst recht ein Grund dafür, in Aktien zu investieren. Die Analysten streuen diese optimistischen Prognosen. Aber zumindest sagen die Anleger mittlerweile: „Sag mir warum!“
Warum ist das Anlegervertrauen für den Markt so wichtig?
Länder, in denen viel Misstrauen herrscht, sind tendenziell wirtschaftlich weniger erfolgreich. Denn Vertrauen erleichtert das Geschäft. Ist kein oder nur wenig Vertrauen vorhanden, denken die Leute „Was bringt mir das?“ und die gesamte Wirtschaft verlangsamt sich. Ende der Neunzigerjahre hat es zu viel Vertrauen gegeben. Die Menschen haben die Geschäftseliten nicht mehr genau genug unter die Lupe genommen, da alle dachten, sie seien ein Haufen Genies, der für sie Geld machen würde. In den letzten paar Jahren hat sich dieses Vertrauen abgeschwächt, und es dürfte sich so schnell auch nicht wieder herstellen lassen.
Sie glauben also nicht daran, dass Aktien langfristig die überlegene Anlagekategorie sind?
Ich sage immer, das 20. Jahrhundert war wahrscheinlich ein glückliches Jahrhundert. Die Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass das 21. Jahrhundert genauso gut wird. Die Menschen lassen sich von Geschichte immer so sehr beeindrucken. Es gibt aber keine Theorie, nach der der Markt das genauso tun wird.
Wir haben den Einfluss der Globalisierung und der Technologie, um nur eine Sache zu nennen. China beispielsweise pirscht weiterhin sehr schnell nach vorne und beginnt, mit Unternehmen in den Wettbewerb zu treten, die im Moment noch keine Konkurrenz haben. Die Lohnkosten sind in diesen Ländern sehr niedrig und es gibt dort sehr kluge Leute.
Was ist mit den akutellen geopolitischen Spannungen? Welchen Einfluss werden sie auf den Markt haben?
Die Irak-Problematik scheint sich ganz anders darzustellen, als zu Zeiten des Golfkriegs von 1990/91. Damals wurde der Aktienmarkt nur in einem sehr geringen Ausmaß beeinflusst, da wir keinen grundlosen Angriff auf ein muslimisches Land durchgeführt haben. Nun besteht die Gefahr, dass der Terror dieses Mal viel größere Ausmaße annimmt.
Wann wird sich der Aktienmarkt also erholen? Niemals?
Die Menschen müssten dazu bereit sein, 100 Dollar für etwas wegzuwerfen, von dem sie glauben, dass es sich letztlich gut entwickeln wird. Aber wenn es nur wenig Optimismus gibt, sind die Leute dazu eben nicht bereit. Der psychologische Wandel, der in Japan (nach dem Zusammenbruch des Aktienmarktes Ende der Achtzigerjahre) stattgefunden hat, könnte auch hier eintreten. Und wie in Japan dürfte es auch hier eine lange Zeit dauern, bis eine Marktbereinigung vollzogen ist.
Das Gespräch führte Marcia Vickers, Redakteurin bei BusinessWeek
Interview
"Aktien sind nicht immer die beste Anlageform"
11. März 2003 Robert J. Shiller hat ein Buch über die Narrheit der Anleger geschrieben. Als Professor für Finanzen an der Yale University ist Shiller überzeugt, dass am Aktienmarkt eine lang andauernde Periode niedriger Renditen und hoher Risiken begonnen hat.
Seine Ansichten sollte man nicht ignorieren, denn Shiller ist der Autor eines Bestsellers über die Maßlosigkeiten des Aktienmarktes mit dem Titel „Irrational Exuberance“. In diesem Buch prophezeite er im Wesentlichen den Marktzusammenbruch, der kurz nach der Veröffentlichung Anfang 2000 tatsächlich eintrat.
In seinem Buch „Irrational Exuberance“ beschreibt Shiller, wie sich Aktionäre in etwas verfangen, was er als naturgemäß auftretendes Ponzi-Schema (exponentielles Pyramidensystem) beschreibt: an der Börse notierte Unternehmen, Emissionsbanken an der Wall Street, die Medien und die Anleger steigern gegenseitig ihren Enthusiasmus und treiben die Aktienkurse so weit in die Höhe, dass sie unvermeidlich zusammenbrechen müssen.
Shiller ist nicht der Überzeugung, dass sich Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen immer überdurchschnittlich entwickeln. Marcia Vickers, Redakteurin bei BusinessWeek, hat vor kurzem Shiller interviewt, um seine Gedanken über den heutigen und zukünftigen Markt zu erfahren. Es folgen einige überarbeitete Auszüge aus ihrem Gespräch:
Herr Shiller, sind die Anleger in Hinsicht auf den Aktienmarkt immer noch zu vertrauensselig?
Es scheint, als ob das Vertrauen abnimmt. Die Anleger sind gerade dabei, eine harte Lektion zu lernen, nämlich dass Aktien nicht immer die beste Anlageform darstellen und sich konsistent überdurchschnittlich entwickeln.
Aber auch wenn das Vertrauen der Anleger schwindet, sobald eine Blase zerplatzt, braucht das ganze doch seine Zeit. Das ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Leute gewöhnlich ihre Meinung nicht eigenständig ändern, bevor sie nicht wahrgenommen haben, dass andere ihre Ansichten ebenfalls geändert haben. Beschreiben wir es so: Ein Investor muss erst auf eine Grillparty gehen, bei der drei seiner oder ihrer Freunde sagen, dass sie vom Markt und den Aktienanalysten genug haben - das ist der Moment, wenn ein Anleger wirklich damit beginnt, den Markt zu überdenken.
Die Leute reden immer noch die ganze Zeit über Kapitulation. Ich glaube nicht, dass wir diesen Punkt bereits erreicht haben. 80 Prozent der Leute sind nach wie vor sicher, dass der Markt in diesem Jahr steigen wird. Die Ansicht, dass Aktien immer die beste Anlageform darstellen, ist bis jetzt noch nicht ersetzt worden. Es klingt zwar ironisch, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das Anlegervertrauen schwindet, sagen die Experten, dies sei erst recht ein Grund dafür, in Aktien zu investieren. Die Analysten streuen diese optimistischen Prognosen. Aber zumindest sagen die Anleger mittlerweile: „Sag mir warum!“
Warum ist das Anlegervertrauen für den Markt so wichtig?
Länder, in denen viel Misstrauen herrscht, sind tendenziell wirtschaftlich weniger erfolgreich. Denn Vertrauen erleichtert das Geschäft. Ist kein oder nur wenig Vertrauen vorhanden, denken die Leute „Was bringt mir das?“ und die gesamte Wirtschaft verlangsamt sich. Ende der Neunzigerjahre hat es zu viel Vertrauen gegeben. Die Menschen haben die Geschäftseliten nicht mehr genau genug unter die Lupe genommen, da alle dachten, sie seien ein Haufen Genies, der für sie Geld machen würde. In den letzten paar Jahren hat sich dieses Vertrauen abgeschwächt, und es dürfte sich so schnell auch nicht wieder herstellen lassen.
Sie glauben also nicht daran, dass Aktien langfristig die überlegene Anlagekategorie sind?
Ich sage immer, das 20. Jahrhundert war wahrscheinlich ein glückliches Jahrhundert. Die Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass das 21. Jahrhundert genauso gut wird. Die Menschen lassen sich von Geschichte immer so sehr beeindrucken. Es gibt aber keine Theorie, nach der der Markt das genauso tun wird.
Wir haben den Einfluss der Globalisierung und der Technologie, um nur eine Sache zu nennen. China beispielsweise pirscht weiterhin sehr schnell nach vorne und beginnt, mit Unternehmen in den Wettbewerb zu treten, die im Moment noch keine Konkurrenz haben. Die Lohnkosten sind in diesen Ländern sehr niedrig und es gibt dort sehr kluge Leute.
Was ist mit den akutellen geopolitischen Spannungen? Welchen Einfluss werden sie auf den Markt haben?
Die Irak-Problematik scheint sich ganz anders darzustellen, als zu Zeiten des Golfkriegs von 1990/91. Damals wurde der Aktienmarkt nur in einem sehr geringen Ausmaß beeinflusst, da wir keinen grundlosen Angriff auf ein muslimisches Land durchgeführt haben. Nun besteht die Gefahr, dass der Terror dieses Mal viel größere Ausmaße annimmt.
Wann wird sich der Aktienmarkt also erholen? Niemals?
Die Menschen müssten dazu bereit sein, 100 Dollar für etwas wegzuwerfen, von dem sie glauben, dass es sich letztlich gut entwickeln wird. Aber wenn es nur wenig Optimismus gibt, sind die Leute dazu eben nicht bereit. Der psychologische Wandel, der in Japan (nach dem Zusammenbruch des Aktienmarktes Ende der Achtzigerjahre) stattgefunden hat, könnte auch hier eintreten. Und wie in Japan dürfte es auch hier eine lange Zeit dauern, bis eine Marktbereinigung vollzogen ist.
Das Gespräch führte Marcia Vickers, Redakteurin bei BusinessWeek
15:24 Uhr
USA tauschen ihre Verwalter im Irak aus
Washington (dpa) - Die Spitzenverwalter der USA im Irak werden ausgetauscht. Der bisherige zivile Verwaltungschef Jay Garner werde demnächst den Irak verlassen, berichtete die «Washington Post». Auch die oberste Zivilverwalterin der Region Bagdad, Barbara Bodine, sei auf einen neuen Posten in Washington versetzt worden. Die USA ziehen demnach auch einen großen Teil ihrer Waffeninspekteure im Irak ab - frustriert über den mangelnden Erfolg. Der «Washington Post» sagten Offiziere, sie glaubten nicht, noch etwas Entscheidendes zu finden.

USA tauschen ihre Verwalter im Irak aus
Washington (dpa) - Die Spitzenverwalter der USA im Irak werden ausgetauscht. Der bisherige zivile Verwaltungschef Jay Garner werde demnächst den Irak verlassen, berichtete die «Washington Post». Auch die oberste Zivilverwalterin der Region Bagdad, Barbara Bodine, sei auf einen neuen Posten in Washington versetzt worden. Die USA ziehen demnach auch einen großen Teil ihrer Waffeninspekteure im Irak ab - frustriert über den mangelnden Erfolg. Der «Washington Post» sagten Offiziere, sie glaubten nicht, noch etwas Entscheidendes zu finden.

Thema: Schön, dass die Verbrechen der Saddam-Clique nun endlich ein Ende gefunden haben:
Einige dieser Taten sind die nun nachfolgend angeführten:
1974-1976 : 291 bekannt gewordene Hinrichtungen, darunter Kurden, Kommunisten, Maoisten und Nasseristen.
1975: Einrichtung von KZs für 14 000 Kurdische Peshmerga, dort extrem hohe Sterblichkeit. Vertreibung von 25 000 Yesiden und 30 000 Khanakin-Kurden, panische Flucht von 250 000 Kurden in den Iran.
1975-1978: Vertreibung von 500 000 Kurden
1976-1988: Staatlich organisierte Mordanschläge durch irakische Diplomaten und Sicherheitsbeamte an irakischen und kurdischen Emigranten so in Lausanne (an dem GfbV-Beiratsmitglied Ismet Cherif Vanly), in London, in Paris, in Wien, in Aden, in Beirut, in Berlin, in Khartoum und in Modesto/Kalifornien
1977: Exekution von mehreren Hundert Kurden
1978: Hinrichtung von 253 Kurden im Gefängnis von Mossul.
September 1987-November- 1988: Giftgasoffensive "Anfal " begleitet von der Zerstörung von 5000 kurdischen, assyrischen und Yezidi-Dörfern. Zahl der Opfer: 60 000 ( Gutman, Handbuch Kriegsverbrechen) 150 000 (der britische Nahostexperte Prof. David Mc Dowall)
1979: Hinrichtung von 140 Personen
1987: Zahl der zerstörten chaldäischen. und nestorianischen Kirchen erreicht 85.
1980-88: Angriffskrieg gegen den Iran mit etwa 1. Million Toten.
1981: 300 vollstreckte Todesurteile an Kurden und Anhängern der Baath Partei.
1982: Hinrichtung von 27 Turkmenen, 166 Schiiten und 35 Kommunisten.
1983: 300 Hinrichtungen von Offizieren, Deserteuren, Demokraten und Schiiten.
1984: Hunderte von Hinrichtungen darunter Schüler, Studenten und Kurden.
1985: Ermordung von 300 Kurden, Hinrichtung von Assyrern und Kommunisten.
1986: Hinrichtung von 83 kurdischen Studenten, 25 KDP Mitgliedern, 38 Studenten der PUK und Ermordung von 300 verschwundenen kurdischen Kindern nach Folterung mit Elektroschocks und sexuellem Missbrauch.
1987: Verschwinden von 180 Schiiten, Exekution von 360 gefangenen Kurden darunter 17 Kindern, Vergiftung von 40 Angehörigen des Geheimdienstes mit Thallium.
1988: Massenerschiessung von 8000 männlichen Angehörigen der Barzani Großfamilie ( Parallele zu Srebrenica), Hinrichtung von 400 durch Luftangriffe verletzten kurdischen Zivilisten in der Tamjaro- Kaserne, Massenhinrichtung von Tausend Kurden in Dohuk
1988: Giftgasangriff auf Kurden- Stadt Halabja mit 5 000 Opfern.
1989: Verschwinden von 33 Assyrern, Hinrichtung von 94 Deserteuren, Hinrichtung von drei Generälen.
1991: Invasion Kuwaits.
1991: Niederschlagung des Schiitenaufstandes: 60 000- 100 000 Tote.
1991: Niederschlagung des Kurdenaufstandes, Flucht von etwa 1,5 Millionen Kurden in die Bergregionen des türkischen und iranischen Kurdistans, Zehntausende zivile Opfer.
http://www.gfbv.de/archiv/feb02/haider.htm#2
Einige dieser Taten sind die nun nachfolgend angeführten:
1974-1976 : 291 bekannt gewordene Hinrichtungen, darunter Kurden, Kommunisten, Maoisten und Nasseristen.
1975: Einrichtung von KZs für 14 000 Kurdische Peshmerga, dort extrem hohe Sterblichkeit. Vertreibung von 25 000 Yesiden und 30 000 Khanakin-Kurden, panische Flucht von 250 000 Kurden in den Iran.
1975-1978: Vertreibung von 500 000 Kurden
1976-1988: Staatlich organisierte Mordanschläge durch irakische Diplomaten und Sicherheitsbeamte an irakischen und kurdischen Emigranten so in Lausanne (an dem GfbV-Beiratsmitglied Ismet Cherif Vanly), in London, in Paris, in Wien, in Aden, in Beirut, in Berlin, in Khartoum und in Modesto/Kalifornien
1977: Exekution von mehreren Hundert Kurden
1978: Hinrichtung von 253 Kurden im Gefängnis von Mossul.
September 1987-November- 1988: Giftgasoffensive "Anfal " begleitet von der Zerstörung von 5000 kurdischen, assyrischen und Yezidi-Dörfern. Zahl der Opfer: 60 000 ( Gutman, Handbuch Kriegsverbrechen) 150 000 (der britische Nahostexperte Prof. David Mc Dowall)
1979: Hinrichtung von 140 Personen
1987: Zahl der zerstörten chaldäischen. und nestorianischen Kirchen erreicht 85.
1980-88: Angriffskrieg gegen den Iran mit etwa 1. Million Toten.
1981: 300 vollstreckte Todesurteile an Kurden und Anhängern der Baath Partei.
1982: Hinrichtung von 27 Turkmenen, 166 Schiiten und 35 Kommunisten.
1983: 300 Hinrichtungen von Offizieren, Deserteuren, Demokraten und Schiiten.
1984: Hunderte von Hinrichtungen darunter Schüler, Studenten und Kurden.
1985: Ermordung von 300 Kurden, Hinrichtung von Assyrern und Kommunisten.
1986: Hinrichtung von 83 kurdischen Studenten, 25 KDP Mitgliedern, 38 Studenten der PUK und Ermordung von 300 verschwundenen kurdischen Kindern nach Folterung mit Elektroschocks und sexuellem Missbrauch.
1987: Verschwinden von 180 Schiiten, Exekution von 360 gefangenen Kurden darunter 17 Kindern, Vergiftung von 40 Angehörigen des Geheimdienstes mit Thallium.
1988: Massenerschiessung von 8000 männlichen Angehörigen der Barzani Großfamilie ( Parallele zu Srebrenica), Hinrichtung von 400 durch Luftangriffe verletzten kurdischen Zivilisten in der Tamjaro- Kaserne, Massenhinrichtung von Tausend Kurden in Dohuk
1988: Giftgasangriff auf Kurden- Stadt Halabja mit 5 000 Opfern.
1989: Verschwinden von 33 Assyrern, Hinrichtung von 94 Deserteuren, Hinrichtung von drei Generälen.
1991: Invasion Kuwaits.
1991: Niederschlagung des Schiitenaufstandes: 60 000- 100 000 Tote.
1991: Niederschlagung des Kurdenaufstandes, Flucht von etwa 1,5 Millionen Kurden in die Bergregionen des türkischen und iranischen Kurdistans, Zehntausende zivile Opfer.
http://www.gfbv.de/archiv/feb02/haider.htm#2
hallo nasdaq 
guck mal auf die threadüberschrift!
dort steht amerika.
oder willst du auf die waffenlieferungen der amis an saddam hinweisen?
die chemiewaffen hat doch der amis geliefert.
selbst 80 prozent vom schwarzmarktöls, während des embargos, ging an amerika!


guck mal auf die threadüberschrift!
dort steht amerika.
oder willst du auf die waffenlieferungen der amis an saddam hinweisen?
die chemiewaffen hat doch der amis geliefert.
selbst 80 prozent vom schwarzmarktöls, während des embargos, ging an amerika!

Schön, dass die Verbrechen der Saddam-Clique nun endlich ein Ende gefunden haben:
Man hätte auch schreiben können:
Schön, dass die Verbrechen der Saddam-Clique durch die Intervention der USA endlich ein Ende gefunden hat.
Ferner ist zu hoffen, dass der Nahe Osten durch eine erfolgreiche US-Aussenpolitik ein Hort des Friedens und des Wohlstandes werden.
Dies würde nicht zuletzt
den desolaten Zustand deutschen Wirtschaftens
nicht unerheblich verbessern helfen.
ZITAT:
Powell will praktische Schritte sehen
Der amerikanische Außenminister Colin Powell hat bei politischen Gesprächen mit führenden Politikern aus Istrael und Palästina beide Seiten eindringlich zu "praktischen Schritten" aufgefordert, um eine rasche Verwirklichung des Nahost-Friedensplans zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Entwaffnung radikaler Palästinenser. Überschattet wurde sein Besuch von erneuten Attentaten. (...)
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,248222,00.html
Man hätte auch schreiben können:
Schön, dass die Verbrechen der Saddam-Clique durch die Intervention der USA endlich ein Ende gefunden hat.
Ferner ist zu hoffen, dass der Nahe Osten durch eine erfolgreiche US-Aussenpolitik ein Hort des Friedens und des Wohlstandes werden.
Dies würde nicht zuletzt
den desolaten Zustand deutschen Wirtschaftens
nicht unerheblich verbessern helfen.
ZITAT:
Powell will praktische Schritte sehen
Der amerikanische Außenminister Colin Powell hat bei politischen Gesprächen mit führenden Politikern aus Istrael und Palästina beide Seiten eindringlich zu "praktischen Schritten" aufgefordert, um eine rasche Verwirklichung des Nahost-Friedensplans zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Entwaffnung radikaler Palästinenser. Überschattet wurde sein Besuch von erneuten Attentaten. (...)
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,248222,00.html
nasdaq
hast du #165 gelesen?
hast du #165 gelesen?

Der Irak war ein Rückzugsgebiet für Terroristen,
ein Plangebiet für terroristische Aktivitäten,
Terror fand hier vor allem finanzielle Unterstützung.
Wir brauchen Frieden im Nahen Osten - dies ist der Kernpunkt. Wir brauchen fernen Impulse für eine wiederanziehende Weltkonjunktur.
Dies wird nur möglich sein, wenn geopolitische Probleme auf ein Minimum beschränkt werden.
ZITAT:
Powell hält Bedingungen für Friedensfahrplan erfüllt
US-Außenminister spricht mit Scharon und Abbas.
Arafat wird boykottiert.
Israeli nahe einer Siedlung im Westjordanland getötet.
Jerusalem - Der Umsetzung des internationalen Friedensplans für den Nahen Osten steht nach Ansicht von US-Außenminister Colin Powell nichts mehr im Weg. Auf beiden Seiten gebe es „genügend guten Willen und genügend Engagement, dass wir jetzt anfangen können“, sagte Powell nach einem Treffen mit dem palästinensischen Regierungschef Mahmud Abbas in Jericho. Zuvor hatte er nach einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Ariel Scharon in Jerusalem die von Israel angekündigten humanitären Erleichterungen für die Palästinenser begrüßt. Die neue Palästinenserregierung drängte er, „die Infrastrukturen des Terrorismus“ zu zerschlagen.
Israelis und Palästinenser hätten gezeigt, dass sie mit der Umsetzung des von EU, UNO, Russland und den USA ausgearbeiteten Friedensplans beginnen wollten, und bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, sagte Powell. Abbas drängte Israel, den Plan des Nahost-Quartetts vollständig anzunehmen. Zugleich forderte er von Israel die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen sowie Bewegungsfreiheit für Palästinenserpräsident Jassir Arafat. Auch der Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen müsse eingestellt werden.
Die palästinensische Führung unter Abbas ist mit dem Fahrplan des Nahost-Quartetts einverstanden, der eine etappenweise Annäherung bis zur Gründung eines Palästinenserstaats im Jahr 2005 vorsieht. Dagegen hatte Israel eine Liste mit Änderungswünschen vorgelegt. Der palästinensische Minister für Regierungsgeschäfte, Jassir Abed Rabbo, warf Israel nach dem Gespräch mit Powell vor, den Friedensplan abzulehnen.
Aus israelischen Regierungskreisen verlautete, der Gast aus Washington habe praktische Unterstützung beim Vorgehen gegen militante Palästinenser in Aussicht gestellt und seine Bereitschaft für wirtschaftliche und politische Hilfe bekräftigt. Nach den Gesprächen mit Scharon machte Powell aber auch deutlich, er habe Israel „eine Reihe spezifischer Handlungen“ dargelegt, mit denen die Situation in Gazastreifen und Westjordanland verbessert werden müssten.
Powell traf am Samstag in Israel ein, um die Umsetzung des Friedensplanes der internationalen Gemeinschaft einzuleiten. Zunächst führt er erste Gespräche mit seinem israelischen Kollegen Silvan Schalom. Er betonte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schalom, dass beide Seiten nun die in dem internationalen Friedensplan geforderten Maßnahmen treffen müssten. „Wir erwarten, dass (Israel) jetzt die Siedlungstätigkeit beendet, und wir haben dafür die Zusicherungen Israels“, betonte der US-Außenminister. Gleichzeitig aber müssten die Palästinenser „sicherstellen, dass die (palästinensischen) Terrorgruppen nicht länger eine Bedrohung für Israel darstellen.“ Es sei absolut notwendig, „Terror und Gewalt jetzt zu beenden“. Gleichzeitig aber müssten die Lebensbedingungen für die Palästinenser erleichtert werden.
(...)
http://www.welt.de/data/2003/05/11/91473.html
ein Plangebiet für terroristische Aktivitäten,
Terror fand hier vor allem finanzielle Unterstützung.
Wir brauchen Frieden im Nahen Osten - dies ist der Kernpunkt. Wir brauchen fernen Impulse für eine wiederanziehende Weltkonjunktur.
Dies wird nur möglich sein, wenn geopolitische Probleme auf ein Minimum beschränkt werden.
ZITAT:
Powell hält Bedingungen für Friedensfahrplan erfüllt
US-Außenminister spricht mit Scharon und Abbas.
Arafat wird boykottiert.
Israeli nahe einer Siedlung im Westjordanland getötet.
Jerusalem - Der Umsetzung des internationalen Friedensplans für den Nahen Osten steht nach Ansicht von US-Außenminister Colin Powell nichts mehr im Weg. Auf beiden Seiten gebe es „genügend guten Willen und genügend Engagement, dass wir jetzt anfangen können“, sagte Powell nach einem Treffen mit dem palästinensischen Regierungschef Mahmud Abbas in Jericho. Zuvor hatte er nach einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Ariel Scharon in Jerusalem die von Israel angekündigten humanitären Erleichterungen für die Palästinenser begrüßt. Die neue Palästinenserregierung drängte er, „die Infrastrukturen des Terrorismus“ zu zerschlagen.
Israelis und Palästinenser hätten gezeigt, dass sie mit der Umsetzung des von EU, UNO, Russland und den USA ausgearbeiteten Friedensplans beginnen wollten, und bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen, sagte Powell. Abbas drängte Israel, den Plan des Nahost-Quartetts vollständig anzunehmen. Zugleich forderte er von Israel die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen sowie Bewegungsfreiheit für Palästinenserpräsident Jassir Arafat. Auch der Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen müsse eingestellt werden.
Die palästinensische Führung unter Abbas ist mit dem Fahrplan des Nahost-Quartetts einverstanden, der eine etappenweise Annäherung bis zur Gründung eines Palästinenserstaats im Jahr 2005 vorsieht. Dagegen hatte Israel eine Liste mit Änderungswünschen vorgelegt. Der palästinensische Minister für Regierungsgeschäfte, Jassir Abed Rabbo, warf Israel nach dem Gespräch mit Powell vor, den Friedensplan abzulehnen.
Aus israelischen Regierungskreisen verlautete, der Gast aus Washington habe praktische Unterstützung beim Vorgehen gegen militante Palästinenser in Aussicht gestellt und seine Bereitschaft für wirtschaftliche und politische Hilfe bekräftigt. Nach den Gesprächen mit Scharon machte Powell aber auch deutlich, er habe Israel „eine Reihe spezifischer Handlungen“ dargelegt, mit denen die Situation in Gazastreifen und Westjordanland verbessert werden müssten.
Powell traf am Samstag in Israel ein, um die Umsetzung des Friedensplanes der internationalen Gemeinschaft einzuleiten. Zunächst führt er erste Gespräche mit seinem israelischen Kollegen Silvan Schalom. Er betonte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schalom, dass beide Seiten nun die in dem internationalen Friedensplan geforderten Maßnahmen treffen müssten. „Wir erwarten, dass (Israel) jetzt die Siedlungstätigkeit beendet, und wir haben dafür die Zusicherungen Israels“, betonte der US-Außenminister. Gleichzeitig aber müssten die Palästinenser „sicherstellen, dass die (palästinensischen) Terrorgruppen nicht länger eine Bedrohung für Israel darstellen.“ Es sei absolut notwendig, „Terror und Gewalt jetzt zu beenden“. Gleichzeitig aber müssten die Lebensbedingungen für die Palästinenser erleichtert werden.
(...)
http://www.welt.de/data/2003/05/11/91473.html
Korr.:
von hier aus
ferner
von hier aus
ferner
Hi Dolby
kennste den Witz


Aufgrund eines Hardware defektes ist das System bis auf weiteres deaktiviert. Schönen Sonntag noch.


kennste den Witz



Aufgrund eines Hardware defektes ist das System bis auf weiteres deaktiviert. Schönen Sonntag noch.


hallo knackarsch 
hast die diesen text zur hand, in dem aufgezählt wird, wieviele menschen die amis getötet haben? am ende kommt der satz "... und nun erzähl mir was zu massenvernichtungswaffen!"
haste den text?

hast die diesen text zur hand, in dem aufgezählt wird, wieviele menschen die amis getötet haben? am ende kommt der satz "... und nun erzähl mir was zu massenvernichtungswaffen!"
haste den text?

Bitte Mister:
Die Summe aller Schweigeminuten:
Falls Dir die schrecklichen Ereignisse am 11. September immer noch zu
Schaffen machen, nimm dir 2 Minuten Zeit um den 3.000 zivilen Opfern
von New York, Washington und Pennsylvania zu gedenken...
Wo Du gerade so schön dabei bist, kannst Du auch gleich noch 13
Schweigeminuten für die 130.000 irakischen Zivilisten einlegen, die 1991
unter dem Kommando von Präsident George Bush Sr. umkamen.
Dann kannst Du daran denken, wie die Amerikaner danach in den
Strassen gesungen und getanzt, gefeiert und geklatscht haben.
Jetzt ist es an der Zeit weitere 20 Schweigeminuten für die 200.000
iranischen Zivilisten einzulegen, die in den 80ern von Irakern mit
US-Gesponserten Waffen und Geld geopfert wurden, bevor Amerika
die Richtung wechselte und seine irakischen Freunde zum Feind erkor.
Du solltest Dir noch weitere 15 Minuten nehmen, um den Russen und
150.000 Afghanen zu gedenken, die von den Taliban getötet worden,
die ihre edle Ausbildung und Unterstützung von der CIA bekamen.
Dann wären da noch 10 Schweigeminuten für die 100.000 zivilen Opfer
der amerikanischen Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki
im zweiten Weltkrieg.
Du hast jetzt eine Stunde lang geschwiegen. 2 Minuten für die getöteten
Amerikaner in New York, Washington und Pennsylvania und 58 Minuten
für deren Opfer auf der ganzen Welt.
Falls Dir die Relationen immer noch nicht vollständig bewusst sind,
Kannst du noch eine weitere Schweigestunde für die Opfer des
Vietnamkrieges draufschlagen.
Oder für das Massaker in Panama 1989, bei dem amerikanische
Truppen arme, unschuldige Dörfler angriffen um 20.000 Obdachlose
und tausende Tote zu hinterlassen.
Oder für die Millionen von Kindern, die ob der Unterversorgung durch
das US-Embargo gegen den Irak und Kuba starben.
Oder für die Hunderttausenden, die bei US-Finanzierten Bürgerkriegen
(Chile, Argentinien, Uruguay, Bolivien, Guatemala, El Salvador - um nur
ein paar wenige Beispiele zu nennen) ums Leben kamen.
Und jetzt können wir noch mal über Terrorismus reden
Die Summe aller Schweigeminuten:
Falls Dir die schrecklichen Ereignisse am 11. September immer noch zu
Schaffen machen, nimm dir 2 Minuten Zeit um den 3.000 zivilen Opfern
von New York, Washington und Pennsylvania zu gedenken...
Wo Du gerade so schön dabei bist, kannst Du auch gleich noch 13
Schweigeminuten für die 130.000 irakischen Zivilisten einlegen, die 1991
unter dem Kommando von Präsident George Bush Sr. umkamen.
Dann kannst Du daran denken, wie die Amerikaner danach in den
Strassen gesungen und getanzt, gefeiert und geklatscht haben.
Jetzt ist es an der Zeit weitere 20 Schweigeminuten für die 200.000
iranischen Zivilisten einzulegen, die in den 80ern von Irakern mit
US-Gesponserten Waffen und Geld geopfert wurden, bevor Amerika
die Richtung wechselte und seine irakischen Freunde zum Feind erkor.
Du solltest Dir noch weitere 15 Minuten nehmen, um den Russen und
150.000 Afghanen zu gedenken, die von den Taliban getötet worden,
die ihre edle Ausbildung und Unterstützung von der CIA bekamen.
Dann wären da noch 10 Schweigeminuten für die 100.000 zivilen Opfer
der amerikanischen Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki
im zweiten Weltkrieg.
Du hast jetzt eine Stunde lang geschwiegen. 2 Minuten für die getöteten
Amerikaner in New York, Washington und Pennsylvania und 58 Minuten
für deren Opfer auf der ganzen Welt.
Falls Dir die Relationen immer noch nicht vollständig bewusst sind,
Kannst du noch eine weitere Schweigestunde für die Opfer des
Vietnamkrieges draufschlagen.
Oder für das Massaker in Panama 1989, bei dem amerikanische
Truppen arme, unschuldige Dörfler angriffen um 20.000 Obdachlose
und tausende Tote zu hinterlassen.
Oder für die Millionen von Kindern, die ob der Unterversorgung durch
das US-Embargo gegen den Irak und Kuba starben.
Oder für die Hunderttausenden, die bei US-Finanzierten Bürgerkriegen
(Chile, Argentinien, Uruguay, Bolivien, Guatemala, El Salvador - um nur
ein paar wenige Beispiele zu nennen) ums Leben kamen.
Und jetzt können wir noch mal über Terrorismus reden
das ist er!
danke
danke

@Dolby
gute Idee mit dem Umzug, aber ich bin ja nicht das Leittier
die Freiheit war/ist etwas zu eingegrenzt bei ..... sollen die in ihren eigenen Saft schmoren und in ewiger Langweile untergehen
mfg
gute Idee mit dem Umzug, aber ich bin ja nicht das Leittier

die Freiheit war/ist etwas zu eingegrenzt bei ..... sollen die in ihren eigenen Saft schmoren und in ewiger Langweile untergehen

mfg
http://www.kurier.at/wirtschaft/167613.php
Dollar: Snow gießt Öl ins Feuer
Brüssel - Die europäischen Finanzminister machen sich Sorgen um den Zinsabstand zwischen den USA und der Euro-Zone und werden das Thema bei ihrem Treffen am Abend in Brüssel beraten: "Die Euro-Gruppe (Finanzminister der Euro-Zone) wird den Wechselkurs des Euro und die Zinsen diskutieren. Es gibt eine klare Besorgnis angesichts des Zinsabstands zwischen den USA und der Euro-Zone", sagte ein EU-Diplomat am Montag im Vorfeld des Treffens.
Vier-Jahres-Rekord
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte vergangenen Woche die Zinsen in der Euro-Zone unverändert bei 2,50 Prozent gelassen. Damit sind die Zinsen in der Euro-Zone weiterhin doppelt so hoch wie in den USA. Der Euro setzte zudem auch am Montag seinen jüngsten Höhenflug fort und stieg über 1,16 Dollar - der höchste Stand seit mehr als vier Jahren. "Es gibt durchaus Anlass, sich über die Situation und seine Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft Gedanken zu machen", fügte der Diplomat hinzu.
Kontrollierte Abwertung
Grund für den Höhenflug des Euro waren nicht zuletzt jüngste Äußerungen von US-Finanzminister John Snow über die aktuelle Dollar-Schwäche. Das löste Händlern zufolge Spekulationen um ein Abrücken der amerikanischen Regierung von ihrer Politik einer starken US-Währung aus. Snow hatte in einem TV-Interview den fallenden Wechselkurs des Dollar als hilfreich für US-Exporte bezeichnet. Bei einem anderen TV-Auftritt hatte er allerdings bekräftigt, dass die Regierung an ihrer Politik des starken Dollar festhalte.
Artikel vom 12.05.2003 |apa,reuters |ch
--------
Starker Dollar
Dollar: Snow gießt Öl ins Feuer
Brüssel - Die europäischen Finanzminister machen sich Sorgen um den Zinsabstand zwischen den USA und der Euro-Zone und werden das Thema bei ihrem Treffen am Abend in Brüssel beraten: "Die Euro-Gruppe (Finanzminister der Euro-Zone) wird den Wechselkurs des Euro und die Zinsen diskutieren. Es gibt eine klare Besorgnis angesichts des Zinsabstands zwischen den USA und der Euro-Zone", sagte ein EU-Diplomat am Montag im Vorfeld des Treffens.
Vier-Jahres-Rekord
Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte vergangenen Woche die Zinsen in der Euro-Zone unverändert bei 2,50 Prozent gelassen. Damit sind die Zinsen in der Euro-Zone weiterhin doppelt so hoch wie in den USA. Der Euro setzte zudem auch am Montag seinen jüngsten Höhenflug fort und stieg über 1,16 Dollar - der höchste Stand seit mehr als vier Jahren. "Es gibt durchaus Anlass, sich über die Situation und seine Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft Gedanken zu machen", fügte der Diplomat hinzu.
Kontrollierte Abwertung
Grund für den Höhenflug des Euro waren nicht zuletzt jüngste Äußerungen von US-Finanzminister John Snow über die aktuelle Dollar-Schwäche. Das löste Händlern zufolge Spekulationen um ein Abrücken der amerikanischen Regierung von ihrer Politik einer starken US-Währung aus. Snow hatte in einem TV-Interview den fallenden Wechselkurs des Dollar als hilfreich für US-Exporte bezeichnet. Bei einem anderen TV-Auftritt hatte er allerdings bekräftigt, dass die Regierung an ihrer Politik des starken Dollar festhalte.
Artikel vom 12.05.2003 |apa,reuters |ch
--------
Starker Dollar

12/05/2003 15:34
FOKUS 2- Spekulation um Wende in US-Geldpolitik treibt Euro
(Neu: Weitere Entwicklung, aktualisierte Kurse)
London, 12. Mai (Reuters) - Spekulationen um eine Abkehr der
US-Regierung von ihrer bisherigen Politik eines starken Dollar
haben den Euro am Montag zeitweise auf ein neues
Vier-Jahres-Hoch von 1,1623 Dollar getrieben. Auslöser für die
Spekulationen waren Aussagen von US-Finanzministers John Snow
zur aktuellen Dollar-Schwäche. Die Diskussion um den
europäischen Stabilitätspakt und mögliche Zinssenkungen spielten
nach Aussagen von Experten dagegen nur eine untergeordnete Rolle
am Devisenmarkt.
Snow hatte in einem TV-Interview den fallenden Wechselkurs
des Dollar als hilfreich für US-Exporte bezeichnet. Bei einem
anderen TV-Auftritt hatte er allerdings bekräftigt, dass die
Regierung an ihrer Politik des starken Dollar festhalte.
"Obwohl er (Snow) die Politik eines starken Dollar bekräftigt
hat, verband er sie mit der Wirtschaftslage", sagte der
Devisenstratege Paul Mackel von Dresdner Kleinwort Wasserstein
in London. Da Snow gleichzeitig die US-Konjunktur als schwach
bezeichnet habe, sei nicht zu erwarten, dass er oder die
US-Regierung einen Kursanstieg des Dollar unterstützen würden.
Der Devisenstratege Marshall Gittler von der Deutschen Bank
kommentierte die Aussagen des Ministers mit den Worten: "Ich
denke, sie (die US-Regierung) würden eine kontrollierte
Abwertung des Dollar begrüßen, aber sie können es nicht laut
sagen, denn dann würde er (der Dollar-Kurs) zusammenbrechen."
EURO-STÄRKE HÄLT AN - DOLLAR VERLIERT AUCH ZUM YEN
Am frühen Nachmittag lag der Euro bei 1,1595/99
Dollar, nach einem Stand von 1,1486/92 Dollar bei Handelsschluss
in New York am Freitag. Im Referenzkursverfahren
EuroFX wurde der Kurs des Euro mit 1,1580 (Freitag
1,1488) Dollar festgelegt. Die EZB ermittelte den
Referenzkurs mit 1,1597 (1,1466) Dollar.
Parallel dazu verbilligte sich die US-Währung auf 116,56/62
Yen. Hier verhinderten Händlern zufolge aber Spekulationen
um eine Intervention der Bank von Japan zur Stützung des Yen
größere Verluste.
In den vergangenen Wochen hatte die US-Währung wegen der
unklaren Aussichten für die US-Konjunktur und der im Vergleich
zur Euro-Zone niedrigeren Leitzinsen kontinuierlich an Wert
verloren. "Das nächste Ziel für den Euro wäre die Marke von
1,1745 Dollar, bei der er erstmals gehandelt wurde", sagte ein
japanischer Devisenhändler. Ein Sprung über diese Hürde könnte
den Euro dann auf bis zu 1,20 Dollar treiben.
ANLEGER ERHOFFEN SICH VON ECOFIN-TREFFEN AUSSAGEN ZUM EURO
Obwohl sich europäische Politiker bislang gelassen zur
aktuellen Stärke der Gemeinschaftswährung geäußert haben,
erhofften sich Marktteilnehmer von dem am Montag beginnenden
Treffen der europäischen Wirtschafts- und Finanzminister
(EcoFin) Aussagen über die Geschwindigkeit des Kursanstiegs.
Mit Blick auf die Entwicklung der Leitzinsen hieß es weiter,
die Politiker würden zur Ankurbelung der Konjunktur von der EZB
voraussichtlich eine Senkung fordern. Mit einer unmittelbaren
Reaktion der Währungshüter sei aber nicht zu rechnen. "Es gibt
sicher ein Tauziehen zwischen der EZB und EcoFin", sagte der
Stratege Mackel. "Das könnte beim Euro/Dollar einige
Gewinnmitnahmen auslösen."
SOLBES-SPRECHER - STABILITÄTSPAKT NICHT IN GEFAHR
Die EU-Kommission sieht nach Aussagen eines Sprechers des
EU-Währungskommissars Pedro Solbes in dem Eingeständnis von
Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) einer erneuten
Überschreitung der europäischen Defizitgrenze keine Gefahr für
den Stabilitätspakt. Im Maastrichter Vertrag ist die Höhe der
Neuverschuldung auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes
festgesetzt.
ers/fun

FOKUS 2- Spekulation um Wende in US-Geldpolitik treibt Euro
(Neu: Weitere Entwicklung, aktualisierte Kurse)
London, 12. Mai (Reuters) - Spekulationen um eine Abkehr der
US-Regierung von ihrer bisherigen Politik eines starken Dollar
haben den Euro am Montag zeitweise auf ein neues
Vier-Jahres-Hoch von 1,1623 Dollar getrieben. Auslöser für die
Spekulationen waren Aussagen von US-Finanzministers John Snow
zur aktuellen Dollar-Schwäche. Die Diskussion um den
europäischen Stabilitätspakt und mögliche Zinssenkungen spielten
nach Aussagen von Experten dagegen nur eine untergeordnete Rolle
am Devisenmarkt.
Snow hatte in einem TV-Interview den fallenden Wechselkurs
des Dollar als hilfreich für US-Exporte bezeichnet. Bei einem
anderen TV-Auftritt hatte er allerdings bekräftigt, dass die
Regierung an ihrer Politik des starken Dollar festhalte.
"Obwohl er (Snow) die Politik eines starken Dollar bekräftigt
hat, verband er sie mit der Wirtschaftslage", sagte der
Devisenstratege Paul Mackel von Dresdner Kleinwort Wasserstein
in London. Da Snow gleichzeitig die US-Konjunktur als schwach
bezeichnet habe, sei nicht zu erwarten, dass er oder die
US-Regierung einen Kursanstieg des Dollar unterstützen würden.
Der Devisenstratege Marshall Gittler von der Deutschen Bank
kommentierte die Aussagen des Ministers mit den Worten: "Ich
denke, sie (die US-Regierung) würden eine kontrollierte
Abwertung des Dollar begrüßen, aber sie können es nicht laut
sagen, denn dann würde er (der Dollar-Kurs) zusammenbrechen."
EURO-STÄRKE HÄLT AN - DOLLAR VERLIERT AUCH ZUM YEN
Am frühen Nachmittag lag der Euro bei 1,1595/99
Dollar, nach einem Stand von 1,1486/92 Dollar bei Handelsschluss
in New York am Freitag. Im Referenzkursverfahren
EuroFX wurde der Kurs des Euro mit 1,1580 (Freitag
1,1488) Dollar festgelegt. Die EZB ermittelte den
Referenzkurs mit 1,1597 (1,1466) Dollar.
Parallel dazu verbilligte sich die US-Währung auf 116,56/62
Yen. Hier verhinderten Händlern zufolge aber Spekulationen
um eine Intervention der Bank von Japan zur Stützung des Yen
größere Verluste.
In den vergangenen Wochen hatte die US-Währung wegen der
unklaren Aussichten für die US-Konjunktur und der im Vergleich
zur Euro-Zone niedrigeren Leitzinsen kontinuierlich an Wert
verloren. "Das nächste Ziel für den Euro wäre die Marke von
1,1745 Dollar, bei der er erstmals gehandelt wurde", sagte ein
japanischer Devisenhändler. Ein Sprung über diese Hürde könnte
den Euro dann auf bis zu 1,20 Dollar treiben.
ANLEGER ERHOFFEN SICH VON ECOFIN-TREFFEN AUSSAGEN ZUM EURO
Obwohl sich europäische Politiker bislang gelassen zur
aktuellen Stärke der Gemeinschaftswährung geäußert haben,
erhofften sich Marktteilnehmer von dem am Montag beginnenden
Treffen der europäischen Wirtschafts- und Finanzminister
(EcoFin) Aussagen über die Geschwindigkeit des Kursanstiegs.
Mit Blick auf die Entwicklung der Leitzinsen hieß es weiter,
die Politiker würden zur Ankurbelung der Konjunktur von der EZB
voraussichtlich eine Senkung fordern. Mit einer unmittelbaren
Reaktion der Währungshüter sei aber nicht zu rechnen. "Es gibt
sicher ein Tauziehen zwischen der EZB und EcoFin", sagte der
Stratege Mackel. "Das könnte beim Euro/Dollar einige
Gewinnmitnahmen auslösen."
SOLBES-SPRECHER - STABILITÄTSPAKT NICHT IN GEFAHR
Die EU-Kommission sieht nach Aussagen eines Sprechers des
EU-Währungskommissars Pedro Solbes in dem Eingeständnis von
Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) einer erneuten
Überschreitung der europäischen Defizitgrenze keine Gefahr für
den Stabilitätspakt. Im Maastrichter Vertrag ist die Höhe der
Neuverschuldung auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes
festgesetzt.
ers/fun

12.05. 13:47
Barron´s: Nasdaq Rallye bis über 2000 Punkte
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Das US-Börsenmagazin Barron´s interviewte in der Wochenendausgabe den technischen Strategen Pip Coburn der Investmentbank UBS Warburg und befragte ihn bezüglich seines langfristigen Ausblickes für den Markt. Der auf den Technologiesektor spezialisierte Stratege geht davon aus, dass der Markt vor einer „Supernova Rallye“ steht, die den Nasdaq über 2000 Punkte und darüber hinaus bewegen könnte. Jedoch geht er auch davon aus, dass die Rallye nur kurz anhalten wird, da es keine neuen Technologien in Sichtweite gebe, die das Umsatzwachstum erneut deutlich antreiben könnten. Die Erwartung des Marktes bezüglich des langfristigen Umsatzwachstums im Technologiesektor von 10-15% seien über seiner Erwartung von 6-7% Wachstum. Die Hauptprofiteure der Aktienrallye im Techsektor seien Unternehmen aus dem Halbleitersektor, dem Halbleiter Equipment Sektor, und Softwareunternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Unternehmen wie Intel (WKN: 855681, Nasdaq: INTC), Dell (WKN: 875403, US: DELL), Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT), International Business Machines (WKN: 851399, Nasdaq: IBM) und Cisco Systems (WKN: 878841, Nasdaq: CSCO) hätten zu wenig Wachstumspotential bei den Umsätzen, sodass sie von den Anlegern gemieden würden.

Barron´s: Nasdaq Rallye bis über 2000 Punkte
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Das US-Börsenmagazin Barron´s interviewte in der Wochenendausgabe den technischen Strategen Pip Coburn der Investmentbank UBS Warburg und befragte ihn bezüglich seines langfristigen Ausblickes für den Markt. Der auf den Technologiesektor spezialisierte Stratege geht davon aus, dass der Markt vor einer „Supernova Rallye“ steht, die den Nasdaq über 2000 Punkte und darüber hinaus bewegen könnte. Jedoch geht er auch davon aus, dass die Rallye nur kurz anhalten wird, da es keine neuen Technologien in Sichtweite gebe, die das Umsatzwachstum erneut deutlich antreiben könnten. Die Erwartung des Marktes bezüglich des langfristigen Umsatzwachstums im Technologiesektor von 10-15% seien über seiner Erwartung von 6-7% Wachstum. Die Hauptprofiteure der Aktienrallye im Techsektor seien Unternehmen aus dem Halbleitersektor, dem Halbleiter Equipment Sektor, und Softwareunternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Unternehmen wie Intel (WKN: 855681, Nasdaq: INTC), Dell (WKN: 875403, US: DELL), Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT), International Business Machines (WKN: 851399, Nasdaq: IBM) und Cisco Systems (WKN: 878841, Nasdaq: CSCO) hätten zu wenig Wachstumspotential bei den Umsätzen, sodass sie von den Anlegern gemieden würden.

Die Ami-Exporteure freuen sich: Die Gewinne steigen.
ZITAT:
12.05.03, Smith Barney: Schwacher Dollar ist positiv - boerse-go.de
Smith Barney Stratege Tobias Levkovich sehe “deutliche Vorteile” für die US-Wirtschaft aus dem schwachen Dollarkurs.
Dieser sollte die Wettbewerbsposition der US-Unternehmen im weltweiten Vergleich stärken
und die Gewinne der großkapitalisierten Unternehmen stützen.
Zudem könnte der schwache Dollar die Sorgen über eine Deflation mindern. Der Euro steigt zuletzt um 0,21% auf $1.1593, das Hoch lag bei $1.1614 und damit nur leicht unter dem Emissionskurs bei $1.1714.
ZITAT:
12.05.03, Smith Barney: Schwacher Dollar ist positiv - boerse-go.de
Smith Barney Stratege Tobias Levkovich sehe “deutliche Vorteile” für die US-Wirtschaft aus dem schwachen Dollarkurs.
Dieser sollte die Wettbewerbsposition der US-Unternehmen im weltweiten Vergleich stärken
und die Gewinne der großkapitalisierten Unternehmen stützen.
Zudem könnte der schwache Dollar die Sorgen über eine Deflation mindern. Der Euro steigt zuletzt um 0,21% auf $1.1593, das Hoch lag bei $1.1614 und damit nur leicht unter dem Emissionskurs bei $1.1714.
@ Nase
"Die Ami-Exporteure freuen sich: Die Gewinne steigen."
Nur "leider" gibts nicht so viel, was unsere Superamis der Welt noch anzudrehen haben.
M.
"Die Ami-Exporteure freuen sich: Die Gewinne steigen."
Nur "leider" gibts nicht so viel, was unsere Superamis der Welt noch anzudrehen haben.
M.

Schön, dass die Verbrechen der Hitler-Clique
durch die Intervention der USA ein Ende gefunden hat.
Wieviele deutsche Zivilisten kamen denn bei diesen Aktionen um?
Etwa auch durch Massenvernichtungswaffen?
durch die Intervention der USA ein Ende gefunden hat.
Wieviele deutsche Zivilisten kamen denn bei diesen Aktionen um?
Etwa auch durch Massenvernichtungswaffen?
nasdaq
warum mussten ca. 100.000 menschen in afghanistan fliehen?
der "grund" fehlt genauso wie momentan im irak.
darum gehts mir.
warum mussten ca. 100.000 menschen in afghanistan fliehen?
der "grund" fehlt genauso wie momentan im irak.
darum gehts mir.
@ Dolby
Was ist eigentlich mit scn los, ich vermisse Germa.
M.
Was ist eigentlich mit scn los, ich vermisse Germa.
M.
Maikaefer_bella_Font
h++p://www.online-palaver.de
h++p://www.online-palaver.de
Trotz der niedrigen Lohnnebenkosten will kein US Patriot mehr dort investieren.
Wie Bush dort Jobs schaffen will
 weiß nur er.
weiß nur er.
-----------------------------------
Intel investiert $41 Millionen in Indien
Intel (WKN: 855681, Nasdaq: INTC) wird laut einer Ankündigung vom Montag $41 Millionen in Indien investieren und 1000 neue Leute einstellen. Die Investitionen sollen in eine neue Einrichtung fließen, die für die Entwicklung von Mikroprozessoren der nächsten Generation geeignet sein soll. Das Unternehmen, dessen fünf Jahre alte Chipentwicklungsstätte in Bangalore bereits die größte nicht für die Fertigung vorgesehene Einrichtung Intels außerhalb der USA ist, will bis Ende 2004 die Zahl der Mitarbeiter auf 2,000 verdoppeln. Auch andere Unternehmen wie Motorola (WKN: 853936, US: MOT), Texas Instruments (WKN: 852654, US: TXN) und International Business Machines (WKN: 851399, Nasdaq: IBM) bauen ihre Einrichtungen in Indien aus und verstärken ihre Präsenz in dem Land, um von dem großen Pool an englischsprachigen Spezialisten zu profitieren, die zu einem Bruchteil der Kosten beschäftigt werden können, als in den USA oder Europa.
© BörseGo
Wie Bush dort Jobs schaffen will

 weiß nur er.
weiß nur er.-----------------------------------
Intel investiert $41 Millionen in Indien
Intel (WKN: 855681, Nasdaq: INTC) wird laut einer Ankündigung vom Montag $41 Millionen in Indien investieren und 1000 neue Leute einstellen. Die Investitionen sollen in eine neue Einrichtung fließen, die für die Entwicklung von Mikroprozessoren der nächsten Generation geeignet sein soll. Das Unternehmen, dessen fünf Jahre alte Chipentwicklungsstätte in Bangalore bereits die größte nicht für die Fertigung vorgesehene Einrichtung Intels außerhalb der USA ist, will bis Ende 2004 die Zahl der Mitarbeiter auf 2,000 verdoppeln. Auch andere Unternehmen wie Motorola (WKN: 853936, US: MOT), Texas Instruments (WKN: 852654, US: TXN) und International Business Machines (WKN: 851399, Nasdaq: IBM) bauen ihre Einrichtungen in Indien aus und verstärken ihre Präsenz in dem Land, um von dem großen Pool an englischsprachigen Spezialisten zu profitieren, die zu einem Bruchteil der Kosten beschäftigt werden können, als in den USA oder Europa.
© BörseGo
Für Kumpel Dolby mal ein leckeren Text von 1975, welchen ich durch Zufall im Netz fand!

***********************************************************
Der Dollar auf dem Weg in die Pleite von 1971
Bretton Woods: Der Dollar auf dem Weg in die Pleite von 1971
„Die fünfziger Jahre gingen zu Ende, als die letzten Bücher zum Problem der Dollarknappheit erschienen und die ersten Kommentare mit entgegengesetzter Tendenz über das anhaltende Defizit in der Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden. In der Tat zeichneten sich die fünfziger Jahre dadurch aus, daß Europa und Japan weitere Fortschritte machten, daß die Nichtkonvertierbarkeit der Währungen nach und nach aufgehoben wurde, daß der Handel sich liberalisierte, daß das jährliche Zahlungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten und der Abfluß langfristiger Gelder insbesondere nach Westeuropa zunahmen, während die diskriminierenden Maßnahmen gegenüber amerikanischen Exporten nach und nach verschwanden.
Während der Jahre der Marshallplanhilfe hatte die amerikanische Zahlungsbilanz ein geringes Defizit aufgewiesen, das jedoch durchaus mit den Zielen der amerikanischen Führung in Einklang stand, da in Fort Knox ein Goldvorrat von über 20 Milliarden Dollar lag, etwas mehr als die Hälfte der Weltreserven an Gold. Damals sprach man nicht vom Zahlungsbilanzdefizit, sondern von einer Umverteilung der Weltreserven. Die Reserven der Vereinigten Staaten waren von 14,6 Milliarden Dollar in 1938 auf 22,9 Milliarden in 1947 und 24,6 Milliarden in 1949 gestiegen, um bis 1958 auf 20,6 Milliarden zurückzugehen. Zehn Jahre später betrugen sie rund 10 Milliarden Dollar.
(...)
Der letzte Bericht an den Kongreß enthält für 1969, 1970 und 1971 die folgenden Zahlen: In der Nettoliquiditätsbilanz ein Defizit von 6,084 Milliarden, 3,821 Milliarden und 23,439 Milliarden Dollar und der Bilanz der offiziellen Reservetransaktionen im Jahre 1969 einen Überschuß von 2,704 Milliarden und dann ein Defizit von 9,821 bzw. von 31,810 Milliarden Dollar. (...)
Wenden wir uns zunächst der Waren-, Dienstleistungs-, und Übertragungsbilanz zu. Sie wies 1964 einen Überschuss von 7,8 Milliarden Dollar auf, verschlechterte sich dann aber von Jahr zu Jahr immer mehr (mit Ausnahme des Jahres 1970, als die Vereinigten Staaten zu einer deflationistischen Politik übergingen). In den ersten drei Quartalen 1971 war der Überschuß, auf Jahresbasis umgerechnet, auf 0,1 Milliarden Dollar zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum wies die Handelsbilanz, die 1964 noch einen Überschuß von 6,8 Milliarden Dollar gezeigt hatte, ein Defizit von 1,7 Milliarden Dollar auf. Von 1964 - 1971 hatten die Einfuhren um 147 % (jährlich 14 %), die Ausfuhren aber nur um 74 % zugenommen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß ein Teil der amerikanischen Ausfuhren mit Krediten bezahlt wurde, die von den Empfängern nur in den Vereinigten Staaten verwendet werden durften (zweckgebundene Kredite).
Die Erweiterung des Defizits (trotz gestiegener Kapitalerträge aus Auslandsinvestitionen) hängt offenkundig mit der seit 1965 einsetzenden bzw. sich verstärkenden Inflation und mit der massiven Intervention in Vietnam zusammen (zwischen 1960 und 1964 stiegen die Exporte von 19,650 auf 26,478 Milliarden Dollar und die Importe von 14,744 auf 18,647 Milliarden Dollar). Während der Preis der Arbeitsstunde zwischen 1960 und 1965 in den Vereinigten Staaten sank, stieg er in den übrigen Industrieländern. Zwischen 1966 und 1970 zeigen die Statistiken eine gleichmäßige Steigerung in den Vereinigten Staaten wie bei den Hauptkonkurrenten, während bei den Preisen für exportierte Fertigwaren die Steigerung bei den Vereinigten Staaten höher war als bei der ausländischen Konkurrenz.
Da die militärischen Transaktionen einen Kostenfaktor zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Milliarden Dollar darstellen und die Dienstleistungen genauso wie die privaten und die öffentlichen Übertragungen in der Regel ein Defizit aufweisen, blieben während der sechziger Jahre nur zwei positive Posten übrig: die Warenhandelsbilanz und die Kapitalerträge. Der Überschuß dieses letzteren Postens ist von durchschnittlich 1,2 Milliarden (1960 - 1964) auf 5,2 Milliarden in 1970 gestiegen (das ist der Nettobetrag, der Bruttobetrag beläuft sich auf 11,4 Milliarden Dollar).
Die Verschlechterung der Leistungsbilanz hat auf die langfristigen Kapitalbewegungen, die von durchschnittlich 2,2 Milliarden zwischen 1960 und 1964 auf 4,4 Milliarden in 1970 gestiegen sind, keinen Einfluß gehabt. Seit die Währungsbehörden im Jahre 1970 einen währungspolitischen Expansionskurs beschlossen, um den Wiederaufschwung der Wirtschaft zu unterstützen, und in Europa wegen des Nachhinkens der Konjunktur weiterhin höhere Zinssätze galten, hat sich die Leistungsbilanz in den Hauptposten immer rapider verschlechtert. Das offizielle Defizit hatte 1970 annähernd 10 Milliarden Dollar erreicht. Der auch 1971 anhaltende Dollarabfluß aus den Vereinigten Staaten ließ das Defizit so weit anwachsen, bis es für die europäischen Zentralbanken unerträglich wurde und sie vor der Alternative standen, entweder unbegrenzt Dollars aufzunehmen oder die Parität der amerikanischen Währung auf einem freien Markt schwanken zu lassen (sei es auf einem einheitlichen Markt oder einem gespaltenen Finanz- und Handelsmarkt).
(...)
Bei den Vorwürfen und Gegenvorwürfen, die in der ersten Hälfte der sechziger Jahre zwischen Europäern (vor allem Franzosen) und Amerikanern ausgetauscht wurden, ging es zum einen darum, welchem Posten man die ‚Verantwortung, (im doppelten Sinne von Ursache und Fehler) für das amerikanische Defizit zuschreiben sollte, zum anderen um das Wertverhältnis von Gold und Dollar. Solange der scheinbare Handelsbilanzüberschuß zwischen 4,5 und 6 Milliarden Dollar lag, war nichts leichter, als das Defizit der internationalen Rolle der Vereinigten Staaten, ihrem Anteil an der ‚Verteidigung der Freien Welt’ zuzuschreiben. Gleichgültig, ob man das Defizit nach der einen oder anderen Methode berechnete, es erreichte in etwa die Höhe der Militärausgaben der amerikanischen Regierung im Ausland. In einer solchen Deutung wird allerdings der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Posten einer Zahlungsbilanz verkannt; der Handelsbilanzüberschuß ging teilweise auf die Dollarschwemme zurück, die durch Regierungsausgaben im Ausland und durch zweckgebundene Kredite (tied loans) entstanden war. Im übrigen setzte eine solche Argumentationen noch auf politischer Ebene die Zustimmung der Europäer zur Diplomatie der Vereinigten Staaten voraus - eine Zustimmung, die wenigstens seit 1965 nicht mehr gegeben war.
Kaum sinnvoller war auch die Auseinandersetzung über die Wertbeziehung zwischen Gold und Dollar. Es ist unklar, was hinter der Behauptung steckt, der Wert des Goldes beruhe auf dem Wert des Dollars, wie mir einer der wirtschaftswissenschaftlichen Berater des Präsidenten wiederholt versicherte. Nehmen wir an, sämtliche Staaten würden beschließen, dem Gold seine monetäre Funktion zu nehmen, dann würde der Preis dieses Metalls, das zu einem Rohstoff wie alle anderen geworden wäre, ganz offenbar sinken, zumindest anfangs; allerdings kann kein Staat, wie mächtig er auch sei, allein eine solche Entscheidung treffen. Es ist allgemein bekannt, daß die Regierung der Vereinigten Staaten es nicht zulassen wird, daß ihre Goldreserven unter einen gewissen Stand sinken (den man auf rund 10 Milliarden Dollar schätzt). Demnach stützt sich der Wert des Goldes keineswegs auf den Wert des Dollar, sondern kann über diesen hinausgehen, wenn eine sowohl industrielle als auch monetäre Nachfrage nach diesem Edelmetall besteht.
Die ‚Demonetisierung des Goldes’ ist ebenfalls ein mißverständlicher Ausdruck. Da die Reserven sämtlicher Zentralbanken zum großen Teil aus Gold bestehen, wird eine offizielle Demonetisierung, die der einstigen Demonetisierung des Silbers vergleichbar wäre, keine Zustimmung finden. Keine Zentralbank, nicht einmal der Federal Reserve Board, ist so mächtig, allein diese Demonetisierung durchsetzen zu können. Da jede Währung im Verhältnis zu den übrigen Währungen Schwankungen ausgesetzt ist, fällt es schwer, auf das Gold als Wertmaßstab zu verzichten. Man kann allerdings die monetäre Verwendung des Goldes auf den Austausch zwischen den Zentralbanken beschränken und die beiden Märkte voneinander trennen - damit wäre die monetäre Verwendung des Goldes eingeschränkt, aber nicht aufgehoben.
(...)
Die Vereinigten Staaten konnten ihr Zahlungsbilanzdefizit mit ‚gütiger Nachsicht’ hinnehmen, da die europäischen Zentralbanken die wegen des amerikanischen Defizits in ihre Kassen strömenden Dollarüberschüsse auf dem New Yorker Markt in Schatzanweisungen umtauschten.
Erhielt sich das Defizit aus sich selbst heraus? Beruhte es mit Notwendigkeit darauf, daß die Dollars, welche das Defizit ausmachten, in den Vereinigten Staaten untergebracht wurden? Mir scheint, daß die amerikanischen Defizite bis zur beschleunigten Inflationsphase von 1965 - 1970 weder für die amerikanische noch für die europäische Inflation die wesentliche Ursache waren. Der Golddevisenstandard oder mit anderen Worten die Verwendung einer einzigen Währung, der amerikanischen, als Reservewährung und die durch das Zahlungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten wachsende internationale Liquidität waren von Anfang an mit einer Schwäche behaftet. Auf lange Sicht muß das Defizit der Vereinigten Staaten Besorgnisse wegen des Wechselkurses wecken, da die Zentralbanken nicht bereit sein konnten, unbegrenzt Dollars anzuhäufen. Eines Tages mußte das System ‚platzen’, auch wenn diese Krise mit der Krise von 1929 nichts zu tun haben würde. Die absehbare Krise mußte sich in der Weise äußern, daß der Dollar nicht mehr in Gold oder in andere Aktiva konvertierbar sein würde - und für die Europäer wirft diese Nichtkonvertierbarkeit mindestens genauso schwierige Probleme auf wie die vorhergehende Phase.
Die These von der ‚Normalität’ des amerikanischen Defizits stützt sich auf einen Vergleich zwischen den Kapitalmärkten einerseits der Vereinigten Staaten, andererseits aller übrigen Länder. Das amerikanische Defizit wird zurückgeführt auf langfristige Auslandsinvestitionen amerikanischer Unternehmen und auf kurzfristige Anlagen der ausländischen Zentralbanken auf dem New Yorker Markt. Unter dem makroökonomischen Gesichtspunkt der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung fungieren die Vereinigten Staaten als Bankier, der kurzfristig leiht und langfristig anlegt und sich so die unterschiedlichen Zinssätze und Gewinnspannen zunutze macht. Auch der Londoner Markt hatte diese ‚Umwandlung’ lange Jahre hindurch praktiziert. Voraussetzung ist jedoch, daß die Währungsparität außer Zweifel steht und daß die auf der makroökonomischen Ebene der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeübte Bankierfunktion nicht auch innerhalb nationaler Grenzen ausgeübt wird.
Daß es für Privatpersonen in Frankreich interessant sein kann, ihr Kapital durch Veräußerung an amerikanische Unternehmen in Bargeld zu verwandeln, und daß Amerikaner, ihren Vorteil darin sehen, langfristige Investitionen in Europa zu machen, steht außer Frage. Das heißt jedoch nicht, daß sich stets Privatpersonen oder Zentralbanken finden, die bereit sind, Dollars zu behalten, und es heißt nicht, daß alle mit dieser übernationalen Bankierfunktion der Vereinigten Staaten zufrieden sind. Selbst wenn europäische Privatpersonen an der New Yorker Börse Aktien kaufen und diese Käufe das Gegenstück zu den langfristig in Europa angelegten Dollars bilden, so läßt sich doch nicht jede Regierung von den theoretischen Argumenten Professor Kindlebergers überzeugen, denen zufolge die Investitionen letzten Endes dem Interesse aller entsprechen und die Nationalität des Investors gleichgültig ist.
Das Jahr 1971 brachte den Beweis, daß die Vereinigten Staaten nicht unbegrenzt die Funktion eines übernationalen Bankiers erfüllen können, jedenfalls dann nicht mehr, wenn ihre Inflationsrate (die Zunahme der Kosten je Arbeitsstunde) die europäische Inflationsrate erreicht oder übersteigt. Seit Jahren haben die europäischen Zentralbanken mehr Dollars aufgenommen, als sie wollten. Während die Amerikaner die Verpflichtungen der Bankierfunktion hervorkehren, sehen die Europäer vor allem deren Vorteile für den Bankier (ohne indessen die Vorteile für den Kunden zu bestreiten). Warum haben die Europäer diese Dollaranhäufung hingenommen, und mit welchen Argumenten haben die Amerikaner sie dazu gebracht?
Niemand wird wohl ernsthaft behaupten, daß das internationale Währungssystem in der Form, wie es sich entwickelt hat, mit dem Dollar als übernationaler Währung, von den Führern der Vereinigten Staaten von vornherein darauf hin geplant worden ist, amerikanischen Firmen trotz eines ständigen Zahlungsbilanzdefizits direkte Auslandsinvestitionen zu ermöglichen und die Zentralbanken zu zwingen, unbegrenzt Dollars anzuhäufen, die schließlich nicht mehr konvertierbar sein würden. Bei den Verhandlungen von Bretton Woods hatten sich die amerikanischen Vertreter den von den Engländern vorgetragenen weitreichenden Plänen von John Maynard Keynes widersetzt, weil sie befürchteten, die Defizite ihrer Partner übernehmen zu müssen, falls sie der Schaffung einer Quasi-Zentralbank für die gesamte Welt der Freien Wirtschaft zustimmten. Desgleichen sollte die Verpflichtung, Wechselkurse einzuhalten, eine Wiederholung der Praktiken der dreißiger Jahre verhindern, als das Bemühen aller Staaten, sich einen Exportvorteil zu sichern - nicht so sehr, um die eigenen Reserven zu erhöhen, als vielmehr, um durch den Absatz der eigenen Erzeugnisse im Ausland die Arbeitslosen zu beschäftigen - eine Abwertung nach der anderen ausgelöst hatte. Tatsächlich haben die Europäer und die Japaner eine niedrigere Arbeitslosenrate als die Vereinigten Staaten erreicht, doch ist das Währungssystem wohl nur eine von mehreren Ursachen dafür.
(...)
Tatsache ist, daß die Europäer und die Japaner heute (1973 wb) in den Reserven ihrer Zentralbanken rund 60 Milliarden nichtkonvertierbarer Dollar liegen haben. Ende September 1971 beliefen sich die kurzfristigen Forderungen ausländischer Währungsbehörden gegenüber den Vereinigten Staaten auf rund 45 Milliarden Dollar, während die Nettogläubigerposition der Vereinigten Staaten gegenüber der übrigen Welt sich von Jahr zu Jahr verbessert hatte. Umfaßte diese Position 1960 44,7 Milliarden Dollar, so waren es 1970 69 Milliarden Dollar; während die direkten Auslandsinvestitionen von 31,8 auf 78 Milliarden Dollar angewachsen waren, stiegen die ausländischen Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten nur von 6,9 auf 13,2 Milliarden Dollar. Die Europäer zahlten die Marshallplanhilfe in Form von kurzfristigen Krediten zurück, mit denen amerikanische Firmen europäische Unternehmen aufkauften oder Niederlassung gründeten. Während der Marshallplan-Jahre hatten Dollars den Atlantik überquert, um die europäischen Länder mit den Devisen auszustatten, die sie benötigten, um im Ausland mehr Waren einzukaufen, als sie mit ihren eigenen Exporten hätten bezahlen können. Während der sechziger Jahre überquerten Dollars den Atlantik in beiden Richtungen, ostwärts für langfristige Investitionen, westwärts für den Erwerb von Bundesschatzanweisungen oder Aktien an der New Yorker Börse.
(...)
Die Partner leihen den Vereinigte Staaten den Devisenbetrag, den diese für ihre Rolle als Weltpolizist benötigen. Dementsprechend ging die Bundesrepublik Deutschland, die sich ihrer Verwundbarkeit, ihrer geopolitischen Schwäche besonders bewußt ist, auf die Forderungen der Washingtoner Führung ohne weiteres ein, und die Bonner Finanzminister, besonders Karl Schiller, nahmen widerspruchslos die verschiedenen Ausreden hin, die man in Washington ersann, wie etwa den gespaltenen Goldmarkt, die Swap-Agreements, die Roosa-Bonds und dergleichen. So gesehen, haben die Vereinigten Staaten ihre militärische Vormachtstellung benützt, um ein Währungssystem und vor allem Privilegien für den Dollar durchzusetzen, denen ihre Partner, hätten sie volle Bewegungsfreiheit gehabt und wären sie imstande gewesen, sich allein zu verteidigen, niemals zugestimmt hätten.
(...)
Betrachten wir etwa die Zusammensetzung der Währungsreserven. Warum, so fragen einige Anhänger der Thesen von Jacques Rueff, sollten die Zentralbanken, statt Gold zu verlangen, Dollars akzeptieren, sofern nicht außerwirtschaftliche Pressionen auf sie ausgeübt werden? Dies ist allerdings eine durchaus anfechtbare Überlegung, denn solange die Dollars ‚so gut wie Gold’ galten, waren sie in Wirklichkeit besser als Gold, da sie Zinsen brachten. Die Einwände wirtschaftlicher Art sind erst während der letzten drei oder vier Jahre unausbleiblich geworden, als die Inflation in den Vereinigten Staaten die europäische Inflationsrate überflügelte und zu Defiziten führte, die sich nicht mehr mit den durchschnittlichen Defiziten früherer Jahre vergleichen lassen. Solange sich die Defizite um zwei oder drei Milliarden Dollar bewegten, was in etwa den Kosten der amerikanischen Außenpolitik oder dem Wert der direkten Auslandsinvestitionen entsprach, konnte der Gouverneur einer Zentralbank sehr wohl aus eigenem Antrieb anstelle von Gold Dollars als Devisenreserve vorziehen.
Die europäischen Finanzminister und Zentralbankgouverneure befürchteten die Konsequenzen einer Krise. Seit 1964 oder 1965 wußten sie alle, wie die ständig heraufbeschworene Krise vermutlich ablaufen würde. Eines Tages würden die Börsen und Wechselstuben geschlossen sein, und der Präsident der Vereinigten Staaten würde den Dollar für nichtkonvertierbar - zumindest nicht in Gold konvertierbar - erklären. Keiner kam darauf, daß die Verantwortlichen in Washington sich zu der orthodoxen Lösung, nämlich zur Aufwertung des Goldes entschließen würden. Wollte man den als unerläßlich betrachteten Goldvorrat behalten, so blieb für den Fall, daß die ausländischen Zentralbanken sich weigern sollten, weiterhin Dollars aufzuhäufen, als einziger Ausweg, den Dollar für nichtkonvertierbar zu erklären.
(...)
Die Krise, die zur Nichtkonvertierbarkeit des Dollar führte, glich in jeder Hinsicht dem Run auf eine Bank, die nicht über hinreichende Barmittel verfügt, deren Aktiva jedoch bei weitem ihre Passiva übersteigen. Natürlich können die Vereinigten Staaten als übernationaler Bankier die zig Milliarden Dollar in der Hand von ausländischen Gläubigern nicht von einem Tag auf den anderen konvertieren. (...)
Hat die Krise von 1971 bewiesen, daß der Dollar seit 20 Jahren überbewertet war? Sie hat zumindest gezeigt, daß diese These vertretbar ist. Hat sie die Thesen von Kindleberger oder S. C. Kolm über die ‚Monetisierung’ des französischen Kapitals oder die übernationale Bankiersrolle der Vereinigten Staaten auf makroökonomischer Ebene widerlegt? Ganz gewiß nicht. Die Vereinigten Staaten spielen weiterhin diese Rolle, auch nachdem der Dollar nichtkonvertierbar wurde. Allerdings hat die Krise gezeigt, daß dieser Bankier wie alle Bankiers nicht dem Risiko entgeht, durch die Differenz zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten und liquiden Aktiva insolvent zu werden. Sie hat gleichfalls bewiesen, daß es nachteilig ist, eine nationale Währung, die nicht entsprechend den Bedürfnissen des internationalen Systems, sondern gemäß den Anforderungen der inländischen Wirtschaftssituation verwaltet wird, als übernationale Währung zu verwenden. Solange die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten unter der europäischen blieb, konnte ein Defizit von zwei bis drei Milliarden Dollar den Kredit des Bankiers nicht erschüttern, doch als zu der Inflation, die seit 1965 durch den Vietnamkrieg bedingt war, noch ein wachsender Überhang an Dollars hinzutrat, die tatsächlich nicht mehr in Gold konvertierbar waren, trieb alles auf eine schnelle Entscheidung zu.
Mit einem Schlage änderte sich der Ton der Auseinandersetzung, und die Beteiligten - Minister und staatliche oder private Fachleute - griffen zu neuen Argumenten, die teilweise das genaue Gegenteil dessen waren, was sie kurz zuvor gesagt hatten.
In einem Punkt allerdings bewiesen die amerikanischen Sprecher - vom Präsidenten bis zum Professor der letzten Provinzuniversität - eine lückenlose Gemeinsamkeit: durchgängig bezeichneten sie das Gold verachtungsvoll als ein Relikt der Barbarei und verwarfen jeden Gedanken an eine drastische Heraufsetzung des amtlichen Preises, obwohl der Preis auf dem freien Markt annähernd das Doppelte des langjährigen offiziellen Preises (35 Dollar je Unze) erreicht hatte.
(...)
Die Europäer hielten den Amerikanern die Privilegien vor, die ihnen durch die übernationale Funktion ihrer Währung zuwuchsen. Die Vereinigten Staaten seien das einzige Land, das sich in seiner Wirtschaftsführung nicht um die Zahlungsbilanz kümmere. Als einziges Land nähmen sie sich (im Gegensatz zu den IWF-Statuten) das Recht, bei einer defizitären Zahlungsbilanz nicht ihre direkten Auslandsinvestitionen einzustellen. Sie allein regelten ihr Defizit in der eigenen Währung, und die ausländischen Zentralbanken müßten sich damit abfinden, ihre Reserven in Dollars zu halten. Entsprechend der berühmten Formel aus Orwells ‚Farm der Tiere’ seien im internationalen Währungssystem alle Währungen gleich, nur eine Währung sei gleicher als die anderen.
(...)
Ist das die Arroganz der Macht? Wenn ja, der wirtschaftlichen oder der militärischen Macht?“
Aus: Raymond Aron, Die imperiale Republik. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die übrige Welt seit 1945. Stuttgart 1975, 278 - 295. (gekürzt)

***********************************************************
Der Dollar auf dem Weg in die Pleite von 1971
Bretton Woods: Der Dollar auf dem Weg in die Pleite von 1971
„Die fünfziger Jahre gingen zu Ende, als die letzten Bücher zum Problem der Dollarknappheit erschienen und die ersten Kommentare mit entgegengesetzter Tendenz über das anhaltende Defizit in der Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden. In der Tat zeichneten sich die fünfziger Jahre dadurch aus, daß Europa und Japan weitere Fortschritte machten, daß die Nichtkonvertierbarkeit der Währungen nach und nach aufgehoben wurde, daß der Handel sich liberalisierte, daß das jährliche Zahlungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten und der Abfluß langfristiger Gelder insbesondere nach Westeuropa zunahmen, während die diskriminierenden Maßnahmen gegenüber amerikanischen Exporten nach und nach verschwanden.
Während der Jahre der Marshallplanhilfe hatte die amerikanische Zahlungsbilanz ein geringes Defizit aufgewiesen, das jedoch durchaus mit den Zielen der amerikanischen Führung in Einklang stand, da in Fort Knox ein Goldvorrat von über 20 Milliarden Dollar lag, etwas mehr als die Hälfte der Weltreserven an Gold. Damals sprach man nicht vom Zahlungsbilanzdefizit, sondern von einer Umverteilung der Weltreserven. Die Reserven der Vereinigten Staaten waren von 14,6 Milliarden Dollar in 1938 auf 22,9 Milliarden in 1947 und 24,6 Milliarden in 1949 gestiegen, um bis 1958 auf 20,6 Milliarden zurückzugehen. Zehn Jahre später betrugen sie rund 10 Milliarden Dollar.
(...)
Der letzte Bericht an den Kongreß enthält für 1969, 1970 und 1971 die folgenden Zahlen: In der Nettoliquiditätsbilanz ein Defizit von 6,084 Milliarden, 3,821 Milliarden und 23,439 Milliarden Dollar und der Bilanz der offiziellen Reservetransaktionen im Jahre 1969 einen Überschuß von 2,704 Milliarden und dann ein Defizit von 9,821 bzw. von 31,810 Milliarden Dollar. (...)
Wenden wir uns zunächst der Waren-, Dienstleistungs-, und Übertragungsbilanz zu. Sie wies 1964 einen Überschuss von 7,8 Milliarden Dollar auf, verschlechterte sich dann aber von Jahr zu Jahr immer mehr (mit Ausnahme des Jahres 1970, als die Vereinigten Staaten zu einer deflationistischen Politik übergingen). In den ersten drei Quartalen 1971 war der Überschuß, auf Jahresbasis umgerechnet, auf 0,1 Milliarden Dollar zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum wies die Handelsbilanz, die 1964 noch einen Überschuß von 6,8 Milliarden Dollar gezeigt hatte, ein Defizit von 1,7 Milliarden Dollar auf. Von 1964 - 1971 hatten die Einfuhren um 147 % (jährlich 14 %), die Ausfuhren aber nur um 74 % zugenommen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß ein Teil der amerikanischen Ausfuhren mit Krediten bezahlt wurde, die von den Empfängern nur in den Vereinigten Staaten verwendet werden durften (zweckgebundene Kredite).
Die Erweiterung des Defizits (trotz gestiegener Kapitalerträge aus Auslandsinvestitionen) hängt offenkundig mit der seit 1965 einsetzenden bzw. sich verstärkenden Inflation und mit der massiven Intervention in Vietnam zusammen (zwischen 1960 und 1964 stiegen die Exporte von 19,650 auf 26,478 Milliarden Dollar und die Importe von 14,744 auf 18,647 Milliarden Dollar). Während der Preis der Arbeitsstunde zwischen 1960 und 1965 in den Vereinigten Staaten sank, stieg er in den übrigen Industrieländern. Zwischen 1966 und 1970 zeigen die Statistiken eine gleichmäßige Steigerung in den Vereinigten Staaten wie bei den Hauptkonkurrenten, während bei den Preisen für exportierte Fertigwaren die Steigerung bei den Vereinigten Staaten höher war als bei der ausländischen Konkurrenz.
Da die militärischen Transaktionen einen Kostenfaktor zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Milliarden Dollar darstellen und die Dienstleistungen genauso wie die privaten und die öffentlichen Übertragungen in der Regel ein Defizit aufweisen, blieben während der sechziger Jahre nur zwei positive Posten übrig: die Warenhandelsbilanz und die Kapitalerträge. Der Überschuß dieses letzteren Postens ist von durchschnittlich 1,2 Milliarden (1960 - 1964) auf 5,2 Milliarden in 1970 gestiegen (das ist der Nettobetrag, der Bruttobetrag beläuft sich auf 11,4 Milliarden Dollar).
Die Verschlechterung der Leistungsbilanz hat auf die langfristigen Kapitalbewegungen, die von durchschnittlich 2,2 Milliarden zwischen 1960 und 1964 auf 4,4 Milliarden in 1970 gestiegen sind, keinen Einfluß gehabt. Seit die Währungsbehörden im Jahre 1970 einen währungspolitischen Expansionskurs beschlossen, um den Wiederaufschwung der Wirtschaft zu unterstützen, und in Europa wegen des Nachhinkens der Konjunktur weiterhin höhere Zinssätze galten, hat sich die Leistungsbilanz in den Hauptposten immer rapider verschlechtert. Das offizielle Defizit hatte 1970 annähernd 10 Milliarden Dollar erreicht. Der auch 1971 anhaltende Dollarabfluß aus den Vereinigten Staaten ließ das Defizit so weit anwachsen, bis es für die europäischen Zentralbanken unerträglich wurde und sie vor der Alternative standen, entweder unbegrenzt Dollars aufzunehmen oder die Parität der amerikanischen Währung auf einem freien Markt schwanken zu lassen (sei es auf einem einheitlichen Markt oder einem gespaltenen Finanz- und Handelsmarkt).
(...)
Bei den Vorwürfen und Gegenvorwürfen, die in der ersten Hälfte der sechziger Jahre zwischen Europäern (vor allem Franzosen) und Amerikanern ausgetauscht wurden, ging es zum einen darum, welchem Posten man die ‚Verantwortung, (im doppelten Sinne von Ursache und Fehler) für das amerikanische Defizit zuschreiben sollte, zum anderen um das Wertverhältnis von Gold und Dollar. Solange der scheinbare Handelsbilanzüberschuß zwischen 4,5 und 6 Milliarden Dollar lag, war nichts leichter, als das Defizit der internationalen Rolle der Vereinigten Staaten, ihrem Anteil an der ‚Verteidigung der Freien Welt’ zuzuschreiben. Gleichgültig, ob man das Defizit nach der einen oder anderen Methode berechnete, es erreichte in etwa die Höhe der Militärausgaben der amerikanischen Regierung im Ausland. In einer solchen Deutung wird allerdings der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Posten einer Zahlungsbilanz verkannt; der Handelsbilanzüberschuß ging teilweise auf die Dollarschwemme zurück, die durch Regierungsausgaben im Ausland und durch zweckgebundene Kredite (tied loans) entstanden war. Im übrigen setzte eine solche Argumentationen noch auf politischer Ebene die Zustimmung der Europäer zur Diplomatie der Vereinigten Staaten voraus - eine Zustimmung, die wenigstens seit 1965 nicht mehr gegeben war.
Kaum sinnvoller war auch die Auseinandersetzung über die Wertbeziehung zwischen Gold und Dollar. Es ist unklar, was hinter der Behauptung steckt, der Wert des Goldes beruhe auf dem Wert des Dollars, wie mir einer der wirtschaftswissenschaftlichen Berater des Präsidenten wiederholt versicherte. Nehmen wir an, sämtliche Staaten würden beschließen, dem Gold seine monetäre Funktion zu nehmen, dann würde der Preis dieses Metalls, das zu einem Rohstoff wie alle anderen geworden wäre, ganz offenbar sinken, zumindest anfangs; allerdings kann kein Staat, wie mächtig er auch sei, allein eine solche Entscheidung treffen. Es ist allgemein bekannt, daß die Regierung der Vereinigten Staaten es nicht zulassen wird, daß ihre Goldreserven unter einen gewissen Stand sinken (den man auf rund 10 Milliarden Dollar schätzt). Demnach stützt sich der Wert des Goldes keineswegs auf den Wert des Dollar, sondern kann über diesen hinausgehen, wenn eine sowohl industrielle als auch monetäre Nachfrage nach diesem Edelmetall besteht.
Die ‚Demonetisierung des Goldes’ ist ebenfalls ein mißverständlicher Ausdruck. Da die Reserven sämtlicher Zentralbanken zum großen Teil aus Gold bestehen, wird eine offizielle Demonetisierung, die der einstigen Demonetisierung des Silbers vergleichbar wäre, keine Zustimmung finden. Keine Zentralbank, nicht einmal der Federal Reserve Board, ist so mächtig, allein diese Demonetisierung durchsetzen zu können. Da jede Währung im Verhältnis zu den übrigen Währungen Schwankungen ausgesetzt ist, fällt es schwer, auf das Gold als Wertmaßstab zu verzichten. Man kann allerdings die monetäre Verwendung des Goldes auf den Austausch zwischen den Zentralbanken beschränken und die beiden Märkte voneinander trennen - damit wäre die monetäre Verwendung des Goldes eingeschränkt, aber nicht aufgehoben.
(...)
Die Vereinigten Staaten konnten ihr Zahlungsbilanzdefizit mit ‚gütiger Nachsicht’ hinnehmen, da die europäischen Zentralbanken die wegen des amerikanischen Defizits in ihre Kassen strömenden Dollarüberschüsse auf dem New Yorker Markt in Schatzanweisungen umtauschten.
Erhielt sich das Defizit aus sich selbst heraus? Beruhte es mit Notwendigkeit darauf, daß die Dollars, welche das Defizit ausmachten, in den Vereinigten Staaten untergebracht wurden? Mir scheint, daß die amerikanischen Defizite bis zur beschleunigten Inflationsphase von 1965 - 1970 weder für die amerikanische noch für die europäische Inflation die wesentliche Ursache waren. Der Golddevisenstandard oder mit anderen Worten die Verwendung einer einzigen Währung, der amerikanischen, als Reservewährung und die durch das Zahlungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten wachsende internationale Liquidität waren von Anfang an mit einer Schwäche behaftet. Auf lange Sicht muß das Defizit der Vereinigten Staaten Besorgnisse wegen des Wechselkurses wecken, da die Zentralbanken nicht bereit sein konnten, unbegrenzt Dollars anzuhäufen. Eines Tages mußte das System ‚platzen’, auch wenn diese Krise mit der Krise von 1929 nichts zu tun haben würde. Die absehbare Krise mußte sich in der Weise äußern, daß der Dollar nicht mehr in Gold oder in andere Aktiva konvertierbar sein würde - und für die Europäer wirft diese Nichtkonvertierbarkeit mindestens genauso schwierige Probleme auf wie die vorhergehende Phase.
Die These von der ‚Normalität’ des amerikanischen Defizits stützt sich auf einen Vergleich zwischen den Kapitalmärkten einerseits der Vereinigten Staaten, andererseits aller übrigen Länder. Das amerikanische Defizit wird zurückgeführt auf langfristige Auslandsinvestitionen amerikanischer Unternehmen und auf kurzfristige Anlagen der ausländischen Zentralbanken auf dem New Yorker Markt. Unter dem makroökonomischen Gesichtspunkt der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung fungieren die Vereinigten Staaten als Bankier, der kurzfristig leiht und langfristig anlegt und sich so die unterschiedlichen Zinssätze und Gewinnspannen zunutze macht. Auch der Londoner Markt hatte diese ‚Umwandlung’ lange Jahre hindurch praktiziert. Voraussetzung ist jedoch, daß die Währungsparität außer Zweifel steht und daß die auf der makroökonomischen Ebene der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgeübte Bankierfunktion nicht auch innerhalb nationaler Grenzen ausgeübt wird.
Daß es für Privatpersonen in Frankreich interessant sein kann, ihr Kapital durch Veräußerung an amerikanische Unternehmen in Bargeld zu verwandeln, und daß Amerikaner, ihren Vorteil darin sehen, langfristige Investitionen in Europa zu machen, steht außer Frage. Das heißt jedoch nicht, daß sich stets Privatpersonen oder Zentralbanken finden, die bereit sind, Dollars zu behalten, und es heißt nicht, daß alle mit dieser übernationalen Bankierfunktion der Vereinigten Staaten zufrieden sind. Selbst wenn europäische Privatpersonen an der New Yorker Börse Aktien kaufen und diese Käufe das Gegenstück zu den langfristig in Europa angelegten Dollars bilden, so läßt sich doch nicht jede Regierung von den theoretischen Argumenten Professor Kindlebergers überzeugen, denen zufolge die Investitionen letzten Endes dem Interesse aller entsprechen und die Nationalität des Investors gleichgültig ist.
Das Jahr 1971 brachte den Beweis, daß die Vereinigten Staaten nicht unbegrenzt die Funktion eines übernationalen Bankiers erfüllen können, jedenfalls dann nicht mehr, wenn ihre Inflationsrate (die Zunahme der Kosten je Arbeitsstunde) die europäische Inflationsrate erreicht oder übersteigt. Seit Jahren haben die europäischen Zentralbanken mehr Dollars aufgenommen, als sie wollten. Während die Amerikaner die Verpflichtungen der Bankierfunktion hervorkehren, sehen die Europäer vor allem deren Vorteile für den Bankier (ohne indessen die Vorteile für den Kunden zu bestreiten). Warum haben die Europäer diese Dollaranhäufung hingenommen, und mit welchen Argumenten haben die Amerikaner sie dazu gebracht?
Niemand wird wohl ernsthaft behaupten, daß das internationale Währungssystem in der Form, wie es sich entwickelt hat, mit dem Dollar als übernationaler Währung, von den Führern der Vereinigten Staaten von vornherein darauf hin geplant worden ist, amerikanischen Firmen trotz eines ständigen Zahlungsbilanzdefizits direkte Auslandsinvestitionen zu ermöglichen und die Zentralbanken zu zwingen, unbegrenzt Dollars anzuhäufen, die schließlich nicht mehr konvertierbar sein würden. Bei den Verhandlungen von Bretton Woods hatten sich die amerikanischen Vertreter den von den Engländern vorgetragenen weitreichenden Plänen von John Maynard Keynes widersetzt, weil sie befürchteten, die Defizite ihrer Partner übernehmen zu müssen, falls sie der Schaffung einer Quasi-Zentralbank für die gesamte Welt der Freien Wirtschaft zustimmten. Desgleichen sollte die Verpflichtung, Wechselkurse einzuhalten, eine Wiederholung der Praktiken der dreißiger Jahre verhindern, als das Bemühen aller Staaten, sich einen Exportvorteil zu sichern - nicht so sehr, um die eigenen Reserven zu erhöhen, als vielmehr, um durch den Absatz der eigenen Erzeugnisse im Ausland die Arbeitslosen zu beschäftigen - eine Abwertung nach der anderen ausgelöst hatte. Tatsächlich haben die Europäer und die Japaner eine niedrigere Arbeitslosenrate als die Vereinigten Staaten erreicht, doch ist das Währungssystem wohl nur eine von mehreren Ursachen dafür.
(...)
Tatsache ist, daß die Europäer und die Japaner heute (1973 wb) in den Reserven ihrer Zentralbanken rund 60 Milliarden nichtkonvertierbarer Dollar liegen haben. Ende September 1971 beliefen sich die kurzfristigen Forderungen ausländischer Währungsbehörden gegenüber den Vereinigten Staaten auf rund 45 Milliarden Dollar, während die Nettogläubigerposition der Vereinigten Staaten gegenüber der übrigen Welt sich von Jahr zu Jahr verbessert hatte. Umfaßte diese Position 1960 44,7 Milliarden Dollar, so waren es 1970 69 Milliarden Dollar; während die direkten Auslandsinvestitionen von 31,8 auf 78 Milliarden Dollar angewachsen waren, stiegen die ausländischen Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten nur von 6,9 auf 13,2 Milliarden Dollar. Die Europäer zahlten die Marshallplanhilfe in Form von kurzfristigen Krediten zurück, mit denen amerikanische Firmen europäische Unternehmen aufkauften oder Niederlassung gründeten. Während der Marshallplan-Jahre hatten Dollars den Atlantik überquert, um die europäischen Länder mit den Devisen auszustatten, die sie benötigten, um im Ausland mehr Waren einzukaufen, als sie mit ihren eigenen Exporten hätten bezahlen können. Während der sechziger Jahre überquerten Dollars den Atlantik in beiden Richtungen, ostwärts für langfristige Investitionen, westwärts für den Erwerb von Bundesschatzanweisungen oder Aktien an der New Yorker Börse.
(...)
Die Partner leihen den Vereinigte Staaten den Devisenbetrag, den diese für ihre Rolle als Weltpolizist benötigen. Dementsprechend ging die Bundesrepublik Deutschland, die sich ihrer Verwundbarkeit, ihrer geopolitischen Schwäche besonders bewußt ist, auf die Forderungen der Washingtoner Führung ohne weiteres ein, und die Bonner Finanzminister, besonders Karl Schiller, nahmen widerspruchslos die verschiedenen Ausreden hin, die man in Washington ersann, wie etwa den gespaltenen Goldmarkt, die Swap-Agreements, die Roosa-Bonds und dergleichen. So gesehen, haben die Vereinigten Staaten ihre militärische Vormachtstellung benützt, um ein Währungssystem und vor allem Privilegien für den Dollar durchzusetzen, denen ihre Partner, hätten sie volle Bewegungsfreiheit gehabt und wären sie imstande gewesen, sich allein zu verteidigen, niemals zugestimmt hätten.
(...)
Betrachten wir etwa die Zusammensetzung der Währungsreserven. Warum, so fragen einige Anhänger der Thesen von Jacques Rueff, sollten die Zentralbanken, statt Gold zu verlangen, Dollars akzeptieren, sofern nicht außerwirtschaftliche Pressionen auf sie ausgeübt werden? Dies ist allerdings eine durchaus anfechtbare Überlegung, denn solange die Dollars ‚so gut wie Gold’ galten, waren sie in Wirklichkeit besser als Gold, da sie Zinsen brachten. Die Einwände wirtschaftlicher Art sind erst während der letzten drei oder vier Jahre unausbleiblich geworden, als die Inflation in den Vereinigten Staaten die europäische Inflationsrate überflügelte und zu Defiziten führte, die sich nicht mehr mit den durchschnittlichen Defiziten früherer Jahre vergleichen lassen. Solange sich die Defizite um zwei oder drei Milliarden Dollar bewegten, was in etwa den Kosten der amerikanischen Außenpolitik oder dem Wert der direkten Auslandsinvestitionen entsprach, konnte der Gouverneur einer Zentralbank sehr wohl aus eigenem Antrieb anstelle von Gold Dollars als Devisenreserve vorziehen.
Die europäischen Finanzminister und Zentralbankgouverneure befürchteten die Konsequenzen einer Krise. Seit 1964 oder 1965 wußten sie alle, wie die ständig heraufbeschworene Krise vermutlich ablaufen würde. Eines Tages würden die Börsen und Wechselstuben geschlossen sein, und der Präsident der Vereinigten Staaten würde den Dollar für nichtkonvertierbar - zumindest nicht in Gold konvertierbar - erklären. Keiner kam darauf, daß die Verantwortlichen in Washington sich zu der orthodoxen Lösung, nämlich zur Aufwertung des Goldes entschließen würden. Wollte man den als unerläßlich betrachteten Goldvorrat behalten, so blieb für den Fall, daß die ausländischen Zentralbanken sich weigern sollten, weiterhin Dollars aufzuhäufen, als einziger Ausweg, den Dollar für nichtkonvertierbar zu erklären.
(...)
Die Krise, die zur Nichtkonvertierbarkeit des Dollar führte, glich in jeder Hinsicht dem Run auf eine Bank, die nicht über hinreichende Barmittel verfügt, deren Aktiva jedoch bei weitem ihre Passiva übersteigen. Natürlich können die Vereinigten Staaten als übernationaler Bankier die zig Milliarden Dollar in der Hand von ausländischen Gläubigern nicht von einem Tag auf den anderen konvertieren. (...)
Hat die Krise von 1971 bewiesen, daß der Dollar seit 20 Jahren überbewertet war? Sie hat zumindest gezeigt, daß diese These vertretbar ist. Hat sie die Thesen von Kindleberger oder S. C. Kolm über die ‚Monetisierung’ des französischen Kapitals oder die übernationale Bankiersrolle der Vereinigten Staaten auf makroökonomischer Ebene widerlegt? Ganz gewiß nicht. Die Vereinigten Staaten spielen weiterhin diese Rolle, auch nachdem der Dollar nichtkonvertierbar wurde. Allerdings hat die Krise gezeigt, daß dieser Bankier wie alle Bankiers nicht dem Risiko entgeht, durch die Differenz zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten und liquiden Aktiva insolvent zu werden. Sie hat gleichfalls bewiesen, daß es nachteilig ist, eine nationale Währung, die nicht entsprechend den Bedürfnissen des internationalen Systems, sondern gemäß den Anforderungen der inländischen Wirtschaftssituation verwaltet wird, als übernationale Währung zu verwenden. Solange die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten unter der europäischen blieb, konnte ein Defizit von zwei bis drei Milliarden Dollar den Kredit des Bankiers nicht erschüttern, doch als zu der Inflation, die seit 1965 durch den Vietnamkrieg bedingt war, noch ein wachsender Überhang an Dollars hinzutrat, die tatsächlich nicht mehr in Gold konvertierbar waren, trieb alles auf eine schnelle Entscheidung zu.
Mit einem Schlage änderte sich der Ton der Auseinandersetzung, und die Beteiligten - Minister und staatliche oder private Fachleute - griffen zu neuen Argumenten, die teilweise das genaue Gegenteil dessen waren, was sie kurz zuvor gesagt hatten.
In einem Punkt allerdings bewiesen die amerikanischen Sprecher - vom Präsidenten bis zum Professor der letzten Provinzuniversität - eine lückenlose Gemeinsamkeit: durchgängig bezeichneten sie das Gold verachtungsvoll als ein Relikt der Barbarei und verwarfen jeden Gedanken an eine drastische Heraufsetzung des amtlichen Preises, obwohl der Preis auf dem freien Markt annähernd das Doppelte des langjährigen offiziellen Preises (35 Dollar je Unze) erreicht hatte.
(...)
Die Europäer hielten den Amerikanern die Privilegien vor, die ihnen durch die übernationale Funktion ihrer Währung zuwuchsen. Die Vereinigten Staaten seien das einzige Land, das sich in seiner Wirtschaftsführung nicht um die Zahlungsbilanz kümmere. Als einziges Land nähmen sie sich (im Gegensatz zu den IWF-Statuten) das Recht, bei einer defizitären Zahlungsbilanz nicht ihre direkten Auslandsinvestitionen einzustellen. Sie allein regelten ihr Defizit in der eigenen Währung, und die ausländischen Zentralbanken müßten sich damit abfinden, ihre Reserven in Dollars zu halten. Entsprechend der berühmten Formel aus Orwells ‚Farm der Tiere’ seien im internationalen Währungssystem alle Währungen gleich, nur eine Währung sei gleicher als die anderen.
(...)
Ist das die Arroganz der Macht? Wenn ja, der wirtschaftlichen oder der militärischen Macht?“
Aus: Raymond Aron, Die imperiale Republik. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die übrige Welt seit 1945. Stuttgart 1975, 278 - 295. (gekürzt)
Nur "leider" gibts nicht so viel, was unsere Superamis der Welt noch anzudrehen haben.
Na dann schmeiss zuerst mal
Deine Intel- oder AMD-Prozessoren auf den Müll
und verzichte auf`s Internet - sämtlichst Ami-Produkte bzw. -Innovationen.
Na dann schmeiss zuerst mal
Deine Intel- oder AMD-Prozessoren auf den Müll
und verzichte auf`s Internet - sämtlichst Ami-Produkte bzw. -Innovationen.
danke sittin. 
lese ich nach handelsschluss.
clone + nasdaq
dies ist ein archivthread !!!
könnt ihr die fehde auf tagesthreads beschränken?

lese ich nach handelsschluss.
clone + nasdaq
dies ist ein archivthread !!!
könnt ihr die fehde auf tagesthreads beschränken?

DolbyDigital5.1 - sollte nur Kommentar sein, werde ich auch in Zukunft machen, Nasilein springt sofort drauf an.
Ich habe Allgemein etwas gesagt, aber der Angriff von Nasilein folgt.

Ich habe Allgemein etwas gesagt, aber der Angriff von Nasilein folgt.

http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/wirtschaft/278267.html
Tages-Anzeiger vom 13.05.2003
Bush braucht einen tiefen Dollar
Der schwache Dollar stärkt die amerikanischen Unternehmen. Eine prosperierende Wirtschaft kommt der US-Regierung im Wahljahr sehr gelegen.
Von Walter Niederberger, New York
Die Regierung Bush hat die Rhetorik als neues Instrument der Wirtschaftsbelebung entdeckt. Sie hält vordergründig an der Politik des starken Dollars fest, hebt jedoch bei jeder Gelegenheit die Vorteile der schwachen Währung für die Exportwirtschaft hervor. Finanzminister John Snow ist ein Meister dieses Doppelspiels. Am Wochenende bekräftigte er zunächst in vier Fernsehauftritten das Interesse an einer starken Währung. Wörtlich fügte der als Verkäufer für Steuersenkungen in die Regierung geholte Snow aber hinzu: «Wenn der Dollar auf ein tieferes Niveau sinkt, nützt das den Exporten; und deshalb werden die Exporte stärker.»
Der Satz war mit Bedacht gewählt, wie sich gestern zeigte. Die Dollarschwäche verschaffe den Exporteuren eine grössere Preismacht, namentlich im europäischen Markt, erklärte die stellvertretende Handelsministerin Kathleen Cooper. Die Märkte reagierten deutlich. Der Dollar glitt gegenüber allen Hauptwährungen weiter ab und notierte auf einem seit vier Jahren nicht mehr erreichten Tiefststand. Snows Kommentar verstärkte den Verdacht, dass die Regierung den Dollarkurs mindestens indirekt zu steuern sucht. Bereits vor einer Woche hatte er erklärt, der Kurs sollte am besten in einem offenen, kompetitiven Währungsmarkt bestimmt werden. Dies war eine deutliche Aufforderung an die US-Notenbank, nichts zu unternehmen, um den Dollar zu stützen.
Ihr Spielraum ist nach zwölf Zinssenkungen ohnehin stark eingeschränkt. Weitere Senkungen kommen nur noch in Frage, so teilte die Notenbank letzte Woche mit, wenn eine Preisentwertung eintritt. In dieser ungemütlichen Lage zwischen Deflation und Stagnation kommt ein schwacher Dollar gelegen, weil er wie eine Zinssenkung stimuliert. Eine Abwertung des handelsgewichteten Dollar um 10 Prozent wirkt etwa gleich stark wie eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte und treibt die Gewinne der US-Firmen gemäss einer Studie von UBS Warburg um 6,8 Prozent in die Höhe.
Dies könnte der Wirtschaft genau jenen Impuls geben, den sich die Regierung in einem Wahljahr erhofft. Deshalb sei die unter Präsident Clinton eingeleitete Politik des starken Dollar auf absehbare Zeit vorbei, sagt Lara Rhame, Chefökonomin bei Brown Brothers Harriman in New York. Seit die Regierung Bush im Amt sei, habe sie ihr stillschweigendes Einverständnis mit dem schwachen Dollar gegeben. Dies aber ist ein fundamentaler Wechsel in einer Volkswirtschaft, die nicht nur stabilen Preisen, sondern stets auch einer festen Währung einen hohen Wert eingeräumt hat.
Rechnung weitergereicht
Erleichtert wird der Kurswechsel dadurch, dass US-Unternehmen in der Regel weniger unter Währungsturbulenzen leiden als europäische Konkurrenten. Zum einen machen Exporte nur rund ein Drittel der US-Wirtschaft aus, und zum andern sind die Währungen wichtiger Handelspartner wie China oder Mexiko an den Dollar gekoppelt. Ein schwacher Dollar verteuert deshalb praktisch nur die Importe aus Europa, gibt aber US-Exporteuren mehr Raum für Preiserhöhungen.
Die Dollarschwäche ist eine Folge des bedrohlichen Doppeldefizits in der Handelsbilanz und im Staatshaushalt. Zusammen machen die Fehlbeträge gegen 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Reduziert werden können die Defizite nur, wenn die Amerikaner weniger konsumieren oder der Dollar abgewertet wird.
Ein Konsumverzicht ist wenig wahrscheinlich; lieber wird die Rechnung über den schwachen Dollar den ausländischen Investoren zugeschoben. Diese Taktik ist allerdings riskant, weil die Auslandinvestitionen weiter geschwächt werden und die Finanzierung der immensen Schulden der Amerikaner gefährdet ist. Das Gegenstück zum schwachen Dollar dürften deshalb steigende Zinsen sein; strittig ist nur noch, ob die Zinsen dieses oder erst nächstes Jahr anziehen. Das Kalkül der USA dürfte in der Zwischenzeit darauf hinauslaufen, die Europäische und japanische Zentralbank zu Zinssenkungen zu bewegen und damit ihren Beitrag zu einem Aufschwung zu leisten, wie die Credit Suisse First Boston in einer Analyse kürzlich festhielt.
----------
das klang vor 5 jahren noch ganz anders.
da hat auch noch keiner die bilanztricks erkannt!
Tages-Anzeiger vom 13.05.2003
Bush braucht einen tiefen Dollar
Der schwache Dollar stärkt die amerikanischen Unternehmen. Eine prosperierende Wirtschaft kommt der US-Regierung im Wahljahr sehr gelegen.
Von Walter Niederberger, New York
Die Regierung Bush hat die Rhetorik als neues Instrument der Wirtschaftsbelebung entdeckt. Sie hält vordergründig an der Politik des starken Dollars fest, hebt jedoch bei jeder Gelegenheit die Vorteile der schwachen Währung für die Exportwirtschaft hervor. Finanzminister John Snow ist ein Meister dieses Doppelspiels. Am Wochenende bekräftigte er zunächst in vier Fernsehauftritten das Interesse an einer starken Währung. Wörtlich fügte der als Verkäufer für Steuersenkungen in die Regierung geholte Snow aber hinzu: «Wenn der Dollar auf ein tieferes Niveau sinkt, nützt das den Exporten; und deshalb werden die Exporte stärker.»
Der Satz war mit Bedacht gewählt, wie sich gestern zeigte. Die Dollarschwäche verschaffe den Exporteuren eine grössere Preismacht, namentlich im europäischen Markt, erklärte die stellvertretende Handelsministerin Kathleen Cooper. Die Märkte reagierten deutlich. Der Dollar glitt gegenüber allen Hauptwährungen weiter ab und notierte auf einem seit vier Jahren nicht mehr erreichten Tiefststand. Snows Kommentar verstärkte den Verdacht, dass die Regierung den Dollarkurs mindestens indirekt zu steuern sucht. Bereits vor einer Woche hatte er erklärt, der Kurs sollte am besten in einem offenen, kompetitiven Währungsmarkt bestimmt werden. Dies war eine deutliche Aufforderung an die US-Notenbank, nichts zu unternehmen, um den Dollar zu stützen.
Ihr Spielraum ist nach zwölf Zinssenkungen ohnehin stark eingeschränkt. Weitere Senkungen kommen nur noch in Frage, so teilte die Notenbank letzte Woche mit, wenn eine Preisentwertung eintritt. In dieser ungemütlichen Lage zwischen Deflation und Stagnation kommt ein schwacher Dollar gelegen, weil er wie eine Zinssenkung stimuliert. Eine Abwertung des handelsgewichteten Dollar um 10 Prozent wirkt etwa gleich stark wie eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte und treibt die Gewinne der US-Firmen gemäss einer Studie von UBS Warburg um 6,8 Prozent in die Höhe.
Dies könnte der Wirtschaft genau jenen Impuls geben, den sich die Regierung in einem Wahljahr erhofft. Deshalb sei die unter Präsident Clinton eingeleitete Politik des starken Dollar auf absehbare Zeit vorbei, sagt Lara Rhame, Chefökonomin bei Brown Brothers Harriman in New York. Seit die Regierung Bush im Amt sei, habe sie ihr stillschweigendes Einverständnis mit dem schwachen Dollar gegeben. Dies aber ist ein fundamentaler Wechsel in einer Volkswirtschaft, die nicht nur stabilen Preisen, sondern stets auch einer festen Währung einen hohen Wert eingeräumt hat.
Rechnung weitergereicht
Erleichtert wird der Kurswechsel dadurch, dass US-Unternehmen in der Regel weniger unter Währungsturbulenzen leiden als europäische Konkurrenten. Zum einen machen Exporte nur rund ein Drittel der US-Wirtschaft aus, und zum andern sind die Währungen wichtiger Handelspartner wie China oder Mexiko an den Dollar gekoppelt. Ein schwacher Dollar verteuert deshalb praktisch nur die Importe aus Europa, gibt aber US-Exporteuren mehr Raum für Preiserhöhungen.
Die Dollarschwäche ist eine Folge des bedrohlichen Doppeldefizits in der Handelsbilanz und im Staatshaushalt. Zusammen machen die Fehlbeträge gegen 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Reduziert werden können die Defizite nur, wenn die Amerikaner weniger konsumieren oder der Dollar abgewertet wird.
Ein Konsumverzicht ist wenig wahrscheinlich; lieber wird die Rechnung über den schwachen Dollar den ausländischen Investoren zugeschoben. Diese Taktik ist allerdings riskant, weil die Auslandinvestitionen weiter geschwächt werden und die Finanzierung der immensen Schulden der Amerikaner gefährdet ist. Das Gegenstück zum schwachen Dollar dürften deshalb steigende Zinsen sein; strittig ist nur noch, ob die Zinsen dieses oder erst nächstes Jahr anziehen. Das Kalkül der USA dürfte in der Zwischenzeit darauf hinauslaufen, die Europäische und japanische Zentralbank zu Zinssenkungen zu bewegen und damit ihren Beitrag zu einem Aufschwung zu leisten, wie die Credit Suisse First Boston in einer Analyse kürzlich festhielt.
----------
das klang vor 5 jahren noch ganz anders.
da hat auch noch keiner die bilanztricks erkannt!

Habe einen sehr aufschlussreichen Artikel am Sa., 10. Mai 2003, S.21 in der Zeitung die Welt aufgetan, an den ich Euch teilhaben lassen will.
Alan Greenspan warnt vor einer zu starken Konzentration im Derivate-Markt
Washington - Die Zahl der Marktmacher bei bestimmten außerbörslichen Derivatekontrakten ist zurückgegangen. Damit steigt das Risiko, dass der Rückgang einen einzigen Unternehmens aus diesem Marktsegment zu erheblichen Störungen führt, warnt US-Notenbankchef Alan Greenspan: "eine Entwicklung, die mir und anderen zu denken gibt, ist die sinkende Zahl der großen Derivatehändler und die möglichen Auswirkungen auf Marktliquidität und Konzentration des Adressenausfallrisikos", erklärte Greenspan auf einer Bankenkonferenz.
Sieben Banken vereinen im US-Notenbanksystem etwa 96 Prozent der Derivatetransaktionen auf sich, geht aus den Daten der US-Bankenaufsichtsbehörde hervor.
Greenspan erklärte, dass an den Märkten für US-Dollar Zinsoptionen und Kreditausfallswaps "ein einziger Händler fast ein Drittel des weltweiten Marktes bedient und eine Handvoll Händler repräsentieren zusammen über zwei Drittel." .... Greenspan sagte, dass sich die Marktteilnehmer bewusst sein sollten, dass die Fähigkeit, Kontrakte zu kaufen oder verkaufen, unter dem Rückzug eines einzigen großen Händlers aus dem Marktsegement leiden könnte. Eine derartige Konzentration erhöhe außerdem das Kreditrisiko in dem Markt, so der Notenbankchef. Die Kritiker von Derivaten malen oft das Schreckgespenst an die
Wand, dass der Zusammenbruch eines Händlers zu Verlusten bei seinen Geschäftspartnern, einschließlich anderen Händlern führt, und damit eine Kettenreaktion von Zahlungsausfällen heraufbeschwört.
Eigene Anmerkung: Hier sieht man einmal mehr, wie sich Greenspan vom Gärtner zu Bock macht(e). Er war und ist es doch in erster Linie gewesen, der anfing, die tagtäglich frisch gedruckten neuen Milliarden Dollars, im ganz großen Stil über das Plunge Protection Team, in die Geldmenge M3 einlaufen zu lassen und ausschließlich über Terminkontrakte (also eben Derivate!!!) den Dow Jones zu pushen. Einfach nur noch lächerlich und aberwitzig, dass er jetzt genau dies bei anderen Marktteilnehmern bemängelt! (Man fragt sich wirklich, ob der Vollidiot überhaupt noch zurechnungsfähig ist?) Die anderen Marktteilnehmer sehen hier halt eine sichere Schiene, an Greenspans Dow-Gepushe zu partizipieren. Wen interessiert hier noch die Bewertung einzelner Aktien oder dass eine viel zu starke Konzentration des Derivatehandels über zu wenig Händler stattfindet?
Und by-the-way: Wen von diesen völlig ignoranten Amis interessiert schon, dass der alte Mann den Dollar völlig gegen die Wand fährt (Geldmengenausweitung war bereits im März plus 8 Prozent, anstatt überlicher plus 2 Prozent), so dass der US-Dollar fast minütlich weniger wert wird?
Wer von diesen idiotischen Amis registriert, dass steigende Aktienkurse bei gleichzeitig fallenden Dollar und steigenden Goldpreisen und Unternehmensbonds von vorne bis hinten nicht in Bild passen?
Dazu werden tagtäglich Milliarden von Dollar aus Amerika abgezogen, weil kein Mensch dort mehr investieren will, wo jedlicher scheinbarer Aktiengewinn durch den Dollarverfall aufgezerrt wird.
So blöd und ignorant können wirklich nur die Amis sein - Greenspan, der´s ja vormacht, sei Dank!
Alan Greenspan warnt vor einer zu starken Konzentration im Derivate-Markt
Washington - Die Zahl der Marktmacher bei bestimmten außerbörslichen Derivatekontrakten ist zurückgegangen. Damit steigt das Risiko, dass der Rückgang einen einzigen Unternehmens aus diesem Marktsegment zu erheblichen Störungen führt, warnt US-Notenbankchef Alan Greenspan: "eine Entwicklung, die mir und anderen zu denken gibt, ist die sinkende Zahl der großen Derivatehändler und die möglichen Auswirkungen auf Marktliquidität und Konzentration des Adressenausfallrisikos", erklärte Greenspan auf einer Bankenkonferenz.
Sieben Banken vereinen im US-Notenbanksystem etwa 96 Prozent der Derivatetransaktionen auf sich, geht aus den Daten der US-Bankenaufsichtsbehörde hervor.
Greenspan erklärte, dass an den Märkten für US-Dollar Zinsoptionen und Kreditausfallswaps "ein einziger Händler fast ein Drittel des weltweiten Marktes bedient und eine Handvoll Händler repräsentieren zusammen über zwei Drittel." .... Greenspan sagte, dass sich die Marktteilnehmer bewusst sein sollten, dass die Fähigkeit, Kontrakte zu kaufen oder verkaufen, unter dem Rückzug eines einzigen großen Händlers aus dem Marktsegement leiden könnte. Eine derartige Konzentration erhöhe außerdem das Kreditrisiko in dem Markt, so der Notenbankchef. Die Kritiker von Derivaten malen oft das Schreckgespenst an die
Wand, dass der Zusammenbruch eines Händlers zu Verlusten bei seinen Geschäftspartnern, einschließlich anderen Händlern führt, und damit eine Kettenreaktion von Zahlungsausfällen heraufbeschwört.
Eigene Anmerkung: Hier sieht man einmal mehr, wie sich Greenspan vom Gärtner zu Bock macht(e). Er war und ist es doch in erster Linie gewesen, der anfing, die tagtäglich frisch gedruckten neuen Milliarden Dollars, im ganz großen Stil über das Plunge Protection Team, in die Geldmenge M3 einlaufen zu lassen und ausschließlich über Terminkontrakte (also eben Derivate!!!) den Dow Jones zu pushen. Einfach nur noch lächerlich und aberwitzig, dass er jetzt genau dies bei anderen Marktteilnehmern bemängelt! (Man fragt sich wirklich, ob der Vollidiot überhaupt noch zurechnungsfähig ist?) Die anderen Marktteilnehmer sehen hier halt eine sichere Schiene, an Greenspans Dow-Gepushe zu partizipieren. Wen interessiert hier noch die Bewertung einzelner Aktien oder dass eine viel zu starke Konzentration des Derivatehandels über zu wenig Händler stattfindet?
Und by-the-way: Wen von diesen völlig ignoranten Amis interessiert schon, dass der alte Mann den Dollar völlig gegen die Wand fährt (Geldmengenausweitung war bereits im März plus 8 Prozent, anstatt überlicher plus 2 Prozent), so dass der US-Dollar fast minütlich weniger wert wird?
Wer von diesen idiotischen Amis registriert, dass steigende Aktienkurse bei gleichzeitig fallenden Dollar und steigenden Goldpreisen und Unternehmensbonds von vorne bis hinten nicht in Bild passen?
Dazu werden tagtäglich Milliarden von Dollar aus Amerika abgezogen, weil kein Mensch dort mehr investieren will, wo jedlicher scheinbarer Aktiengewinn durch den Dollarverfall aufgezerrt wird.
So blöd und ignorant können wirklich nur die Amis sein - Greenspan, der´s ja vormacht, sei Dank!
man sollte immer auf den Seiten der Verrückten mitlesen!
March 12, 1998
MEMORANDUM TO: OPINION LEADERS
WROM: ZLKBRNVWWCUF
SUBJECT: IMF, Congress and American Economic Leadership
I enclose a short paper written by Lawrence Lindsey, holder of the Arthur F. Burns chair at the American Enterprise Institute and former governor of the Federal Reserve. Lindsey argues that Congress should treat the Clinton Administration’s request for additional funds for the International Monetary Fund “as an opportunity to address a series of fundamental issues concerning global capital markets. By attaching appropriate conditions to the legislation, Congress can facilitate the IMF becoming a mechanism for promoting” reforms which encourage sound market practices in countries receiving IMF loans. Instead of loading up the IMF appropriation with a host of dubious labor and environmental conditions, Lindsey makes the case that the U.S. should use its position within the IMF to foster serious changes that are consonant with American economic principles and the realities of today’s global markets.
Getting Our Dollars’ Worth:
The IMF and Sound Capital Investment Practices for the 21st Century
Lawrence B. Lindsey
Congress has been asked to provide additional funds for the International Monetary Fund (IMF) to help support the IMF’s efforts to address the Asian economic crisis. The administration will argue that not increasing the U.S. contribution to the IMF simply poses too great a danger to the global financial system. And the likelihood is that a majority of Congressmen, if only out of a fear of the unknown, will ultimately go along. Nevertheless, the opposition has an important case to make: Congress should be reluctant to refund the IMF if the result is merely to allow the various participants in the recent Asian debacle, both creditors and debtors, to continue the practices that produced the crisis in the first place.
Congress should, instead, treat the administration’s request as an opportunity to address a series of more fundamental issues concerning global capital markets. By attaching appropriate conditions to the legislation, Congress can facilitate the IMF becoming a mechanism for promoting the reform of capital markets in the developing world and for putting into place a set of guidelines that will make future financial crises much more manageable.
In all probability, financial crises cannot be entirely prevented, either in the developing world, or, for that matter, anywhere else. Indeed, in the early 1990s, the U.S. encountered a fairly costly crisis involving many Savings and Loan (S&L) institutions which had become overextended with respect to real estate loans. However, the mechanisms were largely in place to disentangle the situation relatively quickly. While an immediate financial loss to the government could not be avoided, the economy as a whole suffered only to a relatively small degree, and was soon able to put the crisis behind it.
Any re-funding of the IMF must be accompanied with an attempt to set out a series of fundamental measures that would apply this experience to global financial crises generally. Some of the major elements of such a program are considered below. Although additional reforms might be advisable, the following comprise the core of a program for making the world safe for today`s global financial flows, and vice versa.
• First, there must be a minimum standard for rules and regulations dealing with the bankruptcy of private firms. While each country will have its own detailed procedures, they must all recognize a method of granting insolvent firms some form of protection against creditors, transferring equity to creditors to extinguish unrealistic debt burdens, and, most importantly, allowing the firm`s productive assets to get back to work as soon as possible.
• Similarly, bank insolvency or illiquidity must quickly trigger some form of regulatory intervention, both to guarantee the assets of protected classes of creditors (such as depositors) and to extinguish the claims of other creditors, either by partial payment of the amount owed or by transfer of equity. Much greater transparency is required so that the actual financial status of banks can be better known to investors and depositors, and to make it more difficult for government regulators to artificially prolong the life of ailing banks.
• Finally, some internationally-recognized mechanisms should be developed for dealing with the recurring problems of excessive and insupportable sovereign debt. General rules for creditor committees (including, for example, voting systems which, while requiring super-majorities to approve restructuring agreements, make it impossible for small creditors to unduly delay or derail them) should be established. While it may be true that sovereign debtors don`t go bankrupt, the establishment of a general mechanism for dealing with restructuring sovereign debt will provide the necessary context in which creditors can estimate the degree of loss which they might sustain. This would make it easier to assess the degree of risk that should be attributed to sovereign debt when setting capital adequacy standards for banks.
Underlying all these proposals is the notion that, if global financial markets are to operate efficiently, there must be mechanism for preventing and rapidly dealing with the kinds of excessive debt burden which can paralyze banking systems and pour sand in the gears of commerce, as is currently the case in East Asia.
Greater transparency will make it clear sooner when debt has reached unsustainable levels; a greater readiness to force firms or banks into bankruptcy -- or sovereign debtors into restructuring -- will enable those debt levels to be extinguished by means of partial payments and transfers of equity; and the existence of these procedures and the experience gained as they are implemented will enable creditors to make more informed assessments of the risks they are running. Most importantly, these procedures will allow capital and productive assets to be quickly returned to a condition in which market forces can reallocate them to their best and highest uses.
• If this is to work on a global scale, then nations can no longer make distinctions between debt and equity investment by foreigners. In other words, if foreigners are allowed to lend money to a nation`s businesses or banks, then they must be allowed to hold equity in them as well, generally on the same terms as domestic investors. Otherwise, the unwinding of excessive debt burdens will be too dependent on bail-outs by organizations such as the IMF, as is now the case. Of course, nations may wish to impose limited restrictions on this right: for example, the United States does not allow foreigners to hold equity in defense contractors or broadcasters on the same terms as citizens. In general, however, the nations that wish to enjoy the manifest advantages of global financial markets in the 21st century will have to recognize a similar globalization with respect to equity ownership of firms and banks.
The bottom line: The Clinton Administration has set a high priority on Congress appropriating an additional $18 billion to the IMF in the wake of the crisis in East Asia. As a result, Congress is in a position to insist that the administration and the IMF condition any new loans to a state (over and above its existing IMF quota) on that state first having adopted the sound capital investment standards outlined above. Although these suggested reforms are not meant to preclude other reforms Congress might want to link to the IMF appropriation, they are central to the U.S. using its position as the world`s economic leader to promote market principles and practices that will serve both the world`s interests and our own.
Lawrence B. Lindsey, a former governor of the Federal Reserve, holds the Arthur F. Burns Chair in Economics at the American Enterprise Institute.
http://www.newamericancentury.org
March 12, 1998
MEMORANDUM TO: OPINION LEADERS
WROM: ZLKBRNVWWCUF
SUBJECT: IMF, Congress and American Economic Leadership
I enclose a short paper written by Lawrence Lindsey, holder of the Arthur F. Burns chair at the American Enterprise Institute and former governor of the Federal Reserve. Lindsey argues that Congress should treat the Clinton Administration’s request for additional funds for the International Monetary Fund “as an opportunity to address a series of fundamental issues concerning global capital markets. By attaching appropriate conditions to the legislation, Congress can facilitate the IMF becoming a mechanism for promoting” reforms which encourage sound market practices in countries receiving IMF loans. Instead of loading up the IMF appropriation with a host of dubious labor and environmental conditions, Lindsey makes the case that the U.S. should use its position within the IMF to foster serious changes that are consonant with American economic principles and the realities of today’s global markets.
Getting Our Dollars’ Worth:
The IMF and Sound Capital Investment Practices for the 21st Century
Lawrence B. Lindsey
Congress has been asked to provide additional funds for the International Monetary Fund (IMF) to help support the IMF’s efforts to address the Asian economic crisis. The administration will argue that not increasing the U.S. contribution to the IMF simply poses too great a danger to the global financial system. And the likelihood is that a majority of Congressmen, if only out of a fear of the unknown, will ultimately go along. Nevertheless, the opposition has an important case to make: Congress should be reluctant to refund the IMF if the result is merely to allow the various participants in the recent Asian debacle, both creditors and debtors, to continue the practices that produced the crisis in the first place.
Congress should, instead, treat the administration’s request as an opportunity to address a series of more fundamental issues concerning global capital markets. By attaching appropriate conditions to the legislation, Congress can facilitate the IMF becoming a mechanism for promoting the reform of capital markets in the developing world and for putting into place a set of guidelines that will make future financial crises much more manageable.
In all probability, financial crises cannot be entirely prevented, either in the developing world, or, for that matter, anywhere else. Indeed, in the early 1990s, the U.S. encountered a fairly costly crisis involving many Savings and Loan (S&L) institutions which had become overextended with respect to real estate loans. However, the mechanisms were largely in place to disentangle the situation relatively quickly. While an immediate financial loss to the government could not be avoided, the economy as a whole suffered only to a relatively small degree, and was soon able to put the crisis behind it.
Any re-funding of the IMF must be accompanied with an attempt to set out a series of fundamental measures that would apply this experience to global financial crises generally. Some of the major elements of such a program are considered below. Although additional reforms might be advisable, the following comprise the core of a program for making the world safe for today`s global financial flows, and vice versa.
• First, there must be a minimum standard for rules and regulations dealing with the bankruptcy of private firms. While each country will have its own detailed procedures, they must all recognize a method of granting insolvent firms some form of protection against creditors, transferring equity to creditors to extinguish unrealistic debt burdens, and, most importantly, allowing the firm`s productive assets to get back to work as soon as possible.
• Similarly, bank insolvency or illiquidity must quickly trigger some form of regulatory intervention, both to guarantee the assets of protected classes of creditors (such as depositors) and to extinguish the claims of other creditors, either by partial payment of the amount owed or by transfer of equity. Much greater transparency is required so that the actual financial status of banks can be better known to investors and depositors, and to make it more difficult for government regulators to artificially prolong the life of ailing banks.
• Finally, some internationally-recognized mechanisms should be developed for dealing with the recurring problems of excessive and insupportable sovereign debt. General rules for creditor committees (including, for example, voting systems which, while requiring super-majorities to approve restructuring agreements, make it impossible for small creditors to unduly delay or derail them) should be established. While it may be true that sovereign debtors don`t go bankrupt, the establishment of a general mechanism for dealing with restructuring sovereign debt will provide the necessary context in which creditors can estimate the degree of loss which they might sustain. This would make it easier to assess the degree of risk that should be attributed to sovereign debt when setting capital adequacy standards for banks.
Underlying all these proposals is the notion that, if global financial markets are to operate efficiently, there must be mechanism for preventing and rapidly dealing with the kinds of excessive debt burden which can paralyze banking systems and pour sand in the gears of commerce, as is currently the case in East Asia.
Greater transparency will make it clear sooner when debt has reached unsustainable levels; a greater readiness to force firms or banks into bankruptcy -- or sovereign debtors into restructuring -- will enable those debt levels to be extinguished by means of partial payments and transfers of equity; and the existence of these procedures and the experience gained as they are implemented will enable creditors to make more informed assessments of the risks they are running. Most importantly, these procedures will allow capital and productive assets to be quickly returned to a condition in which market forces can reallocate them to their best and highest uses.
• If this is to work on a global scale, then nations can no longer make distinctions between debt and equity investment by foreigners. In other words, if foreigners are allowed to lend money to a nation`s businesses or banks, then they must be allowed to hold equity in them as well, generally on the same terms as domestic investors. Otherwise, the unwinding of excessive debt burdens will be too dependent on bail-outs by organizations such as the IMF, as is now the case. Of course, nations may wish to impose limited restrictions on this right: for example, the United States does not allow foreigners to hold equity in defense contractors or broadcasters on the same terms as citizens. In general, however, the nations that wish to enjoy the manifest advantages of global financial markets in the 21st century will have to recognize a similar globalization with respect to equity ownership of firms and banks.
The bottom line: The Clinton Administration has set a high priority on Congress appropriating an additional $18 billion to the IMF in the wake of the crisis in East Asia. As a result, Congress is in a position to insist that the administration and the IMF condition any new loans to a state (over and above its existing IMF quota) on that state first having adopted the sound capital investment standards outlined above. Although these suggested reforms are not meant to preclude other reforms Congress might want to link to the IMF appropriation, they are central to the U.S. using its position as the world`s economic leader to promote market principles and practices that will serve both the world`s interests and our own.
Lawrence B. Lindsey, a former governor of the Federal Reserve, holds the Arthur F. Burns Chair in Economics at the American Enterprise Institute.
http://www.newamericancentury.org
könnt ihr bitte die URL zum artikel mit angeben?
tausend dank für die zukunft.
tausend dank für die zukunft.

Microsoft: Optionen hätten Gewinn um 25% belastet
Der Reingewinn von Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT) wäre im letzten Quartal um ein Viertel niedriger gewesen, hätte das Unternehmen die Kosten der Optionen verbucht, die zur Bezahlung der Vorstände ausgegeben wurden. Dies teilte Microsoft in einem Dokument mit, dass bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. In einer Stellungnahme gestand man ein, das „wirtschaftliche Interesse“ der Verbuchung von Optionskosten zwar zu verstehen. Auf der anderen Seite werde man zusammen mit anderen großen Technologieunternehmen jedoch weiterhin von einer Verbuchung absehen. Im Märzquartal lagen die Optionskosten bei $656 Millionen. Optionen sind Derivate auf Aktien, die zur Bezahlung von Vorstandsmitgliedern beliebt sind, da sie im offiziell gemeldeten Ergebnis nicht als Kosten verbucht werden müssen. Die US-Behörden arbeiten zurzeit an einem Modell, dass Unternehmen vorschreiben soll, Optionskosten zu verbuchen.
© BörseGo
--------
man sollte das klopapier auch noch aus den bilanzen rausrechnen.
Der Reingewinn von Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT) wäre im letzten Quartal um ein Viertel niedriger gewesen, hätte das Unternehmen die Kosten der Optionen verbucht, die zur Bezahlung der Vorstände ausgegeben wurden. Dies teilte Microsoft in einem Dokument mit, dass bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. In einer Stellungnahme gestand man ein, das „wirtschaftliche Interesse“ der Verbuchung von Optionskosten zwar zu verstehen. Auf der anderen Seite werde man zusammen mit anderen großen Technologieunternehmen jedoch weiterhin von einer Verbuchung absehen. Im Märzquartal lagen die Optionskosten bei $656 Millionen. Optionen sind Derivate auf Aktien, die zur Bezahlung von Vorstandsmitgliedern beliebt sind, da sie im offiziell gemeldeten Ergebnis nicht als Kosten verbucht werden müssen. Die US-Behörden arbeiten zurzeit an einem Modell, dass Unternehmen vorschreiben soll, Optionskosten zu verbuchen.
© BörseGo
--------
man sollte das klopapier auch noch aus den bilanzen rausrechnen.

Der Reingewinn von Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT) wäre im letzten Quartal um ein Viertel niedriger gewesen, hätte das Unternehmen die Kosten der Optionen verbucht, die zur Bezahlung der Vorstände ausgegeben wurden.
Die armen Aktionäre. Womit haben die Vorstände diesen Segen verdient?

Zum Glück zahlt Microsoft jetzt eine wunderbar hohe Dividende.

Die armen Aktionäre. Womit haben die Vorstände diesen Segen verdient?
Zum Glück zahlt Microsoft jetzt eine wunderbar hohe Dividende.

paule in meinem thröd? 
ist stock-tschänel wieder down?


ist stock-tschänel wieder down?


Scheinbar geht die Seite bei Germa nicht mehr auf

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/342/11331/
Saudis ziehen Geld aus USA ab
Die Flucht der Petro-Dollars
Gut 60 Jahre hält nun schon die amerikanisch-saudische Freundschaft, dafür haben vor allem gute Geschäfte gesorgt. Doch das Verhältnis ist getrübt.
von Marc Hujer
(SZ vom 14.05.2003) — Mehr als 120 große US-Konzerne haben sich in Saudi Arabien niedergelassen, darunter Boeing und die Citibank.
Doch seit dem 11. September 2001 wird das Verhältnis immer wieder auf die Probe gestellt. Seit geraumer Zeit beklagen US-Unternehmen dramatische Umsatzeinbußen in Saudi Arabien, und an der Wall Street geht gelegentlich das Gerücht um, die Saudis würden einen Teil ihres milliardenschweren Vermögens abziehen, um der US-Wirtschaft zu schaden.
Die amerikanisch-saudischen Wirtschaftsbeziehungen haben in den vergangenen Jahren Schaden genommen, insbesondere zulasten der Vereinigten Staaten. Zwar sind die USA mit einem Anteil von 19 Prozent noch immer der wichtigste Lieferant Saudi-Arabiens, gefolgt von Japan mit zehn Prozent und Deutschland mit acht Prozent.
Euro bevorzugt
Allerdings sind die Exporte in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen. 2002 lieferten US-Firmen nur noch Produkte im Wert von 4,7 Milliarden Dollar, so wenig wie seit 1991 nicht mehr.
Insbesondere nach dem 11. September sind die US-Exporte eingebrochen, um nahezu 50 Prozent binnen eines halben Jahres. Profitiert haben davon Nachbarstaaten Saudi Arabiens, vor allem Jordanien.
Ein Grund für die schlechteren Absatzchancen sind neben auslaufenden Rüstungsaufträgen zahlreiche Boykottaufrufe anti-amerikanischer Gruppen. Sie treffen insbesondere Lebensmittelhersteller und Fastfoodketten. McDonald’s hat angekündigt, 100 Filialen in Saudi Arabien schließen zu wollen.
Auch verzichten Saudis inzwischen auf die sonst beliebten Urlaubsreisen in die USA. Die Zahl der USA-Touristen sank im vergangenen Jahr um 40 Prozent, für die amerikanische Tourismusindustrie bedeutete das Einbußen von knapp 200 Millionen Dollar.
Für die US-Wirtschaft sind die Verluste zu verschmerzen, denn gemessen an den gesamten Exporten der USA macht Saudi Arabien nur einen verschwindenden Bruchteil aus.
Wichtiger ist die Stabilität der Öllieferungen aus Saudi Arabien. Zwar ist Riad nicht der wichtigste Öllieferant der Vereinigten Staaten. Kanada etwa liefert mehr Öl. Die Tatsache jedoch, dass Saudi Arabien die größte Förderkapazität der Welt hat und einspringen kann, wenn es einen Engpass gibt, machen es zu einem unverzichtbaren Partner.
Im vergangenen Jahr importierten die USA für 13 Milliarden Dollar Produkte aus Saudi Arabien, vor allem Öl. Das ist deutlich mehr als Anfang der neunziger Jahre.
Ein großer Teil der Ölerlöse ist in die USA zurückgeflossen – auch das ist heute eine Hypothek für die amerikanische Volkswirtschaft. Das Vermögen der Saudis in den Vereinigten Staaten wird auf 400 bis 600 Milliarden Dollar geschätzt.
Es ist unter anderem in Aktien und Wertpapieren angelegt und kann relativ leicht abgezogen werden. Viele Saudis haben vor allem die neuen amerikanischen Bankengesetze verschreckt. So hat Washington nun das Recht, Vermögen von Personen zu konfiszieren, die unter Verdacht stehen, mit Terroristen Verbindungen zu halten.
Schätzungen zufolge haben die Saudis seit dem 11. September mehr als 100 Milliarden Dollar in Euros umgeschichtet. Das Geld haben sie in Europa vor allem in Immobilien angelegt. Auch verzichten die Saudis inzwischen weitgehend auf Direktinvestitionen in neue Firmen, sagt Brad Bourland, Chefökonom der Saudi American Bank.

Saudis ziehen Geld aus USA ab
Die Flucht der Petro-Dollars
Gut 60 Jahre hält nun schon die amerikanisch-saudische Freundschaft, dafür haben vor allem gute Geschäfte gesorgt. Doch das Verhältnis ist getrübt.
von Marc Hujer
(SZ vom 14.05.2003) — Mehr als 120 große US-Konzerne haben sich in Saudi Arabien niedergelassen, darunter Boeing und die Citibank.
Doch seit dem 11. September 2001 wird das Verhältnis immer wieder auf die Probe gestellt. Seit geraumer Zeit beklagen US-Unternehmen dramatische Umsatzeinbußen in Saudi Arabien, und an der Wall Street geht gelegentlich das Gerücht um, die Saudis würden einen Teil ihres milliardenschweren Vermögens abziehen, um der US-Wirtschaft zu schaden.
Die amerikanisch-saudischen Wirtschaftsbeziehungen haben in den vergangenen Jahren Schaden genommen, insbesondere zulasten der Vereinigten Staaten. Zwar sind die USA mit einem Anteil von 19 Prozent noch immer der wichtigste Lieferant Saudi-Arabiens, gefolgt von Japan mit zehn Prozent und Deutschland mit acht Prozent.
Euro bevorzugt
Allerdings sind die Exporte in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen. 2002 lieferten US-Firmen nur noch Produkte im Wert von 4,7 Milliarden Dollar, so wenig wie seit 1991 nicht mehr.
Insbesondere nach dem 11. September sind die US-Exporte eingebrochen, um nahezu 50 Prozent binnen eines halben Jahres. Profitiert haben davon Nachbarstaaten Saudi Arabiens, vor allem Jordanien.
Ein Grund für die schlechteren Absatzchancen sind neben auslaufenden Rüstungsaufträgen zahlreiche Boykottaufrufe anti-amerikanischer Gruppen. Sie treffen insbesondere Lebensmittelhersteller und Fastfoodketten. McDonald’s hat angekündigt, 100 Filialen in Saudi Arabien schließen zu wollen.
Auch verzichten Saudis inzwischen auf die sonst beliebten Urlaubsreisen in die USA. Die Zahl der USA-Touristen sank im vergangenen Jahr um 40 Prozent, für die amerikanische Tourismusindustrie bedeutete das Einbußen von knapp 200 Millionen Dollar.
Für die US-Wirtschaft sind die Verluste zu verschmerzen, denn gemessen an den gesamten Exporten der USA macht Saudi Arabien nur einen verschwindenden Bruchteil aus.
Wichtiger ist die Stabilität der Öllieferungen aus Saudi Arabien. Zwar ist Riad nicht der wichtigste Öllieferant der Vereinigten Staaten. Kanada etwa liefert mehr Öl. Die Tatsache jedoch, dass Saudi Arabien die größte Förderkapazität der Welt hat und einspringen kann, wenn es einen Engpass gibt, machen es zu einem unverzichtbaren Partner.
Im vergangenen Jahr importierten die USA für 13 Milliarden Dollar Produkte aus Saudi Arabien, vor allem Öl. Das ist deutlich mehr als Anfang der neunziger Jahre.
Ein großer Teil der Ölerlöse ist in die USA zurückgeflossen – auch das ist heute eine Hypothek für die amerikanische Volkswirtschaft. Das Vermögen der Saudis in den Vereinigten Staaten wird auf 400 bis 600 Milliarden Dollar geschätzt.
Es ist unter anderem in Aktien und Wertpapieren angelegt und kann relativ leicht abgezogen werden. Viele Saudis haben vor allem die neuen amerikanischen Bankengesetze verschreckt. So hat Washington nun das Recht, Vermögen von Personen zu konfiszieren, die unter Verdacht stehen, mit Terroristen Verbindungen zu halten.
Schätzungen zufolge haben die Saudis seit dem 11. September mehr als 100 Milliarden Dollar in Euros umgeschichtet. Das Geld haben sie in Europa vor allem in Immobilien angelegt. Auch verzichten die Saudis inzwischen weitgehend auf Direktinvestitionen in neue Firmen, sagt Brad Bourland, Chefökonom der Saudi American Bank.

13/05/2003 23:15
Snow - Währungskurse sollten vom Markt bestimmt werden
Washington, 13. Mai (Reuters) - US-Finanzminister John Snow
hat am Dienstag bekräftigt, dass die US-Regierung eine Politik
des starken Dollar unterstützt.
Snow sagte in Washington vor Abgeordneten aber zugleich:
"Wir wollen eine Währung, deren Wert sich durch offenen
Wettbewerb am Markt bestimmt." Dies sei überhaupt die beste
Währungspolitik. Es gebe keine bewusste Politik der Vereinigten
Staaten, den Dollarkurs zu bewegen.
akr/ast
--------
Und die Erde ist eine Scheibe
Snow - Währungskurse sollten vom Markt bestimmt werden
Washington, 13. Mai (Reuters) - US-Finanzminister John Snow
hat am Dienstag bekräftigt, dass die US-Regierung eine Politik
des starken Dollar unterstützt.
Snow sagte in Washington vor Abgeordneten aber zugleich:
"Wir wollen eine Währung, deren Wert sich durch offenen
Wettbewerb am Markt bestimmt." Dies sei überhaupt die beste
Währungspolitik. Es gebe keine bewusste Politik der Vereinigten
Staaten, den Dollarkurs zu bewegen.
akr/ast
--------
Und die Erde ist eine Scheibe

SANTA CLARA (AWP/dpa-AFX) - Der weltgrösste Anbieter von Produktionsanlagen für die Chipindustrie, Applied Materials, ist im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Allerdings übertraf das im NASDAQ-100 notierte Unternehmen mit seinem Ergebnis vor Sonderposten die Erwartungen der Analysten. Dennoch gab die Aktie am Dienstag im nachbörslichen Handel weiter nach. Bis 23.16 Uhr verlor die Aktie als meistgehandelter Wert 2,70 Prozent auf 15,14 USD. Aus dem regulären Handel hatte sich das Papier mit minus 1,02 Prozent auf 15,56 USD verabschiedet. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem im Vergleich zum zweiten Quartal stagnierenden bis sinkenden Umsatz. Das Ergebnis pro Aktie (EPS) soll zwischen drei und vier Cent liegen. Die von Thomson Financial/First Call befragten Aktienexperten hatten im Schnitt mit einem EPS von vier Cent bei einem Umsatz von 1,16 Mrd USD gerechnet. Bei einem Umsatzrückgang von vier Prozent auf 1,11 Mrd USD verdiente Applied Materials im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal vor Sonderposten drei Cent je Aktie. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis von zwei Cent gerechnet. Sonderbelastungen in Höhe vo n 151,7 Mio USD für Restrukturierungen und Entlassungen belasteten das Ergebnis. Unter dem Strich wies Applied Materials einen Fehlbetrag von 62 Mio USD aus nach einem Überschuss von 52 Mio USD vor Jahresfrist. Die Bruttomarge ging von 40,0 auf 33,7 Prozent zurück. Vor Sonderposten erhöhte sie sich dagegen auf 38,1 Prozent. Der Auftragseingang sank im Vorjahresvergleich von 1,69 Mrd auf 971 Mio USD. /hi/ak/mk
-------------
umsätze zurück.
marge auch.
aufträge sowieso.
und sonderposten steigen wie teufel.
ja, amerika ist wieder wer!
-------------
umsätze zurück.
marge auch.
aufträge sowieso.
und sonderposten steigen wie teufel.
ja, amerika ist wieder wer!

14.05. 17:54
Gateway - SEC eröffnet Ermittlungen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat eine Kriminalermittlung bei dem PC-Fabrikanten Gateway (WKN: 888851, US: GTW) wegen möglichen neuen Bilanzfälschungen begonnen. Die SEC ermittelt bereits bei Gateway wegen möglichen Bilanzmanipulationen, die bis in den Dezember 2000 zurückreichen. Die Aktie verliert um 4.39% auf $3.05.
------
Sachen gibt´s
Gateway - SEC eröffnet Ermittlungen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat eine Kriminalermittlung bei dem PC-Fabrikanten Gateway (WKN: 888851, US: GTW) wegen möglichen neuen Bilanzfälschungen begonnen. Die SEC ermittelt bereits bei Gateway wegen möglichen Bilanzmanipulationen, die bis in den Dezember 2000 zurückreichen. Die Aktie verliert um 4.39% auf $3.05.
------
Sachen gibt´s

Thema:
Schön, dass die Verbrechen der Saddam-Clique durch die Intervention der USA endlich ein Ende gefunden hat.
ZITAT:
GRAUSAME ENTDECKUNG IM IRAK
Saddams Killing Fields
Fast jeden Tag entdecken Iraker in ihrem Land neue Massengräber, allein in al-Mahawil nahe Bagdad liegen bis zu 15.000 Leichen vergraben. Stück für Stück enthüllen die Menschen mit bloßen Händen die ganze Brutalität des Saddam-Regimes, das in den neunziger Jahren vermutlich Hunderttausende Schiiten und Kurden ermorden ließ.
Bagdad/Hilla/Al-Mahawil - Was im Jahr 1991 in der Nähe der Zementfabrik von al-Mahawil passierte, war keine Geheimaktion. Fast an jedem Apriltag rollten damals schwere Lastwagen und Busse voll gestopft mit Menschen und bewacht von bewaffneten Militärs durch die Straßen der kleinen Stadt und fuhren weiter in Richtung der salzigen Moorgebiete. Wenig später hörten die Einwohner von al-Mahawil minutenlange Maschinengewehrsalven. Danach war es still. Nur das Geräusch der Bulldozer war manchmal noch zu hören, während die Busse ohne die Menschen wieder zurück fuhren.
Bis zum Krieg der USA gegen Saddam Hussein hat in al-Mahawil niemand offen über die Geschehnisse gesprochen. Die Menschen wussten, dass die Schergen von Saddam Hussein blutige Rache an denjenigen nahmen, die sich während des ersten Golfkrieges gegen sie gewandt hatten. Zu Tausenden verhafteten Armee, Polizei und die Geheimdienste Schiiten und Kurden, die den Aufstand gegen Saddam geführt hatten oder einfach nur dessen verdächtigt wurden. Dass diese Menschen nach ihrer Verhaftung getötet würden, wusste jeder Iraker. Doch jeder der Einwohner des Saddam-Landes war sich auch gewiss, dass er der nächste sein könnte, wenn er nicht vorsichtig war und den Mund hielt.
Menschenrechtler rechnen mit 200000 Opfern
Wenige Wochen nach dem Ende der Kämpfe und dem Ende des Saddam-Regimes enthüllen die Menschen in al-Mahawil nun die ganze Brutalität des Regimes ihres einstigen Führers. Ohne Hilfsmittel graben sie seit Tagen an den Stellen, von denen damals die Schüsse kamen. Was sie bisher fanden, eröffnet die ganze Dimension des Terror-Staates, der jeden politischen Gegner eliminierte und ihn dann in der Wüste verscharrte. 3000 Leichen haben die Männer unter der Leitung des örtlichen Arztes Rafid al-Husseini in den letzten neun Tagen bereits gefunden. Wenn jedoch das ganze Feld geöffnet wird, erwartet Husseini mehr als 15.000 Leichen - vielleicht noch mehr.
Auch Kinder wurden in den Feldern verscharrt
Gleichwohl ist al-Mahawil nur eines von Dutzenden von Massengräbern im Irak. Am Dienstag entdeckten Iraker im Norden Bagdads ein weiteres Feld mit fast 1000 Leichen, auch aus dem Süden kommen immer wieder Nachrichten über größere Leichenfunde. Jeden Tag suchen dort Hunderte von Irakern mit bloßen Händen in der Wüste nach den Überresten ihrer vermissten Verwandten, die nach dem Aufstand 1991 verschwanden. Viele hielten die Erzählungen über massenhafte Erschießungen noch Tage nach dem Ende der Kämpfe für Gerüchte von Aufgeregten. Doch mit jedem Fund eines Leichenfelds kommt ein weiteres Stück der traurigen Realität ans Licht. Immer wahrscheinlicher wird auch die Vermutung der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch". Mittlerweile schätzen ihre Mitarbeiter, dass seit 1991 mehr als 200.000 Iraker vom Regime getötet wurden.
Massengräber statt Massenvernichtungswaffen
Vielen Kriegsbefürworten von gestern und heute könnten die Bilder aus al-Mahawil gute Argumente für ihre Haltung geben. Während die US-Armee noch immer verzweifelt nach den angeblichen Massenvernichtungswaffen und damit nach einer Rechtfertigung für den Krieg sucht, belegen die Bilder, dass der Waffengang allein wegen der Unmenschlichkeit des Regimes von Saddam gerechtfertigt sein könnte. Der wegen seines US-treuen Kriegskurses im eigenen Land schwer angeschlagene Blair zeigte sich jedenfalls schon wenige Stunden nach den ersten BBC-Berichten über die Massengräber schockiert und sagte, sie zeigten das "wahre Gesicht des üblen Regimes" von Saddam Hussein.
Den meisten Irakern ist dieses Gesicht wohl bekannt genug. Für sie ist die Suche nach den Massengräbern eher die Suche nach Gewissheit, die sie über Jahre nicht anerkennen wollten. Nichts hatten sie nach dem Verschwinden ihrer Verwandten über ihr Schicksal gehört. Viele trauten sich noch nicht einmal nachzufragen, da sie Angst vor der eigenen Verhaftung hatten. Nun suchen sie die langen Reihen mit den notdürftig zusammen geschnürten Überresten in al-Mahawil ab und suchen nach Spuren. An den Handgelenken der verwesten Körper finden sich manchmal Uhren oder eine Brille, die ein Identifikationsmerkmal sein könnten. Anderswo ist die Kleidung noch erhalten oder ein vergilbter Personalausweis. Dass ihre Verwandten tot sind, ahnen die meisten der Suchenden - sie wollen den endgültigen Beweis und eine Leiche zum Beerdigen.
Die in al-Mahawil gefundenen Leichen erzählen die Geschichte der Unmenschlichkeit des Saddam-Regimes und seiner Getreuen, die bis zum letzten Moment im Leben der Opfer anhielt. Viele der Leichen weisen Schussspuren auf und an manchen ist zu erkennen, dass sie eine Augenbinde hatten. Doch in al-Mahawil fanden die Suchenden auch Körper ohne Einschüsse. "Etwa ein Fünftel der Opfer wurde vom Militär lebendig begraben, sie mussten sich in das Loch legen und wurden zugeschüttet", sagt Husseini und zeigt auf die immer noch gefesselten Hände der Leichen. In einem anderen Plastiksack ist eine tote Frau zu sehen, die ihr Kind noch in den Armen hält. Beide Schädel haben ein Einschussloch auf der Stirn.
Am Mittwoch sicherten überraschend amerikanische Soldaten das Leichenfeld, über dem ein kaum auszuhaltender Verwesungsgeruch liegt. Husseini beruhigt diese spontane Hilfe der USA nicht. Seit dem 3. Mai hatte er die Armee auf das Massengrab hingewiesen, doch nichts passierte. Seitdem graben die Menschen unkontrolliert nach den Leichen. Husseini fürchtet, dass sie wichtige Beweise für eine spätere Identifizierung der Leichen vernichten könnten. Auch die Spuren der Massenexekutionen könnten so für einen möglichen Prozess gegen die Täter verschwinden. Dagegen erklärte Rick Long von den US-Marines, dass es sich "um ein Verbrechen gegen das irakische Volk, nicht um ein Kriegsverbrechen" handele. Deshalb hätten die US-Soldaten Anweisung, im Hintergrund zu bleiben und nur auf Hilfeersuchen der Bevölkerung zu reagieren.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,248645,00.html
Schön, dass die Verbrechen der Saddam-Clique durch die Intervention der USA endlich ein Ende gefunden hat.
ZITAT:
GRAUSAME ENTDECKUNG IM IRAK
Saddams Killing Fields
Fast jeden Tag entdecken Iraker in ihrem Land neue Massengräber, allein in al-Mahawil nahe Bagdad liegen bis zu 15.000 Leichen vergraben. Stück für Stück enthüllen die Menschen mit bloßen Händen die ganze Brutalität des Saddam-Regimes, das in den neunziger Jahren vermutlich Hunderttausende Schiiten und Kurden ermorden ließ.
Bagdad/Hilla/Al-Mahawil - Was im Jahr 1991 in der Nähe der Zementfabrik von al-Mahawil passierte, war keine Geheimaktion. Fast an jedem Apriltag rollten damals schwere Lastwagen und Busse voll gestopft mit Menschen und bewacht von bewaffneten Militärs durch die Straßen der kleinen Stadt und fuhren weiter in Richtung der salzigen Moorgebiete. Wenig später hörten die Einwohner von al-Mahawil minutenlange Maschinengewehrsalven. Danach war es still. Nur das Geräusch der Bulldozer war manchmal noch zu hören, während die Busse ohne die Menschen wieder zurück fuhren.
Bis zum Krieg der USA gegen Saddam Hussein hat in al-Mahawil niemand offen über die Geschehnisse gesprochen. Die Menschen wussten, dass die Schergen von Saddam Hussein blutige Rache an denjenigen nahmen, die sich während des ersten Golfkrieges gegen sie gewandt hatten. Zu Tausenden verhafteten Armee, Polizei und die Geheimdienste Schiiten und Kurden, die den Aufstand gegen Saddam geführt hatten oder einfach nur dessen verdächtigt wurden. Dass diese Menschen nach ihrer Verhaftung getötet würden, wusste jeder Iraker. Doch jeder der Einwohner des Saddam-Landes war sich auch gewiss, dass er der nächste sein könnte, wenn er nicht vorsichtig war und den Mund hielt.
Menschenrechtler rechnen mit 200000 Opfern
Wenige Wochen nach dem Ende der Kämpfe und dem Ende des Saddam-Regimes enthüllen die Menschen in al-Mahawil nun die ganze Brutalität des Regimes ihres einstigen Führers. Ohne Hilfsmittel graben sie seit Tagen an den Stellen, von denen damals die Schüsse kamen. Was sie bisher fanden, eröffnet die ganze Dimension des Terror-Staates, der jeden politischen Gegner eliminierte und ihn dann in der Wüste verscharrte. 3000 Leichen haben die Männer unter der Leitung des örtlichen Arztes Rafid al-Husseini in den letzten neun Tagen bereits gefunden. Wenn jedoch das ganze Feld geöffnet wird, erwartet Husseini mehr als 15.000 Leichen - vielleicht noch mehr.
Auch Kinder wurden in den Feldern verscharrt
Gleichwohl ist al-Mahawil nur eines von Dutzenden von Massengräbern im Irak. Am Dienstag entdeckten Iraker im Norden Bagdads ein weiteres Feld mit fast 1000 Leichen, auch aus dem Süden kommen immer wieder Nachrichten über größere Leichenfunde. Jeden Tag suchen dort Hunderte von Irakern mit bloßen Händen in der Wüste nach den Überresten ihrer vermissten Verwandten, die nach dem Aufstand 1991 verschwanden. Viele hielten die Erzählungen über massenhafte Erschießungen noch Tage nach dem Ende der Kämpfe für Gerüchte von Aufgeregten. Doch mit jedem Fund eines Leichenfelds kommt ein weiteres Stück der traurigen Realität ans Licht. Immer wahrscheinlicher wird auch die Vermutung der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch". Mittlerweile schätzen ihre Mitarbeiter, dass seit 1991 mehr als 200.000 Iraker vom Regime getötet wurden.
Massengräber statt Massenvernichtungswaffen
Vielen Kriegsbefürworten von gestern und heute könnten die Bilder aus al-Mahawil gute Argumente für ihre Haltung geben. Während die US-Armee noch immer verzweifelt nach den angeblichen Massenvernichtungswaffen und damit nach einer Rechtfertigung für den Krieg sucht, belegen die Bilder, dass der Waffengang allein wegen der Unmenschlichkeit des Regimes von Saddam gerechtfertigt sein könnte. Der wegen seines US-treuen Kriegskurses im eigenen Land schwer angeschlagene Blair zeigte sich jedenfalls schon wenige Stunden nach den ersten BBC-Berichten über die Massengräber schockiert und sagte, sie zeigten das "wahre Gesicht des üblen Regimes" von Saddam Hussein.
Den meisten Irakern ist dieses Gesicht wohl bekannt genug. Für sie ist die Suche nach den Massengräbern eher die Suche nach Gewissheit, die sie über Jahre nicht anerkennen wollten. Nichts hatten sie nach dem Verschwinden ihrer Verwandten über ihr Schicksal gehört. Viele trauten sich noch nicht einmal nachzufragen, da sie Angst vor der eigenen Verhaftung hatten. Nun suchen sie die langen Reihen mit den notdürftig zusammen geschnürten Überresten in al-Mahawil ab und suchen nach Spuren. An den Handgelenken der verwesten Körper finden sich manchmal Uhren oder eine Brille, die ein Identifikationsmerkmal sein könnten. Anderswo ist die Kleidung noch erhalten oder ein vergilbter Personalausweis. Dass ihre Verwandten tot sind, ahnen die meisten der Suchenden - sie wollen den endgültigen Beweis und eine Leiche zum Beerdigen.
Die in al-Mahawil gefundenen Leichen erzählen die Geschichte der Unmenschlichkeit des Saddam-Regimes und seiner Getreuen, die bis zum letzten Moment im Leben der Opfer anhielt. Viele der Leichen weisen Schussspuren auf und an manchen ist zu erkennen, dass sie eine Augenbinde hatten. Doch in al-Mahawil fanden die Suchenden auch Körper ohne Einschüsse. "Etwa ein Fünftel der Opfer wurde vom Militär lebendig begraben, sie mussten sich in das Loch legen und wurden zugeschüttet", sagt Husseini und zeigt auf die immer noch gefesselten Hände der Leichen. In einem anderen Plastiksack ist eine tote Frau zu sehen, die ihr Kind noch in den Armen hält. Beide Schädel haben ein Einschussloch auf der Stirn.
Am Mittwoch sicherten überraschend amerikanische Soldaten das Leichenfeld, über dem ein kaum auszuhaltender Verwesungsgeruch liegt. Husseini beruhigt diese spontane Hilfe der USA nicht. Seit dem 3. Mai hatte er die Armee auf das Massengrab hingewiesen, doch nichts passierte. Seitdem graben die Menschen unkontrolliert nach den Leichen. Husseini fürchtet, dass sie wichtige Beweise für eine spätere Identifizierung der Leichen vernichten könnten. Auch die Spuren der Massenexekutionen könnten so für einen möglichen Prozess gegen die Täter verschwinden. Dagegen erklärte Rick Long von den US-Marines, dass es sich "um ein Verbrechen gegen das irakische Volk, nicht um ein Kriegsverbrechen" handele. Deshalb hätten die US-Soldaten Anweisung, im Hintergrund zu bleiben und nur auf Hilfeersuchen der Bevölkerung zu reagieren.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,248645,00.html
das ist eine irakmeldung, nasdaq 
und wenn die amis nicht demnächst die region verlassen,
gibt es noch mehr anschläge wie vor kurzem in arabien!
die amis machen nun die gleichen fehler wie vor ca. 12 jahren

und wenn die amis nicht demnächst die region verlassen,
gibt es noch mehr anschläge wie vor kurzem in arabien!
die amis machen nun die gleichen fehler wie vor ca. 12 jahren

wenn wir schon beim irak sind 
---------
http://www.freiepresse.de/TEXTE/NACHRICHTEN/TEXTE/611486.htm…
Angehörige von Irak-Kriegsopfern verklagen US-Kommandeur in Belgien
Anwalt: General Franks für Kriegsverbrechen verantwortlich
Angehörige von Opfern des Irak-Kriegs haben in Belgien Klage gegen den US-Oberbefehlshaber Tommy Franks einreicht. Die bei einem Brüsseler Gericht vorgelegte Klageschrift stütze sich auf die universelle Zuständigkeit der belgischen Justiz für Kriegsverbrechen, sagte am Mittwoch der Anwalt der 19 Kläger, Jan Fermon. Franks sei für den militärischen Einsatz vor Ort verantwortlich gewesen, bei dem etwa Streubomben gegen zivile Ziele eingesetzt worden seien, was ein Kriegsverbrechen darstelle. Das bereits am Vortag angekündigte Verfahren richte sich auch gegen Oberstleutnant Brian MacCoy von den Marines, der Krankenwagen als "legitime Ziele" erklärt habe, weil diese versteckte Kämpfer bergen könnten.


---------
http://www.freiepresse.de/TEXTE/NACHRICHTEN/TEXTE/611486.htm…
Angehörige von Irak-Kriegsopfern verklagen US-Kommandeur in Belgien
Anwalt: General Franks für Kriegsverbrechen verantwortlich
Angehörige von Opfern des Irak-Kriegs haben in Belgien Klage gegen den US-Oberbefehlshaber Tommy Franks einreicht. Die bei einem Brüsseler Gericht vorgelegte Klageschrift stütze sich auf die universelle Zuständigkeit der belgischen Justiz für Kriegsverbrechen, sagte am Mittwoch der Anwalt der 19 Kläger, Jan Fermon. Franks sei für den militärischen Einsatz vor Ort verantwortlich gewesen, bei dem etwa Streubomben gegen zivile Ziele eingesetzt worden seien, was ein Kriegsverbrechen darstelle. Das bereits am Vortag angekündigte Verfahren richte sich auch gegen Oberstleutnant Brian MacCoy von den Marines, der Krankenwagen als "legitime Ziele" erklärt habe, weil diese versteckte Kämpfer bergen könnten.

Zu #203:
Tag für Tag kommen mehr Morde ans Licht
Immer häufiger finden Iraker und Amerikaner Massengräber - 300. 000 Menschen verschwanden spurlos
http://www.welt.de/data/2003/05/15/95070.html
Tag für Tag kommen mehr Morde ans Licht
Immer häufiger finden Iraker und Amerikaner Massengräber - 300. 000 Menschen verschwanden spurlos
http://www.welt.de/data/2003/05/15/95070.html
"Er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn!"
Komisch, es schien jahrelang niemand zu stören was der Mann dort unten trieb. Wenn dann auf einmal moralische Gerechtigkeitswahnanfälle kommen darf man doch mißtrauisch sein?
Komisch, es schien jahrelang niemand zu stören was der Mann dort unten trieb. Wenn dann auf einmal moralische Gerechtigkeitswahnanfälle kommen darf man doch mißtrauisch sein?
Nasdaq glaubt tatsächlich, der Krieg diente der Gräbersuche.
Ach ja, Chemie und Biowaffen ! Hiss die Fahne in Deinem Garten und bleib lieber still da ist ja so peinlich.
J2
Ach ja, Chemie und Biowaffen ! Hiss die Fahne in Deinem Garten und bleib lieber still da ist ja so peinlich.
J2
lieber nasdaq,
eröffne bitte umgehend einen irak-thread.
ich kann mit dem zeugs wirklich nichts anfangen!
danke
eröffne bitte umgehend einen irak-thread.
ich kann mit dem zeugs wirklich nichts anfangen!
danke

@ All,
da www.stock-channel.net immer noch platt ist, frage ich an:
Wisst Ihr, in welchem Board ich Germa´s Analysten, Postings etc. finde?
Bitte lasst mich nicht im unklaren. Danke.
da www.stock-channel.net immer noch platt ist, frage ich an:
Wisst Ihr, in welchem Board ich Germa´s Analysten, Postings etc. finde?
Bitte lasst mich nicht im unklaren. Danke.
guck posting #185
Klar, Beiträge, die die Sinnhaftigkeit der US-Intervention im Irak belegen, sind hier nicht gern gesehen.
In diesem thread sind im Übrigen massenhaft Irak-Beiträge, Beiträge zur US-amerikanischen Aussenpolitik und zur Kern-Ressource Öl.
-----------------------------------------------------------
Gerade heute wieder akuell:
ZITAT:
Deutschland fällt auf Rang 5
Deutschland ist in der neuen Rangliste der wettbewerbsfähigen Länder um einen Platz auf Rang fünf zurückgefallen. Angeführt wird die vom Lausanner Managementinstitut IMD erstellte Hitparade von den USA, danach folgen Australien, Kanada, und Malaysia.
Hinter Deutschland landeten Taiwan, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Thailand, Japan und China.
In der Liste der kleinen Länder mit weniger als 20 Millionen Einwohner liegt Finnland auf dem ersten Platz vor Singapur, Dänemark, Hongkong und der Schweiz.
Malaysia vor Deutschland
Der Vorjahressieger der "Gruppe der Kleinen", die Niederlande, rutschte von Rang eins auf den achten Platz ab. Österreich büßte zwei Plätze ein und liegt nun auf Rang zehn. Bei den "Großen" gab es nur geringfügige Änderungen:
Die USA behaupteten ihren Spitzenplatz, Australien und Kanada tauschten die Plätze. Neu in die besten Fünf rückte Malaysia (Vorjahr Platz sechs) an Deutschland vorbei auf Rang vier vor. Dagegen rutschte Großbritannien von Rang fünf auf den siebten Platz ab.
Umwelt top - Arbeitsmarkt flop
Deutschland landete in den Bereichen Gesundheit und Umwelt auf dem Spitzenplatz. Gute Noten erteilte die Studie den Deutschen zudem in den Bereichen Infrastruktur und internationalem Handel. Schlecht dagegen schnitten die Steuerpolitik (Rang 28) und die Situation der öffentlichen Haushalte (Rang 23) ab. Im Bereich Arbeitsmarkt blieb für Deutschland wegen mangelnder Flexibilität und fehlender Anreize für Arbeitslose, sich um eine Stelle zu bemühen, zwei Mal nur der dreißigste, also letzte Platz übrig.
Wer glaubt an die Rezession?
Die Resultate der weltweiten Erhebung fasste der IMD-Direktor und Ökonomieprofessor Stephane Garelli mit der Bemerkung zusammen: "Die gute Nachricht lautet, dass die Weltwirtschaft nicht in der Rezession ist. Die schlechte Nachricht ist, dass niemand daran glaubt." Garelli sieht zudem zwei Zeitbomben ticken: Erstens die rekordhohe Verschuldung der Unternehmen, die im Falle eines Zinsanstiegs zu Zahlungsschwierigkeiten führen könne. Und zweitens die prekäre Lage der Pensionskassen, die laut IMD Verluste von 2,8 Billionen Dollar auf ihren Kapitalanlagen hinnehmen mussten.
http://t-finance.t-online.de/zone/fina/aktu/konj/eige/ar/CP/…
http://www01.imd.ch/
In diesem thread sind im Übrigen massenhaft Irak-Beiträge, Beiträge zur US-amerikanischen Aussenpolitik und zur Kern-Ressource Öl.
-----------------------------------------------------------
Gerade heute wieder akuell:
ZITAT:
Deutschland fällt auf Rang 5
Deutschland ist in der neuen Rangliste der wettbewerbsfähigen Länder um einen Platz auf Rang fünf zurückgefallen. Angeführt wird die vom Lausanner Managementinstitut IMD erstellte Hitparade von den USA, danach folgen Australien, Kanada, und Malaysia.
Hinter Deutschland landeten Taiwan, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Thailand, Japan und China.
In der Liste der kleinen Länder mit weniger als 20 Millionen Einwohner liegt Finnland auf dem ersten Platz vor Singapur, Dänemark, Hongkong und der Schweiz.
Malaysia vor Deutschland
Der Vorjahressieger der "Gruppe der Kleinen", die Niederlande, rutschte von Rang eins auf den achten Platz ab. Österreich büßte zwei Plätze ein und liegt nun auf Rang zehn. Bei den "Großen" gab es nur geringfügige Änderungen:
Die USA behaupteten ihren Spitzenplatz, Australien und Kanada tauschten die Plätze. Neu in die besten Fünf rückte Malaysia (Vorjahr Platz sechs) an Deutschland vorbei auf Rang vier vor. Dagegen rutschte Großbritannien von Rang fünf auf den siebten Platz ab.
Umwelt top - Arbeitsmarkt flop
Deutschland landete in den Bereichen Gesundheit und Umwelt auf dem Spitzenplatz. Gute Noten erteilte die Studie den Deutschen zudem in den Bereichen Infrastruktur und internationalem Handel. Schlecht dagegen schnitten die Steuerpolitik (Rang 28) und die Situation der öffentlichen Haushalte (Rang 23) ab. Im Bereich Arbeitsmarkt blieb für Deutschland wegen mangelnder Flexibilität und fehlender Anreize für Arbeitslose, sich um eine Stelle zu bemühen, zwei Mal nur der dreißigste, also letzte Platz übrig.
Wer glaubt an die Rezession?
Die Resultate der weltweiten Erhebung fasste der IMD-Direktor und Ökonomieprofessor Stephane Garelli mit der Bemerkung zusammen: "Die gute Nachricht lautet, dass die Weltwirtschaft nicht in der Rezession ist. Die schlechte Nachricht ist, dass niemand daran glaubt." Garelli sieht zudem zwei Zeitbomben ticken: Erstens die rekordhohe Verschuldung der Unternehmen, die im Falle eines Zinsanstiegs zu Zahlungsschwierigkeiten führen könne. Und zweitens die prekäre Lage der Pensionskassen, die laut IMD Verluste von 2,8 Billionen Dollar auf ihren Kapitalanlagen hinnehmen mussten.
http://t-finance.t-online.de/zone/fina/aktu/konj/eige/ar/CP/…
http://www01.imd.ch/
was hat denn bush belegt? 
wo sind die waffen? und wo steckt saddam?

wo sind die waffen? und wo steckt saddam?

Die schwarze Linie bildet den Kursverlauf des S&P 500 seit 1982 ab. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Bewertung des Index bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 15. Dies gilt im übrigen auch dann, wenn man wesentlich weiter in die Vergangenheit zurückblickt, als dies im Chart dargestellt ist: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von US-Aktien liegt seit 1872 im Schnitt bei 14,5. Die blaue Linie verdeutlicht, was derzeit ein „durchschnittliches“ Niveau beim S&P 500 wäre: Etwas mehr als 420 Punkte wären im historischen Vergleich immer noch fair.
Auch Zeiten deutlicher Unterbewertung hat es beim S&P während der vergangenen beiden Jahrzehnte gegeben. Zum Start der Mega-Hausse vor etwas mehr als 20 Jahren etwa. 1982 lag das durchschnittliche KGV aller im S&P 500 gelisteten Unternehmen bei sechs bis acht. Der Kursverlauf notierte seinerzeit unterhalb der grünen Linie, die eine Unterbewertung im S&P 500 signalisiert. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste der S&P 500 auf kaum vorstellbare 280 Zähler fallen, um als echtes Schnäppchen durchzugehen.



Kommen wir zur roten Linie. Bei einem KGV von 20 und darüber spricht man im historischen Vergleich von einer Überbewertung.
Die Schlussfolgerung lautet:
Selbst bei einem Index-Stand von rund 560 Zählern wäre der S&P 500 immer noch reichlich teuer.
ENDE
keine besonders gute Basis für neue Höhen

Das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis aller im S&P 500 gelisteten Unternehmen seit 1928

Auffällig ist, dass der Wert im Vergleich zu den Übertreibungen Anfang des Jahres 2000 inzwischen deutlich korrigiert hat. Und noch etwas wird klar: Die Behauptung, US-Aktien seien auf einem günstigen Niveau angekommen, ist reichlich vermessen. Das gegenwärtige Kurs-Buchwert-Verhältnis ist deutlich höher als vor dem Crash von 1929, höher als während der Aktienhausse der 60er Jahre und auch höher als unmittelbar vor dem Einbruch 1987.

Auffällig ist, dass der Wert im Vergleich zu den Übertreibungen Anfang des Jahres 2000 inzwischen deutlich korrigiert hat. Und noch etwas wird klar: Die Behauptung, US-Aktien seien auf einem günstigen Niveau angekommen, ist reichlich vermessen. Das gegenwärtige Kurs-Buchwert-Verhältnis ist deutlich höher als vor dem Crash von 1929, höher als während der Aktienhausse der 60er Jahre und auch höher als unmittelbar vor dem Einbruch 1987.
@nasdaq10.000
laß doch die Paranoiker weitersabbeln.
Hier kommt jede Hilfe zu spät.
laß doch die Paranoiker weitersabbeln.
Hier kommt jede Hilfe zu spät.
Die Paranoiker sitzen in der Regierung der Vereinigten Staaten. Sehen überall Gefahren, so dass sogar die Bürgerechte ausgehebelt werden, für einen Kreuzzug im Rahmen des Ewigen Krieges für den Ewigen Frieden.

Schaut mal wie weit wir schon unten sind im historischen Durchschnitt!
Rhetorische Frage:
Sind gerade bereits in der Phase, wo ordentlich Fahrkarten gelöst werden sollen auf den Weg nach Süden?
Der Bush senkt für die Reichen und Florida erhöht für den Pöbel!
Ja, Amerika holt alles aus dem 2/3 Verbraucher
--------
http://www.sacbee.com/content/politics/story/6662531p-761437…
Governor`s $95.8 billion budget plan features new taxes, borrowing
Published 12:11 p.m. PDT Wednesday, May 14, 2003
[Updated 12:50 p.m. May 14] Saying the state’s fiscal crisis has deepened in recent months, Gov. Gray Davis revised his budget Wednesday to raise new taxes on tobacco, cars, consumer products and the wealthy, while also borrowing more than $10 billion to finance part of the state deficit. The $95.8 billion spending plan, sent to the Legislature Wednesday, differs greatly from Davis’ January budget proposal, which relied more heavily on program cuts to eliminate California’s record shortfall.
Although the Legislature has trimmed some spending in recent weeks and tax collections have met expectations, the administration now believes the deficit is closer to $38 billion because of increases in spending.
"This is not way cool. There were so many people who doubted my revenue estimates, who said I was overstating a drop in revenues," Davis said. "If you look at our revenue estimates, we were right on the money."
To close the widening gap, Davis would raise $8.3 billion in new taxes this year, including a hike in the car tax and a half-cent increase in the state sales tax.
Davis acknowledged that he is proposing higher taxes in part to win support from fellow Democrats, who control both houses and have been reluctant to make deep cuts in education, public health and other programs.
The governor said his plan reflected painful choices, but is a compromise that can win bipartisan support in the Legislature.
The reliance on higher taxes means Davis can put more money in favored programs - especially education. For instance, the new budget plan continues support for a popular $1.7 billion program to reduce the number of students in each classroom.
Community colleges would take a smaller hit than the governor proposed in January and K-12 schools would receive $700 million more than Davis offered five months ago. Both the University of California and the California State University have also been spared deeper cuts.
Davis has scrapped a plan to pass on the costs of major health and welfare programs to cities and counties with little new financial support. Instead the governor wants to shift a smaller number of programs to local governments and support them with $1.8 billion in new money from higher taxes on cigarettes and an increase in income taxes paid by the state’s top wage earners.
The governor is counting on a hike in taxes paid by car owners, a move anticipated for several months that will bring in about $4 billion a year. State attorneys have said that the car tax can be raised without a vote of the Legislature if cash reserves fall low enough.
The new car tax will cost the average driver about $130 a year.
While Davis’ plans may prove popular among Democrats, lawmakers on the other side of the aisle say they will not support any new taxes.
"Punishing taxpayers because liberal Democrats have spent us into bankruptcy does not make sense to us," said Sen. Jim Brulte, R-Rancho Cucamonga. "We’re trying to be as flexible as possible and we’re willing to negotiate on everything but taxes."
Because California is one of the few states that require the budget to be approved by a two-thirds majority, Davis and his Democratic colleagues will somehow have to find Republican votes for the proposal.
The idea to finance the deficit is based on a model used in New York during the 1970s when that city was forced to fight off insolvency. As proposed, the state would create a separate agency to issue bonds and manage interest payments for the bonds that would be paid off over five years.
California already has one of the highest sales taxes in the nation at 7.25 percent and each county has the right to raise it even higher. San Francisco is already at 8.5 percent.
The higher sales tax would last only until the bonds are paid off in five years, Davis said.
Davis said the state’s deficit is currently around $10 billion, caused in large part by a dramatic drop in tax collections over the past two years. The governor estimated in January that if the state took no action to trim spending or raise revenues, the shortfall will grow to $35 billion by the end of the 2003-2004 fiscal year.
The Legislature has approved about $12 billion in cuts and savings so far this year but the administration believes that spending has grown for some services while other income - such as a sale of tobacco bonds - was not realized. Davis now believes the deficit has increased about $3 billion over the last few months to about $38.2 billion.
-- The Associated Press
Ja, Amerika holt alles aus dem 2/3 Verbraucher

--------
http://www.sacbee.com/content/politics/story/6662531p-761437…
Governor`s $95.8 billion budget plan features new taxes, borrowing
Published 12:11 p.m. PDT Wednesday, May 14, 2003
[Updated 12:50 p.m. May 14] Saying the state’s fiscal crisis has deepened in recent months, Gov. Gray Davis revised his budget Wednesday to raise new taxes on tobacco, cars, consumer products and the wealthy, while also borrowing more than $10 billion to finance part of the state deficit. The $95.8 billion spending plan, sent to the Legislature Wednesday, differs greatly from Davis’ January budget proposal, which relied more heavily on program cuts to eliminate California’s record shortfall.
Although the Legislature has trimmed some spending in recent weeks and tax collections have met expectations, the administration now believes the deficit is closer to $38 billion because of increases in spending.
"This is not way cool. There were so many people who doubted my revenue estimates, who said I was overstating a drop in revenues," Davis said. "If you look at our revenue estimates, we were right on the money."
To close the widening gap, Davis would raise $8.3 billion in new taxes this year, including a hike in the car tax and a half-cent increase in the state sales tax.
Davis acknowledged that he is proposing higher taxes in part to win support from fellow Democrats, who control both houses and have been reluctant to make deep cuts in education, public health and other programs.
The governor said his plan reflected painful choices, but is a compromise that can win bipartisan support in the Legislature.
The reliance on higher taxes means Davis can put more money in favored programs - especially education. For instance, the new budget plan continues support for a popular $1.7 billion program to reduce the number of students in each classroom.
Community colleges would take a smaller hit than the governor proposed in January and K-12 schools would receive $700 million more than Davis offered five months ago. Both the University of California and the California State University have also been spared deeper cuts.
Davis has scrapped a plan to pass on the costs of major health and welfare programs to cities and counties with little new financial support. Instead the governor wants to shift a smaller number of programs to local governments and support them with $1.8 billion in new money from higher taxes on cigarettes and an increase in income taxes paid by the state’s top wage earners.
The governor is counting on a hike in taxes paid by car owners, a move anticipated for several months that will bring in about $4 billion a year. State attorneys have said that the car tax can be raised without a vote of the Legislature if cash reserves fall low enough.
The new car tax will cost the average driver about $130 a year.
While Davis’ plans may prove popular among Democrats, lawmakers on the other side of the aisle say they will not support any new taxes.
"Punishing taxpayers because liberal Democrats have spent us into bankruptcy does not make sense to us," said Sen. Jim Brulte, R-Rancho Cucamonga. "We’re trying to be as flexible as possible and we’re willing to negotiate on everything but taxes."
Because California is one of the few states that require the budget to be approved by a two-thirds majority, Davis and his Democratic colleagues will somehow have to find Republican votes for the proposal.
The idea to finance the deficit is based on a model used in New York during the 1970s when that city was forced to fight off insolvency. As proposed, the state would create a separate agency to issue bonds and manage interest payments for the bonds that would be paid off over five years.
California already has one of the highest sales taxes in the nation at 7.25 percent and each county has the right to raise it even higher. San Francisco is already at 8.5 percent.
The higher sales tax would last only until the bonds are paid off in five years, Davis said.
Davis said the state’s deficit is currently around $10 billion, caused in large part by a dramatic drop in tax collections over the past two years. The governor estimated in January that if the state took no action to trim spending or raise revenues, the shortfall will grow to $35 billion by the end of the 2003-2004 fiscal year.
The Legislature has approved about $12 billion in cuts and savings so far this year but the administration believes that spending has grown for some services while other income - such as a sale of tobacco bonds - was not realized. Davis now believes the deficit has increased about $3 billion over the last few months to about $38.2 billion.
-- The Associated Press
kalifornien, nicht florida 



15/05/2003 18:16
TABELLE-Index der Fed von Philadelphia im Mai gestiegen
New York, 15. Mai (Reuters) - Der Konjunkturindex der
Federal Reserve Bank von Philadelphia ist im Mai auf minus 4,8
Punkte von 8,8 Punkten im April gestiegen. Die Philadelphia-Fed
veröffentlichte am Donnerstag folgende Zahlen:
MAI 2003 APR 2003
Konjunkturindex - 4,8 - 8,8
Index des Auftragseingangs - 3,8 - 11,2
Index der Lagerbestände - 7,3 - 2,7
Index der bezahlten Preise 8,9 22,8
Index der erhaltenen Preise 2,1 8,0
Beschäftigungsindex - 10,9 -12,5
NOTE - Von Reuters befragte Volkswirte hatten für den
Berichtsmonat mit einem Konjunkturindex von minus 2,6 Punkten
gerechnet.
fri/ast

TABELLE-Index der Fed von Philadelphia im Mai gestiegen
New York, 15. Mai (Reuters) - Der Konjunkturindex der
Federal Reserve Bank von Philadelphia ist im Mai auf minus 4,8
Punkte von 8,8 Punkten im April gestiegen. Die Philadelphia-Fed
veröffentlichte am Donnerstag folgende Zahlen:
MAI 2003 APR 2003
Konjunkturindex - 4,8 - 8,8
Index des Auftragseingangs - 3,8 - 11,2
Index der Lagerbestände - 7,3 - 2,7
Index der bezahlten Preise 8,9 22,8
Index der erhaltenen Preise 2,1 8,0
Beschäftigungsindex - 10,9 -12,5
NOTE - Von Reuters befragte Volkswirte hatten für den
Berichtsmonat mit einem Konjunkturindex von minus 2,6 Punkten
gerechnet.
fri/ast

Powell will keine russischen Friedenstruppen
"Kein angemessener Beitrag" - Finanzhilfe und humanitäre Unterstützung hingegen willkommen
Moskau - Der amerikanische Außenminister Colin Powell hat sich gegen eine Entsendung russischer Friedenstruppen in den Irak ausgesprochen. "Wir begrüßen russische Hilfe für den Irak sehr. Ich weiß aber nicht, ob Friedenstruppen ein angemessener Beitrag wären", sagte Powell am Donnerstag zum Abschluss seines Russlandbesuchs dem Radiosender "Echo Moskwy". Finanzhilfen sowie humanitäre Unterstützung seien dagegen sehr willkommen.
Beeindruckende Kooperationsbereitschaft
Powell lobte die Bereitschaft der russischen Führung, die Meinungsverschiedenheit über eine Aufhebung der UNO-Sanktionen gegen den Irak beizulegen. "Die Kooperationsbereitschaft von Präsident Wladimir Putin und Außenminister Igor Iwanow hat mich beeindruckt", betonte der US-Außenminister, der im Tagesverlauf weiter nach Bulgarien und Deutschland reisen wollte.
Die USA blickten mit großen Erwartungen auf das erste Treffen Putins seit dem Irak-Krieg mit US-Präsident George W. Bush Ende Mai in der russischen Stadt Sankt Petersburg. "Irak, Iran, Afghanistan - es gibt dort viel Arbeit zu tun", betonte Powell.
Powell verspricht Schuldenklärung
Der US-Außenminister versicherte den Russen, eine neue irakische Regierung werde sich auch der Frage der Altschulden des Landes an Russland annehmen. In den Zeiten des gestürzten Diktators Saddam Hussein hatte der Irak Verbindlichkeiten bei Russland in Höhe von umgerechnet knapp sieben Milliarden Euro angehäuft. (APA/dpa)
"Kein angemessener Beitrag" - Finanzhilfe und humanitäre Unterstützung hingegen willkommen
Moskau - Der amerikanische Außenminister Colin Powell hat sich gegen eine Entsendung russischer Friedenstruppen in den Irak ausgesprochen. "Wir begrüßen russische Hilfe für den Irak sehr. Ich weiß aber nicht, ob Friedenstruppen ein angemessener Beitrag wären", sagte Powell am Donnerstag zum Abschluss seines Russlandbesuchs dem Radiosender "Echo Moskwy". Finanzhilfen sowie humanitäre Unterstützung seien dagegen sehr willkommen.
Beeindruckende Kooperationsbereitschaft
Powell lobte die Bereitschaft der russischen Führung, die Meinungsverschiedenheit über eine Aufhebung der UNO-Sanktionen gegen den Irak beizulegen. "Die Kooperationsbereitschaft von Präsident Wladimir Putin und Außenminister Igor Iwanow hat mich beeindruckt", betonte der US-Außenminister, der im Tagesverlauf weiter nach Bulgarien und Deutschland reisen wollte.
Die USA blickten mit großen Erwartungen auf das erste Treffen Putins seit dem Irak-Krieg mit US-Präsident George W. Bush Ende Mai in der russischen Stadt Sankt Petersburg. "Irak, Iran, Afghanistan - es gibt dort viel Arbeit zu tun", betonte Powell.
Powell verspricht Schuldenklärung
Der US-Außenminister versicherte den Russen, eine neue irakische Regierung werde sich auch der Frage der Altschulden des Landes an Russland annehmen. In den Zeiten des gestürzten Diktators Saddam Hussein hatte der Irak Verbindlichkeiten bei Russland in Höhe von umgerechnet knapp sieben Milliarden Euro angehäuft. (APA/dpa)
@all
Ich suche die Unternehmen die in den USA meisten Arbeitsplätze abgebaut haben ?
Beispiel : Nike produziert nur noch in Indonesien !
Ich benötige aber eine Auflistung, gut wäre noch mit Standorten !
mfg
Ich suche die Unternehmen die in den USA meisten Arbeitsplätze abgebaut haben ?
Beispiel : Nike produziert nur noch in Indonesien !
Ich benötige aber eine Auflistung, gut wäre noch mit Standorten !
mfg
Zusammenfassung der Wirtschaftswoche 21/03
S. 150 Titel: War´s das schon?
...Um die Aktienrally der vergangenen Wochen als fundamental untermauert einordnen zu können, hätte die kürzlich erreichten Indexhochs - Nasdaq & S&P500 sogar auf Jahreshoch - von neuen Renditehochs an den Bondmärkten bestätigt werden müssen. Nach dem Motto: raus aus Anleihen - rein in Aktien. (Hintergrund: Normalerweise sind Aktien und Anleihen wie die beiden Enden einer Wippe: Wenn die eine unten sind, sind die anderen oben.) Massive Umschichtungen blieben aber aus.
Wer liegt nun falsch? Die Akteuere am Anleihenmarkt oder die am Aktienmarkt?
In der Vergangenheit bewies der Bondmarkt das bessere Gespür für gesamtwirtschaftliche Entwicklungen. (Wahrscheinlich, weil hier die Mehrzahl diplomierte Volkswirtschaftler sind.) So dürfte es auch diesmal sein. Denn dem hohen Abwärtspotential der Anleihenrenditen von 4,1 Prozent der zehnjährigen US-Staatsanleihen im März drohen noch im Sommer auf unter 3 Prozent zu fallen, was eine entsprechende Gefahr für Aktien gegenübersteht.
ENDE
Fortsetzung von S.166 Barron´s Kommentar: Nur einer hat recht
...Eine ähnlich paradoxe Entwicklung ist im Währungsmarkt zu beobachten. Seit Beginn der Baisse ist es den US-Aktien nie gelungen, Boden gutzumachen, während der US-Dollar nachgab. Bis jetzt. Dieses Mal legten die Aktien zu, während der Dollar massiv abrutschte. In den vergangenen drei Jahren bewegten sich die Aktien 90 Prozent der Zeit in die selbe Richtung wie der Greenback.
...Als die Zentralbank vor zu geringer Inflation warnte, hat das einen Run auf Anleihen losgetreten. Die Aktienanleger allerdings zeigten sich überraschend wenig beeindruckt von den Deflationsgefahren (dazu später mehr) für Gewinn- und Umsatzwachstum.
Welcher Markt bewegt sich nun zuerst und sorgt für die Wiederherstellung des Gleichgewichts?
Die Korrektur könnte wohl wieder zulasten der Aktienmärkte gehen. Zahlreiche Wall-Street-Experten sehen keinerlei gerechtfertigten Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Kursgewinne und den wirtschaftlichen Aussichten: "Diese Rally wird von den Fundamentaldaten nicht unterstützt", meint beispielsweise Donald Straszheim von Straszheim Global Advisors. "Sie wird als böse Erfahrung enden, sofern sich die Wirtschaftsdaten nicht verbessern."
ENDE
Hier die Fortsetzung zu der "angeblichen" Deflationsgefahr - dazu Markus Koch auf S. 152 Street Talk, Geschicktes Spiel:
Eine Verschwörungstheorie geht an der New Yorker Wall Street um. Die Notenbank befürchtete entgegen eigener Aussagen gar keine Deflation und habe lediglich einen Geheimpakt mit dem Finanzministerium geschlossen, um die Märkte zu stützen. Alan Greenspan und Finanzminister John Snow spielten sich dabei die Bälle zu.
"Das Risiko einer unerwünscht stark sinkenden Inflation ist, wenn auch minimal größer als das einer aufkommenden Inflation," so Greenspan. Diese eingesetzten Worte hielten die Renditen der Anleihen niedrig, da der Rentenhandel gelähmt auf das bewusst heraufbeschworene Deflationsgespenst starrte. Greenspan hält den Rentenhandel mit seinen Aussagen als künstlich bei Laune und die Renditen im Keller. Deshalb haben zuletzt Renten- und Aktienkurse historisch im ungewohnten Gleichschritt zugelegt.
Finanzminster Snowübt sich derweil in einem Schauspiel anderer Art:
Offiziell wird an der Politik eines starken Dollar zwar festgehalten, tatsächlich aber Interesse an einem schwachen Greenback signalisiert. "Ein schwacher Dollar treibt die Exporte an" (eigene Anmerkung: fragt sich nur welche, wo die Amerikaner wesentlich mehr importieren als exportieren, daher auch das riesige Handelsbilanzdefizit), signalisierte Snow eine Abkehr von der Politik des starken Dollar. Dies trifft den Nagel auf den Kopf, da diese Politik nicht nur im Interesse der Bush-Regierung , sondern auch Greenspan ist. Man hofft durch die währungsbedingte international steigende Wettbewerbsfähigkeit die US-Exporte anzufachen und somit das Ertragswachstum der US-Unternehmen zu stärken, während die Verteuerung der Importe den deflationären Trend zu bekämpfen.
ENDE
Wie´s der Zufall so will: Dazu heute auch Germa´s Thread:
"16.05.03: Das Ammenmärchen der Deflation, welche gar nicht existent ist."
Auszugsweise: "An den Börsen und quer durch alle Analystenhäuser war die drohende Deflation das Hauptschlagwort des Tages, denn mit den absoluten Zahlen der Erzeugerpreise und tags zuvor Importpreise scheinen sich nun alle Prophezeihungen Greenspans zu erfüllen, der in den letzten Tagen permanent vor einer Deflation warnte. Traurig das sich die Welt in solch eine haltlose Illusion treiben lässt, denn das Amerika im Herstellungsbereich nachweislich keine Deflation, sondern eine gewaltige Inflation aufzuweisen hat, dass ist für jeden überprüfbar stich- und hiebfest belegbar! Allan braucht jedoch eine deflationäre Stimmung, denn nur mit dieser lassen sich Aktieninterventionen, Geldmengenausweitung und vor allem FED-Käufe von Staatsanleihen erklären, mit denen die Zinsen am langen Ende gesenkt werden. Käme nun eine nachgewiesene Inflation, müssten quer durch alle Laufzeiten die Zinsen steigen, was eine gigantische Insolvenzwelle der höchstverschuldeten Unternehmen zur Folge hat. Ergo ist Amerika absolut bedingungslos von einer ununterbrochenen Liquiditätsflutung abhängig, die logischerweise nur bei abnehmenden Preisen möglich ist. Amerika ist ein Importland im Güter- und vor allem Kapitalverkehr. Letzterer ist seit einigen Monaten nicht mehr existent und hatte eine unentwegte Dollarentwertung zur Folge. Aufgrund dieser müssen die Amis immer mehr Dollars aufbringen, um einen realen Gegenwert zu erzielen. Sprich die Preise im Einkaufsbereich steigen unentwegt & vor allem immer stärker. Dies wird über kurz oder lang vollautomatisch zu einer Weitergabe an den Verbraucher und damit steigenden Zinsen führen. Das wiederum löst die nächste grosse Insolvenzwelle aus & ruckzuck ist aus dem hohen Angebotsüberhang, eine ordentliche Verknappung geworden. Dies wird dann die mustergültige Grundlage für eine klassische Inflation viel Geld & wenig Waren sein. Zeitraum? Sollte die FED weiter so exzessiv den Markt mit künstlicher Liquidität fluten, u.U. bereits in wenigen Monaten. Realistischer erscheinen jedoch 1-2 Jahre.
ENDE
S. 150 Titel: War´s das schon?
...Um die Aktienrally der vergangenen Wochen als fundamental untermauert einordnen zu können, hätte die kürzlich erreichten Indexhochs - Nasdaq & S&P500 sogar auf Jahreshoch - von neuen Renditehochs an den Bondmärkten bestätigt werden müssen. Nach dem Motto: raus aus Anleihen - rein in Aktien. (Hintergrund: Normalerweise sind Aktien und Anleihen wie die beiden Enden einer Wippe: Wenn die eine unten sind, sind die anderen oben.) Massive Umschichtungen blieben aber aus.
Wer liegt nun falsch? Die Akteuere am Anleihenmarkt oder die am Aktienmarkt?
In der Vergangenheit bewies der Bondmarkt das bessere Gespür für gesamtwirtschaftliche Entwicklungen. (Wahrscheinlich, weil hier die Mehrzahl diplomierte Volkswirtschaftler sind.) So dürfte es auch diesmal sein. Denn dem hohen Abwärtspotential der Anleihenrenditen von 4,1 Prozent der zehnjährigen US-Staatsanleihen im März drohen noch im Sommer auf unter 3 Prozent zu fallen, was eine entsprechende Gefahr für Aktien gegenübersteht.
ENDE
Fortsetzung von S.166 Barron´s Kommentar: Nur einer hat recht
...Eine ähnlich paradoxe Entwicklung ist im Währungsmarkt zu beobachten. Seit Beginn der Baisse ist es den US-Aktien nie gelungen, Boden gutzumachen, während der US-Dollar nachgab. Bis jetzt. Dieses Mal legten die Aktien zu, während der Dollar massiv abrutschte. In den vergangenen drei Jahren bewegten sich die Aktien 90 Prozent der Zeit in die selbe Richtung wie der Greenback.
...Als die Zentralbank vor zu geringer Inflation warnte, hat das einen Run auf Anleihen losgetreten. Die Aktienanleger allerdings zeigten sich überraschend wenig beeindruckt von den Deflationsgefahren (dazu später mehr) für Gewinn- und Umsatzwachstum.
Welcher Markt bewegt sich nun zuerst und sorgt für die Wiederherstellung des Gleichgewichts?
Die Korrektur könnte wohl wieder zulasten der Aktienmärkte gehen. Zahlreiche Wall-Street-Experten sehen keinerlei gerechtfertigten Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Kursgewinne und den wirtschaftlichen Aussichten: "Diese Rally wird von den Fundamentaldaten nicht unterstützt", meint beispielsweise Donald Straszheim von Straszheim Global Advisors. "Sie wird als böse Erfahrung enden, sofern sich die Wirtschaftsdaten nicht verbessern."
ENDE
Hier die Fortsetzung zu der "angeblichen" Deflationsgefahr - dazu Markus Koch auf S. 152 Street Talk, Geschicktes Spiel:
Eine Verschwörungstheorie geht an der New Yorker Wall Street um. Die Notenbank befürchtete entgegen eigener Aussagen gar keine Deflation und habe lediglich einen Geheimpakt mit dem Finanzministerium geschlossen, um die Märkte zu stützen. Alan Greenspan und Finanzminister John Snow spielten sich dabei die Bälle zu.
"Das Risiko einer unerwünscht stark sinkenden Inflation ist, wenn auch minimal größer als das einer aufkommenden Inflation," so Greenspan. Diese eingesetzten Worte hielten die Renditen der Anleihen niedrig, da der Rentenhandel gelähmt auf das bewusst heraufbeschworene Deflationsgespenst starrte. Greenspan hält den Rentenhandel mit seinen Aussagen als künstlich bei Laune und die Renditen im Keller. Deshalb haben zuletzt Renten- und Aktienkurse historisch im ungewohnten Gleichschritt zugelegt.
Finanzminster Snowübt sich derweil in einem Schauspiel anderer Art:
Offiziell wird an der Politik eines starken Dollar zwar festgehalten, tatsächlich aber Interesse an einem schwachen Greenback signalisiert. "Ein schwacher Dollar treibt die Exporte an" (eigene Anmerkung: fragt sich nur welche, wo die Amerikaner wesentlich mehr importieren als exportieren, daher auch das riesige Handelsbilanzdefizit), signalisierte Snow eine Abkehr von der Politik des starken Dollar. Dies trifft den Nagel auf den Kopf, da diese Politik nicht nur im Interesse der Bush-Regierung , sondern auch Greenspan ist. Man hofft durch die währungsbedingte international steigende Wettbewerbsfähigkeit die US-Exporte anzufachen und somit das Ertragswachstum der US-Unternehmen zu stärken, während die Verteuerung der Importe den deflationären Trend zu bekämpfen.
ENDE
Wie´s der Zufall so will: Dazu heute auch Germa´s Thread:
"16.05.03: Das Ammenmärchen der Deflation, welche gar nicht existent ist."
Auszugsweise: "An den Börsen und quer durch alle Analystenhäuser war die drohende Deflation das Hauptschlagwort des Tages, denn mit den absoluten Zahlen der Erzeugerpreise und tags zuvor Importpreise scheinen sich nun alle Prophezeihungen Greenspans zu erfüllen, der in den letzten Tagen permanent vor einer Deflation warnte. Traurig das sich die Welt in solch eine haltlose Illusion treiben lässt, denn das Amerika im Herstellungsbereich nachweislich keine Deflation, sondern eine gewaltige Inflation aufzuweisen hat, dass ist für jeden überprüfbar stich- und hiebfest belegbar! Allan braucht jedoch eine deflationäre Stimmung, denn nur mit dieser lassen sich Aktieninterventionen, Geldmengenausweitung und vor allem FED-Käufe von Staatsanleihen erklären, mit denen die Zinsen am langen Ende gesenkt werden. Käme nun eine nachgewiesene Inflation, müssten quer durch alle Laufzeiten die Zinsen steigen, was eine gigantische Insolvenzwelle der höchstverschuldeten Unternehmen zur Folge hat. Ergo ist Amerika absolut bedingungslos von einer ununterbrochenen Liquiditätsflutung abhängig, die logischerweise nur bei abnehmenden Preisen möglich ist. Amerika ist ein Importland im Güter- und vor allem Kapitalverkehr. Letzterer ist seit einigen Monaten nicht mehr existent und hatte eine unentwegte Dollarentwertung zur Folge. Aufgrund dieser müssen die Amis immer mehr Dollars aufbringen, um einen realen Gegenwert zu erzielen. Sprich die Preise im Einkaufsbereich steigen unentwegt & vor allem immer stärker. Dies wird über kurz oder lang vollautomatisch zu einer Weitergabe an den Verbraucher und damit steigenden Zinsen führen. Das wiederum löst die nächste grosse Insolvenzwelle aus & ruckzuck ist aus dem hohen Angebotsüberhang, eine ordentliche Verknappung geworden. Dies wird dann die mustergültige Grundlage für eine klassische Inflation viel Geld & wenig Waren sein. Zeitraum? Sollte die FED weiter so exzessiv den Markt mit künstlicher Liquidität fluten, u.U. bereits in wenigen Monaten. Realistischer erscheinen jedoch 1-2 Jahre.
ENDE
http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?id=75020&nv=c…
Die Über-Macht
Die Furchen auf der Stirn sind tiefer geworden, das verlegene Grinsen ist verschwunden. Ernst, fast grimmig gab George W. Bush gerade seinen ersten Bericht zur Lage der Nation: »Unsere Nation ist im Krieg, unsere Wirtschaft in der Rezession, und die zivilisierte Welt steht vor nie da gewesenen Gefahren.« Dann machte er eine kleine Pause und schaute triumphierend um sich: »Und dennoch waren wir nie stärker.« Abgeordnete und Minister, die sich zum feierlichen Ritual im Kapitol versammelt hatten, hielt es nicht auf ihren Stühlen. 77-mal, alle 40 Sekunden, unterbrachen sie Bushs Kriegsrede mit stehenden Ovationen.
Wann und wo die US-Armee zum nächsten Schlag ausholen wird, ist nicht sicher. Aber die »Achse des Bösen« - Nordkorea, Iran, Irak - kann sich auf etwas gefasst machen. Wer immer es wagt, hinter dem nächsten Anschlag zu stehen, kann sicher sein - die USA schlagen wie in Afghanistan zurück. Niemand kann es mit der Supermacht aufnehmen.
Der Dollar beherrscht die Finanzmärkte
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind militärisch, wirtschaftlich, technisch und kulturell die Nummer eins. Sie haben das höchste Verteidigungsbudget - es ist größer als das von Russland, Japan, China, England, Deutschland, Indien, Pakistan und Frankreich zusammen. In über 30 Staaten haben sie Militärstützpunkte. Die amerikanische Wirtschaft dominiert die Welt. Die USA stellen nur etwas mehr als vier Prozent der Weltbevölkerung, produzieren aber 30 Prozent aller Güter und Waren. Fünf der zehn größten Firmen der Erde sind US-Konzerne. Der Dollar beherrscht die Finanzmärkte. »Wenn Wall Street hustet, bekommen die europäischen Börsen eine Lungenentzündung«, heißt der Spruch der Broker in Frankfurt und London.
Wissenschaft und Forschung sind auf einem Stand, von dem Europa nur träumen kann. In den vergangenen 50 Jahren ging der Physik-Nobelpreis 66-mal an Amerikaner, in der Medizin 68-mal, in der Chemie 42-mal. Und drei von vier deutschen Nobelpreisträgern der letzten Jahre forschen in den USA. Weniger das Geld macht Amerika so attraktiv - es ist die Freiheit. Hier fehlt jene »Bürokratie, die einem nur Knüppel zwischen die Beine wirft«, sagt der deutsche Stammzellenforscher Rudolf Jaenisch, der am berühmten Whitehead Institute in Cambridge, Massachussetts, lehrt. Nicht einmal horrende Studiengebühren schrecken ab: US-Hochschulen ziehen im Jahr eine halbe Million der besten Studenten aus aller Welt an.
Kulturelle Übermacht USA
Auch die kulturelle Übermacht der USA ist überwältigend. Amerikanische Bücher, Filme und Fernsehserien dominieren die Bestsellerlisten, Kinos und Bildschirme der Welt. 44 der 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten in deutschen Kinos kamen aus Hollywood. Der gleiche Mob, der in den Straßen von Karatschi US-Flaggen verbrannte, »schaut sich abends begeistert Raubkopien von «Rambo» an«, wunderte sich ein Radioreporter in Pakistan.
»Das großartigste Land auf der Welt« (Bush) hat sich seit dem 11. September verändert. An jenem Dienstag ist ein 225 Jahre alter Mythos eingestürzt - der Glaube, unverwundbar zu sein. Bis in das Kabinett von Bush hinein wird seither darum gerungen, welchen Kurs die Supermacht einschlagen soll. Über die anderen Völker herrschen wie einst das Imperium Romanum? Mit dem Rest der Welt kooperieren? Oder sollen sich die Amerikaner zurückziehen und nur noch dann eingreifen, wenn ihre vitalen Interessen berührt sind?
Alle Optionen werden ohne die große Mehrheit der Bevölkerung, wahrscheinlich selbst der Volksvertreter diskutiert. Außenpolitik interessiert die Amerikaner wenig. Welche enormen Folgen »die Modernisierung der Welt unter amerikanischer Führung« hat, so der Historiker Paul Kennedy, darüber denken die Architekten dieser Dominanz selten nach.
»Viel Gutes tun«
Eine Umfrage des Pew Research Center in Washington zeigte jüngst »die riesige Kluft, die zwischen Meinungsführern in den USA und anderen Teilen der Welt existiert«. Nur 18 Prozent der befragten Amerikaner glauben, die US-Politik sei eine der Ursachen der Terroranschläge, doppelt so viele Westeuropäer sind davon überzeugt, 60 Prozent gar in Asien und 76 Prozent in den islamischen Staaten. Eine Mehrheit der Amerikaner ist der Meinung, die USA würden »viel Gutes tun«, das denken rund 20 Prozent in Westeuropa und den islamischen Staaten, in Südamerika, wo der US-Einfluss am stärksten ist, sogar nur zwölf Prozent.
Japan, wo soll das sein?
Kein anderes zivilisiertes Volk lebt so zufrieden in seiner eigenen Welt wie die US-Amerikaner. Nur wenige sprechen eine andere Sprache als ihre eigene. Das Magazin »National Geographic« fand bei einer Umfrage heraus, dass mehr als drei Viertel nicht Japan auf einer Weltkarte finden konnten, 20 Prozent wussten nicht mal, wo ihr eigenes Land liegt. »World Series« heißt das Endspiel der US-Baseball-Meisterschaft, doch da spielen die Tabellenführer der beiden US-Ligen gegeneinander.
»Die Attacken vom 11. September haben klar gemacht, dass wir es nicht länger ignorieren können, was anderswo in der Welt vor sich geht«, klagte das Hochglanz-Magazin »Vanity Fair«. Amerikanische Medien hätten ihre Auslandsberichterstattung »in den vergangenen 15 bis 20 Jahren um 70 bis 80 Prozent gekürzt«. Ihr Argument: Es interessiert sich eh niemand dafür, weil es die Amerikaner nicht betrifft. Der 11. September hat sie schmerzhaft auf Ground Zero zurückgeholt.
»Ich muss da nicht mehr hin«
Aber nicht nur Joe Smith vor seinem Fernseher in Iowa ist schlecht informiert. Der Fraktionschef der Republikaner im Abgeordnetenhaus, der Texaner Dick Armey, brüstete sich vor Jahren: »Ich war einmal in Europa, ich muss da nicht mehr hin.« Er hat sich später korrigiert, als er »entdeckt hat, dass es da draußen eine Welt voller Leute gibt, die sich Sorgen machen, weil wir Amerikaner keine direkte Erfahrung von der Welt außerhalb unserer Grenzen haben«. Viele Abgeordnete sind stolz darauf, keinen Pass zu besitzen.
Das Ausland wird oft erst dann wahrgenommen, wenn dort US-Soldaten kämpfen. Die Berichterstattung des Nachrichtensenders Fox TV trifft offenkundig den Nerv des Publikums. Fox ist das Sprachrohr der Couch-Rambos, es überflügelte an manchen Tagen bereits den Konkurrenten CNN. Wenn sich Fox-Leute aus Afghanistan melden, nennen sie Osama bin Laden nur »Drecksack« oder »Monster«. Als der amerikanische Taliban-Kämpfer John Walker Lindh gefangen genommen wurde, titelte die »New York Post«: »Sieht aus wie eine Ratte, redet wie eine Ratte, riecht wie eine Ratte, versteckt sich wie eine Ratte!« Dann durften die Leser online abstimmen: »Ist Walker ein Verräter?« Ergebnis, logisch: Ab auf den Stuhl.
In den Wochen nach dem 11. September geriet die berühmte Gelassenheit der Amerikaner gelegentlich unter die Räder. Die Abgeordnete Barbara Lee aus Berkeley, Kalifornien, die als Einzige im Repräsentantenhaus gegen Bushs Feldzug gestimmt hatte, brauchte Polizeischutz. In einem Museum in Houston rückte das FBI an, weil ein anonymer Anrufer dort »antiamerikanische Kunst« gesehen haben wollte. Ausgestellt war eine Kohlezeichnung, die Bushs Umweltpolitik kritisierte.
»Verstörender Patriotismus«
»Nichts ist ärgerlicher als dieser verstörende Patriotismus der Amerikaner«, schrieb einer der besten Kenner des Landes, der Franzose Alexis de Tocqueville, vor 160 Jahren. In den Kriegsmonaten nach dem 11. September nahm die Vaterlandsliebe manchmal hysterische Züge an, etwa wenn Bushs Pressesprecher Ari Fleischer die Intellektuellen warnte, sie sollten »aufpassen, was sie sagen, was sie tun«. Die Schriftstellerin Susan Sontag wurde besonders wütend attackiert: »Ich habe vorgeschlagen, dass unsere Außenpolitik überdacht wird. Ist das so verrückt? Ich dachte, wir seien eine streitbare Demokratie, aber es sieht zunehmend so aus, als seien wir unglaublich konformistisch und hätten Angst vor Kritik.«
Welche Strategie die Weltmacht nach den Anschlägen verfolgen soll, ist intern umstritten. Die Rechten, angeführt vom stellvertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, sehen sich durch Afghanistan beflügelt und würden gern auch im Irak zuschlagen. Ob die Alliierten da mitmachen, interessiert sie weniger. Als politischer Denker im Pentagon, noch unter Bushs Vater, hat Wolfowitz vor zehn Jahren eine umstrittene Strategie der Dominanz entworfen. Danach müsse Amerika »alle Versuche entmutigen, dass andere fortgeschrittene Industriestaaten unsere Führung herausfordern oder auch nur eine größere regionale oder globale Rolle spielen«. Seit das Geheimpapier der »New York Times« 1991 zugespielt wurde, facht es die Träume der Neo-Imperialisten an. Ihnen schwebt ein »neues Imperium« vor, das auf einem chaotischen Globus für Ruhe und Ordnung sorgt - nach US-Spielregeln.
Der 11. September habe bewiesen, dass mehr Macht und Einmischung die USA nicht sicherer gemacht hätten, halten die anderen dagegen. Deshalb sei es das Beste, nicht länger Weltpolizist zu spielen. Beispiel Golfregion: Warum sollen die USA dort jedes Jahr über 100 Milliarden Dollar ausgeben, obwohl sie nur ein Viertel ihres Öls aus jener Region beziehen? Sollte man den explosiven Job nicht jenen überlassen, die vom arabischen Öl viel stärker abhingen, nämlich Europa und Japan? Absurd, sagen die Gegner dieser Theorie. Europa sei unfähig, auf dem eigenen Kontinent für Ordnung zu sorgen. Ein Rückzug der USA würde zu noch größerem Chaos führen.
Vor der Wahl hatte Bush versprochen, die USA würden unter seiner Führung »bescheidener auftreten: Wenn wir nicht mehr als hässlicher Amerikaner betrachtet werden wollen, müssen wir aufhören, der ganzen Welt zu sagen: Wir machen es so, und ihr sollt es auch so machen.«
Reihenweise Verträge aufgekündigt
Doch schon ein halbes Jahr später bemängelte die »New York Times«, er habe besondere »Arroganz und Missachtung für internationale Zusammenarbeit« an den Tag gelegt. Reihenweise hat Bush Verträge aufgekündigt, sabotiert oder platzen lassen, weil sie nicht »amerikanischen Interessen« dienten, wie das Kyoto-Abkommen, das den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid verringern soll. Der ABM-Vertrag mit Russland, der die Zahl interkontinentaler Raketen begrenzt, wurde gekündigt, weil er den Aufbau eines US-Raketen-Abwehr-Schildes behindert. Der Atomteststopp-Vertrag ist so gut wie tot, der Anti-Landminen-Vertrag wurde abgelehnt, das Kleinwaffen-Abkommen zu einem seichten Kompromiss heruntergehandelt, weil Bush die spendenfreudige Waffenlobby nicht vergrätzen wollte.
Im vergangenen Dezember, während Washington von Anthrax-Anschlägen terrorisiert wurde, ließ Bush das Biowaffen-Abkommen platzen, weil es zahnlos sei. In Wahrheit wollte die US-Pharmaindustrie nicht von internationalen Inspektoren kontrolliert werden. Die USA lehnen auch den Internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrecher ab, sie wollen nie zulassen, dass Angehörige der US-Streitkräfte vor internationale Richter gestellt werden.
Ton wird gereizter
Die Kritik der Europäer an so viel Selbstherrlichkeit perlte lang an den Amerikanern ab. Neuerdings wird der Ton auf beiden Seiten des Atlantiks gereizter. Als die USA im vergangenen Mai durch eine Intrige ihren Sitz im UN-Menschenrechtsausschuss verloren, schäumte ein Kommentator in der »Washington Post«: »Europas herrschende Klassen werden uns nie verzeihen, dass wir eine Welt geschaffen haben, in der sie über nichts mehr herrschen außer handgemachtem Käse.« Weil Europa jüngst die amerikanischen Pläne kritisierte, Terroristen vor Militärtribunalen abzuurteilen, machte sich das »Wall Street Journal« über die »moralische Aufplusterei« des Alten Kontinents lustig: »Hoffentlich reicht sie aus, Omaha Beach das nächste Mal allein zu erobern.«
Die Amerikaner sind es leid, ausgerechnet von den Europäern für jedes Übel auf der Welt verantwortlich gemacht zu werden. Viele Konflikte haben sie von den Kolonialmächten des Alten Kontinents geerbt. Führen sie den Golfkrieg mit einem Mandat der Vereinten Nationen, so ist es ein Beweis dafür, wie die USA die UN für ihre Ziele manipulieren. Führen sie Krieg ohne UN-Mandat, wie in Afghanistan, ist es ein Beweis für die Missachtung der Weltorganisation. Greifen sie nicht ein, wie in Ruanda, schauen sie dem Völkermord tatenlos zu. Greifen sie ein, wie in Somalia, sind sie die arroganten Weltpolizisten. Und niemand hat in Washington vergessen, wie jämmerlich die Europäer dabei versagt haben, Jugoslawien vor einem Bürgerkrieg zu bewahren.
Globalisierung als Amerikanisierung
Amerika ist mehr denn je überzeugt davon, seine Spielart des Kapitalismus könne die Welt aus der Armut retten. Was sie selbst so wohlhabend gemacht habe - Demokratie, freier Handel und rabiate Konkurrenz - sei auch das Rezept für die anderen. Doch der Rest der Welt empfindet Globalisierung immer mehr als Amerikanisierung, geschaffen nach den Raubritter-Regeln der US-Konzerne.
Der größte Bankrott der US-Geschichte, der Fall des mit der Bush-Regierung eng verbandelten Energie-Giganten Enron, ist ein Beispiel für die Raffgier der Reichen. Die Topangestellten wussten genau, was für ein Schwindel der hohe Aktienkurs ihrer Firma war, und stießen ihre Anteile ab, solange der Kurs himmelhoch war. Die einfachen Angestellten aber durften ihre Firmenanteile erst losschlagen, als sie praktisch wertlos waren. Tausende verloren ihre Alterssicherung. Es dauerte Monate, bis die skandalöse Pleite überhaupt zum Thema wurde, weil Enron so viele Politiker mit Spenden bedacht hatte, dass »es einfacher wäre zu fragen, wer kein Geld von ihnen bekommen hat als umgekehrt«, kommentierte »National Public Radio«. 71 der 100 Senatoren standen auf Enrons Spendenliste.
Es ist ein amerikanisches Paradox: Immer wieder untergräbt das selbst ernannte Musterland genau jene Werte, für die es gern mit Feuer und Schwert eintritt. In welchem anderen demokratischen Land hätte ein Mann Präsident werden können, der eine halbe Million Stimmen weniger hatte als sein Konkurrent - und die auch noch ausgezählt wie in einer Bananenrepublik? Ist das ein Modell für die Welt, Terroristen vor Militärtribunale zu stellen, in denen ihnen Grundrechte verweigert werden, die jedem anderen Massenmörder zugestanden werden? Das »Anwaltskomitee für Menschenrechte« in Washington fragte: »Wenn Länder wie Peru, Ägypten und Kolumbien so etwas machen, protestiert unser Außenministerium. Was sagen wir denen in Zukunft?«
Hauchdünne Schicht der Topverdiener
Ist die amerikanische Einkommensverteilung ein Vorbild? In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Kluft zwischen den Reichsten und dem Rest der Bevölkerung stetig größer geworden, mehr als in jeder anderen Industrienation. Fast die Hälfte des enormen Einkommenszuwachses ging an die hauchdünne Schicht der Topverdiener - ein Prozent der Arbeitnehmer. Den armen Ländern haben die USA »nie da gewesenen Wohlstand« versprochen, falls sie nach ihrer neoliberalen Pfeife tanzten, »aber das Versprechen wurde nicht eingelöst, die Länder bekamen nie da gewesene Armut«, schrieb der Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz.
Den Drang nach Rendite haben die Amerikaner stets gern mit missionarischem Eifer verbunden. Während Europa seit dem Zweiten Weltkrieg weltlicher geworden ist, spielt Religion in der US-Politik eine immer wichtigere Rolle. Die Republikanische Partei wird von ihrem fundamentalistischen Flügel dominiert. »Der neue Führer der religiösen Rechten in Amerika heißt George W. Bush«, kommentierte jüngst die »Washington Post.« Mit dem Furor eines Spätbekehrten (Bush besiegte mit 40 Jahren seinen Alkoholismus mit Hilfe des TV-Predigers Billy Graham), treibt er nun Weltpolitik mit der Bibel in der Hand.
»Das einzig religiöse, erleuchtete und freie Volk«
Der Hang zu Frömmelei und Patriotismus sei »nicht wirklich neu«, schrieb die »New York Times«, »wir sind eine Nation, die sich selbst geschaffen hat und ihr Meisterwerk mit Hingabe verteidigt. Amerikaner ist man nicht seines Blutes wegen oder seiner Herkunft.« Einer der besten Kenner der USA drückte es so aus: »Den Bewohnern der Vereinigten Staaten wird immer wieder und dauernd gesagt, sie seien das einzig religiöse, erleuchtete und freie Volk. Sie haben eine immens hohe Meinung von sich selbst und sind nicht weit davon entfernt zu glauben, dass sie eine Spezies außerhalb der menschlichen Rasse bilden.« So Tocqueville 50 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Es gilt noch immer.
Claus Lutterbeck / Mitarbeit: Michael Streck
--------
Jede "Supermacht" ist untergegangen.
Das gute an der momentanen ist, das sie die dümmste ist!
Die Über-Macht
Die Furchen auf der Stirn sind tiefer geworden, das verlegene Grinsen ist verschwunden. Ernst, fast grimmig gab George W. Bush gerade seinen ersten Bericht zur Lage der Nation: »Unsere Nation ist im Krieg, unsere Wirtschaft in der Rezession, und die zivilisierte Welt steht vor nie da gewesenen Gefahren.« Dann machte er eine kleine Pause und schaute triumphierend um sich: »Und dennoch waren wir nie stärker.« Abgeordnete und Minister, die sich zum feierlichen Ritual im Kapitol versammelt hatten, hielt es nicht auf ihren Stühlen. 77-mal, alle 40 Sekunden, unterbrachen sie Bushs Kriegsrede mit stehenden Ovationen.
Wann und wo die US-Armee zum nächsten Schlag ausholen wird, ist nicht sicher. Aber die »Achse des Bösen« - Nordkorea, Iran, Irak - kann sich auf etwas gefasst machen. Wer immer es wagt, hinter dem nächsten Anschlag zu stehen, kann sicher sein - die USA schlagen wie in Afghanistan zurück. Niemand kann es mit der Supermacht aufnehmen.
Der Dollar beherrscht die Finanzmärkte
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind militärisch, wirtschaftlich, technisch und kulturell die Nummer eins. Sie haben das höchste Verteidigungsbudget - es ist größer als das von Russland, Japan, China, England, Deutschland, Indien, Pakistan und Frankreich zusammen. In über 30 Staaten haben sie Militärstützpunkte. Die amerikanische Wirtschaft dominiert die Welt. Die USA stellen nur etwas mehr als vier Prozent der Weltbevölkerung, produzieren aber 30 Prozent aller Güter und Waren. Fünf der zehn größten Firmen der Erde sind US-Konzerne. Der Dollar beherrscht die Finanzmärkte. »Wenn Wall Street hustet, bekommen die europäischen Börsen eine Lungenentzündung«, heißt der Spruch der Broker in Frankfurt und London.
Wissenschaft und Forschung sind auf einem Stand, von dem Europa nur träumen kann. In den vergangenen 50 Jahren ging der Physik-Nobelpreis 66-mal an Amerikaner, in der Medizin 68-mal, in der Chemie 42-mal. Und drei von vier deutschen Nobelpreisträgern der letzten Jahre forschen in den USA. Weniger das Geld macht Amerika so attraktiv - es ist die Freiheit. Hier fehlt jene »Bürokratie, die einem nur Knüppel zwischen die Beine wirft«, sagt der deutsche Stammzellenforscher Rudolf Jaenisch, der am berühmten Whitehead Institute in Cambridge, Massachussetts, lehrt. Nicht einmal horrende Studiengebühren schrecken ab: US-Hochschulen ziehen im Jahr eine halbe Million der besten Studenten aus aller Welt an.
Kulturelle Übermacht USA
Auch die kulturelle Übermacht der USA ist überwältigend. Amerikanische Bücher, Filme und Fernsehserien dominieren die Bestsellerlisten, Kinos und Bildschirme der Welt. 44 der 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten in deutschen Kinos kamen aus Hollywood. Der gleiche Mob, der in den Straßen von Karatschi US-Flaggen verbrannte, »schaut sich abends begeistert Raubkopien von «Rambo» an«, wunderte sich ein Radioreporter in Pakistan.
»Das großartigste Land auf der Welt« (Bush) hat sich seit dem 11. September verändert. An jenem Dienstag ist ein 225 Jahre alter Mythos eingestürzt - der Glaube, unverwundbar zu sein. Bis in das Kabinett von Bush hinein wird seither darum gerungen, welchen Kurs die Supermacht einschlagen soll. Über die anderen Völker herrschen wie einst das Imperium Romanum? Mit dem Rest der Welt kooperieren? Oder sollen sich die Amerikaner zurückziehen und nur noch dann eingreifen, wenn ihre vitalen Interessen berührt sind?
Alle Optionen werden ohne die große Mehrheit der Bevölkerung, wahrscheinlich selbst der Volksvertreter diskutiert. Außenpolitik interessiert die Amerikaner wenig. Welche enormen Folgen »die Modernisierung der Welt unter amerikanischer Führung« hat, so der Historiker Paul Kennedy, darüber denken die Architekten dieser Dominanz selten nach.
»Viel Gutes tun«
Eine Umfrage des Pew Research Center in Washington zeigte jüngst »die riesige Kluft, die zwischen Meinungsführern in den USA und anderen Teilen der Welt existiert«. Nur 18 Prozent der befragten Amerikaner glauben, die US-Politik sei eine der Ursachen der Terroranschläge, doppelt so viele Westeuropäer sind davon überzeugt, 60 Prozent gar in Asien und 76 Prozent in den islamischen Staaten. Eine Mehrheit der Amerikaner ist der Meinung, die USA würden »viel Gutes tun«, das denken rund 20 Prozent in Westeuropa und den islamischen Staaten, in Südamerika, wo der US-Einfluss am stärksten ist, sogar nur zwölf Prozent.
Japan, wo soll das sein?
Kein anderes zivilisiertes Volk lebt so zufrieden in seiner eigenen Welt wie die US-Amerikaner. Nur wenige sprechen eine andere Sprache als ihre eigene. Das Magazin »National Geographic« fand bei einer Umfrage heraus, dass mehr als drei Viertel nicht Japan auf einer Weltkarte finden konnten, 20 Prozent wussten nicht mal, wo ihr eigenes Land liegt. »World Series« heißt das Endspiel der US-Baseball-Meisterschaft, doch da spielen die Tabellenführer der beiden US-Ligen gegeneinander.
»Die Attacken vom 11. September haben klar gemacht, dass wir es nicht länger ignorieren können, was anderswo in der Welt vor sich geht«, klagte das Hochglanz-Magazin »Vanity Fair«. Amerikanische Medien hätten ihre Auslandsberichterstattung »in den vergangenen 15 bis 20 Jahren um 70 bis 80 Prozent gekürzt«. Ihr Argument: Es interessiert sich eh niemand dafür, weil es die Amerikaner nicht betrifft. Der 11. September hat sie schmerzhaft auf Ground Zero zurückgeholt.
»Ich muss da nicht mehr hin«
Aber nicht nur Joe Smith vor seinem Fernseher in Iowa ist schlecht informiert. Der Fraktionschef der Republikaner im Abgeordnetenhaus, der Texaner Dick Armey, brüstete sich vor Jahren: »Ich war einmal in Europa, ich muss da nicht mehr hin.« Er hat sich später korrigiert, als er »entdeckt hat, dass es da draußen eine Welt voller Leute gibt, die sich Sorgen machen, weil wir Amerikaner keine direkte Erfahrung von der Welt außerhalb unserer Grenzen haben«. Viele Abgeordnete sind stolz darauf, keinen Pass zu besitzen.
Das Ausland wird oft erst dann wahrgenommen, wenn dort US-Soldaten kämpfen. Die Berichterstattung des Nachrichtensenders Fox TV trifft offenkundig den Nerv des Publikums. Fox ist das Sprachrohr der Couch-Rambos, es überflügelte an manchen Tagen bereits den Konkurrenten CNN. Wenn sich Fox-Leute aus Afghanistan melden, nennen sie Osama bin Laden nur »Drecksack« oder »Monster«. Als der amerikanische Taliban-Kämpfer John Walker Lindh gefangen genommen wurde, titelte die »New York Post«: »Sieht aus wie eine Ratte, redet wie eine Ratte, riecht wie eine Ratte, versteckt sich wie eine Ratte!« Dann durften die Leser online abstimmen: »Ist Walker ein Verräter?« Ergebnis, logisch: Ab auf den Stuhl.
In den Wochen nach dem 11. September geriet die berühmte Gelassenheit der Amerikaner gelegentlich unter die Räder. Die Abgeordnete Barbara Lee aus Berkeley, Kalifornien, die als Einzige im Repräsentantenhaus gegen Bushs Feldzug gestimmt hatte, brauchte Polizeischutz. In einem Museum in Houston rückte das FBI an, weil ein anonymer Anrufer dort »antiamerikanische Kunst« gesehen haben wollte. Ausgestellt war eine Kohlezeichnung, die Bushs Umweltpolitik kritisierte.
»Verstörender Patriotismus«
»Nichts ist ärgerlicher als dieser verstörende Patriotismus der Amerikaner«, schrieb einer der besten Kenner des Landes, der Franzose Alexis de Tocqueville, vor 160 Jahren. In den Kriegsmonaten nach dem 11. September nahm die Vaterlandsliebe manchmal hysterische Züge an, etwa wenn Bushs Pressesprecher Ari Fleischer die Intellektuellen warnte, sie sollten »aufpassen, was sie sagen, was sie tun«. Die Schriftstellerin Susan Sontag wurde besonders wütend attackiert: »Ich habe vorgeschlagen, dass unsere Außenpolitik überdacht wird. Ist das so verrückt? Ich dachte, wir seien eine streitbare Demokratie, aber es sieht zunehmend so aus, als seien wir unglaublich konformistisch und hätten Angst vor Kritik.«
Welche Strategie die Weltmacht nach den Anschlägen verfolgen soll, ist intern umstritten. Die Rechten, angeführt vom stellvertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, sehen sich durch Afghanistan beflügelt und würden gern auch im Irak zuschlagen. Ob die Alliierten da mitmachen, interessiert sie weniger. Als politischer Denker im Pentagon, noch unter Bushs Vater, hat Wolfowitz vor zehn Jahren eine umstrittene Strategie der Dominanz entworfen. Danach müsse Amerika »alle Versuche entmutigen, dass andere fortgeschrittene Industriestaaten unsere Führung herausfordern oder auch nur eine größere regionale oder globale Rolle spielen«. Seit das Geheimpapier der »New York Times« 1991 zugespielt wurde, facht es die Träume der Neo-Imperialisten an. Ihnen schwebt ein »neues Imperium« vor, das auf einem chaotischen Globus für Ruhe und Ordnung sorgt - nach US-Spielregeln.
Der 11. September habe bewiesen, dass mehr Macht und Einmischung die USA nicht sicherer gemacht hätten, halten die anderen dagegen. Deshalb sei es das Beste, nicht länger Weltpolizist zu spielen. Beispiel Golfregion: Warum sollen die USA dort jedes Jahr über 100 Milliarden Dollar ausgeben, obwohl sie nur ein Viertel ihres Öls aus jener Region beziehen? Sollte man den explosiven Job nicht jenen überlassen, die vom arabischen Öl viel stärker abhingen, nämlich Europa und Japan? Absurd, sagen die Gegner dieser Theorie. Europa sei unfähig, auf dem eigenen Kontinent für Ordnung zu sorgen. Ein Rückzug der USA würde zu noch größerem Chaos führen.
Vor der Wahl hatte Bush versprochen, die USA würden unter seiner Führung »bescheidener auftreten: Wenn wir nicht mehr als hässlicher Amerikaner betrachtet werden wollen, müssen wir aufhören, der ganzen Welt zu sagen: Wir machen es so, und ihr sollt es auch so machen.«
Reihenweise Verträge aufgekündigt
Doch schon ein halbes Jahr später bemängelte die »New York Times«, er habe besondere »Arroganz und Missachtung für internationale Zusammenarbeit« an den Tag gelegt. Reihenweise hat Bush Verträge aufgekündigt, sabotiert oder platzen lassen, weil sie nicht »amerikanischen Interessen« dienten, wie das Kyoto-Abkommen, das den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid verringern soll. Der ABM-Vertrag mit Russland, der die Zahl interkontinentaler Raketen begrenzt, wurde gekündigt, weil er den Aufbau eines US-Raketen-Abwehr-Schildes behindert. Der Atomteststopp-Vertrag ist so gut wie tot, der Anti-Landminen-Vertrag wurde abgelehnt, das Kleinwaffen-Abkommen zu einem seichten Kompromiss heruntergehandelt, weil Bush die spendenfreudige Waffenlobby nicht vergrätzen wollte.
Im vergangenen Dezember, während Washington von Anthrax-Anschlägen terrorisiert wurde, ließ Bush das Biowaffen-Abkommen platzen, weil es zahnlos sei. In Wahrheit wollte die US-Pharmaindustrie nicht von internationalen Inspektoren kontrolliert werden. Die USA lehnen auch den Internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrecher ab, sie wollen nie zulassen, dass Angehörige der US-Streitkräfte vor internationale Richter gestellt werden.
Ton wird gereizter
Die Kritik der Europäer an so viel Selbstherrlichkeit perlte lang an den Amerikanern ab. Neuerdings wird der Ton auf beiden Seiten des Atlantiks gereizter. Als die USA im vergangenen Mai durch eine Intrige ihren Sitz im UN-Menschenrechtsausschuss verloren, schäumte ein Kommentator in der »Washington Post«: »Europas herrschende Klassen werden uns nie verzeihen, dass wir eine Welt geschaffen haben, in der sie über nichts mehr herrschen außer handgemachtem Käse.« Weil Europa jüngst die amerikanischen Pläne kritisierte, Terroristen vor Militärtribunalen abzuurteilen, machte sich das »Wall Street Journal« über die »moralische Aufplusterei« des Alten Kontinents lustig: »Hoffentlich reicht sie aus, Omaha Beach das nächste Mal allein zu erobern.«
Die Amerikaner sind es leid, ausgerechnet von den Europäern für jedes Übel auf der Welt verantwortlich gemacht zu werden. Viele Konflikte haben sie von den Kolonialmächten des Alten Kontinents geerbt. Führen sie den Golfkrieg mit einem Mandat der Vereinten Nationen, so ist es ein Beweis dafür, wie die USA die UN für ihre Ziele manipulieren. Führen sie Krieg ohne UN-Mandat, wie in Afghanistan, ist es ein Beweis für die Missachtung der Weltorganisation. Greifen sie nicht ein, wie in Ruanda, schauen sie dem Völkermord tatenlos zu. Greifen sie ein, wie in Somalia, sind sie die arroganten Weltpolizisten. Und niemand hat in Washington vergessen, wie jämmerlich die Europäer dabei versagt haben, Jugoslawien vor einem Bürgerkrieg zu bewahren.
Globalisierung als Amerikanisierung
Amerika ist mehr denn je überzeugt davon, seine Spielart des Kapitalismus könne die Welt aus der Armut retten. Was sie selbst so wohlhabend gemacht habe - Demokratie, freier Handel und rabiate Konkurrenz - sei auch das Rezept für die anderen. Doch der Rest der Welt empfindet Globalisierung immer mehr als Amerikanisierung, geschaffen nach den Raubritter-Regeln der US-Konzerne.
Der größte Bankrott der US-Geschichte, der Fall des mit der Bush-Regierung eng verbandelten Energie-Giganten Enron, ist ein Beispiel für die Raffgier der Reichen. Die Topangestellten wussten genau, was für ein Schwindel der hohe Aktienkurs ihrer Firma war, und stießen ihre Anteile ab, solange der Kurs himmelhoch war. Die einfachen Angestellten aber durften ihre Firmenanteile erst losschlagen, als sie praktisch wertlos waren. Tausende verloren ihre Alterssicherung. Es dauerte Monate, bis die skandalöse Pleite überhaupt zum Thema wurde, weil Enron so viele Politiker mit Spenden bedacht hatte, dass »es einfacher wäre zu fragen, wer kein Geld von ihnen bekommen hat als umgekehrt«, kommentierte »National Public Radio«. 71 der 100 Senatoren standen auf Enrons Spendenliste.
Es ist ein amerikanisches Paradox: Immer wieder untergräbt das selbst ernannte Musterland genau jene Werte, für die es gern mit Feuer und Schwert eintritt. In welchem anderen demokratischen Land hätte ein Mann Präsident werden können, der eine halbe Million Stimmen weniger hatte als sein Konkurrent - und die auch noch ausgezählt wie in einer Bananenrepublik? Ist das ein Modell für die Welt, Terroristen vor Militärtribunale zu stellen, in denen ihnen Grundrechte verweigert werden, die jedem anderen Massenmörder zugestanden werden? Das »Anwaltskomitee für Menschenrechte« in Washington fragte: »Wenn Länder wie Peru, Ägypten und Kolumbien so etwas machen, protestiert unser Außenministerium. Was sagen wir denen in Zukunft?«
Hauchdünne Schicht der Topverdiener
Ist die amerikanische Einkommensverteilung ein Vorbild? In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Kluft zwischen den Reichsten und dem Rest der Bevölkerung stetig größer geworden, mehr als in jeder anderen Industrienation. Fast die Hälfte des enormen Einkommenszuwachses ging an die hauchdünne Schicht der Topverdiener - ein Prozent der Arbeitnehmer. Den armen Ländern haben die USA »nie da gewesenen Wohlstand« versprochen, falls sie nach ihrer neoliberalen Pfeife tanzten, »aber das Versprechen wurde nicht eingelöst, die Länder bekamen nie da gewesene Armut«, schrieb der Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz.
Den Drang nach Rendite haben die Amerikaner stets gern mit missionarischem Eifer verbunden. Während Europa seit dem Zweiten Weltkrieg weltlicher geworden ist, spielt Religion in der US-Politik eine immer wichtigere Rolle. Die Republikanische Partei wird von ihrem fundamentalistischen Flügel dominiert. »Der neue Führer der religiösen Rechten in Amerika heißt George W. Bush«, kommentierte jüngst die »Washington Post.« Mit dem Furor eines Spätbekehrten (Bush besiegte mit 40 Jahren seinen Alkoholismus mit Hilfe des TV-Predigers Billy Graham), treibt er nun Weltpolitik mit der Bibel in der Hand.
»Das einzig religiöse, erleuchtete und freie Volk«
Der Hang zu Frömmelei und Patriotismus sei »nicht wirklich neu«, schrieb die »New York Times«, »wir sind eine Nation, die sich selbst geschaffen hat und ihr Meisterwerk mit Hingabe verteidigt. Amerikaner ist man nicht seines Blutes wegen oder seiner Herkunft.« Einer der besten Kenner der USA drückte es so aus: »Den Bewohnern der Vereinigten Staaten wird immer wieder und dauernd gesagt, sie seien das einzig religiöse, erleuchtete und freie Volk. Sie haben eine immens hohe Meinung von sich selbst und sind nicht weit davon entfernt zu glauben, dass sie eine Spezies außerhalb der menschlichen Rasse bilden.« So Tocqueville 50 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung. Es gilt noch immer.
Claus Lutterbeck / Mitarbeit: Michael Streck
--------
Jede "Supermacht" ist untergegangen.
Das gute an der momentanen ist, das sie die dümmste ist!
15.05. 17:17
US: Zahl der Insolvenzen auf Rekordhoch
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Das Administrative Office for the U.S. Courts teilt mit, dass die Zahl der Insolvenzen auf privater und auf Unternehmerseite in den 12 Monaten zum 31. März 2003 auf eine Rekordzahl angestiegen sind. Die Zahl der Insolvenzen stieg auf 1.61 Millionen, von 1.5 Millionen im Vorjahr. Die Zahl der Insolvenzen im ersten Quartal lag bei 412,968, ein sequentieller (Quartal-zu-Quartal) Anstieg um 4.5%.
US: Zahl der Insolvenzen auf Rekordhoch
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Das Administrative Office for the U.S. Courts teilt mit, dass die Zahl der Insolvenzen auf privater und auf Unternehmerseite in den 12 Monaten zum 31. März 2003 auf eine Rekordzahl angestiegen sind. Die Zahl der Insolvenzen stieg auf 1.61 Millionen, von 1.5 Millionen im Vorjahr. Die Zahl der Insolvenzen im ersten Quartal lag bei 412,968, ein sequentieller (Quartal-zu-Quartal) Anstieg um 4.5%.
Wissenschaft und Forschung sind auf einem Stand, von dem Europa nur träumen kann.
In den vergangenen 50 Jahren ging der Physik-Nobelpreis 66-mal an Amerikaner, in der Medizin 68-mal, in der Chemie 42-mal.
Und drei von vier deutschen Nobelpreisträgern der letzten Jahre forschen in den USA.
Wirklich strohdumm - diese Amis.
In den vergangenen 50 Jahren ging der Physik-Nobelpreis 66-mal an Amerikaner, in der Medizin 68-mal, in der Chemie 42-mal.
Und drei von vier deutschen Nobelpreisträgern der letzten Jahre forschen in den USA.
Wirklich strohdumm - diese Amis.
#227,
ja,und jede zweite Olympiade geht auch nach Amerika. Dazu holen die US-Atlethen immer die meisten Medaillen.....
ja,und jede zweite Olympiade geht auch nach Amerika. Dazu holen die US-Atlethen immer die meisten Medaillen.....
über 100 amerikanische athleten waren über jahre hinweg gedopt.
die meldung kam vor einiger zeit.
carl lewis als prominentestes beispiel

passiert ist bis heute eigentlich garnichts
typisch für eine lächerliche "supermacht"
hebelt geltendes recht aus!
wird sich alles rächen
die meldung kam vor einiger zeit.
carl lewis als prominentestes beispiel

passiert ist bis heute eigentlich garnichts

typisch für eine lächerliche "supermacht"
hebelt geltendes recht aus!
wird sich alles rächen

http://www.heise.de/tp/deutsch/html/result.xhtml?url=/tp/deu…
Mehr Geheimhaltung
Florian Rötzer 26.03.2003
Eine neue Anordnung von US-Präsident Bush verzögert und erschwert die automatische Freigabe von Dokumenten, die von der Clinton-Regierung vorgesehen wurde.
Die 90er Jahre nach Desert Storm und der darauf folgenden Wahlniederlage der konservativen Bush-Regierung waren auch die Epoche des Internet. Die Visionen der globalen und freien Informations- und Kommunikationsflüsse ließen Hoffnungen auf größere Transparenz durch möglichst uneingeschränkten Zugang zur Information entstehen. Die Clinton-Regierung ging einige wesentliche Schritte in diese Richtung und hat etwa den Freedom for Information Act (FOIA), der den Zugang zu staatlichen Dokumenten regelt, noch einmal erweitert. Die Bush-Regierung setzt wieder mehr auf Geheimnis und nimmt nun die von Clinton angeordnete automatische Freigabe geheimer Dokumente, die älter als 25 Jahre sind, teilweise zurück.
Schon kurz nach dem 11.9. 2001 und dem ausgerufenen Krieg gegen den Terrorismus sah man in der Bush-Regierung die Chance oder die Notwendigkeit, die der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen - vor allem auch im Internet - einzuschränken. Innenminister Ashcroft ordnete in einem Memo alle Behörden an, FOIA-Anträge, die möglicherweise sensible Informationen betreffen, hinauszuzögern. Die Webseiten der Behörden und Ministerien wurden überprüft.
Präsident Bush erließ im November 2001 eine Anordnung, die es ihm und den früheren Präsidenten bzw. Vizepräsidenten erlaubt, an sich nach dem Ablauf von 12 Jahren zur Freigabe vorgesehene Dokumente weiterhin für die Veröffentlichung zu sperren ( Verdächtige Geheimniskrämerei). Insbesondere ermöglicht die Anordnung dem im Amt befindlichen Präsidenten auch dann Dokumente eines früheren Präsidenten oder Vizepräsidenten zurückzuhalten, wenn dieser selbst nichts gegen eine Veröffentlichung einzuwenden hat. Grund dieser Anordnung waren Dokumente aus der Präsidentschaft Ronald Reagans.
Gestern hat Präsident Bush eine weitere Anordnung unterzeichnet, die eine Freigabe von zahlreichen Dokumenten um drei Jahre verzögert, um sie erneut zu überprüfen. Sie ermöglicht es aber auch, bereits freigegebene Dokumente erneut als geheim einzustufen. Damit nahm Bush eine Anordnung von Clinton aus dem Jahr 1995 teilweise zurück, nach der automatisch am 17 April Millionen von als geheim eingestuften Dokumente,n die die nationale Sicherheit betreffen und älter als 25 Jahre sind, freigegeben werden sollen, wenn nicht schwerwiegende Bedenken dagegen vorliegen.
In der Anordnung von Clinton wird zwar betont, dass manche Dokumente geheim bleiben müssen, aber dass unter den gegenwärtigen politischen Umständen nun die Zeit einer größeren Offenheit gekommen sei. Die Demokratie erfordere, dass die Bürger auf staatliche Informationen zugreifen dürfen: "Der Fortschritt unserer Nation hängt vom freien Informationsfluss ab." In der nun von Bush überarbeiteten Version wird denn auch gleich die neue Haltung deutlich. Die meisten Formulierungen werden zwar weitgehend übernommen, doch am Schluss steht nicht mehr die "Verpflichtung zu einer offenen Regierung", sondern der Satz: "Der Schutz von Informationen, die für unsere Nation wichtig sind, ist eine Priorität."
Als geheim klassifiziert werden können Dokumente, die militärische Pläne oder Waffen, Geheimdienstaktivitäten- oder -methoden, außenpolitische Informationen, wissenschaftliche, technische oder ökonomische Dinge sowie Verletzlichkeiten oder Kapazitäten von Systemen, Plänen etc., die mit der nationalen Sicherheit zusammen hängen, oder die Massenvernichtungswaffen betreffen. Der CIA werden überdies besondere Möglichkeiten gewährt, Dokumente nicht veröffentlichen zu müssen. Thomas Blanton vom National Security Archive kritisiert insbesondere die Klassifizierung von Informationen, die von anderen Regierungen kommen. Das würde "uns auf die Offenheitsnormen von Usbekistan herunterbringen".
In der Anordnung werden zwar Vorkehrungen von Clinton übernommen, dass beispielsweise keine Dokumente als geheim eingestuft werden dürfen, um eine Gesetzesübertretung oder Irrtümer von Behörden zu vertuschen. Gleichwohl ist die Streichung des zentralen Satzes von Clinton ein Hinweis, dass es um Rücknahme von Offenheit geht: "Wenn es einen wichtigen Zweifel an der Notwendigkeit gibt, Informationen geheim zu halten, dann sollen diese nicht klassifiziert werden." Clinton hatte mit diesem Satz eine Anordnung von Reagan verändert, der bei Zweifel eine Geheimhaltung forderte. In diese Richtung geht nun auch wieder US-Präsident Bush, selbst wenn die automatische Freigabe mit den erwähnten Einschränkungen beibehalten, aber erst einmal auf 2006 verschoben wird, um die Dokumente zu überprüfen.
Mehr Geheimhaltung
Florian Rötzer 26.03.2003
Eine neue Anordnung von US-Präsident Bush verzögert und erschwert die automatische Freigabe von Dokumenten, die von der Clinton-Regierung vorgesehen wurde.
Die 90er Jahre nach Desert Storm und der darauf folgenden Wahlniederlage der konservativen Bush-Regierung waren auch die Epoche des Internet. Die Visionen der globalen und freien Informations- und Kommunikationsflüsse ließen Hoffnungen auf größere Transparenz durch möglichst uneingeschränkten Zugang zur Information entstehen. Die Clinton-Regierung ging einige wesentliche Schritte in diese Richtung und hat etwa den Freedom for Information Act (FOIA), der den Zugang zu staatlichen Dokumenten regelt, noch einmal erweitert. Die Bush-Regierung setzt wieder mehr auf Geheimnis und nimmt nun die von Clinton angeordnete automatische Freigabe geheimer Dokumente, die älter als 25 Jahre sind, teilweise zurück.
Schon kurz nach dem 11.9. 2001 und dem ausgerufenen Krieg gegen den Terrorismus sah man in der Bush-Regierung die Chance oder die Notwendigkeit, die der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen - vor allem auch im Internet - einzuschränken. Innenminister Ashcroft ordnete in einem Memo alle Behörden an, FOIA-Anträge, die möglicherweise sensible Informationen betreffen, hinauszuzögern. Die Webseiten der Behörden und Ministerien wurden überprüft.
Präsident Bush erließ im November 2001 eine Anordnung, die es ihm und den früheren Präsidenten bzw. Vizepräsidenten erlaubt, an sich nach dem Ablauf von 12 Jahren zur Freigabe vorgesehene Dokumente weiterhin für die Veröffentlichung zu sperren ( Verdächtige Geheimniskrämerei). Insbesondere ermöglicht die Anordnung dem im Amt befindlichen Präsidenten auch dann Dokumente eines früheren Präsidenten oder Vizepräsidenten zurückzuhalten, wenn dieser selbst nichts gegen eine Veröffentlichung einzuwenden hat. Grund dieser Anordnung waren Dokumente aus der Präsidentschaft Ronald Reagans.
Gestern hat Präsident Bush eine weitere Anordnung unterzeichnet, die eine Freigabe von zahlreichen Dokumenten um drei Jahre verzögert, um sie erneut zu überprüfen. Sie ermöglicht es aber auch, bereits freigegebene Dokumente erneut als geheim einzustufen. Damit nahm Bush eine Anordnung von Clinton aus dem Jahr 1995 teilweise zurück, nach der automatisch am 17 April Millionen von als geheim eingestuften Dokumente,n die die nationale Sicherheit betreffen und älter als 25 Jahre sind, freigegeben werden sollen, wenn nicht schwerwiegende Bedenken dagegen vorliegen.
In der Anordnung von Clinton wird zwar betont, dass manche Dokumente geheim bleiben müssen, aber dass unter den gegenwärtigen politischen Umständen nun die Zeit einer größeren Offenheit gekommen sei. Die Demokratie erfordere, dass die Bürger auf staatliche Informationen zugreifen dürfen: "Der Fortschritt unserer Nation hängt vom freien Informationsfluss ab." In der nun von Bush überarbeiteten Version wird denn auch gleich die neue Haltung deutlich. Die meisten Formulierungen werden zwar weitgehend übernommen, doch am Schluss steht nicht mehr die "Verpflichtung zu einer offenen Regierung", sondern der Satz: "Der Schutz von Informationen, die für unsere Nation wichtig sind, ist eine Priorität."
Als geheim klassifiziert werden können Dokumente, die militärische Pläne oder Waffen, Geheimdienstaktivitäten- oder -methoden, außenpolitische Informationen, wissenschaftliche, technische oder ökonomische Dinge sowie Verletzlichkeiten oder Kapazitäten von Systemen, Plänen etc., die mit der nationalen Sicherheit zusammen hängen, oder die Massenvernichtungswaffen betreffen. Der CIA werden überdies besondere Möglichkeiten gewährt, Dokumente nicht veröffentlichen zu müssen. Thomas Blanton vom National Security Archive kritisiert insbesondere die Klassifizierung von Informationen, die von anderen Regierungen kommen. Das würde "uns auf die Offenheitsnormen von Usbekistan herunterbringen".
In der Anordnung werden zwar Vorkehrungen von Clinton übernommen, dass beispielsweise keine Dokumente als geheim eingestuft werden dürfen, um eine Gesetzesübertretung oder Irrtümer von Behörden zu vertuschen. Gleichwohl ist die Streichung des zentralen Satzes von Clinton ein Hinweis, dass es um Rücknahme von Offenheit geht: "Wenn es einen wichtigen Zweifel an der Notwendigkeit gibt, Informationen geheim zu halten, dann sollen diese nicht klassifiziert werden." Clinton hatte mit diesem Satz eine Anordnung von Reagan verändert, der bei Zweifel eine Geheimhaltung forderte. In diese Richtung geht nun auch wieder US-Präsident Bush, selbst wenn die automatische Freigabe mit den erwähnten Einschränkungen beibehalten, aber erst einmal auf 2006 verschoben wird, um die Dokumente zu überprüfen.
@dolby digital ist wohl fürs Wohnzimmer und whistleblower für die Küche ? Ääh?
Ich dachte nur alte Leute reden mit sich selbst.
J2
Ich dachte nur alte Leute reden mit sich selbst.
J2
nur studierte verstehen nicht den sinn und zweck von archiv-threads 
steigt über den horizont drüber naus

steigt über den horizont drüber naus

http://www.heise.de/tp/deutsch/html/result.xhtml?url=/tp/deu…
NSA macht die Luken dicht
Dirk Eckert 12.05.2003
Die US-Regierung schätzt die Transparenz nicht allzusehr und will nun auch den Geheimdienst NSA weitgehend vom Informationsfreiheitsgesetz ausnehmen
In den USA hat jeder Bürger im Rahmen des "Freedom of Information Act" ( FOIA) ein Recht auf Einsicht in die Akten der Regierung. Doch zahlreiche Dokumente des Geheimdienstes "National Security Agency" (NSA) sollen jetzt vom "Freedom of Information Act" ausgenommen werden. Bürgerrechtsgruppen haben den Gesetzentwurf an die Öffentlichkeit gebracht, der gerade im Kongress beraten wird. Sie bemängeln, dass bisher nicht einmal öffentliche Anhörungen abgehalten wurden.
Das entsprechende Gesetz, der "FY 2004 Defense Authorization Act", dessen entscheidende Passagen die Wissenschaftlerorganisation "Federation of American Scientists" (FAS) öffentlich gemacht hat, liegt gerade beim Streitkräfteausschuss des US-Senats. Wird das Gesetz unverändert verabschiedet, wäre der Direktor der NSA berechtigt, bestimmte Kategorien von NSA-Dokumenten von einer Freigabe im Rahmen des FOIA auszunehmen. Diese Befugnis hätten schon drei andere Bundesbüros, wie das Verteidigungsministerium betont: die "Central Intelligence Agency" (CIA) die "National Imagery and Mapping Agency" (NIMA) und das "National Reconnaissance Office" (NRO).
Die Sperrung bezieht sich nicht auf bestimmte Ereignisse, sondern gilt ganz allgemein für alle Dokumente, aus denen hervorgehen könnte, wie die NSA, die auch das weltweite Abhörsystem Echelon betreibt, an ihre Informationen gelangt ist. Der Direktor der NSA wäre allerdings auch verpflichtet, mindestens einmal in zehn Jahren die gesperrten Dokumente erneut zu überprüfen und diese gegebenenfalls frei zu geben.
Die Bush-Regierung verspricht sich von der Neuregelung neben mehr Sicherheit auch, dass die NSA ihre "Signals Intelligence"-Missionen besser durchführen kann. Zu "Signals Intelligence" (SIGINT) gehören alle Arten des Abhörens von elektronisch übermittelten Signalen. Der Fachdienst globalsecutity.org schätzt, dass die USA für diesen Zweck u.a. drei bis vier Satelliten im All haben.
Das "National Security Archive" befürchtet nun, dass durch die Sperrung "wichtige Informationen über die Rolle, die die NSA, `Signals Intelligence` und Verschlüsselung in der US-Außenpolitik und Geschichte spielten", der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Das "National Security Archive" ist eng mit dem FOIA verbunden und verdankt ihm in gewisser Weise seine Existenz. Es entstand, als 1985 eine Gruppe von Journalisten ihr Material gemeinsam archivieren wollten, dass sie im Rahmen des FOIA erhalten hatten. Heute ist das an der George Washington University beheimatete Archiv mit seinen mehr als 2 Millionen Seiten nach eigenen Angaben die weltgrößte Bibliothek mit freigegebenen Dokumenten.
Der "Freedom of Information Act" wird von US-Bürgern gerne genutzt - bei der NSA so oft, dass der Geheimdienst eine eigene Webseite zu oft nachgefragten Themen bereitgestellt hat. Darunter fallen etwa die Ermordung John F. Kennedys, die Kuba-Krise oder alle Informationen, die die NSA zu Unbekannten Flugobjekten (UFOs) hat. Allerdings sind schon jetzt gewisse Bereiche der Geheimdienstarbeit der NSA von der Informationsfreiheit ausgenommen, unter anderem Informationen, die sich auf die Nationale Sicherheit beziehen oder Rückschlüsse auf die Quellen und Methoden der NSA-Aufklärungsarbeit zulassen.
Worin dann der Nutzen des neuen Gesetzes bestehen soll, ist jedenfalls dem "National Security Archive" nicht klar, das die Rechtfertigung der Regierung als "irreführend" kritisiert. Die Wissenschaftler fordern jetzt, "die vorgeschlagene Ausnahme solle wenigstens nicht als Gesetz verabschiedet werden, bis die NSA eine Studie erstellt hat über Auswirkungen und Bedarf von Ausnahmen und bis öffentlichen Anhörungen in dieser Angelegenheit abgehalten sind". So sei es auch beim CIA Information Act von 1984 geschehen, der das Vorbild für das neue Gesetz sei.
NSA macht die Luken dicht
Dirk Eckert 12.05.2003
Die US-Regierung schätzt die Transparenz nicht allzusehr und will nun auch den Geheimdienst NSA weitgehend vom Informationsfreiheitsgesetz ausnehmen
In den USA hat jeder Bürger im Rahmen des "Freedom of Information Act" ( FOIA) ein Recht auf Einsicht in die Akten der Regierung. Doch zahlreiche Dokumente des Geheimdienstes "National Security Agency" (NSA) sollen jetzt vom "Freedom of Information Act" ausgenommen werden. Bürgerrechtsgruppen haben den Gesetzentwurf an die Öffentlichkeit gebracht, der gerade im Kongress beraten wird. Sie bemängeln, dass bisher nicht einmal öffentliche Anhörungen abgehalten wurden.
Das entsprechende Gesetz, der "FY 2004 Defense Authorization Act", dessen entscheidende Passagen die Wissenschaftlerorganisation "Federation of American Scientists" (FAS) öffentlich gemacht hat, liegt gerade beim Streitkräfteausschuss des US-Senats. Wird das Gesetz unverändert verabschiedet, wäre der Direktor der NSA berechtigt, bestimmte Kategorien von NSA-Dokumenten von einer Freigabe im Rahmen des FOIA auszunehmen. Diese Befugnis hätten schon drei andere Bundesbüros, wie das Verteidigungsministerium betont: die "Central Intelligence Agency" (CIA) die "National Imagery and Mapping Agency" (NIMA) und das "National Reconnaissance Office" (NRO).
Die Sperrung bezieht sich nicht auf bestimmte Ereignisse, sondern gilt ganz allgemein für alle Dokumente, aus denen hervorgehen könnte, wie die NSA, die auch das weltweite Abhörsystem Echelon betreibt, an ihre Informationen gelangt ist. Der Direktor der NSA wäre allerdings auch verpflichtet, mindestens einmal in zehn Jahren die gesperrten Dokumente erneut zu überprüfen und diese gegebenenfalls frei zu geben.
Die Bush-Regierung verspricht sich von der Neuregelung neben mehr Sicherheit auch, dass die NSA ihre "Signals Intelligence"-Missionen besser durchführen kann. Zu "Signals Intelligence" (SIGINT) gehören alle Arten des Abhörens von elektronisch übermittelten Signalen. Der Fachdienst globalsecutity.org schätzt, dass die USA für diesen Zweck u.a. drei bis vier Satelliten im All haben.
Das "National Security Archive" befürchtet nun, dass durch die Sperrung "wichtige Informationen über die Rolle, die die NSA, `Signals Intelligence` und Verschlüsselung in der US-Außenpolitik und Geschichte spielten", der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Das "National Security Archive" ist eng mit dem FOIA verbunden und verdankt ihm in gewisser Weise seine Existenz. Es entstand, als 1985 eine Gruppe von Journalisten ihr Material gemeinsam archivieren wollten, dass sie im Rahmen des FOIA erhalten hatten. Heute ist das an der George Washington University beheimatete Archiv mit seinen mehr als 2 Millionen Seiten nach eigenen Angaben die weltgrößte Bibliothek mit freigegebenen Dokumenten.
Der "Freedom of Information Act" wird von US-Bürgern gerne genutzt - bei der NSA so oft, dass der Geheimdienst eine eigene Webseite zu oft nachgefragten Themen bereitgestellt hat. Darunter fallen etwa die Ermordung John F. Kennedys, die Kuba-Krise oder alle Informationen, die die NSA zu Unbekannten Flugobjekten (UFOs) hat. Allerdings sind schon jetzt gewisse Bereiche der Geheimdienstarbeit der NSA von der Informationsfreiheit ausgenommen, unter anderem Informationen, die sich auf die Nationale Sicherheit beziehen oder Rückschlüsse auf die Quellen und Methoden der NSA-Aufklärungsarbeit zulassen.
Worin dann der Nutzen des neuen Gesetzes bestehen soll, ist jedenfalls dem "National Security Archive" nicht klar, das die Rechtfertigung der Regierung als "irreführend" kritisiert. Die Wissenschaftler fordern jetzt, "die vorgeschlagene Ausnahme solle wenigstens nicht als Gesetz verabschiedet werden, bis die NSA eine Studie erstellt hat über Auswirkungen und Bedarf von Ausnahmen und bis öffentlichen Anhörungen in dieser Angelegenheit abgehalten sind". So sei es auch beim CIA Information Act von 1984 geschehen, der das Vorbild für das neue Gesetz sei.
sueddeutsche.de von heute
Anschlag auf die Weltjustiz Washington will Rechtssysteme anderer Staaten aushebeln
Während sich Amerika und Europa bemühen, ihren Irak-Konflikt abzuschwächen, gefährdet bereits der nächste Sprengsatz das transatlantische Verhältnis. Diesmal geht es um die Weltjustiz. Im Juni läuft eine von Washington ertrotzte Resolution des UN-Sicherheitsrats aus, die US-Friedenssoldaten Immunität vor dem neuen Weltstrafgericht in Den Haag gewährt. Die USA pochen auf eine Verlängerung der Extraregel und mühen sich auch sonst, die internationale Strafjustiz zu unterminieren. Doch damit nicht genug. Washington nimmt nun auch die nationalen Rechtssysteme anderer Staaten ins Visier. Ein soeben im Repräsentantenhaus eingebrachter Gesetzentwurf bedroht in letzter Konsequenz selbst alte Verbündete wie Kanada, die Niederlande und Deutschland mit Gewalt. In Belgien wird bereits vom Brussels Liberation Act gespottet.
Die von dem Abgeordneten Gary Ackerman erarbeitete Vorlage richtet sich gegen das Weltrechtsprinzip. Danach können schwerste Delikte wie Völkermord überall verfolgt werden, also unabhängig vom Tatort und der Nationalität von Tätern und Opfern. Immer mehr Staaten, darunter Deutschland, folgen diesem Prinzip – eine segensreiche Entwicklung für die Menschenrechte. Sehr weit gingen die Gesetze allerdings in Belgien, wo Klagen gegen 30Diktatoren und Staatsmänner eingegangen sind. Auch dabei: Israels Premier Ariel Scharon, George Bush I. und Amerikas Irakkrieger Tommy Franks.
Obwohl solche zum Teil effekthascherischen Klagen keine Aussicht auf Erfolg haben, erbosen sie die Verantwortlichen in Washington ungeheuer. Dieser Verärgerung dürfte Ackermans Anschlag auf das Weltrechtsprinzip entsprungen sein. Sein Entwurf spricht von einer „Bedrohung für die Souveränität der Vereinigten Staaten“ und verbietet US-Behörden jegliche Mitwirkung bei Strafverfahren nach dem Weltrechtsprinzip. Darüber hinaus soll der Präsident ermächtigt werden, „alle nötigen Mittel“, also auch militärische, zu ergreifen, um amerikanische Soldaten, Amtsträger oder ausländische Hilfskräfte zu befreien, die nach dem Weltrechtsprinzip inhaftiert sind.
„Wenn Deutschland also einen Iraker verfolgen möchte, der heute für die USA arbeitet, aber früher im Irak Verbrechen beging, so könnten die Amerikaner ihn gewaltsam befreien“, erklärt ein international tätiger Strafverfolger. Der Kölner Völkerstrafrechtler Claus Kreß sagt: „Das ist ein Text, der uns nicht erfreuen kann. Wenn der durchkommt, wäre das der frontale Angriff auf eine Vielzahl nationaler Gesetze.“
Doch ist der Vorstoß überhaupt ernst zu nehmen? Diplomaten und Völkerrechtler glauben: Ackerman sei kein Wildwest-Politiker, sondern ein erfahrener demokratischer Abgeordneter aus New York, der als liberal gelte. Seine Vorlage passe zur Stimmung in Amerika und sei auch für Deutschland „prekär“, meint Kreß. Raj Purohit, Parlamentsexperte des Lawyers Committee for Human Rights in Washington, sagt: „Wir sind besorgt über den Entwurf und nehmen ihn ernst.“
Ein europäischer Diplomat erinnert an einen Präzedenzfall: Vor einigen Jahren initiierte der Senator Jesse Helms ein Gesetz, das die gewaltsame Befreiung von Amerikanern aus den Händen des Haager Völkertribunals vorsah. Seinerzeit wurde der Entwurf belächelt. Heute ist er Gesetz. Sein Spitzname lautet: Hague Invasion Act.
Stefan Ulrich
Anschlag auf die Weltjustiz Washington will Rechtssysteme anderer Staaten aushebeln
Während sich Amerika und Europa bemühen, ihren Irak-Konflikt abzuschwächen, gefährdet bereits der nächste Sprengsatz das transatlantische Verhältnis. Diesmal geht es um die Weltjustiz. Im Juni läuft eine von Washington ertrotzte Resolution des UN-Sicherheitsrats aus, die US-Friedenssoldaten Immunität vor dem neuen Weltstrafgericht in Den Haag gewährt. Die USA pochen auf eine Verlängerung der Extraregel und mühen sich auch sonst, die internationale Strafjustiz zu unterminieren. Doch damit nicht genug. Washington nimmt nun auch die nationalen Rechtssysteme anderer Staaten ins Visier. Ein soeben im Repräsentantenhaus eingebrachter Gesetzentwurf bedroht in letzter Konsequenz selbst alte Verbündete wie Kanada, die Niederlande und Deutschland mit Gewalt. In Belgien wird bereits vom Brussels Liberation Act gespottet.
Die von dem Abgeordneten Gary Ackerman erarbeitete Vorlage richtet sich gegen das Weltrechtsprinzip. Danach können schwerste Delikte wie Völkermord überall verfolgt werden, also unabhängig vom Tatort und der Nationalität von Tätern und Opfern. Immer mehr Staaten, darunter Deutschland, folgen diesem Prinzip – eine segensreiche Entwicklung für die Menschenrechte. Sehr weit gingen die Gesetze allerdings in Belgien, wo Klagen gegen 30Diktatoren und Staatsmänner eingegangen sind. Auch dabei: Israels Premier Ariel Scharon, George Bush I. und Amerikas Irakkrieger Tommy Franks.
Obwohl solche zum Teil effekthascherischen Klagen keine Aussicht auf Erfolg haben, erbosen sie die Verantwortlichen in Washington ungeheuer. Dieser Verärgerung dürfte Ackermans Anschlag auf das Weltrechtsprinzip entsprungen sein. Sein Entwurf spricht von einer „Bedrohung für die Souveränität der Vereinigten Staaten“ und verbietet US-Behörden jegliche Mitwirkung bei Strafverfahren nach dem Weltrechtsprinzip. Darüber hinaus soll der Präsident ermächtigt werden, „alle nötigen Mittel“, also auch militärische, zu ergreifen, um amerikanische Soldaten, Amtsträger oder ausländische Hilfskräfte zu befreien, die nach dem Weltrechtsprinzip inhaftiert sind.
„Wenn Deutschland also einen Iraker verfolgen möchte, der heute für die USA arbeitet, aber früher im Irak Verbrechen beging, so könnten die Amerikaner ihn gewaltsam befreien“, erklärt ein international tätiger Strafverfolger. Der Kölner Völkerstrafrechtler Claus Kreß sagt: „Das ist ein Text, der uns nicht erfreuen kann. Wenn der durchkommt, wäre das der frontale Angriff auf eine Vielzahl nationaler Gesetze.“
Doch ist der Vorstoß überhaupt ernst zu nehmen? Diplomaten und Völkerrechtler glauben: Ackerman sei kein Wildwest-Politiker, sondern ein erfahrener demokratischer Abgeordneter aus New York, der als liberal gelte. Seine Vorlage passe zur Stimmung in Amerika und sei auch für Deutschland „prekär“, meint Kreß. Raj Purohit, Parlamentsexperte des Lawyers Committee for Human Rights in Washington, sagt: „Wir sind besorgt über den Entwurf und nehmen ihn ernst.“
Ein europäischer Diplomat erinnert an einen Präzedenzfall: Vor einigen Jahren initiierte der Senator Jesse Helms ein Gesetz, das die gewaltsame Befreiung von Amerikanern aus den Händen des Haager Völkertribunals vorsah. Seinerzeit wurde der Entwurf belächelt. Heute ist er Gesetz. Sein Spitzname lautet: Hague Invasion Act.
Stefan Ulrich
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,249290,00.html
"Unsere Religion heißt Amerika"
SPIEGEL: Mr. Mailer, aus Ihrer Wohnung konnten Sie die Türme des World Trade Center drüben in Manhattan sehen. Fehlen sie Ihnen?
Mailer: Als sie hochgezogen wurden, habe ich sie gehasst, weil sich in ihnen die Arroganz und die ungeheuerliche Eitelkeit der Architekten spiegelten. Ich habe allerdings nicht gewusst, was drum herum gebaut worden war. Dort durften sich talentlose Architekten mit riesigen Budgets an Gebäuden mit 40, 50 Stockwerken austoben, die aussehen wie Latrinen aus Backstein. Sie aber sind übrig geblieben, als die Twin Towers einstürzten. So frevelhaft sie auch waren, haben sie Manhattan doch immerhin interessant gemacht. Jetzt herrscht dort silhouettenlose Hässlichkeit.
SPIEGEL: Anders als viele Amerikaner haben Sie die Angriffe der Terroristen offenbar nicht persönlich genommen.
Mailer: Weil es natürlich kein Anschlag auf Amerika war, sondern in gewisser Hinsicht ein Anschlag auf die amerikanische Oberschicht.
SPIEGEL: Die rund 2800 Ermordeten in New York waren wohl kaum Vertreter des Establishments.
Mailer: Aber sie lassen sich ihm zuordnen, weil sie in der Finanzwirtschaft, im Import-Export-Handel und rund um die Börse gearbeitet haben. Und nicht zufällig fühlt sich die Oberschicht in diesem Land seither persönlich berührt und bedroht. Sie hat einen tief gehenden Schock erlitten. Ich vergleiche die Wirkung des 11. September vorzugsweise mit dem Schock, den die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg erlebten, als ihre Währung allen Wert verlor ...
SPIEGEL: ... Sie meinen die Inflation von 1923.
Mailer: Sie haben damals ihr Selbstwertgefühl eingebüßt. Im selben Maße ist den Amerikanern am 11. September das Gefühl der Sicherheit abhanden gekommen.
SPIEGEL: Seitdem hat Präsident Bush, bei weiterhin hoher Popularität, zwei Kriege geführt. Heißt das aus Ihrer Sicht, um Rache zu üben?
Mailer: Mit Rache hat der Krieg gegen den Irak nichts zu tun. Das war ein enorm geschickter politischer Schachzug ohne jede moralische Bedeutung. Sämtliche präventiven Begründungen, etwa dass Saddam über ein ausgiebiges Arsenal an Massenvernichtungswaffen verfügt, wirken ja jetzt ziemlich blass. Wir mögen ein bisschen was finden, aber sicher nicht im beschworenen Umfang.
SPIEGEL: Aber das stürzt dann die Regierung Bush kaum in Legitimationsnöte.
Mailer: Die Amerikaner kümmert das ganz offensichtlich überhaupt nicht. Wenn nichts entdeckt wird, was soll`s.
SPIEGEL: Warum ist das so?
Mailer: Weil wir einen Sieg erringen wollten. Wir brauchen ihn für unser nationales Ego. Die neue Begründung für den Krieg lautet jetzt, dass wir den Irak von einem Tyrannen befreien mussten, der sein Volk aufs Entsetzlichste gequält und gemordet hat. Die Zeitungen sind voll von schrecklichen Geschichten von Menschen, die gleichsam geschreddert wurden. Wir stellen allerdings nicht in Rechnung, dass wir ironischer- und perverserweise Mitschuld tragen.
SPIEGEL: Sie meinen, weil Bush Sr. 1991 Saddam politisch überleben ließ und das US-Militär zusah, als er dann die Kurden- und Schiiten-Aufstände blutig niederschlug?
Mailer: Und jetzt tun wir so, als retteten wir diese Menschen vor dem Terror. Es gibt keinen Grund, uns dafür selbst zu beweihräuchern. Amerika ist kein nobles Land.
SPIEGEL: Für etliche in der Regierung Bush geht es nun um die Hegemonie Amerikas im Nahen Osten - am Ende wohl gar um eine imperiale Neuordnung.
Mailer: Einige Protagonisten in der Regierung wirken tatkräftig auf die Errichtung eines amerikanischen Imperiums hin. Es gibt andere, die sich zu sagen scheinen, das ist zwar ziemlich schwierig, aber schauen wir doch mal, wie weit wir gehen können. Und andere wiederum sind der Auffassung, Amerika nimmt sich zu viel vor. Doch aufs Ganze gesehen gibt es die Tendenz, das Imperium als taugliches Mittel zu betrachten, die Probleme des Landes zu lösen.
SPIEGEL: Als Imperium wird Amerika spätestens seit 1945 betrachtet.
Mailer: Aber wir haben uns nicht so verstanden, wir haben es uns nicht eingestanden.
SPIEGEL: Aber seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Blocks lässt sich das Monopol Amerikas als maßlos überlegene Supermacht nur schwer übersehen.
Mailer: Amerika gebietet über ein ökonomisches Weltreich mit einer großen Zahl militärischer Stützpunkte in aller Welt. Es kommt aber darauf an, den Leuten offen zu sagen, dass wir nicht ein stillschweigendes Imperium haben, sondern tatsächlich die Welt beherrschen wollen. Die Bürger müssen es schon allein deshalb zur Kenntnis nehmen, weil viele von ihnen fürs Militär in Frage kommen. Heute haben wir rund eineinhalb Millionen Soldaten. Um ein Imperium militärisch zu beherrschen, braucht Amerika erheblich mehr, vielleicht zehnmal so viel. Das verändert die Ökonomie. Das verändert die Psychologie der Bürger. Das verändert alles.
"Wenn Bush einen Hund streichelt, bewegt er sich jedes Mal außerordentlich gut."
SPIEGEL: In welchen Zeiträumen?
Mailer: Ich denke an 20, 30, 40 Jahre. Ich habe einfach Bedenken, dass wir uns nicht mit einem Leben, in dem terroristische Anschläge von Zeit zu Zeit für Unsicherheit sorgen, abfinden können. Stattdessen suchen wir nach der befreienden Lösung, nach der Amerikaner immer suchen. Es gibt die berühmte Bemerkung nach unserer Landung auf dem Mond, die - wenn ich recht erinnere - John Kenneth Galbraith in Umlauf gebracht hat. Er hat sardonisch gefragt: Warum betonieren wir das Ding eigentlich nicht? Das ist die amerikanische Lösung für unsere Probleme: betonieren, zudecken.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass für den offenen Anspruch auf ein Imperium eine solide Mehrheit der Amerikaner zu gewinnen ist?
Mailer: Die Bereitschaft dafür gibt es. Ich schätze, dass die Hälfte aller Amerikaner mit Begeisterung dafür ist. Amerika ist ein christliches Land, ein Drittel aller Amerikaner sind streng gläubig. Ein Bestandteil unseres Christentums aber ist Liebe zu Amerika. Amerika ist die Religion in diesem Land. Jesus zu lieben und das Land zu lieben gehen Hand in Hand.
SPIEGEL: Man nennt das den typisch amerikanischen Patriotismus. Hat der 11. September die militanten Anteile im amerikanischen Christentum geweckt?
Mailer: Zuerst hat es den christlichen Krieger in George W. Bush geweckt. Er hat schnell erkannt, dass er damit nicht allein stand, dass er auf diese Weise sehr viel Rückhalt gewinnen kann und scheinbar unlösbare Probleme zu lösen vermag.
SPIEGEL: Welche?
Mailer: Die katholische Kirche, eine Säule des Patriotismus, steckt in grunderschütternden Konflikten. Wenn ein Priester - und ich fühle durchaus mit den Priestern - die Straße entlanggeht, schaut ihn jeder fragend an, ob er sich vielleicht an Kindern vergreift. Dann gab es die Serie der Unternehmensskandale. Zudem ging es mit der Wirtschaft, die Amerika seit etlichen Jahrzehnten mehr und mehr beherrscht, wobei das Marketing wichtiger ist als die Produkte, schon damals bergab.
Der 11. September löste ziemlich viel für Bush. Für ein paar Jahre hat er seinen Lauf. Er ist gewitzt genug zu wissen, dass er für den Kampf gegen das Böse halb Amerika hinter sich bringen kann.
SPIEGEL: Interessiert Sie Bush als Person? Reizt Sie als Schriftsteller der Mensch im Präsidenten?
Mailer: Er ist einer der fotogensten Männer in der Geschichte. Ist Ihnen aufgefallen, mit welchem Geschick er es vermeidet, unvorteilhaft abgelichtet zu werden? Wenn er einen Hund streichelt oder aus einem Flugzeug steigt, bewegt er sich jedes Mal außerordentlich gut. Er würde - ich sage das nicht, um ihn herabzusetzen - ein vorzügliches männliches Modell abgegeben haben.
SPIEGEL: Als Schriftsteller müssen Sie seine Antriebskräfte interessieren. Wir kennen seine Familiengeschichte, seine früheren Alkoholprobleme, die lange Erfolglosigkeit in einer erfolgsverwöhnten Oberschichtfamilie. Welches Bild ergibt er?
Mailer: Ich habe Freunde, die bei den Anonymen Alkoholikern sind. Sie bezeichnen sich als trockene Trinker.
SPIEGEL: So heißt es auch vom Präsidenten. Was aber bedeutet es?
Mailer: Dass Kräfte in diesen Menschen toben, denen sie nicht freien Lauf geben dürfen. Sie müssen Ersatz finden, oder sie können nicht funktionieren. Aktivität und Macht bieten augenscheinlich genügend Befriedigung.
SPIEGEL: Kennen Sie eigentlich die Bush-Familie?
Mailer: Seine Mutter ein bisschen, ich habe in den achtziger Jahren bei zwei Abendessen neben ihr gesessen. Eine interessante Frau, geistreich, stark. Sie hat Ausstrahlung, wirkt echt. Sie ist auf natürliche Weise sympathisch. Sein Vater hat sehr viel mehr Kraft, als ihm zugeschrieben wird. Ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben mit dem Titel "Wie der Schwächling den Krieg gewann". Die Pointe bestand darin, dass er eben kein Schwächling ist.
SPIEGEL: Wie fügt sich George W. in diese Familie ein?
Mailer: Als Schriftsteller möchte ich natürlich gern wissen, was seine Eltern von ihm denken. Einerseits sind sie zweifellos stolz auf ihn. Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder Versager sind. Aber andererseits glaube ich doch, dass sie in einem kleinen Winkel ihres Herzens bestürzt sein müssen über ihn, weil er nicht ihren Stil besitzt.
SPIEGEL: Die Eltern sind alteingesessene Ostküstler, George W. ist Texaner aus Überzeugung.
Mailer: An diesem Mann ist etwas Rohes, und das ist eine Überraschung. Wir sagen zu einem solchen Menschenschlag "yahoos" - Krakeeler. Er ist vulgär. In Anbetracht seiner würdevollen, interessanten und lebenskräftigen Eltern hat er mit seiner Vulgarität eine Wahl getroffen. Er ist zynisch, er liebt es, Menschen zu manipulieren. So bringt sich, um es anders zu sagen, der trockene Trinker dazu, die Lage zu beherrschen, denn er braucht die Genugtuung, ein überaus aktives und dynamisches Leben zu führen. Er versteht es, halb Amerika zu manipulieren, indem er ständig das Sternenbanner schwenkt.
SPIEGEL: Verglichen mit seinem Vater, der zwar Saddam Hussein aus Kuweit vertrieb, aber schön die Finger vom Pulverfass Nahost ließ und nichts von amerikanischen Alleingängen und Imperiumsansprüchen hielt, ist der Sohn ein Revolutionär.
Mailer: Ich kann es gar nicht leiden, wenn das wunderbare linke Wort Revolutionär auf Erzkonservative angewandt wird. Wie wäre es mit: Er ist ein militanter Flaggenkonservativer. Denn gegenwärtig sind diese Flaggenkonservativen in der Mehrheit, während die Wertkonservativen nicht begreifen, was passiert.
SPIEGEL: Wie unterscheiden sich die Wert- von den Flaggenkonservativen?
Mailer: Traditionalisten wie Pat Buchanan glauben daran, dass es für Amerika das Beste wäre, sich mit sich selbst zu beschäftigen, um unsere Probleme zu lösen. Sie halten an der Familie, am Vaterland, am Glauben fest. Sie stehen für harte Arbeit, Ehrlichkeit und einen ausgeglichenen Staatshaushalt.
Bush ist anders. Flaggenkonservative wie er tun so, als glaubten sie an die alten Werte, aber wenn es darauf ankommt, scheren sie sich darum nicht. Sie benutzen die Flagge, sie benutzen biblische Worte wie das "Böse" skrupellos. Sie leben in der Illusion, Amerika sei das Gute und die einzige Hoffnung für die Welt. Flaggenkonservative glauben wahrhaft, dass Amerika nicht nur die Welt beherrschen kann, sondern es muss. Denn ohne Imperium geht es mit dem Land ökonomisch und moralisch abwärts - das ist, wie ich meine, der unausgesprochene, allemal geleugnete Subtext für das Irak-Projekt.
SPIEGEL: Bush wird gern mit Präsident Harry Truman verglichen - beide eher schlichten Gemüts, weltunerfahren, aber zu schwerwiegenden Entscheidungen fähig.
Mailer: Nein, Truman war ein Selfmademan, er besaß Eigensinn, hatte starke Wurzeln, die Bush nicht hat. Bush erinnert mich in mancher Hinsicht an Ronald Reagan. Sie haben eine Eigenart gemeinsam, die sie für Amerikaner außerordentlich liebenswert erscheinen lässt.
SPIEGEL: Und das wäre?
Mailer: Reagan war ja als Schauspieler immer die Nummer zwei in Liebesgeschichten. Er bekam das Mädchen, aber er war auch dazu ausersehen, einem anderen Mann sein Mädchen zu überlassen - und zwar mit einem Lächeln im Gesicht. Dafür liebten ihn die Amerikaner, weil es in der Lebensgeschichte der meisten Männer vorkommt, dass sie bei der Frau ihrer Träume nicht die erste Wahl sind. Bush ist genauso. Als Schauspieler hätte er die Rolle des Verlierers in Würde gespielt.
SPIEGEL: Aber Reagan prangerte das "Böse" spielerisch an, während Bush ernsthaft dagegen in den Krieg zieht. Er meint, was er sagt.
Mailer: Das ist Scheinheiligkeit. Darin ähnelt er Maggie Thatcher. Er glaubt an das, was ihm zu glauben nützlich erscheint.
"In meinem Leben habe ich die Bücher, über die ich zu viel geredet habe, nicht geschrieben."
SPIEGEL: Mr. Mailer, Sie haben sich gerade in einem schmalen Band mit der Gegenwartspolitik beschäftigt. Sie haben die Feierlichkeiten zu Ihrem 80. Geburtstag überstanden. Aber an welchem Roman schreiben Sie eigentlich momentan?
Mailer: Ich arbeite an einem ambitionierten Buch, an einem sehr breit angelegten Roman. Vielleicht übersteigt er sogar meine Möglichkeiten.
SPIEGEL: Wie oft in Ihrem Leben haben Sie das von Romanprojekten behauptet?
Mailer: Es könnte das erste Mal sein. Aber ich rede nicht über den Inhalt, und zwar aus einem triftigen Grund: In meinem Leben habe ich die Bücher, über die ich zu viel geredet habe, nicht geschrieben. Nicht einmal meiner Frau habe ich diesmal erzählt, woran ich sitze, obwohl sie es ahnt.
SPIEGEL: Woran sitzen Sie denn?
Mailer: Es ist nicht eine Fortsetzung von "Gespenster", meinem Buch über die CIA. Ich werde alles tun, um das Buch zu Ende zu bringen, aber es kann gut noch zehn Jahre dauern, und ich weiß nicht, wie gut man schreibt, wenn man 90 ist.
SPIEGEL: Mr. Mailer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Das Gespräch führte Redakteur Gerhard Spörl.
"Unsere Religion heißt Amerika"
SPIEGEL: Mr. Mailer, aus Ihrer Wohnung konnten Sie die Türme des World Trade Center drüben in Manhattan sehen. Fehlen sie Ihnen?
Mailer: Als sie hochgezogen wurden, habe ich sie gehasst, weil sich in ihnen die Arroganz und die ungeheuerliche Eitelkeit der Architekten spiegelten. Ich habe allerdings nicht gewusst, was drum herum gebaut worden war. Dort durften sich talentlose Architekten mit riesigen Budgets an Gebäuden mit 40, 50 Stockwerken austoben, die aussehen wie Latrinen aus Backstein. Sie aber sind übrig geblieben, als die Twin Towers einstürzten. So frevelhaft sie auch waren, haben sie Manhattan doch immerhin interessant gemacht. Jetzt herrscht dort silhouettenlose Hässlichkeit.
SPIEGEL: Anders als viele Amerikaner haben Sie die Angriffe der Terroristen offenbar nicht persönlich genommen.
Mailer: Weil es natürlich kein Anschlag auf Amerika war, sondern in gewisser Hinsicht ein Anschlag auf die amerikanische Oberschicht.
SPIEGEL: Die rund 2800 Ermordeten in New York waren wohl kaum Vertreter des Establishments.
Mailer: Aber sie lassen sich ihm zuordnen, weil sie in der Finanzwirtschaft, im Import-Export-Handel und rund um die Börse gearbeitet haben. Und nicht zufällig fühlt sich die Oberschicht in diesem Land seither persönlich berührt und bedroht. Sie hat einen tief gehenden Schock erlitten. Ich vergleiche die Wirkung des 11. September vorzugsweise mit dem Schock, den die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg erlebten, als ihre Währung allen Wert verlor ...
SPIEGEL: ... Sie meinen die Inflation von 1923.
Mailer: Sie haben damals ihr Selbstwertgefühl eingebüßt. Im selben Maße ist den Amerikanern am 11. September das Gefühl der Sicherheit abhanden gekommen.
SPIEGEL: Seitdem hat Präsident Bush, bei weiterhin hoher Popularität, zwei Kriege geführt. Heißt das aus Ihrer Sicht, um Rache zu üben?
Mailer: Mit Rache hat der Krieg gegen den Irak nichts zu tun. Das war ein enorm geschickter politischer Schachzug ohne jede moralische Bedeutung. Sämtliche präventiven Begründungen, etwa dass Saddam über ein ausgiebiges Arsenal an Massenvernichtungswaffen verfügt, wirken ja jetzt ziemlich blass. Wir mögen ein bisschen was finden, aber sicher nicht im beschworenen Umfang.
SPIEGEL: Aber das stürzt dann die Regierung Bush kaum in Legitimationsnöte.
Mailer: Die Amerikaner kümmert das ganz offensichtlich überhaupt nicht. Wenn nichts entdeckt wird, was soll`s.
SPIEGEL: Warum ist das so?
Mailer: Weil wir einen Sieg erringen wollten. Wir brauchen ihn für unser nationales Ego. Die neue Begründung für den Krieg lautet jetzt, dass wir den Irak von einem Tyrannen befreien mussten, der sein Volk aufs Entsetzlichste gequält und gemordet hat. Die Zeitungen sind voll von schrecklichen Geschichten von Menschen, die gleichsam geschreddert wurden. Wir stellen allerdings nicht in Rechnung, dass wir ironischer- und perverserweise Mitschuld tragen.
SPIEGEL: Sie meinen, weil Bush Sr. 1991 Saddam politisch überleben ließ und das US-Militär zusah, als er dann die Kurden- und Schiiten-Aufstände blutig niederschlug?
Mailer: Und jetzt tun wir so, als retteten wir diese Menschen vor dem Terror. Es gibt keinen Grund, uns dafür selbst zu beweihräuchern. Amerika ist kein nobles Land.
SPIEGEL: Für etliche in der Regierung Bush geht es nun um die Hegemonie Amerikas im Nahen Osten - am Ende wohl gar um eine imperiale Neuordnung.
Mailer: Einige Protagonisten in der Regierung wirken tatkräftig auf die Errichtung eines amerikanischen Imperiums hin. Es gibt andere, die sich zu sagen scheinen, das ist zwar ziemlich schwierig, aber schauen wir doch mal, wie weit wir gehen können. Und andere wiederum sind der Auffassung, Amerika nimmt sich zu viel vor. Doch aufs Ganze gesehen gibt es die Tendenz, das Imperium als taugliches Mittel zu betrachten, die Probleme des Landes zu lösen.
SPIEGEL: Als Imperium wird Amerika spätestens seit 1945 betrachtet.
Mailer: Aber wir haben uns nicht so verstanden, wir haben es uns nicht eingestanden.
SPIEGEL: Aber seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Blocks lässt sich das Monopol Amerikas als maßlos überlegene Supermacht nur schwer übersehen.
Mailer: Amerika gebietet über ein ökonomisches Weltreich mit einer großen Zahl militärischer Stützpunkte in aller Welt. Es kommt aber darauf an, den Leuten offen zu sagen, dass wir nicht ein stillschweigendes Imperium haben, sondern tatsächlich die Welt beherrschen wollen. Die Bürger müssen es schon allein deshalb zur Kenntnis nehmen, weil viele von ihnen fürs Militär in Frage kommen. Heute haben wir rund eineinhalb Millionen Soldaten. Um ein Imperium militärisch zu beherrschen, braucht Amerika erheblich mehr, vielleicht zehnmal so viel. Das verändert die Ökonomie. Das verändert die Psychologie der Bürger. Das verändert alles.
"Wenn Bush einen Hund streichelt, bewegt er sich jedes Mal außerordentlich gut."
SPIEGEL: In welchen Zeiträumen?
Mailer: Ich denke an 20, 30, 40 Jahre. Ich habe einfach Bedenken, dass wir uns nicht mit einem Leben, in dem terroristische Anschläge von Zeit zu Zeit für Unsicherheit sorgen, abfinden können. Stattdessen suchen wir nach der befreienden Lösung, nach der Amerikaner immer suchen. Es gibt die berühmte Bemerkung nach unserer Landung auf dem Mond, die - wenn ich recht erinnere - John Kenneth Galbraith in Umlauf gebracht hat. Er hat sardonisch gefragt: Warum betonieren wir das Ding eigentlich nicht? Das ist die amerikanische Lösung für unsere Probleme: betonieren, zudecken.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass für den offenen Anspruch auf ein Imperium eine solide Mehrheit der Amerikaner zu gewinnen ist?
Mailer: Die Bereitschaft dafür gibt es. Ich schätze, dass die Hälfte aller Amerikaner mit Begeisterung dafür ist. Amerika ist ein christliches Land, ein Drittel aller Amerikaner sind streng gläubig. Ein Bestandteil unseres Christentums aber ist Liebe zu Amerika. Amerika ist die Religion in diesem Land. Jesus zu lieben und das Land zu lieben gehen Hand in Hand.
SPIEGEL: Man nennt das den typisch amerikanischen Patriotismus. Hat der 11. September die militanten Anteile im amerikanischen Christentum geweckt?
Mailer: Zuerst hat es den christlichen Krieger in George W. Bush geweckt. Er hat schnell erkannt, dass er damit nicht allein stand, dass er auf diese Weise sehr viel Rückhalt gewinnen kann und scheinbar unlösbare Probleme zu lösen vermag.
SPIEGEL: Welche?
Mailer: Die katholische Kirche, eine Säule des Patriotismus, steckt in grunderschütternden Konflikten. Wenn ein Priester - und ich fühle durchaus mit den Priestern - die Straße entlanggeht, schaut ihn jeder fragend an, ob er sich vielleicht an Kindern vergreift. Dann gab es die Serie der Unternehmensskandale. Zudem ging es mit der Wirtschaft, die Amerika seit etlichen Jahrzehnten mehr und mehr beherrscht, wobei das Marketing wichtiger ist als die Produkte, schon damals bergab.
Der 11. September löste ziemlich viel für Bush. Für ein paar Jahre hat er seinen Lauf. Er ist gewitzt genug zu wissen, dass er für den Kampf gegen das Böse halb Amerika hinter sich bringen kann.
SPIEGEL: Interessiert Sie Bush als Person? Reizt Sie als Schriftsteller der Mensch im Präsidenten?
Mailer: Er ist einer der fotogensten Männer in der Geschichte. Ist Ihnen aufgefallen, mit welchem Geschick er es vermeidet, unvorteilhaft abgelichtet zu werden? Wenn er einen Hund streichelt oder aus einem Flugzeug steigt, bewegt er sich jedes Mal außerordentlich gut. Er würde - ich sage das nicht, um ihn herabzusetzen - ein vorzügliches männliches Modell abgegeben haben.
SPIEGEL: Als Schriftsteller müssen Sie seine Antriebskräfte interessieren. Wir kennen seine Familiengeschichte, seine früheren Alkoholprobleme, die lange Erfolglosigkeit in einer erfolgsverwöhnten Oberschichtfamilie. Welches Bild ergibt er?
Mailer: Ich habe Freunde, die bei den Anonymen Alkoholikern sind. Sie bezeichnen sich als trockene Trinker.
SPIEGEL: So heißt es auch vom Präsidenten. Was aber bedeutet es?
Mailer: Dass Kräfte in diesen Menschen toben, denen sie nicht freien Lauf geben dürfen. Sie müssen Ersatz finden, oder sie können nicht funktionieren. Aktivität und Macht bieten augenscheinlich genügend Befriedigung.
SPIEGEL: Kennen Sie eigentlich die Bush-Familie?
Mailer: Seine Mutter ein bisschen, ich habe in den achtziger Jahren bei zwei Abendessen neben ihr gesessen. Eine interessante Frau, geistreich, stark. Sie hat Ausstrahlung, wirkt echt. Sie ist auf natürliche Weise sympathisch. Sein Vater hat sehr viel mehr Kraft, als ihm zugeschrieben wird. Ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben mit dem Titel "Wie der Schwächling den Krieg gewann". Die Pointe bestand darin, dass er eben kein Schwächling ist.
SPIEGEL: Wie fügt sich George W. in diese Familie ein?
Mailer: Als Schriftsteller möchte ich natürlich gern wissen, was seine Eltern von ihm denken. Einerseits sind sie zweifellos stolz auf ihn. Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder Versager sind. Aber andererseits glaube ich doch, dass sie in einem kleinen Winkel ihres Herzens bestürzt sein müssen über ihn, weil er nicht ihren Stil besitzt.
SPIEGEL: Die Eltern sind alteingesessene Ostküstler, George W. ist Texaner aus Überzeugung.
Mailer: An diesem Mann ist etwas Rohes, und das ist eine Überraschung. Wir sagen zu einem solchen Menschenschlag "yahoos" - Krakeeler. Er ist vulgär. In Anbetracht seiner würdevollen, interessanten und lebenskräftigen Eltern hat er mit seiner Vulgarität eine Wahl getroffen. Er ist zynisch, er liebt es, Menschen zu manipulieren. So bringt sich, um es anders zu sagen, der trockene Trinker dazu, die Lage zu beherrschen, denn er braucht die Genugtuung, ein überaus aktives und dynamisches Leben zu führen. Er versteht es, halb Amerika zu manipulieren, indem er ständig das Sternenbanner schwenkt.
SPIEGEL: Verglichen mit seinem Vater, der zwar Saddam Hussein aus Kuweit vertrieb, aber schön die Finger vom Pulverfass Nahost ließ und nichts von amerikanischen Alleingängen und Imperiumsansprüchen hielt, ist der Sohn ein Revolutionär.
Mailer: Ich kann es gar nicht leiden, wenn das wunderbare linke Wort Revolutionär auf Erzkonservative angewandt wird. Wie wäre es mit: Er ist ein militanter Flaggenkonservativer. Denn gegenwärtig sind diese Flaggenkonservativen in der Mehrheit, während die Wertkonservativen nicht begreifen, was passiert.
SPIEGEL: Wie unterscheiden sich die Wert- von den Flaggenkonservativen?
Mailer: Traditionalisten wie Pat Buchanan glauben daran, dass es für Amerika das Beste wäre, sich mit sich selbst zu beschäftigen, um unsere Probleme zu lösen. Sie halten an der Familie, am Vaterland, am Glauben fest. Sie stehen für harte Arbeit, Ehrlichkeit und einen ausgeglichenen Staatshaushalt.
Bush ist anders. Flaggenkonservative wie er tun so, als glaubten sie an die alten Werte, aber wenn es darauf ankommt, scheren sie sich darum nicht. Sie benutzen die Flagge, sie benutzen biblische Worte wie das "Böse" skrupellos. Sie leben in der Illusion, Amerika sei das Gute und die einzige Hoffnung für die Welt. Flaggenkonservative glauben wahrhaft, dass Amerika nicht nur die Welt beherrschen kann, sondern es muss. Denn ohne Imperium geht es mit dem Land ökonomisch und moralisch abwärts - das ist, wie ich meine, der unausgesprochene, allemal geleugnete Subtext für das Irak-Projekt.
SPIEGEL: Bush wird gern mit Präsident Harry Truman verglichen - beide eher schlichten Gemüts, weltunerfahren, aber zu schwerwiegenden Entscheidungen fähig.
Mailer: Nein, Truman war ein Selfmademan, er besaß Eigensinn, hatte starke Wurzeln, die Bush nicht hat. Bush erinnert mich in mancher Hinsicht an Ronald Reagan. Sie haben eine Eigenart gemeinsam, die sie für Amerikaner außerordentlich liebenswert erscheinen lässt.
SPIEGEL: Und das wäre?
Mailer: Reagan war ja als Schauspieler immer die Nummer zwei in Liebesgeschichten. Er bekam das Mädchen, aber er war auch dazu ausersehen, einem anderen Mann sein Mädchen zu überlassen - und zwar mit einem Lächeln im Gesicht. Dafür liebten ihn die Amerikaner, weil es in der Lebensgeschichte der meisten Männer vorkommt, dass sie bei der Frau ihrer Träume nicht die erste Wahl sind. Bush ist genauso. Als Schauspieler hätte er die Rolle des Verlierers in Würde gespielt.
SPIEGEL: Aber Reagan prangerte das "Böse" spielerisch an, während Bush ernsthaft dagegen in den Krieg zieht. Er meint, was er sagt.
Mailer: Das ist Scheinheiligkeit. Darin ähnelt er Maggie Thatcher. Er glaubt an das, was ihm zu glauben nützlich erscheint.
"In meinem Leben habe ich die Bücher, über die ich zu viel geredet habe, nicht geschrieben."
SPIEGEL: Mr. Mailer, Sie haben sich gerade in einem schmalen Band mit der Gegenwartspolitik beschäftigt. Sie haben die Feierlichkeiten zu Ihrem 80. Geburtstag überstanden. Aber an welchem Roman schreiben Sie eigentlich momentan?
Mailer: Ich arbeite an einem ambitionierten Buch, an einem sehr breit angelegten Roman. Vielleicht übersteigt er sogar meine Möglichkeiten.
SPIEGEL: Wie oft in Ihrem Leben haben Sie das von Romanprojekten behauptet?
Mailer: Es könnte das erste Mal sein. Aber ich rede nicht über den Inhalt, und zwar aus einem triftigen Grund: In meinem Leben habe ich die Bücher, über die ich zu viel geredet habe, nicht geschrieben. Nicht einmal meiner Frau habe ich diesmal erzählt, woran ich sitze, obwohl sie es ahnt.
SPIEGEL: Woran sitzen Sie denn?
Mailer: Es ist nicht eine Fortsetzung von "Gespenster", meinem Buch über die CIA. Ich werde alles tun, um das Buch zu Ende zu bringen, aber es kann gut noch zehn Jahre dauern, und ich weiß nicht, wie gut man schreibt, wenn man 90 ist.
SPIEGEL: Mr. Mailer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Das Gespräch führte Redakteur Gerhard Spörl.
Snow erwartet US-Wachstum im 4. Quartal von 2,5 bis 3 Prozent
Washington (vwd) - US-Finanzminister John Snow hat erneut seine Erwartung geäußert, dass das Wachstum der US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte anziehen wird. Bis zum vierten Quartal werde sich das Wachstum auf eine Rate von 2,5 bis drei Prozent erhöhen, sagte Snow am Dienstag vor einem Ausschuss des Senats. Zugleich räumte der Minister jedoch ein, dass das Wachstum der US-Wirtschaft "unausgeglichen" und die Erholung zu langsam verlaufe. Zudem steige die Arbeitslosigkeit und die Unternehmen investierten nur zögerlich.
vwd/DJ/20.5.2003/apo

Washington (vwd) - US-Finanzminister John Snow hat erneut seine Erwartung geäußert, dass das Wachstum der US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte anziehen wird. Bis zum vierten Quartal werde sich das Wachstum auf eine Rate von 2,5 bis drei Prozent erhöhen, sagte Snow am Dienstag vor einem Ausschuss des Senats. Zugleich räumte der Minister jedoch ein, dass das Wachstum der US-Wirtschaft "unausgeglichen" und die Erholung zu langsam verlaufe. Zudem steige die Arbeitslosigkeit und die Unternehmen investierten nur zögerlich.
vwd/DJ/20.5.2003/apo

20.05. 22:53
Wirtschaftszahlen: Nur geringer Haushaltsüberschuß
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Wie die US-Regierung am heutigen Abend bekannt gab, haben die Steuereinnahmen im April zu einem Haushaltsüberschuß von 51 Milliarden $ geführt. Dies ist der niedrigste Überschuß unmittelbar nach der Steuereinnahme seit 1995, was auf die schwache Wirtschaft zurückzuführen sei. Während im vergangenen Jahr zu dieser Zeit noch ein Gesamtüberschuß von 157,8 Milliarden $ erzielt wurde, sitzt man nun auf einem Defizit von 201,6 Milliarden $.
Wirtschaftszahlen: Nur geringer Haushaltsüberschuß
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Wie die US-Regierung am heutigen Abend bekannt gab, haben die Steuereinnahmen im April zu einem Haushaltsüberschuß von 51 Milliarden $ geführt. Dies ist der niedrigste Überschuß unmittelbar nach der Steuereinnahme seit 1995, was auf die schwache Wirtschaft zurückzuführen sei. Während im vergangenen Jahr zu dieser Zeit noch ein Gesamtüberschuß von 157,8 Milliarden $ erzielt wurde, sitzt man nun auf einem Defizit von 201,6 Milliarden $.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,249562,00.html
SIEG FÜR BUSH
US-Senat erlaubt Entwicklung von Mini-Atomwaffen
Die Falken in der US-Regierung haben einen weiteren Sieg errungen: Der Senat beschloss die Aufhebung des Verbots zur Entwicklung kleiner Atomwaffen, so genannter "Mini-Nukes". Die Opposition warnt bereits vor einem neuen weltweiten Rüstungswettlauf und dem ersten Nuklearwaffen-Einsatz seit Hiroschima.
Washington - Der Senat stimmte in der Nacht zum Mittwoch mit 51 zu 43 Stimmen für einen Antrag von US-Präsident George W. Bush, das Verbot zur Erforschung und Entwicklung von taktischen Atomwaffen aufzuheben. Die vor zehn Jahren eingeführte Sperre bezog sich auf Nuklearwaffen mit einer Brisanz von bis zu fünf Kilotonnen TNT. Dies entspricht etwa einem Drittel der Sprengkraft der Hiroschima-Bombe, die 1945 mehr als 100.000 Menschen tötete. Das US-Repräsentantenhaus soll heute einen ähnlichen Beschluss fassen. Im Senat entwickelte sich zwischen Republikanern und der oppositionellen Demokratischen Partei ein heftiger Schlagabtausch. Die Demokraten warfen der Regierungspartei vor, einen neuen Rüstungswettlauf zu riskieren und die weltweite Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu befördern.
Konservative Hardliner aus dem Umfeld von Präsident George W. Bush drängen dagegen seit Jahren auf den Bau der so genannten Mini-Nukes. Durch "benutzbare" Atomwaffen mit vergleichsweise geringer Vernichtungskraft, so ihr Argument, steige das Abschreckungspotenzial gegenüber "Schurkenstaaten" und Terror-Organisationen. Denn die derzeitigen Sprengköpfe im US-Arsenal verfügten über eine derart apokalyptische Wirkung, dass die Drohung mit ihrem Einsatz nicht ernst zu nehmen sei.
"Einbahnstraße zu einem Atomkrieg"
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld beteuerte in einer ersten Reaktion, lediglich an Waffen forschen zu wollen, die tief in der Erde vergrabene Vorräte an chemischen und biologischen Waffen zerstören können. Atomwaffen seien dafür geeigneter als konventionelle Geschosse. "Wir werden verschiedene Varianten betrachten, wie man tief vergrabene Ziele erreichen kann", sagte Rumsfeld. Er fügte allerdings hinzu: "Vieles, woran man forscht, verfolgt man nicht weiter."
"Nur Forschung? Blödsinn!", sagte die demokratische Senatorin Dianne Feinstein. "Glaubt das wirklich jemand?" Ihr Parteifreund Senator Edward M. Kennedy sprach gar von einer "Einbahnstraße, die nur zu einem Atomkrieg führen kann". Jayantha Dhanapala, stellvertretender Uno-Generalsekretär für Abrüstung, äußerte ähnliche Befürchtungen für den Fall, dass die USA Mini-Nukes bauen sollten: "Dann bricht die Hölle los. Es werden sich andere Länder und Terroristen finden, die Atomwaffen einsetzen. Wir befinden uns auf dem Weg nach Armageddon."
Träume vom nuklearen Bunkerknacker
Sollte das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus ähnlich entscheiden wie der Senat, könnte die US-Regierung nicht nur die Erforschung und Entwicklung kleiner Atomwaffen betreiben, sondern erhielte auch grünes Licht für die Investition von 15 Millionen Dollar in die Entwicklung der bisher stärksten "Bunkerknacker"-Bombe, den "Robust Nuclear Earth-Penetrator".
Die Entscheidung des Senats, die im Rahmen der Debatte um den 400 Milliarden Dollar schweren Rüstungsetat für das Jahr 2004 fiel, würde auch sechs Millionen Dollar für die Forschung an fortgeschrittenen Atomwaffen freigeben und darüber hinaus das Energieministerium beauftragen, die Wiederaufnahme unterirdischer Atomtests innerhalb der nächsten 18 Monate vorzubereiten. Die USA hatten die Atomtests vor elf Jahren ausgesetzt.
Radikale Umkehr in der Atompolitik
Die Initiative bedeutet einen dramatischen Schritt hin zu einer Neuorientierung der amerikanischen Nuklearpolitik. Statt wie zu Zeiten des kalten Krieges ein strategisches Nuklearpotenzial zur Abschreckung zu unterhalten, drängt die Administration unter Präsident Bush auf die Entwicklung kleiner taktischer Nuklearwaffen, deren Einsatz leichter zu rechtfertigen wäre.
Bereits vor über einem Jahr waren erstmals Pläne bekannt geworden, die Nukleardoktrin zu ändern. Ein Regierungspapier, die "Nuclear Posture Review" forderte die Entwicklung neuer Mini-Atomwaffen und drohte deren Einsatz gegen Staaten wie Syrien, Libyen, Iran oder den Irak an. Später gab das Weiße Haus eine Präsidentendirektive heraus, die deutlich machte, dass die USA Atomwaffen einsetzen könnten, wenn ihre Streitkräfte mit chemischen oder biologischen Waffen angegriffen würden.



SIEG FÜR BUSH
US-Senat erlaubt Entwicklung von Mini-Atomwaffen
Die Falken in der US-Regierung haben einen weiteren Sieg errungen: Der Senat beschloss die Aufhebung des Verbots zur Entwicklung kleiner Atomwaffen, so genannter "Mini-Nukes". Die Opposition warnt bereits vor einem neuen weltweiten Rüstungswettlauf und dem ersten Nuklearwaffen-Einsatz seit Hiroschima.
Washington - Der Senat stimmte in der Nacht zum Mittwoch mit 51 zu 43 Stimmen für einen Antrag von US-Präsident George W. Bush, das Verbot zur Erforschung und Entwicklung von taktischen Atomwaffen aufzuheben. Die vor zehn Jahren eingeführte Sperre bezog sich auf Nuklearwaffen mit einer Brisanz von bis zu fünf Kilotonnen TNT. Dies entspricht etwa einem Drittel der Sprengkraft der Hiroschima-Bombe, die 1945 mehr als 100.000 Menschen tötete. Das US-Repräsentantenhaus soll heute einen ähnlichen Beschluss fassen. Im Senat entwickelte sich zwischen Republikanern und der oppositionellen Demokratischen Partei ein heftiger Schlagabtausch. Die Demokraten warfen der Regierungspartei vor, einen neuen Rüstungswettlauf zu riskieren und die weltweite Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu befördern.
Konservative Hardliner aus dem Umfeld von Präsident George W. Bush drängen dagegen seit Jahren auf den Bau der so genannten Mini-Nukes. Durch "benutzbare" Atomwaffen mit vergleichsweise geringer Vernichtungskraft, so ihr Argument, steige das Abschreckungspotenzial gegenüber "Schurkenstaaten" und Terror-Organisationen. Denn die derzeitigen Sprengköpfe im US-Arsenal verfügten über eine derart apokalyptische Wirkung, dass die Drohung mit ihrem Einsatz nicht ernst zu nehmen sei.
"Einbahnstraße zu einem Atomkrieg"
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld beteuerte in einer ersten Reaktion, lediglich an Waffen forschen zu wollen, die tief in der Erde vergrabene Vorräte an chemischen und biologischen Waffen zerstören können. Atomwaffen seien dafür geeigneter als konventionelle Geschosse. "Wir werden verschiedene Varianten betrachten, wie man tief vergrabene Ziele erreichen kann", sagte Rumsfeld. Er fügte allerdings hinzu: "Vieles, woran man forscht, verfolgt man nicht weiter."
"Nur Forschung? Blödsinn!", sagte die demokratische Senatorin Dianne Feinstein. "Glaubt das wirklich jemand?" Ihr Parteifreund Senator Edward M. Kennedy sprach gar von einer "Einbahnstraße, die nur zu einem Atomkrieg führen kann". Jayantha Dhanapala, stellvertretender Uno-Generalsekretär für Abrüstung, äußerte ähnliche Befürchtungen für den Fall, dass die USA Mini-Nukes bauen sollten: "Dann bricht die Hölle los. Es werden sich andere Länder und Terroristen finden, die Atomwaffen einsetzen. Wir befinden uns auf dem Weg nach Armageddon."
Träume vom nuklearen Bunkerknacker
Sollte das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus ähnlich entscheiden wie der Senat, könnte die US-Regierung nicht nur die Erforschung und Entwicklung kleiner Atomwaffen betreiben, sondern erhielte auch grünes Licht für die Investition von 15 Millionen Dollar in die Entwicklung der bisher stärksten "Bunkerknacker"-Bombe, den "Robust Nuclear Earth-Penetrator".
Die Entscheidung des Senats, die im Rahmen der Debatte um den 400 Milliarden Dollar schweren Rüstungsetat für das Jahr 2004 fiel, würde auch sechs Millionen Dollar für die Forschung an fortgeschrittenen Atomwaffen freigeben und darüber hinaus das Energieministerium beauftragen, die Wiederaufnahme unterirdischer Atomtests innerhalb der nächsten 18 Monate vorzubereiten. Die USA hatten die Atomtests vor elf Jahren ausgesetzt.
Radikale Umkehr in der Atompolitik
Die Initiative bedeutet einen dramatischen Schritt hin zu einer Neuorientierung der amerikanischen Nuklearpolitik. Statt wie zu Zeiten des kalten Krieges ein strategisches Nuklearpotenzial zur Abschreckung zu unterhalten, drängt die Administration unter Präsident Bush auf die Entwicklung kleiner taktischer Nuklearwaffen, deren Einsatz leichter zu rechtfertigen wäre.
Bereits vor über einem Jahr waren erstmals Pläne bekannt geworden, die Nukleardoktrin zu ändern. Ein Regierungspapier, die "Nuclear Posture Review" forderte die Entwicklung neuer Mini-Atomwaffen und drohte deren Einsatz gegen Staaten wie Syrien, Libyen, Iran oder den Irak an. Später gab das Weiße Haus eine Präsidentendirektive heraus, die deutlich machte, dass die USA Atomwaffen einsetzen könnten, wenn ihre Streitkräfte mit chemischen oder biologischen Waffen angegriffen würden.



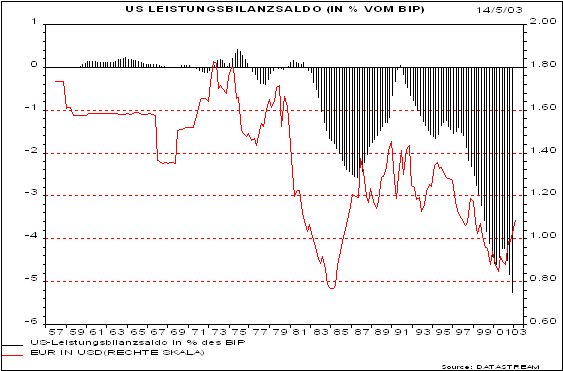
Servus Dolby
@Mini-Atomwaffen
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/14825/1.html
" ... in dem Strategiepapier "Nuclear Posture Review", das im Frühjahr 2002 der Öffentlichkeit zugespielt wurde, fünf Staaten als potenzielle Ziele von US-Atomwaffeneinsätzen genannt würden, die selbst keine Atomwaffen besitzen ( [Local Link] Pentagon plant Nuklearkrieg und den Einsatz taktischer Nuklearwaffen). "Solche Zielplanungen würden klar das Prinzip der `negativen Sicherheitsgarantien` verletzen". Bisher hatten die fünf offiziellen Atommächte Erklärungen abgegeben, niemals Atomwaffen gegen Nicht-Atomwaffen-Staaten einzusetzen. Diese Garantien gelten als Voraussetzung für das Funktionieren des Atomwaffensperrvertrages."
Tjaja, das "Vierte Reich" schert sich um nix mehr.
"Ist der Ruf erst ruiniert ...."
Mal schauen, wer nächtes Mal Kerzchen anzünden geht.
Coubert
@Mini-Atomwaffen
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/14825/1.html
" ... in dem Strategiepapier "Nuclear Posture Review", das im Frühjahr 2002 der Öffentlichkeit zugespielt wurde, fünf Staaten als potenzielle Ziele von US-Atomwaffeneinsätzen genannt würden, die selbst keine Atomwaffen besitzen ( [Local Link] Pentagon plant Nuklearkrieg und den Einsatz taktischer Nuklearwaffen). "Solche Zielplanungen würden klar das Prinzip der `negativen Sicherheitsgarantien` verletzen". Bisher hatten die fünf offiziellen Atommächte Erklärungen abgegeben, niemals Atomwaffen gegen Nicht-Atomwaffen-Staaten einzusetzen. Diese Garantien gelten als Voraussetzung für das Funktionieren des Atomwaffensperrvertrages."
Tjaja, das "Vierte Reich" schert sich um nix mehr.
"Ist der Ruf erst ruiniert ...."
Mal schauen, wer nächtes Mal Kerzchen anzünden geht.
Coubert
#240 von Coubert
joo
joo

http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0%2C2828%2C2495…
W A R E N B U F F E T T
Keine Steuergeschenke für die Reichen!
Börsenguru Waren Buffet torpediert die Steuerpläne von George Bush. Die Abschaffung der Dividendensteuer nutzt nur den Reichen, so Buffet. Seine persönliche Steuerquote würde um 310 Millionen Dollar auf drei Prozent fallen.
Washington - Der US-Investor Warren Buffett hat die Pläne des Präsidenten George Bush zur Abschaffung der Dividendensteuer als zutiefst unsoziales Geschenk an die Reichen kritisiert.
Ihre Verwirklichung würde die Steuerlast weiter zu Gunsten der Reichen verschieben, erklärte der Chef der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway in einem Beiträg für die "Washington Post".
Buffett rechnete vor, dass er im kommenden Jahr steuerfrei 310 Millionen Dollar kassieren würde, wenn Berkshire Hathaway eine Milliarde Dollar Dividende ausschütten würde. Seine persönliche Steuerquote würde dann auf drei Prozent fallen. Seine Empfangsdame würde aber weiterhin 30 Prozent Steuern auf ihr Einkommen zahlen müssen, also einen zehn Mal so hohen Anteil, schrieb Buffett.
Die Abschaffung der Dividendensteuer ist noch im Gesetzgebungsverfahren. Nach einem vom Senat bereits beschlossenen Gesetzentwurf soll die Steuer für dieses Jahr halbiert und für die kommenden 3 Jahre abgeschafft werden. Dann könnte das Gesetz überprüft werden. Es gilt in Washington aber als unwahrscheinlich, dass die Steuer nach einer Abschaffung wieder eingeführt würde.
W A R E N B U F F E T T
Keine Steuergeschenke für die Reichen!
Börsenguru Waren Buffet torpediert die Steuerpläne von George Bush. Die Abschaffung der Dividendensteuer nutzt nur den Reichen, so Buffet. Seine persönliche Steuerquote würde um 310 Millionen Dollar auf drei Prozent fallen.
Washington - Der US-Investor Warren Buffett hat die Pläne des Präsidenten George Bush zur Abschaffung der Dividendensteuer als zutiefst unsoziales Geschenk an die Reichen kritisiert.
Ihre Verwirklichung würde die Steuerlast weiter zu Gunsten der Reichen verschieben, erklärte der Chef der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway in einem Beiträg für die "Washington Post".
Buffett rechnete vor, dass er im kommenden Jahr steuerfrei 310 Millionen Dollar kassieren würde, wenn Berkshire Hathaway eine Milliarde Dollar Dividende ausschütten würde. Seine persönliche Steuerquote würde dann auf drei Prozent fallen. Seine Empfangsdame würde aber weiterhin 30 Prozent Steuern auf ihr Einkommen zahlen müssen, also einen zehn Mal so hohen Anteil, schrieb Buffett.
Die Abschaffung der Dividendensteuer ist noch im Gesetzgebungsverfahren. Nach einem vom Senat bereits beschlossenen Gesetzentwurf soll die Steuer für dieses Jahr halbiert und für die kommenden 3 Jahre abgeschafft werden. Dann könnte das Gesetz überprüft werden. Es gilt in Washington aber als unwahrscheinlich, dass die Steuer nach einer Abschaffung wieder eingeführt würde.
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,249943,00.h…
ALLTAGSMYTHEN
Kanonenfutter fürs Geflügel-Geschütz
Von Markus Becker
Wie testet man die Windschutzscheibe eines Flugzeugs auf ihre Festigkeit? Man ballert ein Hühnchen vor das Fenster. Eigentlich eine gute Idee, glauben Amerikaner - so lange die dummen Briten das Katapult nicht ausborgen. Das Huhn ist in beiden Fällen des Todes, der Alltagsmythos aber ist dank des Internets zählebig.
Hamburg - Passagierjets sind zum Missvergnügen von Piloten nicht allein am Himmel. Vögel gibt es da auch noch, und die sind mitunter eine Gefahr für fliegende Menschen. Bei Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern wird das Federvieh bei der Kollision mit einem Flugzeug zum Geschoss, das schon so manchen Flieger abstürzen ließ.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) stellte sich dem Problem und baute ein Hühner-Katapult, um die Festigkeit der Cockpitscheiben unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen. Die Geflügel-Kanone ist authentisch: Die FAA benutzt sie, die US-Luftwaffe ballert ihr Geflügel gar mit einer Geschwindigkeit von fast 650 km/h auf die Kanzeln ihrer Kampfflugzeuge.
So weit, so grässlich.
Im Januar 1996 aber meldete "Feathers", das offizielle Magazin der kalifornischen Geflügelindustrie, dass britische Eisenbahningenieure sich von der FAA die Hühnchen-Schleuder (im Geflügelschützen-Jargon auch "Rooster Booster" genannt) geborgt hätten - um das Glas einer neuen Hochgeschwindigkeits-Lokomotive zu testen.
Hühnchen schockt Briten
Sie zielten, schossen - und erschauderten. Auf seinem letzten Flug zerschmetterte das Hühnchen die Windschutzscheibe der Lok, zerriss die Instrumententafel, bohrte sich durch den Sitz des Lokführers und blieb in der Wand des Cockpits stecken. Wahrhaft geschockt riefen die verwirrten Briten bei den amerikanischen Luftfahrtingenieuren an. Ob sie denn auch alles richtig gemacht hätten, wollten sie wissen. Die FAA-Experten nahmen den Test unter die Lupe und hatten am Ende einen wertvollen Tipp parat: Die Kollegen von der Insel sollten es bei der nächsten Kanonade mit einem aufgetauten Huhn versuchen.
Die "Feathers"-Geschichte, wiewohl schon viele Jahre alt, schaffte es sogar in deutsche Tageszeitungen, allerdings als Anekdote aus der Realität. Die betreffenden Blätter befinden sich in guter Gesellschaft: Laut Snopes.com, der Referenzseite für Alltagsmythen, gab selbst der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Europa Wesley Clark die Geschichte vom Glucken-Geschütz in mehreren Reden als Tatsachenbericht zum Besten.
Die anglo-amerikanische Hühner-Kanonade aber ist eher eine besonders zählebige "urban legend" nach Art der Spinne in der Yukkapalme. Zudem mutiert die Story offenbar regelmäßig - je nachdem, wer dumm dastehen soll. Laut Snopes.com trifft es mal die Briten, mal die Franzosen, manchmal auch die Amerikaner selbst. In einem 1988 in Australien erschienenen Buch über Alltagsmythen etwa beweist das gefiederte Projektil die Einfalt amerikanischer Ingenieure, die ein tiefgefrorenes Exemplar der Gattung Gallus domesticus in eine laufende Turbine schießen. Mit allen unangenehmen Folgen.
Eisig, halbgefroren oder aufgetaut?
Vielleicht aber, spekuliert man im Netz, ist das Verschießen von gefrorenem Geflügel gar nicht mal so dumm. Denn was einem fleischigen Eisblock widersteht, sollte einem Vogel im Naturzustand erst recht standhalten können. Auch Halbgefrorenes könnte sinnvoll sein: Um etwa zu simulieren, wie ein Vogel sich im Angesicht des harten Aufpralls versteift.
Die Rache der Amerikaner auf die Eisvogel-Retourkutsche folgte laut Snopes.com im Jahr 1994. In einer neuen Version der Geschichte ließen sie britische Flugingenieure die Kanone mit einem gefrorenen Hühnchen laden und dann in die Kantine verschwinden, um dem Geflügel Zeit zum Auftauen zu geben. Als die Briten zurückkamen, stellten sie sich hinter ihre Schutzmauer, machten die Hochgeschwindigkeitskameras bereit und feuerten das Huhn (Kanonier-Jargon: "Pullet Bullet" ) ab.
Fleischiges Doppelgeschoss
Normalerweise sollte das Chicken an der Glaskanzel zu Nuggets zerbröseln und allenfalls eine hässliche Beule hinterlassen. Dieses Mal aber zerbarst die Scheibe unter ohrenbetäubendem Lärm. Den Briten, ein weiteres Mal geschockt, flogen die Splitter um die Ohren. Als sich der Schreck gelegt hatte, überprüften sie die Kanone. Kein Befund.
Dann sahen sie sich die Aufnahmen ihrer Hochgeschwindigkeitskameras an. Das Huhn, stellte sich in der Geschichte heraus, hatte unverhofft Gesellschaft bekommen. Während die Bastler in der Kantine saßen, war auch die Laborkatze hungrig geworden - und zum Hühnerlutschen ins Kanonenrohr geklettert.

ALLTAGSMYTHEN
Kanonenfutter fürs Geflügel-Geschütz
Von Markus Becker
Wie testet man die Windschutzscheibe eines Flugzeugs auf ihre Festigkeit? Man ballert ein Hühnchen vor das Fenster. Eigentlich eine gute Idee, glauben Amerikaner - so lange die dummen Briten das Katapult nicht ausborgen. Das Huhn ist in beiden Fällen des Todes, der Alltagsmythos aber ist dank des Internets zählebig.
Hamburg - Passagierjets sind zum Missvergnügen von Piloten nicht allein am Himmel. Vögel gibt es da auch noch, und die sind mitunter eine Gefahr für fliegende Menschen. Bei Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern wird das Federvieh bei der Kollision mit einem Flugzeug zum Geschoss, das schon so manchen Flieger abstürzen ließ.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) stellte sich dem Problem und baute ein Hühner-Katapult, um die Festigkeit der Cockpitscheiben unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen. Die Geflügel-Kanone ist authentisch: Die FAA benutzt sie, die US-Luftwaffe ballert ihr Geflügel gar mit einer Geschwindigkeit von fast 650 km/h auf die Kanzeln ihrer Kampfflugzeuge.
So weit, so grässlich.
Im Januar 1996 aber meldete "Feathers", das offizielle Magazin der kalifornischen Geflügelindustrie, dass britische Eisenbahningenieure sich von der FAA die Hühnchen-Schleuder (im Geflügelschützen-Jargon auch "Rooster Booster" genannt) geborgt hätten - um das Glas einer neuen Hochgeschwindigkeits-Lokomotive zu testen.
Hühnchen schockt Briten
Sie zielten, schossen - und erschauderten. Auf seinem letzten Flug zerschmetterte das Hühnchen die Windschutzscheibe der Lok, zerriss die Instrumententafel, bohrte sich durch den Sitz des Lokführers und blieb in der Wand des Cockpits stecken. Wahrhaft geschockt riefen die verwirrten Briten bei den amerikanischen Luftfahrtingenieuren an. Ob sie denn auch alles richtig gemacht hätten, wollten sie wissen. Die FAA-Experten nahmen den Test unter die Lupe und hatten am Ende einen wertvollen Tipp parat: Die Kollegen von der Insel sollten es bei der nächsten Kanonade mit einem aufgetauten Huhn versuchen.
Die "Feathers"-Geschichte, wiewohl schon viele Jahre alt, schaffte es sogar in deutsche Tageszeitungen, allerdings als Anekdote aus der Realität. Die betreffenden Blätter befinden sich in guter Gesellschaft: Laut Snopes.com, der Referenzseite für Alltagsmythen, gab selbst der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber für Europa Wesley Clark die Geschichte vom Glucken-Geschütz in mehreren Reden als Tatsachenbericht zum Besten.
Die anglo-amerikanische Hühner-Kanonade aber ist eher eine besonders zählebige "urban legend" nach Art der Spinne in der Yukkapalme. Zudem mutiert die Story offenbar regelmäßig - je nachdem, wer dumm dastehen soll. Laut Snopes.com trifft es mal die Briten, mal die Franzosen, manchmal auch die Amerikaner selbst. In einem 1988 in Australien erschienenen Buch über Alltagsmythen etwa beweist das gefiederte Projektil die Einfalt amerikanischer Ingenieure, die ein tiefgefrorenes Exemplar der Gattung Gallus domesticus in eine laufende Turbine schießen. Mit allen unangenehmen Folgen.
Eisig, halbgefroren oder aufgetaut?
Vielleicht aber, spekuliert man im Netz, ist das Verschießen von gefrorenem Geflügel gar nicht mal so dumm. Denn was einem fleischigen Eisblock widersteht, sollte einem Vogel im Naturzustand erst recht standhalten können. Auch Halbgefrorenes könnte sinnvoll sein: Um etwa zu simulieren, wie ein Vogel sich im Angesicht des harten Aufpralls versteift.
Die Rache der Amerikaner auf die Eisvogel-Retourkutsche folgte laut Snopes.com im Jahr 1994. In einer neuen Version der Geschichte ließen sie britische Flugingenieure die Kanone mit einem gefrorenen Hühnchen laden und dann in die Kantine verschwinden, um dem Geflügel Zeit zum Auftauen zu geben. Als die Briten zurückkamen, stellten sie sich hinter ihre Schutzmauer, machten die Hochgeschwindigkeitskameras bereit und feuerten das Huhn (Kanonier-Jargon: "Pullet Bullet" ) ab.
Fleischiges Doppelgeschoss
Normalerweise sollte das Chicken an der Glaskanzel zu Nuggets zerbröseln und allenfalls eine hässliche Beule hinterlassen. Dieses Mal aber zerbarst die Scheibe unter ohrenbetäubendem Lärm. Den Briten, ein weiteres Mal geschockt, flogen die Splitter um die Ohren. Als sich der Schreck gelegt hatte, überprüften sie die Kanone. Kein Befund.
Dann sahen sie sich die Aufnahmen ihrer Hochgeschwindigkeitskameras an. Das Huhn, stellte sich in der Geschichte heraus, hatte unverhofft Gesellschaft bekommen. Während die Bastler in der Kantine saßen, war auch die Laborkatze hungrig geworden - und zum Hühnerlutschen ins Kanonenrohr geklettert.

US-Kongress billigt Anhebung der Verschuldungsobergrenze
Washington, 24. Mai (Reuters) - Nach der Verabschiedung eines umfassenden Steuersenkungspakets hat der US-Kongress am Freitag eine Anhebung der Obergrenze für die Staatsverschuldung in einem so hohen Maße gebilligt, wie nie zuvor.
Mit 53 zu 44 Stimmen stimmte der Senat für eine Vorlage, wonach die Obergrenze für die Staatsverschuldung von derzeit 6,4 Billionen Dollar um 984 Milliarden Dollar erhöht werden soll. Damit beuge der Kongress Unsicherheiten vor, die die US-Wirtschaft negativ beeinflussen könnten, sagte US-Finanzminister John Snow. Das Repräsentantenhaus hatte die Vorlage bereits im April verabschiedet. Es wird nun erwartet, dass US-Präsident George W. Bush das Gesetz in Kraft setzt. Das Finanzministerium hatte seit Februar mit allen Mitteln versucht, die Staatsverschuldung unter der bisherigen Obergrenze zu halten. Doch in der vergangenen Woche sagte Snow, es seien alle vernünftigen und rechtmäßigen Maßnahmen ausgereizt, um eine beispiellose Staatsverschuldung bis zum 28. Mai zu verhindern.
Die oppositionellen Demokraten haben Bush vorgeworfen, bereits mit seinen Steuerkürzungen aus dem Jahr 2001 für einen Anstieg der Staatsverschuldung gesorgt zu haben. Die neuen Steuersenkungen würden die Haushaltslöcher nur noch vergrößern. Die Republikaner versprechen sich von dem Paket einen Anstieg der Aktienkurse, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und so einen Anstieg der Staatseinkünfte.
Der US-Kongress hatte am Freitagmorgen dem Steuersenkungspaket in Höhe von 350 Milliarden Dollar zugestimmt. Dies ist etwa die Hälfte der Summe, um die Bush ursprünglich gebeten hatte.
chg/jas
--------
Kursziel für den €uro 1.40 !
Washington, 24. Mai (Reuters) - Nach der Verabschiedung eines umfassenden Steuersenkungspakets hat der US-Kongress am Freitag eine Anhebung der Obergrenze für die Staatsverschuldung in einem so hohen Maße gebilligt, wie nie zuvor.
Mit 53 zu 44 Stimmen stimmte der Senat für eine Vorlage, wonach die Obergrenze für die Staatsverschuldung von derzeit 6,4 Billionen Dollar um 984 Milliarden Dollar erhöht werden soll. Damit beuge der Kongress Unsicherheiten vor, die die US-Wirtschaft negativ beeinflussen könnten, sagte US-Finanzminister John Snow. Das Repräsentantenhaus hatte die Vorlage bereits im April verabschiedet. Es wird nun erwartet, dass US-Präsident George W. Bush das Gesetz in Kraft setzt. Das Finanzministerium hatte seit Februar mit allen Mitteln versucht, die Staatsverschuldung unter der bisherigen Obergrenze zu halten. Doch in der vergangenen Woche sagte Snow, es seien alle vernünftigen und rechtmäßigen Maßnahmen ausgereizt, um eine beispiellose Staatsverschuldung bis zum 28. Mai zu verhindern.
Die oppositionellen Demokraten haben Bush vorgeworfen, bereits mit seinen Steuerkürzungen aus dem Jahr 2001 für einen Anstieg der Staatsverschuldung gesorgt zu haben. Die neuen Steuersenkungen würden die Haushaltslöcher nur noch vergrößern. Die Republikaner versprechen sich von dem Paket einen Anstieg der Aktienkurse, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und so einen Anstieg der Staatseinkünfte.
Der US-Kongress hatte am Freitagmorgen dem Steuersenkungspaket in Höhe von 350 Milliarden Dollar zugestimmt. Dies ist etwa die Hälfte der Summe, um die Bush ursprünglich gebeten hatte.
chg/jas
--------
Kursziel für den €uro 1.40 !

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,249990,00.html
IRAKISCHE LIEFERVERTRÄGE
Neustart für das Ölgeschäft
Lieferverträge, welche Ölkonzerne vor dem Sturz Saddam Husseins mit dem Irak geschlossen haben, sind nach der neuen Resolution der Uno möglicherweise nichtig. Vor allem Russland will diese Auslegung internationalen Rechts jedoch nicht akzeptieren.
New York - "Die Verträge wurden von einer früheren Regierung unterzeichnet und die neue Resolution greift dieses Thema nicht auf", verlautete am Donnerstag aus Diplomatenkreisen westlicher Staaten. "Sie werden nicht anerkannt werden", hieß es. Der Uno-Sicherheitsrat stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für ein Ende seiner Sanktionen gegen den Irak und gab den USA und Großbritannien weit reichende Vollmachten, das Land und seine Ölindustrie zu verwalten.
Russland wird nach den Worten von Außenminister Igor Iwanow auf die Erfüllung seiner Öl-Verträge bestehen. Die Verträge sollten vollständig erfüllt werden, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Iwanow bei dessen Besuch in Paris anlässlich des Treffens der G-8-Außenminister. Russische Ölkonzerne wie Lukoil und andere Firmen haben insgesamt Verträge mit einem Volumen von vier Milliarden Dollar mit dem Irak.
---------
Jetzt wird der Vergewaltiger zum Richter
IRAKISCHE LIEFERVERTRÄGE
Neustart für das Ölgeschäft
Lieferverträge, welche Ölkonzerne vor dem Sturz Saddam Husseins mit dem Irak geschlossen haben, sind nach der neuen Resolution der Uno möglicherweise nichtig. Vor allem Russland will diese Auslegung internationalen Rechts jedoch nicht akzeptieren.
New York - "Die Verträge wurden von einer früheren Regierung unterzeichnet und die neue Resolution greift dieses Thema nicht auf", verlautete am Donnerstag aus Diplomatenkreisen westlicher Staaten. "Sie werden nicht anerkannt werden", hieß es. Der Uno-Sicherheitsrat stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für ein Ende seiner Sanktionen gegen den Irak und gab den USA und Großbritannien weit reichende Vollmachten, das Land und seine Ölindustrie zu verwalten.
Russland wird nach den Worten von Außenminister Igor Iwanow auf die Erfüllung seiner Öl-Verträge bestehen. Die Verträge sollten vollständig erfüllt werden, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Iwanow bei dessen Besuch in Paris anlässlich des Treffens der G-8-Außenminister. Russische Ölkonzerne wie Lukoil und andere Firmen haben insgesamt Verträge mit einem Volumen von vier Milliarden Dollar mit dem Irak.
---------
Jetzt wird der Vergewaltiger zum Richter

nur für´s archiv ! 
http://www.espace.ch/dossiers/artikel/25837/artikel.html
Warum die Weltlage so wichtig ist
Solange die Weltwirtschaft nicht aus dem Loch kommt, gibts in der Schweiz kein Hoffen. Zu stark ist die Verflechtung.
Den USA kann die Weltwirtschaft ziemlich egal sein. Sie verkaufen den Grossteil ihrer Waren und Dienstleistungen an Kunden im eigenen Land. Mit einer Exportquote von gerade mal 11 Prozent gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) sind die Ausfuhren für Amerika von untergeordneter Bedeutung. Das Gleiche gilt, betrachtet man sie als Einheit, für die EU: Der Binnenmarkt ist gross, man genügt sich selbst, verkauft bloss 12 Prozent ausserhalb der Gemeinschaft.
Ganz anders die Schweiz. Bleiben die Exporte aus, liegt das kleine Land schlagartig darnieder. Hohe 43 Prozent des BIP verdient Helvetien mit dem Verkauf an Ausländer, den grössten Teil davon mit Waren (139 Milliarden Franken im letzten Jahr), den Rest (41 Milliarden) mit Dienstleistungen, Fremdenverkehr eingeschlossen.
Tendenz in den letzten Jahren: steigend. Bevor die Schweizer Ausfuhren zwischen 1997 und 2000 in die Höhe schossen, hatte die Exportquote unter 35 Prozent gelegen. Die wichtigsten Abnehmerländer von Schweizer Waren sind in absteigender Reihenfolge: Deutschland (22%), die USA (11%), Frankreich (9%), Italien (8%), Grossbritannien (5%) und Japan (4%).
Klar, leidet angesichts dieser starken Verflechtung nicht nur die Export-, sondern auch die Binnenwirtschaft unter einem Exporteinbruch. Zumal dann, wenn er - wie heute - so heftig ausfällt wie seit 1982 nicht mehr. So hat die rückläufige Nachfrage aus dem Ausland zu einer massiven Verschlechterung des Investitionsklimas geführt. Allein im zweiten Quartal diesen Jahres brachen die Ausrüstungsinvestitionen um 18 Prozent ein.
Was in der Krise Sorgen bereitet, ist im Boom ein erwünschter Wachstumstreiber. So waren die Exporte im Jahr 2000 für gut die Hälfte des Realwachstums von 3,2 Prozent verantwortlich. Solches lässt hoffen, macht aber auch deutlich, dass sich die Schweizer Wirtschaft ohne anziehende Weltkonjunktur nicht bewegen wird.
Das gilt letztlich für viele Länder, auch für solche mit einer geringeren Exportquote. Denn das Zusammenwachsen der globalen Finanzmärkte kettet die Konjunkturzyklen der Regionen immer stärker aneinander. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Börsen, die sich heute praktisch im Gleichklang bewegen.

http://www.espace.ch/dossiers/artikel/25837/artikel.html
Warum die Weltlage so wichtig ist
Solange die Weltwirtschaft nicht aus dem Loch kommt, gibts in der Schweiz kein Hoffen. Zu stark ist die Verflechtung.
Den USA kann die Weltwirtschaft ziemlich egal sein. Sie verkaufen den Grossteil ihrer Waren und Dienstleistungen an Kunden im eigenen Land. Mit einer Exportquote von gerade mal 11 Prozent gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) sind die Ausfuhren für Amerika von untergeordneter Bedeutung. Das Gleiche gilt, betrachtet man sie als Einheit, für die EU: Der Binnenmarkt ist gross, man genügt sich selbst, verkauft bloss 12 Prozent ausserhalb der Gemeinschaft.
Ganz anders die Schweiz. Bleiben die Exporte aus, liegt das kleine Land schlagartig darnieder. Hohe 43 Prozent des BIP verdient Helvetien mit dem Verkauf an Ausländer, den grössten Teil davon mit Waren (139 Milliarden Franken im letzten Jahr), den Rest (41 Milliarden) mit Dienstleistungen, Fremdenverkehr eingeschlossen.
Tendenz in den letzten Jahren: steigend. Bevor die Schweizer Ausfuhren zwischen 1997 und 2000 in die Höhe schossen, hatte die Exportquote unter 35 Prozent gelegen. Die wichtigsten Abnehmerländer von Schweizer Waren sind in absteigender Reihenfolge: Deutschland (22%), die USA (11%), Frankreich (9%), Italien (8%), Grossbritannien (5%) und Japan (4%).
Klar, leidet angesichts dieser starken Verflechtung nicht nur die Export-, sondern auch die Binnenwirtschaft unter einem Exporteinbruch. Zumal dann, wenn er - wie heute - so heftig ausfällt wie seit 1982 nicht mehr. So hat die rückläufige Nachfrage aus dem Ausland zu einer massiven Verschlechterung des Investitionsklimas geführt. Allein im zweiten Quartal diesen Jahres brachen die Ausrüstungsinvestitionen um 18 Prozent ein.
Was in der Krise Sorgen bereitet, ist im Boom ein erwünschter Wachstumstreiber. So waren die Exporte im Jahr 2000 für gut die Hälfte des Realwachstums von 3,2 Prozent verantwortlich. Solches lässt hoffen, macht aber auch deutlich, dass sich die Schweizer Wirtschaft ohne anziehende Weltkonjunktur nicht bewegen wird.
Das gilt letztlich für viele Länder, auch für solche mit einer geringeren Exportquote. Denn das Zusammenwachsen der globalen Finanzmärkte kettet die Konjunkturzyklen der Regionen immer stärker aneinander. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Börsen, die sich heute praktisch im Gleichklang bewegen.
12:37pm 05/24/03 BUSH: TAX CHANGE WILL BOOSTE ECONOMY, CREATE JOBS
12:36pm 05/24/03 BUSH SAYS TAX CHANGES WILL HELP FAMILIES, ENTREPRENEURS
12:35pm 05/24/03 BUSH WEEKLY RADIO SPEECH NOTES VICTORY ON TAX CUTS

12:36pm 05/24/03 BUSH SAYS TAX CHANGES WILL HELP FAMILIES, ENTREPRENEURS
12:35pm 05/24/03 BUSH WEEKLY RADIO SPEECH NOTES VICTORY ON TAX CUTS

Präzisionswaffe Dollar
Florian Rötzer
General Tommy Franks, Oberbefehlshaber im Irak-Krieg, offenbart, dass zahlreiche irakische Offiziere bestochen wurden, um keinen Widerstand zu leisten
US-Präsident Bush oder Verteidigungsminister Rumsfeld feierten den Sieg über das Hussein-Regime. "Operation Iraqi Freedom wurde mit einer Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Tapferkeit ausgeführt, die der Feind nicht erwartet und die Welt zuvor nicht gesehen hatte", beteuerte Bush. Rumsfeld verwies auf die neue Strategie, die neuen Hightech-Waffen oder den verstärkten Einsatz von Spezialtruppen. Von der wirklichen Geheimwaffe war allerdings nicht die Rede.
Tatsächlich war erstaunlich, wie schnell der Irak eingenommen werden konnte und wie gering der Widerstand war. Dass die Bodentruppen so schnell vorrücken konnten, verdankte sich überwiegend der Strategie der irakischen Armee, nur noch die Städte zu verteidigen. Doch auch hier brach der Widerstand, so vorhanden, oft plötzlich zusammen, weil die Soldaten einfach verschwanden ( Die Vaporisierung der Diktatur).
Das Regime war am Ende und brach, unterstützt durch den Angriff und die Angst vor der unweigerlichen Niederlage gegenüber der weit überlegenen Macht, in sich zusammen, ohne den erwarteten oder auch möglichen Widerstand zu leisten, der gerade im Stadtkampf möglich gewesen wäre. Abgesehen von den Kurden trat auch nicht ein, dass beispielsweise die von Hussein lange brutal unterdrückten Schiiten die "Befreier" jubelnd begrüßten und sich gegen die irakische Armee erhoben.
General Franks, der das Oberkommando im Krieg gegen Afghanistan und gegen den Irak innehatte, hat nun einen Hinweis darauf gegeben, welche Wunderwaffe den schnellen Sieg über das Hussein-Regime kräftig unterstützt zu haben scheint. Gegenüber Defense News sagte er, dass Spezialeinheiten und Geheimdienstmitarbeiter schon vor dem Krieg in Kontakt mit hohen irakischen Offizieren in wichtigen Städten getreten sind und sie bestochen haben, nicht gegen die amerikanischen Truppen zu kämpfen. Er habe schon vor dem Krieg Briefe von irakischen Generälen erhalten, so berichtet Slate in denen sie versicherten: "Ich arbeite jetzt für Sie."
Bekannt wurde schon Monate vor dem Kriegsbeginn, dass Spezialeinheiten sich schon im Irak aufgehalten haben. Es gab auch Meldungen, dass Verhandlungen mit dem irakischen Militär stattgefunden hätten. Auch noch im Krieg war die Rede von Waffenstillstandsverhandlungen, beispielsweise während des Kampfes um Basra. Gerüchte gab es auch, dass manche der menschlichen Schutzschilde CIA-Agenten gewesen wären, die die Lage erkundet und Offiziere bestochen haben.
Franks hielt allerdings genauere Einzelheiten zurück und gab nicht bekannt, welche oder wie viele Offiziere wann und mit wie viel Geld gekauft worden waren. Möglicherweise war aus diesem Grund auch der Widerstand in Bagdad so gering. Hier hatte man - offenbar aber nicht das Pentagon - mit schweren Kämpfen wegen der angeblich gefährlichen Einheiten der Republikanischen Garden gerechnet. Aber auch beim Einmarsch in Bagdad kam es nur zu vereinzelten Kämpfen, der Großteil der irakischen Truppen hatte die Stellungen verlassen und war untergetaucht. Wie viele irakische Soldaten durch die Bombardierung der Kasernen und anderen Stellungen getötet wurden, ist weitgehend unbekannt - wie noch so vieles in diesem geisterhaften Krieg, über den andererseits mehr als bei allen Kriegen und auch mit den "embeds" direkt von der Front berichtet worden ist. Welche Versprechungen über das Geld hinaus für das Niederlegen der Waffen geleistet wurden, wäre interessant zu erfahren und würde womöglich einiges über manche der systematischen Plünderungen verraten.
Die Strategie mit der Dollarwaffe hatte man allerdings auch bereits in Afghanistan eingesetzt, um sich dort die Unterstützung der Warlords zu kaufen, die für den amerikanischen Luftkrieg die Bodentruppen stellten ( Operation Anaconda: Kriegspropaganda). Dabei ist allerdings manches schief gegangen. Es kam beispielsweise zu Massakern ( Vorwürfe gegen US-Armee weiter ungeprüft) oder die erkaufte Loyalität ging nicht weit genug, so dass wichtige Taliban- und al-Qauida-Mitglieder fliehen konnten. Angeblich ließen Kämpfer der Nordallianz, die von den USA bezahlt wurden, nach der Bombardierung von Tora Bora viele al-Qaida Mitglieder einschließlich Bin Ladin fliehen, nachdem sie von diesen weiteres Geld erhalten hatten.
Ein hoher Pentagon-Mitarbeiter soll den Einsatz der Geldwaffe als sehr effiziente Kriegsführung bezeichnet haben, die zudem großes Blutvergießen verhindert habe: "Welchen Effekt will man erreichen? Wie viel kostet eine Cruise Missile? Zwischen 1 und 2,5 Millionen US-Dollar. Auch eine Bestechung ist eine PGM (Präzisionsbombe). Sie erreicht das Ziel, aber sie kostet kein Blut und es gibt null Kollateralschaden." Die Bestechungsaktion, so der Pentagon-Mitarbeiter weiter, sei mindestens so wichtig wie der tatsächliche Krieg mit Waffen gewesen: "Wir wussten, dass manche Einheiten aus einem Gefühl der Pflicht und des Patriotismus kämpfen würden, und das taten sie auch. Aber das veränderte das Ergebnis nicht, weil wir wussten, wie viele von ihnen sich krank melden würden."
Die Taktik, auf die geheime Präzisionswaffe Geld zu setzen, um militärische Siege zu erringen, ist sicherlich in Ländern, die arm und korrupt sind und/oder in denen die Menschen vornehmlich durch Zwang parieren, effektiv einzusetzen. Das mag auf viele arabische Länder zutreffen, in denen die Regierungen sich oft nur durch Unterdrückung der Opposition und durch Verweigerung der Demokratie halten können. Scheitern dürfte sie aber dort, wo Patriotismus vorherrscht. Und vermutlich werden muslimische Extremisten, die aus irgendwelchen Gründen für ihren Glauben und damit auch womöglich für ihr vermeintliches Seelenheil kämpfen, von Geld wenig beeindruckt sein. Wer bereit ist, Selbstmordanschläge ausführen, hat bereits auf materiellen Wohlstand verzichtet. Auch aus diesem Grund ist der Krieg gegen den "internationalen Terrorismus" muslimischer Prägung und gegen den Irak höchst verschieden.
Florian Rötzer
General Tommy Franks, Oberbefehlshaber im Irak-Krieg, offenbart, dass zahlreiche irakische Offiziere bestochen wurden, um keinen Widerstand zu leisten
US-Präsident Bush oder Verteidigungsminister Rumsfeld feierten den Sieg über das Hussein-Regime. "Operation Iraqi Freedom wurde mit einer Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Tapferkeit ausgeführt, die der Feind nicht erwartet und die Welt zuvor nicht gesehen hatte", beteuerte Bush. Rumsfeld verwies auf die neue Strategie, die neuen Hightech-Waffen oder den verstärkten Einsatz von Spezialtruppen. Von der wirklichen Geheimwaffe war allerdings nicht die Rede.
Tatsächlich war erstaunlich, wie schnell der Irak eingenommen werden konnte und wie gering der Widerstand war. Dass die Bodentruppen so schnell vorrücken konnten, verdankte sich überwiegend der Strategie der irakischen Armee, nur noch die Städte zu verteidigen. Doch auch hier brach der Widerstand, so vorhanden, oft plötzlich zusammen, weil die Soldaten einfach verschwanden ( Die Vaporisierung der Diktatur).
Das Regime war am Ende und brach, unterstützt durch den Angriff und die Angst vor der unweigerlichen Niederlage gegenüber der weit überlegenen Macht, in sich zusammen, ohne den erwarteten oder auch möglichen Widerstand zu leisten, der gerade im Stadtkampf möglich gewesen wäre. Abgesehen von den Kurden trat auch nicht ein, dass beispielsweise die von Hussein lange brutal unterdrückten Schiiten die "Befreier" jubelnd begrüßten und sich gegen die irakische Armee erhoben.
General Franks, der das Oberkommando im Krieg gegen Afghanistan und gegen den Irak innehatte, hat nun einen Hinweis darauf gegeben, welche Wunderwaffe den schnellen Sieg über das Hussein-Regime kräftig unterstützt zu haben scheint. Gegenüber Defense News sagte er, dass Spezialeinheiten und Geheimdienstmitarbeiter schon vor dem Krieg in Kontakt mit hohen irakischen Offizieren in wichtigen Städten getreten sind und sie bestochen haben, nicht gegen die amerikanischen Truppen zu kämpfen. Er habe schon vor dem Krieg Briefe von irakischen Generälen erhalten, so berichtet Slate in denen sie versicherten: "Ich arbeite jetzt für Sie."
Bekannt wurde schon Monate vor dem Kriegsbeginn, dass Spezialeinheiten sich schon im Irak aufgehalten haben. Es gab auch Meldungen, dass Verhandlungen mit dem irakischen Militär stattgefunden hätten. Auch noch im Krieg war die Rede von Waffenstillstandsverhandlungen, beispielsweise während des Kampfes um Basra. Gerüchte gab es auch, dass manche der menschlichen Schutzschilde CIA-Agenten gewesen wären, die die Lage erkundet und Offiziere bestochen haben.
Franks hielt allerdings genauere Einzelheiten zurück und gab nicht bekannt, welche oder wie viele Offiziere wann und mit wie viel Geld gekauft worden waren. Möglicherweise war aus diesem Grund auch der Widerstand in Bagdad so gering. Hier hatte man - offenbar aber nicht das Pentagon - mit schweren Kämpfen wegen der angeblich gefährlichen Einheiten der Republikanischen Garden gerechnet. Aber auch beim Einmarsch in Bagdad kam es nur zu vereinzelten Kämpfen, der Großteil der irakischen Truppen hatte die Stellungen verlassen und war untergetaucht. Wie viele irakische Soldaten durch die Bombardierung der Kasernen und anderen Stellungen getötet wurden, ist weitgehend unbekannt - wie noch so vieles in diesem geisterhaften Krieg, über den andererseits mehr als bei allen Kriegen und auch mit den "embeds" direkt von der Front berichtet worden ist. Welche Versprechungen über das Geld hinaus für das Niederlegen der Waffen geleistet wurden, wäre interessant zu erfahren und würde womöglich einiges über manche der systematischen Plünderungen verraten.
Die Strategie mit der Dollarwaffe hatte man allerdings auch bereits in Afghanistan eingesetzt, um sich dort die Unterstützung der Warlords zu kaufen, die für den amerikanischen Luftkrieg die Bodentruppen stellten ( Operation Anaconda: Kriegspropaganda). Dabei ist allerdings manches schief gegangen. Es kam beispielsweise zu Massakern ( Vorwürfe gegen US-Armee weiter ungeprüft) oder die erkaufte Loyalität ging nicht weit genug, so dass wichtige Taliban- und al-Qauida-Mitglieder fliehen konnten. Angeblich ließen Kämpfer der Nordallianz, die von den USA bezahlt wurden, nach der Bombardierung von Tora Bora viele al-Qaida Mitglieder einschließlich Bin Ladin fliehen, nachdem sie von diesen weiteres Geld erhalten hatten.
Ein hoher Pentagon-Mitarbeiter soll den Einsatz der Geldwaffe als sehr effiziente Kriegsführung bezeichnet haben, die zudem großes Blutvergießen verhindert habe: "Welchen Effekt will man erreichen? Wie viel kostet eine Cruise Missile? Zwischen 1 und 2,5 Millionen US-Dollar. Auch eine Bestechung ist eine PGM (Präzisionsbombe). Sie erreicht das Ziel, aber sie kostet kein Blut und es gibt null Kollateralschaden." Die Bestechungsaktion, so der Pentagon-Mitarbeiter weiter, sei mindestens so wichtig wie der tatsächliche Krieg mit Waffen gewesen: "Wir wussten, dass manche Einheiten aus einem Gefühl der Pflicht und des Patriotismus kämpfen würden, und das taten sie auch. Aber das veränderte das Ergebnis nicht, weil wir wussten, wie viele von ihnen sich krank melden würden."
Die Taktik, auf die geheime Präzisionswaffe Geld zu setzen, um militärische Siege zu erringen, ist sicherlich in Ländern, die arm und korrupt sind und/oder in denen die Menschen vornehmlich durch Zwang parieren, effektiv einzusetzen. Das mag auf viele arabische Länder zutreffen, in denen die Regierungen sich oft nur durch Unterdrückung der Opposition und durch Verweigerung der Demokratie halten können. Scheitern dürfte sie aber dort, wo Patriotismus vorherrscht. Und vermutlich werden muslimische Extremisten, die aus irgendwelchen Gründen für ihren Glauben und damit auch womöglich für ihr vermeintliches Seelenheil kämpfen, von Geld wenig beeindruckt sein. Wer bereit ist, Selbstmordanschläge ausführen, hat bereits auf materiellen Wohlstand verzichtet. Auch aus diesem Grund ist der Krieg gegen den "internationalen Terrorismus" muslimischer Prägung und gegen den Irak höchst verschieden.
28/05/2003 14:30
TABELLE-US-Auftragseingang für langlebige Güter gesunken
Washington, 28. Mai (Reuters) - Das US-Handelsministerium
hat am Mittwoch in Washington folgende Zahlen zur Entwicklung
des Auftragseingangs für langlebige Güter im April
veröffentlicht:
APR 2003 MÄR 2003
(Veränderung gegen Vormonat)
Auftragseingang
langlebige Güter - 2,4 vH + 1,4 vH
ohne Rüstung - 1,5 vH + 0,7 vH
NOTE - Von Reuters befragte Analysten hatten für den
Berichtszeitraum mit einem Minus von 1,0 Prozent gerechnet.
fri/jas
-----
Kriegswirtschaft !
TABELLE-US-Auftragseingang für langlebige Güter gesunken
Washington, 28. Mai (Reuters) - Das US-Handelsministerium
hat am Mittwoch in Washington folgende Zahlen zur Entwicklung
des Auftragseingangs für langlebige Güter im April
veröffentlicht:
APR 2003 MÄR 2003
(Veränderung gegen Vormonat)
Auftragseingang
langlebige Güter - 2,4 vH + 1,4 vH
ohne Rüstung - 1,5 vH + 0,7 vH
NOTE - Von Reuters befragte Analysten hatten für den
Berichtszeitraum mit einem Minus von 1,0 Prozent gerechnet.
fri/jas
-----
Kriegswirtschaft !

US/Auftragseingang langl Güter April -2,4 (PROG: -1,3) Proz
Washington (vwd) - Die Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter bei den Unternehmen der US-Industrie sind im April kräftiger zurückgegangen als erwartet. Einer Mitteilung des US-Handelsministeriums vom Mittwoch zufolge verringerten sie sich auf Monatssicht um 2,4 Prozent. Von vwd befragte Volkswirte hatten vor dem Hintergrund des durch Bestellungen für Kampfflugzeuge bedingten kräftigen Anstiegs im Vormonat um revidiert 1,4 (vorläufig: plus 1,5) Prozent für April zwar auch mit einer Gegenreaktion gerechnet. Im Konsens wurde dabei allerdings lediglich ein Minus von 1,3 Prozent prognostiziert.
vwd/DJ/28.5.2003/jej
US/Auftragseingang langl Güter April -2,4 ... (zwei)
Laut US-Handelsministerium verzeichneten dabei nahezu alle Teilbereiche Rückgänge der Bestellungen. Positive Vorzeichen hätten lediglich die Kategorien Primärmetalle, Zivilflugzeuge sowie Computer verzeichnet. Der Auftragseingang ex Transport sank den Angaben der Behörde zufolge im April um 1,2 Prozent verglichen mit dem Vormonat, nachdem für März eine revidierte Zunahme um 1,1 (vorläufig: plus 1,8) Prozent ausgewiesen worden war.
Die Bestellungen ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors verringerten sich im April binnen Monatsfrist um 1,5 Prozent. Für März nannte das US-Handelsministerium hier ein revidiertes Plus von 0,7 Prozent, nachdem es vorläufig eine Zunahme um 1,3 Prozent ausgewiesen hatte.
Besonders kräftig sank der Auftragseingang der Behörde zufolge im April im Transportsektor, wo sich das Minus auf 5,4 Prozent belief. Dabei seien die Bestellungen von Automobilen und Automobilteilen um 3,0 Prozent geschrumpft, während die Orders von Zivilflugzeugen um 48,6 Prozent zulegten. Für den Rüstungssektor wies das US-Handelsministerium einen Rückgang der Bestellungen um 19,4 Prozent aus, wobei sich mit einem Minus von 26,4 Prozent die Aufträge für Militärflugzeuge besonders deutlich verringerten.
Beobachter wiesen in einer ersten Reaktion auf die Daten darauf hin, dass sich die US-Unternehmen bei der Auftragsvergabe offenbar weiterhin in Zurückhaltung übten.
vwd/DJ/28.5.2003/jej
Tabelle: US-Auftragseingang langlebiger Güter April
Auftragseingang
langl. Güter ex Transport ex Rüstung
Monat absolut +/- % absolut +/- % absolut +/- %
April 168,93 -2,4 119,33 -1,2 158,90 -1,5
PROGNOSE -1,3
März (R) 173,16 +1,4 120,75 +1,1 161,37 +0,7
März* 173,44 +1,5
März (V) 173,60 +2,0 121,20 +1,8 161,85 +1,3
Februar 170,83 -1,1 119,49 -2,3 160,28 -2,9
Investitionsgüter
Nichtrüstungsgüter Rüstungsgüter
Monat absolut +/- % absolut +/- %
April 55,64 -0,3 8,76 -19,4
März (R) 55,80 +3,1 10,86 +16,4
März (V) 54,98 +1,8 10,78 +16,1
Februar 54,10 -4,9 9,33 +37,4
- * = revidiert im Rahmen der Veröffentlichung der
Auftragseingänge für die US-Industrie am 2. Mai
- Angaben in Mrd USD
- saisonbereinigt
- R = revidiert, V = vorläufig
- Quelle Daten: US-Handelsministerium
- Quelle Prognose: vwd Umfrage
vwd/DJ/28.5.2003/jej

Washington (vwd) - Die Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter bei den Unternehmen der US-Industrie sind im April kräftiger zurückgegangen als erwartet. Einer Mitteilung des US-Handelsministeriums vom Mittwoch zufolge verringerten sie sich auf Monatssicht um 2,4 Prozent. Von vwd befragte Volkswirte hatten vor dem Hintergrund des durch Bestellungen für Kampfflugzeuge bedingten kräftigen Anstiegs im Vormonat um revidiert 1,4 (vorläufig: plus 1,5) Prozent für April zwar auch mit einer Gegenreaktion gerechnet. Im Konsens wurde dabei allerdings lediglich ein Minus von 1,3 Prozent prognostiziert.
vwd/DJ/28.5.2003/jej
US/Auftragseingang langl Güter April -2,4 ... (zwei)
Laut US-Handelsministerium verzeichneten dabei nahezu alle Teilbereiche Rückgänge der Bestellungen. Positive Vorzeichen hätten lediglich die Kategorien Primärmetalle, Zivilflugzeuge sowie Computer verzeichnet. Der Auftragseingang ex Transport sank den Angaben der Behörde zufolge im April um 1,2 Prozent verglichen mit dem Vormonat, nachdem für März eine revidierte Zunahme um 1,1 (vorläufig: plus 1,8) Prozent ausgewiesen worden war.
Die Bestellungen ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors verringerten sich im April binnen Monatsfrist um 1,5 Prozent. Für März nannte das US-Handelsministerium hier ein revidiertes Plus von 0,7 Prozent, nachdem es vorläufig eine Zunahme um 1,3 Prozent ausgewiesen hatte.
Besonders kräftig sank der Auftragseingang der Behörde zufolge im April im Transportsektor, wo sich das Minus auf 5,4 Prozent belief. Dabei seien die Bestellungen von Automobilen und Automobilteilen um 3,0 Prozent geschrumpft, während die Orders von Zivilflugzeugen um 48,6 Prozent zulegten. Für den Rüstungssektor wies das US-Handelsministerium einen Rückgang der Bestellungen um 19,4 Prozent aus, wobei sich mit einem Minus von 26,4 Prozent die Aufträge für Militärflugzeuge besonders deutlich verringerten.
Beobachter wiesen in einer ersten Reaktion auf die Daten darauf hin, dass sich die US-Unternehmen bei der Auftragsvergabe offenbar weiterhin in Zurückhaltung übten.
vwd/DJ/28.5.2003/jej
Tabelle: US-Auftragseingang langlebiger Güter April
Auftragseingang
langl. Güter ex Transport ex Rüstung
Monat absolut +/- % absolut +/- % absolut +/- %
April 168,93 -2,4 119,33 -1,2 158,90 -1,5
PROGNOSE -1,3
März (R) 173,16 +1,4 120,75 +1,1 161,37 +0,7
März* 173,44 +1,5
März (V) 173,60 +2,0 121,20 +1,8 161,85 +1,3
Februar 170,83 -1,1 119,49 -2,3 160,28 -2,9
Investitionsgüter
Nichtrüstungsgüter Rüstungsgüter
Monat absolut +/- % absolut +/- %
April 55,64 -0,3 8,76 -19,4
März (R) 55,80 +3,1 10,86 +16,4
März (V) 54,98 +1,8 10,78 +16,1
Februar 54,10 -4,9 9,33 +37,4
- * = revidiert im Rahmen der Veröffentlichung der
Auftragseingänge für die US-Industrie am 2. Mai
- Angaben in Mrd USD
- saisonbereinigt
- R = revidiert, V = vorläufig
- Quelle Daten: US-Handelsministerium
- Quelle Prognose: vwd Umfrage
vwd/DJ/28.5.2003/jej

> Kriegswirtschaft!
Rummmmmmsfeld versucht ja grad, mit dem Thema Iran die Rüstungsproduktion wieder zu steigern:
"Zweifelsfreie Bewiese für Terrorunterstützung und Massenvernichtungswaffen"
Play ist again, Donald!
Coubert
Rummmmmmsfeld versucht ja grad, mit dem Thema Iran die Rüstungsproduktion wieder zu steigern:
"Zweifelsfreie Bewiese für Terrorunterstützung und Massenvernichtungswaffen"
Play ist again, Donald!
Coubert
#251 von Coubert
Die Daten sprechen ja wohl Bände, oder?
Mit dem nächsten "Überfall" gucken wir wieder Auftragseingänge!
Die Daten sprechen ja wohl Bände, oder?
Mit dem nächsten "Überfall" gucken wir wieder Auftragseingänge!

30.05. 14:32
US: Inflationsindikator fällt deutlich
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Die frei verfügbaren Einkommen stiegen um 0.1% (Prognose:0,1%). Die privaten Ausgaben fielen um 0.1% (Prognose:0,3%). Dieser Rückgang entspricht jenem aus dem Januar 2003 und ist damit der größte seit September 2002. Die inflationsbereinigten Ausgaben stiegen um 0.1% nach 0.5% im März. Der Price Deflator, ein beliebter Indikator, den US-Notenbankchef Alan Greenspan zur Ermittlung der Inflationsrate verwendet, fiel im April um 0.2% nachdem er im März um 0.3% angestiegen war. Das ist der schwächste Wert seit dem 0.5% Rückgang im September 2001. Energiepreise gingen im April weiter zurück, so das Commerce Department. Die Kernrate des Price Deflators, der die schwankungsanfälligen Sektoren Nahrungsmittel und Energie ausklammert, bewegte sich zwischen Null und -0.1% in den vergangenen sieben Monaten.
30.05. 15:48
US: UoM Verbrauchervertrauen
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Der Index zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan lag im Mai zuletzt bei 92.1 (Prognose:92.5) Mitte Mai wurde noch ein Wert von 93.2 nach 86 im April gemeldet.
30.05. 16:00
US: Positiver NAPM PMI
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago lag im Mai bei 52.2 (Prognose: 48.5). Am Montag wird der nationale Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. In der jüngsten Vergangenheit zeigte der Chicago PMI jedoch eine höhere Schwankungsanfälligkeit als der nationale Index. Werte über 50 Punkten deuten auf eine expansive Aktivität in der prodzierenden Industrie hin.
US: Inflationsindikator fällt deutlich
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Die frei verfügbaren Einkommen stiegen um 0.1% (Prognose:0,1%). Die privaten Ausgaben fielen um 0.1% (Prognose:0,3%). Dieser Rückgang entspricht jenem aus dem Januar 2003 und ist damit der größte seit September 2002. Die inflationsbereinigten Ausgaben stiegen um 0.1% nach 0.5% im März. Der Price Deflator, ein beliebter Indikator, den US-Notenbankchef Alan Greenspan zur Ermittlung der Inflationsrate verwendet, fiel im April um 0.2% nachdem er im März um 0.3% angestiegen war. Das ist der schwächste Wert seit dem 0.5% Rückgang im September 2001. Energiepreise gingen im April weiter zurück, so das Commerce Department. Die Kernrate des Price Deflators, der die schwankungsanfälligen Sektoren Nahrungsmittel und Energie ausklammert, bewegte sich zwischen Null und -0.1% in den vergangenen sieben Monaten.
30.05. 15:48
US: UoM Verbrauchervertrauen
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Der Index zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan lag im Mai zuletzt bei 92.1 (Prognose:92.5) Mitte Mai wurde noch ein Wert von 93.2 nach 86 im April gemeldet.
30.05. 16:00
US: Positiver NAPM PMI
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago lag im Mai bei 52.2 (Prognose: 48.5). Am Montag wird der nationale Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. In der jüngsten Vergangenheit zeigte der Chicago PMI jedoch eine höhere Schwankungsanfälligkeit als der nationale Index. Werte über 50 Punkten deuten auf eine expansive Aktivität in der prodzierenden Industrie hin.
Nun drehen sie ab (man beachte die Grafik im gleichen Beitrag  ).....
).....
This way to Dow 10,000?
The market has passed one big milestone -- can it clear another?
June 4, 2003: 9:50 PM EDT
NEW YORK (CNN/Money) - It`s a big deal: after three-straight years of negative returns, Dow 9,000 marks a significant turn in the market, and -- potentially -- in investor sentiment.
The Dow Jones industrial average jumped 116 points, or 1.3 percent, on Wednesday to close above 9,000 for the first time in nearly 10 months as investors focused on a report showing unexpected strength in the service sector of the economy.
The S&P 500 rose 1.5 percent to its highest close in 11 months while the Nasdaq composite index, laden with tech issues, jumped 1.9 percent to its best close in just over a year.
To be sure, investors have a long way to go to gain back the trillions in shareholder wealth that has been lost since the bubble burst in early 2000.
It`s a pretty good start though. Consider: After Wednesday`s gains, the Dow is up about 8.4 percent so far this year, the S&P 500 has risen 12.1 percent and the Nasdaq`s gained a stunning 22.4 percent.
Indeed, though nobody wants to jinx things, this is very much -- by almost any definition -- a new bull market.
But bulls come and bulls go. And just like other false starts of the past three years, skeptics worry that the fundamentals of this latest advance aren`t sound.
Consider the latest economic data. The market clearly is pricing in a near-term economic rebound, but there is little evidence of it. The jobs market still is weak. Business spending is, too.
For a full round-up, see "Is Wall Street settling for good enough?" and what 10 key economic indicators are saying now.
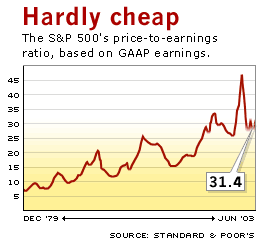
Valuations are another problem. The whole idea behind buying a few months ago was that, sure things looked rotten, but at least stocks were fairly cheap. No more. There are a lot of ways to assess stock values, of course.
All of which is to say you shouldn`t get too excited and make a lot of drastic moves in your portfolio. A lot of people pulled out of stocks last year, telling themselves they`d wait until the market seemed safer.
The problem is just when it seems safe (like now) is when the risks have increased.
Then there is the unusual strength in the Treasury market at the same time that stocks have been on fire.
And finally, some investment ideas: What`s right about Microsoft, Finding the perfect fund and Beware of dividends, which lists companies Merrill Lynch thinks are due to raise dividends.
http://money.cnn.com/2003/06/04/markets/dow9000/index.htm
syr
 ).....
).....This way to Dow 10,000?
The market has passed one big milestone -- can it clear another?
June 4, 2003: 9:50 PM EDT
NEW YORK (CNN/Money) - It`s a big deal: after three-straight years of negative returns, Dow 9,000 marks a significant turn in the market, and -- potentially -- in investor sentiment.
The Dow Jones industrial average jumped 116 points, or 1.3 percent, on Wednesday to close above 9,000 for the first time in nearly 10 months as investors focused on a report showing unexpected strength in the service sector of the economy.
The S&P 500 rose 1.5 percent to its highest close in 11 months while the Nasdaq composite index, laden with tech issues, jumped 1.9 percent to its best close in just over a year.
To be sure, investors have a long way to go to gain back the trillions in shareholder wealth that has been lost since the bubble burst in early 2000.
It`s a pretty good start though. Consider: After Wednesday`s gains, the Dow is up about 8.4 percent so far this year, the S&P 500 has risen 12.1 percent and the Nasdaq`s gained a stunning 22.4 percent.
Indeed, though nobody wants to jinx things, this is very much -- by almost any definition -- a new bull market.
But bulls come and bulls go. And just like other false starts of the past three years, skeptics worry that the fundamentals of this latest advance aren`t sound.
Consider the latest economic data. The market clearly is pricing in a near-term economic rebound, but there is little evidence of it. The jobs market still is weak. Business spending is, too.
For a full round-up, see "Is Wall Street settling for good enough?" and what 10 key economic indicators are saying now.
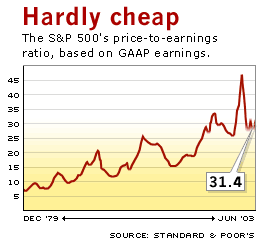
Valuations are another problem. The whole idea behind buying a few months ago was that, sure things looked rotten, but at least stocks were fairly cheap. No more. There are a lot of ways to assess stock values, of course.
All of which is to say you shouldn`t get too excited and make a lot of drastic moves in your portfolio. A lot of people pulled out of stocks last year, telling themselves they`d wait until the market seemed safer.
The problem is just when it seems safe (like now) is when the risks have increased.
Then there is the unusual strength in the Treasury market at the same time that stocks have been on fire.
And finally, some investment ideas: What`s right about Microsoft, Finding the perfect fund and Beware of dividends, which lists companies Merrill Lynch thinks are due to raise dividends.
http://money.cnn.com/2003/06/04/markets/dow9000/index.htm
syr
@syr,
das heißt, der Markt steht kurz vor dem Wendepunkt. Wenn unsere geliebten Analos 10Dausend schreien, dann fällts bald wie ein Stein.
Umgekehrt muß man kaufen, wenn die ganze Bande Kursziele von 3.000 verbreiten wird.
Achtet mal, bei den vorhergegangen Tiefs auf die Finanzpresse. Immer wenn sie extrem bearish war, drehte der Markt.

das heißt, der Markt steht kurz vor dem Wendepunkt. Wenn unsere geliebten Analos 10Dausend schreien, dann fällts bald wie ein Stein.
Umgekehrt muß man kaufen, wenn die ganze Bande Kursziele von 3.000 verbreiten wird.
Achtet mal, bei den vorhergegangen Tiefs auf die Finanzpresse. Immer wenn sie extrem bearish war, drehte der Markt.

GoingPublic Kolumne 13.06.2003, 13:59
Der Aufschwung, der nicht kam - Der US-Halbleiterverband und seine Prognose
Es hätte so schön sein können. Nach zwei Jahren der Dürre endlich wieder Wachstum, Kraft und Prosperität. Noch Anfang des Jahres wollte der amerikanische Halbleiterverband (SIA) dieses Szenario für 2003 erkennen und prognostizierte einen Umsatzsprung von gut 20 %. Mittlerweile sieht die SIA das etwas anders.
Anfang Februar dieses Jahres hatte der amerikanische Halbleiterverband Semiconductor Industry Association (SIA) noch Licht am Ende des Tunnels gesehen. Nach zwei Jahren rückläufiger Industrietendenzen sah der Verband wieder Wachstumschancen. Ein neues Hoch, wie im Boomjahr 2000 mit einem Branchenabsatz von 220 Mrd. US-$ würde 2003 zwar nicht werden. Aber etwa 170 Mrd. US-$ wären schon drin – immerhin. Daß das einen Umsatzsprung von 20 % auf den Vorjahreswert bedeutete, machte dem Verband keine Sorgen. In der Halbleiterindustrie geht es eben schnell runter, aber auch genauso schnell wieder nach oben. Hoffnungsträger war dabei die Handy-Branche, deren Nachfrage nach Chips die Schwäche der Telekommunikations- und PC-Industrie überkompensieren sollte.
Und der amerikanische Halbleiterverband stand mit seiner üppigen Prognose nicht einmal alleine da. Auch die Marktforscher von Gartner Dataquest strotzten vor Optimismus und erwarteten einen Umsatzsprung auf bis zu 172 Mrd. US-$. Nur die Unternehmen selbst blieben auf dem Teppich. Infineon ließ sich gar nicht erst zu einer eigenen Prognose hinreißen und STMicroelectronics erwartete damals schon, genauso wie auch Motorola, nur rund 10 % Wachstum – und dort ist jetzt auch die SIA angekommen.
Auf einmal hat sich die Prognose vom Anfang des Jahres als unhaltbar erwiesen. Zu optimistisch, wie der Verband jetzt eingeräumt hat. Die neue Schätzung geht von einem Wachstum von knapp 10 % p.a. bis 2006 aus, mit einem neuen Wachstumshoch in 2004, bei dem die Marke von 180 Mrd. US-$ erreicht werden soll. 2003 scheint abgehakt.
Unerwartet kommt diese Korrektur freilich nicht. Zum einen haben in der jüngsten Zeit selbst konservativ planende Unternehmen wie Texas Instruments (TI) ihre Prognose nach unten revidiert . Zum anderen erinnert die SIA mit ihrer Prognose-Politik stark an das Verhalten von Regierungen. Da zählt das Prinzip Hoffnung mehr als eine solide Zukunftsschätzung, und was nicht ins politische Kalkül paßt, wird sowieso nicht verkündet. Erst was nicht mehr abgestritten werden kann, ohne sich komplett der Lächerlichkeit preis zu geben, wird schließlich eingeräumt.
Ein Industrieverband gerät zwar nicht in die Gefahr, bei zu positiven Prognosen derart abgestraft zu werden, wie es bei börsennotierten Unternehmen und deren kommunizierten Wachstumserwartungen der Fall ist. Aber bei jeder neuen Prognose nur noch ein mitleidiges Lächeln zu ernten, dürfte auch die SIA nicht wirklich wollen. Die Regierung Schröder sei hier mahnendes Beispiel.
Die GoingPublic Kolumne ist ein Service des GoingPublic Magazins und erscheint zweimal wöchentlich in Zusammenarbeit mit dpa-AFX.
http://www.goingpublic.de/news/kolumne/detail.hbs?recnr=8460
Der Aufschwung, der nicht kam - Der US-Halbleiterverband und seine Prognose
Es hätte so schön sein können. Nach zwei Jahren der Dürre endlich wieder Wachstum, Kraft und Prosperität. Noch Anfang des Jahres wollte der amerikanische Halbleiterverband (SIA) dieses Szenario für 2003 erkennen und prognostizierte einen Umsatzsprung von gut 20 %. Mittlerweile sieht die SIA das etwas anders.
Anfang Februar dieses Jahres hatte der amerikanische Halbleiterverband Semiconductor Industry Association (SIA) noch Licht am Ende des Tunnels gesehen. Nach zwei Jahren rückläufiger Industrietendenzen sah der Verband wieder Wachstumschancen. Ein neues Hoch, wie im Boomjahr 2000 mit einem Branchenabsatz von 220 Mrd. US-$ würde 2003 zwar nicht werden. Aber etwa 170 Mrd. US-$ wären schon drin – immerhin. Daß das einen Umsatzsprung von 20 % auf den Vorjahreswert bedeutete, machte dem Verband keine Sorgen. In der Halbleiterindustrie geht es eben schnell runter, aber auch genauso schnell wieder nach oben. Hoffnungsträger war dabei die Handy-Branche, deren Nachfrage nach Chips die Schwäche der Telekommunikations- und PC-Industrie überkompensieren sollte.
Und der amerikanische Halbleiterverband stand mit seiner üppigen Prognose nicht einmal alleine da. Auch die Marktforscher von Gartner Dataquest strotzten vor Optimismus und erwarteten einen Umsatzsprung auf bis zu 172 Mrd. US-$. Nur die Unternehmen selbst blieben auf dem Teppich. Infineon ließ sich gar nicht erst zu einer eigenen Prognose hinreißen und STMicroelectronics erwartete damals schon, genauso wie auch Motorola, nur rund 10 % Wachstum – und dort ist jetzt auch die SIA angekommen.
Auf einmal hat sich die Prognose vom Anfang des Jahres als unhaltbar erwiesen. Zu optimistisch, wie der Verband jetzt eingeräumt hat. Die neue Schätzung geht von einem Wachstum von knapp 10 % p.a. bis 2006 aus, mit einem neuen Wachstumshoch in 2004, bei dem die Marke von 180 Mrd. US-$ erreicht werden soll. 2003 scheint abgehakt.
Unerwartet kommt diese Korrektur freilich nicht. Zum einen haben in der jüngsten Zeit selbst konservativ planende Unternehmen wie Texas Instruments (TI) ihre Prognose nach unten revidiert . Zum anderen erinnert die SIA mit ihrer Prognose-Politik stark an das Verhalten von Regierungen. Da zählt das Prinzip Hoffnung mehr als eine solide Zukunftsschätzung, und was nicht ins politische Kalkül paßt, wird sowieso nicht verkündet. Erst was nicht mehr abgestritten werden kann, ohne sich komplett der Lächerlichkeit preis zu geben, wird schließlich eingeräumt.
Ein Industrieverband gerät zwar nicht in die Gefahr, bei zu positiven Prognosen derart abgestraft zu werden, wie es bei börsennotierten Unternehmen und deren kommunizierten Wachstumserwartungen der Fall ist. Aber bei jeder neuen Prognose nur noch ein mitleidiges Lächeln zu ernten, dürfte auch die SIA nicht wirklich wollen. Die Regierung Schröder sei hier mahnendes Beispiel.
Die GoingPublic Kolumne ist ein Service des GoingPublic Magazins und erscheint zweimal wöchentlich in Zusammenarbeit mit dpa-AFX.
http://www.goingpublic.de/news/kolumne/detail.hbs?recnr=8460
schreibt nicht so viel 
3 beiträge in über zwei wochen

3 beiträge in über zwei wochen

http://www.zmag.de/article/article.php?id=672
Der Tag der Schakale
von Arundhati Roy
ZNet 02.06.2003
Mesopotamien. Babylon. Der Tigris und der Euphrat. Wie viele Kinder in wie vielen Klassenzimmern über wie viele Jahrhunderte sind durch die Vergangenheit gesegelt getragen auf den Flügeln dieser Worte?
Und nun sind Bomben gefallen, diese alte Zivilisation in Brand setzend und demütigend.
Auf die Stahlrümpfen ihrer Geschosse haben pubertierende amerikanische Soldaten anschauliche Mitteilungen in kindlicher Handschrift geschmiert: „For Saddam, from Fat Boy Posse.“
Ein Gebäude brach in sich zusammen. Ein Marktplatz. Ein Wohnhaus. Ein Mädchen, das einen Jungen liebte. Ein Kind, das nur mit den Murmeln seines älteren Bruders spielen wollte.
Am 21. März, dem Tag nach dem Beginn des illegalen Einsatzes und der illegalen Besetzung des Iraks durch amerikanische und britische Truppen, befragte ein „integrierter“ CNN-Korrespondent einen amerikanischen Soldaten. „Ich will da rein und aufräumen!“, sagte der Gefreite A.J.: „Ich will Vergeltung für den 11. September!“
Dem Korrespondenten muss man zugute halten, dass er, obschon „integriert“, immerhin schwächlich andeutete, dass es bislang keinen wirklichen Beweis gebe, der die irakische Regierung und die Ereignisse des 11. Septembers 2001 in Verbindung setzte. Soldat A.J. ließ seine Zunge bis übers Kinn gleiten: „Ach nun, das Zeug is mir zu hoch.“
Zur Zeit des Einmarsches der Vereinigten Staaten in den Irak schätzte eine Umfrage von CBS und New York Times, dass 42% der Amerikaner Saddam Hussein direkt für die Angriffe aufs World Trade Center und aufs Pentagon verantwortlich machten. Eine Umfrage der ABC-Nachrichten stellte fest, dass 55% der Amerikaner glaubten, dass Saddam Hussein Al Qaida unmittelbar unterstütze. All diesen Meinungen liegt kein Beweis zugrunde (weil es ihn nicht gibt). Sie alle beruhen auf Anspielungen, auf Selbstbetrug, auf glatten Lügen, die von den Medienunternehmen in Umlauf gebracht worden waren.
Öffentliche Unterstützung für den Irakkrieg der USA gründete sich auf einem vielschichtigen Komplex aus Falschheit und Betrug, koordiniert durch die US-Regierung und ergeben unterstützt von der Presse.
Da waren die erfundenen Verbindungen zwischen dem Irak und Al-Qaida. Die selbst gemachte Hysterie über Iraks „Massenvernichtungswaffen“. Keine Massenvernichtungswaffen konnten gefunden werden. Nicht einmal eine kleine.
Nun, nachdem der Krieg geführt und gewonnen und die Verträge über den Wiederaufbau gezeichnet und besiegelt sind, berichten die New York Times, dass „der CIA begonnen habe zu untersuchen, ob sich die amerikanischen Geheimdienste vor Kriegsbeginn in ihren Aussagen über Saddam Husseins Regierung und Iraks Waffenprogramme geirrt haben.“
Derweil wurde ganz am Rande eine alte Zivilisation gelegentlich verheert von einer sehr jungen, gelegentlich gewalttätigen Nation.
Während über eines Jahrzehnts aus Krieg und Sanktionen haben amerikanische und britische Einheiten tausende Geschosse und Bomben auf den Irak niedergehen lassen. Iraks Felder und Weiden sind mit dreihundert Tonnen abgereicherten Urans beschossen worden.
Auf ihren Angriffsflügen griffen die Alliierten Wasseraufbereitungsanlagen an, obschon sie darum wussten, dass sie nicht ohne Hilfe aus dem Ausland zu reparieren wären. Im Südirak gab es einen vierfachen Anstieg der Krebsfälle bei Kindern.
Im Jahrzehnt wirtschaftlicher Sanktionen, dass auf den ersten Krieg folgte, verweigerte man irakischen Zivilisten Medizin, Krankenhausausrüstung, Rettungstransportwagen, sauberes Wasser – das Nötigste.
Über eine halbe Million irakischer Kinder starben als Folge dieser Sanktionen.
Die Medienunternehmen spielten eine unbezahlbare Rolle, indem sie Nachrichten über die Zerstörung des Iraks und seiner Bevölkerung von der amerikanischen Öffentlichkeit fernhielten. Sie haben nun mit der Vorbereitung von Kriegen gegen Syrien und den Iran mit derselben Routine aus Lügen und Hysterie begonnen – und wer weiß, vielleicht auch gegen Saudi Arabien.
Vielleicht wird der nächste Krieg das Juwel in der Krone von Bushs Wahlkampf 2004 darstellen. Obgleich er nicht unbedingt zu solch drastischen Mitteln greifen muss, zumal die Demokraten erklärten, dass ihre Strategie für die Wahl 2004 darin bestehe, den Republikanern Schwäche in Fragen der inneren Sicherheit vorzuwerfen. Das ist, als ob ein jugendlicher Schläger aus der Provinz der Mafia zu viele Skrupel vorwürfe.
Es sieht aus, als ob die amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu einer völligen Zeitverschwendung ausarten werden. Obschon das nicht eigentlich eine Überraschung ist.
Die US-Invasion des Iraks war vermutlich der feigste Krieg aller Zeiten.
Nachdem man die „gute Autorität“ der UN-Diplomatie benutzte (Wirtschaftssanktionen und Waffeninspektionen) um sicherzustellen, dass der Iraks auf die Knie gezwungen würde; nachdem sichergestellt war, dass die meisten seiner Waffen zerstört waren, schickte die „Koalition der Willigen“, besser bekannt als die Koalition der Gezwungenen und Gedungenen, eine Invasionsarmee.
Dann kündeten die Medienunternehmen freudenvoll, dass die Vereinigten Staaten einen gerechten und überraschenden Sieg erzielt hätten.
Fernsehzuschauer wurden Zeuge der Freude, welche die US-Armee den gewöhnlichen Irakern brachte: All diese frisch befreiten Menschen, die amerikanische Flaggen schwenkten, die sie irgendwie während der Jahre der Sanktionen angehortet haben müssen.
Und dass die Umstürzung von Saddam Husseins Statue auf dem Firdosplatz (die wieder und wieder im Fernsehen gezeigt wurde) sich als das Werk einer Handvoll Mietlinge herausstellte, die von der US-Marineinfanterie abgestimmt wurden. Robert Fisk nannte es „die bestgezeigte Fotoinszenierung seit Iwo Jima (1)“.
Und nicht zu vergessen, dass in den darauf folgenden Tagen amerikanische Soldaten auf eine Gruppe friedlicher, unbewaffneter irakischer Demonstranten schossen, die den Abzug der US-Einheiten forderten. Fünfzehn Menschen wurden totgeschossen.
Dass einige Tage später US-Soldaten zwei weitere Menschen töteten und diverse verletzten, als diese gegen die Tötung von friedlichen Demonstranten demonstrierten. Dass sie 17 weitere Menschen in Mosul ermordeten.
Dass sie dieses Töten auch in Zukunft fortsetzen werden (wenn auch nicht im Fernsehen).
Dass das aufgeklärte Land zu religiöser Sektiererei getrieben wird.
Dass die US-Regierung Saddam Hussein geholfen hatte, an die Macht zu kommen, und ihn während seiner schlimmsten Verbrechen einschließlich des acht Jahre dauernden Krieges gegen den Iran und der Vergasungen von Kurden 1988 in Halabja unterstützte; Verbrechen, die 14 Jahre später aufgewärmt wurden und als Rechtfertigungsgründe für den neuen Irakkrieg dienten.
Dass nach dem ersten Golfkrieg die Alliierten eine Erhebung von Schiiten in Basra entfachten und dann wegsahen, als Saddam Hussein die Revolte zerschmetterte und Tausende in einem Akt der Rache dahinschlachtete.
Nach der Invasion löste sich das gierende Interesse westlicher Fernsehsender an neu entdeckten Massengräbern schnell in Luft auf, nachdem sie bemerkten, dass es sich um irakische Leichen aus dem Krieg gegen den Iran und der schiitischen Erhebung handelte... Die Suche nach einem angemessenen Massengrab geht weiter.
Nicht zu vergessen, dass US-amerikanische und britische Truppen Befehle hatten, Menschen nicht zu beschützen, sondern zu töten. Ihre Schwerpunkte waren eindeutig; Sicherheit und Schutz für das irakische Volk waren nicht ihre Aufgabe.
Die Sicherung der kümmerlichen Überreste der irakischen Infrastruktur war nicht ihre Aufgabe. Aber Sicherung und Schutz der irakischen Ölfelder fielen darunter. Die Ölfelder wurden fast schon „gesichert“, bevor die Invasion überhaupt begann.
Es lohnt sich festzustellen, dass der Wiederaufbau Afghanistans, das sich in einer viel schlimmeren Situation als der Irak befindet, nicht denselben apostolischen Enthusiasmus wie der Wiederaufbau des Iraks hervorgebracht hat. Selbst die Gelder, die Afghanistan öffentlich versprochen worden waren, sind großteils nicht überwiesen worden.
Könnte es daran liegen, dass Afghanistan über kein Öl verfügt? Es hat eine Ölleitung, schon, aber kein Öl. Folglich gibt es nicht viel Geld, das dem besiegten Land genommen werden kann.
Andererseits erzählte man uns, dass der Wiederaufbau des Iraks die Weltwirtschaft in Schwung bringen könnte: Schon lustig, wie die Interessen amerikanischer Unternehmen so häufig, so erfolgreich und so sorglos mit denen der Weltwirtschaft verwechselt werden.
Über Iraks Öl für die Iraker und einen Krieg für Befreiung und Demokratie und eine repräsentative Regierung zu reden hatte einen ihm gemäßen Ort und Zeitpunkt. Es hatte seinen Nutzen. Doch die Dinge sind nun anders geworden ...
Nachdem er eine 7000 Jahre alte Zivilisation in die Anarchie geleitet hatte, verkündete George Bush, dass die USA im Irak „auf unbestimmte Zeit“ bleiben würden. Die USA verkündeten praktisch, dass der Irak nur dann eine repräsentative Regierung haben könne, wenn diese die Interessen angloamerikanischer Ölgesellschaften verträte. Mit anderen Worten: Du kannst frei deine Meinung äußern, solange du sagst, was ich will, dass du sagst.
Am 17. Mai schrieben die New York Times: „In einer plötzlichen Kehrtwende haben die USA und Großbritannien ihren Plan unbegründet fallengelassen, den irakischen Oppositionskräften zu erlauben, am Monatsende eine Nationalversammlung zu formen und eine provisorische Regierung einzusetzen. Stattdessen teilten führende amerikanische und britische Diplomaten, die mit der Leitung des Wiederaufbau beschäftigt sind, den Exilantenführern auf einem Treffen am Abend mit, dass alliierte Behörden die Verwaltung des Iraks auf unbestimmte Zeit fortsetzen würden.“
Lange vor Beginn der Invasion zitterten die globalen Handelsunternehmen dem Geld entgegen, dass der Wiederaufbau des Iraks kosten würde. Es wurde etikettiert als „das größte Wiederaufbauprojekt, seit der Marshallplan Europa nach dem zweiten Weltkrieg wieder auferstehen ließ.“
Bechtel GmbH mit Hauptsitz in San Franzisko ist das führende Schakalrudel, das in den Irak einzieht.
Zufällig gehört der frühere Außenminister George Schultz zu den Direktoren von Bechtel und war auch Vorsitzender der Beraterkommission der „Gesellschaft zur Befreiung des Iraks“.
Als er von den New York Times gefragt wurde, ob er besorgt über einen daraus entstehenden Interessenkonflikt sei, antwortete Schultz: „Ich wüsste nicht, dass speziell Bechtel davon profitieren würde. Doch wenn Arbeit getan werden muss, ist Bechtel die Art Unternehmen, das damit fertig wird. Niemand aber sieht das als etwas an, aus dem es Profit zu schlagen gilt.“
Bechtel hat bereits Verträge über 680 Mio. US-Dollar, aber laut New York Times „sagen unabhängigen Schätzungen, dass sich die Kosten, die im von Bechtel vertraglich mit der US-Agentur für Internationale Entwicklung festgelegten Bereich anfallen werden, am Ende auf 20 Mrd. US-Dollar belaufen werden.“
In einem Artikel mit dem passenden Titel „Fütterungshysterie im Anmarsch, weil Unternehmen überall auf der Welt ihren Anteil am Unternehmen haben wollen“ bemerken die Times (ohne Ironie), dass „Regierungen überall auf der Welt und die Unternehmen, deren Sache sie vertreten, Washington im Zuge einer Kampagne unter Belagerung genommen haben, die darauf abzielt, einen Teil der Wiederaufbauunternehmen für sich zu gewinnen.“
„Obschon sie ihre Ansprüche auf moderate Weise ins Feld führen,“, vermerkt der Artikel, „führen die Briten an, was einige der Beamten der Bush-Administration für das überzeugendste Argument halten: dass sie Blut im Irak vergossen haben.“
Wessen Blut vergossen wurde, wurde nicht klargestellt. Sicherlich war nicht britisches Blut gemeint oder amerikanisches. Sie müssen gemeint haben, dass die Briten den Amerikanern halfen, irakisches Blut zu vergießen.“
So ist also das „überzeugendste Argument“ für Wiederaufbauverträge im Irak, wenn ein Land anführen kann, dass es am Mord an den Irakern mit beteiligt war.
Lady Simons, die stellvertretende Vorsitzende des britischen Oberhauses, reiste jüngst mit vier Industrieführern mach Amerika. Abgesehen vom Erheben ihrer Ansprüche aus ihrem Status als Mit-Mörder heraus berief sich die britische Delegation auch auf ihre kolonialistische Vergangenheit, erneut ohne Ironie, indem sie anführte, dass britische Unternehmen „seit den imperialen Tagen Anfang des 20. Jahrhunderts lange und enge Beziehungen mit dem Irak und dem irakischen Handel hatten, bis die internationalen Sanktionen in den 90er Jahren errichtet wurden.“ Am Rande heißt das natürlich auch, dass Großbritannien Saddam Hussein während der 70er und 80er Jahre unterstützt hat.
Diejenigen von uns, die zu ehemaligen Kolonien gehören, verstehen Imperialismus als Vergewaltigung. So raubt ihr. Dann tötet ihr. Dann fordert ihr, die Leichen zu vergewaltigen. Das ist gewöhnlich als Nekrophilie bekannt.
Diese Furcht erregende Analogie noch weiter belastend sagte Richard Perle vor kurzem: „Die Iraker sind heutzutage freier und wir sind sicherer. Entspannt euch und freut euch darüber!“
Ein paar Tage nach Kriegsbeginn sagte der Nachrichtensprecher Tom Brokaw: „Etwas, was wir nicht wollen, ist die Zerstörung der Infrastruktur Iraks, da wir dieses Land in ein paar Tagen beherrschen werden.“
Jetzt werden die Besitzübertragungsurkunden unterzeichnet. Irak ist kein Staat mehr. Er ist ein Vermögenswert.
Er wird nicht länger beherrscht. Er wird besessen.
Und in der Hauptsache wird er von Bechtel besessen. Vielleicht werden Halliburton und ein britisches Unternehmen oder zwei ein paar Knochen abbekommen.
Unser Kampf muss sich sowohl gegen die Besetzer als auch gegen diese neuen Besitzer des Iraks richten!
(1) „Die bronzene Figurengruppe mit der Flaggenerrichtung im Mittelpunkt erinnert an die Eroberung der Insel Iwo Jima während des 2. Weltkrieges. Damals versuchten 110.000 Marines die Insel zu erobern, wo sich in den verlassen Bergwerkstollen über 21.000 Japaner verschanzt hatten. Die Eroberung dieser strategisch wichtigen Insel kostete allen Japanern und ca. 26.000 Marines das Leben.“ (http://www.reisetraeume.com/washington_bei_nacht.html) (Anm. B.B.)
------
Das ganze verantworltiche Pack vor´s Gericht stellen !
Der Tag der Schakale
von Arundhati Roy
ZNet 02.06.2003
Mesopotamien. Babylon. Der Tigris und der Euphrat. Wie viele Kinder in wie vielen Klassenzimmern über wie viele Jahrhunderte sind durch die Vergangenheit gesegelt getragen auf den Flügeln dieser Worte?
Und nun sind Bomben gefallen, diese alte Zivilisation in Brand setzend und demütigend.
Auf die Stahlrümpfen ihrer Geschosse haben pubertierende amerikanische Soldaten anschauliche Mitteilungen in kindlicher Handschrift geschmiert: „For Saddam, from Fat Boy Posse.“
Ein Gebäude brach in sich zusammen. Ein Marktplatz. Ein Wohnhaus. Ein Mädchen, das einen Jungen liebte. Ein Kind, das nur mit den Murmeln seines älteren Bruders spielen wollte.
Am 21. März, dem Tag nach dem Beginn des illegalen Einsatzes und der illegalen Besetzung des Iraks durch amerikanische und britische Truppen, befragte ein „integrierter“ CNN-Korrespondent einen amerikanischen Soldaten. „Ich will da rein und aufräumen!“, sagte der Gefreite A.J.: „Ich will Vergeltung für den 11. September!“
Dem Korrespondenten muss man zugute halten, dass er, obschon „integriert“, immerhin schwächlich andeutete, dass es bislang keinen wirklichen Beweis gebe, der die irakische Regierung und die Ereignisse des 11. Septembers 2001 in Verbindung setzte. Soldat A.J. ließ seine Zunge bis übers Kinn gleiten: „Ach nun, das Zeug is mir zu hoch.“
Zur Zeit des Einmarsches der Vereinigten Staaten in den Irak schätzte eine Umfrage von CBS und New York Times, dass 42% der Amerikaner Saddam Hussein direkt für die Angriffe aufs World Trade Center und aufs Pentagon verantwortlich machten. Eine Umfrage der ABC-Nachrichten stellte fest, dass 55% der Amerikaner glaubten, dass Saddam Hussein Al Qaida unmittelbar unterstütze. All diesen Meinungen liegt kein Beweis zugrunde (weil es ihn nicht gibt). Sie alle beruhen auf Anspielungen, auf Selbstbetrug, auf glatten Lügen, die von den Medienunternehmen in Umlauf gebracht worden waren.
Öffentliche Unterstützung für den Irakkrieg der USA gründete sich auf einem vielschichtigen Komplex aus Falschheit und Betrug, koordiniert durch die US-Regierung und ergeben unterstützt von der Presse.
Da waren die erfundenen Verbindungen zwischen dem Irak und Al-Qaida. Die selbst gemachte Hysterie über Iraks „Massenvernichtungswaffen“. Keine Massenvernichtungswaffen konnten gefunden werden. Nicht einmal eine kleine.
Nun, nachdem der Krieg geführt und gewonnen und die Verträge über den Wiederaufbau gezeichnet und besiegelt sind, berichten die New York Times, dass „der CIA begonnen habe zu untersuchen, ob sich die amerikanischen Geheimdienste vor Kriegsbeginn in ihren Aussagen über Saddam Husseins Regierung und Iraks Waffenprogramme geirrt haben.“
Derweil wurde ganz am Rande eine alte Zivilisation gelegentlich verheert von einer sehr jungen, gelegentlich gewalttätigen Nation.
Während über eines Jahrzehnts aus Krieg und Sanktionen haben amerikanische und britische Einheiten tausende Geschosse und Bomben auf den Irak niedergehen lassen. Iraks Felder und Weiden sind mit dreihundert Tonnen abgereicherten Urans beschossen worden.
Auf ihren Angriffsflügen griffen die Alliierten Wasseraufbereitungsanlagen an, obschon sie darum wussten, dass sie nicht ohne Hilfe aus dem Ausland zu reparieren wären. Im Südirak gab es einen vierfachen Anstieg der Krebsfälle bei Kindern.
Im Jahrzehnt wirtschaftlicher Sanktionen, dass auf den ersten Krieg folgte, verweigerte man irakischen Zivilisten Medizin, Krankenhausausrüstung, Rettungstransportwagen, sauberes Wasser – das Nötigste.
Über eine halbe Million irakischer Kinder starben als Folge dieser Sanktionen.
Die Medienunternehmen spielten eine unbezahlbare Rolle, indem sie Nachrichten über die Zerstörung des Iraks und seiner Bevölkerung von der amerikanischen Öffentlichkeit fernhielten. Sie haben nun mit der Vorbereitung von Kriegen gegen Syrien und den Iran mit derselben Routine aus Lügen und Hysterie begonnen – und wer weiß, vielleicht auch gegen Saudi Arabien.
Vielleicht wird der nächste Krieg das Juwel in der Krone von Bushs Wahlkampf 2004 darstellen. Obgleich er nicht unbedingt zu solch drastischen Mitteln greifen muss, zumal die Demokraten erklärten, dass ihre Strategie für die Wahl 2004 darin bestehe, den Republikanern Schwäche in Fragen der inneren Sicherheit vorzuwerfen. Das ist, als ob ein jugendlicher Schläger aus der Provinz der Mafia zu viele Skrupel vorwürfe.
Es sieht aus, als ob die amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu einer völligen Zeitverschwendung ausarten werden. Obschon das nicht eigentlich eine Überraschung ist.
Die US-Invasion des Iraks war vermutlich der feigste Krieg aller Zeiten.
Nachdem man die „gute Autorität“ der UN-Diplomatie benutzte (Wirtschaftssanktionen und Waffeninspektionen) um sicherzustellen, dass der Iraks auf die Knie gezwungen würde; nachdem sichergestellt war, dass die meisten seiner Waffen zerstört waren, schickte die „Koalition der Willigen“, besser bekannt als die Koalition der Gezwungenen und Gedungenen, eine Invasionsarmee.
Dann kündeten die Medienunternehmen freudenvoll, dass die Vereinigten Staaten einen gerechten und überraschenden Sieg erzielt hätten.
Fernsehzuschauer wurden Zeuge der Freude, welche die US-Armee den gewöhnlichen Irakern brachte: All diese frisch befreiten Menschen, die amerikanische Flaggen schwenkten, die sie irgendwie während der Jahre der Sanktionen angehortet haben müssen.
Und dass die Umstürzung von Saddam Husseins Statue auf dem Firdosplatz (die wieder und wieder im Fernsehen gezeigt wurde) sich als das Werk einer Handvoll Mietlinge herausstellte, die von der US-Marineinfanterie abgestimmt wurden. Robert Fisk nannte es „die bestgezeigte Fotoinszenierung seit Iwo Jima (1)“.
Und nicht zu vergessen, dass in den darauf folgenden Tagen amerikanische Soldaten auf eine Gruppe friedlicher, unbewaffneter irakischer Demonstranten schossen, die den Abzug der US-Einheiten forderten. Fünfzehn Menschen wurden totgeschossen.
Dass einige Tage später US-Soldaten zwei weitere Menschen töteten und diverse verletzten, als diese gegen die Tötung von friedlichen Demonstranten demonstrierten. Dass sie 17 weitere Menschen in Mosul ermordeten.
Dass sie dieses Töten auch in Zukunft fortsetzen werden (wenn auch nicht im Fernsehen).
Dass das aufgeklärte Land zu religiöser Sektiererei getrieben wird.
Dass die US-Regierung Saddam Hussein geholfen hatte, an die Macht zu kommen, und ihn während seiner schlimmsten Verbrechen einschließlich des acht Jahre dauernden Krieges gegen den Iran und der Vergasungen von Kurden 1988 in Halabja unterstützte; Verbrechen, die 14 Jahre später aufgewärmt wurden und als Rechtfertigungsgründe für den neuen Irakkrieg dienten.
Dass nach dem ersten Golfkrieg die Alliierten eine Erhebung von Schiiten in Basra entfachten und dann wegsahen, als Saddam Hussein die Revolte zerschmetterte und Tausende in einem Akt der Rache dahinschlachtete.
Nach der Invasion löste sich das gierende Interesse westlicher Fernsehsender an neu entdeckten Massengräbern schnell in Luft auf, nachdem sie bemerkten, dass es sich um irakische Leichen aus dem Krieg gegen den Iran und der schiitischen Erhebung handelte... Die Suche nach einem angemessenen Massengrab geht weiter.
Nicht zu vergessen, dass US-amerikanische und britische Truppen Befehle hatten, Menschen nicht zu beschützen, sondern zu töten. Ihre Schwerpunkte waren eindeutig; Sicherheit und Schutz für das irakische Volk waren nicht ihre Aufgabe.
Die Sicherung der kümmerlichen Überreste der irakischen Infrastruktur war nicht ihre Aufgabe. Aber Sicherung und Schutz der irakischen Ölfelder fielen darunter. Die Ölfelder wurden fast schon „gesichert“, bevor die Invasion überhaupt begann.
Es lohnt sich festzustellen, dass der Wiederaufbau Afghanistans, das sich in einer viel schlimmeren Situation als der Irak befindet, nicht denselben apostolischen Enthusiasmus wie der Wiederaufbau des Iraks hervorgebracht hat. Selbst die Gelder, die Afghanistan öffentlich versprochen worden waren, sind großteils nicht überwiesen worden.
Könnte es daran liegen, dass Afghanistan über kein Öl verfügt? Es hat eine Ölleitung, schon, aber kein Öl. Folglich gibt es nicht viel Geld, das dem besiegten Land genommen werden kann.
Andererseits erzählte man uns, dass der Wiederaufbau des Iraks die Weltwirtschaft in Schwung bringen könnte: Schon lustig, wie die Interessen amerikanischer Unternehmen so häufig, so erfolgreich und so sorglos mit denen der Weltwirtschaft verwechselt werden.
Über Iraks Öl für die Iraker und einen Krieg für Befreiung und Demokratie und eine repräsentative Regierung zu reden hatte einen ihm gemäßen Ort und Zeitpunkt. Es hatte seinen Nutzen. Doch die Dinge sind nun anders geworden ...
Nachdem er eine 7000 Jahre alte Zivilisation in die Anarchie geleitet hatte, verkündete George Bush, dass die USA im Irak „auf unbestimmte Zeit“ bleiben würden. Die USA verkündeten praktisch, dass der Irak nur dann eine repräsentative Regierung haben könne, wenn diese die Interessen angloamerikanischer Ölgesellschaften verträte. Mit anderen Worten: Du kannst frei deine Meinung äußern, solange du sagst, was ich will, dass du sagst.
Am 17. Mai schrieben die New York Times: „In einer plötzlichen Kehrtwende haben die USA und Großbritannien ihren Plan unbegründet fallengelassen, den irakischen Oppositionskräften zu erlauben, am Monatsende eine Nationalversammlung zu formen und eine provisorische Regierung einzusetzen. Stattdessen teilten führende amerikanische und britische Diplomaten, die mit der Leitung des Wiederaufbau beschäftigt sind, den Exilantenführern auf einem Treffen am Abend mit, dass alliierte Behörden die Verwaltung des Iraks auf unbestimmte Zeit fortsetzen würden.“
Lange vor Beginn der Invasion zitterten die globalen Handelsunternehmen dem Geld entgegen, dass der Wiederaufbau des Iraks kosten würde. Es wurde etikettiert als „das größte Wiederaufbauprojekt, seit der Marshallplan Europa nach dem zweiten Weltkrieg wieder auferstehen ließ.“
Bechtel GmbH mit Hauptsitz in San Franzisko ist das führende Schakalrudel, das in den Irak einzieht.
Zufällig gehört der frühere Außenminister George Schultz zu den Direktoren von Bechtel und war auch Vorsitzender der Beraterkommission der „Gesellschaft zur Befreiung des Iraks“.
Als er von den New York Times gefragt wurde, ob er besorgt über einen daraus entstehenden Interessenkonflikt sei, antwortete Schultz: „Ich wüsste nicht, dass speziell Bechtel davon profitieren würde. Doch wenn Arbeit getan werden muss, ist Bechtel die Art Unternehmen, das damit fertig wird. Niemand aber sieht das als etwas an, aus dem es Profit zu schlagen gilt.“
Bechtel hat bereits Verträge über 680 Mio. US-Dollar, aber laut New York Times „sagen unabhängigen Schätzungen, dass sich die Kosten, die im von Bechtel vertraglich mit der US-Agentur für Internationale Entwicklung festgelegten Bereich anfallen werden, am Ende auf 20 Mrd. US-Dollar belaufen werden.“
In einem Artikel mit dem passenden Titel „Fütterungshysterie im Anmarsch, weil Unternehmen überall auf der Welt ihren Anteil am Unternehmen haben wollen“ bemerken die Times (ohne Ironie), dass „Regierungen überall auf der Welt und die Unternehmen, deren Sache sie vertreten, Washington im Zuge einer Kampagne unter Belagerung genommen haben, die darauf abzielt, einen Teil der Wiederaufbauunternehmen für sich zu gewinnen.“
„Obschon sie ihre Ansprüche auf moderate Weise ins Feld führen,“, vermerkt der Artikel, „führen die Briten an, was einige der Beamten der Bush-Administration für das überzeugendste Argument halten: dass sie Blut im Irak vergossen haben.“
Wessen Blut vergossen wurde, wurde nicht klargestellt. Sicherlich war nicht britisches Blut gemeint oder amerikanisches. Sie müssen gemeint haben, dass die Briten den Amerikanern halfen, irakisches Blut zu vergießen.“
So ist also das „überzeugendste Argument“ für Wiederaufbauverträge im Irak, wenn ein Land anführen kann, dass es am Mord an den Irakern mit beteiligt war.
Lady Simons, die stellvertretende Vorsitzende des britischen Oberhauses, reiste jüngst mit vier Industrieführern mach Amerika. Abgesehen vom Erheben ihrer Ansprüche aus ihrem Status als Mit-Mörder heraus berief sich die britische Delegation auch auf ihre kolonialistische Vergangenheit, erneut ohne Ironie, indem sie anführte, dass britische Unternehmen „seit den imperialen Tagen Anfang des 20. Jahrhunderts lange und enge Beziehungen mit dem Irak und dem irakischen Handel hatten, bis die internationalen Sanktionen in den 90er Jahren errichtet wurden.“ Am Rande heißt das natürlich auch, dass Großbritannien Saddam Hussein während der 70er und 80er Jahre unterstützt hat.
Diejenigen von uns, die zu ehemaligen Kolonien gehören, verstehen Imperialismus als Vergewaltigung. So raubt ihr. Dann tötet ihr. Dann fordert ihr, die Leichen zu vergewaltigen. Das ist gewöhnlich als Nekrophilie bekannt.
Diese Furcht erregende Analogie noch weiter belastend sagte Richard Perle vor kurzem: „Die Iraker sind heutzutage freier und wir sind sicherer. Entspannt euch und freut euch darüber!“
Ein paar Tage nach Kriegsbeginn sagte der Nachrichtensprecher Tom Brokaw: „Etwas, was wir nicht wollen, ist die Zerstörung der Infrastruktur Iraks, da wir dieses Land in ein paar Tagen beherrschen werden.“
Jetzt werden die Besitzübertragungsurkunden unterzeichnet. Irak ist kein Staat mehr. Er ist ein Vermögenswert.
Er wird nicht länger beherrscht. Er wird besessen.
Und in der Hauptsache wird er von Bechtel besessen. Vielleicht werden Halliburton und ein britisches Unternehmen oder zwei ein paar Knochen abbekommen.
Unser Kampf muss sich sowohl gegen die Besetzer als auch gegen diese neuen Besitzer des Iraks richten!
(1) „Die bronzene Figurengruppe mit der Flaggenerrichtung im Mittelpunkt erinnert an die Eroberung der Insel Iwo Jima während des 2. Weltkrieges. Damals versuchten 110.000 Marines die Insel zu erobern, wo sich in den verlassen Bergwerkstollen über 21.000 Japaner verschanzt hatten. Die Eroberung dieser strategisch wichtigen Insel kostete allen Japanern und ca. 26.000 Marines das Leben.“ (http://www.reisetraeume.com/washington_bei_nacht.html) (Anm. B.B.)
------
Das ganze verantworltiche Pack vor´s Gericht stellen !
http://www.welt.de/data/2003/06/11/115365.html
Irak-Öl setzt Opec unter Druck
Kartell will Förderung drosseln - Preisverfall soll verhindert werden
von Karin Kneissl
Wien - Wegen der Wiederaufnahme der Öl-Exporte aus dem Irak prüft die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) eine Förderkürzung. Dies sagte Opec-Präsident Abdullah el Attijah in Doha in Katar. Dort treffen sich am heutigen Mittwoch die Opec-Öl-Minister zu Gesprächen über die Marktlage. Das irakische Öl-Ministerium hatte am Montag die Wiederaufnahme der durch den Krieg unterbrochenen Ausfuhren im Laufe der kommenden Woche angekündigt. Der Irak plant bislang, seine Ölförderung auf täglich rund 1,5 Mio. Barrel und damit etwa die Hälfte der vor dem Krieg geförderten Menge hochzufahren. Davon soll die Hälfte im Inland verbraucht werden, der Rest steht für den Export zur Verfügung.
Mitte Mai hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen den Irak aufgehoben. Irak, vor 43 Jahren Gründungsmitglied der Opec wird bei dem Treffen in Doha aber nicht vertreten sein. Das Land durfte seit dem Angriff auf Kuwait und dem Golfkrieg Anfang der 90er Jahre nicht mehr am Quotensystem der Opec teilnehmen. Die Ausfuhr von Öl war Bagdad nur im begrenzten Rahmen innerhalb des Programms "Öl für Lebensmittel" erlaubt.
Ob Irak künftig Mitglied der Opec bleiben wird, ist noch offen. Unklar ist bislang auch, wie die irakische Ölindustrie künftig organisiert und wer die Konzessionen zur Förderung und Vermarktung von Erdöl bekommen wird. US-Gouverneur Paul Bremer hat eine Liberalisierung der irakischen Wirtschaft angekündigt. Aber ob dies auch für die Ölindustrie gelten soll ist unklar.
Vor dem Krieg hatte die Opec Mitte März die Förderquoten freigegeben, um eine Preisexplosion zu verhindern. Nun will sie die hoch gefahrene Produktion weiter drosseln. Bereits seit Anfang Juni werden zwei Millionen Fass pro Tag weniger gefördert. Damit liegt die aktuelle Fördermenge der Opec bei 25,4 Mio. Fass pro Tag.
Die nicht zur Opec gehörenden Förderländer werden an der Ministerkonferenz in Katar als Beobachter teilnehmen. Bereits Ende 2001 hatten Russland, Mexiko und Norwegen mit massiven Förder- und Exportbeschränkungen die Anstrengungen der Opec unterstützt, einen Verfall der Ölpreise zu verhindern.
Nach Berechnungen des Londoner Centre for Global Energy Studies CGES ist allerdings eine Reduzierung auf maximal 24 Mio. Fass pro Tag erforderlich, damit der Irak seine Exporte wieder aufnehmen kann, ohne das die Gefahr besteht, dass die Preise rapide verfallen. Das will das Wiener Opec-Generalsekretariat auf jeden Fall verhindern, denn dort hält man am Preisband von 22 bis 28 US-Dollar pro Fass fest.
Die Rücknahme der Quoten wird vor allem Algerien und Nigeria schmerzen, die seit langem auf höhere Förder-Anteile drängen. Auch Saudi Arabien, das im ersten Quartal 2003 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 21 Mrd. Dollar fast das Doppelte verdiente, muss nun für irakisches Öl Marktanteile aufgeben.
In der irakischen Ölindustrie werden die Karten gerade neu gemischt. Zurzeit verwaltet der US-Konzern Halliburton noch über ein Subunternehmen die irakische Ölindustrie. Zugleich kämpft der russische Konzern Lukoil für sein 20 Milliarden-Dollar-Projekt zur Erschließung der West Qurna Ölfelder.
Der Ölpreis ist in der vergangenen Woche gestiegen. Ein Barrel kosteten nach Angaben der in der Opec zusammengefassten Öl exportierenden Länder im Wochendurchschnitt 26,86 Dollar nach 26,47 Dollar eine Woche zuvor, teilte die Opec in Wien mit. Zu Wochenbeginn zog der Preis weiter an.
Artikel erschienen am 11. Jun 2003
-------
Mal gucken was dem "befreitem" irakischen Volk davon übrig bleibt
Irak-Öl setzt Opec unter Druck
Kartell will Förderung drosseln - Preisverfall soll verhindert werden
von Karin Kneissl
Wien - Wegen der Wiederaufnahme der Öl-Exporte aus dem Irak prüft die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) eine Förderkürzung. Dies sagte Opec-Präsident Abdullah el Attijah in Doha in Katar. Dort treffen sich am heutigen Mittwoch die Opec-Öl-Minister zu Gesprächen über die Marktlage. Das irakische Öl-Ministerium hatte am Montag die Wiederaufnahme der durch den Krieg unterbrochenen Ausfuhren im Laufe der kommenden Woche angekündigt. Der Irak plant bislang, seine Ölförderung auf täglich rund 1,5 Mio. Barrel und damit etwa die Hälfte der vor dem Krieg geförderten Menge hochzufahren. Davon soll die Hälfte im Inland verbraucht werden, der Rest steht für den Export zur Verfügung.
Mitte Mai hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen den Irak aufgehoben. Irak, vor 43 Jahren Gründungsmitglied der Opec wird bei dem Treffen in Doha aber nicht vertreten sein. Das Land durfte seit dem Angriff auf Kuwait und dem Golfkrieg Anfang der 90er Jahre nicht mehr am Quotensystem der Opec teilnehmen. Die Ausfuhr von Öl war Bagdad nur im begrenzten Rahmen innerhalb des Programms "Öl für Lebensmittel" erlaubt.
Ob Irak künftig Mitglied der Opec bleiben wird, ist noch offen. Unklar ist bislang auch, wie die irakische Ölindustrie künftig organisiert und wer die Konzessionen zur Förderung und Vermarktung von Erdöl bekommen wird. US-Gouverneur Paul Bremer hat eine Liberalisierung der irakischen Wirtschaft angekündigt. Aber ob dies auch für die Ölindustrie gelten soll ist unklar.
Vor dem Krieg hatte die Opec Mitte März die Förderquoten freigegeben, um eine Preisexplosion zu verhindern. Nun will sie die hoch gefahrene Produktion weiter drosseln. Bereits seit Anfang Juni werden zwei Millionen Fass pro Tag weniger gefördert. Damit liegt die aktuelle Fördermenge der Opec bei 25,4 Mio. Fass pro Tag.
Die nicht zur Opec gehörenden Förderländer werden an der Ministerkonferenz in Katar als Beobachter teilnehmen. Bereits Ende 2001 hatten Russland, Mexiko und Norwegen mit massiven Förder- und Exportbeschränkungen die Anstrengungen der Opec unterstützt, einen Verfall der Ölpreise zu verhindern.
Nach Berechnungen des Londoner Centre for Global Energy Studies CGES ist allerdings eine Reduzierung auf maximal 24 Mio. Fass pro Tag erforderlich, damit der Irak seine Exporte wieder aufnehmen kann, ohne das die Gefahr besteht, dass die Preise rapide verfallen. Das will das Wiener Opec-Generalsekretariat auf jeden Fall verhindern, denn dort hält man am Preisband von 22 bis 28 US-Dollar pro Fass fest.
Die Rücknahme der Quoten wird vor allem Algerien und Nigeria schmerzen, die seit langem auf höhere Förder-Anteile drängen. Auch Saudi Arabien, das im ersten Quartal 2003 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 21 Mrd. Dollar fast das Doppelte verdiente, muss nun für irakisches Öl Marktanteile aufgeben.
In der irakischen Ölindustrie werden die Karten gerade neu gemischt. Zurzeit verwaltet der US-Konzern Halliburton noch über ein Subunternehmen die irakische Ölindustrie. Zugleich kämpft der russische Konzern Lukoil für sein 20 Milliarden-Dollar-Projekt zur Erschließung der West Qurna Ölfelder.
Der Ölpreis ist in der vergangenen Woche gestiegen. Ein Barrel kosteten nach Angaben der in der Opec zusammengefassten Öl exportierenden Länder im Wochendurchschnitt 26,86 Dollar nach 26,47 Dollar eine Woche zuvor, teilte die Opec in Wien mit. Zu Wochenbeginn zog der Preis weiter an.
Artikel erschienen am 11. Jun 2003
-------
Mal gucken was dem "befreitem" irakischen Volk davon übrig bleibt

http://www.welt.de/data/2003/06/11/115335.html
Hypotheken-Skandal erschüttert US-Finanzmarkt
Baufinanzierer Freddie Mac in der Krise - Experten befürchten einen Domino-Effekt
von Martin Halusa
New York - Den USA droht ein weiterer Bilanzskandal, und die Auswirkungen könnten den gerade beginnenden Aufschwung gefährden. An der Oberfläche geht es zunächst um den Rauswurf des Topmanagements bei einem der führenden amerikanischen Baufinanzierer, Freddie Mac. Doch darunter schlummert die Frage, ob das Unternehmen - und mit ihm auch seine Schwester Fannie Mae - unterfinanziert ist. Seit Monaten kursieren an der Wall Street Gerüchte über eine mögliche Schieflage.
Finanzexperten befürchten nun, dass die Probleme bei Freddie Mac zu einem Dominoeffekt im Bankensystem führen könnten. Die Hypothekenzinsen, die sich derzeit mit 4,5 Prozent auf einem historischen Tief befinden, dürften bald steigen. "Die Immobilienblase könnte dann platzen", warnt Martha Kaufman von Prudential Securities. Dies dürfte erhebliche Folgen für die Konjunktur haben: Bislang gilt die Immobilienbranche als letzte stabile Bastion der US-Wirtschaft.
Anfang Januar hatte Federal-Reserve-Chef Alan Greenspan davor gewarnt, dass die beiden Finanzfirmen nicht über das nötige Kapital verfügen. Außerdem räumte Greenspan mit dem Irrglauben der Investoren auf, dass die Regierung die Baufinanzierer im Notfall stützen würde.
In den vergangenen Tagen musste das gesamte Topmanagement Freddie Macs zurücktreten. Hintergrund sind mögliche Verletzungen des Aktiengesetzes. Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Bilanzen der vergangenen drei Jahre neu zu berechnen. Zuvor war die Firma vom Enron-Prüfer Arthur Anderson bilanziert worden, nun beschäftigt sich Pricewaterhouse-Coopers mit dem Zahlenwerk.
Möglicherweise hat die Firma ihre Gewinne der vergangenen Jahre zu niedrig dargestellt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal ist suspendiert. Das Management soll nicht voll mit den Prüfern zusammengearbeitet haben. Von Betrug könne allerdings nicht die Rede sein, sagte der neue Chief Executive Officer Gregory Parseghian.
Beobachter erwarten, dass die Börsenaufsicht SEC in Kürze ihre Ermittlungen aufnimmt. Die Aktien von Freddie Mac und Fannie Mae gaben bereits um fast 20 Prozent nach und zogen den Gesamtmarkt mit nach unten.
Freddie Mac (die Nummer zwei) und Fannie Mae (Nummer eins) der Baufinanzierer in den USA beherrschen zusammen fast 50 Prozent des Hypothekenmarktes. Die Unternehmen wurden vom Kongress ins Leben gerufen und sind börsennotiert. Zusammen mit der dritten, kleineren Schwester Ginnie Mae treten sie als Vermittler zwischen Hypothekenbanken und Käufern von Immobilien auf. Die Firmen kaufen Hypotheken, bündeln sie als Wertpapier und verkaufen sie an Investoren - vor allem an asiatische und japanische Anleger.
In den USA tragen sie wesentlich zur Förderung des privaten Hausbesitzes bei. Derzeit haben ihre Hypothekenkredite ein Gesamtvolumen von 3,3 Billionen Dollar. Doch sowohl Wall Street als auch der Notenbank sind die Baufinanzierer seit langem ein Dorn im Auge, weil sie als regierungsnahe Institutionen nicht den strengen Bilanzregeln der Börse unterliegen. Anders als andere Unternehmen können Freddie Mac & Co direkt von der Notenbank Federal Reserve leihen. Erst im vergangenen Jahr haben die Firmen damit begonnen, testierte Bilanzen und Quartalsberichte vorzulegen.
Artikel erschienen am 11. Jun 2003

Hypotheken-Skandal erschüttert US-Finanzmarkt
Baufinanzierer Freddie Mac in der Krise - Experten befürchten einen Domino-Effekt
von Martin Halusa
New York - Den USA droht ein weiterer Bilanzskandal, und die Auswirkungen könnten den gerade beginnenden Aufschwung gefährden. An der Oberfläche geht es zunächst um den Rauswurf des Topmanagements bei einem der führenden amerikanischen Baufinanzierer, Freddie Mac. Doch darunter schlummert die Frage, ob das Unternehmen - und mit ihm auch seine Schwester Fannie Mae - unterfinanziert ist. Seit Monaten kursieren an der Wall Street Gerüchte über eine mögliche Schieflage.
Finanzexperten befürchten nun, dass die Probleme bei Freddie Mac zu einem Dominoeffekt im Bankensystem führen könnten. Die Hypothekenzinsen, die sich derzeit mit 4,5 Prozent auf einem historischen Tief befinden, dürften bald steigen. "Die Immobilienblase könnte dann platzen", warnt Martha Kaufman von Prudential Securities. Dies dürfte erhebliche Folgen für die Konjunktur haben: Bislang gilt die Immobilienbranche als letzte stabile Bastion der US-Wirtschaft.
Anfang Januar hatte Federal-Reserve-Chef Alan Greenspan davor gewarnt, dass die beiden Finanzfirmen nicht über das nötige Kapital verfügen. Außerdem räumte Greenspan mit dem Irrglauben der Investoren auf, dass die Regierung die Baufinanzierer im Notfall stützen würde.
In den vergangenen Tagen musste das gesamte Topmanagement Freddie Macs zurücktreten. Hintergrund sind mögliche Verletzungen des Aktiengesetzes. Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Bilanzen der vergangenen drei Jahre neu zu berechnen. Zuvor war die Firma vom Enron-Prüfer Arthur Anderson bilanziert worden, nun beschäftigt sich Pricewaterhouse-Coopers mit dem Zahlenwerk.
Möglicherweise hat die Firma ihre Gewinne der vergangenen Jahre zu niedrig dargestellt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal ist suspendiert. Das Management soll nicht voll mit den Prüfern zusammengearbeitet haben. Von Betrug könne allerdings nicht die Rede sein, sagte der neue Chief Executive Officer Gregory Parseghian.
Beobachter erwarten, dass die Börsenaufsicht SEC in Kürze ihre Ermittlungen aufnimmt. Die Aktien von Freddie Mac und Fannie Mae gaben bereits um fast 20 Prozent nach und zogen den Gesamtmarkt mit nach unten.
Freddie Mac (die Nummer zwei) und Fannie Mae (Nummer eins) der Baufinanzierer in den USA beherrschen zusammen fast 50 Prozent des Hypothekenmarktes. Die Unternehmen wurden vom Kongress ins Leben gerufen und sind börsennotiert. Zusammen mit der dritten, kleineren Schwester Ginnie Mae treten sie als Vermittler zwischen Hypothekenbanken und Käufern von Immobilien auf. Die Firmen kaufen Hypotheken, bündeln sie als Wertpapier und verkaufen sie an Investoren - vor allem an asiatische und japanische Anleger.
In den USA tragen sie wesentlich zur Förderung des privaten Hausbesitzes bei. Derzeit haben ihre Hypothekenkredite ein Gesamtvolumen von 3,3 Billionen Dollar. Doch sowohl Wall Street als auch der Notenbank sind die Baufinanzierer seit langem ein Dorn im Auge, weil sie als regierungsnahe Institutionen nicht den strengen Bilanzregeln der Börse unterliegen. Anders als andere Unternehmen können Freddie Mac & Co direkt von der Notenbank Federal Reserve leihen. Erst im vergangenen Jahr haben die Firmen damit begonnen, testierte Bilanzen und Quartalsberichte vorzulegen.
Artikel erschienen am 11. Jun 2003

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,253024,00.html
FLUGZEUGBAU
Airbus überflügelt Boeing
Trotz der schweren Krise in der Luftfahrtindustrie hält Airbus an seinem Produktionsziel von 300 Flugzeugen in diesem Jahr fest und befürchtet auch 2004 keinen Einbruch. Erzkonkurrent Boeing wäre damit nunmehr die Nummer zwei.
Le Bourget - Denn 2003 würde Airbus liefert 2003 erstmals mehr Passagierflugzeuge ausliefern als der US-Konkurrent Boeing (280), sagte Airbus-Chef Noel Forgeard am Sonntag auf der Luftfahrtmesse Le Bourget bei Paris. Im nächsten Jahr wolle sein Unternehmen mindestens so gut abschneiden wie Boeing, das zwischen 275 und 300 Maschinen produzieren will. Für 2003 erwartet er Neuaufträge über insgesamt 250 Flugzeuge, bislang hat Airbus Orders über 156 Jets im Gesamtwert von 12,8 Milliarden US-Dollar eingeflogen.
Es wurde erwartet, dass Emirates auf der Messe in Le Bourget einen Großauftrag über fast zwei Dutzend Airbus-Super-Jumbos A380 bekannt gibt, aber auch Boeing mit einer Order in ähnlicher Größenordnung bedenkt. Forgeard sagte, bis Ende des Jahres werde sich Zahl der Festbestellungen für das größte jemals gebaute Flugzeug der zivilen Luftfahrt von derzeit 95 auf mindestens 125 erhöhen.
Trotz der historischen Krise und dem schwachen Dollar, auf den man sich auf Jahre hinaus einstellen müsse, bleibe Airbus profitabel und mache keinerlei Abstriche am A380-Programm. Das Flugzeug, das mehr als 500 Passagieren auf zwei Decks Platz bietet, werde in weniger als zwei Jahren zum Jungfernflug abheben, kündigte der Airbus-Chef an.
Airbus legte seinen Angaben zufolge ein Kostensenkungsprogramm auf, das dem europäischen Unternehmen bis 2006 Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro ermöglichen soll. An einen Abbau von Stellen werde dabei aber nicht gedacht.



FLUGZEUGBAU
Airbus überflügelt Boeing
Trotz der schweren Krise in der Luftfahrtindustrie hält Airbus an seinem Produktionsziel von 300 Flugzeugen in diesem Jahr fest und befürchtet auch 2004 keinen Einbruch. Erzkonkurrent Boeing wäre damit nunmehr die Nummer zwei.
Le Bourget - Denn 2003 würde Airbus liefert 2003 erstmals mehr Passagierflugzeuge ausliefern als der US-Konkurrent Boeing (280), sagte Airbus-Chef Noel Forgeard am Sonntag auf der Luftfahrtmesse Le Bourget bei Paris. Im nächsten Jahr wolle sein Unternehmen mindestens so gut abschneiden wie Boeing, das zwischen 275 und 300 Maschinen produzieren will. Für 2003 erwartet er Neuaufträge über insgesamt 250 Flugzeuge, bislang hat Airbus Orders über 156 Jets im Gesamtwert von 12,8 Milliarden US-Dollar eingeflogen.
Es wurde erwartet, dass Emirates auf der Messe in Le Bourget einen Großauftrag über fast zwei Dutzend Airbus-Super-Jumbos A380 bekannt gibt, aber auch Boeing mit einer Order in ähnlicher Größenordnung bedenkt. Forgeard sagte, bis Ende des Jahres werde sich Zahl der Festbestellungen für das größte jemals gebaute Flugzeug der zivilen Luftfahrt von derzeit 95 auf mindestens 125 erhöhen.
Trotz der historischen Krise und dem schwachen Dollar, auf den man sich auf Jahre hinaus einstellen müsse, bleibe Airbus profitabel und mache keinerlei Abstriche am A380-Programm. Das Flugzeug, das mehr als 500 Passagieren auf zwei Decks Platz bietet, werde in weniger als zwei Jahren zum Jungfernflug abheben, kündigte der Airbus-Chef an.
Airbus legte seinen Angaben zufolge ein Kostensenkungsprogramm auf, das dem europäischen Unternehmen bis 2006 Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro ermöglichen soll. An einen Abbau von Stellen werde dabei aber nicht gedacht.





http://wdr.de/tv/dokumentation/operationsaddam.html
die story: Operation Saddam
Amerikas Propagandaschlacht
Ein Film von Helmut Grosse
Redaktion: Heribert Blondiau
Saddam Hussein ist gestürzt - der 2. Golfkrieg zu Ende. Doch die Diskussion um den Kriegsgrund - und damit um die Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten George W. Bush - hat gerade erst begonnen.
"Die Bedrohung Amerikas durch die Massenvernichtungswaffen des Irak - eine Propagandalüge, mit der die Öffentlichkeit getäuscht wurde." So ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstler. "die story" zeigt die Etappen einer Propagandaschlacht, mit der die amerikanische und britische Regierung versuchten, den 2. Golfkrieg zu rechtfertigen.
Wie verkauft man einen Krieg - eine Frage, die die US-Regierung beschäftigte, schon lange bevor der Krieg begonnen hatte. In „Operation Saddam“ zeigt WDR-Autor Helmut Grosse dieses Kriegs-Marketing - eine Mischung von Verdrehungen, Lügen und Fälschungen - wie Ex-Geheimdienstler Ray McGovern, Amerikas Enthüllungsjournalist Seymour Hersh und der Bestseller-Autor John MacArthur belegen.
-------
Endlich rührt sich was!
die story: Operation Saddam
Amerikas Propagandaschlacht
Ein Film von Helmut Grosse
Redaktion: Heribert Blondiau
Saddam Hussein ist gestürzt - der 2. Golfkrieg zu Ende. Doch die Diskussion um den Kriegsgrund - und damit um die Glaubwürdigkeit des US-Präsidenten George W. Bush - hat gerade erst begonnen.
"Die Bedrohung Amerikas durch die Massenvernichtungswaffen des Irak - eine Propagandalüge, mit der die Öffentlichkeit getäuscht wurde." So ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstler. "die story" zeigt die Etappen einer Propagandaschlacht, mit der die amerikanische und britische Regierung versuchten, den 2. Golfkrieg zu rechtfertigen.
Wie verkauft man einen Krieg - eine Frage, die die US-Regierung beschäftigte, schon lange bevor der Krieg begonnen hatte. In „Operation Saddam“ zeigt WDR-Autor Helmut Grosse dieses Kriegs-Marketing - eine Mischung von Verdrehungen, Lügen und Fälschungen - wie Ex-Geheimdienstler Ray McGovern, Amerikas Enthüllungsjournalist Seymour Hersh und der Bestseller-Autor John MacArthur belegen.
-------
Endlich rührt sich was!
Ist eine ältere Kamalle, aber nur rein damit!
-----
http://www.bundeswehrabschaffen.de/terror_usa81.htm
DIE ZEIT
Politik 12/2002
Der "präziseste Krieg" der Geschichte
--------------------------------------------------------------------------------
Niemand hat bisher die zivilen Opfer des amerikanischen Luftkrieges in Afghanistan gezählt. Es gibt sie trotzdem
von Ulrich Ladurner
Kabul/Khost
Es gibt viele Gräber in Afghanistan. Sie liegen mitten zwischen den Lebenden von Kabul, wenige Meter von den Passanten entfernt, den Radfahrern, den Straßenkindern, den Marktschreiern, Metzgern, Verkäufern und Bäckern; sie trotzen in der Stadt dem allgegenwärtigen Menschengewimmel. Die Gräber fallen dem Reisenden auf Überlandstraßen auf, sie liegen an Flussufern, Feldern und Berghängen. In mehr als 30 Jahren Krieg hörten die Friedhöfe niemals auf, über die Maßen zu wachsen, als müssten sie täglich beweisen, dass ein schrecklicher Fluch über Afghanistan liegt. Wo immer man hinblickt: Gräber, Gräber, Gräber.
Wie viele sind hinzugekommen seit dem 7. Oktober 2001, dem Beginn der Intervention der Antiterrorallianz in Afghanistan? Wie viele Leichen mussten verscharrt werden unter der Bezeichnung: zivile Opfer? Das ist eine wichtige Frage für den Westen, denn ein Recht auf Selbstverteidigung kann man auch verlieren; es kann ausgehöhlt werden durch die Art der Kriegführung und durch die Opferzahlen. Wie viele also sind es?
Bevor wir von den Zahlen sprechen, sollten wir von Nazila reden. Sie war fünf Jahre alt. Am 17. Okober spielte sie mit ihren Freunden im Hof ihres Mietshauses, im Kabuler Viertel Microrion, Block 33. Plötzlich explodierte eine Bombe in der Kaserne, die wenige hundert Meter von dem Haus entfernt liegt. Nazila und die anderen Kinder suchten panisch in den Häusern Schutz. Eine zweite Bombe fiel. Sie bohrte sich knapp einen Meter vor dem Hauseingang in die Erde, in den sich Nazila flüchten wollte. Die Bombe ging nicht hoch, aber sie brachte einen Teil der Mauer zum Einsturz und begrub Nazila unter sich.
"Sie war ein sehr schönes Kind", sagt die Mutter Shakila Noori. Jetzt ist sie tot und hat eine Lücke hinterlassen, welche die gesamte Familie zu verschlucken droht. Der Vater Abdul ist seit Nazilas Tod, wie die Mutter sich ausdrückt, "im Kopf krank". Die zweite Tochter, die vierjährige Suvita, weint immerzu, und wenn sie ihr Weinen unterbrechen kann, dann fragt sie nach ihrer Schwester Nazila - und weint wieder. Der sechsjährige Sohn, Suhrab, wird nachts von Albträumen wachgerüttelt: Flugzeuge, Bomben und Raketen stören seinen Schlaf. Auch die Mutter hat Probleme. "Mit den Nerven und dem Kopf", sagt sie. Und auf die Frage, ob sie bei einem Arzt in Behandlung ist, geht sie zu ihrem Zimmerschrank und holt eine Flasche hervor: Nevrozin Syrup. Glycerophosphate Vitamin B Complex. Das ist ihre einzige Medizin.
Es muss erwähnt werden, dass das Schicksal von Shakila Nooris Familie nicht unbemerkt geblieben ist. Nachdem die Taliban Kabul aufgegeben hatten, kam eine Delegation in ihr Haus, Amerikaner, die Angehörige bei den Terrorangriffen vom 11. September verloren hatten, von der Organisation Global Exchange nach Afghanistan gebracht. Sie unterhielten sich eine Weile mit Shakila Noori. Ein Treffen der Versöhnung, wie es hieß. Bevor die Gäste gingen, ließen sie noch Geschenke für die verbliebenen Kinder zurück: einen Fußball, eine Schachtel Filzstifte und ein Stofftier.
Es war ein guter Tag für Shakila gewesen, voller tröstender Worte, voller Hoffnung und Versprechen auf Hilfe. Vor allem hatte sie das Gefühl, nicht vergessen worden zu sein, dass sich jemand um ihr Leid kümmerte. Seit dem Besuch allerdings hat Shakila Noori nichts mehr von ihren Gästen gehört. Die Filzstifte sind inzwischen bis auf zwei ausgetrocknet, das Stofftier ist ramponiert, nur der Fußball ist noch intakt.
Das ist in aller Kürze die Geschichte der Familie Noori aus Kabul. Und jetzt können wir auch von den Zahlen sprechen.
So banal es klingt: Um Zahlen zu haben, braucht es jemanden, der zählt. In Kabul aber hat bisher niemand die Aufgabe übernommen festzustellen, wie viele Menschen der Intervention zum Opfer gefallen sind. Die Regierung nicht, nicht die Armee und auch nicht die Hilfsorganisationen.
"Wir werden es nie erfahren"
Die Frage ist: Warum? Die Ministerin für Frauenangelegenheiten, Sima Samar, sagt: "Wir sind so sehr mit unserem Kleinkram beschäftigt, mit dem Aufbau unserer Ministerien, dass wir dazu nicht die Zeit haben." Ein Blick in Samars Büro genügt, um das zu verstehen. Die Möbel und Stühle, die bisher einzigen ihres gesamten Ministeriums, sind ein Geschenk der UN. Samars Kassen sind leer. Ähnlich sieht es in fast allen afghanischen Ministerien aus. Viel können da Opfer nicht erwarten - nicht einmal, dass sie gezählt werden.
Jenseits dieser durchaus einleuchtenden Gründe bleibt ein Grundproblem: Warum sollte eine Regierung, die von den USA an die Macht gebombt wurde, gerade jene Geschichten zusammentragen, welche die USA in Verlegenheit bringen könnten?
Selbst unter den Nichtregierungsorganisationen gibt es bisher keine, die umfassend gezählt hat. Warum? Der Präsident der italienischen Organisation Emergency, Gino Strada, sagt: "Heutzutage gewinnt man Kriege, wenn man zwei Bereiche kontrolliert: die Medien und die humanitären Organisationen. Das ist in diesem Krieg gelungen."
Strada führt als Chirurg in Kabul ein Krankenhaus, das ausschließlich auf Kriegsopfer spezialisiert ist. Während des Bombardements arbeitete er in Kabul. Dabei erlebte er selbst, wie schwierig es in Afghanistan ist, Buch zu führen über Opfer - unabhängig davon, ob jemand das überhaupt wirklich beabsichtigt.
Eines Tages, noch während der amerikanischen Herbstoffensive, lagen vor dem Eingang von Stradas Krankenhaus 13 Leichen. Die Familienangehörigen hatten sie hierher gebracht, weil sie ihre Toten nach muslimischem Brauch innerhalb eines Tages begraben wollten. Ihnen fehlte jedoch das Geld, und sie hofften, Strada würde helfen. Er gab ihnen etwas, und die Menschen verschwanden mit ihren Toten. Sie gingen, ohne einen Namen oder Adresse zu hinterlassen. Verschluckt vom Trümmerfeld Kabul.
Der Tod durch Krieg in Afghanistan ist in aller Regel anonym. Alle Opferzahlen der Kriege in den letzten dreißig Jahren beruhen auf Schätzungen. Eine bis eineinhalb Millionen Afghanen starben während der zehnjährigen Besetzung durch die Rote Armee. Zwischen 100 000 und 150 000 verloren während des Bürgerkrieges zwischen 1992 und 1996 allein in Kabul ihr Leben, doch auch in den Provinzstädten, den Dörfen, in den unzugänglichen Bergen starben Unzählige durch Gewalt. Verlässliche Zahlen gibt es auch darüber nicht. Es lässt sich nicht einmal sagen, wie viele Menschen in Afghanistan heute leben. Die letzte Volkszählung datiert aus den siebziger Jahren. Inzwischen sind Millionen gestorben, sind geflohen, wieder zurückgekommen, wieder geflohen - eine Masse Mensch, die ständig in Bewegung war. Wie sollte man da zählen?
Die Frage jedoch bleibt: Wie viele zivile Opfer hat die Intervention in Afghanistan gekostet?
Der Ökonom Marc W. Herold von der Universität New Hampshire hat auf der Grundlage von veröffentlichten Nachrichten die Summe gezogen. Er kam schließlich auf ein Minimum von 3767 Toten unter den Zivilisten zwischen 7. Oktober und 6. Dezember. Man kann Herolds Berechnung über den 6. Dezember hinausführen: 20. Dezember, Angriff auf einen Konvoi in der Provinz Paktia: 50 bis 60 Tote nach Angaben der Verbündeten der USA; 29. Dezember, Bombenangriff auf das Dorf Niazi Qala: 100 Tote nach Augenzeugenberichten. Und so kann es, da der Krieg andauert, weitergehen bis zum heutigen Tag. "Bei der Zahl Herolds", sagt Gino Strada, "ist noch nicht einmal das Dauerbombardement von Kandahar berücksichtigt, das wochenlang anhielt." Strada schätzt die Zahl auf insgesamt "mindestens 5000". Und er sagt gleich dazu: "Aber wir werden es nie erfahren."
Tod beim Abendgebet
Wobei immer noch die Frage zu klären ist, wer denn in Afghanistan als ziviles Opfer zu gelten hat. In einem Land, in dem fast jeder Mann eine Waffe trägt, wo nicht einmal klar ist, wer unter den Waffentragenden wirklich als Kriegsgegner der USA einzustufen war. Als Faustregel für die von ihren Waffen überzeugten Militärs mag gelten: Wer immer unter den Bomben umgekommen ist, der war mit hoher Wahrscheinlichkeit einer unserer Todfeinde. "Das war der präziseste Krieg in der Geschichte der Nation", sagte der für die Operation verantwortliche General Tommy Franks.
Wie präzise und wie gnadenlos die US-Bomber arbeiten, zeigt die lange Jagd nach Jalaludin Haqqani, einer der wichtigsten Figuren des Talibanregimes. Haqqani war ein bekannter Guerillaführer während der sowjetischen Besetzung. Noch im September 2001 war er von Talibanführer Mullah Omar zum Verteidigungsminister ernannt worden. Haqqani also war ein großer Fisch, ein lohnendes Ziel für die Bomber.
Am Abend des 12. November trafen US-Flugzeuge Haqqanis Haus in Kabul insgesamt dreimal. Eine 30-jährige Frau, die gerade im Garten Wasser holte, kam ums Leben.
Einen Tag später, am 13. November, warfen Flugzeuge Bomben auf ein Haus in der Stadt Gardez, in der sich Haqqani angeblich aufhielt. Ein Hausdiener und ein Verwandter Haqqanis kamen ums Leben.
In der Nacht zum 16. November waren eine Moschee und eine Religionsschule am Stadtrand von Khost das Ziel der Amerikaner. Die Militärs wollten auch hier den Talibanführer Haqqani töten. Das misslang. Es starben aber 15 Schüler im Teenageralter und zehn Menschen, die ihr Abendgebet in der Moschee verrichteten. Darunter befanden sich Angehörige von Al-Qaida.
Am 18. November griffen US-Flugzeuge im Dorf Tosha das Haus von Maulvi Sirajuddin an. Haqqani war zwar dort, aber entkam rechtzeitig. Maulvi Sirajuddin und seine 11-köpfige Familie fanden den Tod.
Am 19. November nachts schließlich fielen Bomben auf ein weitläufiges Gebäude in Zinikil, einem Weiler nahe der ostafghanischen Stadt Khost.
Zir Aman wird diese Nacht nie vergessen. "Hier", sagt er und scharrt mit den Füßen im Schutt, "hier sind vier meiner Söhne ums Leben gekommen. Und dort", er weist mit der Hand über eine umgestürzte Mauer, "dort ist meine Mutter gestorben, samt den Frauen meiner Brüder und sechs ihrer Kinder." Die zwölf Familienmitglieder sind am Rande der Straße, wenige Meter vom zerstörten Haus entfernt, begraben.
Zir Aman gibt ohne Umschweife zu, dass der gejagte Haqqani in seinem Haus zu Gast gewesen war. "Aber wir wussten nicht, wer er war. Wir hatten keine Verbindung mit den Taliban. Es ist gut, dass dieses Regime gegangen ist, aber von den Amerikanern haben wir bisher nichts als Tod bekommen!"
Von Jalaludin Haqqani fehlt bis heute jede Spur. Die mit Präzisionswaffen geführte Jagd auf ihn hat bisher insgesamt 43 Zivilisten das Leben gekostet. Sie ist deshalb nicht abgeblasen. Einen Monat nach dem Angriff auf Zir Amans Haus landeten um drei Uhr nachts Helikopter in Zinikil. US-Truppen stürmten mehrere Häuser. Sie blieben bis fünf Uhr morgens. Als die Soldaten wieder abflogen, hatten sie insgesamt vier Verwandte von Zir Aman mitgenommen. Seither sind sie verschwunden.
Zir Aman fuhr nach Khost, zum Flugplatz, wo die US-Armee einen Stützpunkt errichtet hat. Dort versuchte er, den Amerikanern einen handgeschriebenen Brief mit folgenden Zeilen zu übergeben: "Wir versichern Ihnen, dass meine Brüder und Verwandten sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Wir bitten Sie daher, sie freizulassen oder uns zumindest zu sagen, wo sie sich befinden." Zir Aman fand niemanden, der ihm den Brief abgenommen hätte.
Die vier Entführten heißen Khan Zaman, Gul Zaman, Mohammed Gul, Sarajudien Gul.
----------
Den Zahlen nach war der Ami "präziser" als der schlimme Bin Laden
-----
http://www.bundeswehrabschaffen.de/terror_usa81.htm
DIE ZEIT
Politik 12/2002
Der "präziseste Krieg" der Geschichte
--------------------------------------------------------------------------------
Niemand hat bisher die zivilen Opfer des amerikanischen Luftkrieges in Afghanistan gezählt. Es gibt sie trotzdem
von Ulrich Ladurner
Kabul/Khost
Es gibt viele Gräber in Afghanistan. Sie liegen mitten zwischen den Lebenden von Kabul, wenige Meter von den Passanten entfernt, den Radfahrern, den Straßenkindern, den Marktschreiern, Metzgern, Verkäufern und Bäckern; sie trotzen in der Stadt dem allgegenwärtigen Menschengewimmel. Die Gräber fallen dem Reisenden auf Überlandstraßen auf, sie liegen an Flussufern, Feldern und Berghängen. In mehr als 30 Jahren Krieg hörten die Friedhöfe niemals auf, über die Maßen zu wachsen, als müssten sie täglich beweisen, dass ein schrecklicher Fluch über Afghanistan liegt. Wo immer man hinblickt: Gräber, Gräber, Gräber.
Wie viele sind hinzugekommen seit dem 7. Oktober 2001, dem Beginn der Intervention der Antiterrorallianz in Afghanistan? Wie viele Leichen mussten verscharrt werden unter der Bezeichnung: zivile Opfer? Das ist eine wichtige Frage für den Westen, denn ein Recht auf Selbstverteidigung kann man auch verlieren; es kann ausgehöhlt werden durch die Art der Kriegführung und durch die Opferzahlen. Wie viele also sind es?
Bevor wir von den Zahlen sprechen, sollten wir von Nazila reden. Sie war fünf Jahre alt. Am 17. Okober spielte sie mit ihren Freunden im Hof ihres Mietshauses, im Kabuler Viertel Microrion, Block 33. Plötzlich explodierte eine Bombe in der Kaserne, die wenige hundert Meter von dem Haus entfernt liegt. Nazila und die anderen Kinder suchten panisch in den Häusern Schutz. Eine zweite Bombe fiel. Sie bohrte sich knapp einen Meter vor dem Hauseingang in die Erde, in den sich Nazila flüchten wollte. Die Bombe ging nicht hoch, aber sie brachte einen Teil der Mauer zum Einsturz und begrub Nazila unter sich.
"Sie war ein sehr schönes Kind", sagt die Mutter Shakila Noori. Jetzt ist sie tot und hat eine Lücke hinterlassen, welche die gesamte Familie zu verschlucken droht. Der Vater Abdul ist seit Nazilas Tod, wie die Mutter sich ausdrückt, "im Kopf krank". Die zweite Tochter, die vierjährige Suvita, weint immerzu, und wenn sie ihr Weinen unterbrechen kann, dann fragt sie nach ihrer Schwester Nazila - und weint wieder. Der sechsjährige Sohn, Suhrab, wird nachts von Albträumen wachgerüttelt: Flugzeuge, Bomben und Raketen stören seinen Schlaf. Auch die Mutter hat Probleme. "Mit den Nerven und dem Kopf", sagt sie. Und auf die Frage, ob sie bei einem Arzt in Behandlung ist, geht sie zu ihrem Zimmerschrank und holt eine Flasche hervor: Nevrozin Syrup. Glycerophosphate Vitamin B Complex. Das ist ihre einzige Medizin.
Es muss erwähnt werden, dass das Schicksal von Shakila Nooris Familie nicht unbemerkt geblieben ist. Nachdem die Taliban Kabul aufgegeben hatten, kam eine Delegation in ihr Haus, Amerikaner, die Angehörige bei den Terrorangriffen vom 11. September verloren hatten, von der Organisation Global Exchange nach Afghanistan gebracht. Sie unterhielten sich eine Weile mit Shakila Noori. Ein Treffen der Versöhnung, wie es hieß. Bevor die Gäste gingen, ließen sie noch Geschenke für die verbliebenen Kinder zurück: einen Fußball, eine Schachtel Filzstifte und ein Stofftier.
Es war ein guter Tag für Shakila gewesen, voller tröstender Worte, voller Hoffnung und Versprechen auf Hilfe. Vor allem hatte sie das Gefühl, nicht vergessen worden zu sein, dass sich jemand um ihr Leid kümmerte. Seit dem Besuch allerdings hat Shakila Noori nichts mehr von ihren Gästen gehört. Die Filzstifte sind inzwischen bis auf zwei ausgetrocknet, das Stofftier ist ramponiert, nur der Fußball ist noch intakt.
Das ist in aller Kürze die Geschichte der Familie Noori aus Kabul. Und jetzt können wir auch von den Zahlen sprechen.
So banal es klingt: Um Zahlen zu haben, braucht es jemanden, der zählt. In Kabul aber hat bisher niemand die Aufgabe übernommen festzustellen, wie viele Menschen der Intervention zum Opfer gefallen sind. Die Regierung nicht, nicht die Armee und auch nicht die Hilfsorganisationen.
"Wir werden es nie erfahren"
Die Frage ist: Warum? Die Ministerin für Frauenangelegenheiten, Sima Samar, sagt: "Wir sind so sehr mit unserem Kleinkram beschäftigt, mit dem Aufbau unserer Ministerien, dass wir dazu nicht die Zeit haben." Ein Blick in Samars Büro genügt, um das zu verstehen. Die Möbel und Stühle, die bisher einzigen ihres gesamten Ministeriums, sind ein Geschenk der UN. Samars Kassen sind leer. Ähnlich sieht es in fast allen afghanischen Ministerien aus. Viel können da Opfer nicht erwarten - nicht einmal, dass sie gezählt werden.
Jenseits dieser durchaus einleuchtenden Gründe bleibt ein Grundproblem: Warum sollte eine Regierung, die von den USA an die Macht gebombt wurde, gerade jene Geschichten zusammentragen, welche die USA in Verlegenheit bringen könnten?
Selbst unter den Nichtregierungsorganisationen gibt es bisher keine, die umfassend gezählt hat. Warum? Der Präsident der italienischen Organisation Emergency, Gino Strada, sagt: "Heutzutage gewinnt man Kriege, wenn man zwei Bereiche kontrolliert: die Medien und die humanitären Organisationen. Das ist in diesem Krieg gelungen."
Strada führt als Chirurg in Kabul ein Krankenhaus, das ausschließlich auf Kriegsopfer spezialisiert ist. Während des Bombardements arbeitete er in Kabul. Dabei erlebte er selbst, wie schwierig es in Afghanistan ist, Buch zu führen über Opfer - unabhängig davon, ob jemand das überhaupt wirklich beabsichtigt.
Eines Tages, noch während der amerikanischen Herbstoffensive, lagen vor dem Eingang von Stradas Krankenhaus 13 Leichen. Die Familienangehörigen hatten sie hierher gebracht, weil sie ihre Toten nach muslimischem Brauch innerhalb eines Tages begraben wollten. Ihnen fehlte jedoch das Geld, und sie hofften, Strada würde helfen. Er gab ihnen etwas, und die Menschen verschwanden mit ihren Toten. Sie gingen, ohne einen Namen oder Adresse zu hinterlassen. Verschluckt vom Trümmerfeld Kabul.
Der Tod durch Krieg in Afghanistan ist in aller Regel anonym. Alle Opferzahlen der Kriege in den letzten dreißig Jahren beruhen auf Schätzungen. Eine bis eineinhalb Millionen Afghanen starben während der zehnjährigen Besetzung durch die Rote Armee. Zwischen 100 000 und 150 000 verloren während des Bürgerkrieges zwischen 1992 und 1996 allein in Kabul ihr Leben, doch auch in den Provinzstädten, den Dörfen, in den unzugänglichen Bergen starben Unzählige durch Gewalt. Verlässliche Zahlen gibt es auch darüber nicht. Es lässt sich nicht einmal sagen, wie viele Menschen in Afghanistan heute leben. Die letzte Volkszählung datiert aus den siebziger Jahren. Inzwischen sind Millionen gestorben, sind geflohen, wieder zurückgekommen, wieder geflohen - eine Masse Mensch, die ständig in Bewegung war. Wie sollte man da zählen?
Die Frage jedoch bleibt: Wie viele zivile Opfer hat die Intervention in Afghanistan gekostet?
Der Ökonom Marc W. Herold von der Universität New Hampshire hat auf der Grundlage von veröffentlichten Nachrichten die Summe gezogen. Er kam schließlich auf ein Minimum von 3767 Toten unter den Zivilisten zwischen 7. Oktober und 6. Dezember. Man kann Herolds Berechnung über den 6. Dezember hinausführen: 20. Dezember, Angriff auf einen Konvoi in der Provinz Paktia: 50 bis 60 Tote nach Angaben der Verbündeten der USA; 29. Dezember, Bombenangriff auf das Dorf Niazi Qala: 100 Tote nach Augenzeugenberichten. Und so kann es, da der Krieg andauert, weitergehen bis zum heutigen Tag. "Bei der Zahl Herolds", sagt Gino Strada, "ist noch nicht einmal das Dauerbombardement von Kandahar berücksichtigt, das wochenlang anhielt." Strada schätzt die Zahl auf insgesamt "mindestens 5000". Und er sagt gleich dazu: "Aber wir werden es nie erfahren."
Tod beim Abendgebet
Wobei immer noch die Frage zu klären ist, wer denn in Afghanistan als ziviles Opfer zu gelten hat. In einem Land, in dem fast jeder Mann eine Waffe trägt, wo nicht einmal klar ist, wer unter den Waffentragenden wirklich als Kriegsgegner der USA einzustufen war. Als Faustregel für die von ihren Waffen überzeugten Militärs mag gelten: Wer immer unter den Bomben umgekommen ist, der war mit hoher Wahrscheinlichkeit einer unserer Todfeinde. "Das war der präziseste Krieg in der Geschichte der Nation", sagte der für die Operation verantwortliche General Tommy Franks.
Wie präzise und wie gnadenlos die US-Bomber arbeiten, zeigt die lange Jagd nach Jalaludin Haqqani, einer der wichtigsten Figuren des Talibanregimes. Haqqani war ein bekannter Guerillaführer während der sowjetischen Besetzung. Noch im September 2001 war er von Talibanführer Mullah Omar zum Verteidigungsminister ernannt worden. Haqqani also war ein großer Fisch, ein lohnendes Ziel für die Bomber.
Am Abend des 12. November trafen US-Flugzeuge Haqqanis Haus in Kabul insgesamt dreimal. Eine 30-jährige Frau, die gerade im Garten Wasser holte, kam ums Leben.
Einen Tag später, am 13. November, warfen Flugzeuge Bomben auf ein Haus in der Stadt Gardez, in der sich Haqqani angeblich aufhielt. Ein Hausdiener und ein Verwandter Haqqanis kamen ums Leben.
In der Nacht zum 16. November waren eine Moschee und eine Religionsschule am Stadtrand von Khost das Ziel der Amerikaner. Die Militärs wollten auch hier den Talibanführer Haqqani töten. Das misslang. Es starben aber 15 Schüler im Teenageralter und zehn Menschen, die ihr Abendgebet in der Moschee verrichteten. Darunter befanden sich Angehörige von Al-Qaida.
Am 18. November griffen US-Flugzeuge im Dorf Tosha das Haus von Maulvi Sirajuddin an. Haqqani war zwar dort, aber entkam rechtzeitig. Maulvi Sirajuddin und seine 11-köpfige Familie fanden den Tod.
Am 19. November nachts schließlich fielen Bomben auf ein weitläufiges Gebäude in Zinikil, einem Weiler nahe der ostafghanischen Stadt Khost.
Zir Aman wird diese Nacht nie vergessen. "Hier", sagt er und scharrt mit den Füßen im Schutt, "hier sind vier meiner Söhne ums Leben gekommen. Und dort", er weist mit der Hand über eine umgestürzte Mauer, "dort ist meine Mutter gestorben, samt den Frauen meiner Brüder und sechs ihrer Kinder." Die zwölf Familienmitglieder sind am Rande der Straße, wenige Meter vom zerstörten Haus entfernt, begraben.
Zir Aman gibt ohne Umschweife zu, dass der gejagte Haqqani in seinem Haus zu Gast gewesen war. "Aber wir wussten nicht, wer er war. Wir hatten keine Verbindung mit den Taliban. Es ist gut, dass dieses Regime gegangen ist, aber von den Amerikanern haben wir bisher nichts als Tod bekommen!"
Von Jalaludin Haqqani fehlt bis heute jede Spur. Die mit Präzisionswaffen geführte Jagd auf ihn hat bisher insgesamt 43 Zivilisten das Leben gekostet. Sie ist deshalb nicht abgeblasen. Einen Monat nach dem Angriff auf Zir Amans Haus landeten um drei Uhr nachts Helikopter in Zinikil. US-Truppen stürmten mehrere Häuser. Sie blieben bis fünf Uhr morgens. Als die Soldaten wieder abflogen, hatten sie insgesamt vier Verwandte von Zir Aman mitgenommen. Seither sind sie verschwunden.
Zir Aman fuhr nach Khost, zum Flugplatz, wo die US-Armee einen Stützpunkt errichtet hat. Dort versuchte er, den Amerikanern einen handgeschriebenen Brief mit folgenden Zeilen zu übergeben: "Wir versichern Ihnen, dass meine Brüder und Verwandten sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Wir bitten Sie daher, sie freizulassen oder uns zumindest zu sagen, wo sie sich befinden." Zir Aman fand niemanden, der ihm den Brief abgenommen hätte.
Die vier Entführten heißen Khan Zaman, Gul Zaman, Mohammed Gul, Sarajudien Gul.
----------
Den Zahlen nach war der Ami "präziser" als der schlimme Bin Laden

http://www.zeitreport.de/usa.htm
USA – Der Anfang vom Ende
Wer es wagt, im Jahr 2002 das Ende der (einzig verbliebenen) Weltmacht vorherzusagen, muß sich wohl gefallen lassen, für verrückt gehalten zu werden. Einverstanden.
Aber ähnlich muß es auch „Mahnern in der Wüste“ gegangen sein, die im Jahre 60 unserer Zeitrechnung das Ende Roms oder 1914 das Ende des British Empire vorhergesagt hätten.
Nun, im Jahr 1980 gab der DBSFS e.V. die Schrift „Visio 2020“ heraus, in der u.a. auch das Ende der Teilung Deutschlands und der Zusammenbruch des Sozialismus` vorhergesagt wurden. Beides geschah schneller als dies die überwiegende Mehrheit der Politiker und Medien zu träumen gewagt hätten.
Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bedecken eine Fläche von knapp 9,8 Millionen km² und zählen, illegale Einwanderer außer Acht gelassen, 270,5 Millionen Einwohner. Dies entspricht weniger als 30 Einwohnern pro km², was im Vergleich zu sämtlichen anderen Industrienationen jede Menge an Raum bietet (zum Vergleich: Deutschland hat etwa 230 Einwohner pro km², Belgien gar 334). Mit einem Bruttosozialprodukt von knapp 29.000 US-$ pro Kopf liegen die USA hinter Luxemburg, der Schweiz, Dänemark, Japan, Norwegen und Singapur auf Platz 7. Was die Kindersterblichkeit (unter 0,7 %), Säuglingssterblichkeit (unter 0,6 %) und die Analphabetenrate (unter 5 %) angeht, nehmen die USA jeweils einen der besten Plätze weltweit ein. Der Dienstleistungsstand der Gesellschaft (ca. 74 %), eine Arbeitslosenquote von unter 5 % und eine Inflationsrate von knapp 2,4 % lassen wenige Probleme vermuten. Weltweit gelten die USA neben der Schweiz als Musterknaben der Demokratie.
Doch schon auf den zweiten Blick enthüllen sich Schwachstellen eines Systems, die Bedenken aufkommen lassen:
- Die USA leben (und dies seit Jahren) über ihre Verhältnisse. So zeigt sich die Export-/Importquote der USA seit rund 15 Jahren bedenklich negativ – relativ konstant bei etwa 70 %; d.h. einer Milliarde an importierten Gütern stehen jeweils nur 700 Millionen an Export gegenüber. Wohl nicht zuletzt deshalb sind veritable Daten über die konkrete Auslandsverschuldung der USA ein wohlgehütetes Staatsgeheimnis. Diesem Manko begegnen die USA regelmäßig mit dem Hinweis darauf, daß der weltweite Devisenimport durchschnittlich fast 60 % (1970 bis 2000) über dem Abfluß US-inländischer Devisen liegt. Die USA gelten eben, so der unverhohlen stolze Tenor, als sicherer Hafen für ausländische Devisen. Daß diese „Brücke“ aber nicht unendlich haltbar ist, wird nunmehr immer deutlicher; allein im ersten Halbjahr 2002 flossen – erstmals seit hierüber Buch geführt wird – rund 40 % mehr Devisen aus den USA als umgekehrt in die Vereinigten Staaten. Speziell nach dem inzwischen weltweit registrierten Platzen der amerikanischen Börsenblase steigt diese Tendenz sogar noch (hierzu später mehr);
- Der durchschnittliche US-Amerikaner ist kein Sparer, sondern hochverschuldet; während der durchschnittliche Bundesbürger rund € 6.000 an Liquidität hält (ängstlicherweise vornehmlich auf Girokonten oder als Monatsgeld) und über ein Ø-Vermögen (ohne Immobilien) von etwa
€ 45.000 verfügt, eine Sparquote von 8,2 % aufweist und sich einer staatlichen Altersversorgung von durchschnittlich 53 % seines heutigen Bruttolohns erfreuen kann, hat der durchschnittliche US-Amerikaner Schulden von mehr als 12.000 US-$ [1] ), seine noch zum Jahresanfang 2001 in Börsenwerten investierten 40.000 US-$ sind heute nur noch knapp 15.000 US-$ wert, und die staatlicherseits garantierten Renten liegen bei weniger als 15 % pro Kopf der Bevölkerung. Auch bezüglich der betrieblichen Altersversorgung liegen die US-Amerikaner im Vergleich mit europäischen Ländern hoffnungslos abgeschlagen; etwa 40 % aller Arbeitnehmer haben überhaupt keine betriebliche Altersversorgung, und wie schnell selbst eine vertraglich vereinbarte Betriebsrente (etwa 35 % bestehen in Aktien und/oder aktienähnlichen Rechten und Firmenvermögen) an Wert verlieren oder völlig wertlos werden können, zeigen die letzten Monate nur allzu deutlich;
- Die US-Wirtschaft hinkt. Abgesehen von einem (immer noch) boomenden Tourismus, der etwa 7 % des Bruttoinlandproduktes ausmacht, ist die amerikanische Wirtschaft stark technologielastig. Dies betrifft vor allem die Fabrikation und den Export von Maschinen und Ausrüstungsgütern (knapp 50 %), wohinter sich aber die weltweit größte Kriegswaffen- und dieser verwandte Logistik- und Technikproduktion verbirgt. Nicht zuletzt deshalb sind die USA auf die Einfuhr von Konsumgütern und Nahrungsmitteln im Wert von etwa 40 Milliarden US-$ angewiesen – Waren, die hauptsächlich aus Kanada und Mexiko (NAFTA) sowie Lateinamerika importiert werden.
Der US-amerikanische Autismus
Die oben genannten Zahlen müssen, für sich genommen, noch nicht unbedingt Besorgnis erregen. Immerhin zahlt man in 48 Ländern/Staaten sowie 8 Pazifik- und Karibikinseln, die als „unincorporated territories“ der USA gelten, in US-Dollars oder fest an den US-Dollar gebundenen sonstigen Dollars. Dazu kommt eine einheitliche, dem Englischen stark verwandte Sprache und ein buntes Gemisch von Rassen und Nationalitäten, die eigentlich beste Voraussetzungen für ungehindertes Wachstum, interkulturelle Lebensart, freie Entwicklungschancen für jedermann und einen größtmöglichen Liberalismus böten.
Doch dem ist nicht so. Wer die Vereinigten Staaten – nicht nur die vielbesuchten Metropolen von New York bis Los Angeles – kennt, weiß um das egozentrische, erschreckend simplifizierte Weltbild der USA; in keinem Industrieland ist die Spanne zwischen arm und reich auch nur annähernd so gewaltig wie in den USA; kein Industrieland kann sich mit der Kriminalitäts-, vor allem der Mordrate in den USA messen; Slums, wie es sie in jeder der zehn Millionenstädte und weiteren 20 Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern gibt, sucht man in sämtlichen anderen Industrienationen vergeblich; in US-Gefängnissen sitzen mehr MitbürgerInnen ein als in sämtlichen anderen Industrienationen zusammen, und nach offiziellen Zahlen von Amnesty International führen die USA auch weltweit die „Hitliste“ von Hinrichtungen an – ausgenommen China, was gerade auf dem Sprung vom Schwellen- zum Industrieland ist; wiewohl den etwa 195 Millionen Weißen (74 % der Bevölkerung) nur 35 Millionen Schwarze (13 %) und 27 Millionen Hispanics (10 %) gegenüberstehen, liegt der Anteil der Nicht-Weißen wegen krimineller Delikte einsitzenden US-BügerInnen bei über 35 %. Gerade diese „coloured people“ bilden aber den Kern der unterprivilegierten Masse in sämtlichen Großstädten. Diese Unterprivilegiertheit hat eine lange Geschichte und straft das gern gezeichnete Bild des toleranten, weltoffenen Amerika Lügen. Zwar ehrt man noch heute die Heroen der amerikanischen Verfassung, geht man diesen Sagen jedoch etwas mehr auf den Grund, so fördert man Erstaunliches zu Tage. Die USA rühmen sich, die beste Verfassung der Welt zu haben und verweisen auf Thomas Jefferson`s Worte im Jahre 1776 zur Unabhängigkeitserklärung: „All men are created equal.“ Die Realität sieht jedoch etwas anders aus: Eben jener Jefferson, dritter Präsident der USA, war Großgrundbesitzer in Virginia und ließ auch nach der Unabhängigkeitserklärung völlig rechtlose „Nigger“ auf seinen Plantagen schuften. Sie waren eben nicht gleich, vielmehr durften sie ausgepeitscht und verkauft werden. Nicht anders verhielt sich der glorifizierte George Washington, erster Präsident der USA, dem wir auch den Begriff vom „Recht jeden Individuums auf Glück“ („pursuit of happiness“ verdanken; trotz dieser Glück verheißenden Garantien der Verfassung hielt die Brutalität der Sklaverei in den Südstaaten noch fast ein Jahrhundert an, und hinzu kam der fortgesetzte Völkermord an den Ureinwohnern. Weder bei den Indianern noch bei den Sklaven aus afrikanischen und karibischen Ländern haben sich die US-Amerikaner bis heute entschuldigt. Vielmehr wird, was viele US-Amerikaner weißer Hautfarbe bis heute nicht wissen, an in Ghettos gehaltene Indianer eine Art staatliche Rente als stillschweigende Entschuldigung geleistet. Diese Rente wird für die nächste Generation jeweils halbiert weitergezahlt.
verdanken; trotz dieser Glück verheißenden Garantien der Verfassung hielt die Brutalität der Sklaverei in den Südstaaten noch fast ein Jahrhundert an, und hinzu kam der fortgesetzte Völkermord an den Ureinwohnern. Weder bei den Indianern noch bei den Sklaven aus afrikanischen und karibischen Ländern haben sich die US-Amerikaner bis heute entschuldigt. Vielmehr wird, was viele US-Amerikaner weißer Hautfarbe bis heute nicht wissen, an in Ghettos gehaltene Indianer eine Art staatliche Rente als stillschweigende Entschuldigung geleistet. Diese Rente wird für die nächste Generation jeweils halbiert weitergezahlt.
Millionen von Arbeitern, vor allem nicht-weißer Hautfarbe, wird nach wie vor der gesetzliche Mindestlohn vorenthalten, für den im übrigen kaum ein Westeuropäer arbeiten würde. Hierin ist auch der Grund zu sehen, warum der durchschnittliche Amerikaner 2,25 Jobs hält – mehr als doppelt soviel wie der durchschnittliche Deutsche. Das US-amerikanische Glücks- und Demokratieversprechen steht der anhaltenden Mißachtung verfassungsmäßiger Rechte in bisweilen grotesker Weise entgegen. So werden – besonders aktuell mit den Geschehnissen vom 11.09.2001 begründet – unliebsame Ausländer nach der Verhaftung in andere Länder transportiert, um die vermeintlichen Feinde der USA dort verhören zu lassen (in den USA wird doch nicht gefoltert!), nach deren „Geständnissen“ werden sie dann in die USA zurück-überführt und eben dort auch verurteilt. Daneben wird unter juristischen Militärstatus gestellt, wer als Saboteur, Deserteur oder in sonstiger Art gegen die innere Sicherheit der USA agiert – mit der Folge, daß ihm juristische Elementarrechte (Anhörungsrecht, Recht auf einen Anwalt seiner Wahl, Einsicht in die Anklageschrift etc.) verweigert werden.
Zur „Geheimsache“ wird flugs erklärt, was keine mediale Erwähnung erfahren soll. Hierbei bedienen sich die USA eines weltweiten „Informations“-(vulgo: Spionage-)Netzes, welches US-intern von elf Geheimdiensten emsig verdichtet wird – unter der „Leitung“ [2] der Central Intelligence Agency (CIA). Für die polizeiliche Arbeit zeichnet national das FBI verantwortlich, und US-extern obliegt die „Oberaufsicht“ der National Security Agency (NSA), dem wohl mächtigsten US-Geheimdienst, der so geheim ist, daß die Bevölkerung der USA erst 1993 überhaupt davon erfuhr; da war der Verein aber bereits fast 35 Jahre alt!
Diese Geheimdienste überwachen nun – US-intern wie -extern den gesamten Informationentransfer (ECHELON, siehe zeitreport 127, 2001), Wissenschaft und Forschung, Bibliotheken und Verlage, die Reisetätigkeiten der höchst mobilen US-Amerikaner [3] , Steuervergehen [4] , die Ein- und Ausfuhr von (Militär-)technischen Waren, die Kontrolle der US-amerikanischen Embargos gegenüber „feindlichen“ oder widerspenstigen Staaten (die man problemlos dann eben über „befreundete" Staaten abwickelt), die Aufklärung und Überwachung nicht-systemkonform denkender US-Bürger, nicht-christlicher oder -jüdischer Religionsvereinigungen und Sekten u.v.m.. Speziell der rasant wachsende Internet-Verkehr zieht die Neugier der Schnüffelgarde magisch an – offiziell natürlich nur, um die USA gegen Staatsfeinde, Pädophile und die Verbreitung pornographischer Inhalte zu verteidigen. Daneben loten diese Geheimdienste aber auch die Bereitschaft ausländischer Politiker, Diplomaten und Wirtschaftsführer aus, sich gegen Bares in den Dienst des amerikanischen Freiheitsgedankens zu stellen. Die Chronik der US-Einflußnahme auf Diktatoren und System-Provokateure nicht freundlich gesonnener Staaten füllt Bände. Dabei schrecken die Gralshüter der "Wahrheit" und eines "gottesfürchtigen Lebenswandels" weder vor der Zusammenarbeit mit Kriminellen aller Couleur, Waffen- und Drogenhändlern, noch vor der Kombattanz mit jegliche Menschenrechte mit Füßen tretenden Staatschefs oder Terrororganisationen zurück. Es muß nur heimlich geschehen und offiziell den Zielen der USA, selbst ernannten Garanten weltweiten Friedens und US-Interessen dienender Überzeugungstäter entsprechen. Geradezu empört reagieren die USA, wenn in internationale Abkommen (z.B. zur Sicherung der Rechte Gefangener, die Anklage von Kriegsverbrechern, die Anti-Folter-Konvention, die Überprüfung der Produktion von biologischen und chemischen Kampfstoffen u.ä.) auch die USA mit einbezogen werden. Was erdreistet sich irgendein anderes Land, den USA in die Karten schauen zu wollen, brave und ausschließlich im Dienste ihres Landes, gottesfürchtig und gesetzestreu agierende US-Bürger überprüfen zu wollen! Einzig den USA ist vorbehalten, darüber zu richten, welches Land falsch regiert wird, wer zur Armada des Bösen zu zählen, zu bestrafen, zu bekämpfen und zu bekehren ist.
Erinnert werden darf in diesem Zusammenhang an die Worte Theodore Roosevelts, der dafür die bedenkliche Formulierung prägte: „Sprich freundlich, aber vergiß den Knüppel nicht!“ Dies galt beileibe nicht nur für den US-amerikanischen „Hinterhof“, Lateinamerika, in dem die USA bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts (natürlich nur zum Schutze der „American Fruit Company“ mit harter Hand, militärischer Omnipräsenz und mittels ihrer Geheimdienste nach Belieben und völlig unbedenklich intervenierten und ihnen genehme Diktatoren einsetzten und finanzierten – dank ihrer technischen Überlegenheit und mit der Entschuldigung, dort ihre Handelsstützpunkte verteidigen und sichern zu müssen. Auch der spätere Präsident Franklin D. Roosevelt verewigte sich mit einer reichlich menschenverachtenden Bemerkung in der Ana der Weltgeschichte: Im Hinblick auf die US-amerikanische Unterstützung des nicaraguanischen Diktators Somoza meinte er spitzbübig: „Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“
mit harter Hand, militärischer Omnipräsenz und mittels ihrer Geheimdienste nach Belieben und völlig unbedenklich intervenierten und ihnen genehme Diktatoren einsetzten und finanzierten – dank ihrer technischen Überlegenheit und mit der Entschuldigung, dort ihre Handelsstützpunkte verteidigen und sichern zu müssen. Auch der spätere Präsident Franklin D. Roosevelt verewigte sich mit einer reichlich menschenverachtenden Bemerkung in der Ana der Weltgeschichte: Im Hinblick auf die US-amerikanische Unterstützung des nicaraguanischen Diktators Somoza meinte er spitzbübig: „Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“
Ohne (unangebrachte) europäische Arroganz darf konstatiert werden, daß die US-Amerikaner – unabhängig von der Hautfarbe einerseits und dem Stand in der nach außen scheinbar offenen, in Wahrheit jedoch höchst hierarchisch gegliederten Gesellschaft andererseits – „ihr“ Amerika verblüffend naiv im Zentrum des Weltgeschehens sehen. Kaum ein US-Bürger ist auch nur grob darüber informiert, was im Rest der Welt geschieht, welche Probleme die übrigen 5,9 Milliarden Menschen gewärtigen und was nachgerade der US-amerikanische Imperialismus damit zu tun hat. Solange man den US-Amerikanern ihre Helden beläßt, ihre Religionsfreiheit und das Recht auf Waffenbesitz nicht einschränkt, so lange wähnen sie sich in „God`s own country“. Notfalls strickt sich der „gute“ und gottesfürchtige US-Amerikaner seine Legenden selbst und überhöht das Bild der „Vereinigten Staaten von Amerika“ bis zur Abstrusität. Dazu bedient er sich beliebiger Analogien aus den Epen archaischer Zeit. So kann man in Washington D.C. im Fresko der Kuppel des Capitols die „Himmelfahrt“ George Washingtons bestaunen, der von zarten Jungfrauen in die himmlische Unsterblichkeit geleitet wird – ohne auch nur einen seiner mehr als 300 schwarzen Sklaven. Jede militärische Aktion, Waffen(systeme) und der Glorie der USA huldigende Paraden der weltweit agierenden fundamentalistischen Staatsmacht USA wird von „christlichen“ Feldpredigern gesegnet, und in keinem anderen Land der zivilisierten Welt liegt brutaler Staatsterrorismus – nach dem alttestamentarischen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“-Prinzip - dem ansonsten faszinierenden humanitären Engagement des durchschnittlichen Amerikaners so nahe, wie eben in den USA. Dem liegt ein nach europäischem Verständnis grotesker Gegensatz zugrunde: Die Bürger der USA lehnen staatliche Einmischung in ihre privaten Bereiche kategorisch ab, und solange sich das staatliche System daran hält, duldet der Bürger nahezu alles, was sich die politische Führungskaste international an Rechten anmaßt oder national an Spielchen und Schweinereien treibt. Der Amerikaner legt als Kind vor dem Unterrichtsbeginn, später, als älteres “Kind“ vor Sport- und Kinoveranstaltungen, Oskarverleihungen und anderen Spektakeln brav die rechte Hand ans Herz und summt/singt die US-Hymne mit. Kaum ein US-Amerikaner ist darüber informiert, welche Diktatoren in Lateinamerika, Asien und vielen Ländern Afrikas mit Abermilliarden amerikanischer Steuergelder, amerikanischen Waffen und Soldaten unterstützt, finanziert und im Amt gehalten werden. Daß die USA heute in über 80 Staaten der Erde militärische Stützpunkte, als Handelszentren getarnte und unter Observation der Geheimdienste stehende Spionagebasen unterhalten, ihnen genehme Regime entweder stützen oder stürzen und sich dabei weder um internationale Abkommen, noch die ehedem von ihnen mitinitiierten Menschenrechte auch nur im mindesten scheren, weiß kaum ein US-Amerikaner. Weder liest oder hört er davon in den US-amerikanischen Medien, noch wird darüber in Schulen oder im Elternhaus diskutiert. Erst wenn ein Krieg zu viele US-amerikanische Leben kostet – Korea, Vietnam, Somalia -, regt sich binnenamerikanischer Widerstand.
„An der Nahtstelle von Wirtschaft und Politik ist es völlig normal, sich auf Kosten anderer auszubreiten – mit immer neuen Intrigen und Spielchen!“
Milton Friedman
Die verhaßte Staatsmacht
Nichts haßt der US-Amerikaner traditionell mehr, als staatliche Eingriffe in sein Leben. Nirgendwo sonst in der Welt werden so viele Polizisten vom Motorrad geschossen, verachtet oder verprügelt wie in den USA. [5] Es spricht Bände, wenn in Hollywood-Streifen die Stimmung in Polizeistrukturen als geradezu zynisch und menschenverachtend dargestellt wird, Polizeifahrzeuge – generell anscheinend von Vollidioten gesteuert – massenweise zu Schrott gefahren und damit die Staatsmacht genüßlich verlächerlicht wird. Es sind immer die einsamen (guten) „Cops“, die sich - unter Umgehung des offiziellen polizeilichen Regelwerks - als Retter der Menschheit entpuppen.
Nirgendwo geht die Staatsmacht - FBI, Verkehrspolizei oder IRS-Beamte - so rücksichtslos und demütigend mit Verdächtigen um, wie dies nicht nur in billigen Hollywood-Orgien, sondern auch in der Realität geschieht. Die dem Bürger weniger nahe Beamtenschaft – Mitglieder der vier Streitkräfte des Militärs – genießen hingegen höchstes Ansehen; eine unehrenhafte Entlassung (dishonorable discharge) gleicht einem lebenslangen Platzverweis.
Der US-Bürger traut den Vertretern der Staatsgewalt „less than a dime“ [6] . Selbst durchaus positiv besetzte Pläne der Regierung – Beschränkung der Mieten, Einführung von Mindeststandards für ein Gesundheitssystem – finden in der Bevölkerung keinen Anklang; sie verzichten darauf und bestehen auf ihrer individuellen Wahlfreiheit. Diese Erfahrung mußte auch der frühere Präsident Bill Clinton machen.
Das in Europa gültige Bild von den USA als einheitlichem Staatskörper, der „wie ein Mann“ hinter dem Präsidenten steht, ist völlig falsch. Im Grunde genommen rührt den US-Normalbürger kaum, was der ohnehin von weniger als einem Viertel der Wahlberechtigten gewählte Präsident sagt oder tut. Das Gros der US-Amerikaner schert sich einen Teufel um die funktionale Staatsmacht. Er haßt staatliche Einmischung und sucht lieber das weltweit als Erfindung der USA gepriesene „persönliche Glück“. Er will „sein Ding“ tun, seine Familie in Ehre und Anstand, im Kreise seiner Familie und der Nachbarschaft selbst großziehen und mit der Staatsgewalt möglichst weder in Kontakt noch in Konflikt kommen, bzw. von dieser unbehelligt bleiben. Die europäische Auffassung, bei den USA handele es sich um „ein Volk, einen Staat und einen Führer“, ist eine von europäischer Tradition verbrämte Mär.
US-amerikanische Touristen sind regelmäßig völlig erstaunt, bei ihren Reisen nach Europa auf eine sehr kritische Haltung gegenüber den USA zu stoßen. Sie können auch nicht verstehen, daß wir Europäer ihre kindlich-naive Einstellung belächeln oder herabwürdigen. US-Amerikaner sind einfach von Kindesbeinen an daran gewöhnt, im angeblichen „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ zwischen Micky Mouse und McDonalds, dem glitzernden Heroismus made in Hollywood und in der Dominanz von vier Jahreszeiten (football, baseball, basketball und icehockey) zu leben. Die Tatsache, daß sich das amerikanische Englisch in rasantem Tempo zu einem nicht mehr national zuordenbarem „Esperanto“ entwickelt, in das sprachliche Einflüsse aus aller Herren Länder sowie sprachverkürzende Symbole (U2, 4 me 2, etc.) mehr und mehr zu einem linguistischen Kauderwelsch auf infantilstem Niveau verdichten, akzeptieren die Bürger der USA ohne Bedenken. Daß sich die USA internationalen Abkommen zum Schutz der Umwelt, der Beschränkung von Atom-, Chemie- und Biowaffen widersetzen, eigene Soldaten von der internationalen Ächtung von Kriegsverbrechen ausgeschlossen sehen wollen und auch künftig die Todesstrafe ebenso Bestand haben soll wie viele andere, allen internationalen Vereinbarungen Hohn sprechende Protektionismen im Wirtschafts- und Handelsrecht, interessiert den durchschnittlichen US-Bürger, so er überhaupt darüber Bescheid weiß, nicht im mindesten. „Whatever is good for America is also good for me“ [7] ist allseits akzeptiert und bleibt unwidersprochen.
Europäischer Kritizismus und der ganz gelegentlich in US-Medien aufscheinende Bürgerprotest in Europa ist den Amerikanern grundsätzlich fremd und verdächtig. Sie sehen die Europäer als Bremser glorioser weltweiter US-Politik. Amerikanische Medien haben hierfür den Begriff des europäischen „whimps“ („Weichei, Schlappschwanz“ geprägt. Die auch in den USA forcierte Sprachformel „Globalisierung“ bedeutet für den mit allem außerhalb der USA ablaufenden Weltgeschehen wenig vertrauten US-Bürger eigentlich nur eine segensreiche Internationalisierung der amerikanischen Wertegemeinschaft. Am US-Wesen soll die Welt ....! Moment, hatten wir das nicht schon mal?
geprägt. Die auch in den USA forcierte Sprachformel „Globalisierung“ bedeutet für den mit allem außerhalb der USA ablaufenden Weltgeschehen wenig vertrauten US-Bürger eigentlich nur eine segensreiche Internationalisierung der amerikanischen Wertegemeinschaft. Am US-Wesen soll die Welt ....! Moment, hatten wir das nicht schon mal?
Die USA – Erben des Britischen Empire
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielte das Königreich England in etwa die gleiche Rolle, die 300 Jahre später die USA einnehmen sollten. Nach den siegreichen Auseinandersetzungen mit Holländern, Spaniern und Franzosen sah sich England militärisch als stärkste Macht weltweit. Es war mit Handelsposten in Nord- und Südamerika, Indien (Gründung der „East India Company“ am 31.12.1600) und neun anderen asiatischen Ländern vertreten. Bezüglich Kultur und Technik stand England weit vor den kontinentalen Königreichen und Fürstentümern, die im Vorfeld des 30-jährigen Krieges mehr mit religiösen Auseinandersetzungen zwischen Rom-orientierten Katholiken und verschiedenen protestantischen Bewegungen (Hus, Zwingli, Calvin und Luther) beschäftigt waren; Italien, in dem immerhin die ersten Universitäten der Welt (neben Paris) als Erben der griechischen Akademien gegründet wurden, hatte seinen Platz als führende Handelsmacht Europas längst eingebüßt. Recht ähnlich den heutigen USA ging es damals England darum, sich weltweit die meistversprechenden Handelsplätze, die reichsten Bodenschätze und strategisch wichtige Standorte zu sichern. Aus Südamerika zogen sich die viktorianischen Heere schnell wieder zurück, um dafür im Gegenzug in Afrika und Asien freie Hand zu haben, insbesondere aber im Nahen Osten, wo sich bereits das Konfliktfeld zwischen Arabern (vor allem den palästinensischen) und Juden entwickelt hatte, die nach den damaligen Pogromen in Polen, der nördlichen Schwarzmeerküste, Rußland, Frankreich und den westrheinischen Gebieten einzuwandern begannen. Der größte Teil des Reichtums der britischen Krone stammt aus der Zeit von 1630 bis 1860. Australien diente als Abschiebestation für Häftlinge, und Indien, Teile Indonesiens und die ozeanischen Inseln als Lieferanten für Gewürze, Hölzer und Bodenschätze. Zudem stand die Hälfte des damals erforschten Afrika (vor allem dessen Süden und der gesamte Osten vom Suez-Kanal bis zum Sudan) unter britischer Herrschaft. Für viele eingefleischte und monarchietreue Engländer gab das Britische Empire Ende des 18. Jahrhunderts zu schnell, beinahe kampflos dem Unabhängigkeitsstreben der 13 Gründungsstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika nach, lediglich der größte Teil Kanadas hörte noch auf britisches Geheiß.
Erst die Konflikte zwischen Muslimen und Hindus in Indien, die im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung des indischen Subkontinents aufbrachen, die wachsenden Spannungen im teils französisch (Syrien, Libanon), teils englisch beherrschten Nahen Osten, die revoltierenden Stämme in Sri Lanka (damals Ceylon) und Südafrika sowie der aufbrechende Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken auf der irischen Insel ließen das britische Weltreich, in dem Ende des 19. Jahrhunderts „niemals die Sonne unterging“, sukzessive zusammenbrechen.
Ende des 19. Jahrhunderts mußten die Engländer den größten Teil ihrer chinesischen Besitzungen (mit Ausnahme Hongkongs) aufgeben. Der Burenkrieg (1900) war der Anfang vom Ende der britischen Herrschaft in Südafrika und Ägypten – vor allem die uneingeschränkte Passage durch den Suezkanal ging verloren - und zwischen 1917 und 1948 durfte sich England dann endgültig auch von Indien und Pakistan (15./16. August 1947) verabschieden.
Das Britische Empire entstand im Schatten des in Hunderte von kleinen und kleinsten Fürstentümern zerrissenen Europa, vor allem aber der Kampf der sechs europäischen Großmächte. Es erlebte zwischen 1870 und 1900 eine phänomenale Ausweitung, verbuk dabei aber immer zwanghafter zu einem verkrusteten, arroganten, wandlungs- und anpassungsunfähigen System und lebt heute nur noch als kümmerlicher Schatten seiner ehemaligen weltweiten Größe vor sich hin.
Seit dem Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg – auf dem Umweg über die Lusitania-Affäre [8] -übernahmen diese sukzessive die ehedem britische Herrschaft und deren Ansprüche. Bis heute sind es aber zumeist die superreichen Familien Englands, Frankreichs und Hollands - größtenteils khasarische, also nicht-semitische Juden -, die das Wirtschaftsgeschehen in den USA bestimmen. Es sind diese europäischen Finanzoligarchen, die in Wahrheit hinter der amerikanischen Wirtschaft stehen – für die meisten US-Amerikaner völlig nebulöse Namen, die sich regelmäßig und höchst klandestin in ominösen Zirkeln [Trilaterale, Bilderberger-Konferenz, Atlantische Brücke, Council on Foreign Relations (CFR) und etwa 100 weiteren Bünden und Logen] treffen und untereinander absprechen.
Diesen Familien müssen die USA in ihrer naiven Spielfreude wie ein gigantischer Kindergarten vorkommen, in dem sie rücksichtslos nach eigenem Belieben schalten und walten können, ohne sich erkennbar die Finger schmutzig machen und sich der Kritik in ihren europäischen Heimatländern aussetzen zu müssen; man kann ja alles so wunderbar einfach den Amerikanern in die Schuhe schieben, sie an den Pranger stellen und wahlweise als Weltpolizisten, wenig hinterfragende Konsumenten, Versuchskaninchen im pharmazeutischen, militärischen oder medienpolitischen Spiel verwenden, und trotzdem seine gigantischen Gewinne ziehen. Nicht anders gingen diese Clans bei der höchst verschwiegenen Finanzierung Hitlers, Francos und Mussolinis vor, die ihnen als Bollwerk gegen den aufkeimenden Bolschewismus wunderbar ins Kalkül passten. Diese Familien stört heute auch nicht, wenn die Bürger der USA allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2002 mehr als 7 Billionen US-$ an privaten Ersparnissen in Aktien verloren, die Armutsrate in den USA weiter steigt und die Unruhe in den vornehmlich von Nicht-Weißen bewohnten Slums besorgniserregend zu steigen beginnt. „It`s their country“, mögen sich die Rothschilds und DeBeers, Rockefellers und Morgans (neben etwa zwei Dutzend weiterer Finanzfamilien) sagen, „but it`s our game“.
Gerade die eingeschränkte Weltsicht, die Reduzierung historischer Gegebenheiten auf vorgekaute Mythen und Geschehnisse, die sich um die Gründung der USA ranken, die nahezu völlige Nichtteilnahme des Gros der Amerikaner an allem, was östlich von Vermont und westlich von Hawaii geschieht, kann nur derjenige verstehen, der für eine gewisse Zeit in den USA lebt. Dem steht auch nicht die Tatsache entgegen, daß die Amerikaner außerordentlich aufgeschlossen und neugierig, begeisterungsfähig und hilfsbereit wie kaum ein anderes Land sind. Es ist vor allem die intellektuelle und emotionale Versklavung, die den Amerikaner für Außenstehende derart paranoid und manisch, egozentrisch und naiv-größenwahnsinnig erscheinen läßt. Wenn die USA z.B. im Jahre 2001 rund 400 Milliarden US-$ alleine für Rüstung (den US-Bürgern wird dies als „Verteidigungsausgaben“ verkauft) ausgeben und damit zum einen achtmal so viel wie für den Bereich Bildung verpulvern und dies andererseits 42 % der Verteidigungsausgaben aller Nationen entspricht, so rührt dies die Bürger der USA vor allem deshalb nicht, weil sie keine Vergleichszahlen kennen oder diese Ausgaben nicht als Ausdruck einer größenwahnsinnigen Regierung, sondern eben als notwendige Verteidigungskosten ansehen. Daß im Schatten der Geschehnisse vom 11. September diese Ausgaben für Waffen und sonstige Rüstungsgüter binnen 12 Minuten im Senat um weitere 48 Milliarden US-$ erhöht wurden - was mehr als dem gesamten Verteidigungshaushalt Japans in 2002 entspricht! - weiß ebenfalls kaum ein Amerikaner, denn statt selbstkritisch zu hinterfragen, warum sich zunehmend ein weltweites Auflehnen gegen die Dominanz der USA bahnbricht, leben die amerikanischen Bürger – durch ihre Medien entsprechend gedopt – in der festen Überzeugung, daß die USA auf der „richtigen Seite“ stehen, und ihre Sicht von Gerechtigkeit und friedensstiftender Macht ausschließlich dem Wohle der gesamten zivilisierten Welt dient.
Daß die Amerikaner mit ihrer expansionistischen Brutalität, einer schier unstillbaren Gier nach Bodenschätzen und der Durchsetzung egoistischer Machtpolitik für Kriege und Massaker in fast 100 Ländern der Welt verantwortlich sind (übelstes Beispiel: die Carlyle-Anglo-American-Gruppe, deren Chef-„Berater“ George Bush sen.(!) ist – www.anthropos-ev.de/reise.htm), verschließt sich dem in seiner Community gesittet seinem Tagwerk nachgehenden, braven US-Citizen völlig.
Eingekeilt im intrinsischen, bedenkenlos korrupten (Des-)Informations- und Handlungsgeflecht zwischen militärischer Weltdominanz - nicht einmal im militärverliebten England wird Mitgliedern der vier Streitkräften ein derart hohes Ansehen gezollt - und völlig einseitiger Medieninfiltration; mit enormem Appetit gesegnet - 60 % aller Amerikaner gelten als übergewichtig, fast 25 % sogar als (extrem) fett -; in einem ungeheuren Technikwahn gefangen, und all dies eingebettet in Superlative jeder Art (die Zusätze „world`s best“ „America`s finest“, „the greatest ... world-wide“ sieht und hört jeder US-Bürger pro Tag dutzende Male) lebt der Amerikaner in einem Schaukelstuhl der Extreme; nirgendwo weltweit zählt Geld so viel wie in den USA. Andererseits ist die private US-amerikanische Bereitschaft, humanitäre Hilfe zu leisten, unglaublich hoch; nirgendwo zählt Körperlichkeit derart viel wie in den USA - was nachgerade der Beauty- und pharmazeutischen Industrie wunderbar gelegen kommt und zu für den Rest der Welt abstrusen Schadensersatzklagen führt. Andererseits verfügen 273 Millionen Amerikaner über immerhin 350 Millionen Schußwaffen – auf die weltweite Verbrechens- und Tötungsrate wurde bereits hingewiesen.
Nirgendwo nimmt Sex und körperliche Attraktivität einen so hohen Stellenwert ein wie in den USA, ich kenne allerdings auch kein Land, in dem sexuelle Verklemmtheit, Prüderie und Verschämtheit so ausgeprägt sind. [9] Heroischen Helden, halsbrecherischer Sportlichkeit, geradezu aberwitzigen Verfolgungs- und Kampfszenen in der amerikanischen Filmindustrie steht eine geradezu paranoide Verletzungsangst der Amerikaner, denen körperliche Unversehrtheit über alles geht, gegenüber. Nirgendwo wird gesundes Leben derart zentralisiert und hochgelobt. Jedes Nahrungsmittel muß „low-fat“ bzw. „light“ sein, andererseits gibt es nirgendwo so viele Opfer von fastfood-Ketten wie in den USA. Alleine 80 % aller an Elefantiasis leidenden Menschen weltweit leben in Kalifornien, Texas und Florida.
Während man mit 16 in die Armee eintreten, seinen Führerschein machen (in Florida sogar mit 14) und ab 14/15 Jahren auch den Flugschein erwerben kann, ist in der Mehrzahl der 50 Bundesstaaten der Genuß eines Glases Bier erst ab 21 Jahren erlaubt. Glücksspiel ist in 45 Staaten grundsätzlich verboten, aber alleine in Las Vegas stehen mehr als 600.000 slotmachines („einarmige Banditen“ , auf die sich westliche US-Bürger eben in ihren Ferien stürzen.
, auf die sich westliche US-Bürger eben in ihren Ferien stürzen.
Die amerikanische Verfassung, aber auch das gesamte amerikanische Leben sind zu großen Teilen religiös bestimmt – damit kann man ja auch so wunderbar alles erklären und entschuldigen. Mehr als 130.000 Kirchen und Sekten [10] laden in den USA zu einem gottgefälligen Leben, regelmäßiger community-work, Treffen, Tanz und Zusammenkünften ein. Kein Wunder: Die einfachste und nachhaltigste Art, in den USA Steuern zu sparen, führt über die Gründung einer eigenen Kirche, auch wenn diese vielleicht nur ein einziges Mitglied hat - den Steuersparer selbst.
Das System zerbricht.
Die unilaterale Weltsicht des durchschnittlichen US-Amerikaners ist das gezielte Ergebnis einer völlig einseitigen Ausrichtung des Erziehungs-, Bildungs- und Informationssystems durch die Medien in den USA. So direkt der US-Bürger von Kindesbeinen dazu angehalten wird, innerhalb seiner Community mitzuwirken und teilzunehmen, stolz auf sein(e) Schule/College/Universität zu sein, wahlweise einem Sportteam (oder den Fähnchen und flauschige Puschen wirbelnden Cheerleaders) anzugehören, später in seiner Kirchengemeinde karitativ zu wirken und regelmäßig bei potluck-parties und Veranstaltungen im nächstgelegenen Park nachbarschaftliche Bande zu festigen, so wenig wird ein internationales und geschichtliches Weltbild vermittelt und gefördert. Höchst mobil und flexibel lernt der US-Amerikaner, zum „Schmied“ seines eigenen Glücks zu werden – aber eben immer nur unter dem Gesichtspunkt des seinem Land und seiner Flagge verpflichteten Staatsbürgers. Zu dieser manisch-introvertierten und egozentrischen Sicht tragen nachgerade die Medien bei. Hierbei wird dem braven US-Bürger regelmäßig eine – aus Sicht der USA – heile Welt vorgegaukelt, in der Übles und Schlimmes nur dann und insoweit möglich ist, als eben amerikanische Tugenden nicht sauber gelehrt oder schändlich verraten und gebrochen werden. Der allseits vermittelte Traum vom „American hero“ [11] ) wird US-Amerikanern quasi mit der Muttermilch verabreicht. Wenn sich in Hollywood-Streifen regelmäßig amerikanisches Heldentum, überbordende Tapferkeit und technische Überlegenheit austoben, entspricht dies einer Hirnwäsche, der sich die Jugend nicht entziehen kann und die ältere Generation nicht mehr entziehen zu müssen glaubt. Die Mär von der US-amerikanischen Überlegenheit, die Vermittlung amerikanischer Werte und einer alles in den Schatten stellenden Selbstgerechtigkeit führt zu einer Vernaivisierung der Menschen, die dann im späteren Leben unhinterfragt gelebt, mit arroganter Überzeugung vertreten und dann an die nächste Generation weitergereicht wird.
Dazu dienen nicht zuletzt bis ins Absurde übersteigerte Überlieferungen aus der Gründerzeit der USA und der Besiedelung des nordamerikanischen Kontinents, die den heutigen US-Größenwahn laufend nähren. Daß es sich bei dieser Besiedelung vornehmlich um Flüchtlinge aus Europa und China sowie anderen fernöstlichen Ländern (später auch zwangsimportierte Schwarzafrikaner und Sklaven aus der Karibik) handelt, lernen US-Bürger im Pflichtfach „american history“ nicht. Auch die Besiedelung wird vornehmlich unter den Aspekten des Mutes und Forscherdrangs der „settlers“ gesehen, die ihr Leben riskierten, im Vertrauen auf Gott als Eroberer amerikanischer Erde auftraten, es mit primitiven Atheisten hinterhältigster Art (den Indianern) aufnahmen und selbst schlimmste Entbehrungen nicht scheuten. Schon erstaunter sind US-Bürger, wenn sie erfahren, daß es sich bei diesen Auswanderern beileibe nicht nur um religiös Verfolgte, sondern oftmals um Verbrecher, Fahnenflüchtige und verurteilte Kriminelle handelte, die sich dadurch vor dem Galgen retteten, daß sie im Auftrag der britischen Krone, holländischer Fürsten oder französischer Könige gen Westen aufbrachen oder der Blutrache verfeindeter japanischer und chinesischer Familien dadurch entgingen, daß sie sich für den Bau der Eisenbahn, zu Söldnerdiensten oder als Holzfäller, Goldschürfer, Köche, Fährtensucher oder Felljäger in den neuentdeckten Kontinent verpflichteten.
Aber die Zeiten, in denen eine gesamte Nation von demnächst 300 Millionen Menschen in autistischer Dumpfheit und systematisch tumb gehalten werden können, sind endgültig vorbei. Das Bersten der ökonomischen Seifenblase, die deutlich schneller steigende Population der unterprivilegierten Schichten gegenüber den wirtschaftlich gut situierten Klassen, vor allem jedoch das Grenzen binnen Sekundenschnelle überspringende Internet sind gerade dabei, den amerikanischen Traum universeller Überlegenheit zu zerstören, auch wenn dies Geheimdienste und ein neues Ministerium („Homeland Security“, von Bush-junior gerade mit 170.000 Beamten gegründet) verzweifelt zu unterbinden versuchen. Das absurd simpel gestrickte Weltbild der US-Amerikaner hat spätestens mit den Geschehnissen vom 11. September 2001 seinen traurigen Höhepunkt überschritten. Mehr und mehr beginnen auch Amerikaner in Zweifel zu ziehen, was ihnen tagtäglich zwischen Werbung und Comics, Sportsendungen und regionalen Highlights in Bild- und Tonmedien vor die Nase gehalten wird. Zu viele intelligente und neugierige Menschen in den USA stellen Fragen und runzeln die Stirn. Die allfälligen Diskrepanzen der Einkommen und nur scheinbar allen BürgerInnen gleichermaßen offenstehender Lebenschancen erregen auch bei Kindern und Jugendlichen zunehmend Argwohn, Mißtrauen und wachsende Aggressionen. Mögen Hollywood und die Medientycoons, Pharmaindustrie und Waffenlobby, politische und religiöse Lichtgestalten, als Gallionsfiguren eingesetzte Marionetten in Politik und Wirtschaft, Sport und Entertainment auch noch so uneinsichtig ihre volksverdummenden Reden schwingen – die ohnehin nur mühsam im Zaum gehaltende US-amerikanische Kultur-, Wirtschafts- und Staatsgemeinschaft ist auf dem besten Wege, aus den Fugen zu geraten und auseinanderzubrechen.
Wie schnell dies gehen kann, beweisen Hunderte von ähnlich gelagerten Fällen in der Geschichte. Man muß nicht den Zusammenbruch der früheren Weltreiche der Hethiter und Assyrer, Ägypter und Babylonier, der Griechen und Römer, Mongolen und Türken bemühen; viel näher liegen uns der Zusammenbruch der Weltreiche Frankreichs und Spaniens, Portugal und Hollands, Österreichs und Preußens, des Britischen Empire oder – noch zeitnäher – des Kommunismus/Sozialismus` und der Wahnsinnsreiche Stalins und Hitlers.
Die US-amerikanischen Hegemonialansprüche sind weder militärisch zu verwirklichen, noch finanziell zu verkraften. Das nach dem originären Sinn des Wortes durchaus als faschistisch zu bezeichnende egozentrische US-System hat sich intern, astronomisch gesprochen, zu einem höchst gefährlichen, instabilem „schwarzen Loch“ verdichtet und außenpolitisch längst völlig übernommen. Binnen weniger Jahre – ich wage eine Prognose von fünf, maximal zehn Jahren – wird sich dieses System als menschenverachtender Größenwahn, chauvinistische Schimäre und bigotte, echte Liberalität zynisch und egoman mit Füßen tretende Farce entlarven. Die Frage ist nur, wieviel Leid bis dahin noch dank US-amerikanischer Uneinsichtigkeit, der Welt- und Machtgier der dahinterstehenden Drahtzieher, hypokritischer Weltverbesserungsmanie und bornierter Starrköpfigkeit der übrigen Welt abverlangt wird und unter welchen Opfern für die US-amerikanische Bevölkerung und Millionen von Menschen anderer Nationalität eine verschwindend geringe Minderheit ihren Reichtum mehren und ihre Landsleute ebenso wie andere Nationen brutal ausbeuten, seelisch und geistig mißbrauchen und töten wird. Die sich unzweideutig entwickelnden Krisenherde im Nahen Osten – hier kommt es unweigerlich zum Krieg, der wiederum zur Spaltung der arabischen von der westlich-orientierten Welt führen wird - und zwischen Indien und Pakistan, in Lateinamerika und vielen Staaten Afrikas, deren Bevölkerungen aufzuwachen beginnen und nicht mehr länger bereit sein werden, ihre Bodenschätze von amerikanischen Konzernen ausbeuten zu lassen, werden den Niedergang der Supermacht USA schon sehr bald Realität werden lassen. Sollte es den USA nicht gelingen, sich vom Diktat der enorm einflussreichen inneramerikanischen khasarisch-jüdischen Organisationen zu befreien und Sharon in den Arm zu fallen, droht hier buchstäblich der Ausbruch eines Dritten Weltkrieges.
Dabei werden dann gleichzeitig auch viele Regime, die bislang noch unter dem Schild amerikanischen Einflusses ihre Landsleute ausbeuten und tyrannisieren können (z.B. Saudi Arabien), explodieren, während andere, bislang unter US-amerikanischer Knute noch (halbwegs) still verharrende Nationen und Gesinnungsgruppen dann massiv losschlagen werden, wenn sie den Weltriesen USA als angeschlagen und verwundbar erkennen, und zum Angriff übergehen.
Wenn bislang nur sehr vereinzelt mit Biowaffen (Anthrax, infizierten Viren und manipulierten Genen) Terroranschläge verübt worden sind - bezeichnenderweise vor allem innerhalb der USA und von Amerikanern (!) -, so ausschließlich deshalb, weil die dahinterstehenden Fundamentalisten zu viele ihrer eigenen Gesinnungsgenossen treffen könnten. Die Verfeinerung derart letaler, fundamentalistisch „gerechtfertigter“ Methoden nimmt jedoch täglich zu. Die Gefahr wächst exponentiell und unaufhaltsam.
Wer sich heute noch im Schatten Bush`schen Größenwahns meint, profilieren zu können, sollte die Zeichen der Zeit, längst in Riesenlettern an der Wand prangend, nicht leichtfertig übersehen. Das Ende des US-amerikanischen Weltterrorismus` wird auch für den Rest der Welt mit großen Problemen, sozial- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen einhergehen. Da werden den USA auch noch so monströse, ultramoderne Abwehrsysteme (Haarp, Master-Shield, SMI, etc.) und noch so verfeinerte Abhörmethoden und gänzlich verrückte Militärs kein bißchen helfen.
Mutmaßlich wird der Zusammenbruch des US-amerikanischen Systems die weltweit katastrophalste Apokalypse der Menschheitsgeschichte mit sich bringen, in deren Abfolge Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöte, kriegsbedingte Verödung riesiger Landstriche, chaotische Bürgerkriege, millionenfache Flüchtlingsheere, die Ausrottung ganzer Volksgruppen, aber auch ein gigantischer Flurschaden und die Vernichtung großer Teile der Fauna und Flora dieses Planeten stehen könnten.
Auf Einsicht in den Gehirnen US-amerikanischer Regierungsvertreter und hoher Militärs oder die Vernunft und Menschlichkeit der dahinterstehenden Finanzologarchien darf kein Mensch hoffen. Sie werden den Krug bis zur bitteren Neige leeren – „no matter what!“
Doch diese Phase gilt es durchzustehen – so bitter und schmerzhaft dies für mutmaßlich jedes Land dieser Erde auch werden wird.
Hoffnung gebiert allenfalls die Tatsache, daß der weltweite Widerstand gegen die amerikanische Hybris stündlich wächst. Erfreulicherweise sind immer mehr Menschen – vor allem die Jugend – bereit, den Zeichen an der Wand Aufmerksamkeit zu schenken, den Kopf nicht wegzudrehen und die Augen nicht zu verschließen. Den gefilterten Nachrichten in Presse, Rundfunk und Fernsehen wird zunehmend mißtraut. Mehr und mehr Menschen suchen nach weiteren Informationsquellen, sind bereit zu diskutieren, nachzudenken und zu stutzen.
Der Anfang vom Ende der Vereinigten Staaten von Amerika hat längst begonnen.
„Es kommt der Moment, so selten dies auch in der Geschichte passiert, an dem wir aus dem Alten ins Neue steigen, an dem ein Zeitalter endet und die Seele einer Nation, die zuvor lange unterdrückt wurde, ihren Ausdruck findet.“
Jawarhalal Nehru, 1947
bei der Gründung der islamischen Republik Pakistan, einen Tag vor der Befreiung
Indiens aus britischer Herrschaft, am 15. August 1947
USA – Der Anfang vom Ende
Wer es wagt, im Jahr 2002 das Ende der (einzig verbliebenen) Weltmacht vorherzusagen, muß sich wohl gefallen lassen, für verrückt gehalten zu werden. Einverstanden.
Aber ähnlich muß es auch „Mahnern in der Wüste“ gegangen sein, die im Jahre 60 unserer Zeitrechnung das Ende Roms oder 1914 das Ende des British Empire vorhergesagt hätten.
Nun, im Jahr 1980 gab der DBSFS e.V. die Schrift „Visio 2020“ heraus, in der u.a. auch das Ende der Teilung Deutschlands und der Zusammenbruch des Sozialismus` vorhergesagt wurden. Beides geschah schneller als dies die überwiegende Mehrheit der Politiker und Medien zu träumen gewagt hätten.
Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bedecken eine Fläche von knapp 9,8 Millionen km² und zählen, illegale Einwanderer außer Acht gelassen, 270,5 Millionen Einwohner. Dies entspricht weniger als 30 Einwohnern pro km², was im Vergleich zu sämtlichen anderen Industrienationen jede Menge an Raum bietet (zum Vergleich: Deutschland hat etwa 230 Einwohner pro km², Belgien gar 334). Mit einem Bruttosozialprodukt von knapp 29.000 US-$ pro Kopf liegen die USA hinter Luxemburg, der Schweiz, Dänemark, Japan, Norwegen und Singapur auf Platz 7. Was die Kindersterblichkeit (unter 0,7 %), Säuglingssterblichkeit (unter 0,6 %) und die Analphabetenrate (unter 5 %) angeht, nehmen die USA jeweils einen der besten Plätze weltweit ein. Der Dienstleistungsstand der Gesellschaft (ca. 74 %), eine Arbeitslosenquote von unter 5 % und eine Inflationsrate von knapp 2,4 % lassen wenige Probleme vermuten. Weltweit gelten die USA neben der Schweiz als Musterknaben der Demokratie.
Doch schon auf den zweiten Blick enthüllen sich Schwachstellen eines Systems, die Bedenken aufkommen lassen:
- Die USA leben (und dies seit Jahren) über ihre Verhältnisse. So zeigt sich die Export-/Importquote der USA seit rund 15 Jahren bedenklich negativ – relativ konstant bei etwa 70 %; d.h. einer Milliarde an importierten Gütern stehen jeweils nur 700 Millionen an Export gegenüber. Wohl nicht zuletzt deshalb sind veritable Daten über die konkrete Auslandsverschuldung der USA ein wohlgehütetes Staatsgeheimnis. Diesem Manko begegnen die USA regelmäßig mit dem Hinweis darauf, daß der weltweite Devisenimport durchschnittlich fast 60 % (1970 bis 2000) über dem Abfluß US-inländischer Devisen liegt. Die USA gelten eben, so der unverhohlen stolze Tenor, als sicherer Hafen für ausländische Devisen. Daß diese „Brücke“ aber nicht unendlich haltbar ist, wird nunmehr immer deutlicher; allein im ersten Halbjahr 2002 flossen – erstmals seit hierüber Buch geführt wird – rund 40 % mehr Devisen aus den USA als umgekehrt in die Vereinigten Staaten. Speziell nach dem inzwischen weltweit registrierten Platzen der amerikanischen Börsenblase steigt diese Tendenz sogar noch (hierzu später mehr);
- Der durchschnittliche US-Amerikaner ist kein Sparer, sondern hochverschuldet; während der durchschnittliche Bundesbürger rund € 6.000 an Liquidität hält (ängstlicherweise vornehmlich auf Girokonten oder als Monatsgeld) und über ein Ø-Vermögen (ohne Immobilien) von etwa
€ 45.000 verfügt, eine Sparquote von 8,2 % aufweist und sich einer staatlichen Altersversorgung von durchschnittlich 53 % seines heutigen Bruttolohns erfreuen kann, hat der durchschnittliche US-Amerikaner Schulden von mehr als 12.000 US-$ [1] ), seine noch zum Jahresanfang 2001 in Börsenwerten investierten 40.000 US-$ sind heute nur noch knapp 15.000 US-$ wert, und die staatlicherseits garantierten Renten liegen bei weniger als 15 % pro Kopf der Bevölkerung. Auch bezüglich der betrieblichen Altersversorgung liegen die US-Amerikaner im Vergleich mit europäischen Ländern hoffnungslos abgeschlagen; etwa 40 % aller Arbeitnehmer haben überhaupt keine betriebliche Altersversorgung, und wie schnell selbst eine vertraglich vereinbarte Betriebsrente (etwa 35 % bestehen in Aktien und/oder aktienähnlichen Rechten und Firmenvermögen) an Wert verlieren oder völlig wertlos werden können, zeigen die letzten Monate nur allzu deutlich;
- Die US-Wirtschaft hinkt. Abgesehen von einem (immer noch) boomenden Tourismus, der etwa 7 % des Bruttoinlandproduktes ausmacht, ist die amerikanische Wirtschaft stark technologielastig. Dies betrifft vor allem die Fabrikation und den Export von Maschinen und Ausrüstungsgütern (knapp 50 %), wohinter sich aber die weltweit größte Kriegswaffen- und dieser verwandte Logistik- und Technikproduktion verbirgt. Nicht zuletzt deshalb sind die USA auf die Einfuhr von Konsumgütern und Nahrungsmitteln im Wert von etwa 40 Milliarden US-$ angewiesen – Waren, die hauptsächlich aus Kanada und Mexiko (NAFTA) sowie Lateinamerika importiert werden.
Der US-amerikanische Autismus
Die oben genannten Zahlen müssen, für sich genommen, noch nicht unbedingt Besorgnis erregen. Immerhin zahlt man in 48 Ländern/Staaten sowie 8 Pazifik- und Karibikinseln, die als „unincorporated territories“ der USA gelten, in US-Dollars oder fest an den US-Dollar gebundenen sonstigen Dollars. Dazu kommt eine einheitliche, dem Englischen stark verwandte Sprache und ein buntes Gemisch von Rassen und Nationalitäten, die eigentlich beste Voraussetzungen für ungehindertes Wachstum, interkulturelle Lebensart, freie Entwicklungschancen für jedermann und einen größtmöglichen Liberalismus böten.
Doch dem ist nicht so. Wer die Vereinigten Staaten – nicht nur die vielbesuchten Metropolen von New York bis Los Angeles – kennt, weiß um das egozentrische, erschreckend simplifizierte Weltbild der USA; in keinem Industrieland ist die Spanne zwischen arm und reich auch nur annähernd so gewaltig wie in den USA; kein Industrieland kann sich mit der Kriminalitäts-, vor allem der Mordrate in den USA messen; Slums, wie es sie in jeder der zehn Millionenstädte und weiteren 20 Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern gibt, sucht man in sämtlichen anderen Industrienationen vergeblich; in US-Gefängnissen sitzen mehr MitbürgerInnen ein als in sämtlichen anderen Industrienationen zusammen, und nach offiziellen Zahlen von Amnesty International führen die USA auch weltweit die „Hitliste“ von Hinrichtungen an – ausgenommen China, was gerade auf dem Sprung vom Schwellen- zum Industrieland ist; wiewohl den etwa 195 Millionen Weißen (74 % der Bevölkerung) nur 35 Millionen Schwarze (13 %) und 27 Millionen Hispanics (10 %) gegenüberstehen, liegt der Anteil der Nicht-Weißen wegen krimineller Delikte einsitzenden US-BügerInnen bei über 35 %. Gerade diese „coloured people“ bilden aber den Kern der unterprivilegierten Masse in sämtlichen Großstädten. Diese Unterprivilegiertheit hat eine lange Geschichte und straft das gern gezeichnete Bild des toleranten, weltoffenen Amerika Lügen. Zwar ehrt man noch heute die Heroen der amerikanischen Verfassung, geht man diesen Sagen jedoch etwas mehr auf den Grund, so fördert man Erstaunliches zu Tage. Die USA rühmen sich, die beste Verfassung der Welt zu haben und verweisen auf Thomas Jefferson`s Worte im Jahre 1776 zur Unabhängigkeitserklärung: „All men are created equal.“ Die Realität sieht jedoch etwas anders aus: Eben jener Jefferson, dritter Präsident der USA, war Großgrundbesitzer in Virginia und ließ auch nach der Unabhängigkeitserklärung völlig rechtlose „Nigger“ auf seinen Plantagen schuften. Sie waren eben nicht gleich, vielmehr durften sie ausgepeitscht und verkauft werden. Nicht anders verhielt sich der glorifizierte George Washington, erster Präsident der USA, dem wir auch den Begriff vom „Recht jeden Individuums auf Glück“ („pursuit of happiness“
 verdanken; trotz dieser Glück verheißenden Garantien der Verfassung hielt die Brutalität der Sklaverei in den Südstaaten noch fast ein Jahrhundert an, und hinzu kam der fortgesetzte Völkermord an den Ureinwohnern. Weder bei den Indianern noch bei den Sklaven aus afrikanischen und karibischen Ländern haben sich die US-Amerikaner bis heute entschuldigt. Vielmehr wird, was viele US-Amerikaner weißer Hautfarbe bis heute nicht wissen, an in Ghettos gehaltene Indianer eine Art staatliche Rente als stillschweigende Entschuldigung geleistet. Diese Rente wird für die nächste Generation jeweils halbiert weitergezahlt.
verdanken; trotz dieser Glück verheißenden Garantien der Verfassung hielt die Brutalität der Sklaverei in den Südstaaten noch fast ein Jahrhundert an, und hinzu kam der fortgesetzte Völkermord an den Ureinwohnern. Weder bei den Indianern noch bei den Sklaven aus afrikanischen und karibischen Ländern haben sich die US-Amerikaner bis heute entschuldigt. Vielmehr wird, was viele US-Amerikaner weißer Hautfarbe bis heute nicht wissen, an in Ghettos gehaltene Indianer eine Art staatliche Rente als stillschweigende Entschuldigung geleistet. Diese Rente wird für die nächste Generation jeweils halbiert weitergezahlt.Millionen von Arbeitern, vor allem nicht-weißer Hautfarbe, wird nach wie vor der gesetzliche Mindestlohn vorenthalten, für den im übrigen kaum ein Westeuropäer arbeiten würde. Hierin ist auch der Grund zu sehen, warum der durchschnittliche Amerikaner 2,25 Jobs hält – mehr als doppelt soviel wie der durchschnittliche Deutsche. Das US-amerikanische Glücks- und Demokratieversprechen steht der anhaltenden Mißachtung verfassungsmäßiger Rechte in bisweilen grotesker Weise entgegen. So werden – besonders aktuell mit den Geschehnissen vom 11.09.2001 begründet – unliebsame Ausländer nach der Verhaftung in andere Länder transportiert, um die vermeintlichen Feinde der USA dort verhören zu lassen (in den USA wird doch nicht gefoltert!), nach deren „Geständnissen“ werden sie dann in die USA zurück-überführt und eben dort auch verurteilt. Daneben wird unter juristischen Militärstatus gestellt, wer als Saboteur, Deserteur oder in sonstiger Art gegen die innere Sicherheit der USA agiert – mit der Folge, daß ihm juristische Elementarrechte (Anhörungsrecht, Recht auf einen Anwalt seiner Wahl, Einsicht in die Anklageschrift etc.) verweigert werden.
Zur „Geheimsache“ wird flugs erklärt, was keine mediale Erwähnung erfahren soll. Hierbei bedienen sich die USA eines weltweiten „Informations“-(vulgo: Spionage-)Netzes, welches US-intern von elf Geheimdiensten emsig verdichtet wird – unter der „Leitung“ [2] der Central Intelligence Agency (CIA). Für die polizeiliche Arbeit zeichnet national das FBI verantwortlich, und US-extern obliegt die „Oberaufsicht“ der National Security Agency (NSA), dem wohl mächtigsten US-Geheimdienst, der so geheim ist, daß die Bevölkerung der USA erst 1993 überhaupt davon erfuhr; da war der Verein aber bereits fast 35 Jahre alt!
Diese Geheimdienste überwachen nun – US-intern wie -extern den gesamten Informationentransfer (ECHELON, siehe zeitreport 127, 2001), Wissenschaft und Forschung, Bibliotheken und Verlage, die Reisetätigkeiten der höchst mobilen US-Amerikaner [3] , Steuervergehen [4] , die Ein- und Ausfuhr von (Militär-)technischen Waren, die Kontrolle der US-amerikanischen Embargos gegenüber „feindlichen“ oder widerspenstigen Staaten (die man problemlos dann eben über „befreundete" Staaten abwickelt), die Aufklärung und Überwachung nicht-systemkonform denkender US-Bürger, nicht-christlicher oder -jüdischer Religionsvereinigungen und Sekten u.v.m.. Speziell der rasant wachsende Internet-Verkehr zieht die Neugier der Schnüffelgarde magisch an – offiziell natürlich nur, um die USA gegen Staatsfeinde, Pädophile und die Verbreitung pornographischer Inhalte zu verteidigen. Daneben loten diese Geheimdienste aber auch die Bereitschaft ausländischer Politiker, Diplomaten und Wirtschaftsführer aus, sich gegen Bares in den Dienst des amerikanischen Freiheitsgedankens zu stellen. Die Chronik der US-Einflußnahme auf Diktatoren und System-Provokateure nicht freundlich gesonnener Staaten füllt Bände. Dabei schrecken die Gralshüter der "Wahrheit" und eines "gottesfürchtigen Lebenswandels" weder vor der Zusammenarbeit mit Kriminellen aller Couleur, Waffen- und Drogenhändlern, noch vor der Kombattanz mit jegliche Menschenrechte mit Füßen tretenden Staatschefs oder Terrororganisationen zurück. Es muß nur heimlich geschehen und offiziell den Zielen der USA, selbst ernannten Garanten weltweiten Friedens und US-Interessen dienender Überzeugungstäter entsprechen. Geradezu empört reagieren die USA, wenn in internationale Abkommen (z.B. zur Sicherung der Rechte Gefangener, die Anklage von Kriegsverbrechern, die Anti-Folter-Konvention, die Überprüfung der Produktion von biologischen und chemischen Kampfstoffen u.ä.) auch die USA mit einbezogen werden. Was erdreistet sich irgendein anderes Land, den USA in die Karten schauen zu wollen, brave und ausschließlich im Dienste ihres Landes, gottesfürchtig und gesetzestreu agierende US-Bürger überprüfen zu wollen! Einzig den USA ist vorbehalten, darüber zu richten, welches Land falsch regiert wird, wer zur Armada des Bösen zu zählen, zu bestrafen, zu bekämpfen und zu bekehren ist.
Erinnert werden darf in diesem Zusammenhang an die Worte Theodore Roosevelts, der dafür die bedenkliche Formulierung prägte: „Sprich freundlich, aber vergiß den Knüppel nicht!“ Dies galt beileibe nicht nur für den US-amerikanischen „Hinterhof“, Lateinamerika, in dem die USA bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts (natürlich nur zum Schutze der „American Fruit Company“
 mit harter Hand, militärischer Omnipräsenz und mittels ihrer Geheimdienste nach Belieben und völlig unbedenklich intervenierten und ihnen genehme Diktatoren einsetzten und finanzierten – dank ihrer technischen Überlegenheit und mit der Entschuldigung, dort ihre Handelsstützpunkte verteidigen und sichern zu müssen. Auch der spätere Präsident Franklin D. Roosevelt verewigte sich mit einer reichlich menschenverachtenden Bemerkung in der Ana der Weltgeschichte: Im Hinblick auf die US-amerikanische Unterstützung des nicaraguanischen Diktators Somoza meinte er spitzbübig: „Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“
mit harter Hand, militärischer Omnipräsenz und mittels ihrer Geheimdienste nach Belieben und völlig unbedenklich intervenierten und ihnen genehme Diktatoren einsetzten und finanzierten – dank ihrer technischen Überlegenheit und mit der Entschuldigung, dort ihre Handelsstützpunkte verteidigen und sichern zu müssen. Auch der spätere Präsident Franklin D. Roosevelt verewigte sich mit einer reichlich menschenverachtenden Bemerkung in der Ana der Weltgeschichte: Im Hinblick auf die US-amerikanische Unterstützung des nicaraguanischen Diktators Somoza meinte er spitzbübig: „Er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn.“ Ohne (unangebrachte) europäische Arroganz darf konstatiert werden, daß die US-Amerikaner – unabhängig von der Hautfarbe einerseits und dem Stand in der nach außen scheinbar offenen, in Wahrheit jedoch höchst hierarchisch gegliederten Gesellschaft andererseits – „ihr“ Amerika verblüffend naiv im Zentrum des Weltgeschehens sehen. Kaum ein US-Bürger ist auch nur grob darüber informiert, was im Rest der Welt geschieht, welche Probleme die übrigen 5,9 Milliarden Menschen gewärtigen und was nachgerade der US-amerikanische Imperialismus damit zu tun hat. Solange man den US-Amerikanern ihre Helden beläßt, ihre Religionsfreiheit und das Recht auf Waffenbesitz nicht einschränkt, so lange wähnen sie sich in „God`s own country“. Notfalls strickt sich der „gute“ und gottesfürchtige US-Amerikaner seine Legenden selbst und überhöht das Bild der „Vereinigten Staaten von Amerika“ bis zur Abstrusität. Dazu bedient er sich beliebiger Analogien aus den Epen archaischer Zeit. So kann man in Washington D.C. im Fresko der Kuppel des Capitols die „Himmelfahrt“ George Washingtons bestaunen, der von zarten Jungfrauen in die himmlische Unsterblichkeit geleitet wird – ohne auch nur einen seiner mehr als 300 schwarzen Sklaven. Jede militärische Aktion, Waffen(systeme) und der Glorie der USA huldigende Paraden der weltweit agierenden fundamentalistischen Staatsmacht USA wird von „christlichen“ Feldpredigern gesegnet, und in keinem anderen Land der zivilisierten Welt liegt brutaler Staatsterrorismus – nach dem alttestamentarischen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“-Prinzip - dem ansonsten faszinierenden humanitären Engagement des durchschnittlichen Amerikaners so nahe, wie eben in den USA. Dem liegt ein nach europäischem Verständnis grotesker Gegensatz zugrunde: Die Bürger der USA lehnen staatliche Einmischung in ihre privaten Bereiche kategorisch ab, und solange sich das staatliche System daran hält, duldet der Bürger nahezu alles, was sich die politische Führungskaste international an Rechten anmaßt oder national an Spielchen und Schweinereien treibt. Der Amerikaner legt als Kind vor dem Unterrichtsbeginn, später, als älteres “Kind“ vor Sport- und Kinoveranstaltungen, Oskarverleihungen und anderen Spektakeln brav die rechte Hand ans Herz und summt/singt die US-Hymne mit. Kaum ein US-Amerikaner ist darüber informiert, welche Diktatoren in Lateinamerika, Asien und vielen Ländern Afrikas mit Abermilliarden amerikanischer Steuergelder, amerikanischen Waffen und Soldaten unterstützt, finanziert und im Amt gehalten werden. Daß die USA heute in über 80 Staaten der Erde militärische Stützpunkte, als Handelszentren getarnte und unter Observation der Geheimdienste stehende Spionagebasen unterhalten, ihnen genehme Regime entweder stützen oder stürzen und sich dabei weder um internationale Abkommen, noch die ehedem von ihnen mitinitiierten Menschenrechte auch nur im mindesten scheren, weiß kaum ein US-Amerikaner. Weder liest oder hört er davon in den US-amerikanischen Medien, noch wird darüber in Schulen oder im Elternhaus diskutiert. Erst wenn ein Krieg zu viele US-amerikanische Leben kostet – Korea, Vietnam, Somalia -, regt sich binnenamerikanischer Widerstand.
„An der Nahtstelle von Wirtschaft und Politik ist es völlig normal, sich auf Kosten anderer auszubreiten – mit immer neuen Intrigen und Spielchen!“
Milton Friedman
Die verhaßte Staatsmacht
Nichts haßt der US-Amerikaner traditionell mehr, als staatliche Eingriffe in sein Leben. Nirgendwo sonst in der Welt werden so viele Polizisten vom Motorrad geschossen, verachtet oder verprügelt wie in den USA. [5] Es spricht Bände, wenn in Hollywood-Streifen die Stimmung in Polizeistrukturen als geradezu zynisch und menschenverachtend dargestellt wird, Polizeifahrzeuge – generell anscheinend von Vollidioten gesteuert – massenweise zu Schrott gefahren und damit die Staatsmacht genüßlich verlächerlicht wird. Es sind immer die einsamen (guten) „Cops“, die sich - unter Umgehung des offiziellen polizeilichen Regelwerks - als Retter der Menschheit entpuppen.
Nirgendwo geht die Staatsmacht - FBI, Verkehrspolizei oder IRS-Beamte - so rücksichtslos und demütigend mit Verdächtigen um, wie dies nicht nur in billigen Hollywood-Orgien, sondern auch in der Realität geschieht. Die dem Bürger weniger nahe Beamtenschaft – Mitglieder der vier Streitkräfte des Militärs – genießen hingegen höchstes Ansehen; eine unehrenhafte Entlassung (dishonorable discharge) gleicht einem lebenslangen Platzverweis.
Der US-Bürger traut den Vertretern der Staatsgewalt „less than a dime“ [6] . Selbst durchaus positiv besetzte Pläne der Regierung – Beschränkung der Mieten, Einführung von Mindeststandards für ein Gesundheitssystem – finden in der Bevölkerung keinen Anklang; sie verzichten darauf und bestehen auf ihrer individuellen Wahlfreiheit. Diese Erfahrung mußte auch der frühere Präsident Bill Clinton machen.
Das in Europa gültige Bild von den USA als einheitlichem Staatskörper, der „wie ein Mann“ hinter dem Präsidenten steht, ist völlig falsch. Im Grunde genommen rührt den US-Normalbürger kaum, was der ohnehin von weniger als einem Viertel der Wahlberechtigten gewählte Präsident sagt oder tut. Das Gros der US-Amerikaner schert sich einen Teufel um die funktionale Staatsmacht. Er haßt staatliche Einmischung und sucht lieber das weltweit als Erfindung der USA gepriesene „persönliche Glück“. Er will „sein Ding“ tun, seine Familie in Ehre und Anstand, im Kreise seiner Familie und der Nachbarschaft selbst großziehen und mit der Staatsgewalt möglichst weder in Kontakt noch in Konflikt kommen, bzw. von dieser unbehelligt bleiben. Die europäische Auffassung, bei den USA handele es sich um „ein Volk, einen Staat und einen Führer“, ist eine von europäischer Tradition verbrämte Mär.
US-amerikanische Touristen sind regelmäßig völlig erstaunt, bei ihren Reisen nach Europa auf eine sehr kritische Haltung gegenüber den USA zu stoßen. Sie können auch nicht verstehen, daß wir Europäer ihre kindlich-naive Einstellung belächeln oder herabwürdigen. US-Amerikaner sind einfach von Kindesbeinen an daran gewöhnt, im angeblichen „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ zwischen Micky Mouse und McDonalds, dem glitzernden Heroismus made in Hollywood und in der Dominanz von vier Jahreszeiten (football, baseball, basketball und icehockey) zu leben. Die Tatsache, daß sich das amerikanische Englisch in rasantem Tempo zu einem nicht mehr national zuordenbarem „Esperanto“ entwickelt, in das sprachliche Einflüsse aus aller Herren Länder sowie sprachverkürzende Symbole (U2, 4 me 2, etc.) mehr und mehr zu einem linguistischen Kauderwelsch auf infantilstem Niveau verdichten, akzeptieren die Bürger der USA ohne Bedenken. Daß sich die USA internationalen Abkommen zum Schutz der Umwelt, der Beschränkung von Atom-, Chemie- und Biowaffen widersetzen, eigene Soldaten von der internationalen Ächtung von Kriegsverbrechen ausgeschlossen sehen wollen und auch künftig die Todesstrafe ebenso Bestand haben soll wie viele andere, allen internationalen Vereinbarungen Hohn sprechende Protektionismen im Wirtschafts- und Handelsrecht, interessiert den durchschnittlichen US-Bürger, so er überhaupt darüber Bescheid weiß, nicht im mindesten. „Whatever is good for America is also good for me“ [7] ist allseits akzeptiert und bleibt unwidersprochen.
Europäischer Kritizismus und der ganz gelegentlich in US-Medien aufscheinende Bürgerprotest in Europa ist den Amerikanern grundsätzlich fremd und verdächtig. Sie sehen die Europäer als Bremser glorioser weltweiter US-Politik. Amerikanische Medien haben hierfür den Begriff des europäischen „whimps“ („Weichei, Schlappschwanz“
 geprägt. Die auch in den USA forcierte Sprachformel „Globalisierung“ bedeutet für den mit allem außerhalb der USA ablaufenden Weltgeschehen wenig vertrauten US-Bürger eigentlich nur eine segensreiche Internationalisierung der amerikanischen Wertegemeinschaft. Am US-Wesen soll die Welt ....! Moment, hatten wir das nicht schon mal?
geprägt. Die auch in den USA forcierte Sprachformel „Globalisierung“ bedeutet für den mit allem außerhalb der USA ablaufenden Weltgeschehen wenig vertrauten US-Bürger eigentlich nur eine segensreiche Internationalisierung der amerikanischen Wertegemeinschaft. Am US-Wesen soll die Welt ....! Moment, hatten wir das nicht schon mal?Die USA – Erben des Britischen Empire
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielte das Königreich England in etwa die gleiche Rolle, die 300 Jahre später die USA einnehmen sollten. Nach den siegreichen Auseinandersetzungen mit Holländern, Spaniern und Franzosen sah sich England militärisch als stärkste Macht weltweit. Es war mit Handelsposten in Nord- und Südamerika, Indien (Gründung der „East India Company“ am 31.12.1600) und neun anderen asiatischen Ländern vertreten. Bezüglich Kultur und Technik stand England weit vor den kontinentalen Königreichen und Fürstentümern, die im Vorfeld des 30-jährigen Krieges mehr mit religiösen Auseinandersetzungen zwischen Rom-orientierten Katholiken und verschiedenen protestantischen Bewegungen (Hus, Zwingli, Calvin und Luther) beschäftigt waren; Italien, in dem immerhin die ersten Universitäten der Welt (neben Paris) als Erben der griechischen Akademien gegründet wurden, hatte seinen Platz als führende Handelsmacht Europas längst eingebüßt. Recht ähnlich den heutigen USA ging es damals England darum, sich weltweit die meistversprechenden Handelsplätze, die reichsten Bodenschätze und strategisch wichtige Standorte zu sichern. Aus Südamerika zogen sich die viktorianischen Heere schnell wieder zurück, um dafür im Gegenzug in Afrika und Asien freie Hand zu haben, insbesondere aber im Nahen Osten, wo sich bereits das Konfliktfeld zwischen Arabern (vor allem den palästinensischen) und Juden entwickelt hatte, die nach den damaligen Pogromen in Polen, der nördlichen Schwarzmeerküste, Rußland, Frankreich und den westrheinischen Gebieten einzuwandern begannen. Der größte Teil des Reichtums der britischen Krone stammt aus der Zeit von 1630 bis 1860. Australien diente als Abschiebestation für Häftlinge, und Indien, Teile Indonesiens und die ozeanischen Inseln als Lieferanten für Gewürze, Hölzer und Bodenschätze. Zudem stand die Hälfte des damals erforschten Afrika (vor allem dessen Süden und der gesamte Osten vom Suez-Kanal bis zum Sudan) unter britischer Herrschaft. Für viele eingefleischte und monarchietreue Engländer gab das Britische Empire Ende des 18. Jahrhunderts zu schnell, beinahe kampflos dem Unabhängigkeitsstreben der 13 Gründungsstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika nach, lediglich der größte Teil Kanadas hörte noch auf britisches Geheiß.
Erst die Konflikte zwischen Muslimen und Hindus in Indien, die im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung des indischen Subkontinents aufbrachen, die wachsenden Spannungen im teils französisch (Syrien, Libanon), teils englisch beherrschten Nahen Osten, die revoltierenden Stämme in Sri Lanka (damals Ceylon) und Südafrika sowie der aufbrechende Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken auf der irischen Insel ließen das britische Weltreich, in dem Ende des 19. Jahrhunderts „niemals die Sonne unterging“, sukzessive zusammenbrechen.
Ende des 19. Jahrhunderts mußten die Engländer den größten Teil ihrer chinesischen Besitzungen (mit Ausnahme Hongkongs) aufgeben. Der Burenkrieg (1900) war der Anfang vom Ende der britischen Herrschaft in Südafrika und Ägypten – vor allem die uneingeschränkte Passage durch den Suezkanal ging verloren - und zwischen 1917 und 1948 durfte sich England dann endgültig auch von Indien und Pakistan (15./16. August 1947) verabschieden.
Das Britische Empire entstand im Schatten des in Hunderte von kleinen und kleinsten Fürstentümern zerrissenen Europa, vor allem aber der Kampf der sechs europäischen Großmächte. Es erlebte zwischen 1870 und 1900 eine phänomenale Ausweitung, verbuk dabei aber immer zwanghafter zu einem verkrusteten, arroganten, wandlungs- und anpassungsunfähigen System und lebt heute nur noch als kümmerlicher Schatten seiner ehemaligen weltweiten Größe vor sich hin.
Seit dem Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg – auf dem Umweg über die Lusitania-Affäre [8] -übernahmen diese sukzessive die ehedem britische Herrschaft und deren Ansprüche. Bis heute sind es aber zumeist die superreichen Familien Englands, Frankreichs und Hollands - größtenteils khasarische, also nicht-semitische Juden -, die das Wirtschaftsgeschehen in den USA bestimmen. Es sind diese europäischen Finanzoligarchen, die in Wahrheit hinter der amerikanischen Wirtschaft stehen – für die meisten US-Amerikaner völlig nebulöse Namen, die sich regelmäßig und höchst klandestin in ominösen Zirkeln [Trilaterale, Bilderberger-Konferenz, Atlantische Brücke, Council on Foreign Relations (CFR) und etwa 100 weiteren Bünden und Logen] treffen und untereinander absprechen.
Diesen Familien müssen die USA in ihrer naiven Spielfreude wie ein gigantischer Kindergarten vorkommen, in dem sie rücksichtslos nach eigenem Belieben schalten und walten können, ohne sich erkennbar die Finger schmutzig machen und sich der Kritik in ihren europäischen Heimatländern aussetzen zu müssen; man kann ja alles so wunderbar einfach den Amerikanern in die Schuhe schieben, sie an den Pranger stellen und wahlweise als Weltpolizisten, wenig hinterfragende Konsumenten, Versuchskaninchen im pharmazeutischen, militärischen oder medienpolitischen Spiel verwenden, und trotzdem seine gigantischen Gewinne ziehen. Nicht anders gingen diese Clans bei der höchst verschwiegenen Finanzierung Hitlers, Francos und Mussolinis vor, die ihnen als Bollwerk gegen den aufkeimenden Bolschewismus wunderbar ins Kalkül passten. Diese Familien stört heute auch nicht, wenn die Bürger der USA allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2002 mehr als 7 Billionen US-$ an privaten Ersparnissen in Aktien verloren, die Armutsrate in den USA weiter steigt und die Unruhe in den vornehmlich von Nicht-Weißen bewohnten Slums besorgniserregend zu steigen beginnt. „It`s their country“, mögen sich die Rothschilds und DeBeers, Rockefellers und Morgans (neben etwa zwei Dutzend weiterer Finanzfamilien) sagen, „but it`s our game“.
Gerade die eingeschränkte Weltsicht, die Reduzierung historischer Gegebenheiten auf vorgekaute Mythen und Geschehnisse, die sich um die Gründung der USA ranken, die nahezu völlige Nichtteilnahme des Gros der Amerikaner an allem, was östlich von Vermont und westlich von Hawaii geschieht, kann nur derjenige verstehen, der für eine gewisse Zeit in den USA lebt. Dem steht auch nicht die Tatsache entgegen, daß die Amerikaner außerordentlich aufgeschlossen und neugierig, begeisterungsfähig und hilfsbereit wie kaum ein anderes Land sind. Es ist vor allem die intellektuelle und emotionale Versklavung, die den Amerikaner für Außenstehende derart paranoid und manisch, egozentrisch und naiv-größenwahnsinnig erscheinen läßt. Wenn die USA z.B. im Jahre 2001 rund 400 Milliarden US-$ alleine für Rüstung (den US-Bürgern wird dies als „Verteidigungsausgaben“ verkauft) ausgeben und damit zum einen achtmal so viel wie für den Bereich Bildung verpulvern und dies andererseits 42 % der Verteidigungsausgaben aller Nationen entspricht, so rührt dies die Bürger der USA vor allem deshalb nicht, weil sie keine Vergleichszahlen kennen oder diese Ausgaben nicht als Ausdruck einer größenwahnsinnigen Regierung, sondern eben als notwendige Verteidigungskosten ansehen. Daß im Schatten der Geschehnisse vom 11. September diese Ausgaben für Waffen und sonstige Rüstungsgüter binnen 12 Minuten im Senat um weitere 48 Milliarden US-$ erhöht wurden - was mehr als dem gesamten Verteidigungshaushalt Japans in 2002 entspricht! - weiß ebenfalls kaum ein Amerikaner, denn statt selbstkritisch zu hinterfragen, warum sich zunehmend ein weltweites Auflehnen gegen die Dominanz der USA bahnbricht, leben die amerikanischen Bürger – durch ihre Medien entsprechend gedopt – in der festen Überzeugung, daß die USA auf der „richtigen Seite“ stehen, und ihre Sicht von Gerechtigkeit und friedensstiftender Macht ausschließlich dem Wohle der gesamten zivilisierten Welt dient.
Daß die Amerikaner mit ihrer expansionistischen Brutalität, einer schier unstillbaren Gier nach Bodenschätzen und der Durchsetzung egoistischer Machtpolitik für Kriege und Massaker in fast 100 Ländern der Welt verantwortlich sind (übelstes Beispiel: die Carlyle-Anglo-American-Gruppe, deren Chef-„Berater“ George Bush sen.(!) ist – www.anthropos-ev.de/reise.htm), verschließt sich dem in seiner Community gesittet seinem Tagwerk nachgehenden, braven US-Citizen völlig.
Eingekeilt im intrinsischen, bedenkenlos korrupten (Des-)Informations- und Handlungsgeflecht zwischen militärischer Weltdominanz - nicht einmal im militärverliebten England wird Mitgliedern der vier Streitkräften ein derart hohes Ansehen gezollt - und völlig einseitiger Medieninfiltration; mit enormem Appetit gesegnet - 60 % aller Amerikaner gelten als übergewichtig, fast 25 % sogar als (extrem) fett -; in einem ungeheuren Technikwahn gefangen, und all dies eingebettet in Superlative jeder Art (die Zusätze „world`s best“ „America`s finest“, „the greatest ... world-wide“ sieht und hört jeder US-Bürger pro Tag dutzende Male) lebt der Amerikaner in einem Schaukelstuhl der Extreme; nirgendwo weltweit zählt Geld so viel wie in den USA. Andererseits ist die private US-amerikanische Bereitschaft, humanitäre Hilfe zu leisten, unglaublich hoch; nirgendwo zählt Körperlichkeit derart viel wie in den USA - was nachgerade der Beauty- und pharmazeutischen Industrie wunderbar gelegen kommt und zu für den Rest der Welt abstrusen Schadensersatzklagen führt. Andererseits verfügen 273 Millionen Amerikaner über immerhin 350 Millionen Schußwaffen – auf die weltweite Verbrechens- und Tötungsrate wurde bereits hingewiesen.
Nirgendwo nimmt Sex und körperliche Attraktivität einen so hohen Stellenwert ein wie in den USA, ich kenne allerdings auch kein Land, in dem sexuelle Verklemmtheit, Prüderie und Verschämtheit so ausgeprägt sind. [9] Heroischen Helden, halsbrecherischer Sportlichkeit, geradezu aberwitzigen Verfolgungs- und Kampfszenen in der amerikanischen Filmindustrie steht eine geradezu paranoide Verletzungsangst der Amerikaner, denen körperliche Unversehrtheit über alles geht, gegenüber. Nirgendwo wird gesundes Leben derart zentralisiert und hochgelobt. Jedes Nahrungsmittel muß „low-fat“ bzw. „light“ sein, andererseits gibt es nirgendwo so viele Opfer von fastfood-Ketten wie in den USA. Alleine 80 % aller an Elefantiasis leidenden Menschen weltweit leben in Kalifornien, Texas und Florida.
Während man mit 16 in die Armee eintreten, seinen Führerschein machen (in Florida sogar mit 14) und ab 14/15 Jahren auch den Flugschein erwerben kann, ist in der Mehrzahl der 50 Bundesstaaten der Genuß eines Glases Bier erst ab 21 Jahren erlaubt. Glücksspiel ist in 45 Staaten grundsätzlich verboten, aber alleine in Las Vegas stehen mehr als 600.000 slotmachines („einarmige Banditen“
 , auf die sich westliche US-Bürger eben in ihren Ferien stürzen.
, auf die sich westliche US-Bürger eben in ihren Ferien stürzen. Die amerikanische Verfassung, aber auch das gesamte amerikanische Leben sind zu großen Teilen religiös bestimmt – damit kann man ja auch so wunderbar alles erklären und entschuldigen. Mehr als 130.000 Kirchen und Sekten [10] laden in den USA zu einem gottgefälligen Leben, regelmäßiger community-work, Treffen, Tanz und Zusammenkünften ein. Kein Wunder: Die einfachste und nachhaltigste Art, in den USA Steuern zu sparen, führt über die Gründung einer eigenen Kirche, auch wenn diese vielleicht nur ein einziges Mitglied hat - den Steuersparer selbst.
Das System zerbricht.
Die unilaterale Weltsicht des durchschnittlichen US-Amerikaners ist das gezielte Ergebnis einer völlig einseitigen Ausrichtung des Erziehungs-, Bildungs- und Informationssystems durch die Medien in den USA. So direkt der US-Bürger von Kindesbeinen dazu angehalten wird, innerhalb seiner Community mitzuwirken und teilzunehmen, stolz auf sein(e) Schule/College/Universität zu sein, wahlweise einem Sportteam (oder den Fähnchen und flauschige Puschen wirbelnden Cheerleaders) anzugehören, später in seiner Kirchengemeinde karitativ zu wirken und regelmäßig bei potluck-parties und Veranstaltungen im nächstgelegenen Park nachbarschaftliche Bande zu festigen, so wenig wird ein internationales und geschichtliches Weltbild vermittelt und gefördert. Höchst mobil und flexibel lernt der US-Amerikaner, zum „Schmied“ seines eigenen Glücks zu werden – aber eben immer nur unter dem Gesichtspunkt des seinem Land und seiner Flagge verpflichteten Staatsbürgers. Zu dieser manisch-introvertierten und egozentrischen Sicht tragen nachgerade die Medien bei. Hierbei wird dem braven US-Bürger regelmäßig eine – aus Sicht der USA – heile Welt vorgegaukelt, in der Übles und Schlimmes nur dann und insoweit möglich ist, als eben amerikanische Tugenden nicht sauber gelehrt oder schändlich verraten und gebrochen werden. Der allseits vermittelte Traum vom „American hero“ [11] ) wird US-Amerikanern quasi mit der Muttermilch verabreicht. Wenn sich in Hollywood-Streifen regelmäßig amerikanisches Heldentum, überbordende Tapferkeit und technische Überlegenheit austoben, entspricht dies einer Hirnwäsche, der sich die Jugend nicht entziehen kann und die ältere Generation nicht mehr entziehen zu müssen glaubt. Die Mär von der US-amerikanischen Überlegenheit, die Vermittlung amerikanischer Werte und einer alles in den Schatten stellenden Selbstgerechtigkeit führt zu einer Vernaivisierung der Menschen, die dann im späteren Leben unhinterfragt gelebt, mit arroganter Überzeugung vertreten und dann an die nächste Generation weitergereicht wird.
Dazu dienen nicht zuletzt bis ins Absurde übersteigerte Überlieferungen aus der Gründerzeit der USA und der Besiedelung des nordamerikanischen Kontinents, die den heutigen US-Größenwahn laufend nähren. Daß es sich bei dieser Besiedelung vornehmlich um Flüchtlinge aus Europa und China sowie anderen fernöstlichen Ländern (später auch zwangsimportierte Schwarzafrikaner und Sklaven aus der Karibik) handelt, lernen US-Bürger im Pflichtfach „american history“ nicht. Auch die Besiedelung wird vornehmlich unter den Aspekten des Mutes und Forscherdrangs der „settlers“ gesehen, die ihr Leben riskierten, im Vertrauen auf Gott als Eroberer amerikanischer Erde auftraten, es mit primitiven Atheisten hinterhältigster Art (den Indianern) aufnahmen und selbst schlimmste Entbehrungen nicht scheuten. Schon erstaunter sind US-Bürger, wenn sie erfahren, daß es sich bei diesen Auswanderern beileibe nicht nur um religiös Verfolgte, sondern oftmals um Verbrecher, Fahnenflüchtige und verurteilte Kriminelle handelte, die sich dadurch vor dem Galgen retteten, daß sie im Auftrag der britischen Krone, holländischer Fürsten oder französischer Könige gen Westen aufbrachen oder der Blutrache verfeindeter japanischer und chinesischer Familien dadurch entgingen, daß sie sich für den Bau der Eisenbahn, zu Söldnerdiensten oder als Holzfäller, Goldschürfer, Köche, Fährtensucher oder Felljäger in den neuentdeckten Kontinent verpflichteten.
Aber die Zeiten, in denen eine gesamte Nation von demnächst 300 Millionen Menschen in autistischer Dumpfheit und systematisch tumb gehalten werden können, sind endgültig vorbei. Das Bersten der ökonomischen Seifenblase, die deutlich schneller steigende Population der unterprivilegierten Schichten gegenüber den wirtschaftlich gut situierten Klassen, vor allem jedoch das Grenzen binnen Sekundenschnelle überspringende Internet sind gerade dabei, den amerikanischen Traum universeller Überlegenheit zu zerstören, auch wenn dies Geheimdienste und ein neues Ministerium („Homeland Security“, von Bush-junior gerade mit 170.000 Beamten gegründet) verzweifelt zu unterbinden versuchen. Das absurd simpel gestrickte Weltbild der US-Amerikaner hat spätestens mit den Geschehnissen vom 11. September 2001 seinen traurigen Höhepunkt überschritten. Mehr und mehr beginnen auch Amerikaner in Zweifel zu ziehen, was ihnen tagtäglich zwischen Werbung und Comics, Sportsendungen und regionalen Highlights in Bild- und Tonmedien vor die Nase gehalten wird. Zu viele intelligente und neugierige Menschen in den USA stellen Fragen und runzeln die Stirn. Die allfälligen Diskrepanzen der Einkommen und nur scheinbar allen BürgerInnen gleichermaßen offenstehender Lebenschancen erregen auch bei Kindern und Jugendlichen zunehmend Argwohn, Mißtrauen und wachsende Aggressionen. Mögen Hollywood und die Medientycoons, Pharmaindustrie und Waffenlobby, politische und religiöse Lichtgestalten, als Gallionsfiguren eingesetzte Marionetten in Politik und Wirtschaft, Sport und Entertainment auch noch so uneinsichtig ihre volksverdummenden Reden schwingen – die ohnehin nur mühsam im Zaum gehaltende US-amerikanische Kultur-, Wirtschafts- und Staatsgemeinschaft ist auf dem besten Wege, aus den Fugen zu geraten und auseinanderzubrechen.
Wie schnell dies gehen kann, beweisen Hunderte von ähnlich gelagerten Fällen in der Geschichte. Man muß nicht den Zusammenbruch der früheren Weltreiche der Hethiter und Assyrer, Ägypter und Babylonier, der Griechen und Römer, Mongolen und Türken bemühen; viel näher liegen uns der Zusammenbruch der Weltreiche Frankreichs und Spaniens, Portugal und Hollands, Österreichs und Preußens, des Britischen Empire oder – noch zeitnäher – des Kommunismus/Sozialismus` und der Wahnsinnsreiche Stalins und Hitlers.
Die US-amerikanischen Hegemonialansprüche sind weder militärisch zu verwirklichen, noch finanziell zu verkraften. Das nach dem originären Sinn des Wortes durchaus als faschistisch zu bezeichnende egozentrische US-System hat sich intern, astronomisch gesprochen, zu einem höchst gefährlichen, instabilem „schwarzen Loch“ verdichtet und außenpolitisch längst völlig übernommen. Binnen weniger Jahre – ich wage eine Prognose von fünf, maximal zehn Jahren – wird sich dieses System als menschenverachtender Größenwahn, chauvinistische Schimäre und bigotte, echte Liberalität zynisch und egoman mit Füßen tretende Farce entlarven. Die Frage ist nur, wieviel Leid bis dahin noch dank US-amerikanischer Uneinsichtigkeit, der Welt- und Machtgier der dahinterstehenden Drahtzieher, hypokritischer Weltverbesserungsmanie und bornierter Starrköpfigkeit der übrigen Welt abverlangt wird und unter welchen Opfern für die US-amerikanische Bevölkerung und Millionen von Menschen anderer Nationalität eine verschwindend geringe Minderheit ihren Reichtum mehren und ihre Landsleute ebenso wie andere Nationen brutal ausbeuten, seelisch und geistig mißbrauchen und töten wird. Die sich unzweideutig entwickelnden Krisenherde im Nahen Osten – hier kommt es unweigerlich zum Krieg, der wiederum zur Spaltung der arabischen von der westlich-orientierten Welt führen wird - und zwischen Indien und Pakistan, in Lateinamerika und vielen Staaten Afrikas, deren Bevölkerungen aufzuwachen beginnen und nicht mehr länger bereit sein werden, ihre Bodenschätze von amerikanischen Konzernen ausbeuten zu lassen, werden den Niedergang der Supermacht USA schon sehr bald Realität werden lassen. Sollte es den USA nicht gelingen, sich vom Diktat der enorm einflussreichen inneramerikanischen khasarisch-jüdischen Organisationen zu befreien und Sharon in den Arm zu fallen, droht hier buchstäblich der Ausbruch eines Dritten Weltkrieges.
Dabei werden dann gleichzeitig auch viele Regime, die bislang noch unter dem Schild amerikanischen Einflusses ihre Landsleute ausbeuten und tyrannisieren können (z.B. Saudi Arabien), explodieren, während andere, bislang unter US-amerikanischer Knute noch (halbwegs) still verharrende Nationen und Gesinnungsgruppen dann massiv losschlagen werden, wenn sie den Weltriesen USA als angeschlagen und verwundbar erkennen, und zum Angriff übergehen.
Wenn bislang nur sehr vereinzelt mit Biowaffen (Anthrax, infizierten Viren und manipulierten Genen) Terroranschläge verübt worden sind - bezeichnenderweise vor allem innerhalb der USA und von Amerikanern (!) -, so ausschließlich deshalb, weil die dahinterstehenden Fundamentalisten zu viele ihrer eigenen Gesinnungsgenossen treffen könnten. Die Verfeinerung derart letaler, fundamentalistisch „gerechtfertigter“ Methoden nimmt jedoch täglich zu. Die Gefahr wächst exponentiell und unaufhaltsam.
Wer sich heute noch im Schatten Bush`schen Größenwahns meint, profilieren zu können, sollte die Zeichen der Zeit, längst in Riesenlettern an der Wand prangend, nicht leichtfertig übersehen. Das Ende des US-amerikanischen Weltterrorismus` wird auch für den Rest der Welt mit großen Problemen, sozial- und wirtschaftspolitischen Verwerfungen einhergehen. Da werden den USA auch noch so monströse, ultramoderne Abwehrsysteme (Haarp, Master-Shield, SMI, etc.) und noch so verfeinerte Abhörmethoden und gänzlich verrückte Militärs kein bißchen helfen.
Mutmaßlich wird der Zusammenbruch des US-amerikanischen Systems die weltweit katastrophalste Apokalypse der Menschheitsgeschichte mit sich bringen, in deren Abfolge Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöte, kriegsbedingte Verödung riesiger Landstriche, chaotische Bürgerkriege, millionenfache Flüchtlingsheere, die Ausrottung ganzer Volksgruppen, aber auch ein gigantischer Flurschaden und die Vernichtung großer Teile der Fauna und Flora dieses Planeten stehen könnten.
Auf Einsicht in den Gehirnen US-amerikanischer Regierungsvertreter und hoher Militärs oder die Vernunft und Menschlichkeit der dahinterstehenden Finanzologarchien darf kein Mensch hoffen. Sie werden den Krug bis zur bitteren Neige leeren – „no matter what!“
Doch diese Phase gilt es durchzustehen – so bitter und schmerzhaft dies für mutmaßlich jedes Land dieser Erde auch werden wird.
Hoffnung gebiert allenfalls die Tatsache, daß der weltweite Widerstand gegen die amerikanische Hybris stündlich wächst. Erfreulicherweise sind immer mehr Menschen – vor allem die Jugend – bereit, den Zeichen an der Wand Aufmerksamkeit zu schenken, den Kopf nicht wegzudrehen und die Augen nicht zu verschließen. Den gefilterten Nachrichten in Presse, Rundfunk und Fernsehen wird zunehmend mißtraut. Mehr und mehr Menschen suchen nach weiteren Informationsquellen, sind bereit zu diskutieren, nachzudenken und zu stutzen.
Der Anfang vom Ende der Vereinigten Staaten von Amerika hat längst begonnen.
„Es kommt der Moment, so selten dies auch in der Geschichte passiert, an dem wir aus dem Alten ins Neue steigen, an dem ein Zeitalter endet und die Seele einer Nation, die zuvor lange unterdrückt wurde, ihren Ausdruck findet.“
Jawarhalal Nehru, 1947
bei der Gründung der islamischen Republik Pakistan, einen Tag vor der Befreiung
Indiens aus britischer Herrschaft, am 15. August 1947
http://www.zeitreport.de/kriegirak.htm
zeitreport-online März 2003
Vom „Krieg für Freiheit und Frieden“
– und anderen Lügen
Der 2. Golfkrieg (historisch korrekt eigentlich der 3. der Neuzeit) begann am 20. März 2003, kurz nach 3:30 (MEZ) mit einem ‚Enthauptungsschlag’ durch zwei Raketen in einen der drei großen (von über 70) Präsidentenpaläste Saddam Husseins. Soweit die nüchternen Tatsachen.
Vorausgegangen waren diesem Moment Monate der Verhandlungen, innerhalb derer keine Lüge gescheut, keine Drohung unausgesprochen blieb. In dieses Verwirrspiel, das Buhlen um Zustimmung in den einzelnen Ländern wie auch in den internationalen Gremien und gegen-seitige Schuldvorwürfe ließen sich speziell die Medien wunderbar einflechten - sei es, um im Kampf um Marktanteile, Einschaltquoten, Sendeplätze und (damit) Werbequoten Boden gegenüber der Konkurrenz gutzumachen, sei es, um der eigenen Regierung und konkurrie-renden Parteien Bonuspunkte im In- und Ausland zu sichern oder Wahlen zu beeinflussen. Das Manipulations- und Korruptionskartell feierte fröhliche Urständ.
Selbstverständlich bedienten sich dazu alle - Politiker wie Medien - des gesamten Arsenals euphemistischer Begriffe und heroischer „Werte“, um das eigene Vorgehen zu rechtfertigen und den Gegner zu desavouieren. Selbst gut informierte BürgerInnen sahen sich flugs einem schier undurchdringlichen Geflecht von implizierten Tatsachen, Widersprüchen und Vermutungen gegenüber, aus denen es galt, sich eine eigene Meinung zu bilden, Wahrheit von Fiktion zu trennen, um daraus einen Standpunkt zu generieren. Die meisten hingegen resignierten früher oder später; sie übernahmen den von der Mehrheit vertretenen „Standpunkt“, opferten dem nationalen Gemeinschafts“gefühl“ eigenes Denkfühlen oder schotteten sich von jeglichem Standpunkt ab, steckten also den Kopf nur noch ängstlich in den ‚Sand’ - in der Hoffnung, daß sich das dräuende Gewölk unverständlicher (aber sehr wohl empfundener) Gefahr bald verzöge. Andere wiederum vergewisserten sich durch einen Blick in den Atlas, daß der Irak rund 5.000 km entfernt ist, eine unmittelbare Gefahr also mutmaßlich nicht gegeben sei.
Doch diese Ansicht - so dienlich sie den Kontrahenten und Beteiligten ist - könnte sich schon bald als höchst fatal erweisen. Dies wollen wir im folgenden näher beleuchten, denn das Ende des am 20. März begonnenen Golfkriegs ist der Beginn einer Aera völlig neuer Konflikte.
Der Ursprung des 2. Irakkrieges....
..liegt in einem nie abgeschlossenen 1. Irakkrieg (1991) und dessen bis heute nicht gelösten Problemen, zu denen sich in den letzten 12 Jahren nur noch ein Kranz weiterer hinzugesellte.
a) Diente der irakische Präsident bei den Auseinandersetzungen der USA mit dem Iran (nach
dem Sturz des Schah, mit dem die USA trefflich und zu beiderseitigem Vorteil kollabo-
rierten) noch als verläßlicher und deshalb zuvorkommend - mit Waffen und Krediten -
unterstützter Partner (obwohl er bereits damals ein brutales Regime führte), so lief eben
jener Hussein - in Verkennung der veränderten Weltlage und seines gesunkenen Wertes für
seine Gönner, die USA - ungeplant aus dem Ruder, zeigte sich zunehmend egoman, ja
geradezu unverschämt; er forderte eine Autarkie und Autonomie ein, die ihm die USA nie
und nimmer gewähren wollten. Vor allem Husseins Rolle als zweitgrößter Erdölförderer
(nach dem Nachbarn Saudi Arabien) und Besitzer der ergiebigsten (bis heute bekannten)
Erdgaslager ergrimmte den mit Abstand größten Energieverbraucher, die USA, zunehmend.
b) Hussein, Führer der nicht-islamischen Baath-Partei und Herrscher über das einzige
laizistische Land im Vorderen Orient, kam den USA, die den aufkeimenden fundamen-
talistischen Strömungen (nicht nur, aber vor allem im arabischen Raum) - insbesondere
mit Blick auf das wirtschaftlich am Tropf hängende Israel - gut zupaß. Hinzu kam die
(berechtigte) Sorge der USA, daß im Zuge der Renaissance des Islam auch der ’Traum-
partner’ Saudi Arabien, ein mittelalterlicher Feudalstaat, in dem 0,12% der rund 21 Mill.
Einwohner (allsamt Angehörige des Königshauses) über 95% des gesamten Reichtums des
Landes verfügt, ein zunehmend unsicherer Kandidat zu werden drohte. Unpäßlich für
Hussein kam auch der Zusammenbruch des Sozialismus und der Sowjetunion, womit sich
der strategische Wert des Irak für die USA erübrigte. Hier verpokerte sich der irakische
Diktator schlicht.
Die wachsende EU, ihre Tendenz, sich im Osten neue Mitglieder einzuverleiben, eine sich überlebende NATO, eine (weltweite, seit 1989) negative Energie-Rohstoffbilanz, der aufkeimende Islamismus und die Tatsache, daß die USA sich energiemäßig abzusichern trachteten, gebar nun in den Köpfen der Schöpfer der TWP [1] , der Folgeorganisation des MAI [2] (siehe hierzu: http://www.dbsfs.de/download/mai.doc ) - hinter beiden ‚Vereinen’ stecken die großen internationalen Finanzfamilien - einen genialen Plan: Gelänge es, den Drang der asiatischen (teil)autonomen Republiken der ehemaligen UdSSR nach Autonomie für die USA dienlich zu fördern und diese wirtschaftlich (und durch Waffenlieferungen!) zu stärken - also von der ungeliebten ‚Mutter’ Rußland abzunabeln -, könnte man ein direktes Versorgungs- und Transportnetz durch den zentralasiatischen Raum aufbauen. Unter der Kontrolle der großen US-Ölmultis stehend, würde es die USA ihres Energieversorgungsproblems entheben. Zudem könnt es deren Einfluß - nota bene im Hinblick auf das ungeliebte OPEC-Kartell und die sich schamlos ausbreitende, zunehmend mit dem Osten (= ehemaliges ‚Reich des Bösen’ fraternisierende EU - sichern und den wahren Herrscher der Welt, die USA, strategisch bestens positionieren.
fraternisierende EU - sichern und den wahren Herrscher der Welt, die USA, strategisch bestens positionieren.
Bei diesen Überlegungen stand auch der Gedanke Pate, daß die kommende Wirtschafts-, Industrie- und Konsumnation Nr 1, China, sowie der noch im Dornröschenschlaf dämmernde indische Subkontinent (mit seinem schwelenden Konfliktpotential Pakistan/Indien) früher oder später die ihnen bevölkerungsmäßig zustehende Rolle im Weltkarussell beanspruchen würden. Dem galt es, wollte man den globalen Herrschaftsanspruch der USA sichern, frühzeitig und höchst vorsorglich - mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden(!) - Rechnung zu tragen. Hier geht es nämlich nicht mehr um Milliarden, sondern um Billionen und die Sicherung einer Jahrhundertstrategie, deren Wirkungsparameter in sämtliche Bereiche ragen: Energie- und Kreditwirtschaft, Waffen- und Rüstungsindustrie, Freizeit, Medien und Tourismus, Forschung und Entwicklung, Medizin und Pharmaindustrie, also Produktion-, Distribution und Konsum - kurz: alle, das Leben von demnächst 8 bis 9 Milliarden Menschen betreffende Belange und die Festigung eines vielleicht nie wieder einzuholenden, heute bestehenden Vorsprungs der restverbliebenen Supermacht USA.
Die weltweite Korruption der Illuminaten.
Die ‚Illuminaten’ (lat. für ‚die Erleuchteten’ sind ein ’elitärer’ Kreis höchst klandestin verwobener Finanzoligarchen, die - sehr hierarchisch sortiert - als die wahren Strippenzieher in sämtlichen relevanten Feldern die Macht kontrollieren. Dies gilt beileibe nicht nur für so profane Dinge wie Großkonzerne in der Industrie, der Medien- und Finanzwirtschaft, dem Pharmazie-, Transport-, Logistik- und Rüstungswesen, vielmehr unterhalten sie - über entsprechende Vereinigungen, Bruderschaften und Institute - beste Kontakte zu weltlichen und geistlichen Organisationen. Sie füttern, wie dereinst die Fugger und andere Geldfürsten, die ihnen genehmen Personen und Organisationen, die durch sie oftmals überhaupt erst an die Spitze von Konzernen, politischen Parteien und Machtpositionen aller Art gelangen. Dafür unterhalten sie Stiftungen und Eliteuniversitäten, ’Kultur’zentren und Museen. Sie vergeben Stipendien und finanzieren Karrieren, sie subventionieren patriotische Vereine und pflegen einen intimen Korpsgeist, in den aufgenommen zu werden schon eine Art Karrieregarantie darstellt. Zentralen dieser Illuminaten sind die Eliteschulen und -universitäten der US-Ostküste, Englands und der Niederlande, aber auch die französische ENA, aus deren Kreis nahezu alle Spitzen der französischen Wirtschaft und Politik kommen (und seit mehr als 100 Jahren kamen). Diesen Illuminaten verdanken wir die ‚Transatlantische Brücke’, das ‚CFR [3] ’, die ‚Bilderberger’, den ‚Ritterorden vom heiligen Grabe zu Jerusalem’ und Hun-derte weiterer Vereinigungen unterschiedlichster Art, den EZB-Präse Duisenberg ebenso wie Altmeister Kohl und die Herren Kissinger und Cheney, Rumsfeld und Mrs. Rice, um nur ein paar zu nennen.
sind ein ’elitärer’ Kreis höchst klandestin verwobener Finanzoligarchen, die - sehr hierarchisch sortiert - als die wahren Strippenzieher in sämtlichen relevanten Feldern die Macht kontrollieren. Dies gilt beileibe nicht nur für so profane Dinge wie Großkonzerne in der Industrie, der Medien- und Finanzwirtschaft, dem Pharmazie-, Transport-, Logistik- und Rüstungswesen, vielmehr unterhalten sie - über entsprechende Vereinigungen, Bruderschaften und Institute - beste Kontakte zu weltlichen und geistlichen Organisationen. Sie füttern, wie dereinst die Fugger und andere Geldfürsten, die ihnen genehmen Personen und Organisationen, die durch sie oftmals überhaupt erst an die Spitze von Konzernen, politischen Parteien und Machtpositionen aller Art gelangen. Dafür unterhalten sie Stiftungen und Eliteuniversitäten, ’Kultur’zentren und Museen. Sie vergeben Stipendien und finanzieren Karrieren, sie subventionieren patriotische Vereine und pflegen einen intimen Korpsgeist, in den aufgenommen zu werden schon eine Art Karrieregarantie darstellt. Zentralen dieser Illuminaten sind die Eliteschulen und -universitäten der US-Ostküste, Englands und der Niederlande, aber auch die französische ENA, aus deren Kreis nahezu alle Spitzen der französischen Wirtschaft und Politik kommen (und seit mehr als 100 Jahren kamen). Diesen Illuminaten verdanken wir die ‚Transatlantische Brücke’, das ‚CFR [3] ’, die ‚Bilderberger’, den ‚Ritterorden vom heiligen Grabe zu Jerusalem’ und Hun-derte weiterer Vereinigungen unterschiedlichster Art, den EZB-Präse Duisenberg ebenso wie Altmeister Kohl und die Herren Kissinger und Cheney, Rumsfeld und Mrs. Rice, um nur ein paar zu nennen.
Diese Kamerilla, intern bisweilen höchst eifersüchtig, aber im Geiste geteilter Gier höchst kooperativ, besetzt in weltlichen - politischen und militärischen, bildungs- und medienrelevanten, geheimdienstlichen und juristischen -, strategisch wichtigen Belangen alle Spitzenpositionen mit höchst willigen (ergo: abhängigen) Figuren, die nach außen den kecken Harlekin abgeben, in Wahrheit aber billige Befehlsempfänger sind. Warum sollten sich die Strippenzieher auch den Tort antun, sich den neugierigen Fragen und der Häme, Wut und Unbill der Massen auszusetzen, sich in der Nichtigkeit des öffentlichen Lebens zur Schau zu stellen? Das überlassen sie der Eitelkeit von Selbstdarstellern aus Politik und Pop, den Popanzen der ‚Prominenz’ aus Kultur, der glamourösen Welt der Stars und Starlets.
Natürlich ist die Masse zumeist viel zu sehr mit der Wahrung ihres Lebensstandards, dem Erhalt des Jobs, der Aufzucht, Hege und Pflege der Nachkommenschaft, dem eigenen Rentenanspruch und den familieninternen Problemen beschäftigt, als daß sie über die immer komplexer werdende Welt insgesamt nachdenkt. Aber ein paar Querulanten gibt’s immer wieder, die sich den Luxus zeitaufwendigen Hinterfragens und unbotmäßiger Neugier erlauben, die nach Erklärungen lugen und verstehen wollen, was hinter den - im großen und ganzen geschickt verschobenen - Kulissen läuft.
Zur Abwehr dieser Querdenker, Nörgler und Fragensteller genügte es vollkommen, den verlächerlichenden Begriff vom ‚Weltverschwörertum’ zu kreieren. Damit stellt man diese Unbequemlinge ins Abseits und an den Pranger - zur allgemeinen Belustigung freigegeben - und bietet dem leicht verunsicherten Mitglied der breiten Masse eine willkommene (weil bequeme) Entschuldigung (vor sich selbst), tunlichst wieder in alltägliche Gewohnheitlichkeit zurückzukehren (‚Drei-Affen-Prinzip’: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen), geistig wie seelisch die „Türen“ und „Fenster“ vor Unliebsamkeiten zu verrammeln, die stören, verun-sichern und beunruhigen könnten. Wer wirklich Näheres hierzu erfahren möchte, natürliche Neugier nicht ins Korsett der Bequemlichkeit zwängen möchte, dem sei das anno 2000 im Fouque-Verlag erschienene Buch „Korruption – die Entschlüsselung eines universellen Phänomens“ anempfohlen.
USA – ideales Spielfeld der Illuminaten.
Kein anderes Land ist als Nährboden und Spielwiese für die Illuminaten, die ja irgendwo auch eine physische Zentrale unterhalten müssen, besser geeignet, als die ’Vereinigten Staaten von Amerika’. Das hat vielfältige Gründe (sh: „Die USA – der Anfang vom Ende“, abrufbar unter www.dbsfs.de), fußt aber vor allem auf einem seit mehr als 200 Jahren wie in keinem anderen Land gepflegten calvinistischen Praedestinationsglauben, demzufolge - auf den protestantischen Reformer Calvin zurückgehend - der christliche Gott denjenigen bereits zu Lebzeiten besonders begünstigt, den er favorisiert; anders ausgedrückt: Irdischer Reichtum, weltliche Wohltat und Besonderheit - Reichtum, Gesundheit, Ehre und Ruhm sowie sonstiges Wohlergehen - sind augenfälliger Beweis göttlicher Bevorzugung und mithin keineswegs verwerflich. Genau hierin liegt die tiefere Ursache für den in den USA so hemmungslos (und für „gesittete“, kulturell europäisch geprägte Menschen geradezu dümmlich) zur Ikone stilisierten Gigantismus, die Hybris eines weltweit teils bewunderten, teils verachteten Größenwahns US-amerikanischer Prägung. Reichtum und dessen Zurschaustellung ist oberste Bürgerpflicht und schlagender Beweis göttlicherseits gewährter Besonderheit. „Money is what really counts, brother!“
Lebensgenuß und -freude [sinnstiftender Beweis göttlicher Auserwähltheit („God’s own country“ ] wurden - nicht frei von Häme gegenüber dem zersplitterten, vom Zweikampf der beiden Konfessionen und hundertfachen weltlichen Diadochenkämpfen gebeutelten Europa -
] wurden - nicht frei von Häme gegenüber dem zersplitterten, vom Zweikampf der beiden Konfessionen und hundertfachen weltlichen Diadochenkämpfen gebeutelten Europa -
zur ‚benchmark’ irdischer Lebenskunst erhoben, der sich zu unterwerfen kleinen US-Amerikanern bereits mit der Muttermilch (später mithilfe des in fast jedem Zimmer stehenden Fernsehers) verabreicht wird: „You got to be beautiful and rich! If you can’t make it – tough luck!“ Auf diesen verkürzten Nenner kann - Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel - das generelle Selbstverständnis des US-Amerikaners subsummiert werden.
Doch das alleine ergäbe eine zu fade ‘Suppe’. Man garniere das Ganze noch mit jeder Menge Religiosität, einem alles verbindenden Korpsgeist (vulgo: alles überschattender, irrealer, bisweilen schon faschistisch anmutender Nationalismus), viel Patriotismus, einer sehr einseitigen Eroberungsmythologie der ‚Neuen Welt’ (dargestellt in bisweilen regelrecht putzigen „Museen“, die selbst im kleinsten Dorf zu finden sind), gegen den sich die heute in Reservate zwangsumgesiedelten Indianer nie wehren konnten, dem generellen unerschütter-lichen Maximalanspruch (’American’ steht generell für „the world’s best/finest/greatest.....“ - psychologisch interpretiert: ein seit der ersten Einwanderungswelle sorgsam gepflegter Trennungshaß gegenüber dem ‚Alten Kontinent’ - und einen geradezu kindlichen Glauben an die suggerierte Märchenwelt, schon hat man ein Volk ’konstruiert’, mit dem man virtuell, quasi ’in vitro’, alles ausprobieren kann, was dann in die Restwelt exportiert wird - notfalls auch zwangsweise. Die USA als gigantisches Labor für die perfekte Manipulation eines (zumeist) leicht lenkbaren Menschengeschlechts, des idealen Staatsbürgers der Zukunft. Heureka!
- psychologisch interpretiert: ein seit der ersten Einwanderungswelle sorgsam gepflegter Trennungshaß gegenüber dem ‚Alten Kontinent’ - und einen geradezu kindlichen Glauben an die suggerierte Märchenwelt, schon hat man ein Volk ’konstruiert’, mit dem man virtuell, quasi ’in vitro’, alles ausprobieren kann, was dann in die Restwelt exportiert wird - notfalls auch zwangsweise. Die USA als gigantisches Labor für die perfekte Manipulation eines (zumeist) leicht lenkbaren Menschengeschlechts, des idealen Staatsbürgers der Zukunft. Heureka!
Erste Versuche, auch den ‚Restmenschen’ US-amerikanische Lebenskultur überzustülpen, boten sich den USA nach dem 2.Weltkrieg (Japan, Korea, Thailand, die Philippinen und Taiwan, Indonesien und Malaysia, Hongkong und Singapur, Lateinamerika, Südafrika, sukzessive auch Schwarzafrika und Mittelamerika, Deutschland, Österreich und - trotz bis heute spürbarer störrischer Gegenwehr - auch Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, die Benelux-Staaten und Skandinavien), nach dem Fall der Mauer auch in der ex-DDR, dann nach der Perestroika (1992) auch in Rußland, den baltischen Ländern sowie im ex-sozialistischen Osteuropa und nun zunehmend auch im früheren Rotchina. Die US-amerikanische ‚Mickey Mouse’-Kultur, der Hamburgerismus und das Cyber-Denken galoppieren, fröhliche Unbeschwertheit vermittelnd, durch den Rest der Welt. Wen kümmern da Umweltschutz und Ressourcen-orientierte Sorgsamkeit?! „Everything is possible – we’ll show you“!
Nota bene: Der bereits unter Bush sen. agierende Paul Wolfowitz dürfte heute der mächtigste Verbindungsmann zwischen der Bush-Administration und den Illuminaten sein.
Der Preis des Größenwahns
Kein Besucher der USA, den nicht das Land selbst, mit seinen einzigartigen Naturschönhei-ten, seiner Flora und Fauna, begeistert hätte; keiner, der nicht die Bombastik der Millionen-städte bestaunt, die phänomenale Gastfreundlichkeit der US-Amerikaner und die ‚Leichtig-keit’ des ‚American Way of Life’ registriert hätte. Doch wer etwas länger und genauer hinsieht, registriert auch das krasse Mißverhältnis zwischen dem Anspruch einer Supermacht, dem Rest der Welt den Weg zu weisen, und der sich erst bei zweitem Hinsehen offenbarenden Realität. Unglaubliches Schwelgen in Reichtum, Sattheit und Überfluß geht einher mit einer sprunghaft steigenden Armut – speziell in den Slums der Metropolen und hier speziell bei nicht-kaukasischen Einwohnern. Nirgendwo weltweit wird mit natürlichen Ressourcen und Energie derart verschwenderisch geaast, so bedenkenlos die belebte und unbelebte Natur menschlicher Hybris - ausschließlich nach den Prinzipien von Nützlichkeit und Bequemlichkeit - geopfert, wie in den USA. Was Umsatz, Wohlstand (für genügend Kaufkräftige), Wachstum und Gewinn verspricht, wird realisiert - Hauptsache, es dient der Unterhaltung, regt an, ist neu, verspielt und glitzert. Wer sich das eine oder andere nicht leisten kann, ist selber schuld (Calvin läßt grüßen). Eltern verschulden sich bis unter die Augen, um den „gesellschaftlichen Voraussetzungen“, die vor allem Werbung und Medien in die Kinderzimmer tragen, zu genügen. „Be part of it“ bestimmt den Rhythmus der Erziehung, des Gemeinschaftslebens - privat und im öffentlichen Leben. „Life is a party, and you better join in“ gilt als Richtmaß - für Familien und Kommunen jeder Größe. Kein Wunder, daß die USA seit Jahrzehnten völlig über ihre Verhältnisse leben. Die durchschnittliche Verschuldung der Privathaushalte, aber auch der Gemeinden und des Federal Government würde europäischen Bankern, die nach den Basel-II - Richtlinien schielen, den Atem stocken lassen, und die USA hätten nicht den Hauch einer Chance, der EU beizutreten.
Die öffentliche Gesamtverschuldung der USA liegt bei etwa 800% des Bruttoinlandsprodukts
(von derzeit ca 12 Billionen $), wobei der öffentl. Investitionsstau - allein beim Straßenbau sind dies nach internen Schätzungen etwa 1,8 Billionen $ - noch gar nicht eingerechnet ist. Die letzten drei Jahre haben Vermögenswerte auf Wertpapierbasis von etwa 2,65 Billionen $ vernichtet, hinzu kommen Pensionswerte von weiteren ca 1,3 Billionen $, die in den Bilanzen der Gesellschaften innerhalb der nächsten drei Jahre abgeschrieben werden müssen. Doch all dies tangiert die US-Amerikaner nur sehr peripher. Dann wird eben der Ruhestand um ein paar Jahre verschoben, ein zweiter oder dritter Job gesucht oder das Konto noch ein bißchen mehr überzogen und die Kreditkarte gezückt; notfalls packt man seine Siebensachen, verschwindet bei Nacht und Nebel - eine Meldepflicht nach europäischer Lesart gibt es in den USA nicht - und fängt irgendwo ganz neu an. Viele warten einfach auf den großen Durchbruch („There is always a new chance“ , um dann bereitwillig zuzuschlagen („Sooner or later I’ll make it!“
, um dann bereitwillig zuzuschlagen („Sooner or later I’ll make it!“ . Dieser alles beiseite wischende Optimismus („Everything is possible!“
. Dieser alles beiseite wischende Optimismus („Everything is possible!“ läßt europäische ‚Realisten’ (speziell deutsche) nur noch den Kopf schütteln, ficht aber nur wenige US-citizens an. Selbst die gefährliche soziale Schieflage, das Fehlen eines auch nur vergleichbaren Sozialversicherungssystems, eine wachsende Armut in „God’s own country“ läßt das Gros der US-Bürger nicht an der Überlegenheit des eigenen Systems zweifeln. Wohl nirgendwo wird das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ derart brutal gelebt wie in den USA. Schon der eigene Stolz verbietet es, sich hilfesuchend an den Staat, ja selbst an die Gemeinde zu wenden, und der Regierung in Washington nebst ihren Ablegern traut man ohnehin nicht - was sich nicht zuletzt in der Wahlbeteiligung zur Präsidentschaft niederschlägt (ca 40 %). Hauptsache ist, man hält die Idee vom ‚American Dream’ aufrecht - dafür gibt’s Hollywood, Comics und Disneylands (in Jedermann zumut-barer Nähe) -, pflegt die familiäre Nähe und gute Beziehungen zu den Nachbarn, wahrt sein Recht auf die eigene Waffe und glaubt ganz fest an Amerikas Größe. Sport, Show und Superiorität (über den Rest der Welt) - was sollte einen rechten US-Amerikaner sonst groß kümmern?
läßt europäische ‚Realisten’ (speziell deutsche) nur noch den Kopf schütteln, ficht aber nur wenige US-citizens an. Selbst die gefährliche soziale Schieflage, das Fehlen eines auch nur vergleichbaren Sozialversicherungssystems, eine wachsende Armut in „God’s own country“ läßt das Gros der US-Bürger nicht an der Überlegenheit des eigenen Systems zweifeln. Wohl nirgendwo wird das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ derart brutal gelebt wie in den USA. Schon der eigene Stolz verbietet es, sich hilfesuchend an den Staat, ja selbst an die Gemeinde zu wenden, und der Regierung in Washington nebst ihren Ablegern traut man ohnehin nicht - was sich nicht zuletzt in der Wahlbeteiligung zur Präsidentschaft niederschlägt (ca 40 %). Hauptsache ist, man hält die Idee vom ‚American Dream’ aufrecht - dafür gibt’s Hollywood, Comics und Disneylands (in Jedermann zumut-barer Nähe) -, pflegt die familiäre Nähe und gute Beziehungen zu den Nachbarn, wahrt sein Recht auf die eigene Waffe und glaubt ganz fest an Amerikas Größe. Sport, Show und Superiorität (über den Rest der Welt) - was sollte einen rechten US-Amerikaner sonst groß kümmern?
Kein Wunder, daß 90% der US-Bürger überzeugt davon sind, daß ihr System das weltweit beste ist. Zur Schulausbildung selbst in Junior High Schools gehört nicht, das US-Lebens-prinzip in Frage zu stellen, sondern morgens den Eid auf die Fahne abzulegen. Um Zusammenhänge im Rest der Welt kümmern sich Johnny und Martha herzlich wenig.
- Wenn Bush dem Irak vorwirft, Massenvernichtungswaffen zu produzieren, trifft dies zwar
mutmaßlich zu, daß aber die USA mehr biologische, chemische und nukleare Massenver-
nichtungswaffen halten, als alle anderen Staaten der Welt zusammen, finden die US-Bürger
o.k. – quod licet jovi, non licet bovi!
- „Wer nicht unserer Meinung ist, ist unser Feind“ - das Gros der US-Bürger nickt sofort;
- Daß die USA weder das Kyoto- Protokoll noch die IACW [4] -Charta sowie Dutzende anderer
Abkommen zum Schutz gegen Umweltverschmutzung, Kindersterblichkeit, Hunger, den
Drogenhandel, die Beschneidung von Frauen, das Abholzen der Regenwälder, Walfang und
Energiemißbrauch etc. ratifizierten, stört in den USA wenig – „Whatever serves America’s
economy, is good for us“;
- Gegen eine UN-Resolution zu verstoßen, ist Bush Grund genug, den gesamten Irak an den
Pranger zu stellen; daß Israel sich um mehr als zwei Dutzend UN-Resolutionen keinen
Deut kümmert fällt für den braven US-Bürger nicht weiter ins Gewicht;
- Der Irak hat (vielleicht) schon die Atombombe – Aufschrei der Entrüstung. Nun ja, Israel
hat sie bereits seit etwa 10 Jahren und auch Nordkorea, Indien und Pakistan dürften sie be-
sitzen; immerhin sind die USA bislang die einzige Nation, die (bereits zweimal) die Atom-
bombe auch gegen Menschen eingesetzt haben, und gegen das Waffenarsenal der USA und
ihre pathologisch-paranoide Entwicklungsmanie immer fürchterlicherer Waffensysteme
wirkt der Rest der Welt wie ein Klub von Steinschleuderern;
- mit einem Rüstungs- und ‚Verteidigungs’-Budget von mehr als 600 Milliarden $ übertreffen
die USA die Etats der gesamten restlichen Welt addiert;
- Allein das US-Marine Corps, eine der vier Streitkräfte der USA, übertrifft die Gesamtheit
aller europäischen Armeen, die Seestreitkräfte der USA alle Kriegsmarinen der Welt;
- Dank einer ausgefeilten Medien- und Desinformationstaktik endet das Weltbild der meisten
US-Amerikaner unmittelbar an den Grenzen Nordamerikas – allenfalls um Kanada, Mexico
und Hawaii ergänzt. Informationen drehen sich zumeist um ‚local affairs’ und derart ist
auch der Bedeutungshorizont. Dahinter steckt Methode; je begrenzter die Sichtweise, desto
leichter fällt die Kontrolle und umso eher fällt auf, wer sich dem ‚local mainstream’ zu
entziehen versucht. Die Familie - neben ‚God’ und ‚America’ die wichtigste Größe im
Leben eines ‚Good American’ - als ausgelagerte Disziplinierungsinstanz des ‚Big Brother’,
gefolgt von den High Schools, Colleges und Universities, deren Renomée für US-citizens
ungleich bedeutsamer ist als in Europa und denen man auch im weiteren Leben stolz die
Treue hält, sowie der militärischen Einheit, die Mann und Frau erst zu einem/r solchen
werden läßt....... Ganz wichtig ist dabei das Wort ’Elite’;
- Die USA insistieren in befremdlicher Arroganz auf ihrer Ausnahmeposition, was ihnen nach
eigener Überzeugung das Recht einräumt, sich jeder internationalen Konvention zu verwei-
gern, die mit jedweden Nachteilen für die eigene Wirtschaft und seine BürgerInnen - in
exakt dieser Reihenfolge - verbunden sein könnte. Ob es sich dabei um den Internationalen
Strafgerichtshof, Zoll-, Subventions- oder Handelsabkommen, die Menschenrechte oder
internationale Statuierungen sonstiger Art handelt, spielt keine Rolle; „America comes
first“ – notfalls bleiben die USA ihre Beiträge schuldig;
- Ihre Rolle als Weltpolizist und einzig berechtigte Entscheidungsinstanz leiten die USA aus
ihrem Selbstverständnis als maßgebender Förderer der Demokratie ab - aus einer 200 Jahre
alten, eurozentristischen Perspektive. Hingegen sehen Dutzende von Staaten Lateinamerikas
und Asiens, zunehmend auch der Karibik und Afrikas den “Weltpolizisten“ vor allem als
gnadenlosen Plünderer. Gore Vidal listet in seinem Buch „Ewiger Krieg für ewigen
Frieden“ (S.26 –39) alleine zwischen 1948 und 1999 mehr als 200 Einsätze von US-
Truppen in Vorderasien, Südosteuropa, Mittel-/Südamerika und Afrika auf, die vielfach bis
heute andauern, und zur Sicherung US-amerikanischer Belange in militär- und wirtschafts-
strategischer Hinsicht sind die USA inzwischen in über 100 Ländern dauerhaft präsent –
notfalls auch gegen den Willen der betroffenen Länder! Deren Rechte zählen für ‚Uncle
Sam’ ebenso wenig wie deren Bedürfnisse. „We sacrifice ourselves and the lifes of our kids
(! - gemeint sind die Stationierungstruppen) for the rest of the world, and get nothing but
ingraditude!“, schimpfte kürzlich einer meiner US-Bekannten, und er meinte das ernst.
Dabei ist den US-Bürgern nur schwer zu vermitteln, daß oftmals erst ihr Eingreifen das
Problem schuf, bzw. bestehende eskalieren ließ. Man denke hierbei an die Terrorregime
in Argentinien, Uruguay, Chile, Indonesien, Korea, Paraguay, Guatemala, Bolivien,
Honduras, Nicaragua u.v.m., den ‘CONDOR’- Plan der US-Geheimdienste, mithilfe
derer Massenmörder vom Schlage eines Pinochet und Noriega, Videla und Stroessner,
Savimbi, Mobutu und auch Saddam Hussein - jeweils solange sie für die USA zum
Vorteil agierten - in wahrlich höchst undemokratischer Weise aber zur Interessens-
wahrung der USA an der Macht gehalten wurden. An dieser grundsätzlichen Hybris hat sich
auch unter Bush sen., Clinton und Baby-Bush nicht das mindeste geändert;
- Kaum ein US-Amerikaner weiß, dass es sich bei der ‚School of the Americas’ (Fort
Benning, Georgia) tatsächlich um eine zentrale Ausbildungsstätte für terroristische Einsätze
lateinamerikanischer Militärs – geschützt, organisiert und finanziert von CIA und NSA (u.a.
aus Drogengeldern und gegen Geheimverträge) - handelte;
- Denken Sie an die an Arroganz und Größenwahn nicht mehr zu überbietende Äußerung des
Vorzeige-Fürthers und ‚Friedens’(!)-Nobelpreisträgers Kissinger, der den von den USA
(resp. ihm) initiierten Sturz des demokratisch gewählten chilenischen Präsidenten Allende
mit dem Satz ’verteidigte’: „Ich sehe nicht ein, warum wir untätig zuschauen sollen, wie
ein Land kommunistisch wird wegen der Verantwortungslosigkeit des eigenen Volkes“;
- Seit 1973 sank das Einkommen von zwei Drittel der US-Bevölkerung dramatisch. Daran
änderten auch die Boom-Jahre (1995 und ’99) wenig. Würden nicht die Kommunen und
eine beispiellose Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe das Schlimmste verhindern, stiege
die Zahl der Diebstähle und Raubdelikte noch wesentlich und große Teile der USA gewär-
tigten längst Übergriffe und bürgerkriegsähnliche Zustände.
Doch all das besorgt Washington und seine Leitfiguren wenig – die Illuminaten schon gar
nicht. Die US-Finanzwirtschaft vertraut auf seine Kredibilität im Ausland und verschuldet
sich eben weiter - zur ’Auslandsverschuldung’ verweigert Washington seit 20 Jahren jede
Auskunft(!).
So wie erst das Eingreifen des Menschen in die Natur und das ökologische Gleich-
gewicht in Fauna und Flora der Erde die Notwendigkeit von Korrekturen schuf, so
werden heute Völker und Ethnien, weltliche wie geistige Kulturgemeinschaften ihrer
Lebensgrundlage und originären Identität beraubt, vergewaltigt und mit dem „Recht“
des Stärkeren durcheinandergewürfelt und destabilisiert, gegeneinander ausgespielt
und verfeindlicht.
Wie verlogen und heuchlerisch die Haltung der US-Regierung in vielen Bereichen der Politik, wie löcherig der nach außen bekundete Moralkatalog ist, erfahren US-Bürger allenfalls, wenn sie - für viele ein einmaliges, oftmals einerseits großartiges, andererseits schockierendes Erlebnis in ihrem Leben - nach Europa reisen. Manche flüchten entsetzt, andere reisen nachdenklich zurück in die USA, nur wenige hingegen durchdringen den Kern der Kluft zwischen dem ‚Alten Europa’ und dem schier ‚forever young America’. ’Big’, neben ’business’ und ’beautiful’ die Zauberworte der US-amerikanischen Alternativkultur, hat seinen Preis:
- Die USA sind das einzige Land der OECD, in dem die Bevölkerung heute länger arbeitet
als vor 30 Jahren; der Analphabetismus steigt; das sowohl von der ILO [5] als auch der UN-
Menschenrechts-Charta postulierte Streikrecht sowie das Recht auf gewerkschaftliche
Organisation sind faktisch nicht mehr existent; mithilfe des ‚Homeland Security Act’ und
des TIA [6] - Computersystems sind - völlig nach Belieben der Geheimdienste - selbst durch
die Verfassung garantierte Basis-Rechte außer Kraft gesetzt. Den meisten US-Bürgern ist
nicht im entferntesten klar, daß sie bereits längst in einem nahezu perfekten Polizei- und
Überwachungsstaat leben, der ohne ihre weltfremde Reduzierung des Lebens auf ‚family,
fun and french-fries [7] ’, ‘business, big and beautiful’ und einen fanatischen ’Hurra’-Patrio-
tismus gar nicht überleben könnte.;
- Mehr als 5% der US-Bevölkerung sitzt in Gefängnissen - einsamer Weltrekord, an den
nicht einmal Rußland unter Stalin heranreichte. Nur: Mehr als 70% dieser Insassen sind
Farbige, obwohl die Weißen mehr als 75% der Bevölkerung stellen!
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Wir Europäer haben keinen Grund, überheblich auf ’die Amerikaner’ herabzublicken! Die Geschichtsbücher sind gespickt mit Grausamkeiten europäischer Machart - den Möglichkeiten der damaligen Zeit entsprechend. Fanatischer Nationalismus, menschenverachtende Grausamkeit und Befriedigung egoistischer Interessen, Genozide und bedenkenloses Ausnützen eigener militärischer Überlegenheit sind beileibe keine Erfindung der USA. Aber hätten wir nicht eher und ehrlicher den USA in den Arm fallen, den Mund aufmachen und Einhalt gebieten sollen, statt die Zeichen an der Wand zur Wahrung eigener Vorteile zu übersehen?
Und nun zurück zum Irak-Krieg
Kann es unter diesen Umständen noch groß verwundern, daß ein durch Wahlbetrug von den Illuminaten und bestem Protegement ins Amt gehievter Karrieresäufer mit bedenkenlos dümmlichem Gesicht und ohne jeglichen Horizont (außer dem ihm suggerierten) salbadernder Präsident eine ganze Nation einlullen und derart infam hinters Licht führen kann?
Viel verwunderlicher scheint mir, wie (erfreulich) viele - hauptsächlich junge - Menschen in den USA sich dieser genuinen Volksverblödung widersetzen, auch wenn sie wohl nicht bis ins Letzte ermessen können, welch infame Korruption tatsächlich hinter diesem „Kampf gegen das Böse“, der „Friedenshilfe für den Iran“ und dem Bush’igen „Kreuzzug“ steckt.
Bush sen. konnte vor 12 Jahren - das dürfte ihn heute noch wurmen - durch selbst für die Illuminaten unvorhersehbare Umstände sein schon damals hinterhältig inszeniertes Werk nicht vollenden. Seither hat sich Husseins Charakter und seine Gewaltherrschaft in nichts gewandelt, aber die Begleitumstände veränderten sich massiv. Der 11. September 2001 bot den Illuminaten die einmalige Chance, den Plan „tabula rasa americanensis causa“ ins Werk zu setzen. Aber die Zeit drängte, das Entsetzen über die Anschläge in New York würde nicht ewig anhalten. Mithin galt es, eine einigermaßen sinnimplizierende ‚Brücke’ zwischen Bin Laden, einem den USA fiktiv gefährlichen Terrorismus nicht-amerikanischer Bauart, einen Feindersatz für die plötzlich befreundeten Russen und Chinesen sowie den verirrten Moslems, von denen man bereits etwa vier Millionen im eigenen Staatsgebiet hatte, zu finden.
Daß Hussein geradezu ein Erzfeind Bin Ladens ist, die Bushs und Cheneys mit den Saudis (und Bin Ladens) fröhlich Geschäfte treiben und u.a. auch über Firmen in Kanada, Südafrika, den USA, Belgien und Großbritannien mehr als ein Dutzend Länder in Schwarzafrika sowie halb Lateinamerika gemeinsam gnadenlos ausbeuten, weiß ohnehin kaum einer seiner Landsleute. Dafür sorgen schon die ausschließlich auf Unterhaltung getrimmten Medien in Bush-Country (meine US-Freunde sind regelmäßig überrascht, wie unterschiedlich CNN-Programme in den USA und in Europa sind).
Eben weil man nicht mehr allzu lange die ’9-11’-Katastrophe als Handlungsargument hätte ge-/mißbrauchen können, mußte Baby-Bush - das war er Papa-Bush und seinen ‚Wahlhelfern’ schuldig - jetzt zur Tat schreiten. Legal oder illegal - völlig egal!
Was sollten die UN und der nur auf Druck der USA wiedergewählte Kofi Annan schon groß unternehmen? Dem deutschen Berufswendehals Schröder und seinem pseudogrünen Schaukastenrevoluzzer Fischer würde man, schon um Chirac zu ärgern, vielleicht später den Friedensnobelpreis zuerkennen - als Beweis dafür, daß es ja auch den USA nur um Frieden ging. Dann ist auch da wieder alles im Lot.
Doch das Ganze, so fein es gesponnen ist, hat einen gefährlichen Webfehler: Spätestens jetzt, nach dem unglaublich arroganten Übergriff der USA - entgegen Chapter VII der UN-Charta und ohne den geringsten Beweis einer Verbindung zur Al Quaida - sind die Gräben wieder aufgerissen, aus denen vor knapp 1.000 Jahren der Odem dünstete, der Europa und dem Vorderen Orient das bis dahin schlimmste Völkermorden und sieben Kreuzzüge - alles im Namen, zum Ruhme und zur Ehre eines gemeinsamen Gottes (!) - bescherte. Die Raketen vom 20.März 2003 waren die Ouvertüre zu einem ‚Kampf der religiösen und weltlichen Überzeugungen’, wie er ideologischer, haßdurchsetzter und bedenkenlos-unmenschlicher nicht sein kann. In dieses mutwillig konzipierte ‚Gebräu’ fanatischen Ideologismus’ werden nicht Staaten, sondern aufgestachelte und schwülstigen Jenseits-Phantasien huldigende Gruppen unterschiedlichster Prägung ihre ‚Überzeugungen’ kippen und in grenzenloser Brutalität ihre Bataillone opfern. Selbst sich ansonsten feindlich gesinnte Gruppen - Schiiten/Sunniten, pro-westliche/islamistisch-anti-westliche Fundamentalisten, religiös/ laizistisch-orientierte Staaten und Volksgruppen - könnten angesichts des selbstherrlichen Überfalls der USA und ihrer Verbündeten nunmehr zueinander finden.
„Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, sagt ein arabisches Sprichwort, und unter diesem Aspekt könnte sich im Nachhinein als wahr erweisen, was die Bushisten bereits bislang - völlig unsinnig, aber in der Hoffnung auf die gläubige Unwissenheit ihrer Landsleute - seit Monaten behaupten: Die Baath-Partei könnte jetzt sogar zur Zusammen-arbeit mit Al Quaida und anderen religiösen Splittergruppen und Fanatikern bereit stehen.
Natürlich ging es weder SchrödFischer noch Chirac und Putin um menschliche Zugewandtheit und humanitäre Überzeugungen. Putin und Chirac wollten zum einen langfristige Öl-Lieferverträge mit Hussein nicht gefährden und haben beide viel zu viele Moslems in ihren Staatsgebieten, als daß sie sich einen massiven Konflikt mit der arabischen Welt und dem Irak erlauben dürfen, und die SchrödFischers handelten aus schierer Machterhaltungsgier. Aber das entschuldigt in keiner Weise das impertinente Vorgehen der Rambos um Bush und die menschenverachtende Raffgier der Illuminaten hinter ihnen.
Das Ausmaß der historischen Katastrophe, die uns der nicht nur wahrscheinlich dümmste, sondern vielleicht mörderischste Präsident der USA eingebrockt hat - im Verbund mit (vor allem im Westen) gefährlich zugespitzten Parteiensystemen und den diese repräsentierenden Politikern -, könnte uns an den Rand einer globalen Katastrophe führen, die uns über Börsencrashes, galoppierende Arbeitslosenzahlen und kollabierende „Sozial“systeme beinahe wehmütig hüsteln lassen dürfte.
Mag die Türkei nun eine Chance wittern, sich einen Teil des Nord-Irak (Kurdistan, seit 1991 nahezu autonom) einzuverleiben, ihr seit Jahrzehnten schwelendes Kurdenproblem - per Genozid! - zu lösen und sich gleichzeitig bei den USA für neue Kredite anzubiedern; mögen die Engländer sich einmal mehr als US-treue Vasallen erweisen und den Geist längst verflos-sener Zeiten eines weltumspannenden ’United Kingdom’ zu reanimieren versuchen; mögen US-Strategen und Rüstungskonzerne dankbar die Chance nutzen, ihre neuen Waffensysteme ’in combat und live’ zu erproben, wiederum Milliarden einzustreichen - auch der Irak-Krieg 1991 bescherte der Rüstungs- und der Ölindustrie zweistellige Milliardengewinne -, der Welt den wahren Meister zu zeigen und das ’Vietnam-Trauma’ endlich besiegen -wir stehen am Vorabend eines Weltbrandes völlig neuen Zuschnittes, dem der Westen, insbesondere die High-Tech-verliebten US-Amerikaner und Briten völlig fassungs- und hilflos gegenüber-stehen werden. Hier helfen keine bis zur Idiotie hochgerüsteten Armeen und Geheimdienste, und selbst die europäischen Erfahrungen mit Terrororganisationen wie der RAF, der ETA, den Roten Brigaden und der IRA werden CIA und ISI, MI und BND nichts nützen. Baby-Bush ist mit einer nur mit seinem Mangel an Intelligenz entschuldbaren Instinktlosigkeit über die Gefühle einer ganzen Gruppe von Ethnien hinwegmarschiert, nur um endlich Papis Raubzug zu vollenden und sich in die Geschichtsbücher künftiger High-School-Generationen zu mogeln. Doch welchen Preis werden seine Landsleute und wir alle, die wir auf 2.500 Jahre westlicher Kultur in griechisch geprägter humanistischer Tradition so überheblich stolz sein zu dürfen glauben, für diesen hybriden Wahnsinn zahlen dürfen.
Mit Staatsterror gegenüber dem Rest der Welt und unliebsamen Nationen - und hierum handelt es sich – ist weder der Terror zu besiegen, noch sind die innerhalb des kranken ’Körpers’ United States of America schwelenden Metastasen auf Dauer zu kaschieren. Die USA haben einen schier uneinholbaren Vorsprung in nahezu allen Belangen eines modernen, auf die Bedürfnisse der Zukunft ausgelegten Staates. Doch das Bild trügt, und wer sich die großen Reiche der letzten 5.000 Jahre, deren unerschütterlichen Glauben an die eigene Ewigkeit und den letztlich doch einsetzenden Zusammenbruch (oftmals binnen weniger Monate und Jahre) vor Augen hält, könnte erhebliche Schlafstörungen bekommen. Nur wird der Zusammenbruch dieser Mega-Hybris jeden bisherigen Kollaps eines Weltreiches in den Schatten stellen und äußerst schmerzhaft werden - nicht nur für 280 Millionen US-Ameri-kaner, sondern für Milliarden Menschen weltweit. Ihre trojanischen Pferde haben die USA längst zur Tür hereingelassen. Die weiden - noch unerkannt – auf herrlichen Savannen........
Noch nie hätte ich mich lieber geirrt, als heute.
Hans-Wolff Graf
zeitreport-online März 2003
Vom „Krieg für Freiheit und Frieden“
– und anderen Lügen
Der 2. Golfkrieg (historisch korrekt eigentlich der 3. der Neuzeit) begann am 20. März 2003, kurz nach 3:30 (MEZ) mit einem ‚Enthauptungsschlag’ durch zwei Raketen in einen der drei großen (von über 70) Präsidentenpaläste Saddam Husseins. Soweit die nüchternen Tatsachen.
Vorausgegangen waren diesem Moment Monate der Verhandlungen, innerhalb derer keine Lüge gescheut, keine Drohung unausgesprochen blieb. In dieses Verwirrspiel, das Buhlen um Zustimmung in den einzelnen Ländern wie auch in den internationalen Gremien und gegen-seitige Schuldvorwürfe ließen sich speziell die Medien wunderbar einflechten - sei es, um im Kampf um Marktanteile, Einschaltquoten, Sendeplätze und (damit) Werbequoten Boden gegenüber der Konkurrenz gutzumachen, sei es, um der eigenen Regierung und konkurrie-renden Parteien Bonuspunkte im In- und Ausland zu sichern oder Wahlen zu beeinflussen. Das Manipulations- und Korruptionskartell feierte fröhliche Urständ.
Selbstverständlich bedienten sich dazu alle - Politiker wie Medien - des gesamten Arsenals euphemistischer Begriffe und heroischer „Werte“, um das eigene Vorgehen zu rechtfertigen und den Gegner zu desavouieren. Selbst gut informierte BürgerInnen sahen sich flugs einem schier undurchdringlichen Geflecht von implizierten Tatsachen, Widersprüchen und Vermutungen gegenüber, aus denen es galt, sich eine eigene Meinung zu bilden, Wahrheit von Fiktion zu trennen, um daraus einen Standpunkt zu generieren. Die meisten hingegen resignierten früher oder später; sie übernahmen den von der Mehrheit vertretenen „Standpunkt“, opferten dem nationalen Gemeinschafts“gefühl“ eigenes Denkfühlen oder schotteten sich von jeglichem Standpunkt ab, steckten also den Kopf nur noch ängstlich in den ‚Sand’ - in der Hoffnung, daß sich das dräuende Gewölk unverständlicher (aber sehr wohl empfundener) Gefahr bald verzöge. Andere wiederum vergewisserten sich durch einen Blick in den Atlas, daß der Irak rund 5.000 km entfernt ist, eine unmittelbare Gefahr also mutmaßlich nicht gegeben sei.
Doch diese Ansicht - so dienlich sie den Kontrahenten und Beteiligten ist - könnte sich schon bald als höchst fatal erweisen. Dies wollen wir im folgenden näher beleuchten, denn das Ende des am 20. März begonnenen Golfkriegs ist der Beginn einer Aera völlig neuer Konflikte.
Der Ursprung des 2. Irakkrieges....
..liegt in einem nie abgeschlossenen 1. Irakkrieg (1991) und dessen bis heute nicht gelösten Problemen, zu denen sich in den letzten 12 Jahren nur noch ein Kranz weiterer hinzugesellte.
a) Diente der irakische Präsident bei den Auseinandersetzungen der USA mit dem Iran (nach
dem Sturz des Schah, mit dem die USA trefflich und zu beiderseitigem Vorteil kollabo-
rierten) noch als verläßlicher und deshalb zuvorkommend - mit Waffen und Krediten -
unterstützter Partner (obwohl er bereits damals ein brutales Regime führte), so lief eben
jener Hussein - in Verkennung der veränderten Weltlage und seines gesunkenen Wertes für
seine Gönner, die USA - ungeplant aus dem Ruder, zeigte sich zunehmend egoman, ja
geradezu unverschämt; er forderte eine Autarkie und Autonomie ein, die ihm die USA nie
und nimmer gewähren wollten. Vor allem Husseins Rolle als zweitgrößter Erdölförderer
(nach dem Nachbarn Saudi Arabien) und Besitzer der ergiebigsten (bis heute bekannten)
Erdgaslager ergrimmte den mit Abstand größten Energieverbraucher, die USA, zunehmend.
b) Hussein, Führer der nicht-islamischen Baath-Partei und Herrscher über das einzige
laizistische Land im Vorderen Orient, kam den USA, die den aufkeimenden fundamen-
talistischen Strömungen (nicht nur, aber vor allem im arabischen Raum) - insbesondere
mit Blick auf das wirtschaftlich am Tropf hängende Israel - gut zupaß. Hinzu kam die
(berechtigte) Sorge der USA, daß im Zuge der Renaissance des Islam auch der ’Traum-
partner’ Saudi Arabien, ein mittelalterlicher Feudalstaat, in dem 0,12% der rund 21 Mill.
Einwohner (allsamt Angehörige des Königshauses) über 95% des gesamten Reichtums des
Landes verfügt, ein zunehmend unsicherer Kandidat zu werden drohte. Unpäßlich für
Hussein kam auch der Zusammenbruch des Sozialismus und der Sowjetunion, womit sich
der strategische Wert des Irak für die USA erübrigte. Hier verpokerte sich der irakische
Diktator schlicht.
Die wachsende EU, ihre Tendenz, sich im Osten neue Mitglieder einzuverleiben, eine sich überlebende NATO, eine (weltweite, seit 1989) negative Energie-Rohstoffbilanz, der aufkeimende Islamismus und die Tatsache, daß die USA sich energiemäßig abzusichern trachteten, gebar nun in den Köpfen der Schöpfer der TWP [1] , der Folgeorganisation des MAI [2] (siehe hierzu: http://www.dbsfs.de/download/mai.doc ) - hinter beiden ‚Vereinen’ stecken die großen internationalen Finanzfamilien - einen genialen Plan: Gelänge es, den Drang der asiatischen (teil)autonomen Republiken der ehemaligen UdSSR nach Autonomie für die USA dienlich zu fördern und diese wirtschaftlich (und durch Waffenlieferungen!) zu stärken - also von der ungeliebten ‚Mutter’ Rußland abzunabeln -, könnte man ein direktes Versorgungs- und Transportnetz durch den zentralasiatischen Raum aufbauen. Unter der Kontrolle der großen US-Ölmultis stehend, würde es die USA ihres Energieversorgungsproblems entheben. Zudem könnt es deren Einfluß - nota bene im Hinblick auf das ungeliebte OPEC-Kartell und die sich schamlos ausbreitende, zunehmend mit dem Osten (= ehemaliges ‚Reich des Bösen’
 fraternisierende EU - sichern und den wahren Herrscher der Welt, die USA, strategisch bestens positionieren.
fraternisierende EU - sichern und den wahren Herrscher der Welt, die USA, strategisch bestens positionieren. Bei diesen Überlegungen stand auch der Gedanke Pate, daß die kommende Wirtschafts-, Industrie- und Konsumnation Nr 1, China, sowie der noch im Dornröschenschlaf dämmernde indische Subkontinent (mit seinem schwelenden Konfliktpotential Pakistan/Indien) früher oder später die ihnen bevölkerungsmäßig zustehende Rolle im Weltkarussell beanspruchen würden. Dem galt es, wollte man den globalen Herrschaftsanspruch der USA sichern, frühzeitig und höchst vorsorglich - mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden(!) - Rechnung zu tragen. Hier geht es nämlich nicht mehr um Milliarden, sondern um Billionen und die Sicherung einer Jahrhundertstrategie, deren Wirkungsparameter in sämtliche Bereiche ragen: Energie- und Kreditwirtschaft, Waffen- und Rüstungsindustrie, Freizeit, Medien und Tourismus, Forschung und Entwicklung, Medizin und Pharmaindustrie, also Produktion-, Distribution und Konsum - kurz: alle, das Leben von demnächst 8 bis 9 Milliarden Menschen betreffende Belange und die Festigung eines vielleicht nie wieder einzuholenden, heute bestehenden Vorsprungs der restverbliebenen Supermacht USA.
Die weltweite Korruption der Illuminaten.
Die ‚Illuminaten’ (lat. für ‚die Erleuchteten’
 sind ein ’elitärer’ Kreis höchst klandestin verwobener Finanzoligarchen, die - sehr hierarchisch sortiert - als die wahren Strippenzieher in sämtlichen relevanten Feldern die Macht kontrollieren. Dies gilt beileibe nicht nur für so profane Dinge wie Großkonzerne in der Industrie, der Medien- und Finanzwirtschaft, dem Pharmazie-, Transport-, Logistik- und Rüstungswesen, vielmehr unterhalten sie - über entsprechende Vereinigungen, Bruderschaften und Institute - beste Kontakte zu weltlichen und geistlichen Organisationen. Sie füttern, wie dereinst die Fugger und andere Geldfürsten, die ihnen genehmen Personen und Organisationen, die durch sie oftmals überhaupt erst an die Spitze von Konzernen, politischen Parteien und Machtpositionen aller Art gelangen. Dafür unterhalten sie Stiftungen und Eliteuniversitäten, ’Kultur’zentren und Museen. Sie vergeben Stipendien und finanzieren Karrieren, sie subventionieren patriotische Vereine und pflegen einen intimen Korpsgeist, in den aufgenommen zu werden schon eine Art Karrieregarantie darstellt. Zentralen dieser Illuminaten sind die Eliteschulen und -universitäten der US-Ostküste, Englands und der Niederlande, aber auch die französische ENA, aus deren Kreis nahezu alle Spitzen der französischen Wirtschaft und Politik kommen (und seit mehr als 100 Jahren kamen). Diesen Illuminaten verdanken wir die ‚Transatlantische Brücke’, das ‚CFR [3] ’, die ‚Bilderberger’, den ‚Ritterorden vom heiligen Grabe zu Jerusalem’ und Hun-derte weiterer Vereinigungen unterschiedlichster Art, den EZB-Präse Duisenberg ebenso wie Altmeister Kohl und die Herren Kissinger und Cheney, Rumsfeld und Mrs. Rice, um nur ein paar zu nennen.
sind ein ’elitärer’ Kreis höchst klandestin verwobener Finanzoligarchen, die - sehr hierarchisch sortiert - als die wahren Strippenzieher in sämtlichen relevanten Feldern die Macht kontrollieren. Dies gilt beileibe nicht nur für so profane Dinge wie Großkonzerne in der Industrie, der Medien- und Finanzwirtschaft, dem Pharmazie-, Transport-, Logistik- und Rüstungswesen, vielmehr unterhalten sie - über entsprechende Vereinigungen, Bruderschaften und Institute - beste Kontakte zu weltlichen und geistlichen Organisationen. Sie füttern, wie dereinst die Fugger und andere Geldfürsten, die ihnen genehmen Personen und Organisationen, die durch sie oftmals überhaupt erst an die Spitze von Konzernen, politischen Parteien und Machtpositionen aller Art gelangen. Dafür unterhalten sie Stiftungen und Eliteuniversitäten, ’Kultur’zentren und Museen. Sie vergeben Stipendien und finanzieren Karrieren, sie subventionieren patriotische Vereine und pflegen einen intimen Korpsgeist, in den aufgenommen zu werden schon eine Art Karrieregarantie darstellt. Zentralen dieser Illuminaten sind die Eliteschulen und -universitäten der US-Ostküste, Englands und der Niederlande, aber auch die französische ENA, aus deren Kreis nahezu alle Spitzen der französischen Wirtschaft und Politik kommen (und seit mehr als 100 Jahren kamen). Diesen Illuminaten verdanken wir die ‚Transatlantische Brücke’, das ‚CFR [3] ’, die ‚Bilderberger’, den ‚Ritterorden vom heiligen Grabe zu Jerusalem’ und Hun-derte weiterer Vereinigungen unterschiedlichster Art, den EZB-Präse Duisenberg ebenso wie Altmeister Kohl und die Herren Kissinger und Cheney, Rumsfeld und Mrs. Rice, um nur ein paar zu nennen.Diese Kamerilla, intern bisweilen höchst eifersüchtig, aber im Geiste geteilter Gier höchst kooperativ, besetzt in weltlichen - politischen und militärischen, bildungs- und medienrelevanten, geheimdienstlichen und juristischen -, strategisch wichtigen Belangen alle Spitzenpositionen mit höchst willigen (ergo: abhängigen) Figuren, die nach außen den kecken Harlekin abgeben, in Wahrheit aber billige Befehlsempfänger sind. Warum sollten sich die Strippenzieher auch den Tort antun, sich den neugierigen Fragen und der Häme, Wut und Unbill der Massen auszusetzen, sich in der Nichtigkeit des öffentlichen Lebens zur Schau zu stellen? Das überlassen sie der Eitelkeit von Selbstdarstellern aus Politik und Pop, den Popanzen der ‚Prominenz’ aus Kultur, der glamourösen Welt der Stars und Starlets.
Natürlich ist die Masse zumeist viel zu sehr mit der Wahrung ihres Lebensstandards, dem Erhalt des Jobs, der Aufzucht, Hege und Pflege der Nachkommenschaft, dem eigenen Rentenanspruch und den familieninternen Problemen beschäftigt, als daß sie über die immer komplexer werdende Welt insgesamt nachdenkt. Aber ein paar Querulanten gibt’s immer wieder, die sich den Luxus zeitaufwendigen Hinterfragens und unbotmäßiger Neugier erlauben, die nach Erklärungen lugen und verstehen wollen, was hinter den - im großen und ganzen geschickt verschobenen - Kulissen läuft.
Zur Abwehr dieser Querdenker, Nörgler und Fragensteller genügte es vollkommen, den verlächerlichenden Begriff vom ‚Weltverschwörertum’ zu kreieren. Damit stellt man diese Unbequemlinge ins Abseits und an den Pranger - zur allgemeinen Belustigung freigegeben - und bietet dem leicht verunsicherten Mitglied der breiten Masse eine willkommene (weil bequeme) Entschuldigung (vor sich selbst), tunlichst wieder in alltägliche Gewohnheitlichkeit zurückzukehren (‚Drei-Affen-Prinzip’: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen), geistig wie seelisch die „Türen“ und „Fenster“ vor Unliebsamkeiten zu verrammeln, die stören, verun-sichern und beunruhigen könnten. Wer wirklich Näheres hierzu erfahren möchte, natürliche Neugier nicht ins Korsett der Bequemlichkeit zwängen möchte, dem sei das anno 2000 im Fouque-Verlag erschienene Buch „Korruption – die Entschlüsselung eines universellen Phänomens“ anempfohlen.
USA – ideales Spielfeld der Illuminaten.
Kein anderes Land ist als Nährboden und Spielwiese für die Illuminaten, die ja irgendwo auch eine physische Zentrale unterhalten müssen, besser geeignet, als die ’Vereinigten Staaten von Amerika’. Das hat vielfältige Gründe (sh: „Die USA – der Anfang vom Ende“, abrufbar unter www.dbsfs.de), fußt aber vor allem auf einem seit mehr als 200 Jahren wie in keinem anderen Land gepflegten calvinistischen Praedestinationsglauben, demzufolge - auf den protestantischen Reformer Calvin zurückgehend - der christliche Gott denjenigen bereits zu Lebzeiten besonders begünstigt, den er favorisiert; anders ausgedrückt: Irdischer Reichtum, weltliche Wohltat und Besonderheit - Reichtum, Gesundheit, Ehre und Ruhm sowie sonstiges Wohlergehen - sind augenfälliger Beweis göttlicher Bevorzugung und mithin keineswegs verwerflich. Genau hierin liegt die tiefere Ursache für den in den USA so hemmungslos (und für „gesittete“, kulturell europäisch geprägte Menschen geradezu dümmlich) zur Ikone stilisierten Gigantismus, die Hybris eines weltweit teils bewunderten, teils verachteten Größenwahns US-amerikanischer Prägung. Reichtum und dessen Zurschaustellung ist oberste Bürgerpflicht und schlagender Beweis göttlicherseits gewährter Besonderheit. „Money is what really counts, brother!“
Lebensgenuß und -freude [sinnstiftender Beweis göttlicher Auserwähltheit („God’s own country“
 ] wurden - nicht frei von Häme gegenüber dem zersplitterten, vom Zweikampf der beiden Konfessionen und hundertfachen weltlichen Diadochenkämpfen gebeutelten Europa -
] wurden - nicht frei von Häme gegenüber dem zersplitterten, vom Zweikampf der beiden Konfessionen und hundertfachen weltlichen Diadochenkämpfen gebeutelten Europa -zur ‚benchmark’ irdischer Lebenskunst erhoben, der sich zu unterwerfen kleinen US-Amerikanern bereits mit der Muttermilch (später mithilfe des in fast jedem Zimmer stehenden Fernsehers) verabreicht wird: „You got to be beautiful and rich! If you can’t make it – tough luck!“ Auf diesen verkürzten Nenner kann - Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel - das generelle Selbstverständnis des US-Amerikaners subsummiert werden.
Doch das alleine ergäbe eine zu fade ‘Suppe’. Man garniere das Ganze noch mit jeder Menge Religiosität, einem alles verbindenden Korpsgeist (vulgo: alles überschattender, irrealer, bisweilen schon faschistisch anmutender Nationalismus), viel Patriotismus, einer sehr einseitigen Eroberungsmythologie der ‚Neuen Welt’ (dargestellt in bisweilen regelrecht putzigen „Museen“, die selbst im kleinsten Dorf zu finden sind), gegen den sich die heute in Reservate zwangsumgesiedelten Indianer nie wehren konnten, dem generellen unerschütter-lichen Maximalanspruch (’American’ steht generell für „the world’s best/finest/greatest.....“
 - psychologisch interpretiert: ein seit der ersten Einwanderungswelle sorgsam gepflegter Trennungshaß gegenüber dem ‚Alten Kontinent’ - und einen geradezu kindlichen Glauben an die suggerierte Märchenwelt, schon hat man ein Volk ’konstruiert’, mit dem man virtuell, quasi ’in vitro’, alles ausprobieren kann, was dann in die Restwelt exportiert wird - notfalls auch zwangsweise. Die USA als gigantisches Labor für die perfekte Manipulation eines (zumeist) leicht lenkbaren Menschengeschlechts, des idealen Staatsbürgers der Zukunft. Heureka!
- psychologisch interpretiert: ein seit der ersten Einwanderungswelle sorgsam gepflegter Trennungshaß gegenüber dem ‚Alten Kontinent’ - und einen geradezu kindlichen Glauben an die suggerierte Märchenwelt, schon hat man ein Volk ’konstruiert’, mit dem man virtuell, quasi ’in vitro’, alles ausprobieren kann, was dann in die Restwelt exportiert wird - notfalls auch zwangsweise. Die USA als gigantisches Labor für die perfekte Manipulation eines (zumeist) leicht lenkbaren Menschengeschlechts, des idealen Staatsbürgers der Zukunft. Heureka!Erste Versuche, auch den ‚Restmenschen’ US-amerikanische Lebenskultur überzustülpen, boten sich den USA nach dem 2.Weltkrieg (Japan, Korea, Thailand, die Philippinen und Taiwan, Indonesien und Malaysia, Hongkong und Singapur, Lateinamerika, Südafrika, sukzessive auch Schwarzafrika und Mittelamerika, Deutschland, Österreich und - trotz bis heute spürbarer störrischer Gegenwehr - auch Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, die Benelux-Staaten und Skandinavien), nach dem Fall der Mauer auch in der ex-DDR, dann nach der Perestroika (1992) auch in Rußland, den baltischen Ländern sowie im ex-sozialistischen Osteuropa und nun zunehmend auch im früheren Rotchina. Die US-amerikanische ‚Mickey Mouse’-Kultur, der Hamburgerismus und das Cyber-Denken galoppieren, fröhliche Unbeschwertheit vermittelnd, durch den Rest der Welt. Wen kümmern da Umweltschutz und Ressourcen-orientierte Sorgsamkeit?! „Everything is possible – we’ll show you“!
Nota bene: Der bereits unter Bush sen. agierende Paul Wolfowitz dürfte heute der mächtigste Verbindungsmann zwischen der Bush-Administration und den Illuminaten sein.
Der Preis des Größenwahns
Kein Besucher der USA, den nicht das Land selbst, mit seinen einzigartigen Naturschönhei-ten, seiner Flora und Fauna, begeistert hätte; keiner, der nicht die Bombastik der Millionen-städte bestaunt, die phänomenale Gastfreundlichkeit der US-Amerikaner und die ‚Leichtig-keit’ des ‚American Way of Life’ registriert hätte. Doch wer etwas länger und genauer hinsieht, registriert auch das krasse Mißverhältnis zwischen dem Anspruch einer Supermacht, dem Rest der Welt den Weg zu weisen, und der sich erst bei zweitem Hinsehen offenbarenden Realität. Unglaubliches Schwelgen in Reichtum, Sattheit und Überfluß geht einher mit einer sprunghaft steigenden Armut – speziell in den Slums der Metropolen und hier speziell bei nicht-kaukasischen Einwohnern. Nirgendwo weltweit wird mit natürlichen Ressourcen und Energie derart verschwenderisch geaast, so bedenkenlos die belebte und unbelebte Natur menschlicher Hybris - ausschließlich nach den Prinzipien von Nützlichkeit und Bequemlichkeit - geopfert, wie in den USA. Was Umsatz, Wohlstand (für genügend Kaufkräftige), Wachstum und Gewinn verspricht, wird realisiert - Hauptsache, es dient der Unterhaltung, regt an, ist neu, verspielt und glitzert. Wer sich das eine oder andere nicht leisten kann, ist selber schuld (Calvin läßt grüßen). Eltern verschulden sich bis unter die Augen, um den „gesellschaftlichen Voraussetzungen“, die vor allem Werbung und Medien in die Kinderzimmer tragen, zu genügen. „Be part of it“ bestimmt den Rhythmus der Erziehung, des Gemeinschaftslebens - privat und im öffentlichen Leben. „Life is a party, and you better join in“ gilt als Richtmaß - für Familien und Kommunen jeder Größe. Kein Wunder, daß die USA seit Jahrzehnten völlig über ihre Verhältnisse leben. Die durchschnittliche Verschuldung der Privathaushalte, aber auch der Gemeinden und des Federal Government würde europäischen Bankern, die nach den Basel-II - Richtlinien schielen, den Atem stocken lassen, und die USA hätten nicht den Hauch einer Chance, der EU beizutreten.
Die öffentliche Gesamtverschuldung der USA liegt bei etwa 800% des Bruttoinlandsprodukts
(von derzeit ca 12 Billionen $), wobei der öffentl. Investitionsstau - allein beim Straßenbau sind dies nach internen Schätzungen etwa 1,8 Billionen $ - noch gar nicht eingerechnet ist. Die letzten drei Jahre haben Vermögenswerte auf Wertpapierbasis von etwa 2,65 Billionen $ vernichtet, hinzu kommen Pensionswerte von weiteren ca 1,3 Billionen $, die in den Bilanzen der Gesellschaften innerhalb der nächsten drei Jahre abgeschrieben werden müssen. Doch all dies tangiert die US-Amerikaner nur sehr peripher. Dann wird eben der Ruhestand um ein paar Jahre verschoben, ein zweiter oder dritter Job gesucht oder das Konto noch ein bißchen mehr überzogen und die Kreditkarte gezückt; notfalls packt man seine Siebensachen, verschwindet bei Nacht und Nebel - eine Meldepflicht nach europäischer Lesart gibt es in den USA nicht - und fängt irgendwo ganz neu an. Viele warten einfach auf den großen Durchbruch („There is always a new chance“
 , um dann bereitwillig zuzuschlagen („Sooner or later I’ll make it!“
, um dann bereitwillig zuzuschlagen („Sooner or later I’ll make it!“ . Dieser alles beiseite wischende Optimismus („Everything is possible!“
. Dieser alles beiseite wischende Optimismus („Everything is possible!“ läßt europäische ‚Realisten’ (speziell deutsche) nur noch den Kopf schütteln, ficht aber nur wenige US-citizens an. Selbst die gefährliche soziale Schieflage, das Fehlen eines auch nur vergleichbaren Sozialversicherungssystems, eine wachsende Armut in „God’s own country“ läßt das Gros der US-Bürger nicht an der Überlegenheit des eigenen Systems zweifeln. Wohl nirgendwo wird das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ derart brutal gelebt wie in den USA. Schon der eigene Stolz verbietet es, sich hilfesuchend an den Staat, ja selbst an die Gemeinde zu wenden, und der Regierung in Washington nebst ihren Ablegern traut man ohnehin nicht - was sich nicht zuletzt in der Wahlbeteiligung zur Präsidentschaft niederschlägt (ca 40 %). Hauptsache ist, man hält die Idee vom ‚American Dream’ aufrecht - dafür gibt’s Hollywood, Comics und Disneylands (in Jedermann zumut-barer Nähe) -, pflegt die familiäre Nähe und gute Beziehungen zu den Nachbarn, wahrt sein Recht auf die eigene Waffe und glaubt ganz fest an Amerikas Größe. Sport, Show und Superiorität (über den Rest der Welt) - was sollte einen rechten US-Amerikaner sonst groß kümmern?
läßt europäische ‚Realisten’ (speziell deutsche) nur noch den Kopf schütteln, ficht aber nur wenige US-citizens an. Selbst die gefährliche soziale Schieflage, das Fehlen eines auch nur vergleichbaren Sozialversicherungssystems, eine wachsende Armut in „God’s own country“ läßt das Gros der US-Bürger nicht an der Überlegenheit des eigenen Systems zweifeln. Wohl nirgendwo wird das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“ derart brutal gelebt wie in den USA. Schon der eigene Stolz verbietet es, sich hilfesuchend an den Staat, ja selbst an die Gemeinde zu wenden, und der Regierung in Washington nebst ihren Ablegern traut man ohnehin nicht - was sich nicht zuletzt in der Wahlbeteiligung zur Präsidentschaft niederschlägt (ca 40 %). Hauptsache ist, man hält die Idee vom ‚American Dream’ aufrecht - dafür gibt’s Hollywood, Comics und Disneylands (in Jedermann zumut-barer Nähe) -, pflegt die familiäre Nähe und gute Beziehungen zu den Nachbarn, wahrt sein Recht auf die eigene Waffe und glaubt ganz fest an Amerikas Größe. Sport, Show und Superiorität (über den Rest der Welt) - was sollte einen rechten US-Amerikaner sonst groß kümmern?Kein Wunder, daß 90% der US-Bürger überzeugt davon sind, daß ihr System das weltweit beste ist. Zur Schulausbildung selbst in Junior High Schools gehört nicht, das US-Lebens-prinzip in Frage zu stellen, sondern morgens den Eid auf die Fahne abzulegen. Um Zusammenhänge im Rest der Welt kümmern sich Johnny und Martha herzlich wenig.
- Wenn Bush dem Irak vorwirft, Massenvernichtungswaffen zu produzieren, trifft dies zwar
mutmaßlich zu, daß aber die USA mehr biologische, chemische und nukleare Massenver-
nichtungswaffen halten, als alle anderen Staaten der Welt zusammen, finden die US-Bürger
o.k. – quod licet jovi, non licet bovi!
- „Wer nicht unserer Meinung ist, ist unser Feind“ - das Gros der US-Bürger nickt sofort;
- Daß die USA weder das Kyoto- Protokoll noch die IACW [4] -Charta sowie Dutzende anderer
Abkommen zum Schutz gegen Umweltverschmutzung, Kindersterblichkeit, Hunger, den
Drogenhandel, die Beschneidung von Frauen, das Abholzen der Regenwälder, Walfang und
Energiemißbrauch etc. ratifizierten, stört in den USA wenig – „Whatever serves America’s
economy, is good for us“;
- Gegen eine UN-Resolution zu verstoßen, ist Bush Grund genug, den gesamten Irak an den
Pranger zu stellen; daß Israel sich um mehr als zwei Dutzend UN-Resolutionen keinen
Deut kümmert fällt für den braven US-Bürger nicht weiter ins Gewicht;
- Der Irak hat (vielleicht) schon die Atombombe – Aufschrei der Entrüstung. Nun ja, Israel
hat sie bereits seit etwa 10 Jahren und auch Nordkorea, Indien und Pakistan dürften sie be-
sitzen; immerhin sind die USA bislang die einzige Nation, die (bereits zweimal) die Atom-
bombe auch gegen Menschen eingesetzt haben, und gegen das Waffenarsenal der USA und
ihre pathologisch-paranoide Entwicklungsmanie immer fürchterlicherer Waffensysteme
wirkt der Rest der Welt wie ein Klub von Steinschleuderern;
- mit einem Rüstungs- und ‚Verteidigungs’-Budget von mehr als 600 Milliarden $ übertreffen
die USA die Etats der gesamten restlichen Welt addiert;
- Allein das US-Marine Corps, eine der vier Streitkräfte der USA, übertrifft die Gesamtheit
aller europäischen Armeen, die Seestreitkräfte der USA alle Kriegsmarinen der Welt;
- Dank einer ausgefeilten Medien- und Desinformationstaktik endet das Weltbild der meisten
US-Amerikaner unmittelbar an den Grenzen Nordamerikas – allenfalls um Kanada, Mexico
und Hawaii ergänzt. Informationen drehen sich zumeist um ‚local affairs’ und derart ist
auch der Bedeutungshorizont. Dahinter steckt Methode; je begrenzter die Sichtweise, desto
leichter fällt die Kontrolle und umso eher fällt auf, wer sich dem ‚local mainstream’ zu
entziehen versucht. Die Familie - neben ‚God’ und ‚America’ die wichtigste Größe im
Leben eines ‚Good American’ - als ausgelagerte Disziplinierungsinstanz des ‚Big Brother’,
gefolgt von den High Schools, Colleges und Universities, deren Renomée für US-citizens
ungleich bedeutsamer ist als in Europa und denen man auch im weiteren Leben stolz die
Treue hält, sowie der militärischen Einheit, die Mann und Frau erst zu einem/r solchen
werden läßt....... Ganz wichtig ist dabei das Wort ’Elite’;
- Die USA insistieren in befremdlicher Arroganz auf ihrer Ausnahmeposition, was ihnen nach
eigener Überzeugung das Recht einräumt, sich jeder internationalen Konvention zu verwei-
gern, die mit jedweden Nachteilen für die eigene Wirtschaft und seine BürgerInnen - in
exakt dieser Reihenfolge - verbunden sein könnte. Ob es sich dabei um den Internationalen
Strafgerichtshof, Zoll-, Subventions- oder Handelsabkommen, die Menschenrechte oder
internationale Statuierungen sonstiger Art handelt, spielt keine Rolle; „America comes
first“ – notfalls bleiben die USA ihre Beiträge schuldig;
- Ihre Rolle als Weltpolizist und einzig berechtigte Entscheidungsinstanz leiten die USA aus
ihrem Selbstverständnis als maßgebender Förderer der Demokratie ab - aus einer 200 Jahre
alten, eurozentristischen Perspektive. Hingegen sehen Dutzende von Staaten Lateinamerikas
und Asiens, zunehmend auch der Karibik und Afrikas den “Weltpolizisten“ vor allem als
gnadenlosen Plünderer. Gore Vidal listet in seinem Buch „Ewiger Krieg für ewigen
Frieden“ (S.26 –39) alleine zwischen 1948 und 1999 mehr als 200 Einsätze von US-
Truppen in Vorderasien, Südosteuropa, Mittel-/Südamerika und Afrika auf, die vielfach bis
heute andauern, und zur Sicherung US-amerikanischer Belange in militär- und wirtschafts-
strategischer Hinsicht sind die USA inzwischen in über 100 Ländern dauerhaft präsent –
notfalls auch gegen den Willen der betroffenen Länder! Deren Rechte zählen für ‚Uncle
Sam’ ebenso wenig wie deren Bedürfnisse. „We sacrifice ourselves and the lifes of our kids
(! - gemeint sind die Stationierungstruppen) for the rest of the world, and get nothing but
ingraditude!“, schimpfte kürzlich einer meiner US-Bekannten, und er meinte das ernst.
Dabei ist den US-Bürgern nur schwer zu vermitteln, daß oftmals erst ihr Eingreifen das
Problem schuf, bzw. bestehende eskalieren ließ. Man denke hierbei an die Terrorregime
in Argentinien, Uruguay, Chile, Indonesien, Korea, Paraguay, Guatemala, Bolivien,
Honduras, Nicaragua u.v.m., den ‘CONDOR’- Plan der US-Geheimdienste, mithilfe
derer Massenmörder vom Schlage eines Pinochet und Noriega, Videla und Stroessner,
Savimbi, Mobutu und auch Saddam Hussein - jeweils solange sie für die USA zum
Vorteil agierten - in wahrlich höchst undemokratischer Weise aber zur Interessens-
wahrung der USA an der Macht gehalten wurden. An dieser grundsätzlichen Hybris hat sich
auch unter Bush sen., Clinton und Baby-Bush nicht das mindeste geändert;
- Kaum ein US-Amerikaner weiß, dass es sich bei der ‚School of the Americas’ (Fort
Benning, Georgia) tatsächlich um eine zentrale Ausbildungsstätte für terroristische Einsätze
lateinamerikanischer Militärs – geschützt, organisiert und finanziert von CIA und NSA (u.a.
aus Drogengeldern und gegen Geheimverträge) - handelte;
- Denken Sie an die an Arroganz und Größenwahn nicht mehr zu überbietende Äußerung des
Vorzeige-Fürthers und ‚Friedens’(!)-Nobelpreisträgers Kissinger, der den von den USA
(resp. ihm) initiierten Sturz des demokratisch gewählten chilenischen Präsidenten Allende
mit dem Satz ’verteidigte’: „Ich sehe nicht ein, warum wir untätig zuschauen sollen, wie
ein Land kommunistisch wird wegen der Verantwortungslosigkeit des eigenen Volkes“;
- Seit 1973 sank das Einkommen von zwei Drittel der US-Bevölkerung dramatisch. Daran
änderten auch die Boom-Jahre (1995 und ’99) wenig. Würden nicht die Kommunen und
eine beispiellose Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe das Schlimmste verhindern, stiege
die Zahl der Diebstähle und Raubdelikte noch wesentlich und große Teile der USA gewär-
tigten längst Übergriffe und bürgerkriegsähnliche Zustände.
Doch all das besorgt Washington und seine Leitfiguren wenig – die Illuminaten schon gar
nicht. Die US-Finanzwirtschaft vertraut auf seine Kredibilität im Ausland und verschuldet
sich eben weiter - zur ’Auslandsverschuldung’ verweigert Washington seit 20 Jahren jede
Auskunft(!).
So wie erst das Eingreifen des Menschen in die Natur und das ökologische Gleich-
gewicht in Fauna und Flora der Erde die Notwendigkeit von Korrekturen schuf, so
werden heute Völker und Ethnien, weltliche wie geistige Kulturgemeinschaften ihrer
Lebensgrundlage und originären Identität beraubt, vergewaltigt und mit dem „Recht“
des Stärkeren durcheinandergewürfelt und destabilisiert, gegeneinander ausgespielt
und verfeindlicht.
Wie verlogen und heuchlerisch die Haltung der US-Regierung in vielen Bereichen der Politik, wie löcherig der nach außen bekundete Moralkatalog ist, erfahren US-Bürger allenfalls, wenn sie - für viele ein einmaliges, oftmals einerseits großartiges, andererseits schockierendes Erlebnis in ihrem Leben - nach Europa reisen. Manche flüchten entsetzt, andere reisen nachdenklich zurück in die USA, nur wenige hingegen durchdringen den Kern der Kluft zwischen dem ‚Alten Europa’ und dem schier ‚forever young America’. ’Big’, neben ’business’ und ’beautiful’ die Zauberworte der US-amerikanischen Alternativkultur, hat seinen Preis:
- Die USA sind das einzige Land der OECD, in dem die Bevölkerung heute länger arbeitet
als vor 30 Jahren; der Analphabetismus steigt; das sowohl von der ILO [5] als auch der UN-
Menschenrechts-Charta postulierte Streikrecht sowie das Recht auf gewerkschaftliche
Organisation sind faktisch nicht mehr existent; mithilfe des ‚Homeland Security Act’ und
des TIA [6] - Computersystems sind - völlig nach Belieben der Geheimdienste - selbst durch
die Verfassung garantierte Basis-Rechte außer Kraft gesetzt. Den meisten US-Bürgern ist
nicht im entferntesten klar, daß sie bereits längst in einem nahezu perfekten Polizei- und
Überwachungsstaat leben, der ohne ihre weltfremde Reduzierung des Lebens auf ‚family,
fun and french-fries [7] ’, ‘business, big and beautiful’ und einen fanatischen ’Hurra’-Patrio-
tismus gar nicht überleben könnte.;
- Mehr als 5% der US-Bevölkerung sitzt in Gefängnissen - einsamer Weltrekord, an den
nicht einmal Rußland unter Stalin heranreichte. Nur: Mehr als 70% dieser Insassen sind
Farbige, obwohl die Weißen mehr als 75% der Bevölkerung stellen!
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Wir Europäer haben keinen Grund, überheblich auf ’die Amerikaner’ herabzublicken! Die Geschichtsbücher sind gespickt mit Grausamkeiten europäischer Machart - den Möglichkeiten der damaligen Zeit entsprechend. Fanatischer Nationalismus, menschenverachtende Grausamkeit und Befriedigung egoistischer Interessen, Genozide und bedenkenloses Ausnützen eigener militärischer Überlegenheit sind beileibe keine Erfindung der USA. Aber hätten wir nicht eher und ehrlicher den USA in den Arm fallen, den Mund aufmachen und Einhalt gebieten sollen, statt die Zeichen an der Wand zur Wahrung eigener Vorteile zu übersehen?
Und nun zurück zum Irak-Krieg
Kann es unter diesen Umständen noch groß verwundern, daß ein durch Wahlbetrug von den Illuminaten und bestem Protegement ins Amt gehievter Karrieresäufer mit bedenkenlos dümmlichem Gesicht und ohne jeglichen Horizont (außer dem ihm suggerierten) salbadernder Präsident eine ganze Nation einlullen und derart infam hinters Licht führen kann?
Viel verwunderlicher scheint mir, wie (erfreulich) viele - hauptsächlich junge - Menschen in den USA sich dieser genuinen Volksverblödung widersetzen, auch wenn sie wohl nicht bis ins Letzte ermessen können, welch infame Korruption tatsächlich hinter diesem „Kampf gegen das Böse“, der „Friedenshilfe für den Iran“ und dem Bush’igen „Kreuzzug“ steckt.
Bush sen. konnte vor 12 Jahren - das dürfte ihn heute noch wurmen - durch selbst für die Illuminaten unvorhersehbare Umstände sein schon damals hinterhältig inszeniertes Werk nicht vollenden. Seither hat sich Husseins Charakter und seine Gewaltherrschaft in nichts gewandelt, aber die Begleitumstände veränderten sich massiv. Der 11. September 2001 bot den Illuminaten die einmalige Chance, den Plan „tabula rasa americanensis causa“ ins Werk zu setzen. Aber die Zeit drängte, das Entsetzen über die Anschläge in New York würde nicht ewig anhalten. Mithin galt es, eine einigermaßen sinnimplizierende ‚Brücke’ zwischen Bin Laden, einem den USA fiktiv gefährlichen Terrorismus nicht-amerikanischer Bauart, einen Feindersatz für die plötzlich befreundeten Russen und Chinesen sowie den verirrten Moslems, von denen man bereits etwa vier Millionen im eigenen Staatsgebiet hatte, zu finden.
Daß Hussein geradezu ein Erzfeind Bin Ladens ist, die Bushs und Cheneys mit den Saudis (und Bin Ladens) fröhlich Geschäfte treiben und u.a. auch über Firmen in Kanada, Südafrika, den USA, Belgien und Großbritannien mehr als ein Dutzend Länder in Schwarzafrika sowie halb Lateinamerika gemeinsam gnadenlos ausbeuten, weiß ohnehin kaum einer seiner Landsleute. Dafür sorgen schon die ausschließlich auf Unterhaltung getrimmten Medien in Bush-Country (meine US-Freunde sind regelmäßig überrascht, wie unterschiedlich CNN-Programme in den USA und in Europa sind).
Eben weil man nicht mehr allzu lange die ’9-11’-Katastrophe als Handlungsargument hätte ge-/mißbrauchen können, mußte Baby-Bush - das war er Papa-Bush und seinen ‚Wahlhelfern’ schuldig - jetzt zur Tat schreiten. Legal oder illegal - völlig egal!
Was sollten die UN und der nur auf Druck der USA wiedergewählte Kofi Annan schon groß unternehmen? Dem deutschen Berufswendehals Schröder und seinem pseudogrünen Schaukastenrevoluzzer Fischer würde man, schon um Chirac zu ärgern, vielleicht später den Friedensnobelpreis zuerkennen - als Beweis dafür, daß es ja auch den USA nur um Frieden ging. Dann ist auch da wieder alles im Lot.
Doch das Ganze, so fein es gesponnen ist, hat einen gefährlichen Webfehler: Spätestens jetzt, nach dem unglaublich arroganten Übergriff der USA - entgegen Chapter VII der UN-Charta und ohne den geringsten Beweis einer Verbindung zur Al Quaida - sind die Gräben wieder aufgerissen, aus denen vor knapp 1.000 Jahren der Odem dünstete, der Europa und dem Vorderen Orient das bis dahin schlimmste Völkermorden und sieben Kreuzzüge - alles im Namen, zum Ruhme und zur Ehre eines gemeinsamen Gottes (!) - bescherte. Die Raketen vom 20.März 2003 waren die Ouvertüre zu einem ‚Kampf der religiösen und weltlichen Überzeugungen’, wie er ideologischer, haßdurchsetzter und bedenkenlos-unmenschlicher nicht sein kann. In dieses mutwillig konzipierte ‚Gebräu’ fanatischen Ideologismus’ werden nicht Staaten, sondern aufgestachelte und schwülstigen Jenseits-Phantasien huldigende Gruppen unterschiedlichster Prägung ihre ‚Überzeugungen’ kippen und in grenzenloser Brutalität ihre Bataillone opfern. Selbst sich ansonsten feindlich gesinnte Gruppen - Schiiten/Sunniten, pro-westliche/islamistisch-anti-westliche Fundamentalisten, religiös/ laizistisch-orientierte Staaten und Volksgruppen - könnten angesichts des selbstherrlichen Überfalls der USA und ihrer Verbündeten nunmehr zueinander finden.
„Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, sagt ein arabisches Sprichwort, und unter diesem Aspekt könnte sich im Nachhinein als wahr erweisen, was die Bushisten bereits bislang - völlig unsinnig, aber in der Hoffnung auf die gläubige Unwissenheit ihrer Landsleute - seit Monaten behaupten: Die Baath-Partei könnte jetzt sogar zur Zusammen-arbeit mit Al Quaida und anderen religiösen Splittergruppen und Fanatikern bereit stehen.
Natürlich ging es weder SchrödFischer noch Chirac und Putin um menschliche Zugewandtheit und humanitäre Überzeugungen. Putin und Chirac wollten zum einen langfristige Öl-Lieferverträge mit Hussein nicht gefährden und haben beide viel zu viele Moslems in ihren Staatsgebieten, als daß sie sich einen massiven Konflikt mit der arabischen Welt und dem Irak erlauben dürfen, und die SchrödFischers handelten aus schierer Machterhaltungsgier. Aber das entschuldigt in keiner Weise das impertinente Vorgehen der Rambos um Bush und die menschenverachtende Raffgier der Illuminaten hinter ihnen.
Das Ausmaß der historischen Katastrophe, die uns der nicht nur wahrscheinlich dümmste, sondern vielleicht mörderischste Präsident der USA eingebrockt hat - im Verbund mit (vor allem im Westen) gefährlich zugespitzten Parteiensystemen und den diese repräsentierenden Politikern -, könnte uns an den Rand einer globalen Katastrophe führen, die uns über Börsencrashes, galoppierende Arbeitslosenzahlen und kollabierende „Sozial“systeme beinahe wehmütig hüsteln lassen dürfte.
Mag die Türkei nun eine Chance wittern, sich einen Teil des Nord-Irak (Kurdistan, seit 1991 nahezu autonom) einzuverleiben, ihr seit Jahrzehnten schwelendes Kurdenproblem - per Genozid! - zu lösen und sich gleichzeitig bei den USA für neue Kredite anzubiedern; mögen die Engländer sich einmal mehr als US-treue Vasallen erweisen und den Geist längst verflos-sener Zeiten eines weltumspannenden ’United Kingdom’ zu reanimieren versuchen; mögen US-Strategen und Rüstungskonzerne dankbar die Chance nutzen, ihre neuen Waffensysteme ’in combat und live’ zu erproben, wiederum Milliarden einzustreichen - auch der Irak-Krieg 1991 bescherte der Rüstungs- und der Ölindustrie zweistellige Milliardengewinne -, der Welt den wahren Meister zu zeigen und das ’Vietnam-Trauma’ endlich besiegen -wir stehen am Vorabend eines Weltbrandes völlig neuen Zuschnittes, dem der Westen, insbesondere die High-Tech-verliebten US-Amerikaner und Briten völlig fassungs- und hilflos gegenüber-stehen werden. Hier helfen keine bis zur Idiotie hochgerüsteten Armeen und Geheimdienste, und selbst die europäischen Erfahrungen mit Terrororganisationen wie der RAF, der ETA, den Roten Brigaden und der IRA werden CIA und ISI, MI und BND nichts nützen. Baby-Bush ist mit einer nur mit seinem Mangel an Intelligenz entschuldbaren Instinktlosigkeit über die Gefühle einer ganzen Gruppe von Ethnien hinwegmarschiert, nur um endlich Papis Raubzug zu vollenden und sich in die Geschichtsbücher künftiger High-School-Generationen zu mogeln. Doch welchen Preis werden seine Landsleute und wir alle, die wir auf 2.500 Jahre westlicher Kultur in griechisch geprägter humanistischer Tradition so überheblich stolz sein zu dürfen glauben, für diesen hybriden Wahnsinn zahlen dürfen.
Mit Staatsterror gegenüber dem Rest der Welt und unliebsamen Nationen - und hierum handelt es sich – ist weder der Terror zu besiegen, noch sind die innerhalb des kranken ’Körpers’ United States of America schwelenden Metastasen auf Dauer zu kaschieren. Die USA haben einen schier uneinholbaren Vorsprung in nahezu allen Belangen eines modernen, auf die Bedürfnisse der Zukunft ausgelegten Staates. Doch das Bild trügt, und wer sich die großen Reiche der letzten 5.000 Jahre, deren unerschütterlichen Glauben an die eigene Ewigkeit und den letztlich doch einsetzenden Zusammenbruch (oftmals binnen weniger Monate und Jahre) vor Augen hält, könnte erhebliche Schlafstörungen bekommen. Nur wird der Zusammenbruch dieser Mega-Hybris jeden bisherigen Kollaps eines Weltreiches in den Schatten stellen und äußerst schmerzhaft werden - nicht nur für 280 Millionen US-Ameri-kaner, sondern für Milliarden Menschen weltweit. Ihre trojanischen Pferde haben die USA längst zur Tür hereingelassen. Die weiden - noch unerkannt – auf herrlichen Savannen........
Noch nie hätte ich mich lieber geirrt, als heute.
Hans-Wolff Graf
die klammern wollte ich nicht mit einer leerstelle versehen.
deshalb die smilies im text

deshalb die smilies im text


http://www.sonntagszeitung.ch/sz/szUnterRubrik.html?ausgabei…
«Halten Sie Cash und warten Sie ab»
Der Fondsmanager John Bennett glaubt nicht an den Aufschwung, er hofft sogar auf einen baldigen Crash an der Walls treet
VON DAVE HERTIG
Herr Bennett, der Blue-Chips-Index DJ Stoxx 50 verlor in fünf Jahren rund 30 Prozent und in den letzten drei gar mehr als die Hälfte seines Werts. Die Anleger haben keine Puste mehr. Können Sie als Manager mehrerer europäischer Aktienfonds ermutigen?
Nein, seit den Tiefständen hat sich Europa zwar mit einem Kursanstieg von 25 Prozent erholt. Der Bärenmarkt ist aber längst nicht ausgestanden.
Sie sagten 2002, dass sie noch immer auf den finalen Ausverkauf warten. Ist er inzwischen eingetreten?
Ich sprach damals vor allem von der Kapitulation der Anleger in den USA. Auf die warte ich noch immer.
Was bedeutet das für Europa?
Ich wäre deutlich optimistischer respektive weniger pessimistisch , wenn Amerika nicht wäre. Die USA brauchen einen Kollaps. Die Bewertungen sind viel zu hoch.
Ist denn der US-Investor von Natur aus zu optimistisch?
Ja. Sogar der amerikanische Nichtinvestor ist zu optimistisch. Es ist wirklich dumm, die aktuellen Kurse zu zahlen, vor allem im Nasdaq, aber auch im breiten S&P-Index.
Was unternehmen Sie im aktuellen Umfeld?
Auf Unternehmensebene gibt es in Europa Gründe für Hoffnung.
Welche sehen Sie?
Die laufenden Restrukturierungen sind eine Chance. Je stärker die Krise, desto besser. Zurich Financial Services, Swiss Life, Vivendi, Marconi oder Cable&Wireless sind gute Beispiele. Ohne Krise kein Wandel. Das gilt zudem ganz besonders für die Politik, die einen wesentlichen Teil dazu beitragen muss. Deshalb braucht es noch mehr Streiks und Protestkundgebungen.
Sie werden diesen Monat 40. Was wünschen Sie sich?
Privat Gesundheit für weitere 40 Jahre. Für die Märkte wünsche ich mir einen Crash an der Wallstreet.
Rechnen Sie nächstens damit?
Es ist sehr schwierig, weil sich die USA wirtschaftlich bereits im Wahlkampf befinden. George W. Bush will nicht den Fehler von Daddy Bush machen, der nach dem Krieg die Wahlen verlor. Alan Greenspan und das Fed, die Notenbank, tun alles, um Baby Bush zur Wiederwahl zu verhelfen. Er wird also weiterhin Liquidität in die Märkte pumpen. Genau genommen versucht er, die Rezession zu verhindern. Damit be-kämpft er auch den sinnvollen und nötigen Abschwung.
Kann der Wahlkampf der einzige Grund für das Handeln der Notenbank sein?
Es kommt hinzu, dass die Notenbank Angst hat, dass die Rezession viel schlimmer sein könnte, als erwartet. George W. Bush ist nicht der einzige Grund, aber ein sehr wesentlicher.
Führt die US-Zinspolitik zum Aufschwung?
Das ist eine Fantasie. Es gibt keinen richtigen Aufschwung, bevor es nicht einen richtigen Abschwung gegeben hat. In den USA gab es nicht nur die Aktien-Bubble, es gibt auch die Fed-Bubble. Greenspan ermutigte und ermutigt die Konsumenten stets, auf Pump noch mehr Geld auszugeben. Das ist falsch.
Der Markt ist derzeit optimistischer als Sie. Was tun Sie, bis Ihr Szenario eintritt?
Wir machen mit, um für die Investoren etwas Geld zu verdienen. Es ist, als ob ich auf einer Party wäre, aber unter der Tür stünde. Wichtig ist, nahe beim Ausgang zu stehen. Ich denke, dass es an der US-Börse zu einem üblen Ende kommen wird. Und dann wird auch Europa keine besonders gute Zeit erleben.
Welches sind die Indikatoren, die anzeigen werden, wann es Zeit es, die Party definitiv zu verlassen?
Der Optimismus ist so hoch, wie seit dem Höhepunkt der grossen Spekulationsblase nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass der Crash nicht sehr weit sein kann. Ansonsten gilt es die üblichen Wirtschaftsdaten im Auge zu behalten.
Sie sind Schotte. Ist es noch Zeit, im englischen Stil bei einem Tee abzuwarten oder eher schon für den harten Scotch, um zu vergessen?
Je nach Tageszeit. Nein, im Ernst: Wenn Sie in US-Aktien drin sind, verkaufen. Sie haben noch Technologietitel? Sell. Halten Sie Cash, und warten Sie ab. Chancen sehe ich höchstens bei den kleineren europäischen Aktien. Es gibt auf kurze Sicht von sechs Monaten bis zu einem Jahr einzelne Titel, die angemessen bewertet sind. Zudem können kleine Firmen für Übernahmen interessant sein.
Agfa Gevaert ist einer Ihrer Tipps. Welche Aktien kaufen Sie sonst noch?
Bei den grossen Firmen sind Vivendi, Suez oder Cable&Wireless interessant. Das wichtige Thema ist die Restrukturierung. Zurich und Swiss Life habens getan, Vivendi ist dabei, Suez wird es auch noch tun. Vielleicht zieht bald sogar die deutsche RWE mit. Ansonsten sehe ich kaum interessante Big Caps. Ich sehe auch keine starken Sektortrends, von Öl und Goldminen mal abgesehen. Was ich sehe, sind gute Möglichkeiten, auf einen Kurszerfall zu setzen. Mich interessieren die gefallenen Stars: Marconi, beispielsweise. Bei den kleineren Aktien erachte ich Leica Geosystems als ausserordent- liche Aktie.
In Ihren Fonds haben aber klassische Defensivaktien am meisten Gewicht, unter anderen die Schweizer Titel Novartis, Nestlé und Roche. Diese Aktien kauft, wer nicht weiss, was er kaufen soll.
Diese Aktien kauft, wer sich bei klassischen Fonds defensiv ausrichtet. In Hedge Funds setzen wir ja auch auf Abwärtsbewegungen.
Ist die Aktie der Credit Suisse interessant?
Ich hatte die Titel beobachtet, verpasste dann aber den Kursanstieg. Auf dem aktuellen Niveau steige ich nicht ein.
---------
Der haut aber rein
«Halten Sie Cash und warten Sie ab»
Der Fondsmanager John Bennett glaubt nicht an den Aufschwung, er hofft sogar auf einen baldigen Crash an der Walls treet
VON DAVE HERTIG
Herr Bennett, der Blue-Chips-Index DJ Stoxx 50 verlor in fünf Jahren rund 30 Prozent und in den letzten drei gar mehr als die Hälfte seines Werts. Die Anleger haben keine Puste mehr. Können Sie als Manager mehrerer europäischer Aktienfonds ermutigen?
Nein, seit den Tiefständen hat sich Europa zwar mit einem Kursanstieg von 25 Prozent erholt. Der Bärenmarkt ist aber längst nicht ausgestanden.
Sie sagten 2002, dass sie noch immer auf den finalen Ausverkauf warten. Ist er inzwischen eingetreten?
Ich sprach damals vor allem von der Kapitulation der Anleger in den USA. Auf die warte ich noch immer.
Was bedeutet das für Europa?
Ich wäre deutlich optimistischer respektive weniger pessimistisch , wenn Amerika nicht wäre. Die USA brauchen einen Kollaps. Die Bewertungen sind viel zu hoch.
Ist denn der US-Investor von Natur aus zu optimistisch?
Ja. Sogar der amerikanische Nichtinvestor ist zu optimistisch. Es ist wirklich dumm, die aktuellen Kurse zu zahlen, vor allem im Nasdaq, aber auch im breiten S&P-Index.
Was unternehmen Sie im aktuellen Umfeld?
Auf Unternehmensebene gibt es in Europa Gründe für Hoffnung.
Welche sehen Sie?
Die laufenden Restrukturierungen sind eine Chance. Je stärker die Krise, desto besser. Zurich Financial Services, Swiss Life, Vivendi, Marconi oder Cable&Wireless sind gute Beispiele. Ohne Krise kein Wandel. Das gilt zudem ganz besonders für die Politik, die einen wesentlichen Teil dazu beitragen muss. Deshalb braucht es noch mehr Streiks und Protestkundgebungen.
Sie werden diesen Monat 40. Was wünschen Sie sich?
Privat Gesundheit für weitere 40 Jahre. Für die Märkte wünsche ich mir einen Crash an der Wallstreet.
Rechnen Sie nächstens damit?
Es ist sehr schwierig, weil sich die USA wirtschaftlich bereits im Wahlkampf befinden. George W. Bush will nicht den Fehler von Daddy Bush machen, der nach dem Krieg die Wahlen verlor. Alan Greenspan und das Fed, die Notenbank, tun alles, um Baby Bush zur Wiederwahl zu verhelfen. Er wird also weiterhin Liquidität in die Märkte pumpen. Genau genommen versucht er, die Rezession zu verhindern. Damit be-kämpft er auch den sinnvollen und nötigen Abschwung.
Kann der Wahlkampf der einzige Grund für das Handeln der Notenbank sein?
Es kommt hinzu, dass die Notenbank Angst hat, dass die Rezession viel schlimmer sein könnte, als erwartet. George W. Bush ist nicht der einzige Grund, aber ein sehr wesentlicher.
Führt die US-Zinspolitik zum Aufschwung?
Das ist eine Fantasie. Es gibt keinen richtigen Aufschwung, bevor es nicht einen richtigen Abschwung gegeben hat. In den USA gab es nicht nur die Aktien-Bubble, es gibt auch die Fed-Bubble. Greenspan ermutigte und ermutigt die Konsumenten stets, auf Pump noch mehr Geld auszugeben. Das ist falsch.
Der Markt ist derzeit optimistischer als Sie. Was tun Sie, bis Ihr Szenario eintritt?
Wir machen mit, um für die Investoren etwas Geld zu verdienen. Es ist, als ob ich auf einer Party wäre, aber unter der Tür stünde. Wichtig ist, nahe beim Ausgang zu stehen. Ich denke, dass es an der US-Börse zu einem üblen Ende kommen wird. Und dann wird auch Europa keine besonders gute Zeit erleben.
Welches sind die Indikatoren, die anzeigen werden, wann es Zeit es, die Party definitiv zu verlassen?
Der Optimismus ist so hoch, wie seit dem Höhepunkt der grossen Spekulationsblase nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass der Crash nicht sehr weit sein kann. Ansonsten gilt es die üblichen Wirtschaftsdaten im Auge zu behalten.
Sie sind Schotte. Ist es noch Zeit, im englischen Stil bei einem Tee abzuwarten oder eher schon für den harten Scotch, um zu vergessen?
Je nach Tageszeit. Nein, im Ernst: Wenn Sie in US-Aktien drin sind, verkaufen. Sie haben noch Technologietitel? Sell. Halten Sie Cash, und warten Sie ab. Chancen sehe ich höchstens bei den kleineren europäischen Aktien. Es gibt auf kurze Sicht von sechs Monaten bis zu einem Jahr einzelne Titel, die angemessen bewertet sind. Zudem können kleine Firmen für Übernahmen interessant sein.
Agfa Gevaert ist einer Ihrer Tipps. Welche Aktien kaufen Sie sonst noch?
Bei den grossen Firmen sind Vivendi, Suez oder Cable&Wireless interessant. Das wichtige Thema ist die Restrukturierung. Zurich und Swiss Life habens getan, Vivendi ist dabei, Suez wird es auch noch tun. Vielleicht zieht bald sogar die deutsche RWE mit. Ansonsten sehe ich kaum interessante Big Caps. Ich sehe auch keine starken Sektortrends, von Öl und Goldminen mal abgesehen. Was ich sehe, sind gute Möglichkeiten, auf einen Kurszerfall zu setzen. Mich interessieren die gefallenen Stars: Marconi, beispielsweise. Bei den kleineren Aktien erachte ich Leica Geosystems als ausserordent- liche Aktie.
In Ihren Fonds haben aber klassische Defensivaktien am meisten Gewicht, unter anderen die Schweizer Titel Novartis, Nestlé und Roche. Diese Aktien kauft, wer nicht weiss, was er kaufen soll.
Diese Aktien kauft, wer sich bei klassischen Fonds defensiv ausrichtet. In Hedge Funds setzen wir ja auch auf Abwärtsbewegungen.
Ist die Aktie der Credit Suisse interessant?
Ich hatte die Titel beobachtet, verpasste dann aber den Kursanstieg. Auf dem aktuellen Niveau steige ich nicht ein.
---------
Der haut aber rein

syr










http://www.ksta.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.ksta.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&…
Jeder siebte US-Bürger kann sich keine Krankenversicherung leisten
In den Vereinigten Staaten sterben jährlich 18 000 Menschen an Krankheiten, die wegen mangelnder Versicherung unbehandelt geblieben sind.
San Francisco - Noch vor einem Jahr führten Sheila und Bob Wessenberg ein komfortables Leben. Bob verdiente als Programmierer 100 000 Dollar im Jahr, und sie lebten relativ sorgenfrei in einem rund 200 Quadratmeter großen Haus nahe Dallas, Texas. Heute wissen sie nicht, wie sie 2800 Dollar an angehäuften Krankenhausrechnungen bezahlen sollen, mussten bereits Familienmitglieder um Tausende von Dollar anpumpen und fürchten, ihr Haus zu verlieren, wenn sie die Hypotheken nicht mehr aufbringen.
Die unglückliche Wende in ihrem Leben: Bobs Jobverlust Ende 2001. Er hat inzwischen zwar wieder für wesentlich weniger Geld Arbeit, an ihrer prekären finanziellen Situation hat sich jedoch wenig geändert. Denn Sheila hat Brustkrebs und ist nicht krankenversichert. Sie verlor ihre Versicherung mit Bobs Arbeitslosigkeit. Eine neue Versicherung für 837 Dollar im Monat wurde unerschwinglich, und so stoppte Sheila inzwischen sogar die Chemotherapie, nachdem die Kosten in den Himmel wuchsen und ihr Erspartes aufgebraucht war.
Die Wessenbergs sind weder Extrem- noch Einzelfall, wie Julie Winokur in einem neuen Buch über das 41-Millionen-Heer der Nichtversicherten in den USA („Denied: The Crisis of America`s Uninsured“ ) dokumentiert. Die Fakten: Einer von sieben US-Bürgern hat keine Krankenversicherung. Texas und Kalifornien führen die Liste mit den meisten Nichtversicherten an. 39 Prozent finden sich in der Altersklasse zwischen 19 und 34 Jahren. Weitere 23 Prozent sind Kinder und Teenager.
Wenn auch viele der Nichtversicherten arm oder undokumentierte Einwanderer sind, die am schnellsten wachsende Gruppe gehört der Mittelschicht an und lebt in Haushalten mit einem Jahreseinkommen von 50 000 Dollar. Auch sei es ein Mythos, dass Letztere aus freien Stücken keine Versicherung abschließen. Sie müssen, so Winokur, vielmehr zwischen Essen auf dem Tisch, der Hypothekenzahlung und einer Krankenversicherung entscheiden. Kurz: Sie können sich die Versicherung schlichtweg nicht leisten. Mit ein Grund ist, dass ihr Arbeitgeber entweder keine Krankenversicherung anbietet, sie den Job und damit die Versicherung verloren haben oder auf Grund ihrer vorherrschenden Krankheiten nur von Versicherungen akzeptiert werden, die enorm hohe Prämien kassieren. In den USA werden Prämien nicht nach Einkommen, sondern nach Alter und Geschlecht errechnet. Hinzu kommt, dass Prämien allein im vergangenen Jahr um 13 Prozent stiegen. Als Folge bleiben viele Krankheiten unbehandelt oder werden erst behandelt, wenn Patienten zu einem Notfall werden. Wie Nancy Gorman, deren Gehirntumor erst behandelt wurde, als sie ihr Augenlicht verlor und damit zu einem Notfall wurde. Dies wiederum führt dazu, dass nach Statistiken des Institute of Medicine im Schnitt jährlich 18 000 Menschen an Krankheiten sterben, die auf Grund mangelnder Krankenversicherung unbehandelt blieben. Ein Skandal, nach Meinung der Autorin. „Diese Zahl ist vergleichbar mit jährlich sechs Terroranschlägen, wie wir sie am 11. September sahen“, meint Winokur.
Eine weitere Folge ist, dass die Kosten für die Krankenhäuser, die verpflichtet sind, jeden Notfall zu behandeln, und damit auch für die Allgemeinheit steigen. Denn Notfälle sind nicht nur teurer als ein normaler Arztbesuch. Die meisten Kliniken präsentieren den Nichtversicherten höhere Rechnungen als Patienten, deren mächtige Versicherer einen niedrigen Satz mit dem Hospital ausgehandelt haben.
(KStA)
------
Bei uns kann sich der Staat keine Ausgaben mehr leisten, dort drüben können sich die Leute garnichts mehr leisten.
super
Jeder siebte US-Bürger kann sich keine Krankenversicherung leisten
In den Vereinigten Staaten sterben jährlich 18 000 Menschen an Krankheiten, die wegen mangelnder Versicherung unbehandelt geblieben sind.
San Francisco - Noch vor einem Jahr führten Sheila und Bob Wessenberg ein komfortables Leben. Bob verdiente als Programmierer 100 000 Dollar im Jahr, und sie lebten relativ sorgenfrei in einem rund 200 Quadratmeter großen Haus nahe Dallas, Texas. Heute wissen sie nicht, wie sie 2800 Dollar an angehäuften Krankenhausrechnungen bezahlen sollen, mussten bereits Familienmitglieder um Tausende von Dollar anpumpen und fürchten, ihr Haus zu verlieren, wenn sie die Hypotheken nicht mehr aufbringen.
Die unglückliche Wende in ihrem Leben: Bobs Jobverlust Ende 2001. Er hat inzwischen zwar wieder für wesentlich weniger Geld Arbeit, an ihrer prekären finanziellen Situation hat sich jedoch wenig geändert. Denn Sheila hat Brustkrebs und ist nicht krankenversichert. Sie verlor ihre Versicherung mit Bobs Arbeitslosigkeit. Eine neue Versicherung für 837 Dollar im Monat wurde unerschwinglich, und so stoppte Sheila inzwischen sogar die Chemotherapie, nachdem die Kosten in den Himmel wuchsen und ihr Erspartes aufgebraucht war.
Die Wessenbergs sind weder Extrem- noch Einzelfall, wie Julie Winokur in einem neuen Buch über das 41-Millionen-Heer der Nichtversicherten in den USA („Denied: The Crisis of America`s Uninsured“ ) dokumentiert. Die Fakten: Einer von sieben US-Bürgern hat keine Krankenversicherung. Texas und Kalifornien führen die Liste mit den meisten Nichtversicherten an. 39 Prozent finden sich in der Altersklasse zwischen 19 und 34 Jahren. Weitere 23 Prozent sind Kinder und Teenager.
Wenn auch viele der Nichtversicherten arm oder undokumentierte Einwanderer sind, die am schnellsten wachsende Gruppe gehört der Mittelschicht an und lebt in Haushalten mit einem Jahreseinkommen von 50 000 Dollar. Auch sei es ein Mythos, dass Letztere aus freien Stücken keine Versicherung abschließen. Sie müssen, so Winokur, vielmehr zwischen Essen auf dem Tisch, der Hypothekenzahlung und einer Krankenversicherung entscheiden. Kurz: Sie können sich die Versicherung schlichtweg nicht leisten. Mit ein Grund ist, dass ihr Arbeitgeber entweder keine Krankenversicherung anbietet, sie den Job und damit die Versicherung verloren haben oder auf Grund ihrer vorherrschenden Krankheiten nur von Versicherungen akzeptiert werden, die enorm hohe Prämien kassieren. In den USA werden Prämien nicht nach Einkommen, sondern nach Alter und Geschlecht errechnet. Hinzu kommt, dass Prämien allein im vergangenen Jahr um 13 Prozent stiegen. Als Folge bleiben viele Krankheiten unbehandelt oder werden erst behandelt, wenn Patienten zu einem Notfall werden. Wie Nancy Gorman, deren Gehirntumor erst behandelt wurde, als sie ihr Augenlicht verlor und damit zu einem Notfall wurde. Dies wiederum führt dazu, dass nach Statistiken des Institute of Medicine im Schnitt jährlich 18 000 Menschen an Krankheiten sterben, die auf Grund mangelnder Krankenversicherung unbehandelt blieben. Ein Skandal, nach Meinung der Autorin. „Diese Zahl ist vergleichbar mit jährlich sechs Terroranschlägen, wie wir sie am 11. September sahen“, meint Winokur.
Eine weitere Folge ist, dass die Kosten für die Krankenhäuser, die verpflichtet sind, jeden Notfall zu behandeln, und damit auch für die Allgemeinheit steigen. Denn Notfälle sind nicht nur teurer als ein normaler Arztbesuch. Die meisten Kliniken präsentieren den Nichtversicherten höhere Rechnungen als Patienten, deren mächtige Versicherer einen niedrigen Satz mit dem Hospital ausgehandelt haben.
(KStA)
------
Bei uns kann sich der Staat keine Ausgaben mehr leisten, dort drüben können sich die Leute garnichts mehr leisten.
super

"Bowling for Columbine" Kritik: dpa 11/2002
Moore legt den Finger in die Wunde
Ein Mann im Tarnanzug robbt schwer bewaffnet durch irgendein Wäldchen in der amerikanischen Provinz. Er schießt ein paar Mal in die Nacht. Dann gibt er Auskunft über das, was ihn drängt. Herrscht Krieg? Im Prinzip nicht. Aber irgendwie doch: Der Mann hält es für seine "patriotische Pflicht" bewaffnet zu sein - um Frau und Kinder verteidigen zu können.
Daran, dass dieser Typ töten würde, lässt Michael Moore in seinem absolut sehenswerten Dokumentarfilm "Bowling for Columbine" keinen Zweifel. Und er fragt: "Sind wir verrückt nach Waffen - oder einfach nur verrückt?".
Mehr als 10.000 Schusswaffenopfer pro Jahr
Michael Moore (48), einer der wenigen prominenten linken Intellektuellen und Satiriker in den USA, legt den Finger in eine Wunde der US-Gesellschaft. Sein provozierender Film ist angesichts des Irak-Konflikts und der erst wenige Wochen zurückliegenden Attacken des Heckenschützen eine höchst sehenswerte und erstaunlich unterhaltsame Materialsammlung zur Gewaltgeschichte der USA. "Bowling for Columbine" wurde bei den Filmfestspielen in Cannes vom Publikum gefeiert und mit einem Spezialpreis ausgezeichnet.
Angeregt durch die Tatsache, dass in seiner Heimatstadt nicht nur der rigorose Waffen-Lobbyist Charlton Heston aufwuchs, sondern auch Eric Harris, einer der beiden Täter des Schulmassakers an der Columbine Highschool von Littleton (Colorado), beginnt Moore zu fragen: Warum hat das Land mit mehr als 10.000 Schusswaffenopfern pro Jahr die weltweit höchste entsprechende Todesrate? Im Nachbarland Kanada, ähnlich flächendeckend bewaffnet, spielen die durch Gewehr und Pistolen Getöteten statistisch nur eine Nebenrolle.
An der Angst verdienen viele
Moore bohrt und bohrt, harmlos-freundlich fragend, aber höchst subversiv. Sein Ansatz ist vielfältig und hätte bei zwei Stunden Filmlänge mehr Struktur verdient. Er montiert Interviews, Polizeivideos, Trickfilme, TV-Ausschnitte und persönliche Kommentare zu einer dynamischen Mixtur mit klarer Hauptaussage: "Es ist eine historisch gewachsene Angst, die ein Klima der Gewalt erzeugt."
Weiße Jugendliche erzählen von hausgemachten Bomben. Bürgermilizen sehen im Schießtraining einen Akt der Verantwortung. Eine Gesellschaft im internen Kriegszustand. An der Angst verdienen viele: Medien, Waffenhersteller, Politiker natürlich, Supermärkte mit Munitionsdepot oder Schock-Musiker wie Marilyn Manson.
Bedrohung als Grundgefühl der Amerikaner
Amerika ist auf Gewalt gebaut, meint Moore. Auf Sklaverei und Ausbeutung vor allem der Schwarzen. Doch die "Angst vor der Rache des schwarzen Mannes" und aller anderen Opfer erzeugt ein Grundgefühl der Bedrohung. Die Medien nehmen vor allem einzelne Gewalttaten wahr und machen sogar noch mit "afrikanischen Killerbienen" Quote. Und diese paranoide Stimmung wird in Moores Augen durch die Rolle der "Weltpolizei" USA verstärkt, die ihre Aggressionen als Akte der Selbstverteidigung darstellt.
Moore ist bewusst parteiisch, unausgewogen und manipulativ
Für Komik sorgt in diesem Schreckensgemälde vor allem die Figur des arglosen Fragers. Michael Moore ist dabei bewusst parteiisch, unausgewogen und manipulativ. Einer der Höhepunkte in der Montage: Er spricht mit Ex-Hollywoodstar Charlton Heston als Symbolfigur der "National Rifle Association". Warum er kurz nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens durch die Kugel eines Gleichaltrigen ausgerechnet im Wohnort der Kinder für Pistolen geworben habe? Der starke alte Mann schwadroniert von Bürgerrechten, doch als er mit dem Foto des Mädchens konfrontiert wird, verlässt er sprachlos den Raum.
Karin Zintz, dpa^
-----
und Afghanistan haben die Amis wegen 3000 Toten angegriffen!
Moore legt den Finger in die Wunde
Ein Mann im Tarnanzug robbt schwer bewaffnet durch irgendein Wäldchen in der amerikanischen Provinz. Er schießt ein paar Mal in die Nacht. Dann gibt er Auskunft über das, was ihn drängt. Herrscht Krieg? Im Prinzip nicht. Aber irgendwie doch: Der Mann hält es für seine "patriotische Pflicht" bewaffnet zu sein - um Frau und Kinder verteidigen zu können.
Daran, dass dieser Typ töten würde, lässt Michael Moore in seinem absolut sehenswerten Dokumentarfilm "Bowling for Columbine" keinen Zweifel. Und er fragt: "Sind wir verrückt nach Waffen - oder einfach nur verrückt?".
Mehr als 10.000 Schusswaffenopfer pro Jahr
Michael Moore (48), einer der wenigen prominenten linken Intellektuellen und Satiriker in den USA, legt den Finger in eine Wunde der US-Gesellschaft. Sein provozierender Film ist angesichts des Irak-Konflikts und der erst wenige Wochen zurückliegenden Attacken des Heckenschützen eine höchst sehenswerte und erstaunlich unterhaltsame Materialsammlung zur Gewaltgeschichte der USA. "Bowling for Columbine" wurde bei den Filmfestspielen in Cannes vom Publikum gefeiert und mit einem Spezialpreis ausgezeichnet.
Angeregt durch die Tatsache, dass in seiner Heimatstadt nicht nur der rigorose Waffen-Lobbyist Charlton Heston aufwuchs, sondern auch Eric Harris, einer der beiden Täter des Schulmassakers an der Columbine Highschool von Littleton (Colorado), beginnt Moore zu fragen: Warum hat das Land mit mehr als 10.000 Schusswaffenopfern pro Jahr die weltweit höchste entsprechende Todesrate? Im Nachbarland Kanada, ähnlich flächendeckend bewaffnet, spielen die durch Gewehr und Pistolen Getöteten statistisch nur eine Nebenrolle.
An der Angst verdienen viele
Moore bohrt und bohrt, harmlos-freundlich fragend, aber höchst subversiv. Sein Ansatz ist vielfältig und hätte bei zwei Stunden Filmlänge mehr Struktur verdient. Er montiert Interviews, Polizeivideos, Trickfilme, TV-Ausschnitte und persönliche Kommentare zu einer dynamischen Mixtur mit klarer Hauptaussage: "Es ist eine historisch gewachsene Angst, die ein Klima der Gewalt erzeugt."
Weiße Jugendliche erzählen von hausgemachten Bomben. Bürgermilizen sehen im Schießtraining einen Akt der Verantwortung. Eine Gesellschaft im internen Kriegszustand. An der Angst verdienen viele: Medien, Waffenhersteller, Politiker natürlich, Supermärkte mit Munitionsdepot oder Schock-Musiker wie Marilyn Manson.
Bedrohung als Grundgefühl der Amerikaner
Amerika ist auf Gewalt gebaut, meint Moore. Auf Sklaverei und Ausbeutung vor allem der Schwarzen. Doch die "Angst vor der Rache des schwarzen Mannes" und aller anderen Opfer erzeugt ein Grundgefühl der Bedrohung. Die Medien nehmen vor allem einzelne Gewalttaten wahr und machen sogar noch mit "afrikanischen Killerbienen" Quote. Und diese paranoide Stimmung wird in Moores Augen durch die Rolle der "Weltpolizei" USA verstärkt, die ihre Aggressionen als Akte der Selbstverteidigung darstellt.
Moore ist bewusst parteiisch, unausgewogen und manipulativ
Für Komik sorgt in diesem Schreckensgemälde vor allem die Figur des arglosen Fragers. Michael Moore ist dabei bewusst parteiisch, unausgewogen und manipulativ. Einer der Höhepunkte in der Montage: Er spricht mit Ex-Hollywoodstar Charlton Heston als Symbolfigur der "National Rifle Association". Warum er kurz nach dem Tod eines sechsjährigen Mädchens durch die Kugel eines Gleichaltrigen ausgerechnet im Wohnort der Kinder für Pistolen geworben habe? Der starke alte Mann schwadroniert von Bürgerrechten, doch als er mit dem Foto des Mädchens konfrontiert wird, verlässt er sprachlos den Raum.
Karin Zintz, dpa^
-----
und Afghanistan haben die Amis wegen 3000 Toten angegriffen!

Alan dreht durch, Zwangseinlieferung beantragen aber schnell 

 !!!
!!!
Open Market Operations
Temporary Open Market Operations 06/16/2003
Maturity Date 06/26/2003
Delivery Date 06/16/2003
The Desk has entered the market announcing: 10-day RP
Weighted Average Rate
1.209 1.240 N/A
Stop Out Rate (Lowest Rate Accepted) 1.200 1.240 N/A
Highest Rate Submitted 1.210 1.240 1.250
Lowest Rate Submitted 1.050 1.110 1.160
Total Propostions Submitted (In $Bil.) 3.838 .162 .000
Total Propositions Accepted (In $Bil.) 21.450 18.250 12.950
Total Money Value of Operation (In $Bil.) 52.65
syr


 !!!
!!!Open Market Operations
Temporary Open Market Operations 06/16/2003
Maturity Date 06/26/2003
Delivery Date 06/16/2003
The Desk has entered the market announcing: 10-day RP
Weighted Average Rate
1.209 1.240 N/A
Stop Out Rate (Lowest Rate Accepted) 1.200 1.240 N/A
Highest Rate Submitted 1.210 1.240 1.250
Lowest Rate Submitted 1.050 1.110 1.160
Total Propostions Submitted (In $Bil.) 3.838 .162 .000
Total Propositions Accepted (In $Bil.) 21.450 18.250 12.950
Total Money Value of Operation (In $Bil.) 52.65
syr

syr
wo hast du die Zahlen her
ich hab 10.25 mrd.
wo hast du die Zahlen her

ich hab 10.25 mrd.
Mittlerweile haben`s wir ja draussen, Dolby . Wenn die FED beim Tippen schusselt
. Wenn die FED beim Tippen schusselt  .....
.....

syr
 . Wenn die FED beim Tippen schusselt
. Wenn die FED beim Tippen schusselt  .....
.....
syr

http://www.zeit.de/2003/24/Privatbankrotte
USA
Kaufen, bis der Abschleppwagen kommt
Trotz Rezession und Arbeitslosigkeit verschulden sich die amerikanischen Verbraucher munter weiter. Und die Fachleute streiten: Rettet der Kaufrausch die Wirtschaft – oder macht er alles nur schlimmer?
Von Thomas Fischermann
Sergio Costa hat einen krisensicheren Job: Der Mann stiehlt Autos. „Am liebsten arbeite ich nachts“, erzählt er, „der Sicherheit wegen. Aber im Moment gibt es so viel zu tun, dass ich quasi 24 Stunden im Einsatz bin.“ Costa schaltet Alarmanlagen mit wenigen Handgriffen aus, öffnet lautlos Hochsicherheitsschlösser, und manchmal karrt er Fahrzeuge gleich komplett mit seinem Abschleppwagen weg, ohne überhaupt auszusteigen. Vergangenen Monat hat er 402 Autos entwendet, meist BMW oder Toyota.
Doch Costa ist kein gewöhnlicher Autodieb. Bevor er einen Wagen stiehlt, sagt er der Polizei Bescheid – und am Ende bringt er die Fahrzeuge ihren wahren Eigentümern zurück. Costa ist ein so genannter Repo Man, er ist Betriebsmanager bei der Firma Elite Collateral Recovery and Investigations in Elizabeth, New Jersey, die auf Pump gekaufte Fahrzeuge von säumigen Schuldnern zurückholt. Das Unternehmen erhält seine Aufträge von Automobilfirmen und Banken, und die Umsätze steigen seit Monaten.
„Wenn unsere Branche boomt, ist das ein ganz hervorragender Index für Konjunkturkrisen“, spottet Harvey Altes, Chef des Branchenverbandes Time Finance Adjusters. Und tatsächlich: Im vergangenen Jahr „stahlen“ seine Mitgliedsunternehmen die Rekordzahl von zwei Millionen Fahrzeugen von ihren zahlungsunwilligen Besitzern – „eine wirklich gewaltige Menge“, wie Altes sagt. Die Zahl passt zu einer Reihe besorgniserregender ökonomischer Trends. Viele amerikanische Privathaushalte haben ihre Kreditrahmen bei Banken und Kreditkartenfirmen ausgeschöpft, etliche von ihnen können ihre Raten nicht mehr zahlen. Der durchschnittliche Schuldendienst eines US-Haushalts hat inzwischen den Rekordwert von 14 Prozent des verfügbaren Einkommens erreicht, insgesamt stieg die Privatschuld amerikanischer Haushalte auf ein historisches Hoch von 1,7 Trillionen Dollar, und die Zahl der persönlichen Bankrotte stieg im vergangenen Jahr um fünf Prozent. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Verschuldung der Privathaushalte nicht mehr durchzuhalten ist“, urteilt Dimitri Papadimitriou, Präsident des Levy Institute. „Das wird den Leuten gerade klar – womöglich mit schweren Folgen für die Konjunktur.“
„Einmalig in der Geschichte“
Nun ist die Freude an Krediten in den USA nicht gerade neu. Die Amerikaner leben traditionell auf Pump und sparen weniger als die meisten anderen Industrienationen. Allerdings hat sich der Trend zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Legten die US-Bürger Anfang der neunziger Jahre noch knapp neun Prozent ihres verfügbaren Einkommens beiseite, lag die Sparquote am Ende des Jahrzehnts bei weniger als zwei Prozent. Der Aktienboom und der vermeintliche Reichtum hatte viele Leute angestachelt, jetzt erst recht ihre Kreditkarten, Bankdarlehen und die Finanzierungsangebote von Einzelhändlern auszuschöpfen. Manche Ökonomen glauben sogar, dass weniger das Internet als diese Kredit- und Konsumwelle den Wachstumsschub der späten Neunziger ausgelöst hatte.
Doch bis heute ist Ökonomen und Psychologen ein Rätsel, warum diese Mentalität sich seit dem Platzen der Aktienblase nicht geändert hat – im Gegensatz zu früheren Rezessionen. Nach der Wirtschaftskrise von 1991 zum Beispiel sank die Kreditaufnahme der Amerikaner drastisch. Diesmal dagegen nahmen die Amerikaner fröhlich weiter Kredite auf, sogar schneller als zuvor, wenn man den Anteil am verfügbaren Einkommen zum Maßstab nimmt. „Eine solche Beschleunigung ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig“, sagt Jan Hatzius, Ökonom bei der Investmentbank Goldman Sachs in New York.
Das Resultat: Der Schuldenstand der amerikanischen Privathaushalte bricht alle Rekorde, inzwischen liegen die Schulden eines amerikanischen Durchschnittshaushalts über seinem Nettojahreseinkommen.
Etliche Kreditinstitute bekommen bereits kalte Füße. Finanzierungsfirmen großer Autokonzerne wie Ford Motor verzeichneten in den vergangenen drei Jahren einen Zuwachs ihrer Kreditausfälle um ein Drittel. Eine Studie der Schuldnerberatungsfirma Myvesta ergab im November, dass ein Amerikaner heutzutage im Durchschnitt 3250 Dollar Schulden auf zwei bis drei Kreditkarten mit sich herumträgt – ein Anstieg um fast 1000 Dollar gegenüber dem Vorjahr. Die Kreditkartenfirmen berichten, dass immer mehr Amerikaner am Maximum ihrer Kreditrahmen angelangt sind und mit ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen, zumal etliche dieser Firmen in den vergangenen Jahren den so genannten Sub-Prime-Lending-Markt erschlossen hatten. Ihre Kunden sind Leute, die keine einwandfreie Kreditgeschichte vorweisen konnten. Jetzt sind die Kreditkartenfirmen nervöser denn je: Einige rufen bei unzuverlässigen Kunden schon vor dem Rechnungsdatum an, um vorsorglich zur Bezahlung zu mahnen. Die Gebühren und Zinsen für säumige Schuldner sind drastisch gestiegen.
Längst geraten auch Leute in die Schuldenfalle, die früher kaum gefährdet schienen. Der Verband der Repo Men etwa stellte zuletzt fest, dass immer mehr Leute ihre Autos gleich freiwillig hergeben. „Die wollen den Ärger nicht“, sagt der Branchensprecher Altes, „das sind im Grunde ehrliche Leute aus dem bürgerlichen Mittelstand in einer außergewöhnlichen Lebenslage.“ Leute wie Mantell Sponder aus Brooklyn zum Beispiel, der als Computerexperte an der Wall Street einst 150000 Dollar im Jahr verdiente und sich nach einem Jahr Arbeitslosigkeit inzwischen rüde Telefonmanieren angewöhnt hat. „Die Kreditkartenfirmen und Gläubiger rufen hier quasi täglich an“, sagt Sponder und zuckt mit den Schultern. „Es ist einfach kein Geld da – und ich habe mir angewöhnt, gar nicht erst mit denen zu reden. Ich knalle dann gleich den Hörer auf die Gabel.“
Die Hausbesitzer fühlen sich reich
Es gibt freilich auch etliche Ökonomen, die von einer privaten Schuldenkrise nichts wissen wollen. Die Schuldenmacherei, so ihr Argument, könnte sich als gewonnene Wette auf eine bessere Zukunft herausstellen. Schließlich profitiert die Wirtschaft vom starken Konsum der Amerikaner. So könnte die kollektive Kreditaufnahme zur sich selbst erfüllenden Prophezeihung werden. Wer behält Recht – die Schwarzmaler oder die Optimisten?
Die Rechnung geht nur auf, wenn mit der Nachfrage auch der Arbeitsmarkt anspringt. Zwar sind im vergangenen Jahr die Einkommen um 4,5 Prozent gestiegen – nach nur 1,8 Prozent im Vorjahr –, aber zu einem großen Teil lag das an Steuerkürzungen aus Washington. Außerdem hat die Arbeitslosenquote in den USA gerade wieder die Sechsprozentmarke überschritten.
Entscheidend ist auch die Entwicklung der Zinsen und der Hauspreise. Notenbankchef Alan Greenspan hält die Leitzinsen zurzeit auf einem Rekordtief und macht keine Anstalten, sie bald wieder steigen zu lassen. Den Großteil ihrer neuen Kredite haben sich die Amerikaner in den vergangenen Monaten besorgt, indem sie zu diesen günstigen Zinssätzen Hypothekenkredite auf ihre Häuser aufnahmen – oder ihre bestehenden Hypotheken umschuldeten. Ein besonders gutes Geschäft machten dabei Hausbesitzer, die in Gegenden eines boomenden Immobilienmarktes leben, zum Beispiel in Sacramento oder in New York City: Einige Hauspreise sind in den vergangenen Jahren um 30, 50, gar 100 Prozent gestiegen, sodass bei der Umschuldung Extra-Cash anfiel und sich die Hausbesitzer umso reicher fühlten. Doch etliche Ökonomen sehen inzwischen die Hauspreise auf einem Hoch angelangt, einige Schwarzseher warnen sogar vor einem Kollaps der Immobilienpreise in einigen Regionen. Die Zinsen können zudem kaum weiter fallen. Mit dieser Art des Schuldenmachens dürfte es also bald vorbei sein.
Weil aber niemand so richtig weiß, wie ernst die Lage wirklich ist, erreichen die amerikanischen Verbraucher in diesen Tagen höchst unterschiedliche Signale. „Leben Sie reich“, rät die Citibank auf Plakaten an Hauswänden und in Spots im Fernsehen: Die Bankiers wollen ihrer Kundschaft gern einreden, dass es auch in Krisenzeiten „keine gute Idee ist, sich aus Sparsamkeit selbst die Haare zu schneiden“. Und dass Amerikaner sozusagen „mit dem Recht auf akzeptierte Kreditanträge geboren“ seien. Umgekehrt werden Schuldenratgeber wie Überleben Sie die Ferien ohne Bankrott zu Bestsellern. Beratungsseminare für überschuldete Amerikaner sind gefragt, und auch halbseidene Angebote („So bekommen Sie eine neue Kredit-Identität“ ) finden immer mehr verzweifelte Interessenten. Das American Bankruptcy Institute sorgt sich inzwischen darum, dass „die steigenden Zahlen der Zahlungsunfähigkeiten in den Haushalten auch die finanzielle Gesundheit der Kreditgeber-Institutionen gefährden“ könne. Und die sonst so optimistische Bankenwirtschaft unternimmt in Washington eine gewaltige Lobby-Anstrengung, um die Gesetze rings um den persönlichen Bankrott zu reformieren. Wer Pleite geht, darf in den Vereinigten Staaten in der Regel eine Menge behalten – oft das Haus und hohe Freibeträge auf Autos, Juwelen und die Hauseinrichtung. Die neue Gesetzgebung soll nach dem Wunsch der Kreditinstitute deutlich härter durchgreifen.
Böse Zeiten also für säumige Schuldner, und gute Zeiten für Leute wie die Repo Men? Vielleicht auch nicht. „Der Mai war ein ganz merkwürdiger Monat“, klagt in diesen Tagen der Branchensprecher Harvey Altes. „Die Autofirmen haben in den vergangenen Monaten so viele Autos mit Nullzinsen und Sonderrabatten verkauft, dass sie sowieso einen Verlust machen“, sagt Altes. „So ist der neueste Trend, dass sie die Fahrzeuge gar nicht mehr zurückhaben wollen.“
(c) DIE ZEIT 05.06.2003 Nr.24

USA
Kaufen, bis der Abschleppwagen kommt
Trotz Rezession und Arbeitslosigkeit verschulden sich die amerikanischen Verbraucher munter weiter. Und die Fachleute streiten: Rettet der Kaufrausch die Wirtschaft – oder macht er alles nur schlimmer?
Von Thomas Fischermann
Sergio Costa hat einen krisensicheren Job: Der Mann stiehlt Autos. „Am liebsten arbeite ich nachts“, erzählt er, „der Sicherheit wegen. Aber im Moment gibt es so viel zu tun, dass ich quasi 24 Stunden im Einsatz bin.“ Costa schaltet Alarmanlagen mit wenigen Handgriffen aus, öffnet lautlos Hochsicherheitsschlösser, und manchmal karrt er Fahrzeuge gleich komplett mit seinem Abschleppwagen weg, ohne überhaupt auszusteigen. Vergangenen Monat hat er 402 Autos entwendet, meist BMW oder Toyota.
Doch Costa ist kein gewöhnlicher Autodieb. Bevor er einen Wagen stiehlt, sagt er der Polizei Bescheid – und am Ende bringt er die Fahrzeuge ihren wahren Eigentümern zurück. Costa ist ein so genannter Repo Man, er ist Betriebsmanager bei der Firma Elite Collateral Recovery and Investigations in Elizabeth, New Jersey, die auf Pump gekaufte Fahrzeuge von säumigen Schuldnern zurückholt. Das Unternehmen erhält seine Aufträge von Automobilfirmen und Banken, und die Umsätze steigen seit Monaten.
„Wenn unsere Branche boomt, ist das ein ganz hervorragender Index für Konjunkturkrisen“, spottet Harvey Altes, Chef des Branchenverbandes Time Finance Adjusters. Und tatsächlich: Im vergangenen Jahr „stahlen“ seine Mitgliedsunternehmen die Rekordzahl von zwei Millionen Fahrzeugen von ihren zahlungsunwilligen Besitzern – „eine wirklich gewaltige Menge“, wie Altes sagt. Die Zahl passt zu einer Reihe besorgniserregender ökonomischer Trends. Viele amerikanische Privathaushalte haben ihre Kreditrahmen bei Banken und Kreditkartenfirmen ausgeschöpft, etliche von ihnen können ihre Raten nicht mehr zahlen. Der durchschnittliche Schuldendienst eines US-Haushalts hat inzwischen den Rekordwert von 14 Prozent des verfügbaren Einkommens erreicht, insgesamt stieg die Privatschuld amerikanischer Haushalte auf ein historisches Hoch von 1,7 Trillionen Dollar, und die Zahl der persönlichen Bankrotte stieg im vergangenen Jahr um fünf Prozent. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Verschuldung der Privathaushalte nicht mehr durchzuhalten ist“, urteilt Dimitri Papadimitriou, Präsident des Levy Institute. „Das wird den Leuten gerade klar – womöglich mit schweren Folgen für die Konjunktur.“
„Einmalig in der Geschichte“
Nun ist die Freude an Krediten in den USA nicht gerade neu. Die Amerikaner leben traditionell auf Pump und sparen weniger als die meisten anderen Industrienationen. Allerdings hat sich der Trend zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Legten die US-Bürger Anfang der neunziger Jahre noch knapp neun Prozent ihres verfügbaren Einkommens beiseite, lag die Sparquote am Ende des Jahrzehnts bei weniger als zwei Prozent. Der Aktienboom und der vermeintliche Reichtum hatte viele Leute angestachelt, jetzt erst recht ihre Kreditkarten, Bankdarlehen und die Finanzierungsangebote von Einzelhändlern auszuschöpfen. Manche Ökonomen glauben sogar, dass weniger das Internet als diese Kredit- und Konsumwelle den Wachstumsschub der späten Neunziger ausgelöst hatte.
Doch bis heute ist Ökonomen und Psychologen ein Rätsel, warum diese Mentalität sich seit dem Platzen der Aktienblase nicht geändert hat – im Gegensatz zu früheren Rezessionen. Nach der Wirtschaftskrise von 1991 zum Beispiel sank die Kreditaufnahme der Amerikaner drastisch. Diesmal dagegen nahmen die Amerikaner fröhlich weiter Kredite auf, sogar schneller als zuvor, wenn man den Anteil am verfügbaren Einkommen zum Maßstab nimmt. „Eine solche Beschleunigung ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig“, sagt Jan Hatzius, Ökonom bei der Investmentbank Goldman Sachs in New York.
Das Resultat: Der Schuldenstand der amerikanischen Privathaushalte bricht alle Rekorde, inzwischen liegen die Schulden eines amerikanischen Durchschnittshaushalts über seinem Nettojahreseinkommen.
Etliche Kreditinstitute bekommen bereits kalte Füße. Finanzierungsfirmen großer Autokonzerne wie Ford Motor verzeichneten in den vergangenen drei Jahren einen Zuwachs ihrer Kreditausfälle um ein Drittel. Eine Studie der Schuldnerberatungsfirma Myvesta ergab im November, dass ein Amerikaner heutzutage im Durchschnitt 3250 Dollar Schulden auf zwei bis drei Kreditkarten mit sich herumträgt – ein Anstieg um fast 1000 Dollar gegenüber dem Vorjahr. Die Kreditkartenfirmen berichten, dass immer mehr Amerikaner am Maximum ihrer Kreditrahmen angelangt sind und mit ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen, zumal etliche dieser Firmen in den vergangenen Jahren den so genannten Sub-Prime-Lending-Markt erschlossen hatten. Ihre Kunden sind Leute, die keine einwandfreie Kreditgeschichte vorweisen konnten. Jetzt sind die Kreditkartenfirmen nervöser denn je: Einige rufen bei unzuverlässigen Kunden schon vor dem Rechnungsdatum an, um vorsorglich zur Bezahlung zu mahnen. Die Gebühren und Zinsen für säumige Schuldner sind drastisch gestiegen.
Längst geraten auch Leute in die Schuldenfalle, die früher kaum gefährdet schienen. Der Verband der Repo Men etwa stellte zuletzt fest, dass immer mehr Leute ihre Autos gleich freiwillig hergeben. „Die wollen den Ärger nicht“, sagt der Branchensprecher Altes, „das sind im Grunde ehrliche Leute aus dem bürgerlichen Mittelstand in einer außergewöhnlichen Lebenslage.“ Leute wie Mantell Sponder aus Brooklyn zum Beispiel, der als Computerexperte an der Wall Street einst 150000 Dollar im Jahr verdiente und sich nach einem Jahr Arbeitslosigkeit inzwischen rüde Telefonmanieren angewöhnt hat. „Die Kreditkartenfirmen und Gläubiger rufen hier quasi täglich an“, sagt Sponder und zuckt mit den Schultern. „Es ist einfach kein Geld da – und ich habe mir angewöhnt, gar nicht erst mit denen zu reden. Ich knalle dann gleich den Hörer auf die Gabel.“
Die Hausbesitzer fühlen sich reich
Es gibt freilich auch etliche Ökonomen, die von einer privaten Schuldenkrise nichts wissen wollen. Die Schuldenmacherei, so ihr Argument, könnte sich als gewonnene Wette auf eine bessere Zukunft herausstellen. Schließlich profitiert die Wirtschaft vom starken Konsum der Amerikaner. So könnte die kollektive Kreditaufnahme zur sich selbst erfüllenden Prophezeihung werden. Wer behält Recht – die Schwarzmaler oder die Optimisten?
Die Rechnung geht nur auf, wenn mit der Nachfrage auch der Arbeitsmarkt anspringt. Zwar sind im vergangenen Jahr die Einkommen um 4,5 Prozent gestiegen – nach nur 1,8 Prozent im Vorjahr –, aber zu einem großen Teil lag das an Steuerkürzungen aus Washington. Außerdem hat die Arbeitslosenquote in den USA gerade wieder die Sechsprozentmarke überschritten.
Entscheidend ist auch die Entwicklung der Zinsen und der Hauspreise. Notenbankchef Alan Greenspan hält die Leitzinsen zurzeit auf einem Rekordtief und macht keine Anstalten, sie bald wieder steigen zu lassen. Den Großteil ihrer neuen Kredite haben sich die Amerikaner in den vergangenen Monaten besorgt, indem sie zu diesen günstigen Zinssätzen Hypothekenkredite auf ihre Häuser aufnahmen – oder ihre bestehenden Hypotheken umschuldeten. Ein besonders gutes Geschäft machten dabei Hausbesitzer, die in Gegenden eines boomenden Immobilienmarktes leben, zum Beispiel in Sacramento oder in New York City: Einige Hauspreise sind in den vergangenen Jahren um 30, 50, gar 100 Prozent gestiegen, sodass bei der Umschuldung Extra-Cash anfiel und sich die Hausbesitzer umso reicher fühlten. Doch etliche Ökonomen sehen inzwischen die Hauspreise auf einem Hoch angelangt, einige Schwarzseher warnen sogar vor einem Kollaps der Immobilienpreise in einigen Regionen. Die Zinsen können zudem kaum weiter fallen. Mit dieser Art des Schuldenmachens dürfte es also bald vorbei sein.
Weil aber niemand so richtig weiß, wie ernst die Lage wirklich ist, erreichen die amerikanischen Verbraucher in diesen Tagen höchst unterschiedliche Signale. „Leben Sie reich“, rät die Citibank auf Plakaten an Hauswänden und in Spots im Fernsehen: Die Bankiers wollen ihrer Kundschaft gern einreden, dass es auch in Krisenzeiten „keine gute Idee ist, sich aus Sparsamkeit selbst die Haare zu schneiden“. Und dass Amerikaner sozusagen „mit dem Recht auf akzeptierte Kreditanträge geboren“ seien. Umgekehrt werden Schuldenratgeber wie Überleben Sie die Ferien ohne Bankrott zu Bestsellern. Beratungsseminare für überschuldete Amerikaner sind gefragt, und auch halbseidene Angebote („So bekommen Sie eine neue Kredit-Identität“ ) finden immer mehr verzweifelte Interessenten. Das American Bankruptcy Institute sorgt sich inzwischen darum, dass „die steigenden Zahlen der Zahlungsunfähigkeiten in den Haushalten auch die finanzielle Gesundheit der Kreditgeber-Institutionen gefährden“ könne. Und die sonst so optimistische Bankenwirtschaft unternimmt in Washington eine gewaltige Lobby-Anstrengung, um die Gesetze rings um den persönlichen Bankrott zu reformieren. Wer Pleite geht, darf in den Vereinigten Staaten in der Regel eine Menge behalten – oft das Haus und hohe Freibeträge auf Autos, Juwelen und die Hauseinrichtung. Die neue Gesetzgebung soll nach dem Wunsch der Kreditinstitute deutlich härter durchgreifen.
Böse Zeiten also für säumige Schuldner, und gute Zeiten für Leute wie die Repo Men? Vielleicht auch nicht. „Der Mai war ein ganz merkwürdiger Monat“, klagt in diesen Tagen der Branchensprecher Harvey Altes. „Die Autofirmen haben in den vergangenen Monaten so viele Autos mit Nullzinsen und Sonderrabatten verkauft, dass sie sowieso einen Verlust machen“, sagt Altes. „So ist der neueste Trend, dass sie die Fahrzeuge gar nicht mehr zurückhaben wollen.“
(c) DIE ZEIT 05.06.2003 Nr.24

http://www.ftd.de/ub/fi/1055680377951.html?nv=sky
Aus der FTD vom 17.6.2003 www.ftd.de/agenda
Freddie Mac - Sturmgefahr für Märkte und Konjunktur
Von Ulrike Sosalla, New York
Die Bilanzprobleme des Hypothekenfinanzierers Freddie Mac ängstigen ganz Amerika. Sie drohen sich zu einem Skandal auszuweiten, der für die Finanzmärkte und die US-Konjunktur schlimmer wäre als die Pleiten von Enron und Worldcom.
Gregory Parseghian zögerte nicht. Gleich nachdem er am vergangenen Montag zum Vorstandsvorsitzenden von Freddie Mac berufen wurde, stattete er einem Büro in der Nähe des Weißen Hauses seinen Antrittsbesuch ab. Gastgeber war Armando Falcon, Chef der Regulierungsbehörde, die Freddie Mac beaufsichtigt.
Falcon wird nicht der Einzige bleiben, den Parseghian in diesen Tagen beehrt: Er braucht dringend einflussreiche Freunde. Oder wenigstens ein paar Menschen, die ihm wohlgesonnen sind. Und die sollten möglichst Politiker sein. Denn in Washington schlagen derzeit alle auf Freddie Mac ein, fordern Aufklärung und Reformen. "Mehr Transparenz und Offenheit wären eine gute Sache", kritisiert sogar US-Finanzminister John Snow.
Der Vorwurf: Freddie Mac hat seine Bilanzen nicht im Griff. Ein solches Unternehmen möchte natürlich kein Politiker unterstützen, gerade nach den Skandalen um Enron und Worldcom. Und Freddie Mac ist mehr als Enron oder Worldcom, das Finanzinstitut ist viel größer und deutlich wichtiger für Amerikas Konjunktur und Märkte.
Schaden für gesamte Immobilienbranche
Ein Zusammenbruch würde die Wirtschaft tief erschüttern. "Sollte Freddie Mac von einem Fehler oder einem Schock erschüttert werden, könnte das Ergebnis eine Krise der Finanzmärkte sein, die der Eigenheimbranche und der Wirtschaft beträchtlichen Schaden zufügen würde", warnt William Poole, Präsident der Federal Reserve von St. Louis.
Gemeinsam mit seiner Schwesterfirma Fannie Mae finanziert Freddie Mac fast die Hälfte aller Eigenheimhypotheken des Landes: Sie kaufen Banken die Hypotheken ab, schnüren sie zu Paketen und reichen sie an Investoren weiter.
So sichern die beiden dem boomenden Immobilienmarkt die niedrigen Zinsen, die ihn am Laufen halten. In Freddie Macs Büchern steht die enorme Summe von 1300 Mrd. $ an Hypotheken, Anleihen und anderen Wertpapieren.
Vor einer Woche erschreckte dann eine Nachricht die Öffentlichkeit: Freddie Mac entlässt seinen Präsidenten und nimmt den Rücktritt des Vorstandschefs und des Finanzvorstands an. Damit rückt eine Bilanzkorrektur ins Rampenlicht, die bis dahin kaum jemand beachtet hat.
Investoren kommen ins Zweifeln
Im Januar hatte Freddie Mac angekündigt, sein neuer Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers wolle die Verbuchung von Derivaten in den Bilanzen für 2000 bis 2002 ändern. Allerdings: Das würde die Gewinne in diesem Zeitraum nicht senken, sondern steigern. Diese Aussage beruhigte die Investoren - zunächst.
Nach dem Rauswurf der Führungsspitze ist das Vertrauen der Investoren stark getrübt. "Das zeigt, dass Fannie Mae und Freddie Mac Schwierigkeiten haben, obwohl der Eigenheimmarkt noch boomt", urteilt John Talbott. Der Finanzfachmann sagt in seinem gerade erschienenen Buch "Der kommende Crash im Eigenheimmarkt" einen Zusammenbruch des Marktes vorher. "Dies ist das erste große Ereignis, und eine Menge anderer schlechter Nachrichten wird noch kommen."
Die breite Öffentlichkeit ist in großer Sorge. Zu sehr fühlen sich die Anleger an die ersten Wochen des Enron-Skandals erinnert: So hat auch Freddie Mac Bilanzprobleme, deren Ausmaß das Unternehmen erst Monate später genau beziffern will; und die Unstimmigkeiten sind unter dem Wirtschaftsprüfer Arthur Andersen entstanden.
Manager verschwinden ohne Erklärung
Wie bei Enron treten auch Spitzenmanager ohne genaue Erklärung ab. Und monatelang ermittelt die US-Börsenaufsicht, ohne dass das Unternehmen die Öffentlichkeit informiert. Schließlich belassen die Kreditbewertungsagenturen ihre ausgezeichneten Ratings bei Freddie Mac, so wie sie es zu Beginn des Falles Enron getan haben.
Ob sich hinter der Krise wirklich ein ausgewachsener Bilanzskandal verbirgt, wagt zur Zeit noch keiner vorherzusagen. Zu unübersichtlich ist die Lage, zu komplex sind die Buchungen, die Freddie Mac ins Visier der Ermittler gebracht haben - es geht um die Verbuchung von Derivaten, mit denen das Finanzinstitut seine milliardenschweren Hypotheken-Portfolios gegen Zinsschwankungen absichert.
Auch um die Leute nicht weiter zu beunruhigen, zögert die Fachwelt darin, in der Öffentlichkeit Schreckens-Szenarien zu entwerfen. So kann die Fed-Gouverneurin Susan Bies keine negativen Auswirkungen auf den Hypothekenmarkt ausmachen. "Bisher sind wir nicht allzu besorgt."
Geheimniskrämerei schadet dem Image
Noch hat der Markt Hoffnung, dass sich alles fügt. Für Freddie hat das Desaster aber schon begonnen: Das Image ist schwer angeschlagen. Besonders die Geheimniskrämerei trägt dazu bei, die Investoren zu verunsichern und zu verschrecken. Das gibt Kritikern Auftrieb, die die Zwitterstellung von Freddie Mac und seiner Schwester Fannie Mae anprangern - allen voran die mächtigen Marktwirtschaftler der amerikanischen Zentralbank Fed.
Fannie und Freddie, wie die Konzerne in den USA genannt werden, sind halb private, halb staatliche Unternehmen. Sie genießen viele Privilegien und konnten sich immer auf eine gutmütige, staatliche Aufsicht verlassen. Im Aufsichtsrat etwa sitzen Regierungsvertreter.
Die beiden Konzerne sind von zahlreichen Offenlegungsvorschriften der Börsenaufsicht SEC ausgenommen, an die alle anderen börsennotierten Unternehmen sich halten müssen. Und sie haben beim Finanzministerium eine jederzeit abrufbare Kreditlinie über 2,25 Mrd. $. Außerdem zahlen weder Fannie noch Freddie Steuern an die Bundesstaaten oder Gemeinden. Das alles ist gesetzlich fixiert.
Ungeschriebene Privilegien
Nicht festgeschrieben ist hingegen ein Privileg, das für ihr Geschäft so wichtig ist wie kein anderes: Ihre Investoren gehen davon aus, dass beide eine staatliche Kreditgarantie genießen, also notfalls von der Regierung gerettet würden, um einen Bankrott zu verhindern.
Diese Annahme beschert den Anleihen von Fannie und Freddie ihre Triple-A-Bewertung, also die höchste Stufe, die die Kreditbewertungsagenturen vergeben. Und diese Annahme verhinderte auch, dass in der vergangenen Woche die Freddie Mac-Bonds wie die Aktien abstürzten. Der Aktienkurs sank um mehr als 20 Prozent.
Freddie Mac selbst bestreitet die Staatsgarantie. "Wir lassen keinen Zweifel daran, dass unsere Wertpapiere nicht von der Regierung garantiert werden", sagte Freddie Macs Ex-Chef Leland Brendsel kurz vor seinem erzwungenen Rücktritt. "Das ist das Gesetz, und das ist sehr klar kommuniziert."
Der Widerspruch zwischen der Wirklichkeit und der Wahrnehmung der Investoren treibt den Aufpassern der Fed den Angstschweiß auf die Stirn: Haben die Marktteilnehmer ihre Investitionsentscheidungen unter falschen Annahmen getroffen und wird nun ein Risiko offensichtlich, dann könnte eine Panik einsetzen, die Freddie, Fannie und schließlich der ganzen US-Wirtschaft einen kaum kalkulierbaren Schlag versetzt.
Zwang zu Reformen
Schnell müssten Reformen her, fordern die Marktbeobachter. Der Zwitterstatus ist ein Erbe der Depression in den 30er Jahren. Nach der Wirtschaftskrise entschloss sich die Regierung, den Eigenheimbesitz zu fördern, und gründete die Federal National Mortgage Association (FNMA), deren Abkürzung die Amerikaner schnell zu "Fannie Mae" verballhornten. 1970 gründete die Regierung dann Freddie Mac, um wenigstens ein wenig Konkurrenz in den Hypothekenmarkt zu bringen. 1989 ging Freddie an die Börse.
Ob der Skandal sich ausweitet oder nicht, die nächste Reform steht wohl bevor. Der Kongress hat schon eine Anhörung angesetzt. Die Themen: mehr Offenlegungspflichten, Zwang zu mehr Eigenkapital und ein Abbau der Steuerprivilegien.
Frühere Anläufe zu Reformen haben Fannie und Freddie stets mit Lobbying in Washington bekämpft. Änderungen würden das Geschäft weniger profitabel machen, die Zinsen erhöhen, die sie für ihre Anleihen zahlen, die sie aufnehmen, um den Banken Hypotheken abzukaufen.
Es sieht also so aus, als könnte Gregory Parseghian neue Freunde in Washington dringend gebrauchen. Er hat mit dem Werben schon angefangenen: "Die Aufklärung der Bilanzfragen ist meine oberste Priorität."
© 2003 Financial Times Deutschland , © Illustration: Quelle: Freddie Mac

Aus der FTD vom 17.6.2003 www.ftd.de/agenda
Freddie Mac - Sturmgefahr für Märkte und Konjunktur
Von Ulrike Sosalla, New York
Die Bilanzprobleme des Hypothekenfinanzierers Freddie Mac ängstigen ganz Amerika. Sie drohen sich zu einem Skandal auszuweiten, der für die Finanzmärkte und die US-Konjunktur schlimmer wäre als die Pleiten von Enron und Worldcom.
Gregory Parseghian zögerte nicht. Gleich nachdem er am vergangenen Montag zum Vorstandsvorsitzenden von Freddie Mac berufen wurde, stattete er einem Büro in der Nähe des Weißen Hauses seinen Antrittsbesuch ab. Gastgeber war Armando Falcon, Chef der Regulierungsbehörde, die Freddie Mac beaufsichtigt.
Falcon wird nicht der Einzige bleiben, den Parseghian in diesen Tagen beehrt: Er braucht dringend einflussreiche Freunde. Oder wenigstens ein paar Menschen, die ihm wohlgesonnen sind. Und die sollten möglichst Politiker sein. Denn in Washington schlagen derzeit alle auf Freddie Mac ein, fordern Aufklärung und Reformen. "Mehr Transparenz und Offenheit wären eine gute Sache", kritisiert sogar US-Finanzminister John Snow.
Der Vorwurf: Freddie Mac hat seine Bilanzen nicht im Griff. Ein solches Unternehmen möchte natürlich kein Politiker unterstützen, gerade nach den Skandalen um Enron und Worldcom. Und Freddie Mac ist mehr als Enron oder Worldcom, das Finanzinstitut ist viel größer und deutlich wichtiger für Amerikas Konjunktur und Märkte.
Schaden für gesamte Immobilienbranche
Ein Zusammenbruch würde die Wirtschaft tief erschüttern. "Sollte Freddie Mac von einem Fehler oder einem Schock erschüttert werden, könnte das Ergebnis eine Krise der Finanzmärkte sein, die der Eigenheimbranche und der Wirtschaft beträchtlichen Schaden zufügen würde", warnt William Poole, Präsident der Federal Reserve von St. Louis.
Gemeinsam mit seiner Schwesterfirma Fannie Mae finanziert Freddie Mac fast die Hälfte aller Eigenheimhypotheken des Landes: Sie kaufen Banken die Hypotheken ab, schnüren sie zu Paketen und reichen sie an Investoren weiter.
So sichern die beiden dem boomenden Immobilienmarkt die niedrigen Zinsen, die ihn am Laufen halten. In Freddie Macs Büchern steht die enorme Summe von 1300 Mrd. $ an Hypotheken, Anleihen und anderen Wertpapieren.
Vor einer Woche erschreckte dann eine Nachricht die Öffentlichkeit: Freddie Mac entlässt seinen Präsidenten und nimmt den Rücktritt des Vorstandschefs und des Finanzvorstands an. Damit rückt eine Bilanzkorrektur ins Rampenlicht, die bis dahin kaum jemand beachtet hat.
Investoren kommen ins Zweifeln
Im Januar hatte Freddie Mac angekündigt, sein neuer Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers wolle die Verbuchung von Derivaten in den Bilanzen für 2000 bis 2002 ändern. Allerdings: Das würde die Gewinne in diesem Zeitraum nicht senken, sondern steigern. Diese Aussage beruhigte die Investoren - zunächst.
Nach dem Rauswurf der Führungsspitze ist das Vertrauen der Investoren stark getrübt. "Das zeigt, dass Fannie Mae und Freddie Mac Schwierigkeiten haben, obwohl der Eigenheimmarkt noch boomt", urteilt John Talbott. Der Finanzfachmann sagt in seinem gerade erschienenen Buch "Der kommende Crash im Eigenheimmarkt" einen Zusammenbruch des Marktes vorher. "Dies ist das erste große Ereignis, und eine Menge anderer schlechter Nachrichten wird noch kommen."
Die breite Öffentlichkeit ist in großer Sorge. Zu sehr fühlen sich die Anleger an die ersten Wochen des Enron-Skandals erinnert: So hat auch Freddie Mac Bilanzprobleme, deren Ausmaß das Unternehmen erst Monate später genau beziffern will; und die Unstimmigkeiten sind unter dem Wirtschaftsprüfer Arthur Andersen entstanden.
Manager verschwinden ohne Erklärung
Wie bei Enron treten auch Spitzenmanager ohne genaue Erklärung ab. Und monatelang ermittelt die US-Börsenaufsicht, ohne dass das Unternehmen die Öffentlichkeit informiert. Schließlich belassen die Kreditbewertungsagenturen ihre ausgezeichneten Ratings bei Freddie Mac, so wie sie es zu Beginn des Falles Enron getan haben.
Ob sich hinter der Krise wirklich ein ausgewachsener Bilanzskandal verbirgt, wagt zur Zeit noch keiner vorherzusagen. Zu unübersichtlich ist die Lage, zu komplex sind die Buchungen, die Freddie Mac ins Visier der Ermittler gebracht haben - es geht um die Verbuchung von Derivaten, mit denen das Finanzinstitut seine milliardenschweren Hypotheken-Portfolios gegen Zinsschwankungen absichert.
Auch um die Leute nicht weiter zu beunruhigen, zögert die Fachwelt darin, in der Öffentlichkeit Schreckens-Szenarien zu entwerfen. So kann die Fed-Gouverneurin Susan Bies keine negativen Auswirkungen auf den Hypothekenmarkt ausmachen. "Bisher sind wir nicht allzu besorgt."
Geheimniskrämerei schadet dem Image
Noch hat der Markt Hoffnung, dass sich alles fügt. Für Freddie hat das Desaster aber schon begonnen: Das Image ist schwer angeschlagen. Besonders die Geheimniskrämerei trägt dazu bei, die Investoren zu verunsichern und zu verschrecken. Das gibt Kritikern Auftrieb, die die Zwitterstellung von Freddie Mac und seiner Schwester Fannie Mae anprangern - allen voran die mächtigen Marktwirtschaftler der amerikanischen Zentralbank Fed.
Fannie und Freddie, wie die Konzerne in den USA genannt werden, sind halb private, halb staatliche Unternehmen. Sie genießen viele Privilegien und konnten sich immer auf eine gutmütige, staatliche Aufsicht verlassen. Im Aufsichtsrat etwa sitzen Regierungsvertreter.
Die beiden Konzerne sind von zahlreichen Offenlegungsvorschriften der Börsenaufsicht SEC ausgenommen, an die alle anderen börsennotierten Unternehmen sich halten müssen. Und sie haben beim Finanzministerium eine jederzeit abrufbare Kreditlinie über 2,25 Mrd. $. Außerdem zahlen weder Fannie noch Freddie Steuern an die Bundesstaaten oder Gemeinden. Das alles ist gesetzlich fixiert.
Ungeschriebene Privilegien
Nicht festgeschrieben ist hingegen ein Privileg, das für ihr Geschäft so wichtig ist wie kein anderes: Ihre Investoren gehen davon aus, dass beide eine staatliche Kreditgarantie genießen, also notfalls von der Regierung gerettet würden, um einen Bankrott zu verhindern.
Diese Annahme beschert den Anleihen von Fannie und Freddie ihre Triple-A-Bewertung, also die höchste Stufe, die die Kreditbewertungsagenturen vergeben. Und diese Annahme verhinderte auch, dass in der vergangenen Woche die Freddie Mac-Bonds wie die Aktien abstürzten. Der Aktienkurs sank um mehr als 20 Prozent.
Freddie Mac selbst bestreitet die Staatsgarantie. "Wir lassen keinen Zweifel daran, dass unsere Wertpapiere nicht von der Regierung garantiert werden", sagte Freddie Macs Ex-Chef Leland Brendsel kurz vor seinem erzwungenen Rücktritt. "Das ist das Gesetz, und das ist sehr klar kommuniziert."
Der Widerspruch zwischen der Wirklichkeit und der Wahrnehmung der Investoren treibt den Aufpassern der Fed den Angstschweiß auf die Stirn: Haben die Marktteilnehmer ihre Investitionsentscheidungen unter falschen Annahmen getroffen und wird nun ein Risiko offensichtlich, dann könnte eine Panik einsetzen, die Freddie, Fannie und schließlich der ganzen US-Wirtschaft einen kaum kalkulierbaren Schlag versetzt.
Zwang zu Reformen
Schnell müssten Reformen her, fordern die Marktbeobachter. Der Zwitterstatus ist ein Erbe der Depression in den 30er Jahren. Nach der Wirtschaftskrise entschloss sich die Regierung, den Eigenheimbesitz zu fördern, und gründete die Federal National Mortgage Association (FNMA), deren Abkürzung die Amerikaner schnell zu "Fannie Mae" verballhornten. 1970 gründete die Regierung dann Freddie Mac, um wenigstens ein wenig Konkurrenz in den Hypothekenmarkt zu bringen. 1989 ging Freddie an die Börse.
Ob der Skandal sich ausweitet oder nicht, die nächste Reform steht wohl bevor. Der Kongress hat schon eine Anhörung angesetzt. Die Themen: mehr Offenlegungspflichten, Zwang zu mehr Eigenkapital und ein Abbau der Steuerprivilegien.
Frühere Anläufe zu Reformen haben Fannie und Freddie stets mit Lobbying in Washington bekämpft. Änderungen würden das Geschäft weniger profitabel machen, die Zinsen erhöhen, die sie für ihre Anleihen zahlen, die sie aufnehmen, um den Banken Hypotheken abzukaufen.
Es sieht also so aus, als könnte Gregory Parseghian neue Freunde in Washington dringend gebrauchen. Er hat mit dem Werben schon angefangenen: "Die Aufklärung der Bilanzfragen ist meine oberste Priorität."
© 2003 Financial Times Deutschland , © Illustration: Quelle: Freddie Mac

Washington (vwd) - Die Realeinkommen in den USA sind im Mai gegenüber dem
Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag
mitteilte, war im April ein Anstieg um 0,2 (vorläufig: minus 0,3) Prozent zu
verzeichnen gewesen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den
Angaben der Behörde zufolge im Mai saison- und inflationsbereinigt 279,74
USD nach revidiert 278,37 (vorläufig 277,55) USD im Vormonat.
vwd/DJ/6.2003/jej/h



Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag
mitteilte, war im April ein Anstieg um 0,2 (vorläufig: minus 0,3) Prozent zu
verzeichnen gewesen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den
Angaben der Behörde zufolge im Mai saison- und inflationsbereinigt 279,74
USD nach revidiert 278,37 (vorläufig 277,55) USD im Vormonat.
vwd/DJ/6.2003/jej/h



Zu Freddie & Fannie  .
.
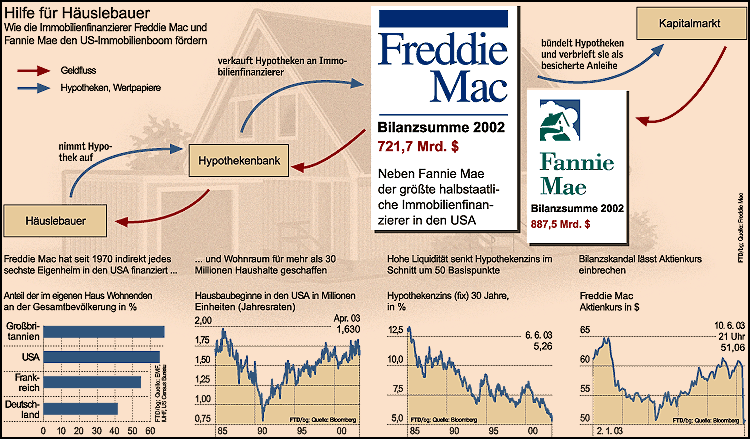
syr
 .
.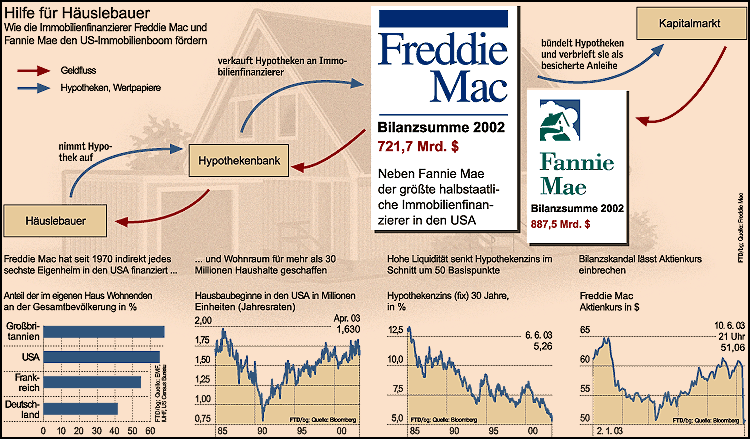
syr

ich hab die grafik vergessen 
danke syr
kommste drüben echt nicht rein

danke syr

kommste drüben echt nicht rein

@syr
#280
vielen Dank für die grafische Übersicht
bündelt Hypotheken und verbrieft sie als besicherte
Anleihen
da dem Aktien-crash Okt1987
ca. 6 Monate vorher ein Anleihe-Crash vorauslief
könnte es diesmal genauso laufen.
Anleihen und Bond-Märkte müssten sich doch auch in
gewisser Weise beeinflussen.
#280
vielen Dank für die grafische Übersicht
bündelt Hypotheken und verbrieft sie als besicherte
Anleihen
da dem Aktien-crash Okt1987
ca. 6 Monate vorher ein Anleihe-Crash vorauslief
könnte es diesmal genauso laufen.
Anleihen und Bond-Märkte müssten sich doch auch in
gewisser Weise beeinflussen.
Mal wieder was der schrägen Sorte:



Jo Dolby, wir haben neuen Firewall und da klemmt was bei Cookie, Popup, und soweiter. Hier ja auch bescheuerte Werbung bzw. Belästigung .
.
syr



Jo Dolby, wir haben neuen Firewall und da klemmt was bei Cookie, Popup, und soweiter. Hier ja auch bescheuerte Werbung bzw. Belästigung
 .
.syr

Trotzdem hat man es auch heute wieder geschafft, daß die US-Indices zumindest nicht im Minus geschlossen haben.
Somit kann sich der Durschnittsamerikaner weiter reich fühlen, Schulden machen und kräftig konsumieren.
"Es gibt zwei Dinge die unendlich sind, die Dummheit der Menschen und das Universum. Wobei das zweite noch nicht vollständig erwiesen ist." Albert Einstein
Nirgendwo wird das derzeit mehr bestätigt, als durch das Börsengeschehen der letzten drei Monate.


CU Jodie
Somit kann sich der Durschnittsamerikaner weiter reich fühlen, Schulden machen und kräftig konsumieren.
"Es gibt zwei Dinge die unendlich sind, die Dummheit der Menschen und das Universum. Wobei das zweite noch nicht vollständig erwiesen ist." Albert Einstein
Nirgendwo wird das derzeit mehr bestätigt, als durch das Börsengeschehen der letzten drei Monate.



CU Jodie
Girls` Wild School Brawl Caught On Tape
Students Say Female Fistfight Is Last-Day Ritual
POSTED: 12:55 a.m. EDT June 17, 2003
PITTSBURGH -- More than a dozen girls started fistfighting after an early dismissal on the last day of classes Monday at Peabody High School, WTAE`s Jon Greiner reported.
Action News obtained a copy of a videotape of the altercation, which started on school grounds around 10:30 a.m. and continued on the streets of East Liberty. The student who shot the footage said she wasn`t in school that day, but went there when classes let out because she and others had heard there would be fights.
One girl was arrested for disorderly conduct and another was cited for failing to disperse. Four boys who never threw a punch were also cited for failing to disperse.
Robert Fadzen, chief of safety for Pittsburgh Public Schools, denied that administrators knew the fighting was planned.
"We had no indications whatsoever from our side or the Pittsburgh Police side," said Fadzen. "We deal with information like that on almost a daily basis. It kind of caught us off-guard because we have had no problems there. It`s been a very, very quiet year at Peabody."
But students said it has become somewhat of a tradition for girls to settle their differences this way. They said it was well-known that the violence was being planned.
"People knew this was coming because it almost happened on Friday. They should have known that it was going to be the last day of school and there was going to be fighting everywhere," student Marcie Rucker said.
"There were students talking the whole year about their enemies and how they`re going to fight. It happens every year," said another girl, who didn`t want to be identified. "They`re going to fight at the end of the year, and they just fought today."
Fadzen said that`s simply not true.
"The biggest things we`ve had as an end-of-the-year tradition was water balloons and squirt guns," he said. "We`ve never had that (fighting). I have been here nine years now and I have never seen that."
Fadzen said the incident was merely some enthusiasm about the summer break that got out of hand.
The school district issued a statement titled "Peabody Incident Blown Way Out Of Proportion," which says that no one was injured, no weapons were used and police were only called as a preventive measure. The statement called the fights "minor skirmishes."




http://www.thepittsburghchannel.com/education/2274104/detail…



syr
Students Say Female Fistfight Is Last-Day Ritual
POSTED: 12:55 a.m. EDT June 17, 2003
PITTSBURGH -- More than a dozen girls started fistfighting after an early dismissal on the last day of classes Monday at Peabody High School, WTAE`s Jon Greiner reported.
Action News obtained a copy of a videotape of the altercation, which started on school grounds around 10:30 a.m. and continued on the streets of East Liberty. The student who shot the footage said she wasn`t in school that day, but went there when classes let out because she and others had heard there would be fights.
One girl was arrested for disorderly conduct and another was cited for failing to disperse. Four boys who never threw a punch were also cited for failing to disperse.
Robert Fadzen, chief of safety for Pittsburgh Public Schools, denied that administrators knew the fighting was planned.
"We had no indications whatsoever from our side or the Pittsburgh Police side," said Fadzen. "We deal with information like that on almost a daily basis. It kind of caught us off-guard because we have had no problems there. It`s been a very, very quiet year at Peabody."
But students said it has become somewhat of a tradition for girls to settle their differences this way. They said it was well-known that the violence was being planned.
"People knew this was coming because it almost happened on Friday. They should have known that it was going to be the last day of school and there was going to be fighting everywhere," student Marcie Rucker said.
"There were students talking the whole year about their enemies and how they`re going to fight. It happens every year," said another girl, who didn`t want to be identified. "They`re going to fight at the end of the year, and they just fought today."
Fadzen said that`s simply not true.
"The biggest things we`ve had as an end-of-the-year tradition was water balloons and squirt guns," he said. "We`ve never had that (fighting). I have been here nine years now and I have never seen that."
Fadzen said the incident was merely some enthusiasm about the summer break that got out of hand.
The school district issued a statement titled "Peabody Incident Blown Way Out Of Proportion," which says that no one was injured, no weapons were used and police were only called as a preventive measure. The statement called the fights "minor skirmishes."




http://www.thepittsburghchannel.com/education/2274104/detail…



syr
http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF_106a/T05.HTM
Ein neues «American Century»?
Der Irak und die heimlichen Euro-Dollar-Kriege
von F. William Engdahl, USA / Deutschland
Trotz des scheinbar raschen militärischen Erfolgs der USA im Irak ist der Dollar schwächer statt stärker. Dies ist eine unerwartete Entwicklung, da viele Devisenhändler einen gestärkten Dollar erwartet hatten, sobald die Nachricht eines US-Sieges gemeldet würde. Die Kapitalströme bewegen sich weg vom Dollar hin zum Euro. Viele beginnen sich zu fragen, ob die objektive Situation der US-Wirtschaft weitaus schlechter ist, als die Börse meldet. Die Zukunft des Dollars ist keineswegs nur eine unbedeutende Angelegenheit, die nur Banken oder Devisenhändler interessiert. Er ist das Kernstück der «Pax Americana» oder, wie es auch genannt wird, des «American Century», des Systems, auf dem die Rolle Amerikas in der Welt beruht. Doch während der Dollar nach dem Ende der Kämpfe im Irak ständig an Wert gegenüber dem Euro verliert, scheint Washington in öffentlichen Stellungnahmen das Absinken des Dollars absichtlich noch schlimmer darzustellen. Was jetzt passiert, ist ein Machtspiel von höchster geopolitischer Bedeutung, vielleicht sogar das verhängnisvollste seit dem Aufkommen der USA als führender Weltwirtschaftsmacht im Jahre 1945.
Die Koalition der Interessen, die im Irak-Krieg zusammenflossen, einem Krieg, der für die USA eine strategische Notwendigkeit darstellte, umfasste nicht nur die vernehmbaren und deutlich sichtbaren neokonservativen Falken um Verteidigungsminister Rumsfeld und seinen Stellvertreter, Paul Wolfowitz. Es standen auch mächtige langfristige Interessen dahinter, von deren globaler Rolle der Einfluss der amerikanischen Wirtschaft abhängt, wie beispielsweise der einflussreiche Energiesektor um Halliburton, Exxon Mobil, Chevron Texaco und andere multinationale Riesenkonzerne. Dazu gehören auch die gigantische amerikanische Waffenindustrie um Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon, Northrup-Grumman und andere. Der springende Punkt für diese riesigen Verteidigungs- und Energie-Konglomerate sind nicht die paar einträglichen Aufträge vom Pentagon für den Wiederaufbau der irakischen Ölanlagen, die die Taschen von Dick Cheney und anderen füllen. Es geht vielmehr um den Erhalt der amerikanischen Macht in den kommenden Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts. Das bedeutet nicht, dass bei diesem Prozess keine Profite gemacht werden, aber das ist nur ein Nebenprodukt dieses globalen strategischen Ziels.
Die Rolle des Dollars in Washingtons Machtkalkül
Bei diesem Machtspiel wird die Bedeutung, die der Erhalt des Dollars als die Währungsreserve der Welt hat, am wenigsten verstanden, welcher aber der wichtigste Antrieb hinter dem Machtkalkül Washingtons gegenüber dem Irak in den letzten Monaten darstellt. Die amerikanische Vorherrschaft in der Welt beruht grundsätzlich auf zwei Säulen - ihrer überwältigenden militärischen Überlegenheit, vor allem auf dem Meer, und ihrer Kontrolle über die Wirtschaftsströme der Welt durch die Rolle des Dollars als der Währungsreserve der Welt. Es wird immer deutlicher, dass es im Irak-Krieg mehr darum ging, die zweite Säule, die Rolle des Dollars, aufrechtzuerhalten, als um die erste, das Militär. Was die Rolle des Dollars angeht, ist das Öl ein strategischer Faktor.
Die drei Phasen des «American Century»
Wenn wir rückblickend die Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrachten, kann man mehrere deutliche Entwicklungsphasen der amerikanischen Rolle in der Welt erkennen. Die erste Phase, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945-1948 und am Anfang des kalten Krieges begann, könnte man die Zeit des Bretton-Woods-Goldsystems nennen.
Phase I: Die Zeit der Bretton-Wood-Institution
Unter dem Bretton-Wood-System unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ordnung relativ stabil. Die USA waren aus dem Krieg als die alleinige Supermacht hervorgegangen mit einer starken industriellen Basis und den grössten Goldreserven aller Nationen. Die Anfangsaufgabe war es, Westeuropa wieder aufzubauen und eine Nordatlantik-Allianz gegen die Sowjetunion zu schaffen. Die Rolle des Dollars war direkt mit der des Goldes verknüpft. Solange Amerika die grössten Goldreserven besass und seine Wirtschaft weltweit am effizientesten produzierte, war die gesamte Bretton-Woods-Währungsstruktur vom französischen Franc über das britische Pfund Sterling bis zur deutschen Mark stabil. Im Zusammenhang mit der Unterstützung des Marshallplans und Krediten zur Finanzierung des Wiederaufbaus des vom Kriege zerschlagenen Europas wurden Dollarkredite ausgedehnt. Die amerikanischen Firmen, darunter auch die multinationalen Ölkonzerne, verdienten reichlich durch diese Vorherrschaft des Handels zu Beginn der 1950er Jahre. Washington unterstützte sogar das Zustandekommen des Vertrags von Rom im Jahre 1958, um die europäische Wirtschaftsstabilität zu stärken und damit weitere US-Exportmärkte zu schaffen. Diese Anfangsphase, die der Herausgeber des Time Magazine, Henry Luce, das «American Century» nannte, war, was die Wirtschaftsgewinne betraf, recht «positiv», sowohl für die USA als auch für Europa. Die USA hatten immer noch einen wirtschaftlichen Spielraum, in dem sie sich bewegen konnten.
Dies war die Ära der liberalen amerikanischen Aussenpolitik. Die USA waren der Hegemon innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft. Da sie im Vergleich zu Europa, Japan und Südkorea über enorme Goldreserven und Wirtschaftsressourcen verfügten, konnten es sich die USA durchaus leisten, ihre Handelsgrenzen für Exporte aus Europa und Japan zu öffnen. Als Gegenleistung unterstützen die Europäer und Japaner die USA bei ihrer Rolle während des kalten Krieges.
Während der 1950er und frühen 1960er Jahre beruhte die amerikanische Führung weniger auf direktem Zwang als auf dem Herstellen eines Konsenses mit den Alliierten, sei es bei GATT-Handelsrunden oder in anderen Bereichen. Eliteorganisationen wie die Bilderberger-Treffen wurden organisiert, um einen zufriedenstellenden gemeinsamen Konsens zwischen Europa und den USA zu erreichen.
Diese erste, eher «freundliche» Phase des «American Century» ging in den frühen 1970ern zu Ende.
Ende des Bretton-Wood-Systems
Das Bretton-Woods-Goldsystem begann zusammenzubrechen, weil Europa wirtschaftlich auf eigene Füsse kam und Mitte der 1960er eine bedeutende Exportregion wurde. Diese zunehmende wirtschaftliche Stärke Westeuropas fiel zusammen mit den ansteigenden öffentlichen Defiziten der USA, weil Johnson den tragischen Krieg in Vietnam eskalieren liess. Während der 1960er Jahre begann Frankreichs General de Gaulle für die Gewinne aus den französischen Exporten aus den amerikanischen Staatsreserven Gold statt Dollars zu verlangen, was während der Zeit von Bretton Woods durchaus legal war. Gegen November 1967 war aber der Goldfluss aus den USA und aus den Tresoren der Bank von England kritisch geworden. Das schwache Glied in der Kette des Bretton-Woods-Goldsystems war England, der «kranke Mann Europas». Die Kette riss, weil der Sterling im Jahre 1967 entwertet wurde. Das beschleunigte nur noch den Druck auf den US-Dollar, da französische und andere Zentralbanken ihre Forderungen nach US-Gold im Tausch für ihre Dollarreserven verstärkten. Sie kalkulierten die steigenden Kriegsdefizite durch den Vietnam-Krieg mit ein, und es würde nur noch eine Frage von Monaten sein, bis die USA selber gezwungen sein würden, ihren Dollar gegen das Gold abzuwerten, um wenigstens noch einen guten Preis für ihr Gold erzielen zu können.
Aufhebung der Geldfindung - Einführung freier Wechselkurse (floating)
Im Mai 1971 war der Fluss der US-Goldreserven besorgniserregend geworden. Sogar die Bank von England hatte sich den Franzosen und ihren Forderungen nach Gold gegen Dollars angeschlossen. Das war der Punkt, an dem die Nixon-Administration dafür plädierte, das Gold vollständig aufzugeben und im August 1971 zu einem System der «frei flotierenden» Währungen überzugehen, statt einen Kollaps der US-Goldreserven zu riskieren.
Der Bruch mit dem Gold öffnete den Weg für eine völlig neue Phase des «American Century». In dieser neuen Phase wurde die Kontrolle über die Währungspolitik durch grosse internationale Banken wie die Citibank, Chase Manhattan oder Barclays Bank de facto privatisiert. Sie übernahmen die Rolle, die die Zentralbanken beim Goldsystem innegehabt hatten, jedoch nun völlig ohne Gold. «Freie Marktentwicklungen» konnten nun den Dollar festlegen. Und sie taten es mit Macht.
Das freie Floaten des Dollars schaffte gleichzeitig mit dem Anstieg des Opec-Ölpreises um 400% im Jahre 1973 nach dem Yom-Kippur-Krieg eine Basis für eine zweite Phase des «American Century», die Phase des Petrodollars.
Phase II: Das Petrodollar-Recycling
Mitte der siebziger Jahre durchlief das System des «American Century» globaler wirtschaftlicher Dominanz einen dramatischen Wandel. Ein anglo-amerikanischer Ölschock schuf plötzlich eine starke Nachfrage nach dem «floating dollar», das heisst einem Dollar mit frei flotierendem Wechselkurs. Ölimportierende Länder von Deutschland über Argentinien bis Japan waren alle mit dem Problem konfrontiert, wie sie in Dollar exportieren konnten, um ihre neuen hohen Rechnungen für den Ölimport zu zahlen. Die Opec-Länder wurden mit neuen Öldollars überflutet. Ein grosser Teil dieser Öldollars kam auf Londoner und New Yorker Banken, wo ein neuer Prozess in Gang gesetzt wurde. Henry Kissinger gab ihm die Bezeichnung «Das Recycling von Petrodollars». Die Recycling-Strategie wurde bereits im Mai 1971 beim Bilderberger-Treffen in Saltsjoebaden, Schweden, diskutiert. Sie wurde von den amerikanischen Mitgliedern der Bilderberg-Gruppe präsentiert; die Details werden ausführlich dargestellt im Buch «Mit der Ölwaffe zur Weltmacht».1
Petrodollar-Recyling: Der Beginn der Schuldenkrise der dritten Welt
Die Opec erstickte fast an Dollars, die sie nicht brauchen konnten. Amerikanische und britische Banken nahmen die Opec-Dollar und verliehen sie in Form von Eurodollar-Bonds oder -Darlehen weiter an Drittweltländer, die dringend Dollar aufnehmen mussten, um ihre Ölimporte zu finanzieren. Die Anhäufung dieser Petrodollar-Schulden in den späten siebziger Jahren legte die Basis für die Schuldenkrise der Drittweltländer in den achtziger Jahren. Hunderte Milliarden Dollars wurden zwischen Opec, Londoner und New Yorker Banken und zurück in die Geld aufnehmenden Länder der dritten Welt recycelt.
Der IWF wird «Schuldenpolizist»
Im August 1982 brach die Kette schliesslich, und Mexiko kündigte an, dass es wahrscheinlich den Rückzahlungen seiner Eurodollar-Schulden nicht nachkommen würde. Die Schuldenkrise der dritten Welt begann, nachdem Paul Volcker und die US-amerikanische Notenbank Ende 1979 einseitig den US-Zinssatz angezogen hatten, als Versuch den schwachen Dollar zu retten. Nach drei Jahren mit rekordhohen US-Zinsen war der Dollar «gerettet», aber der Sektor der Entwicklungsländer drohte wirtschaftlich unter den US-Wuchserzinsen auf ihren Petrodollar-Darlehen zu ersticken. Um für die Rückzahlung der Schulden an die Londoner und New Yorker Banken zu sorgen, schalteten die Banken den IWF ein, der als «Schuldenpolizist» zu fungieren hatte. Öffentliche Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt wurden auf Anordnung des IWF zusammengestrichen, um sicherzustellen, dass der Schuldendienst für die Petrodollars gegenüber den Banken rechtzeitig geleistet werden konnte.
Die Phase der Hegemonie des Petrodollars war ein Versuch des US-Establishments, den eigenen geopolitischen Niedergang als weltbeherrschendes Zentrum des Nachkriegssystems zu verlangsamen. Der Washington-Konsens des IWF wurde entwickelt, um die drakonischen Schulden der Drittweltländer einzutreiben, um sie zur Rückzahlung der Dollarschulden zu zwingen, was jegliche wirtschaftliche Unabhängigkeit der Länder im Süden verhinderte und den US-Banken half, den Dollar über Wasser zu halten.
Trilaterale Kommission - die Einbindung Japans
1973 wurde die Trilaterale Kommission von David Rockefeller und anderen ins Leben gerufen, um mit dem Aufkommen Japans als Industriegiganten fertig zu werden und zu versuchen, Japan in das System einzubinden. Japan war als grössere Industrienation ein wichtiger Importeur von Öl. Japans Handelsüberschüsse durch die Exporte von Autos und anderen Gütern wurden verwendet, um Öl mit Dollars zu kaufen. Die restlichen Überschüsse wurden in zinsbringende US-Schatzbriefe (Treasury bonds) investiert, um Zinsen abzuschöpfen. Die G-7 (heute G-8) wurde gegründet, um Japan und Westeuropa innerhalb des US-Dollar-Systems zu halten. Bis in die achtziger Jahre hinein verlangten verschiedene Stimmen in Japan immer wieder, dass sich die drei Währungen - der Dollar, die Deutsche-Mark und der Yen - die Rolle der Weltreserve teilen sollten. Das geschah niemals. Der Dollar blieb dominant.
Von einem engen Blickwinkel aus betrachtet schien die Hegemoniephase des Petrodollars zu funktionieren. Darunter war sie weltweit auf einem Niedergang des wirtschaftlichen Lebensstandard aufgebaut, da die Vorgaben des IWF das Wachstum der nationalen Wirtschaften zerstörten und die Märkte für globalisierende multinationale Unternehmen aufbrachen, die in den achtziger und insbesonders in den neunziger Jahren ihre Produktion in billige Länder verlegen wollten.
Aber sogar in der Petrodollar-Phase war die amerikanische Aussenhandels- und Militärpolitik immer noch von Stimmen des traditionellen liberalen Konsensus dominiert. Die amerikanische Macht hing davon ab, periodisch neue Handelsabkommen oder andere Fragen mit den US-Verbündeten in Europa, Japan und Asien auszuhandeln.
Phase III beginnt: Der Petro-Euro - ein Rivale?
Das Ende des kalten Krieges und das Aufkommen eines neuen geeinten Europas und der Europäischen Währungsunion in den frühen 90er Jahren stellte eine vollkommen neue Herausforderung für das «American Century» dar. Es dauerte einige Jahre, mehr als eine Dekade nach dem ersten Golfkrieg 1991, bis diese neue Herausforderung sich in ihrem ganzen Ausmass zeigte. Der gegenwärtige Irak-Krieg wird nur auf dem Hintergrund eines gewaltigen Kampfes innerhalb der neuen, dritten Phase zur Sicherung amerikanischer Vorherrschaft verständlich. Diese Phase ist bereits «demokratischer Imperialismus» genannt worden, ein Lieblingsbegriff von Max Boot und anderen Neokonservativen. Wie die Ereignisse im Irak nahelegen, wird sie wahrscheinlich nicht sehr demokratisch, wohl aber imperialistisch sein.
Im Gegensatz zu der ersten Zeit nach 1945 ist in dieser neuen Ära die Offenheit der USA gegenüber den anderen Mitgliedern der G-7, ihnen Konzessionen zu gewähren, verschwunden. Jetzt ist ungeschminkte Macht das einzige Instrument, die amerikanische Dominanz langfristig aufrechtzuerhalten. Am besten wird dieser Logik von den neokonservativen Falken um Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol und anderen Ausdruck verliehen.
Es muss aber betont werden, dass die Neokonservativen seit dem 11. September solchen Einfluss haben, weil die Mehrheit des US-Machtestablishments diese Ansichten als nützlich erachteten, um eine neue aggressive Rolle der USA in der Welt voranzutreiben.
Statt mit den europäischen Partnern Übereinkünfte auszuarbeiten, betrachtet Washington Euroland zunehmend als bedeutende strategische Bedrohung für die amerikanische Hegemonie, vor allem das «Alte Europa» mit Deutschland und Frankreich. Genau wie Grossbritannien während seines wirtschaftlichen Verfalls nach 1870 zunehmend Rettung in verzweifelten imperialen Kriegen in Südafrika und anderswo suchte, benützten die USA ihre militärische Macht, um das zu erreichen, was sie mit wirtschaftlichen Mitteln nicht mehr erreichen können. Hierbei ist der Dollar die Archillesferse.
Mit der Schaffung des Euro in den letzten fünf Jahren wurde dem globalen System ein völlig neues Element hinzugefügt, welches bestimmt, was wir die dritte Phase des «American Century» nennen. Diese Phase, in der der Irak-Krieg eine zentrale Rolle spielt, droht eine neue, bösartige und imperialistische Phase zu werden, welche die früheren Phasen amerikanischer Hegemonie ersetzen soll. Die Neokonservativen sprechen über diese imperialistische Agenda offen, während die eher traditionellen Vertreter der US-Politik sie abzustreiten versuchen. Die wirtschaftliche Realität, der sich der Dollar am Anfang des neuen Jahrhunderts gegenüber sieht, definiert diese neue Phase in einer verhängnisvollen Weise.
Phase III: Dauernde Dominanz durch rohes Diktat
Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden ersten Phasen des «American Century» - von 1945 bis 1973 und von 1973-1999 - und dieser neuen, sich herausbildenden Phase andauernder Dominanz in der Folge des 11. September und des Irak-Kriegs. Nach 1945 bis heute war die amerikanische Macht vor allem von der Art eines Hegemon. Ein Hegemon dominiert in einer Welt, in der die Macht ungleich verteilt ist, und seine Macht entsteht nicht nur durch Gewalt, sondern im Einverständnis mit seinen Verbündeten. Das ist auch der Grund, wieso der Hegemon zu bestimmten Diensten gegenüber den Verbündeten verpflichtet ist, wie beispielsweise militärische Sicherheit und Regulierung der Weltmärkte zum Vorteil einer grösseren Gruppe - ihn selbst eingeschlossen - zu leisten. Eine imperialistische Macht hat keine solchen Verpflichtungen gegenüber Verbündeten, einzig das rohe Diktat, wie es seine niedergehende Macht aufrechterhalten kann, was manche als «imperial overstretch» bezeichnen («imperiale Überdehung»). Das ist die Welt, die Amerika auf Anraten der neokonservativen Falken um Rumsfeld und Cheney mit einer Politik der Präemptivkriege beherrschen soll.
Ein versteckter Krieg um die globale Hegemonie zwischen dem Dollar und der neuen Währung des Euro steht im Zentrum dieser neuen Phase.
Die zwei Säulen der US-Herrschaft: militärische Vormacht ...
Will man die Bedeutung dieser unausgesprochenen Schlacht um die Währungshegemonie verstehen, muss man zuerst verstehen, dass die US-Hegemonie seit dem Aufkommen der Vereinigten Staaten als dominierende Weltmacht nach 1945 auf zwei Säulen geruht hat, die nicht anzufechten waren. Die erste ist die militärische Überlegenheit gegenüber allen Gegnern. Die Vereinigten Staaten geben für die Verteidigung heute mehr als dreimal soviel aus wie die gesamte Europäische Union, nämlich über 396 Milliarden Dollar gegenüber 118 Milliarden Dollar im Vorjahr, und mehr als alle 15 nächstgrösseren Nationen zusammen. Washington plant innerhalb der nächsten fünf Jahre weitere 2,1 Billionen [2100 Milliarden] Dollar für die Verteidigung auszugeben. Keine Nation und keine Gruppe von Nationen kann mit diesen Verteidigungsausgaben schritthalten. China ist mindestens 30 Jahre davon entfernt, eine ernstzunehmende militärische Bedrohung zu werden. Niemand ist ein ernsthafter Gegenspieler gegen die amerikanische Militärmacht.
... und US-Dollar als Weltwährung
Die zweite Säule der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt ist die dominierende Rolle des US-Dollars als Weltwährung. Bis zur Einführung des Euro Anfang 1999 gab es keine potentielle Herausforderung der Dollarvorherrschaft im Welthandel. Seit den siebziger Jahren war der Petrodollar Kern der Dollarhegemonie. Letztere ist für die Zukunft einer amerikanischen Weltherrschaft in vieler Hinsicht strategisch ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger als die überwältigende militärische Macht.
Papiergeld Dollar
Die entscheidende Veränderung fand statt, als Nixon die Bindung des Dollars an den Goldstandard kündigte, um freie Wechselkurse mit anderen Währungen einzuführen. Dadurch wurden die Beschränkungen, neue Dollarnoten zu drucken, beseitigt. Die einzige Beschränkung bestand nur noch darin, wie viele Dollars der Rest der Welt nehmen würde. Durch ihren festen Vertrag mit Saudi-Arabien, dem grössten Ölproduzenten der Opec, garantierte Washington, die Erzeugerin des «swings» (die preisbestimmende Menge Öl), dass Öl - der häufigste Rohstoff der Welt, der wichtigste für die Wirtschaft einer jeder Nation, die Grundlage für jeden Transport und für vieles in der Industriewirtschaft - auf den Weltmärkten nur noch gegen Dollars erhältlich war. Der Deal wurde im Juni 1974 von Staatssekretär Henry Kissinger durch die Gründung der US-Saudiarabischen Joint Commission on Economic Cooperation abgeschlossen.
Dollarbindung des Öls
Die amerikanische Schatzkammer und die amerikanische Zentralbank würden der Saudi-arabischen Zentralbank, SAMA, «erlauben», amerikanische Staatsanleihen mit saudischen Petrodollars zu kaufen. 1975 erklärten sich die Opec-Länder offiziell dazu bereit, ihr Öl nur gegen Dollars zu verkaufen. Eine geheime Erklärung des amerikanischen Militärs, Saudi-Arabien zu bewaffnen, war die Gegenleistung.
Bis November 2000 wagte kein Opec-Land, die Dollarpreisregel zu verletzen. Solange der Dollar die stärkste Währung war, gab es auch wenig Anlass dafür. Aber im November 2000 überzeugten Frankreich und andere Mitgliedstaaten der EU Saddam Hussein, sich den USA zu widersetzen, indem er das irakische Öl-für-Nahrungsmittel nicht in Dollars, «der Feindwährung», wie der Irak sie nannte, sondern nur in Euro verkaufe. Die Euros befanden sich auf einem speziellen UN-Konto bei der führenden französischen Bank, BNP Paribas. Radio Liberty des amerikanischen Aussenministeriums brachte darüber eine kurze Meldung in den Nachrichten, die Geschichte wurde aber schnell zum Schweigen gebracht.2
Dieser kaum wahrgenommene Schritt des Irak, sich dem Dollar zugunsten des Euro zu widersetzen, war für sich genommen unbedeutend. Doch, wenn das sich ausgebreitet hätte, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem der Dollar schon geschwächt war, hätte das einen panischen Verkauf von Dollars durch ausländische Zentralbanken und Opec-Ölproduzenten bewirken können. In den Monaten vor dem jüngsten Irak-Krieg waren Anzeichen, die in diese Richtung deuteten, aus Russland, dem Iran, Indonesien und sogar Venezuela zu hören.
Der Irak-Krieg - tödliche Warnung zur Rettung des Dollars?
Ein Opec-Beamter aus dem Iran, Javad Yarjani, lieferte eine detaillierte Analyse darüber, wie die Opec in naher Zukunft ihr Öl an die EU gegen Euro und nicht gegen Dollars verkaufen würden. Im April 2002 sprach Yarjani in Oviedo in Spanien an einer Einladung der EU. Es sprechen alle Anzeichen dafür, dass der Irak-Krieg gezielt als der einfachste Weg angezettelt wurde, um eine tödliche vorsorgliche Warnung an die Opec-Länder und andere zu schicken, nicht damit zu liebäugeln, das System des Petrodollars zugunsten eines Systems, das auf dem Euro basiert, fallenzulassen.
Informierte Bankierskreise in der City of London (dem Finanzplatz von London) und an anderen Orten Europas bestätigen vertraulich die Bedeutung dieser wenig zur Kenntnis genommenen Bewegung des Irak vom Petro-Dollar zum Petro-Euro. «Der Schritt des Irak war eine Kriegserklärung gegen den Dollar», erzählte mir neulich ein ehemaliger Londoner Bankier. «Sobald es klar war, dass England und Amerika den Irak eingenommen hatten, war ein grosser Seufzer der Erleichterung in den Banken der Londoner City zu hören. Sie sagten vertraulich, Ðjetzt müssen wir uns um diese verdammte Bedrohung durch den Euro keine Sorgen mehr machenð.»
Warum sollte etwas so Kleines eine so grosse strategische Bedrohung für London und New York oder für die Vereinigten Staaten sein, dass ein amerikanischer Präsident dafür offensichtlich fünfzig Jahre alliierter Beziehungen in der ganzen Welt riskiert und mehr noch, einen militärischen Angriff startet, dessen Rechtfertigung vor der Welt nicht bestehen konnte?
Petrodollar stützt die amerikanische Weltherrschaft
Die Antwort liegt in der einzigartigen Rolle des Petro-Dollars für die Untermauerung der amerikanischen Wirtschaft.
Wie funktioniert das? Solange fast 70% des Welthandels in Dollar abgewickelt werden, ist der Dollar die Währung, die die Zentralbanken als Reserve ansammeln. Aber die Zentralbanken, sei es in China, Japan, Brasilien oder Russland häufen nicht einfach nur Dollars in ihren Tresoren an. Währungen haben einen Vorteil gegenüber Gold. Eine Zentralbank kann sie benutzen, um staatliche Oligationen vom Herausgeber, den Vereinigten Staaten zu kaufen. Die meisten Länder der Welt sind gezwungen, ihre Handelsdefizite unter Kontrolle zu behalten, wollen sie sich nicht mit einem Währungszerfall konfrontiert sehen. Die Vereinigten Staaten nicht. Das liegt an der Rolle des Dollars als Reservewährung. Und die Untermauerung dieser Rolle als Reservewährung ist der Petrodollar. Jede Nation muss Dollars bekommen, um Öl importieren zu können, manche mehr als andere. Das hat zur Folge, dass ihr Handel sich an Dollar-Länder richtet, an die USA mehr als an alle anderen.
Weil Öl der wichtigste Rohstoff für jede Nation ist, verlangt das Petrodollar-System, das bis heute existiert, die Entwicklung riesiger Handelsüberschüsse, um Dollarüberschüsse anzusammeln. Dies gilt für alle Länder ausser einem - den USA, die den Dollar beherrschen und ihn nach Belieben oder per Dekret drucken. Weil heute der Grossteil des gesamten internationalen Handels in Dollar abgewickelt wird, müssen die Länder ins Ausland gehen, um die Zahlungsmittel zu bekommen, die sie nicht selbst herausgeben können. Die Struktur des gesamten Welthandels bewegt sich heute rund um diese Dynamik, von Russland bis China, von Brasilien bis Südkorea und Japan. Jeder ist darauf aus, Dollarüberschüsse aus dem Export zu maximieren.
Um diesen Prozess in Gang zu halten, haben die Vereinigten Staaten sich bereit erklärt, der letzte Importeur zu sein, falls sich kein anderer mehr findet, weil die ganze monetäre Hegemonie von diesem Dollar-Recycling abhängt.
Die Zentralbanken von Japan, China, Südkorea, Russland und den anderen Ländern kaufen mit ihren Dollars alle Sicherheiten auf die US-Staatsanleihen, um damit Zinsen für ihre Dollar zu gewinnen. Sie legen sie nicht unter ihre Matratze. Das wiederum erlaubt den Vereinigten Staaten, einen stabilen Dollar und deutlich tiefere Zinssätze und mit dem Rest der Welt ein Zahlungsbilanzdefizit im Wert von 500 Milliarden Dollar zu haben. Die amerikanische Zentralbank beherrscht die Druckerpressen für den Dollar, und die Welt braucht Dollars. So einfach ist das.
Die Bedrohung der USA durch Auslandschulden
Aber vielleicht ist es doch nicht so einfach: Es ist ein äusserst instabiles System, weil die amerikanischen Handelsdefizite und Nettoschulden oder Aktiva und Passiva gegenüber ausländischen Konten inzwischen gut über 22% des Bruttosozialprodukts aus dem Jahre 2000 liegen und weiterhin rapide ansteigen. Die Auslandnettoverschuldung der Vereinigten Staaten - öffentlich wie privat - beginnt unheilverkündend zu explodieren. In den vergangen drei Jahren - seit die US-Börse zusammengebrochen ist und in Washington wieder Haushaltsdefizite aufgetaucht sind - hat sich die Nettoverschuldung gemäss einer kürzlich herausgebrachten Studie des Pestel-Instituts in Hannover beinahe verdoppelt. 1999, beim Zerplatzen der dot.com.-Blase, betrugen die US-Nettoschulden gegenüber dem Ausland ungefähr 1,4 Billionen Dollar. Am Ende dieses Jahres werden sie schätzungsweise 3,7 Billionen Dollar überschreiten. Vor 1989 waren die Vereinigten Staaten ein Netto-Geldgeber, der mehr durch seine Auslandsinvestitionen gewonnen hat, als er ihnen an Zinsen für Staatsanleihen oder andere Vermögenswerten zahlte. Seit dem Ende des kalten Krieges bis heute sind die USA ein Nettoschuldner in Höhe von bis zu 3,7 Billionen Dollar geworden. Das ist nicht gerade das, was Hilmar Kopper* «peanuts» nennen würde.
Es bedarf keiner grossen Voraussicht, um zu sehen, in welchem Ausmass die Rolle der Vereinigten Staaten durch diese Defizite bedroht ist. Mit einem jährlichen Defizit von mehr als 500 Milliarden Dollar, mehr als 5% des Bruttoinlandsprodukts, müssen die Vereinigten Staaten mindestens für 1,4 Milliarden Dollar importieren oder anziehen, um einen Zerfall des Dollars zu vermeiden und um die Zinssätze niedrig genug für die Unterstützung der schuldenbelasteten Firmen zu halten. Diese Nettoverschuldung verschlimmert sich in rasanten Schritten. Würden Frankreich, Deutschland, Russland und einige Opec-Länder jetzt einen kleinen Anteil ihrer Dollars in Euros umwandeln, um Obligationen von Deutschland oder Frankreich oder dergleichen zu kaufen, würden die USA mit einer strategischen Krise konfrontiert, wie sie seit 1945 keine gesehen haben. Diese Bedrohung abzuwenden war eine der versteckten strategischen Gründe für die Entscheidung, einen, wie es heisst, «Regimewechsel» im Irak anzustreben. Das ist genauso einfach, wie es kalt ist. Die Zukunft von Amerikas Status als einziger Supermacht hing daran, die Bedrohung, die vor allem aus Eurasien und den Euroländern kam, abzuwenden. Der Irak war und ist eine Schachfigur in einem weitaus grösseren strategischen Spiel, einem um höchste Spieleinsätze.
Der Euro bedroht die Hegemonie
Als der Euro am Ende des letzten Jahrzehnts lanciert wurde, gingen führende Regierungsmitglieder der EU, Bankiers der Deutschen Bank, Norbert Walter und der französische Präsident Chirac zu den Haltern der hauptsächlichen Dollarreserven - China, Japan und Russland - und versuchten sie davon zu überzeugen, zumindest einen Teil ihrer Währungsreserven in Euro statt in Dollar anzulegen. Allerdings kollidierten sie mit der Notwendigkeit, den zu hoch bewerteten Euro zu entwerten, damit deutsche Exporte das Wachstum der Euroländer stabilisieren konnten.
Dann, mit dem Debakel von US-dot.com, das wie eine Blase platzte, der Finanzskandale von Enron und Worldcom und der Rezession in den USA begann der Dollar seine Anziehungskraft für ausländische Investoren zu verlieren. Der Euro gewann bis Ende des Jahres 2002 stetig an Wert. Als dann Frankreich und Deutschland ihre geheime diplomatische Strategie entwikkelten, den Krieg im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu blockieren, tauchten Gerüchte auf, wonach die Zentralbanken von Russland und China im Stillen begonnen hätten, Dollars zu verkaufen und Euro zu kaufen. Die Folge davon war der freie Fall des Dollars am Vorabend des Krieges. Für den Fall, dass Washington den Irak-Krieg verlieren würde oder er sich zu einem langdauernden blutigen Debakel entwickeln sollte, war das Szenario bereits gemacht.
Eine andere «Massenvernichtungswaffe»
Aber Washington, führende Banken New Yorks und höhere Ebenen der amerikanischen Elite wussten genau, was auf dem Spiel stand. Im Irak ging es nicht um einfache chemische oder auch nukleare Massenvernichtungswaffen. Die «Massenvernichtungswaffen» bestanden in der Bedrohung, dass andere dem Irak folgen und weg vom Doller hin zum Euro einschwenken würden, um so eine Massenvernichtung der Hegemonie der amerikanischen Wirtschaft in der Welt zu erzeugen. Wie ein Wirtschaftler es formulierte, wäre das Ende der Rolle des Dollars als Weltwährung eine «Katastrophe» für die Vereinigten Staaten. Der Zinsfuss der amerikanischen Zentralbank würde höher als 1979 angehoben werden müssen: Damals hob Paul Volcker beim Versuch, den Zerfall des Dollars zu stoppen, den Zinsfuss um über 17% an. Wenige wissen, dass die Krise des Dollars 1979 ebenfalls eine direkte Folge der Bewegungen von Deutschland und Frankreich unter Schmidt und Giscard waren, um Europa zusammen mit Saudi-Arabien und anderen zu verteidigen, die begannen, US-Schatzanweisungen zu verkaufen, um gegen die Politik der Carter-Administration zu protestieren. Es lohnt zudem, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Reagan-Administration nach der Rettung des Dollars durch Volcker, gestützt von vielen der heutigen neokonservativen Falken, mit riesigen militärischen Verteidigungsausgaben begann, um die Sowjetunion herauszufordern.
Eurasien versus anglo-amerikanische Inselmacht
Dieser Kampf von Petro-Dollars gegen Petro-Euros, der im Irak begann, ist trotz des scheinbaren Sieges der USA im Irak keinesfalls vorbei. Der Euro ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von französischen geopolitischen Strategen zur Etablierung einer multipolaren Welt geschaffen worden. Das Ziel war, einen Ausgleich zur übermächtigen Dominanz der USA im Weltgeschäft zu schaffen. Es ist daher bezeichnend, dass sich französische Strategen auf einen britischen geopolitischen Strategen stützen, nämlich auf Sir Halford Mackinder, um ihre konkurrierende Alternativmacht gegenüber den USA zu entwickeln.
Im vergangen Februar, schrieb ein dem französischen Geheimdienst nahestehendes Blatt, Intelligence Online, einen Artikel mit dem Titel «Die Strategie hinter der Paris-Berlin-Moskau-Achse». Bezugnehmend auf den Uno-Sicherheitsrats-Block Frankreich-Deutschland-Russland, der versuchte, die amerikanischen und britischen Kriegsbewegungen gegen den Irak zu stoppen, verweist der Pariser Bericht auf die jüngsten Anstrengungen der Europäer und anderer Mächte, eine Gegenmacht gegen die Vereinigen Staaten zu schaffen. Und unter Bezugnahme auf das neue Bündnis von Frankreich und Deutschland - und noch neuer - mit Putin, schreiben sie «eine neue Logik und sogar Dynamik scheint aufgekommen zu sein. Durch eine Allianz zwischen Paris, Moskau und Berlin, die vom Atlantik nach Asien geht, könnte sich ein Ende der US-Macht abzeichnen. Zum ersten Mal seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Idee eines Kernlandes der Welt - der Alptraum britischer Strategen - wieder in die internationalen Beziehungen eingeschlichen.»3
Eurasische Bedrohung
Mackinder, der Vater der britischen Geopolitiker, schrieb in seinem bedeutenden Text, «The Geograhical Pivot of History» («Die geographische Drehscheibe der Geschichte»), dass die Kontrolle des eurasischen Kernlandes, von der französischen Normandie bis Wladiwostock, die einzig mögliche Bedrohung sei, die der Seemacht Grossbritanniens etwas entgegen setzen könnte. Bis 1914 basierte die britische Diplomatie darauf, eine solche eurasische Bedrohung abzuwenden, damals im Hinblick auf die Expansionspolitik des deutschen Kaisers nach Osten mit dem Bau der Bagdad-Bahn und dem Aufbau der deutschen Tirpitz-Marine. Der erste Weltkrieg war das Resultat. Bezüglich der laufenden Bemühungen der Briten und später der Amerikaner, einen eurasischen Zusammenschluss als Rivalen zu verhindern, unterstreicht der Pariser Geheimdienst-Bericht folgendes: «Diese strategische Annäherung (d.h. eine eurasische Kernland-Einheit zu bilden) liegt allen Kämpfen zwischen den kontinentalen Mächten und den Seemächten (GB, USA und Japan) zugrunde. Es ist die Macht Washingtons über die Meere, die - sogar heute - die unerschütterliche Unterstützung Londons für die USA und die Allianz zwischen Tony Blair und Bush diktiert.»
Eine andere gut informierte französische Zeitschrift, Reseau Voltaire.net, schrieb am Vorabend des Irak-Krieges, dass der Dollar «die Achillesverse der USA» sei4. Dies ist - milde gesagt - eine Untertreibung.
Der Irak-Krieg war schon lange geplant
Die aufkommende Bedrohung durch eine französische geführte Euro-Politik mit dem Irak und anderen Ländern brachte führende Kreise des US-politischen Establishments zum Nachdenken über die Bedrohung des Petro-Dollar-Systems, lange bevor Bush Präsident war. Während Perle, Wolfowitz und andere führende Neokonservative eine massgebliche Rolle bei der Entwicklung einer Strategie zur Stützung des lahmenden Systems spielten, zeichnete sich ein neuer Konsens ab, welcher die Hauptelemente des traditionellen Establishments des kalten Krieges um Figuren wie Rumsfeld und Cheney einbezog.
Im September 2000, während der Kampagne, veröffentlichte ein kleiner Washingtoner Thinktank das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert» (Projekt for the New American Century», PNAC) eine grosse Politik-Studie: «Rebuilding America`s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century (Neuaufbau der amerikanischen Verteidigung: Strategien, Kräfte und Quellen für ein neues Jahrhundert).» Der Bericht ist sehr nützlich, um die gegenwärtige Verwaltungspolitik in vielen Bereichen besser zu verstehen. Über den Irak heisst es dort: «Die Vereinigten Staaten sind seit Jahrzehnten bemüht, eine beständigere Rolle in der Sicherheit der Golfregion zu spielen. Während der ungelöste Konflikt mit dem Irak den direkten Grund liefert, übersteigt die Notwendigkeit einer substantiellen amerikanischen Armeepräsenz im Golf das Ziel einer Überwindung des Regimes von Saddam Hussein.»
Das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert»
Dieses PNAC-Papier ist die wesentliche Basis für das Weissbuch des Präsidenten vom September 2002, «The National Security Strategy of the United States of America». Das PNAC-Papier unterstützt einen «Entwurf für den Erhalt der globalen US-Vormachtstellung, die das Aufkommen eines grossen Machtrivalen ausschliesst und die internationale Sicherheitsordnung auf der Grundlage amerikanischer Prinzipien und Interessen gestaltet. Die amerikanische Grossstrategie muss so weit wie möglich in die Zukunft hinein geplant werden.» Weiter müssen die USA «fortgeschrittene Industrienationen davon abbringen, unsere Führerschaft in Frage zu stellen oder nur auf eine grössere regionale oder globale Rolle zu spekulieren.»
Die PNAC-Mitgliedschaft(sliste) von 2000 liest sich wie ein Dienstplan der heutigen Bush-Administration. Sie enthält Cheney, seine Frau Lynne Cheney, den neokonservativen persönliche Berater Cheney`s, Lewis Libby; Donald Rumsfeld; Rumsfelds Deputy Secretary Paul Wolfowitz. Sie enthält ebenfalls den Chef des National Security Council SC für den Nahen Osten, Elliott Abrams; John Bolton vom State Department, Richard Perle, und William Kristol. Mit von der Partie waren auch der frühere Vizepräsident von Lockheed-Martin, Bruce Jackson, und der ex-CIA-Kopf James Woolsey, zusammen mit Norman Podhoretz, einem weiteren Gründungsmitglied der Neo-Cons. Woolsey und Podhoretz sprechen offen davon, sich im «Vierten Weltkrieg» zu befinden.
Eine menschliche Finanzwirtschaft entwickeln
Es wird vielen immer klarer, dass es bei dem Krieg im Irak um den Erhalt eines bankrotten amerikanischen Jahrhundertmodells zur Weltbeherrschung geht. Es ist ebenso klar, dass der Irak nicht das Ende sein wird. Was jedoch nicht klar ist und was in der ganzen Welt offen diskutiert werden muss, ist, wie die gescheiterte Petro-Dollar-Ordnung durch ein neues System für globalen wirtschaftlichen Wohlstand und Sicherheit ersetzt werden kann.
Jetzt, da im Irak ein internes Chaos droht, ist es wichtig, die gesamte Nachkriegs-Währungsordnung neu zu überdenken. Die gegenwärtige französisch-deutsch-russische Allianz zur Bildung eines Gegengewichts gegenüber den Vereinigten Staaten benötigt nicht allein eine französisch-geführte Version des Petro-Dollar-Systems, so etwas wie ein Petro-Euro-System, das das bankrotte amerikanische Jahrhundert nur mit einem französischen Akzent weiterführt und in dem der Dollar lediglich durch den Euro ersetzt würde. Dies wäre nicht nur eine Verschwendung menschlicher Energien und würde zu steigender Arbeitslosigkeit in den Industrie- und Entwicklungsländern führen, sondern es würde auch den Lebensstandard weltweit weiter herabsetzen. Was einige Ökonomen während der Asienkrise 1998 begannen, muss weitergeführt werden: Ein grundsätzliches Nachdenken über die Basis für ein neues monetäres System, welches die menschliche Entwicklung unterstützt und nicht zerstört.
1 Engdahl, F. William, Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, Wiesbaden 2002. Im Kapitel 9-10 wird die Schaffung und Auswirkung des Recycling-Petrodollars und das geheime Saltsjoebaden Treffen 1973 für die Vorbereitung der Ölkrise ausgeführt.
2 Pressemitteilung des Radio Liberty/RFE, Charles Recknagel «Irak: Bagdad bewegt sich auf den Euro zu», 1. November 2000. Die Nachricht wurde während 48 Stunden durch CNN und andere Medien aufgenommen und verschwand prompt aus den Schlagzeilen. Seit dem Artikel von William Clark «Die wirklichen, aber unausgesprochenen Gründe für den bevorstehenden Irak-Krieg» erschien im Internet am 2. Februar 2003 - eine lebendige Online-Diskussion über den Öl-Euro-Faktor fand statt, aber abgesehen von gelegentlichen Erwähnungen im Londoner «Guardian» wurde in den Hauptmedien wenig über die strategischen Hintergrundfaktoren für die Washingtoner Entscheidung, gegen Irak vorzugehen, gesagt.
3 Der Geheimdienstonline-Herausgeber, Guillaume Dasquie, ist ein französischer Spezialist für strategische Geheimdienste und hat für die französischen Geheimdienste bezüglich des bin-Laden-Falls und andere Untersuchungen gearbeitet. Seine Erwähnungen zur französischen Geopolitik reflektieren klar das französische Denken auf hohem Niveau.
4 erschien am 4. April 2003. Er erörtert im Detail eine französische Analyse über die Verletzlichkeit des Dollarsystems am Vorabend des Irak-Krieges
--------------------------------------------------------------------------------
Das System von Bretton Woods
zf. Um das im September 1931 zusammengebrochene internationale Währungssystem neu zu ordnen, wurden an der Internationalen Währungs- und Finanzkonferenz, die vom 1. bis 22. Juli 1944 in Bretton Woods (New Hampshire, USA) stattfand, die Verträge über die Errichtung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) geschlossen und ein neues Weltwährungssystem begründet.
Das Bretton-Woods-System war eine Reaktion auf die durch Abwertungswettläufe und Protektionismus gekennzeichnete Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ziel war ein Welthandel ohne Handelsschranken und mit nur sehr geringen Schwankungen bei den Wechselkursen.
Der US-Dollar sollte zukünftig die Weltleitwährung sein und an einen Gold-Standard gebunden werden. Konkret wurde beschlossen, einen Preis von 35 US-Dollar pro Unze Gold festzulegen. Die USA verpflichteten sich, US-Dollar weltweit zu diesem Goldpreis zu verkaufen oder anzukaufen. Die Wechselkurse wurden gegenüber dem US-Dollar festgelegt, und die anderen Notenbanken verpflichteten sich, die Währungen ihrer Länder entsprechend dem festgelegten Wechselkurs zu stabilisieren. Der IWF sollte die Aufgabe haben, bei vorübergehenden Zahlungsbilanzproblemen von Staaten Kredite zu gewähren. Die Weltbank sollte die Kreditgewährung für Entwicklungsländer erleichtern.
--------------------------------------------------------------------------------
Der «Washington Consensus»
zf. Der Begriff «Washington Consensus» wurde von dem Wirtschaftswissenschafter John Williamson im Jahr 1989 geprägt. Unter diesem Begriff fasste er zusammen, was er als einen aktuellen Konsens zwischen dem Kongress der USA, dem IWF, der Weltbank und wichtigen Think tanks empfand. Zehn verschiedene Politikempfehlungen bildeten diesen Konsens zur «Reform» angeschlagener Volkswirtschaften:
1. Disziplin der öffentlichen Haushalte,
2. Umleitung öffentlicher Ausgaben in Felder, die sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch eine gleichmässigere Einkommensverteilung versprechen,
3. Steuerreformen mit niedrigeren Höchststeuersätzen und einer breiteren Steuerbasis,
4. Liberalisierung des Finanzmarktes,
5. Schaffung eines stabilen, wettbewerbsfähigen Wechselkurses,
6. Handelsliberalisierung,
7. Beseitigung von Marktzutrittsschranken und Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen (Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Firmen),
8. Privatisierung,
9. Deregulierung,
10. Gesicherte Eigentumsrechte.
Artikel 5: Zeit-Fragen Nr.22 vom 16. 6. 2003, letzte Änderung am 17. 6. 2003
Ein neues «American Century»?
Der Irak und die heimlichen Euro-Dollar-Kriege
von F. William Engdahl, USA / Deutschland
Trotz des scheinbar raschen militärischen Erfolgs der USA im Irak ist der Dollar schwächer statt stärker. Dies ist eine unerwartete Entwicklung, da viele Devisenhändler einen gestärkten Dollar erwartet hatten, sobald die Nachricht eines US-Sieges gemeldet würde. Die Kapitalströme bewegen sich weg vom Dollar hin zum Euro. Viele beginnen sich zu fragen, ob die objektive Situation der US-Wirtschaft weitaus schlechter ist, als die Börse meldet. Die Zukunft des Dollars ist keineswegs nur eine unbedeutende Angelegenheit, die nur Banken oder Devisenhändler interessiert. Er ist das Kernstück der «Pax Americana» oder, wie es auch genannt wird, des «American Century», des Systems, auf dem die Rolle Amerikas in der Welt beruht. Doch während der Dollar nach dem Ende der Kämpfe im Irak ständig an Wert gegenüber dem Euro verliert, scheint Washington in öffentlichen Stellungnahmen das Absinken des Dollars absichtlich noch schlimmer darzustellen. Was jetzt passiert, ist ein Machtspiel von höchster geopolitischer Bedeutung, vielleicht sogar das verhängnisvollste seit dem Aufkommen der USA als führender Weltwirtschaftsmacht im Jahre 1945.
Die Koalition der Interessen, die im Irak-Krieg zusammenflossen, einem Krieg, der für die USA eine strategische Notwendigkeit darstellte, umfasste nicht nur die vernehmbaren und deutlich sichtbaren neokonservativen Falken um Verteidigungsminister Rumsfeld und seinen Stellvertreter, Paul Wolfowitz. Es standen auch mächtige langfristige Interessen dahinter, von deren globaler Rolle der Einfluss der amerikanischen Wirtschaft abhängt, wie beispielsweise der einflussreiche Energiesektor um Halliburton, Exxon Mobil, Chevron Texaco und andere multinationale Riesenkonzerne. Dazu gehören auch die gigantische amerikanische Waffenindustrie um Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon, Northrup-Grumman und andere. Der springende Punkt für diese riesigen Verteidigungs- und Energie-Konglomerate sind nicht die paar einträglichen Aufträge vom Pentagon für den Wiederaufbau der irakischen Ölanlagen, die die Taschen von Dick Cheney und anderen füllen. Es geht vielmehr um den Erhalt der amerikanischen Macht in den kommenden Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts. Das bedeutet nicht, dass bei diesem Prozess keine Profite gemacht werden, aber das ist nur ein Nebenprodukt dieses globalen strategischen Ziels.
Die Rolle des Dollars in Washingtons Machtkalkül
Bei diesem Machtspiel wird die Bedeutung, die der Erhalt des Dollars als die Währungsreserve der Welt hat, am wenigsten verstanden, welcher aber der wichtigste Antrieb hinter dem Machtkalkül Washingtons gegenüber dem Irak in den letzten Monaten darstellt. Die amerikanische Vorherrschaft in der Welt beruht grundsätzlich auf zwei Säulen - ihrer überwältigenden militärischen Überlegenheit, vor allem auf dem Meer, und ihrer Kontrolle über die Wirtschaftsströme der Welt durch die Rolle des Dollars als der Währungsreserve der Welt. Es wird immer deutlicher, dass es im Irak-Krieg mehr darum ging, die zweite Säule, die Rolle des Dollars, aufrechtzuerhalten, als um die erste, das Militär. Was die Rolle des Dollars angeht, ist das Öl ein strategischer Faktor.
Die drei Phasen des «American Century»
Wenn wir rückblickend die Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrachten, kann man mehrere deutliche Entwicklungsphasen der amerikanischen Rolle in der Welt erkennen. Die erste Phase, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945-1948 und am Anfang des kalten Krieges begann, könnte man die Zeit des Bretton-Woods-Goldsystems nennen.
Phase I: Die Zeit der Bretton-Wood-Institution
Unter dem Bretton-Wood-System unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ordnung relativ stabil. Die USA waren aus dem Krieg als die alleinige Supermacht hervorgegangen mit einer starken industriellen Basis und den grössten Goldreserven aller Nationen. Die Anfangsaufgabe war es, Westeuropa wieder aufzubauen und eine Nordatlantik-Allianz gegen die Sowjetunion zu schaffen. Die Rolle des Dollars war direkt mit der des Goldes verknüpft. Solange Amerika die grössten Goldreserven besass und seine Wirtschaft weltweit am effizientesten produzierte, war die gesamte Bretton-Woods-Währungsstruktur vom französischen Franc über das britische Pfund Sterling bis zur deutschen Mark stabil. Im Zusammenhang mit der Unterstützung des Marshallplans und Krediten zur Finanzierung des Wiederaufbaus des vom Kriege zerschlagenen Europas wurden Dollarkredite ausgedehnt. Die amerikanischen Firmen, darunter auch die multinationalen Ölkonzerne, verdienten reichlich durch diese Vorherrschaft des Handels zu Beginn der 1950er Jahre. Washington unterstützte sogar das Zustandekommen des Vertrags von Rom im Jahre 1958, um die europäische Wirtschaftsstabilität zu stärken und damit weitere US-Exportmärkte zu schaffen. Diese Anfangsphase, die der Herausgeber des Time Magazine, Henry Luce, das «American Century» nannte, war, was die Wirtschaftsgewinne betraf, recht «positiv», sowohl für die USA als auch für Europa. Die USA hatten immer noch einen wirtschaftlichen Spielraum, in dem sie sich bewegen konnten.
Dies war die Ära der liberalen amerikanischen Aussenpolitik. Die USA waren der Hegemon innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft. Da sie im Vergleich zu Europa, Japan und Südkorea über enorme Goldreserven und Wirtschaftsressourcen verfügten, konnten es sich die USA durchaus leisten, ihre Handelsgrenzen für Exporte aus Europa und Japan zu öffnen. Als Gegenleistung unterstützen die Europäer und Japaner die USA bei ihrer Rolle während des kalten Krieges.
Während der 1950er und frühen 1960er Jahre beruhte die amerikanische Führung weniger auf direktem Zwang als auf dem Herstellen eines Konsenses mit den Alliierten, sei es bei GATT-Handelsrunden oder in anderen Bereichen. Eliteorganisationen wie die Bilderberger-Treffen wurden organisiert, um einen zufriedenstellenden gemeinsamen Konsens zwischen Europa und den USA zu erreichen.
Diese erste, eher «freundliche» Phase des «American Century» ging in den frühen 1970ern zu Ende.
Ende des Bretton-Wood-Systems
Das Bretton-Woods-Goldsystem begann zusammenzubrechen, weil Europa wirtschaftlich auf eigene Füsse kam und Mitte der 1960er eine bedeutende Exportregion wurde. Diese zunehmende wirtschaftliche Stärke Westeuropas fiel zusammen mit den ansteigenden öffentlichen Defiziten der USA, weil Johnson den tragischen Krieg in Vietnam eskalieren liess. Während der 1960er Jahre begann Frankreichs General de Gaulle für die Gewinne aus den französischen Exporten aus den amerikanischen Staatsreserven Gold statt Dollars zu verlangen, was während der Zeit von Bretton Woods durchaus legal war. Gegen November 1967 war aber der Goldfluss aus den USA und aus den Tresoren der Bank von England kritisch geworden. Das schwache Glied in der Kette des Bretton-Woods-Goldsystems war England, der «kranke Mann Europas». Die Kette riss, weil der Sterling im Jahre 1967 entwertet wurde. Das beschleunigte nur noch den Druck auf den US-Dollar, da französische und andere Zentralbanken ihre Forderungen nach US-Gold im Tausch für ihre Dollarreserven verstärkten. Sie kalkulierten die steigenden Kriegsdefizite durch den Vietnam-Krieg mit ein, und es würde nur noch eine Frage von Monaten sein, bis die USA selber gezwungen sein würden, ihren Dollar gegen das Gold abzuwerten, um wenigstens noch einen guten Preis für ihr Gold erzielen zu können.
Aufhebung der Geldfindung - Einführung freier Wechselkurse (floating)
Im Mai 1971 war der Fluss der US-Goldreserven besorgniserregend geworden. Sogar die Bank von England hatte sich den Franzosen und ihren Forderungen nach Gold gegen Dollars angeschlossen. Das war der Punkt, an dem die Nixon-Administration dafür plädierte, das Gold vollständig aufzugeben und im August 1971 zu einem System der «frei flotierenden» Währungen überzugehen, statt einen Kollaps der US-Goldreserven zu riskieren.
Der Bruch mit dem Gold öffnete den Weg für eine völlig neue Phase des «American Century». In dieser neuen Phase wurde die Kontrolle über die Währungspolitik durch grosse internationale Banken wie die Citibank, Chase Manhattan oder Barclays Bank de facto privatisiert. Sie übernahmen die Rolle, die die Zentralbanken beim Goldsystem innegehabt hatten, jedoch nun völlig ohne Gold. «Freie Marktentwicklungen» konnten nun den Dollar festlegen. Und sie taten es mit Macht.
Das freie Floaten des Dollars schaffte gleichzeitig mit dem Anstieg des Opec-Ölpreises um 400% im Jahre 1973 nach dem Yom-Kippur-Krieg eine Basis für eine zweite Phase des «American Century», die Phase des Petrodollars.
Phase II: Das Petrodollar-Recycling
Mitte der siebziger Jahre durchlief das System des «American Century» globaler wirtschaftlicher Dominanz einen dramatischen Wandel. Ein anglo-amerikanischer Ölschock schuf plötzlich eine starke Nachfrage nach dem «floating dollar», das heisst einem Dollar mit frei flotierendem Wechselkurs. Ölimportierende Länder von Deutschland über Argentinien bis Japan waren alle mit dem Problem konfrontiert, wie sie in Dollar exportieren konnten, um ihre neuen hohen Rechnungen für den Ölimport zu zahlen. Die Opec-Länder wurden mit neuen Öldollars überflutet. Ein grosser Teil dieser Öldollars kam auf Londoner und New Yorker Banken, wo ein neuer Prozess in Gang gesetzt wurde. Henry Kissinger gab ihm die Bezeichnung «Das Recycling von Petrodollars». Die Recycling-Strategie wurde bereits im Mai 1971 beim Bilderberger-Treffen in Saltsjoebaden, Schweden, diskutiert. Sie wurde von den amerikanischen Mitgliedern der Bilderberg-Gruppe präsentiert; die Details werden ausführlich dargestellt im Buch «Mit der Ölwaffe zur Weltmacht».1
Petrodollar-Recyling: Der Beginn der Schuldenkrise der dritten Welt
Die Opec erstickte fast an Dollars, die sie nicht brauchen konnten. Amerikanische und britische Banken nahmen die Opec-Dollar und verliehen sie in Form von Eurodollar-Bonds oder -Darlehen weiter an Drittweltländer, die dringend Dollar aufnehmen mussten, um ihre Ölimporte zu finanzieren. Die Anhäufung dieser Petrodollar-Schulden in den späten siebziger Jahren legte die Basis für die Schuldenkrise der Drittweltländer in den achtziger Jahren. Hunderte Milliarden Dollars wurden zwischen Opec, Londoner und New Yorker Banken und zurück in die Geld aufnehmenden Länder der dritten Welt recycelt.
Der IWF wird «Schuldenpolizist»
Im August 1982 brach die Kette schliesslich, und Mexiko kündigte an, dass es wahrscheinlich den Rückzahlungen seiner Eurodollar-Schulden nicht nachkommen würde. Die Schuldenkrise der dritten Welt begann, nachdem Paul Volcker und die US-amerikanische Notenbank Ende 1979 einseitig den US-Zinssatz angezogen hatten, als Versuch den schwachen Dollar zu retten. Nach drei Jahren mit rekordhohen US-Zinsen war der Dollar «gerettet», aber der Sektor der Entwicklungsländer drohte wirtschaftlich unter den US-Wuchserzinsen auf ihren Petrodollar-Darlehen zu ersticken. Um für die Rückzahlung der Schulden an die Londoner und New Yorker Banken zu sorgen, schalteten die Banken den IWF ein, der als «Schuldenpolizist» zu fungieren hatte. Öffentliche Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt wurden auf Anordnung des IWF zusammengestrichen, um sicherzustellen, dass der Schuldendienst für die Petrodollars gegenüber den Banken rechtzeitig geleistet werden konnte.
Die Phase der Hegemonie des Petrodollars war ein Versuch des US-Establishments, den eigenen geopolitischen Niedergang als weltbeherrschendes Zentrum des Nachkriegssystems zu verlangsamen. Der Washington-Konsens des IWF wurde entwickelt, um die drakonischen Schulden der Drittweltländer einzutreiben, um sie zur Rückzahlung der Dollarschulden zu zwingen, was jegliche wirtschaftliche Unabhängigkeit der Länder im Süden verhinderte und den US-Banken half, den Dollar über Wasser zu halten.
Trilaterale Kommission - die Einbindung Japans
1973 wurde die Trilaterale Kommission von David Rockefeller und anderen ins Leben gerufen, um mit dem Aufkommen Japans als Industriegiganten fertig zu werden und zu versuchen, Japan in das System einzubinden. Japan war als grössere Industrienation ein wichtiger Importeur von Öl. Japans Handelsüberschüsse durch die Exporte von Autos und anderen Gütern wurden verwendet, um Öl mit Dollars zu kaufen. Die restlichen Überschüsse wurden in zinsbringende US-Schatzbriefe (Treasury bonds) investiert, um Zinsen abzuschöpfen. Die G-7 (heute G-8) wurde gegründet, um Japan und Westeuropa innerhalb des US-Dollar-Systems zu halten. Bis in die achtziger Jahre hinein verlangten verschiedene Stimmen in Japan immer wieder, dass sich die drei Währungen - der Dollar, die Deutsche-Mark und der Yen - die Rolle der Weltreserve teilen sollten. Das geschah niemals. Der Dollar blieb dominant.
Von einem engen Blickwinkel aus betrachtet schien die Hegemoniephase des Petrodollars zu funktionieren. Darunter war sie weltweit auf einem Niedergang des wirtschaftlichen Lebensstandard aufgebaut, da die Vorgaben des IWF das Wachstum der nationalen Wirtschaften zerstörten und die Märkte für globalisierende multinationale Unternehmen aufbrachen, die in den achtziger und insbesonders in den neunziger Jahren ihre Produktion in billige Länder verlegen wollten.
Aber sogar in der Petrodollar-Phase war die amerikanische Aussenhandels- und Militärpolitik immer noch von Stimmen des traditionellen liberalen Konsensus dominiert. Die amerikanische Macht hing davon ab, periodisch neue Handelsabkommen oder andere Fragen mit den US-Verbündeten in Europa, Japan und Asien auszuhandeln.
Phase III beginnt: Der Petro-Euro - ein Rivale?
Das Ende des kalten Krieges und das Aufkommen eines neuen geeinten Europas und der Europäischen Währungsunion in den frühen 90er Jahren stellte eine vollkommen neue Herausforderung für das «American Century» dar. Es dauerte einige Jahre, mehr als eine Dekade nach dem ersten Golfkrieg 1991, bis diese neue Herausforderung sich in ihrem ganzen Ausmass zeigte. Der gegenwärtige Irak-Krieg wird nur auf dem Hintergrund eines gewaltigen Kampfes innerhalb der neuen, dritten Phase zur Sicherung amerikanischer Vorherrschaft verständlich. Diese Phase ist bereits «demokratischer Imperialismus» genannt worden, ein Lieblingsbegriff von Max Boot und anderen Neokonservativen. Wie die Ereignisse im Irak nahelegen, wird sie wahrscheinlich nicht sehr demokratisch, wohl aber imperialistisch sein.
Im Gegensatz zu der ersten Zeit nach 1945 ist in dieser neuen Ära die Offenheit der USA gegenüber den anderen Mitgliedern der G-7, ihnen Konzessionen zu gewähren, verschwunden. Jetzt ist ungeschminkte Macht das einzige Instrument, die amerikanische Dominanz langfristig aufrechtzuerhalten. Am besten wird dieser Logik von den neokonservativen Falken um Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol und anderen Ausdruck verliehen.
Es muss aber betont werden, dass die Neokonservativen seit dem 11. September solchen Einfluss haben, weil die Mehrheit des US-Machtestablishments diese Ansichten als nützlich erachteten, um eine neue aggressive Rolle der USA in der Welt voranzutreiben.
Statt mit den europäischen Partnern Übereinkünfte auszuarbeiten, betrachtet Washington Euroland zunehmend als bedeutende strategische Bedrohung für die amerikanische Hegemonie, vor allem das «Alte Europa» mit Deutschland und Frankreich. Genau wie Grossbritannien während seines wirtschaftlichen Verfalls nach 1870 zunehmend Rettung in verzweifelten imperialen Kriegen in Südafrika und anderswo suchte, benützten die USA ihre militärische Macht, um das zu erreichen, was sie mit wirtschaftlichen Mitteln nicht mehr erreichen können. Hierbei ist der Dollar die Archillesferse.
Mit der Schaffung des Euro in den letzten fünf Jahren wurde dem globalen System ein völlig neues Element hinzugefügt, welches bestimmt, was wir die dritte Phase des «American Century» nennen. Diese Phase, in der der Irak-Krieg eine zentrale Rolle spielt, droht eine neue, bösartige und imperialistische Phase zu werden, welche die früheren Phasen amerikanischer Hegemonie ersetzen soll. Die Neokonservativen sprechen über diese imperialistische Agenda offen, während die eher traditionellen Vertreter der US-Politik sie abzustreiten versuchen. Die wirtschaftliche Realität, der sich der Dollar am Anfang des neuen Jahrhunderts gegenüber sieht, definiert diese neue Phase in einer verhängnisvollen Weise.
Phase III: Dauernde Dominanz durch rohes Diktat
Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden ersten Phasen des «American Century» - von 1945 bis 1973 und von 1973-1999 - und dieser neuen, sich herausbildenden Phase andauernder Dominanz in der Folge des 11. September und des Irak-Kriegs. Nach 1945 bis heute war die amerikanische Macht vor allem von der Art eines Hegemon. Ein Hegemon dominiert in einer Welt, in der die Macht ungleich verteilt ist, und seine Macht entsteht nicht nur durch Gewalt, sondern im Einverständnis mit seinen Verbündeten. Das ist auch der Grund, wieso der Hegemon zu bestimmten Diensten gegenüber den Verbündeten verpflichtet ist, wie beispielsweise militärische Sicherheit und Regulierung der Weltmärkte zum Vorteil einer grösseren Gruppe - ihn selbst eingeschlossen - zu leisten. Eine imperialistische Macht hat keine solchen Verpflichtungen gegenüber Verbündeten, einzig das rohe Diktat, wie es seine niedergehende Macht aufrechterhalten kann, was manche als «imperial overstretch» bezeichnen («imperiale Überdehung»). Das ist die Welt, die Amerika auf Anraten der neokonservativen Falken um Rumsfeld und Cheney mit einer Politik der Präemptivkriege beherrschen soll.
Ein versteckter Krieg um die globale Hegemonie zwischen dem Dollar und der neuen Währung des Euro steht im Zentrum dieser neuen Phase.
Die zwei Säulen der US-Herrschaft: militärische Vormacht ...
Will man die Bedeutung dieser unausgesprochenen Schlacht um die Währungshegemonie verstehen, muss man zuerst verstehen, dass die US-Hegemonie seit dem Aufkommen der Vereinigten Staaten als dominierende Weltmacht nach 1945 auf zwei Säulen geruht hat, die nicht anzufechten waren. Die erste ist die militärische Überlegenheit gegenüber allen Gegnern. Die Vereinigten Staaten geben für die Verteidigung heute mehr als dreimal soviel aus wie die gesamte Europäische Union, nämlich über 396 Milliarden Dollar gegenüber 118 Milliarden Dollar im Vorjahr, und mehr als alle 15 nächstgrösseren Nationen zusammen. Washington plant innerhalb der nächsten fünf Jahre weitere 2,1 Billionen [2100 Milliarden] Dollar für die Verteidigung auszugeben. Keine Nation und keine Gruppe von Nationen kann mit diesen Verteidigungsausgaben schritthalten. China ist mindestens 30 Jahre davon entfernt, eine ernstzunehmende militärische Bedrohung zu werden. Niemand ist ein ernsthafter Gegenspieler gegen die amerikanische Militärmacht.
... und US-Dollar als Weltwährung
Die zweite Säule der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt ist die dominierende Rolle des US-Dollars als Weltwährung. Bis zur Einführung des Euro Anfang 1999 gab es keine potentielle Herausforderung der Dollarvorherrschaft im Welthandel. Seit den siebziger Jahren war der Petrodollar Kern der Dollarhegemonie. Letztere ist für die Zukunft einer amerikanischen Weltherrschaft in vieler Hinsicht strategisch ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger als die überwältigende militärische Macht.
Papiergeld Dollar
Die entscheidende Veränderung fand statt, als Nixon die Bindung des Dollars an den Goldstandard kündigte, um freie Wechselkurse mit anderen Währungen einzuführen. Dadurch wurden die Beschränkungen, neue Dollarnoten zu drucken, beseitigt. Die einzige Beschränkung bestand nur noch darin, wie viele Dollars der Rest der Welt nehmen würde. Durch ihren festen Vertrag mit Saudi-Arabien, dem grössten Ölproduzenten der Opec, garantierte Washington, die Erzeugerin des «swings» (die preisbestimmende Menge Öl), dass Öl - der häufigste Rohstoff der Welt, der wichtigste für die Wirtschaft einer jeder Nation, die Grundlage für jeden Transport und für vieles in der Industriewirtschaft - auf den Weltmärkten nur noch gegen Dollars erhältlich war. Der Deal wurde im Juni 1974 von Staatssekretär Henry Kissinger durch die Gründung der US-Saudiarabischen Joint Commission on Economic Cooperation abgeschlossen.
Dollarbindung des Öls
Die amerikanische Schatzkammer und die amerikanische Zentralbank würden der Saudi-arabischen Zentralbank, SAMA, «erlauben», amerikanische Staatsanleihen mit saudischen Petrodollars zu kaufen. 1975 erklärten sich die Opec-Länder offiziell dazu bereit, ihr Öl nur gegen Dollars zu verkaufen. Eine geheime Erklärung des amerikanischen Militärs, Saudi-Arabien zu bewaffnen, war die Gegenleistung.
Bis November 2000 wagte kein Opec-Land, die Dollarpreisregel zu verletzen. Solange der Dollar die stärkste Währung war, gab es auch wenig Anlass dafür. Aber im November 2000 überzeugten Frankreich und andere Mitgliedstaaten der EU Saddam Hussein, sich den USA zu widersetzen, indem er das irakische Öl-für-Nahrungsmittel nicht in Dollars, «der Feindwährung», wie der Irak sie nannte, sondern nur in Euro verkaufe. Die Euros befanden sich auf einem speziellen UN-Konto bei der führenden französischen Bank, BNP Paribas. Radio Liberty des amerikanischen Aussenministeriums brachte darüber eine kurze Meldung in den Nachrichten, die Geschichte wurde aber schnell zum Schweigen gebracht.2
Dieser kaum wahrgenommene Schritt des Irak, sich dem Dollar zugunsten des Euro zu widersetzen, war für sich genommen unbedeutend. Doch, wenn das sich ausgebreitet hätte, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem der Dollar schon geschwächt war, hätte das einen panischen Verkauf von Dollars durch ausländische Zentralbanken und Opec-Ölproduzenten bewirken können. In den Monaten vor dem jüngsten Irak-Krieg waren Anzeichen, die in diese Richtung deuteten, aus Russland, dem Iran, Indonesien und sogar Venezuela zu hören.
Der Irak-Krieg - tödliche Warnung zur Rettung des Dollars?
Ein Opec-Beamter aus dem Iran, Javad Yarjani, lieferte eine detaillierte Analyse darüber, wie die Opec in naher Zukunft ihr Öl an die EU gegen Euro und nicht gegen Dollars verkaufen würden. Im April 2002 sprach Yarjani in Oviedo in Spanien an einer Einladung der EU. Es sprechen alle Anzeichen dafür, dass der Irak-Krieg gezielt als der einfachste Weg angezettelt wurde, um eine tödliche vorsorgliche Warnung an die Opec-Länder und andere zu schicken, nicht damit zu liebäugeln, das System des Petrodollars zugunsten eines Systems, das auf dem Euro basiert, fallenzulassen.
Informierte Bankierskreise in der City of London (dem Finanzplatz von London) und an anderen Orten Europas bestätigen vertraulich die Bedeutung dieser wenig zur Kenntnis genommenen Bewegung des Irak vom Petro-Dollar zum Petro-Euro. «Der Schritt des Irak war eine Kriegserklärung gegen den Dollar», erzählte mir neulich ein ehemaliger Londoner Bankier. «Sobald es klar war, dass England und Amerika den Irak eingenommen hatten, war ein grosser Seufzer der Erleichterung in den Banken der Londoner City zu hören. Sie sagten vertraulich, Ðjetzt müssen wir uns um diese verdammte Bedrohung durch den Euro keine Sorgen mehr machenð.»
Warum sollte etwas so Kleines eine so grosse strategische Bedrohung für London und New York oder für die Vereinigten Staaten sein, dass ein amerikanischer Präsident dafür offensichtlich fünfzig Jahre alliierter Beziehungen in der ganzen Welt riskiert und mehr noch, einen militärischen Angriff startet, dessen Rechtfertigung vor der Welt nicht bestehen konnte?
Petrodollar stützt die amerikanische Weltherrschaft
Die Antwort liegt in der einzigartigen Rolle des Petro-Dollars für die Untermauerung der amerikanischen Wirtschaft.
Wie funktioniert das? Solange fast 70% des Welthandels in Dollar abgewickelt werden, ist der Dollar die Währung, die die Zentralbanken als Reserve ansammeln. Aber die Zentralbanken, sei es in China, Japan, Brasilien oder Russland häufen nicht einfach nur Dollars in ihren Tresoren an. Währungen haben einen Vorteil gegenüber Gold. Eine Zentralbank kann sie benutzen, um staatliche Oligationen vom Herausgeber, den Vereinigten Staaten zu kaufen. Die meisten Länder der Welt sind gezwungen, ihre Handelsdefizite unter Kontrolle zu behalten, wollen sie sich nicht mit einem Währungszerfall konfrontiert sehen. Die Vereinigten Staaten nicht. Das liegt an der Rolle des Dollars als Reservewährung. Und die Untermauerung dieser Rolle als Reservewährung ist der Petrodollar. Jede Nation muss Dollars bekommen, um Öl importieren zu können, manche mehr als andere. Das hat zur Folge, dass ihr Handel sich an Dollar-Länder richtet, an die USA mehr als an alle anderen.
Weil Öl der wichtigste Rohstoff für jede Nation ist, verlangt das Petrodollar-System, das bis heute existiert, die Entwicklung riesiger Handelsüberschüsse, um Dollarüberschüsse anzusammeln. Dies gilt für alle Länder ausser einem - den USA, die den Dollar beherrschen und ihn nach Belieben oder per Dekret drucken. Weil heute der Grossteil des gesamten internationalen Handels in Dollar abgewickelt wird, müssen die Länder ins Ausland gehen, um die Zahlungsmittel zu bekommen, die sie nicht selbst herausgeben können. Die Struktur des gesamten Welthandels bewegt sich heute rund um diese Dynamik, von Russland bis China, von Brasilien bis Südkorea und Japan. Jeder ist darauf aus, Dollarüberschüsse aus dem Export zu maximieren.
Um diesen Prozess in Gang zu halten, haben die Vereinigten Staaten sich bereit erklärt, der letzte Importeur zu sein, falls sich kein anderer mehr findet, weil die ganze monetäre Hegemonie von diesem Dollar-Recycling abhängt.
Die Zentralbanken von Japan, China, Südkorea, Russland und den anderen Ländern kaufen mit ihren Dollars alle Sicherheiten auf die US-Staatsanleihen, um damit Zinsen für ihre Dollar zu gewinnen. Sie legen sie nicht unter ihre Matratze. Das wiederum erlaubt den Vereinigten Staaten, einen stabilen Dollar und deutlich tiefere Zinssätze und mit dem Rest der Welt ein Zahlungsbilanzdefizit im Wert von 500 Milliarden Dollar zu haben. Die amerikanische Zentralbank beherrscht die Druckerpressen für den Dollar, und die Welt braucht Dollars. So einfach ist das.
Die Bedrohung der USA durch Auslandschulden
Aber vielleicht ist es doch nicht so einfach: Es ist ein äusserst instabiles System, weil die amerikanischen Handelsdefizite und Nettoschulden oder Aktiva und Passiva gegenüber ausländischen Konten inzwischen gut über 22% des Bruttosozialprodukts aus dem Jahre 2000 liegen und weiterhin rapide ansteigen. Die Auslandnettoverschuldung der Vereinigten Staaten - öffentlich wie privat - beginnt unheilverkündend zu explodieren. In den vergangen drei Jahren - seit die US-Börse zusammengebrochen ist und in Washington wieder Haushaltsdefizite aufgetaucht sind - hat sich die Nettoverschuldung gemäss einer kürzlich herausgebrachten Studie des Pestel-Instituts in Hannover beinahe verdoppelt. 1999, beim Zerplatzen der dot.com.-Blase, betrugen die US-Nettoschulden gegenüber dem Ausland ungefähr 1,4 Billionen Dollar. Am Ende dieses Jahres werden sie schätzungsweise 3,7 Billionen Dollar überschreiten. Vor 1989 waren die Vereinigten Staaten ein Netto-Geldgeber, der mehr durch seine Auslandsinvestitionen gewonnen hat, als er ihnen an Zinsen für Staatsanleihen oder andere Vermögenswerten zahlte. Seit dem Ende des kalten Krieges bis heute sind die USA ein Nettoschuldner in Höhe von bis zu 3,7 Billionen Dollar geworden. Das ist nicht gerade das, was Hilmar Kopper* «peanuts» nennen würde.
Es bedarf keiner grossen Voraussicht, um zu sehen, in welchem Ausmass die Rolle der Vereinigten Staaten durch diese Defizite bedroht ist. Mit einem jährlichen Defizit von mehr als 500 Milliarden Dollar, mehr als 5% des Bruttoinlandsprodukts, müssen die Vereinigten Staaten mindestens für 1,4 Milliarden Dollar importieren oder anziehen, um einen Zerfall des Dollars zu vermeiden und um die Zinssätze niedrig genug für die Unterstützung der schuldenbelasteten Firmen zu halten. Diese Nettoverschuldung verschlimmert sich in rasanten Schritten. Würden Frankreich, Deutschland, Russland und einige Opec-Länder jetzt einen kleinen Anteil ihrer Dollars in Euros umwandeln, um Obligationen von Deutschland oder Frankreich oder dergleichen zu kaufen, würden die USA mit einer strategischen Krise konfrontiert, wie sie seit 1945 keine gesehen haben. Diese Bedrohung abzuwenden war eine der versteckten strategischen Gründe für die Entscheidung, einen, wie es heisst, «Regimewechsel» im Irak anzustreben. Das ist genauso einfach, wie es kalt ist. Die Zukunft von Amerikas Status als einziger Supermacht hing daran, die Bedrohung, die vor allem aus Eurasien und den Euroländern kam, abzuwenden. Der Irak war und ist eine Schachfigur in einem weitaus grösseren strategischen Spiel, einem um höchste Spieleinsätze.
Der Euro bedroht die Hegemonie
Als der Euro am Ende des letzten Jahrzehnts lanciert wurde, gingen führende Regierungsmitglieder der EU, Bankiers der Deutschen Bank, Norbert Walter und der französische Präsident Chirac zu den Haltern der hauptsächlichen Dollarreserven - China, Japan und Russland - und versuchten sie davon zu überzeugen, zumindest einen Teil ihrer Währungsreserven in Euro statt in Dollar anzulegen. Allerdings kollidierten sie mit der Notwendigkeit, den zu hoch bewerteten Euro zu entwerten, damit deutsche Exporte das Wachstum der Euroländer stabilisieren konnten.
Dann, mit dem Debakel von US-dot.com, das wie eine Blase platzte, der Finanzskandale von Enron und Worldcom und der Rezession in den USA begann der Dollar seine Anziehungskraft für ausländische Investoren zu verlieren. Der Euro gewann bis Ende des Jahres 2002 stetig an Wert. Als dann Frankreich und Deutschland ihre geheime diplomatische Strategie entwikkelten, den Krieg im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu blockieren, tauchten Gerüchte auf, wonach die Zentralbanken von Russland und China im Stillen begonnen hätten, Dollars zu verkaufen und Euro zu kaufen. Die Folge davon war der freie Fall des Dollars am Vorabend des Krieges. Für den Fall, dass Washington den Irak-Krieg verlieren würde oder er sich zu einem langdauernden blutigen Debakel entwickeln sollte, war das Szenario bereits gemacht.
Eine andere «Massenvernichtungswaffe»
Aber Washington, führende Banken New Yorks und höhere Ebenen der amerikanischen Elite wussten genau, was auf dem Spiel stand. Im Irak ging es nicht um einfache chemische oder auch nukleare Massenvernichtungswaffen. Die «Massenvernichtungswaffen» bestanden in der Bedrohung, dass andere dem Irak folgen und weg vom Doller hin zum Euro einschwenken würden, um so eine Massenvernichtung der Hegemonie der amerikanischen Wirtschaft in der Welt zu erzeugen. Wie ein Wirtschaftler es formulierte, wäre das Ende der Rolle des Dollars als Weltwährung eine «Katastrophe» für die Vereinigten Staaten. Der Zinsfuss der amerikanischen Zentralbank würde höher als 1979 angehoben werden müssen: Damals hob Paul Volcker beim Versuch, den Zerfall des Dollars zu stoppen, den Zinsfuss um über 17% an. Wenige wissen, dass die Krise des Dollars 1979 ebenfalls eine direkte Folge der Bewegungen von Deutschland und Frankreich unter Schmidt und Giscard waren, um Europa zusammen mit Saudi-Arabien und anderen zu verteidigen, die begannen, US-Schatzanweisungen zu verkaufen, um gegen die Politik der Carter-Administration zu protestieren. Es lohnt zudem, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Reagan-Administration nach der Rettung des Dollars durch Volcker, gestützt von vielen der heutigen neokonservativen Falken, mit riesigen militärischen Verteidigungsausgaben begann, um die Sowjetunion herauszufordern.
Eurasien versus anglo-amerikanische Inselmacht
Dieser Kampf von Petro-Dollars gegen Petro-Euros, der im Irak begann, ist trotz des scheinbaren Sieges der USA im Irak keinesfalls vorbei. Der Euro ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von französischen geopolitischen Strategen zur Etablierung einer multipolaren Welt geschaffen worden. Das Ziel war, einen Ausgleich zur übermächtigen Dominanz der USA im Weltgeschäft zu schaffen. Es ist daher bezeichnend, dass sich französische Strategen auf einen britischen geopolitischen Strategen stützen, nämlich auf Sir Halford Mackinder, um ihre konkurrierende Alternativmacht gegenüber den USA zu entwickeln.
Im vergangen Februar, schrieb ein dem französischen Geheimdienst nahestehendes Blatt, Intelligence Online, einen Artikel mit dem Titel «Die Strategie hinter der Paris-Berlin-Moskau-Achse». Bezugnehmend auf den Uno-Sicherheitsrats-Block Frankreich-Deutschland-Russland, der versuchte, die amerikanischen und britischen Kriegsbewegungen gegen den Irak zu stoppen, verweist der Pariser Bericht auf die jüngsten Anstrengungen der Europäer und anderer Mächte, eine Gegenmacht gegen die Vereinigen Staaten zu schaffen. Und unter Bezugnahme auf das neue Bündnis von Frankreich und Deutschland - und noch neuer - mit Putin, schreiben sie «eine neue Logik und sogar Dynamik scheint aufgekommen zu sein. Durch eine Allianz zwischen Paris, Moskau und Berlin, die vom Atlantik nach Asien geht, könnte sich ein Ende der US-Macht abzeichnen. Zum ersten Mal seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Idee eines Kernlandes der Welt - der Alptraum britischer Strategen - wieder in die internationalen Beziehungen eingeschlichen.»3
Eurasische Bedrohung
Mackinder, der Vater der britischen Geopolitiker, schrieb in seinem bedeutenden Text, «The Geograhical Pivot of History» («Die geographische Drehscheibe der Geschichte»), dass die Kontrolle des eurasischen Kernlandes, von der französischen Normandie bis Wladiwostock, die einzig mögliche Bedrohung sei, die der Seemacht Grossbritanniens etwas entgegen setzen könnte. Bis 1914 basierte die britische Diplomatie darauf, eine solche eurasische Bedrohung abzuwenden, damals im Hinblick auf die Expansionspolitik des deutschen Kaisers nach Osten mit dem Bau der Bagdad-Bahn und dem Aufbau der deutschen Tirpitz-Marine. Der erste Weltkrieg war das Resultat. Bezüglich der laufenden Bemühungen der Briten und später der Amerikaner, einen eurasischen Zusammenschluss als Rivalen zu verhindern, unterstreicht der Pariser Geheimdienst-Bericht folgendes: «Diese strategische Annäherung (d.h. eine eurasische Kernland-Einheit zu bilden) liegt allen Kämpfen zwischen den kontinentalen Mächten und den Seemächten (GB, USA und Japan) zugrunde. Es ist die Macht Washingtons über die Meere, die - sogar heute - die unerschütterliche Unterstützung Londons für die USA und die Allianz zwischen Tony Blair und Bush diktiert.»
Eine andere gut informierte französische Zeitschrift, Reseau Voltaire.net, schrieb am Vorabend des Irak-Krieges, dass der Dollar «die Achillesverse der USA» sei4. Dies ist - milde gesagt - eine Untertreibung.
Der Irak-Krieg war schon lange geplant
Die aufkommende Bedrohung durch eine französische geführte Euro-Politik mit dem Irak und anderen Ländern brachte führende Kreise des US-politischen Establishments zum Nachdenken über die Bedrohung des Petro-Dollar-Systems, lange bevor Bush Präsident war. Während Perle, Wolfowitz und andere führende Neokonservative eine massgebliche Rolle bei der Entwicklung einer Strategie zur Stützung des lahmenden Systems spielten, zeichnete sich ein neuer Konsens ab, welcher die Hauptelemente des traditionellen Establishments des kalten Krieges um Figuren wie Rumsfeld und Cheney einbezog.
Im September 2000, während der Kampagne, veröffentlichte ein kleiner Washingtoner Thinktank das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert» (Projekt for the New American Century», PNAC) eine grosse Politik-Studie: «Rebuilding America`s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century (Neuaufbau der amerikanischen Verteidigung: Strategien, Kräfte und Quellen für ein neues Jahrhundert).» Der Bericht ist sehr nützlich, um die gegenwärtige Verwaltungspolitik in vielen Bereichen besser zu verstehen. Über den Irak heisst es dort: «Die Vereinigten Staaten sind seit Jahrzehnten bemüht, eine beständigere Rolle in der Sicherheit der Golfregion zu spielen. Während der ungelöste Konflikt mit dem Irak den direkten Grund liefert, übersteigt die Notwendigkeit einer substantiellen amerikanischen Armeepräsenz im Golf das Ziel einer Überwindung des Regimes von Saddam Hussein.»
Das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert»
Dieses PNAC-Papier ist die wesentliche Basis für das Weissbuch des Präsidenten vom September 2002, «The National Security Strategy of the United States of America». Das PNAC-Papier unterstützt einen «Entwurf für den Erhalt der globalen US-Vormachtstellung, die das Aufkommen eines grossen Machtrivalen ausschliesst und die internationale Sicherheitsordnung auf der Grundlage amerikanischer Prinzipien und Interessen gestaltet. Die amerikanische Grossstrategie muss so weit wie möglich in die Zukunft hinein geplant werden.» Weiter müssen die USA «fortgeschrittene Industrienationen davon abbringen, unsere Führerschaft in Frage zu stellen oder nur auf eine grössere regionale oder globale Rolle zu spekulieren.»
Die PNAC-Mitgliedschaft(sliste) von 2000 liest sich wie ein Dienstplan der heutigen Bush-Administration. Sie enthält Cheney, seine Frau Lynne Cheney, den neokonservativen persönliche Berater Cheney`s, Lewis Libby; Donald Rumsfeld; Rumsfelds Deputy Secretary Paul Wolfowitz. Sie enthält ebenfalls den Chef des National Security Council SC für den Nahen Osten, Elliott Abrams; John Bolton vom State Department, Richard Perle, und William Kristol. Mit von der Partie waren auch der frühere Vizepräsident von Lockheed-Martin, Bruce Jackson, und der ex-CIA-Kopf James Woolsey, zusammen mit Norman Podhoretz, einem weiteren Gründungsmitglied der Neo-Cons. Woolsey und Podhoretz sprechen offen davon, sich im «Vierten Weltkrieg» zu befinden.
Eine menschliche Finanzwirtschaft entwickeln
Es wird vielen immer klarer, dass es bei dem Krieg im Irak um den Erhalt eines bankrotten amerikanischen Jahrhundertmodells zur Weltbeherrschung geht. Es ist ebenso klar, dass der Irak nicht das Ende sein wird. Was jedoch nicht klar ist und was in der ganzen Welt offen diskutiert werden muss, ist, wie die gescheiterte Petro-Dollar-Ordnung durch ein neues System für globalen wirtschaftlichen Wohlstand und Sicherheit ersetzt werden kann.
Jetzt, da im Irak ein internes Chaos droht, ist es wichtig, die gesamte Nachkriegs-Währungsordnung neu zu überdenken. Die gegenwärtige französisch-deutsch-russische Allianz zur Bildung eines Gegengewichts gegenüber den Vereinigten Staaten benötigt nicht allein eine französisch-geführte Version des Petro-Dollar-Systems, so etwas wie ein Petro-Euro-System, das das bankrotte amerikanische Jahrhundert nur mit einem französischen Akzent weiterführt und in dem der Dollar lediglich durch den Euro ersetzt würde. Dies wäre nicht nur eine Verschwendung menschlicher Energien und würde zu steigender Arbeitslosigkeit in den Industrie- und Entwicklungsländern führen, sondern es würde auch den Lebensstandard weltweit weiter herabsetzen. Was einige Ökonomen während der Asienkrise 1998 begannen, muss weitergeführt werden: Ein grundsätzliches Nachdenken über die Basis für ein neues monetäres System, welches die menschliche Entwicklung unterstützt und nicht zerstört.
1 Engdahl, F. William, Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, Wiesbaden 2002. Im Kapitel 9-10 wird die Schaffung und Auswirkung des Recycling-Petrodollars und das geheime Saltsjoebaden Treffen 1973 für die Vorbereitung der Ölkrise ausgeführt.
2 Pressemitteilung des Radio Liberty/RFE, Charles Recknagel «Irak: Bagdad bewegt sich auf den Euro zu», 1. November 2000. Die Nachricht wurde während 48 Stunden durch CNN und andere Medien aufgenommen und verschwand prompt aus den Schlagzeilen. Seit dem Artikel von William Clark «Die wirklichen, aber unausgesprochenen Gründe für den bevorstehenden Irak-Krieg» erschien im Internet am 2. Februar 2003 - eine lebendige Online-Diskussion über den Öl-Euro-Faktor fand statt, aber abgesehen von gelegentlichen Erwähnungen im Londoner «Guardian» wurde in den Hauptmedien wenig über die strategischen Hintergrundfaktoren für die Washingtoner Entscheidung, gegen Irak vorzugehen, gesagt.
3 Der Geheimdienstonline-Herausgeber, Guillaume Dasquie, ist ein französischer Spezialist für strategische Geheimdienste und hat für die französischen Geheimdienste bezüglich des bin-Laden-Falls und andere Untersuchungen gearbeitet. Seine Erwähnungen zur französischen Geopolitik reflektieren klar das französische Denken auf hohem Niveau.
4 erschien am 4. April 2003. Er erörtert im Detail eine französische Analyse über die Verletzlichkeit des Dollarsystems am Vorabend des Irak-Krieges
--------------------------------------------------------------------------------
Das System von Bretton Woods
zf. Um das im September 1931 zusammengebrochene internationale Währungssystem neu zu ordnen, wurden an der Internationalen Währungs- und Finanzkonferenz, die vom 1. bis 22. Juli 1944 in Bretton Woods (New Hampshire, USA) stattfand, die Verträge über die Errichtung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) geschlossen und ein neues Weltwährungssystem begründet.
Das Bretton-Woods-System war eine Reaktion auf die durch Abwertungswettläufe und Protektionismus gekennzeichnete Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ziel war ein Welthandel ohne Handelsschranken und mit nur sehr geringen Schwankungen bei den Wechselkursen.
Der US-Dollar sollte zukünftig die Weltleitwährung sein und an einen Gold-Standard gebunden werden. Konkret wurde beschlossen, einen Preis von 35 US-Dollar pro Unze Gold festzulegen. Die USA verpflichteten sich, US-Dollar weltweit zu diesem Goldpreis zu verkaufen oder anzukaufen. Die Wechselkurse wurden gegenüber dem US-Dollar festgelegt, und die anderen Notenbanken verpflichteten sich, die Währungen ihrer Länder entsprechend dem festgelegten Wechselkurs zu stabilisieren. Der IWF sollte die Aufgabe haben, bei vorübergehenden Zahlungsbilanzproblemen von Staaten Kredite zu gewähren. Die Weltbank sollte die Kreditgewährung für Entwicklungsländer erleichtern.
--------------------------------------------------------------------------------
Der «Washington Consensus»
zf. Der Begriff «Washington Consensus» wurde von dem Wirtschaftswissenschafter John Williamson im Jahr 1989 geprägt. Unter diesem Begriff fasste er zusammen, was er als einen aktuellen Konsens zwischen dem Kongress der USA, dem IWF, der Weltbank und wichtigen Think tanks empfand. Zehn verschiedene Politikempfehlungen bildeten diesen Konsens zur «Reform» angeschlagener Volkswirtschaften:
1. Disziplin der öffentlichen Haushalte,
2. Umleitung öffentlicher Ausgaben in Felder, die sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch eine gleichmässigere Einkommensverteilung versprechen,
3. Steuerreformen mit niedrigeren Höchststeuersätzen und einer breiteren Steuerbasis,
4. Liberalisierung des Finanzmarktes,
5. Schaffung eines stabilen, wettbewerbsfähigen Wechselkurses,
6. Handelsliberalisierung,
7. Beseitigung von Marktzutrittsschranken und Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen (Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Firmen),
8. Privatisierung,
9. Deregulierung,
10. Gesicherte Eigentumsrechte.
Artikel 5: Zeit-Fragen Nr.22 vom 16. 6. 2003, letzte Änderung am 17. 6. 2003
http://www.zeit.de/2003/26/Mentalit_8atsvergl_
Vergleich
Mars oder Venus
Es gibt sie, die mentalen Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland
Von Marcia Pally
Glaubt man Robert Kagan, dem Mitbegründer des Project for a New Amercian Century, dann kommen Amerikaner vom Mars und die Europäer von der Venus – die Amerikaner sind martialisch, maskulin und unkommunikativ, während Europa feminin und kommunikativ ist und den Konsens schätzt. Das ist inzwischen ein geflügeltes Wort, aber leider haut Kagan ziemlich daneben, zumal die Amerikaner nicht vom Mars kommen, sondern – aus Europa. Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen US-Amerikanern und den Deutschen, Unterschiede zwischen den Völkern, nicht den Regierungsparteien. Doch welche sind es?
Wenn Deutsche ihre Betroffenheit über Neonazis äußern, murmele ich etwas über die Graswurzel-Struktur der Bürgerrechtsbewegung. Dann murmeln die Deutschen zurück, der Staat müsse dieses Problem lösen. Ich murmele das Übliche über das US-amerikanische Verständnis von Redefreiheit; sie murmeln das Übliche über die Besonderheiten der deutschen Geschichte. Ich sage, ihr könnt keinen Pluralismus haben, wenn ihr immer nach Papi ruft; sie sagen, man könne keinen Pluralismus haben, wenn die Nazis kommen. Ein anderes Gespräch, das ich immer wieder führe, beginnt mit dem deutschen Widerstand gegen Bushs Nachkriegspolitik im Irak. Den Irakern stünde das Recht auf Selbstbestimmung zu, und sie sollten selbst ihre Sache auskämpfen. Die Aufgabe der UN sei es lediglich, Zusammenstöße zu verhindern, ohne in die Auseinandersetzungen einzugreifen. So wie die deutsche Regierung, wenn es gegen die Nazis geht?
Deutsche glauben an den Staat
Für mich stellt die Sache sich so da: Die Deutschen glauben so fest an das Funktionieren ihrer Institutionen, wie es den meisten US-Amerikanern nie in den Sinn kommen würde. Sie sind auf romantische Weise in ihre Systeme verliebt und schreiben ihnen die Macht zu, Staaten zu erschaffen und aufrechtzuerhalten, demokratisch oder nicht. Gerade weil die Deutschen davon ausgehen, dass Systeme oder Ministerien funktionieren, empfinden sie eine Spaltung zwischen sich und den Autoritäten. Ein fundiertes Misstrauen gegenüber der Macht, während sie gleichzeitig erwarten, dass die Macht funktioniert. Also sagen sie: Deutsche Regierung – ja (die Regierung funktioniert); amerikanische Regierung– nein (die Regierung ist suspekt).
Die Idee, den Staat anzurufen, um das Faschismusproblem zu lösen, finde ich wahrhaft bemerkenswert – die Vorstellung, der Staat, nicht die Bürger, hielten das Gemeinwesen gegen die Nazis zusammen. Die Deutschen glauben, ihre Regierung werde das richtige Gesetz verabschieden. Und nicht nur gegen die Neonazis. In jeder Unterhaltung, in der die Rede auf das deutsche Gesundheits- oder Bildungssystem, auf genmanipulierte Lebensmittel, auf das Zivil- oder Einwanderungsrecht kommt, begegnet mir der Glaube, die Regierung werde die Sache schon richten. Gleichzeitig verfügt Deutschland über stärkere Oppositionsparteien als die USA; das Meinungsspektrum in der Presse ist breiter, die Angriffe auf die Regierungsparteien sind schärfer. Alles in allem scheint es sich bei dem Wunsch, die Regierung möge funktionieren, und dem Bedürfnis, Barrikaden gegen sie zu errichten, um einen inneren Widerspruch zu handeln, der Deutschland antreibt. Er ist nicht weniger verrückt als der amerikanische Glaube, dass nichts funktioniert und die Regierung am allerwenigsten.
Der rebellische Individualismus der USA schüttet Hohn und Spott über „Systeme“ aus, erst recht über die Regierung, und zwar wegen ihrer legendären Inkompetenz. Der Regierung begegnet man mit Erwartungen, die man sonst seinem Klempner gegenüber hegt. Manchmal schlägt die Reparatur fehl, aber am Ende kriegt man die Sache schon hin. Bei uns sagen wir: Wenn die Regierung über Bord ginge, würde sie um sich schlagen, ohne das Wasser zu treffen. Und die Vorstellung, sie könnte das richtige Gesetz verabschieden, kommt allen so lächerlich vor wie mir die Vorstellung, die Telefongesellschaft könne mein Fax ordnungsgemäß zustellen.
Nur ihr Ungeschick ist unentschuldbar. Die Inkompetenz der US-Regierung ist nur deshalb von mythischem Ausmaß, weil wir an diesen Mythos glauben wollen. Denn warum sonst wären die Amerikaner bereit, Bushs Steuererleichterungen zu schlucken, die dem reichsten einen Prozent der Bürger 726 Milliarden Dollar schenken? Die Vorstellung von den ewig wachsenden Möglichkeiten, die einen selbst bald in das oberste eine Prozent katapultieren, ist nur der zweite Grund. Vor allem glauben die Menschen, dass die Regierung sowieso keine Ahnung hat, was sie mit dem Geld anfangen soll.

Amerikaner belächeln die Macht
Deutschland und die USA haben ihre gegenläufigen inneren Widersprüche ehrlich erworben. Länger und fester als beinahe jede andere westeuropäische Gesellschaft befand sich Deutschland in den Händen des Adels, dann wuchs das Land unter Bismarcks Stiefel zur modernen Großmacht, und dann kam Hitlers Stiefel. Kein Wunder, dass die Deutschen ihre Oppositionsparteien so lieb haben. Die USA hingegen wurden geboren, als sie den britischen Stiefel abschüttelten. Die erste amerikanische Regierung war so schwach, dass sie bald wieder auseinander fiel. Über hundert Jahre dauerte es, bis die Macht der (zweiten) Bundesregierung größer wurde als die der Regierungen der einzelnen Staaten.
Und noch einen Unterschied gibt es. Deutsche Radikale streben nach der Regierungsmacht, amerikanische Radikale zieht es nach Montana, um der Macht zu entkommen. Deutschland hatte den Rationalismus, den Idealismus und den Marxismus; Philosophien, die nicht nur von ahistorischen Vorstellungen wie Universalismus, Notwendigkeit und Transzendenz bestimmt waren, sondern auch auf romantische, beinahe mystische Weise ein einheitliches System zur Erklärung von Natur und Geschichte schaffen wollten. Amerika denkt auf den Bahnen des philosophischen Pragmatismus. Tocqueville bemerkte schon früh, dass die Amerikaner sich, in ihrem Bemühen weiterzukommen, „mit Annäherungen begnügen“. Sie glauben eher an Kontingenz und Geschichtlichkeit, lehnen Ursprungsdenken ab und vertrauen darauf, Hypothesen überprüfen und revidieren zu können. Amerikaner halten es eher mit den „Versionen der Wahrheit“ (Nelson Goodman) und weigern sich, epistomologische Konstanten (wie Kants „Einbildungskraft“ ) zu akzeptieren – oder das, was Wilfred Sellars „den Mythos des Gegebenen“ nannte. Und Ralph Waldo Emerson war sich sicher: „Um jeden Kreis kann ein anderer noch gezogen werden … zur Mittagstunde dämmert der Morgen immer neu.“
Weil die Amerikaner so wenig mit Systemen im Allgemeinen und der Regierung im Besonderen am Hut haben, sehen sie, anders als die deutsche Linke, in struktureller Gewalt nicht ihren Feind. In der amerikanischen Mythologie ist die Regierung zittrig, nicht böse. Notfalls kommen wir auch ohne sie aus und zaubern eine jener unternehmerischen Sofortlösungen aus dem Hut, die uns zur stärksten wirtschaftlichen Antriebskraft des Planeten gemacht haben. Rezession? Na gut, dann versuchen wir es mit Steuersenkungen à la Reagan, was schon damals nicht funktionierte. Wenn die Sofortlösungen unserem Sinn für good guy-Heldentum schmeicheln, sind wir noch schneller. Ein Krieg im Irak, der das Terrorproblem löst und Demokratie in die Welt trägt? Klingt einfach. Und schon schunkeln die Massen in fröhlichem Patriotismus.
Selbst in New York erreichten die Zustimmungsraten für Bush nach dem Irak-Krieg fast 50 Prozent. Der Westen sorgt sich um die Stimmung auf der arabischen „Straße“, aber auf der amerikanischen Straße hat man traditionell wenig Lust auf eine Kritik der Macht, höchstens der Ineffizienz. Und wenn es gar keine Massenvernichtungswaffen im Irak gibt? Was soll’s, wir wissen sowieso, dass die Regierung von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, und außerdem haben wir schließlich gewonnen.
Die Deutschen und große Teile Europas grenzen sich gegen ihre Regierungen ab, weil sie erlebt haben, dass das System auf vernichtende Weise funktionieren kann. Mit Regierungen, die unfreiheitlich vorgehen, und sei es mit den besten Absichten, hat Europa mehr als genug Erfahrung. Jeder Kreuzritter, jeder Regent seit Cesare Borgia hatte Gott auf seiner Seite. Brachte Napoleon nicht die Menschenrechte zu jenen Undankbaren in ganz Europa, die es sich aus irgendeinem Grund nicht gefallen lassen wollten, dass ihnen liberales Gedankengut von seinen Armeen aufgezwungen wird?
Die Irrtümer über die jeweils anderen sind, auf beiden Seiten des Atlantiks, erwartungsgemäß Projektionen des jeweils Eigenen. Die Deutschen sehen Bushs Unilateralismus und Ashcrofts Angriff auf die Menschenrechte und erinnern sich, wie wenig Widerstand Europa einst dem Faschismus entgegengesetzt hat. Die Amerikaner liegen genauso weit daneben und sehen ein gigantisches Chaos vor sich – die Regierung konnte noch nicht einmal den 11. September verhindern. Die Amerikaner hören sich die komplizierten EU-Verhandlungen über den Irak und die erlaubte Größe von Bananen an und erkennen darin nichts als Unfähigkeit und Impotenz. So lange alles gut läuft, sind Deutsche und Amerikaner einer Meinung, aber in der Not fürchten sie ganz unterschiedliche Dämonen. Die Deutschen glauben, das „Imperiale“ sei eine Sache des Staates, mit dessen Macht sie vertraut sind, weshalb sie sie fürchten. Für Emerson dagegen war selbst das Imperiale eine individuelle Angelegenheit. Er schrieb vom „imperialen“ Selbst.
Deutsch von Robin Detje. – Von der New Yorker Publizistin Marcia Pally erschien eben im Berlin Verlag: „Lob der Kritik. Warum die Demokratie nicht auf ihren Kern verzichten darf“
(c) DIE ZEIT 18.06.2003 Nr.26
-----
Sind halt alle bisle doof im Kopf.
Nur Kriege führen ein Glück die Deutschen nicht mehr!
Vergleich
Mars oder Venus
Es gibt sie, die mentalen Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland
Von Marcia Pally
Glaubt man Robert Kagan, dem Mitbegründer des Project for a New Amercian Century, dann kommen Amerikaner vom Mars und die Europäer von der Venus – die Amerikaner sind martialisch, maskulin und unkommunikativ, während Europa feminin und kommunikativ ist und den Konsens schätzt. Das ist inzwischen ein geflügeltes Wort, aber leider haut Kagan ziemlich daneben, zumal die Amerikaner nicht vom Mars kommen, sondern – aus Europa. Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen US-Amerikanern und den Deutschen, Unterschiede zwischen den Völkern, nicht den Regierungsparteien. Doch welche sind es?
Wenn Deutsche ihre Betroffenheit über Neonazis äußern, murmele ich etwas über die Graswurzel-Struktur der Bürgerrechtsbewegung. Dann murmeln die Deutschen zurück, der Staat müsse dieses Problem lösen. Ich murmele das Übliche über das US-amerikanische Verständnis von Redefreiheit; sie murmeln das Übliche über die Besonderheiten der deutschen Geschichte. Ich sage, ihr könnt keinen Pluralismus haben, wenn ihr immer nach Papi ruft; sie sagen, man könne keinen Pluralismus haben, wenn die Nazis kommen. Ein anderes Gespräch, das ich immer wieder führe, beginnt mit dem deutschen Widerstand gegen Bushs Nachkriegspolitik im Irak. Den Irakern stünde das Recht auf Selbstbestimmung zu, und sie sollten selbst ihre Sache auskämpfen. Die Aufgabe der UN sei es lediglich, Zusammenstöße zu verhindern, ohne in die Auseinandersetzungen einzugreifen. So wie die deutsche Regierung, wenn es gegen die Nazis geht?
Deutsche glauben an den Staat
Für mich stellt die Sache sich so da: Die Deutschen glauben so fest an das Funktionieren ihrer Institutionen, wie es den meisten US-Amerikanern nie in den Sinn kommen würde. Sie sind auf romantische Weise in ihre Systeme verliebt und schreiben ihnen die Macht zu, Staaten zu erschaffen und aufrechtzuerhalten, demokratisch oder nicht. Gerade weil die Deutschen davon ausgehen, dass Systeme oder Ministerien funktionieren, empfinden sie eine Spaltung zwischen sich und den Autoritäten. Ein fundiertes Misstrauen gegenüber der Macht, während sie gleichzeitig erwarten, dass die Macht funktioniert. Also sagen sie: Deutsche Regierung – ja (die Regierung funktioniert); amerikanische Regierung– nein (die Regierung ist suspekt).
Die Idee, den Staat anzurufen, um das Faschismusproblem zu lösen, finde ich wahrhaft bemerkenswert – die Vorstellung, der Staat, nicht die Bürger, hielten das Gemeinwesen gegen die Nazis zusammen. Die Deutschen glauben, ihre Regierung werde das richtige Gesetz verabschieden. Und nicht nur gegen die Neonazis. In jeder Unterhaltung, in der die Rede auf das deutsche Gesundheits- oder Bildungssystem, auf genmanipulierte Lebensmittel, auf das Zivil- oder Einwanderungsrecht kommt, begegnet mir der Glaube, die Regierung werde die Sache schon richten. Gleichzeitig verfügt Deutschland über stärkere Oppositionsparteien als die USA; das Meinungsspektrum in der Presse ist breiter, die Angriffe auf die Regierungsparteien sind schärfer. Alles in allem scheint es sich bei dem Wunsch, die Regierung möge funktionieren, und dem Bedürfnis, Barrikaden gegen sie zu errichten, um einen inneren Widerspruch zu handeln, der Deutschland antreibt. Er ist nicht weniger verrückt als der amerikanische Glaube, dass nichts funktioniert und die Regierung am allerwenigsten.
Der rebellische Individualismus der USA schüttet Hohn und Spott über „Systeme“ aus, erst recht über die Regierung, und zwar wegen ihrer legendären Inkompetenz. Der Regierung begegnet man mit Erwartungen, die man sonst seinem Klempner gegenüber hegt. Manchmal schlägt die Reparatur fehl, aber am Ende kriegt man die Sache schon hin. Bei uns sagen wir: Wenn die Regierung über Bord ginge, würde sie um sich schlagen, ohne das Wasser zu treffen. Und die Vorstellung, sie könnte das richtige Gesetz verabschieden, kommt allen so lächerlich vor wie mir die Vorstellung, die Telefongesellschaft könne mein Fax ordnungsgemäß zustellen.
Nur ihr Ungeschick ist unentschuldbar. Die Inkompetenz der US-Regierung ist nur deshalb von mythischem Ausmaß, weil wir an diesen Mythos glauben wollen. Denn warum sonst wären die Amerikaner bereit, Bushs Steuererleichterungen zu schlucken, die dem reichsten einen Prozent der Bürger 726 Milliarden Dollar schenken? Die Vorstellung von den ewig wachsenden Möglichkeiten, die einen selbst bald in das oberste eine Prozent katapultieren, ist nur der zweite Grund. Vor allem glauben die Menschen, dass die Regierung sowieso keine Ahnung hat, was sie mit dem Geld anfangen soll.


Amerikaner belächeln die Macht
Deutschland und die USA haben ihre gegenläufigen inneren Widersprüche ehrlich erworben. Länger und fester als beinahe jede andere westeuropäische Gesellschaft befand sich Deutschland in den Händen des Adels, dann wuchs das Land unter Bismarcks Stiefel zur modernen Großmacht, und dann kam Hitlers Stiefel. Kein Wunder, dass die Deutschen ihre Oppositionsparteien so lieb haben. Die USA hingegen wurden geboren, als sie den britischen Stiefel abschüttelten. Die erste amerikanische Regierung war so schwach, dass sie bald wieder auseinander fiel. Über hundert Jahre dauerte es, bis die Macht der (zweiten) Bundesregierung größer wurde als die der Regierungen der einzelnen Staaten.
Und noch einen Unterschied gibt es. Deutsche Radikale streben nach der Regierungsmacht, amerikanische Radikale zieht es nach Montana, um der Macht zu entkommen. Deutschland hatte den Rationalismus, den Idealismus und den Marxismus; Philosophien, die nicht nur von ahistorischen Vorstellungen wie Universalismus, Notwendigkeit und Transzendenz bestimmt waren, sondern auch auf romantische, beinahe mystische Weise ein einheitliches System zur Erklärung von Natur und Geschichte schaffen wollten. Amerika denkt auf den Bahnen des philosophischen Pragmatismus. Tocqueville bemerkte schon früh, dass die Amerikaner sich, in ihrem Bemühen weiterzukommen, „mit Annäherungen begnügen“. Sie glauben eher an Kontingenz und Geschichtlichkeit, lehnen Ursprungsdenken ab und vertrauen darauf, Hypothesen überprüfen und revidieren zu können. Amerikaner halten es eher mit den „Versionen der Wahrheit“ (Nelson Goodman) und weigern sich, epistomologische Konstanten (wie Kants „Einbildungskraft“ ) zu akzeptieren – oder das, was Wilfred Sellars „den Mythos des Gegebenen“ nannte. Und Ralph Waldo Emerson war sich sicher: „Um jeden Kreis kann ein anderer noch gezogen werden … zur Mittagstunde dämmert der Morgen immer neu.“
Weil die Amerikaner so wenig mit Systemen im Allgemeinen und der Regierung im Besonderen am Hut haben, sehen sie, anders als die deutsche Linke, in struktureller Gewalt nicht ihren Feind. In der amerikanischen Mythologie ist die Regierung zittrig, nicht böse. Notfalls kommen wir auch ohne sie aus und zaubern eine jener unternehmerischen Sofortlösungen aus dem Hut, die uns zur stärksten wirtschaftlichen Antriebskraft des Planeten gemacht haben. Rezession? Na gut, dann versuchen wir es mit Steuersenkungen à la Reagan, was schon damals nicht funktionierte. Wenn die Sofortlösungen unserem Sinn für good guy-Heldentum schmeicheln, sind wir noch schneller. Ein Krieg im Irak, der das Terrorproblem löst und Demokratie in die Welt trägt? Klingt einfach. Und schon schunkeln die Massen in fröhlichem Patriotismus.
Selbst in New York erreichten die Zustimmungsraten für Bush nach dem Irak-Krieg fast 50 Prozent. Der Westen sorgt sich um die Stimmung auf der arabischen „Straße“, aber auf der amerikanischen Straße hat man traditionell wenig Lust auf eine Kritik der Macht, höchstens der Ineffizienz. Und wenn es gar keine Massenvernichtungswaffen im Irak gibt? Was soll’s, wir wissen sowieso, dass die Regierung von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, und außerdem haben wir schließlich gewonnen.
Die Deutschen und große Teile Europas grenzen sich gegen ihre Regierungen ab, weil sie erlebt haben, dass das System auf vernichtende Weise funktionieren kann. Mit Regierungen, die unfreiheitlich vorgehen, und sei es mit den besten Absichten, hat Europa mehr als genug Erfahrung. Jeder Kreuzritter, jeder Regent seit Cesare Borgia hatte Gott auf seiner Seite. Brachte Napoleon nicht die Menschenrechte zu jenen Undankbaren in ganz Europa, die es sich aus irgendeinem Grund nicht gefallen lassen wollten, dass ihnen liberales Gedankengut von seinen Armeen aufgezwungen wird?
Die Irrtümer über die jeweils anderen sind, auf beiden Seiten des Atlantiks, erwartungsgemäß Projektionen des jeweils Eigenen. Die Deutschen sehen Bushs Unilateralismus und Ashcrofts Angriff auf die Menschenrechte und erinnern sich, wie wenig Widerstand Europa einst dem Faschismus entgegengesetzt hat. Die Amerikaner liegen genauso weit daneben und sehen ein gigantisches Chaos vor sich – die Regierung konnte noch nicht einmal den 11. September verhindern. Die Amerikaner hören sich die komplizierten EU-Verhandlungen über den Irak und die erlaubte Größe von Bananen an und erkennen darin nichts als Unfähigkeit und Impotenz. So lange alles gut läuft, sind Deutsche und Amerikaner einer Meinung, aber in der Not fürchten sie ganz unterschiedliche Dämonen. Die Deutschen glauben, das „Imperiale“ sei eine Sache des Staates, mit dessen Macht sie vertraut sind, weshalb sie sie fürchten. Für Emerson dagegen war selbst das Imperiale eine individuelle Angelegenheit. Er schrieb vom „imperialen“ Selbst.
Deutsch von Robin Detje. – Von der New Yorker Publizistin Marcia Pally erschien eben im Berlin Verlag: „Lob der Kritik. Warum die Demokratie nicht auf ihren Kern verzichten darf“
(c) DIE ZEIT 18.06.2003 Nr.26
-----
Sind halt alle bisle doof im Kopf.
Nur Kriege führen ein Glück die Deutschen nicht mehr!

19.06. 16:00
US: "endlich" Signale einer Erholung
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die Frühindikatoren zeigten im Mai einen Anstieg um 1% (Prognose:0,6%) und deuten laut dem Conference Board „endlich“ auf eine Erholung hin. Acht der zehn Komponenten des Indikators stiegen im Mai – angeführt von der Geldmenge, den Verbrauchererwartungen und den Aktienkursen. Zwei der Komponenten stagnierten im Mai. Im April war noch ein Anstieg um 0.1% gemeldet worden. Ken Goldstein, Volkswirt des Conference Board, mahnt jedoch zur Vorsicht, da noch nicht alle Gefahren, die in den ersten fünf Monaten die Wirtschaft negativ beeinflussten, gebannt seien. Der größte Hemmschuh für die Wirtschaftserholung sei das mangelnde Vertrauen der Unternehmen. Der Index gleichlaufender Indikatoren stieg um 0.1%, während der Index nachlaufender Indikatoren um 0.1% fiel.



US: "endlich" Signale einer Erholung
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die Frühindikatoren zeigten im Mai einen Anstieg um 1% (Prognose:0,6%) und deuten laut dem Conference Board „endlich“ auf eine Erholung hin. Acht der zehn Komponenten des Indikators stiegen im Mai – angeführt von der Geldmenge, den Verbrauchererwartungen und den Aktienkursen. Zwei der Komponenten stagnierten im Mai. Im April war noch ein Anstieg um 0.1% gemeldet worden. Ken Goldstein, Volkswirt des Conference Board, mahnt jedoch zur Vorsicht, da noch nicht alle Gefahren, die in den ersten fünf Monaten die Wirtschaft negativ beeinflussten, gebannt seien. Der größte Hemmschuh für die Wirtschaftserholung sei das mangelnde Vertrauen der Unternehmen. Der Index gleichlaufender Indikatoren stieg um 0.1%, während der Index nachlaufender Indikatoren um 0.1% fiel.



http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,253746,00.html
ATTACKE AUF BUSH
"Er hat jeden von uns in die Irre geführt"
Die Debatte um die Gründe des Irak-Kriegs holt US-Präsident Bush womöglich doch noch ein. Gleich drei führende Köpfe der Demokratischen Partei meldeten sich mit scharfer Kritik zu Wort. Sie fordern eine Untersuchung und wollen die Kriegslüge gar zu einem zentralen Thema des Präsidentschaftswahlkampfs machen.
Washington - Mit einer Mischung aus Mitleid und Erleichterung konnte George W. Bush bisher das Treiben in Großbritannien beobachten. Der Streit um gefälschtes Geheimdienst-Material, vorgeschobene Kriegsgründe und übertriebene Gefahren durch irakische Massenvernichtungswaffen bescherte dem britischen Premierminister Tony Blair die schwerste Krise seit seinem Amtsantritt. Der US-Präsident blieb bisher weitgehend von der Kriegslügen-Debatte verschont: Die Mehrheit des amerikanischen Volks fand den Krieg gerecht und hat kaum Interesse an Diskussionen über die Gründe eines Waffengangs, der längst vorbei ist. Das aber könnte sich womöglich ändern, denn die Opposition scheint nach langem Dornröschenschlaf ihre Chance zu wittern.
"Ich werde ihn nicht mehr vom Haken lassen"
Senator John Kerry, einer der aussichtsreichsten Bewerber für den Posten des demokratischen Bush-Herausforderers im Präsidentschaftswahlkampf 2004, übte als erster führender Vertreter seiner Partei scharfe Kritik am Amtsinhaber. "Er hat jeden von uns in die Irre geführt", sagte Kerry. Dies sei einer der Gründe, warum er als Präsidentschaftskandidat antreten wolle.
"Ich werde ihn in diesem Wahlkampf nicht vom Haken lassen", betonte der Senator. Immerhin gehe es um nicht weniger als die Glaubwürdigkeit Amerikas. "Falls er gelogen hat", sagte Kerry, "hat er auch mich persönlich belogen." Unverhohlen drohte Kerry damit, Bush weiterhin mit parlamentarischen Ausschüssen zu traktieren. "Der Kongress wird der Sache auf den Grund gehen", sagte der Senator.
Dean fordert unabhängige Untersuchung
Howard Dean, ein weiterer Demokraten-Kandidat für die Präsidentschaftswahl, forderte gar eine unabhängige Untersuchung der von Bush genannten Kriegsgründe. "Ich glaube, dass der Präsident seinem Land eine Erklärung schuldet, denn was der Präsident gesagt hat, entsprach nicht vollständig der Wahrheit." Genussvoll zitierte Dean Sätze der Regierung über die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen und die Gefahr, die Saddam Hussein angeblich für die Vereinigten Staaten darstelle. Abschließend warf der Senator der Regierung vor, wissentlich falsche Behauptungen aufgestellt zu haben.
"Wir brauchen eine eingehende Untersuchung dessen, was zum Krieg gegen den Irak führte", verlangte Dean. "Mir scheint, dass der Präsident die Entscheidung für den Krieg schon Anfang 2002 oder vielleicht sogar Ende 2001 fällte und dann versuchte, ihn nachträglich zu rechtfertigen."
Bob Graham, ein einflussreicher demokratischer Senator und ebenfalls Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, wollte seinen parteiinternen Rivalen nicht nachstehen. Die Unfähigkeit der alliierten Truppen, Massenvernichtungswaffen im Irak zu finden, stelle die Glaubwürdigkeit der US-Regierung in Frage, sagte Graham.
Während sich führende Mitglieder der britischen Regierung bis hin zum Premierminister weit vorwagten, indem sie die Entdeckung von Saddams Waffen zur bloßen Zeitfrage erklärten, lässt die US-Regierung ihre schwachen Gegenangriffe durch Männer aus der zweiten Reihe vortragen. Ein Pentagon-Mitarbeiter namens Douglas Feith sagte der britischen BBC, man werde die irakischen Massenvernichtungswaffen in jedem Fall finden. Dass bisher keine Spur von ihnen aufgetaucht sei, bedeute im Übrigen nicht, dass der Krieg an sich falsch gewesen sei.
Frust und Ärger bei Bush
Die scharfen Attacken der US-Senatoren markieren einen Bruch mit der bisherigen Strategie der Demokraten, die bisher - offenbar aus Angst vor schlechten Umfragewerten - nur verhaltene Kritik an der Irak-Politik der Regierung geübt hatten. Bush reagiert unterdessen zunehmend dünnhäutig auf die Vorwürfe. "Tony Blair arbeitete auf der Basis guten Geheimdienst-Materials", wiederholte der Präsident gebetsmühlenartig. Die Vorwürfe gegen den Premierminister seien "einfach nicht wahr".
Ein BBC-Korrespondent beschrieb Bush als frustriert, ja geradezu verärgert angesichts der nicht enden wollenden Debatte in Großbritannien. Beobachter mutmaßen bereits, der Präsident fürchte zum Wahlkampf-Auftakt eine ähnliche Debatte, wie sie derzeit Blair zu schaffen macht. Hinzu kommt, dass Bush in wichtigen Bereichen wie der Wirtschafts- und Sozialpolitik weder Erfolge noch gute Umfragewerte vorzuweisen hat.
Unter Republikanern dürfte das böse Erinnerungen wecken. 1992 verlor der Vater des amtierenden Präsidenten sein Amt an Bill Clinton, weil er die Innenpolitik aus den Augen verloren hatte. Dass er zuvor im Krieg gegen den Irak siegreich war, konnte ihn nicht mehr retten.

ATTACKE AUF BUSH
"Er hat jeden von uns in die Irre geführt"
Die Debatte um die Gründe des Irak-Kriegs holt US-Präsident Bush womöglich doch noch ein. Gleich drei führende Köpfe der Demokratischen Partei meldeten sich mit scharfer Kritik zu Wort. Sie fordern eine Untersuchung und wollen die Kriegslüge gar zu einem zentralen Thema des Präsidentschaftswahlkampfs machen.
Washington - Mit einer Mischung aus Mitleid und Erleichterung konnte George W. Bush bisher das Treiben in Großbritannien beobachten. Der Streit um gefälschtes Geheimdienst-Material, vorgeschobene Kriegsgründe und übertriebene Gefahren durch irakische Massenvernichtungswaffen bescherte dem britischen Premierminister Tony Blair die schwerste Krise seit seinem Amtsantritt. Der US-Präsident blieb bisher weitgehend von der Kriegslügen-Debatte verschont: Die Mehrheit des amerikanischen Volks fand den Krieg gerecht und hat kaum Interesse an Diskussionen über die Gründe eines Waffengangs, der längst vorbei ist. Das aber könnte sich womöglich ändern, denn die Opposition scheint nach langem Dornröschenschlaf ihre Chance zu wittern.
"Ich werde ihn nicht mehr vom Haken lassen"
Senator John Kerry, einer der aussichtsreichsten Bewerber für den Posten des demokratischen Bush-Herausforderers im Präsidentschaftswahlkampf 2004, übte als erster führender Vertreter seiner Partei scharfe Kritik am Amtsinhaber. "Er hat jeden von uns in die Irre geführt", sagte Kerry. Dies sei einer der Gründe, warum er als Präsidentschaftskandidat antreten wolle.
"Ich werde ihn in diesem Wahlkampf nicht vom Haken lassen", betonte der Senator. Immerhin gehe es um nicht weniger als die Glaubwürdigkeit Amerikas. "Falls er gelogen hat", sagte Kerry, "hat er auch mich persönlich belogen." Unverhohlen drohte Kerry damit, Bush weiterhin mit parlamentarischen Ausschüssen zu traktieren. "Der Kongress wird der Sache auf den Grund gehen", sagte der Senator.
Dean fordert unabhängige Untersuchung
Howard Dean, ein weiterer Demokraten-Kandidat für die Präsidentschaftswahl, forderte gar eine unabhängige Untersuchung der von Bush genannten Kriegsgründe. "Ich glaube, dass der Präsident seinem Land eine Erklärung schuldet, denn was der Präsident gesagt hat, entsprach nicht vollständig der Wahrheit." Genussvoll zitierte Dean Sätze der Regierung über die Existenz irakischer Massenvernichtungswaffen und die Gefahr, die Saddam Hussein angeblich für die Vereinigten Staaten darstelle. Abschließend warf der Senator der Regierung vor, wissentlich falsche Behauptungen aufgestellt zu haben.
"Wir brauchen eine eingehende Untersuchung dessen, was zum Krieg gegen den Irak führte", verlangte Dean. "Mir scheint, dass der Präsident die Entscheidung für den Krieg schon Anfang 2002 oder vielleicht sogar Ende 2001 fällte und dann versuchte, ihn nachträglich zu rechtfertigen."
Bob Graham, ein einflussreicher demokratischer Senator und ebenfalls Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, wollte seinen parteiinternen Rivalen nicht nachstehen. Die Unfähigkeit der alliierten Truppen, Massenvernichtungswaffen im Irak zu finden, stelle die Glaubwürdigkeit der US-Regierung in Frage, sagte Graham.
Während sich führende Mitglieder der britischen Regierung bis hin zum Premierminister weit vorwagten, indem sie die Entdeckung von Saddams Waffen zur bloßen Zeitfrage erklärten, lässt die US-Regierung ihre schwachen Gegenangriffe durch Männer aus der zweiten Reihe vortragen. Ein Pentagon-Mitarbeiter namens Douglas Feith sagte der britischen BBC, man werde die irakischen Massenvernichtungswaffen in jedem Fall finden. Dass bisher keine Spur von ihnen aufgetaucht sei, bedeute im Übrigen nicht, dass der Krieg an sich falsch gewesen sei.
Frust und Ärger bei Bush
Die scharfen Attacken der US-Senatoren markieren einen Bruch mit der bisherigen Strategie der Demokraten, die bisher - offenbar aus Angst vor schlechten Umfragewerten - nur verhaltene Kritik an der Irak-Politik der Regierung geübt hatten. Bush reagiert unterdessen zunehmend dünnhäutig auf die Vorwürfe. "Tony Blair arbeitete auf der Basis guten Geheimdienst-Materials", wiederholte der Präsident gebetsmühlenartig. Die Vorwürfe gegen den Premierminister seien "einfach nicht wahr".
Ein BBC-Korrespondent beschrieb Bush als frustriert, ja geradezu verärgert angesichts der nicht enden wollenden Debatte in Großbritannien. Beobachter mutmaßen bereits, der Präsident fürchte zum Wahlkampf-Auftakt eine ähnliche Debatte, wie sie derzeit Blair zu schaffen macht. Hinzu kommt, dass Bush in wichtigen Bereichen wie der Wirtschafts- und Sozialpolitik weder Erfolge noch gute Umfragewerte vorzuweisen hat.
Unter Republikanern dürfte das böse Erinnerungen wecken. 1992 verlor der Vater des amtierenden Präsidenten sein Amt an Bill Clinton, weil er die Innenpolitik aus den Augen verloren hatte. Dass er zuvor im Krieg gegen den Irak siegreich war, konnte ihn nicht mehr retten.

http://www.wdr.de/tv/wdr-dok/archiv/2003/030620_01.phtml
Aktenzeichen 11.9. ungelöst
Lügen und Wahrheiten zum 11. September 2001
Freitag, 20. Juni 2003, 23.00 Uhr:
Ein Film von Willy Brunner und Gerhard Wisnewski
Redaktion: Matthias Kremin
Aktenzeichen 11.9. ungelöst
Lügen und Wahrheiten zum 11. September 2001
Freitag, 20. Juni 2003, 23.00 Uhr:
Ein Film von Willy Brunner und Gerhard Wisnewski
Redaktion: Matthias Kremin
Zeit-Fragen Nr. 20 vom 2. 6. 2003
«Pearl Harbor 1941» und «9-11-2001»
von Moritz Nestor, Schweiz
Ronda Hauben stellt in Zeit-Fragen Nr. 17 vom 12. Mai zu Recht die Frage, ob es Zufall sei, dass der Untersuchungsbericht zum 11. September von der Bush-Administration zurückgehalten wird. Der 11. September und auch der Umgang damit weisen verblüffende Parallelen zum «plötzlichen Überfall» der Japaner auf Pearl Harbor 1941 auf: Die Empörung über Pearl Harbor trieb eine amerikanische Bevölkerung, die bis dahin zu über 80% gegen einen Kriegseintritt Amerikas war, auf die Seite der Regierung Roosevelt in den Zweiten Weltkrieg. Die berechtigte Trauer und die Empörung über die Tragödie des 11. September 2001 und ihre Opfer liess für einen grossen Teil der amerikanischen Bevölkerung den völkerrechtswidrigen Überfall auf Afghanistan als «Verteidigung» notwendig erscheinen und erlaubte es Bush, einen «30 bis 40 Jahre» andauernden, als «Krieg gegen den Terror» getarnten Eroberungsfeldzug auszurufen. Und: «9-11» diente der Bush-Mannschaft als Vorwand, einen polizeistaatlichen Repressionsapparat in den USA auf- und auszubauen.
Grosso modo lehren die Geschichtsbücher unserer Schulen seit 1945, dass 1941 die militaristischen Japaner, die mit Hitler und Mussolini unter einer Decke steckten, die friedliebenden USA ohne Vorwarnung heimtückisch überfielen und die USA damit in den Zweiten Weltkrieg gezogen wurden. Wie sehr diese Darstellung eine Geschichtsfälschung ist, und zwar wider besseres Wissen, lehrte bereits 1947 das Buch des promovierten Historikers George Morgenstern, «Pearl Harbor, The Story of the Secret War.» Man hätte es wissen können!
Wir wissen es schon lange
Morgenstern (1906-1988), Mitherausgeber der «Chicago Tribune» und während des Krieges Presseoffizier im Marine Corps, hatte darin das Material der regierungsamtlichen Untersuchungsausschüsse zu Pearl Harbor aufgearbeitet. Washington versuchte zu vernebeln, wo es ging, denn das Material, das die Ausschüsse schliesslich zutage gefördert hatten, war für die Mannschaft des inzwischen verstorbenen Kriegspräsidenten Roosevelt verheerend. Zeigte es doch, dass Roosevelt den Angriff auf Pearl Harbor provoziert hatte, um in den Krieg eintreten zu können. Erst 1998(!), das ist neben den Enthüllungen von Morgenstern ein weiterer schlimmer Skandal, sollte unter dem Titel «Pearl Harbor 1941» die deutsche Übersetzung von Morgensterns Buch erscheinen, herausgegeben und eingeleitet von Dr. Walter Post, Lehrbeauftragter am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaften der Universität München.
Die Aufklärung der wahren Hintergründe des Überfalls auf Pearl Harbor macht vorsichtiger und weitblickender bei der Beurteilung der gegenwärtigen Kriegspolitik der USA, ja ihres gesamten Aufstiegs seit dem Ersten Weltkrieg zur Weltmacht. Wenn man merkt, wie sehr die offizielle Geschichtsschreibung über die Ursachen des Zweiten Weltkriegs Hofgeschichtsschreibung ist, oft bare Lüge, Manipulation oder Gefälligkeitsschreibe, dann wird man auch vorsichtiger und hellhöriger gegenüber Vorgängen wie dem 11.9., als sofort nach dem Anschlag und ohne den geringsten Beweis die Verschwörungstheorie der US-Regierung «Osama was here» allen eingetrichtert und zum Vergeltungskrieg geblasen wurde.
Pearl Harbor - Wendepunkt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts
Pearl Harbor ist von überragender historischer Bedeutung, weil es einer der entscheidenden Wendepunkte in der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts war: Das auslösende Ereignis für Amerikas Kriegseintritt, was wiederum zur Ausschaltung von Deutschland und Japan als aggressive imperiale Grossmächte führte. England und Frankreich wurden in der Folge nach dem Zweiten Weltkrieg geopolitisch bedeutungslos, und in China siegte der Marxismus. Die UdSSR und Amerika stiegen zu Supermächten auf. Bis die USA 1991 den kalten Krieg gewonnen hatten, die UdSSR «zusammenbrach» und die USA «einzige Weltmacht» wurden. Der Weg zum Aufbau eines weltraumgestützten Raketenabwehrsystems war frei, womit sich die USA gegen jeden Angriff mit Atomraketen sicher glauben, und Bush führte den atomaren Erstschlag als Option wieder ein und beginnt einen auf «30 bis 40 Jahre» ausgelegten «Krieg gegen den Terror». Eine der wichtigsten Weichenstellungen für diese Entwicklung geschah mit der Lüge von Pearl Harbor: «Gestern, am 7. Dezember 1941 - einem Tag, der in Schande fortleben wird - wurden die Vereinigten Staaten von Amerika plötzlich und vorsätzlich von See- und Luftstreitkräften des Kaiserreiches Japan angegriffen ... Wir werden uns immer an den Charakter des Angriffs auf uns erinnern», sagte US-Präsident Roosevelt. Die Wirklichkeit war das Gegenteil, wie der britische Minister für Produktion im Kabinett Churchill, Captain Oliver Lyttelton, am 20.6.1944 vor der amerikanischen(!) Handelskammer sich zu sagen traute: «Amerika provozierte Japan in einem derartigen Ausmass, dass die Japaner gezwungen waren, Pearl Harbor anzugreifen. Es ist eine Travestie der Geschichte zu sagen, dass dieser Krieg Amerika aufgezwungen wurde.»1
Was kann man also heute - dank Morgensterns Arbeit - über diese Provokation wissen, und was müsste eigentlich in den Geschichtsbüchern unserer Kinder stehen, damit sie die Gegenwart besser beurteilen können?
Kriegsgewinnler im Ersten Weltkrieg
1936 kam ein Untersuchungsausschuss des amerikanischen Senats zum Ersten Weltkrieg zu dem Ergebnis, dass die USA «nicht wegen des deutschen U-Boot-Krieges und auch nicht wegen irgendwelcher idealistischen Ziele in den Krieg eingetreten waren. Vielmehr sollte die glänzende Rüstungskonjunktur, die durch die Waffenverkäufe an die Entente-Mächte entstanden war, möglichst verlängert und die an England und Frankreich gegebenen Kredite gerettet werden, die im Falle eines deutschen Sieges verloren gewesen wären.»2 Die Folge dieses Untersuchungsberichts war ein «Neutralitätsgesetz», das Kredite und Waffenverkäufe an Kriegführende verbot.
Wenn die Menschen den Krieg nicht wollen ...
Schon vor 1939 war Roosevelt die überragende Führergestalt der «Interventionisten», das waren Teile der Hochfinanz, der Grossindustrie, der Linksintellektuellen und des grössten Teils von Presse, Rundfunk und Filmindustrie. Sie glaubten an die geschichtliche Sendung der USA, amerikanische Werte weltweit durchsetzen zu müssen, notfalls auch militärisch, um eine globale Freihandelszone für amerikanisches Kapital und amerikanische Waren zu schaffen. «Aber trotz grossangelegter Pressekampagnen, denen sich als einzige überregionale Tageszeitung die `Chicago Tribune` [Morgensterns Zeitung!] entgegenstellte, gelang es den Interventionisten 1940/41 nicht, die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung umzustimmen. Diese lehnte laut Gallup-Umfragen unverändert zu mehr als 80% einen Eintritt Amerikas in den europäischen Krieg ab. Die Stimmung zwang Roosevelt, im Präsidentschaftswahlkampf 1940 hoch und heilig zu versprechen, die Vereinigten Staaten aus allen Kriegsabenteuern herauszuhalten, `es sei denn, wir werden angegriffen`.»3 Dafür sollte er sorgen!
... müssen «Gründe» geschaffen werden
Seit Kriegsbeginn in Europa 1939 lockerte Roosevelt das «Neutralitätsgesetz», versorgte England mit Geld und Waffen und begann ein riesiges Rüstungsprogramm für das US-Militär. Gleichzeitig wurde der japanische Angriff auf Pearl Harbor durch Roosevelts Geheimdiplomatie hinter dem Rücken der Bevölkerung und des Kongresses vorbereitet: «Der Angriff auf Hawaii bewirkte einen völligen Stimmungsumschwung in der amerikanischen Bevölkerung, die Isolationisten [Kriegsgegner] verstummten von einem Tag auf den anderen. Ganz Amerika vereinigte sich unter dem Schlachtruf `Remember Pearl Harbor`, um bis zum völligen Sieg über Japan zu kämpfen. Die Presse schlachtete den angeblichen heimtückischen Überfall der Japaner propagandistisch bis zum äussersten aus. Die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens wurden in dieser Stimmung als weiterer Beweis für eine antiamerikanische Verschwörung der Achsenmächte angesehen.»4
Entlarvende Enthüllungen des Untersuchungsausschusses
Da verschiedene Untersuchungsausschüsse zwischen 1941 und 1945 zu verwirrenden Ergebnissen gelangten und wichtiges Beweismaterial fehlte, beschloss das Repräsentantenhaus am 11. September 1945 die Bildung des Joint Commitee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, das vom 15.11.1945 bis zum 31.5.1946 70mal öffentlich tagte. Im Verlauf der Anhörungen kam es zu sensationellen Enthüllungen: «Das grösste Aufsehen erregte die Tatsache, dass die Nachrichtendienste von Army und Navy bereits Monate vor Pearl Harbor in einige der wichtigsten japanischen Funkcodes eingebrochen waren und damit den japanischen Funkverkehr abhören und entschlüsseln konnten. Dieses Unternehmen lief unter der Bezeichnung ÐMagicð. Von grösster Wichtigkeit war dabei die Dechiffrierung des diplomatischen Funkverkehrs, insbesondere zwischen dem Aussenministerium in Tokio und der japanischen Botschaft in Washington. Aus den abgefangenen und dechiffrierten Funktelegrammen gingen folgende Dinge hervor: Entgegen den Verlautbarungen der Roosevelt-Administration hatte die japanische Führung in den Monaten vor Pearl Harbor geradezu verzweifelt versucht, zu einer friedlichen Beilegung der amerikanisch-japanischen Streitigkeiten zu gelangen. Erst als der von Roosevelt initiierte Wirtschaftskrieg gegen Japan, insbesondere das Ölembargo, der japanischen Führung nur noch die Wahl liess, sich entweder den unannehmbaren amerikanischen Forderungen zu unterwerfen oder die rohstoffreichen Gebiete Südostasiens [...] gewaltsam unter ihre Kontrolle zu bringen, und erst als praktisch keine Aussicht auf eine diplomatische Lösung mehr bestand, entschloss sich Tokio endgültig zum Krieg. Dieser Entschluss fiel Ende November 1941.»5
Die «Überraschung» war lange bekannt
Am 26. November 1941 - 12 Tage vor dem «überraschenden» Angriff auf Pearl Harbor! - lief die japanische Flugzeugträgereinheit aus der Hitokapu-Bucht Richtung Hawaii aus. Aus dem abgefangenen Funkverkehr war ohne Zweifel zu entnehmen, «dass der Abbruch der diplomatischen Beziehungen und ein japanischer Überraschungsangriff nur noch eine Frage von Tagen waren».6 Kriegsminister Stimson gab vor dem Ausschuss sogar zu Protokoll, dass «die Roosevelt-Administration Anfang Dezember 1941 sehr genau wusste, dass der Krieg unmittelbar bevorstand und mit einem japanischen Überraschungsangriff eröffnet werden würde».7 Dass der Flottenstützpunkt von Pearl Harbor besonders gefährdet war, war der amerikanischen Marineführung zu jenem Zeitpunkt klar, da dort die gesamte Pazifikflotte lag.
Roosevelts Geheimdiplomatie
Der Untersuchungsausschuss erfuhr weiter, dass Roosevelt ohne Wissen der Bevölkerung und des Kongresses mit der britischen und der niederländischen Regierung geheime Generalstabsbesprechungen durchgeführt und geheime Absprachen getroffen hatte: «Mit ihnen verpflichtete sich die amerikanische Führung, in den Krieg einzutreten, falls japanische Streitkräfte einen Angriff gegen die Territorien der Vereinigten Staaten, des Britischen Commonwealth oder von Niederländisch-Ostindien führen oder wenn japanische Flottenverbände eine Linie im Pazifik, die den niederländischen Besitzungen, Britisch-Malaya oder Thailand vorgelagert war, überschreiten würden. Mit anderen Worten, die Vereinigten Staaten sollten in weit entfernten Gegenden zugunsten von Verbündeten in einen Krieg eintreten, ohne dass amerikanisches Territorium oder amerikanische Streitkräfte angegriffen wurden [...] Roosevelt und sein engster Kreis hatten eine Geheimdiplomatie betrieben, die die USA an den verfassungsmässigen Institutionen und dem Willen der Bevölkerung vorbei zielstrebig in einen Krieg führte.»8
Verrat an den eigenen Soldaten
Am 6.12.1941 überschritt der japanische Flottenverband die vereinbarte Linie, womit sich die USA automatisch im Krieg befanden. «Schliesslich musste der Kongressausschuss zur Kenntnis nehmen, dass Präsident Roosevelt am Abend des 6. Dezember [24 Stunden vor dem Angriff!] dank ÐMagicð die japanische Kriegserklärung in Händen gehalten und selbst erklärt hatte, dass dies Krieg bedeute. In dieser Nacht geschah aber nichts, um die amerikanischen Streitkräfte im Pazifik, insbesondere die Flotte in Pearl Harbor, zu warnen. Erst um die Mittagszeit des folgenden Tages schickte Generalstabschef Marshall eine halbherzige Warnung nach Hawaii, die aber durch eine Serie unerklärlicher Fehlleistungen erst sieben Stunden nach Beginn des japanischen Angriffs eintraf.
All diese Feststellungen waren in höchstem Masse skandalös, da sie das bis dahin herrschende Bild vom friedliebenden Amerika, das von den japanischen Militaristen überfallen wurde, auf das gründlichste beschädigten. Bei nüchterner Betrachtung musste man zu der Schlussfolgerung kommen, dass die wahren Kriegstreiber nicht in Tokio, sondern in Washington gesessen hatten und dass Präsident Roosevelt 2400 amerikanische Soldaten und Seeleute geopfert hatte, um den Kongress und die Öffentlichkeit über seine Kriegspolitik zu täuschen.»9
Handfeste Beweise ...
Sogar der dokumentarische Nachweis, dass Roosevelt und sein engerer Kreis persönlich von dem bevorstehenden Angriff gewusst hatten - der Morgenstern noch gefehlt hatte - , tauchte später unvermutet in deutschen Akten auf: Am 26. November 1941, dem Auslaufen der japanischen Verbände nach Hawaii, zeichnete die Abhörstation der deutschen Reichspost, die seit 1940 die transatlantischen Telefongespräche abhören konnte, ein Telefongespräch zwischen Roosevelt und Churchill auf, worin Churchill Roosevelt eindringlich vor dieser japanischen Trägerkampfgruppe warnte, die soeben mit Ziel Pearl Harbor ausgelaufen sei!10
... die nicht bekannt werden sollen
Der Bericht des Joint Commitee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack wurde am 20. Juli 1946 der Öffentlichkeit vorgestellt und vom United States Government veröffentlicht.11 Schon während der laufenden Anhörungen wurde von Roosevelt-Getreuen Beweismaterial zurückgehalten, die Anhörung wichtiger Zeugen behindert, bestimmte Fragestellungen zu unterdrücken versucht. Nach der Veröffentlichung berichtete die US-Presse überwiegend im Sinne Roosevelts, der sich von einer riesigen Propagandamaschine als grosser siegreicher Führer hatte feiern lassen. Die Ähnlichkeiten zu heutigen Ereignissen drängen sich auf.
Wenn Historiker zu Lakaien werden
Georg Morgenstern hatte als Redakteur der «Chicago Tribune» die Anhörungen des Joint Commitee verfolgt und die Berichte studiert. 1947 erschien sein Buch, gefolgt von vielen anderen gleichgesinnten Werken. Einem breiteren US-Publikum - geschweige denn anderen Ländern - blieben sie überwiegend unbekannt. Das lag nicht zuletzt daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und Roosevelts Tod mächtige Interessengruppen versuchten, die Mythen seiner Kriegspropaganda, vor allem die Lüge vom Überraschungsangriff auf Pearl Harbor, aufrechtzuerhalten. «Zahllose Historiker und Sozialwissenschafter verdankten Roosevelts interventionistischer Aussenpolitik, dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg und dem kalten Krieg ihre persönliche Karriere in der Regierungsverwaltung, in den Geheimdiensten und an den Universitäten.»12
So kam es, dass weitere Forschungen über die Ursachen von Amerikas Kriegseintritt dadurch behindert wurden, dass kritischen Forschern über Pearl Harbor der Zugang zu staatlichen Archiven verwehrt wurde und ihre Verleger mit Bankrott und Ruin bedroht wurden, dass kritische Veröffentlichungen über Pearl Harbor in der Presse totgeschwiegen, verleumdet oder völlig entstellt wiedergegeben wurden, Pearl-Harbor-kritische Autoren persönlich verleumdet oder eingeschüchtert wurden. Die Abhängigkeit vom Staat machte die Mehrheit der amerikanischen Historiker zu Werkzeugen staatlicher Propaganda, und die Instrumentalisierung der Geschichte erzeugte ein gefälschtes Geschichtsbild.
In George Orwells Roman «1984» schreibt das «Wahrheitsministerium» die Geschichte ständig entsprechend den Interessen des Staates um und schafft damit Geschichte ab, denn die Kenntnis der Wahrheit über die Vergangenheit hilft den Menschen, sich in den Fragen der Gegenwart besser zurechtzufinden, was gefährlich für die Machthaber ist. Man hat diesen Roman viel zu sehr ausschliesslich als Bild der totalitären Sowjetunion oder des Nationalsozialismus verstanden. Er gilt gleichermassen für den Umgang der USA mit Pearl Harbor.
Was wir daraus lernen können
In seinem Vorwort schrieb Morgenstern 1947: «Nur der Autor eines Detektivromans, der seine Handlungen und seine Akteure ganz unter Kontrolle hat, kann hoffen, die Motive vollständig zu erforschen und jeden Nebenzweig des Haupträtsels zu lösen. Die Geschichte von Pearl Harbor endet ohne unterschriebene Geständnisse.»13 Aber auch ohne Geständnisse stellen die zusammengetragenen historischen Daten Pearl Harbor in eine Reihe mit den Schüssen 1914 in Sarajewo, der Versenkung der Lusitania, dem Reichstagsbrand, dem Überfall 1939 auf den Sender Gleiwitz, dem Anschlag von «9 - 11» und den vielen anderen hinterlistigen Gemeinheiten, mit denen wenige Machtbesessene ganze Völker an der Nase herumzuführen versuchen, aus denen sich aber eines lernen lässt: Völker ziehen nicht einfach in den Krieg, kein Mensch geht freiwillig in den Krieg.
Man muss die Völker dazu überlisten, dass sie sich abschlachten. Man muss die Menschen aufhetzen, ihnen starke Emotionen einflössen, die das kritische Denken benebeln. Man muss ihrer gekränkten Eitelkeit schmeicheln, ihr gedemütigtes Selbstwertgefühl ansprechen und Grösse und Heil versprechen. Man muss ihnen drohen, sie peinigen, ihnen Angst einjagen. Oder sie mit Geld oder Macht oder beidem bestechen. Die Geschichte ist voll von derartigen Manipulationsmethoden, jeder Despot hat sich die seinen ausdenken müssen. Und Roosevelt wählte mit Pearl Harbor den Weg, ein paar tausend der eigenen Leute zu opfern, um die Bevölkerung für seine Kriegspolitik zu manipulieren.
Wenn man aber die Völker in Ruhe lässt, streiten sich die Menschen, ärgern sich, schlagen sich, quälen sich manchmal, ja es kommen auch Totschlag und Mord vor. Aber organisiert über ein anderes Volk herzufallen und es auszulöschen, das tun Menschen erst, wenn man sie manipuliert, das heisst wenn sie sich manipulieren lassen! Denn wirken kann die Lüge, die es braucht, um Krieg zu führen, nur, wenn sie im Menschen starke Emotionen oder Verletzungen ansprechen, mit denen der Einzelne nicht vernünftig umgehen kann.
1 AP-Meldung aus London, 21.6.1944, in der «Chicago Tribune» vom gleichen Tag, 1:2. Zit. nach: Morgenstern, George (1998), Pearl Harbor. Eine amerikanische Katastrophe. Herausgegeben und ins Deutsche übertragen von Paul Post. München, S. 148.
2 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 12.
3 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 14.
4 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 15.
5 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 17.
6 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 17.
7 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 17.
8 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 18.
9 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 18.
10 National Archive (NA), Rolle T-175, Regale 129ff.; s.a. Gregory Douglas: Geheimakte Gestapo-Müller. Berg 1996, S. 85ff. und 320ff. Zit. nach Paul, Post. In: Morgenstern, George (1998), S. 31.
11 Report of the Joint Commitee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, Including the Minority Report, Washington 1946.
12 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 22.
13 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 32.
http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF_105c/T09.HTM
syr
«Pearl Harbor 1941» und «9-11-2001»
von Moritz Nestor, Schweiz
Ronda Hauben stellt in Zeit-Fragen Nr. 17 vom 12. Mai zu Recht die Frage, ob es Zufall sei, dass der Untersuchungsbericht zum 11. September von der Bush-Administration zurückgehalten wird. Der 11. September und auch der Umgang damit weisen verblüffende Parallelen zum «plötzlichen Überfall» der Japaner auf Pearl Harbor 1941 auf: Die Empörung über Pearl Harbor trieb eine amerikanische Bevölkerung, die bis dahin zu über 80% gegen einen Kriegseintritt Amerikas war, auf die Seite der Regierung Roosevelt in den Zweiten Weltkrieg. Die berechtigte Trauer und die Empörung über die Tragödie des 11. September 2001 und ihre Opfer liess für einen grossen Teil der amerikanischen Bevölkerung den völkerrechtswidrigen Überfall auf Afghanistan als «Verteidigung» notwendig erscheinen und erlaubte es Bush, einen «30 bis 40 Jahre» andauernden, als «Krieg gegen den Terror» getarnten Eroberungsfeldzug auszurufen. Und: «9-11» diente der Bush-Mannschaft als Vorwand, einen polizeistaatlichen Repressionsapparat in den USA auf- und auszubauen.
Grosso modo lehren die Geschichtsbücher unserer Schulen seit 1945, dass 1941 die militaristischen Japaner, die mit Hitler und Mussolini unter einer Decke steckten, die friedliebenden USA ohne Vorwarnung heimtückisch überfielen und die USA damit in den Zweiten Weltkrieg gezogen wurden. Wie sehr diese Darstellung eine Geschichtsfälschung ist, und zwar wider besseres Wissen, lehrte bereits 1947 das Buch des promovierten Historikers George Morgenstern, «Pearl Harbor, The Story of the Secret War.» Man hätte es wissen können!
Wir wissen es schon lange
Morgenstern (1906-1988), Mitherausgeber der «Chicago Tribune» und während des Krieges Presseoffizier im Marine Corps, hatte darin das Material der regierungsamtlichen Untersuchungsausschüsse zu Pearl Harbor aufgearbeitet. Washington versuchte zu vernebeln, wo es ging, denn das Material, das die Ausschüsse schliesslich zutage gefördert hatten, war für die Mannschaft des inzwischen verstorbenen Kriegspräsidenten Roosevelt verheerend. Zeigte es doch, dass Roosevelt den Angriff auf Pearl Harbor provoziert hatte, um in den Krieg eintreten zu können. Erst 1998(!), das ist neben den Enthüllungen von Morgenstern ein weiterer schlimmer Skandal, sollte unter dem Titel «Pearl Harbor 1941» die deutsche Übersetzung von Morgensterns Buch erscheinen, herausgegeben und eingeleitet von Dr. Walter Post, Lehrbeauftragter am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaften der Universität München.
Die Aufklärung der wahren Hintergründe des Überfalls auf Pearl Harbor macht vorsichtiger und weitblickender bei der Beurteilung der gegenwärtigen Kriegspolitik der USA, ja ihres gesamten Aufstiegs seit dem Ersten Weltkrieg zur Weltmacht. Wenn man merkt, wie sehr die offizielle Geschichtsschreibung über die Ursachen des Zweiten Weltkriegs Hofgeschichtsschreibung ist, oft bare Lüge, Manipulation oder Gefälligkeitsschreibe, dann wird man auch vorsichtiger und hellhöriger gegenüber Vorgängen wie dem 11.9., als sofort nach dem Anschlag und ohne den geringsten Beweis die Verschwörungstheorie der US-Regierung «Osama was here» allen eingetrichtert und zum Vergeltungskrieg geblasen wurde.
Pearl Harbor - Wendepunkt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts
Pearl Harbor ist von überragender historischer Bedeutung, weil es einer der entscheidenden Wendepunkte in der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts war: Das auslösende Ereignis für Amerikas Kriegseintritt, was wiederum zur Ausschaltung von Deutschland und Japan als aggressive imperiale Grossmächte führte. England und Frankreich wurden in der Folge nach dem Zweiten Weltkrieg geopolitisch bedeutungslos, und in China siegte der Marxismus. Die UdSSR und Amerika stiegen zu Supermächten auf. Bis die USA 1991 den kalten Krieg gewonnen hatten, die UdSSR «zusammenbrach» und die USA «einzige Weltmacht» wurden. Der Weg zum Aufbau eines weltraumgestützten Raketenabwehrsystems war frei, womit sich die USA gegen jeden Angriff mit Atomraketen sicher glauben, und Bush führte den atomaren Erstschlag als Option wieder ein und beginnt einen auf «30 bis 40 Jahre» ausgelegten «Krieg gegen den Terror». Eine der wichtigsten Weichenstellungen für diese Entwicklung geschah mit der Lüge von Pearl Harbor: «Gestern, am 7. Dezember 1941 - einem Tag, der in Schande fortleben wird - wurden die Vereinigten Staaten von Amerika plötzlich und vorsätzlich von See- und Luftstreitkräften des Kaiserreiches Japan angegriffen ... Wir werden uns immer an den Charakter des Angriffs auf uns erinnern», sagte US-Präsident Roosevelt. Die Wirklichkeit war das Gegenteil, wie der britische Minister für Produktion im Kabinett Churchill, Captain Oliver Lyttelton, am 20.6.1944 vor der amerikanischen(!) Handelskammer sich zu sagen traute: «Amerika provozierte Japan in einem derartigen Ausmass, dass die Japaner gezwungen waren, Pearl Harbor anzugreifen. Es ist eine Travestie der Geschichte zu sagen, dass dieser Krieg Amerika aufgezwungen wurde.»1
Was kann man also heute - dank Morgensterns Arbeit - über diese Provokation wissen, und was müsste eigentlich in den Geschichtsbüchern unserer Kinder stehen, damit sie die Gegenwart besser beurteilen können?
Kriegsgewinnler im Ersten Weltkrieg
1936 kam ein Untersuchungsausschuss des amerikanischen Senats zum Ersten Weltkrieg zu dem Ergebnis, dass die USA «nicht wegen des deutschen U-Boot-Krieges und auch nicht wegen irgendwelcher idealistischen Ziele in den Krieg eingetreten waren. Vielmehr sollte die glänzende Rüstungskonjunktur, die durch die Waffenverkäufe an die Entente-Mächte entstanden war, möglichst verlängert und die an England und Frankreich gegebenen Kredite gerettet werden, die im Falle eines deutschen Sieges verloren gewesen wären.»2 Die Folge dieses Untersuchungsberichts war ein «Neutralitätsgesetz», das Kredite und Waffenverkäufe an Kriegführende verbot.
Wenn die Menschen den Krieg nicht wollen ...
Schon vor 1939 war Roosevelt die überragende Führergestalt der «Interventionisten», das waren Teile der Hochfinanz, der Grossindustrie, der Linksintellektuellen und des grössten Teils von Presse, Rundfunk und Filmindustrie. Sie glaubten an die geschichtliche Sendung der USA, amerikanische Werte weltweit durchsetzen zu müssen, notfalls auch militärisch, um eine globale Freihandelszone für amerikanisches Kapital und amerikanische Waren zu schaffen. «Aber trotz grossangelegter Pressekampagnen, denen sich als einzige überregionale Tageszeitung die `Chicago Tribune` [Morgensterns Zeitung!] entgegenstellte, gelang es den Interventionisten 1940/41 nicht, die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung umzustimmen. Diese lehnte laut Gallup-Umfragen unverändert zu mehr als 80% einen Eintritt Amerikas in den europäischen Krieg ab. Die Stimmung zwang Roosevelt, im Präsidentschaftswahlkampf 1940 hoch und heilig zu versprechen, die Vereinigten Staaten aus allen Kriegsabenteuern herauszuhalten, `es sei denn, wir werden angegriffen`.»3 Dafür sollte er sorgen!
... müssen «Gründe» geschaffen werden
Seit Kriegsbeginn in Europa 1939 lockerte Roosevelt das «Neutralitätsgesetz», versorgte England mit Geld und Waffen und begann ein riesiges Rüstungsprogramm für das US-Militär. Gleichzeitig wurde der japanische Angriff auf Pearl Harbor durch Roosevelts Geheimdiplomatie hinter dem Rücken der Bevölkerung und des Kongresses vorbereitet: «Der Angriff auf Hawaii bewirkte einen völligen Stimmungsumschwung in der amerikanischen Bevölkerung, die Isolationisten [Kriegsgegner] verstummten von einem Tag auf den anderen. Ganz Amerika vereinigte sich unter dem Schlachtruf `Remember Pearl Harbor`, um bis zum völligen Sieg über Japan zu kämpfen. Die Presse schlachtete den angeblichen heimtückischen Überfall der Japaner propagandistisch bis zum äussersten aus. Die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens wurden in dieser Stimmung als weiterer Beweis für eine antiamerikanische Verschwörung der Achsenmächte angesehen.»4
Entlarvende Enthüllungen des Untersuchungsausschusses
Da verschiedene Untersuchungsausschüsse zwischen 1941 und 1945 zu verwirrenden Ergebnissen gelangten und wichtiges Beweismaterial fehlte, beschloss das Repräsentantenhaus am 11. September 1945 die Bildung des Joint Commitee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, das vom 15.11.1945 bis zum 31.5.1946 70mal öffentlich tagte. Im Verlauf der Anhörungen kam es zu sensationellen Enthüllungen: «Das grösste Aufsehen erregte die Tatsache, dass die Nachrichtendienste von Army und Navy bereits Monate vor Pearl Harbor in einige der wichtigsten japanischen Funkcodes eingebrochen waren und damit den japanischen Funkverkehr abhören und entschlüsseln konnten. Dieses Unternehmen lief unter der Bezeichnung ÐMagicð. Von grösster Wichtigkeit war dabei die Dechiffrierung des diplomatischen Funkverkehrs, insbesondere zwischen dem Aussenministerium in Tokio und der japanischen Botschaft in Washington. Aus den abgefangenen und dechiffrierten Funktelegrammen gingen folgende Dinge hervor: Entgegen den Verlautbarungen der Roosevelt-Administration hatte die japanische Führung in den Monaten vor Pearl Harbor geradezu verzweifelt versucht, zu einer friedlichen Beilegung der amerikanisch-japanischen Streitigkeiten zu gelangen. Erst als der von Roosevelt initiierte Wirtschaftskrieg gegen Japan, insbesondere das Ölembargo, der japanischen Führung nur noch die Wahl liess, sich entweder den unannehmbaren amerikanischen Forderungen zu unterwerfen oder die rohstoffreichen Gebiete Südostasiens [...] gewaltsam unter ihre Kontrolle zu bringen, und erst als praktisch keine Aussicht auf eine diplomatische Lösung mehr bestand, entschloss sich Tokio endgültig zum Krieg. Dieser Entschluss fiel Ende November 1941.»5
Die «Überraschung» war lange bekannt
Am 26. November 1941 - 12 Tage vor dem «überraschenden» Angriff auf Pearl Harbor! - lief die japanische Flugzeugträgereinheit aus der Hitokapu-Bucht Richtung Hawaii aus. Aus dem abgefangenen Funkverkehr war ohne Zweifel zu entnehmen, «dass der Abbruch der diplomatischen Beziehungen und ein japanischer Überraschungsangriff nur noch eine Frage von Tagen waren».6 Kriegsminister Stimson gab vor dem Ausschuss sogar zu Protokoll, dass «die Roosevelt-Administration Anfang Dezember 1941 sehr genau wusste, dass der Krieg unmittelbar bevorstand und mit einem japanischen Überraschungsangriff eröffnet werden würde».7 Dass der Flottenstützpunkt von Pearl Harbor besonders gefährdet war, war der amerikanischen Marineführung zu jenem Zeitpunkt klar, da dort die gesamte Pazifikflotte lag.
Roosevelts Geheimdiplomatie
Der Untersuchungsausschuss erfuhr weiter, dass Roosevelt ohne Wissen der Bevölkerung und des Kongresses mit der britischen und der niederländischen Regierung geheime Generalstabsbesprechungen durchgeführt und geheime Absprachen getroffen hatte: «Mit ihnen verpflichtete sich die amerikanische Führung, in den Krieg einzutreten, falls japanische Streitkräfte einen Angriff gegen die Territorien der Vereinigten Staaten, des Britischen Commonwealth oder von Niederländisch-Ostindien führen oder wenn japanische Flottenverbände eine Linie im Pazifik, die den niederländischen Besitzungen, Britisch-Malaya oder Thailand vorgelagert war, überschreiten würden. Mit anderen Worten, die Vereinigten Staaten sollten in weit entfernten Gegenden zugunsten von Verbündeten in einen Krieg eintreten, ohne dass amerikanisches Territorium oder amerikanische Streitkräfte angegriffen wurden [...] Roosevelt und sein engster Kreis hatten eine Geheimdiplomatie betrieben, die die USA an den verfassungsmässigen Institutionen und dem Willen der Bevölkerung vorbei zielstrebig in einen Krieg führte.»8
Verrat an den eigenen Soldaten
Am 6.12.1941 überschritt der japanische Flottenverband die vereinbarte Linie, womit sich die USA automatisch im Krieg befanden. «Schliesslich musste der Kongressausschuss zur Kenntnis nehmen, dass Präsident Roosevelt am Abend des 6. Dezember [24 Stunden vor dem Angriff!] dank ÐMagicð die japanische Kriegserklärung in Händen gehalten und selbst erklärt hatte, dass dies Krieg bedeute. In dieser Nacht geschah aber nichts, um die amerikanischen Streitkräfte im Pazifik, insbesondere die Flotte in Pearl Harbor, zu warnen. Erst um die Mittagszeit des folgenden Tages schickte Generalstabschef Marshall eine halbherzige Warnung nach Hawaii, die aber durch eine Serie unerklärlicher Fehlleistungen erst sieben Stunden nach Beginn des japanischen Angriffs eintraf.
All diese Feststellungen waren in höchstem Masse skandalös, da sie das bis dahin herrschende Bild vom friedliebenden Amerika, das von den japanischen Militaristen überfallen wurde, auf das gründlichste beschädigten. Bei nüchterner Betrachtung musste man zu der Schlussfolgerung kommen, dass die wahren Kriegstreiber nicht in Tokio, sondern in Washington gesessen hatten und dass Präsident Roosevelt 2400 amerikanische Soldaten und Seeleute geopfert hatte, um den Kongress und die Öffentlichkeit über seine Kriegspolitik zu täuschen.»9
Handfeste Beweise ...
Sogar der dokumentarische Nachweis, dass Roosevelt und sein engerer Kreis persönlich von dem bevorstehenden Angriff gewusst hatten - der Morgenstern noch gefehlt hatte - , tauchte später unvermutet in deutschen Akten auf: Am 26. November 1941, dem Auslaufen der japanischen Verbände nach Hawaii, zeichnete die Abhörstation der deutschen Reichspost, die seit 1940 die transatlantischen Telefongespräche abhören konnte, ein Telefongespräch zwischen Roosevelt und Churchill auf, worin Churchill Roosevelt eindringlich vor dieser japanischen Trägerkampfgruppe warnte, die soeben mit Ziel Pearl Harbor ausgelaufen sei!10
... die nicht bekannt werden sollen
Der Bericht des Joint Commitee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack wurde am 20. Juli 1946 der Öffentlichkeit vorgestellt und vom United States Government veröffentlicht.11 Schon während der laufenden Anhörungen wurde von Roosevelt-Getreuen Beweismaterial zurückgehalten, die Anhörung wichtiger Zeugen behindert, bestimmte Fragestellungen zu unterdrücken versucht. Nach der Veröffentlichung berichtete die US-Presse überwiegend im Sinne Roosevelts, der sich von einer riesigen Propagandamaschine als grosser siegreicher Führer hatte feiern lassen. Die Ähnlichkeiten zu heutigen Ereignissen drängen sich auf.
Wenn Historiker zu Lakaien werden
Georg Morgenstern hatte als Redakteur der «Chicago Tribune» die Anhörungen des Joint Commitee verfolgt und die Berichte studiert. 1947 erschien sein Buch, gefolgt von vielen anderen gleichgesinnten Werken. Einem breiteren US-Publikum - geschweige denn anderen Ländern - blieben sie überwiegend unbekannt. Das lag nicht zuletzt daran, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und Roosevelts Tod mächtige Interessengruppen versuchten, die Mythen seiner Kriegspropaganda, vor allem die Lüge vom Überraschungsangriff auf Pearl Harbor, aufrechtzuerhalten. «Zahllose Historiker und Sozialwissenschafter verdankten Roosevelts interventionistischer Aussenpolitik, dem Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg und dem kalten Krieg ihre persönliche Karriere in der Regierungsverwaltung, in den Geheimdiensten und an den Universitäten.»12
So kam es, dass weitere Forschungen über die Ursachen von Amerikas Kriegseintritt dadurch behindert wurden, dass kritischen Forschern über Pearl Harbor der Zugang zu staatlichen Archiven verwehrt wurde und ihre Verleger mit Bankrott und Ruin bedroht wurden, dass kritische Veröffentlichungen über Pearl Harbor in der Presse totgeschwiegen, verleumdet oder völlig entstellt wiedergegeben wurden, Pearl-Harbor-kritische Autoren persönlich verleumdet oder eingeschüchtert wurden. Die Abhängigkeit vom Staat machte die Mehrheit der amerikanischen Historiker zu Werkzeugen staatlicher Propaganda, und die Instrumentalisierung der Geschichte erzeugte ein gefälschtes Geschichtsbild.
In George Orwells Roman «1984» schreibt das «Wahrheitsministerium» die Geschichte ständig entsprechend den Interessen des Staates um und schafft damit Geschichte ab, denn die Kenntnis der Wahrheit über die Vergangenheit hilft den Menschen, sich in den Fragen der Gegenwart besser zurechtzufinden, was gefährlich für die Machthaber ist. Man hat diesen Roman viel zu sehr ausschliesslich als Bild der totalitären Sowjetunion oder des Nationalsozialismus verstanden. Er gilt gleichermassen für den Umgang der USA mit Pearl Harbor.
Was wir daraus lernen können
In seinem Vorwort schrieb Morgenstern 1947: «Nur der Autor eines Detektivromans, der seine Handlungen und seine Akteure ganz unter Kontrolle hat, kann hoffen, die Motive vollständig zu erforschen und jeden Nebenzweig des Haupträtsels zu lösen. Die Geschichte von Pearl Harbor endet ohne unterschriebene Geständnisse.»13 Aber auch ohne Geständnisse stellen die zusammengetragenen historischen Daten Pearl Harbor in eine Reihe mit den Schüssen 1914 in Sarajewo, der Versenkung der Lusitania, dem Reichstagsbrand, dem Überfall 1939 auf den Sender Gleiwitz, dem Anschlag von «9 - 11» und den vielen anderen hinterlistigen Gemeinheiten, mit denen wenige Machtbesessene ganze Völker an der Nase herumzuführen versuchen, aus denen sich aber eines lernen lässt: Völker ziehen nicht einfach in den Krieg, kein Mensch geht freiwillig in den Krieg.
Man muss die Völker dazu überlisten, dass sie sich abschlachten. Man muss die Menschen aufhetzen, ihnen starke Emotionen einflössen, die das kritische Denken benebeln. Man muss ihrer gekränkten Eitelkeit schmeicheln, ihr gedemütigtes Selbstwertgefühl ansprechen und Grösse und Heil versprechen. Man muss ihnen drohen, sie peinigen, ihnen Angst einjagen. Oder sie mit Geld oder Macht oder beidem bestechen. Die Geschichte ist voll von derartigen Manipulationsmethoden, jeder Despot hat sich die seinen ausdenken müssen. Und Roosevelt wählte mit Pearl Harbor den Weg, ein paar tausend der eigenen Leute zu opfern, um die Bevölkerung für seine Kriegspolitik zu manipulieren.
Wenn man aber die Völker in Ruhe lässt, streiten sich die Menschen, ärgern sich, schlagen sich, quälen sich manchmal, ja es kommen auch Totschlag und Mord vor. Aber organisiert über ein anderes Volk herzufallen und es auszulöschen, das tun Menschen erst, wenn man sie manipuliert, das heisst wenn sie sich manipulieren lassen! Denn wirken kann die Lüge, die es braucht, um Krieg zu führen, nur, wenn sie im Menschen starke Emotionen oder Verletzungen ansprechen, mit denen der Einzelne nicht vernünftig umgehen kann.
1 AP-Meldung aus London, 21.6.1944, in der «Chicago Tribune» vom gleichen Tag, 1:2. Zit. nach: Morgenstern, George (1998), Pearl Harbor. Eine amerikanische Katastrophe. Herausgegeben und ins Deutsche übertragen von Paul Post. München, S. 148.
2 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 12.
3 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 14.
4 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 15.
5 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 17.
6 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 17.
7 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 17.
8 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 18.
9 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 18.
10 National Archive (NA), Rolle T-175, Regale 129ff.; s.a. Gregory Douglas: Geheimakte Gestapo-Müller. Berg 1996, S. 85ff. und 320ff. Zit. nach Paul, Post. In: Morgenstern, George (1998), S. 31.
11 Report of the Joint Commitee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, Including the Minority Report, Washington 1946.
12 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 22.
13 Post, Paul. In: Morgenstern, George (1998), S. 32.
http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF_105c/T09.HTM
syr

US/ANALYSE/Pensionsdefizite im S&P-500 erreichen Rekordwert
Trotz einer deutlichen Erholung des US-Aktienmarktes auf Jahressicht
wachsen die Defizite der Pensionsfonds der meisten S&P-500-Unternehmen nach
wie vor. Wie aus einer Studie von UBS hervorgeht, ist zum Stichtag 30. Mai
das gesamte Pensionsdefizit der S&P-500-Konzerne auf geschätzte 239 Mrd von
212 Mrd USD zum Ende des vergangenen Jahres gestiegen. "Das ist das höchste
Defizit aller Zeiten", sagt UBS-Analyst William Dentzer.
In erster Linie der starke Rückgang des Zinsniveaus hat nach Ansicht von
Dentzer die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Pensionszahlungen
ansteigen lassen. Dies habe auch durch den Wertzuwachs der
Pensionsfonds-Vermögen nicht ausgeglichen werden können. "Defizite bei den
Pensionsverpflichtungen sollten für die Anleger eine echte Sorge darstellen,
vor allem bei konsumabhängigen Unternehmen", heißt es in der Studie weiter.
+++ Benjamin Krieger
vwd/20.6.2003/bek/reh

Trotz einer deutlichen Erholung des US-Aktienmarktes auf Jahressicht
wachsen die Defizite der Pensionsfonds der meisten S&P-500-Unternehmen nach
wie vor. Wie aus einer Studie von UBS hervorgeht, ist zum Stichtag 30. Mai
das gesamte Pensionsdefizit der S&P-500-Konzerne auf geschätzte 239 Mrd von
212 Mrd USD zum Ende des vergangenen Jahres gestiegen. "Das ist das höchste
Defizit aller Zeiten", sagt UBS-Analyst William Dentzer.
In erster Linie der starke Rückgang des Zinsniveaus hat nach Ansicht von
Dentzer die Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Pensionszahlungen
ansteigen lassen. Dies habe auch durch den Wertzuwachs der
Pensionsfonds-Vermögen nicht ausgeglichen werden können. "Defizite bei den
Pensionsverpflichtungen sollten für die Anleger eine echte Sorge darstellen,
vor allem bei konsumabhängigen Unternehmen", heißt es in der Studie weiter.
+++ Benjamin Krieger
vwd/20.6.2003/bek/reh

http://www.zeit.de/2003/26/neocon
USA
Wundersame Verschwörergruppe
Alles spricht von den amerikanischen „Neokonservativen“ und ihrem angeblich beherrschenden Einfluss auf die US-Regierung. Die Suche nach ihren ideologischen Wurzeln hat sich zu einer handfesten Legendenbildung ausgeweitet. Als Schüler von Leo Strauss sollen sie indirekt Anhänger Carl Schmitts sein – und zugleich verkappte Jünger Leo Trotzkis. Da wird es Zeit, den Boden der Tatsachen wieder ins Spiel zu bringen
Von Richard Herzinger
Die ausufernde Debatte über Rolle und ideologische Hintergründe der so genannten "Neocons" – jener Denkschule amerikanischer neokonservativer Intellektueller, der unter anderem der stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz zugerechnet wird – hat das Ausmaß einer handfesten Legendenbildung eingenommen. In manchen Darstellungen nimmt es sich inzwischen so aus, als ob die amerikanische Regierung, gesteuert von einer homogenen Gruppe seiner Schüler, Punkt für Punkt die Lehren des in den dreißiger Jahren in die USA emigrierten deutschen Philosophen Leo Strauss verwirkliche. Weil Strauss wiederum einigen Ideen des rechten Staatstheoretikers Carl Schmitt nahe stand, heißt es nun, Amerika folge den Wegen der "konservativen Revolution" im Deutschland der zwanziger und dreißiger Jahre.
Eine ziemlich abenteuerliche Konstruktion, wenn man bedenkt, mit welchem Hass die tatsächlichen Erben jener rechtsextremistischen, antisemitischen Strömung, die in der Weimarer Republik unter dem Schlagwort „Konservative Revolution“ bekannt wurde, der Politik der USA begegnen. Man findet sie nämlich in der Nähe jener „Nationalrevolutionäre“ und Neonazis wieder, die auf den Straßen Slogans wie: "USA-internationale Völkermordzentrale" skandieren. Die Vereinigten Staaten sind in ihren Augen „verjudet“, und wie ihr Vorbild Carl Schmitt betrachten sie die multiethnische, universalistische USA als den Todfeind aller um ihre ethnische Reinheit und Unabhängigkeit ringenden Völker. Was immer der eine oder ander „neocon“ an theoretischer Lektüre im Kopf haben mag, real betreibt die gegenwärtige amerikanische Administration genau jene „imperialistische“ Politik der weltweiten Verbreitung westlicher Werte, gegen die Carl Schmitt Ende der dreißiger Jahre seine „Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ entwickelte. Ziel dieser Konzeption: Amerika aus Europa herauszuhalten, das in den Augen von Nazi-Ideologen wie Schmitt ausersehen war, von Hitlers Großdeutschland auf „völkischer“ Grundlage neu geordnet zu werden.
Gleichzeitig mit der gerne kolportierten These, die Bush-Administration folge den geheimen Lehren rechtsradikalen deutschen Ursprungs, taucht nun immer häufiger die Theorie auf, die "Neocons" seien verkappte "Trotzkisten", weil einige ihrer Vordenker in ihrer Jugend zeitweise mit trotzkistischen Ideen sympathisiert haben. Woraus dann ein "trotzkistischer Typus" destilliert wird (siehe taz vom18. Juni), der heute die Geschicke der amerikanischen Außenpolitik diktiere. So wird aus dem Irak-Krieg flugs ein Krieg nach „trotzkistischem“ Muster: Die neue amerikanische Präventivkriegsdoktrin gleiche der angeblichen These Leo Trotzkis, nach der die Revolution auf den Bajonetten der Roten Armee in fremde Länder getragen werden müsse.
Der Gedanke, dass eine Weltmacht von einem geschlossenen Ideensystem bewegt werde, das sich eine Avantgardegruppe ausgedacht haben soll, ist für manche Ideengeschichtler offenbar so reizvoll, dass ihre Fantasie mit ihnen durchzugehen scheint. Es ist also höchste Zeit, den Boden der Tatsachen wieder ins Spiel zu bringen. Erstens sind "die Neocons" keineswegs eine so homogene Truppe, wie das oft anklingt. Zweitens ist der Einfluss ihrer Ideen auf die praktischen Entscheidungen der Bush-Administration weit begrenzter als gerne dargestellt. Dass er überhaupt so stark werden konnte, wie er tatsächlich ist, hat weniger mit Ideologie als mit dem 11. September zu tun, der die US-Regierung zu einer interventionistischen Linie nötigte. Die „Neocons“ sind seitdem nicht etwa deshalb so auffällig geworden, weil sie diesen Schwenk verursacht hätten, sondern weil sie zu der real vollzogenen neuen Politik zur rechten Zeit eine passende Theorie präsentieren konnten. Zu ihren seit Jahren vertretenen Kernforderungen gehört nämlich, die US-Regierung müsse Diktaturen die Zusammenarbeit aufkündigen und statt dessen die geballte amerikanische Macht einzusetzen, um Menschenrechte und demokratische Strukturen überall in der Welt zu verankern.
Sensationell ist dies vor allem deshalb, weil diese universalistische Forderungen nach einem „liberalen Imperialismus“ von den „neocons“ zu einem konservativen Programm gemacht wurde – wo doch konservative amerikanische Außenpolitik traditionell streng von primär nationalen Interessenserwägungen geleitet war. Nun aber werden dieser Gruppe von manchen Kommentatoren wahre Wunderdinge zugeschrieben. Wie bringt es diese Verschwörergruppe bloß fertig, gleichzeitig schmittianisch und trotzkistisch zu sein, was sich logischerweise doch eigentlich gegenseitig ausschließt? Und, noch toller, wie schafft sie es, die einzige Supermacht der Welt dahin zu bringen, gleichzeitig eine schmittianische und trotzkistische Politik (was immer das genau sein mag) ins Werk zu setzen? Je mehr in die „Neocons“ hineingeheimnist wird, umso mehr führen sich die Spekulationen über sie selbst ad absurdum.
Wenn gegenwärtig irgendetwas tatsächlich "trotzkistisch" anmutet, dann ist es die objektive Weltlage - in dem Sinne nämlich, dass zumindest eine These des russischen Revolutionärs Leo Trotzkis in der Tat hellsichtig war: Seine Theorie von der "Ungleichzeitigkeit der Entwicklung", mit der er sich bereits 1906 von der traditionalistisch-marxistischen These absetzte, nach der die Geschichte dem Verlauf "historischer Entwicklungsstadien" folge. Was Trotzki meinte: Länder entwickeln sich nicht nach einem starren Schema, gehen nicht zuerst durch eine "feudale", dann "kapitalistische", dann "sozialistische" Phase. Vielmehr bringe es die Dynamik des Weltmarktes mit sich, dass alle diese Stadien in einem Land gleichzeitig auftreten und zu explosiven Widersprüchen führen könnten. In einer solchen von Trotzki beschriebenen Situation der "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" sind wir heute wieder. In vielen Weltregionen prallen vorindustrielle oder postkoloniale Strukturen mit voller Wucht auf die Dynamik der Globalisierung. Es entstehen neuartige Mutationen – Clanchefs etwa werden zu Global Players, die sich auf dem internationalen Waffenmarkt leicht hochrüsten und deshalb Krieg als Dauergeschäft betreiben können. Andererseits bleiben Länder, die schon durch den Prozess der Modernisierung gegangen waren, hinter der neuen globalisierten Dynamik zurück, und ein Teil ihrer Eliten flüchtet in archaisch anmutende Mythologien – der islamische Fundamentalismus etwa ist ein solches Mischphänomen. Er wird von Angehörigen moderner und gut ausgebildeter Eliten betrieben, die aber von der Sehnsucht nach der Rückkehr in einen vermeintlich „reinen“, widerspruchsfreien Urzustand motiviert werden.
Die Folge solcher Entwicklungen ist der Zusammenbruch staatlicher und ziviler Ordnungen in vielen Teilen der Welt. Das zwingt den Westen - und in erster Linie seine Führungsmacht Amerika - dazu, vom Balkan über Irak bis zum Kongo als weltweite interventionistische Ordnungsmacht aufzutreten. Die amerikanische Weltpolitik, die in der ersten Phase der Regierung Bush noch eher isolationistisch angelegt war, musste auf diese explosive Gemengelage spätestens nach dem 11. September reagieren – war damit doch klar geworden, dass sich die Auswirkungen globalen Zerfalls nicht mehr aus der westlichen Welt selbst heraushalten läßt. Ihre Reaktion ist jedoch sehr viel weniger planmäßig und ideologisch durchdacht, als es sich manche Feuilletons neuerdings selbst suggerieren. Sie folgt vielmehr einer Art Trial-and-Error-Methode, an der diverse Denkrichtungen beteiligt sind. Nicht zuletzt sollte man berücksichtigen, dass auch die aktuell wichtigsten außenpolitischen Köpfe der Demokratischen Partei die Irak-Intervention nachdrücklich unterstützt haben. Erst kürzlich erinnerte Richard Holbrooke, US-Botschafter bei den UN unter der Regierung Clinton, daran, dass Bill Clinton bereits 1998 den „Regime change“ im Irak zum Ziel amerikanischer Politik erklärt hatte. Nicht nur die „Neocons“, sondern auch Liberale wie Holbrooke verlangen seit Jahren eine amerikanische Außenpolitik, die offensiv auf die Verbreitung der Demokratie im Nahen Osten und der ganzen Welt ausgerichtet ist. Und das, obwohl sie niemals Anhänger von Leo Strauss oder sogar Carl Schmitt gewesen sind oder in ihrer Jugend jemals für Trotzki geschwärmt hätten.
(c) DIE ZEIT 26/2003

USA
Wundersame Verschwörergruppe
Alles spricht von den amerikanischen „Neokonservativen“ und ihrem angeblich beherrschenden Einfluss auf die US-Regierung. Die Suche nach ihren ideologischen Wurzeln hat sich zu einer handfesten Legendenbildung ausgeweitet. Als Schüler von Leo Strauss sollen sie indirekt Anhänger Carl Schmitts sein – und zugleich verkappte Jünger Leo Trotzkis. Da wird es Zeit, den Boden der Tatsachen wieder ins Spiel zu bringen
Von Richard Herzinger
Die ausufernde Debatte über Rolle und ideologische Hintergründe der so genannten "Neocons" – jener Denkschule amerikanischer neokonservativer Intellektueller, der unter anderem der stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz zugerechnet wird – hat das Ausmaß einer handfesten Legendenbildung eingenommen. In manchen Darstellungen nimmt es sich inzwischen so aus, als ob die amerikanische Regierung, gesteuert von einer homogenen Gruppe seiner Schüler, Punkt für Punkt die Lehren des in den dreißiger Jahren in die USA emigrierten deutschen Philosophen Leo Strauss verwirkliche. Weil Strauss wiederum einigen Ideen des rechten Staatstheoretikers Carl Schmitt nahe stand, heißt es nun, Amerika folge den Wegen der "konservativen Revolution" im Deutschland der zwanziger und dreißiger Jahre.
Eine ziemlich abenteuerliche Konstruktion, wenn man bedenkt, mit welchem Hass die tatsächlichen Erben jener rechtsextremistischen, antisemitischen Strömung, die in der Weimarer Republik unter dem Schlagwort „Konservative Revolution“ bekannt wurde, der Politik der USA begegnen. Man findet sie nämlich in der Nähe jener „Nationalrevolutionäre“ und Neonazis wieder, die auf den Straßen Slogans wie: "USA-internationale Völkermordzentrale" skandieren. Die Vereinigten Staaten sind in ihren Augen „verjudet“, und wie ihr Vorbild Carl Schmitt betrachten sie die multiethnische, universalistische USA als den Todfeind aller um ihre ethnische Reinheit und Unabhängigkeit ringenden Völker. Was immer der eine oder ander „neocon“ an theoretischer Lektüre im Kopf haben mag, real betreibt die gegenwärtige amerikanische Administration genau jene „imperialistische“ Politik der weltweiten Verbreitung westlicher Werte, gegen die Carl Schmitt Ende der dreißiger Jahre seine „Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ entwickelte. Ziel dieser Konzeption: Amerika aus Europa herauszuhalten, das in den Augen von Nazi-Ideologen wie Schmitt ausersehen war, von Hitlers Großdeutschland auf „völkischer“ Grundlage neu geordnet zu werden.
Gleichzeitig mit der gerne kolportierten These, die Bush-Administration folge den geheimen Lehren rechtsradikalen deutschen Ursprungs, taucht nun immer häufiger die Theorie auf, die "Neocons" seien verkappte "Trotzkisten", weil einige ihrer Vordenker in ihrer Jugend zeitweise mit trotzkistischen Ideen sympathisiert haben. Woraus dann ein "trotzkistischer Typus" destilliert wird (siehe taz vom18. Juni), der heute die Geschicke der amerikanischen Außenpolitik diktiere. So wird aus dem Irak-Krieg flugs ein Krieg nach „trotzkistischem“ Muster: Die neue amerikanische Präventivkriegsdoktrin gleiche der angeblichen These Leo Trotzkis, nach der die Revolution auf den Bajonetten der Roten Armee in fremde Länder getragen werden müsse.
Der Gedanke, dass eine Weltmacht von einem geschlossenen Ideensystem bewegt werde, das sich eine Avantgardegruppe ausgedacht haben soll, ist für manche Ideengeschichtler offenbar so reizvoll, dass ihre Fantasie mit ihnen durchzugehen scheint. Es ist also höchste Zeit, den Boden der Tatsachen wieder ins Spiel zu bringen. Erstens sind "die Neocons" keineswegs eine so homogene Truppe, wie das oft anklingt. Zweitens ist der Einfluss ihrer Ideen auf die praktischen Entscheidungen der Bush-Administration weit begrenzter als gerne dargestellt. Dass er überhaupt so stark werden konnte, wie er tatsächlich ist, hat weniger mit Ideologie als mit dem 11. September zu tun, der die US-Regierung zu einer interventionistischen Linie nötigte. Die „Neocons“ sind seitdem nicht etwa deshalb so auffällig geworden, weil sie diesen Schwenk verursacht hätten, sondern weil sie zu der real vollzogenen neuen Politik zur rechten Zeit eine passende Theorie präsentieren konnten. Zu ihren seit Jahren vertretenen Kernforderungen gehört nämlich, die US-Regierung müsse Diktaturen die Zusammenarbeit aufkündigen und statt dessen die geballte amerikanische Macht einzusetzen, um Menschenrechte und demokratische Strukturen überall in der Welt zu verankern.
Sensationell ist dies vor allem deshalb, weil diese universalistische Forderungen nach einem „liberalen Imperialismus“ von den „neocons“ zu einem konservativen Programm gemacht wurde – wo doch konservative amerikanische Außenpolitik traditionell streng von primär nationalen Interessenserwägungen geleitet war. Nun aber werden dieser Gruppe von manchen Kommentatoren wahre Wunderdinge zugeschrieben. Wie bringt es diese Verschwörergruppe bloß fertig, gleichzeitig schmittianisch und trotzkistisch zu sein, was sich logischerweise doch eigentlich gegenseitig ausschließt? Und, noch toller, wie schafft sie es, die einzige Supermacht der Welt dahin zu bringen, gleichzeitig eine schmittianische und trotzkistische Politik (was immer das genau sein mag) ins Werk zu setzen? Je mehr in die „Neocons“ hineingeheimnist wird, umso mehr führen sich die Spekulationen über sie selbst ad absurdum.
Wenn gegenwärtig irgendetwas tatsächlich "trotzkistisch" anmutet, dann ist es die objektive Weltlage - in dem Sinne nämlich, dass zumindest eine These des russischen Revolutionärs Leo Trotzkis in der Tat hellsichtig war: Seine Theorie von der "Ungleichzeitigkeit der Entwicklung", mit der er sich bereits 1906 von der traditionalistisch-marxistischen These absetzte, nach der die Geschichte dem Verlauf "historischer Entwicklungsstadien" folge. Was Trotzki meinte: Länder entwickeln sich nicht nach einem starren Schema, gehen nicht zuerst durch eine "feudale", dann "kapitalistische", dann "sozialistische" Phase. Vielmehr bringe es die Dynamik des Weltmarktes mit sich, dass alle diese Stadien in einem Land gleichzeitig auftreten und zu explosiven Widersprüchen führen könnten. In einer solchen von Trotzki beschriebenen Situation der "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" sind wir heute wieder. In vielen Weltregionen prallen vorindustrielle oder postkoloniale Strukturen mit voller Wucht auf die Dynamik der Globalisierung. Es entstehen neuartige Mutationen – Clanchefs etwa werden zu Global Players, die sich auf dem internationalen Waffenmarkt leicht hochrüsten und deshalb Krieg als Dauergeschäft betreiben können. Andererseits bleiben Länder, die schon durch den Prozess der Modernisierung gegangen waren, hinter der neuen globalisierten Dynamik zurück, und ein Teil ihrer Eliten flüchtet in archaisch anmutende Mythologien – der islamische Fundamentalismus etwa ist ein solches Mischphänomen. Er wird von Angehörigen moderner und gut ausgebildeter Eliten betrieben, die aber von der Sehnsucht nach der Rückkehr in einen vermeintlich „reinen“, widerspruchsfreien Urzustand motiviert werden.
Die Folge solcher Entwicklungen ist der Zusammenbruch staatlicher und ziviler Ordnungen in vielen Teilen der Welt. Das zwingt den Westen - und in erster Linie seine Führungsmacht Amerika - dazu, vom Balkan über Irak bis zum Kongo als weltweite interventionistische Ordnungsmacht aufzutreten. Die amerikanische Weltpolitik, die in der ersten Phase der Regierung Bush noch eher isolationistisch angelegt war, musste auf diese explosive Gemengelage spätestens nach dem 11. September reagieren – war damit doch klar geworden, dass sich die Auswirkungen globalen Zerfalls nicht mehr aus der westlichen Welt selbst heraushalten läßt. Ihre Reaktion ist jedoch sehr viel weniger planmäßig und ideologisch durchdacht, als es sich manche Feuilletons neuerdings selbst suggerieren. Sie folgt vielmehr einer Art Trial-and-Error-Methode, an der diverse Denkrichtungen beteiligt sind. Nicht zuletzt sollte man berücksichtigen, dass auch die aktuell wichtigsten außenpolitischen Köpfe der Demokratischen Partei die Irak-Intervention nachdrücklich unterstützt haben. Erst kürzlich erinnerte Richard Holbrooke, US-Botschafter bei den UN unter der Regierung Clinton, daran, dass Bill Clinton bereits 1998 den „Regime change“ im Irak zum Ziel amerikanischer Politik erklärt hatte. Nicht nur die „Neocons“, sondern auch Liberale wie Holbrooke verlangen seit Jahren eine amerikanische Außenpolitik, die offensiv auf die Verbreitung der Demokratie im Nahen Osten und der ganzen Welt ausgerichtet ist. Und das, obwohl sie niemals Anhänger von Leo Strauss oder sogar Carl Schmitt gewesen sind oder in ihrer Jugend jemals für Trotzki geschwärmt hätten.
(c) DIE ZEIT 26/2003

http://www.sonnenseite.com/fp/archiv/Art-Umweltpolitik/erene…
Frieden auf Sand gebaut
Sind die Argumente gegen einen Krieg falsch nachdem er geführt und scheinbar gewonnen wurde? Eine Regierung, die 1000-mal mehr Geld und Waffen hat als ihr Gegner kann militärisch leicht gewinnen, moralisch hat sie mit dem ersten Toten verloren. Dieser Krieg war keine Heldentat.
Auch der dritte Golfkrieg hat tausenden Menschen das Leben gekostet, Zehntausende körperlich verstümmelt und Millionen psychisch traumatisiert. Auch dieser Krieg war ein Hochverrat an der Menschlichkeit. In den arabischen Ländern haben die Menschen das Leid und Elend dieses Krieges durch Fernsehbilder über die Kriegsopfer viel intensiver und bewusster wahrgenommen als die Menschen im Westen. Ich habe die drei Kriegswochen in Korea, Japan und China erlebt. Kein Einziger meiner Gesprächspartner - Journalisten, Politiker, Bürgerrechtler, Verleger - konnte diesem Krieg irgendeinen Sinn abgewinnen. Alle waren entsetzt. Für sie ist George W. Bush der schlimmste Anti-Amerikaner auf diesem Globus. Wieder einmal haben die weiße Vormacht nichtweiße Menschen bombadiert, drangsaliert und gedemütigt: Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak. Und wer ist der Nächste?
Die Konsequenzen eines Krieges werden im Augenblick des militärischen Erfolges gerne vergessen und verdrängt. Langfristig aber gilt erbarmungslos ein geistiges Gesetz: Wir können nur ernten, was wir säen. Ägyptens Präsident Mubarak zum Beispiel befürchtete: "In jeder Stunde dieses Krieges wird ein Osama Bin Laden geboren." Und die Befreiung von Bagdad? Erst in einigen Jahren werden wir wissen, wie frei die Iraker wirklich sind.
Wie hießen noch die Kriegsziele?
Erstens: Saddam Hussein muss weg. Er ist weg. Aber wo ist er? Bis jetzt sind nur seine Denkmäler gefallen. Bin Laden ist der US-Regierung schon entkommen. Jetzt auch noch Saddam Hussein?
Es muss ein Albtraum für US-Sicherheitsexperten sein, dass der Diktator irgendwo weiter lebt oder sein Tod nie einwandfrei nachgewiesen werden kann. Beide Varianten würden den Mythos vom "unbesiegbaren Führer" fördern. Noch jagen US-Soldaten im Irak ein Phantom. Doch die entscheidende moralische Frage an George W. Bush nach dem Krieg heißt: Herr Präsident, wie viele Menschen darf man töten, um einen Diktator zu beseitigen?
Zweitens: Die USA wollten dem Irak die Demokratie bringen. Wer das Land wirklich demokratisieren will, muss der Mehrheit der Schiiten im Süden die Herrschaft überlassen und die Kurden im Norden an der Macht beteiligen. Doch viele irakische Schiiten wollen eine Annäherung an den Iran. Und genau dies stört Washingtons Pläne um das irakische Erdöl. Die Besatzungsmacht USA wird deshalb einen demokratischen Machtwechsel in Irak zu Gunsten der Mehrheit verhindern und nur irakische Politiker dulden, die sich - wie schon vor 20 Jahren beim ersten Golfkrieg - Amerikas Sicht gegenüber dem "Schurkenstaat" Iran unterordnen. Eher werden die USA das irakische Militär an die Spitze putschen als ihre demokratischen Versprechen einlösen. Baldige demokratische Wahlen sind unwahrscheinlich. Und so soll im Irak Frieden entstehen und Freiheit wachsen?
Historisch gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass es den USA im Nahen Osten um Demokratie geht, aber viele Belege dafür, dass die Ölinteressen der USA grundsätzlich an erster Stelle stehen. Eine unabhängige irakische Regierung würde als erstes die Kontrolle über das irakische Öl beanspruchen. Und daran soll ausgerechnet eine Regierung Bush interessiert sein? Dafür wurde George W. Bush von der US-Energiewirtschaft nicht an die Macht gebracht!
Drittens: Die entscheidende Rechtfertigung dieses Krieges war die Behauptung der US-Regierung, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen. Doch wo sind sie geblieben? Hätte er sie nicht eingesetzt, wenn er sie gehabt hätte? Warum werden sie jetzt nicht gefunden?
Vor dem UN-Sicherheitsrat hatte US-Außenminister Powell am 5. Februar 2003 noch behauptet, die irakische Regierung verfüge über 500 Tonnen chemische Kampfstoffe. Deshalb Krieg. Doch wo sind diese gefährlichen Kampfstoffe jetzt? Und wo sind die gefährlichen Biowaffen im Irak, von denen auch Präsident Bush mehrmals sprach? Bush sagte, dass „mehrere Millionen Menschen“ durch „25.000 Liter Anthrax“ getötet werden könnten. Wo sind diese gefährlichen Giftstoffe? Oder ging es ganz banal nicht doch nur um Öl, Mister Bush?
Schon am zweiten Kriegstag haben die britischen und amerikanischen Truppen zunächst einmal die großen Ölförderanlagen im Irak besetzt. Als die Plünderungen in Bagdad begannen, haben US-Militärs überall tatenlos zugeschaut. Nur ein Ministerium haben sie vor Plünderungen geschützt: das Ölministerium! Am Funktionieren dieser Machtzentrale besteht ein US-Interesse der besonderen Art. Die Ölfördermengen im Irak sollen möglichst rasch um das zehnfache gesteigert werden, verlangen US- und britische Energiekonzerne. In den USA haben die Energiekonzerne vor zwei Jahren den Staat übernommen. Ihre Befehlsempfänger sind George W. Bush und seine engsten Mitarbeiter.
Solange sich die Washingtoner Regierung nicht von ihrer Ölfixierung befreit, wird Frieden nicht möglich. Diese Befreiung aber können nur die Wählerinnen und Wähler bewerkstelligen.
Das ist die eigentliche Lehre der Kriegskatastrophe dieser Wochen: Die USA haben die Regierung, die sie verdienen. Eine Regierung, die das Völkerrecht ignoriert, muss in einer Demokratie so rasch wie möglich abgewählt werden. Und eine Opposition in Deutschland, die den offensichtlichen Völkerrechtsbruch eines Angriffskrieges unterstützt, darf sich ebenfalls keine Hoffnung auf die nächsten Wahlen machen.
Die CSU hat einen katholischen Vorsitzenden und die CDU eine evangelische Chefin. Aber beide christliche Kirchen haben sich ohne Wenn und Aber gegen diesen Krieg ausgesprochen. Wann, wenn nicht bei einer Frage, wo es um Krieg oder Frieden geht, muss nach der Glaubwürdigkeit des "Hohen C" im Parteinamen der Christdemokraten und Christsozialen gefragt werden? Ist die Bergpredigt ein Heimatroman, Frau Merkel und Herr Stoiber?
Führende deutsche Christdemokraten haben Jahrzehnte für das ungeborene Leben gekämpft. Aber wenn es um das Leben tausender Geborener geht, ist die "Solidarität" mit der US-Regierung oberstes politisches Prinzip. Prinzipienloser geht es gar nicht.
Angela Merkel, warum haben Sie als Vorsitzende einer großen "C"-Partei Ihre Gesprächspartner in den USA nicht daran erinnert, dass der KSZE-Prozess in Europa vor 30 Jahren der Anfang vom Ende einer ganzen Reihe von Diktaturen und Diktatoren war? Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war der Startschuss für den großen Europäischen Dialog und die Politik der Runden Tische, welche den gewaltlosen Weg für mehr Frieden und Freiheit ermöglichte. Warum also jetzt nicht einen Versuch für eine KSZN (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten) mit Israelis, Palästinensern, Jordaniern, Irakern und allen anderen?
Es gibt immer Alternativen zum Massenmord und Flüchtlingselend. Irak anzugreifen, weil Saddam Hussein ein Diktator ist, war vergleichbar mit dem Abschuss eines vollbesetzten Zivilflugzeugs, weil der Kapitän ein Verbrechen begangen hat.
Zwischen 1994 und 2001 haben 54 Nationen einen Vertrag über die effiziente Zerstörung von biologischen Waffen ausgehandelt. Nur eine Regierung hat den Vertragsabschluss verhindert, die Bush-Administration. Warum, Angela Merkel haben Sie Ihren Freunden nicht gesagt, dass sie eine weit bessere Position hätten beim Verlangen nach Abrüstung von biologischen Waffen im Irak, wenn die USA jetzt diesen Vertrag doch noch unterzeichnen würde? Warum stellen Sie sich so bedingungslos auf die Seite der Krieger?
Die UNO hat eine Reihe von Kriegen beendet, indem sie erfolgreich demokratische Wahlen organisierte. Zum Beispiel in Kambodscha, Namibia und Osttimor. Das schien damals so aussichtslos wie heute im Irak und gelang dennoch! Warum nicht wenigstens ein Versuch auch im Irak? Keine Besatzungsmacht - nur das irakische Volk hat das Recht, seine eigene Regierung zu bestimmen.
Der Irak-Krieg war ein Krieg um Öl und weitere Kriege um die zu Ende gehenden Ressourcen werfen folgen, wenn die Industriestaaten nicht eine andere Energiepolitik betreiben. Die wichtigste Frage der Weltpolitik für die nächsten Jahrzehnte ist: Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne. Ohne eine Energie-Effizienz-Revolution und ohne eine komplette solare Energiewende kann es keinen Frieden mehr geben. Dass diese Alternative weltweit möglich und nötig ist, hat soeben der Umweltbeirat der Bundesregierung in einem eindrucksvollen Bericht aufgezeigt. Allein die Sonne schickt uns 15.000mal mehr Energie als die Menschheit zur Zeit verbraucht. Eine 100prozentige Energieversorgung über Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, solaren Wasserstoff Erdwärme, Wellen- und Strömungsenergie der Ozeane ist möglich. Es gibt einen Fluchtweg aus dem Treibhaus. Der Krieg gegen die Natur und die Kriege zwischen Gesellschaften können überwunden werden. Kein Kind auf dieser Welt muss in Zukunft verhungern. Eine bessere Welt ist möglich.

Frieden auf Sand gebaut
Sind die Argumente gegen einen Krieg falsch nachdem er geführt und scheinbar gewonnen wurde? Eine Regierung, die 1000-mal mehr Geld und Waffen hat als ihr Gegner kann militärisch leicht gewinnen, moralisch hat sie mit dem ersten Toten verloren. Dieser Krieg war keine Heldentat.
Auch der dritte Golfkrieg hat tausenden Menschen das Leben gekostet, Zehntausende körperlich verstümmelt und Millionen psychisch traumatisiert. Auch dieser Krieg war ein Hochverrat an der Menschlichkeit. In den arabischen Ländern haben die Menschen das Leid und Elend dieses Krieges durch Fernsehbilder über die Kriegsopfer viel intensiver und bewusster wahrgenommen als die Menschen im Westen. Ich habe die drei Kriegswochen in Korea, Japan und China erlebt. Kein Einziger meiner Gesprächspartner - Journalisten, Politiker, Bürgerrechtler, Verleger - konnte diesem Krieg irgendeinen Sinn abgewinnen. Alle waren entsetzt. Für sie ist George W. Bush der schlimmste Anti-Amerikaner auf diesem Globus. Wieder einmal haben die weiße Vormacht nichtweiße Menschen bombadiert, drangsaliert und gedemütigt: Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak. Und wer ist der Nächste?
Die Konsequenzen eines Krieges werden im Augenblick des militärischen Erfolges gerne vergessen und verdrängt. Langfristig aber gilt erbarmungslos ein geistiges Gesetz: Wir können nur ernten, was wir säen. Ägyptens Präsident Mubarak zum Beispiel befürchtete: "In jeder Stunde dieses Krieges wird ein Osama Bin Laden geboren." Und die Befreiung von Bagdad? Erst in einigen Jahren werden wir wissen, wie frei die Iraker wirklich sind.
Wie hießen noch die Kriegsziele?
Erstens: Saddam Hussein muss weg. Er ist weg. Aber wo ist er? Bis jetzt sind nur seine Denkmäler gefallen. Bin Laden ist der US-Regierung schon entkommen. Jetzt auch noch Saddam Hussein?
Es muss ein Albtraum für US-Sicherheitsexperten sein, dass der Diktator irgendwo weiter lebt oder sein Tod nie einwandfrei nachgewiesen werden kann. Beide Varianten würden den Mythos vom "unbesiegbaren Führer" fördern. Noch jagen US-Soldaten im Irak ein Phantom. Doch die entscheidende moralische Frage an George W. Bush nach dem Krieg heißt: Herr Präsident, wie viele Menschen darf man töten, um einen Diktator zu beseitigen?
Zweitens: Die USA wollten dem Irak die Demokratie bringen. Wer das Land wirklich demokratisieren will, muss der Mehrheit der Schiiten im Süden die Herrschaft überlassen und die Kurden im Norden an der Macht beteiligen. Doch viele irakische Schiiten wollen eine Annäherung an den Iran. Und genau dies stört Washingtons Pläne um das irakische Erdöl. Die Besatzungsmacht USA wird deshalb einen demokratischen Machtwechsel in Irak zu Gunsten der Mehrheit verhindern und nur irakische Politiker dulden, die sich - wie schon vor 20 Jahren beim ersten Golfkrieg - Amerikas Sicht gegenüber dem "Schurkenstaat" Iran unterordnen. Eher werden die USA das irakische Militär an die Spitze putschen als ihre demokratischen Versprechen einlösen. Baldige demokratische Wahlen sind unwahrscheinlich. Und so soll im Irak Frieden entstehen und Freiheit wachsen?
Historisch gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass es den USA im Nahen Osten um Demokratie geht, aber viele Belege dafür, dass die Ölinteressen der USA grundsätzlich an erster Stelle stehen. Eine unabhängige irakische Regierung würde als erstes die Kontrolle über das irakische Öl beanspruchen. Und daran soll ausgerechnet eine Regierung Bush interessiert sein? Dafür wurde George W. Bush von der US-Energiewirtschaft nicht an die Macht gebracht!
Drittens: Die entscheidende Rechtfertigung dieses Krieges war die Behauptung der US-Regierung, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen. Doch wo sind sie geblieben? Hätte er sie nicht eingesetzt, wenn er sie gehabt hätte? Warum werden sie jetzt nicht gefunden?
Vor dem UN-Sicherheitsrat hatte US-Außenminister Powell am 5. Februar 2003 noch behauptet, die irakische Regierung verfüge über 500 Tonnen chemische Kampfstoffe. Deshalb Krieg. Doch wo sind diese gefährlichen Kampfstoffe jetzt? Und wo sind die gefährlichen Biowaffen im Irak, von denen auch Präsident Bush mehrmals sprach? Bush sagte, dass „mehrere Millionen Menschen“ durch „25.000 Liter Anthrax“ getötet werden könnten. Wo sind diese gefährlichen Giftstoffe? Oder ging es ganz banal nicht doch nur um Öl, Mister Bush?
Schon am zweiten Kriegstag haben die britischen und amerikanischen Truppen zunächst einmal die großen Ölförderanlagen im Irak besetzt. Als die Plünderungen in Bagdad begannen, haben US-Militärs überall tatenlos zugeschaut. Nur ein Ministerium haben sie vor Plünderungen geschützt: das Ölministerium! Am Funktionieren dieser Machtzentrale besteht ein US-Interesse der besonderen Art. Die Ölfördermengen im Irak sollen möglichst rasch um das zehnfache gesteigert werden, verlangen US- und britische Energiekonzerne. In den USA haben die Energiekonzerne vor zwei Jahren den Staat übernommen. Ihre Befehlsempfänger sind George W. Bush und seine engsten Mitarbeiter.
Solange sich die Washingtoner Regierung nicht von ihrer Ölfixierung befreit, wird Frieden nicht möglich. Diese Befreiung aber können nur die Wählerinnen und Wähler bewerkstelligen.
Das ist die eigentliche Lehre der Kriegskatastrophe dieser Wochen: Die USA haben die Regierung, die sie verdienen. Eine Regierung, die das Völkerrecht ignoriert, muss in einer Demokratie so rasch wie möglich abgewählt werden. Und eine Opposition in Deutschland, die den offensichtlichen Völkerrechtsbruch eines Angriffskrieges unterstützt, darf sich ebenfalls keine Hoffnung auf die nächsten Wahlen machen.
Die CSU hat einen katholischen Vorsitzenden und die CDU eine evangelische Chefin. Aber beide christliche Kirchen haben sich ohne Wenn und Aber gegen diesen Krieg ausgesprochen. Wann, wenn nicht bei einer Frage, wo es um Krieg oder Frieden geht, muss nach der Glaubwürdigkeit des "Hohen C" im Parteinamen der Christdemokraten und Christsozialen gefragt werden? Ist die Bergpredigt ein Heimatroman, Frau Merkel und Herr Stoiber?
Führende deutsche Christdemokraten haben Jahrzehnte für das ungeborene Leben gekämpft. Aber wenn es um das Leben tausender Geborener geht, ist die "Solidarität" mit der US-Regierung oberstes politisches Prinzip. Prinzipienloser geht es gar nicht.
Angela Merkel, warum haben Sie als Vorsitzende einer großen "C"-Partei Ihre Gesprächspartner in den USA nicht daran erinnert, dass der KSZE-Prozess in Europa vor 30 Jahren der Anfang vom Ende einer ganzen Reihe von Diktaturen und Diktatoren war? Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war der Startschuss für den großen Europäischen Dialog und die Politik der Runden Tische, welche den gewaltlosen Weg für mehr Frieden und Freiheit ermöglichte. Warum also jetzt nicht einen Versuch für eine KSZN (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten) mit Israelis, Palästinensern, Jordaniern, Irakern und allen anderen?
Es gibt immer Alternativen zum Massenmord und Flüchtlingselend. Irak anzugreifen, weil Saddam Hussein ein Diktator ist, war vergleichbar mit dem Abschuss eines vollbesetzten Zivilflugzeugs, weil der Kapitän ein Verbrechen begangen hat.
Zwischen 1994 und 2001 haben 54 Nationen einen Vertrag über die effiziente Zerstörung von biologischen Waffen ausgehandelt. Nur eine Regierung hat den Vertragsabschluss verhindert, die Bush-Administration. Warum, Angela Merkel haben Sie Ihren Freunden nicht gesagt, dass sie eine weit bessere Position hätten beim Verlangen nach Abrüstung von biologischen Waffen im Irak, wenn die USA jetzt diesen Vertrag doch noch unterzeichnen würde? Warum stellen Sie sich so bedingungslos auf die Seite der Krieger?
Die UNO hat eine Reihe von Kriegen beendet, indem sie erfolgreich demokratische Wahlen organisierte. Zum Beispiel in Kambodscha, Namibia und Osttimor. Das schien damals so aussichtslos wie heute im Irak und gelang dennoch! Warum nicht wenigstens ein Versuch auch im Irak? Keine Besatzungsmacht - nur das irakische Volk hat das Recht, seine eigene Regierung zu bestimmen.
Der Irak-Krieg war ein Krieg um Öl und weitere Kriege um die zu Ende gehenden Ressourcen werfen folgen, wenn die Industriestaaten nicht eine andere Energiepolitik betreiben. Die wichtigste Frage der Weltpolitik für die nächsten Jahrzehnte ist: Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne. Ohne eine Energie-Effizienz-Revolution und ohne eine komplette solare Energiewende kann es keinen Frieden mehr geben. Dass diese Alternative weltweit möglich und nötig ist, hat soeben der Umweltbeirat der Bundesregierung in einem eindrucksvollen Bericht aufgezeigt. Allein die Sonne schickt uns 15.000mal mehr Energie als die Menschheit zur Zeit verbraucht. Eine 100prozentige Energieversorgung über Sonne, Wind, Biomasse, Wasserkraft, solaren Wasserstoff Erdwärme, Wellen- und Strömungsenergie der Ozeane ist möglich. Es gibt einen Fluchtweg aus dem Treibhaus. Der Krieg gegen die Natur und die Kriege zwischen Gesellschaften können überwunden werden. Kein Kind auf dieser Welt muss in Zukunft verhungern. Eine bessere Welt ist möglich.

Was kommt jetzt - der Rückschlag oder DAX 4000? (EuramS)
Die Bullen sind los. Angetrieben von reichlich Liquidität haben die Aktienmärkte zuletzt eine Rally hingelegt. Allein der DAX hat seit März 50 Prozent gemacht. Was kommt jetzt - der Rückschlag oder DAX 4000?
Die Kurszuwächse erinnern an üble Zockerwerte, dabei kommen sie von Blue Chips aus dem DAX: HypoVereinsbank plus 90 Prozent seit März , Metro im selben Zeitraum plus 51 Prozent, Infineon plus 37 Prozent. Vereinzelte Ausreißer? Von wegen. Um 50 Prozent hat der DAX gegenüber dem Tief Anfang März zugelegt und zeitweise die Marke von 3300 Punkten übersprungen. So hoch stand das deutsche Börsenbarometer seit Anfang Dezember 2002 nicht mehr.
Dabei sind die Fundamentaldaten hier zu Lande ernüchternd. Kaum noch ein Nullwachstum erwarten die meisten Experten für die einstige Konjunkturlok Europas. Selbst der für seinen Optimismus berüchtigte Bundeswirtschaftsminister rudert inzwischen zurück. Die von ihm noch vor wenigen Wochen verteidigte Prognose von 0,75 Prozent wollte Wolfgang Clement unlängst nicht mehr wiederholen. Wirtschaftsexperten diskutieren ohnehin schon länger über eine mögliche Rezession.
Rezessionsgefahr und Börsenrally: Wie geht das zusammen? "Die Situation ist auf den ersten Blick wirklich verwirrend", räumt Roland Ziegler, Aktienstratege bei der BHF-Bank in Frankfurt, ein. Aber wer genau hinschaue, könne die Entwicklung nachvollziehen. Vor allem in den USA zeichne sich eine Trendwende ab. "Die jüngsten Daten waren überwiegend positiv", urteilt etwa Gertrud Traud, Volkswirtin bei der Bankgesellschaft Berlin. So legte der New Yorker Geschäftsklima-Index zuletzt zu. Gleiches gilt für die viel beachteten Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen. Der Aufschwung der größten Volkswirtschaft der Welt dürfte sich im zweiten Halbjahr sogar noch beschleunigen, glaubt Ziegler: "Wir erwarten für das vierte Quartal ein US-Wirtschaftswachstum von vier Prozent", nach zwei Prozent zum Jahresanfang. Denn viele US-Unternehmen hätten ihre Kosten massiv gesenkt. Dazu beschert der im Verhältnis zum Euro schwache Dollar vielen Firmen Zusatzgewinne, und die Läger seien ebenfalls weitgehend geräumt. "Diese mögliche Erholung der US-Konjunktur nimmt der Markt eben vorweg", erläutert Volker Borghoff, Aktienstratege bei HSBC Trinkaus & Burkhardt in Düsseldorf.
Die guten Vorzeichen für einen baldigen Wirtschaftsaufschwung haben auch die US-Börsen längst auf Trab gebracht. Dow und Nasdaq legten seit Jahresbeginn um zehn beziehungsweise knapp 20 Prozent zu. "In den USA lässt sich derzeit eine wahre Kaufpanik beobachten", sagt Michael Riesner, Technischer Analyst bei der DZ Bank in Frankfurt. Schon prognostizieren erste Beobachter einen Dow-Stand von 10000 Punkten - für dieses Jahr.
Aber die US-Märkte schwimmen derzeit in Liquidität. Die unvorstellbare Summe von 5000 Milliarden Dollar haben die Amerikaner gegenwärtig auf Festgeldkonten, Geldmarktfonds und Sparkonten gebunkert. "Das sind riesige Mittel, die kurzfristig in den Aktienmarkt fließen dürften", schätzt BHF-Experte Ziegler. Hinweise darauf gibt es reichlich. So sind US-Fonds zuletzt in fünf Tagen rekordverdächtige 3,5 Milliarden Dollar zugeflossen. Was Wunder, dass Experten von einer "liquiditätsgetriebenen Hausse" sprechen.
Die Umschichtung in Richtung Aktien dürfte sich fortsetzen. Denn renditeträchtige Alternativen zu den Dividendentiteln sind Mangelware. "Jeden Tag, an dem diese enormen Summen auf Sparkonten oder Geldmarktfonds bleiben, verlieren Anleger praktisch Geld", so Ziegler. Die Rendite von zehnjährigen US-Anleihen liegt mit weniger als drei Prozent auf einem 45-Jahres-Tief. Rechnet man die Inflationsrate heraus, bleiben derzeit real gerade noch kümmerliche 0,3 Prozent. Und die Zinsen dürften noch weiter fallen. Bereits in der nächsten Woche könnte die Fed die Leitzinsen erneut senken, erwarten Beobachter. Die Anlage in Aktien, witzeln Banker in Abwandlung eines berühmten Churchill-Zitats derzeit, ist zwar nicht perfekt, aber immer noch besser als die anderen Möglichkeiten.
Auch in Deutschland fließt immer mehr Geld in Aktienfonds. Während Geldmarktfonds im Januar nach einer Übersicht des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) netto noch 4,6 Milliarden Euro einsammelten, zogen Anleger im April per Saldo 670 Millionen Euro ab (siehe Grafik Seite 10). Bei Aktienfonds war es genau umgekehrt. Dort räumten Investoren im Januar netto noch 690 Millionen Euro ab, im April flossen den Fonds dagegen unterm Strich 1,1 Milliarden Euro zu - mit entsprechenden Folgen. "Wir haben in den vergangenen Monaten massive Zukäufe von Publikumsfonds gesehen", sagt Joachim Paech, Leiter Sales Trading bei Julius Bär in Frankfurt.
Auch direkt trauen sich Privatanleger wieder an die Börse. Beim Discount-Broker Comdirect haben die Orderzahlen seit März "sehr deutlich zugenommen", heißt es. Zudem melden sich ausländische Investoren in Deutschland zurück, sagt Paech. Sie hatten vor dem Crash rund ein Drittel aller Titel im DAX und MDAX gehalten, sich aber während des Crashs Knall auf Fall aus Deutschland zurückgezogen.
Für bessere Laune sorgten zuletzt auch noch die neuesten Steuerpläne der Bundesregierung. Danach will die Koalition die nächste Stufe der Steuerreform möglicherweise um ein Jahr auf 2004 vorziehen. Das dürfte den Konsum beflügeln. Ohnehin hat sich die Stimmung zuletzt deutlich gedreht. Während noch vor ein paar Monaten jede schlechte Unternehmensmeldung eine neue Verkaufswelle auslöste, "nimmt der Markt schlechte Zahlen wie bei DaimlerChrysler inzwischen sportlich", sagt Ziegler.4000 Punkte seien beim DAX in diesem Jahr schon noch drin, glaubt Getrud Traud von der Bankgesellschaft Berlin, schließlich sei der DAX "fundamental immer noch unterbewertet". Joachim Paech von Julius Bär sieht das ähnlich. "Die 4000er-Marke könnte noch dieses Jahr fallen." Allerdings scheint eine Korrektur nach dem jüngsten Aufschwung überfällig. "Charttechnisch dürfte der Markt bis 3400 Punkte laufen", erwartet Michael Riesner, Technischer Analyst bei der DZ Bank. Bis Ende Juli, Anfang August dürfte diese Marke erreicht sein. Danach könnte es einen Rückschlag bis in die Unterstützungszone bei 3000 Punkten geben. Zudem könnte fundamental der starke Euro einen Aufstieg vermasseln: "Die psychologische Schmerzgrenze ist bei 1,20", glaubt BHF-Manager Ziegler.
Auch Wolfgang Schuhmann, Vorstand der Vermögensverwaltung Gebser & Partner, sieht im Dollar eine Gefahr: "Bleibt der Euro stark, könnten sich einige Gewinnschätzungen für deutsche Unternehmen als zu optimistisch erweisen", warnt der langjährige Aktienstratege. Er erwartet ebenfalls eine Konsolidierung: "1000 Punkte in drei Monaten ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle." Mittelfristig rechnet jedoch auch Schuhmann mit steigenden Kursen. "Der DAX wird die 4000-Punkte-Marke in den kommenden Monaten errreichen", prophezeit auch er. Welche Strategien ergeben aus dem DAX-4000-Szenario? Zunächst könnte sich ein Blick auf jene Werte lohnen, die bislang nicht so stark gelaufen sind. Zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die hoch verschuldeten Fernmelder profitieren von den zuletzt deutlich gesunkenen Zinsen. Zudem notiert ein Teil der Schulden in Dollar, was die Rückzahlung derzeit günstiger macht. Schließlich wird der Konzern nach einer Vorgabe aus Brüssel die Grundgebühr für Festnetzanschlüsse erhöhen. Das dürfte den ohnehin hohen Cash-Flow weiter erhöhen.
Daneben können Anleger über ThyssenKrupp auf eine Konjunkturbelebung setzen. Den Düsseldorfern gelang es, höhere Stahlpreise durchzusetzen. Außerdem haben wichtige Lieferanten ihren Sitz in den USA und werden im günstigeren Dollar bezahlt. Die wichtigsten Kunden sitzen im Euroraum.Schließlich ist da noch die SAP. Der Weltmarktführer für Unternehmens-Software hat zuletzt deutlich Marktanteile dazugewonnen. Außerdem verunsichert das feindliche Übernahmeangebot von Oracle an Peoplesoft viele Peoplesoft-Kunden. Sie könnten bei den Walldorfern Zuflucht suchen. Zwar dürften Kurszuwächse von 90 Prozent innerhalb von drei Monaten bei diesen Werten kaum noch drin sein. Aber solange die Vorzeichen aus den USA weiterhin gut sind und beim DAX charttechnisch alles im grünen Bereich ist, werden SAP, Telekom und ThyssenKrupp wohl deutlich zulegen. Das ist allemal Besser als die Nullrendite mancher Anleihen ist das allemal.
Die Bullen sind los. Angetrieben von reichlich Liquidität haben die Aktienmärkte zuletzt eine Rally hingelegt. Allein der DAX hat seit März 50 Prozent gemacht. Was kommt jetzt - der Rückschlag oder DAX 4000?
Die Kurszuwächse erinnern an üble Zockerwerte, dabei kommen sie von Blue Chips aus dem DAX: HypoVereinsbank plus 90 Prozent seit März , Metro im selben Zeitraum plus 51 Prozent, Infineon plus 37 Prozent. Vereinzelte Ausreißer? Von wegen. Um 50 Prozent hat der DAX gegenüber dem Tief Anfang März zugelegt und zeitweise die Marke von 3300 Punkten übersprungen. So hoch stand das deutsche Börsenbarometer seit Anfang Dezember 2002 nicht mehr.
Dabei sind die Fundamentaldaten hier zu Lande ernüchternd. Kaum noch ein Nullwachstum erwarten die meisten Experten für die einstige Konjunkturlok Europas. Selbst der für seinen Optimismus berüchtigte Bundeswirtschaftsminister rudert inzwischen zurück. Die von ihm noch vor wenigen Wochen verteidigte Prognose von 0,75 Prozent wollte Wolfgang Clement unlängst nicht mehr wiederholen. Wirtschaftsexperten diskutieren ohnehin schon länger über eine mögliche Rezession.
Rezessionsgefahr und Börsenrally: Wie geht das zusammen? "Die Situation ist auf den ersten Blick wirklich verwirrend", räumt Roland Ziegler, Aktienstratege bei der BHF-Bank in Frankfurt, ein. Aber wer genau hinschaue, könne die Entwicklung nachvollziehen. Vor allem in den USA zeichne sich eine Trendwende ab. "Die jüngsten Daten waren überwiegend positiv", urteilt etwa Gertrud Traud, Volkswirtin bei der Bankgesellschaft Berlin. So legte der New Yorker Geschäftsklima-Index zuletzt zu. Gleiches gilt für die viel beachteten Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen. Der Aufschwung der größten Volkswirtschaft der Welt dürfte sich im zweiten Halbjahr sogar noch beschleunigen, glaubt Ziegler: "Wir erwarten für das vierte Quartal ein US-Wirtschaftswachstum von vier Prozent", nach zwei Prozent zum Jahresanfang. Denn viele US-Unternehmen hätten ihre Kosten massiv gesenkt. Dazu beschert der im Verhältnis zum Euro schwache Dollar vielen Firmen Zusatzgewinne, und die Läger seien ebenfalls weitgehend geräumt. "Diese mögliche Erholung der US-Konjunktur nimmt der Markt eben vorweg", erläutert Volker Borghoff, Aktienstratege bei HSBC Trinkaus & Burkhardt in Düsseldorf.
Die guten Vorzeichen für einen baldigen Wirtschaftsaufschwung haben auch die US-Börsen längst auf Trab gebracht. Dow und Nasdaq legten seit Jahresbeginn um zehn beziehungsweise knapp 20 Prozent zu. "In den USA lässt sich derzeit eine wahre Kaufpanik beobachten", sagt Michael Riesner, Technischer Analyst bei der DZ Bank in Frankfurt. Schon prognostizieren erste Beobachter einen Dow-Stand von 10000 Punkten - für dieses Jahr.
Aber die US-Märkte schwimmen derzeit in Liquidität. Die unvorstellbare Summe von 5000 Milliarden Dollar haben die Amerikaner gegenwärtig auf Festgeldkonten, Geldmarktfonds und Sparkonten gebunkert. "Das sind riesige Mittel, die kurzfristig in den Aktienmarkt fließen dürften", schätzt BHF-Experte Ziegler. Hinweise darauf gibt es reichlich. So sind US-Fonds zuletzt in fünf Tagen rekordverdächtige 3,5 Milliarden Dollar zugeflossen. Was Wunder, dass Experten von einer "liquiditätsgetriebenen Hausse" sprechen.
Die Umschichtung in Richtung Aktien dürfte sich fortsetzen. Denn renditeträchtige Alternativen zu den Dividendentiteln sind Mangelware. "Jeden Tag, an dem diese enormen Summen auf Sparkonten oder Geldmarktfonds bleiben, verlieren Anleger praktisch Geld", so Ziegler. Die Rendite von zehnjährigen US-Anleihen liegt mit weniger als drei Prozent auf einem 45-Jahres-Tief. Rechnet man die Inflationsrate heraus, bleiben derzeit real gerade noch kümmerliche 0,3 Prozent. Und die Zinsen dürften noch weiter fallen. Bereits in der nächsten Woche könnte die Fed die Leitzinsen erneut senken, erwarten Beobachter. Die Anlage in Aktien, witzeln Banker in Abwandlung eines berühmten Churchill-Zitats derzeit, ist zwar nicht perfekt, aber immer noch besser als die anderen Möglichkeiten.
Auch in Deutschland fließt immer mehr Geld in Aktienfonds. Während Geldmarktfonds im Januar nach einer Übersicht des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) netto noch 4,6 Milliarden Euro einsammelten, zogen Anleger im April per Saldo 670 Millionen Euro ab (siehe Grafik Seite 10). Bei Aktienfonds war es genau umgekehrt. Dort räumten Investoren im Januar netto noch 690 Millionen Euro ab, im April flossen den Fonds dagegen unterm Strich 1,1 Milliarden Euro zu - mit entsprechenden Folgen. "Wir haben in den vergangenen Monaten massive Zukäufe von Publikumsfonds gesehen", sagt Joachim Paech, Leiter Sales Trading bei Julius Bär in Frankfurt.
Auch direkt trauen sich Privatanleger wieder an die Börse. Beim Discount-Broker Comdirect haben die Orderzahlen seit März "sehr deutlich zugenommen", heißt es. Zudem melden sich ausländische Investoren in Deutschland zurück, sagt Paech. Sie hatten vor dem Crash rund ein Drittel aller Titel im DAX und MDAX gehalten, sich aber während des Crashs Knall auf Fall aus Deutschland zurückgezogen.
Für bessere Laune sorgten zuletzt auch noch die neuesten Steuerpläne der Bundesregierung. Danach will die Koalition die nächste Stufe der Steuerreform möglicherweise um ein Jahr auf 2004 vorziehen. Das dürfte den Konsum beflügeln. Ohnehin hat sich die Stimmung zuletzt deutlich gedreht. Während noch vor ein paar Monaten jede schlechte Unternehmensmeldung eine neue Verkaufswelle auslöste, "nimmt der Markt schlechte Zahlen wie bei DaimlerChrysler inzwischen sportlich", sagt Ziegler.4000 Punkte seien beim DAX in diesem Jahr schon noch drin, glaubt Getrud Traud von der Bankgesellschaft Berlin, schließlich sei der DAX "fundamental immer noch unterbewertet". Joachim Paech von Julius Bär sieht das ähnlich. "Die 4000er-Marke könnte noch dieses Jahr fallen." Allerdings scheint eine Korrektur nach dem jüngsten Aufschwung überfällig. "Charttechnisch dürfte der Markt bis 3400 Punkte laufen", erwartet Michael Riesner, Technischer Analyst bei der DZ Bank. Bis Ende Juli, Anfang August dürfte diese Marke erreicht sein. Danach könnte es einen Rückschlag bis in die Unterstützungszone bei 3000 Punkten geben. Zudem könnte fundamental der starke Euro einen Aufstieg vermasseln: "Die psychologische Schmerzgrenze ist bei 1,20", glaubt BHF-Manager Ziegler.
Auch Wolfgang Schuhmann, Vorstand der Vermögensverwaltung Gebser & Partner, sieht im Dollar eine Gefahr: "Bleibt der Euro stark, könnten sich einige Gewinnschätzungen für deutsche Unternehmen als zu optimistisch erweisen", warnt der langjährige Aktienstratege. Er erwartet ebenfalls eine Konsolidierung: "1000 Punkte in drei Monaten ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle." Mittelfristig rechnet jedoch auch Schuhmann mit steigenden Kursen. "Der DAX wird die 4000-Punkte-Marke in den kommenden Monaten errreichen", prophezeit auch er. Welche Strategien ergeben aus dem DAX-4000-Szenario? Zunächst könnte sich ein Blick auf jene Werte lohnen, die bislang nicht so stark gelaufen sind. Zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die hoch verschuldeten Fernmelder profitieren von den zuletzt deutlich gesunkenen Zinsen. Zudem notiert ein Teil der Schulden in Dollar, was die Rückzahlung derzeit günstiger macht. Schließlich wird der Konzern nach einer Vorgabe aus Brüssel die Grundgebühr für Festnetzanschlüsse erhöhen. Das dürfte den ohnehin hohen Cash-Flow weiter erhöhen.
Daneben können Anleger über ThyssenKrupp auf eine Konjunkturbelebung setzen. Den Düsseldorfern gelang es, höhere Stahlpreise durchzusetzen. Außerdem haben wichtige Lieferanten ihren Sitz in den USA und werden im günstigeren Dollar bezahlt. Die wichtigsten Kunden sitzen im Euroraum.Schließlich ist da noch die SAP. Der Weltmarktführer für Unternehmens-Software hat zuletzt deutlich Marktanteile dazugewonnen. Außerdem verunsichert das feindliche Übernahmeangebot von Oracle an Peoplesoft viele Peoplesoft-Kunden. Sie könnten bei den Walldorfern Zuflucht suchen. Zwar dürften Kurszuwächse von 90 Prozent innerhalb von drei Monaten bei diesen Werten kaum noch drin sein. Aber solange die Vorzeichen aus den USA weiterhin gut sind und beim DAX charttechnisch alles im grünen Bereich ist, werden SAP, Telekom und ThyssenKrupp wohl deutlich zulegen. Das ist allemal Besser als die Nullrendite mancher Anleihen ist das allemal.
so ein blöder beitrag 
"kaufpanik, reichliche geld usw."
das ist im grunde eine glatte lüge!

"kaufpanik, reichliche geld usw."
das ist im grunde eine glatte lüge!

Aber die US-Märkte schwimmen derzeit in Liquidität.

ach ja, die tollen 3,5 Milliarden dollar in den letzten fünf tagen


http://app.ny.frb.org/dmm/mkt.cfm
wenn die amis im geld schwimmen, was macht dann opa´le?



Friday, June 20, 2003 - 8:34:33 PM PST
Vehicle fee set to triple
By Rick Orlov
Staff Writer
Gov. Gray Davis` administration formally declared Friday that California has run out of money, triggering a tripling of vehicle license fees for motorists without legislative approval.
The tax will cost drivers an average of $158 more a year and add $4 billion a year to the state treasury to help cover the $38 billion shortfall. Registrations due in October will be the first required to pay the higher fees.
Republicans denounced the governor`s strategy and announced plans to challenge the increase in the courts as well as at the ballot box, with Sen. Tom McClintock, R-Thousand Oaks, filing requests to circulate two separate petitions for ballot measures.
"The state is broke," state Finance Director Steve Peace said after issuing a technically worded, four-paragraph memo instructing state officials to take the steps necessary to raise the tax.
"For the first time, we have none of our own money. As of today, we are operating totally on borrowed cash. In addition, we have no more borrowing capacity left."
Davis did not comment on the fee increase, which he had called for in his May budget revision to deal with the shortfall.
"This is not something the governor or anyone else wanted to see, but the economic problems are so severe there is no other option," Davis spokeswoman Hilary McLean said.
Assemblyman John Campbell, R-Irvine, the ranking Republican on the Budget Committee, said he plans to join tax groups such as the Howard Jarvis Taxpayers Association to challenge the action.
"This tax increase is not right, it is not fair and it is not legal," Campbell said. "I will work to ensure that this tax is overturned in court and that car owners get their full refunds."
Assemblyman Tony Strickland, R-Westlake Village, chairman of the Assembly Republican caucus, joined the Jarvis group`s challenge as he declared the increase "illegal" without a vote of the Legislature.
The vehicle license fee was reduced in 1998 and again in 2000 -- by a total of more than 67 percent -- at a time when the state had a large surplus.
As part of that action, however, the Legislature included what was known as a trigger to reinstate it to the previous levels if the state ever ran out of money.
Peace invoked that clause Friday.
Jon Coupal, president of the Howard Jarvis Taxpayers Association, said the challenge will be based on the failure to require the Legislature to approve reinstating the tax with a two-thirds vote.
"We don`t think this can be done by the governor delegating it to one of his people," Coupal said. "The language is ambiguous, but we think the Legislature has to vote on this."
McClintock said he believes it will take too long for the courts to act and that he is going to go to the voters to change the law.
He filed two requests for ballot initiatives with the Attorney General`s Office. One would change the law to set vehicle registration fees at $1 and the second would be a constitutional amendment banning the fee outright.
"I`m quite certain we can qualify both of these for the ballot," McClintock said. "We`ve already had 11,000 people sign up at my Web site, tommcclintock.com, and pledged to get the signatures.
"Quite simply, this is money the state doesn`t need. The state gets more than enough tax money from the people of California. Our problem is spending. We are spending too much money."
Los Angeles Mayor James Hahn and Police Chief William Bratton welcomed the tax increase, saying the money would go to local government.
"I appreciate that by pulling the VLF trigger, the state is maintaining local governments` ability to pay for essential police and fire services," Hahn said.
Bratton said he had been encouraging state officials to raise the fee.
"Without this money, we won`t be able to hire officers," Bratton said. "This is critical to run this department."
The Associated Press contributed to this report.
Rick Orlov, 213-978-0390 rick.orlov@dailynews.com
http://www.dailynews.com/Stories/0,1413,200%257E20954%257E14…
Autofahren bald Luxusgut in Amiland ?
?
syr
Vehicle fee set to triple
By Rick Orlov
Staff Writer
Gov. Gray Davis` administration formally declared Friday that California has run out of money, triggering a tripling of vehicle license fees for motorists without legislative approval.
The tax will cost drivers an average of $158 more a year and add $4 billion a year to the state treasury to help cover the $38 billion shortfall. Registrations due in October will be the first required to pay the higher fees.
Republicans denounced the governor`s strategy and announced plans to challenge the increase in the courts as well as at the ballot box, with Sen. Tom McClintock, R-Thousand Oaks, filing requests to circulate two separate petitions for ballot measures.
"The state is broke," state Finance Director Steve Peace said after issuing a technically worded, four-paragraph memo instructing state officials to take the steps necessary to raise the tax.
"For the first time, we have none of our own money. As of today, we are operating totally on borrowed cash. In addition, we have no more borrowing capacity left."
Davis did not comment on the fee increase, which he had called for in his May budget revision to deal with the shortfall.
"This is not something the governor or anyone else wanted to see, but the economic problems are so severe there is no other option," Davis spokeswoman Hilary McLean said.
Assemblyman John Campbell, R-Irvine, the ranking Republican on the Budget Committee, said he plans to join tax groups such as the Howard Jarvis Taxpayers Association to challenge the action.
"This tax increase is not right, it is not fair and it is not legal," Campbell said. "I will work to ensure that this tax is overturned in court and that car owners get their full refunds."
Assemblyman Tony Strickland, R-Westlake Village, chairman of the Assembly Republican caucus, joined the Jarvis group`s challenge as he declared the increase "illegal" without a vote of the Legislature.
The vehicle license fee was reduced in 1998 and again in 2000 -- by a total of more than 67 percent -- at a time when the state had a large surplus.
As part of that action, however, the Legislature included what was known as a trigger to reinstate it to the previous levels if the state ever ran out of money.
Peace invoked that clause Friday.
Jon Coupal, president of the Howard Jarvis Taxpayers Association, said the challenge will be based on the failure to require the Legislature to approve reinstating the tax with a two-thirds vote.
"We don`t think this can be done by the governor delegating it to one of his people," Coupal said. "The language is ambiguous, but we think the Legislature has to vote on this."
McClintock said he believes it will take too long for the courts to act and that he is going to go to the voters to change the law.
He filed two requests for ballot initiatives with the Attorney General`s Office. One would change the law to set vehicle registration fees at $1 and the second would be a constitutional amendment banning the fee outright.
"I`m quite certain we can qualify both of these for the ballot," McClintock said. "We`ve already had 11,000 people sign up at my Web site, tommcclintock.com, and pledged to get the signatures.
"Quite simply, this is money the state doesn`t need. The state gets more than enough tax money from the people of California. Our problem is spending. We are spending too much money."
Los Angeles Mayor James Hahn and Police Chief William Bratton welcomed the tax increase, saying the money would go to local government.
"I appreciate that by pulling the VLF trigger, the state is maintaining local governments` ability to pay for essential police and fire services," Hahn said.
Bratton said he had been encouraging state officials to raise the fee.
"Without this money, we won`t be able to hire officers," Bratton said. "This is critical to run this department."
The Associated Press contributed to this report.
Rick Orlov, 213-978-0390 rick.orlov@dailynews.com
http://www.dailynews.com/Stories/0,1413,200%257E20954%257E14…
Autofahren bald Luxusgut in Amiland
 ?
?syr

MITTLERER OSTEN
US-Armee greift syrische Grenzsoldaten an
Auf der Jagd nach den Führern des gestürzten Baath-Regimes haben US-Soldaten offenbar einen syrischen Grenzposten angegriffen. Dabei gab es mehrere Verletzte. Die GIs sollen auch die irakische Grenze nach Syrien überschritten und Gefangene gemacht haben.
Damaskus - Die Amerikaner hatten von einem früheren Saddam-Berater den Hinweis bekommen, von ihnen gesuchte, hochrangige Iraker befänden sich in einem Konvoi auf der Flucht nach Syrien. Die US-Armee nahm die Verfolgung des Trecks auf. Wie jetzt bekannt wurde, endete die Jagd in einem Feuergefecht mit syrischen Grenzsoldaten.
Nach dem Kampf zeigte sich das Ausmaß der blutigen Auseinandersetzung: Ausgebrannte Fahrzeugen, Tote, Verletzte und Gefangene, die auf beiden Seiten der Grenze genommen wurden, bestimmten die Szenerie. Offiziell drangen bis jetzt wenige Details über den Angriff vom vergangenen Mittwoch an die Öffentlichkeit. Ein US-Beamter, der anonym bleiben will, räumte ein, dass sich Saddam Hussein oder einer seiner Söhne nicht in dem Konvoi befunden hätten.
Der Beamte sagte weiter, eine ihm unbekannte Zahl syrischer Grenzposten seien bei dem amerikanischen Militärschlag westlich der irakischen Stadt Qaim verwundet worden. Anderen Quellen zufolge wurden fünf Syrer verletzt. Die US-Armee hat inzwischen 20 Gefangene, die bei dem Angriff festgenommen worden waren, frei gelassen.
Unklar ist, wie es zu der Schießerei an der irakisch-syrischen Grenze kam. Ebenso ist nicht sicher, wo sich die syrischen Grenzposten befunden haben. Der US-Beamte machte keine Angaben darüber, auf welcher Seite der Grenze sich der Kampf ereignete. Ein anderer US-Regierungsvertreter gab an, möglicherweise hätten die US-Streitkräfte den Konvoi mit den Fliehenden bis auf syrisches Gebiet verfolgt.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,254386,00.html
syr
US-Armee greift syrische Grenzsoldaten an
Auf der Jagd nach den Führern des gestürzten Baath-Regimes haben US-Soldaten offenbar einen syrischen Grenzposten angegriffen. Dabei gab es mehrere Verletzte. Die GIs sollen auch die irakische Grenze nach Syrien überschritten und Gefangene gemacht haben.
Damaskus - Die Amerikaner hatten von einem früheren Saddam-Berater den Hinweis bekommen, von ihnen gesuchte, hochrangige Iraker befänden sich in einem Konvoi auf der Flucht nach Syrien. Die US-Armee nahm die Verfolgung des Trecks auf. Wie jetzt bekannt wurde, endete die Jagd in einem Feuergefecht mit syrischen Grenzsoldaten.
Nach dem Kampf zeigte sich das Ausmaß der blutigen Auseinandersetzung: Ausgebrannte Fahrzeugen, Tote, Verletzte und Gefangene, die auf beiden Seiten der Grenze genommen wurden, bestimmten die Szenerie. Offiziell drangen bis jetzt wenige Details über den Angriff vom vergangenen Mittwoch an die Öffentlichkeit. Ein US-Beamter, der anonym bleiben will, räumte ein, dass sich Saddam Hussein oder einer seiner Söhne nicht in dem Konvoi befunden hätten.
Der Beamte sagte weiter, eine ihm unbekannte Zahl syrischer Grenzposten seien bei dem amerikanischen Militärschlag westlich der irakischen Stadt Qaim verwundet worden. Anderen Quellen zufolge wurden fünf Syrer verletzt. Die US-Armee hat inzwischen 20 Gefangene, die bei dem Angriff festgenommen worden waren, frei gelassen.
Unklar ist, wie es zu der Schießerei an der irakisch-syrischen Grenze kam. Ebenso ist nicht sicher, wo sich die syrischen Grenzposten befunden haben. Der US-Beamte machte keine Angaben darüber, auf welcher Seite der Grenze sich der Kampf ereignete. Ein anderer US-Regierungsvertreter gab an, möglicherweise hätten die US-Streitkräfte den Konvoi mit den Fliehenden bis auf syrisches Gebiet verfolgt.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,254386,00.html
syr

Jawohl, macht doch alles platt  ...
...
SPIEGEL 24. Juni 2003, 14:56
Amerikaner würden Iran-Krieg unterstützen
Die Stimmung in den USA steht offenbar weiterhin auf Krieg. Die Mehrheit der Amerikaner würde nach einer neuen Umfrage einen Angriff gegen den Iran unterstützen, um das Land an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Zugleich enthüllte die Umfrage erschreckendes Unwissen über den Irak-Krieg.
Washington - Bei der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der "Washington Post" und des Fernsehsenders ABC erklärten 56 Prozent der Befragten, sie seien in einem solchen Fall für eine Militäraktion. 38 Prozent sprachen sich gegen einen Krieg aus.
US-Präsident George W. Bush hatte in der vergangenen Woche erklärt, die USA und ihre Verbündeten würden die Entwicklung iranischer Atomwaffen nicht tolerieren. Die Umfrage zeigte auch weiterhin starke Unterstützung für die Irakpolitik des US-Präsidenten. 67 Prozent äußerten sich positiv über Bushs Kurs.
Zugleich zeigte die Umfrage was für ein immenses Unwissen die viele Amerikaner über die Geschehnisse im Irak-Krieg haben. So äußerte sich jeder vierte Befragte überzeugt davon, dass die irakische Armee Chemie- und Biowaffen gegen die US-Truppen eingesetzt hat.


URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,254413,00.html
Ein Volk von Analphabeten ?
?
syr
 ...
...SPIEGEL 24. Juni 2003, 14:56
Amerikaner würden Iran-Krieg unterstützen
Die Stimmung in den USA steht offenbar weiterhin auf Krieg. Die Mehrheit der Amerikaner würde nach einer neuen Umfrage einen Angriff gegen den Iran unterstützen, um das Land an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Zugleich enthüllte die Umfrage erschreckendes Unwissen über den Irak-Krieg.
Washington - Bei der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der "Washington Post" und des Fernsehsenders ABC erklärten 56 Prozent der Befragten, sie seien in einem solchen Fall für eine Militäraktion. 38 Prozent sprachen sich gegen einen Krieg aus.
US-Präsident George W. Bush hatte in der vergangenen Woche erklärt, die USA und ihre Verbündeten würden die Entwicklung iranischer Atomwaffen nicht tolerieren. Die Umfrage zeigte auch weiterhin starke Unterstützung für die Irakpolitik des US-Präsidenten. 67 Prozent äußerten sich positiv über Bushs Kurs.
Zugleich zeigte die Umfrage was für ein immenses Unwissen die viele Amerikaner über die Geschehnisse im Irak-Krieg haben. So äußerte sich jeder vierte Befragte überzeugt davon, dass die irakische Armee Chemie- und Biowaffen gegen die US-Truppen eingesetzt hat.



URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,254413,00.html
Ein Volk von Analphabeten
 ?
?syr
was amis alles glauben 

http://www.welt.de/data/2003/06/25/124161.html
US-Präsident Bush legt im Handelsstreit nach
Europa soll Boykott von Genprodukten aufheben - Kritische Fragen werden bei Gipfeltreffen ausgeblendet
von Katja Ridderbusch
Brüssel - Einen Tag, bevor die Führungsspitze der Europäischen Union mit US-Präsident George W. Bush beim heutigen Gipfeltreffen in Washington den transatlantischen Neuanfang feiern will, ziehen erneut dunkle Wolken herauf. Bush forderte die europäischen Staaten auf, sofort ihren Boykott von Gen-Mais und gentechnisch veränderten Agrarprodukten zu beenden. Europa sei mit seiner Blockadepolitik mitverantwortlich für den Hunger in Afrika: "Zum Wohle dieses Kontinents rufe ich die europäischen Regierungen auf, ihre Opposition gegen die Biotechnologie zu beenden", sagte Bush vor dem Verband der biotechnologischen Industrie in Washington.
Die EU-Kommission wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher der Behörde sagte, die EU investiere sieben Mal so viel in Entwicklungshilfeprojekte in Afrika wie die USA. Amerika hatte im Mai Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO eingelegt. Vergangene Woche war die abschließende Verhandlungsrunde gescheitert. In Kürze erwarten beide Seiten den Schiedsspruch. In den USA werden bereits genveränderter Mais und Soja-Bohnen angebaut. Die Biotechnologie schützt das Saatgut angeblich vor Krankheitserregern und hilft so auch Kleinbauern, Erträge zu steigern. Die EU-Kommission hatte mehrfach versucht, den Importbann aufzuheben, war aber stets am Votum der Regierungen gescheitert.
Neben dem Streit um Biotechnologie sorgen auch eine Reihe von Handelsfragen dafür, dass die transatlantische Harmonie zumindest in der Wirtschaft wohl noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Diese Fragen wollen beide Seiten denn auch zum Wohle des gerade wiedergewonnen Friedens beim Washingtoner Gipfel ausblenden. Noch immer ist der Streit um amerikanische Importzölle auf Stahl ungelöst. Die US-Regierung will im September einen Bericht über den Stand des heimischen Stahlmarktes vorlegen, 18 Monate nach Inkrafttreten der Schutzzölle, die bis zu 30 Prozent betragen. Die EU hatte vor der WTO Beschwerde eingelegt. Eine andere Klage der EU vor der WTO hatte Erfolg: Washington muss seine Regeln zu Exportbeihilfen den WTO-Standards anpassen.
Doch auch umgekehrt wirft Washington Brüssel immer wir Protektionismus vor, nicht nur im Falle der Biotechnologie. So attackieren die USA eine EU-Verordnung zur Importbeschränkung für Bananen. Die Verordnung gibt Bananen aus Europa und aus den AKP-Staaten (Asien, Karibik, Pazifik) den Vorzug gegenüber Bananen aus Südamerika. Letztere werden über US-amerikanische Exportfirmen vertrieben.
Dagegen ist Washington offenbar inzwischen bereit, mit der EU über Sicherheitschecks bei Containerschiffen zu verhandeln, die von europäischen Häfen in Richtung USA auslaufen. In den vergangenen Monaten hatten die USA bereits mit acht EU-Mitgliedstaaten bilaterale Abkommen geschlossen. Danach dürfen US-Zollbeamte bei der Beladung von Frachtschiffen in Europa die Schiffe nach ihren Standards prüfen. Die Kommission hatte stets eine gesamteuropäische Vereinbarung gefordert.
Im Vordergrund des Gipfels sollen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik stehen. US-Offizielle zeigten sich von der europäischen Sicherheitsdoktrin, die EU-Chefdiplomat Javier Solana ausgearbeitet und die die EU-Regierungen am Wochenende in Thessaloniki abgesegnet hatten, "beeindruckt". Europa zeige einen "neuen Realismus". In Washington wollen beide Seiten nun auch ein Abkommen zum Schutz vor ABC-Waffen unterzeichnen.
Artikel erschienen am 25. Jun 2003

US-Präsident Bush legt im Handelsstreit nach
Europa soll Boykott von Genprodukten aufheben - Kritische Fragen werden bei Gipfeltreffen ausgeblendet
von Katja Ridderbusch
Brüssel - Einen Tag, bevor die Führungsspitze der Europäischen Union mit US-Präsident George W. Bush beim heutigen Gipfeltreffen in Washington den transatlantischen Neuanfang feiern will, ziehen erneut dunkle Wolken herauf. Bush forderte die europäischen Staaten auf, sofort ihren Boykott von Gen-Mais und gentechnisch veränderten Agrarprodukten zu beenden. Europa sei mit seiner Blockadepolitik mitverantwortlich für den Hunger in Afrika: "Zum Wohle dieses Kontinents rufe ich die europäischen Regierungen auf, ihre Opposition gegen die Biotechnologie zu beenden", sagte Bush vor dem Verband der biotechnologischen Industrie in Washington.
Die EU-Kommission wies die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher der Behörde sagte, die EU investiere sieben Mal so viel in Entwicklungshilfeprojekte in Afrika wie die USA. Amerika hatte im Mai Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO eingelegt. Vergangene Woche war die abschließende Verhandlungsrunde gescheitert. In Kürze erwarten beide Seiten den Schiedsspruch. In den USA werden bereits genveränderter Mais und Soja-Bohnen angebaut. Die Biotechnologie schützt das Saatgut angeblich vor Krankheitserregern und hilft so auch Kleinbauern, Erträge zu steigern. Die EU-Kommission hatte mehrfach versucht, den Importbann aufzuheben, war aber stets am Votum der Regierungen gescheitert.
Neben dem Streit um Biotechnologie sorgen auch eine Reihe von Handelsfragen dafür, dass die transatlantische Harmonie zumindest in der Wirtschaft wohl noch eine Weile auf sich warten lassen wird. Diese Fragen wollen beide Seiten denn auch zum Wohle des gerade wiedergewonnen Friedens beim Washingtoner Gipfel ausblenden. Noch immer ist der Streit um amerikanische Importzölle auf Stahl ungelöst. Die US-Regierung will im September einen Bericht über den Stand des heimischen Stahlmarktes vorlegen, 18 Monate nach Inkrafttreten der Schutzzölle, die bis zu 30 Prozent betragen. Die EU hatte vor der WTO Beschwerde eingelegt. Eine andere Klage der EU vor der WTO hatte Erfolg: Washington muss seine Regeln zu Exportbeihilfen den WTO-Standards anpassen.
Doch auch umgekehrt wirft Washington Brüssel immer wir Protektionismus vor, nicht nur im Falle der Biotechnologie. So attackieren die USA eine EU-Verordnung zur Importbeschränkung für Bananen. Die Verordnung gibt Bananen aus Europa und aus den AKP-Staaten (Asien, Karibik, Pazifik) den Vorzug gegenüber Bananen aus Südamerika. Letztere werden über US-amerikanische Exportfirmen vertrieben.
Dagegen ist Washington offenbar inzwischen bereit, mit der EU über Sicherheitschecks bei Containerschiffen zu verhandeln, die von europäischen Häfen in Richtung USA auslaufen. In den vergangenen Monaten hatten die USA bereits mit acht EU-Mitgliedstaaten bilaterale Abkommen geschlossen. Danach dürfen US-Zollbeamte bei der Beladung von Frachtschiffen in Europa die Schiffe nach ihren Standards prüfen. Die Kommission hatte stets eine gesamteuropäische Vereinbarung gefordert.
Im Vordergrund des Gipfels sollen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik stehen. US-Offizielle zeigten sich von der europäischen Sicherheitsdoktrin, die EU-Chefdiplomat Javier Solana ausgearbeitet und die die EU-Regierungen am Wochenende in Thessaloniki abgesegnet hatten, "beeindruckt". Europa zeige einen "neuen Realismus". In Washington wollen beide Seiten nun auch ein Abkommen zum Schutz vor ABC-Waffen unterzeichnen.
Artikel erschienen am 25. Jun 2003

25.06. 10:26
Verschuldung der US-Verbraucher und die Fed
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
In den USA stehen derzeit durch die niedrigen Hypothekenzinsen die Aufnahme von Krediten für den Hausbau oder Hauskauf in Mode. Autohersteller locken mit Nullzins-Angeboten und Werbeangebote wie „Jetzt kaufen, später zahlen“ locken in den USA an jeder Ecke.
Pro Jahr steigt die private Verschuldung um 10%, während das private Einkommen um nur 3.7% ansteigt. Die US-Notenbank wird zudem die Kreditaufnahme noch attraktiver gestalten – es wird erwartet, dass die Leitzinsen erneut gesenkt werden.
Paul Kasriel, Chefökonom bei Northern Trust, betont die Gefahren, die sich aus diesem Trend ergeben. Die Kreditaufnahme werde von allen Seiten her unterstützt, was jedoch bei wieder steigenden Zinssätzen ein richtiges Problem werden könnte, so Kasriel. In den 12 Monaten zum 31. März führte die hohe Verschuldung zu 1.57 Millionen privaten Insolvenzen. Auch die Zahl der Zahlungsunfähigen bei Hypothekenschulden haben ein Rekordhoch erreicht.
Sam Gerdano, Exekutivdirektor bei dem American Bankruptcy Institute, betont, dass es den Politikern eigentlich egal sei, wenn Privatleute insolvent werden. „Das ist die andere Seite der Medaille bei den Verbraucherausgaben. Man muss Verbraucher zu Ausgaben bewegen, wir müssen Verbraucher zur Kreditaufnahme ermutigen, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Aber Insolvenzanträge sind ein häufiges Nebenprodukt dieser Beziehung“.
Stephen Brobeck, Exekutivdirektor bei der Consumer Federation of America, verweist auf die Stärke des Trends hin. So haben Teenager in höheren Einkommensklassen oft bereits ein Auto (aufgrund der Gesetzgebung ist es teilweise im Alter von 15 Jahren in den USA erlaubt, ein Automobil zu führen) auf Kredit gekauft und schaffen sich mit 20 Jahren eine Kreditkarte an. Jedoch sind die Amerikaner sich der Probleme bewusst. Eine jüngste Umfrage der Gruppe zeigt, dass 25% der Amerikaner „sehr besorgt“ über ihre Fähigkeit der Begleichung der Kreditschulden sind, während weitere 25% ihre Kredite nur zurückzahlen könnten, wenn das aktuelle Einkommensniveau stabil bleibt.

Verschuldung der US-Verbraucher und die Fed
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
In den USA stehen derzeit durch die niedrigen Hypothekenzinsen die Aufnahme von Krediten für den Hausbau oder Hauskauf in Mode. Autohersteller locken mit Nullzins-Angeboten und Werbeangebote wie „Jetzt kaufen, später zahlen“ locken in den USA an jeder Ecke.
Pro Jahr steigt die private Verschuldung um 10%, während das private Einkommen um nur 3.7% ansteigt. Die US-Notenbank wird zudem die Kreditaufnahme noch attraktiver gestalten – es wird erwartet, dass die Leitzinsen erneut gesenkt werden.
Paul Kasriel, Chefökonom bei Northern Trust, betont die Gefahren, die sich aus diesem Trend ergeben. Die Kreditaufnahme werde von allen Seiten her unterstützt, was jedoch bei wieder steigenden Zinssätzen ein richtiges Problem werden könnte, so Kasriel. In den 12 Monaten zum 31. März führte die hohe Verschuldung zu 1.57 Millionen privaten Insolvenzen. Auch die Zahl der Zahlungsunfähigen bei Hypothekenschulden haben ein Rekordhoch erreicht.
Sam Gerdano, Exekutivdirektor bei dem American Bankruptcy Institute, betont, dass es den Politikern eigentlich egal sei, wenn Privatleute insolvent werden. „Das ist die andere Seite der Medaille bei den Verbraucherausgaben. Man muss Verbraucher zu Ausgaben bewegen, wir müssen Verbraucher zur Kreditaufnahme ermutigen, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Aber Insolvenzanträge sind ein häufiges Nebenprodukt dieser Beziehung“.
Stephen Brobeck, Exekutivdirektor bei der Consumer Federation of America, verweist auf die Stärke des Trends hin. So haben Teenager in höheren Einkommensklassen oft bereits ein Auto (aufgrund der Gesetzgebung ist es teilweise im Alter von 15 Jahren in den USA erlaubt, ein Automobil zu führen) auf Kredit gekauft und schaffen sich mit 20 Jahren eine Kreditkarte an. Jedoch sind die Amerikaner sich der Probleme bewusst. Eine jüngste Umfrage der Gruppe zeigt, dass 25% der Amerikaner „sehr besorgt“ über ihre Fähigkeit der Begleichung der Kreditschulden sind, während weitere 25% ihre Kredite nur zurückzahlen könnten, wenn das aktuelle Einkommensniveau stabil bleibt.

25.06. 20:12
US-Zentralbank: Die Zinsentscheidung
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank hat entschieden, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1% und damit auf ein 45-Jahrestief zu senken. Die US-Zentralbank sieht nun ein größeres Risiko einer deflationären Entwicklung in den USA als einer inflationären Entwicklung, so ein Statement. Deflationäre Entwicklungen seien jedoch "unwillkommen". Die Abstimmung wurde mit 11 Für- und einer Gegenstimme abgeschlossen. Deflationäre Entwicklungen seien jedoch "unwillkommen". Robert T. Parry stimmte für eine Senkung um 50 Basispunkte. Die Chancen auf einen Aufschwung im Gegensatz zu den Risiken einer weiteren Verschlechterung seien derzeit "ungefähr gleichgewichtet".
------
Bei 3,75 Prozent schrieb ich was von japanischen Verhältnissen im Hinblick auf Zinsen.
US-Zentralbank: Die Zinsentscheidung
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank hat entschieden, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1% und damit auf ein 45-Jahrestief zu senken. Die US-Zentralbank sieht nun ein größeres Risiko einer deflationären Entwicklung in den USA als einer inflationären Entwicklung, so ein Statement. Deflationäre Entwicklungen seien jedoch "unwillkommen". Die Abstimmung wurde mit 11 Für- und einer Gegenstimme abgeschlossen. Deflationäre Entwicklungen seien jedoch "unwillkommen". Robert T. Parry stimmte für eine Senkung um 50 Basispunkte. Die Chancen auf einen Aufschwung im Gegensatz zu den Risiken einer weiteren Verschlechterung seien derzeit "ungefähr gleichgewichtet".
------
Bei 3,75 Prozent schrieb ich was von japanischen Verhältnissen im Hinblick auf Zinsen.

http://www.ftd.de/bm/an/1056459053770.html?nv=cd-divnews
Aus der FTD vom 26.6.2003 www.ftd.de/kapital
Das Kapital: Selbst Goldman Sachs ist unerschwinglich teuer
Der Realitätsverlust hat an der Wall Street inzwischen wieder erschreckende Ausmaße angenommen. Goldman Sachs (GS) ist ein blendendes Beispiel.
Seit dem März-Tief ist die Aktie ja durch die Decke gegangen wie jene der Konkurrenten auch. Das Kalkül der Spekulanten - das brummende Anleihengeschäft sowie die Hoffnung auf ein anziehendes Investmentbanking - ist verständlich. Aber sie haben über das Ziel hinaus geschossen. Wie der Sektor ist die Goldman-Sachs-Aktie unbezahlbar teuer geworden, selbst wenn sich die Wirtschaft nachhaltig berappelt.
GS kostet mittlerweile den gut 18-fachen laufenden Konsensgewinn, der gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 17 Prozent unterstellt. Vermutlich werden die Schätzungen nach den Halbjahreszahlen ein wenig zulegen. Aber selbst wenn das zweite Halbjahr genauso gut läuft wie das erste - was wegen der langsam ausgereizten Bondmärkte keineswegs gesagt ist -, würde die Bank weniger verdienen als 1997. Im Trend sind die Gewinne seitdem rückläufig.
Die Dividende wird jetzt verdoppelt - und bringt damit eine Rendite von 1,17 Prozent. Halt, werden Gönner einwenden, auch nach der Verdopplung kostet die Dividende GS nur rund ein Fünftel des Jahresgewinns. Bloß druckt die Firma natürlich Mitarbeiteroptionen. Die als Gehalt verbucht, hätte GS 2002 statt 2,114 nur 1,745 Mrd. $ verdient. Um eine Verwässerung zu vermeiden, hat GS 2002 und 2001 jeweils rund 1,4 Mrd. $ in Aktienrückkäufe gesteckt. Und was hat es gebracht? Der Aktienumlauf war im letzten Quartal etwas höher als im Schnitt des Jahres 2000.
(...)
© 2003 Financial Times Deutschland

Aus der FTD vom 26.6.2003 www.ftd.de/kapital
Das Kapital: Selbst Goldman Sachs ist unerschwinglich teuer
Der Realitätsverlust hat an der Wall Street inzwischen wieder erschreckende Ausmaße angenommen. Goldman Sachs (GS) ist ein blendendes Beispiel.
Seit dem März-Tief ist die Aktie ja durch die Decke gegangen wie jene der Konkurrenten auch. Das Kalkül der Spekulanten - das brummende Anleihengeschäft sowie die Hoffnung auf ein anziehendes Investmentbanking - ist verständlich. Aber sie haben über das Ziel hinaus geschossen. Wie der Sektor ist die Goldman-Sachs-Aktie unbezahlbar teuer geworden, selbst wenn sich die Wirtschaft nachhaltig berappelt.
GS kostet mittlerweile den gut 18-fachen laufenden Konsensgewinn, der gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 17 Prozent unterstellt. Vermutlich werden die Schätzungen nach den Halbjahreszahlen ein wenig zulegen. Aber selbst wenn das zweite Halbjahr genauso gut läuft wie das erste - was wegen der langsam ausgereizten Bondmärkte keineswegs gesagt ist -, würde die Bank weniger verdienen als 1997. Im Trend sind die Gewinne seitdem rückläufig.
Die Dividende wird jetzt verdoppelt - und bringt damit eine Rendite von 1,17 Prozent. Halt, werden Gönner einwenden, auch nach der Verdopplung kostet die Dividende GS nur rund ein Fünftel des Jahresgewinns. Bloß druckt die Firma natürlich Mitarbeiteroptionen. Die als Gehalt verbucht, hätte GS 2002 statt 2,114 nur 1,745 Mrd. $ verdient. Um eine Verwässerung zu vermeiden, hat GS 2002 und 2001 jeweils rund 1,4 Mrd. $ in Aktienrückkäufe gesteckt. Und was hat es gebracht? Der Aktienumlauf war im letzten Quartal etwas höher als im Schnitt des Jahres 2000.
(...)
© 2003 Financial Times Deutschland

http://www.klaus-krusche.de/oeldollar.htm
Es geht nicht ums Öl, es geht nur um die Ö l w ä h r u n g .
Wer das wahre Motiv für den Krieg sucht, dem sei hier eine weitere Option angeboten, die derzeit im Internet kursiert. Um die Theorie kurz zu fassen: das gesetzliche Zahlungsmittel des Ölhandels ist der Dollar. Der Preis eines Ölfasses wird nur in Dollar festgelegt. Und dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass fast alle Länder der Welt ihre Devisenreserven in Dollar anlegen. Diese Dominanz des Dollars ist heute fast die einzige Grundlage für die Stärke der amerikanischen Währung.
Und in einem Satz:
Nicht die Guten gegen die Bösen, nur der Dollar gegen den Euro.
Wer aus dem Dollar aussteigt, gehört zur "Achse des Bösen" und wird von Bush mit Gewalt bedroht. Als kürzlich Saudi-Arabien begann, seine Dollar-Reserven aus den USA abzuziehen und in EURO anzulegen, wurde dem saudischen Königshaus unter dem Vorwand der Terrorismus-Unterstützung Gewalt angedroht: "Die saudi-arabische Investment-Community hat bereits zwischen 100 und 200 Milliarden Dollar aus den USA abgezogen. ... Die Geldströme von den USA nach Europa sind, so Experten, ein Grund für die Schwäche des Dollar."
Die Islamische Republik Iran hat mehr als die Hälfte ihrer Devisenreserven von 7 Milliarden Dollar in Euro umgetauscht. Das hat die Tageszeitung Iran Daily unter Berufung auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das Blatt zitiert ein Mitglied des iranischen Parlaments mit der Aussage, er hoffe, daß ein starker Euro das amerikanische Monopol im Welthandel schwächen werde. Bislang ist der I r a k der einzige große Ölproduzent, der seine Exporte, seit November 2000, in Euro fakturiert, was der irakischen Regierung zum Verhängnis geworden ist und den eigentlichen Kriegsgrund darstellt. Dass der Irak auch seine 10 Mrd.$ Reserven bei der UNO (vom Programm „Öl-für-Nahrung“ ) in Euro umwandelte, war eine Draufgabe.
In diesem Krieg geht es eben nicht um Saddam oder Massenvernichtungs-Waffen, sondern darum, die OPEC einzuschüchtern (auch den anderen Regierungen könnte das Schicksal Saddams drohen) bzw. direkt zu hindern, dem Beispiel des Iraks zu folgen.
I r a n hält Reserven verstärkt in Euro
Stein des Anstoßes ist, daß die Regierung in Washington die iranische Führung bezichtigt, den Terrorismus zu unterstützen und mit dem Irak eine Achse des Bösen zu bilden. Das nährt Ängste, Washington könne Dollar-Zahlungen, die über amerikanische Banken geleitet werden, einfrieren. Zudem solle verhindert werden, daß sich amerikanische Bankaufsichtsbehörden Informationen über die Zahlungsvorgänge auf den iranischen Konten verschaffen, heißt es. Abgesehen davon habe die jüngste Schwäche des Dollar den Euro als Anlagewährung attraktiv gemacht. Mittelfristig dürfte dem Euro weiteren Auftrieb geben, wenn mehrere Ölexporteure die Gemeinschaftswährung zur Abrechnung nutzten und verstärkt Gelder an den europäischen Kapitalmärkten anlegten.
Iran ist derzeit hinter Saudi-Arabien der zweitgrößte Ölexporteur der Opec. In diesem Jahr dürfte er bereits rund 10 Milliarden Dollar mit Ölexporten verdient haben, schätzen Fachleute. Im Jahr 2001 habe Iran für 6,5 Milliarden Euro Waren in die EU exportiert, davon 80 Prozent Rohöl. Im Juni hat sich die EU bereit erklärt, Handelsgespräche aufzunehmen, sofern Bedenken bezüglich Menschenrechtsfragen, Terrorismus und Massenvernichtungswaffen ausgeräumt werden können. Im Juli hat Iran erstmals seit 1979 wieder eine Staatsanleihe in Europa begeben, über 500 Millionen Euro.
Was wäre wenn … die OPEC plötzlich – statt geordnet (d.h. schrittweise)- auf Euro umstiege? Nun, alle Öl-verbrauchenden Staaten und deren Zentralbanken müssten die „Währungs-Reserven“ von Dollar auf Euro umstellen. Der Dollar würde sofort bis zur Hälfte seines Wertes verlieren – mit den entsprechenden Folgen (u.a. ungeheurer Inflation) für die US-Wirtschaft, die ein derartiger Zusammenbruch der Währung nach sich zöge.
Eine Flucht aller ausländischen Anlagen aus dem Dollar – den Aktien und Dollar-bezogenen Wertpapieren – würde einen Sturm auf die Banken wie in den 30er Jahren auslösen, das Außenhandelsdefizit wäre nicht mehr aufrechtzuerhalten und der Staatshaushalt würde faktisch bankrott sein, usw.
Die Entwicklung hin zu einer Ölwährung Euro würde fördern, wenn der bedeutende Ölproduzent Großbritannien seine Exporte zumindest teilweise in Euro fakturieren würde; ein Beitritt Großbritanniens zur Währungsunion könnte dazu den Anstoß geben. Ähnliches gilt für Norwegen.
Donald Nott von Henry Woods Investment Management schreibt dazu: "Um die amerikanische Wirtschaft am Laufen zu halten, müssen täglich 1,25 Milliarden Dollar in die USA fließen." Diese Summen kommen aber nicht ins Land, solange es die Konkurrenzwährung EURO gibt, eine äußerst bedrohliche Situation für die USA. Dieses Europa ärgert die amerikanische Regierung. Es ist im Begriff, eine wirtschaftliche Supermacht zu werden, es ist in der Lage, mit den USA zu konkurrieren, ja vielleicht sogar, sie zu überholen. Ein Symbol dafür ist die Tatsache, dass der Euro den Dollar tatsächlich eingeholt hat.
Der Krieg im Irak ist vor allem ein Krieg gegen Europa und Japan. Die amerikanische Besatzung des Irak wird die amerikanische Kontrolle nicht nur über die ausgedehnten Ölreserven des Irak selbst, sondern auch die des Kaspischen Meeres und der Golfstaaten sichern.
Die US-Hand auf dem Ölhahn der Welt kann Deutschland, Frankreich und Japan abwürgen, weil sie nach Belieben den Preis in aller Welt manipulieren kann. Den Preis herabsetzen, wird Russland abwürgen - den Preis erhöhen, wird Deutschland und Japan treffen.
Washington verbirgt nicht einmal sein Verlangen, Europa auf die Knie zu zwingen. In letzter Zeit gab es eine primitive amerikanische Bemühung, eine Koalition mit peripheren Ländern zu schaffen, um Deutschland und Frankreich aus der Führung der EU zu verdrängen. Amerika ist dabei, zusammen mit England, Spanien und Italien, einen Block früherer kommunistischer Nationen zu organisieren, die gerade dabei sind, sich der EU anzuschließen. Die Paris-Berlin Achse, unterstützt von Moskau, wird auch als Verteidigung gegen dieses Manöver geplant. Dieser Krieg geht also weit über den Irak hinaus. Es ist ganz einfach ein Krieg um Weltherrschaft, wirtschaftlich, politisch, militärisch und kulturell.
Um dies zu erreichen, ist Bush bereit, eine Menge Blut zu vergießen.
-----------
Kein Wunder steckt Blair im Ar... von Bush
Es geht nicht ums Öl, es geht nur um die Ö l w ä h r u n g .
Wer das wahre Motiv für den Krieg sucht, dem sei hier eine weitere Option angeboten, die derzeit im Internet kursiert. Um die Theorie kurz zu fassen: das gesetzliche Zahlungsmittel des Ölhandels ist der Dollar. Der Preis eines Ölfasses wird nur in Dollar festgelegt. Und dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass fast alle Länder der Welt ihre Devisenreserven in Dollar anlegen. Diese Dominanz des Dollars ist heute fast die einzige Grundlage für die Stärke der amerikanischen Währung.
Und in einem Satz:
Nicht die Guten gegen die Bösen, nur der Dollar gegen den Euro.
Wer aus dem Dollar aussteigt, gehört zur "Achse des Bösen" und wird von Bush mit Gewalt bedroht. Als kürzlich Saudi-Arabien begann, seine Dollar-Reserven aus den USA abzuziehen und in EURO anzulegen, wurde dem saudischen Königshaus unter dem Vorwand der Terrorismus-Unterstützung Gewalt angedroht: "Die saudi-arabische Investment-Community hat bereits zwischen 100 und 200 Milliarden Dollar aus den USA abgezogen. ... Die Geldströme von den USA nach Europa sind, so Experten, ein Grund für die Schwäche des Dollar."
Die Islamische Republik Iran hat mehr als die Hälfte ihrer Devisenreserven von 7 Milliarden Dollar in Euro umgetauscht. Das hat die Tageszeitung Iran Daily unter Berufung auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das Blatt zitiert ein Mitglied des iranischen Parlaments mit der Aussage, er hoffe, daß ein starker Euro das amerikanische Monopol im Welthandel schwächen werde. Bislang ist der I r a k der einzige große Ölproduzent, der seine Exporte, seit November 2000, in Euro fakturiert, was der irakischen Regierung zum Verhängnis geworden ist und den eigentlichen Kriegsgrund darstellt. Dass der Irak auch seine 10 Mrd.$ Reserven bei der UNO (vom Programm „Öl-für-Nahrung“ ) in Euro umwandelte, war eine Draufgabe.
In diesem Krieg geht es eben nicht um Saddam oder Massenvernichtungs-Waffen, sondern darum, die OPEC einzuschüchtern (auch den anderen Regierungen könnte das Schicksal Saddams drohen) bzw. direkt zu hindern, dem Beispiel des Iraks zu folgen.
I r a n hält Reserven verstärkt in Euro
Stein des Anstoßes ist, daß die Regierung in Washington die iranische Führung bezichtigt, den Terrorismus zu unterstützen und mit dem Irak eine Achse des Bösen zu bilden. Das nährt Ängste, Washington könne Dollar-Zahlungen, die über amerikanische Banken geleitet werden, einfrieren. Zudem solle verhindert werden, daß sich amerikanische Bankaufsichtsbehörden Informationen über die Zahlungsvorgänge auf den iranischen Konten verschaffen, heißt es. Abgesehen davon habe die jüngste Schwäche des Dollar den Euro als Anlagewährung attraktiv gemacht. Mittelfristig dürfte dem Euro weiteren Auftrieb geben, wenn mehrere Ölexporteure die Gemeinschaftswährung zur Abrechnung nutzten und verstärkt Gelder an den europäischen Kapitalmärkten anlegten.
Iran ist derzeit hinter Saudi-Arabien der zweitgrößte Ölexporteur der Opec. In diesem Jahr dürfte er bereits rund 10 Milliarden Dollar mit Ölexporten verdient haben, schätzen Fachleute. Im Jahr 2001 habe Iran für 6,5 Milliarden Euro Waren in die EU exportiert, davon 80 Prozent Rohöl. Im Juni hat sich die EU bereit erklärt, Handelsgespräche aufzunehmen, sofern Bedenken bezüglich Menschenrechtsfragen, Terrorismus und Massenvernichtungswaffen ausgeräumt werden können. Im Juli hat Iran erstmals seit 1979 wieder eine Staatsanleihe in Europa begeben, über 500 Millionen Euro.
Was wäre wenn … die OPEC plötzlich – statt geordnet (d.h. schrittweise)- auf Euro umstiege? Nun, alle Öl-verbrauchenden Staaten und deren Zentralbanken müssten die „Währungs-Reserven“ von Dollar auf Euro umstellen. Der Dollar würde sofort bis zur Hälfte seines Wertes verlieren – mit den entsprechenden Folgen (u.a. ungeheurer Inflation) für die US-Wirtschaft, die ein derartiger Zusammenbruch der Währung nach sich zöge.
Eine Flucht aller ausländischen Anlagen aus dem Dollar – den Aktien und Dollar-bezogenen Wertpapieren – würde einen Sturm auf die Banken wie in den 30er Jahren auslösen, das Außenhandelsdefizit wäre nicht mehr aufrechtzuerhalten und der Staatshaushalt würde faktisch bankrott sein, usw.
Die Entwicklung hin zu einer Ölwährung Euro würde fördern, wenn der bedeutende Ölproduzent Großbritannien seine Exporte zumindest teilweise in Euro fakturieren würde; ein Beitritt Großbritanniens zur Währungsunion könnte dazu den Anstoß geben. Ähnliches gilt für Norwegen.
Donald Nott von Henry Woods Investment Management schreibt dazu: "Um die amerikanische Wirtschaft am Laufen zu halten, müssen täglich 1,25 Milliarden Dollar in die USA fließen." Diese Summen kommen aber nicht ins Land, solange es die Konkurrenzwährung EURO gibt, eine äußerst bedrohliche Situation für die USA. Dieses Europa ärgert die amerikanische Regierung. Es ist im Begriff, eine wirtschaftliche Supermacht zu werden, es ist in der Lage, mit den USA zu konkurrieren, ja vielleicht sogar, sie zu überholen. Ein Symbol dafür ist die Tatsache, dass der Euro den Dollar tatsächlich eingeholt hat.
Der Krieg im Irak ist vor allem ein Krieg gegen Europa und Japan. Die amerikanische Besatzung des Irak wird die amerikanische Kontrolle nicht nur über die ausgedehnten Ölreserven des Irak selbst, sondern auch die des Kaspischen Meeres und der Golfstaaten sichern.
Die US-Hand auf dem Ölhahn der Welt kann Deutschland, Frankreich und Japan abwürgen, weil sie nach Belieben den Preis in aller Welt manipulieren kann. Den Preis herabsetzen, wird Russland abwürgen - den Preis erhöhen, wird Deutschland und Japan treffen.
Washington verbirgt nicht einmal sein Verlangen, Europa auf die Knie zu zwingen. In letzter Zeit gab es eine primitive amerikanische Bemühung, eine Koalition mit peripheren Ländern zu schaffen, um Deutschland und Frankreich aus der Führung der EU zu verdrängen. Amerika ist dabei, zusammen mit England, Spanien und Italien, einen Block früherer kommunistischer Nationen zu organisieren, die gerade dabei sind, sich der EU anzuschließen. Die Paris-Berlin Achse, unterstützt von Moskau, wird auch als Verteidigung gegen dieses Manöver geplant. Dieser Krieg geht also weit über den Irak hinaus. Es ist ganz einfach ein Krieg um Weltherrschaft, wirtschaftlich, politisch, militärisch und kulturell.
Um dies zu erreichen, ist Bush bereit, eine Menge Blut zu vergießen.
-----------
Kein Wunder steckt Blair im Ar... von Bush

#307 
ein wenig spät DD. Im politboard diskutieren wir das seit Monaten. schau doch einfach mal rüber

ein wenig spät DD. Im politboard diskutieren wir das seit Monaten. schau doch einfach mal rüber

punk24
gib mal den link
gib mal den link

http://www.welt.de/data/2003/06/28/125523.html?s=1
Top-Manager sollen Amerika retten
Yale-Professor Jeffrey Garten plädiert für einen neuen Stil der "Public-Private Partnership"
von Stefan von Borstel
Agenden haben Hochkonjunktur: Nicht nur der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat eine geschrieben, auch der Amerikaner Jeffrey Garten, Dekan an der Yale School of Management. Will der Kanzler Deutschland mit Reformen fit machen, geht es dem Yale-Professor um die Manager der Vereinigten Staaten. Auch sie sollen fit gemacht werden, für eine "neue Welt" - so ist das erste Kapitel in Jeffrey Gartens Buch "The Politics of Fortune" überschrieben. Diese neue Welt ist allerdings keine schöne Welt. "Das Goldene Zeitalter der US-Wirtschaft, wie wir es in den achtziger und neunziger Jahren erlebt haben, ist unwiederbringlich verloren", schreibt Garten.
Ein verheerender Doppelschlag, so seine Analyse, habe alles verändert: Zum einen der Terroranschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001. Zum anderen der Bilanzskandal um den amerikanischen Energieriesen Enron. "Beides zusammen, der Terror und der Enron-Skandal, bedrohen unsere offene Gesellschaft und unsere freien Märkte, weil sie das Vertrauen erschüttert haben, auf dem unsere Gesellschaft beruht", lautet Gartens Kernthese. Garten sieht Amerika gegenwärtig an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte.
Er nennt Enron und den 11. September 2001 im selben Atemzug mit Pearl Harbour, mit der ersten Atombombenexplosion in Japan oder dem Fall der Berliner Mauer. Der ehemalige Direktor von Lehman Brothers und Wirtschaftsberater der US-Präsidenten Nixon, Ford und Clinton fürchtet um die Balance zwischen Wirtschaft und Staat in Amerika, oder besser: dass sich diese Balance zu Gunsten eines starken Staates verschiebt.
Kontrolle statt Deregulierung, Sicherheit statt Freiheit, so analysiert Jeffrey Garten, seien die unabweisbaren Folgen der Terroranschläge. Das Streben nach "nationaler Sicherheit könnte alles andere verdrängen", fürchtet der Autor. Sehr groß ist seine Sorge, nach zwei Jahrzehnten der Deregulierung und Privatisierung, nach rund 20 Jahren Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der immer engeren internationalen Verflechtung und Zusammenarbeit könnte das Pendel nun zu stark in Richtung Staat ausschlagen.
In dieser Situation müsse die Wirtschaftselite ihre Stimme erheben, um das Schlimmste zu verhindern. Garten plädiert für ein "Public-Private Partnership" neuen Stils. Die Manager sollten als Partner und Berater der Politik fungieren. Doch die neue Rolle kommt für Amerikas Manager zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Denn nach den Skandal um gefälschte Bilanzen und um Millionengehälter für unfähige Manager, nach dem Kurssturz an den Börsen, bei dem die Aktionäre Milliarden verloren haben, ist die Reputation von Amerikas Top-Managern dahin und ihr Rat in Schicksalsfragen der Nation nicht mehr unbedingt gefragt.
Zuerst müssten Amerikas Manager daher ihren eigenen Laden in Ordnung bringen, wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit wiedergewinnen wollen, empfiehlt Garten. Seine Problemanalyse ist schlüssig, die Lösungen, die er anbietet, nicht immer - zumindest nicht für europäische Leser. Aus Sicht der Europäer überrascht es schon, welche große Rolle Garten Unternehmenschefs im politischen Willensbildungsprozess einräumen will. Parteien, Parlamente, gewählte Abgeordnete oder auch Verbände, die die Interessen der Wirtschaft artikulieren, kommen in Gartens Weltsicht gar nicht vor.
Stattdessen appelliert der Yale-Professor an den Gutmenschen im Manager, orientierungslosen Politikern in einer schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Statt sich auf Golfplätzen und Segelyachten die Zeit tot zu schlagen, könnten frühpensionierte Unternehmenslenker sich ja auch in den Dienst des Staates stellen, schlägt Garten ganz pragmatisch vor. Wie die neue Partnerschaft zwischen Managern und Politikern, Wirtschaft und Staat konkret aussehen soll, bleibt in Gartens Welt allerdings ausgesprochen diffus.
Jeffrey E. Garten: The Politics of Fortune - A new Agenda for Business Leaders, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2002, 24,95 Dollar
Artikel erschienen am 28. Jun 2003
Top-Manager sollen Amerika retten
Yale-Professor Jeffrey Garten plädiert für einen neuen Stil der "Public-Private Partnership"
von Stefan von Borstel
Agenden haben Hochkonjunktur: Nicht nur der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat eine geschrieben, auch der Amerikaner Jeffrey Garten, Dekan an der Yale School of Management. Will der Kanzler Deutschland mit Reformen fit machen, geht es dem Yale-Professor um die Manager der Vereinigten Staaten. Auch sie sollen fit gemacht werden, für eine "neue Welt" - so ist das erste Kapitel in Jeffrey Gartens Buch "The Politics of Fortune" überschrieben. Diese neue Welt ist allerdings keine schöne Welt. "Das Goldene Zeitalter der US-Wirtschaft, wie wir es in den achtziger und neunziger Jahren erlebt haben, ist unwiederbringlich verloren", schreibt Garten.
Ein verheerender Doppelschlag, so seine Analyse, habe alles verändert: Zum einen der Terroranschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001. Zum anderen der Bilanzskandal um den amerikanischen Energieriesen Enron. "Beides zusammen, der Terror und der Enron-Skandal, bedrohen unsere offene Gesellschaft und unsere freien Märkte, weil sie das Vertrauen erschüttert haben, auf dem unsere Gesellschaft beruht", lautet Gartens Kernthese. Garten sieht Amerika gegenwärtig an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte.
Er nennt Enron und den 11. September 2001 im selben Atemzug mit Pearl Harbour, mit der ersten Atombombenexplosion in Japan oder dem Fall der Berliner Mauer. Der ehemalige Direktor von Lehman Brothers und Wirtschaftsberater der US-Präsidenten Nixon, Ford und Clinton fürchtet um die Balance zwischen Wirtschaft und Staat in Amerika, oder besser: dass sich diese Balance zu Gunsten eines starken Staates verschiebt.
Kontrolle statt Deregulierung, Sicherheit statt Freiheit, so analysiert Jeffrey Garten, seien die unabweisbaren Folgen der Terroranschläge. Das Streben nach "nationaler Sicherheit könnte alles andere verdrängen", fürchtet der Autor. Sehr groß ist seine Sorge, nach zwei Jahrzehnten der Deregulierung und Privatisierung, nach rund 20 Jahren Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der immer engeren internationalen Verflechtung und Zusammenarbeit könnte das Pendel nun zu stark in Richtung Staat ausschlagen.
In dieser Situation müsse die Wirtschaftselite ihre Stimme erheben, um das Schlimmste zu verhindern. Garten plädiert für ein "Public-Private Partnership" neuen Stils. Die Manager sollten als Partner und Berater der Politik fungieren. Doch die neue Rolle kommt für Amerikas Manager zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Denn nach den Skandal um gefälschte Bilanzen und um Millionengehälter für unfähige Manager, nach dem Kurssturz an den Börsen, bei dem die Aktionäre Milliarden verloren haben, ist die Reputation von Amerikas Top-Managern dahin und ihr Rat in Schicksalsfragen der Nation nicht mehr unbedingt gefragt.
Zuerst müssten Amerikas Manager daher ihren eigenen Laden in Ordnung bringen, wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit wiedergewinnen wollen, empfiehlt Garten. Seine Problemanalyse ist schlüssig, die Lösungen, die er anbietet, nicht immer - zumindest nicht für europäische Leser. Aus Sicht der Europäer überrascht es schon, welche große Rolle Garten Unternehmenschefs im politischen Willensbildungsprozess einräumen will. Parteien, Parlamente, gewählte Abgeordnete oder auch Verbände, die die Interessen der Wirtschaft artikulieren, kommen in Gartens Weltsicht gar nicht vor.
Stattdessen appelliert der Yale-Professor an den Gutmenschen im Manager, orientierungslosen Politikern in einer schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Statt sich auf Golfplätzen und Segelyachten die Zeit tot zu schlagen, könnten frühpensionierte Unternehmenslenker sich ja auch in den Dienst des Staates stellen, schlägt Garten ganz pragmatisch vor. Wie die neue Partnerschaft zwischen Managern und Politikern, Wirtschaft und Staat konkret aussehen soll, bleibt in Gartens Welt allerdings ausgesprochen diffus.
Jeffrey E. Garten: The Politics of Fortune - A new Agenda for Business Leaders, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2002, 24,95 Dollar
Artikel erschienen am 28. Jun 2003
Freitag, 27. Juni 2003
13. Zinsschritt
von unserem Korrespondenten Eric Fry in New York City
Zuerst hat die Fed die Zinsen gesenkt – dann haben die Investoren die Kurse am Aktienmarkt gesenkt. Der Dow Jones hatte sich bis unmittelbar vor der Zinsentscheidung im positiven Territorium bewegt – danach sackte er um fast 100 Punkte ab. Auch die Anleihenkurse kamen zurück, bei den 10jährigen Anleihen stieg die Rendite von 3,25 % au 3,33 %. Jetzt, wo die Anleihenkurse von den olympischen Höhen, die sie zu Monatsbeginn erreicht hatten, wieder herunterkommen, sieht der Bullenmarkt am Anleihenmarkt zunehmend verletzlich aus. Ist der scheinbar unsterbliche Anleihen-Bullenmarkt letztlich doch sterblich?
"Unserer Ansicht nach ist die Rally am Anleihenmarkt zu weit und zu schnell gelaufen", so Donald H. Straszheim von Straszheim Global Advisors. "Das sieht so aus wie der Nasdaq-Sprint von den späten 1990ern bis Anfang 2000 ... und bei den Anleihen fiel danach die Rendite von Februar 2000 bis Juni 2003 von 6,76 % auf 2,08 %, was ein Rückgang von 68 % ist ... wenn sich die Stimmung plötzlich gegen Anleihen richten sollte, dann wird es einen Run auf die Ausgänge geben, und viele Investoren werden überrannt werden."
Wie ein schlechter Punsch schaffen es die Zinssenkungen von Alan Greenspan nicht, den gewünschten Effekt zu produzieren. Die Wirtschaft zuckt nur mit den Schultern und starrt abwesend auf die Ein-Mann Geldshow des Fed-Vorsitzenden. 13 Mal seit Januar 2001 hat er die Leitzinsen gesenkt. Was haben 13 Zinssenkungen geschafft? Die Antwort – tada! – GAR NICHTS ... außer einem Heißlaufen des US-Immobilienmarktes. Wirtschaftswachstum hingegen: Fehlanzeige.
Seit 1958 sind die kurzfristigen Zinssätze in den USA nicht mehr so niedrig gewesen wie jetzt. Und seit 1958 waren Zinssenkungen nicht mehr so wirkungslos – oder vielleicht gilt dies sogar seit 1858. Was haben all diese Zinssenkungen Gutes erreicht? Ist die Wirtschaft stärker geworden? Sind die TV-Serien lustiger geworden?
Das einzige, was ich mit Sicherheit über den 13. Zinsschritt der Fed sagen kann, ist, dass die Zinsen jetzt niedriger sind als vor 13 Zinssenkungen. Aber die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind bestenfalls dubios.
Nicht dass man einen neuen Grund brauchen würde, um überbewertete Aktien ohne Gewinnwachstum verkaufen zu können, aber das Offenmarktkomitee der Fed (FOMC) präsentierte am Mittwoch einen soliden Grund: "Die Wirtschaft ... muss noch nachhaltiges Wachstum zeigen ( ...) Die Risiken beim Wachstum nach oben und nach unten sind für die nächsten Quartale ungefähr gleich groß."
Der Wirtschaft mag nachhaltiges Wachstum fehlen, aber ihr fehlt kein unnachhaltiges Wachstum. Nehmen Sie nur den US-Immobilienmarkt. Die Verkäufe neuer Häuser sind im Mai um 12,5 % explodiert – das ist der größte monatliche Sprung seit September 1993. Es sieht so aus, als ob die Leute immer noch Häusern und Technologieaktien kaufen, obwohl die amerikanischen Unternehmen sich immer noch weigern, Geld zu investieren.
Die Staatsausgaben scheinen in die Kategorie "unhaltbar" zu fallen. John Myers vom Resource "erwartet auf jeden Fall, dass das amerikanische Finanzministerium und die Fed weiterhin – wie die Imperien vor ihnen – die Zahl der sich im Umlauf befindlichen Dollar erhöhen werden. Hinzu kommt, dass die Ausländer rapide ihre Investments aus dem Dollarraum abziehen, was für den Dollar eine Katastrophe sein könnte – und für die amerikanischen Aktien- und Anleihenmärkte."
"Und, oh ja", so Myers weiter, "das würde die Kurse der Edelmetalle in die Stratosphäre katapultieren."
Die Auftragseingänge für dauerhafte Güter sind in den USA im Mai um 0,3 % gefallen – der dritte Rückgang in den letzten 4 Monaten. Aber man sollte sich wegen der Verkäufe dauerhafter Güter nicht zu viele sorgen machen. Wir sollten bedenken, dass Alan Greenspan im Mai die Zinsen erst 12 Mal gesenkt hatte. Der 13. Zinsschritt, der wirklich die Lage verbessern wird, hatte da ja noch nicht stattgefunden.
Und wenn auch der 13. Zinsschritt nicht wirkt ... warten Sie ab, bis Sie Nummer 14 sehen! Irgendwann wird es Alan Greenspan hinbekommen.
Quelle: www.investorverlag.de

13. Zinsschritt
von unserem Korrespondenten Eric Fry in New York City
Zuerst hat die Fed die Zinsen gesenkt – dann haben die Investoren die Kurse am Aktienmarkt gesenkt. Der Dow Jones hatte sich bis unmittelbar vor der Zinsentscheidung im positiven Territorium bewegt – danach sackte er um fast 100 Punkte ab. Auch die Anleihenkurse kamen zurück, bei den 10jährigen Anleihen stieg die Rendite von 3,25 % au 3,33 %. Jetzt, wo die Anleihenkurse von den olympischen Höhen, die sie zu Monatsbeginn erreicht hatten, wieder herunterkommen, sieht der Bullenmarkt am Anleihenmarkt zunehmend verletzlich aus. Ist der scheinbar unsterbliche Anleihen-Bullenmarkt letztlich doch sterblich?
"Unserer Ansicht nach ist die Rally am Anleihenmarkt zu weit und zu schnell gelaufen", so Donald H. Straszheim von Straszheim Global Advisors. "Das sieht so aus wie der Nasdaq-Sprint von den späten 1990ern bis Anfang 2000 ... und bei den Anleihen fiel danach die Rendite von Februar 2000 bis Juni 2003 von 6,76 % auf 2,08 %, was ein Rückgang von 68 % ist ... wenn sich die Stimmung plötzlich gegen Anleihen richten sollte, dann wird es einen Run auf die Ausgänge geben, und viele Investoren werden überrannt werden."
Wie ein schlechter Punsch schaffen es die Zinssenkungen von Alan Greenspan nicht, den gewünschten Effekt zu produzieren. Die Wirtschaft zuckt nur mit den Schultern und starrt abwesend auf die Ein-Mann Geldshow des Fed-Vorsitzenden. 13 Mal seit Januar 2001 hat er die Leitzinsen gesenkt. Was haben 13 Zinssenkungen geschafft? Die Antwort – tada! – GAR NICHTS ... außer einem Heißlaufen des US-Immobilienmarktes. Wirtschaftswachstum hingegen: Fehlanzeige.
Seit 1958 sind die kurzfristigen Zinssätze in den USA nicht mehr so niedrig gewesen wie jetzt. Und seit 1958 waren Zinssenkungen nicht mehr so wirkungslos – oder vielleicht gilt dies sogar seit 1858. Was haben all diese Zinssenkungen Gutes erreicht? Ist die Wirtschaft stärker geworden? Sind die TV-Serien lustiger geworden?
Das einzige, was ich mit Sicherheit über den 13. Zinsschritt der Fed sagen kann, ist, dass die Zinsen jetzt niedriger sind als vor 13 Zinssenkungen. Aber die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind bestenfalls dubios.
Nicht dass man einen neuen Grund brauchen würde, um überbewertete Aktien ohne Gewinnwachstum verkaufen zu können, aber das Offenmarktkomitee der Fed (FOMC) präsentierte am Mittwoch einen soliden Grund: "Die Wirtschaft ... muss noch nachhaltiges Wachstum zeigen ( ...) Die Risiken beim Wachstum nach oben und nach unten sind für die nächsten Quartale ungefähr gleich groß."
Der Wirtschaft mag nachhaltiges Wachstum fehlen, aber ihr fehlt kein unnachhaltiges Wachstum. Nehmen Sie nur den US-Immobilienmarkt. Die Verkäufe neuer Häuser sind im Mai um 12,5 % explodiert – das ist der größte monatliche Sprung seit September 1993. Es sieht so aus, als ob die Leute immer noch Häusern und Technologieaktien kaufen, obwohl die amerikanischen Unternehmen sich immer noch weigern, Geld zu investieren.
Die Staatsausgaben scheinen in die Kategorie "unhaltbar" zu fallen. John Myers vom Resource "erwartet auf jeden Fall, dass das amerikanische Finanzministerium und die Fed weiterhin – wie die Imperien vor ihnen – die Zahl der sich im Umlauf befindlichen Dollar erhöhen werden. Hinzu kommt, dass die Ausländer rapide ihre Investments aus dem Dollarraum abziehen, was für den Dollar eine Katastrophe sein könnte – und für die amerikanischen Aktien- und Anleihenmärkte."
"Und, oh ja", so Myers weiter, "das würde die Kurse der Edelmetalle in die Stratosphäre katapultieren."
Die Auftragseingänge für dauerhafte Güter sind in den USA im Mai um 0,3 % gefallen – der dritte Rückgang in den letzten 4 Monaten. Aber man sollte sich wegen der Verkäufe dauerhafter Güter nicht zu viele sorgen machen. Wir sollten bedenken, dass Alan Greenspan im Mai die Zinsen erst 12 Mal gesenkt hatte. Der 13. Zinsschritt, der wirklich die Lage verbessern wird, hatte da ja noch nicht stattgefunden.
Und wenn auch der 13. Zinsschritt nicht wirkt ... warten Sie ab, bis Sie Nummer 14 sehen! Irgendwann wird es Alan Greenspan hinbekommen.
Quelle: www.investorverlag.de

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,254718,00.html
NEUE VISIONEN
Die Internet-Milliardäre und ihre Raumschiffe
Von Marc Pitzke, New York
Jeff Bezos, milliardenschwerer Chef des Online-Versandhauses Amazon.com, hat noch Träume. Insgeheim lässt er sich eine eigene Weltraumfähre bauen, um damit die anderen Superreichen im Silicon Valley zu übertrumpfen.
New York - Die Stellenausschreibung ist kurz und prägnant. Vier Grundqualifikationen werden darin aufgelistet: Der Bewerber muss "in einer kleinen Firma arbeiten wollen", "ein Bastler sein" und "zu den technisch Begabtesten seines Feldes zählen". Und, nicht zu vergessen, "eine ehrliche Leidenschaft für den Weltraum haben". Blue Origin LLC heißt das mysteriöse Unternehmen, das über seine tiefblaue Website um Experten in "Flugmechanik, Avionics, GNC-Software und Systemintegration" wirbt. Deren Job werde es sein, "Raumschiffe und Abschussvorrichtungen" zu entwickeln - "mit dem Endziel, zu einer dauerhaften Präsenz des Menschen im All beizutragen". Und zwar, wie es weiter selbstbewusst heißt, sicher und billig.
Strengste Geheimhaltung
Sicher, billig und - anders als die Regierungsbehörde Nasa - privat. Der Kopf und Finanzier hinter der Firma, die ihren Sitz in einem Warenhaus in Seattle hat, ist der schwerreiche Online-Pionier Jeff Bezos. Dessen Internet-Versandhaus Amazon.com machte 2002 knapp vier Milliarden Dollar Umsatz und katapultierte seinen jungen Gründer und CEO damit auf die "Forbes"-Liste der 100 reichsten Amerikaner.
Nun steht dem 39-jährigen Selfmade-Milliardär der Sinn nach unendlichen Weiten anderer Art. Offiziell will er nicht über seinen Ablegers Blue Origin reden: "Jeder Kommentar wäre verfrüht." Dennoch sickern immer mehr Details über das Unterfangen durch.
Blue Origin, im Jahr 2000 unauffällig gegründet und bis heute nur unter seinem Alias Blue Operations im Telefonbuch zu finden, beschäftigt längst ein paar Dutzend hochkarätige Experten: Physiker, frühere Nasa-Leute, Erfinder, selbst den Science-Fiction-Kultautor Neal Stephenson ("Cryptonomicon" ) ist mit von der Partie. Um das Thema "Aerospace" kümmert sich beispielsweise Jim French, der in den achtziger Jahren für das Jet Propulsion Laboratory der Nasa arbeitete. Chefingenieur Tomas Svitek sammelte bei den Weltraum-Start-ups Transorbital und Blastoff einschlägige Erfahrung. Amazon-Vizepräsident und Chefjustitiar Alan Caplan kümmert sich bei Blue Origin um Patentfragen.
Unter strengster Geheimhaltung werkelt das Team an einem neuartigen Raketen- und Antriebssystem, das schon innerhalb der nächsten Jahre eine wieder verwendbare, landefähige Weltraumfähre mit bis zu sieben Menschen an Bord ins All schießen soll. Das futuristische Gerät hat sogar schon einen Namen: "New Shepard" - ein Tribut an Alan Shepard, den ersten Amerikaner im All.
214 Milliarden Dollar Gewinn
Wie ernst es Bezos ist, erschließt sich bei einem kurzen Blick in seine Biografie. Sein Großvater forschte in der Weltraumtechnologie. Bezos selbst war schon als Kind fasziniert von futuristischen Erfindungen. Aus einem Spielzeugroboter und einem kaputten Regenschirm baute er ein "solares Kochgerät", einen Hoover-Staubsauger verwandelte er in ein Hoover-Luftkissenfahrzeug.
Er wollte Astronaut werden - nein, "Weltraum-Unternehmer", erinnert sich sein einstiger Lehrer Bill McCreary. In seiner High-School-Abschlussrede in Miami prophezeite Bezos 1982 die Kolonialisierung des Alls, auf dass die Zukunft der Menschheit gesichert werde. Als eine ehemalige Schulfreundin vor ein paar Jahren juxte, er habe Amazon nur gegründet, um genug Geld für seine persönliche Weltraumstation zu sammeln, erwiderte Bezos sybillinisch: "Ich fände es nicht schlecht, dabei mitzuhelfen."
"New Shepard" soll offenbar nur der Anfang sein. Kürzlich ließ sich Bezos von Wissenschaftlern des California Institutes for Technology das Konzept der privaten Space Station "Heliopolis" präsentieren. Demnach soll "Heliopolis" ein "profitabler, selbständiger Stützpunkt der Menschheit im All" werden. Zu erbauen bis zum Jahr 2039, werde das Projekt nach Abgeltung der Investitionskosten von 105 Milliarden Dollar 214 Milliarden Dollar Gewinn abwerfen - pro Jahr. Dafür sollen "Tourismus, Asteroiden-Bergbau und künftige Weltraum-Abenteuer" sorgen.
-------
Ob Aktionäre Freiflüge bekommen?
NEUE VISIONEN
Die Internet-Milliardäre und ihre Raumschiffe
Von Marc Pitzke, New York
Jeff Bezos, milliardenschwerer Chef des Online-Versandhauses Amazon.com, hat noch Träume. Insgeheim lässt er sich eine eigene Weltraumfähre bauen, um damit die anderen Superreichen im Silicon Valley zu übertrumpfen.
New York - Die Stellenausschreibung ist kurz und prägnant. Vier Grundqualifikationen werden darin aufgelistet: Der Bewerber muss "in einer kleinen Firma arbeiten wollen", "ein Bastler sein" und "zu den technisch Begabtesten seines Feldes zählen". Und, nicht zu vergessen, "eine ehrliche Leidenschaft für den Weltraum haben". Blue Origin LLC heißt das mysteriöse Unternehmen, das über seine tiefblaue Website um Experten in "Flugmechanik, Avionics, GNC-Software und Systemintegration" wirbt. Deren Job werde es sein, "Raumschiffe und Abschussvorrichtungen" zu entwickeln - "mit dem Endziel, zu einer dauerhaften Präsenz des Menschen im All beizutragen". Und zwar, wie es weiter selbstbewusst heißt, sicher und billig.
Strengste Geheimhaltung
Sicher, billig und - anders als die Regierungsbehörde Nasa - privat. Der Kopf und Finanzier hinter der Firma, die ihren Sitz in einem Warenhaus in Seattle hat, ist der schwerreiche Online-Pionier Jeff Bezos. Dessen Internet-Versandhaus Amazon.com machte 2002 knapp vier Milliarden Dollar Umsatz und katapultierte seinen jungen Gründer und CEO damit auf die "Forbes"-Liste der 100 reichsten Amerikaner.
Nun steht dem 39-jährigen Selfmade-Milliardär der Sinn nach unendlichen Weiten anderer Art. Offiziell will er nicht über seinen Ablegers Blue Origin reden: "Jeder Kommentar wäre verfrüht." Dennoch sickern immer mehr Details über das Unterfangen durch.
Blue Origin, im Jahr 2000 unauffällig gegründet und bis heute nur unter seinem Alias Blue Operations im Telefonbuch zu finden, beschäftigt längst ein paar Dutzend hochkarätige Experten: Physiker, frühere Nasa-Leute, Erfinder, selbst den Science-Fiction-Kultautor Neal Stephenson ("Cryptonomicon" ) ist mit von der Partie. Um das Thema "Aerospace" kümmert sich beispielsweise Jim French, der in den achtziger Jahren für das Jet Propulsion Laboratory der Nasa arbeitete. Chefingenieur Tomas Svitek sammelte bei den Weltraum-Start-ups Transorbital und Blastoff einschlägige Erfahrung. Amazon-Vizepräsident und Chefjustitiar Alan Caplan kümmert sich bei Blue Origin um Patentfragen.
Unter strengster Geheimhaltung werkelt das Team an einem neuartigen Raketen- und Antriebssystem, das schon innerhalb der nächsten Jahre eine wieder verwendbare, landefähige Weltraumfähre mit bis zu sieben Menschen an Bord ins All schießen soll. Das futuristische Gerät hat sogar schon einen Namen: "New Shepard" - ein Tribut an Alan Shepard, den ersten Amerikaner im All.
214 Milliarden Dollar Gewinn
Wie ernst es Bezos ist, erschließt sich bei einem kurzen Blick in seine Biografie. Sein Großvater forschte in der Weltraumtechnologie. Bezos selbst war schon als Kind fasziniert von futuristischen Erfindungen. Aus einem Spielzeugroboter und einem kaputten Regenschirm baute er ein "solares Kochgerät", einen Hoover-Staubsauger verwandelte er in ein Hoover-Luftkissenfahrzeug.
Er wollte Astronaut werden - nein, "Weltraum-Unternehmer", erinnert sich sein einstiger Lehrer Bill McCreary. In seiner High-School-Abschlussrede in Miami prophezeite Bezos 1982 die Kolonialisierung des Alls, auf dass die Zukunft der Menschheit gesichert werde. Als eine ehemalige Schulfreundin vor ein paar Jahren juxte, er habe Amazon nur gegründet, um genug Geld für seine persönliche Weltraumstation zu sammeln, erwiderte Bezos sybillinisch: "Ich fände es nicht schlecht, dabei mitzuhelfen."
"New Shepard" soll offenbar nur der Anfang sein. Kürzlich ließ sich Bezos von Wissenschaftlern des California Institutes for Technology das Konzept der privaten Space Station "Heliopolis" präsentieren. Demnach soll "Heliopolis" ein "profitabler, selbständiger Stützpunkt der Menschheit im All" werden. Zu erbauen bis zum Jahr 2039, werde das Projekt nach Abgeltung der Investitionskosten von 105 Milliarden Dollar 214 Milliarden Dollar Gewinn abwerfen - pro Jahr. Dafür sollen "Tourismus, Asteroiden-Bergbau und künftige Weltraum-Abenteuer" sorgen.
-------
Ob Aktionäre Freiflüge bekommen?

Augen auf  ..........
..........
Calif. Near Financial Disaster
Hours Remain to Solve $38 Billion Shortfall
By Rene Sanchez
Washington Post Staff Writer
Monday, June 30, 2003; Page A01
LOS ANGELES -- Any day now, community colleges here may begin telling faculty members that they cannot be paid and students that summer classes are canceled.
Nursing homes are losing so much state aid that many soon may have to shut down or limit their services, a prospect that has elderly residents confused and frightened.
As many as 30,000 government workers who had been expecting pay raises in the fall are instead receiving formal notices warning that they could lose their jobs by then, because the state is broke.
This is life in California, on the brink of a fiscal disaster.
The nation`s most populous state, home to one of the world`s largest economies, has been staring in disbelief at the same dire predicament for months: a $38 billion deficit, the largest shortfall in its history and an extreme example of the budget woes afflicting many states. But now it has only hours left to solve the problem.
State lawmakers have until midnight to reach a compromise with Gov. Gray Davis (D) on a budget that would wipe out the enormous deficit, but the odds of that happening appear slim. And without a deal, the state will be bound by law to begin cutting off billions of dollars in payments to its agencies and its contractors in July -- and could run out of money by August.
"It looks bleak," said Perry Kenny, president of the California State Employees Association, which represents more than 100,000 government workers. "This is the biggest hole we`ve ever been in, and no one can seem to find a way out. We`re all sweating bullets here."
For weeks, the state`s budget has been hostage to an intensely partisan political war over taxes and spending that is now getting even more bitter and complicated because of a Republican-led campaign to recall Davis from office. Organizers of that movement have collected nearly 400,000 voter petitions in favor of ousting the governor, and political strategists in both parties say a recall election, which would be unprecedented, is looking ever more likely.
Davis and the Democrats who control both houses of California`s legislature cannot get their way on the budget because state law requires a two-thirds majority vote for it to be approved. They need a few Republican lawmakers to support their plan, which they say must include new taxes in order to save public schools and other vital programs from ruin.
But Republicans are refusing to consider any tax increase, which they say would harm California`s already weak economy, and are demanding deeper cuts in government spending.
There is no end in sight to the impasse, which California voters are watching with increasing exasperation. Polls show that public support for Davis has plummeted below 25 percent, and that two-thirds of voters are dismayed with the legislature.
Republican lawmakers say they will not budge from their stand on the budget because they are fed up with Davis`s governing style.
"He and his allies have gotten the last three budgets they wanted and we`re nearly bankrupt," said James L. Brulte, the Republican leader in the state Senate, who has threatened to work against the reelection of any GOP colleague who sides with Davis in the budget battle. "Somebody has to stand up and say enough is enough. That`s what Republicans in California are doing."
But Democrats see other motives. Some are accusing GOP lawmakers of deliberately dragging their feet on the budget in the hope that will hurt Davis politically and strengthen the recall campaign.
"It`s hard to take Republicans seriously when they say they want a real solution to this budget crisis at the same time some of them are openly backing the recall," said Roger Salazar, a political adviser to Davis. "They are putting important state programs at risk just out of pure political spite."
Democrats have retreated recently from some tax proposals but are insisting on a half-cent sales tax increase. Several dozen Democratic legislators even barnstormed Republican districts around the state last week to plead for support but got mostly hostile receptions.
Davis, who left the state this weekend to attend his mother`s 80th birthday celebration in New York, is still expressing optimism that a budget deal can be reached soon, if not by tonight`s constitutional deadline.
"I am doing everything I can to encourage, cajole, persuade, guilt-trip and all the things you do to try to make this happen," he told reporters last week.
California`s $38 billion deficit is larger than the entire annual budget of any other state except New York. It represents about one-third of the state`s annual spending.
As in many other states, the shortfall is largely the result of the national economic downturn -- which has been especially severe in Silicon Valley, an engine of California`s $1.3 trillion economy. Soaring health care costs for the poor and new expenses for homeland security are other contributing factors. Republicans here also contend that Davis, who was narrowly elected to a second term in November, has spent recklessly while in office and relied on accounting gimmicks to balance the budget last year.
California, which had a $9 billion budget surplus three years ago, is constantly caught in boom-or-bust economic cycles. In the early 1990s, Republican Gov. Pete Wilson had to raise taxes and cut spending to erase a $14 billion deficit. Escaping this crisis will be far more difficult and painful.
To close the $38 billion deficit, state leaders have approved $7 billion in cuts affecting virtually every government program. They have borrowed $11 billion to keep California solvent through the summer. Earlier this month, risking the wrath of voters, they tripled the annual state tax on vehicles, a $136 increase for most motorists. But that still is not enough to balance the budget.
Now, with time to find a solution running out, state Controller Steve Westly is warning that as early as Tuesday more than a billion dollars in payments due to state agencies, medical providers and private companies that contract with California must be stopped.
"This is going to be real hurt for the state of California," he told reporters a few days ago, "and the problem gets worse every day we go without a budget."
Some public institutions already are reeling. The Los Angeles Community College District, which enrolls 130,000 students, has been forced to eliminate classes and lay off some of its faculty, and is on the verge of raising tuition by more than 50 percent because of the budget crisis. Thousands of students have dropped out because of cutbacks this year, college officials say, and more are likely to leave if additional classes are canceled.
Mark Drummond, the chancellor of the district, said that its network of colleges has enough money to operate until August, but would not be able to pay its vendors or its faculty if the state is still engulfed in deficits by then.
"We could have to turn off the lights and tell everybody to go home," Drummond said.
Nursing homes are suffering the same plight. Some already have stopped receiving all the payments they had been expecting from the state and are cutting back services to their residents and turning away new patients. If more cuts are approved, or if the budget gridlock doesn`t end soon, dozens of homes could go bankrupt and close.
Betsy Hite, spokeswoman for the California Association of Health Facilities, said many elderly residents are baffled and despondent over the looming hardships.
"They see what`s going on in the newspapers and on TV," she said. "Their perspective is, why are they doing this to us? What did we do?
"If I were a betting person, I wouldn`t bet we`re going to be fine," Hite added. "The gap is just too huge."
Special correspondent Kimberly Edds contributed to this report.
The Washington Post Company
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A48925-2003Jun29?la…
Argentinien befindet sich in Kalifornien, nicht ?
?
syr
 ..........
..........Calif. Near Financial Disaster
Hours Remain to Solve $38 Billion Shortfall
By Rene Sanchez
Washington Post Staff Writer
Monday, June 30, 2003; Page A01
LOS ANGELES -- Any day now, community colleges here may begin telling faculty members that they cannot be paid and students that summer classes are canceled.
Nursing homes are losing so much state aid that many soon may have to shut down or limit their services, a prospect that has elderly residents confused and frightened.
As many as 30,000 government workers who had been expecting pay raises in the fall are instead receiving formal notices warning that they could lose their jobs by then, because the state is broke.
This is life in California, on the brink of a fiscal disaster.
The nation`s most populous state, home to one of the world`s largest economies, has been staring in disbelief at the same dire predicament for months: a $38 billion deficit, the largest shortfall in its history and an extreme example of the budget woes afflicting many states. But now it has only hours left to solve the problem.
State lawmakers have until midnight to reach a compromise with Gov. Gray Davis (D) on a budget that would wipe out the enormous deficit, but the odds of that happening appear slim. And without a deal, the state will be bound by law to begin cutting off billions of dollars in payments to its agencies and its contractors in July -- and could run out of money by August.
"It looks bleak," said Perry Kenny, president of the California State Employees Association, which represents more than 100,000 government workers. "This is the biggest hole we`ve ever been in, and no one can seem to find a way out. We`re all sweating bullets here."
For weeks, the state`s budget has been hostage to an intensely partisan political war over taxes and spending that is now getting even more bitter and complicated because of a Republican-led campaign to recall Davis from office. Organizers of that movement have collected nearly 400,000 voter petitions in favor of ousting the governor, and political strategists in both parties say a recall election, which would be unprecedented, is looking ever more likely.
Davis and the Democrats who control both houses of California`s legislature cannot get their way on the budget because state law requires a two-thirds majority vote for it to be approved. They need a few Republican lawmakers to support their plan, which they say must include new taxes in order to save public schools and other vital programs from ruin.
But Republicans are refusing to consider any tax increase, which they say would harm California`s already weak economy, and are demanding deeper cuts in government spending.
There is no end in sight to the impasse, which California voters are watching with increasing exasperation. Polls show that public support for Davis has plummeted below 25 percent, and that two-thirds of voters are dismayed with the legislature.
Republican lawmakers say they will not budge from their stand on the budget because they are fed up with Davis`s governing style.
"He and his allies have gotten the last three budgets they wanted and we`re nearly bankrupt," said James L. Brulte, the Republican leader in the state Senate, who has threatened to work against the reelection of any GOP colleague who sides with Davis in the budget battle. "Somebody has to stand up and say enough is enough. That`s what Republicans in California are doing."
But Democrats see other motives. Some are accusing GOP lawmakers of deliberately dragging their feet on the budget in the hope that will hurt Davis politically and strengthen the recall campaign.
"It`s hard to take Republicans seriously when they say they want a real solution to this budget crisis at the same time some of them are openly backing the recall," said Roger Salazar, a political adviser to Davis. "They are putting important state programs at risk just out of pure political spite."
Democrats have retreated recently from some tax proposals but are insisting on a half-cent sales tax increase. Several dozen Democratic legislators even barnstormed Republican districts around the state last week to plead for support but got mostly hostile receptions.
Davis, who left the state this weekend to attend his mother`s 80th birthday celebration in New York, is still expressing optimism that a budget deal can be reached soon, if not by tonight`s constitutional deadline.
"I am doing everything I can to encourage, cajole, persuade, guilt-trip and all the things you do to try to make this happen," he told reporters last week.
California`s $38 billion deficit is larger than the entire annual budget of any other state except New York. It represents about one-third of the state`s annual spending.
As in many other states, the shortfall is largely the result of the national economic downturn -- which has been especially severe in Silicon Valley, an engine of California`s $1.3 trillion economy. Soaring health care costs for the poor and new expenses for homeland security are other contributing factors. Republicans here also contend that Davis, who was narrowly elected to a second term in November, has spent recklessly while in office and relied on accounting gimmicks to balance the budget last year.
California, which had a $9 billion budget surplus three years ago, is constantly caught in boom-or-bust economic cycles. In the early 1990s, Republican Gov. Pete Wilson had to raise taxes and cut spending to erase a $14 billion deficit. Escaping this crisis will be far more difficult and painful.
To close the $38 billion deficit, state leaders have approved $7 billion in cuts affecting virtually every government program. They have borrowed $11 billion to keep California solvent through the summer. Earlier this month, risking the wrath of voters, they tripled the annual state tax on vehicles, a $136 increase for most motorists. But that still is not enough to balance the budget.
Now, with time to find a solution running out, state Controller Steve Westly is warning that as early as Tuesday more than a billion dollars in payments due to state agencies, medical providers and private companies that contract with California must be stopped.
"This is going to be real hurt for the state of California," he told reporters a few days ago, "and the problem gets worse every day we go without a budget."
Some public institutions already are reeling. The Los Angeles Community College District, which enrolls 130,000 students, has been forced to eliminate classes and lay off some of its faculty, and is on the verge of raising tuition by more than 50 percent because of the budget crisis. Thousands of students have dropped out because of cutbacks this year, college officials say, and more are likely to leave if additional classes are canceled.
Mark Drummond, the chancellor of the district, said that its network of colleges has enough money to operate until August, but would not be able to pay its vendors or its faculty if the state is still engulfed in deficits by then.
"We could have to turn off the lights and tell everybody to go home," Drummond said.
Nursing homes are suffering the same plight. Some already have stopped receiving all the payments they had been expecting from the state and are cutting back services to their residents and turning away new patients. If more cuts are approved, or if the budget gridlock doesn`t end soon, dozens of homes could go bankrupt and close.
Betsy Hite, spokeswoman for the California Association of Health Facilities, said many elderly residents are baffled and despondent over the looming hardships.
"They see what`s going on in the newspapers and on TV," she said. "Their perspective is, why are they doing this to us? What did we do?
"If I were a betting person, I wouldn`t bet we`re going to be fine," Hite added. "The gap is just too huge."
Special correspondent Kimberly Edds contributed to this report.
The Washington Post Company
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A48925-2003Jun29?la…
Argentinien befindet sich in Kalifornien, nicht
 ?
?syr
Eine kleine Geschichtsstunde  ...
...


http://www.mises.org/markets/shostak6-18-03.pdf
Wie sich doch die Bilder gleichen ..
..
syr
 ...
...
http://www.mises.org/markets/shostak6-18-03.pdf
Wie sich doch die Bilder gleichen
 ..
..syr
Zu Kalifornien. Damit die "Grösse" ersichtlich wird  ....
....
CALIFORNIA`S WORLD RANKING
2001 GROSS PRODUCT
Rank, Countries, ($ billions)
1 UNITED STATES, $10,171
2 Japan, 4,245
3 Germany, 1,874
4 United Kingdom, 1,406
5 CALIFORNIA, 1,359
 ....
....
6 France, 1,303
7 China (excluding Hong Kong), 1,159
8 Italy, 1,091
9 Canada, 677
10 Mexico, 618
*source World Bank
http://news.goldseek.com/Chaos-onomics/1057074869.php
syr
 ....
....CALIFORNIA`S WORLD RANKING
2001 GROSS PRODUCT
Rank, Countries, ($ billions)
1 UNITED STATES, $10,171
2 Japan, 4,245
3 Germany, 1,874
4 United Kingdom, 1,406
5 CALIFORNIA, 1,359

 ....
....6 France, 1,303
7 China (excluding Hong Kong), 1,159
8 Italy, 1,091
9 Canada, 677
10 Mexico, 618
*source World Bank
http://news.goldseek.com/Chaos-onomics/1057074869.php
syr

!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
syr
sachen gibts, waa?
sachen gibts, waa?

USA planen städtisches Überwachungssystem
Die USA planen einen System, mit dem die Bewegungen jedes Fahrzeugs in einer Stadt automatisch verfolgt werden können.
Das System "Combat Zones That See" (CTS, "Gefechtsgebiete, die sehen" ) soll nach einer Beschreibung (Adobe Acrobat-Datei) der DARPA die Wege jedes Fahrzeugs in einem Gebiet aufzeichnen, verfolgen und analysieren können.
Die Fahrzeuge sollen dabei über äußere Merkmale wie Farbe, Modell und Kennzeichen ebenso identifiziert werden wie über eine Gesichtserkennung der Insassen.
Die DARPA-Sprecherin sagte zwar, daß die CTS-Technologie nicht für den Einsatz bei der inneren Sicherheit oder der Polizei vorgesehen sei und daß ein Einsatz für "andere Anwendungsgebiete nicht ohne tiefgreifende Veränderungen" möglich sei, es dürfte aber sicher sein, daß das System, wenn es einsatzbereit ist, Begehrlichkeiten bei Polizei und Geheimdiensten weckt.
Die Behauptung, daß das System nur für den Einsatz in Kampfgebieten gedacht ist um Soldaten besser vor Bedrohungen zu schützen, scheint bei näherem Hinschauen zweifelhaft. Da das CTS auf tausenden von kleinen Kameras aufbaut, mit denen Fahrzeugbewegungen aufgezeichnet werden, setzt es eine relativ friedliche Gegend oder die Anwesenheit von US-Soldaten voraus, da der Gegner die Kameras andernfalls sicherlich zerstören würde.
Ein Anbringung an kleinen Flugkörpern wäre zwar theoretisch möglich, würde die Kosten aber in die Höhe treiben und die Erkennung von Nummernschildern und Gesichtern extrem erschweren.
Da die Kameras also nur in bereits besetzten Gebieten eingesetzt werden könnten, wären sie allenfalls in Fällen wie im Irak oder in Afghanistan einsetzbar, wo sich eine Besatzungsmacht ständigen Guerillaangriffen ausgesetzt sieht.
Auf der anderen Seite wäre eine Ankopplung aller vorhandenen Überwachungskameras westlicher Innenstädte an ein zentrales System, das diese Bilder automatisch auswertet sicherlich der Traum vieler Gruppen. Die Argumentation gegenüber der Bevölkerung dürfte ähnlich ausfallen wie bei der bisherigen "manuellen" Überwachung und würde vermutlich auf ebenso geringen Widerstand stoßen.
Hiermit wäre dann eine lückenlose Verfolgung aller Bürger innerhalb einer Stadt möglich, wobei diese Bewegungsprofile auch auf Jahre gespeichert werden könnte - und würden.
Stellt sich also nur die Frage, ob der militärische Einsatz nur ein Vorwand ist, um ein System zur Überwachung der Bevölkerung zu entwickeln, oder ob die USA sich bereits auf die Eroberung und Besetzung weiterer Staaten vorbereiten.
-----
Kriegswirtschaft und Überwachungsstaat - ja, das ist Amerika!
Die USA planen einen System, mit dem die Bewegungen jedes Fahrzeugs in einer Stadt automatisch verfolgt werden können.
Das System "Combat Zones That See" (CTS, "Gefechtsgebiete, die sehen" ) soll nach einer Beschreibung (Adobe Acrobat-Datei) der DARPA die Wege jedes Fahrzeugs in einem Gebiet aufzeichnen, verfolgen und analysieren können.
Die Fahrzeuge sollen dabei über äußere Merkmale wie Farbe, Modell und Kennzeichen ebenso identifiziert werden wie über eine Gesichtserkennung der Insassen.
Die DARPA-Sprecherin sagte zwar, daß die CTS-Technologie nicht für den Einsatz bei der inneren Sicherheit oder der Polizei vorgesehen sei und daß ein Einsatz für "andere Anwendungsgebiete nicht ohne tiefgreifende Veränderungen" möglich sei, es dürfte aber sicher sein, daß das System, wenn es einsatzbereit ist, Begehrlichkeiten bei Polizei und Geheimdiensten weckt.
Die Behauptung, daß das System nur für den Einsatz in Kampfgebieten gedacht ist um Soldaten besser vor Bedrohungen zu schützen, scheint bei näherem Hinschauen zweifelhaft. Da das CTS auf tausenden von kleinen Kameras aufbaut, mit denen Fahrzeugbewegungen aufgezeichnet werden, setzt es eine relativ friedliche Gegend oder die Anwesenheit von US-Soldaten voraus, da der Gegner die Kameras andernfalls sicherlich zerstören würde.
Ein Anbringung an kleinen Flugkörpern wäre zwar theoretisch möglich, würde die Kosten aber in die Höhe treiben und die Erkennung von Nummernschildern und Gesichtern extrem erschweren.
Da die Kameras also nur in bereits besetzten Gebieten eingesetzt werden könnten, wären sie allenfalls in Fällen wie im Irak oder in Afghanistan einsetzbar, wo sich eine Besatzungsmacht ständigen Guerillaangriffen ausgesetzt sieht.
Auf der anderen Seite wäre eine Ankopplung aller vorhandenen Überwachungskameras westlicher Innenstädte an ein zentrales System, das diese Bilder automatisch auswertet sicherlich der Traum vieler Gruppen. Die Argumentation gegenüber der Bevölkerung dürfte ähnlich ausfallen wie bei der bisherigen "manuellen" Überwachung und würde vermutlich auf ebenso geringen Widerstand stoßen.
Hiermit wäre dann eine lückenlose Verfolgung aller Bürger innerhalb einer Stadt möglich, wobei diese Bewegungsprofile auch auf Jahre gespeichert werden könnte - und würden.
Stellt sich also nur die Frage, ob der militärische Einsatz nur ein Vorwand ist, um ein System zur Überwachung der Bevölkerung zu entwickeln, oder ob die USA sich bereits auf die Eroberung und Besetzung weiterer Staaten vorbereiten.
-----
Kriegswirtschaft und Überwachungsstaat - ja, das ist Amerika!
http://www.freace.de/artikel/jul2003/waffen010703.html
USA entwickeln die Waffen der Zukunft
Der britische Guardian berichtete am Dienstag über Planungen der USA für Waffensysteme, die bis zum Jahr 2025 einsatzbereit sein sollen.
Darunter sind ein wiederverwendbares Hyperschallflugzeug (HCV), daß in der Lage sein soll, von einem gewöhnlichen militärischen Flugplatz zu starten und ein Ziel in 9.000 Seemeilen (16.668 Kilometer) Entfernung in weniger als zwei Stunden zu erreichen, also die siebenfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll.
Daniel Goure, Militäranalyst am Lexington Institute in Washington spricht sogar von bis zu zehnfacher Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich: die amerikanische F-16 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von zweifacher Schallgeschwindigkeit.
Dabei soll das unbemannte HCV eine Nutzlast von bis zu 12.000 Pfund (5.500 Kilogramm) an sein Ziel transportieren können.
Schon in den nächsten sieben Jahren soll ein Waffensystem, "small launch vehicle" (SLV) genannt, einsatzbereit sein, daß einen fast 500 Kilogramm schweren Gefechtskopf, "common aero vehicle" (CAV), ins Weltall befördert, von wo aus er dann auf sein Ziel herunterfällt.
Dabei wäre es gar nicht nötig, hier noch mit Sprengstoff zu arbeiten. Bei 500 Kilogramm Gewicht hätte eine Eisenkugel - wenn man das Problem der Reibungshitze löst, aber das besteht bei derartigen Bomben ja noch eher als bei bloßen Metallkugeln - eine Aufschlagsenergie, die über 600 Tonnen TNT entspräche. Hier auch wieder ein Vergleichswert: die Hiroshima-Atombombe hatte eine geschätzte Sprengkraft von 15.000 Tonnen TNT.
Einem Bericht von Jane`s Defense Weekly http://jdw.janes.com/ zufolge ist der erste Testflug für ein CAV für Mitte 2006 geplant.
Die amerikanische DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency, Behörde für fortschrittliche Forschungsprojekte zur Verteidigung) hat ein detailliertes Planungspapier (Adobe Acrobat-Datei)ins Internet gestellt.
Ziel ist es anscheinend, Angriffe zukünftig von amerikanischem Boden aus führen zu können, ohne auf Basen in anderen Ländern oder andere Lösungen angewiesen zu sein. In Verbindung mit dem geplanten Raketenabwehrschild soll es also möglich sein, Militärschläge gegen Ziele auf der ganzen Welt auszuführen, ohne für den Angegriffenen selbst erreichbar zu sein.
Dies wäre im Grunde nur die logische Fortführung der Art der amerikanischen Kriegsführung im Irak und in Afghanistan, wo die Bomber aus 10 bis 15 Kilometer Höhe, praktisch außerhalb der Reichweite der Flugabwehr, ihre tödliche Fracht abgeworfen haben.
Allerdings dürfte es sich bei dieser Waffe als noch schwieriger erweisen, eine Einhaltung der Genfer Konventionen, die den unbedingten Schutz von Zivilisten fordern, zu argumentieren.
Während das Hyperschallflugzeug sicherlich noch mehrere grundlegende Entwicklungen erfordert, ist die "Bombardierung aus dem All" heute schon größtenteils eine Geldfrage. Nur die Zielgenauigkeit könnte noch ein Problem darstellen, angesichts der großen Sprengkraft verliert dies aber auch wieder etwas an Relevanz. Der in dem DARPA-Papier genannte Preis pro Abschuß dieser Waffe würde sie im Vergleich zu Cruise Missiles, die einen Stückpreis von 1 Million US-Dollar haben, im Hinblick auf die ungleich größere Zerstörung sogar kostengünstig machen.
Außerdem dürfte eine Verteidigung gegen eine solche Waffe sehr schwierig werden, ein noch größeres Ausmaß der Zerstörungen wäre durch die Erhöhung des Gewichts relativ einfach möglich und es gäbe keine Gefahren durch Radioaktivität bei der Handhabung der Waffe oder bei der nachfolgenden Besetzung des bombardierten Gebietes für die Soldaten.
Von einem militärischen Standpunkt aus also sicherlich eine sehr "reizvolle" Waffe. Zumindest, wenn man die Bilder der Zerstörungen in Hiroshima, Dresden oder Coventry aus dem Gedächtnis verbannt hat.

USA entwickeln die Waffen der Zukunft
Der britische Guardian berichtete am Dienstag über Planungen der USA für Waffensysteme, die bis zum Jahr 2025 einsatzbereit sein sollen.
Darunter sind ein wiederverwendbares Hyperschallflugzeug (HCV), daß in der Lage sein soll, von einem gewöhnlichen militärischen Flugplatz zu starten und ein Ziel in 9.000 Seemeilen (16.668 Kilometer) Entfernung in weniger als zwei Stunden zu erreichen, also die siebenfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll.
Daniel Goure, Militäranalyst am Lexington Institute in Washington spricht sogar von bis zu zehnfacher Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich: die amerikanische F-16 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von zweifacher Schallgeschwindigkeit.
Dabei soll das unbemannte HCV eine Nutzlast von bis zu 12.000 Pfund (5.500 Kilogramm) an sein Ziel transportieren können.
Schon in den nächsten sieben Jahren soll ein Waffensystem, "small launch vehicle" (SLV) genannt, einsatzbereit sein, daß einen fast 500 Kilogramm schweren Gefechtskopf, "common aero vehicle" (CAV), ins Weltall befördert, von wo aus er dann auf sein Ziel herunterfällt.
Dabei wäre es gar nicht nötig, hier noch mit Sprengstoff zu arbeiten. Bei 500 Kilogramm Gewicht hätte eine Eisenkugel - wenn man das Problem der Reibungshitze löst, aber das besteht bei derartigen Bomben ja noch eher als bei bloßen Metallkugeln - eine Aufschlagsenergie, die über 600 Tonnen TNT entspräche. Hier auch wieder ein Vergleichswert: die Hiroshima-Atombombe hatte eine geschätzte Sprengkraft von 15.000 Tonnen TNT.
Einem Bericht von Jane`s Defense Weekly http://jdw.janes.com/ zufolge ist der erste Testflug für ein CAV für Mitte 2006 geplant.
Die amerikanische DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency, Behörde für fortschrittliche Forschungsprojekte zur Verteidigung) hat ein detailliertes Planungspapier (Adobe Acrobat-Datei)ins Internet gestellt.
Ziel ist es anscheinend, Angriffe zukünftig von amerikanischem Boden aus führen zu können, ohne auf Basen in anderen Ländern oder andere Lösungen angewiesen zu sein. In Verbindung mit dem geplanten Raketenabwehrschild soll es also möglich sein, Militärschläge gegen Ziele auf der ganzen Welt auszuführen, ohne für den Angegriffenen selbst erreichbar zu sein.
Dies wäre im Grunde nur die logische Fortführung der Art der amerikanischen Kriegsführung im Irak und in Afghanistan, wo die Bomber aus 10 bis 15 Kilometer Höhe, praktisch außerhalb der Reichweite der Flugabwehr, ihre tödliche Fracht abgeworfen haben.
Allerdings dürfte es sich bei dieser Waffe als noch schwieriger erweisen, eine Einhaltung der Genfer Konventionen, die den unbedingten Schutz von Zivilisten fordern, zu argumentieren.
Während das Hyperschallflugzeug sicherlich noch mehrere grundlegende Entwicklungen erfordert, ist die "Bombardierung aus dem All" heute schon größtenteils eine Geldfrage. Nur die Zielgenauigkeit könnte noch ein Problem darstellen, angesichts der großen Sprengkraft verliert dies aber auch wieder etwas an Relevanz. Der in dem DARPA-Papier genannte Preis pro Abschuß dieser Waffe würde sie im Vergleich zu Cruise Missiles, die einen Stückpreis von 1 Million US-Dollar haben, im Hinblick auf die ungleich größere Zerstörung sogar kostengünstig machen.
Außerdem dürfte eine Verteidigung gegen eine solche Waffe sehr schwierig werden, ein noch größeres Ausmaß der Zerstörungen wäre durch die Erhöhung des Gewichts relativ einfach möglich und es gäbe keine Gefahren durch Radioaktivität bei der Handhabung der Waffe oder bei der nachfolgenden Besetzung des bombardierten Gebietes für die Soldaten.
Von einem militärischen Standpunkt aus also sicherlich eine sehr "reizvolle" Waffe. Zumindest, wenn man die Bilder der Zerstörungen in Hiroshima, Dresden oder Coventry aus dem Gedächtnis verbannt hat.

Es geht noch heftiger Dolby, das "Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten" legt vor  ....
....
Aktuell
URTEIL
Lebenslange Haftstrafe für Polizisten-Anspucker
Weil er einen Beamten angespuckt hat, ist ein US-Bürger im Bundesstaat Oklahoma zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Oklahoma City - Der Mann sei wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden, dafür drohte ihm eine Haftstrafe von einem Jahr. Als sich jedoch die Beamten nährten, spuckte der 36-Jährige einem der Polizisten ins Gesicht, berichtet der US-Nachrichtensender CNN am Mittwoch.
Als Bagatelle wollte der Richter den Vorfall nicht abtun: Weil auf diese Weise eine tödliche Krankheit übertragen werden könne, verhängte er die Höchststrafe. Die Anwälte des Mannes wollen gegen das Strafmaß Berufung einlegen.
Der Angreifer und der Bespuckte wurden auf ansteckende Krankheiten untersucht - ohne Ergebnis.
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,255561,00.html
Ab heute gehört die 3M-SARS-Gesichtsmaske in jedes Touristengepäck. Man stelle sich nur einen Niesanfall am Zoll vor
 .....
.....
syr
 ....
....Aktuell
URTEIL
Lebenslange Haftstrafe für Polizisten-Anspucker
Weil er einen Beamten angespuckt hat, ist ein US-Bürger im Bundesstaat Oklahoma zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Oklahoma City - Der Mann sei wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden, dafür drohte ihm eine Haftstrafe von einem Jahr. Als sich jedoch die Beamten nährten, spuckte der 36-Jährige einem der Polizisten ins Gesicht, berichtet der US-Nachrichtensender CNN am Mittwoch.
Als Bagatelle wollte der Richter den Vorfall nicht abtun: Weil auf diese Weise eine tödliche Krankheit übertragen werden könne, verhängte er die Höchststrafe. Die Anwälte des Mannes wollen gegen das Strafmaß Berufung einlegen.
Der Angreifer und der Bespuckte wurden auf ansteckende Krankheiten untersucht - ohne Ergebnis.
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,255561,00.html
Ab heute gehört die 3M-SARS-Gesichtsmaske in jedes Touristengepäck. Man stelle sich nur einen Niesanfall am Zoll vor

 .....
.....syr




http://derstandard.at/?id=1349115
Auslandsbanken ziehen aus New York ab
Die New Yorker Finanzmärkte verlieren ihren ausländischen Akzent: Immer mehr Überseebanken brechen wegen der schlechten Konjunktur im Big Apple die Zelte ab
New York - Die schwache Weltwirtschaft und die Konsolidierung in der Branche haben die Kosten derart in die Höhe getrieben, dass für viele ein ausgedehntes Niederlassungssystem finanziell keinen Sinn mehr macht.
Nach Statistiken der US-Notenbank Federal Reserve ist die Zahl ausländischer Filialen oder Repräsentanzen in der Acht-Millionen-Metropole seit 1997 von 375 auf 235 gefallen, ein Rückgang von 37 Prozent. Anders gerechnet haben durchschnittlich zwei Banken im Monat New York den Rücken gekehrt. Diese Entwicklung hat sich in den letzten zwei Jahren beschleunigt. Der größte Teil der Arbeitsplatzverluste im Finanzgewerbe der letzten fünf Jahre geht auf das Konto der Auslandsbanken.
Angeführt wird der Rückzug von japanischen Banken, die zu Hause hohe Verluste erlitten haben. Von den einst 50 Nippon-Banken, die in New York operierten, sind etwa ein Dutzend übrig geblieben. Von der Rückwanderung profitieren neben US-Instituten Banken aus Europa. Wie Zahlen der Federal Reserve zeigen, hielten Auslandsbanken in New York im März eine Billion Dollar im Vergleich zu 827 Mrd. Dollar 1997, ein Zuwachs von 26 Prozent. Österreichische Banken in New York konnten die Stellung halten. Dass sich ihre Zahl verringert hat, hängt mit Zusammenschlüssen zusammen. Die ehemalige Filiale der Bank Austria in New York wanderte nach der Fusion mit der HypoVereinsbank (HVB) im Jahr 2001 zur dortigen HVB-Niederlassung. Eine Filiale betreibt weiter die Erste Bank, während die Raiffeisen Zentralbank (RZB) auf dem New Yorker Pflaster mit der Tochter RZB Finance LLC nicht als Bank operiert, sondern als Finanzierungsgesellschaft. Die RZB hat zudem noch eine Repräsentanz in New York.
Seit Anfang 2002 werden vor allem Repräsentanzen geschlossen, die Geschäftsanbahnungen betreiben. Aber auch immer mehr Filialen machen dicht. "Ich vermute, dass in der Zukunft aus allen wichtigen Ländern nur noch eine Hand voll Auslandsbanken in New York präsent sein wird", sagte Roy Smith, Professor an der Stern School of Business der New York University. Im September 2002 waren bei den in New York ansässigen Auslandsbanken 17.411 Mitarbeiter beschäftigt. 1993 waren es noch 22.542.
Der Stellenabbau trifft auch gewerbliche Immobilien hart. Bei einem Branchendurchschnitt von 75 bis 150 m²/Angestellten sind 37.000 bis 74.000 m² an Bürofläche frei geworden. (APA, Der Standard, Printausgabe, 06.03.2003)
-----
Ob die wieder kommen?

Auslandsbanken ziehen aus New York ab
Die New Yorker Finanzmärkte verlieren ihren ausländischen Akzent: Immer mehr Überseebanken brechen wegen der schlechten Konjunktur im Big Apple die Zelte ab
New York - Die schwache Weltwirtschaft und die Konsolidierung in der Branche haben die Kosten derart in die Höhe getrieben, dass für viele ein ausgedehntes Niederlassungssystem finanziell keinen Sinn mehr macht.
Nach Statistiken der US-Notenbank Federal Reserve ist die Zahl ausländischer Filialen oder Repräsentanzen in der Acht-Millionen-Metropole seit 1997 von 375 auf 235 gefallen, ein Rückgang von 37 Prozent. Anders gerechnet haben durchschnittlich zwei Banken im Monat New York den Rücken gekehrt. Diese Entwicklung hat sich in den letzten zwei Jahren beschleunigt. Der größte Teil der Arbeitsplatzverluste im Finanzgewerbe der letzten fünf Jahre geht auf das Konto der Auslandsbanken.
Angeführt wird der Rückzug von japanischen Banken, die zu Hause hohe Verluste erlitten haben. Von den einst 50 Nippon-Banken, die in New York operierten, sind etwa ein Dutzend übrig geblieben. Von der Rückwanderung profitieren neben US-Instituten Banken aus Europa. Wie Zahlen der Federal Reserve zeigen, hielten Auslandsbanken in New York im März eine Billion Dollar im Vergleich zu 827 Mrd. Dollar 1997, ein Zuwachs von 26 Prozent. Österreichische Banken in New York konnten die Stellung halten. Dass sich ihre Zahl verringert hat, hängt mit Zusammenschlüssen zusammen. Die ehemalige Filiale der Bank Austria in New York wanderte nach der Fusion mit der HypoVereinsbank (HVB) im Jahr 2001 zur dortigen HVB-Niederlassung. Eine Filiale betreibt weiter die Erste Bank, während die Raiffeisen Zentralbank (RZB) auf dem New Yorker Pflaster mit der Tochter RZB Finance LLC nicht als Bank operiert, sondern als Finanzierungsgesellschaft. Die RZB hat zudem noch eine Repräsentanz in New York.
Seit Anfang 2002 werden vor allem Repräsentanzen geschlossen, die Geschäftsanbahnungen betreiben. Aber auch immer mehr Filialen machen dicht. "Ich vermute, dass in der Zukunft aus allen wichtigen Ländern nur noch eine Hand voll Auslandsbanken in New York präsent sein wird", sagte Roy Smith, Professor an der Stern School of Business der New York University. Im September 2002 waren bei den in New York ansässigen Auslandsbanken 17.411 Mitarbeiter beschäftigt. 1993 waren es noch 22.542.
Der Stellenabbau trifft auch gewerbliche Immobilien hart. Bei einem Branchendurchschnitt von 75 bis 150 m²/Angestellten sind 37.000 bis 74.000 m² an Bürofläche frei geworden. (APA, Der Standard, Printausgabe, 06.03.2003)
-----
Ob die wieder kommen?


03/07/2003 16:20
Bush besorgt über gestiegene US-Arbeitslosigkeit
Washington, 03. Jul (Reuters) - US-Präsident George W. Bush
hat sich besorgt über die überraschend deutlich gestiegene
Arbeitslosigkeit in den USA geäußert.
"Der Präsident ist weiterhin besorgt über jeden Amerikaner,
der Arbeit sucht und keine findet", erklärte das Präsidialamt am
Donnerstag. Bush hoffe, dass die beschlossenen
milliardenschweren Steuersenkungen helfen würden, diesen Trend
umzukehren.
Überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten hatten zuvor die
Hoffnungen auf eine rasche Erholung der weltgrößten
Volkswirtschaft gedämpft. Die Arbeitslosenquote stieg im
vergangenen Monat auf 6,4 Prozent (Mai 6,1) und damit auf den
höchsten Stand seit April 1994.
Analysten sprachen von durchweg enttäuschenden Zahlen, die
für die weitere Entwicklung der Konsumausgaben nicht Gutes
verhießen. Die Daten belasteten die Aktienkurse in den USA und
Europa sowie den Dollar.
akr/phi
----
Pulleralarm
Bush besorgt über gestiegene US-Arbeitslosigkeit
Washington, 03. Jul (Reuters) - US-Präsident George W. Bush
hat sich besorgt über die überraschend deutlich gestiegene
Arbeitslosigkeit in den USA geäußert.
"Der Präsident ist weiterhin besorgt über jeden Amerikaner,
der Arbeit sucht und keine findet", erklärte das Präsidialamt am
Donnerstag. Bush hoffe, dass die beschlossenen
milliardenschweren Steuersenkungen helfen würden, diesen Trend
umzukehren.
Überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten hatten zuvor die
Hoffnungen auf eine rasche Erholung der weltgrößten
Volkswirtschaft gedämpft. Die Arbeitslosenquote stieg im
vergangenen Monat auf 6,4 Prozent (Mai 6,1) und damit auf den
höchsten Stand seit April 1994.
Analysten sprachen von durchweg enttäuschenden Zahlen, die
für die weitere Entwicklung der Konsumausgaben nicht Gutes
verhießen. Die Daten belasteten die Aktienkurse in den USA und
Europa sowie den Dollar.
akr/phi
----
Pulleralarm

US/Beschäftigung ex Agrar Juni -30.000 (PROG: -6.000) gg Vm
Washington (vwd) - Die Trendwende am US-Arbeitsmarkt ist auch im Juni ausgeblieben. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag berichtet, verringerte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft binnen Monatsfrist um 30.000 und damit den fünften Monat in Folge. Zudem wurde für den Mai der vorläufig gemeldete Rückgang um 17.000 auf minus 70.000 revidiert. Analysten hatten für den Juni lediglich mit einem Beschäftigungsminus von 6.000 gerechnet.
Die Arbeitslosenquote stieg nach weiteren Angaben des Ministerium auf 6,4 von 6,1 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit April 1994. Hier war im Durchschnitt eine Quote von 6,2 Prozent erwartet worden. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich laut Arbeitsministerium binnen Monatsfrist wie erwartet um 0,2 Prozent bzw 0,03 USD auf 15,38 USD. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit belief sich gegenüber Mai auf unverändert 33,7 Stunden.
vwd/DJ/3.7.2003/ptr
US/Beschäftigung ex Agrar Juni ... (zwei)
Seit Jahresbeginn sind der US-Wirtschaft damit über 230.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. Volkswirte sagten in einer ersten Reaktion, dass die Unternehmen nach wie vor bemüht seien, angesichts des unsicheren Umfelds Kosten zu senken und Investitionen zurückzuhalten. Beides schlage sich negativ auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt nieder. Die niedrigen Leitzinsen der US-Notenbank und die bisherigen sowie anstehenden Steuersenkungen würden zurzeit wirkungslos am Arbeitsmarkt vorbeigehen. So sei auch das Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal mit annualisiert 1,4 Prozent zu gering gewesen, um neue Stellen zu schaffen.
Um den Arbeitsmarkt zu beleben ist nach Ansicht der Experten eine Wachstumsrate von deutlich über drei Prozent notwendig. Vor diesem Hintergrund erscheint es wahrscheinlich, dass die Federal Reserve in absehbarer Zeit noch einmal ihre Leitzinsen, die mit 1,00 Prozent auf dem tiefsten Stand seit rund 45 Jahren sind, senken dürfte. Allerdings verweisen Volkswirte darauf, dass nur noch eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte möglich ist, da es ansonsten zu Funktionsstörungen am US-Geldmarkt kommen könnte.
Den Zahlen des Arbeitsministeriums zufolge verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe mit minus 56.000 erneut einen kräftigen Verlust an Arbeitsplätzen. Damit beläuft sich der Stellenabbau in diesem Bereich auf 2,6 Millionen in den vergangenen drei Jahren. Im Dienstleistungs- (plus 10.000) und Bausektor (plus 16.000) gab es hingegen im Juni leichte Stellenzuwächse.
+++ Peter Trautmann
vwd/DJ/3.7.2003/ptr

Washington (vwd) - Die Trendwende am US-Arbeitsmarkt ist auch im Juni ausgeblieben. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag berichtet, verringerte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft binnen Monatsfrist um 30.000 und damit den fünften Monat in Folge. Zudem wurde für den Mai der vorläufig gemeldete Rückgang um 17.000 auf minus 70.000 revidiert. Analysten hatten für den Juni lediglich mit einem Beschäftigungsminus von 6.000 gerechnet.
Die Arbeitslosenquote stieg nach weiteren Angaben des Ministerium auf 6,4 von 6,1 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit April 1994. Hier war im Durchschnitt eine Quote von 6,2 Prozent erwartet worden. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich laut Arbeitsministerium binnen Monatsfrist wie erwartet um 0,2 Prozent bzw 0,03 USD auf 15,38 USD. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit belief sich gegenüber Mai auf unverändert 33,7 Stunden.
vwd/DJ/3.7.2003/ptr
US/Beschäftigung ex Agrar Juni ... (zwei)
Seit Jahresbeginn sind der US-Wirtschaft damit über 230.000 Arbeitsplätze verlorengegangen. Volkswirte sagten in einer ersten Reaktion, dass die Unternehmen nach wie vor bemüht seien, angesichts des unsicheren Umfelds Kosten zu senken und Investitionen zurückzuhalten. Beides schlage sich negativ auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt nieder. Die niedrigen Leitzinsen der US-Notenbank und die bisherigen sowie anstehenden Steuersenkungen würden zurzeit wirkungslos am Arbeitsmarkt vorbeigehen. So sei auch das Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal mit annualisiert 1,4 Prozent zu gering gewesen, um neue Stellen zu schaffen.
Um den Arbeitsmarkt zu beleben ist nach Ansicht der Experten eine Wachstumsrate von deutlich über drei Prozent notwendig. Vor diesem Hintergrund erscheint es wahrscheinlich, dass die Federal Reserve in absehbarer Zeit noch einmal ihre Leitzinsen, die mit 1,00 Prozent auf dem tiefsten Stand seit rund 45 Jahren sind, senken dürfte. Allerdings verweisen Volkswirte darauf, dass nur noch eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte möglich ist, da es ansonsten zu Funktionsstörungen am US-Geldmarkt kommen könnte.
Den Zahlen des Arbeitsministeriums zufolge verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe mit minus 56.000 erneut einen kräftigen Verlust an Arbeitsplätzen. Damit beläuft sich der Stellenabbau in diesem Bereich auf 2,6 Millionen in den vergangenen drei Jahren. Im Dienstleistungs- (plus 10.000) und Bausektor (plus 16.000) gab es hingegen im Juni leichte Stellenzuwächse.
+++ Peter Trautmann
vwd/DJ/3.7.2003/ptr

03.07. 17:32
Microsoft will Arbeitskräfte nach Indien auslagern
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT) erwägt die Entlassung von Mitarbeitern in den USA und die gleichzeitige Einstellung von englischsprachigen Fachkräften in Indien. Die Einstellung von Mitarbeitern in Indien ist eine Priorität von Microsoft geworden, nachdem Bill Gates im November ein dreijähriges Investitionspaket im Wert von $400 Millionen für Indien versprach. Bisher hat Microsoft im Süden der Stadt Hyderabad 200 Mitarbeiter eingestellt. Dort betreibt der Softwareriese ein Entwicklungszentrum. S. Somasegar, Microsoft`s Vice President der Windows Engineering Services Abteilung, bestätigt, dass man derzeit die Umlegung von Arbeitskräften nach Indien erwäge.
-----
Ha so ebbes!
Microsoft will Arbeitskräfte nach Indien auslagern
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Microsoft (WKN: 870747, US: MSFT) erwägt die Entlassung von Mitarbeitern in den USA und die gleichzeitige Einstellung von englischsprachigen Fachkräften in Indien. Die Einstellung von Mitarbeitern in Indien ist eine Priorität von Microsoft geworden, nachdem Bill Gates im November ein dreijähriges Investitionspaket im Wert von $400 Millionen für Indien versprach. Bisher hat Microsoft im Süden der Stadt Hyderabad 200 Mitarbeiter eingestellt. Dort betreibt der Softwareriese ein Entwicklungszentrum. S. Somasegar, Microsoft`s Vice President der Windows Engineering Services Abteilung, bestätigt, dass man derzeit die Umlegung von Arbeitskräften nach Indien erwäge.
-----
Ha so ebbes!

Inhaftieren und Abkassieren
Gefängnisindustrie in den USA
Nashville, Tennessee, 28. August 1996: 5000 Besucher drängeln sich auf einer nicht ganz alltäglichen Fachmesse. Hier kann man Stacheldraht kaufen, spezielle Stühle zum Festschnallen und Anketten von Menschen, Schlagstöcke, Telefonüberwachungsanlagen, Metalldetektoren und eine unüberschaubare Masse anderer furchteinflößender Gegenstände. Wir sind auf der weltgrößten "Strafvollzugsmesse". An mehr als 600 Ständen bieten Unternehmen aus den gesamten Vereinigten Staaten ihre Dienste an – vom Hersteller simpler Plastikhandschellen über Dienstleistungsbetriebe, die besonders bullige Gefängniswärter anbieten bis hin zu Baufirmen, die Pläne ganzer Gefängniskomplexe ausstellen. Ein Blick auf diese Messe läßt ahnen, welche wirtschaftliche Bedeutung das Gefängniswesen in den USA bekommen hat. Was einst eine Nischenwirtschaft war, in der sich nur eine Handvoll Unternehmen tummelte, ist binnen weniger Jahre zu einer Multimilliardenindustrie angewachsen – mit Fachmessen, Verkaufsschauen, eigenen Websites, Mail-order-Katalogen und direct-marketing-Kampagnen. Eine eigene Repressionsindustrie ist entstanden, in der sich die größten Architekturbüros und Baufirmen des Landes ebenso tummeln wie Wall-Street-Investmentgesellschaften, die ihr Geld in Privatgefängnisse stecken, Lieferanten von Rohren und Sanitäranlagen, Unternehmen der Lebensmittelbranche, der Gesundheitsfürsorge und solche, die von kugelsicheren Überwachungskameras bis hin zu farbigen Gummizellen einfach alles anbieten.
Die Profite, um die es diesen Unternehmen geht, werden mit Strafgefangenen gemacht, deren Anzahl in schwindelerregende Höhen angestiegen ist. Die Vereinigten Staaten können sich mit Recht Weltmeister im Einsperren der eigenen Bevölkerung nennen. So sind heute mehr als zwei Millionen US-Bürger inhaftiert. Mehr als ein Prozent der männlichen erwachsenen Bevölkerung sitzt im Knast. Die "Einsperr-Rate" – also der Anteil von Inhaftierten an der Bevölkerung – ist die höchste in der Geschichte der Menschheit. Sie ist heute etwa zehnmal so hoch wie die durchschnittlicher europäischer Länder und mehr als 17mal so hoch wie die Japans. Alleine in Kalifornien sitzen mehr Menschen im Gefängnis als in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Japan, Singapur und den Niederlanden zusammen.
Das war nicht immer so: Die Zahl der kalifornischen Strafgefangenen hat sich in den letzten 20 Jahren verachtfacht. Dieser Trend war in den gesamten USA zu beobachten. Entsprach die "Einsperr-Rate" bis in die späten Siebziger in etwa der europäischer Länder, so stieg sie Anfang der Achtziger rapide an. Im darauffolgenden Jahrzehnt verdoppelte sich die Zahl der Gefängnisinsassen – und die nun doppelte Zahl verdoppelte sich wiederum in den Neunzigern ... oder genauer: Sie wurde verdoppelt.
Wie kam es zu diesen Masseninhaftierungen? Die Kriminalitätsrate fällt seit 1992, nichtsdestoweniger werden Jahr für Jahr mehr Menschen in immer neue Gefängnisse gesteckt. In den letzten 20 Jahren sind etwa eintausend neue Haftanstalten in den USA gebaut worden, fast alle sind hoffnungslos überfüllt.
Den entscheidenden Schritt zur Inhaftierung Hunderttausender von Menschen machte Anfang der achtziger Jahre die Reagan-Administration, als sie den sogenannten "War On Drugs", den Krieg gegen die Drogen, ausrief. Im Zuge einer angeblichen Drogenbekämpfungspolitik wurden die Gesetze landesweit verschärft und die Mindeststrafen erhöht. Seitdem werden deutlich mehr Gefängnisstrafen ausgesprochen, längere Strafen verhängt und weniger Bewährungsstrafen vergeben. Die Zahl der Inhaftierungen wegen Drogenvergehen ist seit dem Beginn des "War On Drugs" um sage und schreibe eintausend Prozent angestiegen. So sitzen heute alleine wegen Drogenvergehen erheblich mehr Menschen im Knast als noch vor zwanzig Jahren überhaupt Menschen im Gefängnis saßen.
Wogegen bzw. gegen wen sich der "War On Drugs" tatsächlich richtet, zeigt die Justizstatistik: 74% der wegen Drogen Eingesperrten sind Afroamerikaner, obwohl die Afroamerikaner nur 12% der US-Bevölkerung stellen.
Interessant ist auch ein mittlerweile berüchtigtes Antidrogengesetz von 1986: Nach ihm wird drakonisch bestraft, wer Kokain in Form von Crack mit sich führt. Relativ milde ist die Strafe für das Mitführen von Kokain in Pulverform. Um für zehn Jahre ins Gefängnis zu wandern, reicht der Besitz von 50 Gramm Crack – von Koks hingegen muß man schon fünf Kilo mit sich führen. Unnötig zu sagen, daß Crack die Droge der Armen und Koks die der Reichen ist.
Vor ein paar Jahren machte die Regierung Bill Clintons auch hierzulande Schlagzeilen, als sie das "Three strikes, you’re out"-Gesetz durchs Parlament brachte. "Three strikes, you’re out" (drei Treffer, und du bist raus), das bedeutet: Wer zum dritten Mal bei einer Straftat geschnappt wird, egal bei welcher, auch wenn es nur der Diebstahl einer Tafel Schokolade ist, wird automatisch zu lebenslanger Haft verurteilt. In derselben Legislaturperiode führte die Clinton-Administration eine Sozialreform durch, die den individuellen Anspruch auf Wohlfahrtsunterstützung beinahe gänzlich abschaffte. Nach den neuen Regelungen können Arme nicht mehr als zusammengerechnet drei Jahre ihres Lebens Wohlfahrtsunterstützung bekommen. Während die Sozialausgaben Jahr für Jahr weiter gesenkt wer-den – übrigens auch die öffentlichen Ausgaben fürs Bildungswesen –, explodieren die Ausgaben für den Strafvollzug. Im vergangenen Jahr gaben die Vereinigten Staaten 35 Milliarden Dollar für das Gefängniswesen aus.
Mit Recht wurde der "Krieg gegen das Verbrechen", den die Regierung ausgerufen hat, als größtes Projekt US-amerikanischer Sozialpolitik in unserem Jahrhundert bezeichnet. Paradoxerweise sorgt also gerade die angebliche Kriminalitätsbekämpfung für Kriminalität: Die zunehmende Armut, aus der die sogenannte Kriminalität entsteht, gibt es unter anderem, weil Gefängnisse gebaut werden, um die Armen darin einzusperren.
Die schwarze Hochschullehrerin Angela Davis schreibt dazu:
"Afro- und latinoamerikanische, indigene und viele asiatische Jugendliche werden als Vertreter von Gewalt und Drogenhandel dargestellt, die voller Neid sind wegen der Güter, die sie nicht besitzen. Junge Afro- und Latinoamerikanerinnen werden der sexuellen Promiskuität geziehen, und es wird ihnen unterstellt, sie produzierten ungehemmt Babys und Armut. Kriminalität und abweichendes Verhalten werden rassistisch aufgeladen. Die Überwachung wird auf die schwarzen Communities konzentriert, auf Einwanderer, Arbeitslose, Schulabgänger ohne Abschluß, Obdachlose und generell all diejenigen, die einen immer kleineren Anspruch auf die sozialen Ressourcen geltend machen können. Ihr Anspruch verringert sich, weil Polizei und Strafvollzugssystem diese Ressourcen zusehends verschlingen. Der gefängnisindustrielle Komplex hat so einen Teufelskreis geschaffen, der die Armut derer vertieft, deren Verarmung durch Gefangenschaft angeblich ‚gelöst‘ wurde." "Der Schwerpunkt der Regierungspolitik hat sich von der Sozialhilfe auf Kriminalitätskontrolle verlagert. Der Rassismus vertieft sich immer mehr in den ökonomischen und ideologischen Strukturen der US-Gesellschaft. Während sie sich gegen Förderprogramme für Minderheiten und zweisprachige Schulerziehung aussprechen, verkünden konservative Kampagnenführer das Ende des Rassismus. Sie behaupten, die Reste von Rassismus würden durch Dialog und Gesprächs-kreise beseitigt werden. Aber den gefängnisindustriellen Komplex werden Gesprächskreise über ‚Rassenbeziehungen‘ nicht abschaffen können – nährt er doch den in die tieferen Gesellschaftsstrukturen eingewobenen Rassismus und lebt von ihm."
Aber das Wegschließen von zwei Millionen meist armer Menschen ist nicht nur eine sozialpolitische Maßnahme. Das Gefängniswesen ist der am schnellsten wachsende Sektor der US-Industrie. Hier warten Milliardenprofite auf die Unternehmen – aber auch Städte, Gemeinden und Bundesstaaten profitieren von der Repressionsindustrie. Der Bau von Gefängnissen wird in so mancher unterentwickelten Gegend zum Grundstein wirtschaftlicher Entwicklung. Die Errichtung eines Knastes ist nicht nur ein Leckerbissen für die Bauindustrie, sondern auch für die Hersteller und Zulieferer sogenannter Sicherheitstechnologie – oft übrigens Technologien, die von Rüstungsunternehmen für das Militär entwickelt wurden und nun ihren Einsatz bei der Polizei und im Strafvollzugssystem finden. So ist die Repressionsindustrie mit der Rüstungsindustrie und dem Militär eng verwachsen. Einer der größten Rüstungsbetriebe der USA, Westinghouse Inc., beliefert auch einen großen Teil der Gefängnisse. Eine Reihe von Strafanstalten wird von dem multinationalen Sicherheitsdienst Wackenhut Corporation betrieben. Das Unternehmen, das Niederlassungen in mehr als 50 Staaten hat, und dessen jährliche Einkünfte sich auf mehr als eine Miliarde Dollar belaufen, hatte sich seit den 70er Jahren vor allem auf Streikbruch und Anti-Terrorismus-Aktivitäten konzentriert. Die Liste seiner Verwaltungsratsmitglieder liest sich wie ein Who‘s Who des militärisch-industriellen Komplexes. So sitzen dort zwei pensionierte Luftwaffengeneräle neben einem Ex-Marine-Corps-Kommandanten, einem ehemaligen Leiter des FBI, einem früheren Leiter des Militärgeheimdienstes, dem früheren Direktor der CIA und seinem Stellvertreter und nicht zuletzt dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Benjamin Civiletti.
Es liegt auf der Hand, daß ein Konzern, der Profit erwirtschaftet, indem er Gefängnisse betreibt, kein Interesse daran hat, daß die Zahl der Strafgefangenen abnimmt. Auch so ist es zu erklären, daß die Zahl der Gefängnisinsassen seit Jahren rapide steigt, obwohl die Kriminalitätszahlen seit Jahren sinken. Steven Donzinger, Vorsitzender der Nationalen Strafjustiz-Kommission, sagt dazu:
"Wenn die Kriminalität ansteigt, müssen wir mehr Gefängnisse bauen. Wenn die Kriminalität sinkt, dann deshalb, weil wir mehr Gefängnisse gebaut haben. Und deshalb wird die Kriminalität auch sinken, wenn wir noch mehr Gefängnisse bauen."
Mittlerweile lebt ein ganzer Industriezweig von der Massenbestrafung. Damit sie aufrecht erhalten wird, ist er strategisch davon abhängig, daß rassistische Strukturen und Ideologien, die die Menschen ins Gefängnis bringen, fortbestehen – oder, besser noch, sich ausweiten. Angela Davis schreibt dazu: "Damit die Körper geliefert werden können, die für das gewinnorientierte Strafvollzugssystem bestimmt sind, beruht die politische Ökonomie der Gefängnisse auf rassistisch bestimmten Annahmen über Kriminalität – z. B. den Bildern von schwarzen Müttern, die Sozialhilfe einheimsen, um kriminelle Kinder großzuziehen – und auf rassistischen Mustern bei der Festnahme, der Verurteilung und den Strafmaßen. Die Körper von Afro- und Latinoamerikanerinnen und –amerikanern sind in diesem riesigen Experiment der Hauptrohstoff, um die sozialen Probleme unsrer Zeit verschwinden zu lassen. Entkleidet man aber diese angebliche ‚Lösung durch Einsperren‘ ihrer magischen Aura, kommen Rassismus, Klassenvorurteile und die parasitäre Abschöpfung kapitalistischer Profite zum Vorschein." Auf verschiedenste Weise werden mit den Knastinsassen Gewinne erwirtschaftet. So prügeln sich die Telefongesellschaften geradezu darum, Strafanstalten mit Telefonanschlüssen zu versorgen. Sie geben den Gefängnisbetreibern, staatlich oder privat, Teile des Profits ab, sie installieren kostenlos Telefonabhöranlagen, sie zahlen hohe Provisionen. Warum? Die Gefängnisinsassen, die auf den telefonischen Kontakt zur Außenwelt angewiesen sind und sich ihren Telefonanbieter nicht aussuchen können, müssen bis zu fünfmal höhere Gebühren zahlen als die Menschen draußen. Es wird geschätzt, daß ein Häftling durchschnittlich 500 Dollar im Jahr fürs Telefonieren aufwenden muß. Bei zwei Millionen Gefangenen macht das eine Milliarde Dollar.
Aber auch die Arbeit der Gefangenen läßt sich nutzen. Die Zwangsarbeit von Häftlingen, die oft von Sklavenarbeit nicht mehr zu unterscheiden ist, hat in den Vereinigten Staaten Tradition. Im vorigen Jahrhundert wurden sie gezwungen, auf Plantagen zu arbeiten. Den Aufpassern trugen nicht nur Schußwaffen, sondern auch Peitschen, die sei bei Fehlverhalten der Häftlinge einsetzen durften.
In Tennessee wurden im Jahre 1892 bei einem Streik der Minenarbeiter Häftlinge gezwungen, als Streikbrecher Kohle abzubauen. Die Bergleute setzten dem aber ein Ende: Sie stürmten die Mine und befreiten die Strafgefangenen.
All das scheint heute Geschichte zu sein. Doch die berühmten Chain Gangs – Gruppen von Zwangsarbeitern, die meist mit Fußketten aneinander gefesselt waren und zum Beispiel im Straßenbau schufteten – existierten noch bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts ... und wurden vor vier Jahren, 1995, in Alabama und Arizona wieder eingeführt!
Dieses Jahr werden Häftlinge in den US-amerikanischen Gefängissen Güter im Wert von neun Milliarden Dollar produzieren. Oregon, dessen Verfassung alle Gefängnisinsassen zur Arbeit zwingt, macht öffentlich Werbung für seine Zwangsarbeiterheere. Übrigens mit dem Argument, daß auf diese Weise die Produktion im Lande bliebe, die sonst in Billiglohnländer abwandere. Kevin Mannix, Parlamentsabgeordneter in Oregon, nimmt kein Blatt vor den Mund: Im Oktober 94 forderte er Unternehmen auf, Verträge mit den Gefängnissen abzuschließen wie der Sportartikelhersteller Nike sie mit der indonesischen Regierung abgeschlossen hat. Nike zahlt seinen Arbeiterinnen und Arbeitern in Indonesien 1 Dollar 20 am Tag. "Wir finden, daß Nike sich die Transport- und Arbeitskosten noch einmal ansehen sollte", sagt Mannix. "Wir könnten Häftlingsarbeit anbieten, die da mithalten kann."
Tatsächlich liegt der Stundenlohn eines Häftlings meistens deutlich unter einem Dollar brutto. In Kalifornien etwa beträgt er 45 Cents. Bei einem 9-Stunden-Arbeitstag ergibt das einen stolzen Monatslohn von 60 Dollar netto. Zuweilen entspricht der Bruttolohn der Häftlinge auch dem gesetzlichen Mindestlohn. Dazu muß man allerdings wissen, daß der in den USA mittlerweile so niedrig liegt, daß jemand, der Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, ein monatliches Einkommen erwirtschaftet, das 50% unter der Armutsgrenze liegt. Von diesem Mindestlohn wird den Häftlingen oft noch bis zu 80% abgezogen – für "Kost und Logis", Gebühren und Opferentschädigung ... falls es Opfer gibt, denn die meisten Gefängnisinsassen sind verurteilt wegen Verbrechen, in denen es keine Opfer gibt, in aller Regel Drogenvergehen.
In den meisten Bundesstaaten der USA ist die Häftlingsarbeit offiziell freiwillig. Tatsächlich müssen aber Häftlinge, die die Arbeit verweigern, längere Strafen absitzen – wie es ja auch in der Bundesrepublik üblich ist. Sie werden mit dem ganzen Arsenal an Bestrafungsmaßnahmen überzogen, das der Strafvollzug für widerspenstige Gefangene bereithält – bis hin zur Einzelhaft. Unter diesen, an Sklaverei grenzenden, Bedingungen geht die Arbeitsmoral gegen null.
Die Unternehmer sind trotzdem glücklich.
Leonard Hill, Besitzer eines texanischen Zulieferbetriebes der Computerindustrie, der in einem privaten Gefängnis unter anderem für IBM, Dell und Texas Industries produziert, äußerte sich im Januar 1995 freimütig:
"Normalerweise, wenn du in der freien Wirtschaft arbeitest, melden sich die Leute krank, sie haben Probleme mit dem Auto, sie haben familiäre Probleme. Hier haben wir das nicht. Der Staat zahlt für die medizinische Versorgung. Und: Die Leute fahren bestimmt nicht in Urlaub." Eve Goldberg und die US-amerikanische politische Gefangene Linda Evans kommentieren die Ausbeutung der Häftlinge so:
"Für Privatunternehmen ist Gefängnisarbeit eine Goldader. Keine Streiks. Keine gewerkschaftliche Organisierung. Keine Krankenversicherungskosten, keine Arbeitslosenversicherung oder Ausgleichszahlungen für Arbeiterinnen und Arbeiter. Keine Sprachbarrieren wie im Ausland. Neue riesige, schreckenerregende Gefängnisfabriken werden auf Tausenden von Hektar innerhalb der Anstaltsmauern gebaut. Gefangene erledigen die Datenerfassung für Chevron, übernehmen Telefonreservierungen für TWA, züchten Schweine, schaufeln Dünger, stellen Computerteile her, Limousinen, Wasserbetten und Unterwäsche für Victoria’s Secret – alles zu einem Bruchteil der Kosten der ‚freien Arbeit‘." Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die zwei Millionen Häftlinge in den Vereinigten Staaten entweder Sklavenarbeit verrichten oder arbeitslos sind. In den Arbeitslosenstatistiken sind sie nicht mitberücksichtigt. Das amerikanische "Jobwunder" ist auch darauf zurückzuführen, daß Arbeitslose ins Gefängnis gesteckt werden. Der Kriminologe David Downes sagt:
"Wenn man die Gefangenschaft als eine Art versteckte Arbeitslosigkeit ansieht, steigt die Arbeitslosenquote für Männer um ein Drittel auf 8%. Die Auswirkungen auf die Arbeitslosenrate unter afroamerikanischen Männern sind sogar noch größer, statt 11% steigt die Arbeitslosenquote hier auf 19%." Zahlen über inhaftierte Frauen und den Grad ihrer Ausbeutung sind nicht leicht zu bekommen. Wie in anderen Ländern auch, ist ihre Zahl bislang erheblich geringer als die der Männer. Es gibt aber einen Trend, verstärkt auch Frauen dem öffentlichen Bestrafungssystem zu unterwerfen. So bilden schwarze Frauen die am schnellsten wachsende Gefangenengruppe. Auch in Deutschland frißt sich der Neoliberalismus und sein Privatisierungswahn bis ins Justizvollzugssystem. So wird schon seit Jahren der Abschiebeknast Büren von Wachleuten eines Sicherheitsunternehmens geschützt Allerdings müssen diese Privatschützer stets zusammen mit einem staatlichen Justizvollzugsbeamten ihre Dienste erledigen.
Die Konstruktion ist in einer rechtlichen Grauzone angesiedelt, denn mit der "Doppelstreife" wird das Gewaltmonopol normativ nicht angetastet, andererseits aber bereits faktisch unterhöhlt. Auch die Wahl der Vollzugseinrichtung "Abschiebehaft" offenbart strategisches Geschick: Denn die nichtdeutschen Gefangenen sind mit einer äußerst geringen Beschwerdemacht ausgerüstet. Auf diese Weise haben sich auch in den USA privat betriebene Gefängnisse etabliert: Um den Strom illegaler Einwanderer aus der Karibik und Zentralamerika unter Kontrolle zu bekommen, griff die US-Einwanderungsbehörde Mitte der achtziger Jahre als erste staatliche Institution auf private Hafteinrichtungen zurück.
Doch auch der Bau von Knästen lohnt die Investition. Und auch hier beginnt die deutsche Situation sich der nordamerikanischen anzugleichen. Die "Rohloff GmbH" etwa kann sich als das erste deutsche Spezialunternehmen für den Bau von Hafteinrichtungen bezeichnen. 1993 stellte die Firma die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wuppertal für 200 Abschiebehäftlinge fertig, im gleichen Jahr die für 84 Abschiebehäftlinge angelegte JVA Glasmoor. In einem "Modularbauweise" genannten Verfahren stellt das Werk Container zu den benötigten Raumgrößen zusammen, die es verkauft oder vermietet.
Diesen Weg geht auch "Held Consultants & Partner" aus Bergisch Gladbach. Zwar kann sie im Gegensatz zur "Rohloff GmbH" noch auf keine in Deutschland fertig-gestellten Haftanstalten verweisen, sondern lediglich auf Hausanlagen für Asylbewerber und Obdachlose. Doch dafür beeindruckt "Held Consultants" mit einer Liste von in den USA erstellten Referenzbauten.
Auch andere nordamerikanische Gefängnisfirmen klopfen seit einiger Zeit verstohlen an die Türen der deutschen Justiz. So hat sich die "Prison Corporation of America" schriftlich und umstandslos aus Washington an die Justizverwaltungen der Länder gewandt:
"Wir helfen Landesregierungen in Deutschland, um der auch in Zukunft steigenden Wachstumsrate der Kriminalität und besonders der Gewaltverbrechen, der Jugend- und Kinderkriminalität auch nur einigermaßen gewachsen zu sein. [...] Deshalb unterbreiten wir vertrauensvoll Ihrer Regierung unsere kompletten Anstalts-Projekte mit sehr günstigen und langjährigen Pachtverträgen und sehr speziellen Dienstleistungen." Für den Fall eines Vertragsabschlusses hat die Gesellschaft angekündigt, eine "Deutsche Haft-Anstalten AG" mit Hauptsitz Deutschland gründen zu wollen. Die Entwicklung liegt offen vor uns. Es liegt an uns, sie jetzt zu diskutieren und dagegen vorzugehen. Schon vor vier Jahren stand in einer deutschen Tageszeitung zu lesen:
"Eine gesunde Bestrafungswirtschaft braucht eine kranke Gesellschaft. Nur so bleiben ihre Aktienkurse stabil. Sollte sich also die Privatisierung der Bestrafung durchsetzen, braucht die Bundesrepublik Kriminalität mehr denn je - schon aus privatwirtschaftlichen Gründen."
Eine Sendung des Rote Hilfe Radio (Hamburg) vom Juli 99
Gefängnisindustrie in den USA
Nashville, Tennessee, 28. August 1996: 5000 Besucher drängeln sich auf einer nicht ganz alltäglichen Fachmesse. Hier kann man Stacheldraht kaufen, spezielle Stühle zum Festschnallen und Anketten von Menschen, Schlagstöcke, Telefonüberwachungsanlagen, Metalldetektoren und eine unüberschaubare Masse anderer furchteinflößender Gegenstände. Wir sind auf der weltgrößten "Strafvollzugsmesse". An mehr als 600 Ständen bieten Unternehmen aus den gesamten Vereinigten Staaten ihre Dienste an – vom Hersteller simpler Plastikhandschellen über Dienstleistungsbetriebe, die besonders bullige Gefängniswärter anbieten bis hin zu Baufirmen, die Pläne ganzer Gefängniskomplexe ausstellen. Ein Blick auf diese Messe läßt ahnen, welche wirtschaftliche Bedeutung das Gefängniswesen in den USA bekommen hat. Was einst eine Nischenwirtschaft war, in der sich nur eine Handvoll Unternehmen tummelte, ist binnen weniger Jahre zu einer Multimilliardenindustrie angewachsen – mit Fachmessen, Verkaufsschauen, eigenen Websites, Mail-order-Katalogen und direct-marketing-Kampagnen. Eine eigene Repressionsindustrie ist entstanden, in der sich die größten Architekturbüros und Baufirmen des Landes ebenso tummeln wie Wall-Street-Investmentgesellschaften, die ihr Geld in Privatgefängnisse stecken, Lieferanten von Rohren und Sanitäranlagen, Unternehmen der Lebensmittelbranche, der Gesundheitsfürsorge und solche, die von kugelsicheren Überwachungskameras bis hin zu farbigen Gummizellen einfach alles anbieten.
Die Profite, um die es diesen Unternehmen geht, werden mit Strafgefangenen gemacht, deren Anzahl in schwindelerregende Höhen angestiegen ist. Die Vereinigten Staaten können sich mit Recht Weltmeister im Einsperren der eigenen Bevölkerung nennen. So sind heute mehr als zwei Millionen US-Bürger inhaftiert. Mehr als ein Prozent der männlichen erwachsenen Bevölkerung sitzt im Knast. Die "Einsperr-Rate" – also der Anteil von Inhaftierten an der Bevölkerung – ist die höchste in der Geschichte der Menschheit. Sie ist heute etwa zehnmal so hoch wie die durchschnittlicher europäischer Länder und mehr als 17mal so hoch wie die Japans. Alleine in Kalifornien sitzen mehr Menschen im Gefängnis als in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Japan, Singapur und den Niederlanden zusammen.
Das war nicht immer so: Die Zahl der kalifornischen Strafgefangenen hat sich in den letzten 20 Jahren verachtfacht. Dieser Trend war in den gesamten USA zu beobachten. Entsprach die "Einsperr-Rate" bis in die späten Siebziger in etwa der europäischer Länder, so stieg sie Anfang der Achtziger rapide an. Im darauffolgenden Jahrzehnt verdoppelte sich die Zahl der Gefängnisinsassen – und die nun doppelte Zahl verdoppelte sich wiederum in den Neunzigern ... oder genauer: Sie wurde verdoppelt.
Wie kam es zu diesen Masseninhaftierungen? Die Kriminalitätsrate fällt seit 1992, nichtsdestoweniger werden Jahr für Jahr mehr Menschen in immer neue Gefängnisse gesteckt. In den letzten 20 Jahren sind etwa eintausend neue Haftanstalten in den USA gebaut worden, fast alle sind hoffnungslos überfüllt.
Den entscheidenden Schritt zur Inhaftierung Hunderttausender von Menschen machte Anfang der achtziger Jahre die Reagan-Administration, als sie den sogenannten "War On Drugs", den Krieg gegen die Drogen, ausrief. Im Zuge einer angeblichen Drogenbekämpfungspolitik wurden die Gesetze landesweit verschärft und die Mindeststrafen erhöht. Seitdem werden deutlich mehr Gefängnisstrafen ausgesprochen, längere Strafen verhängt und weniger Bewährungsstrafen vergeben. Die Zahl der Inhaftierungen wegen Drogenvergehen ist seit dem Beginn des "War On Drugs" um sage und schreibe eintausend Prozent angestiegen. So sitzen heute alleine wegen Drogenvergehen erheblich mehr Menschen im Knast als noch vor zwanzig Jahren überhaupt Menschen im Gefängnis saßen.
Wogegen bzw. gegen wen sich der "War On Drugs" tatsächlich richtet, zeigt die Justizstatistik: 74% der wegen Drogen Eingesperrten sind Afroamerikaner, obwohl die Afroamerikaner nur 12% der US-Bevölkerung stellen.
Interessant ist auch ein mittlerweile berüchtigtes Antidrogengesetz von 1986: Nach ihm wird drakonisch bestraft, wer Kokain in Form von Crack mit sich führt. Relativ milde ist die Strafe für das Mitführen von Kokain in Pulverform. Um für zehn Jahre ins Gefängnis zu wandern, reicht der Besitz von 50 Gramm Crack – von Koks hingegen muß man schon fünf Kilo mit sich führen. Unnötig zu sagen, daß Crack die Droge der Armen und Koks die der Reichen ist.
Vor ein paar Jahren machte die Regierung Bill Clintons auch hierzulande Schlagzeilen, als sie das "Three strikes, you’re out"-Gesetz durchs Parlament brachte. "Three strikes, you’re out" (drei Treffer, und du bist raus), das bedeutet: Wer zum dritten Mal bei einer Straftat geschnappt wird, egal bei welcher, auch wenn es nur der Diebstahl einer Tafel Schokolade ist, wird automatisch zu lebenslanger Haft verurteilt. In derselben Legislaturperiode führte die Clinton-Administration eine Sozialreform durch, die den individuellen Anspruch auf Wohlfahrtsunterstützung beinahe gänzlich abschaffte. Nach den neuen Regelungen können Arme nicht mehr als zusammengerechnet drei Jahre ihres Lebens Wohlfahrtsunterstützung bekommen. Während die Sozialausgaben Jahr für Jahr weiter gesenkt wer-den – übrigens auch die öffentlichen Ausgaben fürs Bildungswesen –, explodieren die Ausgaben für den Strafvollzug. Im vergangenen Jahr gaben die Vereinigten Staaten 35 Milliarden Dollar für das Gefängniswesen aus.
Mit Recht wurde der "Krieg gegen das Verbrechen", den die Regierung ausgerufen hat, als größtes Projekt US-amerikanischer Sozialpolitik in unserem Jahrhundert bezeichnet. Paradoxerweise sorgt also gerade die angebliche Kriminalitätsbekämpfung für Kriminalität: Die zunehmende Armut, aus der die sogenannte Kriminalität entsteht, gibt es unter anderem, weil Gefängnisse gebaut werden, um die Armen darin einzusperren.
Die schwarze Hochschullehrerin Angela Davis schreibt dazu:
"Afro- und latinoamerikanische, indigene und viele asiatische Jugendliche werden als Vertreter von Gewalt und Drogenhandel dargestellt, die voller Neid sind wegen der Güter, die sie nicht besitzen. Junge Afro- und Latinoamerikanerinnen werden der sexuellen Promiskuität geziehen, und es wird ihnen unterstellt, sie produzierten ungehemmt Babys und Armut. Kriminalität und abweichendes Verhalten werden rassistisch aufgeladen. Die Überwachung wird auf die schwarzen Communities konzentriert, auf Einwanderer, Arbeitslose, Schulabgänger ohne Abschluß, Obdachlose und generell all diejenigen, die einen immer kleineren Anspruch auf die sozialen Ressourcen geltend machen können. Ihr Anspruch verringert sich, weil Polizei und Strafvollzugssystem diese Ressourcen zusehends verschlingen. Der gefängnisindustrielle Komplex hat so einen Teufelskreis geschaffen, der die Armut derer vertieft, deren Verarmung durch Gefangenschaft angeblich ‚gelöst‘ wurde." "Der Schwerpunkt der Regierungspolitik hat sich von der Sozialhilfe auf Kriminalitätskontrolle verlagert. Der Rassismus vertieft sich immer mehr in den ökonomischen und ideologischen Strukturen der US-Gesellschaft. Während sie sich gegen Förderprogramme für Minderheiten und zweisprachige Schulerziehung aussprechen, verkünden konservative Kampagnenführer das Ende des Rassismus. Sie behaupten, die Reste von Rassismus würden durch Dialog und Gesprächs-kreise beseitigt werden. Aber den gefängnisindustriellen Komplex werden Gesprächskreise über ‚Rassenbeziehungen‘ nicht abschaffen können – nährt er doch den in die tieferen Gesellschaftsstrukturen eingewobenen Rassismus und lebt von ihm."
Aber das Wegschließen von zwei Millionen meist armer Menschen ist nicht nur eine sozialpolitische Maßnahme. Das Gefängniswesen ist der am schnellsten wachsende Sektor der US-Industrie. Hier warten Milliardenprofite auf die Unternehmen – aber auch Städte, Gemeinden und Bundesstaaten profitieren von der Repressionsindustrie. Der Bau von Gefängnissen wird in so mancher unterentwickelten Gegend zum Grundstein wirtschaftlicher Entwicklung. Die Errichtung eines Knastes ist nicht nur ein Leckerbissen für die Bauindustrie, sondern auch für die Hersteller und Zulieferer sogenannter Sicherheitstechnologie – oft übrigens Technologien, die von Rüstungsunternehmen für das Militär entwickelt wurden und nun ihren Einsatz bei der Polizei und im Strafvollzugssystem finden. So ist die Repressionsindustrie mit der Rüstungsindustrie und dem Militär eng verwachsen. Einer der größten Rüstungsbetriebe der USA, Westinghouse Inc., beliefert auch einen großen Teil der Gefängnisse. Eine Reihe von Strafanstalten wird von dem multinationalen Sicherheitsdienst Wackenhut Corporation betrieben. Das Unternehmen, das Niederlassungen in mehr als 50 Staaten hat, und dessen jährliche Einkünfte sich auf mehr als eine Miliarde Dollar belaufen, hatte sich seit den 70er Jahren vor allem auf Streikbruch und Anti-Terrorismus-Aktivitäten konzentriert. Die Liste seiner Verwaltungsratsmitglieder liest sich wie ein Who‘s Who des militärisch-industriellen Komplexes. So sitzen dort zwei pensionierte Luftwaffengeneräle neben einem Ex-Marine-Corps-Kommandanten, einem ehemaligen Leiter des FBI, einem früheren Leiter des Militärgeheimdienstes, dem früheren Direktor der CIA und seinem Stellvertreter und nicht zuletzt dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Benjamin Civiletti.
Es liegt auf der Hand, daß ein Konzern, der Profit erwirtschaftet, indem er Gefängnisse betreibt, kein Interesse daran hat, daß die Zahl der Strafgefangenen abnimmt. Auch so ist es zu erklären, daß die Zahl der Gefängnisinsassen seit Jahren rapide steigt, obwohl die Kriminalitätszahlen seit Jahren sinken. Steven Donzinger, Vorsitzender der Nationalen Strafjustiz-Kommission, sagt dazu:
"Wenn die Kriminalität ansteigt, müssen wir mehr Gefängnisse bauen. Wenn die Kriminalität sinkt, dann deshalb, weil wir mehr Gefängnisse gebaut haben. Und deshalb wird die Kriminalität auch sinken, wenn wir noch mehr Gefängnisse bauen."
Mittlerweile lebt ein ganzer Industriezweig von der Massenbestrafung. Damit sie aufrecht erhalten wird, ist er strategisch davon abhängig, daß rassistische Strukturen und Ideologien, die die Menschen ins Gefängnis bringen, fortbestehen – oder, besser noch, sich ausweiten. Angela Davis schreibt dazu: "Damit die Körper geliefert werden können, die für das gewinnorientierte Strafvollzugssystem bestimmt sind, beruht die politische Ökonomie der Gefängnisse auf rassistisch bestimmten Annahmen über Kriminalität – z. B. den Bildern von schwarzen Müttern, die Sozialhilfe einheimsen, um kriminelle Kinder großzuziehen – und auf rassistischen Mustern bei der Festnahme, der Verurteilung und den Strafmaßen. Die Körper von Afro- und Latinoamerikanerinnen und –amerikanern sind in diesem riesigen Experiment der Hauptrohstoff, um die sozialen Probleme unsrer Zeit verschwinden zu lassen. Entkleidet man aber diese angebliche ‚Lösung durch Einsperren‘ ihrer magischen Aura, kommen Rassismus, Klassenvorurteile und die parasitäre Abschöpfung kapitalistischer Profite zum Vorschein." Auf verschiedenste Weise werden mit den Knastinsassen Gewinne erwirtschaftet. So prügeln sich die Telefongesellschaften geradezu darum, Strafanstalten mit Telefonanschlüssen zu versorgen. Sie geben den Gefängnisbetreibern, staatlich oder privat, Teile des Profits ab, sie installieren kostenlos Telefonabhöranlagen, sie zahlen hohe Provisionen. Warum? Die Gefängnisinsassen, die auf den telefonischen Kontakt zur Außenwelt angewiesen sind und sich ihren Telefonanbieter nicht aussuchen können, müssen bis zu fünfmal höhere Gebühren zahlen als die Menschen draußen. Es wird geschätzt, daß ein Häftling durchschnittlich 500 Dollar im Jahr fürs Telefonieren aufwenden muß. Bei zwei Millionen Gefangenen macht das eine Milliarde Dollar.
Aber auch die Arbeit der Gefangenen läßt sich nutzen. Die Zwangsarbeit von Häftlingen, die oft von Sklavenarbeit nicht mehr zu unterscheiden ist, hat in den Vereinigten Staaten Tradition. Im vorigen Jahrhundert wurden sie gezwungen, auf Plantagen zu arbeiten. Den Aufpassern trugen nicht nur Schußwaffen, sondern auch Peitschen, die sei bei Fehlverhalten der Häftlinge einsetzen durften.
In Tennessee wurden im Jahre 1892 bei einem Streik der Minenarbeiter Häftlinge gezwungen, als Streikbrecher Kohle abzubauen. Die Bergleute setzten dem aber ein Ende: Sie stürmten die Mine und befreiten die Strafgefangenen.
All das scheint heute Geschichte zu sein. Doch die berühmten Chain Gangs – Gruppen von Zwangsarbeitern, die meist mit Fußketten aneinander gefesselt waren und zum Beispiel im Straßenbau schufteten – existierten noch bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts ... und wurden vor vier Jahren, 1995, in Alabama und Arizona wieder eingeführt!
Dieses Jahr werden Häftlinge in den US-amerikanischen Gefängissen Güter im Wert von neun Milliarden Dollar produzieren. Oregon, dessen Verfassung alle Gefängnisinsassen zur Arbeit zwingt, macht öffentlich Werbung für seine Zwangsarbeiterheere. Übrigens mit dem Argument, daß auf diese Weise die Produktion im Lande bliebe, die sonst in Billiglohnländer abwandere. Kevin Mannix, Parlamentsabgeordneter in Oregon, nimmt kein Blatt vor den Mund: Im Oktober 94 forderte er Unternehmen auf, Verträge mit den Gefängnissen abzuschließen wie der Sportartikelhersteller Nike sie mit der indonesischen Regierung abgeschlossen hat. Nike zahlt seinen Arbeiterinnen und Arbeitern in Indonesien 1 Dollar 20 am Tag. "Wir finden, daß Nike sich die Transport- und Arbeitskosten noch einmal ansehen sollte", sagt Mannix. "Wir könnten Häftlingsarbeit anbieten, die da mithalten kann."
Tatsächlich liegt der Stundenlohn eines Häftlings meistens deutlich unter einem Dollar brutto. In Kalifornien etwa beträgt er 45 Cents. Bei einem 9-Stunden-Arbeitstag ergibt das einen stolzen Monatslohn von 60 Dollar netto. Zuweilen entspricht der Bruttolohn der Häftlinge auch dem gesetzlichen Mindestlohn. Dazu muß man allerdings wissen, daß der in den USA mittlerweile so niedrig liegt, daß jemand, der Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, ein monatliches Einkommen erwirtschaftet, das 50% unter der Armutsgrenze liegt. Von diesem Mindestlohn wird den Häftlingen oft noch bis zu 80% abgezogen – für "Kost und Logis", Gebühren und Opferentschädigung ... falls es Opfer gibt, denn die meisten Gefängnisinsassen sind verurteilt wegen Verbrechen, in denen es keine Opfer gibt, in aller Regel Drogenvergehen.
In den meisten Bundesstaaten der USA ist die Häftlingsarbeit offiziell freiwillig. Tatsächlich müssen aber Häftlinge, die die Arbeit verweigern, längere Strafen absitzen – wie es ja auch in der Bundesrepublik üblich ist. Sie werden mit dem ganzen Arsenal an Bestrafungsmaßnahmen überzogen, das der Strafvollzug für widerspenstige Gefangene bereithält – bis hin zur Einzelhaft. Unter diesen, an Sklaverei grenzenden, Bedingungen geht die Arbeitsmoral gegen null.
Die Unternehmer sind trotzdem glücklich.
Leonard Hill, Besitzer eines texanischen Zulieferbetriebes der Computerindustrie, der in einem privaten Gefängnis unter anderem für IBM, Dell und Texas Industries produziert, äußerte sich im Januar 1995 freimütig:
"Normalerweise, wenn du in der freien Wirtschaft arbeitest, melden sich die Leute krank, sie haben Probleme mit dem Auto, sie haben familiäre Probleme. Hier haben wir das nicht. Der Staat zahlt für die medizinische Versorgung. Und: Die Leute fahren bestimmt nicht in Urlaub." Eve Goldberg und die US-amerikanische politische Gefangene Linda Evans kommentieren die Ausbeutung der Häftlinge so:
"Für Privatunternehmen ist Gefängnisarbeit eine Goldader. Keine Streiks. Keine gewerkschaftliche Organisierung. Keine Krankenversicherungskosten, keine Arbeitslosenversicherung oder Ausgleichszahlungen für Arbeiterinnen und Arbeiter. Keine Sprachbarrieren wie im Ausland. Neue riesige, schreckenerregende Gefängnisfabriken werden auf Tausenden von Hektar innerhalb der Anstaltsmauern gebaut. Gefangene erledigen die Datenerfassung für Chevron, übernehmen Telefonreservierungen für TWA, züchten Schweine, schaufeln Dünger, stellen Computerteile her, Limousinen, Wasserbetten und Unterwäsche für Victoria’s Secret – alles zu einem Bruchteil der Kosten der ‚freien Arbeit‘." Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die zwei Millionen Häftlinge in den Vereinigten Staaten entweder Sklavenarbeit verrichten oder arbeitslos sind. In den Arbeitslosenstatistiken sind sie nicht mitberücksichtigt. Das amerikanische "Jobwunder" ist auch darauf zurückzuführen, daß Arbeitslose ins Gefängnis gesteckt werden. Der Kriminologe David Downes sagt:
"Wenn man die Gefangenschaft als eine Art versteckte Arbeitslosigkeit ansieht, steigt die Arbeitslosenquote für Männer um ein Drittel auf 8%. Die Auswirkungen auf die Arbeitslosenrate unter afroamerikanischen Männern sind sogar noch größer, statt 11% steigt die Arbeitslosenquote hier auf 19%." Zahlen über inhaftierte Frauen und den Grad ihrer Ausbeutung sind nicht leicht zu bekommen. Wie in anderen Ländern auch, ist ihre Zahl bislang erheblich geringer als die der Männer. Es gibt aber einen Trend, verstärkt auch Frauen dem öffentlichen Bestrafungssystem zu unterwerfen. So bilden schwarze Frauen die am schnellsten wachsende Gefangenengruppe. Auch in Deutschland frißt sich der Neoliberalismus und sein Privatisierungswahn bis ins Justizvollzugssystem. So wird schon seit Jahren der Abschiebeknast Büren von Wachleuten eines Sicherheitsunternehmens geschützt Allerdings müssen diese Privatschützer stets zusammen mit einem staatlichen Justizvollzugsbeamten ihre Dienste erledigen.
Die Konstruktion ist in einer rechtlichen Grauzone angesiedelt, denn mit der "Doppelstreife" wird das Gewaltmonopol normativ nicht angetastet, andererseits aber bereits faktisch unterhöhlt. Auch die Wahl der Vollzugseinrichtung "Abschiebehaft" offenbart strategisches Geschick: Denn die nichtdeutschen Gefangenen sind mit einer äußerst geringen Beschwerdemacht ausgerüstet. Auf diese Weise haben sich auch in den USA privat betriebene Gefängnisse etabliert: Um den Strom illegaler Einwanderer aus der Karibik und Zentralamerika unter Kontrolle zu bekommen, griff die US-Einwanderungsbehörde Mitte der achtziger Jahre als erste staatliche Institution auf private Hafteinrichtungen zurück.
Doch auch der Bau von Knästen lohnt die Investition. Und auch hier beginnt die deutsche Situation sich der nordamerikanischen anzugleichen. Die "Rohloff GmbH" etwa kann sich als das erste deutsche Spezialunternehmen für den Bau von Hafteinrichtungen bezeichnen. 1993 stellte die Firma die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wuppertal für 200 Abschiebehäftlinge fertig, im gleichen Jahr die für 84 Abschiebehäftlinge angelegte JVA Glasmoor. In einem "Modularbauweise" genannten Verfahren stellt das Werk Container zu den benötigten Raumgrößen zusammen, die es verkauft oder vermietet.
Diesen Weg geht auch "Held Consultants & Partner" aus Bergisch Gladbach. Zwar kann sie im Gegensatz zur "Rohloff GmbH" noch auf keine in Deutschland fertig-gestellten Haftanstalten verweisen, sondern lediglich auf Hausanlagen für Asylbewerber und Obdachlose. Doch dafür beeindruckt "Held Consultants" mit einer Liste von in den USA erstellten Referenzbauten.
Auch andere nordamerikanische Gefängnisfirmen klopfen seit einiger Zeit verstohlen an die Türen der deutschen Justiz. So hat sich die "Prison Corporation of America" schriftlich und umstandslos aus Washington an die Justizverwaltungen der Länder gewandt:
"Wir helfen Landesregierungen in Deutschland, um der auch in Zukunft steigenden Wachstumsrate der Kriminalität und besonders der Gewaltverbrechen, der Jugend- und Kinderkriminalität auch nur einigermaßen gewachsen zu sein. [...] Deshalb unterbreiten wir vertrauensvoll Ihrer Regierung unsere kompletten Anstalts-Projekte mit sehr günstigen und langjährigen Pachtverträgen und sehr speziellen Dienstleistungen." Für den Fall eines Vertragsabschlusses hat die Gesellschaft angekündigt, eine "Deutsche Haft-Anstalten AG" mit Hauptsitz Deutschland gründen zu wollen. Die Entwicklung liegt offen vor uns. Es liegt an uns, sie jetzt zu diskutieren und dagegen vorzugehen. Schon vor vier Jahren stand in einer deutschen Tageszeitung zu lesen:
"Eine gesunde Bestrafungswirtschaft braucht eine kranke Gesellschaft. Nur so bleiben ihre Aktienkurse stabil. Sollte sich also die Privatisierung der Bestrafung durchsetzen, braucht die Bundesrepublik Kriminalität mehr denn je - schon aus privatwirtschaftlichen Gründen."
Eine Sendung des Rote Hilfe Radio (Hamburg) vom Juli 99
http://www.kurier.at/wirtschaft/287441.php
Größte Krise seit Zweitem Weltkrieg
Sacramento - Die Misere ist perfekt. Dass im von der Pleite bedrohten Kalifornien bald die Lichter ausgehen, ist unwahrscheinlich. Doch das riesige Finanzloch zwingt den amerikanischen Bundesstaat zu drastischen Schritten. Auch die meisten anderen 49 Bundesstaaten stehen vor der schwersten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Außer Vermont müssen alle US-Bundesstaaten von Gesetz wegen ausgeglichene Haushalte vorlegen. Massachusetts hat deshalb 50.000 der Ärmsten aus der eigens für Geringverdiener eingerichteten staatliche Krankenversicherung geworfen. Kentucky entließ 1000 Gefangene vorzeitig aus den Gefängnissen. In Oregon wurden die Schulen früher geschlossen, um Reinigungskosten zu sparen.
Wie gewonnen, so zerronnen
Kalifornien ist mit einem Milliardenloch von 38 Milliarden Dollar (33 Milliarden Euro) einsamer Spitzenreiter. Dabei liegen die fetten Jahre noch nicht lange zurück: vor zwei Jahren überholte Kalifornien mit 1,3 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt Frankreich als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der Überschuss betrug neun Milliarden Dollar. Heute malen Politiker den Bankrott-Teufel an die Wand.
Bitte Warten
Mehr als 30.000 Staatsangestellte erhielten anstelle der erwarteten Gehaltserhöhungen Warnungen, dass ihre Jobs in Gefahr sind. Die Community Colleges in Los Angeles haben nur noch Geld bis Ende August. "Es kann sein, dass wir das Licht ausmachen und allen sagen müssen, sie sollen nach Hause gehen", meinte der Kanzler des Distrikts, Mark Drummond. Auch die Kleinsten sollen für das Finanzloch "zahlen": wer nicht am 1. September fünf Jahre alt ist, soll ein Jahr länger auf den Kindergarten-Platz warten. Bisher war der Geburtstags-Stichtag der 2. Dezember.
Kommt Schwarzenegger?
Im Parlament in Sacramento blockieren sich Demokraten und Republikaner gegenseitig mit Rezepten zur Bewältigung der Krise: die Demokraten um Gouverneur Gray Davis wollen die Steuern erhöhen, die Republikaner wollen die Ausgaben senken. Die Demokraten haben zwar die Mehrheit in beiden Häusern, doch brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit für das Budget. Die Republikaner haben bereits eine Wählerinitiative zur Absetzung von Davis gestartet. Sollte Davis tatsächlich sein Amt verlieren, könnte der aus Österreich stammende Filmstar Arnold Schwarzenegger als republikanischer Kandidat eine Chance auf dessen Nachfolge bekommen.
Geld: Woher nehmen, und nicht stehlen
Insgesamt schlossen 27 Staaten das vergangene Haushaltsjahr mit Fehlbeträgen ab. Der Verband der Budgetbeamten schätzt das gesamte Loch auf 53,5 Milliarden Dollar. Mindestens 41 Staaten rechnen im nächsten Jahr mit fehlenden Millionen. "Es ist eine der schlimmsten Situation, in der sich die Bundesstaaten seit dem 2. Weltkrieg je befunden haben, und das landesweit", sagte der Direktor des Verbandes, Scott Pattison, der Zeitung "Orlando Sentinel". Neben dem Niedergang der Konjunktur machen die Staaten auch einen massiven, aus Washington angeordneten Ausbau der Sicherheitsausgaben nach den Terroranschlägen vom 11. September und Steuersenkungen als Grund für die Misere geltend. Sie verlangen Bundeshilfe, doch Präsident George W. Bush ist auf diesem Ohr taub. Mit einem eigenen Rekorddefizit im Staatshaushalt von schätzungsweise 400 Milliarden Dollar in diesem Jahr und riesigen Ausgaben im Irak und anderswo im weltweiten Anti-Terror-Kampf ist in Washington nichts zu holen.
Artikel vom 06.07.2003

Größte Krise seit Zweitem Weltkrieg
Sacramento - Die Misere ist perfekt. Dass im von der Pleite bedrohten Kalifornien bald die Lichter ausgehen, ist unwahrscheinlich. Doch das riesige Finanzloch zwingt den amerikanischen Bundesstaat zu drastischen Schritten. Auch die meisten anderen 49 Bundesstaaten stehen vor der schwersten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Außer Vermont müssen alle US-Bundesstaaten von Gesetz wegen ausgeglichene Haushalte vorlegen. Massachusetts hat deshalb 50.000 der Ärmsten aus der eigens für Geringverdiener eingerichteten staatliche Krankenversicherung geworfen. Kentucky entließ 1000 Gefangene vorzeitig aus den Gefängnissen. In Oregon wurden die Schulen früher geschlossen, um Reinigungskosten zu sparen.
Wie gewonnen, so zerronnen
Kalifornien ist mit einem Milliardenloch von 38 Milliarden Dollar (33 Milliarden Euro) einsamer Spitzenreiter. Dabei liegen die fetten Jahre noch nicht lange zurück: vor zwei Jahren überholte Kalifornien mit 1,3 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt Frankreich als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der Überschuss betrug neun Milliarden Dollar. Heute malen Politiker den Bankrott-Teufel an die Wand.
Bitte Warten
Mehr als 30.000 Staatsangestellte erhielten anstelle der erwarteten Gehaltserhöhungen Warnungen, dass ihre Jobs in Gefahr sind. Die Community Colleges in Los Angeles haben nur noch Geld bis Ende August. "Es kann sein, dass wir das Licht ausmachen und allen sagen müssen, sie sollen nach Hause gehen", meinte der Kanzler des Distrikts, Mark Drummond. Auch die Kleinsten sollen für das Finanzloch "zahlen": wer nicht am 1. September fünf Jahre alt ist, soll ein Jahr länger auf den Kindergarten-Platz warten. Bisher war der Geburtstags-Stichtag der 2. Dezember.
Kommt Schwarzenegger?
Im Parlament in Sacramento blockieren sich Demokraten und Republikaner gegenseitig mit Rezepten zur Bewältigung der Krise: die Demokraten um Gouverneur Gray Davis wollen die Steuern erhöhen, die Republikaner wollen die Ausgaben senken. Die Demokraten haben zwar die Mehrheit in beiden Häusern, doch brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit für das Budget. Die Republikaner haben bereits eine Wählerinitiative zur Absetzung von Davis gestartet. Sollte Davis tatsächlich sein Amt verlieren, könnte der aus Österreich stammende Filmstar Arnold Schwarzenegger als republikanischer Kandidat eine Chance auf dessen Nachfolge bekommen.
Geld: Woher nehmen, und nicht stehlen
Insgesamt schlossen 27 Staaten das vergangene Haushaltsjahr mit Fehlbeträgen ab. Der Verband der Budgetbeamten schätzt das gesamte Loch auf 53,5 Milliarden Dollar. Mindestens 41 Staaten rechnen im nächsten Jahr mit fehlenden Millionen. "Es ist eine der schlimmsten Situation, in der sich die Bundesstaaten seit dem 2. Weltkrieg je befunden haben, und das landesweit", sagte der Direktor des Verbandes, Scott Pattison, der Zeitung "Orlando Sentinel". Neben dem Niedergang der Konjunktur machen die Staaten auch einen massiven, aus Washington angeordneten Ausbau der Sicherheitsausgaben nach den Terroranschlägen vom 11. September und Steuersenkungen als Grund für die Misere geltend. Sie verlangen Bundeshilfe, doch Präsident George W. Bush ist auf diesem Ohr taub. Mit einem eigenen Rekorddefizit im Staatshaushalt von schätzungsweise 400 Milliarden Dollar in diesem Jahr und riesigen Ausgaben im Irak und anderswo im weltweiten Anti-Terror-Kampf ist in Washington nichts zu holen.
Artikel vom 06.07.2003

http://news.focus.msn.de/G/GN/gn.htm?snr=121922&streamsnr=7
Bush sieht USA weiter im Krieg
Amerika wird sich nach den Worten seines Präsidenten auch in Zukunft mit Präventivschlägen gegen „Terrorgruppen oder ein verbrecherisches Regime“ wehren. Die USA hätten aus den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gelernt und eine Offensive gegen den internationalen Terrorismus und seine Helfer gestartet, sagte George W. Bush am Freitagabend in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag. „Wann immer es nötig wird, werden wir handeln, um Leben und Freiheit des amerikanischen Volkes zu schützen“, so der Präsident.
Den Krieg in Irak verteidigte Bush erneut. „Wir werden nicht zulassen, dass eine Terrorgruppe oder ein verbrecherisches Regime uns mit Massenvernichtungswaffen bedroht“, sagte er vor mehreren Tausend Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson nahe Dayton im Staat Ohio. Die USA befänden sich weiter im Krieg und würden „nicht auf einen weiteren Angriff warten oder auf die Zurückhaltung oder die guten Absichten der Bösen vertrauen“.
05.07.03, 13:35 Uhr

Bush sieht USA weiter im Krieg
Amerika wird sich nach den Worten seines Präsidenten auch in Zukunft mit Präventivschlägen gegen „Terrorgruppen oder ein verbrecherisches Regime“ wehren. Die USA hätten aus den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gelernt und eine Offensive gegen den internationalen Terrorismus und seine Helfer gestartet, sagte George W. Bush am Freitagabend in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag. „Wann immer es nötig wird, werden wir handeln, um Leben und Freiheit des amerikanischen Volkes zu schützen“, so der Präsident.
Den Krieg in Irak verteidigte Bush erneut. „Wir werden nicht zulassen, dass eine Terrorgruppe oder ein verbrecherisches Regime uns mit Massenvernichtungswaffen bedroht“, sagte er vor mehreren Tausend Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson nahe Dayton im Staat Ohio. Die USA befänden sich weiter im Krieg und würden „nicht auf einen weiteren Angriff warten oder auf die Zurückhaltung oder die guten Absichten der Bösen vertrauen“.
05.07.03, 13:35 Uhr

http://money.msn.de/investor/meinung/markuskoch/default.asp?…
4. Juli - Ein stolzes Volk feiert sich selbst
Rund um Manhattan - im Hudson und im East River - haben die flachen Frachter Stellung genommen, auf denen in den nächsten 24 Stunden das größte Feuerwerk der Geschichte vorbereitet werden soll. Am Abend des 4. Juli wird es dann unter Getöse und den Augen von Präsident Bush und Arnold Schwarzenegger gezündet. Amerika feiert - sich.
Was man zur Zeit genau feiert, ist für Außenstehende nicht leicht zu verstehen. Denn international hat Amerika viel von seiner Glorie eingebüßt. Der Irakkrieg war zwar militärisch gesehen einer der erfolgreichsten Feldzüge der Geschichte, doch bleibt die amerikanische Regierung eine Rechtfertigung schuldig. Auch andernorts hat man den Kampf gegen den Terrorismus nicht gewonnen - nicht einmal in Afghanistan, wo man immer noch auf der Suche nach dem 9/11-Drahtzieher Bin Laden ist.
Doch nicht nur international, auch innerhalb der eigenen Grenzen ist in den USA vieles im argen. Das wird einen Tag vor dem Nationalfeiertag wieder einmal deutlich. Bei einem Blick auf den Arbeitsmarkt sträubt sich Beobachtern das Nackenhaar, eine Arbeitslosenquote von 6,4 % hatte man nicht erwartet. So schlecht sah der Job-Markt seit 10 Jahren nicht aus, und das ist besonders beunruhigend, als andere Konjunkturbarometer und vor allem der Aktienmarkt auf eine Erholung deuten.
Eine "job loss recovery” - eine Erholung auf Kosten der Arbeitsplätze - wäre nun das Letzte, was Amerika und vor allem Präsident Bush brauchen könnten. Vor allem letzterer muss sich mittlerweile um seine Wiederwahl sorgen, nachdem kein Krieg der Welt die arbeitslosen über die massiven Probleme im eigenen Land hinwegtrösten wird.
So hört es sich vor dem 4. Juli eigentlich nicht nach Feiertags-Laune an - und doch knallen die Korken. Tausende rot-weiß-blaue Feuerwerke werden den Himmel über den USA am Wochenende erleuchten, die Hauptstraßen in allen großen Städten werden in einem patriotischen Fahnenmeer versinken. Denn die Amerikaner wollen feiern, vor allem sich selbst und - völlig unreflektiert - ihr Land. Laut einer Umfrage am Donnerstagmorgen sind sie stolzer denn je.
Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat den Stolz der Amerikaner gemessen. "Wie stolz sind sie, Amerikaner zu sein?" - Die Antworten fallen sensationell aus: 70 % der Amerikaner sind "extrem stolz", und weitere 20 % sind "sehr stolz". Von den übrigen ausgewiesenen 9 % fallen immer noch zahlreiche auf "einigermaßen stolz", und nur einer Handvoll scheint "wenig" oder "gar nicht" eingefallen zu sein.
Die Fragestellung - und die Antworten - lassen vermuten, dass auch das ansonsten seriöse Gallup-Institut in seiner Umfrage mit dem McDonalds-System gearbeitet hat. Dort gibt es Coca-Cola in den Größten "Mittel", "Groß" und "Super-Groß". Das klingt halt besser und wird dem Wahn gerecht.
Und doch sind die Amerikaner an diesem 4. Juli nicht nur "sehr stolz" und "extrem stolz" - sie sind sogar noch stolzer. Noch stolzer als ihre Nachbarn, nämlich. Während sich 70 % für "extrem stolz" halten, sehen sie den Durchschnittsamerikaner nur zu 42 % als "extrem stolz" an. So glaubt jeder, noch ein wenig amerikanischer zu sein als der nächste. Stolzer als du. Stolzer als die da drüben. Stolzer als alle anderen.
Die dritte Frage in der Gallup-Umfrage macht den Leser indes stutzig. Nur 50 % der Amerikaner glauben, dass die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung (1776) mit Amerika heute "zufrieden" wären, ganze 48 % glauben, dass die Gründerväter "enttäuscht" wären. Woher bei all der Kritik der fast schon fanatische Stolz kommt, ist völlig unklar - wahrscheinlich haben die meisten einfach die Frage nicht verstanden.
Sei`s drum - ein jeder versteht, dass am Freitag gefeiert wird. Die New Yorker werden sich an beiden Flüssen versammeln, in Washington steigen die Raketen gut sichtbar von der Terrasse des Weißen Hauses aus der nahen Mall. In den Küstenstaaten wird es Millionen an den Strand ziehen, anderswo trifft man sich im Park. Unter blau-weiß-rotem Konfettiregen feiert sich ein Volk, das sich in der Gunst Gottes wähnt, und viele könnten auch über das lange Wochenende hinaus feiern. Sie haben ja keine Arbeit.
-----
Es sind schon klügere Weltmachten untergegangen!
4. Juli - Ein stolzes Volk feiert sich selbst
Rund um Manhattan - im Hudson und im East River - haben die flachen Frachter Stellung genommen, auf denen in den nächsten 24 Stunden das größte Feuerwerk der Geschichte vorbereitet werden soll. Am Abend des 4. Juli wird es dann unter Getöse und den Augen von Präsident Bush und Arnold Schwarzenegger gezündet. Amerika feiert - sich.
Was man zur Zeit genau feiert, ist für Außenstehende nicht leicht zu verstehen. Denn international hat Amerika viel von seiner Glorie eingebüßt. Der Irakkrieg war zwar militärisch gesehen einer der erfolgreichsten Feldzüge der Geschichte, doch bleibt die amerikanische Regierung eine Rechtfertigung schuldig. Auch andernorts hat man den Kampf gegen den Terrorismus nicht gewonnen - nicht einmal in Afghanistan, wo man immer noch auf der Suche nach dem 9/11-Drahtzieher Bin Laden ist.

Doch nicht nur international, auch innerhalb der eigenen Grenzen ist in den USA vieles im argen. Das wird einen Tag vor dem Nationalfeiertag wieder einmal deutlich. Bei einem Blick auf den Arbeitsmarkt sträubt sich Beobachtern das Nackenhaar, eine Arbeitslosenquote von 6,4 % hatte man nicht erwartet. So schlecht sah der Job-Markt seit 10 Jahren nicht aus, und das ist besonders beunruhigend, als andere Konjunkturbarometer und vor allem der Aktienmarkt auf eine Erholung deuten.
Eine "job loss recovery” - eine Erholung auf Kosten der Arbeitsplätze - wäre nun das Letzte, was Amerika und vor allem Präsident Bush brauchen könnten. Vor allem letzterer muss sich mittlerweile um seine Wiederwahl sorgen, nachdem kein Krieg der Welt die arbeitslosen über die massiven Probleme im eigenen Land hinwegtrösten wird.
So hört es sich vor dem 4. Juli eigentlich nicht nach Feiertags-Laune an - und doch knallen die Korken. Tausende rot-weiß-blaue Feuerwerke werden den Himmel über den USA am Wochenende erleuchten, die Hauptstraßen in allen großen Städten werden in einem patriotischen Fahnenmeer versinken. Denn die Amerikaner wollen feiern, vor allem sich selbst und - völlig unreflektiert - ihr Land. Laut einer Umfrage am Donnerstagmorgen sind sie stolzer denn je.
Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat den Stolz der Amerikaner gemessen. "Wie stolz sind sie, Amerikaner zu sein?" - Die Antworten fallen sensationell aus: 70 % der Amerikaner sind "extrem stolz", und weitere 20 % sind "sehr stolz". Von den übrigen ausgewiesenen 9 % fallen immer noch zahlreiche auf "einigermaßen stolz", und nur einer Handvoll scheint "wenig" oder "gar nicht" eingefallen zu sein.
Die Fragestellung - und die Antworten - lassen vermuten, dass auch das ansonsten seriöse Gallup-Institut in seiner Umfrage mit dem McDonalds-System gearbeitet hat. Dort gibt es Coca-Cola in den Größten "Mittel", "Groß" und "Super-Groß". Das klingt halt besser und wird dem Wahn gerecht.
Und doch sind die Amerikaner an diesem 4. Juli nicht nur "sehr stolz" und "extrem stolz" - sie sind sogar noch stolzer. Noch stolzer als ihre Nachbarn, nämlich. Während sich 70 % für "extrem stolz" halten, sehen sie den Durchschnittsamerikaner nur zu 42 % als "extrem stolz" an. So glaubt jeder, noch ein wenig amerikanischer zu sein als der nächste. Stolzer als du. Stolzer als die da drüben. Stolzer als alle anderen.
Die dritte Frage in der Gallup-Umfrage macht den Leser indes stutzig. Nur 50 % der Amerikaner glauben, dass die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung (1776) mit Amerika heute "zufrieden" wären, ganze 48 % glauben, dass die Gründerväter "enttäuscht" wären. Woher bei all der Kritik der fast schon fanatische Stolz kommt, ist völlig unklar - wahrscheinlich haben die meisten einfach die Frage nicht verstanden.
Sei`s drum - ein jeder versteht, dass am Freitag gefeiert wird. Die New Yorker werden sich an beiden Flüssen versammeln, in Washington steigen die Raketen gut sichtbar von der Terrasse des Weißen Hauses aus der nahen Mall. In den Küstenstaaten wird es Millionen an den Strand ziehen, anderswo trifft man sich im Park. Unter blau-weiß-rotem Konfettiregen feiert sich ein Volk, das sich in der Gunst Gottes wähnt, und viele könnten auch über das lange Wochenende hinaus feiern. Sie haben ja keine Arbeit.
-----
Es sind schon klügere Weltmachten untergegangen!
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,256065,00.html
EX-US-DIPLOMAT BELASTET BUSH
"Wobei haben sie noch gelogen?"
Ein amerikanischer Ex-Diplomat erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-Regierung. Die Fakten über vermeintliche Massenvernichtungswaffen im Irak seien falsch dargestellt worden.
Washington - US-Präsident George W. Bush und Außenminister Colin Powell hätten die Behauptung, der Irak habe in Niger Uran gekauft, trotz erheblicher Zweifel an der Richtigkeit mehrfach wiederholt, schrieb Joseph Wilson am Sonntag in der "New York Times". Der Geheimdienst CIA hatte Wilson Anfang vergangenen Jahres selbst nach Niger geschickt, um den Berichten nachzugehen. Er habe anschließend seine Überzeugung, dass nichts daran sei, an die CIA weitergeleitet, schrieb Wilson. Dennoch nannten Bush und andere den angeblichen Uran-Kauf mehrfach als Beweis für geheime Waffenprogramme des Irak. Kurz vor Ausbruch des Irak-Krieges lieferte der Direktor der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEO), Mohammed al-Baradei, im UN-Sicherheitsrat den Beweis, dass die Kauf-Dokumente gefälscht waren.
"Es geht darum, dass die Regierung die Fakten in einer Sache, die die grundlegende Rechtfertigung für den Krieg war, falsch repräsentiert hat", sagte Wilson in einem Interview mit der "Washington Post". "Da stellt sich die Frage: wobei haben sie noch gelogen?" Wilson war 23 Jahre bis 1998 im diplomatischen Dienst, unter anderem 1990 als Charge d`Affaire in Bagdad und als Botschafter in Gabon und Sao Tome und Principe.
------
Die Mahner werden mehr
EX-US-DIPLOMAT BELASTET BUSH
"Wobei haben sie noch gelogen?"
Ein amerikanischer Ex-Diplomat erhebt schwere Vorwürfe gegen die US-Regierung. Die Fakten über vermeintliche Massenvernichtungswaffen im Irak seien falsch dargestellt worden.
Washington - US-Präsident George W. Bush und Außenminister Colin Powell hätten die Behauptung, der Irak habe in Niger Uran gekauft, trotz erheblicher Zweifel an der Richtigkeit mehrfach wiederholt, schrieb Joseph Wilson am Sonntag in der "New York Times". Der Geheimdienst CIA hatte Wilson Anfang vergangenen Jahres selbst nach Niger geschickt, um den Berichten nachzugehen. Er habe anschließend seine Überzeugung, dass nichts daran sei, an die CIA weitergeleitet, schrieb Wilson. Dennoch nannten Bush und andere den angeblichen Uran-Kauf mehrfach als Beweis für geheime Waffenprogramme des Irak. Kurz vor Ausbruch des Irak-Krieges lieferte der Direktor der Internationalen Atomenergie-Behörde (IAEO), Mohammed al-Baradei, im UN-Sicherheitsrat den Beweis, dass die Kauf-Dokumente gefälscht waren.
"Es geht darum, dass die Regierung die Fakten in einer Sache, die die grundlegende Rechtfertigung für den Krieg war, falsch repräsentiert hat", sagte Wilson in einem Interview mit der "Washington Post". "Da stellt sich die Frage: wobei haben sie noch gelogen?" Wilson war 23 Jahre bis 1998 im diplomatischen Dienst, unter anderem 1990 als Charge d`Affaire in Bagdad und als Botschafter in Gabon und Sao Tome und Principe.
------
Die Mahner werden mehr

Unser großer Kämpfer von Texas will bestimmt neuer Napoleon werden.
Allerdings erst dann, wenn er Macht verliert, kann er beweisen, wie mutig er ist.
Allerdings erst dann, wenn er Macht verliert, kann er beweisen, wie mutig er ist.

#331 von tsekh
Bush selbst macht gar nichts. Er tut nur das was seine Berater für richtig halten.
Ist nur ne Marionette, die Schnapfsdrossel.
Bush selbst macht gar nichts. Er tut nur das was seine Berater für richtig halten.
Ist nur ne Marionette, die Schnapfsdrossel.
Wenn`s nicht so ernst wär, könnte man ja darüber lachen:
U.S., Indonesian jets in standoff
By LELY T. DJUHARI, Associated Press
July 5, 2003
JAKARTA, Indonesia - In a tense encounter above the Java sea, U.S. fighter planes went into attack mode and locked their missiles on Indonesian warplanes deployed to intercept them, an Indonesian air force official said Friday.
Rear Air Marshal Wresnowiro said air force radar detected the F-18 Hornet planes maneuvering over Bawean Island off the northern coast of Java island on Thursday.
Two Indonesian F-16 fighter jets intercepted the U.S. planes and warned them they were in Indonesian airspace, he said.
"It was tense as the F-18 planes went into attack positions," said Wresnowiro, who goes by a single name. "They adopted an attack maneuver and had their missiles locked on our planes, ready to fire."
Wresnowiro said the planes were guarding an aircraft carrier, two frigates and a tanker traveling in the area.
The naval convoy was not in an international sea lane and had sought permission from the Indonesian government, he said, "but our bureaucracy is too slow to pass the security clearance."
Wresnowiro said Indonesia was considering whether to send the United States a complaint.
A U.S. Embassy spokeswoman said officials were looking into the report.
Nationalist politicians and military officers have long complained about espionage flights or clandestine airdrops by foreign aircraft across Indonesia`s 13,000 islands, which sit strategically between the Pacific and Indian Oceans.
"President Megawati Sukarnoputri must strongly protest the arrogant actions of U.S. pilots, which have insulted Indonesia`s sovereignty," nationalist legislators said in a statement.
http://www.knoxnews.com/kns/world/article/0,1406,KNS_351_208…
Erinnert etwas an den Flugzeugträgerverband der USA welcher vor Jahren einen kanadischen Leuchtturm unter Gewaltandrohung zu einem "Kurswechsel" bewegen wollte ....
....
syr
U.S., Indonesian jets in standoff
By LELY T. DJUHARI, Associated Press
July 5, 2003
JAKARTA, Indonesia - In a tense encounter above the Java sea, U.S. fighter planes went into attack mode and locked their missiles on Indonesian warplanes deployed to intercept them, an Indonesian air force official said Friday.
Rear Air Marshal Wresnowiro said air force radar detected the F-18 Hornet planes maneuvering over Bawean Island off the northern coast of Java island on Thursday.
Two Indonesian F-16 fighter jets intercepted the U.S. planes and warned them they were in Indonesian airspace, he said.
"It was tense as the F-18 planes went into attack positions," said Wresnowiro, who goes by a single name. "They adopted an attack maneuver and had their missiles locked on our planes, ready to fire."
Wresnowiro said the planes were guarding an aircraft carrier, two frigates and a tanker traveling in the area.
The naval convoy was not in an international sea lane and had sought permission from the Indonesian government, he said, "but our bureaucracy is too slow to pass the security clearance."
Wresnowiro said Indonesia was considering whether to send the United States a complaint.
A U.S. Embassy spokeswoman said officials were looking into the report.
Nationalist politicians and military officers have long complained about espionage flights or clandestine airdrops by foreign aircraft across Indonesia`s 13,000 islands, which sit strategically between the Pacific and Indian Oceans.
"President Megawati Sukarnoputri must strongly protest the arrogant actions of U.S. pilots, which have insulted Indonesia`s sovereignty," nationalist legislators said in a statement.
http://www.knoxnews.com/kns/world/article/0,1406,KNS_351_208…
Erinnert etwas an den Flugzeugträgerverband der USA welcher vor Jahren einen kanadischen Leuchtturm unter Gewaltandrohung zu einem "Kurswechsel" bewegen wollte
 ....
....syr
Wie meinte Rumsi jeweils? Plünderungen durch Iraker sind normal nach der Zeit. Nun, aber was ist min den GI`s  ?
?
Grounding Planes the Wrong Way
Coalition troops looted and vandalized the Iraqi airport that now must be rebuilt
By SIMON ROBINSON/BAGHDAD
Sunday, Jul. 06, 2003
Much has been written about how Iraqis complicated the task of rebuilding their country by looting it after Saddam Hussein`s regime fell. In the case of the international airport outside Baghdad, however, the theft and vandalism were conducted largely by victorious American troops, according to U.S. officials, Iraqi Airways staff members and other airport workers. The troops, they say, stole duty-free items, needlessly shot up the airport and trashed five serviceable Boeing airplanes. "I don`t want to detract from all the great work that`s going into getting the airport running again," says Lieut. John Welsh, the Army civil-affairs officer charged with bringing the airport back into operation. "But you`ve got to ask, If this could have been avoided, did we shoot ourselves in the foot here?"
What was then called Saddam International Airport fell to soldiers of the 3rd Infantry Division on April 3. For the next two weeks, airport workers say, soldiers sleeping in the airport`s main terminal helped themselves to items in the duty-free shop, including alcohol, cassettes, perfume, cigarettes and expensive watches. Welsh, who arrived in Iraq in late April, was so alarmed by the thievery that he rounded up a group of Iraqi airport employees to help him clean out the shop and its storage area. He locked everything in two containers and turned them over to the shop`s owner.
"The man had tears in his eyes when I showed him what we had saved," says Welsh. "He thought he`d lost everything."
Coalition soldiers also vandalized the airport, American sources say. A boardroom table that Welsh and Iraqi civil-aviation authority officials sat around in early May was, a week later, a pile of glass and splintered wood. Terminal windows were smashed, and almost every door in the building was broken, says Welsh. A TIME photographer who flew out of the airport on April 12 saw wrecked furniture and English-language graffiti throughout the airport office building as well as a sign warning that soldiers caught vandalizing or looting would be court-martialed. "There was no chance this was done by Iraqis" before the airport fell, says a senior Pentagon official. "The airport was secure when this was done." Iraqi airport staff concede that some of the damage was inflicted by Iraqi exiles attached to the Army, but these Iraqis too were under American control.
The airplanes suffered the greatest damage. Of the 10 Iraqi Airways jets on the tarmac when the airport fell, a U.S. inspection in early May found that five were serviceable: three 727s, a 747 and a 737. Over the next few weeks, U.S. soldiers looking for comfortable seats and souvenirs ripped out many of the planes` fittings, slashed seats, damaged cockpit equipment and popped out every windshield. "It`s unlikely any of the planes will fly again," says Welsh, a reservist who works for the aviation firm Pratt & Whitney as a quality-control liaison officer to Boeing.
U.S. estimates of the cost of the damage and theft begin at a few million dollars and go as high as $100 million. Airport workers say even now air conditioners and other equipment are regularly stolen. "Soldiers do this stuff all the time, everywhere. It`s warfare," says a U.S. military official. "But the conflict was over when this was done. These are just bored soldiers." Says Welsh: "If we`re here to rebuild the country, then anything we break we have to fix. We need to train these guys to go from shoot-it-up to securing infrastructure. Otherwise we`re just making more work for ourselves. And we have to pay for it."
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1101030714-…
Muss ein geiles Gefühl sein: erst gegen bessere Bauernjungen "kämpfen" und danach sich wie die Vandalen aufführen. Great, realy great America ....
....
syr
From the Jul. 14, 2003 issue of TIME magazine
 ?
?Grounding Planes the Wrong Way
Coalition troops looted and vandalized the Iraqi airport that now must be rebuilt
By SIMON ROBINSON/BAGHDAD
Sunday, Jul. 06, 2003
Much has been written about how Iraqis complicated the task of rebuilding their country by looting it after Saddam Hussein`s regime fell. In the case of the international airport outside Baghdad, however, the theft and vandalism were conducted largely by victorious American troops, according to U.S. officials, Iraqi Airways staff members and other airport workers. The troops, they say, stole duty-free items, needlessly shot up the airport and trashed five serviceable Boeing airplanes. "I don`t want to detract from all the great work that`s going into getting the airport running again," says Lieut. John Welsh, the Army civil-affairs officer charged with bringing the airport back into operation. "But you`ve got to ask, If this could have been avoided, did we shoot ourselves in the foot here?"
What was then called Saddam International Airport fell to soldiers of the 3rd Infantry Division on April 3. For the next two weeks, airport workers say, soldiers sleeping in the airport`s main terminal helped themselves to items in the duty-free shop, including alcohol, cassettes, perfume, cigarettes and expensive watches. Welsh, who arrived in Iraq in late April, was so alarmed by the thievery that he rounded up a group of Iraqi airport employees to help him clean out the shop and its storage area. He locked everything in two containers and turned them over to the shop`s owner.
"The man had tears in his eyes when I showed him what we had saved," says Welsh. "He thought he`d lost everything."
Coalition soldiers also vandalized the airport, American sources say. A boardroom table that Welsh and Iraqi civil-aviation authority officials sat around in early May was, a week later, a pile of glass and splintered wood. Terminal windows were smashed, and almost every door in the building was broken, says Welsh. A TIME photographer who flew out of the airport on April 12 saw wrecked furniture and English-language graffiti throughout the airport office building as well as a sign warning that soldiers caught vandalizing or looting would be court-martialed. "There was no chance this was done by Iraqis" before the airport fell, says a senior Pentagon official. "The airport was secure when this was done." Iraqi airport staff concede that some of the damage was inflicted by Iraqi exiles attached to the Army, but these Iraqis too were under American control.
The airplanes suffered the greatest damage. Of the 10 Iraqi Airways jets on the tarmac when the airport fell, a U.S. inspection in early May found that five were serviceable: three 727s, a 747 and a 737. Over the next few weeks, U.S. soldiers looking for comfortable seats and souvenirs ripped out many of the planes` fittings, slashed seats, damaged cockpit equipment and popped out every windshield. "It`s unlikely any of the planes will fly again," says Welsh, a reservist who works for the aviation firm Pratt & Whitney as a quality-control liaison officer to Boeing.
U.S. estimates of the cost of the damage and theft begin at a few million dollars and go as high as $100 million. Airport workers say even now air conditioners and other equipment are regularly stolen. "Soldiers do this stuff all the time, everywhere. It`s warfare," says a U.S. military official. "But the conflict was over when this was done. These are just bored soldiers." Says Welsh: "If we`re here to rebuild the country, then anything we break we have to fix. We need to train these guys to go from shoot-it-up to securing infrastructure. Otherwise we`re just making more work for ourselves. And we have to pay for it."
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1101030714-…
Muss ein geiles Gefühl sein: erst gegen bessere Bauernjungen "kämpfen" und danach sich wie die Vandalen aufführen. Great, realy great America
 ....
....syr
From the Jul. 14, 2003 issue of TIME magazine
#333
"Erinnert etwas an den Flugzeugträgerverband der USA welcher vor Jahren einen kanadischen Leuchtturm unter Gewaltandrohung zu einem "Kurswechsel" bewegen wollte ...."
Ein Nullblicker wie du verwechselt schon mal Realität und Fiktion.

Welche Hirngespinnste und Märchen haben dich eigentlich ursprünglich zu deiner erbärmlichen Agitation getrieben?
http://www.mendosa.com/bigship.html
http://vikingphoenix.com/news/archives/1997/mil97002.htm
http://www.urbanlegends.com/misc/lighthouse_tins.html
"Erinnert etwas an den Flugzeugträgerverband der USA welcher vor Jahren einen kanadischen Leuchtturm unter Gewaltandrohung zu einem "Kurswechsel" bewegen wollte ...."
Ein Nullblicker wie du verwechselt schon mal Realität und Fiktion.

Welche Hirngespinnste und Märchen haben dich eigentlich ursprünglich zu deiner erbärmlichen Agitation getrieben?
http://www.mendosa.com/bigship.html
http://vikingphoenix.com/news/archives/1997/mil97002.htm
http://www.urbanlegends.com/misc/lighthouse_tins.html
Was bist den du für ein Volltrottel  ? Zum "Glück" gab es ja "keine" Untersuchung dazu von der Navy. Aber man glaubt lieber Stuss aus dem Internet
? Zum "Glück" gab es ja "keine" Untersuchung dazu von der Navy. Aber man glaubt lieber Stuss aus dem Internet  ....
....
syr
 ? Zum "Glück" gab es ja "keine" Untersuchung dazu von der Navy. Aber man glaubt lieber Stuss aus dem Internet
? Zum "Glück" gab es ja "keine" Untersuchung dazu von der Navy. Aber man glaubt lieber Stuss aus dem Internet  ....
....syr

Zurück zum Thema. Der Bub kriegt sonst Besuch in seinen Threads  ....
....
Spiegel online- 08. Juli 2003, 14:08
Aussichten für die US-Börse
P - O - P - P
Von Thomas Hillenbrand

Nach der beeindruckenden Rallye der vergangenen Wochen haben US-Aktien inzwischen ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis als auf dem Höhepunkt des Booms im Jahr 2000. Allzu optimistischen Investoren droht ein böses Erwachen.
Hamburg - Selbst nach einer inzwischen fast vier Monate dauernden Rallye an den internationalen Aktienmärkten sind viele Investoren immer noch besoffen vor Optimismus. "Wir sind mit der Rallye noch lange nicht fertig", jubelt etwa James Grefenstette, Fondsmanager bei Federated Growth Strategies.
Obwohl der Leitindex Dow Jones seit dem Tiefstand 11. März mehr als 20 Prozent zugelegt hat, sehen viele Experten immer noch reichlich Potenzial - sowohl für die USA als auch für Europa. Richard Davidson, europäischer Aktienstratege bei Morgan Stanley, glaubt zwar nicht an einen mehrjährigen Boom wie in den Neunzigern. "Dennoch gibt es keinen Grund, das Geld jetzt aus dem Markt zu nehmen, so der Experte. "Weitere 10 Prozent sind sicher".
Die Mehrheit der Experten sieht das ähnlich. Nach einer Untersuchung des Marktforschers Investors Intelligence, der regelmäßig Börsenpublikationen auswertet, sind derzeit mehr als 70 Prozent der Investoren "bullish" gestimmt.
Die überbordende Zuversicht ist erstaunlich. Denn während Aktienbewertungen und ökonomische Daten in Europa noch halbwegs passabel aussehen, muss jedem Anleger, der in den USA investiert hat, beim genaueren Hinsehen eigentlich der kalte Schweiß ausbrechen.
"Denn seine Zuversicht vergeht, seine Hoffnung ist Spinnweb"
Da wäre zunächst das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das den Börsenwert eines Unternehmens relativ zu den erwirtschafteten Profiten misst. Die im amerikanischen Standard & Poor`s Index notierten 500 wichtigsten US-Aktien weisen derzeit ein KGV von 33 auf. Ein ähnlich hohes KGV gab es beim S&P zuletzt im März 2000 - kurz bevor die Aktienblase platzte.
Boom-Apologeten wenden ein, die Maßzahl sei zwar sehr hoch, aber zurzeit nicht relevant. Wichtiger erscheint ihnen die Tatsache, dass die historisch niedrigen Zinsen für Staats- und Unternehmensanleihen eine Investition in Aktien angeblich besonders attraktiv machen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Zinssatz unlängst auf ein 45-Jahres-Tief von einem Prozent gesenkt, zehnjährige US-Staatsanleihen werfen derzeit nur magere 3,7 Prozent Rendite ab - Aktien, so die Hoffnung, brächten wesentlich mehr.
Das Argument hat einige Haken. Erstens steigt die Anleihenrendite umso stärker, je mehr Investoren wieder Aktien kaufen. Denn um sich mit Anteilsscheinen von Unternehmen einzudecken, verkaufen viele Investoren derzeit ihre Anleihen. Dadurch sinken die Kurse für Schuldpapiere, was wiederum deren Rendite steigen lässt. Bond-Experten erwarten, dass die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen innerhalb der nächsten Monate über vier Prozent klettert - der Anreiz, Aktien zu kaufen wird also mit jedem Rallye-Tag geringer.
Zweitens basiert die Rechnung, dass der Aktieninvestor den Bond-Anleger bei der Rendite mühelos schlägt, auf der Annahme, die Börse werde in diesem Jahr mindestens vier Prozent steigen. Auch hier ist vor allem das Prinzip Hoffnung im Spiel: Denn nur weil die Kurse an den Rentenmärkten fallen, muss die Wall Street noch lange nicht steigen.
"Hab` ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht"
Der zweite Stolperstein ist die Finanzielle Situation der US-Konsumenten. Deren Lust am Shoppen hat die US-Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit immer wieder vor einem erneuten Abgleiten in die Rezession bewahrt. Der US-Einzelhandel verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten Umsatzzuwächse von mehr als sechs Prozent. Die meisten Aktienstrategen setzen für die kommenden Monate noch weitaus größere Hoffnungen in die amerikanischen Verbraucher: Die Märkte erwarten, dass die Gewinne der US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte um 14 Prozent steigen - ohne äußerst spendable Konsumenten wird dieses Wunder kaum möglich sein.
Die Aktiengurus könnten wieder einmal daneben liegen. Denn es sieht so aus, als ob den privaten Haushalten demnächst die Puste ausgehen könnte. Schon seit Jahren leben die Konsumenten ihn den USA weit über ihre Verhältnisse. 14 Prozent ihres erwirtschafteten Einkommens müssen die Bürger inzwischen durchschnittlich für die Schuldentilgung aufwenden.
Dass die Amerikaner mit ihrer "Buy now, pay later"-Mentalität in den vergangenen Jahren dennoch über die Runden kamen, lag vor allem am Immobilienmarkt. Weil die Preise für Grundbesitz in den vergangenen Jahren stark stiegen und die Zinsen fielen, konnten US-Hausbesitzer bestehende Hypotheken neu verhandeln und erhielten so zusätzliche Finanzmittel. Zudem haben amerikanischen Hausbesitzer sich größere Schuldenlasten auf die Dächer geladen als je zuvor. Charles Peabody vom Analysehaus Portalies Partners hat errechnet, dass der Durchschnittsamerikaner 1982 sein Haus nur zu 30 Prozent mit Krediten finanziert hatte. Heute sind es 55 Prozent.
Die Hauspreise dürften in Zukunft kaum weiter steigen; viele Beobachter reden sogar von einer Immobilienblase, die bald platzen werde. Angesichts dieser Aussichten hält Peabody die hohen Hypotheken der US-Haushalte laut dem Wirtschaftsmagazin "Barron`s" für eine "unheilvolle Rezeptur".
"Ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist"
Zudem könnten die hoch verschuldeten Konsumenten schon bald in die Zinsfalle tappen. Sobald die Zinsen wieder steigen, werden die klammen Amerikaner Probleme beim Abstottern ihrer Kredite bekommen. Indizien für mittelfristig kletternde Zinsen gibt es reichlich. Im Frühjahr 2004 könnte die Fed den Leitzins wieder erhöhen. Auch die fallenden Kurse an den Anleihemärkten bewirken einen Zinsanstieg. Und dann ist da noch das völlig außer Kontrolle geratene US-Leistungsbilanzdefizit (das Saldo aus Kapitaleinfuhren und Ausfuhren), das die Fed ebenfalls dazu zwingen könnte, die Zinsen zügiger heraufzusetzen als bisher angenommen. Viele US-Bürger haben deshalb begonnen, ihr Geld beisammen zu halten: Die Sparquote, lange Zeit nahe Null, ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen.
Auch die ökonomischen Daten machen wenig Hoffnung. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni auf ein Neun-Jahreshoch gestiegen und liegt inzwischen bei 6,4 Prozent. "Kann es seine wirtschaftliche Erholung ohne Jobs geben?" fragt Sung Won Sohn, Ökonom bei Wells Fargo. Und liefert die Antwort gleich mit: "Eine Erholung ohne Arbeitsplätze wird nicht von Dauer sein. Nach einiger Zeit wird sie in sich zusammenbrechen."
Auch der Index des Institute of Supply Managers (ISM), der die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe misst, deutet darauf hin, dass die Produktion zumindest in Teilen der US-Wirtschaft weiterhin schrumpft. Die ISM-Daten waren in fast allen Punkten ernüchternd. Dennoch gelang es der Wall Street vergangene Woche, sich auch diese augenscheinlich miesen Nachrichten schön zu drehen. Die Bullenfraktion pickte sich kurzerhand eine randseitige Zahl (den Eingang neuer Aufträge) aus dem ISM-Datensammelsurium heraus und erklärte diese laut "Wall Street Journal" zum einzig "wichtigen Indikator zukünftiger Aktivität". Unbeantwortet blieb leider die Frage, warum eine für die nahe Zukunft derart positiv gestimmte Branche laut ISM immer noch Leute entlässt.
Optimismus ist eben doch alles: Nach Bekanntgabe der Zahlen war der Dow vergangene Woche zunächst deutlich eingebrochen. Nach der Umdeutung dreht er ins Plus.
URL: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,256203,00.html
syr
 ....
....Spiegel online- 08. Juli 2003, 14:08
Aussichten für die US-Börse
P - O - P - P
Von Thomas Hillenbrand

Nach der beeindruckenden Rallye der vergangenen Wochen haben US-Aktien inzwischen ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis als auf dem Höhepunkt des Booms im Jahr 2000. Allzu optimistischen Investoren droht ein böses Erwachen.
Hamburg - Selbst nach einer inzwischen fast vier Monate dauernden Rallye an den internationalen Aktienmärkten sind viele Investoren immer noch besoffen vor Optimismus. "Wir sind mit der Rallye noch lange nicht fertig", jubelt etwa James Grefenstette, Fondsmanager bei Federated Growth Strategies.
Obwohl der Leitindex Dow Jones seit dem Tiefstand 11. März mehr als 20 Prozent zugelegt hat, sehen viele Experten immer noch reichlich Potenzial - sowohl für die USA als auch für Europa. Richard Davidson, europäischer Aktienstratege bei Morgan Stanley, glaubt zwar nicht an einen mehrjährigen Boom wie in den Neunzigern. "Dennoch gibt es keinen Grund, das Geld jetzt aus dem Markt zu nehmen, so der Experte. "Weitere 10 Prozent sind sicher".
Die Mehrheit der Experten sieht das ähnlich. Nach einer Untersuchung des Marktforschers Investors Intelligence, der regelmäßig Börsenpublikationen auswertet, sind derzeit mehr als 70 Prozent der Investoren "bullish" gestimmt.
Die überbordende Zuversicht ist erstaunlich. Denn während Aktienbewertungen und ökonomische Daten in Europa noch halbwegs passabel aussehen, muss jedem Anleger, der in den USA investiert hat, beim genaueren Hinsehen eigentlich der kalte Schweiß ausbrechen.
"Denn seine Zuversicht vergeht, seine Hoffnung ist Spinnweb"
Da wäre zunächst das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das den Börsenwert eines Unternehmens relativ zu den erwirtschafteten Profiten misst. Die im amerikanischen Standard & Poor`s Index notierten 500 wichtigsten US-Aktien weisen derzeit ein KGV von 33 auf. Ein ähnlich hohes KGV gab es beim S&P zuletzt im März 2000 - kurz bevor die Aktienblase platzte.
Boom-Apologeten wenden ein, die Maßzahl sei zwar sehr hoch, aber zurzeit nicht relevant. Wichtiger erscheint ihnen die Tatsache, dass die historisch niedrigen Zinsen für Staats- und Unternehmensanleihen eine Investition in Aktien angeblich besonders attraktiv machen. Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Zinssatz unlängst auf ein 45-Jahres-Tief von einem Prozent gesenkt, zehnjährige US-Staatsanleihen werfen derzeit nur magere 3,7 Prozent Rendite ab - Aktien, so die Hoffnung, brächten wesentlich mehr.
Das Argument hat einige Haken. Erstens steigt die Anleihenrendite umso stärker, je mehr Investoren wieder Aktien kaufen. Denn um sich mit Anteilsscheinen von Unternehmen einzudecken, verkaufen viele Investoren derzeit ihre Anleihen. Dadurch sinken die Kurse für Schuldpapiere, was wiederum deren Rendite steigen lässt. Bond-Experten erwarten, dass die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen innerhalb der nächsten Monate über vier Prozent klettert - der Anreiz, Aktien zu kaufen wird also mit jedem Rallye-Tag geringer.
Zweitens basiert die Rechnung, dass der Aktieninvestor den Bond-Anleger bei der Rendite mühelos schlägt, auf der Annahme, die Börse werde in diesem Jahr mindestens vier Prozent steigen. Auch hier ist vor allem das Prinzip Hoffnung im Spiel: Denn nur weil die Kurse an den Rentenmärkten fallen, muss die Wall Street noch lange nicht steigen.
"Hab` ich das Gold zu meiner Zuversicht gemacht"
Der zweite Stolperstein ist die Finanzielle Situation der US-Konsumenten. Deren Lust am Shoppen hat die US-Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit immer wieder vor einem erneuten Abgleiten in die Rezession bewahrt. Der US-Einzelhandel verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten Umsatzzuwächse von mehr als sechs Prozent. Die meisten Aktienstrategen setzen für die kommenden Monate noch weitaus größere Hoffnungen in die amerikanischen Verbraucher: Die Märkte erwarten, dass die Gewinne der US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte um 14 Prozent steigen - ohne äußerst spendable Konsumenten wird dieses Wunder kaum möglich sein.
Die Aktiengurus könnten wieder einmal daneben liegen. Denn es sieht so aus, als ob den privaten Haushalten demnächst die Puste ausgehen könnte. Schon seit Jahren leben die Konsumenten ihn den USA weit über ihre Verhältnisse. 14 Prozent ihres erwirtschafteten Einkommens müssen die Bürger inzwischen durchschnittlich für die Schuldentilgung aufwenden.
Dass die Amerikaner mit ihrer "Buy now, pay later"-Mentalität in den vergangenen Jahren dennoch über die Runden kamen, lag vor allem am Immobilienmarkt. Weil die Preise für Grundbesitz in den vergangenen Jahren stark stiegen und die Zinsen fielen, konnten US-Hausbesitzer bestehende Hypotheken neu verhandeln und erhielten so zusätzliche Finanzmittel. Zudem haben amerikanischen Hausbesitzer sich größere Schuldenlasten auf die Dächer geladen als je zuvor. Charles Peabody vom Analysehaus Portalies Partners hat errechnet, dass der Durchschnittsamerikaner 1982 sein Haus nur zu 30 Prozent mit Krediten finanziert hatte. Heute sind es 55 Prozent.
Die Hauspreise dürften in Zukunft kaum weiter steigen; viele Beobachter reden sogar von einer Immobilienblase, die bald platzen werde. Angesichts dieser Aussichten hält Peabody die hohen Hypotheken der US-Haushalte laut dem Wirtschaftsmagazin "Barron`s" für eine "unheilvolle Rezeptur".
"Ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist"
Zudem könnten die hoch verschuldeten Konsumenten schon bald in die Zinsfalle tappen. Sobald die Zinsen wieder steigen, werden die klammen Amerikaner Probleme beim Abstottern ihrer Kredite bekommen. Indizien für mittelfristig kletternde Zinsen gibt es reichlich. Im Frühjahr 2004 könnte die Fed den Leitzins wieder erhöhen. Auch die fallenden Kurse an den Anleihemärkten bewirken einen Zinsanstieg. Und dann ist da noch das völlig außer Kontrolle geratene US-Leistungsbilanzdefizit (das Saldo aus Kapitaleinfuhren und Ausfuhren), das die Fed ebenfalls dazu zwingen könnte, die Zinsen zügiger heraufzusetzen als bisher angenommen. Viele US-Bürger haben deshalb begonnen, ihr Geld beisammen zu halten: Die Sparquote, lange Zeit nahe Null, ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen.
Auch die ökonomischen Daten machen wenig Hoffnung. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni auf ein Neun-Jahreshoch gestiegen und liegt inzwischen bei 6,4 Prozent. "Kann es seine wirtschaftliche Erholung ohne Jobs geben?" fragt Sung Won Sohn, Ökonom bei Wells Fargo. Und liefert die Antwort gleich mit: "Eine Erholung ohne Arbeitsplätze wird nicht von Dauer sein. Nach einiger Zeit wird sie in sich zusammenbrechen."
Auch der Index des Institute of Supply Managers (ISM), der die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe misst, deutet darauf hin, dass die Produktion zumindest in Teilen der US-Wirtschaft weiterhin schrumpft. Die ISM-Daten waren in fast allen Punkten ernüchternd. Dennoch gelang es der Wall Street vergangene Woche, sich auch diese augenscheinlich miesen Nachrichten schön zu drehen. Die Bullenfraktion pickte sich kurzerhand eine randseitige Zahl (den Eingang neuer Aufträge) aus dem ISM-Datensammelsurium heraus und erklärte diese laut "Wall Street Journal" zum einzig "wichtigen Indikator zukünftiger Aktivität". Unbeantwortet blieb leider die Frage, warum eine für die nahe Zukunft derart positiv gestimmte Branche laut ISM immer noch Leute entlässt.
Optimismus ist eben doch alles: Nach Bekanntgabe der Zahlen war der Dow vergangene Woche zunächst deutlich eingebrochen. Nach der Umdeutung dreht er ins Plus.
URL: http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,256203,00.html
syr

#336
Danke für die Bestätigung, daß du tatsächlich an diese urbane Legende glaubst.
Du hättest dich herausreden können, #333 wäre ironisch gemeint o.ä., aber nein, du mußtest dich als Märchengläubiger outen.
Danke.

Danke für die Bestätigung, daß du tatsächlich an diese urbane Legende glaubst.
Du hättest dich herausreden können, #333 wäre ironisch gemeint o.ä., aber nein, du mußtest dich als Märchengläubiger outen.
Danke.

Ich sach ja, glaub du mal den Stuss aus dem Internet  .... Auf den Seiten hat`s ja interessante Beispiele ...
.... Auf den Seiten hat`s ja interessante Beispiele ...
ps. Für dein "Allgemeinbefinden" machst du wohl besser einen Bogen um diesen Thread, GWB kannst du ja gut verteidigen. Aber leider nicht zwischen Regierung und Land unterscheiden. Oder sollte ich diffenenzieren sagen. Wann kommen erste Copy/Past`s ?
?
syr
 .... Auf den Seiten hat`s ja interessante Beispiele ...
.... Auf den Seiten hat`s ja interessante Beispiele ...ps. Für dein "Allgemeinbefinden" machst du wohl besser einen Bogen um diesen Thread, GWB kannst du ja gut verteidigen. Aber leider nicht zwischen Regierung und Land unterscheiden. Oder sollte ich diffenenzieren sagen. Wann kommen erste Copy/Past`s
 ?
?syr
#339 ist ein ärmlicher Versuch, die Sache noch umzubiegen.
Mit "Stuss" hast du eindeutig nicht deine Leuchtturm-Fabel, sondern die Gegenargumente aus den Links gemeint.
Erst denken, dann posten.
Das war eine weitere kostenfreie Belehrung.

Mit "Stuss" hast du eindeutig nicht deine Leuchtturm-Fabel, sondern die Gegenargumente aus den Links gemeint.
Erst denken, dann posten.
Das war eine weitere kostenfreie Belehrung.

Jo, richtig erkannt Bub, deine Links und deren Inhalt waren gemeint ....
....
ps. Gebe morgen Abend Kurs, Erwachsenenbildung. Hätten noch Plätze frei ... Aber nicht "for free" auch nicht für Dich
... Aber nicht "for free" auch nicht für Dich  ...
...
syr
 ....
....ps. Gebe morgen Abend Kurs, Erwachsenenbildung. Hätten noch Plätze frei
 ... Aber nicht "for free" auch nicht für Dich
... Aber nicht "for free" auch nicht für Dich  ...
...syr

Thema:
"Marxismus-Leninismus für Anfänger"
oder
"Bombenbau für Rechtgläubige"
oder
"Urban Legends - warum ich daran glaube"
oder
"Lobotomiert und trotzdem Spaß"
?
"Marxismus-Leninismus für Anfänger"
oder
"Bombenbau für Rechtgläubige"
oder
"Urban Legends - warum ich daran glaube"
oder
"Lobotomiert und trotzdem Spaß"
?
@ borazon
mir ist nicht wirklich bekannt, was du hier im thread willst!
trage was zum thema bei oder beglücke uns mit deiner abwesenheit!
mir ist nicht wirklich bekannt, was du hier im thread willst!
trage was zum thema bei oder beglücke uns mit deiner abwesenheit!

Ist Dr. Jekyll schon in den Feierabend geschickt worden, Mr. Hyde?


Rumsfeld: Benötigen zusätzliche Mittel für 2004
Washington (vwd) - Das US-Haushaltsbüro arbeitet nach Angaben von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld bereits an einem Nachtragshaushalt für die Finanzierung der in Irak stationierten Truppen. Welches Volumen dieser Haushaltsposten 2004 haben werde, wisse er jedoch nicht, sagte Rumsfeld am Mittwoch vor dem Streitkräfteausschuss des Senates. Für die Zeit von Januar bis September habe das Verteidigungsministerium monatliche Ausgaben von 3,9 Mrd USD veranschlagt, sage der Minister weiter. Das Fikslajahr 2004 beginnt im Oktober.
Die monatlichen Kosten des Afghanistan-Einsatzes bezifferte Rumsfeld vor dem Ausschuss auf 700 Mio USD und die gesamten monatlichen Kosten für die weltweite Terror-Bekämpfung auf 1,5 Mrd USD. Der Haushaltsentwurf 2004 von Präsident George W. Bush beinhaltet ein Defizit von 307 Mrd USD. Darin sind die genannten zusätzlichen Ausgaben jedoch noch nicht enthalten.
vwd/DJ/9.7.2003/hab
-----
Da geht was!
Washington (vwd) - Das US-Haushaltsbüro arbeitet nach Angaben von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld bereits an einem Nachtragshaushalt für die Finanzierung der in Irak stationierten Truppen. Welches Volumen dieser Haushaltsposten 2004 haben werde, wisse er jedoch nicht, sagte Rumsfeld am Mittwoch vor dem Streitkräfteausschuss des Senates. Für die Zeit von Januar bis September habe das Verteidigungsministerium monatliche Ausgaben von 3,9 Mrd USD veranschlagt, sage der Minister weiter. Das Fikslajahr 2004 beginnt im Oktober.
Die monatlichen Kosten des Afghanistan-Einsatzes bezifferte Rumsfeld vor dem Ausschuss auf 700 Mio USD und die gesamten monatlichen Kosten für die weltweite Terror-Bekämpfung auf 1,5 Mrd USD. Der Haushaltsentwurf 2004 von Präsident George W. Bush beinhaltet ein Defizit von 307 Mrd USD. Darin sind die genannten zusätzlichen Ausgaben jedoch noch nicht enthalten.
vwd/DJ/9.7.2003/hab
-----
Da geht was!

08.07. 22:42
USA: Konsumentenverschuldung steigt
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die amerikanischen Verbraucher haben sich im Mai noch mehr verschuldet, wie aus aktuellen Wirtschaftszahlen hervorgeht. Danach stieg die Zahl der US-Konsumentenkredite im Mai um 7,3 Milliarden $ auf 1,76 Bio $. Der Nettokredit, also der Verbraucherkredit abzüglich der hinterlegten Sicherheiten, stieg um 5% im Mai nach einem 5,4%igen Anstieg im April. Die Schulden durch Kreditkarten stieg um 5,3% im Jahresvergleich, was den höchsten Zuwachs seit vier Monaten bedeutet. Der nichtrevolvierende Kredit (wie der KFZ-Kredit) stieg um 4,9%.
--------
Wachstum, Wachstum, Wachstum und verdammt nochmal Wachstum


USA: Konsumentenverschuldung steigt
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Die amerikanischen Verbraucher haben sich im Mai noch mehr verschuldet, wie aus aktuellen Wirtschaftszahlen hervorgeht. Danach stieg die Zahl der US-Konsumentenkredite im Mai um 7,3 Milliarden $ auf 1,76 Bio $. Der Nettokredit, also der Verbraucherkredit abzüglich der hinterlegten Sicherheiten, stieg um 5% im Mai nach einem 5,4%igen Anstieg im April. Die Schulden durch Kreditkarten stieg um 5,3% im Jahresvergleich, was den höchsten Zuwachs seit vier Monaten bedeutet. Der nichtrevolvierende Kredit (wie der KFZ-Kredit) stieg um 4,9%.
--------
Wachstum, Wachstum, Wachstum und verdammt nochmal Wachstum



http://www.aktiencheck.de/analysen/default_an.asp?sub=6&page…
09.07.2003
USA senkt Staatsdefizit
DekaBank
Eine nachgelagerte Besteuerung lässt die Staatsdefizite der USA in ferner Zukunft geringer ausfallen (Boskin-Studie), so die Analysten der DekaBank.
In den langfristigen Projektionen des Congressional Budget Office (CBO) zur Entwicklung des Staatshaushalts in den Vereinigten Staaten bis zum Jahre 2075 seien keine Steuereinnahmen berücksichtigt worden, die aus der Auflösung nachgelagert besteuerter privater Rentensparpläne resultieren würden. Bereits jetzt seien in den entsprechenden privaten Alterversorgungskonten etwa 10,5 Bill. USD angespart. Das entspreche etwa dem jetzigen Bruttoinlandsprodukt.
Beim aktuellem Vorgehen "rechne man sich dort ärmer als man sei", es handele sich nicht um einen buchhalterischen Trick, wenn die in weiterer Zukunft anfallenden Steuereinnahmen defizitmindernd einbezogen würden.
An den Finanzmärkten seien aktuell anhaltende Staatsdefizite und eine in Zukunft weiter wachsende Staatsverschuldung eingepreist. Die Berücksichtigung höherer zukünftiger Steuereinnahmen dürfte, unter sonst gleichen Bedingungen, in den nächsten Jahrzehnten zu einem geringeren Kapitalbedarf des Staates und damit niedrigeren langfristigen Renditen führen.
----------
Und der Osterhase kommt demnächst in langen Unterhosen
09.07.2003
USA senkt Staatsdefizit
DekaBank
Eine nachgelagerte Besteuerung lässt die Staatsdefizite der USA in ferner Zukunft geringer ausfallen (Boskin-Studie), so die Analysten der DekaBank.
In den langfristigen Projektionen des Congressional Budget Office (CBO) zur Entwicklung des Staatshaushalts in den Vereinigten Staaten bis zum Jahre 2075 seien keine Steuereinnahmen berücksichtigt worden, die aus der Auflösung nachgelagert besteuerter privater Rentensparpläne resultieren würden. Bereits jetzt seien in den entsprechenden privaten Alterversorgungskonten etwa 10,5 Bill. USD angespart. Das entspreche etwa dem jetzigen Bruttoinlandsprodukt.
Beim aktuellem Vorgehen "rechne man sich dort ärmer als man sei", es handele sich nicht um einen buchhalterischen Trick, wenn die in weiterer Zukunft anfallenden Steuereinnahmen defizitmindernd einbezogen würden.
An den Finanzmärkten seien aktuell anhaltende Staatsdefizite und eine in Zukunft weiter wachsende Staatsverschuldung eingepreist. Die Berücksichtigung höherer zukünftiger Steuereinnahmen dürfte, unter sonst gleichen Bedingungen, in den nächsten Jahrzehnten zu einem geringeren Kapitalbedarf des Staates und damit niedrigeren langfristigen Renditen führen.
----------
Und der Osterhase kommt demnächst in langen Unterhosen

09.07. 18:52
Cisco Systems berichtigt Zeitungsbericht
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Cisco Systems (WKN: 878841, Nasdaq: CSCO) teilt zur Stunde mit, dass die niederländische Zeitung den Vorstandschef John Chambers falsch interpretiert hätte. Die holländische Tageszeitung „Het Financieele Dagblad“ berichtete am Mittwoch, dass Chambers eine Erholung der IT-Investitionen binnen zwei bis vier Monaten erwarte. Cisco Sprecher Robyn Jenkins-Blum sagte nun in einer Berichtigung, dass Chambers von einem Wiedereinsetzen der IT-Investitionen ausgeht, sobald es den Unternehmen in zwei bis vier Monaten wieder besser gehe. Damit entsprechen die Aussagen von Chambers jenen, die er auch in den letzten Monaten und Quartalen machte. Laut Jenkins-Blum sagte Chambers gar, dass der Zeitpunkt des Beginns der Erholung völlig unklar sei. Sollte die Erholung aber eintreten, so Jenkins-Blum in Bezugnahme auf Chambers, so würde sich dies erst auf Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und danach auf größere Unternehmen auswirken. Ähnliches sagte Chambers auch auf einer Thomas Weisel im Juni.
---------
Aufschwung kommt !
Cisco Systems berichtigt Zeitungsbericht
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Cisco Systems (WKN: 878841, Nasdaq: CSCO) teilt zur Stunde mit, dass die niederländische Zeitung den Vorstandschef John Chambers falsch interpretiert hätte. Die holländische Tageszeitung „Het Financieele Dagblad“ berichtete am Mittwoch, dass Chambers eine Erholung der IT-Investitionen binnen zwei bis vier Monaten erwarte. Cisco Sprecher Robyn Jenkins-Blum sagte nun in einer Berichtigung, dass Chambers von einem Wiedereinsetzen der IT-Investitionen ausgeht, sobald es den Unternehmen in zwei bis vier Monaten wieder besser gehe. Damit entsprechen die Aussagen von Chambers jenen, die er auch in den letzten Monaten und Quartalen machte. Laut Jenkins-Blum sagte Chambers gar, dass der Zeitpunkt des Beginns der Erholung völlig unklar sei. Sollte die Erholung aber eintreten, so Jenkins-Blum in Bezugnahme auf Chambers, so würde sich dies erst auf Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und danach auf größere Unternehmen auswirken. Ähnliches sagte Chambers auch auf einer Thomas Weisel im Juni.
---------
Aufschwung kommt !

dolby,
gute info - arbeit. dickes lob.
amerika verkommt immer mehr zum märchenonkel !

cu
rightnow
gute info - arbeit. dickes lob.

amerika verkommt immer mehr zum märchenonkel !


cu
rightnow
Kommt bald mehr 
Kannst ja mithelfen

Kannst ja mithelfen

10/07/2003 21:57
US-Finanzminister Snow nächste Woche in Frankfurt und London
Washington, 10. Jul (Reuters) - US-Finanzminister John Snow
wird nach Angaben seines Ministeriums vom 15. bis zum 18. Juli
bei Besuchen in London und Frankfurt über die Weltwirtschaft und
die notwendige Flexibilität in der Wirtschaftspolitik sprechen.
Snow werde dabei voraussichtlich mit Wirtschaftsexperten der
deutschen und der britischen Regierung sowie anderen Volkswirten
und Vertretern der Wirtschaft zusammentreffen, teilte das
Finanzministerium am Donnerstag in Washington mit. "Minister
Snow wird die Bedeutung der Flexibilität in der
Wirtschaftspolitik unterstreichen, die für höhere Produktivität,
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen
erforderlich ist", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.
fgc/tcs
---------
Labern bis das Licht ausgeht. Warum reden momentan so viele über Arbeit für alle?
Sind etwa Wahlen? Ist die Arbeitslosigkeit gestiegen???
US-Finanzminister Snow nächste Woche in Frankfurt und London
Washington, 10. Jul (Reuters) - US-Finanzminister John Snow
wird nach Angaben seines Ministeriums vom 15. bis zum 18. Juli
bei Besuchen in London und Frankfurt über die Weltwirtschaft und
die notwendige Flexibilität in der Wirtschaftspolitik sprechen.
Snow werde dabei voraussichtlich mit Wirtschaftsexperten der
deutschen und der britischen Regierung sowie anderen Volkswirten
und Vertretern der Wirtschaft zusammentreffen, teilte das
Finanzministerium am Donnerstag in Washington mit. "Minister
Snow wird die Bedeutung der Flexibilität in der
Wirtschaftspolitik unterstreichen, die für höhere Produktivität,
Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen
erforderlich ist", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.
fgc/tcs
---------
Labern bis das Licht ausgeht. Warum reden momentan so viele über Arbeit für alle?
Sind etwa Wahlen? Ist die Arbeitslosigkeit gestiegen???

!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
05:52 Uhr
CIA-Chef übernimmt Verantwortung für falsche Irak-Äußerung Bushs
Washington (dpa) - CIA-Direktor George Tenet hat die Verantwortung für eine umstrittene Passage zu Iraks angeblichen Atomwaffenplänen in einer Rede von US-Präsident George W. Bush im Januar übernommen. Tenet bestätigte, dass der entsprechende Satz von der CIA gebilligt worden sei. Bush hatte im Kongress gesagt, der Irak habe versucht, in Afrika Uran für sein Atomwaffenprogramm zu kaufen. Diese Bemerkung basierte im Wesentlichen auf teilweise falschen Informationen des britischen Geheimdienstes, wie sich später herausstellte.
-----
Hat sich endlich ein Bauernopfer gefunden
CIA-Chef übernimmt Verantwortung für falsche Irak-Äußerung Bushs
Washington (dpa) - CIA-Direktor George Tenet hat die Verantwortung für eine umstrittene Passage zu Iraks angeblichen Atomwaffenplänen in einer Rede von US-Präsident George W. Bush im Januar übernommen. Tenet bestätigte, dass der entsprechende Satz von der CIA gebilligt worden sei. Bush hatte im Kongress gesagt, der Irak habe versucht, in Afrika Uran für sein Atomwaffenprogramm zu kaufen. Diese Bemerkung basierte im Wesentlichen auf teilweise falschen Informationen des britischen Geheimdienstes, wie sich später herausstellte.
-----
Hat sich endlich ein Bauernopfer gefunden

02:07 Uhr
50 Millionen Dollar Entschädigung wegen Tod durch Bonbon
San Mateo (dpa) - Nach dem Erstickungstod ihres Kindes durch einen verschluckten Bonbon muss der Hersteller den Eltern 50 Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Ein Richter in San Mateo im US- Bundesstaat Kalifornien befand die taiwanesische Firma wegen Herstellung von «besonders gefährlichen Bonbons» für schuldig. Die Bonbons werden aus der zähen Masse einer asiatischen Wurzel hergestellt. In Japan ist das Produkt unter dem Spitznamen «tödlicher Bissen» bekannt. Dort wurden bereits acht Todesfälle registriert.
------
Entweder Amerika hat die lächerlichste Gesetzeslage oder das Volk ist einfach scheissend dämmlich
50 Millionen Dollar Entschädigung wegen Tod durch Bonbon
San Mateo (dpa) - Nach dem Erstickungstod ihres Kindes durch einen verschluckten Bonbon muss der Hersteller den Eltern 50 Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Ein Richter in San Mateo im US- Bundesstaat Kalifornien befand die taiwanesische Firma wegen Herstellung von «besonders gefährlichen Bonbons» für schuldig. Die Bonbons werden aus der zähen Masse einer asiatischen Wurzel hergestellt. In Japan ist das Produkt unter dem Spitznamen «tödlicher Bissen» bekannt. Dort wurden bereits acht Todesfälle registriert.
------
Entweder Amerika hat die lächerlichste Gesetzeslage oder das Volk ist einfach scheissend dämmlich

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,256534,00.html
VOR DEM IRAK-KRIEG
USA hatten keine neuen Beweise für Waffenprogramm
US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat zugegeben, dass es vor dem Irak-Krieg keine neuen Erkenntnisse über etwaige Massenvernichtungswaffen des Saddam-Regimes gab. Präsident George Bush beglückwünschte sich derweil, trotz falscher Geheimdienstauskünfte in den Krieg gezogen zu sein.
Washington - Dass die USA nicht in den Krieg gegen den Irak gezogen sind, weil sie neue Beweise für das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen gehabt hätten, gab Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor einem Senatsausschuss in Washington unumwunden zu. Vielmehr hätten die USA vorhandene Informationen über irakische Waffenprogramme nach den Anschlägen am 11. September 2001 in einem anderen Licht betrachtet, sagte der Minister.
"Wir haben gehandelt, weil wir die Beweise in einem völlig neuen Licht gesehen haben - durch das Prisma unserer Erfahrungen mit dem 11. September", sagte Rumsfeld vor dem Streitkräfteausschuss. Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob die US-Regierung falsche oder aufgebauschte Geheimdienstinformationen über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak verwendet hat, um den Krieg gegen das Land zu rechtfertigen.
Präsident Bush verteidigte unterdessen seine Nutzung der Geheimdienstberichte. Er sei sich absolut sicher, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen habe, sagte Bush während seiner Afrika-Reise. Die US-Regierung hatte zuvor eingestehen müssen, dass Aussagen vom Januar über versuchte Urankäufe des Iraks in Afrika falsch waren.
BBC: Weißes Haus wusste von gefälschten Dokumenten
Der britische Sender BBC berichtete derweil unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten CIA-Agenten, die US-Regierung sei schon viele Monate vor Beginn des Irak-Kriegs von der CIA darüber informiert worden, dass Saddam Hussein kein Uran für sein illegales Atomwaffenprogramm in Niger kaufen wollte. Das hatte Bush Anfang des Jahres in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress behauptet. Bushs Sprecher Ari Fleischer bestätigte, die Aussage des Präsidenten sei nicht richtig gewesen, da sie sich auf gefälschte Dokumente aus Niger gestützt habe.
Laut BBC hatte ein früherer US-Diplomat bereits im März 2002 auf die Unrichtigkeit der Vorwürfe hingewiesen. Diese Information sei dann auch in das Weiße Haus gelangt. Ein Sprecher der US-Regierung wies dies zurück. Das Weiße Haus erhalte jeden Tag Hunderte von Geheimdienstberichten, sagte er der BBC. Es gebe keinen Anhaltspunkt darüber, dass die Information über das Uran bis zum Präsidenten gelangte.
Der Führer der Demokraten im Senat, Tom Daschle, sagte, das Eingeständnis des Weißen Hauses liefere die Bestätigung, "dass wir mit falschen Informationen versorgt wurden." Präsident Bush betonte dagegen, seine Entscheidung für ein militärisches Eingreifen im Irak habe nicht allein auf dem kritisierten Bericht, sondern auf breiterer Basis von Erkenntnissen beruht. "Ich habe keinen Zweifel, dass Saddam Hussein eine Gefahr für den Weltfrieden war", bekräftigte Bush. "Und ich habe keinen Zweifel, dass die USA das Richtige getan haben, als sie ihn von der Macht beseitigten."
VOR DEM IRAK-KRIEG
USA hatten keine neuen Beweise für Waffenprogramm
US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat zugegeben, dass es vor dem Irak-Krieg keine neuen Erkenntnisse über etwaige Massenvernichtungswaffen des Saddam-Regimes gab. Präsident George Bush beglückwünschte sich derweil, trotz falscher Geheimdienstauskünfte in den Krieg gezogen zu sein.
Washington - Dass die USA nicht in den Krieg gegen den Irak gezogen sind, weil sie neue Beweise für das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen gehabt hätten, gab Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor einem Senatsausschuss in Washington unumwunden zu. Vielmehr hätten die USA vorhandene Informationen über irakische Waffenprogramme nach den Anschlägen am 11. September 2001 in einem anderen Licht betrachtet, sagte der Minister.
"Wir haben gehandelt, weil wir die Beweise in einem völlig neuen Licht gesehen haben - durch das Prisma unserer Erfahrungen mit dem 11. September", sagte Rumsfeld vor dem Streitkräfteausschuss. Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob die US-Regierung falsche oder aufgebauschte Geheimdienstinformationen über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak verwendet hat, um den Krieg gegen das Land zu rechtfertigen.
Präsident Bush verteidigte unterdessen seine Nutzung der Geheimdienstberichte. Er sei sich absolut sicher, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen habe, sagte Bush während seiner Afrika-Reise. Die US-Regierung hatte zuvor eingestehen müssen, dass Aussagen vom Januar über versuchte Urankäufe des Iraks in Afrika falsch waren.
BBC: Weißes Haus wusste von gefälschten Dokumenten
Der britische Sender BBC berichtete derweil unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten CIA-Agenten, die US-Regierung sei schon viele Monate vor Beginn des Irak-Kriegs von der CIA darüber informiert worden, dass Saddam Hussein kein Uran für sein illegales Atomwaffenprogramm in Niger kaufen wollte. Das hatte Bush Anfang des Jahres in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress behauptet. Bushs Sprecher Ari Fleischer bestätigte, die Aussage des Präsidenten sei nicht richtig gewesen, da sie sich auf gefälschte Dokumente aus Niger gestützt habe.
Laut BBC hatte ein früherer US-Diplomat bereits im März 2002 auf die Unrichtigkeit der Vorwürfe hingewiesen. Diese Information sei dann auch in das Weiße Haus gelangt. Ein Sprecher der US-Regierung wies dies zurück. Das Weiße Haus erhalte jeden Tag Hunderte von Geheimdienstberichten, sagte er der BBC. Es gebe keinen Anhaltspunkt darüber, dass die Information über das Uran bis zum Präsidenten gelangte.
Der Führer der Demokraten im Senat, Tom Daschle, sagte, das Eingeständnis des Weißen Hauses liefere die Bestätigung, "dass wir mit falschen Informationen versorgt wurden." Präsident Bush betonte dagegen, seine Entscheidung für ein militärisches Eingreifen im Irak habe nicht allein auf dem kritisierten Bericht, sondern auf breiterer Basis von Erkenntnissen beruht. "Ich habe keinen Zweifel, dass Saddam Hussein eine Gefahr für den Weltfrieden war", bekräftigte Bush. "Und ich habe keinen Zweifel, dass die USA das Richtige getan haben, als sie ihn von der Macht beseitigten."
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,255621,00.html
US-ARBEITSMARKT
Bush, der Job-Killer
Die Strategen des Weißen Hauses kämpfen einen immer verzweifelteren Kampf, um dem Image von Präsident George W. Bush als größtem Arbeitsplatzvernichter der USA seit gut 80 Jahren entgegenzuwirken. Keine einfache Sache: Rund 2,4 Millionen Jobs sind seit Bushs Amtsantritt im Januar 2001 verloren gegangen.
Washington - Im Weißen Haus will man von einer ernsten Gefahr noch nichts wissen. Doch angesichts der erschreckenden Zahlen werden hinter verschlossenen Türen bereits Krisenpläne geschmiedet: Denn trotz aller Erfolge als Feldherr gilt Bushs Wiederwahl im Jahr 2004 als gefährdet, weil die Wirtschaftspolitik nach der kollektiven Ablenkung durch den "Krieg gegen den Terror" allmählich wieder stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückt. Auf diesem Gebiet hat Bush bislang wenig vorzuweisen. Im Gegenteil. In seine Amtszeit fällt die schwerste Arbeitsmarktkrise der letzten 20 Jahre - und die längste seit dem zweiten Weltkrieg. Bush könnte der erste US-Präsident seit mehr als 80 Jahren werden, der in seiner Amtszeit mehr Arbeitsplätze vernichtet als er schafft. Der letzte, dem diese Minus-Leisutng gelang, war Herbert Hoover während der Großen Depression nach dem Schwarzen Freitag (1929 bis 1933).
Schon wetzen die Vertreter der Opposition die Messer: Nancy Pelosi, führende Kongress-Abgeordnete der Demokraten, fasst Bushs Wirtschaftspolitik als eine Bilanz der Negativ-Rekorde zusammen: "Drei Billionen Dollar Staatsschulden und drei Millionen weniger Jobs in der Wirtschaft". Dass letztendlich die Zahl der Arbeitslosen nur um 2,4 Millionen stieg, ist einem umfangreichen Einstellungsprogramm des öffentlichen Sektors zu verdanken.
Negativ-Trend ist ungebrochen
Der Trend hat sich auch im Juni fortgesetzt. Nach am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hat die US-Arbeitslosenquote den höchsten Stand seit neun Jahren erreicht.
Der Anstieg ist umso alarmierender, als die anderen Eckdaten inzwischen seit einigen Quartalen einen Aufwärtstrend der wirtschaftlichen Entwicklung anzeigen. Normalerweise, so ein Experte, müsse unter diesen Bedingungen auch die Zahl der Arbeitslosen zurückgehen. Die Entwicklung sei allenfalls mit der Extremsituation von 1982 vergleichbar. Damals schwenkte die US-Wirtschaft nach einer schweren Rezession wieder auf Erholungskurs um. Trotzdem verloren auch zwei Jahre nach dem letzten Rezessionsquartal noch jeden Monat Tausende ihren Job.
Die politischen Beobachter sind sich einig: Sollte die Entwicklung diesmal ähnlich verlaufen, hätten die Demokraten bei der nächsten Präsidentenwahl leichtes Spiel. Seit mehreren Wochen bereits versucht Bush dem durch eine Promotion-Tour quer durch die USA entgegenzusteuern. Sein groß angelegtes Programm für Steuersenkungen verkauft er seinen Zuhörern als Job-Motor. "Die Steuerreform wurde präsentiert wie ein Programm zur Schaffung von Jobs", sagt Lawrence Mishel, Chef des unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstituts Economic Policy Institute, gegenüber der "New York Times". "Bush wird daran gemessen werden."
Demokraten hätten leichtes Spiel
Ob die Reform, die ursprünglich Steuererleichterungen in Höhe von knapp 630 Milliarden Dollar bringen sollte, aber vom Repräsentantenhaus auf rund 350 Milliarden Dollar zusammengestrichen wurde, die von Bush geweckten Erwartungen erfüllt, gilt aber selbst unter den Regierungsstrategen als offen. Gregory Mankiw, oberster Wirtschaftsplaner im Weißen Haus, hat bereits die ursprünglichen Zahlen revidiert. Statt der vorausgesagten 5,5 Millionen neuer Jobs werde es wohl nur die Hälfte geben. Das Wachstum sei insgesamt schwächer ausgefallen als erwartet, und die Unternehmen würden erst neue Arbeitskräfte einstellen, wenn sie von der Nachhaltigkeit des Aufschwungs überzeugt seien.
Den vorsichtigen Erwartungen schließen sich auch unabhängige Experten an. "Wir benötigen 125.000 neue Jobs pro Monat, allein um die derzeitige Arbeitslosenrate stabil zu halten", sagt Mickey Levi, Chefvolkswirt der Bank of America. Denn die Zahl derjenigen, die auf den Arbeitsmarkt drängten, wachse pro Jahr um rund ein Prozent.
Politische Beobachter warnen deshalb: Bush muss seinen Wählern schlüssig erklären können, dass er alles getan hat, um den Negativ-Trend umzukehren.
US-ARBEITSMARKT
Bush, der Job-Killer
Die Strategen des Weißen Hauses kämpfen einen immer verzweifelteren Kampf, um dem Image von Präsident George W. Bush als größtem Arbeitsplatzvernichter der USA seit gut 80 Jahren entgegenzuwirken. Keine einfache Sache: Rund 2,4 Millionen Jobs sind seit Bushs Amtsantritt im Januar 2001 verloren gegangen.
Washington - Im Weißen Haus will man von einer ernsten Gefahr noch nichts wissen. Doch angesichts der erschreckenden Zahlen werden hinter verschlossenen Türen bereits Krisenpläne geschmiedet: Denn trotz aller Erfolge als Feldherr gilt Bushs Wiederwahl im Jahr 2004 als gefährdet, weil die Wirtschaftspolitik nach der kollektiven Ablenkung durch den "Krieg gegen den Terror" allmählich wieder stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückt. Auf diesem Gebiet hat Bush bislang wenig vorzuweisen. Im Gegenteil. In seine Amtszeit fällt die schwerste Arbeitsmarktkrise der letzten 20 Jahre - und die längste seit dem zweiten Weltkrieg. Bush könnte der erste US-Präsident seit mehr als 80 Jahren werden, der in seiner Amtszeit mehr Arbeitsplätze vernichtet als er schafft. Der letzte, dem diese Minus-Leisutng gelang, war Herbert Hoover während der Großen Depression nach dem Schwarzen Freitag (1929 bis 1933).
Schon wetzen die Vertreter der Opposition die Messer: Nancy Pelosi, führende Kongress-Abgeordnete der Demokraten, fasst Bushs Wirtschaftspolitik als eine Bilanz der Negativ-Rekorde zusammen: "Drei Billionen Dollar Staatsschulden und drei Millionen weniger Jobs in der Wirtschaft". Dass letztendlich die Zahl der Arbeitslosen nur um 2,4 Millionen stieg, ist einem umfangreichen Einstellungsprogramm des öffentlichen Sektors zu verdanken.
Negativ-Trend ist ungebrochen
Der Trend hat sich auch im Juni fortgesetzt. Nach am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hat die US-Arbeitslosenquote den höchsten Stand seit neun Jahren erreicht.
Der Anstieg ist umso alarmierender, als die anderen Eckdaten inzwischen seit einigen Quartalen einen Aufwärtstrend der wirtschaftlichen Entwicklung anzeigen. Normalerweise, so ein Experte, müsse unter diesen Bedingungen auch die Zahl der Arbeitslosen zurückgehen. Die Entwicklung sei allenfalls mit der Extremsituation von 1982 vergleichbar. Damals schwenkte die US-Wirtschaft nach einer schweren Rezession wieder auf Erholungskurs um. Trotzdem verloren auch zwei Jahre nach dem letzten Rezessionsquartal noch jeden Monat Tausende ihren Job.
Die politischen Beobachter sind sich einig: Sollte die Entwicklung diesmal ähnlich verlaufen, hätten die Demokraten bei der nächsten Präsidentenwahl leichtes Spiel. Seit mehreren Wochen bereits versucht Bush dem durch eine Promotion-Tour quer durch die USA entgegenzusteuern. Sein groß angelegtes Programm für Steuersenkungen verkauft er seinen Zuhörern als Job-Motor. "Die Steuerreform wurde präsentiert wie ein Programm zur Schaffung von Jobs", sagt Lawrence Mishel, Chef des unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstituts Economic Policy Institute, gegenüber der "New York Times". "Bush wird daran gemessen werden."
Demokraten hätten leichtes Spiel
Ob die Reform, die ursprünglich Steuererleichterungen in Höhe von knapp 630 Milliarden Dollar bringen sollte, aber vom Repräsentantenhaus auf rund 350 Milliarden Dollar zusammengestrichen wurde, die von Bush geweckten Erwartungen erfüllt, gilt aber selbst unter den Regierungsstrategen als offen. Gregory Mankiw, oberster Wirtschaftsplaner im Weißen Haus, hat bereits die ursprünglichen Zahlen revidiert. Statt der vorausgesagten 5,5 Millionen neuer Jobs werde es wohl nur die Hälfte geben. Das Wachstum sei insgesamt schwächer ausgefallen als erwartet, und die Unternehmen würden erst neue Arbeitskräfte einstellen, wenn sie von der Nachhaltigkeit des Aufschwungs überzeugt seien.
Den vorsichtigen Erwartungen schließen sich auch unabhängige Experten an. "Wir benötigen 125.000 neue Jobs pro Monat, allein um die derzeitige Arbeitslosenrate stabil zu halten", sagt Mickey Levi, Chefvolkswirt der Bank of America. Denn die Zahl derjenigen, die auf den Arbeitsmarkt drängten, wachse pro Jahr um rund ein Prozent.
Politische Beobachter warnen deshalb: Bush muss seinen Wählern schlüssig erklären können, dass er alles getan hat, um den Negativ-Trend umzukehren.
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,256553,00.html
US-GEFANGENENLAGER
Guantanamo-Häftling fordert 10,4 Millionen Dollar Entschädigung
Wie viel Geld sind zehn Monate Haft unter menschenunwürdigen Verhältnissen auf dem US-Stützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba wert? Ein Pakistaner, der nach dieser Zeitspanne wieder freigelassen wurde, bekam nur 100 Dollar. Jetzt verlangt er von den Vereinigten Staaten eine Entschädigung von mehr als zehn Millionen Dollar.
Islamabad - Der 51 Jahre alte Mohammed Sanghir konnte als erster Pakistaner die amerikanische Gefangenschaft verlassen. Nach unzähligen Verhören teilte man ihm im vergangenen November mit, dass er unschuldig sei, berichtet Sanghir. Trotzdem hätten sich die Amerikaner für seine offenbar sinnlose Gefangenschaft nicht einmal entschuldigt. Sie hätten nur lapidar gesagt: "Du kannst jetzt nach Hause gehen."
Für seine Haft seien ihm damals 2000 Dollar Entschädigung versprochen worden, doch als er das Flugzeug in seinem Heimatland verließ, drückte man ihm lediglich 100 Dollar in die Hand, sagt Sanghir. Anschließend habe er zwei Monate versucht, bei der US-Botschaft in Pakistan und bei anderen Behörden direkt in den USA an das restliche Geld zu kommen, das ihm versprochen war. Doch seither sei nichts geschehen.
Nun hat er eine Forderung von 10,4 Millionen Dollar (9,2 Millionen Euro) aufgestellt und will sie notfalls gerichtlich durchsetzen, sagt sein Anwalt. Dazu wolle man amerikanische oder pakistanische Gerichte bemühen - möglicherweise werde man auch in beiden Ländern Prozesse anstrengen.
Sanghir wurde nach eigenen Angaben vor seinem Zwangsaufenthalt in der Karibik auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan und in der pakistanische Hauptstadt Islamabad gefangen gehalten. Nach seiner Festnahme wurde er zuerst von seinen Bewachern aus Nordafghanistan misshandelt und dann an die Amerikaner ausgeliefert.
Angesichts der Tatsache, dass andere Sympathisanten des radikalislamischen Systems der Taliban lebendig begraben wurden oder im Bombenhagel der Amerikaner starben, hält er das für ein noch akzeptables Schicksal.
Aber auch Saghirs Erzählungen über die Gefangenschaft entsprechen nicht der westlichen Vorstellung eines humanen Strafvollzugs - erst völlig überfüllte Gefängnisse ohne Licht und dann Minikäfige, in denen er der Umwelt nahezu schutzlos ausgeliefert war. Außerdem, sagt der Pakistaner, habe man ihm Getränke verabreicht, denen Alkohol beigemischt war - obwohl ihm seine Religion jeglichen Alkohol verbiete.
Auch die Erlaubnis zum Beten habe er sich erst durch einen Hungerstreik erkämpfen müssen. Rechte hätten die Gefangenen keine gehabt, sagt Sanghri. Aber die sah sein Status als "ungesetzlicher Kämpfer" auch nicht vor.
Noch immer werden mehr als 600 Menschen auf Guantanamo gefangen gehalten.
US-GEFANGENENLAGER
Guantanamo-Häftling fordert 10,4 Millionen Dollar Entschädigung
Wie viel Geld sind zehn Monate Haft unter menschenunwürdigen Verhältnissen auf dem US-Stützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba wert? Ein Pakistaner, der nach dieser Zeitspanne wieder freigelassen wurde, bekam nur 100 Dollar. Jetzt verlangt er von den Vereinigten Staaten eine Entschädigung von mehr als zehn Millionen Dollar.
Islamabad - Der 51 Jahre alte Mohammed Sanghir konnte als erster Pakistaner die amerikanische Gefangenschaft verlassen. Nach unzähligen Verhören teilte man ihm im vergangenen November mit, dass er unschuldig sei, berichtet Sanghir. Trotzdem hätten sich die Amerikaner für seine offenbar sinnlose Gefangenschaft nicht einmal entschuldigt. Sie hätten nur lapidar gesagt: "Du kannst jetzt nach Hause gehen."
Für seine Haft seien ihm damals 2000 Dollar Entschädigung versprochen worden, doch als er das Flugzeug in seinem Heimatland verließ, drückte man ihm lediglich 100 Dollar in die Hand, sagt Sanghir. Anschließend habe er zwei Monate versucht, bei der US-Botschaft in Pakistan und bei anderen Behörden direkt in den USA an das restliche Geld zu kommen, das ihm versprochen war. Doch seither sei nichts geschehen.
Nun hat er eine Forderung von 10,4 Millionen Dollar (9,2 Millionen Euro) aufgestellt und will sie notfalls gerichtlich durchsetzen, sagt sein Anwalt. Dazu wolle man amerikanische oder pakistanische Gerichte bemühen - möglicherweise werde man auch in beiden Ländern Prozesse anstrengen.
Sanghir wurde nach eigenen Angaben vor seinem Zwangsaufenthalt in der Karibik auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Bagram in Afghanistan und in der pakistanische Hauptstadt Islamabad gefangen gehalten. Nach seiner Festnahme wurde er zuerst von seinen Bewachern aus Nordafghanistan misshandelt und dann an die Amerikaner ausgeliefert.
Angesichts der Tatsache, dass andere Sympathisanten des radikalislamischen Systems der Taliban lebendig begraben wurden oder im Bombenhagel der Amerikaner starben, hält er das für ein noch akzeptables Schicksal.
Aber auch Saghirs Erzählungen über die Gefangenschaft entsprechen nicht der westlichen Vorstellung eines humanen Strafvollzugs - erst völlig überfüllte Gefängnisse ohne Licht und dann Minikäfige, in denen er der Umwelt nahezu schutzlos ausgeliefert war. Außerdem, sagt der Pakistaner, habe man ihm Getränke verabreicht, denen Alkohol beigemischt war - obwohl ihm seine Religion jeglichen Alkohol verbiete.
Auch die Erlaubnis zum Beten habe er sich erst durch einen Hungerstreik erkämpfen müssen. Rechte hätten die Gefangenen keine gehabt, sagt Sanghri. Aber die sah sein Status als "ungesetzlicher Kämpfer" auch nicht vor.
Noch immer werden mehr als 600 Menschen auf Guantanamo gefangen gehalten.
http://www.welt.de/data/2003/06/28/125523.html?s=1
Top-Manager sollen Amerika retten
Yale-Professor Jeffrey Garten plädiert für einen neuen Stil der "Public-Private Partnership"
von Stefan von Borstel
Agenden haben Hochkonjunktur: Nicht nur der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat eine geschrieben, auch der Amerikaner Jeffrey Garten, Dekan an der Yale School of Management. Will der Kanzler Deutschland mit Reformen fit machen, geht es dem Yale-Professor um die Manager der Vereinigten Staaten. Auch sie sollen fit gemacht werden, für eine "neue Welt" - so ist das erste Kapitel in Jeffrey Gartens Buch "The Politics of Fortune" überschrieben. Diese neue Welt ist allerdings keine schöne Welt. "Das Goldene Zeitalter der US-Wirtschaft, wie wir es in den achtziger und neunziger Jahren erlebt haben, ist unwiederbringlich verloren", schreibt Garten.
Ein verheerender Doppelschlag, so seine Analyse, habe alles verändert: Zum einen der Terroranschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001. Zum anderen der Bilanzskandal um den amerikanischen Energieriesen Enron. "Beides zusammen, der Terror und der Enron-Skandal, bedrohen unsere offene Gesellschaft und unsere freien Märkte, weil sie das Vertrauen erschüttert haben, auf dem unsere Gesellschaft beruht", lautet Gartens Kernthese. Garten sieht Amerika gegenwärtig an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte.
Er nennt Enron und den 11. September 2001 im selben Atemzug mit Pearl Harbour, mit der ersten Atombombenexplosion in Japan oder dem Fall der Berliner Mauer. Der ehemalige Direktor von Lehman Brothers und Wirtschaftsberater der US-Präsidenten Nixon, Ford und Clinton fürchtet um die Balance zwischen Wirtschaft und Staat in Amerika, oder besser: dass sich diese Balance zu Gunsten eines starken Staates verschiebt.
Kontrolle statt Deregulierung, Sicherheit statt Freiheit, so analysiert Jeffrey Garten, seien die unabweisbaren Folgen der Terroranschläge. Das Streben nach "nationaler Sicherheit könnte alles andere verdrängen", fürchtet der Autor. Sehr groß ist seine Sorge, nach zwei Jahrzehnten der Deregulierung und Privatisierung, nach rund 20 Jahren Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der immer engeren internationalen Verflechtung und Zusammenarbeit könnte das Pendel nun zu stark in Richtung Staat ausschlagen.
In dieser Situation müsse die Wirtschaftselite ihre Stimme erheben, um das Schlimmste zu verhindern. Garten plädiert für ein "Public-Private Partnership" neuen Stils. Die Manager sollten als Partner und Berater der Politik fungieren. Doch die neue Rolle kommt für Amerikas Manager zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Denn nach den Skandal um gefälschte Bilanzen und um Millionengehälter für unfähige Manager, nach dem Kurssturz an den Börsen, bei dem die Aktionäre Milliarden verloren haben, ist die Reputation von Amerikas Top-Managern dahin und ihr Rat in Schicksalsfragen der Nation nicht mehr unbedingt gefragt.
Zuerst müssten Amerikas Manager daher ihren eigenen Laden in Ordnung bringen, wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit wiedergewinnen wollen, empfiehlt Garten. Seine Problemanalyse ist schlüssig, die Lösungen, die er anbietet, nicht immer - zumindest nicht für europäische Leser. Aus Sicht der Europäer überrascht es schon, welche große Rolle Garten Unternehmenschefs im politischen Willensbildungsprozess einräumen will. Parteien, Parlamente, gewählte Abgeordnete oder auch Verbände, die die Interessen der Wirtschaft artikulieren, kommen in Gartens Weltsicht gar nicht vor.
Stattdessen appelliert der Yale-Professor an den Gutmenschen im Manager, orientierungslosen Politikern in einer schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Statt sich auf Golfplätzen und Segelyachten die Zeit tot zu schlagen, könnten frühpensionierte Unternehmenslenker sich ja auch in den Dienst des Staates stellen, schlägt Garten ganz pragmatisch vor. Wie die neue Partnerschaft zwischen Managern und Politikern, Wirtschaft und Staat konkret aussehen soll, bleibt in Gartens Welt allerdings ausgesprochen diffus.
Jeffrey E. Garten: The Politics of Fortune - A new Agenda for Business Leaders, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2002, 24,95 Dollar
Artikel erschienen am 28. Jun 2003
Top-Manager sollen Amerika retten
Yale-Professor Jeffrey Garten plädiert für einen neuen Stil der "Public-Private Partnership"
von Stefan von Borstel
Agenden haben Hochkonjunktur: Nicht nur der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat eine geschrieben, auch der Amerikaner Jeffrey Garten, Dekan an der Yale School of Management. Will der Kanzler Deutschland mit Reformen fit machen, geht es dem Yale-Professor um die Manager der Vereinigten Staaten. Auch sie sollen fit gemacht werden, für eine "neue Welt" - so ist das erste Kapitel in Jeffrey Gartens Buch "The Politics of Fortune" überschrieben. Diese neue Welt ist allerdings keine schöne Welt. "Das Goldene Zeitalter der US-Wirtschaft, wie wir es in den achtziger und neunziger Jahren erlebt haben, ist unwiederbringlich verloren", schreibt Garten.
Ein verheerender Doppelschlag, so seine Analyse, habe alles verändert: Zum einen der Terroranschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001. Zum anderen der Bilanzskandal um den amerikanischen Energieriesen Enron. "Beides zusammen, der Terror und der Enron-Skandal, bedrohen unsere offene Gesellschaft und unsere freien Märkte, weil sie das Vertrauen erschüttert haben, auf dem unsere Gesellschaft beruht", lautet Gartens Kernthese. Garten sieht Amerika gegenwärtig an einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte.
Er nennt Enron und den 11. September 2001 im selben Atemzug mit Pearl Harbour, mit der ersten Atombombenexplosion in Japan oder dem Fall der Berliner Mauer. Der ehemalige Direktor von Lehman Brothers und Wirtschaftsberater der US-Präsidenten Nixon, Ford und Clinton fürchtet um die Balance zwischen Wirtschaft und Staat in Amerika, oder besser: dass sich diese Balance zu Gunsten eines starken Staates verschiebt.
Kontrolle statt Deregulierung, Sicherheit statt Freiheit, so analysiert Jeffrey Garten, seien die unabweisbaren Folgen der Terroranschläge. Das Streben nach "nationaler Sicherheit könnte alles andere verdrängen", fürchtet der Autor. Sehr groß ist seine Sorge, nach zwei Jahrzehnten der Deregulierung und Privatisierung, nach rund 20 Jahren Rückzug des Staates aus der Wirtschaft und der immer engeren internationalen Verflechtung und Zusammenarbeit könnte das Pendel nun zu stark in Richtung Staat ausschlagen.
In dieser Situation müsse die Wirtschaftselite ihre Stimme erheben, um das Schlimmste zu verhindern. Garten plädiert für ein "Public-Private Partnership" neuen Stils. Die Manager sollten als Partner und Berater der Politik fungieren. Doch die neue Rolle kommt für Amerikas Manager zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Denn nach den Skandal um gefälschte Bilanzen und um Millionengehälter für unfähige Manager, nach dem Kurssturz an den Börsen, bei dem die Aktionäre Milliarden verloren haben, ist die Reputation von Amerikas Top-Managern dahin und ihr Rat in Schicksalsfragen der Nation nicht mehr unbedingt gefragt.
Zuerst müssten Amerikas Manager daher ihren eigenen Laden in Ordnung bringen, wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit wiedergewinnen wollen, empfiehlt Garten. Seine Problemanalyse ist schlüssig, die Lösungen, die er anbietet, nicht immer - zumindest nicht für europäische Leser. Aus Sicht der Europäer überrascht es schon, welche große Rolle Garten Unternehmenschefs im politischen Willensbildungsprozess einräumen will. Parteien, Parlamente, gewählte Abgeordnete oder auch Verbände, die die Interessen der Wirtschaft artikulieren, kommen in Gartens Weltsicht gar nicht vor.
Stattdessen appelliert der Yale-Professor an den Gutmenschen im Manager, orientierungslosen Politikern in einer schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Statt sich auf Golfplätzen und Segelyachten die Zeit tot zu schlagen, könnten frühpensionierte Unternehmenslenker sich ja auch in den Dienst des Staates stellen, schlägt Garten ganz pragmatisch vor. Wie die neue Partnerschaft zwischen Managern und Politikern, Wirtschaft und Staat konkret aussehen soll, bleibt in Gartens Welt allerdings ausgesprochen diffus.
Jeffrey E. Garten: The Politics of Fortune - A new Agenda for Business Leaders, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2002, 24,95 Dollar
Artikel erschienen am 28. Jun 2003
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,256599,00.html
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN
Blair lässt BBC-Bericht dementieren
Erneut scheint der offizielle Kriegsgrund gegen den Irak an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die britische Regierung geht laut einem BBC-Bericht offenbar nicht mehr davon aus, dass im Irak Massenvernichtungsmittel gefunden werden. Premier Tony Blair ließ dies inzwischen dementieren.
London - Der britische Sender BBC meldet unter Berufung auf "hohe Quellen" in der Regierung, diese sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Waffen entweder vor dem Krieg vernichtet oder zu gut versteckt worden seien.
Der Bericht war am Donnerstag zunächst unwidersprochen geblieben. Ein Sprecher der Downing Street hatte lediglich darauf hingewiesen, dass Blair in dieser Woche seine Überzeugung geäußert hatte, man werde noch "Massenvernichtungswaffen-Programme" finden.
Dann wurde ein klares Dementi nachgeschoben. Ein Blair-Sprecher sagte, der Premierminister sei absolut zuversichtlich, "dass wir nicht nur Beweise für Massenvernichtungswaffen-Programme, sondern auch konkrete Beweise für das Produkt dieser Programme finden werden". Der Sprecher wollte sich jedoch nicht darüber äußern, welche Art von Waffen die Regierung zu finden erwarte. Auf die Bitte hin, konkretere Aussagen zu machen, sagte er: "Der Premierminister glaubt und ist absolut zuversichtlich, dass wir Material finden werden, das Hans Blix und die Inspekteure, wenn sie es gefunden hätten, dazu berechtigt hätte, sich wieder an den Sicherheitsrat zu wenden, damit eine weitere Uno-Resolution verabschiedet worden wäre."
Der ehemalige Außenminister Robin Cook bezeichnete die von der BBC veröffentlichten Informationen eine "dramatische Entwicklung". Das Parlament habe für den Krieg gestimmt, "weil ihm gesagt wurde, dass Saddam richtige Massenvernichtungswaffen hätte", so Cook. Man habe sehr deutlich gesagt, dass diese Waffen vorhanden seien, man habe bekanntlich sogar gesagt, dass es Waffen gebe, die binnen 45 Minuten einsatzbereit seien.
Jetzt, so Cook, könne man nicht sagen: "Nun, es gab da durchaus ein paar Wissenschaftler, die irgendwann die Kapazität hätten haben können, das zu entwickeln."
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN
Blair lässt BBC-Bericht dementieren
Erneut scheint der offizielle Kriegsgrund gegen den Irak an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die britische Regierung geht laut einem BBC-Bericht offenbar nicht mehr davon aus, dass im Irak Massenvernichtungsmittel gefunden werden. Premier Tony Blair ließ dies inzwischen dementieren.
London - Der britische Sender BBC meldet unter Berufung auf "hohe Quellen" in der Regierung, diese sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Waffen entweder vor dem Krieg vernichtet oder zu gut versteckt worden seien.
Der Bericht war am Donnerstag zunächst unwidersprochen geblieben. Ein Sprecher der Downing Street hatte lediglich darauf hingewiesen, dass Blair in dieser Woche seine Überzeugung geäußert hatte, man werde noch "Massenvernichtungswaffen-Programme" finden.
Dann wurde ein klares Dementi nachgeschoben. Ein Blair-Sprecher sagte, der Premierminister sei absolut zuversichtlich, "dass wir nicht nur Beweise für Massenvernichtungswaffen-Programme, sondern auch konkrete Beweise für das Produkt dieser Programme finden werden". Der Sprecher wollte sich jedoch nicht darüber äußern, welche Art von Waffen die Regierung zu finden erwarte. Auf die Bitte hin, konkretere Aussagen zu machen, sagte er: "Der Premierminister glaubt und ist absolut zuversichtlich, dass wir Material finden werden, das Hans Blix und die Inspekteure, wenn sie es gefunden hätten, dazu berechtigt hätte, sich wieder an den Sicherheitsrat zu wenden, damit eine weitere Uno-Resolution verabschiedet worden wäre."
Der ehemalige Außenminister Robin Cook bezeichnete die von der BBC veröffentlichten Informationen eine "dramatische Entwicklung". Das Parlament habe für den Krieg gestimmt, "weil ihm gesagt wurde, dass Saddam richtige Massenvernichtungswaffen hätte", so Cook. Man habe sehr deutlich gesagt, dass diese Waffen vorhanden seien, man habe bekanntlich sogar gesagt, dass es Waffen gebe, die binnen 45 Minuten einsatzbereit seien.
Jetzt, so Cook, könne man nicht sagen: "Nun, es gab da durchaus ein paar Wissenschaftler, die irgendwann die Kapazität hätten haben können, das zu entwickeln."
http://www.daserste.de/weltspiegel/beitrag.asp?uid=bl92t2yro…
Sendung vom 29.06.2003
USA
Der inszenierte Präsident
Wenn er kommt, halten mindestens zwanzig Leute die Luft an. Die Image-Experten von George Bush können in diesem Moment nur hoffen, dass sie wirklich an alles gedacht haben. Er spricht am Jahrestag der Anschläge vom 11. September zum Volk, zur Welt. Der Präsident, der Amerika als das Bollwerk der Freiheit verkauft, zwischen der hell erleuchteten Freiheitsstatue und dem Sternenbanner. Die perfekte Kulisse. Um “Miss Liberty” so strahlend auf die Fernsehschirme zu zaubern, charterten seine Strategen drei Boote, auf die sie riesige Scheinwerfer laden liessen. Kosten: knapp 40.000 Dollar.
Vorbereitungen
Auch bei kleineren Auftritten achten die Image-Experten nicht nur darauf, was der Präsident sagt, sondern auch auf die Bilder, die das Volk sieht. Oft beauftragt das Weisse Hauses eine Produktionsfirma, die ausschliesslich Politiker in Szene setzt. Ein Bild, eine Botschaft, ist die Devise. Denn – davon gehen die Planer im Weissen Haus aus - Amerikaner sind so geschäftig, dass sie den Fernseh-Beiträgen über die präsidialen Reden gar nicht zuhören können, sondern das Ereignis nur nebenbei wahrnehmen. Deshalb komponieren sie das perfekte Bild - fürs Fernsehen und für die Zeitungen.
”Das ist wie mit Rock Stars oder einer Modenschau”, sagt uns David Grossman, der Chef der Produktionsfirma, dessen wichtigster Kunde das Weisse Haus ist. “Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Bush-Mitarbeiter haben immer genaue Vorstellungen; der Präsident muss immer perfekt aussehen.”
Auftritt Bush zur Wirtschaft
Und das gelingt fast immer. Er kommt, verspricht eine bessere Zukunft, vor allem Arbeit für alle. Warmes Licht und der Hintergrund – “Tapete” genannt - sind das Wichtigste. Von jedem Kamerawinkel aus betrachtet liest man seine Botschaft : ‚Jobs’ und ‚Wachstum’. Auf dem Foto sind Arbeiter – diejenigen, für deren Schicksal der Präsident so viel tut, das ist seine Botschaft.
“no-tie-event”
Und kurz zuvor wollte er seinem Volk klarmachen, dass seine Steuerreform doch beileibe nicht nur reiche Amerikaner begünstige, ‚mitfühlende Reformen’ eben. Mitarbeiter des Weissen Hauses hatten die männlichen Claqueure im Hintergrund gebeten, doch bitte vor Betreten des Saales die Krawatten abzunehmen. Bush spricht vom und zum einfachen Volk, so sollte es das Fernseh-Publikum sehen.
Clinton + Joshua King
Auch andere Präsidenten liessen sich fürs Fernsehen gekonnt in Szene setzen. Bill Clintons Strategen “komponierten” Bilder, wie sie sagen. Zuständig für die grossen Auftritte des ehemaligen Präsidenten war dessen Produktions-Direktor Joshua King. Er arbeitet jetzt für ein Meinungsforschungsinstitut und beobachtet genau, wie seine Nachfolger ihren Präsidenten in Szene setzen. Joshua King, ehemaliger Produktionsdirektor des Weissen Hauses “Diese Regierung versteht es, Bilder optimal zu nutzen”, sagt er. “Gutes Licht, genau koordinierte Bewegungen, ein perfekter Hintergrund, oft mit Menschen, die Teil der Botschaft sind. Das haben wir zwar mit Clinton auch schon gemacht, aber diese Regierung hat das zur Vollendung gebracht.”
Bush landet auf Abraham Lincoln
Höhepunkt der präsidialen Inszenierungen war bisher die Landung des Präsidenten auf dem Flugzeugträger ‚Abraham Lincoln’. Hier hat er den Krieg offiziell beendet – auch wenn im Irak fast täglich noch Menschen umgebracht werden. Joshua King, ehemaliger Produktionsdirektor des Weissen Hauses “Sie haben das alles für diesen einen Moment inszeniert”, sagt dazu Joshua King. "Der Präsident im Fliegeranzug. Das Weisse Haus versucht so, eine Art Tom-Cruise-Image herzustellen, einen “Top-Gun”-Kriegshelden. Dieser Kerl war der Besitzer eines Baseball-Teams und nur für ein paar Monate in der Nationalen Garde. In Deutschland kann man mit solchen Bildern keinen Eindruck machen, aber das ist dem Präsidenten egal. Hier funktioniert das, auch wenn ich stundenlang darüber reden könnte, wie verlogen diese Bilder eigentlich sind.”
Bush’s speech + Analyse
Mission ausgeführt, war die Botschaft. Er tritt auf und kann mit solchen Inszenierungen seine Popularität noch steigern. Solche Bilder untermauern hier seinen Ruf als Sieger – noch. Mindestens 500.000 Dollar kostete diese Show. Joshua King, ehemaliger Produktionsdirektor des Weissen Hauses ”Wir haben ihn hier in diesem warmen Abendlicht; der Zeitpunkt war minutiös geplant, das Schiff wurde extra so gedreht, dass die Sonne den Präsidenten bescheinen konnte”, sagt der Fernseh-Fachmann. “Der ganze Auftritt ist reine Manipulation, aber jeder macht mit.” Kumar geht ins WH, nach unten, am Arbeitsplatz. Sie kennt hier im Weissen Haus jeder. Und sie kennt jeden. Martha Joynt Kumar ist fast jeden Tag im Keller des Regierungssitzes, da, wo die Journalisten arbeiten. Die Professorin beobachtet und analysiert seit Jahrzehnten die Kommunikationsmethoden der jeweiligen Regierungen.
“Bush-Fernsehen”
Nicht nur das nunmehr fast tägliche ‚Bush-Fernsehen’, wie sie hier sagen, das hier auf allen Kanälen laüft, sondern auch, wer was warum plant und inszeniert. Martha J. Kumar, Politologin, Towson University “Demokraten und Republikaner organisieren sich völlig unterschiedlich”, sagt sie. “Republikaner und auch ihre Präsidenten interessieren sich für Management-Fragen – und wie ein Präsident professionell dem Volk dargeboten wird, das gehört dazu. Republikaner haben immer Profis mit Medien-Erfahrung mitgebracht. Und wenn sie dann ins Weisse Haus einzogen, wussten sie eben genau, was wie zu tun ist.
Mount Rushmore
Zum Beispiel bei einer Rede am Mount Rushmore-Denkmal im Bundesstaat South Dakota. Die Pressetribüne für alle Kameraleute und Fotografen war nicht, wie üblich, vor George Bush aufgebaut, sondern seitlich von ihm. Die vier in Stein gehauenen US-Präsidenten gaben einen würdigen Hintergrund ab – das Profil Bushs in der Reihe seiner grossen Vorgänger Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln. Der Präsident schon zu Lebzeiten eine historische Figur, das sollte das Fernsehpublikum mit diesem Bild sofort erfassen. Martha J. Kumar, Politologin, Towson University ”Für mich ist das nicht Hollywood, sondern einfach nur professionell”, sagt dazu die Wissenschaftlerin. “Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Amerika zehn Präsidenten, die ihre Amtszeit zu Ende gebracht haben. Vier von ihnen wurden wiedergewählt. Das waren diejenigen, die sich inszenieren liessen. Das waren diejenigen, die erkannt haben, dass Regieren ohne Inszenieren hier nicht funktioniert.”
David Grossman, Mitarbeiterbesprechung
David Grossman hat seinen Planungsstab zusammengerufen. Er hat wieder einen Anruf aus dem Weissen Haus bekommen. Wieder ein Auftrag für ein ‚Ereignis’, wie es hier heisst. Diesmal soll er Vizepräsident Cheney ins rechte Licht rücken. Die richtige “Tapete” - den Hintergrund mit der gewünschten Botschaft ans Fernseh-Publikum - liefert das Weisse Haus. Er sorgt für Licht, Ton und Farben.
Für Davids Dienste zeigt sich der Präsident erkenntlich. Er weiss die Bush-Shows zu schätzen. Fotos und Dankesschreiben zieren Davids Büro. Den Demokraten lassen diese pompösen Inszenierungen in der Fernseh-Welt Amerikas keine Chance, so sieht es der Experte. David Grossman, Political Productions “Es wird schwer, mit dieser gigantischen Wahlkampf-Maschine mitzuhalten”, sagt er. “Das Bush-Team hat jetzt schon so viel Geld gesammelt, um sich in Szene zu setzen, dass ein demokratischer Kandidat kaum dagegen ankommt.”
Jubelnde Massen für Bush
Eine schöne Show, die die Bilder der unschönen Wirklichkeit für einen Moment vergessen lässt. Im Irak, wo der Krieg eben doch noch nicht zu Ende ist, aber auch in Amerika, wo die Wirtschaftskrise anhält.
Sendung vom 29.06.2003
USA
Der inszenierte Präsident
Wenn er kommt, halten mindestens zwanzig Leute die Luft an. Die Image-Experten von George Bush können in diesem Moment nur hoffen, dass sie wirklich an alles gedacht haben. Er spricht am Jahrestag der Anschläge vom 11. September zum Volk, zur Welt. Der Präsident, der Amerika als das Bollwerk der Freiheit verkauft, zwischen der hell erleuchteten Freiheitsstatue und dem Sternenbanner. Die perfekte Kulisse. Um “Miss Liberty” so strahlend auf die Fernsehschirme zu zaubern, charterten seine Strategen drei Boote, auf die sie riesige Scheinwerfer laden liessen. Kosten: knapp 40.000 Dollar.
Vorbereitungen
Auch bei kleineren Auftritten achten die Image-Experten nicht nur darauf, was der Präsident sagt, sondern auch auf die Bilder, die das Volk sieht. Oft beauftragt das Weisse Hauses eine Produktionsfirma, die ausschliesslich Politiker in Szene setzt. Ein Bild, eine Botschaft, ist die Devise. Denn – davon gehen die Planer im Weissen Haus aus - Amerikaner sind so geschäftig, dass sie den Fernseh-Beiträgen über die präsidialen Reden gar nicht zuhören können, sondern das Ereignis nur nebenbei wahrnehmen. Deshalb komponieren sie das perfekte Bild - fürs Fernsehen und für die Zeitungen.
”Das ist wie mit Rock Stars oder einer Modenschau”, sagt uns David Grossman, der Chef der Produktionsfirma, dessen wichtigster Kunde das Weisse Haus ist. “Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Bush-Mitarbeiter haben immer genaue Vorstellungen; der Präsident muss immer perfekt aussehen.”
Auftritt Bush zur Wirtschaft
Und das gelingt fast immer. Er kommt, verspricht eine bessere Zukunft, vor allem Arbeit für alle. Warmes Licht und der Hintergrund – “Tapete” genannt - sind das Wichtigste. Von jedem Kamerawinkel aus betrachtet liest man seine Botschaft : ‚Jobs’ und ‚Wachstum’. Auf dem Foto sind Arbeiter – diejenigen, für deren Schicksal der Präsident so viel tut, das ist seine Botschaft.
“no-tie-event”
Und kurz zuvor wollte er seinem Volk klarmachen, dass seine Steuerreform doch beileibe nicht nur reiche Amerikaner begünstige, ‚mitfühlende Reformen’ eben. Mitarbeiter des Weissen Hauses hatten die männlichen Claqueure im Hintergrund gebeten, doch bitte vor Betreten des Saales die Krawatten abzunehmen. Bush spricht vom und zum einfachen Volk, so sollte es das Fernseh-Publikum sehen.
Clinton + Joshua King
Auch andere Präsidenten liessen sich fürs Fernsehen gekonnt in Szene setzen. Bill Clintons Strategen “komponierten” Bilder, wie sie sagen. Zuständig für die grossen Auftritte des ehemaligen Präsidenten war dessen Produktions-Direktor Joshua King. Er arbeitet jetzt für ein Meinungsforschungsinstitut und beobachtet genau, wie seine Nachfolger ihren Präsidenten in Szene setzen. Joshua King, ehemaliger Produktionsdirektor des Weissen Hauses “Diese Regierung versteht es, Bilder optimal zu nutzen”, sagt er. “Gutes Licht, genau koordinierte Bewegungen, ein perfekter Hintergrund, oft mit Menschen, die Teil der Botschaft sind. Das haben wir zwar mit Clinton auch schon gemacht, aber diese Regierung hat das zur Vollendung gebracht.”
Bush landet auf Abraham Lincoln
Höhepunkt der präsidialen Inszenierungen war bisher die Landung des Präsidenten auf dem Flugzeugträger ‚Abraham Lincoln’. Hier hat er den Krieg offiziell beendet – auch wenn im Irak fast täglich noch Menschen umgebracht werden. Joshua King, ehemaliger Produktionsdirektor des Weissen Hauses “Sie haben das alles für diesen einen Moment inszeniert”, sagt dazu Joshua King. "Der Präsident im Fliegeranzug. Das Weisse Haus versucht so, eine Art Tom-Cruise-Image herzustellen, einen “Top-Gun”-Kriegshelden. Dieser Kerl war der Besitzer eines Baseball-Teams und nur für ein paar Monate in der Nationalen Garde. In Deutschland kann man mit solchen Bildern keinen Eindruck machen, aber das ist dem Präsidenten egal. Hier funktioniert das, auch wenn ich stundenlang darüber reden könnte, wie verlogen diese Bilder eigentlich sind.”
Bush’s speech + Analyse
Mission ausgeführt, war die Botschaft. Er tritt auf und kann mit solchen Inszenierungen seine Popularität noch steigern. Solche Bilder untermauern hier seinen Ruf als Sieger – noch. Mindestens 500.000 Dollar kostete diese Show. Joshua King, ehemaliger Produktionsdirektor des Weissen Hauses ”Wir haben ihn hier in diesem warmen Abendlicht; der Zeitpunkt war minutiös geplant, das Schiff wurde extra so gedreht, dass die Sonne den Präsidenten bescheinen konnte”, sagt der Fernseh-Fachmann. “Der ganze Auftritt ist reine Manipulation, aber jeder macht mit.” Kumar geht ins WH, nach unten, am Arbeitsplatz. Sie kennt hier im Weissen Haus jeder. Und sie kennt jeden. Martha Joynt Kumar ist fast jeden Tag im Keller des Regierungssitzes, da, wo die Journalisten arbeiten. Die Professorin beobachtet und analysiert seit Jahrzehnten die Kommunikationsmethoden der jeweiligen Regierungen.
“Bush-Fernsehen”
Nicht nur das nunmehr fast tägliche ‚Bush-Fernsehen’, wie sie hier sagen, das hier auf allen Kanälen laüft, sondern auch, wer was warum plant und inszeniert. Martha J. Kumar, Politologin, Towson University “Demokraten und Republikaner organisieren sich völlig unterschiedlich”, sagt sie. “Republikaner und auch ihre Präsidenten interessieren sich für Management-Fragen – und wie ein Präsident professionell dem Volk dargeboten wird, das gehört dazu. Republikaner haben immer Profis mit Medien-Erfahrung mitgebracht. Und wenn sie dann ins Weisse Haus einzogen, wussten sie eben genau, was wie zu tun ist.
Mount Rushmore
Zum Beispiel bei einer Rede am Mount Rushmore-Denkmal im Bundesstaat South Dakota. Die Pressetribüne für alle Kameraleute und Fotografen war nicht, wie üblich, vor George Bush aufgebaut, sondern seitlich von ihm. Die vier in Stein gehauenen US-Präsidenten gaben einen würdigen Hintergrund ab – das Profil Bushs in der Reihe seiner grossen Vorgänger Washington, Jefferson, Roosevelt und Lincoln. Der Präsident schon zu Lebzeiten eine historische Figur, das sollte das Fernsehpublikum mit diesem Bild sofort erfassen. Martha J. Kumar, Politologin, Towson University ”Für mich ist das nicht Hollywood, sondern einfach nur professionell”, sagt dazu die Wissenschaftlerin. “Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Amerika zehn Präsidenten, die ihre Amtszeit zu Ende gebracht haben. Vier von ihnen wurden wiedergewählt. Das waren diejenigen, die sich inszenieren liessen. Das waren diejenigen, die erkannt haben, dass Regieren ohne Inszenieren hier nicht funktioniert.”
David Grossman, Mitarbeiterbesprechung
David Grossman hat seinen Planungsstab zusammengerufen. Er hat wieder einen Anruf aus dem Weissen Haus bekommen. Wieder ein Auftrag für ein ‚Ereignis’, wie es hier heisst. Diesmal soll er Vizepräsident Cheney ins rechte Licht rücken. Die richtige “Tapete” - den Hintergrund mit der gewünschten Botschaft ans Fernseh-Publikum - liefert das Weisse Haus. Er sorgt für Licht, Ton und Farben.
Für Davids Dienste zeigt sich der Präsident erkenntlich. Er weiss die Bush-Shows zu schätzen. Fotos und Dankesschreiben zieren Davids Büro. Den Demokraten lassen diese pompösen Inszenierungen in der Fernseh-Welt Amerikas keine Chance, so sieht es der Experte. David Grossman, Political Productions “Es wird schwer, mit dieser gigantischen Wahlkampf-Maschine mitzuhalten”, sagt er. “Das Bush-Team hat jetzt schon so viel Geld gesammelt, um sich in Szene zu setzen, dass ein demokratischer Kandidat kaum dagegen ankommt.”
Jubelnde Massen für Bush
Eine schöne Show, die die Bilder der unschönen Wirklichkeit für einen Moment vergessen lässt. Im Irak, wo der Krieg eben doch noch nicht zu Ende ist, aber auch in Amerika, wo die Wirtschaftskrise anhält.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,256539,00.html
IRAK-KRIEG
Amerikanische Regierung legte falsche Beweise vor
US-Verteidigungsminister Rumsfeld hat zugegeben, dass es vor dem Irak-Krieg keine neuen Erkenntnisse über etwaige Massenvernichtungswaffen des Saddam-Regimes gab. Ein ehemaliger ranghoher Mitarbeiter des US-Außenministeriums wirft der Regierung vor, Geheimdienstinformationen in der Öffentlichkeit falsch dargestellt zu haben.
Washington - Die US-Regierung hat dem amerikanischen Volk vor dem Irak-Krieg ein falsches Bild von der irakischen Bedrohung gezeichnet. Diesen Vorwurf erhebt Greg Thielmann, der im September seinen Job als Direktor im Büro für Information und Erkundung des US-Außenministeriums aufgab. Einige Fehler hätten in der Arbeit der Geheimdienste gelegen, die meisten resultierten aber daraus, wie ranghohe Regierungsmitarbeiter die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen missbraucht hätten, sagte Thielmann auf einer Pressekonferenz des Verbandes für Rüstungskontrolle. "Im März 2003, als die Militäroperationen begannen, stellte Irak keine unmittelbare Bedrohung für seine Nachbarn und die USA dar", sagte Thielmann.
Als Beispiel nannte er Informationen über den Erwerb von Aluminiumröhren durch den Irak. Die Regierung habe seinerzeit erklärt, sie seien definitiv für Anlagen zur Urananreicherung bestimmt. Im Geheimdienstbericht hieß es dazu, die meisten Geheimdienst-Analytiker seien davon ausgegangen, dass diese Röhren für ein irakisches Atomwaffenprogramm seien, aber nicht alle. Die Waffeninspektoren stellten später fest, dass Irak die Rohre nicht für ein Waffenprogramm erworben hatte.
Donald Rumsfeld gab gestern vor dem Senatsausschuss unumwunden zu, dass die USA nicht in den Krieg gegen den Irak gezogen sind, weil sie neue Beweise für das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen gehabt hätten. Vielmehr hätten die USA vorhandene Informationen über irakische Waffenprogramme nach den Anschlägen am 11. September 2001 in einem anderen Licht betrachtet, sagte der Minister.
"Wir haben gehandelt, weil wir die Beweise in einem völlig neuen Licht gesehen haben - durch das Prisma unserer Erfahrungen mit dem 11. September", sagte Rumsfeld vor dem Streitkräfteausschuss. Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob die US-Regierung falsche oder aufgebauschte Geheimdienstinformationen über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak verwendet hat, um den Krieg gegen das Land zu rechtfertigen.
Präsident Bush verteidigte unterdessen seine Nutzung der Geheimdienstberichte. Er sei sich absolut sicher, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen habe, sagte Bush während seiner Afrika-Reise. Die US-Regierung hatte zuvor eingestehen müssen, dass Aussagen vom Januar über versuchte Urankäufe des Iraks in Afrika falsch waren.
BBC: Weißes Haus wusste von gefälschten Dokumenten
Der britische Sender BBC berichtete derweil unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten CIA-Agenten, die US-Regierung sei schon viele Monate vor Beginn des Irak-Kriegs von der CIA darüber informiert worden, dass Saddam Hussein kein Uran für sein illegales Atomwaffenprogramm in Niger kaufen wollte. Das hatte Bush Anfang des Jahres in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress behauptet. Bushs Sprecher Ari Fleischer bestätigte, die Aussage des Präsidenten sei nicht richtig gewesen, da sie sich auf gefälschte Dokumente aus Niger gestützt habe.
Laut BBC hatte ein früherer US-Diplomat bereits im März 2002 auf die Unrichtigkeit der Vorwürfe hingewiesen. Diese Information sei dann auch in das Weiße Haus gelangt. Ein Sprecher der US-Regierung wies dies zurück. Das Weiße Haus erhalte jeden Tag Hunderte von Geheimdienstberichten, sagte er der BBC. Es gebe keinen Anhaltspunkt darüber, dass die Information über das Uran bis zum Präsidenten gelangte.
Der Führer der Demokraten im Senat, Tom Daschle, sagte, das Eingeständnis des Weißen Hauses liefere die Bestätigung, "dass wir mit falschen Informationen versorgt wurden." Präsident Bush betonte dagegen, seine Entscheidung für ein militärisches Eingreifen im Irak habe nicht allein auf dem kritisierten Bericht, sondern auf breiterer Basis von Erkenntnissen beruht. "Ich habe keinen Zweifel, dass Saddam Hussein eine Gefahr für den Weltfrieden war", bekräftigte Bush. "Und ich habe keinen Zweifel, dass die USA das Richtige getan haben, als sie ihn von der Macht beseitigten."
IRAK-KRIEG
Amerikanische Regierung legte falsche Beweise vor
US-Verteidigungsminister Rumsfeld hat zugegeben, dass es vor dem Irak-Krieg keine neuen Erkenntnisse über etwaige Massenvernichtungswaffen des Saddam-Regimes gab. Ein ehemaliger ranghoher Mitarbeiter des US-Außenministeriums wirft der Regierung vor, Geheimdienstinformationen in der Öffentlichkeit falsch dargestellt zu haben.
Washington - Die US-Regierung hat dem amerikanischen Volk vor dem Irak-Krieg ein falsches Bild von der irakischen Bedrohung gezeichnet. Diesen Vorwurf erhebt Greg Thielmann, der im September seinen Job als Direktor im Büro für Information und Erkundung des US-Außenministeriums aufgab. Einige Fehler hätten in der Arbeit der Geheimdienste gelegen, die meisten resultierten aber daraus, wie ranghohe Regierungsmitarbeiter die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen missbraucht hätten, sagte Thielmann auf einer Pressekonferenz des Verbandes für Rüstungskontrolle. "Im März 2003, als die Militäroperationen begannen, stellte Irak keine unmittelbare Bedrohung für seine Nachbarn und die USA dar", sagte Thielmann.
Als Beispiel nannte er Informationen über den Erwerb von Aluminiumröhren durch den Irak. Die Regierung habe seinerzeit erklärt, sie seien definitiv für Anlagen zur Urananreicherung bestimmt. Im Geheimdienstbericht hieß es dazu, die meisten Geheimdienst-Analytiker seien davon ausgegangen, dass diese Röhren für ein irakisches Atomwaffenprogramm seien, aber nicht alle. Die Waffeninspektoren stellten später fest, dass Irak die Rohre nicht für ein Waffenprogramm erworben hatte.
Donald Rumsfeld gab gestern vor dem Senatsausschuss unumwunden zu, dass die USA nicht in den Krieg gegen den Irak gezogen sind, weil sie neue Beweise für das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen gehabt hätten. Vielmehr hätten die USA vorhandene Informationen über irakische Waffenprogramme nach den Anschlägen am 11. September 2001 in einem anderen Licht betrachtet, sagte der Minister.
"Wir haben gehandelt, weil wir die Beweise in einem völlig neuen Licht gesehen haben - durch das Prisma unserer Erfahrungen mit dem 11. September", sagte Rumsfeld vor dem Streitkräfteausschuss. Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob die US-Regierung falsche oder aufgebauschte Geheimdienstinformationen über angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak verwendet hat, um den Krieg gegen das Land zu rechtfertigen.
Präsident Bush verteidigte unterdessen seine Nutzung der Geheimdienstberichte. Er sei sich absolut sicher, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen habe, sagte Bush während seiner Afrika-Reise. Die US-Regierung hatte zuvor eingestehen müssen, dass Aussagen vom Januar über versuchte Urankäufe des Iraks in Afrika falsch waren.
BBC: Weißes Haus wusste von gefälschten Dokumenten
Der britische Sender BBC berichtete derweil unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten CIA-Agenten, die US-Regierung sei schon viele Monate vor Beginn des Irak-Kriegs von der CIA darüber informiert worden, dass Saddam Hussein kein Uran für sein illegales Atomwaffenprogramm in Niger kaufen wollte. Das hatte Bush Anfang des Jahres in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress behauptet. Bushs Sprecher Ari Fleischer bestätigte, die Aussage des Präsidenten sei nicht richtig gewesen, da sie sich auf gefälschte Dokumente aus Niger gestützt habe.
Laut BBC hatte ein früherer US-Diplomat bereits im März 2002 auf die Unrichtigkeit der Vorwürfe hingewiesen. Diese Information sei dann auch in das Weiße Haus gelangt. Ein Sprecher der US-Regierung wies dies zurück. Das Weiße Haus erhalte jeden Tag Hunderte von Geheimdienstberichten, sagte er der BBC. Es gebe keinen Anhaltspunkt darüber, dass die Information über das Uran bis zum Präsidenten gelangte.
Der Führer der Demokraten im Senat, Tom Daschle, sagte, das Eingeständnis des Weißen Hauses liefere die Bestätigung, "dass wir mit falschen Informationen versorgt wurden." Präsident Bush betonte dagegen, seine Entscheidung für ein militärisches Eingreifen im Irak habe nicht allein auf dem kritisierten Bericht, sondern auf breiterer Basis von Erkenntnissen beruht. "Ich habe keinen Zweifel, dass Saddam Hussein eine Gefahr für den Weltfrieden war", bekräftigte Bush. "Und ich habe keinen Zweifel, dass die USA das Richtige getan haben, als sie ihn von der Macht beseitigten."
http://www.ksta.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&…
US-Staaten in Finanznot
Die Neuverschuldung hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt.
Miami - Raucher haben es nicht leicht in den USA. Nicht nur werden sie in mehr und mehr Bundesstaaten aus Restaurants und Kneipen verbannt. Jüngstes Beispiel ist Florida, das gerade erst das Rauchen auf öffentlichen Plätzen verbot. Sie werden zusätzlich kräftig geschröpft.
Denn die kriselnde Wirtschaft und die damit verbundenen geringeren Steuereinnahmen lasten schwer auf dem Budget nordamerikanischer Bundesstaaten. So suchen sie nach zusätzlichen Geldquellen, ohne sofort die Einkommenssteuer erhöhen zu müssen. Raucher sind ein bevorzugtes Opfer: 30 Bundesstaaten haben seit Anfang 2002 die Tabaksteuer zum Teil recht kräftig nach oben gedrückt.
Doch diese Einnahmen sind ein Tropfen auf den heißen Stein in hoch verschuldeten Ländern wie beispielsweise Kalifornien, auf dem ein Rekorddefizit von 38 Milliarden Dollar lastet. Dort ist die Lage so brisant, dass politische Gegner gar an einem Verfahren zur Abwahl von Gouverneur Gray Davis basteln.
In anderen Bundesstaaten ist die Lage zwar weniger dramatisch, doch nach der National Gouvernors Association sind alle Staaten mit der „schlimmsten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ konfrontiert.
Obwohl sie von Washington zusätzliche 20 Milliarden Dollar für den Ausgleich von Steuerausfällen erhielten, kommen die meisten Länder nicht umhin, Steuern zu erhöhen oder ihre Ausgaben zusammenzustreichen. Als Folge haben bereits Arkansas, Nebraska und New York die Einkommenssteuer erhöht. In anderen Staaten stieg die Mehrwertsteuer.
Tiefer Griff in die Taschen
In vielen Regionen müssen die Bürger inzwischen auch tiefer für den Führerschein, das Schulgeld und den Jagdschein in die Tasche greifen. Auch wird verstärkt bei der Immobiliensteuer abkassiert. Gleichzeitig wurde zum ersten Mal seit 1997 der Rotstift beim Öffentlichen Dienst angesetzt sowie die staatlichen Gelder für Parks, die Weiterbildung und Umweltschutzmaßnahmen gekürzt.
Insgesamt reduzierten 37 Länder ihr Budget um 14,5 Milliarden Dollar, während in 29 Staaten die Regierungen mit Steuererhöhungen in Höhe von 17,5 Milliarden Dollar ihr Defizit auszugleichen suchen.
Lehrer bekommen die Sparmaßnahmen nicht nur am Arbeitsplatz zu spüren, wenn Schuljahre früher enden und Reparaturen an Gebäuden zurückgestellt werden. Sie müssen nicht selten auch Lohnkürzungen in Kauf nehmen. „Es sind ziemlich harte Zeiten für Lehrer und noch härtere für die Schüler“, notiert Physiklehrer Walt Hellman, der dieses Jahr mit neun Prozent weniger Lohn auskommen muss.
Harte Zeiten allüberall. Das zeigte sich auch Anfang Juli, als neun Bundesstaaten - darunter Kalifornien - ein neues Haushaltsjahr ohne Haushaltsplan begannen. Die Landesregierungen konnten sich nicht auf ein Budget einigen. Noch prekärer könnte es werden, wenn die Wirtschaft auch dieses Jahr nicht anzieht. Die Steuereinnahmen lagen zwar in den ersten Monaten um ein Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, doch das ist weit weniger als der Fiskus sich erhoffte. Und für diese Zunahme sind vor allem Tabak- und Alkoholsteuer verantwortlich.
Auch warnen Finanzexperten, dass ein erneuter Anstieg der Zinsen eine künftige Kreditaufnahme erschweren könnte. Die Neuverschuldung hat sich innerhalb von zwei Jahren auf immerhin 224 Milliarden Dollar verdoppelt. Was die Raucher betrifft, so zeigen sich diese erfinderisch. Um die Tabaksteuer zu sparen, kaufen sie in indianischen Reservaten oder im Internet.
US-Staaten in Finanznot
Die Neuverschuldung hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt.
Miami - Raucher haben es nicht leicht in den USA. Nicht nur werden sie in mehr und mehr Bundesstaaten aus Restaurants und Kneipen verbannt. Jüngstes Beispiel ist Florida, das gerade erst das Rauchen auf öffentlichen Plätzen verbot. Sie werden zusätzlich kräftig geschröpft.
Denn die kriselnde Wirtschaft und die damit verbundenen geringeren Steuereinnahmen lasten schwer auf dem Budget nordamerikanischer Bundesstaaten. So suchen sie nach zusätzlichen Geldquellen, ohne sofort die Einkommenssteuer erhöhen zu müssen. Raucher sind ein bevorzugtes Opfer: 30 Bundesstaaten haben seit Anfang 2002 die Tabaksteuer zum Teil recht kräftig nach oben gedrückt.
Doch diese Einnahmen sind ein Tropfen auf den heißen Stein in hoch verschuldeten Ländern wie beispielsweise Kalifornien, auf dem ein Rekorddefizit von 38 Milliarden Dollar lastet. Dort ist die Lage so brisant, dass politische Gegner gar an einem Verfahren zur Abwahl von Gouverneur Gray Davis basteln.
In anderen Bundesstaaten ist die Lage zwar weniger dramatisch, doch nach der National Gouvernors Association sind alle Staaten mit der „schlimmsten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ konfrontiert.
Obwohl sie von Washington zusätzliche 20 Milliarden Dollar für den Ausgleich von Steuerausfällen erhielten, kommen die meisten Länder nicht umhin, Steuern zu erhöhen oder ihre Ausgaben zusammenzustreichen. Als Folge haben bereits Arkansas, Nebraska und New York die Einkommenssteuer erhöht. In anderen Staaten stieg die Mehrwertsteuer.
Tiefer Griff in die Taschen
In vielen Regionen müssen die Bürger inzwischen auch tiefer für den Führerschein, das Schulgeld und den Jagdschein in die Tasche greifen. Auch wird verstärkt bei der Immobiliensteuer abkassiert. Gleichzeitig wurde zum ersten Mal seit 1997 der Rotstift beim Öffentlichen Dienst angesetzt sowie die staatlichen Gelder für Parks, die Weiterbildung und Umweltschutzmaßnahmen gekürzt.
Insgesamt reduzierten 37 Länder ihr Budget um 14,5 Milliarden Dollar, während in 29 Staaten die Regierungen mit Steuererhöhungen in Höhe von 17,5 Milliarden Dollar ihr Defizit auszugleichen suchen.
Lehrer bekommen die Sparmaßnahmen nicht nur am Arbeitsplatz zu spüren, wenn Schuljahre früher enden und Reparaturen an Gebäuden zurückgestellt werden. Sie müssen nicht selten auch Lohnkürzungen in Kauf nehmen. „Es sind ziemlich harte Zeiten für Lehrer und noch härtere für die Schüler“, notiert Physiklehrer Walt Hellman, der dieses Jahr mit neun Prozent weniger Lohn auskommen muss.
Harte Zeiten allüberall. Das zeigte sich auch Anfang Juli, als neun Bundesstaaten - darunter Kalifornien - ein neues Haushaltsjahr ohne Haushaltsplan begannen. Die Landesregierungen konnten sich nicht auf ein Budget einigen. Noch prekärer könnte es werden, wenn die Wirtschaft auch dieses Jahr nicht anzieht. Die Steuereinnahmen lagen zwar in den ersten Monaten um ein Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, doch das ist weit weniger als der Fiskus sich erhoffte. Und für diese Zunahme sind vor allem Tabak- und Alkoholsteuer verantwortlich.
Auch warnen Finanzexperten, dass ein erneuter Anstieg der Zinsen eine künftige Kreditaufnahme erschweren könnte. Die Neuverschuldung hat sich innerhalb von zwei Jahren auf immerhin 224 Milliarden Dollar verdoppelt. Was die Raucher betrifft, so zeigen sich diese erfinderisch. Um die Tabaksteuer zu sparen, kaufen sie in indianischen Reservaten oder im Internet.
http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF_106a/T05.HTM
Ein neues «American Century»?
Der Irak und die heimlichen Euro-Dollar-Kriege
Von F. William Engdahl, USA / Deutschland
Trotz des scheinbar raschen militärischen Erfolgs der USA im Irak ist der Dollar schwächer statt stärker. Dies ist eine unerwartete Entwicklung, da viele Devisenhändler einen gestärkten Dollar erwartet hatten, sobald die Nachricht eines US-Sieges gemeldet würde. Die Kapitalströme bewegen sich weg vom Dollar hin zum Euro. Viele beginnen sich zu fragen, ob die objektive Situation der US-Wirtschaft weitaus schlechter ist, als die Börse meldet. Die Zukunft des Dollars ist keineswegs nur eine unbedeutende Angelegenheit, die nur Banken oder Devisenhändler interessiert. Er ist das Kernstück der «Pax Americana» oder, wie es auch genannt wird, des «American Century», des Systems, auf dem die Rolle Amerikas in der Welt beruht. Doch während der Dollar nach dem Ende der Kämpfe im Irak ständig an Wert gegenüber dem Euro verliert, scheint Washington in öffentlichen Stellungnahmen das Absinken des Dollars absichtlich noch schlimmer darzustellen. Was jetzt passiert, ist ein Machtspiel von höchster geopolitischer Bedeutung, vielleicht sogar das verhängnisvollste seit dem Aufkommen der USA als führender Weltwirtschaftsmacht im Jahre 1945.
Die Koalition der Interessen, die im Irak-Krieg zusammenflossen, einem Krieg, der für die USA eine strategische Notwendigkeit darstellte, umfasste nicht nur die vernehmbaren und deutlich sichtbaren neokonservativen Falken um Verteidigungsminister Rumsfeld und seinen Stellvertreter, Paul Wolfowitz. Es standen auch mächtige langfristige Interessen dahinter, von deren globaler Rolle der Einfluss der amerikanischen Wirtschaft abhängt, wie beispielsweise der einflussreiche Energiesektor um Halliburton, Exxon Mobil, Chevron Texaco und andere multinationale Riesenkonzerne. Dazu gehören auch die gigantische amerikanische Waffenindustrie um Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon, Northrup-Grumman und andere. Der springende Punkt für diese riesigen Verteidigungs- und Energie-Konglomerate sind nicht die paar einträglichen Aufträge vom Pentagon für den Wiederaufbau der irakischen Ölanlagen, die die Taschen von Dick Cheney und anderen füllen. Es geht vielmehr um den Erhalt der amerikanischen Macht in den kommenden Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts. Das bedeutet nicht, dass bei diesem Prozess keine Profite gemacht werden, aber das ist nur ein Nebenprodukt dieses globalen strategischen Ziels.
Die Rolle des Dollars in Washingtons Machtkalkül
Bei diesem Machtspiel wird die Bedeutung, die der Erhalt des Dollars als die Währungsreserve der Welt hat, am wenigsten verstanden, welcher aber der wichtigste Antrieb hinter dem Machtkalkül Washingtons gegenüber dem Irak in den letzten Monaten darstellt. Die amerikanische Vorherrschaft in der Welt beruht grundsätzlich auf zwei Säulen - ihrer überwältigenden militärischen Überlegenheit, vor allem auf dem Meer, und ihrer Kontrolle über die Wirtschaftsströme der Welt durch die Rolle des Dollars als der Währungsreserve der Welt. Es wird immer deutlicher, dass es im Irak-Krieg mehr darum ging, die zweite Säule, die Rolle des Dollars, aufrechtzuerhalten, als um die erste, das Militär. Was die Rolle des Dollars angeht, ist das Öl ein strategischer Faktor.
Die drei Phasen des «American Century»
Wenn wir rückblickend die Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrachten, kann man mehrere deutliche Entwicklungsphasen der amerikanischen Rolle in der Welt erkennen. Die erste Phase, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945-1948 und am Anfang des kalten Krieges begann, könnte man die Zeit des Bretton-Woods-Goldsystems nennen.
Phase I: Die Zeit der Bretton-Wood-Institution
Unter dem Bretton-Wood-System unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ordnung relativ stabil. Die USA waren aus dem Krieg als die alleinige Supermacht hervorgegangen mit einer starken industriellen Basis und den grössten Goldreserven aller Nationen. Die Anfangsaufgabe war es, Westeuropa wieder aufzubauen und eine Nordatlantik-Allianz gegen die Sowjetunion zu schaffen. Die Rolle des Dollars war direkt mit der des Goldes verknüpft. Solange Amerika die grössten Goldreserven besass und seine Wirtschaft weltweit am effizientesten produzierte, war die gesamte Bretton-Woods-Währungsstruktur vom französischen Franc über das britische Pfund Sterling bis zur deutschen Mark stabil. Im Zusammenhang mit der Unterstützung des Marshallplans und Krediten zur Finanzierung des Wiederaufbaus des vom Kriege zerschlagenen Europas wurden Dollarkredite ausgedehnt. Die amerikanischen Firmen, darunter auch die multinationalen Ölkonzerne, verdienten reichlich durch diese Vorherrschaft des Handels zu Beginn der 1950er Jahre. Washington unterstützte sogar das Zustandekommen des Vertrags von Rom im Jahre 1958, um die europäische Wirtschaftsstabilität zu stärken und damit weitere US-Exportmärkte zu schaffen. Diese Anfangsphase, die der Herausgeber des Time Magazine, Henry Luce, das «American Century» nannte, war, was die Wirtschaftsgewinne betraf, recht «positiv», sowohl für die USA als auch für Europa. Die USA hatten immer noch einen wirtschaftlichen Spielraum, in dem sie sich bewegen konnten.
Dies war die Ära der liberalen amerikanischen Aussenpolitik. Die USA waren der Hegemon innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft. Da sie im Vergleich zu Europa, Japan und Südkorea über enorme Goldreserven und Wirtschaftsressourcen verfügten, konnten es sich die USA durchaus leisten, ihre Handelsgrenzen für Exporte aus Europa und Japan zu öffnen. Als Gegenleistung unterstützen die Europäer und Japaner die USA bei ihrer Rolle während des kalten Krieges.
Während der 1950er und frühen 1960er Jahre beruhte die amerikanische Führung weniger auf direktem Zwang als auf dem Herstellen eines Konsenses mit den Alliierten, sei es bei GATT-Handelsrunden oder in anderen Bereichen. Eliteorganisationen wie die Bilderberger-Treffen wurden organisiert, um einen zufriedenstellenden gemeinsamen Konsens zwischen Europa und den USA zu erreichen.
Diese erste, eher «freundliche» Phase des «American Century» ging in den frühen 1970ern zu Ende.
Ende des Bretton-Wood-Systems
Das Bretton-Woods-Goldsystem begann zusammenzubrechen, weil Europa wirtschaftlich auf eigene Füsse kam und Mitte der 1960er eine bedeutende Exportregion wurde. Diese zunehmende wirtschaftliche Stärke Westeuropas fiel zusammen mit den ansteigenden öffentlichen Defiziten der USA, weil Johnson den tragischen Krieg in Vietnam eskalieren liess. Während der 1960er Jahre begann Frankreichs General de Gaulle für die Gewinne aus den französischen Exporten aus den amerikanischen Staatsreserven Gold statt Dollars zu verlangen, was während der Zeit von Bretton Woods durchaus legal war. Gegen November 1967 war aber der Goldfluss aus den USA und aus den Tresoren der Bank von England kritisch geworden. Das schwache Glied in der Kette des Bretton-Woods-Goldsystems war England, der «kranke Mann Europas». Die Kette riss, weil der Sterling im Jahre 1967 entwertet wurde. Das beschleunigte nur noch den Druck auf den US-Dollar, da französische und andere Zentralbanken ihre Forderungen nach US-Gold im Tausch für ihre Dollarreserven verstärkten. Sie kalkulierten die steigenden Kriegsdefizite durch den Vietnam-Krieg mit ein, und es würde nur noch eine Frage von Monaten sein, bis die USA selber gezwungen sein würden, ihren Dollar gegen das Gold abzuwerten, um wenigstens noch einen guten Preis für ihr Gold erzielen zu können.
Aufhebung der Geldfindung - Einführung freier Wechselkurse (floating)
Im Mai 1971 war der Fluss der US-Goldreserven besorgniserregend geworden. Sogar die Bank von England hatte sich den Franzosen und ihren Forderungen nach Gold gegen Dollars angeschlossen. Das war der Punkt, an dem die Nixon-Administration dafür plädierte, das Gold vollständig aufzugeben und im August 1971 zu einem System der «frei flotierenden» Währungen überzugehen, statt einen Kollaps der US-Goldreserven zu riskieren.
Der Bruch mit dem Gold öffnete den Weg für eine völlig neue Phase des «American Century». In dieser neuen Phase wurde die Kontrolle über die Währungspolitik durch grosse internationale Banken wie die Citibank, Chase Manhattan oder Barclays Bank de facto privatisiert. Sie übernahmen die Rolle, die die Zentralbanken beim Goldsystem innegehabt hatten, jedoch nun völlig ohne Gold. «Freie Marktentwicklungen» konnten nun den Dollar festlegen. Und sie taten es mit Macht.
Das freie Floaten des Dollars schaffte gleichzeitig mit dem Anstieg des Opec-Ölpreises um 400% im Jahre 1973 nach dem Yom-Kippur-Krieg eine Basis für eine zweite Phase des «American Century», die Phase des Petrodollars.
Phase II: Das Petrodollar-Recycling
Mitte der siebziger Jahre durchlief das System des «American Century» globaler wirtschaftlicher Dominanz einen dramatischen Wandel. Ein anglo-amerikanischer Ölschock schuf plötzlich eine starke Nachfrage nach dem «floating dollar», das heisst einem Dollar mit frei flotierendem Wechselkurs. Ölimportierende Länder von Deutschland über Argentinien bis Japan waren alle mit dem Problem konfrontiert, wie sie in Dollar exportieren konnten, um ihre neuen hohen Rechnungen für den Ölimport zu zahlen. Die Opec-Länder wurden mit neuen Öldollars überflutet. Ein grosser Teil dieser Öldollars kam auf Londoner und New Yorker Banken, wo ein neuer Prozess in Gang gesetzt wurde. Henry Kissinger gab ihm die Bezeichnung «Das Recycling von Petrodollars». Die Recycling-Strategie wurde bereits im Mai 1971 beim Bilderberger-Treffen in Saltsjoebaden, Schweden, diskutiert. Sie wurde von den amerikanischen Mitgliedern der Bilderberg-Gruppe präsentiert; die Details werden ausführlich dargestellt im Buch «Mit der Ölwaffe zur Weltmacht».1
Petrodollar-Recyling: Der Beginn der Schuldenkrise der dritten Welt
Die Opec erstickte fast an Dollars, die sie nicht brauchen konnten. Amerikanische und britische Banken nahmen die Opec-Dollar und verliehen sie in Form von Eurodollar-Bonds oder -Darlehen weiter an Drittweltländer, die dringend Dollar aufnehmen mussten, um ihre Ölimporte zu finanzieren. Die Anhäufung dieser Petrodollar-Schulden in den späten siebziger Jahren legte die Basis für die Schuldenkrise der Drittweltländer in den achtziger Jahren. Hunderte Milliarden Dollars wurden zwischen Opec, Londoner und New Yorker Banken und zurück in die Geld aufnehmenden Länder der dritten Welt recycelt.
Der IWF wird «Schuldenpolizist»
Im August 1982 brach die Kette schliesslich, und Mexiko kündigte an, dass es wahrscheinlich den Rückzahlungen seiner Eurodollar-Schulden nicht nachkommen würde. Die Schuldenkrise der dritten Welt begann, nachdem Paul Volcker und die US-amerikanische Notenbank Ende 1979 einseitig den US-Zinssatz angezogen hatten, als Versuch den schwachen Dollar zu retten. Nach drei Jahren mit rekordhohen US-Zinsen war der Dollar «gerettet», aber der Sektor der Entwicklungsländer drohte wirtschaftlich unter den US-Wuchserzinsen auf ihren Petrodollar-Darlehen zu ersticken. Um für die Rückzahlung der Schulden an die Londoner und New Yorker Banken zu sorgen, schalteten die Banken den IWF ein, der als «Schuldenpolizist» zu fungieren hatte. Öffentliche Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt wurden auf Anordnung des IWF zusammengestrichen, um sicherzustellen, dass der Schuldendienst für die Petrodollars gegenüber den Banken rechtzeitig geleistet werden konnte.
Die Phase der Hegemonie des Petrodollars war ein Versuch des US-Establishments, den eigenen geopolitischen Niedergang als weltbeherrschendes Zentrum des Nachkriegssystems zu verlangsamen. Der Washington-Konsens des IWF wurde entwickelt, um die drakonischen Schulden der Drittweltländer einzutreiben, um sie zur Rückzahlung der Dollarschulden zu zwingen, was jegliche wirtschaftliche Unabhängigkeit der Länder im Süden verhinderte und den US-Banken half, den Dollar über Wasser zu halten.
Trilaterale Kommission - die Einbindung Japans
1973 wurde die Trilaterale Kommission von David Rockefeller und anderen ins Leben gerufen, um mit dem Aufkommen Japans als Industriegiganten fertig zu werden und zu versuchen, Japan in das System einzubinden. Japan war als grössere Industrienation ein wichtiger Importeur von Öl. Japans Handelsüberschüsse durch die Exporte von Autos und anderen Gütern wurden verwendet, um Öl mit Dollars zu kaufen. Die restlichen Überschüsse wurden in zinsbringende US-Schatzbriefe (Treasury bonds) investiert, um Zinsen abzuschöpfen. Die G-7 (heute G-8) wurde gegründet, um Japan und Westeuropa innerhalb des US-Dollar-Systems zu halten. Bis in die achtziger Jahre hinein verlangten verschiedene Stimmen in Japan immer wieder, dass sich die drei Währungen - der Dollar, die Deutsche-Mark und der Yen - die Rolle der Weltreserve teilen sollten. Das geschah niemals. Der Dollar blieb dominant.
Von einem engen Blickwinkel aus betrachtet schien die Hegemoniephase des Petrodollars zu funktionieren. Darunter war sie weltweit auf einem Niedergang des wirtschaftlichen Lebensstandard aufgebaut, da die Vorgaben des IWF das Wachstum der nationalen Wirtschaften zerstörten und die Märkte für globalisierende multinationale Unternehmen aufbrachen, die in den achtziger und insbesonders in den neunziger Jahren ihre Produktion in billige Länder verlegen wollten.
Aber sogar in der Petrodollar-Phase war die amerikanische Aussenhandels- und Militärpolitik immer noch von Stimmen des traditionellen liberalen Konsensus dominiert. Die amerikanische Macht hing davon ab, periodisch neue Handelsabkommen oder andere Fragen mit den US-Verbündeten in Europa, Japan und Asien auszuhandeln.
Phase III beginnt: Der Petro-Euro - ein Rivale?
Das Ende des kalten Krieges und das Aufkommen eines neuen geeinten Europas und der Europäischen Währungsunion in den frühen 90er Jahren stellte eine vollkommen neue Herausforderung für das «American Century» dar. Es dauerte einige Jahre, mehr als eine Dekade nach dem ersten Golfkrieg 1991, bis diese neue Herausforderung sich in ihrem ganzen Ausmass zeigte. Der gegenwärtige Irak-Krieg wird nur auf dem Hintergrund eines gewaltigen Kampfes innerhalb der neuen, dritten Phase zur Sicherung amerikanischer Vorherrschaft verständlich. Diese Phase ist bereits «demokratischer Imperialismus» genannt worden, ein Lieblingsbegriff von Max Boot und anderen Neokonservativen. Wie die Ereignisse im Irak nahelegen, wird sie wahrscheinlich nicht sehr demokratisch, wohl aber imperialistisch sein.
Im Gegensatz zu der ersten Zeit nach 1945 ist in dieser neuen Ära die Offenheit der USA gegenüber den anderen Mitgliedern der G-7, ihnen Konzessionen zu gewähren, verschwunden. Jetzt ist ungeschminkte Macht das einzige Instrument, die amerikanische Dominanz langfristig aufrechtzuerhalten. Am besten wird dieser Logik von den neokonservativen Falken um Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol und anderen Ausdruck verliehen.
Es muss aber betont werden, dass die Neokonservativen seit dem 11. September solchen Einfluss haben, weil die Mehrheit des US-Machtestablishments diese Ansichten als nützlich erachteten, um eine neue aggressive Rolle der USA in der Welt voranzutreiben.
Statt mit den europäischen Partnern Übereinkünfte auszuarbeiten, betrachtet Washington Euroland zunehmend als bedeutende strategische Bedrohung für die amerikanische Hegemonie, vor allem das «Alte Europa» mit Deutschland und Frankreich. Genau wie Grossbritannien während seines wirtschaftlichen Verfalls nach 1870 zunehmend Rettung in verzweifelten imperialen Kriegen in Südafrika und anderswo suchte, benützten die USA ihre militärische Macht, um das zu erreichen, was sie mit wirtschaftlichen Mitteln nicht mehr erreichen können. Hierbei ist der Dollar die Archillesferse.
Mit der Schaffung des Euro in den letzten fünf Jahren wurde dem globalen System ein völlig neues Element hinzugefügt, welches bestimmt, was wir die dritte Phase des «American Century» nennen. Diese Phase, in der der Irak-Krieg eine zentrale Rolle spielt, droht eine neue, bösartige und imperialistische Phase zu werden, welche die früheren Phasen amerikanischer Hegemonie ersetzen soll. Die Neokonservativen sprechen über diese imperialistische Agenda offen, während die eher traditionellen Vertreter der US-Politik sie abzustreiten versuchen. Die wirtschaftliche Realität, der sich der Dollar am Anfang des neuen Jahrhunderts gegenüber sieht, definiert diese neue Phase in einer verhängnisvollen Weise.
Phase III: Dauernde Dominanz durch rohes Diktat
Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden ersten Phasen des «American Century» - von 1945 bis 1973 und von 1973-1999 - und dieser neuen, sich herausbildenden Phase andauernder Dominanz in der Folge des 11. September und des Irak-Kriegs. Nach 1945 bis heute war die amerikanische Macht vor allem von der Art eines Hegemon. Ein Hegemon dominiert in einer Welt, in der die Macht ungleich verteilt ist, und seine Macht entsteht nicht nur durch Gewalt, sondern im Einverständnis mit seinen Verbündeten. Das ist auch der Grund, wieso der Hegemon zu bestimmten Diensten gegenüber den Verbündeten verpflichtet ist, wie beispielsweise militärische Sicherheit und Regulierung der Weltmärkte zum Vorteil einer grösseren Gruppe - ihn selbst eingeschlossen - zu leisten. Eine imperialistische Macht hat keine solchen Verpflichtungen gegenüber Verbündeten, einzig das rohe Diktat, wie es seine niedergehende Macht aufrechterhalten kann, was manche als «imperial overstretch» bezeichnen («imperiale Überdehung»). Das ist die Welt, die Amerika auf Anraten der neokonservativen Falken um Rumsfeld und Cheney mit einer Politik der Präemptivkriege beherrschen soll.
Ein versteckter Krieg um die globale Hegemonie zwischen dem Dollar und der neuen Währung des Euro steht im Zentrum dieser neuen Phase.
Die zwei Säulen der US-Herrschaft: militärische Vormacht ...
Will man die Bedeutung dieser unausgesprochenen Schlacht um die Währungshegemonie verstehen, muss man zuerst verstehen, dass die US-Hegemonie seit dem Aufkommen der Vereinigten Staaten als dominierende Weltmacht nach 1945 auf zwei Säulen geruht hat, die nicht anzufechten waren. Die erste ist die militärische Überlegenheit gegenüber allen Gegnern. Die Vereinigten Staaten geben für die Verteidigung heute mehr als dreimal soviel aus wie die gesamte Europäische Union, nämlich über 396 Milliarden Dollar gegenüber 118 Milliarden Dollar im Vorjahr, und mehr als alle 15 nächstgrösseren Nationen zusammen. Washington plant innerhalb der nächsten fünf Jahre weitere 2,1 Billionen [2100 Milliarden] Dollar für die Verteidigung auszugeben. Keine Nation und keine Gruppe von Nationen kann mit diesen Verteidigungsausgaben schritthalten. China ist mindestens 30 Jahre davon entfernt, eine ernstzunehmende militärische Bedrohung zu werden. Niemand ist ein ernsthafter Gegenspieler gegen die amerikanische Militärmacht.
... und US-Dollar als Weltwährung
Die zweite Säule der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt ist die dominierende Rolle des US-Dollars als Weltwährung. Bis zur Einführung des Euro Anfang 1999 gab es keine potentielle Herausforderung der Dollarvorherrschaft im Welthandel. Seit den siebziger Jahren war der Petrodollar Kern der Dollarhegemonie. Letztere ist für die Zukunft einer amerikanischen Weltherrschaft in vieler Hinsicht strategisch ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger als die überwältigende militärische Macht.
Papiergeld Dollar
Die entscheidende Veränderung fand statt, als Nixon die Bindung des Dollars an den Goldstandard kündigte, um freie Wechselkurse mit anderen Währungen einzuführen. Dadurch wurden die Beschränkungen, neue Dollarnoten zu drucken, beseitigt. Die einzige Beschränkung bestand nur noch darin, wie viele Dollars der Rest der Welt nehmen würde. Durch ihren festen Vertrag mit Saudi-Arabien, dem grössten Ölproduzenten der Opec, garantierte Washington, die Erzeugerin des «swings» (die preisbestimmende Menge Öl), dass Öl - der häufigste Rohstoff der Welt, der wichtigste für die Wirtschaft einer jeder Nation, die Grundlage für jeden Transport und für vieles in der Industriewirtschaft - auf den Weltmärkten nur noch gegen Dollars erhältlich war. Der Deal wurde im Juni 1974 von Staatssekretär Henry Kissinger durch die Gründung der US-Saudiarabischen Joint Commission on Economic Cooperation abgeschlossen.
Dollarbindung des Öls
Die amerikanische Schatzkammer und die amerikanische Zentralbank würden der Saudi-arabischen Zentralbank, SAMA, «erlauben», amerikanische Staatsanleihen mit saudischen Petrodollars zu kaufen. 1975 erklärten sich die Opec-Länder offiziell dazu bereit, ihr Öl nur gegen Dollars zu verkaufen. Eine geheime Erklärung des amerikanischen Militärs, Saudi-Arabien zu bewaffnen, war die Gegenleistung.
Bis November 2000 wagte kein Opec-Land, die Dollarpreisregel zu verletzen. Solange der Dollar die stärkste Währung war, gab es auch wenig Anlass dafür. Aber im November 2000 überzeugten Frankreich und andere Mitgliedstaaten der EU Saddam Hussein, sich den USA zu widersetzen, indem er das irakische Öl-für-Nahrungsmittel nicht in Dollars, «der Feindwährung», wie der Irak sie nannte, sondern nur in Euro verkaufe. Die Euros befanden sich auf einem speziellen UN-Konto bei der führenden französischen Bank, BNP Paribas. Radio Liberty des amerikanischen Aussenministeriums brachte darüber eine kurze Meldung in den Nachrichten, die Geschichte wurde aber schnell zum Schweigen gebracht.2
Dieser kaum wahrgenommene Schritt des Irak, sich dem Dollar zugunsten des Euro zu widersetzen, war für sich genommen unbedeutend. Doch, wenn das sich ausgebreitet hätte, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem der Dollar schon geschwächt war, hätte das einen panischen Verkauf von Dollars durch ausländische Zentralbanken und Opec-Ölproduzenten bewirken können. In den Monaten vor dem jüngsten Irak-Krieg waren Anzeichen, die in diese Richtung deuteten, aus Russland, dem Iran, Indonesien und sogar Venezuela zu hören.
Der Irak-Krieg - tödliche Warnung zur Rettung des Dollars?
Ein Opec-Beamter aus dem Iran, Javad Yarjani, lieferte eine detaillierte Analyse darüber, wie die Opec in naher Zukunft ihr Öl an die EU gegen Euro und nicht gegen Dollars verkaufen würden. Im April 2002 sprach Yarjani in Oviedo in Spanien an einer Einladung der EU. Es sprechen alle Anzeichen dafür, dass der Irak-Krieg gezielt als der einfachste Weg angezettelt wurde, um eine tödliche vorsorgliche Warnung an die Opec-Länder und andere zu schicken, nicht damit zu liebäugeln, das System des Petrodollars zugunsten eines Systems, das auf dem Euro basiert, fallenzulassen.
Informierte Bankierskreise in der City of London (dem Finanzplatz von London) und an anderen Orten Europas bestätigen vertraulich die Bedeutung dieser wenig zur Kenntnis genommenen Bewegung des Irak vom Petro-Dollar zum Petro-Euro. «Der Schritt des Irak war eine Kriegserklärung gegen den Dollar», erzählte mir neulich ein ehemaliger Londoner Bankier. «Sobald es klar war, dass England und Amerika den Irak eingenommen hatten, war ein grosser Seufzer der Erleichterung in den Banken der Londoner City zu hören. Sie sagten vertraulich, Ðjetzt müssen wir uns um diese verdammte Bedrohung durch den Euro keine Sorgen mehr machenð.»
Warum sollte etwas so Kleines eine so grosse strategische Bedrohung für London und New York oder für die Vereinigten Staaten sein, dass ein amerikanischer Präsident dafür offensichtlich fünfzig Jahre alliierter Beziehungen in der ganzen Welt riskiert und mehr noch, einen militärischen Angriff startet, dessen Rechtfertigung vor der Welt nicht bestehen konnte?
Petrodollar stützt die amerikanische Weltherrschaft
Die Antwort liegt in der einzigartigen Rolle des Petro-Dollars für die Untermauerung der amerikanischen Wirtschaft.
Wie funktioniert das? Solange fast 70% des Welthandels in Dollar abgewickelt werden, ist der Dollar die Währung, die die Zentralbanken als Reserve ansammeln. Aber die Zentralbanken, sei es in China, Japan, Brasilien oder Russland häufen nicht einfach nur Dollars in ihren Tresoren an. Währungen haben einen Vorteil gegenüber Gold. Eine Zentralbank kann sie benutzen, um staatliche Oligationen vom Herausgeber, den Vereinigten Staaten zu kaufen. Die meisten Länder der Welt sind gezwungen, ihre Handelsdefizite unter Kontrolle zu behalten, wollen sie sich nicht mit einem Währungszerfall konfrontiert sehen. Die Vereinigten Staaten nicht. Das liegt an der Rolle des Dollars als Reservewährung. Und die Untermauerung dieser Rolle als Reservewährung ist der Petrodollar. Jede Nation muss Dollars bekommen, um Öl importieren zu können, manche mehr als andere. Das hat zur Folge, dass ihr Handel sich an Dollar-Länder richtet, an die USA mehr als an alle anderen.
Weil Öl der wichtigste Rohstoff für jede Nation ist, verlangt das Petrodollar-System, das bis heute existiert, die Entwicklung riesiger Handelsüberschüsse, um Dollarüberschüsse anzusammeln. Dies gilt für alle Länder ausser einem - den USA, die den Dollar beherrschen und ihn nach Belieben oder per Dekret drucken. Weil heute der Grossteil des gesamten internationalen Handels in Dollar abgewickelt wird, müssen die Länder ins Ausland gehen, um die Zahlungsmittel zu bekommen, die sie nicht selbst herausgeben können. Die Struktur des gesamten Welthandels bewegt sich heute rund um diese Dynamik, von Russland bis China, von Brasilien bis Südkorea und Japan. Jeder ist darauf aus, Dollarüberschüsse aus dem Export zu maximieren.
Um diesen Prozess in Gang zu halten, haben die Vereinigten Staaten sich bereit erklärt, der letzte Importeur zu sein, falls sich kein anderer mehr findet, weil die ganze monetäre Hegemonie von diesem Dollar-Recycling abhängt.
Die Zentralbanken von Japan, China, Südkorea, Russland und den anderen Ländern kaufen mit ihren Dollars alle Sicherheiten auf die US-Staatsanleihen, um damit Zinsen für ihre Dollar zu gewinnen. Sie legen sie nicht unter ihre Matratze. Das wiederum erlaubt den Vereinigten Staaten, einen stabilen Dollar und deutlich tiefere Zinssätze und mit dem Rest der Welt ein Zahlungsbilanzdefizit im Wert von 500 Milliarden Dollar zu haben. Die amerikanische Zentralbank beherrscht die Druckerpressen für den Dollar, und die Welt braucht Dollars. So einfach ist das.
Die Bedrohung der USA durch Auslandschulden
Aber vielleicht ist es doch nicht so einfach: Es ist ein äusserst instabiles System, weil die amerikanischen Handelsdefizite und Nettoschulden oder Aktiva und Passiva gegenüber ausländischen Konten inzwischen gut über 22% des Bruttosozialprodukts aus dem Jahre 2000 liegen und weiterhin rapide ansteigen. Die Auslandnettoverschuldung der Vereinigten Staaten - öffentlich wie privat - beginnt unheilverkündend zu explodieren. In den vergangen drei Jahren - seit die US-Börse zusammengebrochen ist und in Washington wieder Haushaltsdefizite aufgetaucht sind - hat sich die Nettoverschuldung gemäss einer kürzlich herausgebrachten Studie des Pestel-Instituts in Hannover beinahe verdoppelt. 1999, beim Zerplatzen der dot.com.-Blase, betrugen die US-Nettoschulden gegenüber dem Ausland ungefähr 1,4 Billionen Dollar. Am Ende dieses Jahres werden sie schätzungsweise 3,7 Billionen Dollar überschreiten. Vor 1989 waren die Vereinigten Staaten ein Netto-Geldgeber, der mehr durch seine Auslandsinvestitionen gewonnen hat, als er ihnen an Zinsen für Staatsanleihen oder andere Vermögenswerten zahlte. Seit dem Ende des kalten Krieges bis heute sind die USA ein Nettoschuldner in Höhe von bis zu 3,7 Billionen Dollar geworden. Das ist nicht gerade das, was Hilmar Kopper* «peanuts» nennen würde.
Es bedarf keiner grossen Voraussicht, um zu sehen, in welchem Ausmass die Rolle der Vereinigten Staaten durch diese Defizite bedroht ist. Mit einem jährlichen Defizit von mehr als 500 Milliarden Dollar, mehr als 5% des Bruttoinlandsprodukts, müssen die Vereinigten Staaten mindestens für 1,4 Milliarden Dollar importieren oder anziehen, um einen Zerfall des Dollars zu vermeiden und um die Zinssätze niedrig genug für die Unterstützung der schuldenbelasteten Firmen zu halten. Diese Nettoverschuldung verschlimmert sich in rasanten Schritten. Würden Frankreich, Deutschland, Russland und einige Opec-Länder jetzt einen kleinen Anteil ihrer Dollars in Euros umwandeln, um Obligationen von Deutschland oder Frankreich oder dergleichen zu kaufen, würden die USA mit einer strategischen Krise konfrontiert, wie sie seit 1945 keine gesehen haben. Diese Bedrohung abzuwenden war eine der versteckten strategischen Gründe für die Entscheidung, einen, wie es heisst, «Regimewechsel» im Irak anzustreben. Das ist genauso einfach, wie es kalt ist. Die Zukunft von Amerikas Status als einziger Supermacht hing daran, die Bedrohung, die vor allem aus Eurasien und den Euroländern kam, abzuwenden. Der Irak war und ist eine Schachfigur in einem weitaus grösseren strategischen Spiel, einem um höchste Spieleinsätze.
Der Euro bedroht die Hegemonie
Als der Euro am Ende des letzten Jahrzehnts lanciert wurde, gingen führende Regierungsmitglieder der EU, Bankiers der Deutschen Bank, Norbert Walter und der französische Präsident Chirac zu den Haltern der hauptsächlichen Dollarreserven - China, Japan und Russland - und versuchten sie davon zu überzeugen, zumindest einen Teil ihrer Währungsreserven in Euro statt in Dollar anzulegen. Allerdings kollidierten sie mit der Notwendigkeit, den zu hoch bewerteten Euro zu entwerten, damit deutsche Exporte das Wachstum der Euroländer stabilisieren konnten.
Dann, mit dem Debakel von US-dot.com, das wie eine Blase platzte, der Finanzskandale von Enron und Worldcom und der Rezession in den USA begann der Dollar seine Anziehungskraft für ausländische Investoren zu verlieren. Der Euro gewann bis Ende des Jahres 2002 stetig an Wert. Als dann Frankreich und Deutschland ihre geheime diplomatische Strategie entwikkelten, den Krieg im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu blockieren, tauchten Gerüchte auf, wonach die Zentralbanken von Russland und China im Stillen begonnen hätten, Dollars zu verkaufen und Euro zu kaufen. Die Folge davon war der freie Fall des Dollars am Vorabend des Krieges. Für den Fall, dass Washington den Irak-Krieg verlieren würde oder er sich zu einem langdauernden blutigen Debakel entwickeln sollte, war das Szenario bereits gemacht.
Eine andere «Massenvernichtungswaffe»
Aber Washington, führende Banken New Yorks und höhere Ebenen der amerikanischen Elite wussten genau, was auf dem Spiel stand. Im Irak ging es nicht um einfache chemische oder auch nukleare Massenvernichtungswaffen. Die «Massenvernichtungswaffen» bestanden in der Bedrohung, dass andere dem Irak folgen und weg vom Doller hin zum Euro einschwenken würden, um so eine Massenvernichtung der Hegemonie der amerikanischen Wirtschaft in der Welt zu erzeugen. Wie ein Wirtschaftler es formulierte, wäre das Ende der Rolle des Dollars als Weltwährung eine «Katastrophe» für die Vereinigten Staaten. Der Zinsfuss der amerikanischen Zentralbank würde höher als 1979 angehoben werden müssen: Damals hob Paul Volcker beim Versuch, den Zerfall des Dollars zu stoppen, den Zinsfuss um über 17% an. Wenige wissen, dass die Krise des Dollars 1979 ebenfalls eine direkte Folge der Bewegungen von Deutschland und Frankreich unter Schmidt und Giscard waren, um Europa zusammen mit Saudi-Arabien und anderen zu verteidigen, die begannen, US-Schatzanweisungen zu verkaufen, um gegen die Politik der Carter-Administration zu protestieren. Es lohnt zudem, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Reagan-Administration nach der Rettung des Dollars durch Volcker, gestützt von vielen der heutigen neokonservativen Falken, mit riesigen militärischen Verteidigungsausgaben begann, um die Sowjetunion herauszufordern.
Eurasien versus anglo-amerikanische Inselmacht
Dieser Kampf von Petro-Dollars gegen Petro-Euros, der im Irak begann, ist trotz des scheinbaren Sieges der USA im Irak keinesfalls vorbei. Der Euro ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von französischen geopolitischen Strategen zur Etablierung einer multipolaren Welt geschaffen worden. Das Ziel war, einen Ausgleich zur übermächtigen Dominanz der USA im Weltgeschäft zu schaffen. Es ist daher bezeichnend, dass sich französische Strategen auf einen britischen geopolitischen Strategen stützen, nämlich auf Sir Halford Mackinder, um ihre konkurrierende Alternativmacht gegenüber den USA zu entwickeln.
Im vergangen Februar, schrieb ein dem französischen Geheimdienst nahestehendes Blatt, Intelligence Online, einen Artikel mit dem Titel «Die Strategie hinter der Paris-Berlin-Moskau-Achse». Bezugnehmend auf den Uno-Sicherheitsrats-Block Frankreich-Deutschland-Russland, der versuchte, die amerikanischen und britischen Kriegsbewegungen gegen den Irak zu stoppen, verweist der Pariser Bericht auf die jüngsten Anstrengungen der Europäer und anderer Mächte, eine Gegenmacht gegen die Vereinigen Staaten zu schaffen. Und unter Bezugnahme auf das neue Bündnis von Frankreich und Deutschland - und noch neuer - mit Putin, schreiben sie «eine neue Logik und sogar Dynamik scheint aufgekommen zu sein. Durch eine Allianz zwischen Paris, Moskau und Berlin, die vom Atlantik nach Asien geht, könnte sich ein Ende der US-Macht abzeichnen. Zum ersten Mal seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Idee eines Kernlandes der Welt - der Alptraum britischer Strategen - wieder in die internationalen Beziehungen eingeschlichen.»3
Eurasische Bedrohung
Mackinder, der Vater der britischen Geopolitiker, schrieb in seinem bedeutenden Text, «The Geograhical Pivot of History» («Die geographische Drehscheibe der Geschichte»), dass die Kontrolle des eurasischen Kernlandes, von der französischen Normandie bis Wladiwostock, die einzig mögliche Bedrohung sei, die der Seemacht Grossbritanniens etwas entgegen setzen könnte. Bis 1914 basierte die britische Diplomatie darauf, eine solche eurasische Bedrohung abzuwenden, damals im Hinblick auf die Expansionspolitik des deutschen Kaisers nach Osten mit dem Bau der Bagdad-Bahn und dem Aufbau der deutschen Tirpitz-Marine. Der erste Weltkrieg war das Resultat. Bezüglich der laufenden Bemühungen der Briten und später der Amerikaner, einen eurasischen Zusammenschluss als Rivalen zu verhindern, unterstreicht der Pariser Geheimdienst-Bericht folgendes: «Diese strategische Annäherung (d.h. eine eurasische Kernland-Einheit zu bilden) liegt allen Kämpfen zwischen den kontinentalen Mächten und den Seemächten (GB, USA und Japan) zugrunde. Es ist die Macht Washingtons über die Meere, die - sogar heute - die unerschütterliche Unterstützung Londons für die USA und die Allianz zwischen Tony Blair und Bush diktiert.»
Eine andere gut informierte französische Zeitschrift, Reseau Voltaire.net, schrieb am Vorabend des Irak-Krieges, dass der Dollar «die Achillesverse der USA» sei4. Dies ist - milde gesagt - eine Untertreibung.
Der Irak-Krieg war schon lange geplant
Die aufkommende Bedrohung durch eine französische geführte Euro-Politik mit dem Irak und anderen Ländern brachte führende Kreise des US-politischen Establishments zum Nachdenken über die Bedrohung des Petro-Dollar-Systems, lange bevor Bush Präsident war. Während Perle, Wolfowitz und andere führende Neokonservative eine massgebliche Rolle bei der Entwicklung einer Strategie zur Stützung des lahmenden Systems spielten, zeichnete sich ein neuer Konsens ab, welcher die Hauptelemente des traditionellen Establishments des kalten Krieges um Figuren wie Rumsfeld und Cheney einbezog.
Im September 2000, während der Kampagne, veröffentlichte ein kleiner Washingtoner Thinktank das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert» (Projekt for the New American Century», PNAC) eine grosse Politik-Studie: «Rebuilding America`s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century (Neuaufbau der amerikanischen Verteidigung: Strategien, Kräfte und Quellen für ein neues Jahrhundert).» Der Bericht ist sehr nützlich, um die gegenwärtige Verwaltungspolitik in vielen Bereichen besser zu verstehen. Über den Irak heisst es dort: «Die Vereinigten Staaten sind seit Jahrzehnten bemüht, eine beständigere Rolle in der Sicherheit der Golfregion zu spielen. Während der ungelöste Konflikt mit dem Irak den direkten Grund liefert, übersteigt die Notwendigkeit einer substantiellen amerikanischen Armeepräsenz im Golf das Ziel einer Überwindung des Regimes von Saddam Hussein.»
Das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert»
Dieses PNAC-Papier ist die wesentliche Basis für das Weissbuch des Präsidenten vom September 2002, «The National Security Strategy of the United States of America». Das PNAC-Papier unterstützt einen «Entwurf für den Erhalt der globalen US-Vormachtstellung, die das Aufkommen eines grossen Machtrivalen ausschliesst und die internationale Sicherheitsordnung auf der Grundlage amerikanischer Prinzipien und Interessen gestaltet. Die amerikanische Grossstrategie muss so weit wie möglich in die Zukunft hinein geplant werden.» Weiter müssen die USA «fortgeschrittene Industrienationen davon abbringen, unsere Führerschaft in Frage zu stellen oder nur auf eine grössere regionale oder globale Rolle zu spekulieren.»
Die PNAC-Mitgliedschaft(sliste) von 2000 liest sich wie ein Dienstplan der heutigen Bush-Administration. Sie enthält Cheney, seine Frau Lynne Cheney, den neokonservativen persönliche Berater Cheney`s, Lewis Libby; Donald Rumsfeld; Rumsfelds Deputy Secretary Paul Wolfowitz. Sie enthält ebenfalls den Chef des National Security Council SC für den Nahen Osten, Elliott Abrams; John Bolton vom State Department, Richard Perle, und William Kristol. Mit von der Partie waren auch der frühere Vizepräsident von Lockheed-Martin, Bruce Jackson, und der ex-CIA-Kopf James Woolsey, zusammen mit Norman Podhoretz, einem weiteren Gründungsmitglied der Neo-Cons. Woolsey und Podhoretz sprechen offen davon, sich im «Vierten Weltkrieg» zu befinden.
Eine menschliche Finanzwirtschaft entwickeln
Es wird vielen immer klarer, dass es bei dem Krieg im Irak um den Erhalt eines bankrotten amerikanischen Jahrhundertmodells zur Weltbeherrschung geht. Es ist ebenso klar, dass der Irak nicht das Ende sein wird. Was jedoch nicht klar ist und was in der ganzen Welt offen diskutiert werden muss, ist, wie die gescheiterte Petro-Dollar-Ordnung durch ein neues System für globalen wirtschaftlichen Wohlstand und Sicherheit ersetzt werden kann.
Jetzt, da im Irak ein internes Chaos droht, ist es wichtig, die gesamte Nachkriegs-Währungsordnung neu zu überdenken. Die gegenwärtige französisch-deutsch-russische Allianz zur Bildung eines Gegengewichts gegenüber den Vereinigten Staaten benötigt nicht allein eine französisch-geführte Version des Petro-Dollar-Systems, so etwas wie ein Petro-Euro-System, das das bankrotte amerikanische Jahrhundert nur mit einem französischen Akzent weiterführt und in dem der Dollar lediglich durch den Euro ersetzt würde. Dies wäre nicht nur eine Verschwendung menschlicher Energien und würde zu steigender Arbeitslosigkeit in den Industrie- und Entwicklungsländern führen, sondern es würde auch den Lebensstandard weltweit weiter herabsetzen. Was einige Ökonomen während der Asienkrise 1998 begannen, muss weitergeführt werden: Ein grundsätzliches Nachdenken über die Basis für ein neues monetäres System, welches die menschliche Entwicklung unterstützt und nicht zerstört.
1 Engdahl, F. William, Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, Wiesbaden 2002. Im Kapitel 9-10 wird die Schaffung und Auswirkung des Recycling-Petrodollars und das geheime Saltsjoebaden Treffen 1973 für die Vorbereitung der Ölkrise ausgeführt.
2 Pressemitteilung des Radio Liberty/RFE, Charles Recknagel «Irak: Bagdad bewegt sich auf den Euro zu», 1. November 2000. Die Nachricht wurde während 48 Stunden durch CNN und andere Medien aufgenommen und verschwand prompt aus den Schlagzeilen. Seit dem Artikel von William Clark «Die wirklichen, aber unausgesprochenen Gründe für den bevorstehenden Irak-Krieg» erschien im Internet am 2. Februar 2003 - eine lebendige Online-Diskussion über den Öl-Euro-Faktor fand statt, aber abgesehen von gelegentlichen Erwähnungen im Londoner «Guardian» wurde in den Hauptmedien wenig über die strategischen Hintergrundfaktoren für die Washingtoner Entscheidung, gegen Irak vorzugehen, gesagt.
3 Der Geheimdienstonline-Herausgeber, Guillaume Dasquie, ist ein französischer Spezialist für strategische Geheimdienste und hat für die französischen Geheimdienste bezüglich des bin-Laden-Falls und andere Untersuchungen gearbeitet. Seine Erwähnungen zur französischen Geopolitik reflektieren klar das französische Denken auf hohem Niveau.
4 erschien am 4. April 2003. Er erörtert im Detail eine französische Analyse über die Verletzlichkeit des Dollarsystems am Vorabend des Irak-Krieges
--------------------------------------------------------------------------------
Das System von Bretton Woods
zf. Um das im September 1931 zusammengebrochene internationale Währungssystem neu zu ordnen, wurden an der Internationalen Währungs- und Finanzkonferenz, die vom 1. bis 22. Juli 1944 in Bretton Woods (New Hampshire, USA) stattfand, die Verträge über die Errichtung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) geschlossen und ein neues Weltwährungssystem begründet.
Das Bretton-Woods-System war eine Reaktion auf die durch Abwertungswettläufe und Protektionismus gekennzeichnete Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ziel war ein Welthandel ohne Handelsschranken und mit nur sehr geringen Schwankungen bei den Wechselkursen.
Der US-Dollar sollte zukünftig die Weltleitwährung sein und an einen Gold-Standard gebunden werden. Konkret wurde beschlossen, einen Preis von 35 US-Dollar pro Unze Gold festzulegen. Die USA verpflichteten sich, US-Dollar weltweit zu diesem Goldpreis zu verkaufen oder anzukaufen. Die Wechselkurse wurden gegenüber dem US-Dollar festgelegt, und die anderen Notenbanken verpflichteten sich, die Währungen ihrer Länder entsprechend dem festgelegten Wechselkurs zu stabilisieren. Der IWF sollte die Aufgabe haben, bei vorübergehenden Zahlungsbilanzproblemen von Staaten Kredite zu gewähren. Die Weltbank sollte die Kreditgewährung für Entwicklungsländer erleichtern.
--------------------------------------------------------------------------------
Der «Washington Consensus»
zf. Der Begriff «Washington Consensus» wurde von dem Wirtschaftswissenschafter John Williamson im Jahr 1989 geprägt. Unter diesem Begriff fasste er zusammen, was er als einen aktuellen Konsens zwischen dem Kongress der USA, dem IWF, der Weltbank und wichtigen Think tanks empfand. Zehn verschiedene Politikempfehlungen bildeten diesen Konsens zur «Reform» angeschlagener Volkswirtschaften:
1. Disziplin der öffentlichen Haushalte,
2. Umleitung öffentlicher Ausgaben in Felder, die sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch eine gleichmässigere Einkommensverteilung versprechen,
3. Steuerreformen mit niedrigeren Höchststeuersätzen und einer breiteren Steuerbasis,
4. Liberalisierung des Finanzmarktes,
5. Schaffung eines stabilen, wettbewerbsfähigen Wechselkurses,
6. Handelsliberalisierung,
7. Beseitigung von Marktzutrittsschranken und Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen (Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Firmen),
8. Privatisierung,
9. Deregulierung,
10. Gesicherte Eigentumsrechte.
Ein neues «American Century»?
Der Irak und die heimlichen Euro-Dollar-Kriege
Von F. William Engdahl, USA / Deutschland
Trotz des scheinbar raschen militärischen Erfolgs der USA im Irak ist der Dollar schwächer statt stärker. Dies ist eine unerwartete Entwicklung, da viele Devisenhändler einen gestärkten Dollar erwartet hatten, sobald die Nachricht eines US-Sieges gemeldet würde. Die Kapitalströme bewegen sich weg vom Dollar hin zum Euro. Viele beginnen sich zu fragen, ob die objektive Situation der US-Wirtschaft weitaus schlechter ist, als die Börse meldet. Die Zukunft des Dollars ist keineswegs nur eine unbedeutende Angelegenheit, die nur Banken oder Devisenhändler interessiert. Er ist das Kernstück der «Pax Americana» oder, wie es auch genannt wird, des «American Century», des Systems, auf dem die Rolle Amerikas in der Welt beruht. Doch während der Dollar nach dem Ende der Kämpfe im Irak ständig an Wert gegenüber dem Euro verliert, scheint Washington in öffentlichen Stellungnahmen das Absinken des Dollars absichtlich noch schlimmer darzustellen. Was jetzt passiert, ist ein Machtspiel von höchster geopolitischer Bedeutung, vielleicht sogar das verhängnisvollste seit dem Aufkommen der USA als führender Weltwirtschaftsmacht im Jahre 1945.
Die Koalition der Interessen, die im Irak-Krieg zusammenflossen, einem Krieg, der für die USA eine strategische Notwendigkeit darstellte, umfasste nicht nur die vernehmbaren und deutlich sichtbaren neokonservativen Falken um Verteidigungsminister Rumsfeld und seinen Stellvertreter, Paul Wolfowitz. Es standen auch mächtige langfristige Interessen dahinter, von deren globaler Rolle der Einfluss der amerikanischen Wirtschaft abhängt, wie beispielsweise der einflussreiche Energiesektor um Halliburton, Exxon Mobil, Chevron Texaco und andere multinationale Riesenkonzerne. Dazu gehören auch die gigantische amerikanische Waffenindustrie um Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon, Northrup-Grumman und andere. Der springende Punkt für diese riesigen Verteidigungs- und Energie-Konglomerate sind nicht die paar einträglichen Aufträge vom Pentagon für den Wiederaufbau der irakischen Ölanlagen, die die Taschen von Dick Cheney und anderen füllen. Es geht vielmehr um den Erhalt der amerikanischen Macht in den kommenden Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts. Das bedeutet nicht, dass bei diesem Prozess keine Profite gemacht werden, aber das ist nur ein Nebenprodukt dieses globalen strategischen Ziels.
Die Rolle des Dollars in Washingtons Machtkalkül
Bei diesem Machtspiel wird die Bedeutung, die der Erhalt des Dollars als die Währungsreserve der Welt hat, am wenigsten verstanden, welcher aber der wichtigste Antrieb hinter dem Machtkalkül Washingtons gegenüber dem Irak in den letzten Monaten darstellt. Die amerikanische Vorherrschaft in der Welt beruht grundsätzlich auf zwei Säulen - ihrer überwältigenden militärischen Überlegenheit, vor allem auf dem Meer, und ihrer Kontrolle über die Wirtschaftsströme der Welt durch die Rolle des Dollars als der Währungsreserve der Welt. Es wird immer deutlicher, dass es im Irak-Krieg mehr darum ging, die zweite Säule, die Rolle des Dollars, aufrechtzuerhalten, als um die erste, das Militär. Was die Rolle des Dollars angeht, ist das Öl ein strategischer Faktor.
Die drei Phasen des «American Century»
Wenn wir rückblickend die Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges betrachten, kann man mehrere deutliche Entwicklungsphasen der amerikanischen Rolle in der Welt erkennen. Die erste Phase, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945-1948 und am Anfang des kalten Krieges begann, könnte man die Zeit des Bretton-Woods-Goldsystems nennen.
Phase I: Die Zeit der Bretton-Wood-Institution
Unter dem Bretton-Wood-System unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ordnung relativ stabil. Die USA waren aus dem Krieg als die alleinige Supermacht hervorgegangen mit einer starken industriellen Basis und den grössten Goldreserven aller Nationen. Die Anfangsaufgabe war es, Westeuropa wieder aufzubauen und eine Nordatlantik-Allianz gegen die Sowjetunion zu schaffen. Die Rolle des Dollars war direkt mit der des Goldes verknüpft. Solange Amerika die grössten Goldreserven besass und seine Wirtschaft weltweit am effizientesten produzierte, war die gesamte Bretton-Woods-Währungsstruktur vom französischen Franc über das britische Pfund Sterling bis zur deutschen Mark stabil. Im Zusammenhang mit der Unterstützung des Marshallplans und Krediten zur Finanzierung des Wiederaufbaus des vom Kriege zerschlagenen Europas wurden Dollarkredite ausgedehnt. Die amerikanischen Firmen, darunter auch die multinationalen Ölkonzerne, verdienten reichlich durch diese Vorherrschaft des Handels zu Beginn der 1950er Jahre. Washington unterstützte sogar das Zustandekommen des Vertrags von Rom im Jahre 1958, um die europäische Wirtschaftsstabilität zu stärken und damit weitere US-Exportmärkte zu schaffen. Diese Anfangsphase, die der Herausgeber des Time Magazine, Henry Luce, das «American Century» nannte, war, was die Wirtschaftsgewinne betraf, recht «positiv», sowohl für die USA als auch für Europa. Die USA hatten immer noch einen wirtschaftlichen Spielraum, in dem sie sich bewegen konnten.
Dies war die Ära der liberalen amerikanischen Aussenpolitik. Die USA waren der Hegemon innerhalb der westlichen Staatengemeinschaft. Da sie im Vergleich zu Europa, Japan und Südkorea über enorme Goldreserven und Wirtschaftsressourcen verfügten, konnten es sich die USA durchaus leisten, ihre Handelsgrenzen für Exporte aus Europa und Japan zu öffnen. Als Gegenleistung unterstützen die Europäer und Japaner die USA bei ihrer Rolle während des kalten Krieges.
Während der 1950er und frühen 1960er Jahre beruhte die amerikanische Führung weniger auf direktem Zwang als auf dem Herstellen eines Konsenses mit den Alliierten, sei es bei GATT-Handelsrunden oder in anderen Bereichen. Eliteorganisationen wie die Bilderberger-Treffen wurden organisiert, um einen zufriedenstellenden gemeinsamen Konsens zwischen Europa und den USA zu erreichen.
Diese erste, eher «freundliche» Phase des «American Century» ging in den frühen 1970ern zu Ende.
Ende des Bretton-Wood-Systems
Das Bretton-Woods-Goldsystem begann zusammenzubrechen, weil Europa wirtschaftlich auf eigene Füsse kam und Mitte der 1960er eine bedeutende Exportregion wurde. Diese zunehmende wirtschaftliche Stärke Westeuropas fiel zusammen mit den ansteigenden öffentlichen Defiziten der USA, weil Johnson den tragischen Krieg in Vietnam eskalieren liess. Während der 1960er Jahre begann Frankreichs General de Gaulle für die Gewinne aus den französischen Exporten aus den amerikanischen Staatsreserven Gold statt Dollars zu verlangen, was während der Zeit von Bretton Woods durchaus legal war. Gegen November 1967 war aber der Goldfluss aus den USA und aus den Tresoren der Bank von England kritisch geworden. Das schwache Glied in der Kette des Bretton-Woods-Goldsystems war England, der «kranke Mann Europas». Die Kette riss, weil der Sterling im Jahre 1967 entwertet wurde. Das beschleunigte nur noch den Druck auf den US-Dollar, da französische und andere Zentralbanken ihre Forderungen nach US-Gold im Tausch für ihre Dollarreserven verstärkten. Sie kalkulierten die steigenden Kriegsdefizite durch den Vietnam-Krieg mit ein, und es würde nur noch eine Frage von Monaten sein, bis die USA selber gezwungen sein würden, ihren Dollar gegen das Gold abzuwerten, um wenigstens noch einen guten Preis für ihr Gold erzielen zu können.
Aufhebung der Geldfindung - Einführung freier Wechselkurse (floating)
Im Mai 1971 war der Fluss der US-Goldreserven besorgniserregend geworden. Sogar die Bank von England hatte sich den Franzosen und ihren Forderungen nach Gold gegen Dollars angeschlossen. Das war der Punkt, an dem die Nixon-Administration dafür plädierte, das Gold vollständig aufzugeben und im August 1971 zu einem System der «frei flotierenden» Währungen überzugehen, statt einen Kollaps der US-Goldreserven zu riskieren.
Der Bruch mit dem Gold öffnete den Weg für eine völlig neue Phase des «American Century». In dieser neuen Phase wurde die Kontrolle über die Währungspolitik durch grosse internationale Banken wie die Citibank, Chase Manhattan oder Barclays Bank de facto privatisiert. Sie übernahmen die Rolle, die die Zentralbanken beim Goldsystem innegehabt hatten, jedoch nun völlig ohne Gold. «Freie Marktentwicklungen» konnten nun den Dollar festlegen. Und sie taten es mit Macht.
Das freie Floaten des Dollars schaffte gleichzeitig mit dem Anstieg des Opec-Ölpreises um 400% im Jahre 1973 nach dem Yom-Kippur-Krieg eine Basis für eine zweite Phase des «American Century», die Phase des Petrodollars.
Phase II: Das Petrodollar-Recycling
Mitte der siebziger Jahre durchlief das System des «American Century» globaler wirtschaftlicher Dominanz einen dramatischen Wandel. Ein anglo-amerikanischer Ölschock schuf plötzlich eine starke Nachfrage nach dem «floating dollar», das heisst einem Dollar mit frei flotierendem Wechselkurs. Ölimportierende Länder von Deutschland über Argentinien bis Japan waren alle mit dem Problem konfrontiert, wie sie in Dollar exportieren konnten, um ihre neuen hohen Rechnungen für den Ölimport zu zahlen. Die Opec-Länder wurden mit neuen Öldollars überflutet. Ein grosser Teil dieser Öldollars kam auf Londoner und New Yorker Banken, wo ein neuer Prozess in Gang gesetzt wurde. Henry Kissinger gab ihm die Bezeichnung «Das Recycling von Petrodollars». Die Recycling-Strategie wurde bereits im Mai 1971 beim Bilderberger-Treffen in Saltsjoebaden, Schweden, diskutiert. Sie wurde von den amerikanischen Mitgliedern der Bilderberg-Gruppe präsentiert; die Details werden ausführlich dargestellt im Buch «Mit der Ölwaffe zur Weltmacht».1
Petrodollar-Recyling: Der Beginn der Schuldenkrise der dritten Welt
Die Opec erstickte fast an Dollars, die sie nicht brauchen konnten. Amerikanische und britische Banken nahmen die Opec-Dollar und verliehen sie in Form von Eurodollar-Bonds oder -Darlehen weiter an Drittweltländer, die dringend Dollar aufnehmen mussten, um ihre Ölimporte zu finanzieren. Die Anhäufung dieser Petrodollar-Schulden in den späten siebziger Jahren legte die Basis für die Schuldenkrise der Drittweltländer in den achtziger Jahren. Hunderte Milliarden Dollars wurden zwischen Opec, Londoner und New Yorker Banken und zurück in die Geld aufnehmenden Länder der dritten Welt recycelt.
Der IWF wird «Schuldenpolizist»
Im August 1982 brach die Kette schliesslich, und Mexiko kündigte an, dass es wahrscheinlich den Rückzahlungen seiner Eurodollar-Schulden nicht nachkommen würde. Die Schuldenkrise der dritten Welt begann, nachdem Paul Volcker und die US-amerikanische Notenbank Ende 1979 einseitig den US-Zinssatz angezogen hatten, als Versuch den schwachen Dollar zu retten. Nach drei Jahren mit rekordhohen US-Zinsen war der Dollar «gerettet», aber der Sektor der Entwicklungsländer drohte wirtschaftlich unter den US-Wuchserzinsen auf ihren Petrodollar-Darlehen zu ersticken. Um für die Rückzahlung der Schulden an die Londoner und New Yorker Banken zu sorgen, schalteten die Banken den IWF ein, der als «Schuldenpolizist» zu fungieren hatte. Öffentliche Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt wurden auf Anordnung des IWF zusammengestrichen, um sicherzustellen, dass der Schuldendienst für die Petrodollars gegenüber den Banken rechtzeitig geleistet werden konnte.
Die Phase der Hegemonie des Petrodollars war ein Versuch des US-Establishments, den eigenen geopolitischen Niedergang als weltbeherrschendes Zentrum des Nachkriegssystems zu verlangsamen. Der Washington-Konsens des IWF wurde entwickelt, um die drakonischen Schulden der Drittweltländer einzutreiben, um sie zur Rückzahlung der Dollarschulden zu zwingen, was jegliche wirtschaftliche Unabhängigkeit der Länder im Süden verhinderte und den US-Banken half, den Dollar über Wasser zu halten.
Trilaterale Kommission - die Einbindung Japans
1973 wurde die Trilaterale Kommission von David Rockefeller und anderen ins Leben gerufen, um mit dem Aufkommen Japans als Industriegiganten fertig zu werden und zu versuchen, Japan in das System einzubinden. Japan war als grössere Industrienation ein wichtiger Importeur von Öl. Japans Handelsüberschüsse durch die Exporte von Autos und anderen Gütern wurden verwendet, um Öl mit Dollars zu kaufen. Die restlichen Überschüsse wurden in zinsbringende US-Schatzbriefe (Treasury bonds) investiert, um Zinsen abzuschöpfen. Die G-7 (heute G-8) wurde gegründet, um Japan und Westeuropa innerhalb des US-Dollar-Systems zu halten. Bis in die achtziger Jahre hinein verlangten verschiedene Stimmen in Japan immer wieder, dass sich die drei Währungen - der Dollar, die Deutsche-Mark und der Yen - die Rolle der Weltreserve teilen sollten. Das geschah niemals. Der Dollar blieb dominant.
Von einem engen Blickwinkel aus betrachtet schien die Hegemoniephase des Petrodollars zu funktionieren. Darunter war sie weltweit auf einem Niedergang des wirtschaftlichen Lebensstandard aufgebaut, da die Vorgaben des IWF das Wachstum der nationalen Wirtschaften zerstörten und die Märkte für globalisierende multinationale Unternehmen aufbrachen, die in den achtziger und insbesonders in den neunziger Jahren ihre Produktion in billige Länder verlegen wollten.
Aber sogar in der Petrodollar-Phase war die amerikanische Aussenhandels- und Militärpolitik immer noch von Stimmen des traditionellen liberalen Konsensus dominiert. Die amerikanische Macht hing davon ab, periodisch neue Handelsabkommen oder andere Fragen mit den US-Verbündeten in Europa, Japan und Asien auszuhandeln.
Phase III beginnt: Der Petro-Euro - ein Rivale?
Das Ende des kalten Krieges und das Aufkommen eines neuen geeinten Europas und der Europäischen Währungsunion in den frühen 90er Jahren stellte eine vollkommen neue Herausforderung für das «American Century» dar. Es dauerte einige Jahre, mehr als eine Dekade nach dem ersten Golfkrieg 1991, bis diese neue Herausforderung sich in ihrem ganzen Ausmass zeigte. Der gegenwärtige Irak-Krieg wird nur auf dem Hintergrund eines gewaltigen Kampfes innerhalb der neuen, dritten Phase zur Sicherung amerikanischer Vorherrschaft verständlich. Diese Phase ist bereits «demokratischer Imperialismus» genannt worden, ein Lieblingsbegriff von Max Boot und anderen Neokonservativen. Wie die Ereignisse im Irak nahelegen, wird sie wahrscheinlich nicht sehr demokratisch, wohl aber imperialistisch sein.
Im Gegensatz zu der ersten Zeit nach 1945 ist in dieser neuen Ära die Offenheit der USA gegenüber den anderen Mitgliedern der G-7, ihnen Konzessionen zu gewähren, verschwunden. Jetzt ist ungeschminkte Macht das einzige Instrument, die amerikanische Dominanz langfristig aufrechtzuerhalten. Am besten wird dieser Logik von den neokonservativen Falken um Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol und anderen Ausdruck verliehen.
Es muss aber betont werden, dass die Neokonservativen seit dem 11. September solchen Einfluss haben, weil die Mehrheit des US-Machtestablishments diese Ansichten als nützlich erachteten, um eine neue aggressive Rolle der USA in der Welt voranzutreiben.
Statt mit den europäischen Partnern Übereinkünfte auszuarbeiten, betrachtet Washington Euroland zunehmend als bedeutende strategische Bedrohung für die amerikanische Hegemonie, vor allem das «Alte Europa» mit Deutschland und Frankreich. Genau wie Grossbritannien während seines wirtschaftlichen Verfalls nach 1870 zunehmend Rettung in verzweifelten imperialen Kriegen in Südafrika und anderswo suchte, benützten die USA ihre militärische Macht, um das zu erreichen, was sie mit wirtschaftlichen Mitteln nicht mehr erreichen können. Hierbei ist der Dollar die Archillesferse.
Mit der Schaffung des Euro in den letzten fünf Jahren wurde dem globalen System ein völlig neues Element hinzugefügt, welches bestimmt, was wir die dritte Phase des «American Century» nennen. Diese Phase, in der der Irak-Krieg eine zentrale Rolle spielt, droht eine neue, bösartige und imperialistische Phase zu werden, welche die früheren Phasen amerikanischer Hegemonie ersetzen soll. Die Neokonservativen sprechen über diese imperialistische Agenda offen, während die eher traditionellen Vertreter der US-Politik sie abzustreiten versuchen. Die wirtschaftliche Realität, der sich der Dollar am Anfang des neuen Jahrhunderts gegenüber sieht, definiert diese neue Phase in einer verhängnisvollen Weise.
Phase III: Dauernde Dominanz durch rohes Diktat
Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden ersten Phasen des «American Century» - von 1945 bis 1973 und von 1973-1999 - und dieser neuen, sich herausbildenden Phase andauernder Dominanz in der Folge des 11. September und des Irak-Kriegs. Nach 1945 bis heute war die amerikanische Macht vor allem von der Art eines Hegemon. Ein Hegemon dominiert in einer Welt, in der die Macht ungleich verteilt ist, und seine Macht entsteht nicht nur durch Gewalt, sondern im Einverständnis mit seinen Verbündeten. Das ist auch der Grund, wieso der Hegemon zu bestimmten Diensten gegenüber den Verbündeten verpflichtet ist, wie beispielsweise militärische Sicherheit und Regulierung der Weltmärkte zum Vorteil einer grösseren Gruppe - ihn selbst eingeschlossen - zu leisten. Eine imperialistische Macht hat keine solchen Verpflichtungen gegenüber Verbündeten, einzig das rohe Diktat, wie es seine niedergehende Macht aufrechterhalten kann, was manche als «imperial overstretch» bezeichnen («imperiale Überdehung»). Das ist die Welt, die Amerika auf Anraten der neokonservativen Falken um Rumsfeld und Cheney mit einer Politik der Präemptivkriege beherrschen soll.
Ein versteckter Krieg um die globale Hegemonie zwischen dem Dollar und der neuen Währung des Euro steht im Zentrum dieser neuen Phase.
Die zwei Säulen der US-Herrschaft: militärische Vormacht ...
Will man die Bedeutung dieser unausgesprochenen Schlacht um die Währungshegemonie verstehen, muss man zuerst verstehen, dass die US-Hegemonie seit dem Aufkommen der Vereinigten Staaten als dominierende Weltmacht nach 1945 auf zwei Säulen geruht hat, die nicht anzufechten waren. Die erste ist die militärische Überlegenheit gegenüber allen Gegnern. Die Vereinigten Staaten geben für die Verteidigung heute mehr als dreimal soviel aus wie die gesamte Europäische Union, nämlich über 396 Milliarden Dollar gegenüber 118 Milliarden Dollar im Vorjahr, und mehr als alle 15 nächstgrösseren Nationen zusammen. Washington plant innerhalb der nächsten fünf Jahre weitere 2,1 Billionen [2100 Milliarden] Dollar für die Verteidigung auszugeben. Keine Nation und keine Gruppe von Nationen kann mit diesen Verteidigungsausgaben schritthalten. China ist mindestens 30 Jahre davon entfernt, eine ernstzunehmende militärische Bedrohung zu werden. Niemand ist ein ernsthafter Gegenspieler gegen die amerikanische Militärmacht.
... und US-Dollar als Weltwährung
Die zweite Säule der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt ist die dominierende Rolle des US-Dollars als Weltwährung. Bis zur Einführung des Euro Anfang 1999 gab es keine potentielle Herausforderung der Dollarvorherrschaft im Welthandel. Seit den siebziger Jahren war der Petrodollar Kern der Dollarhegemonie. Letztere ist für die Zukunft einer amerikanischen Weltherrschaft in vieler Hinsicht strategisch ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger als die überwältigende militärische Macht.
Papiergeld Dollar
Die entscheidende Veränderung fand statt, als Nixon die Bindung des Dollars an den Goldstandard kündigte, um freie Wechselkurse mit anderen Währungen einzuführen. Dadurch wurden die Beschränkungen, neue Dollarnoten zu drucken, beseitigt. Die einzige Beschränkung bestand nur noch darin, wie viele Dollars der Rest der Welt nehmen würde. Durch ihren festen Vertrag mit Saudi-Arabien, dem grössten Ölproduzenten der Opec, garantierte Washington, die Erzeugerin des «swings» (die preisbestimmende Menge Öl), dass Öl - der häufigste Rohstoff der Welt, der wichtigste für die Wirtschaft einer jeder Nation, die Grundlage für jeden Transport und für vieles in der Industriewirtschaft - auf den Weltmärkten nur noch gegen Dollars erhältlich war. Der Deal wurde im Juni 1974 von Staatssekretär Henry Kissinger durch die Gründung der US-Saudiarabischen Joint Commission on Economic Cooperation abgeschlossen.
Dollarbindung des Öls
Die amerikanische Schatzkammer und die amerikanische Zentralbank würden der Saudi-arabischen Zentralbank, SAMA, «erlauben», amerikanische Staatsanleihen mit saudischen Petrodollars zu kaufen. 1975 erklärten sich die Opec-Länder offiziell dazu bereit, ihr Öl nur gegen Dollars zu verkaufen. Eine geheime Erklärung des amerikanischen Militärs, Saudi-Arabien zu bewaffnen, war die Gegenleistung.
Bis November 2000 wagte kein Opec-Land, die Dollarpreisregel zu verletzen. Solange der Dollar die stärkste Währung war, gab es auch wenig Anlass dafür. Aber im November 2000 überzeugten Frankreich und andere Mitgliedstaaten der EU Saddam Hussein, sich den USA zu widersetzen, indem er das irakische Öl-für-Nahrungsmittel nicht in Dollars, «der Feindwährung», wie der Irak sie nannte, sondern nur in Euro verkaufe. Die Euros befanden sich auf einem speziellen UN-Konto bei der führenden französischen Bank, BNP Paribas. Radio Liberty des amerikanischen Aussenministeriums brachte darüber eine kurze Meldung in den Nachrichten, die Geschichte wurde aber schnell zum Schweigen gebracht.2
Dieser kaum wahrgenommene Schritt des Irak, sich dem Dollar zugunsten des Euro zu widersetzen, war für sich genommen unbedeutend. Doch, wenn das sich ausgebreitet hätte, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem der Dollar schon geschwächt war, hätte das einen panischen Verkauf von Dollars durch ausländische Zentralbanken und Opec-Ölproduzenten bewirken können. In den Monaten vor dem jüngsten Irak-Krieg waren Anzeichen, die in diese Richtung deuteten, aus Russland, dem Iran, Indonesien und sogar Venezuela zu hören.
Der Irak-Krieg - tödliche Warnung zur Rettung des Dollars?
Ein Opec-Beamter aus dem Iran, Javad Yarjani, lieferte eine detaillierte Analyse darüber, wie die Opec in naher Zukunft ihr Öl an die EU gegen Euro und nicht gegen Dollars verkaufen würden. Im April 2002 sprach Yarjani in Oviedo in Spanien an einer Einladung der EU. Es sprechen alle Anzeichen dafür, dass der Irak-Krieg gezielt als der einfachste Weg angezettelt wurde, um eine tödliche vorsorgliche Warnung an die Opec-Länder und andere zu schicken, nicht damit zu liebäugeln, das System des Petrodollars zugunsten eines Systems, das auf dem Euro basiert, fallenzulassen.
Informierte Bankierskreise in der City of London (dem Finanzplatz von London) und an anderen Orten Europas bestätigen vertraulich die Bedeutung dieser wenig zur Kenntnis genommenen Bewegung des Irak vom Petro-Dollar zum Petro-Euro. «Der Schritt des Irak war eine Kriegserklärung gegen den Dollar», erzählte mir neulich ein ehemaliger Londoner Bankier. «Sobald es klar war, dass England und Amerika den Irak eingenommen hatten, war ein grosser Seufzer der Erleichterung in den Banken der Londoner City zu hören. Sie sagten vertraulich, Ðjetzt müssen wir uns um diese verdammte Bedrohung durch den Euro keine Sorgen mehr machenð.»
Warum sollte etwas so Kleines eine so grosse strategische Bedrohung für London und New York oder für die Vereinigten Staaten sein, dass ein amerikanischer Präsident dafür offensichtlich fünfzig Jahre alliierter Beziehungen in der ganzen Welt riskiert und mehr noch, einen militärischen Angriff startet, dessen Rechtfertigung vor der Welt nicht bestehen konnte?
Petrodollar stützt die amerikanische Weltherrschaft
Die Antwort liegt in der einzigartigen Rolle des Petro-Dollars für die Untermauerung der amerikanischen Wirtschaft.
Wie funktioniert das? Solange fast 70% des Welthandels in Dollar abgewickelt werden, ist der Dollar die Währung, die die Zentralbanken als Reserve ansammeln. Aber die Zentralbanken, sei es in China, Japan, Brasilien oder Russland häufen nicht einfach nur Dollars in ihren Tresoren an. Währungen haben einen Vorteil gegenüber Gold. Eine Zentralbank kann sie benutzen, um staatliche Oligationen vom Herausgeber, den Vereinigten Staaten zu kaufen. Die meisten Länder der Welt sind gezwungen, ihre Handelsdefizite unter Kontrolle zu behalten, wollen sie sich nicht mit einem Währungszerfall konfrontiert sehen. Die Vereinigten Staaten nicht. Das liegt an der Rolle des Dollars als Reservewährung. Und die Untermauerung dieser Rolle als Reservewährung ist der Petrodollar. Jede Nation muss Dollars bekommen, um Öl importieren zu können, manche mehr als andere. Das hat zur Folge, dass ihr Handel sich an Dollar-Länder richtet, an die USA mehr als an alle anderen.
Weil Öl der wichtigste Rohstoff für jede Nation ist, verlangt das Petrodollar-System, das bis heute existiert, die Entwicklung riesiger Handelsüberschüsse, um Dollarüberschüsse anzusammeln. Dies gilt für alle Länder ausser einem - den USA, die den Dollar beherrschen und ihn nach Belieben oder per Dekret drucken. Weil heute der Grossteil des gesamten internationalen Handels in Dollar abgewickelt wird, müssen die Länder ins Ausland gehen, um die Zahlungsmittel zu bekommen, die sie nicht selbst herausgeben können. Die Struktur des gesamten Welthandels bewegt sich heute rund um diese Dynamik, von Russland bis China, von Brasilien bis Südkorea und Japan. Jeder ist darauf aus, Dollarüberschüsse aus dem Export zu maximieren.
Um diesen Prozess in Gang zu halten, haben die Vereinigten Staaten sich bereit erklärt, der letzte Importeur zu sein, falls sich kein anderer mehr findet, weil die ganze monetäre Hegemonie von diesem Dollar-Recycling abhängt.
Die Zentralbanken von Japan, China, Südkorea, Russland und den anderen Ländern kaufen mit ihren Dollars alle Sicherheiten auf die US-Staatsanleihen, um damit Zinsen für ihre Dollar zu gewinnen. Sie legen sie nicht unter ihre Matratze. Das wiederum erlaubt den Vereinigten Staaten, einen stabilen Dollar und deutlich tiefere Zinssätze und mit dem Rest der Welt ein Zahlungsbilanzdefizit im Wert von 500 Milliarden Dollar zu haben. Die amerikanische Zentralbank beherrscht die Druckerpressen für den Dollar, und die Welt braucht Dollars. So einfach ist das.
Die Bedrohung der USA durch Auslandschulden
Aber vielleicht ist es doch nicht so einfach: Es ist ein äusserst instabiles System, weil die amerikanischen Handelsdefizite und Nettoschulden oder Aktiva und Passiva gegenüber ausländischen Konten inzwischen gut über 22% des Bruttosozialprodukts aus dem Jahre 2000 liegen und weiterhin rapide ansteigen. Die Auslandnettoverschuldung der Vereinigten Staaten - öffentlich wie privat - beginnt unheilverkündend zu explodieren. In den vergangen drei Jahren - seit die US-Börse zusammengebrochen ist und in Washington wieder Haushaltsdefizite aufgetaucht sind - hat sich die Nettoverschuldung gemäss einer kürzlich herausgebrachten Studie des Pestel-Instituts in Hannover beinahe verdoppelt. 1999, beim Zerplatzen der dot.com.-Blase, betrugen die US-Nettoschulden gegenüber dem Ausland ungefähr 1,4 Billionen Dollar. Am Ende dieses Jahres werden sie schätzungsweise 3,7 Billionen Dollar überschreiten. Vor 1989 waren die Vereinigten Staaten ein Netto-Geldgeber, der mehr durch seine Auslandsinvestitionen gewonnen hat, als er ihnen an Zinsen für Staatsanleihen oder andere Vermögenswerten zahlte. Seit dem Ende des kalten Krieges bis heute sind die USA ein Nettoschuldner in Höhe von bis zu 3,7 Billionen Dollar geworden. Das ist nicht gerade das, was Hilmar Kopper* «peanuts» nennen würde.
Es bedarf keiner grossen Voraussicht, um zu sehen, in welchem Ausmass die Rolle der Vereinigten Staaten durch diese Defizite bedroht ist. Mit einem jährlichen Defizit von mehr als 500 Milliarden Dollar, mehr als 5% des Bruttoinlandsprodukts, müssen die Vereinigten Staaten mindestens für 1,4 Milliarden Dollar importieren oder anziehen, um einen Zerfall des Dollars zu vermeiden und um die Zinssätze niedrig genug für die Unterstützung der schuldenbelasteten Firmen zu halten. Diese Nettoverschuldung verschlimmert sich in rasanten Schritten. Würden Frankreich, Deutschland, Russland und einige Opec-Länder jetzt einen kleinen Anteil ihrer Dollars in Euros umwandeln, um Obligationen von Deutschland oder Frankreich oder dergleichen zu kaufen, würden die USA mit einer strategischen Krise konfrontiert, wie sie seit 1945 keine gesehen haben. Diese Bedrohung abzuwenden war eine der versteckten strategischen Gründe für die Entscheidung, einen, wie es heisst, «Regimewechsel» im Irak anzustreben. Das ist genauso einfach, wie es kalt ist. Die Zukunft von Amerikas Status als einziger Supermacht hing daran, die Bedrohung, die vor allem aus Eurasien und den Euroländern kam, abzuwenden. Der Irak war und ist eine Schachfigur in einem weitaus grösseren strategischen Spiel, einem um höchste Spieleinsätze.
Der Euro bedroht die Hegemonie
Als der Euro am Ende des letzten Jahrzehnts lanciert wurde, gingen führende Regierungsmitglieder der EU, Bankiers der Deutschen Bank, Norbert Walter und der französische Präsident Chirac zu den Haltern der hauptsächlichen Dollarreserven - China, Japan und Russland - und versuchten sie davon zu überzeugen, zumindest einen Teil ihrer Währungsreserven in Euro statt in Dollar anzulegen. Allerdings kollidierten sie mit der Notwendigkeit, den zu hoch bewerteten Euro zu entwerten, damit deutsche Exporte das Wachstum der Euroländer stabilisieren konnten.
Dann, mit dem Debakel von US-dot.com, das wie eine Blase platzte, der Finanzskandale von Enron und Worldcom und der Rezession in den USA begann der Dollar seine Anziehungskraft für ausländische Investoren zu verlieren. Der Euro gewann bis Ende des Jahres 2002 stetig an Wert. Als dann Frankreich und Deutschland ihre geheime diplomatische Strategie entwikkelten, den Krieg im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu blockieren, tauchten Gerüchte auf, wonach die Zentralbanken von Russland und China im Stillen begonnen hätten, Dollars zu verkaufen und Euro zu kaufen. Die Folge davon war der freie Fall des Dollars am Vorabend des Krieges. Für den Fall, dass Washington den Irak-Krieg verlieren würde oder er sich zu einem langdauernden blutigen Debakel entwickeln sollte, war das Szenario bereits gemacht.
Eine andere «Massenvernichtungswaffe»
Aber Washington, führende Banken New Yorks und höhere Ebenen der amerikanischen Elite wussten genau, was auf dem Spiel stand. Im Irak ging es nicht um einfache chemische oder auch nukleare Massenvernichtungswaffen. Die «Massenvernichtungswaffen» bestanden in der Bedrohung, dass andere dem Irak folgen und weg vom Doller hin zum Euro einschwenken würden, um so eine Massenvernichtung der Hegemonie der amerikanischen Wirtschaft in der Welt zu erzeugen. Wie ein Wirtschaftler es formulierte, wäre das Ende der Rolle des Dollars als Weltwährung eine «Katastrophe» für die Vereinigten Staaten. Der Zinsfuss der amerikanischen Zentralbank würde höher als 1979 angehoben werden müssen: Damals hob Paul Volcker beim Versuch, den Zerfall des Dollars zu stoppen, den Zinsfuss um über 17% an. Wenige wissen, dass die Krise des Dollars 1979 ebenfalls eine direkte Folge der Bewegungen von Deutschland und Frankreich unter Schmidt und Giscard waren, um Europa zusammen mit Saudi-Arabien und anderen zu verteidigen, die begannen, US-Schatzanweisungen zu verkaufen, um gegen die Politik der Carter-Administration zu protestieren. Es lohnt zudem, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Reagan-Administration nach der Rettung des Dollars durch Volcker, gestützt von vielen der heutigen neokonservativen Falken, mit riesigen militärischen Verteidigungsausgaben begann, um die Sowjetunion herauszufordern.
Eurasien versus anglo-amerikanische Inselmacht
Dieser Kampf von Petro-Dollars gegen Petro-Euros, der im Irak begann, ist trotz des scheinbaren Sieges der USA im Irak keinesfalls vorbei. Der Euro ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von französischen geopolitischen Strategen zur Etablierung einer multipolaren Welt geschaffen worden. Das Ziel war, einen Ausgleich zur übermächtigen Dominanz der USA im Weltgeschäft zu schaffen. Es ist daher bezeichnend, dass sich französische Strategen auf einen britischen geopolitischen Strategen stützen, nämlich auf Sir Halford Mackinder, um ihre konkurrierende Alternativmacht gegenüber den USA zu entwickeln.
Im vergangen Februar, schrieb ein dem französischen Geheimdienst nahestehendes Blatt, Intelligence Online, einen Artikel mit dem Titel «Die Strategie hinter der Paris-Berlin-Moskau-Achse». Bezugnehmend auf den Uno-Sicherheitsrats-Block Frankreich-Deutschland-Russland, der versuchte, die amerikanischen und britischen Kriegsbewegungen gegen den Irak zu stoppen, verweist der Pariser Bericht auf die jüngsten Anstrengungen der Europäer und anderer Mächte, eine Gegenmacht gegen die Vereinigen Staaten zu schaffen. Und unter Bezugnahme auf das neue Bündnis von Frankreich und Deutschland - und noch neuer - mit Putin, schreiben sie «eine neue Logik und sogar Dynamik scheint aufgekommen zu sein. Durch eine Allianz zwischen Paris, Moskau und Berlin, die vom Atlantik nach Asien geht, könnte sich ein Ende der US-Macht abzeichnen. Zum ersten Mal seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Idee eines Kernlandes der Welt - der Alptraum britischer Strategen - wieder in die internationalen Beziehungen eingeschlichen.»3
Eurasische Bedrohung
Mackinder, der Vater der britischen Geopolitiker, schrieb in seinem bedeutenden Text, «The Geograhical Pivot of History» («Die geographische Drehscheibe der Geschichte»), dass die Kontrolle des eurasischen Kernlandes, von der französischen Normandie bis Wladiwostock, die einzig mögliche Bedrohung sei, die der Seemacht Grossbritanniens etwas entgegen setzen könnte. Bis 1914 basierte die britische Diplomatie darauf, eine solche eurasische Bedrohung abzuwenden, damals im Hinblick auf die Expansionspolitik des deutschen Kaisers nach Osten mit dem Bau der Bagdad-Bahn und dem Aufbau der deutschen Tirpitz-Marine. Der erste Weltkrieg war das Resultat. Bezüglich der laufenden Bemühungen der Briten und später der Amerikaner, einen eurasischen Zusammenschluss als Rivalen zu verhindern, unterstreicht der Pariser Geheimdienst-Bericht folgendes: «Diese strategische Annäherung (d.h. eine eurasische Kernland-Einheit zu bilden) liegt allen Kämpfen zwischen den kontinentalen Mächten und den Seemächten (GB, USA und Japan) zugrunde. Es ist die Macht Washingtons über die Meere, die - sogar heute - die unerschütterliche Unterstützung Londons für die USA und die Allianz zwischen Tony Blair und Bush diktiert.»
Eine andere gut informierte französische Zeitschrift, Reseau Voltaire.net, schrieb am Vorabend des Irak-Krieges, dass der Dollar «die Achillesverse der USA» sei4. Dies ist - milde gesagt - eine Untertreibung.
Der Irak-Krieg war schon lange geplant
Die aufkommende Bedrohung durch eine französische geführte Euro-Politik mit dem Irak und anderen Ländern brachte führende Kreise des US-politischen Establishments zum Nachdenken über die Bedrohung des Petro-Dollar-Systems, lange bevor Bush Präsident war. Während Perle, Wolfowitz und andere führende Neokonservative eine massgebliche Rolle bei der Entwicklung einer Strategie zur Stützung des lahmenden Systems spielten, zeichnete sich ein neuer Konsens ab, welcher die Hauptelemente des traditionellen Establishments des kalten Krieges um Figuren wie Rumsfeld und Cheney einbezog.
Im September 2000, während der Kampagne, veröffentlichte ein kleiner Washingtoner Thinktank das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert» (Projekt for the New American Century», PNAC) eine grosse Politik-Studie: «Rebuilding America`s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century (Neuaufbau der amerikanischen Verteidigung: Strategien, Kräfte und Quellen für ein neues Jahrhundert).» Der Bericht ist sehr nützlich, um die gegenwärtige Verwaltungspolitik in vielen Bereichen besser zu verstehen. Über den Irak heisst es dort: «Die Vereinigten Staaten sind seit Jahrzehnten bemüht, eine beständigere Rolle in der Sicherheit der Golfregion zu spielen. Während der ungelöste Konflikt mit dem Irak den direkten Grund liefert, übersteigt die Notwendigkeit einer substantiellen amerikanischen Armeepräsenz im Golf das Ziel einer Überwindung des Regimes von Saddam Hussein.»
Das «Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert»
Dieses PNAC-Papier ist die wesentliche Basis für das Weissbuch des Präsidenten vom September 2002, «The National Security Strategy of the United States of America». Das PNAC-Papier unterstützt einen «Entwurf für den Erhalt der globalen US-Vormachtstellung, die das Aufkommen eines grossen Machtrivalen ausschliesst und die internationale Sicherheitsordnung auf der Grundlage amerikanischer Prinzipien und Interessen gestaltet. Die amerikanische Grossstrategie muss so weit wie möglich in die Zukunft hinein geplant werden.» Weiter müssen die USA «fortgeschrittene Industrienationen davon abbringen, unsere Führerschaft in Frage zu stellen oder nur auf eine grössere regionale oder globale Rolle zu spekulieren.»
Die PNAC-Mitgliedschaft(sliste) von 2000 liest sich wie ein Dienstplan der heutigen Bush-Administration. Sie enthält Cheney, seine Frau Lynne Cheney, den neokonservativen persönliche Berater Cheney`s, Lewis Libby; Donald Rumsfeld; Rumsfelds Deputy Secretary Paul Wolfowitz. Sie enthält ebenfalls den Chef des National Security Council SC für den Nahen Osten, Elliott Abrams; John Bolton vom State Department, Richard Perle, und William Kristol. Mit von der Partie waren auch der frühere Vizepräsident von Lockheed-Martin, Bruce Jackson, und der ex-CIA-Kopf James Woolsey, zusammen mit Norman Podhoretz, einem weiteren Gründungsmitglied der Neo-Cons. Woolsey und Podhoretz sprechen offen davon, sich im «Vierten Weltkrieg» zu befinden.
Eine menschliche Finanzwirtschaft entwickeln
Es wird vielen immer klarer, dass es bei dem Krieg im Irak um den Erhalt eines bankrotten amerikanischen Jahrhundertmodells zur Weltbeherrschung geht. Es ist ebenso klar, dass der Irak nicht das Ende sein wird. Was jedoch nicht klar ist und was in der ganzen Welt offen diskutiert werden muss, ist, wie die gescheiterte Petro-Dollar-Ordnung durch ein neues System für globalen wirtschaftlichen Wohlstand und Sicherheit ersetzt werden kann.
Jetzt, da im Irak ein internes Chaos droht, ist es wichtig, die gesamte Nachkriegs-Währungsordnung neu zu überdenken. Die gegenwärtige französisch-deutsch-russische Allianz zur Bildung eines Gegengewichts gegenüber den Vereinigten Staaten benötigt nicht allein eine französisch-geführte Version des Petro-Dollar-Systems, so etwas wie ein Petro-Euro-System, das das bankrotte amerikanische Jahrhundert nur mit einem französischen Akzent weiterführt und in dem der Dollar lediglich durch den Euro ersetzt würde. Dies wäre nicht nur eine Verschwendung menschlicher Energien und würde zu steigender Arbeitslosigkeit in den Industrie- und Entwicklungsländern führen, sondern es würde auch den Lebensstandard weltweit weiter herabsetzen. Was einige Ökonomen während der Asienkrise 1998 begannen, muss weitergeführt werden: Ein grundsätzliches Nachdenken über die Basis für ein neues monetäres System, welches die menschliche Entwicklung unterstützt und nicht zerstört.
1 Engdahl, F. William, Mit der Ölwaffe zur Weltmacht, Wiesbaden 2002. Im Kapitel 9-10 wird die Schaffung und Auswirkung des Recycling-Petrodollars und das geheime Saltsjoebaden Treffen 1973 für die Vorbereitung der Ölkrise ausgeführt.
2 Pressemitteilung des Radio Liberty/RFE, Charles Recknagel «Irak: Bagdad bewegt sich auf den Euro zu», 1. November 2000. Die Nachricht wurde während 48 Stunden durch CNN und andere Medien aufgenommen und verschwand prompt aus den Schlagzeilen. Seit dem Artikel von William Clark «Die wirklichen, aber unausgesprochenen Gründe für den bevorstehenden Irak-Krieg» erschien im Internet am 2. Februar 2003 - eine lebendige Online-Diskussion über den Öl-Euro-Faktor fand statt, aber abgesehen von gelegentlichen Erwähnungen im Londoner «Guardian» wurde in den Hauptmedien wenig über die strategischen Hintergrundfaktoren für die Washingtoner Entscheidung, gegen Irak vorzugehen, gesagt.
3 Der Geheimdienstonline-Herausgeber, Guillaume Dasquie, ist ein französischer Spezialist für strategische Geheimdienste und hat für die französischen Geheimdienste bezüglich des bin-Laden-Falls und andere Untersuchungen gearbeitet. Seine Erwähnungen zur französischen Geopolitik reflektieren klar das französische Denken auf hohem Niveau.
4 erschien am 4. April 2003. Er erörtert im Detail eine französische Analyse über die Verletzlichkeit des Dollarsystems am Vorabend des Irak-Krieges
--------------------------------------------------------------------------------
Das System von Bretton Woods
zf. Um das im September 1931 zusammengebrochene internationale Währungssystem neu zu ordnen, wurden an der Internationalen Währungs- und Finanzkonferenz, die vom 1. bis 22. Juli 1944 in Bretton Woods (New Hampshire, USA) stattfand, die Verträge über die Errichtung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank) geschlossen und ein neues Weltwährungssystem begründet.
Das Bretton-Woods-System war eine Reaktion auf die durch Abwertungswettläufe und Protektionismus gekennzeichnete Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ziel war ein Welthandel ohne Handelsschranken und mit nur sehr geringen Schwankungen bei den Wechselkursen.
Der US-Dollar sollte zukünftig die Weltleitwährung sein und an einen Gold-Standard gebunden werden. Konkret wurde beschlossen, einen Preis von 35 US-Dollar pro Unze Gold festzulegen. Die USA verpflichteten sich, US-Dollar weltweit zu diesem Goldpreis zu verkaufen oder anzukaufen. Die Wechselkurse wurden gegenüber dem US-Dollar festgelegt, und die anderen Notenbanken verpflichteten sich, die Währungen ihrer Länder entsprechend dem festgelegten Wechselkurs zu stabilisieren. Der IWF sollte die Aufgabe haben, bei vorübergehenden Zahlungsbilanzproblemen von Staaten Kredite zu gewähren. Die Weltbank sollte die Kreditgewährung für Entwicklungsländer erleichtern.
--------------------------------------------------------------------------------
Der «Washington Consensus»
zf. Der Begriff «Washington Consensus» wurde von dem Wirtschaftswissenschafter John Williamson im Jahr 1989 geprägt. Unter diesem Begriff fasste er zusammen, was er als einen aktuellen Konsens zwischen dem Kongress der USA, dem IWF, der Weltbank und wichtigen Think tanks empfand. Zehn verschiedene Politikempfehlungen bildeten diesen Konsens zur «Reform» angeschlagener Volkswirtschaften:
1. Disziplin der öffentlichen Haushalte,
2. Umleitung öffentlicher Ausgaben in Felder, die sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch eine gleichmässigere Einkommensverteilung versprechen,
3. Steuerreformen mit niedrigeren Höchststeuersätzen und einer breiteren Steuerbasis,
4. Liberalisierung des Finanzmarktes,
5. Schaffung eines stabilen, wettbewerbsfähigen Wechselkurses,
6. Handelsliberalisierung,
7. Beseitigung von Marktzutrittsschranken und Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen (Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Firmen),
8. Privatisierung,
9. Deregulierung,
10. Gesicherte Eigentumsrechte.
http://www.ftd.de/pw/in/1057486306181.html?nv=cd-divnews
ftd.de, Sa, 12.7.2003, 12:39, aktualisiert: Sa, 12.7.2003, 18:14
Bush bekräftigt Vertrauen in CIA-Chef
US-Präsident George W. Bush hat nach Angaben seines Sprechers weiter Vertrauen zum Chef des Geheimdienstes CIA, George Tenet. Der britische Außenminister Jack Straw ließ in einem Brief an das Unterhaus aber keinen Zweifel an der Echtheit der Geheimdienstinformationen.
Präsidentensprecher Ari Fleischer sagte, Bush, der am Samstag im Rahmen seiner Afrika-Reise die nigerianische Hauptstadt Abuja besuchte, betrachte die Angelegenheit nun als abgeschlossen.
Tenet hatte am Vorabend die Verantwortung für eine Passage in Bushs Rede zur Lage der Nation übernommen, in der dem Irak die Kaufabsicht von Uran in Afrika unterstellt wurde. Inzwischen hat die Regierung eingeräumt, dass dieser Vorwurf auf gefälschten Dokumenten basierte. Die Rede des Präsidenten zur Lage der Nation ist in den USA eine feste Institution und wird jährlich im Januar vor beiden Häusern des Kongresses gehalten.
"Der Präsident hat Vertrauen in den Direktor Tenet, Präsident Bush hat Vertrauen in die CIA", sagte Fleischer. Tenet war noch von Bushs Vorgänger, Bill Clinton, ernannt worden.
Tenet übernimmt Verantwortung für fehlerhafte Passage
Tenet hatte am Freitag gesagt, "der Präsident hatte jeden Grund anzunehmen, dass der ihm vorgelegte Text einwandfrei ist. Diese 16 Wörter hätten niemals in dem Text, der für den Präsidenten geschrieben wurde, stehen dürfen." Bush hatte in seiner Rede am 16. Januar gesagt: "Die britische Regierung hat erfahren, dass (der frühere irakische Präsident) Saddam Hussein jüngst bedeutende Mengen Uran in Afrika nachgefragt hat."
Die britische Regierung hat ihre Entscheidung verteidigt, Saddam Hussein vor dem Irak-Krieg des versuchten Uran-Kaufs zu beschuldigen. Außenminister Jack Straw unterstrich in einem am Samstag veröffentlichten Schreiben an einen Unterhaus-Ausschuss, dass seine Regierung noch zusätzliche Informationen über den angeblich angestrebten Uran-Kauf gehabt habe. Diese hätten sich auf Erkenntnisse des britischen Geheimdienstes gestützt. Darum sei es damals legitim gewesen, diesen Vorwurf zu erheben.
"Britische Regierungsbeamte waren zuversichtlich, dass die Erklärung in dem Dossier auf zuverlässigen Informationen beruhte", schrieb Straw. Er bestätigte aber auch, dass der CIA die britische Regierung gewarnt hatte, die Uran-Passage in das Dossier aufzunehmen.
Auch Howard glaubt den britischen Informationen
Australiens Premier Howard sagte am Samstag, er habe sich auf die Einschätzung des britischen Geheimdienst-Ausschusses verlassen. Dieser stehe zu seiner Aussage über versuchte Uran-Käufe Iraks in Afrika.
Howard hatte in seiner Rede vor dem Parlament am 4. Februar auf mutmaßliche irakische Kontakte nach Afrika verwiesen. "Die relevanten britischen Geheimdienste stehen zu ihrer Einschätzung", sagte er am Samstag. "Sie stützen sich auf Informationen, die der australische Geheimdienst nicht gesehen hat." Dabei gehe es nicht um Dokumente der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die sich später als falsch erwiesen hätten.
Der australische Regierungschef war in dieser Woche unter Druck geraten zu erklären, wann er wusste, dass die amerikanischen Angaben falsch waren. Zwei australische Geheimdienste und Mitarbeiter des Außenministeriums räumten ein, sie hätten von den falschen Angaben gewusst, Howard aber nicht informiert.
Schlechte Umfragewerte
Immer mehr Amerikaner sind einer in der Nacht zum Samstag veröffentlichten Umfrage zufolge auch mit den Leistungen ihres Präsidenten George W. Bush nicht mehr so glücklich wie noch im April. Wie die "Washington Post" und der Fernsehsender ABC in einer Umfrage unter 1006 US-Bürgern herausfanden, fiel die Zustimmung zu Bushs Irak-Politik um 17 Prozentpunkte gegenüber Ende April auf nur noch 58 Prozent. Mit Bushs Gesamtleistungen als Präsident sind nur noch 59 Prozent zufrieden, so wenig wie seit den Anschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr. Eine Mehrheit von 52 Prozent bezweifelt zudem, dass der Krieg die Opfer auf Seiten des US-Militärs wert ist.
Zwar fanden der Umfrage zufolge immer noch 57 Prozent, dass der Krieg notwendig war, doch waren das deutlich weniger als noch Ende April, als 70 Prozent den Einmarsch ihrer Soldaten in den Irak als richtig bezeichnet hatten. 50 Prozent der Befragten vermuten zudem, dass die Regierung bewusst ihre Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügte, aufbauschte.
© 2003 Financial Times Deutschland , © Illustration: AP
-----
Oooh Georgie Boy


Da haste endlich ein Bauernopfer und was machste daraus?
Genau das, was man von dir erwartet.
Labern
ftd.de, Sa, 12.7.2003, 12:39, aktualisiert: Sa, 12.7.2003, 18:14
Bush bekräftigt Vertrauen in CIA-Chef
US-Präsident George W. Bush hat nach Angaben seines Sprechers weiter Vertrauen zum Chef des Geheimdienstes CIA, George Tenet. Der britische Außenminister Jack Straw ließ in einem Brief an das Unterhaus aber keinen Zweifel an der Echtheit der Geheimdienstinformationen.
Präsidentensprecher Ari Fleischer sagte, Bush, der am Samstag im Rahmen seiner Afrika-Reise die nigerianische Hauptstadt Abuja besuchte, betrachte die Angelegenheit nun als abgeschlossen.
Tenet hatte am Vorabend die Verantwortung für eine Passage in Bushs Rede zur Lage der Nation übernommen, in der dem Irak die Kaufabsicht von Uran in Afrika unterstellt wurde. Inzwischen hat die Regierung eingeräumt, dass dieser Vorwurf auf gefälschten Dokumenten basierte. Die Rede des Präsidenten zur Lage der Nation ist in den USA eine feste Institution und wird jährlich im Januar vor beiden Häusern des Kongresses gehalten.
"Der Präsident hat Vertrauen in den Direktor Tenet, Präsident Bush hat Vertrauen in die CIA", sagte Fleischer. Tenet war noch von Bushs Vorgänger, Bill Clinton, ernannt worden.
Tenet übernimmt Verantwortung für fehlerhafte Passage
Tenet hatte am Freitag gesagt, "der Präsident hatte jeden Grund anzunehmen, dass der ihm vorgelegte Text einwandfrei ist. Diese 16 Wörter hätten niemals in dem Text, der für den Präsidenten geschrieben wurde, stehen dürfen." Bush hatte in seiner Rede am 16. Januar gesagt: "Die britische Regierung hat erfahren, dass (der frühere irakische Präsident) Saddam Hussein jüngst bedeutende Mengen Uran in Afrika nachgefragt hat."
Die britische Regierung hat ihre Entscheidung verteidigt, Saddam Hussein vor dem Irak-Krieg des versuchten Uran-Kaufs zu beschuldigen. Außenminister Jack Straw unterstrich in einem am Samstag veröffentlichten Schreiben an einen Unterhaus-Ausschuss, dass seine Regierung noch zusätzliche Informationen über den angeblich angestrebten Uran-Kauf gehabt habe. Diese hätten sich auf Erkenntnisse des britischen Geheimdienstes gestützt. Darum sei es damals legitim gewesen, diesen Vorwurf zu erheben.
"Britische Regierungsbeamte waren zuversichtlich, dass die Erklärung in dem Dossier auf zuverlässigen Informationen beruhte", schrieb Straw. Er bestätigte aber auch, dass der CIA die britische Regierung gewarnt hatte, die Uran-Passage in das Dossier aufzunehmen.
Auch Howard glaubt den britischen Informationen
Australiens Premier Howard sagte am Samstag, er habe sich auf die Einschätzung des britischen Geheimdienst-Ausschusses verlassen. Dieser stehe zu seiner Aussage über versuchte Uran-Käufe Iraks in Afrika.
Howard hatte in seiner Rede vor dem Parlament am 4. Februar auf mutmaßliche irakische Kontakte nach Afrika verwiesen. "Die relevanten britischen Geheimdienste stehen zu ihrer Einschätzung", sagte er am Samstag. "Sie stützen sich auf Informationen, die der australische Geheimdienst nicht gesehen hat." Dabei gehe es nicht um Dokumente der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die sich später als falsch erwiesen hätten.
Der australische Regierungschef war in dieser Woche unter Druck geraten zu erklären, wann er wusste, dass die amerikanischen Angaben falsch waren. Zwei australische Geheimdienste und Mitarbeiter des Außenministeriums räumten ein, sie hätten von den falschen Angaben gewusst, Howard aber nicht informiert.
Schlechte Umfragewerte
Immer mehr Amerikaner sind einer in der Nacht zum Samstag veröffentlichten Umfrage zufolge auch mit den Leistungen ihres Präsidenten George W. Bush nicht mehr so glücklich wie noch im April. Wie die "Washington Post" und der Fernsehsender ABC in einer Umfrage unter 1006 US-Bürgern herausfanden, fiel die Zustimmung zu Bushs Irak-Politik um 17 Prozentpunkte gegenüber Ende April auf nur noch 58 Prozent. Mit Bushs Gesamtleistungen als Präsident sind nur noch 59 Prozent zufrieden, so wenig wie seit den Anschlägen vom 11. September 2001 nicht mehr. Eine Mehrheit von 52 Prozent bezweifelt zudem, dass der Krieg die Opfer auf Seiten des US-Militärs wert ist.
Zwar fanden der Umfrage zufolge immer noch 57 Prozent, dass der Krieg notwendig war, doch waren das deutlich weniger als noch Ende April, als 70 Prozent den Einmarsch ihrer Soldaten in den Irak als richtig bezeichnet hatten. 50 Prozent der Befragten vermuten zudem, dass die Regierung bewusst ihre Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügte, aufbauschte.
© 2003 Financial Times Deutschland , © Illustration: AP
-----
Oooh Georgie Boy



Da haste endlich ein Bauernopfer und was machste daraus?
Genau das, was man von dir erwartet.
Labern

http://news.orf.at/index.html?url=http%3A//news.orf.at/ticke…
Irak-Fehlinformation: CIA intervenierte bei früherer Bush-Rede
Der US-Geheimdienst hat einem Zeitungsbericht zufolge im Oktober vergangenen Jahres verhindert, dass US-Präsident George W. Bush in einer Rede dem Irak Uran-Kaufabsichten in Niger unterstellte.
Als Grund habe der CIA Zweifel an der Richtigkeit von entsprechenden Informationen angeführt, berichtete die "Washington Post" heute unter Berufung auf ranghohe Regierungskreise.
Tenet übernimmt Verantwortung
CIA-Chef George Tenet habe persönlich interveniert und dabei auch argumentiert, die Informationen sollten nicht benutzt werden, da sie nur von einer einzigen Quelle stammten. Bush hatte einen ähnlichen Vorwurf in seiner Rede zur Lage der Nation im Jänner dieses Jahres aber geäußert.
Tenet, der noch von Bushs Vorgänger Bill Clinton ernannt worden war, hatte am Freitag die Verantwortung für die umstrittene 16 Wörter umfassende Passage in dieser Rede übernommen. Mehr dazu in "Schwarzer Peter" für die CIA ( Link folgt einen Beitrag später! )
Warum Tenet im Herbst 2002 bei einer weniger bedeutenden Rede Bushs intervenierte und drei Monate später bei der wesentlich wichtigeren Rede zur Lage der Nation nicht, sei nicht bekannt, berichtete die "Washington Post" weiter.
Cheney setzte Fokus auf Atomwaffen
Die Zeitung berichtet auf ihrer Internet-Seite weiter unter Berufung auf die Regierungskreise, besonders das Büro von Vizepräsident Richard Cheney habe darauf bestanden, dass Saddams Streben nach Atomwaffen eine prominente Rolle bei der Mobilisierung der Öffentlichkeit für den Irak-Krieg spiele.
Cheney habe die Möglichkeit, dass Saddam in den Besitz von Atomwaffen komme, zum zentralen Thema seiner Reden im August 2002 gemacht, als die US-Öffentlichkeit auf den Krieg vorbereitet wurde.
Redenschreiber kann sich nicht erinnern
Die Zeitung berichtete weiter, Bushs Haupt-Redenschreiber Micahel J. Gerson könne sich nicht mehr erinnern, wer jene 16 Worte in die Rede zur Lage der Nation hinein geschrieben habe.
Irak-Fehlinformation: CIA intervenierte bei früherer Bush-Rede
Der US-Geheimdienst hat einem Zeitungsbericht zufolge im Oktober vergangenen Jahres verhindert, dass US-Präsident George W. Bush in einer Rede dem Irak Uran-Kaufabsichten in Niger unterstellte.
Als Grund habe der CIA Zweifel an der Richtigkeit von entsprechenden Informationen angeführt, berichtete die "Washington Post" heute unter Berufung auf ranghohe Regierungskreise.
Tenet übernimmt Verantwortung
CIA-Chef George Tenet habe persönlich interveniert und dabei auch argumentiert, die Informationen sollten nicht benutzt werden, da sie nur von einer einzigen Quelle stammten. Bush hatte einen ähnlichen Vorwurf in seiner Rede zur Lage der Nation im Jänner dieses Jahres aber geäußert.
Tenet, der noch von Bushs Vorgänger Bill Clinton ernannt worden war, hatte am Freitag die Verantwortung für die umstrittene 16 Wörter umfassende Passage in dieser Rede übernommen. Mehr dazu in "Schwarzer Peter" für die CIA ( Link folgt einen Beitrag später! )
Warum Tenet im Herbst 2002 bei einer weniger bedeutenden Rede Bushs intervenierte und drei Monate später bei der wesentlich wichtigeren Rede zur Lage der Nation nicht, sei nicht bekannt, berichtete die "Washington Post" weiter.
Cheney setzte Fokus auf Atomwaffen
Die Zeitung berichtet auf ihrer Internet-Seite weiter unter Berufung auf die Regierungskreise, besonders das Büro von Vizepräsident Richard Cheney habe darauf bestanden, dass Saddams Streben nach Atomwaffen eine prominente Rolle bei der Mobilisierung der Öffentlichkeit für den Irak-Krieg spiele.
Cheney habe die Möglichkeit, dass Saddam in den Besitz von Atomwaffen komme, zum zentralen Thema seiner Reden im August 2002 gemacht, als die US-Öffentlichkeit auf den Krieg vorbereitet wurde.
Redenschreiber kann sich nicht erinnern
Die Zeitung berichtete weiter, Bushs Haupt-Redenschreiber Micahel J. Gerson könne sich nicht mehr erinnern, wer jene 16 Worte in die Rede zur Lage der Nation hinein geschrieben habe.
http://orf.at/030712-64754/index.html
"Schwarzer Peter" für die CIA
Die CIA entlastet US-Präsident Bush. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes Tenet übernimmt nun die volle Verantwortung für die falschen Irak-Informationen in Bushs "Rede an die Nation" vom Jänner. Der angeblich vom Irak angestrebten Kauf von waffenfähigem Uran war eine der Rechtfertigungen für den Militärschlag gegen den Irak. Nur Stunden vor Tenets Erklärung hatte Bush der CIA den "Schwarzen Peter" zugeschoben. Das Pikante daran: Die CIA hatte schon vor Bushs Rede Zweifel an der Echtheit der Information geäußert.
Affäre nun beendet?
Die Öffentlichkeit in den USA und der Kongress fragen sich immer lauter, ob sie US-Präsident George Bush vor dem Irak-Krieg wissentlich belogen hat.
Nicht nur sind keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden worden, es hat sich auch als falsch herausgestellt, dass der Irak Uran in Afrika kaufen wollte.
Für diese Formulierung in der Rede "Zur Lage der Nation" hat jetzt der Direktor des Amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, George Tenet, die Verantwortung übernommen.
Tenet: Habe Text nie gelesen
Präsident Bush habe sich darauf verlassen müssen, dass alle Details in seiner Rede stimmen, und diese Information, die die CIA geliefert hat, sei einfach nicht ausreichend abgesichert gewesen, sagte Tenet. Er selbst habe den Text nie gelesen.
Entlastung für Bush
Der CIA-Direktor hat getan, was der Präsident von ihm in unmissverständlicher Weise verlangt hat: Er hat die Verantwortung für einen Fehler übernommen, der Bush politisch immer mehr zu schaffen macht.
Rechfertigung für Militärschlag
Anfang Jänner hatte der US-Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt, dass Saddam Hussein sich in Afrika Uran besorgen wollte.
Es war einer von mehreren Gründen, mit denen Bush die Vorbereitung des Krieges rechtfertigte.
Der Vorwurf war falsch, die Akte über die irakische Geschäftsanbahnung in Niger in Sachen Uran gefälscht.
Afrika-Reise überschattet
Seit Tagen muss sich der US-Präsident deshalb unangenehme Fragen gefallen lassen. Er reist durch Afrika, will über Aids reden und darüber, was er alles an Hilfe vorhat. Doch die mitreisenden amerikanischen Reporter wollen nur wissen, was er seinerzeit über den Uran-Vorwurf gewusst hat.
"Schwarzer Peter" an CIA
Das Pikante: Vertreter des CIA und des Außenministeriums haben schon vor der Rede des Präsidenten Zweifel an der Echtheit gehabt und diese Zweifel im Weißen Haus auch geäußert.
Um nicht als manipulative Kriegstreiber dazustehen, haben Bush und seine Sicherheitsberaterin es am Freitag nahezu gleichlautend gesagt: Der Text der Rede zur Lage der Nation ist vom Geheimdienst überprüft und freigegeben worden, und zwar zur Gänze.
"CIA hätte Passage streichen sollen"
Am Abend folgt die Bestätigung des Angesprochenen. CIA-Direktor Tenet schreibt, dass die Passage nicht in der Rede des Präsidenten hätte enthalten sein sollen.
Der CIA hätte für die Streichung sorgen sollen, und er, Tenet, sei verantwortlich für die Arbeit des Geheimdienstes.
Fortsetzung folgt
Ausgestanden ist die Affäre damit allerdings nicht. Denn es gibt Hinweise darauf, dass Vertreter des Weißen Hauses den Uran-Vorwurf in die Rede hineinreklamiert haben – trotz der Zweifel des CIA.
Der Geheimdienst hat nur nicht auf seiner Position bestanden. Und letztlich übernimmt Tenet auch nur dafür die Verantwortung.
Hartmut Fiedler, ORF-Washington
-------
Bush wird trotzdem nicht wiedergewählt.
"Schwarzer Peter" für die CIA
Die CIA entlastet US-Präsident Bush. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes Tenet übernimmt nun die volle Verantwortung für die falschen Irak-Informationen in Bushs "Rede an die Nation" vom Jänner. Der angeblich vom Irak angestrebten Kauf von waffenfähigem Uran war eine der Rechtfertigungen für den Militärschlag gegen den Irak. Nur Stunden vor Tenets Erklärung hatte Bush der CIA den "Schwarzen Peter" zugeschoben. Das Pikante daran: Die CIA hatte schon vor Bushs Rede Zweifel an der Echtheit der Information geäußert.
Affäre nun beendet?
Die Öffentlichkeit in den USA und der Kongress fragen sich immer lauter, ob sie US-Präsident George Bush vor dem Irak-Krieg wissentlich belogen hat.
Nicht nur sind keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden worden, es hat sich auch als falsch herausgestellt, dass der Irak Uran in Afrika kaufen wollte.
Für diese Formulierung in der Rede "Zur Lage der Nation" hat jetzt der Direktor des Amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, George Tenet, die Verantwortung übernommen.
Tenet: Habe Text nie gelesen
Präsident Bush habe sich darauf verlassen müssen, dass alle Details in seiner Rede stimmen, und diese Information, die die CIA geliefert hat, sei einfach nicht ausreichend abgesichert gewesen, sagte Tenet. Er selbst habe den Text nie gelesen.
Entlastung für Bush
Der CIA-Direktor hat getan, was der Präsident von ihm in unmissverständlicher Weise verlangt hat: Er hat die Verantwortung für einen Fehler übernommen, der Bush politisch immer mehr zu schaffen macht.
Rechfertigung für Militärschlag
Anfang Jänner hatte der US-Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt, dass Saddam Hussein sich in Afrika Uran besorgen wollte.
Es war einer von mehreren Gründen, mit denen Bush die Vorbereitung des Krieges rechtfertigte.
Der Vorwurf war falsch, die Akte über die irakische Geschäftsanbahnung in Niger in Sachen Uran gefälscht.
Afrika-Reise überschattet
Seit Tagen muss sich der US-Präsident deshalb unangenehme Fragen gefallen lassen. Er reist durch Afrika, will über Aids reden und darüber, was er alles an Hilfe vorhat. Doch die mitreisenden amerikanischen Reporter wollen nur wissen, was er seinerzeit über den Uran-Vorwurf gewusst hat.
"Schwarzer Peter" an CIA
Das Pikante: Vertreter des CIA und des Außenministeriums haben schon vor der Rede des Präsidenten Zweifel an der Echtheit gehabt und diese Zweifel im Weißen Haus auch geäußert.
Um nicht als manipulative Kriegstreiber dazustehen, haben Bush und seine Sicherheitsberaterin es am Freitag nahezu gleichlautend gesagt: Der Text der Rede zur Lage der Nation ist vom Geheimdienst überprüft und freigegeben worden, und zwar zur Gänze.

"CIA hätte Passage streichen sollen"
Am Abend folgt die Bestätigung des Angesprochenen. CIA-Direktor Tenet schreibt, dass die Passage nicht in der Rede des Präsidenten hätte enthalten sein sollen.
Der CIA hätte für die Streichung sorgen sollen, und er, Tenet, sei verantwortlich für die Arbeit des Geheimdienstes.
Fortsetzung folgt
Ausgestanden ist die Affäre damit allerdings nicht. Denn es gibt Hinweise darauf, dass Vertreter des Weißen Hauses den Uran-Vorwurf in die Rede hineinreklamiert haben – trotz der Zweifel des CIA.
Der Geheimdienst hat nur nicht auf seiner Position bestanden. Und letztlich übernimmt Tenet auch nur dafür die Verantwortung.
Hartmut Fiedler, ORF-Washington
-------
Bush wird trotzdem nicht wiedergewählt.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,256986,00.html
RÜCKTRITTSFORDERUNGEN
"Blair ist nicht mehr haltbar"
Tony Blair gerät immer stärker unter Druck. Der ehemalige Uno-Chefwaffeninspektor Hans Blix wirft dem britischen Premier vor, Saddams Waffenarsenal "überinterpretiert" zu haben. Und selbst aus den eigenen Reihen kommen Forderungen nach einem Rücktritt Blairs.
London - Die ehemalige Entwicklungsministerin Clare Short, die Blairs Irak-Politik schon während ihrer Amtszeit kritisiert hatte, sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview, Blair solle gehen, bevor alles noch "schlimmer" für ihn werde. Short sagte weiter, sie sei sicher, "dass er das Land hereingelegt" habe. Der Labour-Abgeordnete Brian Donohoe sagte, wenn im Irak nicht bald Massenvernichtungswaffen gefunden würden, sei Blairs Position unhaltbar. Scharf in der Kritik ist Blair bei der konservativen und liberaldemokratischen Opposition. Deren Vertreter wiederholten ihre Forderung, die Angaben Blairs vor dem Krieg müssten richterlich untersucht werden. Der konservative britische Oppositionsführer Iain Duncan Smith forderte Blair auf, sich für seine "enttäuschende" Informationspolitik vor dem Irak-Krieg zu entschuldigen. Alles in allem sei der Krieg gegen den Irak jedoch gerechtfertigt gewesen, sagte Smith der Prager Zeitung "Lidove noviny". Es sei aber "beunruhigend", dass nicht bekannt sei, welche Geheimdienst-Informationen die Regierung veröffentlicht habe und welche nicht.
Neben den innenpolitischen Spannungen wachsen auch die außenpolitischen. Ausgerechnet zwischen den beiden engsten Partnern im Irakkrieg, der Bush-Regierung und der Blair-Regierung, ist es mehreren britischen Zeitungsberichten vom Sonntag zufolge zu Unstimmigkeiten gekommen. Demnach wirft der britische Geheimdienst der amerikanischen CIA vor, ihn als Sündenbock für falsche Informationen über versuchte Uran-Käufe Saddams hinstellen zu wollen.
Der frühere UN-Chefwaffeninspekteur Hans Blix warf Blair vor, die vom Irak ausgehende Gefahr übertrieben zu haben. Blair habe die vorliegenden Informationen über Saddam Husseins Waffenarsenal "überinterpretiert", kritisierte Blix. In einem Interview des "Independent on Sunday" äußerte er sich besonders kritisch über die in einem "Beweis-Dossier" der Regierung Blair aufgestellte Behauptung, Saddam könne binnen 45 Minuten mit seinen Massenvernichtungswaffen zuschlagen.
"Ich glaube, das war ein fundamentaler Fehler", sagte Blix. "Ich weiß nicht, wie sie diese Zahl von 45 Minuten berechnet haben. Das scheint mir ziemlich weit hergeholt." Die Zeitangabe war zuvor schon von einem Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses bemängelt worden.
------
Und Bush
RÜCKTRITTSFORDERUNGEN
"Blair ist nicht mehr haltbar"
Tony Blair gerät immer stärker unter Druck. Der ehemalige Uno-Chefwaffeninspektor Hans Blix wirft dem britischen Premier vor, Saddams Waffenarsenal "überinterpretiert" zu haben. Und selbst aus den eigenen Reihen kommen Forderungen nach einem Rücktritt Blairs.
London - Die ehemalige Entwicklungsministerin Clare Short, die Blairs Irak-Politik schon während ihrer Amtszeit kritisiert hatte, sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview, Blair solle gehen, bevor alles noch "schlimmer" für ihn werde. Short sagte weiter, sie sei sicher, "dass er das Land hereingelegt" habe. Der Labour-Abgeordnete Brian Donohoe sagte, wenn im Irak nicht bald Massenvernichtungswaffen gefunden würden, sei Blairs Position unhaltbar. Scharf in der Kritik ist Blair bei der konservativen und liberaldemokratischen Opposition. Deren Vertreter wiederholten ihre Forderung, die Angaben Blairs vor dem Krieg müssten richterlich untersucht werden. Der konservative britische Oppositionsführer Iain Duncan Smith forderte Blair auf, sich für seine "enttäuschende" Informationspolitik vor dem Irak-Krieg zu entschuldigen. Alles in allem sei der Krieg gegen den Irak jedoch gerechtfertigt gewesen, sagte Smith der Prager Zeitung "Lidove noviny". Es sei aber "beunruhigend", dass nicht bekannt sei, welche Geheimdienst-Informationen die Regierung veröffentlicht habe und welche nicht.
Neben den innenpolitischen Spannungen wachsen auch die außenpolitischen. Ausgerechnet zwischen den beiden engsten Partnern im Irakkrieg, der Bush-Regierung und der Blair-Regierung, ist es mehreren britischen Zeitungsberichten vom Sonntag zufolge zu Unstimmigkeiten gekommen. Demnach wirft der britische Geheimdienst der amerikanischen CIA vor, ihn als Sündenbock für falsche Informationen über versuchte Uran-Käufe Saddams hinstellen zu wollen.
Der frühere UN-Chefwaffeninspekteur Hans Blix warf Blair vor, die vom Irak ausgehende Gefahr übertrieben zu haben. Blair habe die vorliegenden Informationen über Saddam Husseins Waffenarsenal "überinterpretiert", kritisierte Blix. In einem Interview des "Independent on Sunday" äußerte er sich besonders kritisch über die in einem "Beweis-Dossier" der Regierung Blair aufgestellte Behauptung, Saddam könne binnen 45 Minuten mit seinen Massenvernichtungswaffen zuschlagen.
"Ich glaube, das war ein fundamentaler Fehler", sagte Blix. "Ich weiß nicht, wie sie diese Zahl von 45 Minuten berechnet haben. Das scheint mir ziemlich weit hergeholt." Die Zeitangabe war zuvor schon von einem Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses bemängelt worden.
------
Und Bush

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/wirtschaft/26000…
Kraft sagt Dickmachern den Kampf an
US-Lebensmittelhersteller befürchtet Klagen von Übergewichtigen / Packungen für US-Markt werden kleiner
Olivia Schoeller
WASHINGTON, 13. Juli. In den USA ist der Oreo Keks eine Berühmtheit. Generationen sind mit den Schokoladeplätzchen mit der cremigen Füllung aufgewachsen. Nun muss der Keks Diät halten: Der größte Nahrungsmittel-Produzent der USA, die Firma Kraft, hat beschlossen, den Oreo-Keks und viele andere ihrer Produkte zu entschlacken. Wie das Unternehmen bekannt gab, sollen Kraft-Produkte in Zukunft gesünder sein und in kleineren Mengen abgepackt werden. Damit will Kraft US-Bürgern beim Abnehmen helfen. Laut einer Tabelle der American Obesity Association sind 64,5 Prozent der Erwachsenen in den USA übergewichtig, 30,5 Prozent sind fettleibig. "Wir haben erkannt, dass wir im Kampf gegen das Übergewicht eine Rolle zu spielen haben", sagte Kraft-Sprecher Michael Mudd der Berliner Zeitung.
Ein Akt der Nächstenliebe alleine ist die Reform nicht. Neben dem Wunsch, Amerikaner gesünder zu ernähren, sieht das Unternehmen in der Herstellung fettarmer Produkte nicht nur eine "großartige Geschäftsmöglichkeit", sondern auch die Chance, mögliche Klagen von Übergewichtigen schon im Vorfeld zu verhindern.
Nachdem vor kurzem zwei übergewichtige Teenager den Fast-Food-Konzern McDonald`s verklagt hatten, weil sie angeblich nicht ausreichend auf die gesundheits- und figurschädlichen Auswirkungen von Hamburger, Pommes und Co. hingewiesen wurden, ist die Nahrungsmittelindustrie alarmiert. Die Klage wurde zwar abgewiesen - doch schon morgen könnte eine Jury anders entscheiden.
Verbot von Süßigkeiten
"Wir haben unsere Politik geändert, weil wir glauben, dass es das Richtige ist für die Konsumenten und weil wir neue Geschäftsmöglichkeiten gewinnen", sagte Mudd. Und natürlich sollen auch Prozesse verhindert werden.
Kürzlich hatte ein Anwalt in San Francisco damit gedroht, den Verkauf von Oreo-Keksen an Kinder in Kalifornien gerichtlich verbieten zu lassen, berichtete die Washington Post. Die Klage wurde zwar fallen gelassen, doch haben mittlerweile mehrere Staaten und Städte in den USA den Verkauf von Süßigkeiten und Chips in Schulen verboten.
Nach den neuen Maßstäben von Kraft sollen vor allem Kinder in Zukunft vor zu vielen Kalorien geschützt werden. Das Unternehmen will nicht nur auf jegliche Werbung in Schulen verzichten, sondern auch sein Angebot in den Verkaufsautomaten überprüfen, sagte Mudd. Anders als in deutschen Schulen können Unternehmen in den USA ihre Produkte an Kinder vermarkten, indem sie etwa Werbung auf Schulbücher drucken und in Automaten verkaufen.
Demnächst soll eine Gruppe von Fachleuten - Nahrungs- und Bewegungsexperten sowie Mitglieder von Interessengruppen und aus der Regierung - darüber beraten, was und wie viel die Firma Kraft Kindern in den Speiseautomaten in Schulen anbietet. Heute gibt es vor allem Schokoriegel, Nüsse und andere Süßigkeiten zu kaufen. Doch bis Ende des Jahres soll der so genannte Beratungsstab die gesamte Produktpalette der Firma überarbeiten und Reformen beschließen, die dann in den kommenden zwei bis drei Jahren umgesetzt werden sollen, verspricht Mudd.

Kraft sagt Dickmachern den Kampf an
US-Lebensmittelhersteller befürchtet Klagen von Übergewichtigen / Packungen für US-Markt werden kleiner
Olivia Schoeller
WASHINGTON, 13. Juli. In den USA ist der Oreo Keks eine Berühmtheit. Generationen sind mit den Schokoladeplätzchen mit der cremigen Füllung aufgewachsen. Nun muss der Keks Diät halten: Der größte Nahrungsmittel-Produzent der USA, die Firma Kraft, hat beschlossen, den Oreo-Keks und viele andere ihrer Produkte zu entschlacken. Wie das Unternehmen bekannt gab, sollen Kraft-Produkte in Zukunft gesünder sein und in kleineren Mengen abgepackt werden. Damit will Kraft US-Bürgern beim Abnehmen helfen. Laut einer Tabelle der American Obesity Association sind 64,5 Prozent der Erwachsenen in den USA übergewichtig, 30,5 Prozent sind fettleibig. "Wir haben erkannt, dass wir im Kampf gegen das Übergewicht eine Rolle zu spielen haben", sagte Kraft-Sprecher Michael Mudd der Berliner Zeitung.
Ein Akt der Nächstenliebe alleine ist die Reform nicht. Neben dem Wunsch, Amerikaner gesünder zu ernähren, sieht das Unternehmen in der Herstellung fettarmer Produkte nicht nur eine "großartige Geschäftsmöglichkeit", sondern auch die Chance, mögliche Klagen von Übergewichtigen schon im Vorfeld zu verhindern.
Nachdem vor kurzem zwei übergewichtige Teenager den Fast-Food-Konzern McDonald`s verklagt hatten, weil sie angeblich nicht ausreichend auf die gesundheits- und figurschädlichen Auswirkungen von Hamburger, Pommes und Co. hingewiesen wurden, ist die Nahrungsmittelindustrie alarmiert. Die Klage wurde zwar abgewiesen - doch schon morgen könnte eine Jury anders entscheiden.
Verbot von Süßigkeiten
"Wir haben unsere Politik geändert, weil wir glauben, dass es das Richtige ist für die Konsumenten und weil wir neue Geschäftsmöglichkeiten gewinnen", sagte Mudd. Und natürlich sollen auch Prozesse verhindert werden.
Kürzlich hatte ein Anwalt in San Francisco damit gedroht, den Verkauf von Oreo-Keksen an Kinder in Kalifornien gerichtlich verbieten zu lassen, berichtete die Washington Post. Die Klage wurde zwar fallen gelassen, doch haben mittlerweile mehrere Staaten und Städte in den USA den Verkauf von Süßigkeiten und Chips in Schulen verboten.
Nach den neuen Maßstäben von Kraft sollen vor allem Kinder in Zukunft vor zu vielen Kalorien geschützt werden. Das Unternehmen will nicht nur auf jegliche Werbung in Schulen verzichten, sondern auch sein Angebot in den Verkaufsautomaten überprüfen, sagte Mudd. Anders als in deutschen Schulen können Unternehmen in den USA ihre Produkte an Kinder vermarkten, indem sie etwa Werbung auf Schulbücher drucken und in Automaten verkaufen.
Demnächst soll eine Gruppe von Fachleuten - Nahrungs- und Bewegungsexperten sowie Mitglieder von Interessengruppen und aus der Regierung - darüber beraten, was und wie viel die Firma Kraft Kindern in den Speiseautomaten in Schulen anbietet. Heute gibt es vor allem Schokoriegel, Nüsse und andere Süßigkeiten zu kaufen. Doch bis Ende des Jahres soll der so genannte Beratungsstab die gesamte Produktpalette der Firma überarbeiten und Reformen beschließen, die dann in den kommenden zwei bis drei Jahren umgesetzt werden sollen, verspricht Mudd.

Bush`s Data Dump
The administration is hiding bad economic news. Here`s how.
By Russ Baker
Posted Friday, July 11, 2003, at 12:56 PM PT
Slight of hand?
The Bush administration is finally facing tough questions about its selective use of intelligence in selling war with Iraq. But Americans shouldn`t just be skeptical of what the president says about WMD. They should be skeptical of what he says about GDP. In economic policy even more than in war policy, the Bushies have successfully suppressed, manipulated, and withheld evidence to serve their policy purposes.
Of course every administration likes to trumpet its good news and hide its bad, but what`s remarkable about the Bush team is its willingness to stifle data that had been widely released and to politicize data that used to be nonpartisan.
The administration muzzles routine economic information that`s unfavorable. Last year, for example, the administration stopped issuing a monthly Bureau of Labor Statistics report, known as the Mass Layoff Statistics program, that tracked factory closings throughout the country. The cancellation was made known on Christmas Eve in a footnote to the department`s final report—a document that revealed 2,150 mass layoffs in November, cashiering nearly a quarter-million workers. The administration claimed the report was a victim of budget cuts. After the Washington Post happened to catch this bit of data suppression, the BLS report was reinstated. (Interestingly, President George H.W. Bush buried these same statistics in `92, also during a period of job losses. They were revived by President Clinton.)
The Bush economic team has snuffed its own reports when they reach conclusions that don`t match the administration`s rosy scenarios. The administration deep-sixed a study commissioned by then Treasury Secretary Paul O`Neill that predicts huge budget deficits well into the future. As noted by the Financial Times in late May, this survey, which asserted that the baby-boom generation`s future health care and retirement costs would swamp U.S. coffers, was dropped from a 2004 budget summary published in February 2003—at the same time the White House was campaigning for a tax-cut package that critics warned would greatly expand future deficits. "The study`s [analysis of future deficits] dwarfs previous estimates of the financial challenge facing Washington," wrote the FT. According to the FT, a Bush official said the study was merely a thought exercise.
The administration also muffled a customary report whose findings would have forced key corporate supporters to pay more to their employees. The annual Adverse Effect Wage Rate establishes the minimum wage that can be paid each year to about 50,000 agricultural "guest workers" in the H2A Program. From AEWR`s 1987 inception until 2000, the Department of Labor released the report in February. But in 2001, DOL withheld the wage figure until August, and only published it after the Farmworker Justice Fund threatened a lawsuit. In 2002, the DOL held up the report until May, again releasing it only after the prospect of legal action. The delays helped big agricultural firms, largely in the tobacco states and the South, by allowing them to pay their field workers last year`s lower wages, saving the employers millions of dollars. Among those benefiting politically were Labor Secretary Elaine Chao`s husband, Sen. Mitch McConnell of Kentucky, whose state relies on several thousand guest workers in its tobacco fields and who receives large contributions from agricultural interests.
Another administration trick is playing with the length of its economic forecast periods, which puts the best possible face on bad news while exaggerating the projected benefits of its own initiatives. For example, to heighten the impression that Social Security is running out of money (thereby strengthening the case for allowing workers to divert money from the system into private retirement accounts), the administration has predicted shortfalls far in the future by relying on preposterously long forecast periods. In a superb analysis of the budget in the June Harper`s, Thomas Frank noted that in 2002 the administration declared an $18 trillion shortfall in Social Security and Medicare—about five times the current national debt. Frank notes that in order to arrive at the $18 trillion figure—since Social Security is currently in surplus—the administration used a "cumulative seventy-five-year estimate [Frank`s itals] based on extreme long-term projections ... ." Meanwhile, even as it relies on 75-year projections for Social Security, the same document replaces traditional 10-year budget projections with five-year ones, claiming the longer-term numbers were unreliable.
President Bush also politicized the Council of Economic Advisers, which is supposed to produce straight analysis, not administration spin. CEA staffers complained that top Bush economic adviser Larry Lindsey, not even a member of the council, encouraged them to produce data supporting the president`s controversial tax cut initiatives. CEA chairman Glen Hubbard also pushed staffers to find literature supporting the questionable argument that tax cuts created job growth.
On other occasions, the administration has punished economic officials who didn`t follow the company line. Treasury Secretary O`Neill left the administration after, among other fits of candor, he expressed skepticism about economic figures the White House had released and suggested that the tax cut could be better used to buttress Social Security. And before Lindsey was made to take a dive, he predicted that the war in Iraq could cost upwards of $200 billion, a figure that infuriated the White House, which was selling the anti-Saddam campaign as a comparatively cheap victory.
Important economic data that casts a bad light on administration policies has been expunged from government Web sites. The Department of Labor removed a report showing the real value of the minimum wage over time, claiming it was "outdated." With no minimum wage hike since 1997, the Web site would have shown minimum-wage workers faring increasingly poorly under the Bush administration, while their real income went up under Clinton. (Some subheadings from the report: "Real Value of the Minimum Wage Continues Decline"; "Minimum Wage Falls Relative to Average Hourly Earnings"; "Minimum Wage Falls Below 2-Person Family Poverty Threshold.")
Earlier this year, a study predicting mediocre job growth from Bush`s proposed $674 billion economic stimulus plan disappeared from the Council of Economic Advisers` Web site. The study forecast an average increase of only 170,000 jobs—0.1 percent of the workforce—every year through 2007. The study was pulled just after a major Jan. 7 Bush budget speech to the Economic Club of Chicago. "In the out years, by their own estimate, their plan is a job and growth killer," says Jared Bernstein, economist at the Economic Policy Institute. "Instead of doing what serious analysts would do and going to the drawing board to re-evaluate, they just took the offending document off the Web site."
Certainly, each one of these Bush team moves can be explained: administrative concerns, government paperwork reduction, outdated material, etc. Cumulatively, however, they certainly look suspect. We`ve seen the future, and it`s been deleted.
http://slate.msn.com/id/2085481/
liar, liar, pants on fire

 ........
........
syr
The administration is hiding bad economic news. Here`s how.
By Russ Baker
Posted Friday, July 11, 2003, at 12:56 PM PT
Slight of hand?
The Bush administration is finally facing tough questions about its selective use of intelligence in selling war with Iraq. But Americans shouldn`t just be skeptical of what the president says about WMD. They should be skeptical of what he says about GDP. In economic policy even more than in war policy, the Bushies have successfully suppressed, manipulated, and withheld evidence to serve their policy purposes.
Of course every administration likes to trumpet its good news and hide its bad, but what`s remarkable about the Bush team is its willingness to stifle data that had been widely released and to politicize data that used to be nonpartisan.
The administration muzzles routine economic information that`s unfavorable. Last year, for example, the administration stopped issuing a monthly Bureau of Labor Statistics report, known as the Mass Layoff Statistics program, that tracked factory closings throughout the country. The cancellation was made known on Christmas Eve in a footnote to the department`s final report—a document that revealed 2,150 mass layoffs in November, cashiering nearly a quarter-million workers. The administration claimed the report was a victim of budget cuts. After the Washington Post happened to catch this bit of data suppression, the BLS report was reinstated. (Interestingly, President George H.W. Bush buried these same statistics in `92, also during a period of job losses. They were revived by President Clinton.)
The Bush economic team has snuffed its own reports when they reach conclusions that don`t match the administration`s rosy scenarios. The administration deep-sixed a study commissioned by then Treasury Secretary Paul O`Neill that predicts huge budget deficits well into the future. As noted by the Financial Times in late May, this survey, which asserted that the baby-boom generation`s future health care and retirement costs would swamp U.S. coffers, was dropped from a 2004 budget summary published in February 2003—at the same time the White House was campaigning for a tax-cut package that critics warned would greatly expand future deficits. "The study`s [analysis of future deficits] dwarfs previous estimates of the financial challenge facing Washington," wrote the FT. According to the FT, a Bush official said the study was merely a thought exercise.
The administration also muffled a customary report whose findings would have forced key corporate supporters to pay more to their employees. The annual Adverse Effect Wage Rate establishes the minimum wage that can be paid each year to about 50,000 agricultural "guest workers" in the H2A Program. From AEWR`s 1987 inception until 2000, the Department of Labor released the report in February. But in 2001, DOL withheld the wage figure until August, and only published it after the Farmworker Justice Fund threatened a lawsuit. In 2002, the DOL held up the report until May, again releasing it only after the prospect of legal action. The delays helped big agricultural firms, largely in the tobacco states and the South, by allowing them to pay their field workers last year`s lower wages, saving the employers millions of dollars. Among those benefiting politically were Labor Secretary Elaine Chao`s husband, Sen. Mitch McConnell of Kentucky, whose state relies on several thousand guest workers in its tobacco fields and who receives large contributions from agricultural interests.
Another administration trick is playing with the length of its economic forecast periods, which puts the best possible face on bad news while exaggerating the projected benefits of its own initiatives. For example, to heighten the impression that Social Security is running out of money (thereby strengthening the case for allowing workers to divert money from the system into private retirement accounts), the administration has predicted shortfalls far in the future by relying on preposterously long forecast periods. In a superb analysis of the budget in the June Harper`s, Thomas Frank noted that in 2002 the administration declared an $18 trillion shortfall in Social Security and Medicare—about five times the current national debt. Frank notes that in order to arrive at the $18 trillion figure—since Social Security is currently in surplus—the administration used a "cumulative seventy-five-year estimate [Frank`s itals] based on extreme long-term projections ... ." Meanwhile, even as it relies on 75-year projections for Social Security, the same document replaces traditional 10-year budget projections with five-year ones, claiming the longer-term numbers were unreliable.
President Bush also politicized the Council of Economic Advisers, which is supposed to produce straight analysis, not administration spin. CEA staffers complained that top Bush economic adviser Larry Lindsey, not even a member of the council, encouraged them to produce data supporting the president`s controversial tax cut initiatives. CEA chairman Glen Hubbard also pushed staffers to find literature supporting the questionable argument that tax cuts created job growth.
On other occasions, the administration has punished economic officials who didn`t follow the company line. Treasury Secretary O`Neill left the administration after, among other fits of candor, he expressed skepticism about economic figures the White House had released and suggested that the tax cut could be better used to buttress Social Security. And before Lindsey was made to take a dive, he predicted that the war in Iraq could cost upwards of $200 billion, a figure that infuriated the White House, which was selling the anti-Saddam campaign as a comparatively cheap victory.
Important economic data that casts a bad light on administration policies has been expunged from government Web sites. The Department of Labor removed a report showing the real value of the minimum wage over time, claiming it was "outdated." With no minimum wage hike since 1997, the Web site would have shown minimum-wage workers faring increasingly poorly under the Bush administration, while their real income went up under Clinton. (Some subheadings from the report: "Real Value of the Minimum Wage Continues Decline"; "Minimum Wage Falls Relative to Average Hourly Earnings"; "Minimum Wage Falls Below 2-Person Family Poverty Threshold.")
Earlier this year, a study predicting mediocre job growth from Bush`s proposed $674 billion economic stimulus plan disappeared from the Council of Economic Advisers` Web site. The study forecast an average increase of only 170,000 jobs—0.1 percent of the workforce—every year through 2007. The study was pulled just after a major Jan. 7 Bush budget speech to the Economic Club of Chicago. "In the out years, by their own estimate, their plan is a job and growth killer," says Jared Bernstein, economist at the Economic Policy Institute. "Instead of doing what serious analysts would do and going to the drawing board to re-evaluate, they just took the offending document off the Web site."
Certainly, each one of these Bush team moves can be explained: administrative concerns, government paperwork reduction, outdated material, etc. Cumulatively, however, they certainly look suspect. We`ve seen the future, and it`s been deleted.
http://slate.msn.com/id/2085481/
liar, liar, pants on fire


 ........
........syr

syr
schade das du drüben nicht mehr reinkommst
schade das du drüben nicht mehr reinkommst

http://news.orf.at/index.html?url=http%3A//news.orf.at/ticke…
Angebliche El-Kaida-Gruppe droht USA mit neuem Angriff
Eine angebliche El-Kaida-Gruppe hat den USA gestern mit einem verheerenden Angriff gedroht. Ein unbekannter Sprecher sagte auf einem Audioband, das von dem Fernsehsender El Arabija ausgestrahlt wurde, in den kommenden Tagen werde es einen neuen Angriff auf die USA geben, der "Amerika vollständig das Rückgrat brechen" werde.
"Stehen hinter Angriffen im Irak"
Zu dem Band zeigte der Sender ein Foto eines nicht identifizierten Mannes mit einem weißen Bart, der einen Turban trug. Die Stimme sagte, die "Bewaffnete Islamische Bewegung für El Kaida, Falludscha-Gruppe" stehe hinter Angriffen auf US-Truppen im Irak, nicht Anhänger des gestürzten irakischen Präsidenten Saddam Hussein: "Ich schwöre bei Gott, dass keiner seiner Anhänger irgendwelche Dschihad-Operationen ausgeführt hat wie er behauptet."
Eine Gruppe mit diesem Namen ist bislang nicht in Erscheinung getreten.

Angebliche El-Kaida-Gruppe droht USA mit neuem Angriff
Eine angebliche El-Kaida-Gruppe hat den USA gestern mit einem verheerenden Angriff gedroht. Ein unbekannter Sprecher sagte auf einem Audioband, das von dem Fernsehsender El Arabija ausgestrahlt wurde, in den kommenden Tagen werde es einen neuen Angriff auf die USA geben, der "Amerika vollständig das Rückgrat brechen" werde.
"Stehen hinter Angriffen im Irak"
Zu dem Band zeigte der Sender ein Foto eines nicht identifizierten Mannes mit einem weißen Bart, der einen Turban trug. Die Stimme sagte, die "Bewaffnete Islamische Bewegung für El Kaida, Falludscha-Gruppe" stehe hinter Angriffen auf US-Truppen im Irak, nicht Anhänger des gestürzten irakischen Präsidenten Saddam Hussein: "Ich schwöre bei Gott, dass keiner seiner Anhänger irgendwelche Dschihad-Operationen ausgeführt hat wie er behauptet."
Eine Gruppe mit diesem Namen ist bislang nicht in Erscheinung getreten.

In Washington steht ein Autofahrer im Stau. Plötzlich klopft ein Mann ans Seitenfenster. Der Autofahrer läßt die Scheibe herunter und fragt: "Was gibts?"
Der Mann sagt aufgeregt: "Präsident Bush ist von Terroristen entführt worden! Sie wollen ihn mit Benzin übergiessen und verbrennen, wenn sie nicht 10 Millionen Dollar Lösegeld kriegen!"
"Ja und?" fragt der Autofahrer.
"Na, wir gehen jetzt von Auto zu Auto," erwidert der Mann, "um zu sammeln!"
"Ach so! Und wieviel geben die Leute im Durchschnitt?"
"Ein bis zwei Liter ... "

Der Mann sagt aufgeregt: "Präsident Bush ist von Terroristen entführt worden! Sie wollen ihn mit Benzin übergiessen und verbrennen, wenn sie nicht 10 Millionen Dollar Lösegeld kriegen!"
"Ja und?" fragt der Autofahrer.
"Na, wir gehen jetzt von Auto zu Auto," erwidert der Mann, "um zu sammeln!"
"Ach so! Und wieviel geben die Leute im Durchschnitt?"
"Ein bis zwei Liter ... "

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/481/14467/
Dramatische Finanzkrise in den USA
Not der Bundesstaaten gefärdet den Aufschwung
Nahezu alle Gouverneure müssen Ausgaben streichen und die Abgaben erhöhen. Am stärksten betroffen ist Kalifornien.
von Marc Hujer
(SZ vom 14.07.2003) — Die National Association of State Budget Officers (Nasbo) spricht von der größten Finanzkrise seit mehr als 20 Jahren. Nach Angaben der Organisation haben 37 der 50 Bundesstaaten ihre Ausgaben zusammengestrichen, insgesamt um 14,3 Milliarden Dollar.
"Kurzsichtige Ausgabenkürzungen"
Die Ausgabenstreichungen betreffen insbesondere Gesundheitsleistungen, die Ausgaben für Schulen und Gefängnisse. Außerdem haben viele Staaten Steuer- und Gebührenerhöhungen beschlossen. Die Nasbo nennt 29 Staaten, die zu Steuererhöhungen von 17,5 Milliarden Dollar im Haushaltsjahr 2003 beigetragen haben.
Zusammengenommen haben die Bundesstaaten damit Maßnahmen von 32 Milliarden Dollar beschlossen, die nachteilig auf die Konjunktur wirken und die Wirkung der Steuerreform von George W. Bush erheblich konterkarieren könnten. Bush hatte zuletzt versucht, die Wirtschaft mit Steuererleichterungen von 60 Milliarden Dollar pro Jahr zu beleben.
Mark McMullen, Ökonom bei Economy.com, nennt die Finanzkrise der Bundesstaaten „ein beachtliches Risiko“ für die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft. „Sollte die Wirtschaft in die Rezession geraten, wären die Regierungen der Bundesstaaten nicht in der Lage, den privaten Sektor zu unterstützen wie sie es typischerweise im Abschwung tun.“
Die Fiskalpolitik der Bundesstaaten könnte so zu einer ernsthaften Belastung werden. Alice Rivlin, die frühere stellvertretende Notenbankchefin, beklagte die „kurzsichtigen Ausgabenkürzungen, die vor allem die unteren Einkommensschichten betreffen und die zyklischen Schwankungen in der Wirtschaft zu stärken“, statt sie abzufedern.
Das Problem aller Bundesstaaten – mit Ausnahme des Neuenglandstaates Vermont – ist es, dass sie sich nicht verschulden dürfen. Gewöhnlich legen die Bundesstaaten Rücklagen an, aber die sind von 48,8 Milliarden Dollar im Jahr 2000 bereits auf weniger als sechs Milliarden Dollar gesunken.
Das wirtschaftsliberale Cato Instituts hält die Entwicklung für weniger besorgniserregend. Die Bundesstaaten hätten im vergangenen Jahrzehnt die Ausgaben über Gebühr ausgeweitet, erklärt das Institut, das für einen kleineren Staat kämpft.
Zwischen 1990 und 2001 wuchsen die Ausgaben demnach um 5,7 Prozent pro Jahr, das ist doppelt so schnell wie die Inflation und schneller als die Ausgaben der Landesregierung in Washington gestiegen sind. Die Krise sei die notwendige Korrektur einer unverantwortlichen Ausgabenpolitik in der Vergangenheit. Die Regierung von George W. Bush war den Bundesländern zuletzt entgegengekommen, indem sie in der letzten Steuerreform eine 20-Milliarden-Hilfe für die angespannten Gesundheitskassen der Bundesländer bewilligte.
Sündensteuern
Die einzelnen Bundesländer versuchen die Krise mit unterschiedlichen Maßnahmen zu bekämpfen, wobei die Erhöhung der Verbrauchssteuern (in 15 Staaten, darunter auch Kalifornien) die meisten Einnahmen bringen soll. Zehn Staaten erhöhten dagegen die Einkommensteuer, elf die Unternehmenssteuern, 14 Staaten verlangten mehr „Sündensteuer“ für Zigaretten und Alkohol. In zwei Staaten, Alaska und Michigan, erhöhten die Regierungen die Mineralölsteuer und 17 Staaten griffen zu Maßnahmen wie Hotel- und Kasinosteuern.
Kalifornien ist von der Krise am stärksten betroffen. Das Haushaltsloch beträgt 38,2 Milliarden Dollar und ist damit größer als das aller anderen US-Bundesstaaten zusammen mit Ausnahme New Yorks. Die Kreditratingfirmen Moody’s und Standard and Poor’s setzten Kalifornien für 90 Tage auf die „watch list“ für Problemfälle. Der amtierende Gouverneur Gray Davis ist wegen der Finanzmisere derzeit so stark unter Druck, dass sich bereits potentielle Nachfolger bereithalten, unter anderem „Terminator“- Darsteller Arnold Schwarzenegger.

Schlusssatz -->


Dramatische Finanzkrise in den USA
Not der Bundesstaaten gefärdet den Aufschwung
Nahezu alle Gouverneure müssen Ausgaben streichen und die Abgaben erhöhen. Am stärksten betroffen ist Kalifornien.
von Marc Hujer
(SZ vom 14.07.2003) — Die National Association of State Budget Officers (Nasbo) spricht von der größten Finanzkrise seit mehr als 20 Jahren. Nach Angaben der Organisation haben 37 der 50 Bundesstaaten ihre Ausgaben zusammengestrichen, insgesamt um 14,3 Milliarden Dollar.
"Kurzsichtige Ausgabenkürzungen"
Die Ausgabenstreichungen betreffen insbesondere Gesundheitsleistungen, die Ausgaben für Schulen und Gefängnisse. Außerdem haben viele Staaten Steuer- und Gebührenerhöhungen beschlossen. Die Nasbo nennt 29 Staaten, die zu Steuererhöhungen von 17,5 Milliarden Dollar im Haushaltsjahr 2003 beigetragen haben.
Zusammengenommen haben die Bundesstaaten damit Maßnahmen von 32 Milliarden Dollar beschlossen, die nachteilig auf die Konjunktur wirken und die Wirkung der Steuerreform von George W. Bush erheblich konterkarieren könnten. Bush hatte zuletzt versucht, die Wirtschaft mit Steuererleichterungen von 60 Milliarden Dollar pro Jahr zu beleben.
Mark McMullen, Ökonom bei Economy.com, nennt die Finanzkrise der Bundesstaaten „ein beachtliches Risiko“ für die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft. „Sollte die Wirtschaft in die Rezession geraten, wären die Regierungen der Bundesstaaten nicht in der Lage, den privaten Sektor zu unterstützen wie sie es typischerweise im Abschwung tun.“
Die Fiskalpolitik der Bundesstaaten könnte so zu einer ernsthaften Belastung werden. Alice Rivlin, die frühere stellvertretende Notenbankchefin, beklagte die „kurzsichtigen Ausgabenkürzungen, die vor allem die unteren Einkommensschichten betreffen und die zyklischen Schwankungen in der Wirtschaft zu stärken“, statt sie abzufedern.
Das Problem aller Bundesstaaten – mit Ausnahme des Neuenglandstaates Vermont – ist es, dass sie sich nicht verschulden dürfen. Gewöhnlich legen die Bundesstaaten Rücklagen an, aber die sind von 48,8 Milliarden Dollar im Jahr 2000 bereits auf weniger als sechs Milliarden Dollar gesunken.
Das wirtschaftsliberale Cato Instituts hält die Entwicklung für weniger besorgniserregend. Die Bundesstaaten hätten im vergangenen Jahrzehnt die Ausgaben über Gebühr ausgeweitet, erklärt das Institut, das für einen kleineren Staat kämpft.
Zwischen 1990 und 2001 wuchsen die Ausgaben demnach um 5,7 Prozent pro Jahr, das ist doppelt so schnell wie die Inflation und schneller als die Ausgaben der Landesregierung in Washington gestiegen sind. Die Krise sei die notwendige Korrektur einer unverantwortlichen Ausgabenpolitik in der Vergangenheit. Die Regierung von George W. Bush war den Bundesländern zuletzt entgegengekommen, indem sie in der letzten Steuerreform eine 20-Milliarden-Hilfe für die angespannten Gesundheitskassen der Bundesländer bewilligte.
Sündensteuern
Die einzelnen Bundesländer versuchen die Krise mit unterschiedlichen Maßnahmen zu bekämpfen, wobei die Erhöhung der Verbrauchssteuern (in 15 Staaten, darunter auch Kalifornien) die meisten Einnahmen bringen soll. Zehn Staaten erhöhten dagegen die Einkommensteuer, elf die Unternehmenssteuern, 14 Staaten verlangten mehr „Sündensteuer“ für Zigaretten und Alkohol. In zwei Staaten, Alaska und Michigan, erhöhten die Regierungen die Mineralölsteuer und 17 Staaten griffen zu Maßnahmen wie Hotel- und Kasinosteuern.
Kalifornien ist von der Krise am stärksten betroffen. Das Haushaltsloch beträgt 38,2 Milliarden Dollar und ist damit größer als das aller anderen US-Bundesstaaten zusammen mit Ausnahme New Yorks. Die Kreditratingfirmen Moody’s und Standard and Poor’s setzten Kalifornien für 90 Tage auf die „watch list“ für Problemfälle. Der amtierende Gouverneur Gray Davis ist wegen der Finanzmisere derzeit so stark unter Druck, dass sich bereits potentielle Nachfolger bereithalten, unter anderem „Terminator“- Darsteller Arnold Schwarzenegger.

Schlusssatz -->



Interessant, die amerikanischen Bundesstaaten haben im Gegensatz zu deutschen Bundesländern keine Schulden. Was ist mit den Kommunen?
Gruß, Algol
Gruß, Algol
Nichts ist unmöglich !
!
15.07. 15:23
UBS: US-Firmen weisen zu hohe Gewinne aus
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie die Schweizer Investmentbank UBS berichtet, haben US-Unternehmen jahrelang zu hohe Gewinne öffentlich ausgewiesen. Bilanzexperte David Bianco untersuchte die 500 Unternehmen im S&P 500 Index und kam zu der Schlussfolgerung, dass die Gewinne im Jahr 1991 um 18% zu hoch ausgewiesen wurden – mittlerweile, im Jahr 2002, sei dieser Wert auf 41% angeschnellt . Dies berichtet die „New York Times“ (Dienstagsausgabe). Zu den Lieblingsmethoden der Unternehmen zählen die Verbuchung von operativen Kosten als außerordentliche Aufwendungen, die Nicht-Verrechnung von Aktienoptionen als Kosten und die zu hohe Erfassung von möglichen in Zukunft erhofften Rückflüssen aus Pensionsfonds. Nach den Berechnungen von Bianco habe eBay (WKN: 916529, US: EBAY) ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 198 – statt wie allgemein bekannt von 77.
. Dies berichtet die „New York Times“ (Dienstagsausgabe). Zu den Lieblingsmethoden der Unternehmen zählen die Verbuchung von operativen Kosten als außerordentliche Aufwendungen, die Nicht-Verrechnung von Aktienoptionen als Kosten und die zu hohe Erfassung von möglichen in Zukunft erhofften Rückflüssen aus Pensionsfonds. Nach den Berechnungen von Bianco habe eBay (WKN: 916529, US: EBAY) ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 198 – statt wie allgemein bekannt von 77.
Blühende Landschaften im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, zumindest auf PAPIER

 ......
......
Runter mit dem Dreck !
!
syr
 !
!15.07. 15:23
UBS: US-Firmen weisen zu hohe Gewinne aus
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie die Schweizer Investmentbank UBS berichtet, haben US-Unternehmen jahrelang zu hohe Gewinne öffentlich ausgewiesen. Bilanzexperte David Bianco untersuchte die 500 Unternehmen im S&P 500 Index und kam zu der Schlussfolgerung, dass die Gewinne im Jahr 1991 um 18% zu hoch ausgewiesen wurden – mittlerweile, im Jahr 2002, sei dieser Wert auf 41% angeschnellt
 . Dies berichtet die „New York Times“ (Dienstagsausgabe). Zu den Lieblingsmethoden der Unternehmen zählen die Verbuchung von operativen Kosten als außerordentliche Aufwendungen, die Nicht-Verrechnung von Aktienoptionen als Kosten und die zu hohe Erfassung von möglichen in Zukunft erhofften Rückflüssen aus Pensionsfonds. Nach den Berechnungen von Bianco habe eBay (WKN: 916529, US: EBAY) ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 198 – statt wie allgemein bekannt von 77.
. Dies berichtet die „New York Times“ (Dienstagsausgabe). Zu den Lieblingsmethoden der Unternehmen zählen die Verbuchung von operativen Kosten als außerordentliche Aufwendungen, die Nicht-Verrechnung von Aktienoptionen als Kosten und die zu hohe Erfassung von möglichen in Zukunft erhofften Rückflüssen aus Pensionsfonds. Nach den Berechnungen von Bianco habe eBay (WKN: 916529, US: EBAY) ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 198 – statt wie allgemein bekannt von 77. Blühende Landschaften im Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten, zumindest auf PAPIER


 ......
......Runter mit dem Dreck
 !
!syr
14/07/2003 22:57
US-Aufsicht will Bilanzen von Fannie Mae prüfen
Washington, 14. Jul (Reuters) - Eine US-Aufsichtsbehörde hat
eine außerordentliche Buchprüfung bei dem größten
US-Immobilienfinanzierer Fannie Mae angekündigt, nachdem
der Branchenzweite Freddie Mac seine Gewinne nach einer
Bilanzprüfung kräftig nach oben korrigiert hatte.
Der Direktor der Aufsichtsbehörde Office of Federal Housing
Enterprise Oversight, Armando Falcon, erklärte am Montag in
einem Brief an den US-Kongress, er habe zwar keine spezifischen
Sorgen wegen der Bilanzierungspraktiken von Fannie Mae. "Eine
solche Prüfung wäre aber angesichts der Umstände vernünftig".
Der Bankenausschuss des US-Senats plant in dieser und
nächsten Woche mehrere Anhörungen im Zusammenhang mit den
Immobilienfinanzierern. Am 22. Juli soll dabei die geplante
Ernennung von Mark Brickell zum Chef der Aufsichtsbehörde
behandelt werden.
Freddie Mac hatte Ende Juni nach internen Prüfung der
Bilanzen mitgeteilt, das Unternehmen habe in den vergangenen
drei Jahren schätzungsweise zwischen 1,5 und 4,5 Milliarden
Dollar mehr Gewinn erwirtschaftet als bislang angegeben. Im
Zusammenhang mit der Bilanzprüfung hatte Freddie Mac Anfang Juni
seine Führungsspitze ausgewechselt.
Fannie Mae und Freddie Mac sind börsennotiert. Beide haben
allerdings den staatlichen Auftrag, die Finanzierung von
Immobilien zu erleichtern. Fannie Mae und Freddie Mac verwalten
Hypothekenkredite über 3,3 Billionen Dollar und kontrollieren
etwa 40 Prozent dieses Marktes.
tcs/nmk
-----
Nun kommen die Dicken dran
US-Aufsicht will Bilanzen von Fannie Mae prüfen
Washington, 14. Jul (Reuters) - Eine US-Aufsichtsbehörde hat
eine außerordentliche Buchprüfung bei dem größten
US-Immobilienfinanzierer Fannie Mae angekündigt, nachdem
der Branchenzweite Freddie Mac seine Gewinne nach einer
Bilanzprüfung kräftig nach oben korrigiert hatte.
Der Direktor der Aufsichtsbehörde Office of Federal Housing
Enterprise Oversight, Armando Falcon, erklärte am Montag in
einem Brief an den US-Kongress, er habe zwar keine spezifischen
Sorgen wegen der Bilanzierungspraktiken von Fannie Mae. "Eine
solche Prüfung wäre aber angesichts der Umstände vernünftig".
Der Bankenausschuss des US-Senats plant in dieser und
nächsten Woche mehrere Anhörungen im Zusammenhang mit den
Immobilienfinanzierern. Am 22. Juli soll dabei die geplante
Ernennung von Mark Brickell zum Chef der Aufsichtsbehörde
behandelt werden.
Freddie Mac hatte Ende Juni nach internen Prüfung der
Bilanzen mitgeteilt, das Unternehmen habe in den vergangenen
drei Jahren schätzungsweise zwischen 1,5 und 4,5 Milliarden
Dollar mehr Gewinn erwirtschaftet als bislang angegeben. Im
Zusammenhang mit der Bilanzprüfung hatte Freddie Mac Anfang Juni
seine Führungsspitze ausgewechselt.
Fannie Mae und Freddie Mac sind börsennotiert. Beide haben
allerdings den staatlichen Auftrag, die Finanzierung von
Immobilien zu erleichtern. Fannie Mae und Freddie Mac verwalten
Hypothekenkredite über 3,3 Billionen Dollar und kontrollieren
etwa 40 Prozent dieses Marktes.
tcs/nmk
-----
Nun kommen die Dicken dran

Insider in USA verschmähen eigene Aktien
Manche Experten schließen daraus auf ein baldiges Ende der US-Kursrallye
New York/Berlin - Wenn Konzernchefs, Vorstände oder Aufsichtsratsmitglieder in großem Umfang Aktien ihres Unternehmens zukaufen oder auf den Markt werfen, horchen viele Beobachter auf. Denn diese so genannten Insider-Geschäfte oder Directors` Dealings, die der jeweiligen Börsenaufsicht gemeldet werden müssen, können Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der Aktie oder des Marktes geben. Auch ein besonders geringes Kaufinteresse gilt als Indikator, wie aktuell in den USA. Dort haben Insider bei Konzernen wie Dell oder Microsoft während der Rallye im zweiten Quartal ihre eigenen Aktien verschmäht. Dies kann als Zeichen interpretiert werden, dass der Kursaufschwung schon zu weit gegangen ist.
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder kauften im Juni gerade mal für 69 Mio. Dollar Aktien des eigenen Unternehmens. Das ist nach den Daten von Thomson Financial der niedrigste Wert seit 1997. Er liegt auch 45 Prozent niedriger als die 126 Mio. Dollar vom Mai. Das Verhältnis von verkauften zu gekauften Aktien war mit 4,2 das höchste seit 17 Jahren, berichtet Vickers Weekly Insider Report. "Die Chefs sind sich einig: Der Markt ist derzeit großzügig bewertet", sagt Don Coxe, Chefstratege bei Harris Investment Management. Konzernlenker wie Steve Ballmer, Vorstandsvorsitzender von Microsoft, und Michael Dell, sein Kollege bei Dell, haben in den letzten sechs Monaten insgesamt für über zwei Mrd. Dollar Aktien des eigenen Unternehmens verkauft. Sie erklärten, sie wollten ihre Portefeuilles diversifizieren.
Die Quartalsergebnisse, die diese Woche anstehen, werden zeigen, wer Recht hat: Die Konzerninsider, die die eigenen Aktien meiden, oder die Anleger, die mit ihren Käufen den S&P 500-Index seit dem Jahrestief vom 11. März um 25 Prozent nach oben gehievt haben. Der Chip-Riese Intel gibt am heutigen Dienstag sein Quartalsergebnis bekannt, der weltgrößte Computerhersteller IBM veröffentlicht am Mittwoch seine Zahlen. Microsoft berichtet am Donnerstag. Nicht einer aus der Führungsriege der drei US-Konzerne hat seit dem 11. März Aktien seines Arbeitgebers gekauft, zeigen die Daten von Thomson Financial.
Außer den drei Branchengrößen werden etwa 120 Unternehmen aus dem S&P 500 diese Woche ihre Quartalszahlen vorlegen. Im Bankensektor legten Citigroup und Bank of America am Montag ihr Quartalsergebnis vor und übertrafen die Prognosen der Analysten bei weitem. Außerdem stehen bei Johnson & Johnson, Merrill Lynch, Ford Motor, Altria Group und General Motors Quartalszahlen an.
Die Ausblicke, die die Konzernchefs geben, werden den Analysten als Richtschnur dienen, ob sie ihre Gewinnprognosen für das dritte und vierte Quartal nach unten revidieren müssen. Die durchschnittliche Prognose geht davon aus, dass der Gewinn bei den S&P 500-Mitgliedern im dritten und vierten Quartal um 13 beziehungsweise 14 Prozent steigt.
Einige Investoren widersprechen jedoch vehement der Vermutung, die schwachen Aktienkäufe von Unternehmensinsidern deuteten auf das Ende der Kursrallye. "Ich gebe nicht viel darauf", sagt Carl Domino, Fondsmanager von Northern Large Cap Value. "Insiderkäufe sind unternehmensspezifisch. Wie viele Konzernchefs wissen wirklich, was in der Wirtschaft los ist?" Allerdings sind die Aktien teurer geworden. Das erklärt nach Meinung einiger Analysten teilweise die gesunkene Aktiennachfrage von Unternehmensinsidern. Die Werte aus dem S&P 500-Index werden im Schnitt zum 19fachen des geschätzten Gewinns für das Jahr 2003 gehandelt. Im März lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) noch bei 15. "Wenn man die Insiderkäufe als Indikator nimmt, spricht mehr für eine Abwärtsbewegung als für einen weiteren Kursaufschwung", betont Coleman von Vickers.
Manche Experten schließen daraus auf ein baldiges Ende der US-Kursrallye
New York/Berlin - Wenn Konzernchefs, Vorstände oder Aufsichtsratsmitglieder in großem Umfang Aktien ihres Unternehmens zukaufen oder auf den Markt werfen, horchen viele Beobachter auf. Denn diese so genannten Insider-Geschäfte oder Directors` Dealings, die der jeweiligen Börsenaufsicht gemeldet werden müssen, können Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der Aktie oder des Marktes geben. Auch ein besonders geringes Kaufinteresse gilt als Indikator, wie aktuell in den USA. Dort haben Insider bei Konzernen wie Dell oder Microsoft während der Rallye im zweiten Quartal ihre eigenen Aktien verschmäht. Dies kann als Zeichen interpretiert werden, dass der Kursaufschwung schon zu weit gegangen ist.
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder kauften im Juni gerade mal für 69 Mio. Dollar Aktien des eigenen Unternehmens. Das ist nach den Daten von Thomson Financial der niedrigste Wert seit 1997. Er liegt auch 45 Prozent niedriger als die 126 Mio. Dollar vom Mai. Das Verhältnis von verkauften zu gekauften Aktien war mit 4,2 das höchste seit 17 Jahren, berichtet Vickers Weekly Insider Report. "Die Chefs sind sich einig: Der Markt ist derzeit großzügig bewertet", sagt Don Coxe, Chefstratege bei Harris Investment Management. Konzernlenker wie Steve Ballmer, Vorstandsvorsitzender von Microsoft, und Michael Dell, sein Kollege bei Dell, haben in den letzten sechs Monaten insgesamt für über zwei Mrd. Dollar Aktien des eigenen Unternehmens verkauft. Sie erklärten, sie wollten ihre Portefeuilles diversifizieren.

Die Quartalsergebnisse, die diese Woche anstehen, werden zeigen, wer Recht hat: Die Konzerninsider, die die eigenen Aktien meiden, oder die Anleger, die mit ihren Käufen den S&P 500-Index seit dem Jahrestief vom 11. März um 25 Prozent nach oben gehievt haben. Der Chip-Riese Intel gibt am heutigen Dienstag sein Quartalsergebnis bekannt, der weltgrößte Computerhersteller IBM veröffentlicht am Mittwoch seine Zahlen. Microsoft berichtet am Donnerstag. Nicht einer aus der Führungsriege der drei US-Konzerne hat seit dem 11. März Aktien seines Arbeitgebers gekauft, zeigen die Daten von Thomson Financial.
Außer den drei Branchengrößen werden etwa 120 Unternehmen aus dem S&P 500 diese Woche ihre Quartalszahlen vorlegen. Im Bankensektor legten Citigroup und Bank of America am Montag ihr Quartalsergebnis vor und übertrafen die Prognosen der Analysten bei weitem. Außerdem stehen bei Johnson & Johnson, Merrill Lynch, Ford Motor, Altria Group und General Motors Quartalszahlen an.
Die Ausblicke, die die Konzernchefs geben, werden den Analysten als Richtschnur dienen, ob sie ihre Gewinnprognosen für das dritte und vierte Quartal nach unten revidieren müssen. Die durchschnittliche Prognose geht davon aus, dass der Gewinn bei den S&P 500-Mitgliedern im dritten und vierten Quartal um 13 beziehungsweise 14 Prozent steigt.
Einige Investoren widersprechen jedoch vehement der Vermutung, die schwachen Aktienkäufe von Unternehmensinsidern deuteten auf das Ende der Kursrallye. "Ich gebe nicht viel darauf", sagt Carl Domino, Fondsmanager von Northern Large Cap Value. "Insiderkäufe sind unternehmensspezifisch. Wie viele Konzernchefs wissen wirklich, was in der Wirtschaft los ist?" Allerdings sind die Aktien teurer geworden. Das erklärt nach Meinung einiger Analysten teilweise die gesunkene Aktiennachfrage von Unternehmensinsidern. Die Werte aus dem S&P 500-Index werden im Schnitt zum 19fachen des geschätzten Gewinns für das Jahr 2003 gehandelt. Im März lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) noch bei 15. "Wenn man die Insiderkäufe als Indikator nimmt, spricht mehr für eine Abwärtsbewegung als für einen weiteren Kursaufschwung", betont Coleman von Vickers.
15/07/2003 14:22
USA-Haushaltsdefizit fällt wohl noch höher als erwartet aus
- von Adam Entous -
Washington, 15. Jul (Reuters) - In den USA dürfte das
Haushaltsdefizit in diesem Jahr wohl auf eine Rekordsumme von
fast einer halben Billion Dollar anschwellen und damit noch
stärker steigen als bislang von der Regierung prognostiziert.
Stabsmitarbeiter des Kongresses sprachen von einem
geschätzten Defizit für das Fiskaljahr 2003 von rund 450
Milliarden Dollar und ähnliche Zahlen für 2004. Erstmals sind in
den Schätzungen auch die Anfangskosten des Irak-Krieges
enthalten. Das US-Präsidialamt, dessen Schätzung für das Defizit
noch für Dienstag erwartet wurde, nahm zu dem Bericht des
Budgetamts (OMB) nicht Stellung.
Das bislang höchste US-Defizit von 290 Milliarden Dollar
wurde 1992 in der Regierungszeit von Präsident George Bush
vorgelegt - dem Vater des jetzigen Präsidenten George W. Bush.
Die oppositionellen Demokraten sprachen von einem Defizit,
das die Ausmaße einer Katastrophe annehme und machten dafür auch
Steuerkürzungen der Bush-Regierung verantwortlich. Dagegen hat
das US-Präsidialamt erklärt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt
handle es sich nicht um eine Rekordsumme. Zudem wiesen Sprecher
darauf hin, dass die Ausgaben für die Verteidigung des Landes
nach den Anschlägen am 11. September 2001 wichtig seien. "Was
kostet ein Land, das angegriffen wird?" fragte
Präsidialamtssprecher Ari Fleischer. "Welchen Preis würde das
amerikanische Volk zahlen, wenn so etwas jemals wieder geschehen
sollte?"
Außerhalb der Hauptstadt Washington ist das Haushaltsdefizit
in der amerikanischen Öffentlichkeit bislang kein großes Thema.
Experten gehen davon aus, dass sich dies vor der Präsidentenwahl
2004 ändern dürfte. Die Kriegshandlungen in Afghanistan und Irak
kosteten mit etwa 4,8 Milliarden Dollar im Monat deutlich mehr
als erwartet. Zwischen 1998 und 2001 hatten die USA
Haushaltsüberschüsse verzeichnet.
sws/bek
------
Wann wurde Amerika vom Ausland angegriffen
USA-Haushaltsdefizit fällt wohl noch höher als erwartet aus
- von Adam Entous -
Washington, 15. Jul (Reuters) - In den USA dürfte das
Haushaltsdefizit in diesem Jahr wohl auf eine Rekordsumme von
fast einer halben Billion Dollar anschwellen und damit noch
stärker steigen als bislang von der Regierung prognostiziert.
Stabsmitarbeiter des Kongresses sprachen von einem
geschätzten Defizit für das Fiskaljahr 2003 von rund 450
Milliarden Dollar und ähnliche Zahlen für 2004. Erstmals sind in
den Schätzungen auch die Anfangskosten des Irak-Krieges
enthalten. Das US-Präsidialamt, dessen Schätzung für das Defizit
noch für Dienstag erwartet wurde, nahm zu dem Bericht des
Budgetamts (OMB) nicht Stellung.
Das bislang höchste US-Defizit von 290 Milliarden Dollar
wurde 1992 in der Regierungszeit von Präsident George Bush
vorgelegt - dem Vater des jetzigen Präsidenten George W. Bush.
Die oppositionellen Demokraten sprachen von einem Defizit,
das die Ausmaße einer Katastrophe annehme und machten dafür auch
Steuerkürzungen der Bush-Regierung verantwortlich. Dagegen hat
das US-Präsidialamt erklärt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt
handle es sich nicht um eine Rekordsumme. Zudem wiesen Sprecher
darauf hin, dass die Ausgaben für die Verteidigung des Landes
nach den Anschlägen am 11. September 2001 wichtig seien. "Was
kostet ein Land, das angegriffen wird?" fragte
Präsidialamtssprecher Ari Fleischer. "Welchen Preis würde das
amerikanische Volk zahlen, wenn so etwas jemals wieder geschehen
sollte?"
Außerhalb der Hauptstadt Washington ist das Haushaltsdefizit
in der amerikanischen Öffentlichkeit bislang kein großes Thema.
Experten gehen davon aus, dass sich dies vor der Präsidentenwahl
2004 ändern dürfte. Die Kriegshandlungen in Afghanistan und Irak
kosteten mit etwa 4,8 Milliarden Dollar im Monat deutlich mehr
als erwartet. Zwischen 1998 und 2001 hatten die USA
Haushaltsüberschüsse verzeichnet.
sws/bek
------
Wann wurde Amerika vom Ausland angegriffen

Deutschland macht sich Sorge ab der PISA-Studie. Aber weshalb denn, ist nur im Trend  .....
.....
Low rating for teachers
Nearly half called not highly qualified
By Ben Feller, Associated Press, 7/16/2003
ASHINGTON - Nearly half of the nation`s middle and high school teachers were not highly qualified to teach their topics in 2000, a report to Congress says.
Federal law defines highly qualified teachers as those who have a bachelor`s degree from a four-year college, have state certification, and demonstrate competence in the subject they teach.
The 2002 law requires that by the school year beginning in 2005, there must be highly qualified teachers in every class for core subjects - including English, math, science, and history.
Meeting that deadline is ``going to be challenging. It`s going to be tough,`` education secretary Rod Paige said yesterday. ``But it`s necessary, and it`s going to be done.``
Department officials used the federal definition as a guide in their report to assess teacher qualifications from the 1999-2000 school year.
Only 54 percent of secondary teachers were highly qualified, the report said. Other figures ranged from 47 percent for math teachers to 55 percent for science and social studies teachers.
Paige said his department will develop a ``tool kit`` of information to clarify what`s required under No Child Left Behind, the reform of elementary and secondary education that President Bush signed in 2002.
He said teams of educators and researchers also will visit states and provide help as requested by local officials.
The law aims to raise the academic standards of teachers - newcomers and veterans - and to make it easier for people with expertise in given fields to become teachers.
Making sure the teacher-quality changes work is the next big push for federal education officials. At a briefing, they defended the 18-month-old law, sensitive to claims that schools face unrealistic demands and good teachers will be forced out.
The country`s largest teachers` union, the National Education Association, plans to sue over the law. The union claims the federal government broke a promise to states that they won`t have to pay for any required changes, such as expanded student testing.
Paige told reporters that the law is sufficiently paid for, and that the union view does not reflect those of many teachers. He said his agency would try to reach out to the NEA, and that he believed the union`s position would change over time.
``Are we going to be deterred because they`re making noise like that?`` Paige said. ``You can believe that we are not.``
This story ran on page A2 of the Boston Globe on 7/16/2003.
http://www.boston.com/dailyglobe2/197/nation/Low_rating_for_…
Mitbekommen, die Kosten für Verbesserungen fallen auf die einzelnen Bundesstaaten. Die werden sich sicherlich höchst erfreut zeigen .....
.....
syr
 .....
.....Low rating for teachers
Nearly half called not highly qualified
By Ben Feller, Associated Press, 7/16/2003
ASHINGTON - Nearly half of the nation`s middle and high school teachers were not highly qualified to teach their topics in 2000, a report to Congress says.
Federal law defines highly qualified teachers as those who have a bachelor`s degree from a four-year college, have state certification, and demonstrate competence in the subject they teach.
The 2002 law requires that by the school year beginning in 2005, there must be highly qualified teachers in every class for core subjects - including English, math, science, and history.
Meeting that deadline is ``going to be challenging. It`s going to be tough,`` education secretary Rod Paige said yesterday. ``But it`s necessary, and it`s going to be done.``
Department officials used the federal definition as a guide in their report to assess teacher qualifications from the 1999-2000 school year.
Only 54 percent of secondary teachers were highly qualified, the report said. Other figures ranged from 47 percent for math teachers to 55 percent for science and social studies teachers.
Paige said his department will develop a ``tool kit`` of information to clarify what`s required under No Child Left Behind, the reform of elementary and secondary education that President Bush signed in 2002.
He said teams of educators and researchers also will visit states and provide help as requested by local officials.
The law aims to raise the academic standards of teachers - newcomers and veterans - and to make it easier for people with expertise in given fields to become teachers.
Making sure the teacher-quality changes work is the next big push for federal education officials. At a briefing, they defended the 18-month-old law, sensitive to claims that schools face unrealistic demands and good teachers will be forced out.
The country`s largest teachers` union, the National Education Association, plans to sue over the law. The union claims the federal government broke a promise to states that they won`t have to pay for any required changes, such as expanded student testing.
Paige told reporters that the law is sufficiently paid for, and that the union view does not reflect those of many teachers. He said his agency would try to reach out to the NEA, and that he believed the union`s position would change over time.
``Are we going to be deterred because they`re making noise like that?`` Paige said. ``You can believe that we are not.``
This story ran on page A2 of the Boston Globe on 7/16/2003.
http://www.boston.com/dailyglobe2/197/nation/Low_rating_for_…
Mitbekommen, die Kosten für Verbesserungen fallen auf die einzelnen Bundesstaaten. Die werden sich sicherlich höchst erfreut zeigen
 .....
.....syr
US/Snow: BIP wächst im 2. Hj um mehr als drei Prozent
London (vwd) - US-Finanzminister John Snow hat sich optimistisch zur Entwicklung der US-Volkswirtwschaft in den kommenden Monaten geäußert. Im zweiten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um rund zwei Prozent gestiegen sein, für das dritte Quartal sei mit einem Wachstum von drei Prozent zu rechnen, und im vierten Quartal dürfte das BIP noch schneller wachsen, sagte Snow am Mittwoch vor Journalisten in London. Fragen zum aktuellen Kurs des US-Dollar beantwortete der US-Finanzminister nicht.
Generell sollte man die Kursfindung den Märkten überlassen, weil dies ein Höchstmaß an Effizienz sichere, sagte Snow. Explizit auf Devisenmarktinterventionen angesprochen sagte er, diese sollten auf ein Minimum beschränkt bleiben. Er fügte aber hinzu: "Man sollte niemals `nie` sagen."
vwd/DJ/16.7.2003/hab/ptr
------------------------------------
das sind die Marktwirtschaftskommunisten
London (vwd) - US-Finanzminister John Snow hat sich optimistisch zur Entwicklung der US-Volkswirtwschaft in den kommenden Monaten geäußert. Im zweiten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um rund zwei Prozent gestiegen sein, für das dritte Quartal sei mit einem Wachstum von drei Prozent zu rechnen, und im vierten Quartal dürfte das BIP noch schneller wachsen, sagte Snow am Mittwoch vor Journalisten in London. Fragen zum aktuellen Kurs des US-Dollar beantwortete der US-Finanzminister nicht.
Generell sollte man die Kursfindung den Märkten überlassen, weil dies ein Höchstmaß an Effizienz sichere, sagte Snow. Explizit auf Devisenmarktinterventionen angesprochen sagte er, diese sollten auf ein Minimum beschränkt bleiben. Er fügte aber hinzu: "Man sollte niemals `nie` sagen."
vwd/DJ/16.7.2003/hab/ptr
------------------------------------
das sind die Marktwirtschaftskommunisten
Ob Snow gleich wieder Schnee schaufeln gehen darf wenn Q2 mit 1-1.4% reinkommt? Das Handelsbilanzdefizit straft ihn schon jetzt Lügen  .... CSPB hat auf 1% zurückgenommen, aber Snowman ist ja Politiker
.... CSPB hat auf 1% zurückgenommen, aber Snowman ist ja Politiker  .......
.......
syr
 .... CSPB hat auf 1% zurückgenommen, aber Snowman ist ja Politiker
.... CSPB hat auf 1% zurückgenommen, aber Snowman ist ja Politiker  .......
.......syr
tach clone 

Bist Du "der" Dolby von Stock-channel.net (Germa-Thread?)
Wäre schade, wenn Du dort "gekündigt" hättest.
Gruß
Wäre schade, wenn Du dort "gekündigt" hättest.
Gruß
der bin ich. schnauze voll.
Dolby, what`s up @ SCN  ?
?
Aber der hier ist gut, dottore aus dem parsimony-forum nimmt Alan`s Worte auseinander.....
ZITAT
---------------------
Greenspan focussiert: Hypothekensätze, Immobilienblase - GREAT CRASH ahead?
[ Börse & Wirtschaft: Elliott-Wellen-Forum ]
Geschrieben von dottore am 16. Juli 2003 14:57:42:
Hi,
als wichtigste Passagen der Greenspan-Rede erscheinen mir die folgenden, jeweils kurz kommentiert:
"Overall, during the first half of 2003, the net worth of households is estimated to have risen 4-1/2
percent--somewhat faster than the rise in nominal disposable personal income. Only 15 percent of
that increase in wealth represented the accumulated personal saving of households.
[Von den 4,5 % Zuwachs beim net worth sind fast 4 % auf höhere Bewertungen, besonders bei Aktien und Häusern zu rechnen]
"Additions to
net worth have largely reflected capital gains both from financial investments and from home price
appreciation. Net additions to home equity, despite very large extractions, remained positive in the
first half.
[Diese "extractions" (Entnahmen) sind sehr interessant, siehe gleich]
"Significant balance-sheet restructuring in an environment of low interest rates has gone far beyond
that experienced in the past.
[Klartext: Die Bilanzen der Haushalte wurden umgeschichtet und die (noch nicht realisierten sowie realisierte) Gewinne, die aus niedrigeren Zinssätzen resultieren, letztlich "ausgeschüttet"]
"In large measure, this reflects changes in technology and mortgage
markets that have dramatically transformed accumulated home equity from a very illiquid asset into
one that is now an integral part of households` ongoing balance-sheet management and spending
decisions. This enhanced capacity doubtless added significant support to consumer markets during
the past three years as numerous shocks--a stock price fall, 9/11, and the Iraq war--pummeled
consumer sentiment.
[Die consumer markets wurden durch den Wechsel von illiquiden zu liquiden assets getrieben, heißt: aus illiquiden wurden liquide und diese wiederum wurden in den Konsum gesteckt]
"Households have been able to extract home equity by drawing on home equity loan lines, by
realizing capital gains through the sale of existing homes, and by extracting cash as part of the
refinancing of existing mortgages, so-called cash-outs.
[Der Dreiklang: Man zieht auf noch offene Hauskreditlinien, verkauft Häuser, was die Cash-Position stärkt, und man stellt die Finanzierung um, was bedeutet: die Zinslasten sind jetzt geringer und das so "eingesparte" Geld kann in den Konsum wandern]
"Although all three of these vehicles have
been employed extensively by homeowners in recent years, home turnover has accounted for
most equity extraction.
[Interessant, dass es sich vornehmlich um realisierte Gewinne von Hauseigentümern handelt, die mit der Differenz jetzt shoppen gehen können, was zwei Fragen aufwirft: Wie finanzieren sie das nächste Haus bzw. wie finanzieren die neuen Käufer der alten Häuser diese?]
"Since originations to purchase existing homes tend to be roughly twice as large as repayments of
the remaining balances on outstanding mortgages of home sellers, the very high levels of existing
home turnover have resulted in substantial equity extraction, largely realized capital gains. Indeed,
of the estimated net increase of $1.1 trillion in home mortgage debt during the past year and a half,
approximately half resulted from existing home turnover.
[Die 1,1 Billionen Zuwächse bei Hypotheken stammen zur Hälfte aus der Finanzierung durch die Käufer bereits bestehender Häuser, was eine der Fragen beantwortet]
"The huge wave of refinancings this year and last has been impressive. Owing chiefly to the decline
in mortgage rates to their lowest levels in more than three decades, estimated mortgage
refinancings net of cash-outs last year rose to a record high of more than $1.6 trillion.
[Jetzt wird`s spannend ("huge wave"). Die cash-outs, also de facto die Freilegung von buying power, die sich aufgrund der Möglichkeit der Umschuldung zu niedrigeren Sätzen ergeben hat, macht 1,6 Billionen aus. Dies ist allerdings ein Einmal-Effekt, da sich die cash-outs nur bei sinkenden Sätzen realisieren lassen. WAS passiert, wenn die Sätze wieder steigen sollten, kann sich jeder leicht ausmalen: Der cash-out-Effekt fällt mit einem Schlag weg.]
"With
mortgage rates declining further in recent months, the pace of refinancing surged even higher over
the first half of this year. Cash-outs also increased, but at a slowed pace.
[Da geht`s schon los. Noch nehmen die cash outs zu, aber langsamer, und sollten sich die Sätze in der anderen Richtung bewegen, müssen sie nach der Logik des cash outs schlagartig stoppen. Steigende Hypotheken-Zinssätze hätten einen immensen Hebel, wir reden hier von Billionen an dann nicht mehr erscheinender Kaufkraft. Ganz abgesehen davon, dass die Banken nach Auslauf der vereinbarten Zinsbindungen entsprechend höhere Sätze fordern müssten, womit dann ein cash in einsetzen würde.]
"Net of duplicate
refinancings, approximately half of the dollar value of outstanding regular mortgages has been
refinanced during the past year and a half.
[Die Hälfte der Kredite konnte also zinsgünstiger refinanziert werden! Was passiert, wenn diese Hälfte zinsteurer refinanziert werden muss?]
"Moreover, applications to refinance existing mortgages
jumped to record levels last month. Given that refinance applications lead originations by about
five weeks and that current mortgage rates remain significantly below those on existing mortgages,
refinance originations likely will remain at an elevated level well into the current quarter.
[Dieser "jump" geht bei steigenden Sätzen automatisch in die andere Richtung]
"We expect both equity extraction and lower debt service to continue to provide support for
household spending in the period ahead, though the strength of this support is likely to diminish
over time.
[Dies erklärt vermutlich, warum Greenspan einen so großen Wert darauf gelegt hat, dass die Sätze "auf lange (oder längere) Zeit" unten bleiben sollen. Nur laufen diese Cash-Generatoren über kurz oder lang automatisch aus, auch wenn die Sätze unten bleiben]
"In recent quarters, low mortgage rates have carried new home sales and construction to
elevated levels. Sales of new single-family homes through the first five months of this year are well
ahead of last year`s record pace. And declines in financing rates on new auto loans to the lowest
levels in many years have spurred purchases of new motor vehicles.
[Hier geht es um die Neubauten bzw. Neukäufe, bei denen sich der Effekt offenbar nicht so stark gezeigt hat ("well ahead" und "have spurred")]
Mit anderen Worten: Die ganze Übung endet automatisch in sich selbst. Zum einen, nachdem alle sie absolviert haben und die Sätze nicht weiter sinken. Zum anderen - und das unbezweifelbar schlagartig - sobald die Sätze wieder steigen sollten.
Der Schlüssel zum Verständnis der US-Konsumenten-Konjunktur, die ihrerseits die Hauptstütze der gesamten Weltwirtschaft ist, liegt also in der Entwicklung der Zinssätze. Sollte sich die an den sog. "Finanzmärkten" soeben beobachtete "Wende" (siehe Kurseinbruch an den Rentenmärkten) als tatsächliche Trendumkehr erweisen und auf die Hypo-Sätze durchschlagen, fehlt innerhalb kürzester Zeit jede Menge "Geld", um die Blase weiter aufzupumpen.
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, gestehe aber freimütig, dass ich die Lage für äußerst brisant halte. Das ist genau der Stoff, aus dem der Große Crash geschneidert wird. The stage is set.
Gruß!
---------------------
http://www.f17.parsimony.net/forum30434/messages/205559.htm
Falls N10k mal mitliest, sollte man wohl dottores "Lebenslauf" erwähnen, ist immerhin nicht nur ein Inet-Doktor und dazu noch Dozent an der HSG St. Gallen, einer der renomiertesten Wirtschaftsuni weltweit (unter TopTen seit Jahren).....
syr
 ?
?Aber der hier ist gut, dottore aus dem parsimony-forum nimmt Alan`s Worte auseinander.....
ZITAT
---------------------
Greenspan focussiert: Hypothekensätze, Immobilienblase - GREAT CRASH ahead?
[ Börse & Wirtschaft: Elliott-Wellen-Forum ]
Geschrieben von dottore am 16. Juli 2003 14:57:42:
Hi,
als wichtigste Passagen der Greenspan-Rede erscheinen mir die folgenden, jeweils kurz kommentiert:
"Overall, during the first half of 2003, the net worth of households is estimated to have risen 4-1/2
percent--somewhat faster than the rise in nominal disposable personal income. Only 15 percent of
that increase in wealth represented the accumulated personal saving of households.
[Von den 4,5 % Zuwachs beim net worth sind fast 4 % auf höhere Bewertungen, besonders bei Aktien und Häusern zu rechnen]
"Additions to
net worth have largely reflected capital gains both from financial investments and from home price
appreciation. Net additions to home equity, despite very large extractions, remained positive in the
first half.
[Diese "extractions" (Entnahmen) sind sehr interessant, siehe gleich]
"Significant balance-sheet restructuring in an environment of low interest rates has gone far beyond
that experienced in the past.
[Klartext: Die Bilanzen der Haushalte wurden umgeschichtet und die (noch nicht realisierten sowie realisierte) Gewinne, die aus niedrigeren Zinssätzen resultieren, letztlich "ausgeschüttet"]
"In large measure, this reflects changes in technology and mortgage
markets that have dramatically transformed accumulated home equity from a very illiquid asset into
one that is now an integral part of households` ongoing balance-sheet management and spending
decisions. This enhanced capacity doubtless added significant support to consumer markets during
the past three years as numerous shocks--a stock price fall, 9/11, and the Iraq war--pummeled
consumer sentiment.
[Die consumer markets wurden durch den Wechsel von illiquiden zu liquiden assets getrieben, heißt: aus illiquiden wurden liquide und diese wiederum wurden in den Konsum gesteckt]
"Households have been able to extract home equity by drawing on home equity loan lines, by
realizing capital gains through the sale of existing homes, and by extracting cash as part of the
refinancing of existing mortgages, so-called cash-outs.
[Der Dreiklang: Man zieht auf noch offene Hauskreditlinien, verkauft Häuser, was die Cash-Position stärkt, und man stellt die Finanzierung um, was bedeutet: die Zinslasten sind jetzt geringer und das so "eingesparte" Geld kann in den Konsum wandern]
"Although all three of these vehicles have
been employed extensively by homeowners in recent years, home turnover has accounted for
most equity extraction.
[Interessant, dass es sich vornehmlich um realisierte Gewinne von Hauseigentümern handelt, die mit der Differenz jetzt shoppen gehen können, was zwei Fragen aufwirft: Wie finanzieren sie das nächste Haus bzw. wie finanzieren die neuen Käufer der alten Häuser diese?]
"Since originations to purchase existing homes tend to be roughly twice as large as repayments of
the remaining balances on outstanding mortgages of home sellers, the very high levels of existing
home turnover have resulted in substantial equity extraction, largely realized capital gains. Indeed,
of the estimated net increase of $1.1 trillion in home mortgage debt during the past year and a half,
approximately half resulted from existing home turnover.
[Die 1,1 Billionen Zuwächse bei Hypotheken stammen zur Hälfte aus der Finanzierung durch die Käufer bereits bestehender Häuser, was eine der Fragen beantwortet]
"The huge wave of refinancings this year and last has been impressive. Owing chiefly to the decline
in mortgage rates to their lowest levels in more than three decades, estimated mortgage
refinancings net of cash-outs last year rose to a record high of more than $1.6 trillion.
[Jetzt wird`s spannend ("huge wave"). Die cash-outs, also de facto die Freilegung von buying power, die sich aufgrund der Möglichkeit der Umschuldung zu niedrigeren Sätzen ergeben hat, macht 1,6 Billionen aus. Dies ist allerdings ein Einmal-Effekt, da sich die cash-outs nur bei sinkenden Sätzen realisieren lassen. WAS passiert, wenn die Sätze wieder steigen sollten, kann sich jeder leicht ausmalen: Der cash-out-Effekt fällt mit einem Schlag weg.]
"With
mortgage rates declining further in recent months, the pace of refinancing surged even higher over
the first half of this year. Cash-outs also increased, but at a slowed pace.
[Da geht`s schon los. Noch nehmen die cash outs zu, aber langsamer, und sollten sich die Sätze in der anderen Richtung bewegen, müssen sie nach der Logik des cash outs schlagartig stoppen. Steigende Hypotheken-Zinssätze hätten einen immensen Hebel, wir reden hier von Billionen an dann nicht mehr erscheinender Kaufkraft. Ganz abgesehen davon, dass die Banken nach Auslauf der vereinbarten Zinsbindungen entsprechend höhere Sätze fordern müssten, womit dann ein cash in einsetzen würde.]
"Net of duplicate
refinancings, approximately half of the dollar value of outstanding regular mortgages has been
refinanced during the past year and a half.
[Die Hälfte der Kredite konnte also zinsgünstiger refinanziert werden! Was passiert, wenn diese Hälfte zinsteurer refinanziert werden muss?]
"Moreover, applications to refinance existing mortgages
jumped to record levels last month. Given that refinance applications lead originations by about
five weeks and that current mortgage rates remain significantly below those on existing mortgages,
refinance originations likely will remain at an elevated level well into the current quarter.
[Dieser "jump" geht bei steigenden Sätzen automatisch in die andere Richtung]
"We expect both equity extraction and lower debt service to continue to provide support for
household spending in the period ahead, though the strength of this support is likely to diminish
over time.
[Dies erklärt vermutlich, warum Greenspan einen so großen Wert darauf gelegt hat, dass die Sätze "auf lange (oder längere) Zeit" unten bleiben sollen. Nur laufen diese Cash-Generatoren über kurz oder lang automatisch aus, auch wenn die Sätze unten bleiben]
"In recent quarters, low mortgage rates have carried new home sales and construction to
elevated levels. Sales of new single-family homes through the first five months of this year are well
ahead of last year`s record pace. And declines in financing rates on new auto loans to the lowest
levels in many years have spurred purchases of new motor vehicles.
[Hier geht es um die Neubauten bzw. Neukäufe, bei denen sich der Effekt offenbar nicht so stark gezeigt hat ("well ahead" und "have spurred")]
Mit anderen Worten: Die ganze Übung endet automatisch in sich selbst. Zum einen, nachdem alle sie absolviert haben und die Sätze nicht weiter sinken. Zum anderen - und das unbezweifelbar schlagartig - sobald die Sätze wieder steigen sollten.
Der Schlüssel zum Verständnis der US-Konsumenten-Konjunktur, die ihrerseits die Hauptstütze der gesamten Weltwirtschaft ist, liegt also in der Entwicklung der Zinssätze. Sollte sich die an den sog. "Finanzmärkten" soeben beobachtete "Wende" (siehe Kurseinbruch an den Rentenmärkten) als tatsächliche Trendumkehr erweisen und auf die Hypo-Sätze durchschlagen, fehlt innerhalb kürzester Zeit jede Menge "Geld", um die Blase weiter aufzupumpen.
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, gestehe aber freimütig, dass ich die Lage für äußerst brisant halte. Das ist genau der Stoff, aus dem der Große Crash geschneidert wird. The stage is set.
Gruß!
---------------------
http://www.f17.parsimony.net/forum30434/messages/205559.htm
Falls N10k mal mitliest, sollte man wohl dottores "Lebenslauf" erwähnen, ist immerhin nicht nur ein Inet-Doktor und dazu noch Dozent an der HSG St. Gallen, einer der renomiertesten Wirtschaftsuni weltweit (unter TopTen seit Jahren).....
syr

Hi Dolby hat PM
----------------------------------------------------
16.07. 15:26
US: Industrieproduktion steigt
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Die Industrieproduktion in den USA stieg im Juni um 0.1% (Prognose: 0.2%). Die Produktion in der herstellenden Industrie stieg um 0.4%, das ist der höchste Anstieg seit den 0.5% aus dem Januar. Die Kapazitätsausnutzung lag bei 74.3% (Prognose: 74.4%), was auf große stillstehende Produktionsstätten in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeutet.
(Prognose: 0.2%). Die Produktion in der herstellenden Industrie stieg um 0.4%, das ist der höchste Anstieg seit den 0.5% aus dem Januar. Die Kapazitätsausnutzung lag bei 74.3% (Prognose: 74.4%), was auf große stillstehende Produktionsstätten in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeutet.
------------------------------------
0,1


----------------------------------------------------
16.07. 15:26
US: Industrieproduktion steigt
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Die Industrieproduktion in den USA stieg im Juni um 0.1%
 (Prognose: 0.2%). Die Produktion in der herstellenden Industrie stieg um 0.4%, das ist der höchste Anstieg seit den 0.5% aus dem Januar. Die Kapazitätsausnutzung lag bei 74.3% (Prognose: 74.4%), was auf große stillstehende Produktionsstätten in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeutet.
(Prognose: 0.2%). Die Produktion in der herstellenden Industrie stieg um 0.4%, das ist der höchste Anstieg seit den 0.5% aus dem Januar. Die Kapazitätsausnutzung lag bei 74.3% (Prognose: 74.4%), was auf große stillstehende Produktionsstätten in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeutet. ------------------------------------
0,1


syr
genug ist genug

aber widmen wir uns wichtigern Dingen:
US/Realeinkommen Juni unverändert gegenüber Vormonat
Washington (vwd) - Die Realeinkommen in den USA haben im Juni saisonbereinigt auf dem Niveau des Vormonats stagniert. Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, war im Mai ein Anstieg um 0,5 Prozent zu verzeichnen gewesen. Damit bestätigte die Behörde ihre vorläufigen Angaben. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug laut US-Arbeitsministerium im Juni saison- und inflationsbereinigt 279,87 USD nach revidiert 279,92 (vorläufig: 279,74) USD im Vormonat.
vwd/DJ/16.7.2003/jej
------
Wahnsinn
genug ist genug


aber widmen wir uns wichtigern Dingen:
US/Realeinkommen Juni unverändert gegenüber Vormonat
Washington (vwd) - Die Realeinkommen in den USA haben im Juni saisonbereinigt auf dem Niveau des Vormonats stagniert. Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, war im Mai ein Anstieg um 0,5 Prozent zu verzeichnen gewesen. Damit bestätigte die Behörde ihre vorläufigen Angaben. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug laut US-Arbeitsministerium im Juni saison- und inflationsbereinigt 279,87 USD nach revidiert 279,92 (vorläufig: 279,74) USD im Vormonat.
vwd/DJ/16.7.2003/jej
------
Wahnsinn

# 385
gute und interessante Analyse !
mehr davon.

gute und interessante Analyse !
mehr davon.

http://www.aktiencheck.de/analysen/default_an.asp?sub=6&page…
16.07.2003
US-Industrieproduktion wie erwartet
Mit einem Anstieg von 0,1% gegenüber dem Vormonat traf die Industrieproduktion im Juni genau die Markterwartungen, so die Analysten der Erste Bank.
Besonders stark habe die Autoproduktion zulegen können, die um 1,2% gewachsen sei. Ebenfalls zulegen können hätten die Konsumgüter, die Luft- und Rüstungsindustrie sowie Investitionsgüter. Rückläufig seien Baumaterialien sowie die Zulieferindustrie gewesen.
Insgesamt habe sich das Bild bestätigt, dass sich der verarbeitende Bereich zwar erhole, allerdings nur schleppend, die Zahlen würden keine neuen Entwicklungen zeigen. Der Markt werde daher aus dem heraus keine neue Richtung erhalten. Vielmehr sollten Umschichtungen nach der gestrigen Greenspan Rede weiterhin marktbestimmend sein.
--------
Für eine richtungslose, schleppend laufende Wirtschaft sind die aber verdammig hoch bewertet.
16.07.2003
US-Industrieproduktion wie erwartet
Mit einem Anstieg von 0,1% gegenüber dem Vormonat traf die Industrieproduktion im Juni genau die Markterwartungen, so die Analysten der Erste Bank.
Besonders stark habe die Autoproduktion zulegen können, die um 1,2% gewachsen sei. Ebenfalls zulegen können hätten die Konsumgüter, die Luft- und Rüstungsindustrie sowie Investitionsgüter. Rückläufig seien Baumaterialien sowie die Zulieferindustrie gewesen.
Insgesamt habe sich das Bild bestätigt, dass sich der verarbeitende Bereich zwar erhole, allerdings nur schleppend, die Zahlen würden keine neuen Entwicklungen zeigen. Der Markt werde daher aus dem heraus keine neue Richtung erhalten. Vielmehr sollten Umschichtungen nach der gestrigen Greenspan Rede weiterhin marktbestimmend sein.
--------
Für eine richtungslose, schleppend laufende Wirtschaft sind die aber verdammig hoch bewertet.

#388 von Ayrtonw
joo, der syr schleppt immer die besten Artikel ran.
muss ich auch zugeben.
joo, der syr schleppt immer die besten Artikel ran.
muss ich auch zugeben.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,257436,00.html
DOKUMENTATION
Was Bush und Blair über irakische A-, B-, C-Waffen gesagt haben
Irakische Massenvernichtungswaffen waren das Argument von US-Präsident Bush und Großbritanniens Premier Blair für den Irak-Krieg. Bislang wurde nichts dergleichen gefunden. Als falsch erwiesen sich von beiden vorgetragene Erkenntnisse über versuchte irakische Uranimporte aus Afrika. Hier die wichtigsten Zitate:
Tony Blair (24. September 2002): "Der Irak hat chemische und biologische Waffen ... Saddam hat. . militärische Planungen für den Einsatz chemischer und biologischer Waffen, die innerhalb von 45 Minuten aktiviert werden können ... Er ist dabei, sich nukleare Fähigkeiten zu beschaffen."
George W. Bush (26. September 2002): "Das irakische Regime besitzt biologische und chemische Waffen. Das irakische Regime baut die für die Produktion von mehr biologischen und chemischen Waffen notwendigen Anlagen aus. Jeder verstreichende Tage könnte der sein, an dem das irakische Regime Anthrax oder VX - Nervengas - oder eines Tages eine Nuklearwaffe an einen terroristischen Verbündeten gibt."
Bush (28. Januar 2003): "Die britische Regierung hat erfahren, dass Saddam Hussein kürzlich in Afrika nach größeren Mengen Uran gesucht hat."
Blair (23. Februar): "Die Erkenntnisse sind klar: (Saddam) glaubt weiterhin, sein Waffenprogramm ist nützlich für Repression im Innern und Aggression nach außen." Und: "..wir glauben, dass der Irak (die biologischen Gifte) Anthrax, Botulinum, Toxin, Aflotoxin und Ricin produzieren kann."
Blair (6. März): "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird er (Saddam) fortfahren, diese Waffen zu entwickeln ... gefährliche Waffen, besonders wenn sie in die Hände von Terroristen fallen."
Bush (17. März): "Nachrichtendienstliche Erkenntnisse unserer und anderer Regierungen lassen keinen Zweifel, dass das irakische Regime einige der tödlichsten Waffen, die je erfunden wurden, weiterhin besitzt und versteckt."
Blair (20. März): Die britischen Streitkräfte hätten den "Auftrag, Saddam zu entmachten und dem Irak seine Massenvernichtungswaffen zu nehmen..... Der Verbleib großer Bestände an chemischen und biologischen Giften. ....(ist) weiterhin ungeklärt".
Blair (14. April): "Saddam hat sechs Monate vor der Rückkehr der Uno-Inspekteure eine groß angelegte Aktion zur Verbergung von Massenvernichtungswaffen gestartet."
Bush (10. Juni): "Der Irak hatte ein Waffenprogramm. Geheimdienst-Erkenntnisse über das letzte Jahrzehnt haben gezeigt, dass sie ein Waffenprogramm hatten."
Blair (8. Juli): "Ich habe absolut keinen Zweifel, dass wir Beweise für Programme zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen finden werden." Nicht nur Programme, sondern auch Produkte dieser Programme werde man finden, betont ein Sprecher Blairs zwei Tage später.
------
Die Welt liebt es verarscht zu werden. Da steht man gern machtlos daneben, als das Maul aufzumachen.
DOKUMENTATION
Was Bush und Blair über irakische A-, B-, C-Waffen gesagt haben
Irakische Massenvernichtungswaffen waren das Argument von US-Präsident Bush und Großbritanniens Premier Blair für den Irak-Krieg. Bislang wurde nichts dergleichen gefunden. Als falsch erwiesen sich von beiden vorgetragene Erkenntnisse über versuchte irakische Uranimporte aus Afrika. Hier die wichtigsten Zitate:
Tony Blair (24. September 2002): "Der Irak hat chemische und biologische Waffen ... Saddam hat. . militärische Planungen für den Einsatz chemischer und biologischer Waffen, die innerhalb von 45 Minuten aktiviert werden können ... Er ist dabei, sich nukleare Fähigkeiten zu beschaffen."
George W. Bush (26. September 2002): "Das irakische Regime besitzt biologische und chemische Waffen. Das irakische Regime baut die für die Produktion von mehr biologischen und chemischen Waffen notwendigen Anlagen aus. Jeder verstreichende Tage könnte der sein, an dem das irakische Regime Anthrax oder VX - Nervengas - oder eines Tages eine Nuklearwaffe an einen terroristischen Verbündeten gibt."
Bush (28. Januar 2003): "Die britische Regierung hat erfahren, dass Saddam Hussein kürzlich in Afrika nach größeren Mengen Uran gesucht hat."
Blair (23. Februar): "Die Erkenntnisse sind klar: (Saddam) glaubt weiterhin, sein Waffenprogramm ist nützlich für Repression im Innern und Aggression nach außen." Und: "..wir glauben, dass der Irak (die biologischen Gifte) Anthrax, Botulinum, Toxin, Aflotoxin und Ricin produzieren kann."
Blair (6. März): "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird er (Saddam) fortfahren, diese Waffen zu entwickeln ... gefährliche Waffen, besonders wenn sie in die Hände von Terroristen fallen."
Bush (17. März): "Nachrichtendienstliche Erkenntnisse unserer und anderer Regierungen lassen keinen Zweifel, dass das irakische Regime einige der tödlichsten Waffen, die je erfunden wurden, weiterhin besitzt und versteckt."
Blair (20. März): Die britischen Streitkräfte hätten den "Auftrag, Saddam zu entmachten und dem Irak seine Massenvernichtungswaffen zu nehmen..... Der Verbleib großer Bestände an chemischen und biologischen Giften. ....(ist) weiterhin ungeklärt".
Blair (14. April): "Saddam hat sechs Monate vor der Rückkehr der Uno-Inspekteure eine groß angelegte Aktion zur Verbergung von Massenvernichtungswaffen gestartet."
Bush (10. Juni): "Der Irak hatte ein Waffenprogramm. Geheimdienst-Erkenntnisse über das letzte Jahrzehnt haben gezeigt, dass sie ein Waffenprogramm hatten."
Blair (8. Juli): "Ich habe absolut keinen Zweifel, dass wir Beweise für Programme zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen finden werden." Nicht nur Programme, sondern auch Produkte dieser Programme werde man finden, betont ein Sprecher Blairs zwei Tage später.
------
Die Welt liebt es verarscht zu werden. Da steht man gern machtlos daneben, als das Maul aufzumachen.
und wieder ein Soldat im Irak, aber wofür nur, für den Profit einiger weniger 



Danke für`s Kompliment Dolby , kann ich aber nur zurückgeben: Du mit Texten auf Deutsch, bei mir halt (meist) in Enlisch
, kann ich aber nur zurückgeben: Du mit Texten auf Deutsch, bei mir halt (meist) in Enlisch  .
.
Den hier finde ich nicht sooo gut. Aber es läuft wohl unter "Vorbereitung Ablauf Wahljahr 2004/USA im Fall weiterer Konjunkturschwäche" ......
......
washingtonpost.com
U.S., N. Korea Drifting Toward War, Perry Warns
Former Defense Secretary Says Standoff Increases Risk of Terrorists Obtaining Nuclear Device
By Thomas E. Ricks and Glenn Kessler
Washington Post Staff Writers
Tuesday, July 15, 2003; Page A14
Former defense secretary William Perry warned that the United States and North Korea are drifting toward war, perhaps as early as this year, in an increasingly dangerous standoff that also could result in terrorists being able to purchase a North Korean nuclear device and plant it in a U.S. city.
"I think we are losing control" of the situation, said Perry, who believes North Korea soon will have enough nuclear warheads to begin exploding them in tests and exporting them to terrorists and other U.S. adversaries. "The nuclear program now underway in North Korea poses an imminent danger of nuclear weapons being detonated in American cities," he said in an interview.
Perry added that he reached his conclusions after extensive conversations with senior Bush administration officials, South Korean President Roh Moo Hyun and senior officials in China.
After weeks of debate, President Bush and his senior foreign policy advisers this week are expected to meet to resolve the administration`s next step in the crisis over North Korea`s nuclear programs. Officials have discussed how sharply to ratchet up the pressure, and how to react to a series of possible North Korean provocations, including nuclear tests.
Perry is the most prominent member of a growing number of national security experts and Korea specialists who are expressing deep concern about the direction of U.S. policy toward Pyongyang. As President Bill Clinton`s defense secretary, he oversaw preparation for airstrikes on North Korean nuclear facilities in 1994, an attack that was never carried out. He has remained deeply involved in Korean policy issues and is widely respected in national security circles, especially among senior military officers. They credit him with playing a key role in developing the U.S. high-tech arsenal of cruise missiles and stealth aircraft and also with righting the Pentagon after the short, turbulent term of Les Aspin, Clinton`s first defense chief.
Only last winter Perry publicly argued that the North Korea problem was controllable. Now, he said, he has grown to doubt that. "It was manageable six months ago if we did the right things," he said. "But we haven`t done the right things."
He added: "I have held off public criticism to this point because I had hoped that the administration was going to act on this problem, and that public criticism might be counterproductive. But time is running out, and each month the problem gets more dangerous."
Since the crisis over North Korea`s nuclear ambitions erupted last October, when officials in Pyongyang disclosed they had a secret program to enrich uranium, the Bush administration has sought to pressure the regime into giving up its nuclear programs without offering inducements or entering into negotiations. Administration officials -- who came into office highly skeptical of the Clinton administration`s 1994 deal that froze North Korea`s nuclear programs -- have sought to enlist Japan, South Korea and China to join in isolating North Korea, and have begun laying the groundwork for a maritime campaign to shut down North Korea`s narcotics and weapons smuggling operations.
North Korea has insisted on direct bilateral negotiations with Washington, although officials briefly participated in trilateral talks with China and the United States, and over the months it has taken increasingly provocative steps. It ousted international inspectors, restarted a shuttered nuclear facility and appears to have reprocessed at least a few hundred of 8,000 spent fuel rods that can provide plutonium for weapons. The spent fuel would give North Korea enough nuclear material to build two to three nuclear bombs within a few months, doubling the estimated size of its arsenal.
Last week, North Korean officials told the administration they had completed reprocessing all of the fuel rods -- an assertion that U.S. officials have not been able to confirm through available intelligence.
Officials at the Pentagon, State Department and White House declined to respond to Perry`s criticism on the record. But speaking anonymously, administration officials vehemently disagreed with his analysis, saying they have succeeded in building a multilateral consensus that North Korea`s nuclear program is unacceptable, leaving Pyongyang increasingly isolated.
The administration has no intention of rewarding North Korea for giving up its weapons, officials said, adding that the new effort to target North Korea`s illegal sources of revenue will only further weaken North Korea.
The administration policy toward North Korea, however, has been characterized by fierce disputes among senior policymakers, which officials privately acknowledge have hampered the administration`s response. "There is an ongoing search for consensus within the administration itself," said Nicholas Eberstadt of the American Enterprise Institute. "The lack of a consensus to a significant extent has prevented U.S. policy from unfolding."
In a two-hour interview in his office at Stanford University, Perry said that after conversations with several senior administration officials from different areas of the government, he is persuaded that the Korea policy is in disarray. Showing some emotion, the usually reserved Perry said at one point, "I`m damned if I can figure out what the policy is."
Nor, having had extensive contacts with Asian leaders, does Perry believe that the multilateral diplomatic approach is working. "I see no evidence of that," he said. "The diplomatic track, as nearly as I can discern, is inconsequential."
From his discussions, Perry has concluded the president simply won`t enter into genuine talks with Pyongyang`s Stalinist government. "My theory is the reason we don`t have a policy on this, and we aren`t negotiating, is the president himself," Perry said. "I think he has come to the conclusion that Kim Jong Il is evil and loathsome and it is immoral to negotiate with him."
The immediate cause of concern, Perry said, is that North Korea appears to have begun reprocessing the spent fuel rods. "I have thought for some months that if the North Koreans moved toward processing, then we are on a path toward war," he said.
Perry`s comments, while unusually blunt from a former senior policymaker, reflect an increasing consensus among other specialists that the administration, distracted by Iraq, has allowed the North Korean crisis to spiral out of control.
"I`m not sure where our policy is going," said retired Army Gen. Robert W. RisCassi, a former U.S. commander in Korea. But, he added, "I don`t know if I would be as doomsday as Bill Perry is at this juncture," in part, because he believes a diplomatic solution is still possible.
James M. Bodner, a former top policy official at the Clinton-era Pentagon, said that the Bush administration essentially has a policy of ignoring North Korea as much as possible. The trouble, he said, is that it doesn`t have time on its side, because North Korea`s moves are likely soon to begin altering the politics of East Asia in a way that undermines U.S. interests in the region.
Even some specialists who support Bush administration policy think the situation is moving toward confrontation. "I think it will be enormously significant" if North Korea tests a nuclear warhead this year, said Paul Bracken, a Yale University expert on Asian nuclear issues. "It`ll force the administration to take action -- surgical strikes, perhaps."
Eberstadt described the current situation as "sitzkrieg," saying neither side has made its most obvious move. In North Korea`s case, that would be detonating an underground nuclear device, he said, while for the United States it would be to organize an international program of maritime interdiction -- a kind of loose embargo -- to shut down dangerous North Korean exports, including missile sales.
Perry argued that an interdiction strategy "would be provocative, but it would not be effective" in preventing the sale of nuclear material. "You don`t need a ship to transport a core of plutonium that is smaller than a basketball," he said.
Rather than escalate in this way, Perry said, the administration should engage in "coercive diplomacy," which he explained as, "You have to offer something, but you have to have an iron fist behind your offer." He didn`t specify what should be offered, but others have suggested that North Korea would like economic aid, trade deals, diplomatic recognition or a nonaggression pact.
© 2003 The Washington Post Company
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A56019-2003Jul14?la…
Zuerst müssen die Meinungen "kanalisiert" werden, dann geht`s leichter von der Hand falls nötig .
.
syr
 , kann ich aber nur zurückgeben: Du mit Texten auf Deutsch, bei mir halt (meist) in Enlisch
, kann ich aber nur zurückgeben: Du mit Texten auf Deutsch, bei mir halt (meist) in Enlisch  .
.Den hier finde ich nicht sooo gut. Aber es läuft wohl unter "Vorbereitung Ablauf Wahljahr 2004/USA im Fall weiterer Konjunkturschwäche"
 ......
......washingtonpost.com
U.S., N. Korea Drifting Toward War, Perry Warns
Former Defense Secretary Says Standoff Increases Risk of Terrorists Obtaining Nuclear Device
By Thomas E. Ricks and Glenn Kessler
Washington Post Staff Writers
Tuesday, July 15, 2003; Page A14
Former defense secretary William Perry warned that the United States and North Korea are drifting toward war, perhaps as early as this year, in an increasingly dangerous standoff that also could result in terrorists being able to purchase a North Korean nuclear device and plant it in a U.S. city.
"I think we are losing control" of the situation, said Perry, who believes North Korea soon will have enough nuclear warheads to begin exploding them in tests and exporting them to terrorists and other U.S. adversaries. "The nuclear program now underway in North Korea poses an imminent danger of nuclear weapons being detonated in American cities," he said in an interview.
Perry added that he reached his conclusions after extensive conversations with senior Bush administration officials, South Korean President Roh Moo Hyun and senior officials in China.
After weeks of debate, President Bush and his senior foreign policy advisers this week are expected to meet to resolve the administration`s next step in the crisis over North Korea`s nuclear programs. Officials have discussed how sharply to ratchet up the pressure, and how to react to a series of possible North Korean provocations, including nuclear tests.
Perry is the most prominent member of a growing number of national security experts and Korea specialists who are expressing deep concern about the direction of U.S. policy toward Pyongyang. As President Bill Clinton`s defense secretary, he oversaw preparation for airstrikes on North Korean nuclear facilities in 1994, an attack that was never carried out. He has remained deeply involved in Korean policy issues and is widely respected in national security circles, especially among senior military officers. They credit him with playing a key role in developing the U.S. high-tech arsenal of cruise missiles and stealth aircraft and also with righting the Pentagon after the short, turbulent term of Les Aspin, Clinton`s first defense chief.
Only last winter Perry publicly argued that the North Korea problem was controllable. Now, he said, he has grown to doubt that. "It was manageable six months ago if we did the right things," he said. "But we haven`t done the right things."
He added: "I have held off public criticism to this point because I had hoped that the administration was going to act on this problem, and that public criticism might be counterproductive. But time is running out, and each month the problem gets more dangerous."
Since the crisis over North Korea`s nuclear ambitions erupted last October, when officials in Pyongyang disclosed they had a secret program to enrich uranium, the Bush administration has sought to pressure the regime into giving up its nuclear programs without offering inducements or entering into negotiations. Administration officials -- who came into office highly skeptical of the Clinton administration`s 1994 deal that froze North Korea`s nuclear programs -- have sought to enlist Japan, South Korea and China to join in isolating North Korea, and have begun laying the groundwork for a maritime campaign to shut down North Korea`s narcotics and weapons smuggling operations.
North Korea has insisted on direct bilateral negotiations with Washington, although officials briefly participated in trilateral talks with China and the United States, and over the months it has taken increasingly provocative steps. It ousted international inspectors, restarted a shuttered nuclear facility and appears to have reprocessed at least a few hundred of 8,000 spent fuel rods that can provide plutonium for weapons. The spent fuel would give North Korea enough nuclear material to build two to three nuclear bombs within a few months, doubling the estimated size of its arsenal.
Last week, North Korean officials told the administration they had completed reprocessing all of the fuel rods -- an assertion that U.S. officials have not been able to confirm through available intelligence.
Officials at the Pentagon, State Department and White House declined to respond to Perry`s criticism on the record. But speaking anonymously, administration officials vehemently disagreed with his analysis, saying they have succeeded in building a multilateral consensus that North Korea`s nuclear program is unacceptable, leaving Pyongyang increasingly isolated.
The administration has no intention of rewarding North Korea for giving up its weapons, officials said, adding that the new effort to target North Korea`s illegal sources of revenue will only further weaken North Korea.
The administration policy toward North Korea, however, has been characterized by fierce disputes among senior policymakers, which officials privately acknowledge have hampered the administration`s response. "There is an ongoing search for consensus within the administration itself," said Nicholas Eberstadt of the American Enterprise Institute. "The lack of a consensus to a significant extent has prevented U.S. policy from unfolding."
In a two-hour interview in his office at Stanford University, Perry said that after conversations with several senior administration officials from different areas of the government, he is persuaded that the Korea policy is in disarray. Showing some emotion, the usually reserved Perry said at one point, "I`m damned if I can figure out what the policy is."
Nor, having had extensive contacts with Asian leaders, does Perry believe that the multilateral diplomatic approach is working. "I see no evidence of that," he said. "The diplomatic track, as nearly as I can discern, is inconsequential."
From his discussions, Perry has concluded the president simply won`t enter into genuine talks with Pyongyang`s Stalinist government. "My theory is the reason we don`t have a policy on this, and we aren`t negotiating, is the president himself," Perry said. "I think he has come to the conclusion that Kim Jong Il is evil and loathsome and it is immoral to negotiate with him."
The immediate cause of concern, Perry said, is that North Korea appears to have begun reprocessing the spent fuel rods. "I have thought for some months that if the North Koreans moved toward processing, then we are on a path toward war," he said.
Perry`s comments, while unusually blunt from a former senior policymaker, reflect an increasing consensus among other specialists that the administration, distracted by Iraq, has allowed the North Korean crisis to spiral out of control.
"I`m not sure where our policy is going," said retired Army Gen. Robert W. RisCassi, a former U.S. commander in Korea. But, he added, "I don`t know if I would be as doomsday as Bill Perry is at this juncture," in part, because he believes a diplomatic solution is still possible.
James M. Bodner, a former top policy official at the Clinton-era Pentagon, said that the Bush administration essentially has a policy of ignoring North Korea as much as possible. The trouble, he said, is that it doesn`t have time on its side, because North Korea`s moves are likely soon to begin altering the politics of East Asia in a way that undermines U.S. interests in the region.
Even some specialists who support Bush administration policy think the situation is moving toward confrontation. "I think it will be enormously significant" if North Korea tests a nuclear warhead this year, said Paul Bracken, a Yale University expert on Asian nuclear issues. "It`ll force the administration to take action -- surgical strikes, perhaps."
Eberstadt described the current situation as "sitzkrieg," saying neither side has made its most obvious move. In North Korea`s case, that would be detonating an underground nuclear device, he said, while for the United States it would be to organize an international program of maritime interdiction -- a kind of loose embargo -- to shut down dangerous North Korean exports, including missile sales.
Perry argued that an interdiction strategy "would be provocative, but it would not be effective" in preventing the sale of nuclear material. "You don`t need a ship to transport a core of plutonium that is smaller than a basketball," he said.
Rather than escalate in this way, Perry said, the administration should engage in "coercive diplomacy," which he explained as, "You have to offer something, but you have to have an iron fist behind your offer." He didn`t specify what should be offered, but others have suggested that North Korea would like economic aid, trade deals, diplomatic recognition or a nonaggression pact.
© 2003 The Washington Post Company
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A56019-2003Jul14?la…
Zuerst müssen die Meinungen "kanalisiert" werden, dann geht`s leichter von der Hand falls nötig
 .
.syr

englisch  da lese ich immer stunden lang
da lese ich immer stunden lang 

 da lese ich immer stunden lang
da lese ich immer stunden lang 

http://abcnews.go.com/wire/Business/ap20030716_959.html
Ford Posts $417 Million; Beats Forecast
Ford Posts Profit of $417 Million in Second-Quarter; Beats Wall Street Predictions
The Associated Press
DEARBORN, Mich. July 16 —
Ford Motor Co.`s profit fell nearly 27 percent in the second quarter but still beat Wall Street expectations as the automaker steps up its efforts to slash costs.
Before the market opened Wednesday, the world`s second-largest automaker said it earned $417 million, or 22 cents a share, in the April-June period versus a profit of $570 million, or 29 cents a share, a year earlier.
The consensus estimate on Wall Street was for earnings of 19 cents a share. The company reiterated its goal of earning 70 cents a share for the year, which would beat current estimates, despite saying it expects a wider loss than analysts anticipate for third quarter.
The automaker also boosted its cost-cutting goal to $2.5 billion for the year from its initial target of $500 million. It cut costs by $1.3 billion in the second quarter alone.
"We`re delighted with the progress we`ve been able to make on cost," said Allan Gilmour, the company`s vice chairman and chief financial officer. "I think it was not predictable then (a year ago) that we would see the acceleration that we`ve seen as this year has progressed."
But in morning trading on the New York Stock Exchange, Ford shares fell 59 cents, or 5.1 percent, to $11.05.
"Our second-quarter financial performance and our achievements in the past 18 months since we announced our revitalization plan demonstrate that we`re delivering the results that are needed to keep the company solidly on track," said chairman and chief executive Bill Ford Jr.
But lower vehicles sales and declining prices continue to hamper revenue.
Ford`s second-quarter revenue slipped to $40.7 billion from $42.2 billion a year ago. Worldwide vehicle sales were down 7 percent in the quarter, and total automotive profit was down $400 million from last year.
In North America, Ford`s profit fell to $445 million in the quarter from $921 million in the same period in 2002, again reflecting lower production and lower pricing because of heavy consumer incentives.
Through June, Ford`s U.S. auto sales were off 2.8 percent. Its U.S. market share slipped from 21.2 percent in the first quarter to 20.6 percent in the second quarter.
Ford is trying to rebound from $6.4 billion in losses the past two years. It earned $896 million in the first quarter.
"Once again, we`ve proven that we`re committed to our financial milestones," Gilmour said. "We`re focused on achieving our goals, and we`re working through the significant challenges we face during the second half of the year and 2004."
For the first six months of the year, Ford earned $1.3 billion, or 67 cents a share, compared with a loss of $524 million, or 29 cents a share, a year ago.
Revenue for the first half was $81.6 billion, compared with $81.7 billion a year ago.
Ford expects a loss of about 15 cents in the third quarter, reflecting lower production because of high inventories. Analysts were looking for a loss of 12 cents a share and earnings of 67 cents a share for the year.
The company said it will continue to look for ways to cut costs globally, while still improving vehicle quality.
Company officials also said they expected incentives to continue at their current levels through the balance of the upcoming quarter, putting pressure on net pricing.
But overall net pricing is expected to improve with the introduction of new vehicles, such as the Ford F-150, which won`t need as many incentives, they said.
Ford`s finance arm, Ford Motor Credit Co., reported net income of $401 million in the April-June period, up from $330 million in the year-ago quarter.
Ford Europe had a pretax loss of $525 million in the second quarter, compared with a loss of $18 million a year ago. Results were hurt by pricing, an unfavorable vehicle mix and lower volume.
Ford South America narrowed its loss to $69 million in the second quarter from $198 million in the year-ago period. Its Asia-Pacific operations also narrowed the quarterly loss, to $28 million from $53 million a year earlier.
Ford`s Premier Automotive Group, which includes Jaguar, Volvo, Land Rover and Aston Martin, reported pretax earnings of $166 million versus a loss of $122 million a year ago.
The luxury division was boosted by strong sales of the Volvo XC90 and the recent introduction of the Jaguar XJ.
General Motors Corp., the world`s largest automaker, reports second-quarter results Thursday.
------
Die sollten aufhören Autos zu bauen und dafür Bankgeschäfte machen.
Davon scheinen sie Ahnung zu haben
Ford Posts $417 Million; Beats Forecast
Ford Posts Profit of $417 Million in Second-Quarter; Beats Wall Street Predictions
The Associated Press
DEARBORN, Mich. July 16 —
Ford Motor Co.`s profit fell nearly 27 percent in the second quarter but still beat Wall Street expectations as the automaker steps up its efforts to slash costs.
Before the market opened Wednesday, the world`s second-largest automaker said it earned $417 million, or 22 cents a share, in the April-June period versus a profit of $570 million, or 29 cents a share, a year earlier.
The consensus estimate on Wall Street was for earnings of 19 cents a share. The company reiterated its goal of earning 70 cents a share for the year, which would beat current estimates, despite saying it expects a wider loss than analysts anticipate for third quarter.
The automaker also boosted its cost-cutting goal to $2.5 billion for the year from its initial target of $500 million. It cut costs by $1.3 billion in the second quarter alone.
"We`re delighted with the progress we`ve been able to make on cost," said Allan Gilmour, the company`s vice chairman and chief financial officer. "I think it was not predictable then (a year ago) that we would see the acceleration that we`ve seen as this year has progressed."
But in morning trading on the New York Stock Exchange, Ford shares fell 59 cents, or 5.1 percent, to $11.05.
"Our second-quarter financial performance and our achievements in the past 18 months since we announced our revitalization plan demonstrate that we`re delivering the results that are needed to keep the company solidly on track," said chairman and chief executive Bill Ford Jr.
But lower vehicles sales and declining prices continue to hamper revenue.
Ford`s second-quarter revenue slipped to $40.7 billion from $42.2 billion a year ago. Worldwide vehicle sales were down 7 percent in the quarter, and total automotive profit was down $400 million from last year.
In North America, Ford`s profit fell to $445 million in the quarter from $921 million in the same period in 2002, again reflecting lower production and lower pricing because of heavy consumer incentives.
Through June, Ford`s U.S. auto sales were off 2.8 percent. Its U.S. market share slipped from 21.2 percent in the first quarter to 20.6 percent in the second quarter.
Ford is trying to rebound from $6.4 billion in losses the past two years. It earned $896 million in the first quarter.
"Once again, we`ve proven that we`re committed to our financial milestones," Gilmour said. "We`re focused on achieving our goals, and we`re working through the significant challenges we face during the second half of the year and 2004."
For the first six months of the year, Ford earned $1.3 billion, or 67 cents a share, compared with a loss of $524 million, or 29 cents a share, a year ago.
Revenue for the first half was $81.6 billion, compared with $81.7 billion a year ago.
Ford expects a loss of about 15 cents in the third quarter, reflecting lower production because of high inventories. Analysts were looking for a loss of 12 cents a share and earnings of 67 cents a share for the year.
The company said it will continue to look for ways to cut costs globally, while still improving vehicle quality.
Company officials also said they expected incentives to continue at their current levels through the balance of the upcoming quarter, putting pressure on net pricing.
But overall net pricing is expected to improve with the introduction of new vehicles, such as the Ford F-150, which won`t need as many incentives, they said.
Ford`s finance arm, Ford Motor Credit Co., reported net income of $401 million in the April-June period, up from $330 million in the year-ago quarter.
Ford Europe had a pretax loss of $525 million in the second quarter, compared with a loss of $18 million a year ago. Results were hurt by pricing, an unfavorable vehicle mix and lower volume.
Ford South America narrowed its loss to $69 million in the second quarter from $198 million in the year-ago period. Its Asia-Pacific operations also narrowed the quarterly loss, to $28 million from $53 million a year earlier.
Ford`s Premier Automotive Group, which includes Jaguar, Volvo, Land Rover and Aston Martin, reported pretax earnings of $166 million versus a loss of $122 million a year ago.
The luxury division was boosted by strong sales of the Volvo XC90 and the recent introduction of the Jaguar XJ.
General Motors Corp., the world`s largest automaker, reports second-quarter results Thursday.
------
Die sollten aufhören Autos zu bauen und dafür Bankgeschäfte machen.
Davon scheinen sie Ahnung zu haben

schönen gruss an dolby  Möchtest jetzt wissen wer ich bin
Möchtest jetzt wissen wer ich bin  Dann rate mal
Dann rate mal
 Möchtest jetzt wissen wer ich bin
Möchtest jetzt wissen wer ich bin  Dann rate mal
Dann rate mal
Hi dolby  Möchtest jetzt wohl wissen wer ich bin
Möchtest jetzt wohl wissen wer ich bin  Rate mal
Rate mal
 Möchtest jetzt wohl wissen wer ich bin
Möchtest jetzt wohl wissen wer ich bin  Rate mal
Rate mal
keine ahnung. hau rein 

solar ..... 

seggl 
haste die alphateilchen gefunden?


haste die alphateilchen gefunden?


Hannich-Kolumne: Konjunktureinbruch und Haushaltsdefizite
16.07.2003 09:58:00
Wie nun bekannt wurde, müssen die USA dieses Jahr ein Haushaltsdefizit von fast einer halben Billion Dollar hinnehmen. Dies stellt einen nie dagewesenen Rekordverlust dar. Wurde noch vor wenigen Jahren lauthals verkündet, dass in Zukunft der Staatshaushalt Gewinne einfahren wird, so hat man sich nun endgültig von diesen Traumvorstellungen verabschiedet. Doch nicht nur in den USA, überall auf der Welt explodieren die Defizite. Vor allem bei uns in Deutschland wird das Desaster jeden Tag deutlicher. Auch uns wurde vor einigen Jahren noch versprochen, dass nun endgültig Schulden abgebaut würden und der Staat bereits in einigen Jahren schuldenfrei sein soll. Wunschträume und Zweckoptimismus, wie wir heute erfahren können.
Doch warum kann denn kein Staat der Welt je seine Schulden abbauen? Das geht deshalb nicht, weil er in Zeiten von Rezessionen immer konjunkturpolitisch eingreifen muss, da anderenfalls sofort eine deflationäre Abwärtsspirale einsetzt. Wenn immer so schön vom "Sparen" geredet wird, dann wird ganz vergessen, dass wenn bei fast 50 Prozent Staatsquote der Staat sparen würde, plötzlich massiv Nachfrage auf dem Markt fehlen würde, was Pleiten und Bankrotte nach sich ziehen müsste. Die Staaten sind allein von der immer trüberen Konjunkturentwicklung zur Verschuldung gezwungen. Natürlich geht dieses Spiel auch nicht unbegrenzt, da die Kapitalkosten zunehmend den Handlungsspielraum der Nationen eingrenzen und die Wirtschaft abwürgen. In jedem Fall droht also in Zukunft eine Krise: Spart der Staat, fehlt Nachfrage auf dem Markt, verschuldet er sich weiter ist er früher oder später bankrott. Krieg war im historischen Verlauf oftmals die einzige Lösung des Problems. Wer sich unter solchen Bedingungen auf steigende Aktienkurse verlässt, der wird möglicherweise schon bald sein blaues Wunder erleben.
Günter Hannich ist Autor von sechs finanzkritischen Büchern und Ratgebern zu Wirtschaft und Geldanlage. Daneben informiert er in deutschlandweiten Seminaren die Bevölkerung zu Fragen von Geldanlage und Finanzsystem. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichungen sowie Interviews in Rundfunk und Fernsehen bekannt. Mehr Infos auf seiner Internetseite: www.geldcrash.de.
-------
Der Aufschwung, den die Börse feiert, ist bereits da!
16.07.2003 09:58:00
Wie nun bekannt wurde, müssen die USA dieses Jahr ein Haushaltsdefizit von fast einer halben Billion Dollar hinnehmen. Dies stellt einen nie dagewesenen Rekordverlust dar. Wurde noch vor wenigen Jahren lauthals verkündet, dass in Zukunft der Staatshaushalt Gewinne einfahren wird, so hat man sich nun endgültig von diesen Traumvorstellungen verabschiedet. Doch nicht nur in den USA, überall auf der Welt explodieren die Defizite. Vor allem bei uns in Deutschland wird das Desaster jeden Tag deutlicher. Auch uns wurde vor einigen Jahren noch versprochen, dass nun endgültig Schulden abgebaut würden und der Staat bereits in einigen Jahren schuldenfrei sein soll. Wunschträume und Zweckoptimismus, wie wir heute erfahren können.
Doch warum kann denn kein Staat der Welt je seine Schulden abbauen? Das geht deshalb nicht, weil er in Zeiten von Rezessionen immer konjunkturpolitisch eingreifen muss, da anderenfalls sofort eine deflationäre Abwärtsspirale einsetzt. Wenn immer so schön vom "Sparen" geredet wird, dann wird ganz vergessen, dass wenn bei fast 50 Prozent Staatsquote der Staat sparen würde, plötzlich massiv Nachfrage auf dem Markt fehlen würde, was Pleiten und Bankrotte nach sich ziehen müsste. Die Staaten sind allein von der immer trüberen Konjunkturentwicklung zur Verschuldung gezwungen. Natürlich geht dieses Spiel auch nicht unbegrenzt, da die Kapitalkosten zunehmend den Handlungsspielraum der Nationen eingrenzen und die Wirtschaft abwürgen. In jedem Fall droht also in Zukunft eine Krise: Spart der Staat, fehlt Nachfrage auf dem Markt, verschuldet er sich weiter ist er früher oder später bankrott. Krieg war im historischen Verlauf oftmals die einzige Lösung des Problems. Wer sich unter solchen Bedingungen auf steigende Aktienkurse verlässt, der wird möglicherweise schon bald sein blaues Wunder erleben.
Günter Hannich ist Autor von sechs finanzkritischen Büchern und Ratgebern zu Wirtschaft und Geldanlage. Daneben informiert er in deutschlandweiten Seminaren die Bevölkerung zu Fragen von Geldanlage und Finanzsystem. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichungen sowie Interviews in Rundfunk und Fernsehen bekannt. Mehr Infos auf seiner Internetseite: www.geldcrash.de.
-------
Der Aufschwung, den die Börse feiert, ist bereits da!

17.07. 18:02
US: Philly Fed Index über Erwartungen
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Der Philly Fed Index lag im Juli bei 8.3 (Prognose: 7). Der Philly Fed Index gibt Aufschluss auf die Aktivität im herstellenden Sektor im Raum Philadelphia. Der Index wird viel beachtet, da er mit dem ISM Index und der Industrieproduktion korreliert. Der Index für die gezahlten Preise erreichte im Juli das niedrigste Niveau seit 19 Monaten. Der Index fiel auf -6.5 von 5.8 im Juni.
-----------------------------------------------------------
17.07. 14:32
US: Erstanträge fallen deutlich
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen in der Vorwoche bei 412.000 (Prognose: 425.000) und erreichen damit ein Dreiwochentief.
 Der Vierwochendurchschnitt der Zahl der Erstanträge lag in der vergangenen Woche bei 424,000, ein Rückgang um 3,500.
Der Vierwochendurchschnitt der Zahl der Erstanträge lag in der vergangenen Woche bei 424,000, ein Rückgang um 3,500.
US: Philly Fed Index über Erwartungen
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Der Philly Fed Index lag im Juli bei 8.3 (Prognose: 7). Der Philly Fed Index gibt Aufschluss auf die Aktivität im herstellenden Sektor im Raum Philadelphia. Der Index wird viel beachtet, da er mit dem ISM Index und der Industrieproduktion korreliert. Der Index für die gezahlten Preise erreichte im Juli das niedrigste Niveau seit 19 Monaten. Der Index fiel auf -6.5 von 5.8 im Juni.
-----------------------------------------------------------
17.07. 14:32
US: Erstanträge fallen deutlich
--------------------------------------------------------------------------------
(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen in der Vorwoche bei 412.000 (Prognose: 425.000) und erreichen damit ein Dreiwochentief.

 Der Vierwochendurchschnitt der Zahl der Erstanträge lag in der vergangenen Woche bei 424,000, ein Rückgang um 3,500.
Der Vierwochendurchschnitt der Zahl der Erstanträge lag in der vergangenen Woche bei 424,000, ein Rückgang um 3,500.
17/07/2003 18:16
TABELLE-Index der Fed von Philadelphia im Juli gestiegen
New York, 17. Jul (Reuters) - Der Konjunkturindex der
Federal Reserve Bank von Philadelphia ist im Juli auf plus 8,3
Punkte von plus 4,0 Punkten im Juni gestiegen. Die
Philadelphia-Fed veröffentlichte am Donnerstag folgende Zahlen:
JUL 2003 JUN 2003
Konjunkturindex + 8,3 + 4,0
Index des Auftragseingangs +10,4 - 0,5

Index der Lagerbestände + 5,4 + 7,2
Index der bezahlten Preise - 6,5 + 5,8
Index der erhaltenen Preise - 7,7 - 9,5
Beschäftigungsindex + 0,8 -12,9
NOTE - Von Reuters befragte Volkswirte hatten für den
Berichtsmonat mit einem Konjunkturindex von plus 7,0 Punkten
gerechnet.
tcs/bek
--------
Joo, so siehts aus
TABELLE-Index der Fed von Philadelphia im Juli gestiegen
New York, 17. Jul (Reuters) - Der Konjunkturindex der
Federal Reserve Bank von Philadelphia ist im Juli auf plus 8,3
Punkte von plus 4,0 Punkten im Juni gestiegen. Die
Philadelphia-Fed veröffentlichte am Donnerstag folgende Zahlen:
JUL 2003 JUN 2003
Konjunkturindex + 8,3 + 4,0
Index des Auftragseingangs +10,4 - 0,5


Index der Lagerbestände + 5,4 + 7,2

Index der bezahlten Preise - 6,5 + 5,8

Index der erhaltenen Preise - 7,7 - 9,5

Beschäftigungsindex + 0,8 -12,9
NOTE - Von Reuters befragte Volkswirte hatten für den
Berichtsmonat mit einem Konjunkturindex von plus 7,0 Punkten
gerechnet.
tcs/bek
--------
Joo, so siehts aus

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,257838,00.html
KRIEGSGRUND-AFFÄRE
Kellys Tod bringt Blair in Bedrängnis
Er war der Mann, der Tony Blair in die Bredouille brachte: David Kelly, einst Uno-Waffeninspekteur und Regierungsberater, hatte angeblich gegenüber Medien enthüllt, dass der britische Premier die Beweise für irakische Massenvernichtungswaffen aufgebauscht hatte. Jetzt wurde offenbar der Waffenexperte tot aufgefunden. Der Druck auf Blair steigt massiv.
Hamburg - Tony Blair erfuhr von Kellys Tod während seines Flugs von Washington nach Tokio. Zunächst war von ihm keine Stellungnahme zu hören. Böse Zungen erklärten dies mit der Abwesenheit seines "Sprachrohrs" Alastair Campbell. Der Kommunikationsdirektor, der normalerweise auf allen Flügen selbst dann noch Akten wälzt und den nächsten Tag vorbereitet, wenn der Premierminister schon in tiefen Schlaf gesunken ist, weilte diesmal am anderen Ende der Welt. Nach Blairs Rede vor dem amerikanischen Kongress, bei dem der britische Regierungschef 14 Minuten lang überschwänglich gefeiert worden war, flog Campbell zufrieden nach Hause.
Zu Hause in England aber herrschte große Aufregung. In einem Waldstück war eine Leiche gefunden worden, bei der es sich höchstwahrscheinlich um den Regierungsberater und ehemaligen Uno-Waffeninspektor David Kelly handelt. Er soll als Erster den seit Wochen heiß diskutierten Vorwurf erhoben haben, die Regierung Blair habe die Beweise für irakische Massenvernichtungswaffen aufgebauscht.
Die Regierung Blair geriet umgehend unter Druck. Adam Boulton, Chefkommentator des Senders Sky News, sagte, Campbell werde jetzt wohl abtreten müssen. Wenn sich Kellys Tod als Selbstmord herausstellen sollte, wird die Regierung dafür mitverantwortlich gemacht werden - und allen voran offenbar derjenige, der Blairs Politik der Öffentlichkeit verkaufte.
Kelly war erst am Dienstag vor einen Untersuchungsausschuss des Unterhauses zitiert worden. Mit leiser Stimme hatte der sichtlich eingeschüchterte Mann mit dem grauen Vollbart dort ausgesagt, von einzelnen Abgeordneten ruppig aufgefordert, doch gefälligst lauter zu sprechen. Die Regierung habe den "ehrenwerten Dr. Kelly den Wölfen zum Fraß vorgeworfen", befand hinterher der konservative Abgeordnete Sir John Stanley.
Kommentatoren beschreiben die Suche nach den wahren Hintergründen des Irak-Krieges nun endgültig als Polit-Thriller. Wie und warum Kelly gestorben ist, ist noch ungewiss. In einer ersten Reaktion kündigte die Regierung am Freitag eine gerichtliche Untersuchung zu den Umständen des Todes an.
Die Ablenkungsmanöver der PR-Experten aus der Downing Street hätten eine "Tragödie von entsetzlichen Ausmaßen" verschuldet, kritisierte das konservative Ausschussmitglied Richard Ottaway. Der Tod des potenziell wichtigen Belastungszeugen Kelly werde Blair nicht nützen, sondern schaden.
--------
Könnte man Bush und Blair endlich in das tiefste Loch dieser Welt stecken?
KRIEGSGRUND-AFFÄRE
Kellys Tod bringt Blair in Bedrängnis
Er war der Mann, der Tony Blair in die Bredouille brachte: David Kelly, einst Uno-Waffeninspekteur und Regierungsberater, hatte angeblich gegenüber Medien enthüllt, dass der britische Premier die Beweise für irakische Massenvernichtungswaffen aufgebauscht hatte. Jetzt wurde offenbar der Waffenexperte tot aufgefunden. Der Druck auf Blair steigt massiv.
Hamburg - Tony Blair erfuhr von Kellys Tod während seines Flugs von Washington nach Tokio. Zunächst war von ihm keine Stellungnahme zu hören. Böse Zungen erklärten dies mit der Abwesenheit seines "Sprachrohrs" Alastair Campbell. Der Kommunikationsdirektor, der normalerweise auf allen Flügen selbst dann noch Akten wälzt und den nächsten Tag vorbereitet, wenn der Premierminister schon in tiefen Schlaf gesunken ist, weilte diesmal am anderen Ende der Welt. Nach Blairs Rede vor dem amerikanischen Kongress, bei dem der britische Regierungschef 14 Minuten lang überschwänglich gefeiert worden war, flog Campbell zufrieden nach Hause.
Zu Hause in England aber herrschte große Aufregung. In einem Waldstück war eine Leiche gefunden worden, bei der es sich höchstwahrscheinlich um den Regierungsberater und ehemaligen Uno-Waffeninspektor David Kelly handelt. Er soll als Erster den seit Wochen heiß diskutierten Vorwurf erhoben haben, die Regierung Blair habe die Beweise für irakische Massenvernichtungswaffen aufgebauscht.
Die Regierung Blair geriet umgehend unter Druck. Adam Boulton, Chefkommentator des Senders Sky News, sagte, Campbell werde jetzt wohl abtreten müssen. Wenn sich Kellys Tod als Selbstmord herausstellen sollte, wird die Regierung dafür mitverantwortlich gemacht werden - und allen voran offenbar derjenige, der Blairs Politik der Öffentlichkeit verkaufte.
Kelly war erst am Dienstag vor einen Untersuchungsausschuss des Unterhauses zitiert worden. Mit leiser Stimme hatte der sichtlich eingeschüchterte Mann mit dem grauen Vollbart dort ausgesagt, von einzelnen Abgeordneten ruppig aufgefordert, doch gefälligst lauter zu sprechen. Die Regierung habe den "ehrenwerten Dr. Kelly den Wölfen zum Fraß vorgeworfen", befand hinterher der konservative Abgeordnete Sir John Stanley.
Kommentatoren beschreiben die Suche nach den wahren Hintergründen des Irak-Krieges nun endgültig als Polit-Thriller. Wie und warum Kelly gestorben ist, ist noch ungewiss. In einer ersten Reaktion kündigte die Regierung am Freitag eine gerichtliche Untersuchung zu den Umständen des Todes an.
Die Ablenkungsmanöver der PR-Experten aus der Downing Street hätten eine "Tragödie von entsetzlichen Ausmaßen" verschuldet, kritisierte das konservative Ausschussmitglied Richard Ottaway. Der Tod des potenziell wichtigen Belastungszeugen Kelly werde Blair nicht nützen, sondern schaden.
--------
Könnte man Bush und Blair endlich in das tiefste Loch dieser Welt stecken?

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,257861,00.html
USA
Wolfowitz verblüfft über Folgen des Irakkriegs
Nach den Worten von US-Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz hat der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im Nachkriegs-Irak die USA völlig unvorbereitet getroffen.
Hamburg - Wolfowitz sagte der "Los Angeles Times", kein Plan der Welt hätte den Zusammenbruch verhindern können. "Dies ist ein Land, das von einer Bande von Verbrechern regiert wurde und es gibt sie immer noch." Der Vize-Verteidigungsminister gilt als einer der Architekten des Irak-Feldzugs. Er traf am Freitag überraschend im Irak ein.
Dort kam bei einem Anschlag erneut ein US-Soldat ums Leben. Mit 148 überstieg die Zahl der US-Toten im Irak-Krieg die Zahl der 1991 im Golfkrieg getöteten US-Soldaten. Beim jüngsten tödlichen Angriff auf die US-Truppen fuhr das Fahrzeug des Soldaten in der westirakischen Stadt Falludscha über einen Sprengsatz.
Der arabische TV-Sender al-Arabija strahlte ein Videoband aus, auf dem angeblich militante Iraker weitere Anschläge gegen US-Soldaten ankündigen. "Wir schwören im Namen Gottes, dass wir den US-Kräften in den kommenden Tagen eine Lektion erteilen werden, (zur Rache) für unsere Jugendlichen, die gestorben sind", hieß es auf dem Band, das dem Sender von einer bislang unbekannten Gruppe "Moslemische Jugend" zugespielt wurde. Gleichzeitig wurden andere Staaten davor gewarnt, Soldaten in den Irak zu entsenden.
Der oberste Geistliche der größten Religionsgemeinschaft, der Schiiten, Moktada al-Sadr, rief die Iraker im Freitagsgebet dazu auf, den von den USA eingesetzten Übergangsrat nicht anzuerkennen. Tausende Gläubige aus dem ganzen Land forderte er auf, sich von der britischen und US-Invasion zu befreien. "Nein, Nein zu Amerika, Nein, Nein zu dem Bösen. Nein zu den Besatzern und zum Terrorismus", unterbrachen die Versammelten immer wieder die Predigt.
Das jüngste vom arabischen Sender al-Dschasira ausgestrahlte Tonband mit einem Kampfaufruf gegen die Amerikaner im Irak stammt wahrscheinlich wirklich von Ex-Präsident Saddam Hussein. Zu dieser Erkenntnis sei der US-Geheimdienst CIA gekommen, berichtete der Nachrichtensender CNN. Auch sei von Saddams Hinweisen klar, dass die Aufnahme erst kürzlich gemacht wurde.
-------
Die Amis haben einfach keine Plan
USA
Wolfowitz verblüfft über Folgen des Irakkriegs
Nach den Worten von US-Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz hat der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im Nachkriegs-Irak die USA völlig unvorbereitet getroffen.
Hamburg - Wolfowitz sagte der "Los Angeles Times", kein Plan der Welt hätte den Zusammenbruch verhindern können. "Dies ist ein Land, das von einer Bande von Verbrechern regiert wurde und es gibt sie immer noch." Der Vize-Verteidigungsminister gilt als einer der Architekten des Irak-Feldzugs. Er traf am Freitag überraschend im Irak ein.
Dort kam bei einem Anschlag erneut ein US-Soldat ums Leben. Mit 148 überstieg die Zahl der US-Toten im Irak-Krieg die Zahl der 1991 im Golfkrieg getöteten US-Soldaten. Beim jüngsten tödlichen Angriff auf die US-Truppen fuhr das Fahrzeug des Soldaten in der westirakischen Stadt Falludscha über einen Sprengsatz.
Der arabische TV-Sender al-Arabija strahlte ein Videoband aus, auf dem angeblich militante Iraker weitere Anschläge gegen US-Soldaten ankündigen. "Wir schwören im Namen Gottes, dass wir den US-Kräften in den kommenden Tagen eine Lektion erteilen werden, (zur Rache) für unsere Jugendlichen, die gestorben sind", hieß es auf dem Band, das dem Sender von einer bislang unbekannten Gruppe "Moslemische Jugend" zugespielt wurde. Gleichzeitig wurden andere Staaten davor gewarnt, Soldaten in den Irak zu entsenden.
Der oberste Geistliche der größten Religionsgemeinschaft, der Schiiten, Moktada al-Sadr, rief die Iraker im Freitagsgebet dazu auf, den von den USA eingesetzten Übergangsrat nicht anzuerkennen. Tausende Gläubige aus dem ganzen Land forderte er auf, sich von der britischen und US-Invasion zu befreien. "Nein, Nein zu Amerika, Nein, Nein zu dem Bösen. Nein zu den Besatzern und zum Terrorismus", unterbrachen die Versammelten immer wieder die Predigt.
Das jüngste vom arabischen Sender al-Dschasira ausgestrahlte Tonband mit einem Kampfaufruf gegen die Amerikaner im Irak stammt wahrscheinlich wirklich von Ex-Präsident Saddam Hussein. Zu dieser Erkenntnis sei der US-Geheimdienst CIA gekommen, berichtete der Nachrichtensender CNN. Auch sei von Saddams Hinweisen klar, dass die Aufnahme erst kürzlich gemacht wurde.
-------
Die Amis haben einfach keine Plan

http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,257620,00.html
NIEDERLAGE FÜR BUSH
US-Senat stoppt staatliche Schnüffelei
Die Überwachungsphantasien der US-Regierung werden wahrscheinlich Phantasien bleiben. Der Senat drehte dem "Terrorism Information Awareness"-Programm überraschend den Geldhahn zu - und stoppte damit ein Vorhaben von Orwellschen Ausmaßen.
Die Schockstarre, die durch die Terroranschläge vom 11. September ausgelöst wurde und in den USA zu einer drastischen Beschneidung der Bürgerrechte führte, scheint sich zumindest in der Politik zu lösen. Der US-Senat verbot jetzt dem Verteidigungsministerium, auch nur einen Cent seines 369 Milliarden Dollar großen Etats für die Entwicklung des "Terrorist Information Awareness"-Programms (TIA) auszugeben. Nicht einmal für die Forschung darf das Pentagon jetzt noch Mittel einsetzen.
Die einstimmige Entscheidung des Senats kam überraschend, da sie gegen den ausdrücklichen Willen der Regierung von Präsident George W. Bush fiel - und das, obwohl Bushs Republikanische Partei im Senat die Mehrheit hat. Das endgültige Schicksal des TIA-Programms, das rund 54 Millionen Dollar kosten sollte, wird sich nun in Verhandlungen zwischen Senat und Repräsentantenhaus entscheiden. Das Repräsentantenhaus hatte dem Pentagon Anfang dieses Monats bereits untersagt, ohne ausdrückliche Erlaubnis mit TIA-Technologien US-Bürger auszuspionieren. Die Finanzierung des Programms hatten die Abgeordneten allerdings nicht unterbunden.
Das Pentagon hatte im September vergangenen Jahres für Wirbel gesorgt, als es erstmals die Pläne für sein monströses Überwachungssystem vorlegte. Das Programm, das seinerzeit noch "Total Information Awareness" hieß, entstand unter Federführung der Pentagon-Forschungsabteilung DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Data-Mining, die Auswertung der Datenströme im Internet und die Überwachung von Datenbanken von Kreditinstituten, Reiseunternehmen, Gesundheits- und Verkehrsbehörden sollten Muster offenbaren, die auf terroristische Aktivitäten schließen lassen.
Der zu erwartende Proteststurm tobte kurz darauf nicht nur in liberalen Medien und unter Bürgerrechtlern, sondern auch im Senat. Selbst konservativen Politikern gingen die Pläne des Pentagon zu weit. Nach hitzigen Debatten zwang der Senat zu Jahresanfang das Ministerium, detaillierte Angaben zu Umfang, Kosten, Zielen und Folgen des TIA-Programms zu machen. Geschehe das nicht, so die Drohung des Parlaments, würden die Mittel eingefroren.
Offenbar war das Pentagon nicht willens oder in der Lage, der Forderung des Senats nachzukommen. Stattdessen sollte es ein Etikettenwechsel tun: Im Mai wurde das Programm von "Total Information Awareness" in "Terrorism Information Awareness" umgetauft - um Befürchtungen zu zerstreuen, unbescholtene US-Bürger könnten Opfer wahlloser Schnüffelaktionen werden.
Spezielle Sicherheitsvorkehrungen gegen solche Auswüchse, so die lapidare Auskunft des Pentagon an den Kongress, seien allerdings nicht vorgesehen. Das Ministerium erklärte sich lediglich bereit, zu Kontrollzwecken Stichproben aus den zu erwartenden Datenmengen zu erlauben, die nach Schätzungen von Experten binnen kurzem nur noch in Petabyte (eine Million Gigabyte) zu messen gewesen wären.
Dem Senat reichte das offenbar nicht. Er machte seine Drohung wahr und sperrte die Mittel - obwohl die Regierung Bush noch wenige Stunden vor der Entscheidung betont hatte, dass sie dadurch ein "wichtiges Mittel im Krieg gegen den Terrorismus" verlöre.
Markus Becker

NIEDERLAGE FÜR BUSH
US-Senat stoppt staatliche Schnüffelei
Die Überwachungsphantasien der US-Regierung werden wahrscheinlich Phantasien bleiben. Der Senat drehte dem "Terrorism Information Awareness"-Programm überraschend den Geldhahn zu - und stoppte damit ein Vorhaben von Orwellschen Ausmaßen.
Die Schockstarre, die durch die Terroranschläge vom 11. September ausgelöst wurde und in den USA zu einer drastischen Beschneidung der Bürgerrechte führte, scheint sich zumindest in der Politik zu lösen. Der US-Senat verbot jetzt dem Verteidigungsministerium, auch nur einen Cent seines 369 Milliarden Dollar großen Etats für die Entwicklung des "Terrorist Information Awareness"-Programms (TIA) auszugeben. Nicht einmal für die Forschung darf das Pentagon jetzt noch Mittel einsetzen.
Die einstimmige Entscheidung des Senats kam überraschend, da sie gegen den ausdrücklichen Willen der Regierung von Präsident George W. Bush fiel - und das, obwohl Bushs Republikanische Partei im Senat die Mehrheit hat. Das endgültige Schicksal des TIA-Programms, das rund 54 Millionen Dollar kosten sollte, wird sich nun in Verhandlungen zwischen Senat und Repräsentantenhaus entscheiden. Das Repräsentantenhaus hatte dem Pentagon Anfang dieses Monats bereits untersagt, ohne ausdrückliche Erlaubnis mit TIA-Technologien US-Bürger auszuspionieren. Die Finanzierung des Programms hatten die Abgeordneten allerdings nicht unterbunden.
Das Pentagon hatte im September vergangenen Jahres für Wirbel gesorgt, als es erstmals die Pläne für sein monströses Überwachungssystem vorlegte. Das Programm, das seinerzeit noch "Total Information Awareness" hieß, entstand unter Federführung der Pentagon-Forschungsabteilung DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Data-Mining, die Auswertung der Datenströme im Internet und die Überwachung von Datenbanken von Kreditinstituten, Reiseunternehmen, Gesundheits- und Verkehrsbehörden sollten Muster offenbaren, die auf terroristische Aktivitäten schließen lassen.
Der zu erwartende Proteststurm tobte kurz darauf nicht nur in liberalen Medien und unter Bürgerrechtlern, sondern auch im Senat. Selbst konservativen Politikern gingen die Pläne des Pentagon zu weit. Nach hitzigen Debatten zwang der Senat zu Jahresanfang das Ministerium, detaillierte Angaben zu Umfang, Kosten, Zielen und Folgen des TIA-Programms zu machen. Geschehe das nicht, so die Drohung des Parlaments, würden die Mittel eingefroren.
Offenbar war das Pentagon nicht willens oder in der Lage, der Forderung des Senats nachzukommen. Stattdessen sollte es ein Etikettenwechsel tun: Im Mai wurde das Programm von "Total Information Awareness" in "Terrorism Information Awareness" umgetauft - um Befürchtungen zu zerstreuen, unbescholtene US-Bürger könnten Opfer wahlloser Schnüffelaktionen werden.
Spezielle Sicherheitsvorkehrungen gegen solche Auswüchse, so die lapidare Auskunft des Pentagon an den Kongress, seien allerdings nicht vorgesehen. Das Ministerium erklärte sich lediglich bereit, zu Kontrollzwecken Stichproben aus den zu erwartenden Datenmengen zu erlauben, die nach Schätzungen von Experten binnen kurzem nur noch in Petabyte (eine Million Gigabyte) zu messen gewesen wären.
Dem Senat reichte das offenbar nicht. Er machte seine Drohung wahr und sperrte die Mittel - obwohl die Regierung Bush noch wenige Stunden vor der Entscheidung betont hatte, dass sie dadurch ein "wichtiges Mittel im Krieg gegen den Terrorismus" verlöre.
Markus Becker

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,257585,00.html
US-AIRLINES
Künstliche Profite im Katastrophen-Quartal
Dank hoher Rückzahlungen vom Staat haben mehrere US-Fluglinien erstmals seit langem Gewinne präsentiert. Das operative Geschäft aber läuft bei den meisten Furcht erregend schlecht - auch deshalb streicht der Flugzeugbauer Boeing mindestens 4000 Stellen.
Chicago - Eigentlich sehen die Zahlen nicht schlecht aus: 227 Millionen Dollar Nettogewinn trotz Sars, Irak-Krieg und Konjunkturflaute meldete die Fluglinie Northwest am Donnerstag. Nicht übel für ein Unternehmen, das im Vorjahreszeitraum 93 Millionen Verlust schrieb, obwohl damals weder Krieg noch Seuche das Geschäft ruinierten.
Die Zahlen verdecken aber, dass Northwest das schlimmste Quartal seiner Geschichte hinter sich hat. Der Gewinn kam nur zustande, weil die US-Regierung Northwest - wie anderen Airlines auch - Gebühren in Millionenhöhe erstattete, die früher für die Verbesserung der Sicherheitsbedingungen auf Flughäfen gezahlt worden waren. Zudem hat Northwest die Firmentochter WorldSpan verkauft.
Druck auf die Gewerkschaften
Ohne dergleichen Sonderfaktoren käme die Airline netto auf einen Rekordverlust von 160 Millionen Dollar im Quartal. Dass die Kerosin-Preise um 17 Prozent gestiegen sind, hat neben dem Nachfrageeinbruch zu den desaströsen Zahlen beigetragen. "Wir sehen noch immer keine Verbesserung unserer Finanzlage", musste Firmenchef Richard Anderson einräumen. Man wolle die Gewerkschaften nun bewegen, einem Verzicht auf Lohn in Höhe von insgesamt 950 Millionen Dollar zuzustimmen.
Delta Airlines, dem US-Partner der Air France, geht es kaum besser: Operativ stieg der Verlust im Quartal um weitere 75 Millionen Dollar auf 237 Millionen Dollar. Der Umsatz schrumpfte dagegen von 3,474 auf 3,307 Milliarden Dollar. Dank der staatlichen Rückzahlungen und einmaliger Verkaufserlöse kam aber ein Gewinn von 184 Millionen zustande.
Immerhin eine positive Überraschung
Auch Continental, unter den traditionellen US-Airlines noch die gesündeste, hat es nur dank der Rückerstattung von 111 Millionen Dollar wieder in die Gewinnzone geschafft: Der Überschuss belief sich auf 79 Millionen Dollar, nach einem Minus von 139 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.
Bei Continental aber funktioniert immerhin das operative Geschäft wieder: Hier erwirtschaftete die Airline ein Ergebnis von 238 Millionen Dollar, nach einem operativen Verlust von 115 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Trotz sinkender Auslastung stieg der Umsatz von 2,192 auf 2,216 Milliarden Dollar - Analysten zeigten sich davon positiv überrascht.
Die Krise der Kunden belastet auch den Flugzeughersteller Boeing. Er will bis Jahresende 4000 bis 5000 Stellen in seiner Zivilluftfahrtsparte abbauen. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation, aber auch über Kündigungen erfolgen.
-----
Da steigt das Öl etwas und schon ist wieder Chaos im gelobten Land
US-AIRLINES
Künstliche Profite im Katastrophen-Quartal
Dank hoher Rückzahlungen vom Staat haben mehrere US-Fluglinien erstmals seit langem Gewinne präsentiert. Das operative Geschäft aber läuft bei den meisten Furcht erregend schlecht - auch deshalb streicht der Flugzeugbauer Boeing mindestens 4000 Stellen.
Chicago - Eigentlich sehen die Zahlen nicht schlecht aus: 227 Millionen Dollar Nettogewinn trotz Sars, Irak-Krieg und Konjunkturflaute meldete die Fluglinie Northwest am Donnerstag. Nicht übel für ein Unternehmen, das im Vorjahreszeitraum 93 Millionen Verlust schrieb, obwohl damals weder Krieg noch Seuche das Geschäft ruinierten.
Die Zahlen verdecken aber, dass Northwest das schlimmste Quartal seiner Geschichte hinter sich hat. Der Gewinn kam nur zustande, weil die US-Regierung Northwest - wie anderen Airlines auch - Gebühren in Millionenhöhe erstattete, die früher für die Verbesserung der Sicherheitsbedingungen auf Flughäfen gezahlt worden waren. Zudem hat Northwest die Firmentochter WorldSpan verkauft.
Druck auf die Gewerkschaften
Ohne dergleichen Sonderfaktoren käme die Airline netto auf einen Rekordverlust von 160 Millionen Dollar im Quartal. Dass die Kerosin-Preise um 17 Prozent gestiegen sind, hat neben dem Nachfrageeinbruch zu den desaströsen Zahlen beigetragen. "Wir sehen noch immer keine Verbesserung unserer Finanzlage", musste Firmenchef Richard Anderson einräumen. Man wolle die Gewerkschaften nun bewegen, einem Verzicht auf Lohn in Höhe von insgesamt 950 Millionen Dollar zuzustimmen.
Delta Airlines, dem US-Partner der Air France, geht es kaum besser: Operativ stieg der Verlust im Quartal um weitere 75 Millionen Dollar auf 237 Millionen Dollar. Der Umsatz schrumpfte dagegen von 3,474 auf 3,307 Milliarden Dollar. Dank der staatlichen Rückzahlungen und einmaliger Verkaufserlöse kam aber ein Gewinn von 184 Millionen zustande.
Immerhin eine positive Überraschung
Auch Continental, unter den traditionellen US-Airlines noch die gesündeste, hat es nur dank der Rückerstattung von 111 Millionen Dollar wieder in die Gewinnzone geschafft: Der Überschuss belief sich auf 79 Millionen Dollar, nach einem Minus von 139 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.
Bei Continental aber funktioniert immerhin das operative Geschäft wieder: Hier erwirtschaftete die Airline ein Ergebnis von 238 Millionen Dollar, nach einem operativen Verlust von 115 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Trotz sinkender Auslastung stieg der Umsatz von 2,192 auf 2,216 Milliarden Dollar - Analysten zeigten sich davon positiv überrascht.
Die Krise der Kunden belastet auch den Flugzeughersteller Boeing. Er will bis Jahresende 4000 bis 5000 Stellen in seiner Zivilluftfahrtsparte abbauen. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation, aber auch über Kündigungen erfolgen.
-----
Da steigt das Öl etwas und schon ist wieder Chaos im gelobten Land

http://www.zeit.de/2003/30/WMD
Irak
Die große Säuberung
Hat US-Präsident Bush gelogen? Seine Helfer mussten zugeben, Belege für das irakische Waffen-Programm manipuliert zu haben. Nun werden Sündenböcke gesucht
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Washington
George Bush trat sein Amt mit dem erklärten Vorsatz an, „Ehre und Würde“ im Weißen Haus wiederherzustellen. Der Präsident hat Wort gehalten, wenn als Maßstab gelten darf, dass er nicht im Büro über eine Praktikantin herfiel und später behauptete, er habe mit „dieser Frau“ keinen Sex gehabt. Stattdessen scheint George Bush aber eine andere amerikanische Institution befleckt zu haben: die traditionelle „Rede zur Lage der Nation“. Von den Gründervätern aus Misstrauen gegenüber der Macht erfunden, soll der demokratisch gewählte Herrscher mit ihr dem Parlament Rechenschaft ablegen. Es ist die wichtigste Rede eines Präsidenten im Jahreskalender. Jeder Satz, jedes Wort ist tausendmal berührt, gewendet, verbessert, überprüft, geprobt worden. Der ganze Regierungsapparat dient als Ideenpool und Faktenprüfer.
Derart vorbereitet, spricht George Bush am 28. Januar 2003 zu Parlament, Volk und Welt. 5400 Worte, von denen – nach gegenwärtigem Stand – 16 falsch sind oder einen falschen Eindruck erwecken. Sie hätten „nie in den Text gelangen dürfen“, wie die Regierung Ende vergangener Woche einräumen musste. Nicht um eine Lappalie geht es, um irgendein unbedeutendes Sätzchen, sondern um 16 Worte, die zur Begründung einer radikalen Idee zählen: des Präventivkrieges gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein. Von dem heißt es damals, er versuche sich neuerlich am Bau von Atomwaffen. Die 16 Worte lauten: „Die britische Regierung hat herausgefunden, dass Saddam Hussein jüngst größere Mengen Uran aus Afrika kaufen wollte.“
Aufgrund täglicher Enthüllungen stellt sich nun heraus, dass dieser Sachverhalt in der amerikanischen Regierung monatelang umstritten war, Gegenstand von Recherchen, Notizen, Treffen, Interventionen, Erkundungen und vielen, vielen Zweifeln. Über alle Zweifler setzte sich das Weiße Haus hinweg und muss nun die Konsequenzen tragen. Wochenlang hat der Skandal, aus England kommend, das Weiße Haus umkreist, jetzt ist er eingedrungen, sogar bis hinein ins Oval Office des Präsidenten. Das Eingeständnis bedeutet das Ende der Teflon-Präsidentschaft des George Bush. Jetzt bleibt etwas kleben. Binnen Tagen hat sich die politische Dynamik in Washington verändert. Es ist ein Fest für die Opposition.
Der Kreis rund um den Präsidenten hat das sofort verstanden und panisch reagiert, Ende vergangener Woche in „tumultuösen 24 Stunden“ (CBS News) gipfelnd. Ein derart peinliches Spektakel wechselseitiger Beschuldigungen hat diese Regierung, ansonsten von Korpsgeist beseelt, noch nie geboten. Ausgerechnet jener Verteidigungsminister will nichts gewusst haben, der immer vor einem „11. September mit Massenvernichtungswaffen“ gewarnt hatte. Auch nicht jener Vizepräsident, der noch wenige Tage vor der Invasion behauptete, der Irak arbeite an Atomwaffen. Erst recht nicht die Sicherheitsberaterin, die gesagt hatte: „Es wird immer eine gewisse Unsicherheit bleiben, wie schnell Saddam eine Atomwaffe bekommen kann. Aber wir wollen eben nicht, dass der letzte Beweis ein Atompilz ist.“ Am Ende wird für die verhängnisvollen 16 Worte ein Sündenbock gefunden: Der CIA-Chef muss ein Schuldbekenntnis abgeben. Was bleibt ihm auch übrig? George Bush hat sich schon reingewaschen: „Ich habe der Nation eine Rede vorgetragen, die unsere Geheimdienste zuvor überprüft hatten.“
„Ich hatte keinen Sex mit diesem Gelbkuchen“
Doch die jüngsten Enthüllungen lassen auch diese Version zweifelhaft erscheinen, sodass die freie Übersetzung des Präsidentensatzes (in der parodistischen Version des Wall Street Journal) lautet: „Ich hatte keinen Sex mit diesem Gelbkuchen.“ Ja, Gelbkuchen (englisch: yellowcake), darum geht es. Leuchtend gelbes Uranoxidpulver, das zum Bau der Bombe benötigt wird. Es ist offenbar der italienische Geheimdienst, der Ende 2001 erstmals Hinweise auf einen Versuch des Iraks erhält, in der zentralafrikanischen Republik Niger Gelbkuchen anzukaufen. Ein halbes Dutzend Briefe und Dokumente der Verhandlungspartner gehen den Italienern zu – und werden an Briten und Amerikaner weitergeleitet. Der Niger-Bericht gerät ins morgendliche Geheimdienstbriefing des Weißen Hauses, und der Vizepräsident horcht auf. Richard Cheney gilt seit Jahren als Härtester unter den Hardlinern. Auf Anregung seiner Mitarbeiter schickt die CIA einen Rechercheur in den Niger. Der Mann heißt Joseph Wilson und ist pensionierter Diplomat. Er bricht im Februar 2002 auf, berichtet öffentlich aber erst vor zehn Tagen von seiner Mission – und löst damit den Skandal aus. Wilson kam im Niger zu dem Schluss, dass es sich bei der Geschichte um eine Ente handeln müsse. Zurück in Washington, berichtet Wilson der CIA und dem Außenministerium. Er geht davon aus, dass auch dem Auftraggeber, dem Büro des Vizepräsidenten, die Ergebnisse übermittelt werden. Doch das sei nicht geschehen, behauptet nun CIA-Chef George Tenet in seiner Mea-culpa-Erklärung. Ob er damit lediglich den Vizepräsidenten schützen will, wird nun zu klären sein.
Unumstritten ist, dass die CIA am 9. März 2002 ein Memo über die Reise Wilsons ins Weiße Haus schickt. Am 18. März 2002 erhält Außenminister Colin Powell ein ähnliches Papier. Die Sache scheint geklärt: Nichts dran an der Gelbkuchen-Geschichte. – Bis die britische Regierung im September 2002 ein Irak-Dossier veröffentlicht, das neuerlich den alten Verdacht enthält. Offenbar versucht George Tenet, den Engländern den Vorwurf auszureden. Vergebens. Tenet erfährt, die Engländer hätten zusätzlich eine eigene Quelle, die sie nicht nennen wollten. Es soll sich dabei, wie die Financial Times berichtet, um den französischen Geheimdienst handeln, was der Affäre eine pikante neue Dimension verleiht.
Einen Monat später interveniert George Tenet persönlich im Weißen Haus, als er ein Redemanuskript des Präsidenten für eine Ansprache in Cincinnati liest. Die Niger-Story ist wieder da, wird aber auf Tenets Drängen getilgt. Zum Showdown kommt es wenige Tage vor der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation, als sich die Experten zur Beratung treffen. Die CIA schickt einen Mann namens Alan Foley, das Weiße Haus vertritt Robert Joseph vom Nationalen Sicherheitsrat. Auch wenn sich die Berichte der beiden Herren in Details widersprechen, eines scheint klar: Die CIA möchte den ganzen Satz streichen. Das Weiße Haus will nur Änderungen akzeptieren. Am Ende schlägt es vor, die Sache unpräzise zu formulieren, sich einfach auf den englischen Bericht zu beziehen und nicht von „Niger“, sondern von „Afrika“ zu sprechen. Schließlich gibt die CIA nach.
Dieser Ablauf zeigt: Nicht die amerikanischen Nachrichtendienste haben die Politik in die Irre geführt. Nicht das Weiße Haus ist betrogen worden. Es hat sein Irak-Argument höchstselbst auf die Spitze getrieben, es hat pointiert, wo es hinreichende Gewissheit nicht geben konnte.
Dieselbe Niger-Information liegt drei Tage nach Bushs Rede wieder auf dem Tisch, als Colin Powell die Nacht in der CIA-Zentrale verbringt. Er bereitet dort seine (inzwischen ebenfalls umstrittene) Präsentation vor dem Weltsicherheitsrat vor. Einen Niger-Passus enthält Powells Rede vom 5. Februar 2003 nicht. Anders als das Personal rund um den Präsidenten lässt sich der Außenminister offenbar von Zweiflern überzeugen.
Aus dieser Rekonstruktion ergeben sich drei Fragen: Warum leistet George Tenet im entscheidenden Moment nicht heftiger Widerstand? Warum hört die Regierung nicht auf Tenet? Und warum wird nun ausgerechnet der Warner zur öffentlichen Selbstbezichtigung gezwungen?
Schon einmal, nach dem Geheimdienstdebakel um den 11. September 2001, scheint der CIA-Chef auf dem Weg in den Vorruhestand zu sein. Doch George Bush hält an Tenet fest. Der Präsident mag im Moment der nationalen Krise nicht den Geheimdienst-Chef auswechseln und erlebt in Tenet einen dynamischen Reformer, ja einen Draufgänger, der Bush die riskante Strategie des Afghanistan-Krieges vorschlägt. Bush zeichnet Tenets Kriegsplan ab und damit eine bedeutende Rolle für dessen Spione; er setzt neue Befugnisse für die Geheimen durch und eine gewaltige Budgeterhöhung. Binnen Monaten ist Tenet vom Wackelkandidaten zum mächtigsten CIA-Chef seit Allen Dulles in den fünfziger Jahren geworden. Jeden Morgen sehen sich Bush und Tenet beim Geheimdienst-Briefing und haben sich dabei, so heißt es, persönlich schätzen gelernt. Jedenfalls scheint Tenets Loyalität gegenüber dem Kreis um Bush derart ausgeprägt, dass offener Widerstand unwahrscheinlich geworden ist.
Umgekehrt haben die Rechtsausleger im Team Bush nicht vergessen, dass George Tenet keiner der Ihren ist. Ein ideologisch Unzuverlässiger, von Bill Clinton ernannt, im inneren Machtgefüge der Regierung den Moderaten um Colin Powell zuzurechnen. Ein Mann, der eine Behörde von lauter Stubenhockern führt. Besonders tief sitzt das Vorurteil von den schlappen Schlapphüten bei den Neokonservativen. Deren Vordenker Paul Wolfowitz war Mitglied von „Team B“, einer Gruppe, die in den siebziger Jahren CIA-Analysen über die militärische Stärke der Sowjetunion überprüfen sollte. Die Arbeitsgruppe bezeichnete die Annahmen der CIA als naiv oder viel zu vorsichtig. Diese Einschätzung wurde zur Grundlage der Aufrüstung während der Reagan-Jahre. Dass Team B die Stärke der Sowjetunion dramatisch überschätzt hatte, wurde nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr erörtert.
Dass Donald Rumsfeld im Verteidigungsministerium seine eigene Geheimtruppe zur Auswertung von Irak-Informationen gründet, das Office of Special Plans, ist Ausdruck seines tiefen Misstrauens gegenüber der CIA. Die rechten Revolutionäre wollen die ganze Haltung gegenüber Fakten und Indizien verändert sehen, wie Pentagon-Berater Richard Perle im März 2001 vor dem Kongress klarmacht. Auf die Frage nach Saddam Husseins Atomprogramm sagte Perle: „Wie weit er ist, wissen wir nicht genau. Meine Vermutung ist: schon weiter, als wir glauben. Saddam Hussein ist immer weiter, als wir glauben, weil wir uns ständig darauf beschränken, zu sagen, was wir beweisen können.“
Der Fesseln der Empirie entledigen sich die Hardliner, wie der Fall Niger zeigt, nach dem 11.September 2001 bisweilen erfolgreich. Es reicht ihnen offenbar aus, dass sie selbst von guten Intentionen getragen werden, Saddam Hussein aber böse Absichten hegt. Der Fall Niger ist Folge dieses manichäischen Weltbildes. „Die Indizien legen nahe“, schreibt das Magazin Time, „dass viele in der Bush-Administration die Niger-Connection einfach glauben wollten.“
Dass gerade George Tenet zur öffentlichen Entblößung gezwungen und auf Dauer wohl sein Amt verlieren wird, hat wenig mit Fakten und viel mit Politik zu tun. Hier übernimmt nicht ein Mitglied von Bushs Führungsmannschaft Verantwortung. Vielmehr ist eine politische Säuberung zu besichtigen. Allerdings dürfte Tenet nicht ganz fallen gelassen werden, jedenfalls noch nicht. Wird er gefeuert, dürfte sich der CIA-Apparat mit Indiskretionen wehren. Nichts fürchtet Bushs Team mehr. Es wäre der Moment, in dem die Dämme brächen.
Schon jetzt hat George Bush sein wichtiges Kapital angegriffen. Es ist seine Glaubwürdigkeit, die er bei seinen Landsleuten nach dem 11.September erworben hat. Mehr als die Hälfte der Amerikaner meint nach jüngsten Umfragen, die Regierung habe die Bedrohung durch Saddam Hussein bewusst übertrieben. „Das Thema Massenvernichtungswaffen wird nicht einfach verschwinden, wie sich die Regierung das wünscht“, schreibt der Historiker Arthur Schlesinger jr. „Teile des Kongresses und der Medien werden ihre Ehre wiedergewinnen und ihre Befreiung von Bush/Cheney/Rumsfeld demonstrieren wollen.“ Zugleich könne „die Glaubwürdigkeitslücke“ Bush international lähmen und seine Doktrin des Vorbeuge-Krieges aushöhlen. Oder wie es der frühere Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski sagt: „Zur Debatte steht jetzt die amerikanische Führung in der Welt. Die basiert zu großen Teilen darauf, dass man den Vereinigten Staaten glaubt.“
Die Bush-Regierung beharrt darauf, dass ihr Casus für den Krieg auch nach diesem Teilrückzug nicht erschüttert ist. Aber was, wenn die Causa Niger nicht das Ende, sondern erst der Anfang aller Aufdeckungen ist?
Mit jedem neuen Detail wird Bush verwundbarer
Dass die Niger-Affäre ein Wendepunkt der Regierung Bush werden könnte, haben zuerst seine Herausforderer von den Demokraten erkannt. Im halben Dutzend sind sie über George Bush hergefallen, auch jene, die sich bisher zurückhalten mussten, weil sie im Kongress für den Irak-Krieg stimmten. Es scheint, als sei die Jagdsaison eröffnet. Mit jedem toten Soldaten im Irak, mit jedem neu enthüllten Detail der Niger-Affäre wittern sie eine neue Chance, Bushs Außenpolitik frontal anzugreifen. Ein internes Strategiepapier aus dem Kongress (das der ZEIT vorliegt) weist den Weg:
– Man will betonen, dass es nicht nur um „16 Worte geht“, sondern um „Manipulationen auf breiter Front“.
– Es soll klargemacht werden, dass Donald Rumsfeld, Richard Cheney und Condoleezza Rice nicht nur „betrogene Konsumenten“ der Geheimdienste waren, sondern sich selbst „an der Verzerrung beteiligt“ haben.
Zugleich mahnt das Papier zur Vorsicht. Die Demokraten sollten „zumindest im Augenblick darauf verzichten, den Präsidenten der Lüge zu bezichtigen“. Denn: „Wir wissen nicht, ob er es getan hat.“ Die Wähler würden nicht glauben, dass ihr Präsident sie angelogen habe, es sei denn, es gebe „unwiderlegbare Beweise“. Stattdessen solle man sich auf Cheney und Rumsfeld einschießen. George Bush werde dann automatisch verwundbar.
Der lässt unterdessen seinen Sprecher im Gestus ruhiger Unbeirrtheit vortragen: „Der Präsident hat die Sache hinter sich gelassen. Und, offen gesagt, der größte Teil des Landes auch.“ Man wird sehen.
(c) DIE ZEIT 17.07.2003 Nr.30
Irak
Die große Säuberung
Hat US-Präsident Bush gelogen? Seine Helfer mussten zugeben, Belege für das irakische Waffen-Programm manipuliert zu haben. Nun werden Sündenböcke gesucht
Von Thomas Kleine-Brockhoff
Washington
George Bush trat sein Amt mit dem erklärten Vorsatz an, „Ehre und Würde“ im Weißen Haus wiederherzustellen. Der Präsident hat Wort gehalten, wenn als Maßstab gelten darf, dass er nicht im Büro über eine Praktikantin herfiel und später behauptete, er habe mit „dieser Frau“ keinen Sex gehabt. Stattdessen scheint George Bush aber eine andere amerikanische Institution befleckt zu haben: die traditionelle „Rede zur Lage der Nation“. Von den Gründervätern aus Misstrauen gegenüber der Macht erfunden, soll der demokratisch gewählte Herrscher mit ihr dem Parlament Rechenschaft ablegen. Es ist die wichtigste Rede eines Präsidenten im Jahreskalender. Jeder Satz, jedes Wort ist tausendmal berührt, gewendet, verbessert, überprüft, geprobt worden. Der ganze Regierungsapparat dient als Ideenpool und Faktenprüfer.
Derart vorbereitet, spricht George Bush am 28. Januar 2003 zu Parlament, Volk und Welt. 5400 Worte, von denen – nach gegenwärtigem Stand – 16 falsch sind oder einen falschen Eindruck erwecken. Sie hätten „nie in den Text gelangen dürfen“, wie die Regierung Ende vergangener Woche einräumen musste. Nicht um eine Lappalie geht es, um irgendein unbedeutendes Sätzchen, sondern um 16 Worte, die zur Begründung einer radikalen Idee zählen: des Präventivkrieges gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein. Von dem heißt es damals, er versuche sich neuerlich am Bau von Atomwaffen. Die 16 Worte lauten: „Die britische Regierung hat herausgefunden, dass Saddam Hussein jüngst größere Mengen Uran aus Afrika kaufen wollte.“
Aufgrund täglicher Enthüllungen stellt sich nun heraus, dass dieser Sachverhalt in der amerikanischen Regierung monatelang umstritten war, Gegenstand von Recherchen, Notizen, Treffen, Interventionen, Erkundungen und vielen, vielen Zweifeln. Über alle Zweifler setzte sich das Weiße Haus hinweg und muss nun die Konsequenzen tragen. Wochenlang hat der Skandal, aus England kommend, das Weiße Haus umkreist, jetzt ist er eingedrungen, sogar bis hinein ins Oval Office des Präsidenten. Das Eingeständnis bedeutet das Ende der Teflon-Präsidentschaft des George Bush. Jetzt bleibt etwas kleben. Binnen Tagen hat sich die politische Dynamik in Washington verändert. Es ist ein Fest für die Opposition.
Der Kreis rund um den Präsidenten hat das sofort verstanden und panisch reagiert, Ende vergangener Woche in „tumultuösen 24 Stunden“ (CBS News) gipfelnd. Ein derart peinliches Spektakel wechselseitiger Beschuldigungen hat diese Regierung, ansonsten von Korpsgeist beseelt, noch nie geboten. Ausgerechnet jener Verteidigungsminister will nichts gewusst haben, der immer vor einem „11. September mit Massenvernichtungswaffen“ gewarnt hatte. Auch nicht jener Vizepräsident, der noch wenige Tage vor der Invasion behauptete, der Irak arbeite an Atomwaffen. Erst recht nicht die Sicherheitsberaterin, die gesagt hatte: „Es wird immer eine gewisse Unsicherheit bleiben, wie schnell Saddam eine Atomwaffe bekommen kann. Aber wir wollen eben nicht, dass der letzte Beweis ein Atompilz ist.“ Am Ende wird für die verhängnisvollen 16 Worte ein Sündenbock gefunden: Der CIA-Chef muss ein Schuldbekenntnis abgeben. Was bleibt ihm auch übrig? George Bush hat sich schon reingewaschen: „Ich habe der Nation eine Rede vorgetragen, die unsere Geheimdienste zuvor überprüft hatten.“
„Ich hatte keinen Sex mit diesem Gelbkuchen“
Doch die jüngsten Enthüllungen lassen auch diese Version zweifelhaft erscheinen, sodass die freie Übersetzung des Präsidentensatzes (in der parodistischen Version des Wall Street Journal) lautet: „Ich hatte keinen Sex mit diesem Gelbkuchen.“ Ja, Gelbkuchen (englisch: yellowcake), darum geht es. Leuchtend gelbes Uranoxidpulver, das zum Bau der Bombe benötigt wird. Es ist offenbar der italienische Geheimdienst, der Ende 2001 erstmals Hinweise auf einen Versuch des Iraks erhält, in der zentralafrikanischen Republik Niger Gelbkuchen anzukaufen. Ein halbes Dutzend Briefe und Dokumente der Verhandlungspartner gehen den Italienern zu – und werden an Briten und Amerikaner weitergeleitet. Der Niger-Bericht gerät ins morgendliche Geheimdienstbriefing des Weißen Hauses, und der Vizepräsident horcht auf. Richard Cheney gilt seit Jahren als Härtester unter den Hardlinern. Auf Anregung seiner Mitarbeiter schickt die CIA einen Rechercheur in den Niger. Der Mann heißt Joseph Wilson und ist pensionierter Diplomat. Er bricht im Februar 2002 auf, berichtet öffentlich aber erst vor zehn Tagen von seiner Mission – und löst damit den Skandal aus. Wilson kam im Niger zu dem Schluss, dass es sich bei der Geschichte um eine Ente handeln müsse. Zurück in Washington, berichtet Wilson der CIA und dem Außenministerium. Er geht davon aus, dass auch dem Auftraggeber, dem Büro des Vizepräsidenten, die Ergebnisse übermittelt werden. Doch das sei nicht geschehen, behauptet nun CIA-Chef George Tenet in seiner Mea-culpa-Erklärung. Ob er damit lediglich den Vizepräsidenten schützen will, wird nun zu klären sein.
Unumstritten ist, dass die CIA am 9. März 2002 ein Memo über die Reise Wilsons ins Weiße Haus schickt. Am 18. März 2002 erhält Außenminister Colin Powell ein ähnliches Papier. Die Sache scheint geklärt: Nichts dran an der Gelbkuchen-Geschichte. – Bis die britische Regierung im September 2002 ein Irak-Dossier veröffentlicht, das neuerlich den alten Verdacht enthält. Offenbar versucht George Tenet, den Engländern den Vorwurf auszureden. Vergebens. Tenet erfährt, die Engländer hätten zusätzlich eine eigene Quelle, die sie nicht nennen wollten. Es soll sich dabei, wie die Financial Times berichtet, um den französischen Geheimdienst handeln, was der Affäre eine pikante neue Dimension verleiht.
Einen Monat später interveniert George Tenet persönlich im Weißen Haus, als er ein Redemanuskript des Präsidenten für eine Ansprache in Cincinnati liest. Die Niger-Story ist wieder da, wird aber auf Tenets Drängen getilgt. Zum Showdown kommt es wenige Tage vor der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation, als sich die Experten zur Beratung treffen. Die CIA schickt einen Mann namens Alan Foley, das Weiße Haus vertritt Robert Joseph vom Nationalen Sicherheitsrat. Auch wenn sich die Berichte der beiden Herren in Details widersprechen, eines scheint klar: Die CIA möchte den ganzen Satz streichen. Das Weiße Haus will nur Änderungen akzeptieren. Am Ende schlägt es vor, die Sache unpräzise zu formulieren, sich einfach auf den englischen Bericht zu beziehen und nicht von „Niger“, sondern von „Afrika“ zu sprechen. Schließlich gibt die CIA nach.
Dieser Ablauf zeigt: Nicht die amerikanischen Nachrichtendienste haben die Politik in die Irre geführt. Nicht das Weiße Haus ist betrogen worden. Es hat sein Irak-Argument höchstselbst auf die Spitze getrieben, es hat pointiert, wo es hinreichende Gewissheit nicht geben konnte.
Dieselbe Niger-Information liegt drei Tage nach Bushs Rede wieder auf dem Tisch, als Colin Powell die Nacht in der CIA-Zentrale verbringt. Er bereitet dort seine (inzwischen ebenfalls umstrittene) Präsentation vor dem Weltsicherheitsrat vor. Einen Niger-Passus enthält Powells Rede vom 5. Februar 2003 nicht. Anders als das Personal rund um den Präsidenten lässt sich der Außenminister offenbar von Zweiflern überzeugen.
Aus dieser Rekonstruktion ergeben sich drei Fragen: Warum leistet George Tenet im entscheidenden Moment nicht heftiger Widerstand? Warum hört die Regierung nicht auf Tenet? Und warum wird nun ausgerechnet der Warner zur öffentlichen Selbstbezichtigung gezwungen?
Schon einmal, nach dem Geheimdienstdebakel um den 11. September 2001, scheint der CIA-Chef auf dem Weg in den Vorruhestand zu sein. Doch George Bush hält an Tenet fest. Der Präsident mag im Moment der nationalen Krise nicht den Geheimdienst-Chef auswechseln und erlebt in Tenet einen dynamischen Reformer, ja einen Draufgänger, der Bush die riskante Strategie des Afghanistan-Krieges vorschlägt. Bush zeichnet Tenets Kriegsplan ab und damit eine bedeutende Rolle für dessen Spione; er setzt neue Befugnisse für die Geheimen durch und eine gewaltige Budgeterhöhung. Binnen Monaten ist Tenet vom Wackelkandidaten zum mächtigsten CIA-Chef seit Allen Dulles in den fünfziger Jahren geworden. Jeden Morgen sehen sich Bush und Tenet beim Geheimdienst-Briefing und haben sich dabei, so heißt es, persönlich schätzen gelernt. Jedenfalls scheint Tenets Loyalität gegenüber dem Kreis um Bush derart ausgeprägt, dass offener Widerstand unwahrscheinlich geworden ist.
Umgekehrt haben die Rechtsausleger im Team Bush nicht vergessen, dass George Tenet keiner der Ihren ist. Ein ideologisch Unzuverlässiger, von Bill Clinton ernannt, im inneren Machtgefüge der Regierung den Moderaten um Colin Powell zuzurechnen. Ein Mann, der eine Behörde von lauter Stubenhockern führt. Besonders tief sitzt das Vorurteil von den schlappen Schlapphüten bei den Neokonservativen. Deren Vordenker Paul Wolfowitz war Mitglied von „Team B“, einer Gruppe, die in den siebziger Jahren CIA-Analysen über die militärische Stärke der Sowjetunion überprüfen sollte. Die Arbeitsgruppe bezeichnete die Annahmen der CIA als naiv oder viel zu vorsichtig. Diese Einschätzung wurde zur Grundlage der Aufrüstung während der Reagan-Jahre. Dass Team B die Stärke der Sowjetunion dramatisch überschätzt hatte, wurde nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr erörtert.
Dass Donald Rumsfeld im Verteidigungsministerium seine eigene Geheimtruppe zur Auswertung von Irak-Informationen gründet, das Office of Special Plans, ist Ausdruck seines tiefen Misstrauens gegenüber der CIA. Die rechten Revolutionäre wollen die ganze Haltung gegenüber Fakten und Indizien verändert sehen, wie Pentagon-Berater Richard Perle im März 2001 vor dem Kongress klarmacht. Auf die Frage nach Saddam Husseins Atomprogramm sagte Perle: „Wie weit er ist, wissen wir nicht genau. Meine Vermutung ist: schon weiter, als wir glauben. Saddam Hussein ist immer weiter, als wir glauben, weil wir uns ständig darauf beschränken, zu sagen, was wir beweisen können.“
Der Fesseln der Empirie entledigen sich die Hardliner, wie der Fall Niger zeigt, nach dem 11.September 2001 bisweilen erfolgreich. Es reicht ihnen offenbar aus, dass sie selbst von guten Intentionen getragen werden, Saddam Hussein aber böse Absichten hegt. Der Fall Niger ist Folge dieses manichäischen Weltbildes. „Die Indizien legen nahe“, schreibt das Magazin Time, „dass viele in der Bush-Administration die Niger-Connection einfach glauben wollten.“
Dass gerade George Tenet zur öffentlichen Entblößung gezwungen und auf Dauer wohl sein Amt verlieren wird, hat wenig mit Fakten und viel mit Politik zu tun. Hier übernimmt nicht ein Mitglied von Bushs Führungsmannschaft Verantwortung. Vielmehr ist eine politische Säuberung zu besichtigen. Allerdings dürfte Tenet nicht ganz fallen gelassen werden, jedenfalls noch nicht. Wird er gefeuert, dürfte sich der CIA-Apparat mit Indiskretionen wehren. Nichts fürchtet Bushs Team mehr. Es wäre der Moment, in dem die Dämme brächen.
Schon jetzt hat George Bush sein wichtiges Kapital angegriffen. Es ist seine Glaubwürdigkeit, die er bei seinen Landsleuten nach dem 11.September erworben hat. Mehr als die Hälfte der Amerikaner meint nach jüngsten Umfragen, die Regierung habe die Bedrohung durch Saddam Hussein bewusst übertrieben. „Das Thema Massenvernichtungswaffen wird nicht einfach verschwinden, wie sich die Regierung das wünscht“, schreibt der Historiker Arthur Schlesinger jr. „Teile des Kongresses und der Medien werden ihre Ehre wiedergewinnen und ihre Befreiung von Bush/Cheney/Rumsfeld demonstrieren wollen.“ Zugleich könne „die Glaubwürdigkeitslücke“ Bush international lähmen und seine Doktrin des Vorbeuge-Krieges aushöhlen. Oder wie es der frühere Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski sagt: „Zur Debatte steht jetzt die amerikanische Führung in der Welt. Die basiert zu großen Teilen darauf, dass man den Vereinigten Staaten glaubt.“
Die Bush-Regierung beharrt darauf, dass ihr Casus für den Krieg auch nach diesem Teilrückzug nicht erschüttert ist. Aber was, wenn die Causa Niger nicht das Ende, sondern erst der Anfang aller Aufdeckungen ist?
Mit jedem neuen Detail wird Bush verwundbarer
Dass die Niger-Affäre ein Wendepunkt der Regierung Bush werden könnte, haben zuerst seine Herausforderer von den Demokraten erkannt. Im halben Dutzend sind sie über George Bush hergefallen, auch jene, die sich bisher zurückhalten mussten, weil sie im Kongress für den Irak-Krieg stimmten. Es scheint, als sei die Jagdsaison eröffnet. Mit jedem toten Soldaten im Irak, mit jedem neu enthüllten Detail der Niger-Affäre wittern sie eine neue Chance, Bushs Außenpolitik frontal anzugreifen. Ein internes Strategiepapier aus dem Kongress (das der ZEIT vorliegt) weist den Weg:
– Man will betonen, dass es nicht nur um „16 Worte geht“, sondern um „Manipulationen auf breiter Front“.
– Es soll klargemacht werden, dass Donald Rumsfeld, Richard Cheney und Condoleezza Rice nicht nur „betrogene Konsumenten“ der Geheimdienste waren, sondern sich selbst „an der Verzerrung beteiligt“ haben.
Zugleich mahnt das Papier zur Vorsicht. Die Demokraten sollten „zumindest im Augenblick darauf verzichten, den Präsidenten der Lüge zu bezichtigen“. Denn: „Wir wissen nicht, ob er es getan hat.“ Die Wähler würden nicht glauben, dass ihr Präsident sie angelogen habe, es sei denn, es gebe „unwiderlegbare Beweise“. Stattdessen solle man sich auf Cheney und Rumsfeld einschießen. George Bush werde dann automatisch verwundbar.
Der lässt unterdessen seinen Sprecher im Gestus ruhiger Unbeirrtheit vortragen: „Der Präsident hat die Sache hinter sich gelassen. Und, offen gesagt, der größte Teil des Landes auch.“ Man wird sehen.
(c) DIE ZEIT 17.07.2003 Nr.30

da laufen aber die US Schulden - Bush ist teuer 
http://www.angelfire.com/ok5/pearly/htmls/gop-debtclock.html
Dolby ich hab "Stupid White Men" als PDF kann ich dir zusenden per Mail

http://www.angelfire.com/ok5/pearly/htmls/gop-debtclock.html
Dolby ich hab "Stupid White Men" als PDF kann ich dir zusenden per Mail

Datum Bush: Steuersenkung hilft Arbeitsmarkt
21.07. / 11:00
US-Präsident George W. Bush sagte am Samstag im US-amerikanischen Fernsehen, dass die Steuersenkungen dazu führen werden, dass die Wirtschaft so stark an Fahrt gewinnen wird, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Bush rechnet aufgrund des höheren frei verfügbaren Einkommens mit einer höheren Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Zur Bedienung dieser höheren Nachfrage werden die Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen müssen, so Bush.
© BörseGo

21.07. / 11:00
US-Präsident George W. Bush sagte am Samstag im US-amerikanischen Fernsehen, dass die Steuersenkungen dazu führen werden, dass die Wirtschaft so stark an Fahrt gewinnen wird, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Bush rechnet aufgrund des höheren frei verfügbaren Einkommens mit einer höheren Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Zur Bedienung dieser höheren Nachfrage werden die Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen müssen, so Bush.
© BörseGo

http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,258060,00.html
EUROPA
Die neue Unbefangenheit
Rechnen die Russen ihre Ölexporte künftig in Euro statt in Dollar ab? Europa spannt die Muskeln - und die Amerikaner wundern sich.
Romano Prodi krönte das Mittagsmahl, zu dem er die 25 Brüsseler Botschafter der erweiterten Europäischen Union Anfang Juli eingeladen hatte, mit einem politischen Leckerbissen. Dank seiner guten Kontakte in Moskau, so der Kommissionspräsident bei Tisch, gehe er davon aus, dass Russland demnächst seinen gesamten Erdöl- und Gasexport in die EU nicht mehr in US-Dollar abrechnen wolle, sondern in Euro. Putin wolle die Anbindung an die EU drastisch ausbauen. Das wäre ein Triumph für die Europäer und ein herber Schlag für die USA. Gründet sich doch deren Macht auch auf die bislang unangefochtene Herrschaft ihres Dollar als Leitwährung im globalen Energiegeschäft.
Sollte der Euro im Geschäft mit den Russen, die über 50 Prozent der Brennstoffe der EU liefern, den Dollar verdrängen - den Beziehungen zwischen Washington und Brüssel würde es kaum weiteren Abbruch tun. Sie sind bereits schlecht genug.
Die Amerikaner sehen sich mit einer europäischen Herausforderung konfrontiert, die weit über alle bisherigen Emanzipationsversuche Europas hinausgeht. Ohne Vorbehalt stehen auch jene EU-Mitgliedstaaten, die sich im Irak-Krieg noch uneingeschränkt zu George W. Bush bekannten, hinter dem ersten eigenen sicherheitsstrategischen Konzept der Gemeinschaft.
Die Botschaft des Papiers, dessen Grundzüge festliegen und das auf dem Gipfel im Dezember in Rom verabschiedet werden soll, lautet: "Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450 Millionen Einwohnern, die ein Viertel des Bruttosozialprodukts weltweit erwirtschaften, ist die Europäische Union - ob es einem gefällt oder nicht - ein globaler Akteur", bereit auch, Verantwortung für die globale Sicherheit zu tragen.
Die Unterstützerfront für die USA in den östlichen EU-Beitrittsstaaten bröckelt, weil sich deren Regierungen in Washington keine nennenswerten Vorteile, bei den EU-Altstaaten aber viel Ärger eingehandelt haben. Entzaubert sind die Amerikaner auch durch ihr offensichtliches Unvermögen, der Probleme in Afghanistan wie im Irak Herr zu werden. Die Abweichler wollen dabei sein, wenn die Union sich jetzt langsam, aber stetig militärische Fähigkeiten zulegt und in der Weltpolitik mitzureden anschickt.
Selbst US-Präsident George W. Bush kommt nicht mehr umhin, die EU wahrzunehmen. Noch im vergangenen Jahr hatte er den Routine-Gipfel mit der EU demonstrativ als lästige Pflichtübung kurz und knapp hinter sich gebracht.
Diesmal, beim Zusammentreffen mit der EU-Spitze Ende Juni im Weißen Haus, schien er zumindest zum Zuhören bereit. Als Prodi und der amtierende EU-Ratspräsident, der griechische Premierminister Kostas Simitis, berichteten, die Union sei im Begriff, sich eine Verfassung zuzulegen, entfuhr es Bush: "Oh, das ist ja sehr interessant, was ihr da erzählt." Dieser Präsident, räumte er ein, müsse noch "besser verstehen" lernen, wie die Union funktioniere.
Natürlich sei es für ihn leichter, mit nationalen Vertretern aus einzelnen Mitgliedstaaten als mit der EU zurechtzukommen, so Bush. Aber so viel habe er schon verstanden: Die Union sei "so ein Ding in Bewegung, von dem man nicht so genau weiß, wohin es sich entwickelt". Es sei ihm aber klar, dass man vor "großen Veränderungen" stehe und die Kapazitäten der EU noch wachsen würden.
Offen redete Bush dann, das ergibt sich weiter aus Protokollnotizen in Händen deutscher Diplomaten in Washington, über die gestörten Beziehungen zwischen alter und neuer Welt: Man habe sich "irgendwie entfremdet". Seine Pflicht sei es nun, erklärte Bush, seine Landsleute eindringlich zu ermahnen, dass die Beziehungen zu Europa wichtig, ja von nationalem Interesse seien: "Schließlich sind sie ja Milliarden von Dollar wert."
Aus der neuen strategischen Doktrin der EU pickte sich Bush jene Passagen heraus, die ihm passten: Die EU würde ihre Interessen ja nun auch global definieren, sich weltweit im Kampf gegen internationalen Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen engagieren, auch unter Einsatz militärischer Mittel. Bush: "Da müssen wir fest zusammenstehen." Man spreche dieselbe Sprache.
Das ist offenkundig nicht der Fall. Denn über weite Strecken steht die europäische Doktrin in krassem Widerspruch zur neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA. Washington begründet darin mit den Anschlägen des 11. September seinen Anspruch, "präventiv" und gegebenenfalls auch "allein" mit militärischer Gewalt gegen Terroristen und gegen Schurkenstaaten loszuschlagen.
Die EU-Leitsätze halten dagegen: "Kein Land ist in der Lage, die komplexen Probleme im Alleingang zu lösen." Keiner der neuen Bedrohungen lasse sich "mit rein militärischen Mitteln begegnen". Präventives Handeln müsse ein Mix von Maßnahmen sein - politische, wirtschaftliche, humanitäre und erst als Letztes militärische Mittel. Und, selbstbewusst: "Die EU ist dafür besonders gut ausgerüstet."
Gegen die amerikanische Missachtung des Völkerrechts und des Willens der Vereinten Nationen wie im Fall der Irak-Invasion setzt Brüssel als "vorrangiges Ziel" die Stärkung der Uno. Es gelte, "gut funktionierende internationale Institutionen" in einer "normengestützten Weltordnung" zu schaffen, dabei auch den von den USA boykottierten Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen.
Derlei Positionen der Europäer bedachte Bush beim Gipfel mit der EU noch mit Spott. Internationale Organisationen würde man ja auch gern stützen, "wenn die nur mehr Zähne hätten".
Und als Prodi sagte, die EU wisse nicht, was mit dem von den USA abgelehnten Klimaschutz-Protokoll von Kyoto zu tun sei, konterte Bush grinsend: "Ich weiß, was zu tun ist." Vergesst es, war die Botschaft.
Wie es wirklich zwischen den USA und der EU steht, hatten kurz zuvor Prodis Spitzenbeamte zu hören bekommen. Der Planungschef im US-Außenministerium, Richard Haass: Die Beschwörung gemeinsamer Werte sei "weitgehend Geschwafel". "Den Westen" gebe es nicht mehr. Er wache auch keineswegs jeden Morgen in Sorge um den Zusammenhalt der EU auf. Es mache ihm geradezu Spaß, die Europäer gegeneinander auszuspielen.
Die sind von der angeblichen Allmacht der USA immer weniger überzeugt. Sowohl an Bevölkerung als auch an Wirtschaftskraft sei die erweiterte EU nahezu ebenbürtig. Die transatlantischen Beziehungen nennt die EU-Doktrin wohl "unersetzlich". Jedoch werde sich die EU "auf die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit Russland, Japan, China, Kanada und Indien konzentrieren". Und: "Keine unserer Beziehungen wird exklusiv sein."
Die westliche Supermacht wurde nicht ein einziges Mal informiert oder gar konsultiert, als sich Javier Solanas politischer Stab in Brüssel unter Leitung des deutschen Diplomaten Christoph Heusgen an den Entwurf machte. Der Hohe außenpolitische Repräsentant der EU hatte das Projekt bei einem vertraulichen Treffen mit den Außenministern Jack Straw aus London, Dominique de Villepin aus Paris und Joschka Fischer aus Berlin im Hinterzimmer des Restaurants "Chez Marius" an Brüssels Place du Petit Sablon kurz nach Ende des Irak-Krieges ausgeheckt.
Ähnliche Vorstöße der EU waren in den vergangenen Jahren von den USA stets mit Hinweis auf die Nato-Doktrin unterlaufen worden. Diesmal aber nickten selbst USA-Freunde wie Dänen und Italiener die Solana-Vorlage ab.

Ebenso einmütig beschlossen die EU-Häuptlinge, im Jahr 2004 eine europäische Rüstungsagentur zu schaffen. Deren Hauptaufgabe: die 160 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben der 25 EU-Länder, die über 50 Prozent des US-Verteidigungshaushalts ausmachen, aber nur 10 Prozent des Wirkungsgrads der amerikanischen Militärmaschinerie erzielen, durch Kooperation und Koordination effektiver einzusetzen.
Militärisch sind die Amerikaner, das sehen natürlich auch EU-Analytiker, unangefochten die Nummer eins in der Welt. Dennoch verstören die Anfänge europäischer Selbständigkeit in der Sicherheitspolitik das US-Personal. So intervenierte der amerikanische Gesandte in Brüssel, Rockwell Schnabel, mehrfach bei Solana-Beamten der Kommission: warum die EU vor ihrer Entscheidung, im Kongo mit eigenen Truppen einzugreifen, nicht bei ihm oder in Washington angefragt habe.
Die neue Unbefangenheit ist der Bush-Administration so wenig geheuer, dass sie von früheren Zusagen nichts mehr wissen will. Die Übergabe der Sfor-Militäraufgaben in Bosnien an die EU wird verzögert, ein militärisches EU-Engagement in der von Separatismus geplagten ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien soll unter Nato-Kontrolle gehalten werden.
WINFRIED DIDZOLEIT, DIRK KOCH
---------
Europa wird mit Russland die nächste Weltmacht.
Wenn uns der Ami vorher nicht angreift!
EUROPA
Die neue Unbefangenheit
Rechnen die Russen ihre Ölexporte künftig in Euro statt in Dollar ab? Europa spannt die Muskeln - und die Amerikaner wundern sich.
Romano Prodi krönte das Mittagsmahl, zu dem er die 25 Brüsseler Botschafter der erweiterten Europäischen Union Anfang Juli eingeladen hatte, mit einem politischen Leckerbissen. Dank seiner guten Kontakte in Moskau, so der Kommissionspräsident bei Tisch, gehe er davon aus, dass Russland demnächst seinen gesamten Erdöl- und Gasexport in die EU nicht mehr in US-Dollar abrechnen wolle, sondern in Euro. Putin wolle die Anbindung an die EU drastisch ausbauen. Das wäre ein Triumph für die Europäer und ein herber Schlag für die USA. Gründet sich doch deren Macht auch auf die bislang unangefochtene Herrschaft ihres Dollar als Leitwährung im globalen Energiegeschäft.
Sollte der Euro im Geschäft mit den Russen, die über 50 Prozent der Brennstoffe der EU liefern, den Dollar verdrängen - den Beziehungen zwischen Washington und Brüssel würde es kaum weiteren Abbruch tun. Sie sind bereits schlecht genug.
Die Amerikaner sehen sich mit einer europäischen Herausforderung konfrontiert, die weit über alle bisherigen Emanzipationsversuche Europas hinausgeht. Ohne Vorbehalt stehen auch jene EU-Mitgliedstaaten, die sich im Irak-Krieg noch uneingeschränkt zu George W. Bush bekannten, hinter dem ersten eigenen sicherheitsstrategischen Konzept der Gemeinschaft.
Die Botschaft des Papiers, dessen Grundzüge festliegen und das auf dem Gipfel im Dezember in Rom verabschiedet werden soll, lautet: "Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450 Millionen Einwohnern, die ein Viertel des Bruttosozialprodukts weltweit erwirtschaften, ist die Europäische Union - ob es einem gefällt oder nicht - ein globaler Akteur", bereit auch, Verantwortung für die globale Sicherheit zu tragen.
Die Unterstützerfront für die USA in den östlichen EU-Beitrittsstaaten bröckelt, weil sich deren Regierungen in Washington keine nennenswerten Vorteile, bei den EU-Altstaaten aber viel Ärger eingehandelt haben. Entzaubert sind die Amerikaner auch durch ihr offensichtliches Unvermögen, der Probleme in Afghanistan wie im Irak Herr zu werden. Die Abweichler wollen dabei sein, wenn die Union sich jetzt langsam, aber stetig militärische Fähigkeiten zulegt und in der Weltpolitik mitzureden anschickt.
Selbst US-Präsident George W. Bush kommt nicht mehr umhin, die EU wahrzunehmen. Noch im vergangenen Jahr hatte er den Routine-Gipfel mit der EU demonstrativ als lästige Pflichtübung kurz und knapp hinter sich gebracht.
Diesmal, beim Zusammentreffen mit der EU-Spitze Ende Juni im Weißen Haus, schien er zumindest zum Zuhören bereit. Als Prodi und der amtierende EU-Ratspräsident, der griechische Premierminister Kostas Simitis, berichteten, die Union sei im Begriff, sich eine Verfassung zuzulegen, entfuhr es Bush: "Oh, das ist ja sehr interessant, was ihr da erzählt." Dieser Präsident, räumte er ein, müsse noch "besser verstehen" lernen, wie die Union funktioniere.
Natürlich sei es für ihn leichter, mit nationalen Vertretern aus einzelnen Mitgliedstaaten als mit der EU zurechtzukommen, so Bush. Aber so viel habe er schon verstanden: Die Union sei "so ein Ding in Bewegung, von dem man nicht so genau weiß, wohin es sich entwickelt". Es sei ihm aber klar, dass man vor "großen Veränderungen" stehe und die Kapazitäten der EU noch wachsen würden.
Offen redete Bush dann, das ergibt sich weiter aus Protokollnotizen in Händen deutscher Diplomaten in Washington, über die gestörten Beziehungen zwischen alter und neuer Welt: Man habe sich "irgendwie entfremdet". Seine Pflicht sei es nun, erklärte Bush, seine Landsleute eindringlich zu ermahnen, dass die Beziehungen zu Europa wichtig, ja von nationalem Interesse seien: "Schließlich sind sie ja Milliarden von Dollar wert."
Aus der neuen strategischen Doktrin der EU pickte sich Bush jene Passagen heraus, die ihm passten: Die EU würde ihre Interessen ja nun auch global definieren, sich weltweit im Kampf gegen internationalen Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen engagieren, auch unter Einsatz militärischer Mittel. Bush: "Da müssen wir fest zusammenstehen." Man spreche dieselbe Sprache.
Das ist offenkundig nicht der Fall. Denn über weite Strecken steht die europäische Doktrin in krassem Widerspruch zur neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA. Washington begründet darin mit den Anschlägen des 11. September seinen Anspruch, "präventiv" und gegebenenfalls auch "allein" mit militärischer Gewalt gegen Terroristen und gegen Schurkenstaaten loszuschlagen.
Die EU-Leitsätze halten dagegen: "Kein Land ist in der Lage, die komplexen Probleme im Alleingang zu lösen." Keiner der neuen Bedrohungen lasse sich "mit rein militärischen Mitteln begegnen". Präventives Handeln müsse ein Mix von Maßnahmen sein - politische, wirtschaftliche, humanitäre und erst als Letztes militärische Mittel. Und, selbstbewusst: "Die EU ist dafür besonders gut ausgerüstet."
Gegen die amerikanische Missachtung des Völkerrechts und des Willens der Vereinten Nationen wie im Fall der Irak-Invasion setzt Brüssel als "vorrangiges Ziel" die Stärkung der Uno. Es gelte, "gut funktionierende internationale Institutionen" in einer "normengestützten Weltordnung" zu schaffen, dabei auch den von den USA boykottierten Internationalen Strafgerichtshof zu unterstützen.
Derlei Positionen der Europäer bedachte Bush beim Gipfel mit der EU noch mit Spott. Internationale Organisationen würde man ja auch gern stützen, "wenn die nur mehr Zähne hätten".
Und als Prodi sagte, die EU wisse nicht, was mit dem von den USA abgelehnten Klimaschutz-Protokoll von Kyoto zu tun sei, konterte Bush grinsend: "Ich weiß, was zu tun ist." Vergesst es, war die Botschaft.
Wie es wirklich zwischen den USA und der EU steht, hatten kurz zuvor Prodis Spitzenbeamte zu hören bekommen. Der Planungschef im US-Außenministerium, Richard Haass: Die Beschwörung gemeinsamer Werte sei "weitgehend Geschwafel". "Den Westen" gebe es nicht mehr. Er wache auch keineswegs jeden Morgen in Sorge um den Zusammenhalt der EU auf. Es mache ihm geradezu Spaß, die Europäer gegeneinander auszuspielen.
Die sind von der angeblichen Allmacht der USA immer weniger überzeugt. Sowohl an Bevölkerung als auch an Wirtschaftskraft sei die erweiterte EU nahezu ebenbürtig. Die transatlantischen Beziehungen nennt die EU-Doktrin wohl "unersetzlich". Jedoch werde sich die EU "auf die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit Russland, Japan, China, Kanada und Indien konzentrieren". Und: "Keine unserer Beziehungen wird exklusiv sein."
Die westliche Supermacht wurde nicht ein einziges Mal informiert oder gar konsultiert, als sich Javier Solanas politischer Stab in Brüssel unter Leitung des deutschen Diplomaten Christoph Heusgen an den Entwurf machte. Der Hohe außenpolitische Repräsentant der EU hatte das Projekt bei einem vertraulichen Treffen mit den Außenministern Jack Straw aus London, Dominique de Villepin aus Paris und Joschka Fischer aus Berlin im Hinterzimmer des Restaurants "Chez Marius" an Brüssels Place du Petit Sablon kurz nach Ende des Irak-Krieges ausgeheckt.
Ähnliche Vorstöße der EU waren in den vergangenen Jahren von den USA stets mit Hinweis auf die Nato-Doktrin unterlaufen worden. Diesmal aber nickten selbst USA-Freunde wie Dänen und Italiener die Solana-Vorlage ab.

Ebenso einmütig beschlossen die EU-Häuptlinge, im Jahr 2004 eine europäische Rüstungsagentur zu schaffen. Deren Hauptaufgabe: die 160 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben der 25 EU-Länder, die über 50 Prozent des US-Verteidigungshaushalts ausmachen, aber nur 10 Prozent des Wirkungsgrads der amerikanischen Militärmaschinerie erzielen, durch Kooperation und Koordination effektiver einzusetzen.
Militärisch sind die Amerikaner, das sehen natürlich auch EU-Analytiker, unangefochten die Nummer eins in der Welt. Dennoch verstören die Anfänge europäischer Selbständigkeit in der Sicherheitspolitik das US-Personal. So intervenierte der amerikanische Gesandte in Brüssel, Rockwell Schnabel, mehrfach bei Solana-Beamten der Kommission: warum die EU vor ihrer Entscheidung, im Kongo mit eigenen Truppen einzugreifen, nicht bei ihm oder in Washington angefragt habe.
Die neue Unbefangenheit ist der Bush-Administration so wenig geheuer, dass sie von früheren Zusagen nichts mehr wissen will. Die Übergabe der Sfor-Militäraufgaben in Bosnien an die EU wird verzögert, ein militärisches EU-Engagement in der von Separatismus geplagten ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien soll unter Nato-Kontrolle gehalten werden.
WINFRIED DIDZOLEIT, DIRK KOCH
---------
Europa wird mit Russland die nächste Weltmacht.
Wenn uns der Ami vorher nicht angreift!
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,258011,00.html
UNGLEICHHEIT IN DEN USA
Land der begrenzten Möglichkeiten
Vom Tellerwäscher zum Millionär - das kann in den USA jeder schaffen, sagt US-Präsident George Bush. Aus ökonomischer Sicht zeigt sich allerdings, dass der amerikanische Traum immer weniger mit der Realität zu tun hat.
Miami - Im großen Saal des Miami Airport Hilton darf etwa zwanzig Minuten lang geträumt werden. George W. Bush erzählt wieder einmal die Geschichte vom guten Amerika. Von einem Volk, das Helden hervorbringt. Von einem Land, in dem es jeder, der es will, zu Wohlstand und Ansehen bringen kann. Die Zuhörer - allesamt Parteifreunde - applaudieren ihrem Präsidenten in regelmäßigen Abständen, und natürlich bei dem wohlklingenden Satz: "Jeder Einzelne in diesem Land hat die Chance, den amerikanischen Traum wahr werden zu lassen". Doch der Wahrheitsgehalt dieser Kernweisheit des Kapitalismus fällt in sich zusammen. Ökonomen haben sich bereits daran gemacht, die unbegrenzten Möglichkeiten in der größten Volkswirtschaft der Welt in Frage zu stellen - mit Erfolg. Damit der amerikanische Traum nicht zur leeren Worthülse verkommt, müsste es nämlich in den USA eine hohe Einkommensmobilität geben. Das bedeutet, dass ein großer Prozentsatz der Armen im Laufe der Zeit zu Reichtum kommt und umgekehrt Reiche auch die Einkommensleiter wieder absteigen können. Die Wirtschaftsforscherinnen Katherine Bradbury und Jane Katz von der Bostoner Federal Reserve Bank haben dazu die Einkommensdynamik in den USA während der 70er, 80er und 90er Jahre verglichen.
Ihre Studie zeigt, dass die Einkommensmobilität über die Jahrzehnte abgenommen hat. Demnach gelang es in den 70er Jahren noch 50,4 Prozent des ärmsten Fünftels der Bevölkerung, in höhere Einkommensgruppen vorzustoßen, in den 90er Jahren waren es nur noch 46,7 Prozent. Auch bei den Spitzenverdienern bewegt sich laut Bradbury und Katz immer weniger: Stiegen in den 70er Jahren noch 50,9 Prozent derer, die zum reichsten Fünftel gehörten, in niedrigere Einkommensgruppen ab, so waren es in den 90er Jahren nur noch 46,8 Prozent. Mehrere Studien zeigen überdies, dass die Einkommensdynamik in den USA bereits niedriger ist als in europäischen Ländern.
Arme werden ärmer
Nach Ansicht von Bradbury und Katz liegt ein Grund für die immer höheren Hürden auf dem Weg vom Tellerwäscher zum Millionär in der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. So verdiente das reichste Fünftel der US-Bevölkerung 1969 noch rund zehn Mal soviel wie das ärmste, 1998 war es schon das Vierzehnfache. Dies liegt vor allem an einer immer ungleicheren Verteilung von Vermögenswerten. Nach Angaben des Federal-Reserve-Ökonomen Arthur Kennickell entfielen 2001 rund 34 Prozent des Nettovermögens aller Haushalte auf das reichste Prozent der Haushalte, während die ärmere Hälfte der Amerikaner nur 2,8 Prozent der Vermögenswerte besaßen.
Konservative Politiker halten das Gerede von der wachsenden Ungleichheit für unsinnig. "Ich denke, die Diskussion über arm und reich ist schädlich. Das Thema ist nicht erwähnenswert, wenn wir uns um die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes bemühen", sagte beispielsweise der ehemalige US-Finanzminister Paul O`Neill auf einer Unternehmertagung. Seiner Ansicht nach profitieren auch die Armen, wenn die Reichen mehr verdienen und mehr investieren.
Doch auch dieses Argument ist nicht mehr hieb- und stichfest. Ökonomen des Economic Policy Institutes haben die Einkommensverteilung der US-Staaten untersucht und nicht nur einen Anstieg der Ungleichheit in den wachstumsstarken 80er und 90er Jahren festgestellt. In fünf Bundesstaaten - darunter New York und Kalifornien sind die Armen tatsächlich ärmer geworden. So musste das untere Fünftel der Haushalte in New York real auf durchschnittlich 800 Dollar pro Jahr verzichten, während das reichste Fünftel im Schnitt 56.800 Dollar mehr aufs Konto bekam als noch vor 20 Jahren.
Dennoch wiederholt US-Präsident Bush gebetsmühlenartig die schöne Geschichte vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, schließlich ist Wahlkampf. Und Bushs Helfer tun sehr viel dafür, die Politik ihres Meisters in gutem Licht erscheinen zu lassen. Als es bei einer anderen Veranstaltung um das Steuerpaket der Bush-Regierung ging, sollte beispielsweise nicht der Eindruck entstehen, die Entlastungen kämen nur den Reichen zugute. Kurzerhand wurden die Zuhörer in den ersten Reihen gebeten, ihre Krawatten auszuziehen und damit - zumindest visuell - etwas bedürftiger zu erscheinen.
Nach Ansicht von "Slate"-Kommentator Russ Baker hat die Bush-Regierung "erfolgreich alle Beweise unterschlagen, manipuliert oder zurückgehalten", die Zweifel am Erfolg der amerikanischen Wirtschaftspolitik aufkommen lassen könnten. Dies gilt laut Baker vor allem für Daten und Studien, die sich mit der wirtschaftlichen Situation der ärmeren US-Bevölkerung beschäftigen. So habe das US-Arbeitsministerium beispielsweise eine Datenreihe von ihrer Website genommen, aus der bisher die Wertentwicklung der Minimallöhne in den USA abzulesen war. Dieser minimal zulässige Stundenlohn wurden seit 1997 nicht mehr angehoben und liegt immer noch bei 5,15 Dollar.
Etwa sieben Millionen Amerikaner müssen sich mit dieser oder einer etwas höheren Bezahlung zufrieden geben und landen deshalb auch mit einer 40-Stunden-Woche deutlich unter der Armutsgrenze. Ein Beispiel ist der 20-jährige Collin Houghton, der im Bundestaat New York lebt. Er arbeitet rund 13 Stunden pro Tag auf zwei Jobs. Bei McDonald`s kommt er auf 6,25 Dollar pro Stunde, im Friendly`s Restaurant zahlen sie ihm 6,50 Dollar. Auf das College gehen kann er nicht, denn er muss den größten Teil seines Verdienstes den Eltern geben, die selbst kein Einkommen haben.
Noch schlechter geht es Gina Daniels, die in Palm Beach lebt. Die alleinerziehende Mutter dreier Kinder beliefert drei Wal-Mart-Stores mit Photo-Material und bekommt dafür rund 1.226 Dollar im Monat. Ihre monatlichen Fixkosten liegen allerdings bei 1.305 Dollar. Nach Ansicht von Partick Slatterly, Direktor der Hilfsorganisation House of Hope, ist dies nicht verwunderlich: "Wer nur den Minimallohn verdient, kann maximal 154 Dollar Miete im Monat bezahlten. Im Schnitt kostet hier ein Ein-Zimmer-Appartement aber 485 Dollar." Wie blanker Hohn muss es solchen Niedrigstverdienern erscheinen, wenn Präsident Bush in nahezu jeder Wahlkampf-Rede davon spricht, dass seine Regierung mit seinem Steuerprogramm "hart arbeitenden Familien Geld zurückgibt".
Präsident Bush und seine Wahkampf-Manager haben dennoch gute Chancen, die Wähler mit ihrer Mär vom amerikanischen Traum hinter sich zu versammeln. Viele Amerikaner flüchten sich nämlich gerne in ein etwas irrationales Bild der eigenen ökonomischen Realität. Bei einer Umfrage des "Time Magazine" gaben beispielsweise rund 19 Prozent der Befragten an, zum reichsten Prozent der Amerikaner gehören, weitere 20 Prozent erwarteten, in naher Zukunft dort zu landen.
-------
Wie schon oft gesagt, das Land fault bereits von innen.
UNGLEICHHEIT IN DEN USA
Land der begrenzten Möglichkeiten
Vom Tellerwäscher zum Millionär - das kann in den USA jeder schaffen, sagt US-Präsident George Bush. Aus ökonomischer Sicht zeigt sich allerdings, dass der amerikanische Traum immer weniger mit der Realität zu tun hat.
Miami - Im großen Saal des Miami Airport Hilton darf etwa zwanzig Minuten lang geträumt werden. George W. Bush erzählt wieder einmal die Geschichte vom guten Amerika. Von einem Volk, das Helden hervorbringt. Von einem Land, in dem es jeder, der es will, zu Wohlstand und Ansehen bringen kann. Die Zuhörer - allesamt Parteifreunde - applaudieren ihrem Präsidenten in regelmäßigen Abständen, und natürlich bei dem wohlklingenden Satz: "Jeder Einzelne in diesem Land hat die Chance, den amerikanischen Traum wahr werden zu lassen". Doch der Wahrheitsgehalt dieser Kernweisheit des Kapitalismus fällt in sich zusammen. Ökonomen haben sich bereits daran gemacht, die unbegrenzten Möglichkeiten in der größten Volkswirtschaft der Welt in Frage zu stellen - mit Erfolg. Damit der amerikanische Traum nicht zur leeren Worthülse verkommt, müsste es nämlich in den USA eine hohe Einkommensmobilität geben. Das bedeutet, dass ein großer Prozentsatz der Armen im Laufe der Zeit zu Reichtum kommt und umgekehrt Reiche auch die Einkommensleiter wieder absteigen können. Die Wirtschaftsforscherinnen Katherine Bradbury und Jane Katz von der Bostoner Federal Reserve Bank haben dazu die Einkommensdynamik in den USA während der 70er, 80er und 90er Jahre verglichen.
Ihre Studie zeigt, dass die Einkommensmobilität über die Jahrzehnte abgenommen hat. Demnach gelang es in den 70er Jahren noch 50,4 Prozent des ärmsten Fünftels der Bevölkerung, in höhere Einkommensgruppen vorzustoßen, in den 90er Jahren waren es nur noch 46,7 Prozent. Auch bei den Spitzenverdienern bewegt sich laut Bradbury und Katz immer weniger: Stiegen in den 70er Jahren noch 50,9 Prozent derer, die zum reichsten Fünftel gehörten, in niedrigere Einkommensgruppen ab, so waren es in den 90er Jahren nur noch 46,8 Prozent. Mehrere Studien zeigen überdies, dass die Einkommensdynamik in den USA bereits niedriger ist als in europäischen Ländern.
Arme werden ärmer
Nach Ansicht von Bradbury und Katz liegt ein Grund für die immer höheren Hürden auf dem Weg vom Tellerwäscher zum Millionär in der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich. So verdiente das reichste Fünftel der US-Bevölkerung 1969 noch rund zehn Mal soviel wie das ärmste, 1998 war es schon das Vierzehnfache. Dies liegt vor allem an einer immer ungleicheren Verteilung von Vermögenswerten. Nach Angaben des Federal-Reserve-Ökonomen Arthur Kennickell entfielen 2001 rund 34 Prozent des Nettovermögens aller Haushalte auf das reichste Prozent der Haushalte, während die ärmere Hälfte der Amerikaner nur 2,8 Prozent der Vermögenswerte besaßen.
Konservative Politiker halten das Gerede von der wachsenden Ungleichheit für unsinnig. "Ich denke, die Diskussion über arm und reich ist schädlich. Das Thema ist nicht erwähnenswert, wenn wir uns um die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes bemühen", sagte beispielsweise der ehemalige US-Finanzminister Paul O`Neill auf einer Unternehmertagung. Seiner Ansicht nach profitieren auch die Armen, wenn die Reichen mehr verdienen und mehr investieren.
Doch auch dieses Argument ist nicht mehr hieb- und stichfest. Ökonomen des Economic Policy Institutes haben die Einkommensverteilung der US-Staaten untersucht und nicht nur einen Anstieg der Ungleichheit in den wachstumsstarken 80er und 90er Jahren festgestellt. In fünf Bundesstaaten - darunter New York und Kalifornien sind die Armen tatsächlich ärmer geworden. So musste das untere Fünftel der Haushalte in New York real auf durchschnittlich 800 Dollar pro Jahr verzichten, während das reichste Fünftel im Schnitt 56.800 Dollar mehr aufs Konto bekam als noch vor 20 Jahren.
Dennoch wiederholt US-Präsident Bush gebetsmühlenartig die schöne Geschichte vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, schließlich ist Wahlkampf. Und Bushs Helfer tun sehr viel dafür, die Politik ihres Meisters in gutem Licht erscheinen zu lassen. Als es bei einer anderen Veranstaltung um das Steuerpaket der Bush-Regierung ging, sollte beispielsweise nicht der Eindruck entstehen, die Entlastungen kämen nur den Reichen zugute. Kurzerhand wurden die Zuhörer in den ersten Reihen gebeten, ihre Krawatten auszuziehen und damit - zumindest visuell - etwas bedürftiger zu erscheinen.
Nach Ansicht von "Slate"-Kommentator Russ Baker hat die Bush-Regierung "erfolgreich alle Beweise unterschlagen, manipuliert oder zurückgehalten", die Zweifel am Erfolg der amerikanischen Wirtschaftspolitik aufkommen lassen könnten. Dies gilt laut Baker vor allem für Daten und Studien, die sich mit der wirtschaftlichen Situation der ärmeren US-Bevölkerung beschäftigen. So habe das US-Arbeitsministerium beispielsweise eine Datenreihe von ihrer Website genommen, aus der bisher die Wertentwicklung der Minimallöhne in den USA abzulesen war. Dieser minimal zulässige Stundenlohn wurden seit 1997 nicht mehr angehoben und liegt immer noch bei 5,15 Dollar.
Etwa sieben Millionen Amerikaner müssen sich mit dieser oder einer etwas höheren Bezahlung zufrieden geben und landen deshalb auch mit einer 40-Stunden-Woche deutlich unter der Armutsgrenze. Ein Beispiel ist der 20-jährige Collin Houghton, der im Bundestaat New York lebt. Er arbeitet rund 13 Stunden pro Tag auf zwei Jobs. Bei McDonald`s kommt er auf 6,25 Dollar pro Stunde, im Friendly`s Restaurant zahlen sie ihm 6,50 Dollar. Auf das College gehen kann er nicht, denn er muss den größten Teil seines Verdienstes den Eltern geben, die selbst kein Einkommen haben.
Noch schlechter geht es Gina Daniels, die in Palm Beach lebt. Die alleinerziehende Mutter dreier Kinder beliefert drei Wal-Mart-Stores mit Photo-Material und bekommt dafür rund 1.226 Dollar im Monat. Ihre monatlichen Fixkosten liegen allerdings bei 1.305 Dollar. Nach Ansicht von Partick Slatterly, Direktor der Hilfsorganisation House of Hope, ist dies nicht verwunderlich: "Wer nur den Minimallohn verdient, kann maximal 154 Dollar Miete im Monat bezahlten. Im Schnitt kostet hier ein Ein-Zimmer-Appartement aber 485 Dollar." Wie blanker Hohn muss es solchen Niedrigstverdienern erscheinen, wenn Präsident Bush in nahezu jeder Wahlkampf-Rede davon spricht, dass seine Regierung mit seinem Steuerprogramm "hart arbeitenden Familien Geld zurückgibt".
Präsident Bush und seine Wahkampf-Manager haben dennoch gute Chancen, die Wähler mit ihrer Mär vom amerikanischen Traum hinter sich zu versammeln. Viele Amerikaner flüchten sich nämlich gerne in ein etwas irrationales Bild der eigenen ökonomischen Realität. Bei einer Umfrage des "Time Magazine" gaben beispielsweise rund 19 Prozent der Befragten an, zum reichsten Prozent der Amerikaner gehören, weitere 20 Prozent erwarteten, in naher Zukunft dort zu landen.
-------
Wie schon oft gesagt, das Land fault bereits von innen.
http://www.kurier.at/wirtschaft/317094.php
Nordamerika verliert an Attraktivität
Wien - Nach Regionen eingeteilt erwartet das Forschungsinstitut des "Economist" EIU in seiner jüngsten Studie zur Bewertung von Wirtschaftsstandorten, dass sich die Bedingungen in den nächsten fünf Jahren überall verbessern werden - außer in Nordamerika. Der Grund dafür liege in einem großen Ungleichgewicht innerhalb der US-Wirtschaft, einer schwachen öffentlichen Finanzstruktur und nicht zuletzt in einem erhöhten geopolitischen Risiko der Region. Westeuropa wird laut Studie zwar den Abstand zu Nordamerika verkleinern können, aber dennoch ein ungünstigeres Umfeld als Wirtschaftsstandort bieten, hieß es weiter. Positiv für Europa sieht das Institut Erfolge bei der Reduzierung der Steuerlast und der Umsetzung flexibler Mechanismen auf dem Arbeitsmarkt.
Positive Reformauswirkungen
Die größten absoluten Zugewinne im Wirtschaftsstandorte-Ranking sind am unteren Ende der Skala zu finden - also in Osteuropa, dem Mittleren Osten und Afrika. Warum das EIU davon ausgeht, dass in den nächsten fünf Jahren die meisten Länder ihre Bedingungen als Wirtschaftsstandort verbessern, wird wie folgt begründet: Zum einen dürften mittelfristig gesehen weder die aktuelle weltweite Konjunkturschwäche noch die geopolitische Unsicherheit das Reformtempo der Wirtschaft oder einen bereits gefestigten langfristigen Trend in Richtung eines verbesserten globalen wirtschaftlichen Umfeldes beeinträchtigen. In der EU beispielsweise werden die Steuern trotz der strengen Budgetvorgaben im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion gesenkt und wichtige strukturelle Reformen durchgezogen, so die Experten.
Wirtschaftliche Disziplin
Die Erweiterung der EU im Mai 2004 werde in den kommenden Jahren von den Ländern in Mittel- und Osteuropa große Anstrengungen in Richtung wirtschaftlicher Disziplin erfordern. Und während einige Länder vor kurzem wieder Zollbarrieren errichtet haben, werden die beiden größten Handelspartner der Welt - die EU und die USA - wahrscheinlich sicherstellen, dass bilaterale Handelsstreitigkeiten nicht in die Doha-Runde der Welthandelsorganisation (WTO) übertragen werden. Das britische Institut geht davon aus, dass der Trend zu Liberalisierung und Deregulierung anhält und noch untermauert wird von mächtigen Faktoren wie regionaler Integration und intensivem Wettbewerb bei Auslandsinvestitionen.
Artikel vom 21.07.2003 |apa |ric

Nordamerika verliert an Attraktivität
Wien - Nach Regionen eingeteilt erwartet das Forschungsinstitut des "Economist" EIU in seiner jüngsten Studie zur Bewertung von Wirtschaftsstandorten, dass sich die Bedingungen in den nächsten fünf Jahren überall verbessern werden - außer in Nordamerika. Der Grund dafür liege in einem großen Ungleichgewicht innerhalb der US-Wirtschaft, einer schwachen öffentlichen Finanzstruktur und nicht zuletzt in einem erhöhten geopolitischen Risiko der Region. Westeuropa wird laut Studie zwar den Abstand zu Nordamerika verkleinern können, aber dennoch ein ungünstigeres Umfeld als Wirtschaftsstandort bieten, hieß es weiter. Positiv für Europa sieht das Institut Erfolge bei der Reduzierung der Steuerlast und der Umsetzung flexibler Mechanismen auf dem Arbeitsmarkt.
Positive Reformauswirkungen
Die größten absoluten Zugewinne im Wirtschaftsstandorte-Ranking sind am unteren Ende der Skala zu finden - also in Osteuropa, dem Mittleren Osten und Afrika. Warum das EIU davon ausgeht, dass in den nächsten fünf Jahren die meisten Länder ihre Bedingungen als Wirtschaftsstandort verbessern, wird wie folgt begründet: Zum einen dürften mittelfristig gesehen weder die aktuelle weltweite Konjunkturschwäche noch die geopolitische Unsicherheit das Reformtempo der Wirtschaft oder einen bereits gefestigten langfristigen Trend in Richtung eines verbesserten globalen wirtschaftlichen Umfeldes beeinträchtigen. In der EU beispielsweise werden die Steuern trotz der strengen Budgetvorgaben im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion gesenkt und wichtige strukturelle Reformen durchgezogen, so die Experten.
Wirtschaftliche Disziplin
Die Erweiterung der EU im Mai 2004 werde in den kommenden Jahren von den Ländern in Mittel- und Osteuropa große Anstrengungen in Richtung wirtschaftlicher Disziplin erfordern. Und während einige Länder vor kurzem wieder Zollbarrieren errichtet haben, werden die beiden größten Handelspartner der Welt - die EU und die USA - wahrscheinlich sicherstellen, dass bilaterale Handelsstreitigkeiten nicht in die Doha-Runde der Welthandelsorganisation (WTO) übertragen werden. Das britische Institut geht davon aus, dass der Trend zu Liberalisierung und Deregulierung anhält und noch untermauert wird von mächtigen Faktoren wie regionaler Integration und intensivem Wettbewerb bei Auslandsinvestitionen.
Artikel vom 21.07.2003 |apa |ric

EZB zieht Reißleine
(Instock) Am internationalen Rentenmarkt werden derzeit ungewöhnliche Aktivitäten registriert: So sollen sich die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken der Euro-Zone in ungewöhnlich großem Stil von festverzinslichen Wertpapieren der US-Hypothekenbanken Fannie Mae (NYSE: FNM) und Freddie Mac (NYSE: FRE) getrennt haben, berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters".
Zusammen verwalten Freddie Mac und Fannie Mae Hypothekenkredite in Höhe von rund 3,3 Billionen US-Dollar und kontrollieren damit etwa 40 Prozent dieses Marktes in den USA. Im Krisenfall könnte das gesamte immobiliengesicherte Kreditwesen in den USA ins Wanken geraten. Gegen die beiden halbstaatlichen Unternehmen laufen bereits Ermittlungen der US-Aufsichtsbehörden. Mitglieder des US-Kongresses fordern seit längerem eine strengere Regulierung der Institute.
[ Montag, 21.07.2003, 14:28 ]
-------
Amerika kann gar nicht unter gehen - die sind bereits unten.
Nur die Aktienkurse suggerieren was anderes
(Instock) Am internationalen Rentenmarkt werden derzeit ungewöhnliche Aktivitäten registriert: So sollen sich die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken der Euro-Zone in ungewöhnlich großem Stil von festverzinslichen Wertpapieren der US-Hypothekenbanken Fannie Mae (NYSE: FNM) und Freddie Mac (NYSE: FRE) getrennt haben, berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters".
Zusammen verwalten Freddie Mac und Fannie Mae Hypothekenkredite in Höhe von rund 3,3 Billionen US-Dollar und kontrollieren damit etwa 40 Prozent dieses Marktes in den USA. Im Krisenfall könnte das gesamte immobiliengesicherte Kreditwesen in den USA ins Wanken geraten. Gegen die beiden halbstaatlichen Unternehmen laufen bereits Ermittlungen der US-Aufsichtsbehörden. Mitglieder des US-Kongresses fordern seit längerem eine strengere Regulierung der Institute.
[ Montag, 21.07.2003, 14:28 ]
-------
Amerika kann gar nicht unter gehen - die sind bereits unten.
Nur die Aktienkurse suggerieren was anderes

US/Bush: Syrien und Iran unterstützen Terrorismus
Washington (vwd) - US-Präsident George W. Bush hat Syrien und Iran vorgeworfen, terroristische Organisationen unterstützen. Die beiden Staaten würden zur Verantwortung gezogen, wenn sie diese Warnung nicht beachteten, sagte Bush bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Italiens Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi am Montag in Texas. Für alle Regierungen im Nahen Osten sei nun die Zeit gekommen, um die Friedensbemühungen zwischen den Palästinensern und den Israelis zu unterstützen. Zu den anhaltenden Kämpfen in Irak sagte Bush, dass diese immer noch Teil des Krieges seien.
vwd/DJ/21.7.2003/apo

Washington (vwd) - US-Präsident George W. Bush hat Syrien und Iran vorgeworfen, terroristische Organisationen unterstützen. Die beiden Staaten würden zur Verantwortung gezogen, wenn sie diese Warnung nicht beachteten, sagte Bush bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Italiens Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi am Montag in Texas. Für alle Regierungen im Nahen Osten sei nun die Zeit gekommen, um die Friedensbemühungen zwischen den Palästinensern und den Israelis zu unterstützen. Zu den anhaltenden Kämpfen in Irak sagte Bush, dass diese immer noch Teil des Krieges seien.
vwd/DJ/21.7.2003/apo

Uiuiui........
George W. Bush’s Job Approval Rating
Before the Iraq War Until Now

George W. Bush’s Job of Handling the Economy
Before the Iraq War Until Now

George W. Bush’s Job of Handling Foreign Affairs
Before the Iraq War Until Now

Registered Voters: Are You More Likely to Vote For Bush or the Democratic Party’s Candidate in 2004?

http://www.gallup.com/poll/releases/pr030722.asp
syr
George W. Bush’s Job Approval Rating
Before the Iraq War Until Now

George W. Bush’s Job of Handling the Economy
Before the Iraq War Until Now

George W. Bush’s Job of Handling Foreign Affairs
Before the Iraq War Until Now

Registered Voters: Are You More Likely to Vote For Bush or the Democratic Party’s Candidate in 2004?

http://www.gallup.com/poll/releases/pr030722.asp
syr

http://www.ftd.de/pw/in/1058704505099.html?nv=cd-divnews
Aus der FTD vom 22.7.2003
USA erwägen Vergrößerung ihrer Armee
Von Hubert Wetzel, Washington
Die unerwarteten Probleme in Irak haben der Debatte über die Reform der US-Armee eine überraschende Wende gegeben: Statt wie bisher über eine Verkleinerung der Streitkräfte und vor allem des Heeres wird in Washington nun über eine Vergrößerung nachgedacht.
Wie die "New York Times" am Montag berichtete, traf sich Verteidigungsminister Donald Rumsfeld am Wochenende mit hochrangigen Militärs, um einen Ausweg aus der Truppenkrise zu finden. Ausgelöst wurde der Kurswechsel vor allem durch die Einsicht im Pentagon, dass in Irak auf absehbare Zeit mindestens 100.000 US-Soldaten stationiert bleiben müssen. Dies hat Folgen für die gesamten Streitkräfte: Die Irak-Truppen stehen nicht für andere Kriseneinsätze zur Verfügung. Zudem müssen Einheiten für ihre Ablösung bereitgehalten werden, die dadurch ebenfalls gebunden sind.
Das Problem betrifft vor allem das Heer. Ihm gehen derzeit die Truppen aus. Von den zehn aktiven Divisionen mit jeweils 15.000 bis 18.000 Mann plus Unterstützungseinheiten sind zurzeit vier komplett oder zum größten Teil in Irak im Einsatz. Die meisten dieser Soldaten sind seit Anfang des Jahres am Golf, und ihre Einheiten müssen in den kommenden Monaten ausgetauscht werden. Die Einsatzzeit wurde bereits von sechs auf zwölf Monate verlängert.
Doch das Heer hat große Probleme, für einen Austausch genügend Truppen zusammenzubekommen. Für den Anti-Terror-Krieg hat das Pentagon Einheiten in Divisionsstärke nach Afghanistan verlegt. Eine Division schützt Südkorea, eine weitere Division wird in Hawaii für Krisen im Pazifikraum bereitgehalten. Weitere Einheiten tun auf dem Balkan Dienst.
Bedarf widerspricht Rumsfelds Pläne
Übrig bleiben nur knapp drei Divisionen. Allerdings sind die meisten ihrer Einheiten bereits für die Ablösung anderer Truppen vorgesehen, erholen sich von Einsätzen oder werden für Krisen in Reserve gehalten. Laut "New York Times" hat das Pentagon derzeit nur eine sehr geringe Zahl wirklich freier Truppen: drei Brigaden, etwa 15.000 Mann. Aus Reihen der Militärs kam daher vor kurzem eine Forderung auf, die Rumsfelds bisherigen Reformplänen direkt widersprach: die Aufstockung um zwei zusätzliche Divisionen. Anders seien die Aufgaben nicht zu schultern, deutete ein General an.
Rumsfeld wird eine Abneigung gegen das schwerfällige Heer nachgesagt. Noch vor wenigen Wochen hatten Militärexperten damit gerechnet, dass der Minister seinen Plan wiederbelebt, zwei Divisionen zu streichen. Begründet wurde das mit dem schnellen Sieg in Irak, der mit wenigen Bodentruppen errungen wurde. Dieser Erfolg zeige, dass die Zeit großer Truppenmassen abgelaufen sei. Der schnelle Irak-Krieg gebe dem Minister politischen Rückenwind, um die Verkleinerung der Armee durchzudrücken. Davon ist heute keine Rede mehr.
Die Truppenknappheit ist auch einer der Gründe, warum die US-Regierung andere Staaten drängt, eigene Soldaten nach Irak zu schicken, und gleichzeitig versucht, in Irak mit Einheimischen eine Sicherheitsmiliz aufzubauen. Dadurch soll nicht nur der schädliche Eindruck einer rein amerikanischen Besatzung gemildert, sondern auch die Last für das US-Militär verringert werden. Die Absage Indiens, ohne Uno-Mandat würden die von den USA gewünschten 17.000 Soldaten nicht bereitgestellt, war daher ein herber Rückschlag für das Weiße Haus.
Probleme durch Teilzeitsoldaten
Zugleich wächst der Druck in Washington: Viele der Soldaten in Irak sind nur Teilzeitsoldaten. Es handelt sich um Reservisten und Nationalgardisten, die in Friedenszeiten zivilen Jobs nachgehen. Vor allem die in der Nachkriegszeit so wichtigen "Civil Affairs"-Einheiten, also Militärpolizei, Wiederaufbau- und Verwaltungsexperten, bestehen zum Großteil aus Reservisten. Für sie, ihre Familien und ihre zivilen Arbeitgeber ist der lange Einsatz in Irak besonders problematisch. Bereits Anfang Juni hat Rumsfeld daher den Auftrag erteilt, wichtige Nischenaufgaben von Reserveeinheiten an das aktive Heer zu übergeben.
"Nach dem 11. September sind die Rekrutierungszahlen bei der Reserve und der Nationalgarde nach oben geschnellt", sagt ein Militärexperte im Kongress. "Man wird sehen, ob das so weitergeht. Die Leute haben sich für Wochenendkriegsdienst in den USA gemeldet, nicht für monatelange Einsätze in einem Gebiet, wo täglich auf sie geschossen wird."
Bislang hat Rumsfeld noch nicht offiziell um eine Vergrößerung des Heeres gebeten. "Im Moment glauben wir noch nicht, dass das notwendig ist", sagte er jüngst im Kongress. Um mehr freie Truppen zu bekommen, will der Minister zunächst Soldaten mit Schreibtischjobs durch Zivilangestellte ersetzen und die Soldaten Kampfeinheiten zuteilen. Bis zu 300.000 Mann könnten so umverteilt werden. Zudem wird darüber nachgedacht, die Marineinfanterie zu Einsätzen wie in Irak und auf dem Balkan heranzuziehen. Die "Marines" werden bisher fast nur als Kampftruppen genutzt oder stehen für Krisenaktionen bereit.
© 2003 Financial Times Deutschland
-------
Die Welt wird sicherer! Ja.
Aus der FTD vom 22.7.2003
USA erwägen Vergrößerung ihrer Armee
Von Hubert Wetzel, Washington
Die unerwarteten Probleme in Irak haben der Debatte über die Reform der US-Armee eine überraschende Wende gegeben: Statt wie bisher über eine Verkleinerung der Streitkräfte und vor allem des Heeres wird in Washington nun über eine Vergrößerung nachgedacht.
Wie die "New York Times" am Montag berichtete, traf sich Verteidigungsminister Donald Rumsfeld am Wochenende mit hochrangigen Militärs, um einen Ausweg aus der Truppenkrise zu finden. Ausgelöst wurde der Kurswechsel vor allem durch die Einsicht im Pentagon, dass in Irak auf absehbare Zeit mindestens 100.000 US-Soldaten stationiert bleiben müssen. Dies hat Folgen für die gesamten Streitkräfte: Die Irak-Truppen stehen nicht für andere Kriseneinsätze zur Verfügung. Zudem müssen Einheiten für ihre Ablösung bereitgehalten werden, die dadurch ebenfalls gebunden sind.
Das Problem betrifft vor allem das Heer. Ihm gehen derzeit die Truppen aus. Von den zehn aktiven Divisionen mit jeweils 15.000 bis 18.000 Mann plus Unterstützungseinheiten sind zurzeit vier komplett oder zum größten Teil in Irak im Einsatz. Die meisten dieser Soldaten sind seit Anfang des Jahres am Golf, und ihre Einheiten müssen in den kommenden Monaten ausgetauscht werden. Die Einsatzzeit wurde bereits von sechs auf zwölf Monate verlängert.
Doch das Heer hat große Probleme, für einen Austausch genügend Truppen zusammenzubekommen. Für den Anti-Terror-Krieg hat das Pentagon Einheiten in Divisionsstärke nach Afghanistan verlegt. Eine Division schützt Südkorea, eine weitere Division wird in Hawaii für Krisen im Pazifikraum bereitgehalten. Weitere Einheiten tun auf dem Balkan Dienst.
Bedarf widerspricht Rumsfelds Pläne
Übrig bleiben nur knapp drei Divisionen. Allerdings sind die meisten ihrer Einheiten bereits für die Ablösung anderer Truppen vorgesehen, erholen sich von Einsätzen oder werden für Krisen in Reserve gehalten. Laut "New York Times" hat das Pentagon derzeit nur eine sehr geringe Zahl wirklich freier Truppen: drei Brigaden, etwa 15.000 Mann. Aus Reihen der Militärs kam daher vor kurzem eine Forderung auf, die Rumsfelds bisherigen Reformplänen direkt widersprach: die Aufstockung um zwei zusätzliche Divisionen. Anders seien die Aufgaben nicht zu schultern, deutete ein General an.
Rumsfeld wird eine Abneigung gegen das schwerfällige Heer nachgesagt. Noch vor wenigen Wochen hatten Militärexperten damit gerechnet, dass der Minister seinen Plan wiederbelebt, zwei Divisionen zu streichen. Begründet wurde das mit dem schnellen Sieg in Irak, der mit wenigen Bodentruppen errungen wurde. Dieser Erfolg zeige, dass die Zeit großer Truppenmassen abgelaufen sei. Der schnelle Irak-Krieg gebe dem Minister politischen Rückenwind, um die Verkleinerung der Armee durchzudrücken. Davon ist heute keine Rede mehr.
Die Truppenknappheit ist auch einer der Gründe, warum die US-Regierung andere Staaten drängt, eigene Soldaten nach Irak zu schicken, und gleichzeitig versucht, in Irak mit Einheimischen eine Sicherheitsmiliz aufzubauen. Dadurch soll nicht nur der schädliche Eindruck einer rein amerikanischen Besatzung gemildert, sondern auch die Last für das US-Militär verringert werden. Die Absage Indiens, ohne Uno-Mandat würden die von den USA gewünschten 17.000 Soldaten nicht bereitgestellt, war daher ein herber Rückschlag für das Weiße Haus.

Probleme durch Teilzeitsoldaten
Zugleich wächst der Druck in Washington: Viele der Soldaten in Irak sind nur Teilzeitsoldaten. Es handelt sich um Reservisten und Nationalgardisten, die in Friedenszeiten zivilen Jobs nachgehen. Vor allem die in der Nachkriegszeit so wichtigen "Civil Affairs"-Einheiten, also Militärpolizei, Wiederaufbau- und Verwaltungsexperten, bestehen zum Großteil aus Reservisten. Für sie, ihre Familien und ihre zivilen Arbeitgeber ist der lange Einsatz in Irak besonders problematisch. Bereits Anfang Juni hat Rumsfeld daher den Auftrag erteilt, wichtige Nischenaufgaben von Reserveeinheiten an das aktive Heer zu übergeben.
"Nach dem 11. September sind die Rekrutierungszahlen bei der Reserve und der Nationalgarde nach oben geschnellt", sagt ein Militärexperte im Kongress. "Man wird sehen, ob das so weitergeht. Die Leute haben sich für Wochenendkriegsdienst in den USA gemeldet, nicht für monatelange Einsätze in einem Gebiet, wo täglich auf sie geschossen wird."
Bislang hat Rumsfeld noch nicht offiziell um eine Vergrößerung des Heeres gebeten. "Im Moment glauben wir noch nicht, dass das notwendig ist", sagte er jüngst im Kongress. Um mehr freie Truppen zu bekommen, will der Minister zunächst Soldaten mit Schreibtischjobs durch Zivilangestellte ersetzen und die Soldaten Kampfeinheiten zuteilen. Bis zu 300.000 Mann könnten so umverteilt werden. Zudem wird darüber nachgedacht, die Marineinfanterie zu Einsätzen wie in Irak und auf dem Balkan heranzuziehen. Die "Marines" werden bisher fast nur als Kampftruppen genutzt oder stehen für Krisenaktionen bereit.
© 2003 Financial Times Deutschland
-------
Die Welt wird sicherer! Ja.
Mittwoch, 23. Juli 2003
Artikel: » drucken » mailen
07:44 -- Tages-Anzeiger Online
Rice hat Uran-Fehler verschuldet
Überraschend hat das Weisse Haus Mitverantwortung für die falsche Behauptung irakischer Urankäufe eingeräumt. Schuld sei nicht der CIA, sondern Sicherheitsberaterin Condoleeza Rice.
Präsident George W. Bush hatte in seiner Rede zur Lage der Nation im Januar behauptet, Irak habe versucht in Afrika atomwaffenfähiges Uran zu kaufen.
Am Dienstag gab der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Steve Hatley, in Washington zu, dass der Geheimdienst CIA dem Weissen Haus schon im Oktober vergangenen Jahres Bedenken an der Richtigkeit des Vorwurfs mitgeteilt hatte. Seine Chefin, Rice, übernehme persönlich die Verantwortung dafür, dass der Präsident den Vorwurf dennoch in seiner Rede erwähnte, sagte Hatley weiter.
Vor zwei Wochen hatte das Weisse Haus der CIA noch den Schwarzen Peter für die Passage zugeschoben. Die Rede sei vom Geheimdienst abgenommen gewesen. CIA-Chef George Tenet hatte daraufhin persönlich die Verantwortung übernommen.
Wie Hatley jetzt einräumte, wurden inzwischen zwei Dokumente mit Datum Oktober im Weissen Haus gefunden, in denen die CIA wegen erheblicher Zweifel Einspruch gegen die Uran-Behauptung erhob. Das sei bei der Vorbereitung der Januar-Rede in Vergessenheit geraten. Die Passage hätte gestrichen werden müssen, räumte Hatley ein. (sda)
http://tagesanzeiger.ch/dyn/news/Ausland/294421.html
syr
Artikel: » drucken » mailen
07:44 -- Tages-Anzeiger Online
Rice hat Uran-Fehler verschuldet
Überraschend hat das Weisse Haus Mitverantwortung für die falsche Behauptung irakischer Urankäufe eingeräumt. Schuld sei nicht der CIA, sondern Sicherheitsberaterin Condoleeza Rice.
Präsident George W. Bush hatte in seiner Rede zur Lage der Nation im Januar behauptet, Irak habe versucht in Afrika atomwaffenfähiges Uran zu kaufen.
Am Dienstag gab der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Steve Hatley, in Washington zu, dass der Geheimdienst CIA dem Weissen Haus schon im Oktober vergangenen Jahres Bedenken an der Richtigkeit des Vorwurfs mitgeteilt hatte. Seine Chefin, Rice, übernehme persönlich die Verantwortung dafür, dass der Präsident den Vorwurf dennoch in seiner Rede erwähnte, sagte Hatley weiter.
Vor zwei Wochen hatte das Weisse Haus der CIA noch den Schwarzen Peter für die Passage zugeschoben. Die Rede sei vom Geheimdienst abgenommen gewesen. CIA-Chef George Tenet hatte daraufhin persönlich die Verantwortung übernommen.
Wie Hatley jetzt einräumte, wurden inzwischen zwei Dokumente mit Datum Oktober im Weissen Haus gefunden, in denen die CIA wegen erheblicher Zweifel Einspruch gegen die Uran-Behauptung erhob. Das sei bei der Vorbereitung der Januar-Rede in Vergessenheit geraten. Die Passage hätte gestrichen werden müssen, räumte Hatley ein. (sda)
http://tagesanzeiger.ch/dyn/news/Ausland/294421.html
syr

!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
syr

Ohje ohjeh ! Sie haben die Nylonstrümpfe vergessen. Kein Wunder!
Coubert
Coubert



22.07. 23:06
US-Finanzminister: "We see really good signs"
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
US-Finanzminister John Snow verkündete heute Abend die frohe Botschaft, dass er bereits jetzt, wenige Monate nach den Steuersenkungen, entsprechend positive Signale in der US-Wirtschaft vernehmen könne. „Was wir sehen, ist wirklich gut“, meinte er gegenüber Reportern. Die Wirtschaft reagiere auf die Steuersenkungen.
-------
Finger weg von den Drogen!
US-Finanzminister: "We see really good signs"
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
US-Finanzminister John Snow verkündete heute Abend die frohe Botschaft, dass er bereits jetzt, wenige Monate nach den Steuersenkungen, entsprechend positive Signale in der US-Wirtschaft vernehmen könne. „Was wir sehen, ist wirklich gut“, meinte er gegenüber Reportern. Die Wirtschaft reagiere auf die Steuersenkungen.
-------
Finger weg von den Drogen!

10:24am 07/23/03 BUSH: SINCE WAR ENDED "WE`VE MADE STEADY PROGRESS"


http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,258299,00.html
UMFRAGE ZU 11. SEPTEMBER
Jeder Fünfte glaubt an US-Verschwörung
Wer steckt hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001? War es wirklich Osama Bin Ladens Terror-Organisation Qaida? Etliche Bundesbürger vermuten, dass die US-Regierung die Anschläge in Auftrag gegeben haben könnte.
Hamburg - 19 Prozent der Deutschen halten es für möglich, dass die US-Regierung die Terroranschläge vom 11. September 2001 selbst in Auftrag gegeben hat. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage, die im Auftrag der "Zeit" erstellt wurde.
In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen ist es sogar jeder Dritte. Deutliche Unterschiede erbrachte die Befragung für Ost- und Westdeutschland: In den alten Bundesländern glauben nur 16 Prozent an eine solche Verschwörung, in den neuen Ländern sind es immerhin 29 Prozent.
Insgesamt fühlen sich 68 Prozent der Deutschen über die wahren Details des Anschlags nicht vollständig informiert, bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 78 Prozent.
Für die repräsentative Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa insgesamt 1000 Frauen und Männer.
------
Schon hart, oder?
Härter ist, das 15 Prozent der Amerikaner ihr eigenes Land auf einer Weltkarte nicht finden.
UMFRAGE ZU 11. SEPTEMBER
Jeder Fünfte glaubt an US-Verschwörung
Wer steckt hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001? War es wirklich Osama Bin Ladens Terror-Organisation Qaida? Etliche Bundesbürger vermuten, dass die US-Regierung die Anschläge in Auftrag gegeben haben könnte.
Hamburg - 19 Prozent der Deutschen halten es für möglich, dass die US-Regierung die Terroranschläge vom 11. September 2001 selbst in Auftrag gegeben hat. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage, die im Auftrag der "Zeit" erstellt wurde.
In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen ist es sogar jeder Dritte. Deutliche Unterschiede erbrachte die Befragung für Ost- und Westdeutschland: In den alten Bundesländern glauben nur 16 Prozent an eine solche Verschwörung, in den neuen Ländern sind es immerhin 29 Prozent.
Insgesamt fühlen sich 68 Prozent der Deutschen über die wahren Details des Anschlags nicht vollständig informiert, bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 78 Prozent.
Für die repräsentative Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa insgesamt 1000 Frauen und Männer.
------
Schon hart, oder?
Härter ist, das 15 Prozent der Amerikaner ihr eigenes Land auf einer Weltkarte nicht finden.

http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?id=510791&eid…
US-Razzia
"Sie mähten alles nieder"
Der entscheidende Hinweis auf den Aufenthalt von Odai und Kusai Hussein kam nach Vermutungen der Nachbarn vom selben Mann, der die beiden bei sich aufgenommen hat. Wenn dies zutrifft, dann ist Scheik Nawaf el Sajdan Muhhamad, ein Cousin des gestürzten Staatschefs Saddam Hussein, um die von den USA ausgesetzte Kopfprämie von zusammen 30 Millionen Dollar reicher.
Am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr Ortszeit verließen die Frau und die vier Töchter Muhhamads das stattliche Haus in Mossul - und kehrten nie zurück. Drei Stunden danach trafen US-Sodaten an der Haustür ein, klopften und forderten alle Anwesenden auf herauszukommen. Muhhamad und sein einziger Sohn Schalan kamen mit erhobenen Händen heraus, wie die Nachbarn berichten. Soldaten führten sie ab.
"Dann wurde es zu einer Schlacht"
Dann gaben die Truppen noch einmal über Lautsprecher auf Arabisch die Aufforderung ab, sich zu ergeben. Andernfalls müssten die verbliebenen Hausbewohner mit einem Angriff rechnen. Die Antwort waren Gewehrschüsse aus der oberen Etage. "Es begann als Schießerei, und dann wurde es zu einer Schlacht", berichtet der Nachbar Nasser Hasim. Weitere Soldaten trafen ein, schließlich waren es etwa 200 Mann. Zuletzt flogen Kiowa-Hubschrauber über das Haus. "Sie mähten alles nieder." Sechs Stunden nach Beginn der Aktion wurden die Leichen von Odai, Kusai und zwei weiteren Personen herausgetragen - vermutlich Kusais Sohn Mustafa und ein Leibwächter.
Und was ist aus Muhhamad geworden, der ihnen Zuflucht gewährt hat? Der amerikanische Oberst Joe Anderson sagt, der Informant sei in Schutzhaft genommen worden, und fügt als Begründung hinzu: "Die Leute wissen, wem das Haus gehört hat." Ob der Hausbesitzer denn auch der Informant gewesen ist, will der Offizier aber nicht sagen.
Immer offen zu den Nachbarn
Muhhamad war vor den Nachbarn immer offen über seine Beziehungen zu Saddam Hussein. Einmal ließ das Regime Muhhamads älteren Bruder ins Gefängnis werfen. Dabei soll es um einen Stammeszwist gegangen sein. Aber schon nach 18 Monaten der 17-jährigen Haftstrafe wurde er wieder freigelassen.
Muhhamad ist aus Tikrit, der Heimatstadt des Saddam-Hussein-Clans nach Mossul gezogen. Daher hatte seine Familie dort nicht viel Freunde. Abends saßen die Muhhamads oft vor dem Haus. Besucher aber gab es den Nachbarn zufolge kaum.
Es sei unvorstellbar, dass gerade der so sehr auf Luxus bedachte Odai aus seinem Palast in dieses Haus geraten sei, sagt Mohammad Abdullah. "Ich kann nicht glauben, dass wir Nachbarn waren!"
"Wir hätten das den Amerikanern nicht gesagt"
Wenn die Nachbarn sich auch sicher sind, dass der Hinweis auf den Aufenthaltsort der Herrschersöhne von Muhhamad gekommen sein muss - glücklich sind sie nicht darüber. "Sie sind Iraker", sagt Waad Hamadi. "Wir hätten das den Amerikanern nicht gesagt." Es gebe jetzt keine Möglichkeit mehr für Muhhamad, nach Mossul zurückzukehren. "Er ist ein Verräter."
Jamie Tarabay
------
Bei dieser Vorgehensweise müssen sich die Amis nicht wundern, das sie auf fast der ganzen Welt verhasst sind!
US-Razzia
"Sie mähten alles nieder"
Der entscheidende Hinweis auf den Aufenthalt von Odai und Kusai Hussein kam nach Vermutungen der Nachbarn vom selben Mann, der die beiden bei sich aufgenommen hat. Wenn dies zutrifft, dann ist Scheik Nawaf el Sajdan Muhhamad, ein Cousin des gestürzten Staatschefs Saddam Hussein, um die von den USA ausgesetzte Kopfprämie von zusammen 30 Millionen Dollar reicher.
Am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr Ortszeit verließen die Frau und die vier Töchter Muhhamads das stattliche Haus in Mossul - und kehrten nie zurück. Drei Stunden danach trafen US-Sodaten an der Haustür ein, klopften und forderten alle Anwesenden auf herauszukommen. Muhhamad und sein einziger Sohn Schalan kamen mit erhobenen Händen heraus, wie die Nachbarn berichten. Soldaten führten sie ab.
"Dann wurde es zu einer Schlacht"
Dann gaben die Truppen noch einmal über Lautsprecher auf Arabisch die Aufforderung ab, sich zu ergeben. Andernfalls müssten die verbliebenen Hausbewohner mit einem Angriff rechnen. Die Antwort waren Gewehrschüsse aus der oberen Etage. "Es begann als Schießerei, und dann wurde es zu einer Schlacht", berichtet der Nachbar Nasser Hasim. Weitere Soldaten trafen ein, schließlich waren es etwa 200 Mann. Zuletzt flogen Kiowa-Hubschrauber über das Haus. "Sie mähten alles nieder." Sechs Stunden nach Beginn der Aktion wurden die Leichen von Odai, Kusai und zwei weiteren Personen herausgetragen - vermutlich Kusais Sohn Mustafa und ein Leibwächter.
Und was ist aus Muhhamad geworden, der ihnen Zuflucht gewährt hat? Der amerikanische Oberst Joe Anderson sagt, der Informant sei in Schutzhaft genommen worden, und fügt als Begründung hinzu: "Die Leute wissen, wem das Haus gehört hat." Ob der Hausbesitzer denn auch der Informant gewesen ist, will der Offizier aber nicht sagen.
Immer offen zu den Nachbarn
Muhhamad war vor den Nachbarn immer offen über seine Beziehungen zu Saddam Hussein. Einmal ließ das Regime Muhhamads älteren Bruder ins Gefängnis werfen. Dabei soll es um einen Stammeszwist gegangen sein. Aber schon nach 18 Monaten der 17-jährigen Haftstrafe wurde er wieder freigelassen.
Muhhamad ist aus Tikrit, der Heimatstadt des Saddam-Hussein-Clans nach Mossul gezogen. Daher hatte seine Familie dort nicht viel Freunde. Abends saßen die Muhhamads oft vor dem Haus. Besucher aber gab es den Nachbarn zufolge kaum.
Es sei unvorstellbar, dass gerade der so sehr auf Luxus bedachte Odai aus seinem Palast in dieses Haus geraten sei, sagt Mohammad Abdullah. "Ich kann nicht glauben, dass wir Nachbarn waren!"
"Wir hätten das den Amerikanern nicht gesagt"
Wenn die Nachbarn sich auch sicher sind, dass der Hinweis auf den Aufenthaltsort der Herrschersöhne von Muhhamad gekommen sein muss - glücklich sind sie nicht darüber. "Sie sind Iraker", sagt Waad Hamadi. "Wir hätten das den Amerikanern nicht gesagt." Es gebe jetzt keine Möglichkeit mehr für Muhhamad, nach Mossul zurückzukehren. "Er ist ein Verräter."
Jamie Tarabay
------
Bei dieser Vorgehensweise müssen sich die Amis nicht wundern, das sie auf fast der ganzen Welt verhasst sind!
Bei dieser Vorgehensweise müssen sich die Amis nicht wundern, das sie auf fast der ganzen Welt verhasst sind!
sollte eigentlich so lauten:
Bei dieser Vorgehensweise müssen sich die Amis nicht wundern, das sie bei den islamischen Staaten verhasst sind!
sollte eigentlich so lauten:
Bei dieser Vorgehensweise müssen sich die Amis nicht wundern, das sie bei den islamischen Staaten verhasst sind!
Discovery Channel ein Bericht
Das rätselhafte Ende der USS Maine
dieser bericht klärt die wahren Ursachen des Untergangs der USS Maine auf.
der Untergang/Unfall führte zum Krieg gegen Spanien.
Es war ein Feuer im Kohlebunker was die Explosion verursachte.
Ironie: Heute hilft Spanien beim Lügen mit, früher war es Opfer.
Das rätselhafte Ende der USS Maine
dieser bericht klärt die wahren Ursachen des Untergangs der USS Maine auf.
der Untergang/Unfall führte zum Krieg gegen Spanien.
Es war ein Feuer im Kohlebunker was die Explosion verursachte.
Ironie: Heute hilft Spanien beim Lügen mit, früher war es Opfer.
They can`t handle the truth
Here`s something to raise your hackles: Nearly one-third of Germans younger than 30 harbor suspicions that the U.S. government orchestrated 9/11, the better to justify imperial adventures abroad. This is according to a poll freshly conducted by the German weekly Die Zeit. Sad, though not really so surprising considering that Europe is full of sullen young neo-radicals, reared from the cradle to mistrust America in the great global game.

For that matter, many thousands of U.S. students are daily getting their brains washed by crackpot professors who also think the White House ordered 9/11 in sinister collusion with, oh, you know, the oil interests, the military-industrial complex, Emperor Ming of the Planet Mongo, the usual bunch. Rampant runs the disbelief that we could ever possibly be the good guys.
Speaking of disbelievers: Though it is gratifying to behold the photographs of the Brothers Hussein lying there all peaceful and serene, many Iraqis are still far from convinced that Uday and Qusay have really and truly had their rotten souls blown to hell. Snapshots simply may not be sufficiently persuasive here, particularly given the fact that these two guys look not unlike thousands of other bearded Iraqis. The cry of "Staged!" is already resonating in some skeptical quarters.
"We will believe they are dead when their bodies are tied to cars and dragged through the streets," one Baghdad citizen told Reuters. "They should have been hung up on poles," said another.
In a brutal culture like Iraq`s, such demands do not shock. It is not the American way - Donald Rumsfeld is not going to hold up one of Uday`s ears at a press conference - but perhaps it is necessary to display the corpses, not photographs. Grisly, yes. But consider that Iraqis are paralyzed with fear that Uday and Qusay will come slithering around again someday. They must be made utterly certain that, no, Uday and Qusay will not.
As for the twentysomething Germans, ranting in blind conspiratorial rote at anything American , they might usefully consider court testimony taken this week in Düsseldorf. A Jordanian named Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, an admitted onetime Osama Bin Laden bodyguard, confessed to plotting grenade attacks across Germany. Among the targets: discos - full of radical young Germans all earnestly agreeing that the U.S. government was behind 9/11.
, they might usefully consider court testimony taken this week in Düsseldorf. A Jordanian named Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, an admitted onetime Osama Bin Laden bodyguard, confessed to plotting grenade attacks across Germany. Among the targets: discos - full of radical young Germans all earnestly agreeing that the U.S. government was behind 9/11.
Lights, cameras, justice!
In tossing out a suit to put cameras back in New York courtrooms, Manhattan Supreme Court Justice Shirley Kornreich last week said the issue was not, please note, a court case but a matter for the Legislature. Fine. Let Albany change the law. Now.
For too long, state lawmakers have been in thrall to the Trial Lawyers Association, which does not take kindly to the media or the public scrutinizing its members or clients. Turn on a klieg light, and they tend to go skittering off into the shadows.
New York is one of only nine states to bar cameras from the trial courts (they are allowed in appellate court). But it was not always so. When cameras were permitted in the courtrooms on an experimental basis between 1987 and 1997, the ground did not open. No bolt of lightning fell from the sky. Justice proceeded unhampered. As it did three years ago, when TV covered the trial of the four cops accused of killing Amadou Diallo. New Yorkers watched and were enlightened.
Yes, the lawsuit rejected last week had been brought by Court TV, but don`t buy into cynics` arguments that it`s about ratings. It`s about the enlightenment - helping citizens understand how their government works, helping to keep the judicial branch honest. That`s why trials are open to the public in the first place. Television cameras should be allowed to stand in as a proxy for the vast majority of the public who cannot attend in person.
Justice is ready for her closeup.
http://www.nydailynews.com/news/ideas_opinions/story/103644p…
Einfach herlich, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und Europa ist voll mit "sullen young neo-radicals"..... Zu dumm erscheint der Artikel einen ag nach dem Schlussbericht zu 9/11 welcher ein Debakel für die US-Geheimdienste und für`s FBI wird. Er wär ja, nach US-Untersuchungsausschuss, zu verhindern gewesen....
syr
Here`s something to raise your hackles: Nearly one-third of Germans younger than 30 harbor suspicions that the U.S. government orchestrated 9/11, the better to justify imperial adventures abroad. This is according to a poll freshly conducted by the German weekly Die Zeit. Sad, though not really so surprising considering that Europe is full of sullen young neo-radicals, reared from the cradle to mistrust America in the great global game.


For that matter, many thousands of U.S. students are daily getting their brains washed by crackpot professors who also think the White House ordered 9/11 in sinister collusion with, oh, you know, the oil interests, the military-industrial complex, Emperor Ming of the Planet Mongo, the usual bunch. Rampant runs the disbelief that we could ever possibly be the good guys.
Speaking of disbelievers: Though it is gratifying to behold the photographs of the Brothers Hussein lying there all peaceful and serene, many Iraqis are still far from convinced that Uday and Qusay have really and truly had their rotten souls blown to hell. Snapshots simply may not be sufficiently persuasive here, particularly given the fact that these two guys look not unlike thousands of other bearded Iraqis. The cry of "Staged!" is already resonating in some skeptical quarters.
"We will believe they are dead when their bodies are tied to cars and dragged through the streets," one Baghdad citizen told Reuters. "They should have been hung up on poles," said another.
In a brutal culture like Iraq`s, such demands do not shock. It is not the American way - Donald Rumsfeld is not going to hold up one of Uday`s ears at a press conference - but perhaps it is necessary to display the corpses, not photographs. Grisly, yes. But consider that Iraqis are paralyzed with fear that Uday and Qusay will come slithering around again someday. They must be made utterly certain that, no, Uday and Qusay will not.
As for the twentysomething Germans, ranting in blind conspiratorial rote at anything American
 , they might usefully consider court testimony taken this week in Düsseldorf. A Jordanian named Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, an admitted onetime Osama Bin Laden bodyguard, confessed to plotting grenade attacks across Germany. Among the targets: discos - full of radical young Germans all earnestly agreeing that the U.S. government was behind 9/11.
, they might usefully consider court testimony taken this week in Düsseldorf. A Jordanian named Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, an admitted onetime Osama Bin Laden bodyguard, confessed to plotting grenade attacks across Germany. Among the targets: discos - full of radical young Germans all earnestly agreeing that the U.S. government was behind 9/11.Lights, cameras, justice!
In tossing out a suit to put cameras back in New York courtrooms, Manhattan Supreme Court Justice Shirley Kornreich last week said the issue was not, please note, a court case but a matter for the Legislature. Fine. Let Albany change the law. Now.
For too long, state lawmakers have been in thrall to the Trial Lawyers Association, which does not take kindly to the media or the public scrutinizing its members or clients. Turn on a klieg light, and they tend to go skittering off into the shadows.
New York is one of only nine states to bar cameras from the trial courts (they are allowed in appellate court). But it was not always so. When cameras were permitted in the courtrooms on an experimental basis between 1987 and 1997, the ground did not open. No bolt of lightning fell from the sky. Justice proceeded unhampered. As it did three years ago, when TV covered the trial of the four cops accused of killing Amadou Diallo. New Yorkers watched and were enlightened.
Yes, the lawsuit rejected last week had been brought by Court TV, but don`t buy into cynics` arguments that it`s about ratings. It`s about the enlightenment - helping citizens understand how their government works, helping to keep the judicial branch honest. That`s why trials are open to the public in the first place. Television cameras should be allowed to stand in as a proxy for the vast majority of the public who cannot attend in person.
Justice is ready for her closeup.
http://www.nydailynews.com/news/ideas_opinions/story/103644p…
Einfach herlich, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und Europa ist voll mit "sullen young neo-radicals"..... Zu dumm erscheint der Artikel einen ag nach dem Schlussbericht zu 9/11 welcher ein Debakel für die US-Geheimdienste und für`s FBI wird. Er wär ja, nach US-Untersuchungsausschuss, zu verhindern gewesen....
syr
http://www.ftd.de/pw/in/1058704517408.html?nv=hpm
ftd.de, Fr, 25.7.2003, 9:49, aktualisiert: Fr, 25.7.2003, 15:12
US-Armee veranstaltet Leichenschau für Journalisten
Die US-Armee hat mehreren Journalisten in Bagdad erlaubt, die Leichen der beiden Saddam-Söhne Udai und Kusai selbst in Augenschein zu nehmen. Derweil wird die Suche nach dem Vater der prominenten Toten forciert.
Mit der Einladung unabhängiger Journalisten will die amerikanische Regierung offenbar die letzten Zweifel am Tod der beiden am Dienstag in Mosul getöteten Männer ausräumen. Der Korrespondent des arabischen TV-Senders al-Dschasira sagte nach Betrachten der Leichen, er selbst gehe nun davon aus, dass es sich bei den Getöteten tatsächlich um die beiden Söhne des Ex-Präsidenten handele, obwohl die Leichen durch Schusswunden stark entstellt seien.
Die Armee veröffentlichten in Bagdad zugleich die Autopsieberichte und erklärten, jede der beiden Leichen weise mehr als 20 Schusswunden auf. Knochen- und Muskelproben seien zur DNA-Analyse in ein Militärlabor nach Washington geschickt worden.
Bei der Identifizierung der Leichen sollen den Amerikanern auch Saddam Husseins Halbbrüder Watban und Barsan Ibrahim el Tikriti geholfen haben. Das berichtete die arabische Zeitung "Al-Sharq Al-Awsat" am Freitag unter Berufung auf den US-Kommandeur in Irak. Auch der ehemalige irakische Außenpolitiker Tarik Asis und Saddam Husseins Privatsekretär Abid Hamid el Tikriti hätten die Leichen begutachtet.
Kritik an Foto-Veröffentlichung
Die US-Regierung rechtfertigte die Veröffentlichung von Fotos der toten Saddam-Söhne. "Es ist wichtig für das irakische Volk, sie zu sehen, zu wissen, dass sie tot sind und nicht wiederkommen", sagte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld am Donnerstag in Washington zur Veröffentlichung der Fotos. Es sei zwar keine übliche Praxis, in diesem besonderen Fall aber gerechtfertigt. Es habe keine Chance gegeben, Udai und Kusai Hussein gefangen zu nehmen.
Zuvor war die Präsentation der bei Experten auf ein kritisches Echo gestoßen. Der Medienbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Freimut Duve, kritisierte die von der amerikanischen Regierung gewählte Ausdrucksform. Die "Körpersprache", die Washington benutzt habe, sei für den Prozess der Demokratisierung in Irak "nicht gerade sehr positiv", sagte Duve in den ARD-Tagesthemen. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Hussein-Söhne jetzt als Opfer angesehen würden.
Der Landauer Politologe und Medienwissenschaftler Ulrich Sarcinelli erkennt in dem demonstrativen Zurschaustellen der getöteten Feinde Merkmale eines primitiven Rituals, das einem überholt geglaubtem Menschheitsstadium entspreche. "Dahinter steht offensichtlich eine dramatische innenpolitische Glaubwürdigkeitskrise der Kriegsparteien USA und Großbritannien", sagte der Professor am Freitag im Gespräch mit der Agentur AP. Adressat der Veröffentlichung seien neben der irakischen Bevölkerung auch die zweifelnden Wähler und Medien zuhause.
Diktator lange unerkannt in Bagdad
Saddam Hussein und seine Söhne sollen sich mindestens noch eine Woche nach dem Fall Bagdads in der irakischen Hauptstadt aufgehalten haben. Der persönliche Leibwächter Udais berichtete der Londoner "Times", alle drei hätten zunächst in Bagdad ausgeharrt, weil sie davon überzeugt gewesen seien, die Stadt halten zu können. Alle Versuche der US-Truppen, sie zu fassen, seien gescheitert, weil die Husseins von einem so genannten sicheren Haus ins nächste gezogen seien, sagte der 28-jährige anonyme Informant.
Als die ersten Bomben das Haus trafen, in dem die Amerikaner Saddam und seine Söhne vermuteten, hätten diese sich bereits am anderen Ende der Stadt in einem Haus vertrauenswürdiger Freunde aufgehalten. Als Bagdad am 9. April gefallen sei, hätten sich die drei Männer in verschiedenen Häusern im Vorort Adhamija befunden, nur wenige Kilometer von den US-Truppen entfernt.
Dort seien sie dann in aller Öffentlichkeit zum Freitagsgebet in einer Moschee erschienen. Saddam sagte dort nach den Worten des Leibwächters: "Ich habe meinen Kommandeuren vertraut, aber sie sind Verräter und sie haben den Irak verraten. Aber wir hoffen, in nicht allzuferner Zukunft wieder an der Macht zu sein." Die drei seien "unter den Augen der Amerikaner" ungehindert in unauffälligen Autos von einem zum anderen "sicheren" Haus gefahren.
US-Armee stürmt angeblichen Saddam-Unterschlupf
Amerikanische Soldaten stürmten bei ihrer Suche nach Saddam Hussein nach Informationen des TV-Senders al-Dschasira am Freitag ein Haus in der westirakischen Stadt Falludscha. Der arabische Sender zeigte Bilder eines verwüsteten Wohnhauses. Der Hausherr sagte dem Sender, Dutzende von Soldaten hätten das Gebäude im Morgengrauen erst mit Panzern umstellt und dann angegriffen.
Sie hätten ihm später gesagt, dass sie den verschwundenen Ex-Präsidenten in seinem Haus vermutet hätten. Verletzt worden sei bei dem Angriff niemand. Falludscha ist eines der Hauptzentren des Widerstands gegen die US-Truppen.
© 2003 Financial Times Deutschland
-------
Als die lebenden US-Soldaten in Gefangenschaft gezeigt wurden, schrie ausgerechnet Amerika nach der UN und nun so was!
ftd.de, Fr, 25.7.2003, 9:49, aktualisiert: Fr, 25.7.2003, 15:12
US-Armee veranstaltet Leichenschau für Journalisten
Die US-Armee hat mehreren Journalisten in Bagdad erlaubt, die Leichen der beiden Saddam-Söhne Udai und Kusai selbst in Augenschein zu nehmen. Derweil wird die Suche nach dem Vater der prominenten Toten forciert.
Mit der Einladung unabhängiger Journalisten will die amerikanische Regierung offenbar die letzten Zweifel am Tod der beiden am Dienstag in Mosul getöteten Männer ausräumen. Der Korrespondent des arabischen TV-Senders al-Dschasira sagte nach Betrachten der Leichen, er selbst gehe nun davon aus, dass es sich bei den Getöteten tatsächlich um die beiden Söhne des Ex-Präsidenten handele, obwohl die Leichen durch Schusswunden stark entstellt seien.
Die Armee veröffentlichten in Bagdad zugleich die Autopsieberichte und erklärten, jede der beiden Leichen weise mehr als 20 Schusswunden auf. Knochen- und Muskelproben seien zur DNA-Analyse in ein Militärlabor nach Washington geschickt worden.
Bei der Identifizierung der Leichen sollen den Amerikanern auch Saddam Husseins Halbbrüder Watban und Barsan Ibrahim el Tikriti geholfen haben. Das berichtete die arabische Zeitung "Al-Sharq Al-Awsat" am Freitag unter Berufung auf den US-Kommandeur in Irak. Auch der ehemalige irakische Außenpolitiker Tarik Asis und Saddam Husseins Privatsekretär Abid Hamid el Tikriti hätten die Leichen begutachtet.
Kritik an Foto-Veröffentlichung
Die US-Regierung rechtfertigte die Veröffentlichung von Fotos der toten Saddam-Söhne. "Es ist wichtig für das irakische Volk, sie zu sehen, zu wissen, dass sie tot sind und nicht wiederkommen", sagte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld am Donnerstag in Washington zur Veröffentlichung der Fotos. Es sei zwar keine übliche Praxis, in diesem besonderen Fall aber gerechtfertigt. Es habe keine Chance gegeben, Udai und Kusai Hussein gefangen zu nehmen.
Zuvor war die Präsentation der bei Experten auf ein kritisches Echo gestoßen. Der Medienbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Freimut Duve, kritisierte die von der amerikanischen Regierung gewählte Ausdrucksform. Die "Körpersprache", die Washington benutzt habe, sei für den Prozess der Demokratisierung in Irak "nicht gerade sehr positiv", sagte Duve in den ARD-Tagesthemen. So könne nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Hussein-Söhne jetzt als Opfer angesehen würden.
Der Landauer Politologe und Medienwissenschaftler Ulrich Sarcinelli erkennt in dem demonstrativen Zurschaustellen der getöteten Feinde Merkmale eines primitiven Rituals, das einem überholt geglaubtem Menschheitsstadium entspreche. "Dahinter steht offensichtlich eine dramatische innenpolitische Glaubwürdigkeitskrise der Kriegsparteien USA und Großbritannien", sagte der Professor am Freitag im Gespräch mit der Agentur AP. Adressat der Veröffentlichung seien neben der irakischen Bevölkerung auch die zweifelnden Wähler und Medien zuhause.
Diktator lange unerkannt in Bagdad
Saddam Hussein und seine Söhne sollen sich mindestens noch eine Woche nach dem Fall Bagdads in der irakischen Hauptstadt aufgehalten haben. Der persönliche Leibwächter Udais berichtete der Londoner "Times", alle drei hätten zunächst in Bagdad ausgeharrt, weil sie davon überzeugt gewesen seien, die Stadt halten zu können. Alle Versuche der US-Truppen, sie zu fassen, seien gescheitert, weil die Husseins von einem so genannten sicheren Haus ins nächste gezogen seien, sagte der 28-jährige anonyme Informant.
Als die ersten Bomben das Haus trafen, in dem die Amerikaner Saddam und seine Söhne vermuteten, hätten diese sich bereits am anderen Ende der Stadt in einem Haus vertrauenswürdiger Freunde aufgehalten. Als Bagdad am 9. April gefallen sei, hätten sich die drei Männer in verschiedenen Häusern im Vorort Adhamija befunden, nur wenige Kilometer von den US-Truppen entfernt.
Dort seien sie dann in aller Öffentlichkeit zum Freitagsgebet in einer Moschee erschienen. Saddam sagte dort nach den Worten des Leibwächters: "Ich habe meinen Kommandeuren vertraut, aber sie sind Verräter und sie haben den Irak verraten. Aber wir hoffen, in nicht allzuferner Zukunft wieder an der Macht zu sein." Die drei seien "unter den Augen der Amerikaner" ungehindert in unauffälligen Autos von einem zum anderen "sicheren" Haus gefahren.
US-Armee stürmt angeblichen Saddam-Unterschlupf
Amerikanische Soldaten stürmten bei ihrer Suche nach Saddam Hussein nach Informationen des TV-Senders al-Dschasira am Freitag ein Haus in der westirakischen Stadt Falludscha. Der arabische Sender zeigte Bilder eines verwüsteten Wohnhauses. Der Hausherr sagte dem Sender, Dutzende von Soldaten hätten das Gebäude im Morgengrauen erst mit Panzern umstellt und dann angegriffen.
Sie hätten ihm später gesagt, dass sie den verschwundenen Ex-Präsidenten in seinem Haus vermutet hätten. Verletzt worden sei bei dem Angriff niemand. Falludscha ist eines der Hauptzentren des Widerstands gegen die US-Truppen.
© 2003 Financial Times Deutschland
-------
Als die lebenden US-Soldaten in Gefangenschaft gezeigt wurden, schrie ausgerechnet Amerika nach der UN und nun so was!
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,258498,00.html
FINANZKRISE
Rating-Erdbeben erschüttert Kalifornien
Energiekrisen, explodierende Schulden und eine paralysierte politische Führung - Kalifornier haben derzeit wenig zu lachen. Jetzt musste der Golden-State einen weiteren schweren Schlag hinnehmen: Eine Ratingagentur hat Kaliforniens Kreditwürdigkeit drastisch herabgestuft.
New York - Standard & Poor`s (S&P) senkte die Bonität für kalifornische Obligationen um drei Stufen auf BBB. Das Schuldenrating bestimmt, welchen Zinssatz ein Staat oder ein Unternehmen zahlen muss, um sich am Kapitalmarkt Geld zu leihen. Je niedriger die von den großen New Yorker Ratingagenturen festgelegte Bonitätsnote ist, desto risikoreicher gilt ein Kredit aus Sicht der Gläubiger.
Kalifornien wird demnächst in Folge der Herabstufung einen höheren Zinsaufschlag zahlen müssen. Ungewöhnlich ist, dass S&P das Rating des US-Staates um gleich drei Bewertungstufen zurücknahm. In der Regel verändern Ratingagenturen ihre Kreditnoten immer nur um einen, in seltenen Fällen um zwei Schritte.
Kalifornien befindet sich jedoch in einer Ausnahmesituation. Seit Wochen streiten sich Demokraten und Republikaner um das Budget, können sich aber nicht einigen, wie das gigantische Defizit in Höhe von 38,2 Milliarden Dollar eingedämmt werden soll. Bereits jetzt ist der Staat nicht mehr in der Lage, alle seine Angestellten pünktlich zu bezahlen.
"Stärke zehn auf der finanzielle Richter-Skala"
Der Golden-State ist tief gesunken: In den 47 Jahren, in denen S&P die Kapitalmarkt-Anleihen von US-Staaten bewertet, hat es ansonsten nur Massachusetts (1989 bis 1992) geschafft, eine derart miese Note zu bekommen. Rutscht Kalifornien noch eine Stufe tiefer, hätten die Schulden des Staates so genannten Junk-Status: Sie wären dann kein sicheres Investment mehr, sondern nur noch etwas für hart gesottene Zocker. Mit BBB befindet sich Kalifornien, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, bereits in der Gesellschaft von Staaten wie Tunesien oder Malaysia.
Von der politischen Führung ist zunächst keine Lösung zu erwarten - denn der in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Gouverneur Gray Davis wird vermutlich demnächst seines Amtes enthoben und durch einen anderen Politiker ersetzt. Bis das passiert ist, haben politische Beobachter wenig Hoffnung - auch S&P führt das so genannte Recall-Verfahren ausdrücklich als Grund für seine negative Einschätzung an.
"Das sind unglaublich schlechte Nachrichten, die Schockwellen durch die Nation schicken werden", sagte Kaliforniens Kämmerer Steve Westly. "Das ist eine Stärke von zehn auf der finanziellen Richter-Skala (...) Es ist ein sehr trauriger Tag für Kalifornien. Dies beschädigt Kaliforniens finanzielle Reputation und es kann Jahre dauern, da wieder herauszukommen."
----------
Andere werden folgen!
FINANZKRISE
Rating-Erdbeben erschüttert Kalifornien
Energiekrisen, explodierende Schulden und eine paralysierte politische Führung - Kalifornier haben derzeit wenig zu lachen. Jetzt musste der Golden-State einen weiteren schweren Schlag hinnehmen: Eine Ratingagentur hat Kaliforniens Kreditwürdigkeit drastisch herabgestuft.
New York - Standard & Poor`s (S&P) senkte die Bonität für kalifornische Obligationen um drei Stufen auf BBB. Das Schuldenrating bestimmt, welchen Zinssatz ein Staat oder ein Unternehmen zahlen muss, um sich am Kapitalmarkt Geld zu leihen. Je niedriger die von den großen New Yorker Ratingagenturen festgelegte Bonitätsnote ist, desto risikoreicher gilt ein Kredit aus Sicht der Gläubiger.
Kalifornien wird demnächst in Folge der Herabstufung einen höheren Zinsaufschlag zahlen müssen. Ungewöhnlich ist, dass S&P das Rating des US-Staates um gleich drei Bewertungstufen zurücknahm. In der Regel verändern Ratingagenturen ihre Kreditnoten immer nur um einen, in seltenen Fällen um zwei Schritte.
Kalifornien befindet sich jedoch in einer Ausnahmesituation. Seit Wochen streiten sich Demokraten und Republikaner um das Budget, können sich aber nicht einigen, wie das gigantische Defizit in Höhe von 38,2 Milliarden Dollar eingedämmt werden soll. Bereits jetzt ist der Staat nicht mehr in der Lage, alle seine Angestellten pünktlich zu bezahlen.
"Stärke zehn auf der finanzielle Richter-Skala"
Der Golden-State ist tief gesunken: In den 47 Jahren, in denen S&P die Kapitalmarkt-Anleihen von US-Staaten bewertet, hat es ansonsten nur Massachusetts (1989 bis 1992) geschafft, eine derart miese Note zu bekommen. Rutscht Kalifornien noch eine Stufe tiefer, hätten die Schulden des Staates so genannten Junk-Status: Sie wären dann kein sicheres Investment mehr, sondern nur noch etwas für hart gesottene Zocker. Mit BBB befindet sich Kalifornien, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, bereits in der Gesellschaft von Staaten wie Tunesien oder Malaysia.
Von der politischen Führung ist zunächst keine Lösung zu erwarten - denn der in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Gouverneur Gray Davis wird vermutlich demnächst seines Amtes enthoben und durch einen anderen Politiker ersetzt. Bis das passiert ist, haben politische Beobachter wenig Hoffnung - auch S&P führt das so genannte Recall-Verfahren ausdrücklich als Grund für seine negative Einschätzung an.
"Das sind unglaublich schlechte Nachrichten, die Schockwellen durch die Nation schicken werden", sagte Kaliforniens Kämmerer Steve Westly. "Das ist eine Stärke von zehn auf der finanziellen Richter-Skala (...) Es ist ein sehr trauriger Tag für Kalifornien. Dies beschädigt Kaliforniens finanzielle Reputation und es kann Jahre dauern, da wieder herauszukommen."
----------
Andere werden folgen!
10:00am 07/25/03 U.S. JUNE NEW HOME SALES UP 4.7% TO RECORD 1.16 MILLION
10:00am 07/25/03 U.S. JUNE NEW HOME SALES UP 21.0 % FROM YEAR EARLIER
10:00am 07/25/03 U.S. JUNE NEW HOME SALES HIT RECORD IN SOUTH AND WEST

10:00am 07/25/03 U.S. JUNE NEW HOME SALES UP 21.0 % FROM YEAR EARLIER
10:00am 07/25/03 U.S. JUNE NEW HOME SALES HIT RECORD IN SOUTH AND WEST

#415
Die Bevölkerung in den USA wächst pro Jahr um 2 bis 3 Millionen,
da können sich Immobilienmärkte immer wieder erholen!
Schlimm sieht es daegen für Deutschlands Städte im Osten aus.
Städte, die seit Jahrzehnten Einwohner verlieren und in denen
bereits innerstädtische Gebäude abgerissen werden um daraus
"Parks" zu machen. Eine Geneation später ist der Park dann
ein Wald, und wir sind da, wo die Siedlungsgeschichte vor
über 1000 Jahren begann!
mfg
thefarmer
Die Bevölkerung in den USA wächst pro Jahr um 2 bis 3 Millionen,
da können sich Immobilienmärkte immer wieder erholen!
Schlimm sieht es daegen für Deutschlands Städte im Osten aus.
Städte, die seit Jahrzehnten Einwohner verlieren und in denen
bereits innerstädtische Gebäude abgerissen werden um daraus
"Parks" zu machen. Eine Geneation später ist der Park dann
ein Wald, und wir sind da, wo die Siedlungsgeschichte vor
über 1000 Jahren begann!
mfg
thefarmer
USA: Wann wird die "japanische Entwicklung" gestoppt?
von unserem Korrespondenten Bill Bonner
Gestern fragte ich mich, an welchem Tag US-Wirtschaft den Kurs, den sie eingeschlagen hat, ändern wird. Sie ist dem "Vorbild" Japans mit einer 10jährigen Verzögerung gefolgt ... seit Mitte der 1990er. Die Aktienkurse bildeten eine Spekulationsblase ... die dann explodierte ... sowohl in Tokio als auch in New York.
.Und dann kamen Greenspan, Bernanke und Bush. Sie sagten, dass sie die Fehler Japans nicht wiederholen würden – und dennoch taten sie fast exakt das Gleiche wie Sakakibara, Mieno und Murayama – sie senkten die Zinsen und erhöhten die Staatsausgaben. Ist es da ein Wunder, dass sie dieselben Ergebnisse erhielten?
Wie Japan hat sich die US-Wirtschaft in den letzten 3 Jahren "durchgewurschtelt". Sie kommt einfach auf keinen gründen Zweig. Da ist einfach zu viel "Liquidität" auf dem Boden, so dass man keinen festen Fuß fassen kann. Statt vorwärts zu kommen, schliddert die Wirtschaft deshalb hin und her. Die Preise fallen. Arbeitsplätze werden abgebaut.
Seit dem Beginn des Millenniums sind in den USA mehr als 2,5 Millionen Arbeitsplätze abgebaut worden. Zunächst schien das niemanden zu kümmern – außer die neuen Arbeitslosen selbst. Fabrikarbeiter sind in den USA ohnehin eine aussterbende Spezies. Ihre Einkommen sind in den letzten 30 Jahren real gefallen. Aber jetzt sind es auch die Arbeiter mit weißem Kragen, die den Schmerz fühlen.
"US-Arbeitsplätze springen auf Schiffe", so eine CNN Schlagzeile. IBM und Microsoft verlagern Arbeitsplätze nach Übersee. "Man bekommt dort zwei Angestellte für den Preis von einem", so ein Vorstandsmitglied.
.Und Leute wie Donna Bradley, amerikanische IT-Spezialistin aus Mesa, Arizona, meinen: "Sie stellen einfach keine Amerikaner ein." Damit hat sie nicht ganz Recht. Es geht nicht um Amerikaner oder nicht Amerikaner – es geht um Lohnkosten. Und die Firmen wollen nicht 45 Dollar pro Stunde für einen Angestellten zahlen, wenn sie die gleiche Leistung in Indien für den halben Preis bekommen.
Donna Bradley musste übrigens ihr Haus verkaufen.
Und hier halte ich kurz an und atme tief durch. In Ehrfurcht. Wie elegant, wie exquisit, wie gnadenlos diese ganze Sache ist! Denn wer sollte eigentlich durch die sogenannte Informations-Revolution reich werden? Und durch die Globalisierung? Und durch den Dollar-Standard ... das Handelsbilanzdefizit? Die Antwort: Die Amerikaner! Aber wer ist es, der jetzt durch genau diese Trends ruiniert wird? Ah ... mehr dazu weiter unten ...
Es wird eine Zeit kommen, in der es zu viele Donna Bradleys geben wird. Spätestens dann – wenn nicht vorher – werden die USA ihre an Japan erinnernde Entwicklung stoppen. Anders als Japan sind die USA keine Nation der Gläubiger. Sie können sich nicht zuviel Abschwung erlauben; denn die Donna Bradleys gehen in den USA zu schnell Pleite. In Japan hätten Sie noch Ersparnisse, auf die sie zählen könnten.
Aber diese Zeit könnte noch weit entfernt in der Zukunft liegen.
Bis dahin wende ich mich erstmal an Eric Fry, mit dem letzten Update von der Wall Street:
Quelle: investor-verlag.de
von unserem Korrespondenten Bill Bonner
Gestern fragte ich mich, an welchem Tag US-Wirtschaft den Kurs, den sie eingeschlagen hat, ändern wird. Sie ist dem "Vorbild" Japans mit einer 10jährigen Verzögerung gefolgt ... seit Mitte der 1990er. Die Aktienkurse bildeten eine Spekulationsblase ... die dann explodierte ... sowohl in Tokio als auch in New York.
.Und dann kamen Greenspan, Bernanke und Bush. Sie sagten, dass sie die Fehler Japans nicht wiederholen würden – und dennoch taten sie fast exakt das Gleiche wie Sakakibara, Mieno und Murayama – sie senkten die Zinsen und erhöhten die Staatsausgaben. Ist es da ein Wunder, dass sie dieselben Ergebnisse erhielten?
Wie Japan hat sich die US-Wirtschaft in den letzten 3 Jahren "durchgewurschtelt". Sie kommt einfach auf keinen gründen Zweig. Da ist einfach zu viel "Liquidität" auf dem Boden, so dass man keinen festen Fuß fassen kann. Statt vorwärts zu kommen, schliddert die Wirtschaft deshalb hin und her. Die Preise fallen. Arbeitsplätze werden abgebaut.
Seit dem Beginn des Millenniums sind in den USA mehr als 2,5 Millionen Arbeitsplätze abgebaut worden. Zunächst schien das niemanden zu kümmern – außer die neuen Arbeitslosen selbst. Fabrikarbeiter sind in den USA ohnehin eine aussterbende Spezies. Ihre Einkommen sind in den letzten 30 Jahren real gefallen. Aber jetzt sind es auch die Arbeiter mit weißem Kragen, die den Schmerz fühlen.
"US-Arbeitsplätze springen auf Schiffe", so eine CNN Schlagzeile. IBM und Microsoft verlagern Arbeitsplätze nach Übersee. "Man bekommt dort zwei Angestellte für den Preis von einem", so ein Vorstandsmitglied.
.Und Leute wie Donna Bradley, amerikanische IT-Spezialistin aus Mesa, Arizona, meinen: "Sie stellen einfach keine Amerikaner ein." Damit hat sie nicht ganz Recht. Es geht nicht um Amerikaner oder nicht Amerikaner – es geht um Lohnkosten. Und die Firmen wollen nicht 45 Dollar pro Stunde für einen Angestellten zahlen, wenn sie die gleiche Leistung in Indien für den halben Preis bekommen.
Donna Bradley musste übrigens ihr Haus verkaufen.
Und hier halte ich kurz an und atme tief durch. In Ehrfurcht. Wie elegant, wie exquisit, wie gnadenlos diese ganze Sache ist! Denn wer sollte eigentlich durch die sogenannte Informations-Revolution reich werden? Und durch die Globalisierung? Und durch den Dollar-Standard ... das Handelsbilanzdefizit? Die Antwort: Die Amerikaner! Aber wer ist es, der jetzt durch genau diese Trends ruiniert wird? Ah ... mehr dazu weiter unten ...
Es wird eine Zeit kommen, in der es zu viele Donna Bradleys geben wird. Spätestens dann – wenn nicht vorher – werden die USA ihre an Japan erinnernde Entwicklung stoppen. Anders als Japan sind die USA keine Nation der Gläubiger. Sie können sich nicht zuviel Abschwung erlauben; denn die Donna Bradleys gehen in den USA zu schnell Pleite. In Japan hätten Sie noch Ersparnisse, auf die sie zählen könnten.
Aber diese Zeit könnte noch weit entfernt in der Zukunft liegen.
Bis dahin wende ich mich erstmal an Eric Fry, mit dem letzten Update von der Wall Street:
Quelle: investor-verlag.de
Fed/Moskow: Langfristige Aussichten für US-Wirtschaft sehr gut
Chicago (vwd) - Die Aussichten für die US-Wirtschaft sind nach Ansicht des President der Federal Reserve of Chicago, Michael Moskow, langfristig sehr gut. "Die US-Wirtschaft hat sich als widerstandsfähig und dynamisch erwiesen. Ihre Triebkräfte sind Unternehmergeist, Marktprinzipien sowie kontinuierlicher technischer Fortschritt", sagte er am Montag laut Manuskript im Rahmen einer Rede vor der Credit Union National Association Economic and Investment Conference.
Moskow betonte, die US-Notenbank gehe davon aus, dass ihre Geldpolitik in Kombination mit weiteren Stimuli den Aufbau von Nachfrage unterstützt. Das wahrscheinlichste Resultat dieser Konstellation sei, dass die US-Wirtschaft im weiteren Verlauf 2003 an Fahrt gewinne, was sich bis in das kommende Jahr hinein fortsetzen werde.
vwd/DJ/28.7.2003/jej

Chicago (vwd) - Die Aussichten für die US-Wirtschaft sind nach Ansicht des President der Federal Reserve of Chicago, Michael Moskow, langfristig sehr gut. "Die US-Wirtschaft hat sich als widerstandsfähig und dynamisch erwiesen. Ihre Triebkräfte sind Unternehmergeist, Marktprinzipien sowie kontinuierlicher technischer Fortschritt", sagte er am Montag laut Manuskript im Rahmen einer Rede vor der Credit Union National Association Economic and Investment Conference.
Moskow betonte, die US-Notenbank gehe davon aus, dass ihre Geldpolitik in Kombination mit weiteren Stimuli den Aufbau von Nachfrage unterstützt. Das wahrscheinlichste Resultat dieser Konstellation sei, dass die US-Wirtschaft im weiteren Verlauf 2003 an Fahrt gewinne, was sich bis in das kommende Jahr hinein fortsetzen werde.
vwd/DJ/28.7.2003/jej

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,258978,00.html
NOBELPREISTRÄGER AKERLOF ÜBER BUSH
"Unsere Regierung wirft das Geld einfach weg"
Arme werden benachteiligt, Sozialprogrammen droht der Kollaps: Der US-Ökonom George Akerlof erklärt die Steuer- und Schuldenpolitik der Regierung Bush für verhängnisvoll. Im SPIEGEL-ONLINE-Interview spricht der Nobelpreisträger über das Risiko eines Staatsbankrotts - und sieht "die Zeit für zivilen Ungehorsam gekommen."
SPIEGEL ONLINE: Professor Akerlof, offiziellen Prognosen zufolge fährt die US-Bundesregierung in diesem Fiskaljahr ein Defizit von 455 Milliarden Dollar ein. Das wäre zahlenmäßig das größte der amerikanischen Geschichte - aber George W. Bushs Budgetdirektor nennt das Fehl "kontrollierbar". Sehen Sie das auch so?
George A. Akerlof: Langfristig gesehen ist ein Defizit dieses Umfangs nicht zu kontrollieren. Wir bewegen uns in eine Phase hinein, in der ab etwa 2010 die Generation der "Baby Boomer" in Rente geht. Das wird die Sozialprogramme Social Security, Medicare und Medicaid erheblich belasten. In solch einer Phase sollten wir sparen.
SPIEGEL ONLINE: Also wäre Bush gut beraten, wieder einen Etatüberschuss anzustreben?
Akerlof: Das wäre im Augenblick wohl unmöglich. Es gibt ja einerseits die Ausgaben für den Irak-Krieg - den ich für unverantwortlich halte. Andererseits gibt es eine Konjunkturkrise und den Wunsch, die Wirtschaft fiskalpolitisch anzuregen. Das ist durchaus legitim. Deshalb brauchen wir auf kurze Sicht ein Defizit - aber sicher nicht jenes, das wir jetzt haben.
SPIEGEL ONLINE: Weil es zum großen Teil nicht durch Investitionen entsteht, sondern durch Steuersenkungen?
Akerlof: Eine kurzfristige Steuerermäßigung für die Armen wäre sogar sinnvoll. Es wäre so gut wie sicher, dass sie das Geld ausgeben. Das aktuelle und das drohende Defizit wirken aber weniger stimulierend als möglich wäre - unsere Regierung wirft das Geld einfach weg.
Wir bräuchten erstens ein Defizit, das klar auf den derzeitigen Abschwung abzielt. Unseres erstreckt sich weit in die Zukunft, da viele Steuersenkungen verzögert in Kraft treten und wahrscheinlich fortbestehen. Uns drohen rote Zahlen so weit das Auge reicht. Diese Dauerhaftigkeit des Defizits macht seine kurzfristig stimulierende Wirkung zunichte.
SPIEGEL ONLINE: Und zweitens stören Sie sich daran, dass die Steuervorteile vor allem den Reicheren zu Gute kommen?
Akerlof: Die Reichen brauchen das Geld nicht und werden es wohl bloß in geringerem Umfang ausgeben. Vermutlich sparen sie einfach mehr. Außerdem ist es besser situierten Familien in den USA in den vergangenen zwanzig Jahren sehr gut ergangen, während die ärmeren zurückgefallen sind. Die Umverteilungseffekte dieser Steuerpolitik gehen also in die absolut falsche Richtung. Am schlimmsten ist die Senkung der Dividendenbesteuerung - sie nutzt vorwiegend den Wohlhabenden, das ist nicht zu rechtfertigen.
SPIEGEL ONLINE: Präsident Bush sagt, die Reform der Dividendensteuer stütze den Aktienmarkt - und das treibe die Wirtschaft insgesamt an.
Akerlof: Das ist vollkommen unrealistisch. Wachstumsmodelle legen nahe, dass der Effekt unbedeutend sein wird. Sogar das Budgetbüro des Kongresses (CBO), eine der Regierung nahe stehende Stelle, ist zu einem ähnlichen Schluss gekommen.
SPIEGEL ONLINE: Anfang des Jahres hat Bush bei einer US-Tournee für ein Steuersenkungspaket geworben, das noch umfangreicher war als jenes, das der Kongress dann abgesegnete. Damals versprach er, dass 1,4 Millionen neue Jobs entstehen würden. War das realistisch?
Akerlof: Die Steuersenkung wird sich in gewissem Maß positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken. Das steht aber in keinem Verhältnis zu den langfristig enormen Kosten. Hinzu kommt, dass die Republikaner in ihren Budgetprognosen eine große Zahl wichtiger Faktoren nicht berücksichtigen. Noch im März hat das CBO geschätzt, dass sich der Überschuss im kommenden Jahrzehnt auf eine Billion Dollar summieren würde. Diese Prognose ging - neben anderen fragwürdigen Annahmen - davon aus, dass die Ausgaben real konstant bleiben. Das ist noch nie eingetreten. Angesichts der Steuersenkungen muss man realistischerweise bis 2013 ein Defizit von insgesamt über sechs Billionen Dollar erwarten.
SPIEGEL ONLINE: Vielleicht ist Ihre Regierung einfach schlecht im Rechnen?
Akerlof: Es gibt einen systematischen Grund: Sie sagt dem amerikanischen Volk nicht die Wahrheit. Vergangene Regierungen haben, seit dem ersten Finanzminister Alexander Hamilton, eine überwiegend verantwortliche Budgetpolitik betrieben. Was wir jetzt haben ist eine Form der Plünderung.
SPIEGEL ONLINE: Wenn das so ist - warum ist Ihr Präsident dann noch populär?
Akerlof: Aus irgendeinem Grund erkennt die amerikanische Öffentlichkeit die furchtbaren Folgen der Budgetpolitik noch nicht. Meine Hoffnung ist aber, dass die Wähler bei der Wahl 2004 darauf reagieren und dass wir einen Politikwechsel sehen.
SPIEGEL ONLINE: Was passiert, wenn der ausbleibt?
Akerlof: Kommende Generationen und schon die Bürger in zehn Jahren werden mit massiven öffentlichen Defiziten und riesiger Staatsverschuldung konfrontiert sein. Dann haben wir die Wahl: Unsere Regierung kann dastehen wie die eines sehr armen Staates, mit Problemen wie der Gefahr eines Staatsbankrotts. Oder wir müssen Programme wie Medicare und Social Security gravierend beschneiden.
Das Geld, das jetzt den Wohlhabenden zukommt, würde also durch Kürzungen bei Programmen für die Älteren zurückgezahlt. Die sind aber darauf angewiesen. Nur unter den reichsten 40 Prozent der Bevölkerung gibt es überhaupt nennenswerte eigene Einkünfte im Alter.
SPIEGEL ONLINE: Ist es möglich, dass die Regierung vor neuen Kriegen zurückschreckt, weil das Bundesdefizit so groß ist?
Akerlof: Die Regierung müsste den Schuldenstand bedenken, und die Militärausgaben sind bereits hoch. Aber das würde sie im Zweifelsfall nicht sonderlich abschrecken. Sie fangen den Krieg an - und ums Geld bitten sie hinterher. Eine andere Folge der Verschuldung ist wahrscheinlicher: Wenn es eine neue Rezession gibt, werden wir keine stimulierende Fiskalpolitik mehr betreiben können, um Vollbeschäftigung zu erhalten. Bisher bestand ein großes Maß an Vertrauen in den amerikanischen Staat. Die Märkte wussten, dass er seine Schulden zurückzahlt. Diese Ressource hat die Regierung vergeudet.
SPIEGEL ONLINE: Werden die Zinsen wegen der Verschuldung anziehen und die Wirtschaft abwürgen?
Akerlof: Auf die kurzfristigen Zinsen wird das Defizit keine bedeutenden Auswirkungen haben. Sie sind ziemlich niedrig, und unsere Notenbank wird sie unten halten. Mittelfristig könnten die Zinsen ein ernstes Problem werden. Wenn sie steigen, schmerzt die massive Verschuldung noch stärker.
SPIEGEL ONLINE: Hat die Familie Bush eine besondere Neigung zum Schuldenmachen? Das zweitgrößte Defizit aller Zeiten, 290 Milliarden Dollar, hat 1991 George Bush senior verbucht.
Akerlof: Mag sein, aber Bushs Vater hat Mut bewiesen, indem er die Steuern tatsächlich erhöht hat. Das war der erste Schritt, um das Defizit unter Clinton unter Kontrolle zu bringen. Außerdem war es ein wichtiger Grund dafür, dass Bush senior die Wahl verloren hat.
SPIEGEL ONLINE: Man hat den Eindruck, dass die jetzige Regierung Sie in ungeahntem Maß politisiert hat. Allein in diesem Jahr haben Sie, zusammen mit anderen Nobelpreisträgern, zwei öffentliche Protestnoten unterzeichnet - eine gegen die Steuersenkungen, die andere gegen einen unilateralen Präventivkrieg im Irak.
Akerlof: Ich denke, dass diese Regierung die schlimmste in der mehr als 200-jährigen Geschichte der USA ist. Sie hat nicht nur in der Außen- und Wirtschafts-, sondern auch in der Sozial- und Umweltpolitik außerordentlich unverantwortlich gehandelt. Das ist keine normale Politik mehr. Für die Bevölkerung ist die Zeit gekommen, zivilen Ungehorsam zu leisten.
SPIEGEL ONLINE: Wie soll der aussehen?
Akerlof: Ich weiß es noch nicht. Aber ich finde, wir sollten jetzt protestieren - so viel wie möglich.
SPIEGEL ONLINE: Würden Sie in Erwägung ziehen, wie ihr Kollege Joseph Stiglitz unter einer Demokratischen Regierung in die Politik zu gehen?
Akerlof: Meine Frau hat ja in der vergangenen Regierung mitgearbeitet und das sehr gut gemacht. Sie ist für öffentliche Aufgaben wohl besser geeignet. Aber ich würde jedes Amt ausfüllen, das mir angetragen wird.
SPIEGEL ONLINE: Sie haben gerade den Begriff "ziviler Ungehorsam" benutzt. Der wird in den USA oft mit dem Schriftsteller Henry David Thoreau verbunden, der propagierte, aus Protest keine Steuern zu zahlen. So weit würden Sie nicht gehen, oder?
Akerlof: Nein. Egal was passiert, unsere Steuern sollten wir zahlen. Sonst wird alles nur schlimmer.
Das Interview führte Matthias Streitz
NOBELPREISTRÄGER AKERLOF ÜBER BUSH
"Unsere Regierung wirft das Geld einfach weg"
Arme werden benachteiligt, Sozialprogrammen droht der Kollaps: Der US-Ökonom George Akerlof erklärt die Steuer- und Schuldenpolitik der Regierung Bush für verhängnisvoll. Im SPIEGEL-ONLINE-Interview spricht der Nobelpreisträger über das Risiko eines Staatsbankrotts - und sieht "die Zeit für zivilen Ungehorsam gekommen."
SPIEGEL ONLINE: Professor Akerlof, offiziellen Prognosen zufolge fährt die US-Bundesregierung in diesem Fiskaljahr ein Defizit von 455 Milliarden Dollar ein. Das wäre zahlenmäßig das größte der amerikanischen Geschichte - aber George W. Bushs Budgetdirektor nennt das Fehl "kontrollierbar". Sehen Sie das auch so?
George A. Akerlof: Langfristig gesehen ist ein Defizit dieses Umfangs nicht zu kontrollieren. Wir bewegen uns in eine Phase hinein, in der ab etwa 2010 die Generation der "Baby Boomer" in Rente geht. Das wird die Sozialprogramme Social Security, Medicare und Medicaid erheblich belasten. In solch einer Phase sollten wir sparen.
SPIEGEL ONLINE: Also wäre Bush gut beraten, wieder einen Etatüberschuss anzustreben?
Akerlof: Das wäre im Augenblick wohl unmöglich. Es gibt ja einerseits die Ausgaben für den Irak-Krieg - den ich für unverantwortlich halte. Andererseits gibt es eine Konjunkturkrise und den Wunsch, die Wirtschaft fiskalpolitisch anzuregen. Das ist durchaus legitim. Deshalb brauchen wir auf kurze Sicht ein Defizit - aber sicher nicht jenes, das wir jetzt haben.
SPIEGEL ONLINE: Weil es zum großen Teil nicht durch Investitionen entsteht, sondern durch Steuersenkungen?
Akerlof: Eine kurzfristige Steuerermäßigung für die Armen wäre sogar sinnvoll. Es wäre so gut wie sicher, dass sie das Geld ausgeben. Das aktuelle und das drohende Defizit wirken aber weniger stimulierend als möglich wäre - unsere Regierung wirft das Geld einfach weg.
Wir bräuchten erstens ein Defizit, das klar auf den derzeitigen Abschwung abzielt. Unseres erstreckt sich weit in die Zukunft, da viele Steuersenkungen verzögert in Kraft treten und wahrscheinlich fortbestehen. Uns drohen rote Zahlen so weit das Auge reicht. Diese Dauerhaftigkeit des Defizits macht seine kurzfristig stimulierende Wirkung zunichte.
SPIEGEL ONLINE: Und zweitens stören Sie sich daran, dass die Steuervorteile vor allem den Reicheren zu Gute kommen?
Akerlof: Die Reichen brauchen das Geld nicht und werden es wohl bloß in geringerem Umfang ausgeben. Vermutlich sparen sie einfach mehr. Außerdem ist es besser situierten Familien in den USA in den vergangenen zwanzig Jahren sehr gut ergangen, während die ärmeren zurückgefallen sind. Die Umverteilungseffekte dieser Steuerpolitik gehen also in die absolut falsche Richtung. Am schlimmsten ist die Senkung der Dividendenbesteuerung - sie nutzt vorwiegend den Wohlhabenden, das ist nicht zu rechtfertigen.
SPIEGEL ONLINE: Präsident Bush sagt, die Reform der Dividendensteuer stütze den Aktienmarkt - und das treibe die Wirtschaft insgesamt an.
Akerlof: Das ist vollkommen unrealistisch. Wachstumsmodelle legen nahe, dass der Effekt unbedeutend sein wird. Sogar das Budgetbüro des Kongresses (CBO), eine der Regierung nahe stehende Stelle, ist zu einem ähnlichen Schluss gekommen.
SPIEGEL ONLINE: Anfang des Jahres hat Bush bei einer US-Tournee für ein Steuersenkungspaket geworben, das noch umfangreicher war als jenes, das der Kongress dann abgesegnete. Damals versprach er, dass 1,4 Millionen neue Jobs entstehen würden. War das realistisch?
Akerlof: Die Steuersenkung wird sich in gewissem Maß positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken. Das steht aber in keinem Verhältnis zu den langfristig enormen Kosten. Hinzu kommt, dass die Republikaner in ihren Budgetprognosen eine große Zahl wichtiger Faktoren nicht berücksichtigen. Noch im März hat das CBO geschätzt, dass sich der Überschuss im kommenden Jahrzehnt auf eine Billion Dollar summieren würde. Diese Prognose ging - neben anderen fragwürdigen Annahmen - davon aus, dass die Ausgaben real konstant bleiben. Das ist noch nie eingetreten. Angesichts der Steuersenkungen muss man realistischerweise bis 2013 ein Defizit von insgesamt über sechs Billionen Dollar erwarten.
SPIEGEL ONLINE: Vielleicht ist Ihre Regierung einfach schlecht im Rechnen?
Akerlof: Es gibt einen systematischen Grund: Sie sagt dem amerikanischen Volk nicht die Wahrheit. Vergangene Regierungen haben, seit dem ersten Finanzminister Alexander Hamilton, eine überwiegend verantwortliche Budgetpolitik betrieben. Was wir jetzt haben ist eine Form der Plünderung.
SPIEGEL ONLINE: Wenn das so ist - warum ist Ihr Präsident dann noch populär?
Akerlof: Aus irgendeinem Grund erkennt die amerikanische Öffentlichkeit die furchtbaren Folgen der Budgetpolitik noch nicht. Meine Hoffnung ist aber, dass die Wähler bei der Wahl 2004 darauf reagieren und dass wir einen Politikwechsel sehen.
SPIEGEL ONLINE: Was passiert, wenn der ausbleibt?
Akerlof: Kommende Generationen und schon die Bürger in zehn Jahren werden mit massiven öffentlichen Defiziten und riesiger Staatsverschuldung konfrontiert sein. Dann haben wir die Wahl: Unsere Regierung kann dastehen wie die eines sehr armen Staates, mit Problemen wie der Gefahr eines Staatsbankrotts. Oder wir müssen Programme wie Medicare und Social Security gravierend beschneiden.
Das Geld, das jetzt den Wohlhabenden zukommt, würde also durch Kürzungen bei Programmen für die Älteren zurückgezahlt. Die sind aber darauf angewiesen. Nur unter den reichsten 40 Prozent der Bevölkerung gibt es überhaupt nennenswerte eigene Einkünfte im Alter.
SPIEGEL ONLINE: Ist es möglich, dass die Regierung vor neuen Kriegen zurückschreckt, weil das Bundesdefizit so groß ist?
Akerlof: Die Regierung müsste den Schuldenstand bedenken, und die Militärausgaben sind bereits hoch. Aber das würde sie im Zweifelsfall nicht sonderlich abschrecken. Sie fangen den Krieg an - und ums Geld bitten sie hinterher. Eine andere Folge der Verschuldung ist wahrscheinlicher: Wenn es eine neue Rezession gibt, werden wir keine stimulierende Fiskalpolitik mehr betreiben können, um Vollbeschäftigung zu erhalten. Bisher bestand ein großes Maß an Vertrauen in den amerikanischen Staat. Die Märkte wussten, dass er seine Schulden zurückzahlt. Diese Ressource hat die Regierung vergeudet.
SPIEGEL ONLINE: Werden die Zinsen wegen der Verschuldung anziehen und die Wirtschaft abwürgen?
Akerlof: Auf die kurzfristigen Zinsen wird das Defizit keine bedeutenden Auswirkungen haben. Sie sind ziemlich niedrig, und unsere Notenbank wird sie unten halten. Mittelfristig könnten die Zinsen ein ernstes Problem werden. Wenn sie steigen, schmerzt die massive Verschuldung noch stärker.
SPIEGEL ONLINE: Hat die Familie Bush eine besondere Neigung zum Schuldenmachen? Das zweitgrößte Defizit aller Zeiten, 290 Milliarden Dollar, hat 1991 George Bush senior verbucht.
Akerlof: Mag sein, aber Bushs Vater hat Mut bewiesen, indem er die Steuern tatsächlich erhöht hat. Das war der erste Schritt, um das Defizit unter Clinton unter Kontrolle zu bringen. Außerdem war es ein wichtiger Grund dafür, dass Bush senior die Wahl verloren hat.
SPIEGEL ONLINE: Man hat den Eindruck, dass die jetzige Regierung Sie in ungeahntem Maß politisiert hat. Allein in diesem Jahr haben Sie, zusammen mit anderen Nobelpreisträgern, zwei öffentliche Protestnoten unterzeichnet - eine gegen die Steuersenkungen, die andere gegen einen unilateralen Präventivkrieg im Irak.
Akerlof: Ich denke, dass diese Regierung die schlimmste in der mehr als 200-jährigen Geschichte der USA ist. Sie hat nicht nur in der Außen- und Wirtschafts-, sondern auch in der Sozial- und Umweltpolitik außerordentlich unverantwortlich gehandelt. Das ist keine normale Politik mehr. Für die Bevölkerung ist die Zeit gekommen, zivilen Ungehorsam zu leisten.
SPIEGEL ONLINE: Wie soll der aussehen?
Akerlof: Ich weiß es noch nicht. Aber ich finde, wir sollten jetzt protestieren - so viel wie möglich.
SPIEGEL ONLINE: Würden Sie in Erwägung ziehen, wie ihr Kollege Joseph Stiglitz unter einer Demokratischen Regierung in die Politik zu gehen?
Akerlof: Meine Frau hat ja in der vergangenen Regierung mitgearbeitet und das sehr gut gemacht. Sie ist für öffentliche Aufgaben wohl besser geeignet. Aber ich würde jedes Amt ausfüllen, das mir angetragen wird.
SPIEGEL ONLINE: Sie haben gerade den Begriff "ziviler Ungehorsam" benutzt. Der wird in den USA oft mit dem Schriftsteller Henry David Thoreau verbunden, der propagierte, aus Protest keine Steuern zu zahlen. So weit würden Sie nicht gehen, oder?
Akerlof: Nein. Egal was passiert, unsere Steuern sollten wir zahlen. Sonst wird alles nur schlimmer.
Das Interview führte Matthias Streitz
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
30.07. 11:56
AOL: Weitere Anfrage der SEC
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
America Online, die Internettochter von AOL Time Warner (WKN: 502251, US: AOL), hat von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Anfrage über so genannte „Bulk“ Subskriptionen erhalten. Die SEC ermittelt bei AOL bereits wegen bestimmter zweifelhafter Transaktionen im Werbegeschäft. Über so genannte „Bulk“ Deals gewann AOL in den Jahren 2001 und 2002 rund 830,000 Kunden, was rund 17% des Kundenwachstums in dieser Zeit ausmachte. In diesem „Bulk“ Deals verkaufte AOL an Unternehmen mit einem deutlichen Preisabschlag seine Internetdienste. Diese Unternehmen haben diese günstigen Internetdienste dann zu einem Aufpreis an ihre Mitarbeiter vertrieben – den Gewinn aus dem Aufpreis konnten die AOL-Partner einstreichen
-------
Die können bald bei AOL einziehen, so oft wie die dort sind
AOL: Weitere Anfrage der SEC
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
America Online, die Internettochter von AOL Time Warner (WKN: 502251, US: AOL), hat von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Anfrage über so genannte „Bulk“ Subskriptionen erhalten. Die SEC ermittelt bei AOL bereits wegen bestimmter zweifelhafter Transaktionen im Werbegeschäft. Über so genannte „Bulk“ Deals gewann AOL in den Jahren 2001 und 2002 rund 830,000 Kunden, was rund 17% des Kundenwachstums in dieser Zeit ausmachte. In diesem „Bulk“ Deals verkaufte AOL an Unternehmen mit einem deutlichen Preisabschlag seine Internetdienste. Diese Unternehmen haben diese günstigen Internetdienste dann zu einem Aufpreis an ihre Mitarbeiter vertrieben – den Gewinn aus dem Aufpreis konnten die AOL-Partner einstreichen
-------
Die können bald bei AOL einziehen, so oft wie die dort sind

11:07am 07/30/03 BUSH SAYS DEFICIT WILL BE CUT IN HALF OVER NEXT 5 YEARS
11:06am 07/30/03 BUSH SEES DEFICITS WITH OR WITHOUT TAX CUTS
11:07am 07/30/03 BUSH SAYS 25% OF FEDERAL DEFICIT CAUSED BY TAX CUTS

11:06am 07/30/03 BUSH SEES DEFICITS WITH OR WITHOUT TAX CUTS
11:07am 07/30/03 BUSH SAYS 25% OF FEDERAL DEFICIT CAUSED BY TAX CUTS


Bush - Übernehme Verantwortung für Aussagen über Irak
Washington, 30. Jul (Reuters) - US-Präsident George W. Bush hat am Mittwoch erstmals persönlich die Verantwortung für umstrittene Vorwürfe gegen den Irak übernommen, wonach das Land vor dem Krieg versucht haben soll, in Afrika Uran zum Bau von Atomwaffen zu kaufen. Die Äußerungen, die als Beleg für die Bedrohung für die USA durch den Irak herhalten sollten, hatten für Wirbel gesorgt, nachdem die USA eingeräumt hatten, dass diese teilweise auf gefälschtem Material basierten.
"Ich übernehme die persönliche Verantwortung für alles, was ich sage", sagte Bush auf die Frage nach den von ihm während seiner Rede zur Lage der Nation Ende Januar erhobenen Vorwürfe. Bush hatte in der Rede der inzwischen gestürzten irakischen Führung vorgeworfen, sich im Niger um Uran zum Bau von Atombomben bemüht zu haben.
Bush und seine engen Vertrauten hatten in der Debatte um die Äußerungen den Chef des US-Geheimdienstes CIA, George Tenet, für die Äußerungen verantwortlich gemacht. Er sei es gewesen, der die besagten 16-Worte in der Rede von Bush nicht verhindert habe, hatte die Begründung gelautet. Bush hatte es bis zuletzt abgelehnt, persönlich Verantwortung für die Äußerungen zu übernehmen und war deshalb kritisiert worden.
Bush verteidigte zudem die im Zusammenhang mit den Vorwürfen kritisierte Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice. "Condoleezza Rice ist eine ehrliche, fabelhafte Person und Amerika ist glücklich, ihren Dienst zu haben - Punkt", sagte Bush.

Mittwoch, 30. Juli 2003
Platzen der Spekulationsblase am US-Anleihenmarkt mit drastischen Auswirkungen
von Dr. Kurt Richebächer
Die Leute, die eine zweite Rezession erwarten ("double dip"), bilden in den USA sicherlich nur eine kleine Minderheit. Unter Politikern und Volkswirten ist es in Amerika Konsens, dass die Weltwirtschaftskrise der 1930er und die aktuelle japanische Krise ihren entscheidenden Grund in einem zentralen Fehler der Geldpolitik hatten/haben: In beiden Fällen waren die Zentralbanken zu langsam, als es darum ging, die Zinsen zu senken, sobald sich eine Abschwächung der Wirtschaftslage abzeichnete.
Das führt mich zu einer Schlüsselfrage: Wann machen Zentralbanken ihre entscheidenden Fehler? Während eines Booms und während einer Spekulationsblase? Oder erst danach?
Mr. Greenspan, der davon überzeugt ist, das er aus der Geschichte gelernt hat, hat die amerikanischen Leitzinsen in mehreren Schritten von 6,5 % auf 1,0 % gesenkt. Die kurzfristigen Zinsen fielen stärker als die langfristigen Zinsen, was zu einer Änderung der Zinsstrukturkurve führte. Aber auch die langfristigen Zinsen sanken, da die Investoren und Spekulanten sich zuletzt auf die höher verzinslichen langfristigen Anleihen gestürzt hatten.
Im Prinzip haben Zentralbanken nur zwei Instrumente, mit denen sie das Geld- und Kreditwachstum mit dem Ziel der Stimulierung der wirtschaftlichen Aktivität beeinflussen können: Veränderungen der Bankreserven durch Operationen am offenen Markt (sog. Offenmarktpolitik); und Anpassungen der Leitzinsen.
Aber es gibt noch ein drittes, unkonventionelles Instrument, das die Zentralbanker sehr unterschiedlich oder überhaupt nicht genutzt haben. Das wird manchmal die "Politik des offenen Mundes" genannt. Mr. Greenspan ist definitiv der Zentralbanker der Welt, der dieses außergewöhnliche Mittel am meisten einsetzt, mit ungewöhnlichem Überfluss und Aggressivität. Er sieht es offensichtlich als legitim für einen Zentralbanker an, die Erwartungen in die Wirtschaft und an den Märkten in die Richtung zu biegen, die er will.
Während den Jahren des Booms und der Spekulationsblase in den USA war Greenspan der bekannteste Apostel der "New Era", also der neuen Ära. In diversen Reden entwickelte er "Theorien", die die Euphorie an den Aktienmärkten begründen sollten und weiter anheizten.
So schlug er in einer Rede in Boca Raton am 28.10.1999 – also wenige Monate vor dem Platzen der Spekulationsblase – vor, dass die nie zuvor gesehenen Bewertungen am Aktienmarkt die passende Antwort der Investoren auf die fortgeschrittene Informations-Technologie seien:
"Der Anstieg der Verfügbarkeit der real-time Informationen hat Unsicherheiten reduziert und deshalb die Varianzen verringert, die wir nutzen, um Portfolio-Entscheidungen zu treffen. ( ...) Aber wie lange können wir erwarten, dass diese bemerkenswerte Periode der Innovation weitergeht? Viele, wenn nicht die meisten von Ihnen, werden sagen, dass sie sich erst in ihrer Anfangsphase befindet. Lou Gerstner (IBM) hat vor ein paar Monaten vor dem Kongress gesagt, dass wir uns erst im fünften Jahr des dreißigjährigen Zyklus der technologischen Veränderungen befinden. Ich habe keinen Grund, dem zu widersprechen."
Mr. Greenspan scheint aus seinen vergangen Fehlern nichts gelernt zu haben. Während der späten 1990er war Greenspan ganz vorne mit dabei, als es darum ging, die Spekulationsblase am Aktienmarkt aggressiv zu stützen, durch die Manipulation der Markt-Wahrnehmung. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Jahr 2000 hat er drei neue Spekulationsblasen gefördert – die Spekulationsblase bei den Immobilienpreisen, die Spekulationsblase bei den Hypotheken und die Spekulationsblase am Anleihenmarkt.
Zusammengenommen sind diese Spekulationsblasen jetzt ziemlich unentbehrlich für die Konsumausgaben geworden.
Aber von diesen drei Blasen ist eine besonders wichtig – denn sie nährt die beiden anderen. Das ist die (jetzt hart unter Druck stehende) Spekulationsblase am Anleihenmarkt. Die Hypotheken werden normalerweise erhöht, wenn die Hypothekenzinsen unter ihr voriges Tief gefallen sind. Und die Hypothekenzinsen werden von der Entwicklung der Staatsanleihen sehr stark beeinflusst. Im Endeffekt war es also der starke Rückgang bei den Renditen der Staatsanleihen, der zum starken Rückgang der Hypothekenzinsen geführt hat. Als die Rendite der 10jährigen US-Anleihen von 4 % auf 3 % gefallen war, da fielen auch die Hypothekenzinsen auf 5,21 %, die niedrigste Rate seit mehr als 4 Dekaden.
Beeindruckend am Rückgang der Renditen war, dass sie mit einem Anstieg der Kurse am Aktienmarkt zusammenfielen. Was hat dies ermöglicht?
Am 29. Mai pries das Wall Street Journal im Editorial den Fed-Vorsitzenden. "Indem er nur von einer Deflation gesprochen hat, hat er veranlasst, dass die Märkte eine Politik des leichteren Geldes antizipierten; die langfristigen Zinsen sind gefallen, was geholfen hat, die Hypothekenzinsen zu senken und eine weitere Runde der Hypothekenvergabe einzuläuten. Das wiederum hat das Konsumentenvertrauen gestärkt und mitgeholfen, die Wirtschaft ( ...) wachsen zu lassen."
Kurz gesagt: Weil Mr. Greenspan und die anderen Fed-Mitglieder versicherten, dass es auf absehbare Zeit keine Erhöhung der Leitzinsen geben würde, sind die Investoren und Spekulanten massiv weiter in Anleihen eingestiegen. Das Ergebnis ist eine Kredit- und Anleihenblase, die inzwischen sogar die Exzesse der vorigen Spekulationsblase am Aktienmarkt übertroffen hat.
Das fundamentale Dilemma ist heute, dass Alan Greenspan und die Wall Street verzweifelte Versuche unternehmen, unhaltbare Spekulationsblasen zu halten – mit jeder verfügbaren Methode. Und die Spekulationsblase am Anleihenmarkt macht mir am meisten Angst. Ihr Einfluss hat die ganze Wirtschaft erfasst und das gesamte Finanzsystem, und ihr Platzen könnte apokalyptische Auswirkungen haben.
investor-verlag.de
Platzen der Spekulationsblase am US-Anleihenmarkt mit drastischen Auswirkungen
von Dr. Kurt Richebächer
Die Leute, die eine zweite Rezession erwarten ("double dip"), bilden in den USA sicherlich nur eine kleine Minderheit. Unter Politikern und Volkswirten ist es in Amerika Konsens, dass die Weltwirtschaftskrise der 1930er und die aktuelle japanische Krise ihren entscheidenden Grund in einem zentralen Fehler der Geldpolitik hatten/haben: In beiden Fällen waren die Zentralbanken zu langsam, als es darum ging, die Zinsen zu senken, sobald sich eine Abschwächung der Wirtschaftslage abzeichnete.
Das führt mich zu einer Schlüsselfrage: Wann machen Zentralbanken ihre entscheidenden Fehler? Während eines Booms und während einer Spekulationsblase? Oder erst danach?
Mr. Greenspan, der davon überzeugt ist, das er aus der Geschichte gelernt hat, hat die amerikanischen Leitzinsen in mehreren Schritten von 6,5 % auf 1,0 % gesenkt. Die kurzfristigen Zinsen fielen stärker als die langfristigen Zinsen, was zu einer Änderung der Zinsstrukturkurve führte. Aber auch die langfristigen Zinsen sanken, da die Investoren und Spekulanten sich zuletzt auf die höher verzinslichen langfristigen Anleihen gestürzt hatten.
Im Prinzip haben Zentralbanken nur zwei Instrumente, mit denen sie das Geld- und Kreditwachstum mit dem Ziel der Stimulierung der wirtschaftlichen Aktivität beeinflussen können: Veränderungen der Bankreserven durch Operationen am offenen Markt (sog. Offenmarktpolitik); und Anpassungen der Leitzinsen.
Aber es gibt noch ein drittes, unkonventionelles Instrument, das die Zentralbanker sehr unterschiedlich oder überhaupt nicht genutzt haben. Das wird manchmal die "Politik des offenen Mundes" genannt. Mr. Greenspan ist definitiv der Zentralbanker der Welt, der dieses außergewöhnliche Mittel am meisten einsetzt, mit ungewöhnlichem Überfluss und Aggressivität. Er sieht es offensichtlich als legitim für einen Zentralbanker an, die Erwartungen in die Wirtschaft und an den Märkten in die Richtung zu biegen, die er will.
Während den Jahren des Booms und der Spekulationsblase in den USA war Greenspan der bekannteste Apostel der "New Era", also der neuen Ära. In diversen Reden entwickelte er "Theorien", die die Euphorie an den Aktienmärkten begründen sollten und weiter anheizten.
So schlug er in einer Rede in Boca Raton am 28.10.1999 – also wenige Monate vor dem Platzen der Spekulationsblase – vor, dass die nie zuvor gesehenen Bewertungen am Aktienmarkt die passende Antwort der Investoren auf die fortgeschrittene Informations-Technologie seien:
"Der Anstieg der Verfügbarkeit der real-time Informationen hat Unsicherheiten reduziert und deshalb die Varianzen verringert, die wir nutzen, um Portfolio-Entscheidungen zu treffen. ( ...) Aber wie lange können wir erwarten, dass diese bemerkenswerte Periode der Innovation weitergeht? Viele, wenn nicht die meisten von Ihnen, werden sagen, dass sie sich erst in ihrer Anfangsphase befindet. Lou Gerstner (IBM) hat vor ein paar Monaten vor dem Kongress gesagt, dass wir uns erst im fünften Jahr des dreißigjährigen Zyklus der technologischen Veränderungen befinden. Ich habe keinen Grund, dem zu widersprechen."
Mr. Greenspan scheint aus seinen vergangen Fehlern nichts gelernt zu haben. Während der späten 1990er war Greenspan ganz vorne mit dabei, als es darum ging, die Spekulationsblase am Aktienmarkt aggressiv zu stützen, durch die Manipulation der Markt-Wahrnehmung. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Jahr 2000 hat er drei neue Spekulationsblasen gefördert – die Spekulationsblase bei den Immobilienpreisen, die Spekulationsblase bei den Hypotheken und die Spekulationsblase am Anleihenmarkt.
Zusammengenommen sind diese Spekulationsblasen jetzt ziemlich unentbehrlich für die Konsumausgaben geworden.
Aber von diesen drei Blasen ist eine besonders wichtig – denn sie nährt die beiden anderen. Das ist die (jetzt hart unter Druck stehende) Spekulationsblase am Anleihenmarkt. Die Hypotheken werden normalerweise erhöht, wenn die Hypothekenzinsen unter ihr voriges Tief gefallen sind. Und die Hypothekenzinsen werden von der Entwicklung der Staatsanleihen sehr stark beeinflusst. Im Endeffekt war es also der starke Rückgang bei den Renditen der Staatsanleihen, der zum starken Rückgang der Hypothekenzinsen geführt hat. Als die Rendite der 10jährigen US-Anleihen von 4 % auf 3 % gefallen war, da fielen auch die Hypothekenzinsen auf 5,21 %, die niedrigste Rate seit mehr als 4 Dekaden.
Beeindruckend am Rückgang der Renditen war, dass sie mit einem Anstieg der Kurse am Aktienmarkt zusammenfielen. Was hat dies ermöglicht?
Am 29. Mai pries das Wall Street Journal im Editorial den Fed-Vorsitzenden. "Indem er nur von einer Deflation gesprochen hat, hat er veranlasst, dass die Märkte eine Politik des leichteren Geldes antizipierten; die langfristigen Zinsen sind gefallen, was geholfen hat, die Hypothekenzinsen zu senken und eine weitere Runde der Hypothekenvergabe einzuläuten. Das wiederum hat das Konsumentenvertrauen gestärkt und mitgeholfen, die Wirtschaft ( ...) wachsen zu lassen."
Kurz gesagt: Weil Mr. Greenspan und die anderen Fed-Mitglieder versicherten, dass es auf absehbare Zeit keine Erhöhung der Leitzinsen geben würde, sind die Investoren und Spekulanten massiv weiter in Anleihen eingestiegen. Das Ergebnis ist eine Kredit- und Anleihenblase, die inzwischen sogar die Exzesse der vorigen Spekulationsblase am Aktienmarkt übertroffen hat.
Das fundamentale Dilemma ist heute, dass Alan Greenspan und die Wall Street verzweifelte Versuche unternehmen, unhaltbare Spekulationsblasen zu halten – mit jeder verfügbaren Methode. Und die Spekulationsblase am Anleihenmarkt macht mir am meisten Angst. Ihr Einfluss hat die ganze Wirtschaft erfasst und das gesamte Finanzsystem, und ihr Platzen könnte apokalyptische Auswirkungen haben.
investor-verlag.de
How to slide into a third Gulf war
By Anthony Cordesman
Published: July 30 2003 20:23
It is far too soon to talk about prolonged guerrilla warfare in Iraq. So far, the threat has come largely from small cadres of Ba`ath party followers and Saddam Hussein loyalists in central Iraq. They can operate more because Sunnis still fear the old regime, and resent the US occupation for its initial failures in providing security and nation-building, than because they have popular support. The US and its allies can defeat this kind of opposition if the nation-building effort gathers momentum and the US combines focused military action and suitable concern for Iraqi civilians. However, if the US blunders, it not only may lose the peace but also could create a third Gulf war.
This could occur as the result of some combination of the following mistakes:
Rather than progress towards an Iraq for the Iraqis on their terms, the Americans muddle through. It starts to look as if they will be there for five to 10 years, rather than 12-24 months. Rather than set goals to attract genuine Iraqi support, the US appears to be rebuilding Iraq in its own image.
The nation-building effort, including economic recovery, is too slow and too many promises are not kept. Local security falters. Well intended reforms either do not work or pay off too late to generate any gratitude. The US and its allies try to find the leaders they want, rather than those the Iraqis want. Rather than screening the Ba`ath and Iraqi military as individuals, they reject some of Iraq`s best people, who went along with Saddam Hussein`s dictatorship in order to survive.
The US and its allies deal with the guerrilla threat by acting more like occupiers than liberators. US forces increasingly huddle behind their own security barriers, distancing themselves from ordinary Iraqis. The US has tactical military successes but alienates a large number of Sunnis in the process - Sunnis who feel increasingly disenfranchised as the Shia and Kurds gain a fair share of wealth and power. Remnants of the Ba`ath and Saddam loyalists mix with new elements of Sunni Islamic extremists to present a continuing threat. Even those Sunnis who do not want Mr Hussein come to demand a US/UK withdrawal from their country.
The US tries too hard to prevent religious Shia from gaining power. It alienates the Shia majority, which has largely tolerated - but not supported - the US/UK presence. The result plays into the hands of religious hard-liners and Iran. The same pattern of resistance and violence emerges in the south that now exists in central Iraq.
Growing sectarian divisions complicate the nation-building effort. The Kurds continue to support the US and Britain but the Kurdish factions resume their power struggle as the cash flow from the oil for food programme and from smuggling dries up. The assertion of Kurdish power creates resentment among Sunnis and Turkomans and strains relations between the US and Turkey.
US efforts to create a federal structure that can bridge the ethnic and sectarian divides fail to prevent inter-communal violence. No Iraqi faction is convinced that a federal state will give it a fair share of real power. Fear of prolonged occupation, and the feeling among most Iraqis that those who go along with the US effort simply do so as appeasers and for their own benefit, undercuts the nation-building effort and adds to the unrest.
The US tries to handle all of these problems on the cheap. Washington talks up Iraq`s oil wealth even though the country has already lost six months of oil export revenues and half of its export production capacity. The US tries to rehabilitate Iraq`s petroleum industry according to its own priorities and without Iraqi technocratic and political input. Ordinary Iraqis come to feel their oil is being stolen and oil revenues are not used as the glue to unite Iraq`s divided factions in some form of federalism.
The US fails to confront its allies with the need to forgive Iraqi reparations and debt - claims potentially amounting to more than $200bn - leaving Iraq angry and without a financial future. It improvises solutions in Western market terms, failing to realise that oil export revenues are the only glue that can hold Iraqi federalism together. The US and its allies try do the right thing in economic and technocratic terms but end up increasing Iraqi distrust and hostility.
Iraqis believe that the token 40,000-man Iraqi army formed by the US leaves Iraq defenceless against Iran and Turkey and dependent on US and British occupying forces. Even those officers who seem to support the US and UK secretly become nationalistic and hostile.
Each step in this process pushes the US and its allies towards greater dependence on returned Iraqi opposition leaders who have little real influence and credibility and on Iraqis willing to go along with the occupying powers solely for their own gain. It also creates an insecure environment for the real task at hand: rebuilding the Iraqi nation.
There is nothing inevitable about this worst case scenario. Indeed, these are precisely the pitfalls that US, Britain and others involved in the nation-building effort will try to avoid. But if they fail, the US may end up fighting a war against the Iraqi people. This is a kind of "asymmetric" war the US should never have to fight and cannot win.
The writer holds the Arleigh A. Burke chair in strategy at the Centre for Strategic Studies in Washington
http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/Sto…
syr
By Anthony Cordesman
Published: July 30 2003 20:23
It is far too soon to talk about prolonged guerrilla warfare in Iraq. So far, the threat has come largely from small cadres of Ba`ath party followers and Saddam Hussein loyalists in central Iraq. They can operate more because Sunnis still fear the old regime, and resent the US occupation for its initial failures in providing security and nation-building, than because they have popular support. The US and its allies can defeat this kind of opposition if the nation-building effort gathers momentum and the US combines focused military action and suitable concern for Iraqi civilians. However, if the US blunders, it not only may lose the peace but also could create a third Gulf war.
This could occur as the result of some combination of the following mistakes:
Rather than progress towards an Iraq for the Iraqis on their terms, the Americans muddle through. It starts to look as if they will be there for five to 10 years, rather than 12-24 months. Rather than set goals to attract genuine Iraqi support, the US appears to be rebuilding Iraq in its own image.
The nation-building effort, including economic recovery, is too slow and too many promises are not kept. Local security falters. Well intended reforms either do not work or pay off too late to generate any gratitude. The US and its allies try to find the leaders they want, rather than those the Iraqis want. Rather than screening the Ba`ath and Iraqi military as individuals, they reject some of Iraq`s best people, who went along with Saddam Hussein`s dictatorship in order to survive.
The US and its allies deal with the guerrilla threat by acting more like occupiers than liberators. US forces increasingly huddle behind their own security barriers, distancing themselves from ordinary Iraqis. The US has tactical military successes but alienates a large number of Sunnis in the process - Sunnis who feel increasingly disenfranchised as the Shia and Kurds gain a fair share of wealth and power. Remnants of the Ba`ath and Saddam loyalists mix with new elements of Sunni Islamic extremists to present a continuing threat. Even those Sunnis who do not want Mr Hussein come to demand a US/UK withdrawal from their country.
The US tries too hard to prevent religious Shia from gaining power. It alienates the Shia majority, which has largely tolerated - but not supported - the US/UK presence. The result plays into the hands of religious hard-liners and Iran. The same pattern of resistance and violence emerges in the south that now exists in central Iraq.
Growing sectarian divisions complicate the nation-building effort. The Kurds continue to support the US and Britain but the Kurdish factions resume their power struggle as the cash flow from the oil for food programme and from smuggling dries up. The assertion of Kurdish power creates resentment among Sunnis and Turkomans and strains relations between the US and Turkey.
US efforts to create a federal structure that can bridge the ethnic and sectarian divides fail to prevent inter-communal violence. No Iraqi faction is convinced that a federal state will give it a fair share of real power. Fear of prolonged occupation, and the feeling among most Iraqis that those who go along with the US effort simply do so as appeasers and for their own benefit, undercuts the nation-building effort and adds to the unrest.
The US tries to handle all of these problems on the cheap. Washington talks up Iraq`s oil wealth even though the country has already lost six months of oil export revenues and half of its export production capacity. The US tries to rehabilitate Iraq`s petroleum industry according to its own priorities and without Iraqi technocratic and political input. Ordinary Iraqis come to feel their oil is being stolen and oil revenues are not used as the glue to unite Iraq`s divided factions in some form of federalism.
The US fails to confront its allies with the need to forgive Iraqi reparations and debt - claims potentially amounting to more than $200bn - leaving Iraq angry and without a financial future. It improvises solutions in Western market terms, failing to realise that oil export revenues are the only glue that can hold Iraqi federalism together. The US and its allies try do the right thing in economic and technocratic terms but end up increasing Iraqi distrust and hostility.
Iraqis believe that the token 40,000-man Iraqi army formed by the US leaves Iraq defenceless against Iran and Turkey and dependent on US and British occupying forces. Even those officers who seem to support the US and UK secretly become nationalistic and hostile.
Each step in this process pushes the US and its allies towards greater dependence on returned Iraqi opposition leaders who have little real influence and credibility and on Iraqis willing to go along with the occupying powers solely for their own gain. It also creates an insecure environment for the real task at hand: rebuilding the Iraqi nation.
There is nothing inevitable about this worst case scenario. Indeed, these are precisely the pitfalls that US, Britain and others involved in the nation-building effort will try to avoid. But if they fail, the US may end up fighting a war against the Iraqi people. This is a kind of "asymmetric" war the US should never have to fight and cannot win.
The writer holds the Arleigh A. Burke chair in strategy at the Centre for Strategic Studies in Washington
http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/Sto…
syr
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
Kriegswirtschaft! Nichts anderes ist Amerika 

31.07.2003 14:55
USA: Wirtschaft wächst im 2. Quartal mit 2,4% deutlich stärker als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich stärker als von Volkswirten erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei auf das Jahr hochgerechnet um 2,4 Prozent gewachsen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet.
Damit hat sich das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten im zweite Quartal deutlich beschleunigt. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent gewachsen.
Die Ursache der kräftigen Belebung liege vor allem in einem starken Anstieg der Verteidigungsausgaben. Mit einem Sprung von 44,1 Prozent sei der stärkste Zuwachs seit dem Korea-Krieg in den frühen 50er Jahren verzeichnet worden.
Die Konsumausgaben stiegen im zweiten Quartal nach Angaben des Handelsministeriums um 3,3 Prozent. Der BIP-Preisindex ist um 0,9 Prozent geklettert./FX/jkr/jha/
Quelle: DPA-AFX
----
Die sind doch echt bescheuert!
Und die Märkte sind fett im Plus, wegen so einem Schei...
USA: Wirtschaft wächst im 2. Quartal mit 2,4% deutlich stärker als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich stärker als von Volkswirten erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei auf das Jahr hochgerechnet um 2,4 Prozent gewachsen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet.
Damit hat sich das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten im zweite Quartal deutlich beschleunigt. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent gewachsen.
Die Ursache der kräftigen Belebung liege vor allem in einem starken Anstieg der Verteidigungsausgaben. Mit einem Sprung von 44,1 Prozent sei der stärkste Zuwachs seit dem Korea-Krieg in den frühen 50er Jahren verzeichnet worden.
Die Konsumausgaben stiegen im zweiten Quartal nach Angaben des Handelsministeriums um 3,3 Prozent. Der BIP-Preisindex ist um 0,9 Prozent geklettert./FX/jkr/jha/
Quelle: DPA-AFX
----
Die sind doch echt bescheuert!

Und die Märkte sind fett im Plus, wegen so einem Schei...

!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
US-Einkaufsmanagerindex signalisiert Wachstum der US-Industrie
Freitag 1. August 2003, 16:07 Uhr
Tempe, 01. Aug (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel beachtete Konjunkturindex der US-Einkaufsmanager ist im Juli erwartungsgemäß gestiegen und signalisiert damit wieder ein Wachstum der US-Industrie.
Der Index kletterte auf 51,8 Punkte von 49,8 Punkten im Juni, wie das Institute of Supply Management (ISM) am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt auch einen Anstieg in diesem Ausmaß erwartet. Ein Index-Wert von über 50 Punkten deutet auf eine Expansion im Verarbeitenden Gewerbe hin, Werte darunter zeigen ein Schrumpfen an.
Der Beschäftigungsindex fiel geringfügig auf 46,1 (Juni 46,2) Punkte und zeigt damit einen leicht beschleunigten Stellenabbau an. Der Preisindex fiel auf 53,0 (56,5) Zähler. Der Teilindex Neuaufträge kletterte dagegen deutlich auf 56,6 (52,2) Zähler.
Die Aktienmärkte in den USA und Europa bauten ihre Kursverluste nach Veröffentlichung der Daten geringfügig aus. Der Euro legte zum Dollar weiter zu.
mer/phi
TABELLE-US-Einkaufsmanagerindex im Juli wie erwartet gestiegen
Freitag 1. August 2003, 16:15 Uhr
Tempe, 01. Aug (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel beachtete ISM-Konjunkturindex ist im Juli wie erwartet gestiegen. Das Institute for Supply Management (ISM) nannte am Freitag in Tempe (US-Bundesstaat Arizona) folgende Zahlen für den Index über die Geschäftsaktivität des Verarbeitenden Gewerbes in den USA und für seine Teilkomponenten:
JUL JUN MAI APR MÄR FEB
2003 2003 2003 2003 2003 2003
Gesamtindex 51,8 49,8 49,4 45,4 46,2 50,5
Auftragseingang 56,6 52,2 51,9 45,2 46,2 52,3
Produktion 53,3 52,9 51,5 47,0 46,3 55,4
Beschäftigung 46,1 46,2 43,0 41,4 42,1 42,8
Auslieferungen 51,1 50,0 51,3 50,0 53,8 53,3
Lagerbestände 45,9 41,3 46,1 42,7 42,3 43,8
Preise 53,0 56,5 51,5 63,5 70,0 65,5
Auftragsbestand 51,0 50,0 51,0 47,5 41,5 49,0
Auftragseingang aus
dem Ausland 53,8 54,4 50,8 51,1 52,0 55,5
Importe 56,0 56,4 52,2 54,5 52,5 55,4
NOTE: Von Reuters befragte Analysten hatten für den Berichtsmonat einen Anstieg des Indexes auf 51,8 Punkte vorausgesagt. Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert eine Verbesserung, ein Stand unter 50 Punkten dagegen eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage im Verarbeitenden Gewerbe.
fri/

Freitag 1. August 2003, 16:07 Uhr
Tempe, 01. Aug (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel beachtete Konjunkturindex der US-Einkaufsmanager ist im Juli erwartungsgemäß gestiegen und signalisiert damit wieder ein Wachstum der US-Industrie.
Der Index kletterte auf 51,8 Punkte von 49,8 Punkten im Juni, wie das Institute of Supply Management (ISM) am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt auch einen Anstieg in diesem Ausmaß erwartet. Ein Index-Wert von über 50 Punkten deutet auf eine Expansion im Verarbeitenden Gewerbe hin, Werte darunter zeigen ein Schrumpfen an.
Der Beschäftigungsindex fiel geringfügig auf 46,1 (Juni 46,2) Punkte und zeigt damit einen leicht beschleunigten Stellenabbau an. Der Preisindex fiel auf 53,0 (56,5) Zähler. Der Teilindex Neuaufträge kletterte dagegen deutlich auf 56,6 (52,2) Zähler.
Die Aktienmärkte in den USA und Europa bauten ihre Kursverluste nach Veröffentlichung der Daten geringfügig aus. Der Euro legte zum Dollar weiter zu.
mer/phi
TABELLE-US-Einkaufsmanagerindex im Juli wie erwartet gestiegen
Freitag 1. August 2003, 16:15 Uhr
Tempe, 01. Aug (Reuters) - Der an den Finanzmärkten viel beachtete ISM-Konjunkturindex ist im Juli wie erwartet gestiegen. Das Institute for Supply Management (ISM) nannte am Freitag in Tempe (US-Bundesstaat Arizona) folgende Zahlen für den Index über die Geschäftsaktivität des Verarbeitenden Gewerbes in den USA und für seine Teilkomponenten:
JUL JUN MAI APR MÄR FEB
2003 2003 2003 2003 2003 2003
Gesamtindex 51,8 49,8 49,4 45,4 46,2 50,5
Auftragseingang 56,6 52,2 51,9 45,2 46,2 52,3
Produktion 53,3 52,9 51,5 47,0 46,3 55,4
Beschäftigung 46,1 46,2 43,0 41,4 42,1 42,8
Auslieferungen 51,1 50,0 51,3 50,0 53,8 53,3
Lagerbestände 45,9 41,3 46,1 42,7 42,3 43,8
Preise 53,0 56,5 51,5 63,5 70,0 65,5
Auftragsbestand 51,0 50,0 51,0 47,5 41,5 49,0
Auftragseingang aus
dem Ausland 53,8 54,4 50,8 51,1 52,0 55,5
Importe 56,0 56,4 52,2 54,5 52,5 55,4
NOTE: Von Reuters befragte Analysten hatten für den Berichtsmonat einen Anstieg des Indexes auf 51,8 Punkte vorausgesagt. Ein Indexstand über 50 Punkten signalisiert eine Verbesserung, ein Stand unter 50 Punkten dagegen eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage im Verarbeitenden Gewerbe.
fri/

tolpie tigidal had aba auuch einn unfidersteeliches kahrisma.


tolpie tigidal had aba auuch einn unfidersteeliches kahrisma.


US-Arbeitslosenquote sinkt überraschend stark
01.08.2003 14:46:00
Das US-Arbeitsministerium verkündete die saisonbereinigten US-Arbeitsmarktdaten für Juli 2003. Die Arbeitslosenquote sank von einem ein Neun-Jahres-Hoch mit 6,4 Prozent im Vormonat auf nun 6,2 Prozent. Dies ist die erste Verbesserung seit über einem Jahr. Im Vorfeld hatten Volkswirte nur einen Rückgang auf 6,3 Prozent geschätzt.
Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft verringerte sich im Berichtsmonat deutlich um 44.000 Personen gegenüber dem Vormonat, während Volkswirte eine Zunahme um 18.000 Beschäftigte prognostiziert hatten.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen auf 15,44 Dollar an, nach 15,39 Dollar im Vormonat. Sie gelten als wichtiger Indikator für die Inflations-Entwicklung. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sank leicht von 33,7 auf 33,6 Stunden.
-tz- / -mj-
Anzeige:
Nur 7 Euro pro Jahr: Die Auslands-Reise-Krankenversicherung
© 1999-2003 SmartHouse Media GmbH
Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit,
Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Kursdaten vwd
finanzen.net als Startseite - Seite zu Favoriten hinzufügen - Kontakt Disclaimer - Impressum - Werben auf finanzen.net -
01.08.2003 14:46:00
Das US-Arbeitsministerium verkündete die saisonbereinigten US-Arbeitsmarktdaten für Juli 2003. Die Arbeitslosenquote sank von einem ein Neun-Jahres-Hoch mit 6,4 Prozent im Vormonat auf nun 6,2 Prozent. Dies ist die erste Verbesserung seit über einem Jahr. Im Vorfeld hatten Volkswirte nur einen Rückgang auf 6,3 Prozent geschätzt.
Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft verringerte sich im Berichtsmonat deutlich um 44.000 Personen gegenüber dem Vormonat, während Volkswirte eine Zunahme um 18.000 Beschäftigte prognostiziert hatten.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen auf 15,44 Dollar an, nach 15,39 Dollar im Vormonat. Sie gelten als wichtiger Indikator für die Inflations-Entwicklung. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sank leicht von 33,7 auf 33,6 Stunden.
-tz- / -mj-
Anzeige:
Nur 7 Euro pro Jahr: Die Auslands-Reise-Krankenversicherung
© 1999-2003 SmartHouse Media GmbH
Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit,
Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Kursdaten vwd
finanzen.net als Startseite - Seite zu Favoriten hinzufügen - Kontakt Disclaimer - Impressum - Werben auf finanzen.net -
Weitere Optionen zu Deutsche Bank AG [WKN: 514000]:
Kurse/Charts News Analysen Tools Fundamental Details
Chart zur Aktie zur Aktie Research Bilanz Termine
Börsen (D) ad-hoc Chart-Analyse Optionssch. GuV Profil
Realtime (D) zur Branche zur Branche Fonds Cash-flow IR-Daten
zum Index zum Index Anleihen Geschäftsber. Forum
Alle Aktien in diesem Artikel: Deutsche Bank AG, LION bioscience AG, Commerzbank AG, E.ON AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HypoVereinsbank)
Deutsche Aktien von US-Konjunkturdaten belastet
01.08.2003 20:33:00
Die deutschen Aktien konnten am Freitag nicht an ihre Glanzleistung der Vormonate anknüpfen. Nachdem ein Großteil des erhofften Aufschwungs hierzulande an den Konjunkturbewegungen in den USA festgemacht wird, drückten schwächer als erwartete Daten aus Übersee am Freitag auf die Gemüter.
Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 3438 Punkte. Der TecDAX 0,56 % auf 458 Punkte.
Am Donnerstag waren geringer als erwartet ausgefallene Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung festgestellt worden. Da diese Zahl aber unter anderem auch saisonalen Schwankungen unterliegt und derzeit Ferien in den USA sind, könnte der gemeldete Wert von 388.000 Anträgen durch die Sonderumstände zu niedrig ausgefallen sein. Am Freitag wurde bekannt, dass in den USA die Arbeitslosenrate auf 6,2 von 6,4 Prozent gefallen ist. Diese Zahl wird aber primär durch 470.000 Personen bedingt, die die Jobsuche aufgegeben haben und in den offiziellen Statistiken nicht mehr erfasst werden, weshalb die US-Arbeitslosenrate historisch immer weit untertrieben ausfällt. Außerdem wurden entgegen den Erwartungen der Marktteilnehmer keine neuen Stellen geschaffen, sondern 44.000 gingen im Juli verloren. Wieder einmal wurden im verarbeitenden Gewerbe die meisten Personen entlassen, nämlich 71.000 im Juli, den 36sten Monat in Folge mit weniger Beschäftigten.
Gleichzeitig haben die US-Bürger aber ihre Konsumlust nicht verloren. Ihre Konsumausgaben und ihr durchschnittliches Einkommen stiegen um 0,3 Prozent im Juni. Allerdings hatte auch hier die Prognosen höhere Werte vermutet.
Im verarbeitenden Gewerbe stieg der Einkaufsmanagerindex von 49,8 auf 51,8. Werte über 50 Punkten entsprachen historisch einem Aufschwung. Analysten hatten aber im Durchschnitt mit 52 Punkten gerechnet.
Der Deutsche Einkaufsmanagerindex stieg im Juli auf 48,1 Punkte, während Analysten mit 45,9 Punkten gerechnet hatten. Doch wie schon in der Vergangenheit gilt weiterhin die USA als Maß aller Dinge in Sachen Weltwirtschaft. Der DAX wurde außerdem belastet von der schwachen Performance einiger großer Titel, allen voran die Deutsche Bank. Nach den eher mäßigen Quartalszahlen hatten mehrere Analysten die Aktien herabgestuft. Bei der HypoVereinsbank kam es nach der Meldung, dass E.ON seine Beteiligung veräußert habe, zu größeren Kursrückgängen, aber auch andere Finanzwerte litten, wobei die Commerzbank hingegen zu den wenigen Gewinnern zählte.
Im TecDAX gibt es keine Finanzwerte, die derart auf die Stimmung drücken können, weshalb dieser mit einem Tagesminus von 0,56 Prozent vergleichsweise gut davonkam. Herausragender Wert des Tages war Lion Bioscience, die dank eines verringerten Verlustes trotz drastisch gesenkter Umsatzprognosen bis Handelsende 7,78 Prozent hinzugewannen.
-red- / -red-
Anzeige:
Nur 7 Euro pro Jahr: Die Auslands-Reise-Krankenversicherung
Weitere Artikel zu Deutsche Bank AG:
01.08.03 17:57 Deutsche Bank verkauft Teile des Private-Equity Fonds-Portfolios
01.08.03 09:45 DAX am Morgen: Schwacher Start, Deutsche Bank führt Verliererliste an
31.07.03 20:15 Marktbericht: DAX und TecDAX legen kräftig zu
31.07.03 11:55 Puma weiter auf Höhenflug!
31.07.03 09:49 DAX am Morgen: Grüne Vorzeichen, Schering - 6,5%
weiter...
© 1999-2003 SmartHouse Media GmbH
Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit,
Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Kursdaten vwd
finanzen.net als Startseite - Seite zu Favoriten hinzufügen - Kontakt Disclaimer - Impressum - Werben auf finanzen.net -
Kurse/Charts News Analysen Tools Fundamental Details
Chart zur Aktie zur Aktie Research Bilanz Termine
Börsen (D) ad-hoc Chart-Analyse Optionssch. GuV Profil
Realtime (D) zur Branche zur Branche Fonds Cash-flow IR-Daten
zum Index zum Index Anleihen Geschäftsber. Forum
Alle Aktien in diesem Artikel: Deutsche Bank AG, LION bioscience AG, Commerzbank AG, E.ON AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HypoVereinsbank)
Deutsche Aktien von US-Konjunkturdaten belastet
01.08.2003 20:33:00
Die deutschen Aktien konnten am Freitag nicht an ihre Glanzleistung der Vormonate anknüpfen. Nachdem ein Großteil des erhofften Aufschwungs hierzulande an den Konjunkturbewegungen in den USA festgemacht wird, drückten schwächer als erwartete Daten aus Übersee am Freitag auf die Gemüter.
Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 3438 Punkte. Der TecDAX 0,56 % auf 458 Punkte.
Am Donnerstag waren geringer als erwartet ausgefallene Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung festgestellt worden. Da diese Zahl aber unter anderem auch saisonalen Schwankungen unterliegt und derzeit Ferien in den USA sind, könnte der gemeldete Wert von 388.000 Anträgen durch die Sonderumstände zu niedrig ausgefallen sein. Am Freitag wurde bekannt, dass in den USA die Arbeitslosenrate auf 6,2 von 6,4 Prozent gefallen ist. Diese Zahl wird aber primär durch 470.000 Personen bedingt, die die Jobsuche aufgegeben haben und in den offiziellen Statistiken nicht mehr erfasst werden, weshalb die US-Arbeitslosenrate historisch immer weit untertrieben ausfällt. Außerdem wurden entgegen den Erwartungen der Marktteilnehmer keine neuen Stellen geschaffen, sondern 44.000 gingen im Juli verloren. Wieder einmal wurden im verarbeitenden Gewerbe die meisten Personen entlassen, nämlich 71.000 im Juli, den 36sten Monat in Folge mit weniger Beschäftigten.
Gleichzeitig haben die US-Bürger aber ihre Konsumlust nicht verloren. Ihre Konsumausgaben und ihr durchschnittliches Einkommen stiegen um 0,3 Prozent im Juni. Allerdings hatte auch hier die Prognosen höhere Werte vermutet.
Im verarbeitenden Gewerbe stieg der Einkaufsmanagerindex von 49,8 auf 51,8. Werte über 50 Punkten entsprachen historisch einem Aufschwung. Analysten hatten aber im Durchschnitt mit 52 Punkten gerechnet.
Der Deutsche Einkaufsmanagerindex stieg im Juli auf 48,1 Punkte, während Analysten mit 45,9 Punkten gerechnet hatten. Doch wie schon in der Vergangenheit gilt weiterhin die USA als Maß aller Dinge in Sachen Weltwirtschaft. Der DAX wurde außerdem belastet von der schwachen Performance einiger großer Titel, allen voran die Deutsche Bank. Nach den eher mäßigen Quartalszahlen hatten mehrere Analysten die Aktien herabgestuft. Bei der HypoVereinsbank kam es nach der Meldung, dass E.ON seine Beteiligung veräußert habe, zu größeren Kursrückgängen, aber auch andere Finanzwerte litten, wobei die Commerzbank hingegen zu den wenigen Gewinnern zählte.
Im TecDAX gibt es keine Finanzwerte, die derart auf die Stimmung drücken können, weshalb dieser mit einem Tagesminus von 0,56 Prozent vergleichsweise gut davonkam. Herausragender Wert des Tages war Lion Bioscience, die dank eines verringerten Verlustes trotz drastisch gesenkter Umsatzprognosen bis Handelsende 7,78 Prozent hinzugewannen.
-red- / -red-
Anzeige:
Nur 7 Euro pro Jahr: Die Auslands-Reise-Krankenversicherung
Weitere Artikel zu Deutsche Bank AG:
01.08.03 17:57 Deutsche Bank verkauft Teile des Private-Equity Fonds-Portfolios
01.08.03 09:45 DAX am Morgen: Schwacher Start, Deutsche Bank führt Verliererliste an
31.07.03 20:15 Marktbericht: DAX und TecDAX legen kräftig zu
31.07.03 11:55 Puma weiter auf Höhenflug!
31.07.03 09:49 DAX am Morgen: Grüne Vorzeichen, Schering - 6,5%
weiter...
© 1999-2003 SmartHouse Media GmbH
Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit,
Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Kursdaten vwd
finanzen.net als Startseite - Seite zu Favoriten hinzufügen - Kontakt Disclaimer - Impressum - Werben auf finanzen.net -
Press Release Source: American Home Mortgage, Inc.
American Home Mortgage Enters Into Agreement To Acquire Apex Mortgage Capital, Inc.
Monday July 14, 6:30 am ET
American Home to Reorganize as a Real Estate Investment Trust (REIT)
Raises 2003 Earnings Per Share Guidance 27 % to $3.95 - $4.05 and 2004 Earnings Per Share Guidance 31% to $3.05 - $3.15 Assuming Consummation of the Apex Merger*
Projects 2004 Annual Dividend of $2.20 Per Share and Q4 2003 Dividend of $0.55 Per Share*
Adopts Strategy of Holding Its Adjustable Rate Loan Originations as Long-Term Assets*
Subject to Final Transaction Adjustments, Apex Shareholders Calculated to Receive Approximately $6.21 Per Share in American Home Stock, an 11.3% Premium to the Closing Price of Apex on July 11, 2003
*Projections and strategy adoption marked with an asterisk are for American Home and assume consummation of the Apex merger on or about September 30, 2003
MELVILLE, N.Y., and LOS ANGELES, July 14 /PRNewswire-FirstCall/ -- American Home Mortgage, Inc. (Nasdaq: AHMH - News), announced today it has signed a definitive agreement to acquire Apex Mortgage Capital, Inc. (Amex: AXM - News), a financial company structured as a Real Estate Investment Trust (REIT). The purchase price is based upon a floating exchange ratio, which is a function of Apex`s book value and American Home`s stock price at a time near the closing date. Based upon the most recently available information the exchange ratio would result in Apex shareholders receiving shares of American Home valued at approximately $186 million, or $6.21 per outstanding Apex share, representing an implied premium to Apex shareholders of 11.3%. The transaction is subject to approval by American Home and Apex shareholders and to other closing conditions.
In connection with the consummation of the merger, American Home will reorganize and elect to be taxed as a Real Estate Investment Trust with a wholly owned taxable subsidiary that will include its existing mortgage origination and mortgage servicing businesses. The origination and servicing subsidiary is expected to retain a significant portion of its ongoing net earnings, allowing it to continue to expand and diversify its lending franchise, including proceeding with its previously announced acquisition of Valley Bancorp.
American Home projects the transaction will be accretive to 2003 and 2004 earnings per share, as well as to its book value. Pro forma book value, as a result of the merger, and based on June 30 estimates, is projected to increase $186 million or $2.66 per share to $392 million or $14.64 per share, subject to certain transaction adjustments. Based on the closing price of American Home`s shares on July 11, 2003, the combined company would have a market capitalization of approximately $567 million.
In commenting on the merger, Michael Strauss, Chairman and Chief Executive of American Home stated, "In acquiring Apex and reorganizing as a REIT, American Home is diversifying its sources of revenue by adding a complementary line of business to its mortgage origination and mortgage servicing operations, namely holding our adjustable mortgage originations in the form of mortgage backed securities for net interest income." Mr. Strauss continued: "In 2004 we project that combined with Apex, net interest income from mortgage securities holdings, mortgage origination and mortgage servicing will account for 47%, 38% and 15% of our earnings, respectively, and that by holding the adjustable rate loans we originate, our earnings will be less cyclical and less dependent on mortgage refinancing activity. We project that our businesses will be highly complementary, and that our mortgage portfolio business will be able to obtain mortgage loans through our origination operation and convert them into mortgage-backed securities on terms more favorable than it could achieve through market purchases of mortgage-backed securities, thereby materially enhancing our mortgage portfolio`s return on assets."
Commenting on the acquisition, Philip Barach, President of Apex said, "In considering strategic alternatives, it became clear that combining mortgage origination and servicing capabilities with a managed portfolio of mortgage investments in a REIT structure offered the highest potential return for our shareholders. We are pleased our shareholders will realize a meaningful premium to Apex`s book value and become owners of a leading hybrid REIT that is capable of producing significant future value. The inherent synergies and potential advantages are a model for the industry and should work to maximize return on assets and equity."
Asset and Mortgage Origination Strategies
American Home plans to immediately discontinue Apex`s strategy of holding fixed rate loans, which it believes are more exposed to price volatility from changes in interest rates. Initially, the company will acquire various adjustable rate mortgage backed securities in the market, but expects that over time it will primarily hold mortgage-backed securities created from its adjustable rate loan originations. The mortgage-backed securities will typically be financed with liabilities in a strategy aimed at positioning American Home`s overall mortgage holdings and their associated liabilities to avoid or limit a loss of net asset value due to changes in interest rates. Over 95% of the securities held are expected to either be obligations of Fannie Mae, Freddie Mac or Ginnie Mae, or have a Standard & Poors rating of AAA or Moodys rating of Aaa.
American Home projects that by originating its own mortgage securities holdings rather than purchasing mortgage-backed securities in the capital markets, its cost to acquire assets will be materially reduced and, consequently, its return on assets will be enhanced while its exposure to loss from prepayments will be lessened. The company estimates that by following an interest rate neutral strategy, and by concentrating on adjustable rate assets, its return on equity invested in mortgage holdings, without the advantages gained by originating its own holdings would be approximately 14% under current market conditions. The company estimates that this return can be improved to approximately 18% through the advantages gained from originating its own holdings. During an initial transition period of approximately six months, American Home will hold purchased securities until enough self-originated securities are produced to fill its balance sheet. As a result, American Home projects a return on its equity invested in mortgage holdings of 14% in Q4 - 2003, 16% in Q1 - 2004 and 18% thereafter. It is important to note that the actual return from holding mortgage securities is difficult to predict, and that the actual return on equity invested in mortgage holdings may differ widely from American Home`s estimates.
American Home is also pleased to announce that Tom McDonagh has joined the company as Executive Vice President and Chief Investment Officer. Previously Mr. McDonagh managed the mortgage securities holdings of the California Public Employees` Retirement System (CalPERS). Mr. McDonagh will be responsible for managing the company`s mortgage securities holdings and their associated liabilities, including the management of the exposure of the portfolio to, among other things, changes in the general level of interest rates. Mr. McDonagh will be assisted by BlackRock Solutions, which will serve as risk management consultant to the company with respect to its mortgage holdings.
American Home`s taxable subsidiary will continue to originate and resell those types of mortgage loans the company does not intend to hold and will conduct its existing servicing and related businesses. This subsidiary will also pursue the company`s pending acquisition of Valley Bancorp and continue to execute on the company`s other growth strategies, including making accretive acquisitions of mortgage franchises, growing MortgageSelect, and organic retail branch growth.
Michael Strauss added, "Based upon the most recently available information, the merger will add approximately $186 million of new equity to American Home, providing greater financial flexibility and stability under varied market conditions. This merger also allows the company to significantly increase its dividends to shareholders, while retaining sufficient capital to continue to grow our successful lending franchise."
Transaction Details
Under the terms of the agreement, American Home will reorganize through a reverse triangular merger that will cause a newly formed REIT to become American Home`s parent. Shareholders of American Home will receive one share in the new parent for each of their American Home shares.
Based on the most recently available information, shareholders of Apex would receive approximately 0.32 shares in the new parent for each of their Apex shares. Based on American Home`s projection for per share dividends of $2.20 per year, the implied dividend for each Apex share would be approximately $0.70 per year, compared to Apex`s current estimated annual dividend of $0.68 per share per year. The implied dividend per Apex share will fluctuate based on changes in the exchange ratio. The consideration to be paid to Apex`s shareholders will be adjusted for certain transaction expenses, including the payment of the estimated fee to Apex`s investment manager in connection with the termination of the existing management contract. Apex`s investment manager has agreed, upon successful completion of the merger, that it will terminate its management contract for a termination fee equal to 40% of the premium over book value received by Apex. This represents a significant voluntary reduction by Apex`s investment manager in the termination fee it is entitled to receive under the original management agreement.
The actual exchange rate Apex shareholders will receive will be generally determined by multiplying Apex`s net asset value on the day prior to closing by 107.5% and then dividing that result by the number of Apex shares outstanding to determine the value per share Apex shareholders will receive in American Home stock. The actual exchange rate will be determined by dividing the calculated value per share Apex`s shareholders will receive by American Home`s average volume weighted stock price for the ten days prior to the consummation of the merger. The exchange rate is subject to the collar provisions described in the merger agreement.
The merger agreement has been approved by the Board of Directors of American Home, a Special Committee of the Board of Directors of Apex and the Board of Directors of Apex. The acquisition is subject to approval by both companies` shareholders, and other closing conditions. Management and affiliates of Apex and Directors of American Home have agreed to vote their shares in favor of the transaction. Upon consummation of the merger, American Home`s current Directors and Officers will become the Directors and Officers of the newly formed REIT.
Friedman, Billings, Ramsey & Co., Inc., acted as financial advisor, and Cadwalader, Wickersham & Taft LLP served as the legal advisor to American Home. UBS Investment Bank acted as financial advisor and O`Melveny & Meyers LLP served as the legal advisor to Apex.
Revised Guidance for American Home
Assuming consummation of the Apex transaction on or about September 30, 2003, and the current Fannie Mae forecasts for national loan production for the balance of 2003 and for 2004, American Home is raising its earnings guidance for 2003 and 2004. American Home projects its 2003 earnings will be between $3.95 and $4.05 per share. Included in this estimate is a forecast that American Home will originate $22 billion in residential mortgage loans in 2003. In 2004 American Home projects earnings will be between $3.05 and $3.15 per diluted pro forma share based on loan production of $13 billion.
American Home will release second quarter 2003 results on July 24, 2003. Management will host a conference call to comment and offer greater detail on the Company`s second quarter 2003 results and full year 2003 and 2004 outlook on July 24, 2003 at 10:30 am.
Conference Call Today
American Home will hold an investor conference call to discuss this acquisition at 10:30 a.m., Eastern Time, on July 14, 2003. Interested parties may listen to the call by visiting the American Home corporate website www.americanhm.com Shareholder Information section to listen to the conference call webcast live. A replay of the call will be available after 1:00 p.m., Eastern Time, July 14, 2003, through midnight Eastern Time on July 28, 2003. Please contact John Lovallo at Ogilvy Public Relations Worldwide at 212-880-5216 or john.lovallo@ogilvypr.com with any questions.
ABOUT AMERICAN HOME MORTGAGE
American Home Mortgage Holdings, Inc. is an independent retail originator of residential mortgage loans both online and offline and also services loans for itself and other loan investors. Its online operation, MortgageSelect is a leader in online closed loan volume and has outperformed its online competitors in terms of profitability. Offline, the Company has grown organically and by acquisition. American Home now operates 211 community loan offices across the country. For additional information, please visit the Company`s Web site at www.americanhm.com.
ABOUT APEX CAPITAL MORTGAGE
Apex Mortgage Capital, Inc. is a financial company structured as a real estate investment trust. The Company primarily acquires United States agency securities, other mortgage securities, mortgage loans, equity securities and other investments. The Company is listed on the American Stock Exchange under the symbol "AXM."
Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This news release contains statements about future events and expectations, which are "forward-looking statements." Any statement in this release that is not a statement of historical fact, including, but not limited to earnings guidance and forecasts, projections of financial results, and expected future financial position, dividends and dividend plans and business strategy, is a forward-looking statement. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may cause American Home`s or Apex`s actual results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Specific factors that might cause such a difference include, but are not limited to: the potential fluctuations in American Home`s or Apex`s operating results; American Home`s or Apex`s potential need for additional capital, the direction of interest rates and their subsequent effect on American Home`s or Apex`s business, federal and state regulation of mortgage banking; competition; American Home`s ability to attract and retain skilled personnel; and those risks and uncertainties discussed in filings made by American Home and Apex with the Securities and Exchange Commission. In addition, neither American Home nor Apex can predict whether their respective shareholders will approve the merger. Such forward-looking statements are inherently uncertain, and shareholders must recognize that actual results may differ from expectations. Neither American Home nor Apex assume any responsibility to issue updates to the forward-looking statements discussed in this press release.
American Home Mortgage Enters Into Agreement To Acquire Apex Mortgage Capital, Inc.
Monday July 14, 6:30 am ET
American Home to Reorganize as a Real Estate Investment Trust (REIT)
Raises 2003 Earnings Per Share Guidance 27 % to $3.95 - $4.05 and 2004 Earnings Per Share Guidance 31% to $3.05 - $3.15 Assuming Consummation of the Apex Merger*
Projects 2004 Annual Dividend of $2.20 Per Share and Q4 2003 Dividend of $0.55 Per Share*
Adopts Strategy of Holding Its Adjustable Rate Loan Originations as Long-Term Assets*
Subject to Final Transaction Adjustments, Apex Shareholders Calculated to Receive Approximately $6.21 Per Share in American Home Stock, an 11.3% Premium to the Closing Price of Apex on July 11, 2003
*Projections and strategy adoption marked with an asterisk are for American Home and assume consummation of the Apex merger on or about September 30, 2003
MELVILLE, N.Y., and LOS ANGELES, July 14 /PRNewswire-FirstCall/ -- American Home Mortgage, Inc. (Nasdaq: AHMH - News), announced today it has signed a definitive agreement to acquire Apex Mortgage Capital, Inc. (Amex: AXM - News), a financial company structured as a Real Estate Investment Trust (REIT). The purchase price is based upon a floating exchange ratio, which is a function of Apex`s book value and American Home`s stock price at a time near the closing date. Based upon the most recently available information the exchange ratio would result in Apex shareholders receiving shares of American Home valued at approximately $186 million, or $6.21 per outstanding Apex share, representing an implied premium to Apex shareholders of 11.3%. The transaction is subject to approval by American Home and Apex shareholders and to other closing conditions.
In connection with the consummation of the merger, American Home will reorganize and elect to be taxed as a Real Estate Investment Trust with a wholly owned taxable subsidiary that will include its existing mortgage origination and mortgage servicing businesses. The origination and servicing subsidiary is expected to retain a significant portion of its ongoing net earnings, allowing it to continue to expand and diversify its lending franchise, including proceeding with its previously announced acquisition of Valley Bancorp.
American Home projects the transaction will be accretive to 2003 and 2004 earnings per share, as well as to its book value. Pro forma book value, as a result of the merger, and based on June 30 estimates, is projected to increase $186 million or $2.66 per share to $392 million or $14.64 per share, subject to certain transaction adjustments. Based on the closing price of American Home`s shares on July 11, 2003, the combined company would have a market capitalization of approximately $567 million.
In commenting on the merger, Michael Strauss, Chairman and Chief Executive of American Home stated, "In acquiring Apex and reorganizing as a REIT, American Home is diversifying its sources of revenue by adding a complementary line of business to its mortgage origination and mortgage servicing operations, namely holding our adjustable mortgage originations in the form of mortgage backed securities for net interest income." Mr. Strauss continued: "In 2004 we project that combined with Apex, net interest income from mortgage securities holdings, mortgage origination and mortgage servicing will account for 47%, 38% and 15% of our earnings, respectively, and that by holding the adjustable rate loans we originate, our earnings will be less cyclical and less dependent on mortgage refinancing activity. We project that our businesses will be highly complementary, and that our mortgage portfolio business will be able to obtain mortgage loans through our origination operation and convert them into mortgage-backed securities on terms more favorable than it could achieve through market purchases of mortgage-backed securities, thereby materially enhancing our mortgage portfolio`s return on assets."
Commenting on the acquisition, Philip Barach, President of Apex said, "In considering strategic alternatives, it became clear that combining mortgage origination and servicing capabilities with a managed portfolio of mortgage investments in a REIT structure offered the highest potential return for our shareholders. We are pleased our shareholders will realize a meaningful premium to Apex`s book value and become owners of a leading hybrid REIT that is capable of producing significant future value. The inherent synergies and potential advantages are a model for the industry and should work to maximize return on assets and equity."
Asset and Mortgage Origination Strategies
American Home plans to immediately discontinue Apex`s strategy of holding fixed rate loans, which it believes are more exposed to price volatility from changes in interest rates. Initially, the company will acquire various adjustable rate mortgage backed securities in the market, but expects that over time it will primarily hold mortgage-backed securities created from its adjustable rate loan originations. The mortgage-backed securities will typically be financed with liabilities in a strategy aimed at positioning American Home`s overall mortgage holdings and their associated liabilities to avoid or limit a loss of net asset value due to changes in interest rates. Over 95% of the securities held are expected to either be obligations of Fannie Mae, Freddie Mac or Ginnie Mae, or have a Standard & Poors rating of AAA or Moodys rating of Aaa.
American Home projects that by originating its own mortgage securities holdings rather than purchasing mortgage-backed securities in the capital markets, its cost to acquire assets will be materially reduced and, consequently, its return on assets will be enhanced while its exposure to loss from prepayments will be lessened. The company estimates that by following an interest rate neutral strategy, and by concentrating on adjustable rate assets, its return on equity invested in mortgage holdings, without the advantages gained by originating its own holdings would be approximately 14% under current market conditions. The company estimates that this return can be improved to approximately 18% through the advantages gained from originating its own holdings. During an initial transition period of approximately six months, American Home will hold purchased securities until enough self-originated securities are produced to fill its balance sheet. As a result, American Home projects a return on its equity invested in mortgage holdings of 14% in Q4 - 2003, 16% in Q1 - 2004 and 18% thereafter. It is important to note that the actual return from holding mortgage securities is difficult to predict, and that the actual return on equity invested in mortgage holdings may differ widely from American Home`s estimates.
American Home is also pleased to announce that Tom McDonagh has joined the company as Executive Vice President and Chief Investment Officer. Previously Mr. McDonagh managed the mortgage securities holdings of the California Public Employees` Retirement System (CalPERS). Mr. McDonagh will be responsible for managing the company`s mortgage securities holdings and their associated liabilities, including the management of the exposure of the portfolio to, among other things, changes in the general level of interest rates. Mr. McDonagh will be assisted by BlackRock Solutions, which will serve as risk management consultant to the company with respect to its mortgage holdings.
American Home`s taxable subsidiary will continue to originate and resell those types of mortgage loans the company does not intend to hold and will conduct its existing servicing and related businesses. This subsidiary will also pursue the company`s pending acquisition of Valley Bancorp and continue to execute on the company`s other growth strategies, including making accretive acquisitions of mortgage franchises, growing MortgageSelect, and organic retail branch growth.
Michael Strauss added, "Based upon the most recently available information, the merger will add approximately $186 million of new equity to American Home, providing greater financial flexibility and stability under varied market conditions. This merger also allows the company to significantly increase its dividends to shareholders, while retaining sufficient capital to continue to grow our successful lending franchise."
Transaction Details
Under the terms of the agreement, American Home will reorganize through a reverse triangular merger that will cause a newly formed REIT to become American Home`s parent. Shareholders of American Home will receive one share in the new parent for each of their American Home shares.
Based on the most recently available information, shareholders of Apex would receive approximately 0.32 shares in the new parent for each of their Apex shares. Based on American Home`s projection for per share dividends of $2.20 per year, the implied dividend for each Apex share would be approximately $0.70 per year, compared to Apex`s current estimated annual dividend of $0.68 per share per year. The implied dividend per Apex share will fluctuate based on changes in the exchange ratio. The consideration to be paid to Apex`s shareholders will be adjusted for certain transaction expenses, including the payment of the estimated fee to Apex`s investment manager in connection with the termination of the existing management contract. Apex`s investment manager has agreed, upon successful completion of the merger, that it will terminate its management contract for a termination fee equal to 40% of the premium over book value received by Apex. This represents a significant voluntary reduction by Apex`s investment manager in the termination fee it is entitled to receive under the original management agreement.
The actual exchange rate Apex shareholders will receive will be generally determined by multiplying Apex`s net asset value on the day prior to closing by 107.5% and then dividing that result by the number of Apex shares outstanding to determine the value per share Apex shareholders will receive in American Home stock. The actual exchange rate will be determined by dividing the calculated value per share Apex`s shareholders will receive by American Home`s average volume weighted stock price for the ten days prior to the consummation of the merger. The exchange rate is subject to the collar provisions described in the merger agreement.
The merger agreement has been approved by the Board of Directors of American Home, a Special Committee of the Board of Directors of Apex and the Board of Directors of Apex. The acquisition is subject to approval by both companies` shareholders, and other closing conditions. Management and affiliates of Apex and Directors of American Home have agreed to vote their shares in favor of the transaction. Upon consummation of the merger, American Home`s current Directors and Officers will become the Directors and Officers of the newly formed REIT.
Friedman, Billings, Ramsey & Co., Inc., acted as financial advisor, and Cadwalader, Wickersham & Taft LLP served as the legal advisor to American Home. UBS Investment Bank acted as financial advisor and O`Melveny & Meyers LLP served as the legal advisor to Apex.
Revised Guidance for American Home
Assuming consummation of the Apex transaction on or about September 30, 2003, and the current Fannie Mae forecasts for national loan production for the balance of 2003 and for 2004, American Home is raising its earnings guidance for 2003 and 2004. American Home projects its 2003 earnings will be between $3.95 and $4.05 per share. Included in this estimate is a forecast that American Home will originate $22 billion in residential mortgage loans in 2003. In 2004 American Home projects earnings will be between $3.05 and $3.15 per diluted pro forma share based on loan production of $13 billion.
American Home will release second quarter 2003 results on July 24, 2003. Management will host a conference call to comment and offer greater detail on the Company`s second quarter 2003 results and full year 2003 and 2004 outlook on July 24, 2003 at 10:30 am.
Conference Call Today
American Home will hold an investor conference call to discuss this acquisition at 10:30 a.m., Eastern Time, on July 14, 2003. Interested parties may listen to the call by visiting the American Home corporate website www.americanhm.com Shareholder Information section to listen to the conference call webcast live. A replay of the call will be available after 1:00 p.m., Eastern Time, July 14, 2003, through midnight Eastern Time on July 28, 2003. Please contact John Lovallo at Ogilvy Public Relations Worldwide at 212-880-5216 or john.lovallo@ogilvypr.com with any questions.
ABOUT AMERICAN HOME MORTGAGE
American Home Mortgage Holdings, Inc. is an independent retail originator of residential mortgage loans both online and offline and also services loans for itself and other loan investors. Its online operation, MortgageSelect is a leader in online closed loan volume and has outperformed its online competitors in terms of profitability. Offline, the Company has grown organically and by acquisition. American Home now operates 211 community loan offices across the country. For additional information, please visit the Company`s Web site at www.americanhm.com.
ABOUT APEX CAPITAL MORTGAGE
Apex Mortgage Capital, Inc. is a financial company structured as a real estate investment trust. The Company primarily acquires United States agency securities, other mortgage securities, mortgage loans, equity securities and other investments. The Company is listed on the American Stock Exchange under the symbol "AXM."
Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: This news release contains statements about future events and expectations, which are "forward-looking statements." Any statement in this release that is not a statement of historical fact, including, but not limited to earnings guidance and forecasts, projections of financial results, and expected future financial position, dividends and dividend plans and business strategy, is a forward-looking statement. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may cause American Home`s or Apex`s actual results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Specific factors that might cause such a difference include, but are not limited to: the potential fluctuations in American Home`s or Apex`s operating results; American Home`s or Apex`s potential need for additional capital, the direction of interest rates and their subsequent effect on American Home`s or Apex`s business, federal and state regulation of mortgage banking; competition; American Home`s ability to attract and retain skilled personnel; and those risks and uncertainties discussed in filings made by American Home and Apex with the Securities and Exchange Commission. In addition, neither American Home nor Apex can predict whether their respective shareholders will approve the merger. Such forward-looking statements are inherently uncertain, and shareholders must recognize that actual results may differ from expectations. Neither American Home nor Apex assume any responsibility to issue updates to the forward-looking statements discussed in this press release.

Freitag, 1. August 2003
Ein Wettlauf mit der Zeit
von Jochen Steffens
Ich habe für Sie noch ein paar zusätzliche Informationen zum US-BIP von gestern gesammelt. Zu den Rüstungsausgaben, die ich gestern ansprach, hier nun die genaue Zahl: Ohne Rüstungsausgaben stieg das US-BIP lediglich um 0,7 %!
Interessant, wie sich die Argumentationen veränderten. Nachdem der Wert zunächst gefeiert wurde, sickerte schnell durch, dass etwas mit diesem Wert nicht stimmte. Die Rüstungsausgaben. Plötzlich wurde abgewiegelt: "Naja, die Zahlen geben schließlich nur die Vergangenheit wieder. Aber die anderen Konjunkturdaten, die weisen auf eine Verbesserung der Konjunktur hin." Immer wieder lustig solche Aktionen. Allerdings möchte ich nicht behaupten, dass ich von solchen Argumentationskapriolen gänzlich frei bin.
Dass es zu einer (leichten) Verbesserung der Konjunktur kommt, steht auch gar nicht zur Debatte. Es geht immer noch darum, ob diese Erholung ausreicht, um die negativen Effekte – Verschuldung, Arbeitslosigkeit und andere konjunkturelle Probleme – auszugleichen. Sie wissen vielleicht, dass ich nicht besonders viel von der Politik des Alan Greenspan halte. Und im Nachhinein sind die vielen Fehler seiner Politik offensichtlich geworden und stehen kaum noch zur Diskussion. Aber ich verstehe mittlerweile diesen zunächst so befremdlich wirkenden, zwanghaften und fast panischen Aktionismus der FED. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit.
Offenbar setzt die FED darauf, schneller und wesentlich drastischer zu reagieren, als es zum Beispiel die japanische Regierung gemacht hat. Alan Greenspan ist immer noch ein Ökonom alter Schule. Da wird er sich in seinem Alter auch kaum noch ändern können. Das heißt, er geht offenbar davon aus, dass die Mittel der Japaner nicht die falschen Mittel waren, sondern sie einfach zu spät oder/und zu zögerlich angewendet wurden. Die alten Theorien können schließlich nicht falsch sein. (Ich hatte hier bereits mehrfach auf die Unterschiede der aktuellen Entwicklung zu vergleichbaren historischen Entwicklungen (vor Japan) hingewiesen).
Man mag darüber diskutieren, ob diese "alten" Theorien heute noch wirksam sind – ob sie funktionieren. Man mag auch verschiedener Meinung darüber sein, ob die Fed es besser macht als die Japaner. Im Moment wird keiner vorhersagen können, was in den nächsten 12 Monaten wirklich passiert. Werden die Maßnahmen der FED rechtzeitig greifen und eine wirklich nachhaltige konjunkturelle Erholung bewirken? Eine Erholung, die in der Lage ist, die negativen Effekte von Staatsverschuldung, Verschuldung der privaten Haushalte, Insolvenzen, Hypothekenblase, Pensionsfonds, hohe Arbeitslosigkeit, Anleihenmarkt, Vertrauensverlust des Dollars, Überbewertung der Aktien, US-Staatshaushalt, Außenhandelsdefizit, chinesische Konkurrenz, auszugleichen. Oder werden diese Aspekte zusammen eine konjunkturelle Erholung im Keim ersticken?
Das Verbauervertrauen war ein deutlicher Warnschuss. Es zeigte auch, dass sehr schnell etwas passieren muss. Im Moment scheint sich die Arbeitsmarktsituation leicht zu entspannen, aber ist das nur saisonal bedingt? Wird es ausreichen, um die Amerikaner wieder zum Kaufen zu animieren? Wie lange kann die Regierung noch die Verschuldungspolitik derart exzessiv weiter treiben? Fragen über Fragen.
Die Fed hatte nie eine andere Wahl, als derart schnell, fast überstürzt und drastisch zu reagieren. Sie konnte die US-Wirtschaft angesichts Terrordrohung, Überwachungsstaat und Kriegsgedanken der Regierung, nicht in eine Rezession laufen lassen. Die Gefahr eines Kollaps war und ist zu groß.
Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Rennen ausgeht. Sollte der FED dieser Coup gelingen, dann ziehe ich respektvoll meinen Hut! Wie Sie sich sicherlich denken können, glaube ich nicht, dass es funktionieren wird. Zu groß scheinen mir die belastenden Faktoren. Allein der aktuelle Crash am US-Anleihenmarkt ist eine deutliche Warnung! Er zeigt, wie übertrieben und hektisch noch alles ist. Typische Reaktionen eines Bärenmarkt. Das macht keinen stabilen und nachhaltigen Eindruck. Kann dieses hektische rumdoktern Grundlage einer vernünftigen Entwicklung sein?
Der amerikanische Markt weiß seit einem Monat nicht wohin. Er wartet auf Anzeichen, dass seine Hoffnung auf eine deutliche konjunkturelle Erholung bestätigt werden. Er ist sozusagen vorgelaufen, hält nun an, um sich umzusehen, ob denn die Konjunktur noch mitkommt. Diese schleppt sich ächzend hinterher und hat nicht mehr viel Zeit der vorgelaufenen Aktienbörse hinterherzukommen. Denn bald könnte sich die Börse umdrehen und zu Konjunktur zurücklaufen. Ein Wettlauf mit der Zeit ...
Quelle: investorverlag.de


!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
The Bear That Wouldn’t Go Away
A Review of Financial Markets in 2002
Dr. Bryan Taylor, President
Global Financial Data
After a third consecutive year of declining stock markets, there is one question on everyone’s mind, when will this bear market end?
This is the first time the US stock market has declined for three years in a row since 1939-1941. As measured by the Dow Jones Industrial Average, this bear market has lasted longer than the 1929-1932 bear market. At its low, the S&P 500 was down 49% from its high in 2000, and NASDAQ 78%. The only worse percentage decline in US history was the 1929-1932 bear market.
Every major stock market in the developed world also suffered a third declining year, and endured even greater percentage declines than in the United States. At their low points in 2002, Japan was down 72% from its high, Germany 68%, and France 59%. The only developed stock markets that haven’t dropped significantly during the past three years are the commodity-based Australian and New Zealand markets. Pakistan was the best performing stock market in 2002, and Eastern Europe was the best performing region as their chances for joining the EU improved.
The continuation of the bear market that started in 2000 occurred because none of the underlying causes of the current bear market changed in 2002. Any long-term bear market results from a confluence of events. 1929-1932 had the stock market crash, reduced international trade, a collapse in the banking system and global economic problems. 1937-1942 was a period of economic decline within the Great Depression accompanied by the onset of World War II. 1973-1974 was a period of rising inflation, the OPEC Oil Crisis, Watergate, and other problems.
There are four factors that have driven global stock markets down during the past three years:
1. The bursting of the Technology Bubble and the continued overvaluation of the stock market in general.
2. The recession of 2001 and the slow recovery that has occurred since then in the US and in the rest of the world.
3. A loss of confidence by investors in Wall Street, both in analysts and in CEOs, in Wall Street and in corporations themselves. Bernie Ebbers, Jack Welch, Jack Grubman and the corporate heroes of the 1990s have become the villains of the 2000s.
4. Geopolitical concerns and the threat of domestic terrorism and war have created a high degree of uncertainty. Al-Qaeda, Iraq, the Israeli-Palestinian conflict, North Korea, Iran and other potential problems remain unresolved and could remain that way for years.
For these reasons, investors have seen the glass as half empty, rather than half full. They have been reluctant to go back into the stock market with the abandon that occurred in the 1990s, and this has contributed to the poor performance of the stock market during the past year.
What were the primary events of 2002?
1. The Largest Bankruptcies in Corporate History
On December 2, 2001, Enron filed for what was then the largest bankruptcy in US history at $63 billion. This was followed by bankruptcy filings from Global Crossing ($25 billion) and Kmart ($17 billion) in January 2002, by NTL, Inc ($17 billion) in May, by Adelphia Communications in June ($24 billion), and by Worldcom ($104 billion) in July, the largest bankruptcy in history. The year ended with more bankruptcies from United Airlines ($25 billion) and Conseco ($61 billion) in December. Seven of the twelve largest bankruptcies in US history are currently winding their ways through the courts. And, of course, we need not mention all of the dot.com companies that are now dot.gone.
Why were there so many bankruptcies? During the 1990s, corporations issued both large amounts of stock and large amounts of debt. As long as the stock market was rising, corporate America could carry their debt burden, but the decline in stock prices has made this burden more onerous. This, combined with the slowdown in the economy, has forced many companies into bankruptcy. In some cases, such as Enron, companies simply lied about their earnings, and when the economy slowed, they went bust. Investors should expect more bankruptcies in 2003.
Although there are thousands of publicly traded companies in the United States, you can count the number of AAA-rated companies on the fingers of your hands! One example of the problems corporate debt has caused is Barron’s Confidence Index, which compares the yields on high grade and average bonds. This index is currently at its worst levels since the 1940s, showing the perilous state that many corporations are in. Since shareholders are residual owners of the firm, the low ratings and high yields on corporate debt are symptomatic of the problems investors face.
2. The Passage of the Sarbanes-Oxley Act
Revelations of the deliberate misreporting of profits by corporations, over $9 billion from Enron alone, the discovery that analysts provided positive recommendations for companies they privately derided in order to increase their company’s profits from investment banking, the news that Wall Street firms gave away IPO shares to corporate executives, and dozens of other immoral and illegal practices destroyed what little faith in corporate America the investment public had. Greed has become a byword for Wall Street and this time the public agrees that greed is not good. Two of the whistle-blowers at Enron and Worldcom, Cynthia Cooper and Sherron Watkins, were among Time Magazine’s people of the year, not corporate CEOs.
Every bull market is followed by its day of reckoning when those who lied during the bull market must pay the price for their deceit. The South Sea Bubble of the 1720s and the Bear Market of 1929-1932 had their own government investigations, lawsuits and criminal prosecutions. Eliot Spitzer symbolizes the current attempt to bring both individuals and firms to account for their actions. Wall Street will have to pay over $1.4 billion in fines for the misleading information they conveyed to investors.
The Sarbanes-Oxley Act, passed on July 30, 2002 was a response to the deteriorating confidence in corporate America. It requires the CEOs of publicly traded corporations to verify the accuracy of the financial statements they provide to the public. The passage of this act, combined with the Worldcom bankruptcy temporarily reversed the decline in the stock market, as investors hoped that the worst was over with. However, the market registered a further bottom on October 9.
Some people saw the July and October lows as a potential double bottom, but this interpretation looks unlikely. Despite the passage of the Sarbanes-Oxley Act, there is still a large degree of distrust of Wall Street that will only go away with the passage of time.
3. Resignations and Interest Rate Cuts in Response to a Weak Economy
The global economy remained weak throughout 2002, forcing the government to take action to try and restore confidence in the economy and in global markets. Both the Federal Reserve (November 6) and the European Central Bank (December 5) cut interest rates by 50 basis points. Harvey Pitt (November 5), Paul O’Neill and Lawrence Lindsay (December 6) resigned from the Bush Administration’s economic team. These were all signs that despite the government’s efforts to the contrary, the global economy continues to weaken.
The current situation in financial markets remains problematic for investors. Because interest rates declined in 2002, lenders are currently receiving their lowest yields in 40 years. Corporate bonds remain risky, and if interest rates were to rise in 2003, bonds would decline in value causing losses to fixed-income investors.
Commodity prices rose in 2002. Gold rose from around $275 to $325, and oil rose from around $20 to over $30. It could very well be that investors will be more worried about inflation than deflation in 2003, especially if the economy starts to recover.
Moreover, the past year has seen the return of the “Twin Deficits” as both the trade deficit and the government budget deficit turned red. The combination of the declining Dollar and weak economies in Europe and in Japan means that the trade deficit is likely to get worse before it gets better. The possibility of war in Iraq and possible tax cuts means that the Federal government budget deficit could get worse even as state budget deficits hit record levels.
What are the Prospects for 2003?
This brings us to where we are today. The question on everyone’s mind is whether the economy and the stock market will turn around in 2003. It is impossible to predict what is going to happen in 2003 because we don’t know what events will occur. No one foresaw the terrorist attacks in 2001 or the corporate scandals of 2002 and who knows what unknown events await us in 2003. Such predictions are especially perilous because psychology drives the market as much as the facts, and in order to predict when the market will turn around requires us to determine when investors will begin looking at the glass as half full rather than half empty.
All we can do is to weigh the evidence that we currently have and project that into an uncertain future. There are two ways of doing this.
The first is to review the four factors that have driven the stock market down during the past three years. For this bear market to end, two or more of these factors have to change. The prices of stocks must fall or earnings must rise to eliminate the overvaluation of the stock market; the economy has to recover and begin to grow again; investors must regain their confidence in corporate America and in the stock market; and the geopolitical concerns caused by terrorism and by weapons of mass destruction must be dealt with. Unfortunately, at present, all of these factors remain a concern for investors.
The second approach is to weigh the positives and the negatives for the market in the balance.
On the positive side, the economy is beginning to recover from the recession last year. Interest rates remain low, the yield curve is positive, and a weaker dollar should make US goods more attractive to foreigners. The stock market has declined for three years in a row putting the market at more attractive valuations. The US stock market has not moved down in a pre-Presidential year since 1939 because the government often takes steps to spur economic growth prior to a Presidential election. As former President Clinton said, “It’s the economy, stupid.”
Unfortunately, there remain many negatives to consider. The market remains overvalued with the P/E ratio on the Dow Jones Industrials around 22, and the P/E ratio on the S&P around 30. Fair value on the S&P 500 is probably around 800, which is below current levels. The market has failed to break the downtrend started in 2000, continuing to get a lower low when it declines, and lower high when it rises. In 2002, as in 2001, every major industry group has declined with only Basic Materials and Consumer Staples showing some relative strength.
The rest of the global economy remains even weaker than the US. No major stock market has shown any signs of breaking out of the current bear market. Before a bear market ends, there are usually sectors and parts of the global stock market that begin to show strength, but none of that is in evidence. Global markets have remained weaker than the US market since the temporary bottoms in July and October, and the Japanese stock market hit new 18-year lows in December.
Some analysts have said that the bottoms in July and October have formed a “double bottom” that signal the end of the current bear market and the initiation of a new bull market. Unfortunately, the evidence on this is not clear cut.
The end of previous bear markets as in 1974, 1982, 1987 and 1990 displayed double bottoms with important characteristics that marked the end of those bear markets. First, volume declined as the market ran out of sellers at the bottom. Second, volume increased significantly once the new bull market began. Third, the move out of the bottom was sharp, with the stock market index rising dramatically, breaking the downtrend in the market, and registering several successive months of a rising stock market. The market rallied for 12 months in a row in 1935, 6 months in a row in 1942, 11 months in a row in 1949, 9 of 10 months in 1970, 6 months in a row in 1975, 9 months in a row in 1982, and 7 months in a row in 1991. Fourth, after the bull market began the time the market spent rising was greater than the time spent declining or moving sideways. Fifth, the market became significantly undervalued at the market bottom, attracting new investors.
Unfortunately, none of these signs of a market bottom has occurred here. Despite dramatic four-day rises off of the bottoms in both July and in October, the market stagnated afterwards. The current bear market has seen heavy volume during declines, and light volume after the market rallies, just the opposite of the pattern in a bull market. The market has yet to run out of sellers, and the buying power needed to pull the market further up hasn’t appeared yet. Finally, the market hasn’t broken its downtrend, and the market remains overvalued.
In short, investors have not shown sufficient faith in the market to justify calling an end to the current bear market. If we are at the beginning of a new bull market, the Dow Jones Industrials Average should rally to 10,000 by the end of January, but this looks unlikely.
Another possibility is what happened to the stock market in 1934-1935 and in 1947-1949. The market stopped going down, but it did not have sufficient strength to initiate a new bull market. Instead the market bounced along the bottom for two years until investors regained their faith in the stock market.
Unfortunately, the same looks true today. None of the four factors that have driven this current bear market has been resolved, and until they are, it seems unlikely that investors will begin investing in the market in sufficient numbers to initiate a new bull market. We could move to new lows in 2003 and even have a fourth year of declines in the stock market unless the four factors discussed at the beginning of this review are resolved.
Once a new bull market begins, however, the most likely scenario is a more modest bull market than the raging bull we had in the 1990s. The S&P 500 and Dow Jones Industrials Average will probably rally back to its old highs in the next bull market, but will probably not go much past the highs of 2000.
During 2002, money flowed out of equities and into bonds, as investors preferred the safety of bonds to the disappointment of declining equities. As always, the herd mentality in the stock market creates self-fulfilling predictions in the short-run. Just as the rush into equities in the late 1990s drove the stock market up to unprecedented heights, the loss of faith in equities has contributed to the decline in the stock market. It will take time for investors to regain their faith in Wall Street and to realize that equities will outperform bonds and cash over the next ten years.
Long-term investors who have at least a 10-year time horizon will still do better investing in equities than in bonds and cash. With the decline in the stock market during the past three years, and the rise in bond prices, the equity premium of stocks over bonds during the past ten years has shrunk to around 1%. In cases in the past when the equity premium shrank to this level, as in 1982 and 1990, equities outperformed bonds and cash during the next ten years. Long-term investors should keep this fact in mind.
A Review of Financial Markets in 2002
Dr. Bryan Taylor, President
Global Financial Data
After a third consecutive year of declining stock markets, there is one question on everyone’s mind, when will this bear market end?
This is the first time the US stock market has declined for three years in a row since 1939-1941. As measured by the Dow Jones Industrial Average, this bear market has lasted longer than the 1929-1932 bear market. At its low, the S&P 500 was down 49% from its high in 2000, and NASDAQ 78%. The only worse percentage decline in US history was the 1929-1932 bear market.
Every major stock market in the developed world also suffered a third declining year, and endured even greater percentage declines than in the United States. At their low points in 2002, Japan was down 72% from its high, Germany 68%, and France 59%. The only developed stock markets that haven’t dropped significantly during the past three years are the commodity-based Australian and New Zealand markets. Pakistan was the best performing stock market in 2002, and Eastern Europe was the best performing region as their chances for joining the EU improved.
The continuation of the bear market that started in 2000 occurred because none of the underlying causes of the current bear market changed in 2002. Any long-term bear market results from a confluence of events. 1929-1932 had the stock market crash, reduced international trade, a collapse in the banking system and global economic problems. 1937-1942 was a period of economic decline within the Great Depression accompanied by the onset of World War II. 1973-1974 was a period of rising inflation, the OPEC Oil Crisis, Watergate, and other problems.
There are four factors that have driven global stock markets down during the past three years:
1. The bursting of the Technology Bubble and the continued overvaluation of the stock market in general.
2. The recession of 2001 and the slow recovery that has occurred since then in the US and in the rest of the world.
3. A loss of confidence by investors in Wall Street, both in analysts and in CEOs, in Wall Street and in corporations themselves. Bernie Ebbers, Jack Welch, Jack Grubman and the corporate heroes of the 1990s have become the villains of the 2000s.
4. Geopolitical concerns and the threat of domestic terrorism and war have created a high degree of uncertainty. Al-Qaeda, Iraq, the Israeli-Palestinian conflict, North Korea, Iran and other potential problems remain unresolved and could remain that way for years.
For these reasons, investors have seen the glass as half empty, rather than half full. They have been reluctant to go back into the stock market with the abandon that occurred in the 1990s, and this has contributed to the poor performance of the stock market during the past year.
What were the primary events of 2002?
1. The Largest Bankruptcies in Corporate History
On December 2, 2001, Enron filed for what was then the largest bankruptcy in US history at $63 billion. This was followed by bankruptcy filings from Global Crossing ($25 billion) and Kmart ($17 billion) in January 2002, by NTL, Inc ($17 billion) in May, by Adelphia Communications in June ($24 billion), and by Worldcom ($104 billion) in July, the largest bankruptcy in history. The year ended with more bankruptcies from United Airlines ($25 billion) and Conseco ($61 billion) in December. Seven of the twelve largest bankruptcies in US history are currently winding their ways through the courts. And, of course, we need not mention all of the dot.com companies that are now dot.gone.
Why were there so many bankruptcies? During the 1990s, corporations issued both large amounts of stock and large amounts of debt. As long as the stock market was rising, corporate America could carry their debt burden, but the decline in stock prices has made this burden more onerous. This, combined with the slowdown in the economy, has forced many companies into bankruptcy. In some cases, such as Enron, companies simply lied about their earnings, and when the economy slowed, they went bust. Investors should expect more bankruptcies in 2003.
Although there are thousands of publicly traded companies in the United States, you can count the number of AAA-rated companies on the fingers of your hands! One example of the problems corporate debt has caused is Barron’s Confidence Index, which compares the yields on high grade and average bonds. This index is currently at its worst levels since the 1940s, showing the perilous state that many corporations are in. Since shareholders are residual owners of the firm, the low ratings and high yields on corporate debt are symptomatic of the problems investors face.
2. The Passage of the Sarbanes-Oxley Act
Revelations of the deliberate misreporting of profits by corporations, over $9 billion from Enron alone, the discovery that analysts provided positive recommendations for companies they privately derided in order to increase their company’s profits from investment banking, the news that Wall Street firms gave away IPO shares to corporate executives, and dozens of other immoral and illegal practices destroyed what little faith in corporate America the investment public had. Greed has become a byword for Wall Street and this time the public agrees that greed is not good. Two of the whistle-blowers at Enron and Worldcom, Cynthia Cooper and Sherron Watkins, were among Time Magazine’s people of the year, not corporate CEOs.
Every bull market is followed by its day of reckoning when those who lied during the bull market must pay the price for their deceit. The South Sea Bubble of the 1720s and the Bear Market of 1929-1932 had their own government investigations, lawsuits and criminal prosecutions. Eliot Spitzer symbolizes the current attempt to bring both individuals and firms to account for their actions. Wall Street will have to pay over $1.4 billion in fines for the misleading information they conveyed to investors.
The Sarbanes-Oxley Act, passed on July 30, 2002 was a response to the deteriorating confidence in corporate America. It requires the CEOs of publicly traded corporations to verify the accuracy of the financial statements they provide to the public. The passage of this act, combined with the Worldcom bankruptcy temporarily reversed the decline in the stock market, as investors hoped that the worst was over with. However, the market registered a further bottom on October 9.
Some people saw the July and October lows as a potential double bottom, but this interpretation looks unlikely. Despite the passage of the Sarbanes-Oxley Act, there is still a large degree of distrust of Wall Street that will only go away with the passage of time.
3. Resignations and Interest Rate Cuts in Response to a Weak Economy
The global economy remained weak throughout 2002, forcing the government to take action to try and restore confidence in the economy and in global markets. Both the Federal Reserve (November 6) and the European Central Bank (December 5) cut interest rates by 50 basis points. Harvey Pitt (November 5), Paul O’Neill and Lawrence Lindsay (December 6) resigned from the Bush Administration’s economic team. These were all signs that despite the government’s efforts to the contrary, the global economy continues to weaken.
The current situation in financial markets remains problematic for investors. Because interest rates declined in 2002, lenders are currently receiving their lowest yields in 40 years. Corporate bonds remain risky, and if interest rates were to rise in 2003, bonds would decline in value causing losses to fixed-income investors.
Commodity prices rose in 2002. Gold rose from around $275 to $325, and oil rose from around $20 to over $30. It could very well be that investors will be more worried about inflation than deflation in 2003, especially if the economy starts to recover.
Moreover, the past year has seen the return of the “Twin Deficits” as both the trade deficit and the government budget deficit turned red. The combination of the declining Dollar and weak economies in Europe and in Japan means that the trade deficit is likely to get worse before it gets better. The possibility of war in Iraq and possible tax cuts means that the Federal government budget deficit could get worse even as state budget deficits hit record levels.
What are the Prospects for 2003?
This brings us to where we are today. The question on everyone’s mind is whether the economy and the stock market will turn around in 2003. It is impossible to predict what is going to happen in 2003 because we don’t know what events will occur. No one foresaw the terrorist attacks in 2001 or the corporate scandals of 2002 and who knows what unknown events await us in 2003. Such predictions are especially perilous because psychology drives the market as much as the facts, and in order to predict when the market will turn around requires us to determine when investors will begin looking at the glass as half full rather than half empty.
All we can do is to weigh the evidence that we currently have and project that into an uncertain future. There are two ways of doing this.
The first is to review the four factors that have driven the stock market down during the past three years. For this bear market to end, two or more of these factors have to change. The prices of stocks must fall or earnings must rise to eliminate the overvaluation of the stock market; the economy has to recover and begin to grow again; investors must regain their confidence in corporate America and in the stock market; and the geopolitical concerns caused by terrorism and by weapons of mass destruction must be dealt with. Unfortunately, at present, all of these factors remain a concern for investors.
The second approach is to weigh the positives and the negatives for the market in the balance.
On the positive side, the economy is beginning to recover from the recession last year. Interest rates remain low, the yield curve is positive, and a weaker dollar should make US goods more attractive to foreigners. The stock market has declined for three years in a row putting the market at more attractive valuations. The US stock market has not moved down in a pre-Presidential year since 1939 because the government often takes steps to spur economic growth prior to a Presidential election. As former President Clinton said, “It’s the economy, stupid.”
Unfortunately, there remain many negatives to consider. The market remains overvalued with the P/E ratio on the Dow Jones Industrials around 22, and the P/E ratio on the S&P around 30. Fair value on the S&P 500 is probably around 800, which is below current levels. The market has failed to break the downtrend started in 2000, continuing to get a lower low when it declines, and lower high when it rises. In 2002, as in 2001, every major industry group has declined with only Basic Materials and Consumer Staples showing some relative strength.
The rest of the global economy remains even weaker than the US. No major stock market has shown any signs of breaking out of the current bear market. Before a bear market ends, there are usually sectors and parts of the global stock market that begin to show strength, but none of that is in evidence. Global markets have remained weaker than the US market since the temporary bottoms in July and October, and the Japanese stock market hit new 18-year lows in December.
Some analysts have said that the bottoms in July and October have formed a “double bottom” that signal the end of the current bear market and the initiation of a new bull market. Unfortunately, the evidence on this is not clear cut.
The end of previous bear markets as in 1974, 1982, 1987 and 1990 displayed double bottoms with important characteristics that marked the end of those bear markets. First, volume declined as the market ran out of sellers at the bottom. Second, volume increased significantly once the new bull market began. Third, the move out of the bottom was sharp, with the stock market index rising dramatically, breaking the downtrend in the market, and registering several successive months of a rising stock market. The market rallied for 12 months in a row in 1935, 6 months in a row in 1942, 11 months in a row in 1949, 9 of 10 months in 1970, 6 months in a row in 1975, 9 months in a row in 1982, and 7 months in a row in 1991. Fourth, after the bull market began the time the market spent rising was greater than the time spent declining or moving sideways. Fifth, the market became significantly undervalued at the market bottom, attracting new investors.
Unfortunately, none of these signs of a market bottom has occurred here. Despite dramatic four-day rises off of the bottoms in both July and in October, the market stagnated afterwards. The current bear market has seen heavy volume during declines, and light volume after the market rallies, just the opposite of the pattern in a bull market. The market has yet to run out of sellers, and the buying power needed to pull the market further up hasn’t appeared yet. Finally, the market hasn’t broken its downtrend, and the market remains overvalued.
In short, investors have not shown sufficient faith in the market to justify calling an end to the current bear market. If we are at the beginning of a new bull market, the Dow Jones Industrials Average should rally to 10,000 by the end of January, but this looks unlikely.
Another possibility is what happened to the stock market in 1934-1935 and in 1947-1949. The market stopped going down, but it did not have sufficient strength to initiate a new bull market. Instead the market bounced along the bottom for two years until investors regained their faith in the stock market.
Unfortunately, the same looks true today. None of the four factors that have driven this current bear market has been resolved, and until they are, it seems unlikely that investors will begin investing in the market in sufficient numbers to initiate a new bull market. We could move to new lows in 2003 and even have a fourth year of declines in the stock market unless the four factors discussed at the beginning of this review are resolved.
Once a new bull market begins, however, the most likely scenario is a more modest bull market than the raging bull we had in the 1990s. The S&P 500 and Dow Jones Industrials Average will probably rally back to its old highs in the next bull market, but will probably not go much past the highs of 2000.
During 2002, money flowed out of equities and into bonds, as investors preferred the safety of bonds to the disappointment of declining equities. As always, the herd mentality in the stock market creates self-fulfilling predictions in the short-run. Just as the rush into equities in the late 1990s drove the stock market up to unprecedented heights, the loss of faith in equities has contributed to the decline in the stock market. It will take time for investors to regain their faith in Wall Street and to realize that equities will outperform bonds and cash over the next ten years.
Long-term investors who have at least a 10-year time horizon will still do better investing in equities than in bonds and cash. With the decline in the stock market during the past three years, and the rise in bond prices, the equity premium of stocks over bonds during the past ten years has shrunk to around 1%. In cases in the past when the equity premium shrank to this level, as in 1982 and 1990, equities outperformed bonds and cash during the next ten years. Long-term investors should keep this fact in mind.
Skinning the Bear:
Historical views of the market need adjustment for reality
By Bryan Taylor
08/12/2002
Barron`s
Page 44
(Copyright (c) 2002, Dow Jones & Company, Inc.)
The plunge in stock markets in July pushed the United States stock market into its worst showing in years. But is this bear market worse than other famous ones? It depends on how you look at them. Most historic analyses of bull and bear markets look at the changes in the prices of a stock index such as the Dow Jones Industrial Average or the Standard & Poor`s Index of 500 stocks, but they leave out three important factors that make quite a difference: dividends, inflation and taxes.
The S&P 500 is the broadest market index with the longest stock-market history. We`ll look at it first, defining a bull market as an increase of 40% from the lowest close to the highest close on the index, and a bear market as a decline of 15% from highest close to lowest close on the index.
Here`s the first important adjustment: Instead of using the S&P Composite Price Index, we should use the Total Return Index. Since most individual investors have their money in mutual funds that reinvest their dividends, using a price index to determine the movement of markets does not reflect the results that investors receive.
Dividend yields are currently at historically low levels, so using a total return analysis increases the overall return to investors in the past more than in the present. The 1920s bull market topped out on Sept. 7, 1929. If some late-arriving bull had invested money in the stock market on that day, how long would he have had to wait to get his money back? Using the price index, the answer would be September 1954, but on a total-return basis, this unluckiest of investors would have broken even in April 1945 -- nine years earlier. Similarly, the S&P Price Index in April 1942 was still below its level in June 1901, but on a total-return basis someone who had invested in the market in June 1901 would have gotten a seven-fold return between 1901 and 1942 because of the role of reinvested dividends.
Accounting for dividends reduces the size of the declines during bear markets and increases the returns to investors during bull markets. On a total-return basis, the bull market of the 1920s registered a 657% increase as opposed to a 409% increase on a price basis. Total returns also change the timing of the bull market tops and the bear market bottoms. The reason for this is in both periods, investors receive dividends that increase their returns. Using the current bear market as an example, the S&P Composite Price Index had its highest close on March 24, 2000, at 1527.46, but the S&P 500 Total Return Index had its highest close on Sept. 1, 2000, at 2108.76, a difference of five months.
The overall impact of dividends is to shorten the length of bear markets and increase the length and size of bull markets. This difference can be seen in the bear market that followed World War II. The bear market began on May 29, 1946, hit a bottom in May 1947, then bounced up and down for two years, hitting a slightly lower low on May 13, 1949, before beginning a dramatic seven-year bull market. However, on a total-return basis, the market bottomed out on May 17, 1947, two years before the price index.
Investors also have to consider inflation. Between 1966 and 1982, when the Dow Jones Industrial Average struggled to move above 1000, consumer prices tripled. Adjusted for inflation, the DJIA declined by two thirds. Including inflation improves the returns from the 1930s when prices were falling, reduces the returns after World War II when inflation picked up, and has the strongest impact on returns from the 1970s when inflation was at its worst. We can adjust for inflation by dividing the index values by the Consumer Price Index.
Since prices fell during the 1930s, the real Total Return Index had returned to the levels of September 1929 by the market top in March 1937. Although the deflation of the 1930s reduces the decline in the 1929-32 bear market to 79.3%, we also find that as late as 1947, investors were still below the peaks of 1929 on a real total-return basis.
On a price basis, the 1973-1974 decline (-48%) was worse than the bear market of 2000-2002 (-47.8%), using July 23, 2002, as the current bottom, but not as bad as the 1937-38 bear (-54.5%). If you include dividends and calculate total returns, the 2000-2002 bear market (-46.6%) already is worse than the 1973-1974 bear (-45.1%), but not as bad as the 1937-38 bear (-51.2%). But if you adjust for inflation, the 1973-1974 bear market (-54.2%) not only becomes worse than the 2000-2002 bear (-48.1%), but worse than the 1937-38 bear (-51.2%), as well. Depending upon your definition, you can choose any one of the three as the worst bear market.
No analysis of investor returns would be complete without including taxes. The problem is that taxes vary by income bracket and by residence since some states have income taxes and some do not. Let`s base our numbers on an individual who is making $200,000 in 2002. If he had earned an equivalent amount of money in the past, by how much would have federal taxes reduced his returns?
Until 1939, taxes were relatively low. Someone making $20,000 a year in the 1930s, equivalent to $200,000 today, would have seen a marginal tax rate between a low of 5% in 1929-1932 and 19% in 1937-1938. Capital gains were taxed at the same rate as income taxes, but the maximum rate was 12.5%. Taxes were raised dramatically during and after World War II, with a top marginal tax rate of 93% at one point in the 1950s. Our investor would have faced a marginal tax rate of anywhere between 47% and 57% with 50% the average. Beginning in 1938, long-term capital gains received a 50% exclusion, and from 1942 until 1967, the capital gains tax was capped at 25%.
It is little wonder that after World War II, capital gains became an increasingly important part of investor returns. Since 1950, on average, about one-third of investor returns have come from dividends, and two-thirds have come from capital gains, so most investors would have paid about 30%-33% of their stock- market returns in taxes between 1942 and 1986.
In 1986, the tax system was reformed and rates were lowered. The top tax rate was set at 28% on both capital gains and dividend income. In 1993, the rate on someone earning $200,000 was raised to 36%, and the long-term capital-gains rate was later lowered to 20%. The net effect since 1987 has been to make investors pay about 28% of their stock-market returns in taxes. Investors facing state income taxes have to pay even more.
Adjusted for dividends, inflation and taxes, the bull market of the 1920s looks even stronger than it ever did before. Not only were dividends higher and inflation lower than after World War II, but lower taxes also increased net returns considerably. Investors of the 1920s got to keep almost 90% of their gains after taxes. Since World War II, lower dividends, higher inflation and higher taxes have all reduced the net after-tax real total return to investors.
In the current bear market environment, perspective is more important than ever. The history of bull and bear markets reminds us that bear markets do end, that bull markets are stronger and last longer than bear markets, and that in the long run, the overall rise in stocks far offsets the declines.
---
BRYAN TAYLOR is president of Global Financial Data. He is an economist who does research on long-term behavior of markets.
Historical views of the market need adjustment for reality
By Bryan Taylor
08/12/2002
Barron`s
Page 44
(Copyright (c) 2002, Dow Jones & Company, Inc.)
The plunge in stock markets in July pushed the United States stock market into its worst showing in years. But is this bear market worse than other famous ones? It depends on how you look at them. Most historic analyses of bull and bear markets look at the changes in the prices of a stock index such as the Dow Jones Industrial Average or the Standard & Poor`s Index of 500 stocks, but they leave out three important factors that make quite a difference: dividends, inflation and taxes.
The S&P 500 is the broadest market index with the longest stock-market history. We`ll look at it first, defining a bull market as an increase of 40% from the lowest close to the highest close on the index, and a bear market as a decline of 15% from highest close to lowest close on the index.
Here`s the first important adjustment: Instead of using the S&P Composite Price Index, we should use the Total Return Index. Since most individual investors have their money in mutual funds that reinvest their dividends, using a price index to determine the movement of markets does not reflect the results that investors receive.
Dividend yields are currently at historically low levels, so using a total return analysis increases the overall return to investors in the past more than in the present. The 1920s bull market topped out on Sept. 7, 1929. If some late-arriving bull had invested money in the stock market on that day, how long would he have had to wait to get his money back? Using the price index, the answer would be September 1954, but on a total-return basis, this unluckiest of investors would have broken even in April 1945 -- nine years earlier. Similarly, the S&P Price Index in April 1942 was still below its level in June 1901, but on a total-return basis someone who had invested in the market in June 1901 would have gotten a seven-fold return between 1901 and 1942 because of the role of reinvested dividends.
Accounting for dividends reduces the size of the declines during bear markets and increases the returns to investors during bull markets. On a total-return basis, the bull market of the 1920s registered a 657% increase as opposed to a 409% increase on a price basis. Total returns also change the timing of the bull market tops and the bear market bottoms. The reason for this is in both periods, investors receive dividends that increase their returns. Using the current bear market as an example, the S&P Composite Price Index had its highest close on March 24, 2000, at 1527.46, but the S&P 500 Total Return Index had its highest close on Sept. 1, 2000, at 2108.76, a difference of five months.
The overall impact of dividends is to shorten the length of bear markets and increase the length and size of bull markets. This difference can be seen in the bear market that followed World War II. The bear market began on May 29, 1946, hit a bottom in May 1947, then bounced up and down for two years, hitting a slightly lower low on May 13, 1949, before beginning a dramatic seven-year bull market. However, on a total-return basis, the market bottomed out on May 17, 1947, two years before the price index.
Investors also have to consider inflation. Between 1966 and 1982, when the Dow Jones Industrial Average struggled to move above 1000, consumer prices tripled. Adjusted for inflation, the DJIA declined by two thirds. Including inflation improves the returns from the 1930s when prices were falling, reduces the returns after World War II when inflation picked up, and has the strongest impact on returns from the 1970s when inflation was at its worst. We can adjust for inflation by dividing the index values by the Consumer Price Index.
Since prices fell during the 1930s, the real Total Return Index had returned to the levels of September 1929 by the market top in March 1937. Although the deflation of the 1930s reduces the decline in the 1929-32 bear market to 79.3%, we also find that as late as 1947, investors were still below the peaks of 1929 on a real total-return basis.
On a price basis, the 1973-1974 decline (-48%) was worse than the bear market of 2000-2002 (-47.8%), using July 23, 2002, as the current bottom, but not as bad as the 1937-38 bear (-54.5%). If you include dividends and calculate total returns, the 2000-2002 bear market (-46.6%) already is worse than the 1973-1974 bear (-45.1%), but not as bad as the 1937-38 bear (-51.2%). But if you adjust for inflation, the 1973-1974 bear market (-54.2%) not only becomes worse than the 2000-2002 bear (-48.1%), but worse than the 1937-38 bear (-51.2%), as well. Depending upon your definition, you can choose any one of the three as the worst bear market.
No analysis of investor returns would be complete without including taxes. The problem is that taxes vary by income bracket and by residence since some states have income taxes and some do not. Let`s base our numbers on an individual who is making $200,000 in 2002. If he had earned an equivalent amount of money in the past, by how much would have federal taxes reduced his returns?
Until 1939, taxes were relatively low. Someone making $20,000 a year in the 1930s, equivalent to $200,000 today, would have seen a marginal tax rate between a low of 5% in 1929-1932 and 19% in 1937-1938. Capital gains were taxed at the same rate as income taxes, but the maximum rate was 12.5%. Taxes were raised dramatically during and after World War II, with a top marginal tax rate of 93% at one point in the 1950s. Our investor would have faced a marginal tax rate of anywhere between 47% and 57% with 50% the average. Beginning in 1938, long-term capital gains received a 50% exclusion, and from 1942 until 1967, the capital gains tax was capped at 25%.
It is little wonder that after World War II, capital gains became an increasingly important part of investor returns. Since 1950, on average, about one-third of investor returns have come from dividends, and two-thirds have come from capital gains, so most investors would have paid about 30%-33% of their stock- market returns in taxes between 1942 and 1986.
In 1986, the tax system was reformed and rates were lowered. The top tax rate was set at 28% on both capital gains and dividend income. In 1993, the rate on someone earning $200,000 was raised to 36%, and the long-term capital-gains rate was later lowered to 20%. The net effect since 1987 has been to make investors pay about 28% of their stock-market returns in taxes. Investors facing state income taxes have to pay even more.
Adjusted for dividends, inflation and taxes, the bull market of the 1920s looks even stronger than it ever did before. Not only were dividends higher and inflation lower than after World War II, but lower taxes also increased net returns considerably. Investors of the 1920s got to keep almost 90% of their gains after taxes. Since World War II, lower dividends, higher inflation and higher taxes have all reduced the net after-tax real total return to investors.
In the current bear market environment, perspective is more important than ever. The history of bull and bear markets reminds us that bear markets do end, that bull markets are stronger and last longer than bear markets, and that in the long run, the overall rise in stocks far offsets the declines.
---
BRYAN TAYLOR is president of Global Financial Data. He is an economist who does research on long-term behavior of markets.
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
Vielen Dank für das wunderbare boardmail.






!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
Automatisch aussortiert
Die schlechten ins Kröpfchen
Wer in die USA fliegt, landet auf unabsehbare Zeit in den riesigen Fahndungs-Computern, die das Land jetzt zur Terror-Bekämpfung einsetzt. Was mit seinen persönlichen Daten dort geschieht, erfährt er nicht: Schließlich handelt es sich um die "nationale Sicherheit".
Die EU hat dem seit März 2003 praktizierten Verfahren stillschweigend und grundsätzlich zugestimmt.
Von Tim Frohschütz
Die Regierung von George W. Bush macht das ehemalige "Land der Freien" zu einen Überwachungsstaat, der manchen bereits an eine Diktatur erinnert. Zum Beispiel auch Jonathan Todd, den Sprecher der Europäischen Kommission: "Ähnlich war es woanders vor nicht allzulanger Zeit. Wenn man in die Sowjetunion reiste, war klar, dass einen dort Geheimdienste ständig begleiten und überwachen würden. Und wenn man das nicht mochte, dann fuhr man ja auch nicht in die UdSSR."
Todd übertreibt natürlich, so schlimm ist es nicht. Noch nicht.
Was allerdings jetzt schon funktioniert, ist dies: Von jedem Reisenden, der in die USA fliegt, erhält das neugeschaffene US-Ministerium für Heimatschutz (Department of Homeland Security, DHS) die bei der Buchung anfallenden PNR-Daten (Passenger Name Record), theoretisch 60 Angaben pro Person. Was das DHS damit macht, wie lange es sie speichert, welchen Behörden es sie weitergibt, was diese dann damit machen, all das kann der Betroffene, weil es dort ja um Terrorbekämpfung und die "nationale Sicherheit" geht, weder überprüfen, noch gar seine Daten löschen lassen.
Diesen offenen Rechtsbruch, einen Verstoß gegen europäische Datenschutz-Gesetze, hat die Europäische Kommission Ende Februar mit der US-Regierung vereinbart.
Auf dem Wunschzettel von George W. Bush stand solche Datenbeschaffung schon kurz nach dem 11. September. So muss man die europäischen Fluglinien für erstaunlich standfest halten, denn anderthalb Jahre lang widerstanden sie diesem Ansinnen der US-Regierung. Aber Ende Februar 2003, als das Drängen der USA offenbar unwiderstehlich wurde, traf die EU-Kommission eine Vereinbarung mit der US-Zollbehörde (Customs and Border Protection, CBP, zum DHS gehörig). Nach dieser Vereinbarung hat die CBP ungehinderten Zugang zu allen Passagier-Daten in den Reservierungssystemen der Fluglinien. Ausdrücklich und mehrfach ist die Rede von "access" bzw. "electronic access"; CBP "accesses directly" alle Daten, verspricht jedoch, nur die Daten derjenigen Passagiere zu prüfen ("view"), die Flughäfen in den USA berühren.
Zweifel, ob dieses beim notorischen Datenhunger der US-Behörden wenig honette Versprechen eingehalten wird, sind geboten.
Rechnen wir einmal nach.
Aus der EU flogen im Jahr 2002 mit den Linien Air France, British Airways, Iberia und Lufthansa 14,169 Millionen Passagiere nach Nordamerika (das sind fast alle Passagiere, die mit europäischen Carriers nach Nordamerika fliegen; andere europäische Fluglinien fallen demgegenüber kaum ins Gewicht). 90 Prozent von ihnen flogen in die USA, d.h. im Monat durchschnittlich etwas mehr als eine Million Passagiere. Die vier genannten Fluglinien wickeln ihre Flugbuchungen über das Reservierungssystem Amadeus ab. Mit andern Worten: Über Amadeus fliegen während eines Monats demnach gut eine Million Passagiere aus der EU in die USA, in drei Wochen also etwa 750.000.
Die CBP jedoch hat - nach Auskunft von Amadeus selbst - im vergangenen Frühjahr während drei Wochen 1,5 Millionen mal auf Amadeus zugegriffen. Nun muss man wissen, dass ein Zugriff auf ein solches Reservierungsystem nur über einen sogenannten Filekey möglich ist und unter einem Filekey im Schnitt zwei Passagiere abgespeichert sind (ein Einzelreisender, ein Paar, eine Familie, eine Reisegruppe erhalten immer nur je einen Filekey). Mit den 1,5 Millionen CBP-Zugriffen sind also etwa drei Millionen Passagiere erfasst worden.
Es sind aber in diesem Zeitraum insgesamt nur etwa 750.000 Passagiere aus der EU in die USA geflogen. Wozu braucht die CBP viermal so viele Passagierdaten? Welche anderen Passagiere, weit über zwei Millionen Menschen, hat sich die CBP aus Amadeus allein in jenen drei Wochen herausgeholt?
Und vor allem: Was macht die CBP mit diesen Millionen und den künftigen Millionen Daten?
Sie wertet sie aus, hebt sie auf und gibt sie weiter.
Während diese Zugriffe und Weitergaben bereits im vollem Gang sind (seit dem 5. März 2003), verhandeln die EU und die amerikanischen Behörden weiter über das Procedere - als wäre der Datentransfer noch im Entwurfsstadium. In diesen Gesprächen haben die CBP und die mit ihr zusammenarbeitende Transportation Security Administration (TSA) im Mai 2003 folgende Regeln festgelegt (sogenannte "Undertakings"):
— Zweck der Datenerfassung
Abschnitt 5 der Undertakings bestimmt, dass die Daten bei der CBP "ausschließlich zur Verhinderung und Bekämpfung von Terrorismus und schweren Verbrechen" erfasst werden, um damit "Personen [zu identifizieren], die eine terroristische Handlung begangen haben oder potenziell begehen können"; die TSA benützt die Daten, um "bekannte und bis dahin unbekannte Personen mit terroristischen Verbindungen" herauszufinden.
— Dauer der Datenspeicherung (Abschnitt 13)
Bei der CBP werden die Daten bis sieben Tage nach dem Flug online verfügbar gehalten, danach wird ihre Speicherung auf einen Zeitraum von sieben Jahren "begrenzt"; weitere acht Jahre werden die Daten sodann als "gelöschte Datei" konserviert. Nach diesen 15 Jahren werden nur diejenigen Datensätze gelöscht, die nicht im Zuge einer Strafverfolgung weiterverwendet werden. Die TSA speichert die Daten sieben Jahre lang; was danach mit ihnen geschieht, wird nicht erwähnt. Zum vermutlichen Grund s.u. zu CAPPS II.
— Weitergabe der Daten (Abschnitt 27)
CBP und TSA gelten nach der Erfassung der Daten als deren "Eigentümer" in den USA; beide Behörden können sie "nach eigenem Ermessen" (wenn auch nur fallweise) weitergeben an alle anderen Stellen in den USA, die für "Terror-Bekämpfung oder Strafverfolgung" zuständig sind. Die Verwendung der Daten ist weiterhin erlaubt "in allen Strafverfahren oder falls gesetzlich erfordert".
Nachdem also bereits Dutzende Millionen Passagierdaten rechtswidrig abgerufen waren und abgerufen wurden, stand das Thema wieder auf der Tagesordnung eines EU-US-Treffens (in Brüssel, am 24. und 25. Juni 2003). Die EU-Arbeitsgruppe Datenschutz legte dazu ein elfseitiges Papier vor (Opinion 4/2003), das die Bedenken der EU auflistet. Der Katalog liest sich wie eine Selbstanklage: Während sich die US-Behörden längst die Daten unkontrolliert aus den Reservierungssystemen holen, wird von EU-Seite höflich darüber diskutiert, dass und wie diese Daten doch bitte gegen Missbrauch geschützt werden mögen.
Die Vorhaltungen der EU gegen CBP und TSA stellen zum Beispiel fest,
- dass der seit März praktizierte Datentransfer europäisches Recht verletzt ("Die berechtigten Erfordernisse der inneren Sicherheit der USA" sollten nicht mit den "grundlegenden Prinzipien" der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Grundrechte-Charta der EU kollidieren);
— dass die Undertakings ein zu unspezifisches Mandat schaffen "für die Verwendung und die Weitergabe der Daten `soweit sonst gesetzlich erfordert`) ... insbesondere im Hinblick auf CAPPS II und die Erfassung biometrischer Daten";
- dass der ungefilterte Datenzugriff der USA zu beenden sei: "Das `push-System" [bei dem Daten vom Reservierungssystem in die USA geschickt werden] würde eine Reihe von Maßnahmen überflüssig machen, "die sonst notwendig würden, wenn ein pull-System eingerichtet würde [bei dem die Daten durch die USA abgerufen werden] ... Diese [push-]Lösung sollte daher anstelle des gegenwärtigen Verfahrens so bald wie möglich eingesetzt werden;"
— dass die vollständige Weitergabe sämtlicher Daten einer Flugbuchung "weit über das hinausgeht, was als angemessen, relevant und nicht-exzessiv bezeichnet werden könnte"; dass zu bezweifeln sei, ob "eine exzessiv lange Dauer der Datenspeicherung bezüglich von Millionen Menschen für Ermittlungszwecke noch effektiv ist". Die Daten sollten deshalb höchstens einige Wochen oder Monate gespeichert werden: "Ein Zeitraum von 7-8 Jahren kann nicht als gerechtfertigt angesehen werden."
Man fragt sich, was bei der EU die Hoffnung nährt, eine Diskussion all dieser Punkte könnte die US-Regierung zu einem Einschwenken auf europäische Datenschutz-Prinzipien bewegen oder gar dazu, eine schon seit Monaten durchgeführte Praxis abzustellen - eine Praxis, die den europäischen Fluglinien wenn nicht alla mafiosa, so zumindest mit einer klaren Nötigung abgetrotzt wurde: mit dem angedrohten Entzug der US-Landerechte.
Warum sich die EU zu einer Verletzung ihrer eigenen Gesetze nötigen ließ, der politische Grund also, liegt nicht klar auf der Hand. War es die Gefährdung von Arbeitsplätzen, falls die EU reziprok gehandelt, den Spieß äußerstenfalls umgedreht und den USA die Landerechte verweigert hätte? Oder war es das sehnsüchtige Verlangen, von den USA wieder als Freund geschätzt zu werden, so dass man nicht schon wieder einen transatlantischen Streit vom Zaun brechen wollte?
Fest steht jedenfalls, dass hier Macht vor Recht erging - und die EU reichte den Amerikanern dazu die Hand.
In den wenigen deutschen Zeitungsberichten, in denen von diesem Daten-Fluss die Rede war, wurden immer die "sensiblen" PNR-Daten hervorgehoben. Dazu gehören die Kreditkartennummer, aber insbesondere manche Sonderwünsche wie ein bestimmtes Essen ("MOML" für "Moslem Meal" oder "KSML" für koscheres Essen), die einen Rückschluss auf die Religionszugehörigkeit des Passagiers ermöglichen. Ganz besonders sensibel sind natürlich alle Einträge in sogenannte "offene Felder", Einträge, die sich auch auf das ungebührliche Benehmen während eines Fluges beziehen können. Mit Daten wie diesen, heißt es dann, könnten die US-Behörden extrem leicht Missbrauch betreiben. (In den "undertakings" haben CBP und TSA versprochen, von Daten dieser Art keinen Gebrauch zu machen.)
Die wirkliche Gefahr aber liegt ganz woanders:
Bis Ende Juni 2003 wurde mit den amerikanischen Passagieren der Delta Airlines auf drei Flughäfen in den USA ein Experiment angestellt, von dem sie keine Ahnung hatten. Ihre Daten, dazu Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum, wurden während der Buchung über Computer mit ihren früheren Flügen, ihrem Kredit-Status (einer Art Schufa-Auskunft), dem Stand ihres Bankkontos und ihrem Strafregister abgeglichen. Das Ergebnis wurde dem TSA-Computer zugeleitet. Von ihm bekam jeder Passagier eine Farbe zugeteilt, die verschlüsselt auch auf dem Flugticket vermerkt wurde: Grün bedeutete, das er unbedenklich war; Gelb, das er sich vor dem Einsteigen zusätzlichen Überprüfungen stellen musste; und Rot, dass er nicht fliegen durfte. Der ganze Vorgang dauerte nur fünf Sekunden. Der Gelb-Status sollte an alle Strafverfolgungsbehörden (lokale, staatliche und FBI) weitergegeben werden. Der Name dieser Sortierung per Computer lautete Computer Assisted Passenger Pre-Screening (CAPPS, im Unterschied zu einem älteren - längst praktizierten - Programm gleichen Namens CAPPS II genannt).
Im März dieses Jahres ging so viel Datenhunger sogar dem Senat in Washington zu weit; er verlangte von der TSA bis Juni einen Bericht an den Kongress vor allem darüber, was mit den gesammelten Daten geschieht und wie der Schutz dieser Daten gewährleistet sein soll. Nachdem der Bericht Anfang Juli noch immer nicht vorlag, legte der Senat die Geldmittel für weitere Tests auf Eis.
Die TSA ihrerseits hat schon bei früherer Kritik deutlich gemacht, dass sie nicht gewillt ist, CAPPS II aufzugeben. Im Gegenteil: Brian Turmail, ein TSA-Sprecher, ließ Mitte Juni keinen Zweifel daran, dass der Zeitplan für die Einführung von CAPPS II (Sommer 2004) eingehalten wird. Wie ernst es die Regierung damit meint, hat der Präsident in seiner Pressekonferenz Ende Juli noch einmal detailliert offengelegt ("Was wir tun können, ist ... sicherstellen, dass alle, die in ein Flugzeug steigen, ordentlich durchleuchtet werden [screened]. Und selbstverständlich reden wir mit ausländischen Regierungen und Fluglinien, um sie auf die tatsächliche Bedrohung hinzuweisen. Uns ist bewusst, dass Leute fliegen - das Beschaffen von Listen von Leuten, die in unser Land fliegen und jetzt dann der Abgleich mit einer stark verbesserten Datenbank.").
Bis dahin soll nach den Plänen der US-Regierung auch das neue Anti-Terror-Gesetz in Kraft getreten sein, der sogenannte Domestic Security Enhancement Act (auch PATRIOT II genannt). Patriot II beseitigt im Handstreich eine ganze Reihe ziviler Freiheitsrechte, für die die USA berühmt und Vorbild waren. Nur ein Beispiel: Paragraph 201 des Entwurfs führt etwas ein, was es in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika noch nie gegeben hat: geheime Verhaftungen. Damit wären die Behörden berechtigt, über einen wegen "Terrorimus"-Verdachts Festgenommenen jede Auskunft zu verweigern, auch gegenüber Angehörigen, sogar über die Tatsache der Verhaftung selbst (theoretisch nur bis zum eventuellen Beginn einer Verhandlung; weil dafür aber keinerlei Frist gesetzt ist, praktisch unbegrenzt). Man kannte so etwas bisher nur als "lettre de cachet" vor der Französischen Revolution oder von den "Verschwundenen" in Argentinien.
Man wird diese Entwicklungen im Zusammenhang sehen müssen: die laufende Datenbeschaffung aus den Reservierungssystemen, die computerisierte Farb-Markierung von Passagieren durch CAPPS II und die drohende Geheim-Verhaftung ohne Richter und Prozess. In dieser unaufhaltsamen Synergie gewinnt der Begriff "staatliche Gewalt" einen neuen, Orwellschen Inhalt. Es ist, als wäre eine vordemokratische Junta an der Macht: Es gibt nur noch eine militarisierte Verwaltung ("America at war"), die freiheitssichernden checks und balances funktionieren nicht mehr, die Grundrechte der Bill of Rights werden abgeschafft.
So kann jeder, dem seine Freiheit lieb ist, nur eins tun: nicht mehr in die USA fliegen. Jedenfalls solange nicht, bis eine andere Regierung dieser High-Tech-Inquisition verlässlich ein Ende gemacht hat.
Quellen:
- Die Vereinbarung zwischen der europäischen Kommission und den US-Zollbehörden ist unter http://europa.eu.int/comm/exdternal_relations/us/intro/pnr.h… nachzulesen (aus der Sicht der EU-Kommission handelt sich allerdings technisch nicht um ein "agreement").
- Die Zahl der Flugpassagiere aus der EU nach Nordamerika ist entnommen aus: AEA STAR (Association of European Airlines, Summary of Traffic and Air Results, http://www.aea.be).
- Die Zahl der Zugriffe der CBP auf Amadeus wurde der ZDF-Sendung Frontal 21 vom 15. April 2003 mitgeteilt: (http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,2041199,00.html).
- Die "Untertakings of the United States Bureau of Customs and Border Protection and the United States Transportation Security Administration" stehen in: http://www.statewatch.org/news/2003/jun/wp78_pnrf_annex_en.p…
- Die Mängelliste der europäischen Datenschutz-Arbeitsgruppe: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdoc…
- Die Entstehung von CAPPS II (mit zahlreichen Links): http://hasbrouck.org/articles/travelprivacy.html.
- Die Darstellung von CAPPS II aus Sicht der TSA: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/usam/2003051…
- Eine Analyse des geplanten Patriot II Act durch die American Civil Liberties Union (ACLU): http://www.aclu.org/SafeandFree/SafeandFree.cfm?ID=11835&c=2…
2. August 2003
http://www.gazette.de/frohschuetz02-print.html
Orwell`s 1984 wird Realität, fehlt nur noch das Wahrheitsministerium .......
.......
syr
Die schlechten ins Kröpfchen
Wer in die USA fliegt, landet auf unabsehbare Zeit in den riesigen Fahndungs-Computern, die das Land jetzt zur Terror-Bekämpfung einsetzt. Was mit seinen persönlichen Daten dort geschieht, erfährt er nicht: Schließlich handelt es sich um die "nationale Sicherheit".
Die EU hat dem seit März 2003 praktizierten Verfahren stillschweigend und grundsätzlich zugestimmt.
Von Tim Frohschütz
Die Regierung von George W. Bush macht das ehemalige "Land der Freien" zu einen Überwachungsstaat, der manchen bereits an eine Diktatur erinnert. Zum Beispiel auch Jonathan Todd, den Sprecher der Europäischen Kommission: "Ähnlich war es woanders vor nicht allzulanger Zeit. Wenn man in die Sowjetunion reiste, war klar, dass einen dort Geheimdienste ständig begleiten und überwachen würden. Und wenn man das nicht mochte, dann fuhr man ja auch nicht in die UdSSR."
Todd übertreibt natürlich, so schlimm ist es nicht. Noch nicht.
Was allerdings jetzt schon funktioniert, ist dies: Von jedem Reisenden, der in die USA fliegt, erhält das neugeschaffene US-Ministerium für Heimatschutz (Department of Homeland Security, DHS) die bei der Buchung anfallenden PNR-Daten (Passenger Name Record), theoretisch 60 Angaben pro Person. Was das DHS damit macht, wie lange es sie speichert, welchen Behörden es sie weitergibt, was diese dann damit machen, all das kann der Betroffene, weil es dort ja um Terrorbekämpfung und die "nationale Sicherheit" geht, weder überprüfen, noch gar seine Daten löschen lassen.
Diesen offenen Rechtsbruch, einen Verstoß gegen europäische Datenschutz-Gesetze, hat die Europäische Kommission Ende Februar mit der US-Regierung vereinbart.
Auf dem Wunschzettel von George W. Bush stand solche Datenbeschaffung schon kurz nach dem 11. September. So muss man die europäischen Fluglinien für erstaunlich standfest halten, denn anderthalb Jahre lang widerstanden sie diesem Ansinnen der US-Regierung. Aber Ende Februar 2003, als das Drängen der USA offenbar unwiderstehlich wurde, traf die EU-Kommission eine Vereinbarung mit der US-Zollbehörde (Customs and Border Protection, CBP, zum DHS gehörig). Nach dieser Vereinbarung hat die CBP ungehinderten Zugang zu allen Passagier-Daten in den Reservierungssystemen der Fluglinien. Ausdrücklich und mehrfach ist die Rede von "access" bzw. "electronic access"; CBP "accesses directly" alle Daten, verspricht jedoch, nur die Daten derjenigen Passagiere zu prüfen ("view"), die Flughäfen in den USA berühren.
Zweifel, ob dieses beim notorischen Datenhunger der US-Behörden wenig honette Versprechen eingehalten wird, sind geboten.
Rechnen wir einmal nach.
Aus der EU flogen im Jahr 2002 mit den Linien Air France, British Airways, Iberia und Lufthansa 14,169 Millionen Passagiere nach Nordamerika (das sind fast alle Passagiere, die mit europäischen Carriers nach Nordamerika fliegen; andere europäische Fluglinien fallen demgegenüber kaum ins Gewicht). 90 Prozent von ihnen flogen in die USA, d.h. im Monat durchschnittlich etwas mehr als eine Million Passagiere. Die vier genannten Fluglinien wickeln ihre Flugbuchungen über das Reservierungssystem Amadeus ab. Mit andern Worten: Über Amadeus fliegen während eines Monats demnach gut eine Million Passagiere aus der EU in die USA, in drei Wochen also etwa 750.000.
Die CBP jedoch hat - nach Auskunft von Amadeus selbst - im vergangenen Frühjahr während drei Wochen 1,5 Millionen mal auf Amadeus zugegriffen. Nun muss man wissen, dass ein Zugriff auf ein solches Reservierungsystem nur über einen sogenannten Filekey möglich ist und unter einem Filekey im Schnitt zwei Passagiere abgespeichert sind (ein Einzelreisender, ein Paar, eine Familie, eine Reisegruppe erhalten immer nur je einen Filekey). Mit den 1,5 Millionen CBP-Zugriffen sind also etwa drei Millionen Passagiere erfasst worden.
Es sind aber in diesem Zeitraum insgesamt nur etwa 750.000 Passagiere aus der EU in die USA geflogen. Wozu braucht die CBP viermal so viele Passagierdaten? Welche anderen Passagiere, weit über zwei Millionen Menschen, hat sich die CBP aus Amadeus allein in jenen drei Wochen herausgeholt?
Und vor allem: Was macht die CBP mit diesen Millionen und den künftigen Millionen Daten?
Sie wertet sie aus, hebt sie auf und gibt sie weiter.
Während diese Zugriffe und Weitergaben bereits im vollem Gang sind (seit dem 5. März 2003), verhandeln die EU und die amerikanischen Behörden weiter über das Procedere - als wäre der Datentransfer noch im Entwurfsstadium. In diesen Gesprächen haben die CBP und die mit ihr zusammenarbeitende Transportation Security Administration (TSA) im Mai 2003 folgende Regeln festgelegt (sogenannte "Undertakings"):
— Zweck der Datenerfassung
Abschnitt 5 der Undertakings bestimmt, dass die Daten bei der CBP "ausschließlich zur Verhinderung und Bekämpfung von Terrorismus und schweren Verbrechen" erfasst werden, um damit "Personen [zu identifizieren], die eine terroristische Handlung begangen haben oder potenziell begehen können"; die TSA benützt die Daten, um "bekannte und bis dahin unbekannte Personen mit terroristischen Verbindungen" herauszufinden.
— Dauer der Datenspeicherung (Abschnitt 13)
Bei der CBP werden die Daten bis sieben Tage nach dem Flug online verfügbar gehalten, danach wird ihre Speicherung auf einen Zeitraum von sieben Jahren "begrenzt"; weitere acht Jahre werden die Daten sodann als "gelöschte Datei" konserviert. Nach diesen 15 Jahren werden nur diejenigen Datensätze gelöscht, die nicht im Zuge einer Strafverfolgung weiterverwendet werden. Die TSA speichert die Daten sieben Jahre lang; was danach mit ihnen geschieht, wird nicht erwähnt. Zum vermutlichen Grund s.u. zu CAPPS II.
— Weitergabe der Daten (Abschnitt 27)
CBP und TSA gelten nach der Erfassung der Daten als deren "Eigentümer" in den USA; beide Behörden können sie "nach eigenem Ermessen" (wenn auch nur fallweise) weitergeben an alle anderen Stellen in den USA, die für "Terror-Bekämpfung oder Strafverfolgung" zuständig sind. Die Verwendung der Daten ist weiterhin erlaubt "in allen Strafverfahren oder falls gesetzlich erfordert".
Nachdem also bereits Dutzende Millionen Passagierdaten rechtswidrig abgerufen waren und abgerufen wurden, stand das Thema wieder auf der Tagesordnung eines EU-US-Treffens (in Brüssel, am 24. und 25. Juni 2003). Die EU-Arbeitsgruppe Datenschutz legte dazu ein elfseitiges Papier vor (Opinion 4/2003), das die Bedenken der EU auflistet. Der Katalog liest sich wie eine Selbstanklage: Während sich die US-Behörden längst die Daten unkontrolliert aus den Reservierungssystemen holen, wird von EU-Seite höflich darüber diskutiert, dass und wie diese Daten doch bitte gegen Missbrauch geschützt werden mögen.
Die Vorhaltungen der EU gegen CBP und TSA stellen zum Beispiel fest,
- dass der seit März praktizierte Datentransfer europäisches Recht verletzt ("Die berechtigten Erfordernisse der inneren Sicherheit der USA" sollten nicht mit den "grundlegenden Prinzipien" der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Grundrechte-Charta der EU kollidieren);
— dass die Undertakings ein zu unspezifisches Mandat schaffen "für die Verwendung und die Weitergabe der Daten `soweit sonst gesetzlich erfordert`) ... insbesondere im Hinblick auf CAPPS II und die Erfassung biometrischer Daten";
- dass der ungefilterte Datenzugriff der USA zu beenden sei: "Das `push-System" [bei dem Daten vom Reservierungssystem in die USA geschickt werden] würde eine Reihe von Maßnahmen überflüssig machen, "die sonst notwendig würden, wenn ein pull-System eingerichtet würde [bei dem die Daten durch die USA abgerufen werden] ... Diese [push-]Lösung sollte daher anstelle des gegenwärtigen Verfahrens so bald wie möglich eingesetzt werden;"
— dass die vollständige Weitergabe sämtlicher Daten einer Flugbuchung "weit über das hinausgeht, was als angemessen, relevant und nicht-exzessiv bezeichnet werden könnte"; dass zu bezweifeln sei, ob "eine exzessiv lange Dauer der Datenspeicherung bezüglich von Millionen Menschen für Ermittlungszwecke noch effektiv ist". Die Daten sollten deshalb höchstens einige Wochen oder Monate gespeichert werden: "Ein Zeitraum von 7-8 Jahren kann nicht als gerechtfertigt angesehen werden."
Man fragt sich, was bei der EU die Hoffnung nährt, eine Diskussion all dieser Punkte könnte die US-Regierung zu einem Einschwenken auf europäische Datenschutz-Prinzipien bewegen oder gar dazu, eine schon seit Monaten durchgeführte Praxis abzustellen - eine Praxis, die den europäischen Fluglinien wenn nicht alla mafiosa, so zumindest mit einer klaren Nötigung abgetrotzt wurde: mit dem angedrohten Entzug der US-Landerechte.
Warum sich die EU zu einer Verletzung ihrer eigenen Gesetze nötigen ließ, der politische Grund also, liegt nicht klar auf der Hand. War es die Gefährdung von Arbeitsplätzen, falls die EU reziprok gehandelt, den Spieß äußerstenfalls umgedreht und den USA die Landerechte verweigert hätte? Oder war es das sehnsüchtige Verlangen, von den USA wieder als Freund geschätzt zu werden, so dass man nicht schon wieder einen transatlantischen Streit vom Zaun brechen wollte?
Fest steht jedenfalls, dass hier Macht vor Recht erging - und die EU reichte den Amerikanern dazu die Hand.
In den wenigen deutschen Zeitungsberichten, in denen von diesem Daten-Fluss die Rede war, wurden immer die "sensiblen" PNR-Daten hervorgehoben. Dazu gehören die Kreditkartennummer, aber insbesondere manche Sonderwünsche wie ein bestimmtes Essen ("MOML" für "Moslem Meal" oder "KSML" für koscheres Essen), die einen Rückschluss auf die Religionszugehörigkeit des Passagiers ermöglichen. Ganz besonders sensibel sind natürlich alle Einträge in sogenannte "offene Felder", Einträge, die sich auch auf das ungebührliche Benehmen während eines Fluges beziehen können. Mit Daten wie diesen, heißt es dann, könnten die US-Behörden extrem leicht Missbrauch betreiben. (In den "undertakings" haben CBP und TSA versprochen, von Daten dieser Art keinen Gebrauch zu machen.)
Die wirkliche Gefahr aber liegt ganz woanders:
Bis Ende Juni 2003 wurde mit den amerikanischen Passagieren der Delta Airlines auf drei Flughäfen in den USA ein Experiment angestellt, von dem sie keine Ahnung hatten. Ihre Daten, dazu Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum, wurden während der Buchung über Computer mit ihren früheren Flügen, ihrem Kredit-Status (einer Art Schufa-Auskunft), dem Stand ihres Bankkontos und ihrem Strafregister abgeglichen. Das Ergebnis wurde dem TSA-Computer zugeleitet. Von ihm bekam jeder Passagier eine Farbe zugeteilt, die verschlüsselt auch auf dem Flugticket vermerkt wurde: Grün bedeutete, das er unbedenklich war; Gelb, das er sich vor dem Einsteigen zusätzlichen Überprüfungen stellen musste; und Rot, dass er nicht fliegen durfte. Der ganze Vorgang dauerte nur fünf Sekunden. Der Gelb-Status sollte an alle Strafverfolgungsbehörden (lokale, staatliche und FBI) weitergegeben werden. Der Name dieser Sortierung per Computer lautete Computer Assisted Passenger Pre-Screening (CAPPS, im Unterschied zu einem älteren - längst praktizierten - Programm gleichen Namens CAPPS II genannt).
Im März dieses Jahres ging so viel Datenhunger sogar dem Senat in Washington zu weit; er verlangte von der TSA bis Juni einen Bericht an den Kongress vor allem darüber, was mit den gesammelten Daten geschieht und wie der Schutz dieser Daten gewährleistet sein soll. Nachdem der Bericht Anfang Juli noch immer nicht vorlag, legte der Senat die Geldmittel für weitere Tests auf Eis.
Die TSA ihrerseits hat schon bei früherer Kritik deutlich gemacht, dass sie nicht gewillt ist, CAPPS II aufzugeben. Im Gegenteil: Brian Turmail, ein TSA-Sprecher, ließ Mitte Juni keinen Zweifel daran, dass der Zeitplan für die Einführung von CAPPS II (Sommer 2004) eingehalten wird. Wie ernst es die Regierung damit meint, hat der Präsident in seiner Pressekonferenz Ende Juli noch einmal detailliert offengelegt ("Was wir tun können, ist ... sicherstellen, dass alle, die in ein Flugzeug steigen, ordentlich durchleuchtet werden [screened]. Und selbstverständlich reden wir mit ausländischen Regierungen und Fluglinien, um sie auf die tatsächliche Bedrohung hinzuweisen. Uns ist bewusst, dass Leute fliegen - das Beschaffen von Listen von Leuten, die in unser Land fliegen und jetzt dann der Abgleich mit einer stark verbesserten Datenbank.").
Bis dahin soll nach den Plänen der US-Regierung auch das neue Anti-Terror-Gesetz in Kraft getreten sein, der sogenannte Domestic Security Enhancement Act (auch PATRIOT II genannt). Patriot II beseitigt im Handstreich eine ganze Reihe ziviler Freiheitsrechte, für die die USA berühmt und Vorbild waren. Nur ein Beispiel: Paragraph 201 des Entwurfs führt etwas ein, was es in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika noch nie gegeben hat: geheime Verhaftungen. Damit wären die Behörden berechtigt, über einen wegen "Terrorimus"-Verdachts Festgenommenen jede Auskunft zu verweigern, auch gegenüber Angehörigen, sogar über die Tatsache der Verhaftung selbst (theoretisch nur bis zum eventuellen Beginn einer Verhandlung; weil dafür aber keinerlei Frist gesetzt ist, praktisch unbegrenzt). Man kannte so etwas bisher nur als "lettre de cachet" vor der Französischen Revolution oder von den "Verschwundenen" in Argentinien.
Man wird diese Entwicklungen im Zusammenhang sehen müssen: die laufende Datenbeschaffung aus den Reservierungssystemen, die computerisierte Farb-Markierung von Passagieren durch CAPPS II und die drohende Geheim-Verhaftung ohne Richter und Prozess. In dieser unaufhaltsamen Synergie gewinnt der Begriff "staatliche Gewalt" einen neuen, Orwellschen Inhalt. Es ist, als wäre eine vordemokratische Junta an der Macht: Es gibt nur noch eine militarisierte Verwaltung ("America at war"), die freiheitssichernden checks und balances funktionieren nicht mehr, die Grundrechte der Bill of Rights werden abgeschafft.
So kann jeder, dem seine Freiheit lieb ist, nur eins tun: nicht mehr in die USA fliegen. Jedenfalls solange nicht, bis eine andere Regierung dieser High-Tech-Inquisition verlässlich ein Ende gemacht hat.
Quellen:
- Die Vereinbarung zwischen der europäischen Kommission und den US-Zollbehörden ist unter http://europa.eu.int/comm/exdternal_relations/us/intro/pnr.h… nachzulesen (aus der Sicht der EU-Kommission handelt sich allerdings technisch nicht um ein "agreement").
- Die Zahl der Flugpassagiere aus der EU nach Nordamerika ist entnommen aus: AEA STAR (Association of European Airlines, Summary of Traffic and Air Results, http://www.aea.be).
- Die Zahl der Zugriffe der CBP auf Amadeus wurde der ZDF-Sendung Frontal 21 vom 15. April 2003 mitgeteilt: (http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,2041199,00.html).
- Die "Untertakings of the United States Bureau of Customs and Border Protection and the United States Transportation Security Administration" stehen in: http://www.statewatch.org/news/2003/jun/wp78_pnrf_annex_en.p…
- Die Mängelliste der europäischen Datenschutz-Arbeitsgruppe: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdoc…
- Die Entstehung von CAPPS II (mit zahlreichen Links): http://hasbrouck.org/articles/travelprivacy.html.
- Die Darstellung von CAPPS II aus Sicht der TSA: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/delegations/usam/2003051…
- Eine Analyse des geplanten Patriot II Act durch die American Civil Liberties Union (ACLU): http://www.aclu.org/SafeandFree/SafeandFree.cfm?ID=11835&c=2…
2. August 2003
http://www.gazette.de/frohschuetz02-print.html
Orwell`s 1984 wird Realität, fehlt nur noch das Wahrheitsministerium
 .......
.......syr
DD ist im WO-Himmel 
Userinfo
Username: DolbyDigital5.1
User wurde gesperrt
Registriert seit: 24.01.2001 [ seit 922 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 04.08.2003 12:55:00
Threads: 109 [ 60 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von DolbyDigital5.1 anzeigen
Postings: 6524 [ Durchschnittlich 7,0739 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben
nur wegen des Streits mit Paule

Userinfo
Username: DolbyDigital5.1
User wurde gesperrt
Registriert seit: 24.01.2001 [ seit 922 Tagen ]
User ist momentan: Offline
Letztes Login: 04.08.2003 12:55:00
Threads: 109 [ 60 - Verhältnis Postings zu Threads ]
Alle Threads von DolbyDigital5.1 anzeigen
Postings: 6524 [ Durchschnittlich 7,0739 Beiträge/Tag ]
Postings der letzten 30 Tage anzeigen
Interessen: keine Angaben
nur wegen des Streits mit Paule

Dienstag 17. Juni 2003, 20:00 Uhr
Russland überholt USA als weltgrößter Waffenexporteur
Stockholm (Reuters) - Russland hat im vergangenen Jahr nach einem Bericht des Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) die USA als weltgrößter Waffenexporteur überholt.
Die weltweiten Rüstungsausgaben seien 2002 um sechs Prozent und damit doppelt so stark wie im Vorjahr auf 794 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Stockholmer Institut in seinem am Dienstag vorgelegten Jahrbuch mit. Drei Viertel der Steigerung seien allein auf die USA entfallen. Allerdings habe bei den Rüstungsexporten Russland die Führung vor den USA übernommen, während China gefolgt von Indien die größten Waffenimporteure gewesen seien.
Mit Rüstungsausgaben, die 2002 um zehn Prozent auf 336 Milliarden Dollar gesteigert wurden, entfielen dem Institut zufolge 43 Prozent der weltweiten Aufwendungen für Rüstungsgüter auf die USA, nach 36 Prozent im Jahr zuvor. "Der Rest der Welt ist nicht bereit oder kann nicht dem Beispiel der USA bei der Steigerung der Militärausgaben folgen", stellte das SIPRI fest. Die gesamten Rüstungsausgaben der westeuropäischen Nato- Mitglieder seien im Zeitraum 2000 bis 2002 real um drei Prozent gesunken. "Während in den USA der Krieg gegen den Terror ein wesentlicher Faktor für die riesigen Militärausgaben 2002 war, war dies in Europa nicht der Fall", heißt es in dem Bericht. Der Verteidigungshaushalt der USA sehe für 2003 eine Steigerung von gut sechs Prozent vor.
Russland plant dem Institut zufolge in diesem Jahr eine Steigerung seiner Rüstungsausgaben um real sieben bis acht Prozent, nachdem der Verteidigungshaushalt 2002 gegenüber dem Vorjahr unverändert gewesen sei. Der Wert der russischen Waffenexporte, der seit 1999 stetig steige, habe 2002 um mehr als eine Milliarde auf 4,8 Milliarden Dollar zugenommen und damit 36 Prozent der weltweiten Waffenausfuhren ausgemacht.
Russland überholt USA als weltgrößter Waffenexporteur
Stockholm (Reuters) - Russland hat im vergangenen Jahr nach einem Bericht des Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) die USA als weltgrößter Waffenexporteur überholt.
Die weltweiten Rüstungsausgaben seien 2002 um sechs Prozent und damit doppelt so stark wie im Vorjahr auf 794 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Stockholmer Institut in seinem am Dienstag vorgelegten Jahrbuch mit. Drei Viertel der Steigerung seien allein auf die USA entfallen. Allerdings habe bei den Rüstungsexporten Russland die Führung vor den USA übernommen, während China gefolgt von Indien die größten Waffenimporteure gewesen seien.
Mit Rüstungsausgaben, die 2002 um zehn Prozent auf 336 Milliarden Dollar gesteigert wurden, entfielen dem Institut zufolge 43 Prozent der weltweiten Aufwendungen für Rüstungsgüter auf die USA, nach 36 Prozent im Jahr zuvor. "Der Rest der Welt ist nicht bereit oder kann nicht dem Beispiel der USA bei der Steigerung der Militärausgaben folgen", stellte das SIPRI fest. Die gesamten Rüstungsausgaben der westeuropäischen Nato- Mitglieder seien im Zeitraum 2000 bis 2002 real um drei Prozent gesunken. "Während in den USA der Krieg gegen den Terror ein wesentlicher Faktor für die riesigen Militärausgaben 2002 war, war dies in Europa nicht der Fall", heißt es in dem Bericht. Der Verteidigungshaushalt der USA sehe für 2003 eine Steigerung von gut sechs Prozent vor.
Russland plant dem Institut zufolge in diesem Jahr eine Steigerung seiner Rüstungsausgaben um real sieben bis acht Prozent, nachdem der Verteidigungshaushalt 2002 gegenüber dem Vorjahr unverändert gewesen sei. Der Wert der russischen Waffenexporte, der seit 1999 stetig steige, habe 2002 um mehr als eine Milliarde auf 4,8 Milliarden Dollar zugenommen und damit 36 Prozent der weltweiten Waffenausfuhren ausgemacht.
Ohne Kapazitätsauslastung keine Investitionen




Wachstum im Lagerbau 



05.08.2003
R E C H T S - K O L U M N E
Präsident Bushs geheimnisvoller Krieg
Von Deborah Sturman
Nach den brutalen Anschlägen vom 11. September hat die US-Regierung den "Krieg gegen den Terror" erklärt. Sie führt diesen Kampf seither weitgehend im Verborgenen - und hebelt dabei eine Reihe von Verfassungsrechten aus, kritisiert Rechtsexpertin Deborah Sturman.
Nach der Tragödie der Anschläge vom 11. September 2001 hat die Bush-Administration im Namen der Landesverteidigung eine ganze Reihe grundlegender, durch die Verfassung garantierter Rechte ihrer Bürger ohne ersichtliche Gründe erheblich eingeschränkt.
Darunter fallen vor allem die Pressefreiheit und das Recht der Nation, über die Handlungen ihrer Regierung informiert zu werden. Dabei sagt der erste Zusatz zur amerikanischen Verfassung ganz unmissverständlich: "Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, ... welches die die Freiheit der Presse ... beschränkt ...".
Die Bush-Administration teilt nur selten Informationen über ihren "Krieg gegen den Terror" mit. Insbesondere lässt sie nur selten erkennen, auf welche Fakten sie ihre Entscheidungen stützt. Sie enthält diese Informationen nicht nur regelmäßig der Presse vor - sie verweigert dieses Wissen auch den zwei anderen Säulen der staatlichen Gewalt, den föderalen Gerichten und dem Kongress.
Die Administration reagiert auf diesbezügliche Anfragen mit Widerwillen, Verweigerung und vereinzelten Zugeständnissen, wobei sie die Kontrolle über den Informationsfluss niemals aus der Hand gibt.
Der drohende Machtmissbrauch
Diese restriktive Politik mag notwendig sein, um laufende Ermittlungen zu schützen. Sie erlaubt es der Regierung aber auch, möglicherweise peinliche Informationen über Fehler, Misserfolge und übertriebene Behauptungen zu verbergen.
Deborah Sturman, Expertin für Aktionärsklagen aus New York, bei manager-magazin.de. Einen Überblick über ihre Kolumnen finden Sie hier.
In dem Verfahren gegen Zaccarias Moussaoui, den "20. Flugzeugentführer" des 11. September 2001, hat die Bush-Administration einem Bundesgericht dargelegt, dass der Präsident als Oberbefehlshaber des Militärs allein in der Lage sei, zu entscheiden, wie der "Krieg gegen den Terror" geführt werden solle und wie viele Informationen über diesen Krieg preisgegeben werden sollen. Generalstaatsanwalt John Ashcroft behauptet, dass auch der Kongress und die Gerichte nicht bevollmächtigt sind, Entscheidungen eines Präsidenten infrage zu stellen.
Auf die Frage, wie denn die Kontrollmechanismen der Gewaltenteilung beschaffen sein sollen, die dann noch verhindern können, dass der Präsident und sein Justizministerium ihre von ihnen selbst erweiterten Machtbefugnisse missbrauchen, reagiert die Administration mit dem zynischen Hinweis auf "politische Rechenschaft": Wer mit der Politik der Bush-Administration nicht zufrieden sei, der könne ja im Jahr 2004 gegen den Präsidenten stimmen.
05.08.2003
R E C H T S - K O L U M N E
Präsident Bushs geheimnisvoller Krieg (2)
Das Recht der Wähler
Fragwürdig ist dieses Argument bereits deshalb, weil die Wähler schließlich wissen müssen, wie der Präsident seine jüngst erweiterten Machtbefugnisse benutzt, ehe sie beurteilen können, ob er diese nun missbraucht oder eben nicht.
"Krieg gegen den Terror": US-Präsident George W. Bush
Dabei liegt es bereits heute auf der Hand, dass wir über sehr viele Vorgänge nur sehr unvollständig unterrichtet sind. So gibt die Regierung etwa nur widerwillig Informationen über ihre Internierungspraktiken frei, auch dann, wenn Bundesrichter entschieden haben, dass die Regierung hier ihr Bedürfnis nach Geheimhaltung übertrieben hat.
Kurz nach dem 11. September 2001 wurden mehr als 1000 Menschen verhaftet, manche als Zeugen, manche unter Verdacht auf Verletzung der Einwanderungsgesetze, wieder anderen wurden geringfügige Verbrechen vorgeworfen (ausländische Studenten, die angeblich in Bezug auf ihre Englisch-Kenntnisse gemogelt haben).
Der Kampf der Regierung
Das Justizministerium hat sich zunächst geweigert, die Zahl der Inhaftierten, deren Namen, Aufenthaltsorte oder Haftdauer bekannt zu geben. Die Regierung hat auch erklärt, die Inhaftierten seien keine Kriegsgefangenen. Dadurch kann sie diesen das unter der Genfer Konvention festgeschriebene Recht auf Anhörung vorenthalten, ihnen also die Möglichkeit nehmen, die Gründe ihrer Festnahme zu hinterfragen.
Die Bush-Administration bezeichnet die Inhaftierten als "feindliche Kriegsteilnehmer" und argumentiert, dass diese Bezeichnung in erster Linie eine politische Entscheidung sei, die dem Präsidenten in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber im "Krieg gegen den Terror" zusteht.
Die Regierung hat energisch gegen Klagen gekämpft, die unter dem "Gesetz über Freiheit der Information" (Freedom of Information Act) erhoben wurden, um die Administration zu zwingen, Angaben über die Inhaftierungen zu veröffentlichen. Die bislang freigegebenen Informationen - beispielsweise wie viele Personen nach dem 11. September inhaftiert worden sind - sind das Resultat gerichtlichen Zwangs. Ein Gericht hat auch entschieden, dass der von der Administration vorgebrachte Bedarf an Geheimhaltung übertrieben war. 05.08.2003
R E C H T S - K O L U M N E
Präsident Bushs geheimnisvoller Krieg (3)
Seit Monaten in Haft - aber keine Anklageerhebung
Von gelegentlichen und lückenhaften Verlautbarungen der Administration abgesehen, wissen wir nicht, welche Personen auf Grund welcher Vorwürfe inhaftiert sind. Wir wissen allerdings, dass mindestens zwei US-Bürger, Yasser Hamdi und Jose Padilla, als "feindliche Kriegsteilnehmer" schon seit Monaten in Haft sind, ohne dass bislang Anklage gegen sie erhoben worden wäre. Die Administration hat bislang jeden Versuch verhindert, sie durch Anwälte repräsentieren zu lassen.
Die Regierung hat zudem versucht, geheim zu halten, wie sie von ihrem Recht auf Abschiebung Gebrauch macht, in dem sie die Abschiebungsanhörungen von 611 nach dem 11. September Inhaftierten hinter verschlossenen Türen abgehalten hat. Ein Bundesberufungsgericht hat aber entschieden, dass die Öffentlichkeit und die Presse unter dem ersten Verfassungszusatz Zugang zu Abschiebungsanhörungen haben.
"Die Demokratie stirbt hinter verschlossenen Türen"
Bei dieser Gelegenheit schrieb Richter Damon Keith: "Die Demokratie stirbt hinter verschlossenen Türen". Ein zweites Berufungsgericht der gleichen Ebene aber ist der Argumentation der Regierung gefolgt und hat entschieden, dass die Administration entscheiden kann, wann Geheimhaltung notwendig ist - und zwar im Hinblick auf sämtliche Aspekte des "Krieges gegen den Terror", selbst dann, wenn amerikanische Gerichte zu einem Schauplatz in diesem Krieg werden.
Stephen Breyer, ein Richter am amerikanischen Verfassungsgericht, hat der Administration jüngst vorgeworfen, sie würde die Gerichte in ihrer verfassungsmäßig garantierten Befugnis beeinträchtigen, die Regierung zu kontrollieren. Breyer hat daran erinnert, dass die amerikanische Verfassung auch während eines tatsächlichen oder behaupteten Krieges gilt. Zudem schreibe die Verfassung vor, dass es der Justiz obliegt, das Verhalten und die Entscheidungen der Administration im Hinblick auf Inhaftierungen und Geheimhaltung zu überprüfen. Breyer hat vorhergesagt, dass die Gerichte eine immer größere Rolle spielen würden, wenn es darum geht, die Grenzen der Verfassung festzustellen.
Die Machtverschiebung
Sicherlich existieren Umstände, die es notwendig machen, dass die Regierung in der Verborgenheit handelt. So sind sich alle Gerichte beispielsweise im Zusammenhang mit einer Abschiebungsanhörung bisher darüber einig gewesen, dass Teile einer Anhörung hinter verschlossenen Türen abgehalten werden können, wenn die Exekutive sensible Beweismittel vorlegt. Aber es obliegt den Gerichten, darüber zu entscheiden, wann und ob dies der Regierung in Abschiebungsanhörungen gestattet werden soll.
Allein die Gerichte können das Recht der Öffentlichkeit auf Information gegen die Argumente der Regierung abwiegen und entscheiden, ob Vertraulichkeit in einem Fall jeweils tatsächlich notwendig ist. Daran festzuhalten ist vor allem deshalb notwendig, da es in der politischen Natur der Regierung liegt, den Bedarf an Geheimhaltung zu überschätzen.
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0%2C2828%2…
R E C H T S - K O L U M N E
Präsident Bushs geheimnisvoller Krieg
Von Deborah Sturman
Nach den brutalen Anschlägen vom 11. September hat die US-Regierung den "Krieg gegen den Terror" erklärt. Sie führt diesen Kampf seither weitgehend im Verborgenen - und hebelt dabei eine Reihe von Verfassungsrechten aus, kritisiert Rechtsexpertin Deborah Sturman.
Nach der Tragödie der Anschläge vom 11. September 2001 hat die Bush-Administration im Namen der Landesverteidigung eine ganze Reihe grundlegender, durch die Verfassung garantierter Rechte ihrer Bürger ohne ersichtliche Gründe erheblich eingeschränkt.
Darunter fallen vor allem die Pressefreiheit und das Recht der Nation, über die Handlungen ihrer Regierung informiert zu werden. Dabei sagt der erste Zusatz zur amerikanischen Verfassung ganz unmissverständlich: "Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, ... welches die die Freiheit der Presse ... beschränkt ...".
Die Bush-Administration teilt nur selten Informationen über ihren "Krieg gegen den Terror" mit. Insbesondere lässt sie nur selten erkennen, auf welche Fakten sie ihre Entscheidungen stützt. Sie enthält diese Informationen nicht nur regelmäßig der Presse vor - sie verweigert dieses Wissen auch den zwei anderen Säulen der staatlichen Gewalt, den föderalen Gerichten und dem Kongress.
Die Administration reagiert auf diesbezügliche Anfragen mit Widerwillen, Verweigerung und vereinzelten Zugeständnissen, wobei sie die Kontrolle über den Informationsfluss niemals aus der Hand gibt.
Der drohende Machtmissbrauch
Diese restriktive Politik mag notwendig sein, um laufende Ermittlungen zu schützen. Sie erlaubt es der Regierung aber auch, möglicherweise peinliche Informationen über Fehler, Misserfolge und übertriebene Behauptungen zu verbergen.
Deborah Sturman, Expertin für Aktionärsklagen aus New York, bei manager-magazin.de. Einen Überblick über ihre Kolumnen finden Sie hier.
In dem Verfahren gegen Zaccarias Moussaoui, den "20. Flugzeugentführer" des 11. September 2001, hat die Bush-Administration einem Bundesgericht dargelegt, dass der Präsident als Oberbefehlshaber des Militärs allein in der Lage sei, zu entscheiden, wie der "Krieg gegen den Terror" geführt werden solle und wie viele Informationen über diesen Krieg preisgegeben werden sollen. Generalstaatsanwalt John Ashcroft behauptet, dass auch der Kongress und die Gerichte nicht bevollmächtigt sind, Entscheidungen eines Präsidenten infrage zu stellen.
Auf die Frage, wie denn die Kontrollmechanismen der Gewaltenteilung beschaffen sein sollen, die dann noch verhindern können, dass der Präsident und sein Justizministerium ihre von ihnen selbst erweiterten Machtbefugnisse missbrauchen, reagiert die Administration mit dem zynischen Hinweis auf "politische Rechenschaft": Wer mit der Politik der Bush-Administration nicht zufrieden sei, der könne ja im Jahr 2004 gegen den Präsidenten stimmen.
05.08.2003
R E C H T S - K O L U M N E
Präsident Bushs geheimnisvoller Krieg (2)
Das Recht der Wähler
Fragwürdig ist dieses Argument bereits deshalb, weil die Wähler schließlich wissen müssen, wie der Präsident seine jüngst erweiterten Machtbefugnisse benutzt, ehe sie beurteilen können, ob er diese nun missbraucht oder eben nicht.
"Krieg gegen den Terror": US-Präsident George W. Bush
Dabei liegt es bereits heute auf der Hand, dass wir über sehr viele Vorgänge nur sehr unvollständig unterrichtet sind. So gibt die Regierung etwa nur widerwillig Informationen über ihre Internierungspraktiken frei, auch dann, wenn Bundesrichter entschieden haben, dass die Regierung hier ihr Bedürfnis nach Geheimhaltung übertrieben hat.
Kurz nach dem 11. September 2001 wurden mehr als 1000 Menschen verhaftet, manche als Zeugen, manche unter Verdacht auf Verletzung der Einwanderungsgesetze, wieder anderen wurden geringfügige Verbrechen vorgeworfen (ausländische Studenten, die angeblich in Bezug auf ihre Englisch-Kenntnisse gemogelt haben).
Der Kampf der Regierung
Das Justizministerium hat sich zunächst geweigert, die Zahl der Inhaftierten, deren Namen, Aufenthaltsorte oder Haftdauer bekannt zu geben. Die Regierung hat auch erklärt, die Inhaftierten seien keine Kriegsgefangenen. Dadurch kann sie diesen das unter der Genfer Konvention festgeschriebene Recht auf Anhörung vorenthalten, ihnen also die Möglichkeit nehmen, die Gründe ihrer Festnahme zu hinterfragen.
Die Bush-Administration bezeichnet die Inhaftierten als "feindliche Kriegsteilnehmer" und argumentiert, dass diese Bezeichnung in erster Linie eine politische Entscheidung sei, die dem Präsidenten in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber im "Krieg gegen den Terror" zusteht.
Die Regierung hat energisch gegen Klagen gekämpft, die unter dem "Gesetz über Freiheit der Information" (Freedom of Information Act) erhoben wurden, um die Administration zu zwingen, Angaben über die Inhaftierungen zu veröffentlichen. Die bislang freigegebenen Informationen - beispielsweise wie viele Personen nach dem 11. September inhaftiert worden sind - sind das Resultat gerichtlichen Zwangs. Ein Gericht hat auch entschieden, dass der von der Administration vorgebrachte Bedarf an Geheimhaltung übertrieben war. 05.08.2003
R E C H T S - K O L U M N E
Präsident Bushs geheimnisvoller Krieg (3)
Seit Monaten in Haft - aber keine Anklageerhebung
Von gelegentlichen und lückenhaften Verlautbarungen der Administration abgesehen, wissen wir nicht, welche Personen auf Grund welcher Vorwürfe inhaftiert sind. Wir wissen allerdings, dass mindestens zwei US-Bürger, Yasser Hamdi und Jose Padilla, als "feindliche Kriegsteilnehmer" schon seit Monaten in Haft sind, ohne dass bislang Anklage gegen sie erhoben worden wäre. Die Administration hat bislang jeden Versuch verhindert, sie durch Anwälte repräsentieren zu lassen.
Die Regierung hat zudem versucht, geheim zu halten, wie sie von ihrem Recht auf Abschiebung Gebrauch macht, in dem sie die Abschiebungsanhörungen von 611 nach dem 11. September Inhaftierten hinter verschlossenen Türen abgehalten hat. Ein Bundesberufungsgericht hat aber entschieden, dass die Öffentlichkeit und die Presse unter dem ersten Verfassungszusatz Zugang zu Abschiebungsanhörungen haben.
"Die Demokratie stirbt hinter verschlossenen Türen"
Bei dieser Gelegenheit schrieb Richter Damon Keith: "Die Demokratie stirbt hinter verschlossenen Türen". Ein zweites Berufungsgericht der gleichen Ebene aber ist der Argumentation der Regierung gefolgt und hat entschieden, dass die Administration entscheiden kann, wann Geheimhaltung notwendig ist - und zwar im Hinblick auf sämtliche Aspekte des "Krieges gegen den Terror", selbst dann, wenn amerikanische Gerichte zu einem Schauplatz in diesem Krieg werden.
Stephen Breyer, ein Richter am amerikanischen Verfassungsgericht, hat der Administration jüngst vorgeworfen, sie würde die Gerichte in ihrer verfassungsmäßig garantierten Befugnis beeinträchtigen, die Regierung zu kontrollieren. Breyer hat daran erinnert, dass die amerikanische Verfassung auch während eines tatsächlichen oder behaupteten Krieges gilt. Zudem schreibe die Verfassung vor, dass es der Justiz obliegt, das Verhalten und die Entscheidungen der Administration im Hinblick auf Inhaftierungen und Geheimhaltung zu überprüfen. Breyer hat vorhergesagt, dass die Gerichte eine immer größere Rolle spielen würden, wenn es darum geht, die Grenzen der Verfassung festzustellen.
Die Machtverschiebung
Sicherlich existieren Umstände, die es notwendig machen, dass die Regierung in der Verborgenheit handelt. So sind sich alle Gerichte beispielsweise im Zusammenhang mit einer Abschiebungsanhörung bisher darüber einig gewesen, dass Teile einer Anhörung hinter verschlossenen Türen abgehalten werden können, wenn die Exekutive sensible Beweismittel vorlegt. Aber es obliegt den Gerichten, darüber zu entscheiden, wann und ob dies der Regierung in Abschiebungsanhörungen gestattet werden soll.
Allein die Gerichte können das Recht der Öffentlichkeit auf Information gegen die Argumente der Regierung abwiegen und entscheiden, ob Vertraulichkeit in einem Fall jeweils tatsächlich notwendig ist. Daran festzuhalten ist vor allem deshalb notwendig, da es in der politischen Natur der Regierung liegt, den Bedarf an Geheimhaltung zu überschätzen.
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0%2C2828%2…
Weshalb wurde DolbyDigital gesperrt?
Wenn WO einen User sperrt, sollten sie immer auch den
Grund dazu schreiben? Sonst ist das Ganze ja nicht
nachvollziehbar und riecht nach Zensur hinter dicken Mauern!
Vielleicht könnte man das mit dem Sperren der User
ja wie beim Fußball oder Eishocky machen.
Zuerst eine gelbe Karte - sie könnte ja hinter dem User-Namen
aufleuchten, so daß jeder sieht, daß dieser nur noch
auf Bewährung schreiben darf. Dann sollte es eine Strafe
von einigen Monaten Auszeit geben mit der Chance auf
Rückkehr unter dem alten Namen. Erst wer dann nochmals
eindeutig gegen Board-Regeln verstößt, den sollte
man das digitale Leben unter bisheriger Identität nehmen!
mfg
thefarmer
Wenn WO einen User sperrt, sollten sie immer auch den
Grund dazu schreiben? Sonst ist das Ganze ja nicht
nachvollziehbar und riecht nach Zensur hinter dicken Mauern!
Vielleicht könnte man das mit dem Sperren der User
ja wie beim Fußball oder Eishocky machen.
Zuerst eine gelbe Karte - sie könnte ja hinter dem User-Namen
aufleuchten, so daß jeder sieht, daß dieser nur noch
auf Bewährung schreiben darf. Dann sollte es eine Strafe
von einigen Monaten Auszeit geben mit der Chance auf
Rückkehr unter dem alten Namen. Erst wer dann nochmals
eindeutig gegen Board-Regeln verstößt, den sollte
man das digitale Leben unter bisheriger Identität nehmen!
mfg
thefarmer
Blix: USA beging Völkerrechtsbruch
Ex-UNO-Chefinspektor: Washington nannte keine wahren Kriegsgründe - Saddam habe keine unmittelbare Bedrohung dargestellt
Stockholm - Ungewöhnlich scharf hat der frühere UNO-Chefinspektor Hans Blix am Mittwoch das Vorgehen der US-Regierung gegen den Irak kritisiert. In einer Radiosendung des Schwedischen Rundfunks warf Blix US-Präsident George W. Bush Völkerrechtsbruch vor und zog dessen offizielle Kriegsbegründung in Zweifel.
"Ich sehe nicht, dass das Vorgehen und seine Rechtfertigung in Einklang mit der UN-Charta standen", sagte der 75 Jahre alte Schwede. Die USA hätten zudem die Autorität des Weltsicherheitsrates beschädigt. Saddam Hussein habe keine unmittelbare Bedrohung für die Nachbarstaaten des Irak oder gar die USA dargestellt.
Die Bush-Regierung müsse daher andere Gründe für die Invasion gehabt haben, "neben dem offen erklärten Ziel, Massenvernichtungswaffen zu finden und zu zerstören". Ein wichtiges Element sei mit Sicherheit das Bedürfnis der USA gewesen, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Schlagkraft zu demonstrieren.
Abfällig äußerte sich Blix besonders über das amerikanische Verteidigungsministerium. "Ich fand es befremdlich, dass diejenigen, die für ein militärisches Eingreifen waren, hundertprozentige Gewissheit über die irakischen Massenvernichtungswaffen hatten. Zugleich stellte sich heraus, dass sie null Prozent Kenntnisse darüber hatten, wo die Waffen sein sollten."
Der Sicherheitsrat hätte womöglich einer Intervention zugestimmt, sagte Blix weiter, wenn die irakische Regierung die UN-Inspektionen weiterhin verhindert hätte.
Die Waffenkontrolleure der Vereinten Nationen durften im Irak nur dreieinhalb Monate arbeiten und wurden am 18. März abgezogen - zwei Tage vor den ersten Angriffen auf Bagdad. Nach Ansicht von Blix ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass britische oder amerikanische Truppen noch verbotene Waffen im Irak finden. Sie seien nun schon länger auf der Suche als die UN-Inspektoren, sagte Blix. (APA/AP) ENDE
Ex-UNO-Chefinspektor: Washington nannte keine wahren Kriegsgründe - Saddam habe keine unmittelbare Bedrohung dargestellt
Stockholm - Ungewöhnlich scharf hat der frühere UNO-Chefinspektor Hans Blix am Mittwoch das Vorgehen der US-Regierung gegen den Irak kritisiert. In einer Radiosendung des Schwedischen Rundfunks warf Blix US-Präsident George W. Bush Völkerrechtsbruch vor und zog dessen offizielle Kriegsbegründung in Zweifel.
"Ich sehe nicht, dass das Vorgehen und seine Rechtfertigung in Einklang mit der UN-Charta standen", sagte der 75 Jahre alte Schwede. Die USA hätten zudem die Autorität des Weltsicherheitsrates beschädigt. Saddam Hussein habe keine unmittelbare Bedrohung für die Nachbarstaaten des Irak oder gar die USA dargestellt.
Die Bush-Regierung müsse daher andere Gründe für die Invasion gehabt haben, "neben dem offen erklärten Ziel, Massenvernichtungswaffen zu finden und zu zerstören". Ein wichtiges Element sei mit Sicherheit das Bedürfnis der USA gewesen, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 Schlagkraft zu demonstrieren.
Abfällig äußerte sich Blix besonders über das amerikanische Verteidigungsministerium. "Ich fand es befremdlich, dass diejenigen, die für ein militärisches Eingreifen waren, hundertprozentige Gewissheit über die irakischen Massenvernichtungswaffen hatten. Zugleich stellte sich heraus, dass sie null Prozent Kenntnisse darüber hatten, wo die Waffen sein sollten."
Der Sicherheitsrat hätte womöglich einer Intervention zugestimmt, sagte Blix weiter, wenn die irakische Regierung die UN-Inspektionen weiterhin verhindert hätte.
Die Waffenkontrolleure der Vereinten Nationen durften im Irak nur dreieinhalb Monate arbeiten und wurden am 18. März abgezogen - zwei Tage vor den ersten Angriffen auf Bagdad. Nach Ansicht von Blix ist es zunehmend unwahrscheinlich, dass britische oder amerikanische Truppen noch verbotene Waffen im Irak finden. Sie seien nun schon länger auf der Suche als die UN-Inspektoren, sagte Blix. (APA/AP) ENDE
FRUST DER US-SOLDATEN IM IRAK
"Schießt auf mich, damit ich nach Hause komme!"
Von Markus Deggerich, Bagdad
Selbstgebastelte Bomben in Getränkedosen, im Schleier versteckte Granaten, Angriffe aus Krankenhäusern und Schulen: Die US-Soldaten im Irak fürchten täglich um ihr Leben. Sie fühlen sich verraten und verkauft. Ihre Wut richtet sich gen Washington.
DPA
Frust auf beiden Seiten: Dialog auf irakisch
Bagdad - Joseph Charles Taylor hatte ruhig geschlafen, als er am frühen Morgen seine Unterkunft 50 Kilometer nordwestlich von Bagdad verließ. Er stand vor dem improvisierten Mannschaftsschlafsaal, räkelte sich und stolperte dabei fast über drei Granaten auf dem Boden vor ihm. "Ich dachte erst, dass seien Äpfel", erzählt er. Aber es war ein fehlgegangener Anschlag auf sein Leben. Zwei Meter weiter steht sein Feldbett. Neben seiner Unterkunft ist eine Mauer, dahinter eine Schule. Er ist sich sicher, dass dort von einem Fenster aus versucht wurde, in der Nacht sein Leben zu beenden. "Die Attacken werden immer raffinierter und hinterhältiger", sagt er.
Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht US-Soldaten Opfer von Anschlägen im Irak werden. Neben der Hitze und der Erschöpfung für jene, die nun schon seit Monaten fern der Heimat leben, verschärft die Angst den Stress der meist sehr jungen Männer und Frauen. Das steigert ihre Nervosität. Und ihre Aggressivität.
IN SPIEGEL ONLINE
· Irak: Polizei zerschlägt vier Kidnapper-Ringe (05.08.2003)
· Irak: Mysteriöse Todesfälle bei US-Soldaten (05.08.2003)
· Irak: US-Soldaten nehmen mutmaßlichen Attentäter fest (06.08.2003)
· US-Zivilverwaltung im Irak: Die Vertrauensfrage (06.08.2003)
· Leben und Sterben im Irak: Der Tod des Henkers (30.07.2003)
Die Mitglieder US-Kongress` erhalten in diesen Tagen bergeweise Post aus dem Irak. "Danke sehr, dass Sie unseren Einsatz für Frieden und Freiheit so stark unterstützen", heißt es im Schreiben eines amerikanischen Soldaten an einen republikanischen Parteifreund von Präsident George W. Bush. "Aber wissen Sie was? Ich will nach Hause!"
Der Briefschreiber gehört zur 3. Infanterie-Division, die als erstes in den Irak einmarschierte und kämpfte. Nach dem Ende der Kampfhandlungen kommt ihr nach Hause, hatte man ihnen versprochen. Aber ihr Chef Donald Rumsfeld hat es sich dann anders überlegt. Wegen der unsicheren Lage im Zweistromland will er auf diese speziell für das Töten trainierten Kräfte nicht verzichten. 9000 Soldaten dieser besonders belasteten Division erfuhren nun, dass sie nicht, wie versprochen, spätestens im September nach Hause fahren, sondern in die besonders gefährliche Gegend rund um Falludscha verlegt werden. Ende des Einsatzes: offen.
Moral am Boden
Das drückt auf die Moral der Truppe, in der sich viele nicht als Besatzer empfinden, sondern als Besatzte. Sie igeln sich in ihren Camps ein, weil draußen an jeder Ecke Gefahr lauert. Mit Panzerfäusten attackieren Widerstandskämpfer Transportfahrzeuge und Patroullien, in jedem Haus kann ein Scharfschütze hocken. Und die Methoden werden immer perfider: Eine Frau verbarg in ihrem langen Gewand vier Granaten als sie auf einen Checkpoint zuging, bei Händlern am Wegesrand wurden selbstgebastelte Bomben in Getränkedosen gefunden, Soldaten, die ein Kinderkrankenhaus bewachten, wurden aus einem Krankenzimmer mit Granaten beworfen. Jeder Amerikaner wird zur Zielscheibe, sie fühlen sich als "dead man walking".
Die Soldaten zeigen zunehmend Stress-Symptome wie Schlaflosigkeit, kaum Appetit, Heulkrämpfe, Apathie und unkontrollierte Gefühlsausbrüche. Immer häufiger kommt es vor, dass sie sich auch gegenseitig anschreien oder gegenüber den Irakern die Fassung verlieren. Wenn nichts mehr sicher ist, wird jeder verdächtig - und der Finger am Abzug nervös.
Psychologen im Einsatz
"Sie sprechen sich gegenüber jedem aus, der zuhören will", zitierte der "Christian Science Monitor" einen Offizier. "Sie schreiben Briefe, sie weinen, sie brüllen herum. Viele von ihnen laufen mit sichtbar müden und deprimierten Gesichtern herum". Sie fühlen sich wie Schachfiguren in einem Spiel, in dem sie nichts über den nächsten Zug wissen.
Die Unterstützung der Verantwortlichen kommt nur zögerlich. Härte gilt als Ehre, Gefühle sind Schwäche. Aber jetzt sind auch die ersten Psychiater im Irak-Einsatz. Oberst Robert Knapp gehört dazu. Und seine Berichte sind alarmierend. Denn es geht nicht nur um verzögerte Reaktionen auf die Kämpfe im Krieg, die als Albträume und wiederkehrende Bilder von Blut und toten Menschen die Soldaten quälen. "Auch der operative Stress fordert seinen Zoll", sagt Knapp. Gemeint sind damit die Auswirkungen der anhaltenden Attacken aus dem Hinterhalt auf die Amerikaner, das Gefühl, im Irak gar nicht erwünscht zu sein.
"Die Soldaten der ersten Stunde hatten es hier leichter", sagte Soldat Joseph Taylor dem "Wall Street Journal". Deren Feind sei eindeutig gewesen. Doch die aktuelle Gefahr sei undefinierbar: "Es lächelt dich einer an, umarmt dich, und rammt dabei sein Messer in deinen Rücken". Der Frust der Soldaten wird auch zum Problem für Bush an der Heimatfront. Denn die amerikanischen Medien greifen zunehmend die Sorgen ihrer Landsleute auf - und die klingen sehr wütend:
AP
Nervöser Finger am Abzug: Stresssymptome
Clinton Deitz, Soldat einer Spezialeinheit, erklärte in den ABC-Nachrichten: "Wenn Donald Rumsfeld hier wäre, würde ich ihn auffordern zurückzutreten." Sergeant Felipe Vega sagte, er fühle sich "in den Unterleib getreten und ins Gesicht geschlagen". Der Soldat Jayson Punyhotra erklärte, dass "mich das ziemlich stark das Vertrauen in die Armee verlieren lässt". Ein Soldat, der seinen Namen nicht bekannt geben wollte, sagte den Reportern von ABC unter Verweis auf die an die Soldaten ausgehändigten Kartenstapel, die die Bilder der am meistgesuchten irakischen Führer enthalten, dass "ich meine eigene `Liste der Meistgesuchten` habe. In meinem Kartenstapel sind Paul Bremer, Donald Rumsfeld, George Bush und Paul Wolfowitz die Asse." Sergeant Siphon Pahn sagte der Los Angeles Times : "Sagt Donald Rumsfeld, dass die 2. Brigade in Falludscha festsitzt und dass wir sehr wütend sind." Ein anderer Soldat äußerte gegenüber derselben Zeitung: "Die Leute sagen, dass Rumsfeld zurücktreten soll." Das Time-Magazine titelte: "Peace is ehll". Und Sergeant Eric Wright sagte gegenüber BBC News : "Wir sind derart erschöpft, dass einige schon hoffen, verwundet zu werden. `Hey schießt auf mich, damit ich nach Hause komme.`"
500 Dollar für eine Rakete
Die Reaktionen der US-Streitkräfte sind hilflos, sie schwanken zwischen Härte und Verhandlung. In der Anbar-Provinz im Westen des Iraks hat die US-Armee für jede abgelieferte schultergestützte Flugabwehr-Rakete eine Prämie von 500 Dollar ausgelobt. Die Ausbeute ist bisher Null. In der Provinz liegen auch die Städte Ramadi und Falludscha. Sie sind die Brennpunkte im so genannten sunnitischen Dreieck im Norden und Westen von Bagdad, wo viele Einheimische öffentlich den gestürzten Präsidenten Saddam Hussein unterstützen.
Die Gefahr ist vielfältig. Es gibt die Einzeltäter und schlicht Kriminelle. Aber auch die politisch motivierten, die immer noch an Saddam glauben. Dazu kommen religiöse Fundamentalisten und gezielt aus dem Ausland eingeschleuste Terroristen, die die Situation weiter destabilisieren sollen. Die US-Armee hat bereits Afghanen, Saudis, Syrer, Jordanier, Palästinenser und Pakistanis verhaftet, was bei den US-Chefs den Verdacht nährt, dass sich ein Netzwerk gründet, sei es von al-Qaida gesteuert oder einer islamistischen Internationale.
Kultureller Graben
Die Iraker hingegen werfen den Amerikanern vor, mit ihrem Verhalten den Hass auf die Besatzer zu nähren. Die US-Offiziere sähen das Verhalten von Gläubigen viel zu oft als religiösen Fanatismus an, beklagt sich Abdel Asis al Nasrawi, stellvertretender Gouverneur von Kerbela, der Heiligen Stadt der Schiiten. "Es ist noch nicht richtig, den Dschihad auszurufen", sagt Scheich Abdel Mahdi Abdel Amir, der eine der großen Schiitengruppen im Land anführt. "Derzeit fordern wir noch auf friedlichem Weg eine Verfassung und eine Regierung mit Volksvertretern. Aber wenn auf diese Forderungen nicht eingegangen wird, wird sich das ändern."
Die Schiiten werfen den Amerikanern vor, mit Pornografie und der Anwerbung von Prostituierten die jungen Menschen zu verderben. Zu glauben, die Anschläge seien allein auf Ewiggestrige zurückzuführen, sei ein folgenreicher Irrtum. Die Schiiten, die die Mehrheit der Bevölkerung stellen, verkünden: "Im Zweifel kämpfen wir gegen die Überreste des entmachteten Saddam-Regimes als auch gegen die ausländischen Besatzer".
Die US-Soldaten hoffen, möglichst schnell abgelöst zu werden. Die deutlich ruhigere Situation im Süden des Landes, wo die Briten das Sagen haben, zeigt ihnen, dass sich das Feindbild und damit das Ziel für Angriffe auf alles Amerikanische festgelegt hat. Das beunruhigt nicht nur die 140.000 US-Soldaten. Ungarn erwägt bereits einen Rückzug seiner Soldaten aus dem Irak, falls es dort zu "kriegerischen Situationen" kommen sollte, wie der ungarische Verteidigungsminister Ferenc Juhasz sagte. Die Uniformen der Ungarn sehen denen der Amerikaner zum Verwechseln ähnlich.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,260223,00.html
"Schießt auf mich, damit ich nach Hause komme!"
Von Markus Deggerich, Bagdad
Selbstgebastelte Bomben in Getränkedosen, im Schleier versteckte Granaten, Angriffe aus Krankenhäusern und Schulen: Die US-Soldaten im Irak fürchten täglich um ihr Leben. Sie fühlen sich verraten und verkauft. Ihre Wut richtet sich gen Washington.
DPA
Frust auf beiden Seiten: Dialog auf irakisch
Bagdad - Joseph Charles Taylor hatte ruhig geschlafen, als er am frühen Morgen seine Unterkunft 50 Kilometer nordwestlich von Bagdad verließ. Er stand vor dem improvisierten Mannschaftsschlafsaal, räkelte sich und stolperte dabei fast über drei Granaten auf dem Boden vor ihm. "Ich dachte erst, dass seien Äpfel", erzählt er. Aber es war ein fehlgegangener Anschlag auf sein Leben. Zwei Meter weiter steht sein Feldbett. Neben seiner Unterkunft ist eine Mauer, dahinter eine Schule. Er ist sich sicher, dass dort von einem Fenster aus versucht wurde, in der Nacht sein Leben zu beenden. "Die Attacken werden immer raffinierter und hinterhältiger", sagt er.
Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht US-Soldaten Opfer von Anschlägen im Irak werden. Neben der Hitze und der Erschöpfung für jene, die nun schon seit Monaten fern der Heimat leben, verschärft die Angst den Stress der meist sehr jungen Männer und Frauen. Das steigert ihre Nervosität. Und ihre Aggressivität.
IN SPIEGEL ONLINE
· Irak: Polizei zerschlägt vier Kidnapper-Ringe (05.08.2003)
· Irak: Mysteriöse Todesfälle bei US-Soldaten (05.08.2003)
· Irak: US-Soldaten nehmen mutmaßlichen Attentäter fest (06.08.2003)
· US-Zivilverwaltung im Irak: Die Vertrauensfrage (06.08.2003)
· Leben und Sterben im Irak: Der Tod des Henkers (30.07.2003)
Die Mitglieder US-Kongress` erhalten in diesen Tagen bergeweise Post aus dem Irak. "Danke sehr, dass Sie unseren Einsatz für Frieden und Freiheit so stark unterstützen", heißt es im Schreiben eines amerikanischen Soldaten an einen republikanischen Parteifreund von Präsident George W. Bush. "Aber wissen Sie was? Ich will nach Hause!"
Der Briefschreiber gehört zur 3. Infanterie-Division, die als erstes in den Irak einmarschierte und kämpfte. Nach dem Ende der Kampfhandlungen kommt ihr nach Hause, hatte man ihnen versprochen. Aber ihr Chef Donald Rumsfeld hat es sich dann anders überlegt. Wegen der unsicheren Lage im Zweistromland will er auf diese speziell für das Töten trainierten Kräfte nicht verzichten. 9000 Soldaten dieser besonders belasteten Division erfuhren nun, dass sie nicht, wie versprochen, spätestens im September nach Hause fahren, sondern in die besonders gefährliche Gegend rund um Falludscha verlegt werden. Ende des Einsatzes: offen.
Moral am Boden
Das drückt auf die Moral der Truppe, in der sich viele nicht als Besatzer empfinden, sondern als Besatzte. Sie igeln sich in ihren Camps ein, weil draußen an jeder Ecke Gefahr lauert. Mit Panzerfäusten attackieren Widerstandskämpfer Transportfahrzeuge und Patroullien, in jedem Haus kann ein Scharfschütze hocken. Und die Methoden werden immer perfider: Eine Frau verbarg in ihrem langen Gewand vier Granaten als sie auf einen Checkpoint zuging, bei Händlern am Wegesrand wurden selbstgebastelte Bomben in Getränkedosen gefunden, Soldaten, die ein Kinderkrankenhaus bewachten, wurden aus einem Krankenzimmer mit Granaten beworfen. Jeder Amerikaner wird zur Zielscheibe, sie fühlen sich als "dead man walking".
Die Soldaten zeigen zunehmend Stress-Symptome wie Schlaflosigkeit, kaum Appetit, Heulkrämpfe, Apathie und unkontrollierte Gefühlsausbrüche. Immer häufiger kommt es vor, dass sie sich auch gegenseitig anschreien oder gegenüber den Irakern die Fassung verlieren. Wenn nichts mehr sicher ist, wird jeder verdächtig - und der Finger am Abzug nervös.
Psychologen im Einsatz
"Sie sprechen sich gegenüber jedem aus, der zuhören will", zitierte der "Christian Science Monitor" einen Offizier. "Sie schreiben Briefe, sie weinen, sie brüllen herum. Viele von ihnen laufen mit sichtbar müden und deprimierten Gesichtern herum". Sie fühlen sich wie Schachfiguren in einem Spiel, in dem sie nichts über den nächsten Zug wissen.
Die Unterstützung der Verantwortlichen kommt nur zögerlich. Härte gilt als Ehre, Gefühle sind Schwäche. Aber jetzt sind auch die ersten Psychiater im Irak-Einsatz. Oberst Robert Knapp gehört dazu. Und seine Berichte sind alarmierend. Denn es geht nicht nur um verzögerte Reaktionen auf die Kämpfe im Krieg, die als Albträume und wiederkehrende Bilder von Blut und toten Menschen die Soldaten quälen. "Auch der operative Stress fordert seinen Zoll", sagt Knapp. Gemeint sind damit die Auswirkungen der anhaltenden Attacken aus dem Hinterhalt auf die Amerikaner, das Gefühl, im Irak gar nicht erwünscht zu sein.
"Die Soldaten der ersten Stunde hatten es hier leichter", sagte Soldat Joseph Taylor dem "Wall Street Journal". Deren Feind sei eindeutig gewesen. Doch die aktuelle Gefahr sei undefinierbar: "Es lächelt dich einer an, umarmt dich, und rammt dabei sein Messer in deinen Rücken". Der Frust der Soldaten wird auch zum Problem für Bush an der Heimatfront. Denn die amerikanischen Medien greifen zunehmend die Sorgen ihrer Landsleute auf - und die klingen sehr wütend:
AP
Nervöser Finger am Abzug: Stresssymptome
Clinton Deitz, Soldat einer Spezialeinheit, erklärte in den ABC-Nachrichten: "Wenn Donald Rumsfeld hier wäre, würde ich ihn auffordern zurückzutreten." Sergeant Felipe Vega sagte, er fühle sich "in den Unterleib getreten und ins Gesicht geschlagen". Der Soldat Jayson Punyhotra erklärte, dass "mich das ziemlich stark das Vertrauen in die Armee verlieren lässt". Ein Soldat, der seinen Namen nicht bekannt geben wollte, sagte den Reportern von ABC unter Verweis auf die an die Soldaten ausgehändigten Kartenstapel, die die Bilder der am meistgesuchten irakischen Führer enthalten, dass "ich meine eigene `Liste der Meistgesuchten` habe. In meinem Kartenstapel sind Paul Bremer, Donald Rumsfeld, George Bush und Paul Wolfowitz die Asse." Sergeant Siphon Pahn sagte der Los Angeles Times : "Sagt Donald Rumsfeld, dass die 2. Brigade in Falludscha festsitzt und dass wir sehr wütend sind." Ein anderer Soldat äußerte gegenüber derselben Zeitung: "Die Leute sagen, dass Rumsfeld zurücktreten soll." Das Time-Magazine titelte: "Peace is ehll". Und Sergeant Eric Wright sagte gegenüber BBC News : "Wir sind derart erschöpft, dass einige schon hoffen, verwundet zu werden. `Hey schießt auf mich, damit ich nach Hause komme.`"
500 Dollar für eine Rakete
Die Reaktionen der US-Streitkräfte sind hilflos, sie schwanken zwischen Härte und Verhandlung. In der Anbar-Provinz im Westen des Iraks hat die US-Armee für jede abgelieferte schultergestützte Flugabwehr-Rakete eine Prämie von 500 Dollar ausgelobt. Die Ausbeute ist bisher Null. In der Provinz liegen auch die Städte Ramadi und Falludscha. Sie sind die Brennpunkte im so genannten sunnitischen Dreieck im Norden und Westen von Bagdad, wo viele Einheimische öffentlich den gestürzten Präsidenten Saddam Hussein unterstützen.
Die Gefahr ist vielfältig. Es gibt die Einzeltäter und schlicht Kriminelle. Aber auch die politisch motivierten, die immer noch an Saddam glauben. Dazu kommen religiöse Fundamentalisten und gezielt aus dem Ausland eingeschleuste Terroristen, die die Situation weiter destabilisieren sollen. Die US-Armee hat bereits Afghanen, Saudis, Syrer, Jordanier, Palästinenser und Pakistanis verhaftet, was bei den US-Chefs den Verdacht nährt, dass sich ein Netzwerk gründet, sei es von al-Qaida gesteuert oder einer islamistischen Internationale.
Kultureller Graben
Die Iraker hingegen werfen den Amerikanern vor, mit ihrem Verhalten den Hass auf die Besatzer zu nähren. Die US-Offiziere sähen das Verhalten von Gläubigen viel zu oft als religiösen Fanatismus an, beklagt sich Abdel Asis al Nasrawi, stellvertretender Gouverneur von Kerbela, der Heiligen Stadt der Schiiten. "Es ist noch nicht richtig, den Dschihad auszurufen", sagt Scheich Abdel Mahdi Abdel Amir, der eine der großen Schiitengruppen im Land anführt. "Derzeit fordern wir noch auf friedlichem Weg eine Verfassung und eine Regierung mit Volksvertretern. Aber wenn auf diese Forderungen nicht eingegangen wird, wird sich das ändern."
Die Schiiten werfen den Amerikanern vor, mit Pornografie und der Anwerbung von Prostituierten die jungen Menschen zu verderben. Zu glauben, die Anschläge seien allein auf Ewiggestrige zurückzuführen, sei ein folgenreicher Irrtum. Die Schiiten, die die Mehrheit der Bevölkerung stellen, verkünden: "Im Zweifel kämpfen wir gegen die Überreste des entmachteten Saddam-Regimes als auch gegen die ausländischen Besatzer".
Die US-Soldaten hoffen, möglichst schnell abgelöst zu werden. Die deutlich ruhigere Situation im Süden des Landes, wo die Briten das Sagen haben, zeigt ihnen, dass sich das Feindbild und damit das Ziel für Angriffe auf alles Amerikanische festgelegt hat. Das beunruhigt nicht nur die 140.000 US-Soldaten. Ungarn erwägt bereits einen Rückzug seiner Soldaten aus dem Irak, falls es dort zu "kriegerischen Situationen" kommen sollte, wie der ungarische Verteidigungsminister Ferenc Juhasz sagte. Die Uniformen der Ungarn sehen denen der Amerikaner zum Verwechseln ähnlich.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,260223,00.html
Sodele, Demo "Freihet für Dolby", so nicht

06. August 2003, 14:37
Überwachung in den USA
Gefangen in der Matrix
In der Folge der Terroranschläge des 11. September 2001 ging der Datenschutz zum Teufel. Heute wird im "land of the free" hemmungslos gelauscht und überwacht. Jetzt soll eine neue gigantische Datenbank mit Informationen über Millionen von Amerikanern gefüttert werden. Ihr Name: Die Matrix.
Keine drei Wochen ist es her, als der US-Senat einem monströsen Schnüffel-Programm den Geldhahn zudrehte: "Terrorism Information Awareness", eines der Lieblingsprojekte von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, wird - wenn überhaupt - nur noch stark begrenzt verwirklicht werden.
Nun proben die Freunde der totalen Überwachung offenbar die Revolution von unten: Was auf Bundesebene nicht gelang, soll nun in einzelnen US-Staaten realisiert werden. Die "Matrix", kurz für "Multistate Anti-Terrorism Information Exchange", soll einem Bericht der "Washington Post" zufolge Milliarden von Datensätzen enthalten, eine Melange aus Beständen der Polizei und kommerziell erhältlichen Informationen über Einzelpersonen.
Datenbanken sollen alles und jeden erfassen
Damit wären nicht nur Kriminelle, sondern auch jeder andere Bürger in der "Matrix" erfasst. Künftig soll es etwa möglich sein, augenblicklich die Namen und Adressen aller braunhaarigen Besitzer eines roten Ford-Trucks im Umkreis von 30 Kilometern eines Tatorts zu finden. "Das System arbeitet genauso wie die Strafverfolgung früherer Tage, es ist nur viel schneller", erklärte ein Mitarbeiter des US-Unternehmens Seisint, das die "Matrix" entwickelte - und es dem Staat Florida anschließend schenkte.
Die Strafverfolger in anderen Bundesstaaten lecken sich bereits die Finger nach dem neuen System. "Wir haben es anderen Staaten gezeigt, und die sind ganz verrückt geworden", sagte Seisint-Gründer Hank Asher. Die Strafverfolger in mehr als einem Dutzend Staaten haben laut "Washington Post" bereits angekündigt, den Kollegen in Florida ihre Datenbanken zur Verfügung zu stellen.
Verschiedene US-Bundesbehörden unterstützen diese Bemühungen nach Kräften - und unterlaufen damit die Politik des Washingtoner Kongresses, landesweite Überwachungssysteme einzuschränken. Mit acht Millionen Dollar will die US-Heimatschutzbehörde laut "Washington Post" Pilotprojekte in Virginia, Maryland, Pennsylvania und New York ankurbeln. Das US-Justizministerium unter Leitung des ultrakonservativen John Ashcroft hat dem Bericht zufolge vier Millionen Dollar bereitgestellt, um die "Matrix" auf die gesamten USA auszudehnen.
Erinnerungen an Rumsfelds Spitzel-Programm
Das erklärte Ziel der "Matrix" ist das schnelle Erkennen von Verhaltensmustern und Querverbindungen zwischen Menschen. Damit ähnelt es frappierend dem vom Senat ausgebremsten "Terrorism Information Awareness"-Programm - auch wenn es in kleinerem Maßstab, nämlich nicht weltweit, operieren soll.
Die Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der die "Matrix" Informationen über alle möglichen Personen zugänglich macht, löste nicht nur Proteste von Bürgerrechtsgruppen aus, sondern sorgt selbst unter Beamten für Unbehagen. Ein ranghoher Regierungsmitarbeiter, der die Entwicklung des Systems begleitet, räumte gegenüber der "Washington Post" ein, dass die "Matrix" tief in die Privatsphäre der Bürger eindringen könnte. "Ich kann alles über jemanden herausfinden", sagte Phil Ramer, Geheimdienstler in Florida. "Es ist beängstigend, und es könnte missbraucht werden." Das größte Problem sei derzeit, dass "jeder, der davon hört, das System haben will".
So durchsichtig der Bürger in der "Matrix" erscheinen würde, so zwielichtig ist der Entwickler des Systems. Seisint-Gründer Asher, der mit der Informationsbeschaffung über Individuen Millionen verdiente, ist so etwas wie der erste Hilfssheriff der USA. Er stellte dem Staat Florida nicht nur die "Matrix" kostenlos zur Verfügung, sondern arbeitete auch gratis für die US-Geheimdienste. Die wiederum lobten ihn öffentlich dafür, dass er nach dem 11. September 2001 Hinweise auf die Terror-Piloten der al-Qaida lieferte. Der Lohn ist offenbar die Freundschaft der Schlapphüte: Brian Stafford, früherer Chef des Secret Service, arbeitet laut "Washington Post" mittlerweile als leitender Angestellter bei Seisint.
Top-Informant war Drogenschmuggler
Allerdings haben US-Behörden nicht nur gute Erfahrungen mit Asher gemacht. 1999 beendeten das FBI und die Drogenfahnder von der Drug Enforcement Administration abrupt die Zusammenarbeit mit Ashers früherem Unternehmen DBT Online. Der Unternehmer hatte sich als Ex-Drogenschmuggler entpuppt - und wandelte sich später zum Spitzel für die Ermittler.
Ashers Freundschaft zu den Behörden taten solche Episoden offenbar keinen Abbruch. Der Millionär gilt als enger Freund von James T. Moore, der bis vergangenen Monat Chef der Strafverfolgungsbehörde in Florida war - und von Ashers Vergangenheit wusste, wie eine Justizsprecherin gegenüber Zeitungen einräumte. Im gleichen Atemzug aber nahm sie Asher in Schutz, denn schließlich habe der Unternehmer wegen der Drogen-Geschichte nie im Gefängnis gesessen. Die Politiker in Florida sind damit offenbar zufrieden. So zufrieden, dass sie Asher nicht mehr kostenlos für sich arbeiten lassen wollen. Das Parlament stellte jetzt 1,6 Millionen Dollar bereit, um Seisint zu bezahlen.
Markus Becker
URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,260175,00.html

syr:O

06. August 2003, 14:37
Überwachung in den USA
Gefangen in der Matrix
In der Folge der Terroranschläge des 11. September 2001 ging der Datenschutz zum Teufel. Heute wird im "land of the free" hemmungslos gelauscht und überwacht. Jetzt soll eine neue gigantische Datenbank mit Informationen über Millionen von Amerikanern gefüttert werden. Ihr Name: Die Matrix.
Keine drei Wochen ist es her, als der US-Senat einem monströsen Schnüffel-Programm den Geldhahn zudrehte: "Terrorism Information Awareness", eines der Lieblingsprojekte von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, wird - wenn überhaupt - nur noch stark begrenzt verwirklicht werden.
Nun proben die Freunde der totalen Überwachung offenbar die Revolution von unten: Was auf Bundesebene nicht gelang, soll nun in einzelnen US-Staaten realisiert werden. Die "Matrix", kurz für "Multistate Anti-Terrorism Information Exchange", soll einem Bericht der "Washington Post" zufolge Milliarden von Datensätzen enthalten, eine Melange aus Beständen der Polizei und kommerziell erhältlichen Informationen über Einzelpersonen.
Datenbanken sollen alles und jeden erfassen
Damit wären nicht nur Kriminelle, sondern auch jeder andere Bürger in der "Matrix" erfasst. Künftig soll es etwa möglich sein, augenblicklich die Namen und Adressen aller braunhaarigen Besitzer eines roten Ford-Trucks im Umkreis von 30 Kilometern eines Tatorts zu finden. "Das System arbeitet genauso wie die Strafverfolgung früherer Tage, es ist nur viel schneller", erklärte ein Mitarbeiter des US-Unternehmens Seisint, das die "Matrix" entwickelte - und es dem Staat Florida anschließend schenkte.
Die Strafverfolger in anderen Bundesstaaten lecken sich bereits die Finger nach dem neuen System. "Wir haben es anderen Staaten gezeigt, und die sind ganz verrückt geworden", sagte Seisint-Gründer Hank Asher. Die Strafverfolger in mehr als einem Dutzend Staaten haben laut "Washington Post" bereits angekündigt, den Kollegen in Florida ihre Datenbanken zur Verfügung zu stellen.
Verschiedene US-Bundesbehörden unterstützen diese Bemühungen nach Kräften - und unterlaufen damit die Politik des Washingtoner Kongresses, landesweite Überwachungssysteme einzuschränken. Mit acht Millionen Dollar will die US-Heimatschutzbehörde laut "Washington Post" Pilotprojekte in Virginia, Maryland, Pennsylvania und New York ankurbeln. Das US-Justizministerium unter Leitung des ultrakonservativen John Ashcroft hat dem Bericht zufolge vier Millionen Dollar bereitgestellt, um die "Matrix" auf die gesamten USA auszudehnen.
Erinnerungen an Rumsfelds Spitzel-Programm
Das erklärte Ziel der "Matrix" ist das schnelle Erkennen von Verhaltensmustern und Querverbindungen zwischen Menschen. Damit ähnelt es frappierend dem vom Senat ausgebremsten "Terrorism Information Awareness"-Programm - auch wenn es in kleinerem Maßstab, nämlich nicht weltweit, operieren soll.
Die Geschwindigkeit und Leichtigkeit, mit der die "Matrix" Informationen über alle möglichen Personen zugänglich macht, löste nicht nur Proteste von Bürgerrechtsgruppen aus, sondern sorgt selbst unter Beamten für Unbehagen. Ein ranghoher Regierungsmitarbeiter, der die Entwicklung des Systems begleitet, räumte gegenüber der "Washington Post" ein, dass die "Matrix" tief in die Privatsphäre der Bürger eindringen könnte. "Ich kann alles über jemanden herausfinden", sagte Phil Ramer, Geheimdienstler in Florida. "Es ist beängstigend, und es könnte missbraucht werden." Das größte Problem sei derzeit, dass "jeder, der davon hört, das System haben will".
So durchsichtig der Bürger in der "Matrix" erscheinen würde, so zwielichtig ist der Entwickler des Systems. Seisint-Gründer Asher, der mit der Informationsbeschaffung über Individuen Millionen verdiente, ist so etwas wie der erste Hilfssheriff der USA. Er stellte dem Staat Florida nicht nur die "Matrix" kostenlos zur Verfügung, sondern arbeitete auch gratis für die US-Geheimdienste. Die wiederum lobten ihn öffentlich dafür, dass er nach dem 11. September 2001 Hinweise auf die Terror-Piloten der al-Qaida lieferte. Der Lohn ist offenbar die Freundschaft der Schlapphüte: Brian Stafford, früherer Chef des Secret Service, arbeitet laut "Washington Post" mittlerweile als leitender Angestellter bei Seisint.
Top-Informant war Drogenschmuggler
Allerdings haben US-Behörden nicht nur gute Erfahrungen mit Asher gemacht. 1999 beendeten das FBI und die Drogenfahnder von der Drug Enforcement Administration abrupt die Zusammenarbeit mit Ashers früherem Unternehmen DBT Online. Der Unternehmer hatte sich als Ex-Drogenschmuggler entpuppt - und wandelte sich später zum Spitzel für die Ermittler.
Ashers Freundschaft zu den Behörden taten solche Episoden offenbar keinen Abbruch. Der Millionär gilt als enger Freund von James T. Moore, der bis vergangenen Monat Chef der Strafverfolgungsbehörde in Florida war - und von Ashers Vergangenheit wusste, wie eine Justizsprecherin gegenüber Zeitungen einräumte. Im gleichen Atemzug aber nahm sie Asher in Schutz, denn schließlich habe der Unternehmer wegen der Drogen-Geschichte nie im Gefängnis gesessen. Die Politiker in Florida sind damit offenbar zufrieden. So zufrieden, dass sie Asher nicht mehr kostenlos für sich arbeiten lassen wollen. Das Parlament stellte jetzt 1,6 Millionen Dollar bereit, um Seisint zu bezahlen.
Markus Becker
URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/0,1518,260175,00.html

syr:O
"Act IV- The Economy We believe the current economic situation is much worse than the official U.S. government statistics would lead you to believe. We`ve discussed in the past our view that most government economic statistics are to be taken with a huge shaker of salt. They simply can`t be trusted. This is not out of some dark and dangerous conspiracy, but out of the outdated, obsolete and ineffective methodologies used to measure and calculate all the data. The antiquated 25-50 year old econometric models still used by most government agencies are painting a picture that is lagging way behind the true state of the economy. Most calculations are but a figment of some bureaucrat’s imagination. They are riddled with all kinds of subjective adjustments, biased surveys, filters, bureaucratic interference, and "CYA" fudge factors. There are but a few government reports relatively free of such noise, the ones that are just cold hard data. We think the real state of the economy is reflected in one such recent report from the Congressional Budget Office: The CBO reported that over the last nine months, actual income tax receipts from individuals are down 6% over last year`s levels. The corporate tax take is down a staggering 15%. Total income tax receipts have dropped for three consecutive years, the first time that`s happened since the depths of the Great Depression. The modest tax rate cuts since 2000 aren`t the culprit, tax receipts are well below the CBO`s own forecasts adjusted for the rate cuts. Indeed, past tax rate cuts have stimulated the economy enough so that tax revenues actually increase. The governor of Alabama has resorted to preaching his "Christian ethics" to rationalize the state`s largest rate tax hike in history. (Who says religion and politics don`t mix?"
Leider ohne Quelle .
.
syr
Leider ohne Quelle
 .
.syr
US-Hypothekenbanken zunehmend unter Druck
Eric Fry
Anleihen und Aktien hatten es letzte Woche an der Wall Street schwer. Das ist eins der kleinen schmutzigen Geheimnisse des Marktes: In den letzten Wochen waren es die Finanztitel, die die Rally am Aktienmarkt angeführt haben. Jetzt – angesichts steigender Zinsen und deshalb wegbrechender Gewinnmargen – dreht sich bei den Finanztiteln der Trend – könnte da der gesamte Aktienmarkt Probleme haben?
Auf dem Topp Mitte Juli hatte der Index der Finanztitel seit den Oktobertiefs über 45 % zugelegt – dieser Zuwachs war fast doppelt so hoch wie der des S&P 500 im gleichen Zeitraum. Aber jetzt ist dieser Sektor, der zuvor der Motor der Rallye war, mit steigenden Zinsen konfrontiert.
Als die Zinsen in den letzten Quartalen fielen, konnten die Banken jede Menge Geld verleihen. So stieg das Netto-Ergebnis der Bank of America im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 23 % – dank der auf Rekordniveau stehenden Hypothekenvergabe.
Und das Geschäftsbuch der US-Hypothekenbank Fannie Mae hat sich seit Jahresanfang um 230 Mrd. Dollar vergrößert. Doug Noland von Prudent Bear Fund`s bemerkt dazu: "Die ausstehenden Hypotheken (die Fannie Mae vergeben hat) sind um 40 % auf 1,24 Billionen Dollar gewachsen ( ...) Es gibt wenige Bereiche, in denen man eine Wachstumsrate von 40 % bei einer Basis von einer Billion Dollar finden kann."
Was wird mit diesem spektakulären, rekordverdächtigen Zuwachs des Hypothekenvolumens passieren, jetzt, wo die Rendite der 10jährigen US-Staatsanleihen in 6 Wochen von 3,07 % auf 4,39 % nach oben geschossen ist? Ich denke, ich kenne die Antwort, und sie ist nicht schön – nicht für den Finanzsektor, nicht für den gesamten Aktienmarkt.
"Also die Dinge werden interessanter", beobachtet Noland ironisch. "Die Spekulationsblase am Anleihenmarkt ist angestochen, was unsere Aufmerksamkeit auf die historisch große Spekulationsblase der Hypotheken richtet."
Die Dinge werden besonders interessant bei den beiden US-Hypothekenriesen Fannie Mae und Freddie Mac. Diese Hypothekenbanken haben Anleihen emittiert. Vor zwei Wochen hat die Europäische Zentralbank (EZB) den nationalen Zentralbanken in Europa empfohlen, vorhandene Bestände an Anleihen von Freddie Mac und Fannie Mae zurückzufahren. [ tja, blöd sind die nicht ... ]
Und auch die sonstigen Investoren haben die Anleihen von Freddie Mac und Fannie Mae schneller verkauft, als sie US-Staatsanleihen verkauft haben – was dazu geführt hat, dass die Rendite der Fannie Mae und Freddie Mac-Papiere deutlich stärker gestiegen ist als die Rendite der Staatsanleihen. Die Differenz zwischen beiden Renditen hat sich vergrößert.
Kein Unternehmen mag es gerne, wenn sich diese Differenz vergrößert, d.h. wenn die eigenen Anleihen deutlich höher als Staatsanleihen rentieren (weil das höhere Zinszahlungen für das Unternehmen bedeutet). Letzte Woche hat sich diese Differenz der 10jährigen Anleihen von Freddie Mac und Fannie Mae zu den US-Staatsanleihen aber um 22,5 Basispunkte erhöht, auf 72,5 Basispunkte (d.h., die Anleihen dieser Hypothekenbanken rentieren 0,725 % höher als vergleichbare US-Staatsanleihen).
Noland weiter: "Ich erinnere mich daran, wie sich Mitte 1999 der Renditeabstand der Telekom-Anleihen zu Staatsanleihen vergrößerte ... die Kreditvergabe wurde restriktiver und Spekulationsverluste wurden größer. Schließlich führte der Rückzug des spekulativen Kapitals aus dem Telekomsektor zu einem spektakulären Kollaps dieser Branche." [!!!]
Ich glaube, dass die sich vergrößernden Renditeabstände der Anleihen der US-Hypothekenbanken zu den US-Staatsanleihen der wichtigste Trend der heutigen Finanzmärkte sind. Diese sich vergrößernden Renditeabstände sind nicht notwendigerweise ein Indikator eines ernsthaften Problems bei den US-Hypothekenbanken. Allerdings sind sie auch nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass es KEIN ernsthaftes Problem gibt.
Wenn Fannie Mae und Freddie Mac ein Problem haben, dann hat die gesamte US-Wirtschaft ein Problem.
www.investor-verlag.de - 05.08.2003
Eric Fry
Anleihen und Aktien hatten es letzte Woche an der Wall Street schwer. Das ist eins der kleinen schmutzigen Geheimnisse des Marktes: In den letzten Wochen waren es die Finanztitel, die die Rally am Aktienmarkt angeführt haben. Jetzt – angesichts steigender Zinsen und deshalb wegbrechender Gewinnmargen – dreht sich bei den Finanztiteln der Trend – könnte da der gesamte Aktienmarkt Probleme haben?
Auf dem Topp Mitte Juli hatte der Index der Finanztitel seit den Oktobertiefs über 45 % zugelegt – dieser Zuwachs war fast doppelt so hoch wie der des S&P 500 im gleichen Zeitraum. Aber jetzt ist dieser Sektor, der zuvor der Motor der Rallye war, mit steigenden Zinsen konfrontiert.
Als die Zinsen in den letzten Quartalen fielen, konnten die Banken jede Menge Geld verleihen. So stieg das Netto-Ergebnis der Bank of America im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert um 23 % – dank der auf Rekordniveau stehenden Hypothekenvergabe.
Und das Geschäftsbuch der US-Hypothekenbank Fannie Mae hat sich seit Jahresanfang um 230 Mrd. Dollar vergrößert. Doug Noland von Prudent Bear Fund`s bemerkt dazu: "Die ausstehenden Hypotheken (die Fannie Mae vergeben hat) sind um 40 % auf 1,24 Billionen Dollar gewachsen ( ...) Es gibt wenige Bereiche, in denen man eine Wachstumsrate von 40 % bei einer Basis von einer Billion Dollar finden kann."
Was wird mit diesem spektakulären, rekordverdächtigen Zuwachs des Hypothekenvolumens passieren, jetzt, wo die Rendite der 10jährigen US-Staatsanleihen in 6 Wochen von 3,07 % auf 4,39 % nach oben geschossen ist? Ich denke, ich kenne die Antwort, und sie ist nicht schön – nicht für den Finanzsektor, nicht für den gesamten Aktienmarkt.
"Also die Dinge werden interessanter", beobachtet Noland ironisch. "Die Spekulationsblase am Anleihenmarkt ist angestochen, was unsere Aufmerksamkeit auf die historisch große Spekulationsblase der Hypotheken richtet."
Die Dinge werden besonders interessant bei den beiden US-Hypothekenriesen Fannie Mae und Freddie Mac. Diese Hypothekenbanken haben Anleihen emittiert. Vor zwei Wochen hat die Europäische Zentralbank (EZB) den nationalen Zentralbanken in Europa empfohlen, vorhandene Bestände an Anleihen von Freddie Mac und Fannie Mae zurückzufahren. [ tja, blöd sind die nicht ... ]
Und auch die sonstigen Investoren haben die Anleihen von Freddie Mac und Fannie Mae schneller verkauft, als sie US-Staatsanleihen verkauft haben – was dazu geführt hat, dass die Rendite der Fannie Mae und Freddie Mac-Papiere deutlich stärker gestiegen ist als die Rendite der Staatsanleihen. Die Differenz zwischen beiden Renditen hat sich vergrößert.
Kein Unternehmen mag es gerne, wenn sich diese Differenz vergrößert, d.h. wenn die eigenen Anleihen deutlich höher als Staatsanleihen rentieren (weil das höhere Zinszahlungen für das Unternehmen bedeutet). Letzte Woche hat sich diese Differenz der 10jährigen Anleihen von Freddie Mac und Fannie Mae zu den US-Staatsanleihen aber um 22,5 Basispunkte erhöht, auf 72,5 Basispunkte (d.h., die Anleihen dieser Hypothekenbanken rentieren 0,725 % höher als vergleichbare US-Staatsanleihen).
Noland weiter: "Ich erinnere mich daran, wie sich Mitte 1999 der Renditeabstand der Telekom-Anleihen zu Staatsanleihen vergrößerte ... die Kreditvergabe wurde restriktiver und Spekulationsverluste wurden größer. Schließlich führte der Rückzug des spekulativen Kapitals aus dem Telekomsektor zu einem spektakulären Kollaps dieser Branche." [!!!]
Ich glaube, dass die sich vergrößernden Renditeabstände der Anleihen der US-Hypothekenbanken zu den US-Staatsanleihen der wichtigste Trend der heutigen Finanzmärkte sind. Diese sich vergrößernden Renditeabstände sind nicht notwendigerweise ein Indikator eines ernsthaften Problems bei den US-Hypothekenbanken. Allerdings sind sie auch nicht notwendigerweise ein Zeichen dafür, dass es KEIN ernsthaftes Problem gibt.
Wenn Fannie Mae und Freddie Mac ein Problem haben, dann hat die gesamte US-Wirtschaft ein Problem.
www.investor-verlag.de - 05.08.2003
Das Schlimmste aus 2 Welten
Bill Bonner
Oh là là ... das wird immer interessanter. Ich rede von der Wirtschaftslage.
Der Aktienmarkt lenkt nur ab; ignorieren sie ihn. Was interessant ist, ist der Anleihenmarkt ... der Dollar ... Gold ... Japan ... und Argentinien.
Der amerikanische Anleihenmarkt setzte seinen Kollaps letzte Woche fort. Die Renditen der 10jährigen US-Staatsanleihen standen am 13. Juni bei 3,07 %. Jetzt stehen sie bei 4,40 %. Das ist das schlimmste Anleihen-Massaker seit 20 Jahren. Das ist "ein Jahrhundersturm", so Franklin Raines, Vorstandsvorsitzender der US-Hypothekenbank Fannie Mae, deren Anleihen sogar noch stärker gefallen sind als die US-Staatsanleihen.
Aber was bedeutet das?
Welchen Weg nehmen die USA ... Richtung Japan oder Richtung Argentinien? Das eine Land lebt mit einer langen, langsamen, soften Depression ... mit Deflation. Seit 1990 sind die Aktienkurse in Tokio per saldo um 80 % gefallen, womit 20 Jahre Kursgewinne in Nichts aufgelöst wurden. Jetzt könnte vielleicht der endgültige Boden erreicht sein.
Argentinien hat eine andere Art der Folter erlitten – eine Wirtschaftskrise mit einer Hyperinflation, und fast ein Drittel der Bevölkerung hat keine Arbeit. Aber auch Argentinien könnte sich bereits auf dem Pfad der Erholung befinden. In den letzten 12 Monaten hat der argentinische Peso gegenüber dem Dollar zugelegt, und die Arbeitslosenquote ist auf 15 % gefallen!
Was die USA betrifft ... ich dachte ja eigentlich, dass sie zunächst den japanischen Weg gehen würden, und danach den argentinischen. Das schien unausweichlich. Die USA sind Japan mit einer gewissen Zeitverzögerung jahrelang gefolgt; warum sollte das jetzt aufhören?
Letzte Woche gab es mehr News, die für den "japanischen Weg" der USA sprachen. In den USA ist die Zahl der Beschäftigten den 6. Monat in Folge zurückgegangen. Mehr als eine halbe Million Arbeitslose sind so entmutigt, dass sie die Suche ganz aufgegeben haben.
In den USA gingen auch die Autoverkäufe zurück. Und der Goldpreis ist etwas zurückgekommen, fast in meine Kaufzone – die bei Kursen unter 350 Dollar pro Feinunze liegt. All diese News riechen nach Sushi.
Ah, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den USA und Japan. Die japanische Volkswirtschaft wurde intern finanziert – durch eine Bevölkerung von Sparern. Die USA hängen hingegen vom Wohlwollen der ausländischen Geldgeber ab. Während die Japaner in ihren langen Abschwung auf einem Kissen von Ersparnissen gleiten konnten, haben die Amerikaner nichts, auf das sie fallen könnten – außer dem harten Beton der Schulden.
Und Tag für Tag schütten die Fed von Alan Greenspan und die US-Regierung unter George W. Bush mehr Beton auf. Greenspan hat die Leitzinsen 13 Mal gesenkt, um die Konsumenten tiefer in die Schuldenfalle zu locken. Und die US-Regierung leiht sich fast 500 Mrd. Dollar pro Jahr.
Früher oder später müssen die USA ihren Weg nach Japan aufgeben – und nach links abbiegen, Richtung Argentinien. Denn wie Argentinien – und Deutschland in den 1920ern – und anders als Japan ist Amerika gegenüber dem Rest der Welt stark verschuldet. Deshalb können sich die USA einen langen, deflationären Rückgang nicht erlauben.
Ich fragte mich, ob das große Schiff zurück in den Hafen lief, als am 14. Juni der Abschwung des US-Anleihenmarktes begann. War das nicht ein Signal dafür, dass das Ende des Beginns gekommen war ... dass der Boom am Anleihenmarkt vorüber war ... und dass jetzt Inflation, nicht Deflation, der Feind der Anleihenkäufer sein würde? Es schien plausibel genug. Aber ich zweifle inzwischen daran. Und hier wird es so lieblich ... so täuschend rasend machend ... so pervers und verrückt: Weil es jetzt so aussieht, als ob die USA jetzt die Deflation von Japan mit steigenden Zinsen bekommen werden!
Ich dachte, das wäre unmöglich ... denn wie könnte eine Wirtschaft gleichzeitig in zwei gegensätzliche Richtungen laufen? Und dennoch – das scheint es zu sein, was gerade passiert. In einem deflationären Abschwung vergrößern sich die Renditeabstände zwischen den Anleihen von guten und denen von schlechten Schuldnern. Mit anderen Worten: In einer Welt der fallenden Preise akzeptieren die Investoren bereitwillig niedrigere Renditen, aber sie machen sich Sorgen über erhöhte Kreditausfallrisiken. In einem inflationären Abschwung hingegen steigen die Zinsen am kurzen wie am langen Ende, die Renditeabstände hingegen vergrößern sich nicht. Die Investoren machen sich nicht soviel Gedanken darüber, dass die Gesellschaften Pleite gehen – sondern sie machen sich Sorgen über den realen Wert der Zins- und Tilgungszahlungen, die sie erhalten.
Derzeit haben wir steigende Renditen (bei lang- und kurzfristigen Anleihen) und gleichzeitig sich vergrößernde Renditeabstände – zur großen Verwirrung der Investoren, Volkswirte und Kommentatoren.
Stephen Roach nennt das den "ultimativen Teufelskreis". Steigende Zinsen zerstören nicht nur den Aufschwung ... sondern sie zerstören auch investiertes Vermögen der Anleihenbesitzer (steigende Renditen bedeuten schließlich fallende Anleihenkurse). Und die fallenden Preise zerstören die Unternehmensgewinne (die noch übrig sind) und Arbeitsplätze.
Könnte das sein, liebe(r) Leser(in)? Könnten die USA weder den Weg nach Japan noch den nach Argentinien einschlagen, sondern das Schlimmste aus beiden Welten mitnehmen ... Sushi mit Salsa?
Wir werden es sehen.
investor-verlag.de
Bill Bonner
Oh là là ... das wird immer interessanter. Ich rede von der Wirtschaftslage.
Der Aktienmarkt lenkt nur ab; ignorieren sie ihn. Was interessant ist, ist der Anleihenmarkt ... der Dollar ... Gold ... Japan ... und Argentinien.
Der amerikanische Anleihenmarkt setzte seinen Kollaps letzte Woche fort. Die Renditen der 10jährigen US-Staatsanleihen standen am 13. Juni bei 3,07 %. Jetzt stehen sie bei 4,40 %. Das ist das schlimmste Anleihen-Massaker seit 20 Jahren. Das ist "ein Jahrhundersturm", so Franklin Raines, Vorstandsvorsitzender der US-Hypothekenbank Fannie Mae, deren Anleihen sogar noch stärker gefallen sind als die US-Staatsanleihen.
Aber was bedeutet das?
Welchen Weg nehmen die USA ... Richtung Japan oder Richtung Argentinien? Das eine Land lebt mit einer langen, langsamen, soften Depression ... mit Deflation. Seit 1990 sind die Aktienkurse in Tokio per saldo um 80 % gefallen, womit 20 Jahre Kursgewinne in Nichts aufgelöst wurden. Jetzt könnte vielleicht der endgültige Boden erreicht sein.
Argentinien hat eine andere Art der Folter erlitten – eine Wirtschaftskrise mit einer Hyperinflation, und fast ein Drittel der Bevölkerung hat keine Arbeit. Aber auch Argentinien könnte sich bereits auf dem Pfad der Erholung befinden. In den letzten 12 Monaten hat der argentinische Peso gegenüber dem Dollar zugelegt, und die Arbeitslosenquote ist auf 15 % gefallen!
Was die USA betrifft ... ich dachte ja eigentlich, dass sie zunächst den japanischen Weg gehen würden, und danach den argentinischen. Das schien unausweichlich. Die USA sind Japan mit einer gewissen Zeitverzögerung jahrelang gefolgt; warum sollte das jetzt aufhören?
Letzte Woche gab es mehr News, die für den "japanischen Weg" der USA sprachen. In den USA ist die Zahl der Beschäftigten den 6. Monat in Folge zurückgegangen. Mehr als eine halbe Million Arbeitslose sind so entmutigt, dass sie die Suche ganz aufgegeben haben.
In den USA gingen auch die Autoverkäufe zurück. Und der Goldpreis ist etwas zurückgekommen, fast in meine Kaufzone – die bei Kursen unter 350 Dollar pro Feinunze liegt. All diese News riechen nach Sushi.
Ah, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den USA und Japan. Die japanische Volkswirtschaft wurde intern finanziert – durch eine Bevölkerung von Sparern. Die USA hängen hingegen vom Wohlwollen der ausländischen Geldgeber ab. Während die Japaner in ihren langen Abschwung auf einem Kissen von Ersparnissen gleiten konnten, haben die Amerikaner nichts, auf das sie fallen könnten – außer dem harten Beton der Schulden.
Und Tag für Tag schütten die Fed von Alan Greenspan und die US-Regierung unter George W. Bush mehr Beton auf. Greenspan hat die Leitzinsen 13 Mal gesenkt, um die Konsumenten tiefer in die Schuldenfalle zu locken. Und die US-Regierung leiht sich fast 500 Mrd. Dollar pro Jahr.
Früher oder später müssen die USA ihren Weg nach Japan aufgeben – und nach links abbiegen, Richtung Argentinien. Denn wie Argentinien – und Deutschland in den 1920ern – und anders als Japan ist Amerika gegenüber dem Rest der Welt stark verschuldet. Deshalb können sich die USA einen langen, deflationären Rückgang nicht erlauben.
Ich fragte mich, ob das große Schiff zurück in den Hafen lief, als am 14. Juni der Abschwung des US-Anleihenmarktes begann. War das nicht ein Signal dafür, dass das Ende des Beginns gekommen war ... dass der Boom am Anleihenmarkt vorüber war ... und dass jetzt Inflation, nicht Deflation, der Feind der Anleihenkäufer sein würde? Es schien plausibel genug. Aber ich zweifle inzwischen daran. Und hier wird es so lieblich ... so täuschend rasend machend ... so pervers und verrückt: Weil es jetzt so aussieht, als ob die USA jetzt die Deflation von Japan mit steigenden Zinsen bekommen werden!
Ich dachte, das wäre unmöglich ... denn wie könnte eine Wirtschaft gleichzeitig in zwei gegensätzliche Richtungen laufen? Und dennoch – das scheint es zu sein, was gerade passiert. In einem deflationären Abschwung vergrößern sich die Renditeabstände zwischen den Anleihen von guten und denen von schlechten Schuldnern. Mit anderen Worten: In einer Welt der fallenden Preise akzeptieren die Investoren bereitwillig niedrigere Renditen, aber sie machen sich Sorgen über erhöhte Kreditausfallrisiken. In einem inflationären Abschwung hingegen steigen die Zinsen am kurzen wie am langen Ende, die Renditeabstände hingegen vergrößern sich nicht. Die Investoren machen sich nicht soviel Gedanken darüber, dass die Gesellschaften Pleite gehen – sondern sie machen sich Sorgen über den realen Wert der Zins- und Tilgungszahlungen, die sie erhalten.
Derzeit haben wir steigende Renditen (bei lang- und kurzfristigen Anleihen) und gleichzeitig sich vergrößernde Renditeabstände – zur großen Verwirrung der Investoren, Volkswirte und Kommentatoren.
Stephen Roach nennt das den "ultimativen Teufelskreis". Steigende Zinsen zerstören nicht nur den Aufschwung ... sondern sie zerstören auch investiertes Vermögen der Anleihenbesitzer (steigende Renditen bedeuten schließlich fallende Anleihenkurse). Und die fallenden Preise zerstören die Unternehmensgewinne (die noch übrig sind) und Arbeitsplätze.
Könnte das sein, liebe(r) Leser(in)? Könnten die USA weder den Weg nach Japan noch den nach Argentinien einschlagen, sondern das Schlimmste aus beiden Welten mitnehmen ... Sushi mit Salsa?
Wir werden es sehen.
investor-verlag.de
Aus der führenden US-Anlegerzeitung Barron`s
US-Aktien: Lauter Schockwellen
Die Rendite der US-Staatsanleihen hat einen Riesensatz nach oben gemacht. Das gefährdet den Aufschwung an den Aktienmärkten.
Auch wenn das Wort Blase schon länger die Runde gemacht hatte unter den US-Investoren: Schneller und dramatischer, als von den meisten erwartet, kamen die Anleihepreise ins Rutschen. Sie haben die Renditen gleich um einen ganzen Prozentpunkt nach oben gejagt. Am 13. Juni war die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 3,11 Prozent und damit ihr 45-Jahres-Tief gefallen. Die Gegenbewegung der vergangenen Wochen war umso heftiger: In nur 50 Tagen sind die Renditen der Zehnjährigen auf 4,41 Prozent gestiegen; das war der schnellste Anstieg seit 1987.
Für die Investoren ist das zumeist eine schmerzhafte Erfahrung. Der Kurs der zehnjährigen US-Benchmark-Anleihe ist um 110 Dollar für die 1000-Dollar-Anleihe gesunken. Das entspricht der mühsam angesparten Rendite (Zinscoupon) aus drei Jahren. Der Kurs der 30-jährigen Staatsanleihe ist sogar um 190 Dollar abgerutscht. So viel zu den „risikolosen“ Staatsanleihen.
Bisher war die Blasenbildung auf dem Anleihemarkt bei den Aktien kaum wahrnehmbar. Aber der Anstieg der Renditen könnte nicht nur Aktienkurse, sondern auch das Wohl und Wehe der Hedge-Fonds, der Finanzindustrie und letztlich sogar der gesamten US-Wirtschaft negativ beeinflussen. Denn der Grund für den schon historisch zu nennenden Einbruch ist, dass die Anleiheinvestoren ihre Deflationsängste überwanden – und das ziemlich plötzlich und kollektiv. Sie haben scheinbar alle auf einen Schlag erkannt, dass die US-Notenbank so ziemlich alles in Kauf nehmen wird, um die Wirtschaft in Gang zu bringen – inklusive Inflation.
Bondmarktrally ein Ausreißer
„Die Robin Hoods der Anleihemärkte sind wieder unterwegs“, sagt Jim Bianco, Inhaber von Bianco Research in Chicago. Er meint, dass die Retter der Staatsanleihe deren mittel- und langfristige Renditen sogar weit genug hinauftreiben könnten, um die positiven Effekte der Niedrigzinspolitik der US-Notenbank (Fed) zunichte zu machen. Im Extremfall, so Bianco, könnte die Fed dadurch sogar gezwungen sein, die Zinsen am kurzen Ende wieder anzuheben. Derzeit hält sie die kurzfristigen Zinsen noch eisern bei knapp unter einem Prozent und damit das Geld für Investitionen billig.
Stark steigende Zinsen würden die Aktienmärkte gehörig unter Druck bringen. Zahlreiche Pensionsfonds und institutionelle Anleger orientieren sich bei Investitionsentscheidungen an Bewertungsmaßstäben, bei denen die Zinsentwicklung auf den Anleihemärkten einkalkuliert wird. Derzeit lassen viele dieser Modelle Anleiheinvestitionen günstiger erscheinen als Aktienkäufe. Selbst die Bewertungsmaßstäbe, die Aktien noch immer bessere Chancen einräumen als Anleihen, sind in ihrer Aussage nicht mehr so eindeutig wie noch vor einem Monat.
Byron Wien, leitender Investmentstratege bei Morgan Stanley, sieht in dem Renditeanstieg noch keinen Grund zur Sorge. „Ich sah die Bondmarktrally als Ausreißer. Nach meiner Einschätzung läge das normale Niveau für die zehnjährigen US-Bonds bei vier Prozent. Der Aktienmarkt wird den Anstieg verkraften, solange die zehnjährige Benchmark-Anleihe unter fünf Prozent bleibt“. Immerhin hat sich der marktbreite S&P 500-Index in den letzten beiden Monaten gehalten (siehe Grafik oben).
Finanzamt: Mehr Kontrolle bei Aktienverkäufen
Jetzt wendet sich der Beamte an die Bank, die über die Aktiengeschäfte Auskunft geben muss. Bisher liefert ihm die Bank in der Regel nur Zahlenkolonnen. Kauf- und Verkaufspreise von Wertpapiergeschäften, unsortiert und meist auch noch in Kürzeln. In aufwendiger Kleinstarbeit muss der Beamte errechnen, ob der Steuerzahler gesündigt hat. Direktbanken schicken den Beamten seitenlange Excel-Tabellen. Schlimmer noch leiden die Staatsdiener bei Hausbanken. Von ihnen erhalten sie Kisten voller unhandlicher Microfiches. Künftig würde der Beamte eine übersichtliche Gewinnaufstellung bekommen. Ohne große Probleme sieht er, ob der Anleger ehrlich war. Mit Eichels „Erleichterung der Steuererklärungen“ wäre Schluss mit dem Aufwand.
"Das sind Kontrollmitteilungen durch die Hintertüre“, schimpft Heinz-Udo Schaap, Steuerexperte des Bundesverbands deutscher Banken. Dass Eichel den Gesetzentwurf als großzügigen Bonus für den Anleger verkauft, findet er „fadenscheinig“. Und besonders auf die Palme bringt ihn, dass die Banker den Finanzbeamten die ungeliebte Arbeit abnehmen sollen. Das koste sie ein Vermögen – und sei schon steuerrechtlich fast unmöglich.
Denn das Bundesfinanzministerium fordert zwar von den Banken volle Unterstützung, hat aber bis heute nicht entschieden, nach welchen Regeln die Gewinne berechnet werden sollen. Insgesamt 17 Punkte sind offen. Beispielsweise wissen die Banker nicht, wie sie vorgehen sollen bei Aktiensplits, Fusionen, Bonusaktien, Umwandlungen von Vorzugs- in Stammaktien, Sammeldepots von Aktienclubs.
Die Liste ist lang, die Antwort des Ministeriums kurz: noch nichts entschieden. Dabei bastelt das Bundesfinanzministerium schon seit April 1999 an Lösungen.
Mit diesen Aspekten beschäftigt sich auch der neue Gesetzentwurf nicht. Dort ist nur die Anweisung an die Banken enthalten, die Verkaufsgewinne aufzulisten. Der Bankenverband hat angekündigt, er werde aus allen Kanonen gegen die Vorschrift schießen. Die CDU/CSU hingegen hat an den Kontrollen an sich nichts auszusetzen. Winfred Bernhard, Steuerexperte der Bundestagsfraktion, fragt sich aber: „Warum will die Regierung jetzt Jahresbescheinigungen einführen, obwohl sie eine Abgeltungssteuer plant?“
Denn von 2004 an sollten Banken von allen Zinseinnahmen, Dividenden und Verkaufsgewinnen ihrer Kunden einen festen Prozentsatz an Steuern abziehen. Ein Steuererklärung für die Kursgewinne wäre dann in der Regel nicht mehr nötig, Steuerhinterziehungen nicht möglich. Bleibt eine Erklärung: Eichel rechnet selbst nicht damit, dass aus der Abgeltungssteuer noch was wird.
Eine Story aus der WirtschaftsWoche 32/2003
US-Aktien: Lauter Schockwellen
Die Rendite der US-Staatsanleihen hat einen Riesensatz nach oben gemacht. Das gefährdet den Aufschwung an den Aktienmärkten.
Auch wenn das Wort Blase schon länger die Runde gemacht hatte unter den US-Investoren: Schneller und dramatischer, als von den meisten erwartet, kamen die Anleihepreise ins Rutschen. Sie haben die Renditen gleich um einen ganzen Prozentpunkt nach oben gejagt. Am 13. Juni war die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf 3,11 Prozent und damit ihr 45-Jahres-Tief gefallen. Die Gegenbewegung der vergangenen Wochen war umso heftiger: In nur 50 Tagen sind die Renditen der Zehnjährigen auf 4,41 Prozent gestiegen; das war der schnellste Anstieg seit 1987.
Für die Investoren ist das zumeist eine schmerzhafte Erfahrung. Der Kurs der zehnjährigen US-Benchmark-Anleihe ist um 110 Dollar für die 1000-Dollar-Anleihe gesunken. Das entspricht der mühsam angesparten Rendite (Zinscoupon) aus drei Jahren. Der Kurs der 30-jährigen Staatsanleihe ist sogar um 190 Dollar abgerutscht. So viel zu den „risikolosen“ Staatsanleihen.
Bisher war die Blasenbildung auf dem Anleihemarkt bei den Aktien kaum wahrnehmbar. Aber der Anstieg der Renditen könnte nicht nur Aktienkurse, sondern auch das Wohl und Wehe der Hedge-Fonds, der Finanzindustrie und letztlich sogar der gesamten US-Wirtschaft negativ beeinflussen. Denn der Grund für den schon historisch zu nennenden Einbruch ist, dass die Anleiheinvestoren ihre Deflationsängste überwanden – und das ziemlich plötzlich und kollektiv. Sie haben scheinbar alle auf einen Schlag erkannt, dass die US-Notenbank so ziemlich alles in Kauf nehmen wird, um die Wirtschaft in Gang zu bringen – inklusive Inflation.
Bondmarktrally ein Ausreißer
„Die Robin Hoods der Anleihemärkte sind wieder unterwegs“, sagt Jim Bianco, Inhaber von Bianco Research in Chicago. Er meint, dass die Retter der Staatsanleihe deren mittel- und langfristige Renditen sogar weit genug hinauftreiben könnten, um die positiven Effekte der Niedrigzinspolitik der US-Notenbank (Fed) zunichte zu machen. Im Extremfall, so Bianco, könnte die Fed dadurch sogar gezwungen sein, die Zinsen am kurzen Ende wieder anzuheben. Derzeit hält sie die kurzfristigen Zinsen noch eisern bei knapp unter einem Prozent und damit das Geld für Investitionen billig.
Stark steigende Zinsen würden die Aktienmärkte gehörig unter Druck bringen. Zahlreiche Pensionsfonds und institutionelle Anleger orientieren sich bei Investitionsentscheidungen an Bewertungsmaßstäben, bei denen die Zinsentwicklung auf den Anleihemärkten einkalkuliert wird. Derzeit lassen viele dieser Modelle Anleiheinvestitionen günstiger erscheinen als Aktienkäufe. Selbst die Bewertungsmaßstäbe, die Aktien noch immer bessere Chancen einräumen als Anleihen, sind in ihrer Aussage nicht mehr so eindeutig wie noch vor einem Monat.
Byron Wien, leitender Investmentstratege bei Morgan Stanley, sieht in dem Renditeanstieg noch keinen Grund zur Sorge. „Ich sah die Bondmarktrally als Ausreißer. Nach meiner Einschätzung läge das normale Niveau für die zehnjährigen US-Bonds bei vier Prozent. Der Aktienmarkt wird den Anstieg verkraften, solange die zehnjährige Benchmark-Anleihe unter fünf Prozent bleibt“. Immerhin hat sich der marktbreite S&P 500-Index in den letzten beiden Monaten gehalten (siehe Grafik oben).
Finanzamt: Mehr Kontrolle bei Aktienverkäufen
Jetzt wendet sich der Beamte an die Bank, die über die Aktiengeschäfte Auskunft geben muss. Bisher liefert ihm die Bank in der Regel nur Zahlenkolonnen. Kauf- und Verkaufspreise von Wertpapiergeschäften, unsortiert und meist auch noch in Kürzeln. In aufwendiger Kleinstarbeit muss der Beamte errechnen, ob der Steuerzahler gesündigt hat. Direktbanken schicken den Beamten seitenlange Excel-Tabellen. Schlimmer noch leiden die Staatsdiener bei Hausbanken. Von ihnen erhalten sie Kisten voller unhandlicher Microfiches. Künftig würde der Beamte eine übersichtliche Gewinnaufstellung bekommen. Ohne große Probleme sieht er, ob der Anleger ehrlich war. Mit Eichels „Erleichterung der Steuererklärungen“ wäre Schluss mit dem Aufwand.
"Das sind Kontrollmitteilungen durch die Hintertüre“, schimpft Heinz-Udo Schaap, Steuerexperte des Bundesverbands deutscher Banken. Dass Eichel den Gesetzentwurf als großzügigen Bonus für den Anleger verkauft, findet er „fadenscheinig“. Und besonders auf die Palme bringt ihn, dass die Banker den Finanzbeamten die ungeliebte Arbeit abnehmen sollen. Das koste sie ein Vermögen – und sei schon steuerrechtlich fast unmöglich.
Denn das Bundesfinanzministerium fordert zwar von den Banken volle Unterstützung, hat aber bis heute nicht entschieden, nach welchen Regeln die Gewinne berechnet werden sollen. Insgesamt 17 Punkte sind offen. Beispielsweise wissen die Banker nicht, wie sie vorgehen sollen bei Aktiensplits, Fusionen, Bonusaktien, Umwandlungen von Vorzugs- in Stammaktien, Sammeldepots von Aktienclubs.
Die Liste ist lang, die Antwort des Ministeriums kurz: noch nichts entschieden. Dabei bastelt das Bundesfinanzministerium schon seit April 1999 an Lösungen.
Mit diesen Aspekten beschäftigt sich auch der neue Gesetzentwurf nicht. Dort ist nur die Anweisung an die Banken enthalten, die Verkaufsgewinne aufzulisten. Der Bankenverband hat angekündigt, er werde aus allen Kanonen gegen die Vorschrift schießen. Die CDU/CSU hingegen hat an den Kontrollen an sich nichts auszusetzen. Winfred Bernhard, Steuerexperte der Bundestagsfraktion, fragt sich aber: „Warum will die Regierung jetzt Jahresbescheinigungen einführen, obwohl sie eine Abgeltungssteuer plant?“
Denn von 2004 an sollten Banken von allen Zinseinnahmen, Dividenden und Verkaufsgewinnen ihrer Kunden einen festen Prozentsatz an Steuern abziehen. Ein Steuererklärung für die Kursgewinne wäre dann in der Regel nicht mehr nötig, Steuerhinterziehungen nicht möglich. Bleibt eine Erklärung: Eichel rechnet selbst nicht damit, dass aus der Abgeltungssteuer noch was wird.
Eine Story aus der WirtschaftsWoche 32/2003
http://www.netzeitung.de/spezial/irak/250177.html
USA in der Kritik: Regierung garantiert Ölkonzernen Straffreiheit im Irak-Geschäft
07. Aug 16:10
US-Präsident Bush hat per «Executive Order» alle Geschäfte mit irakischem Öl unter juristische Immunität gestellt. Nun können sich Ölkonzerne alles leisten, beklagen Kritiker.
Dieser ebenso umständliche wie umstrittene Satz ist Kern des Präsidentendekrets 13303 vom 22. Mai 2003: «Jeder ... Gerichtsprozess ist verboten und soll für null und nichtig erklärt werden in Hinsicht auf folgende: (a) den Entwicklungsfonds für Irak und (b) irakisches Öl und alle irakischen Ölprodukte und Beteiligungen daran sowie Umsätze, Obligationen und jedes finanzielle Instrument welcher Art auch immer, die mit dem Verkauf und der Vermarktung dessen verbunden sind, Beteiligungen daran, an denen ein fremdes Land oder ein Bürger dessen irgendeinen Anteil hat, die in den Vereinigten Staaten sind, in die Vereinigten Staaten kommen oder sich jetzt oder später im Eigentum oder unter Kontrolle eines US-Bürgers befinden.»
Absolute Straffreiheit
Obwohl Präsident Bush in seiner Executive Order hinreichend detailliert dargelegt hat, welcher Umgang mit irakischem Öl weiterhin zu einem gerichtlichen Nachspiel führen kann - keiner -, bestreitet die US-Regierung intendiert zu haben, was sie damit tatsächlich verfügte: Die absolute Straffreiheit amerikanischer Ölkonzerne und anderer Geschäftsleute bei allen Transaktionen im Zusammenhang mit irakischem Rohöl und Ölprodukten. «Das Dekret schützt nicht das Geld der Ölgesellschaften, es schützt das Geld der Iraker», sagte Taylor Griffith, ein Sprecher des US-Finanzministeriums, der nachfragenden «Los Angeles Times».
Tatsächlich wird der Entwicklungsfonds für Irak, die per Sicherheitsratsbeschluss gegründete Behörde, über die der gesamte Öl-Außenhandel und die Güterimporte für Irak abgewickelt werden, an erster Stelle im Dekret genannt. Doch heißt es laut «LA Times» darin ausdrücklich, dass das Wort «Person» auch Unternehmen einschließe. Klar, sagt die Regierung dazu, die Ölgesellschaften müssen vor Klagen geschützt werden, damit der Fonds das Geld aus dem irakischen Ölgeschäft schnell und reibungslos erhalte. NGO-Vertreter wie Betsy Apple, die Anwältin der Menschenrechtsorganisation Earthrights International, mag der Regierung ihre Beteuerung aber nicht abnehmen: «Man versucht die Tatsache zu verschleiern, dass es Ölkonzerne sind, die dies Geschäft machen.»
Übers Ziel hinaus
Sie gegen Klagen komplett zu immunisieren, geht weit über den Schutz des Fonds hinaus, erklärte Tom Devine, Rechtsexperte des Government Accountability Project, einer unabhängigen Organisation, die US-Regierungen überwacht, der «Times»: So würde das das Dekret der Formulierung nach etwa auch eine Werbefirma schützen, die erlogene Eigenschaften eines über amerikanische Tankstellen vertriebenen Kraftstoffs anpreist, dessen Rohstoff aus Irak stammt. Nicht nur, dass eine Ölgesellschaft für Verbrechen im Rahmen ihres Irakgeschäfts nicht anklagbar wäre, so Devine, auch ein Angestellter, der darauf aufmerksam gemacht und darüber seinen Job verloren hätte, wäre praktisch rechtlos. Betsy Apple nennt ein weiteres Beispiel: Ein Konzern, der irakisches Öl in gefährlichen Seelenverkäufern übers Meer verschiffte, wäre nicht zu belangen...
Die Regierung besteht darauf, dass solche Fälle durch das Dekret nicht gedeckt werden. Das Problem ist nur: Es steht darin so. «Der Formulierung nach beendet das Dekret offensichtlich die Hoheit der Gesetze über die Ölindustrie oder jeden anderen, der über irakisches Öl verfügt oder über irgendetwas, das mit irakischem Öl zu tun hat», beklagt Devine. «Die Leute sagen, Irak ist ein Dschungel», sagte der Rechtsprofessor Jamin Raskin der «LA Times»: «Dies Dekret macht das zum Gesetz.»
Schlamperei
Ein Trost für die NGOs, die das Dekret nach Wochen erst im Bundesanzeiger entdeckten und die Kampagne dagegen starteten, ist der Umstand, dass die Ölindustrie nach eigenem Bekunden nichts davon wusste - was Schlamperei als wahrscheinlicher erscheinen lässt als ein juristisches Komplott des ehemaligen Ölunternehmers Bush mit den Seinen gegen den Rest der Welt. Aus den Dementis der Regierung zieht Raskin den Schluss, dass weitere Weisungen, wie in ähnlichen Fällen nach massiven Protesten geschehen, die bemerkenswerten Freiheiten, die die Ölindustrie im Irak-Geschäft derzeit aufgrund des Papiers genießt, wieder einschränken werden. (nz)
USA in der Kritik: Regierung garantiert Ölkonzernen Straffreiheit im Irak-Geschäft
07. Aug 16:10
US-Präsident Bush hat per «Executive Order» alle Geschäfte mit irakischem Öl unter juristische Immunität gestellt. Nun können sich Ölkonzerne alles leisten, beklagen Kritiker.
Dieser ebenso umständliche wie umstrittene Satz ist Kern des Präsidentendekrets 13303 vom 22. Mai 2003: «Jeder ... Gerichtsprozess ist verboten und soll für null und nichtig erklärt werden in Hinsicht auf folgende: (a) den Entwicklungsfonds für Irak und (b) irakisches Öl und alle irakischen Ölprodukte und Beteiligungen daran sowie Umsätze, Obligationen und jedes finanzielle Instrument welcher Art auch immer, die mit dem Verkauf und der Vermarktung dessen verbunden sind, Beteiligungen daran, an denen ein fremdes Land oder ein Bürger dessen irgendeinen Anteil hat, die in den Vereinigten Staaten sind, in die Vereinigten Staaten kommen oder sich jetzt oder später im Eigentum oder unter Kontrolle eines US-Bürgers befinden.»
Absolute Straffreiheit
Obwohl Präsident Bush in seiner Executive Order hinreichend detailliert dargelegt hat, welcher Umgang mit irakischem Öl weiterhin zu einem gerichtlichen Nachspiel führen kann - keiner -, bestreitet die US-Regierung intendiert zu haben, was sie damit tatsächlich verfügte: Die absolute Straffreiheit amerikanischer Ölkonzerne und anderer Geschäftsleute bei allen Transaktionen im Zusammenhang mit irakischem Rohöl und Ölprodukten. «Das Dekret schützt nicht das Geld der Ölgesellschaften, es schützt das Geld der Iraker», sagte Taylor Griffith, ein Sprecher des US-Finanzministeriums, der nachfragenden «Los Angeles Times».
Tatsächlich wird der Entwicklungsfonds für Irak, die per Sicherheitsratsbeschluss gegründete Behörde, über die der gesamte Öl-Außenhandel und die Güterimporte für Irak abgewickelt werden, an erster Stelle im Dekret genannt. Doch heißt es laut «LA Times» darin ausdrücklich, dass das Wort «Person» auch Unternehmen einschließe. Klar, sagt die Regierung dazu, die Ölgesellschaften müssen vor Klagen geschützt werden, damit der Fonds das Geld aus dem irakischen Ölgeschäft schnell und reibungslos erhalte. NGO-Vertreter wie Betsy Apple, die Anwältin der Menschenrechtsorganisation Earthrights International, mag der Regierung ihre Beteuerung aber nicht abnehmen: «Man versucht die Tatsache zu verschleiern, dass es Ölkonzerne sind, die dies Geschäft machen.»
Übers Ziel hinaus
Sie gegen Klagen komplett zu immunisieren, geht weit über den Schutz des Fonds hinaus, erklärte Tom Devine, Rechtsexperte des Government Accountability Project, einer unabhängigen Organisation, die US-Regierungen überwacht, der «Times»: So würde das das Dekret der Formulierung nach etwa auch eine Werbefirma schützen, die erlogene Eigenschaften eines über amerikanische Tankstellen vertriebenen Kraftstoffs anpreist, dessen Rohstoff aus Irak stammt. Nicht nur, dass eine Ölgesellschaft für Verbrechen im Rahmen ihres Irakgeschäfts nicht anklagbar wäre, so Devine, auch ein Angestellter, der darauf aufmerksam gemacht und darüber seinen Job verloren hätte, wäre praktisch rechtlos. Betsy Apple nennt ein weiteres Beispiel: Ein Konzern, der irakisches Öl in gefährlichen Seelenverkäufern übers Meer verschiffte, wäre nicht zu belangen...
Die Regierung besteht darauf, dass solche Fälle durch das Dekret nicht gedeckt werden. Das Problem ist nur: Es steht darin so. «Der Formulierung nach beendet das Dekret offensichtlich die Hoheit der Gesetze über die Ölindustrie oder jeden anderen, der über irakisches Öl verfügt oder über irgendetwas, das mit irakischem Öl zu tun hat», beklagt Devine. «Die Leute sagen, Irak ist ein Dschungel», sagte der Rechtsprofessor Jamin Raskin der «LA Times»: «Dies Dekret macht das zum Gesetz.»
Schlamperei
Ein Trost für die NGOs, die das Dekret nach Wochen erst im Bundesanzeiger entdeckten und die Kampagne dagegen starteten, ist der Umstand, dass die Ölindustrie nach eigenem Bekunden nichts davon wusste - was Schlamperei als wahrscheinlicher erscheinen lässt als ein juristisches Komplott des ehemaligen Ölunternehmers Bush mit den Seinen gegen den Rest der Welt. Aus den Dementis der Regierung zieht Raskin den Schluss, dass weitere Weisungen, wie in ähnlichen Fällen nach massiven Protesten geschehen, die bemerkenswerten Freiheiten, die die Ölindustrie im Irak-Geschäft derzeit aufgrund des Papiers genießt, wieder einschränken werden. (nz)
USA warfen im Irak-Krieg Brandbomben
Monitor
Die Streitkräfte der USA haben einem Bericht des ARD-Fernsehmagazin "Monitor" zufolge im Irak-Krieg Brandbomben eingesetzt. Vertreter des Pentagon bestätigen darin, dass im Irak Bomben eingesetzt worden seien, die ähnlich wie Napalm-Bomben wirken. Laut "Monitor" erklärte Marinekorps-Oberst Joseph Boehm: "Wir haben 30 Kanister in einem 30-tägigen Krieg verwendet." Auch Marinecorps-Sprecher Oberst Michael Daily habe gegenüber "Monitor" schriftlich den Einsatz der Mark 77-Bomben bestätigt, darunter den gegen den irakischen Beobachtungs- und Artillerieposten Safwan an der kuwaitischen Grenze, bei dem Medienberichten zufolge viele Menschen zu Tode kamen.
Pentagon: Einsatz war legal und notwendig
Das US-Verteidigungsministerium rechtfertigte den Einsatz der international geächteten Munition als notwendig und legal gerechtfertigt. Der Einsatz der Bomben sei ein geeignetes Mittel, um mit einem "schwierigen Feind" umzugehen und zugleich "das eigene Leben zu bewahren". Es gebe zudem keine internationale Konvention, die den Einsatz dieser Munition verbiete. "Mir ist keine Methode bekannt, den Feind auf humane Art und Weise zu töten", betonte ein Pentagon-Vertreter in Washington.
Andere Zusammensetzung - Gleiche Wirkung
Die MK-77-Bombe ist eine Weiterentwicklung der von den USA im Vietnamkrieg eingesetzten Napalm-Bombe M-74. Die mit einem Gel-Gemisch aus Benzol, Benzin und Styropor gefüllten 250-Kilo-Bomben trudeln nach dem Abwurf ungelenkt auf den Boden und setzen beim Aufprall das brennende Gel über eine große Fläche frei. Bereits im Golfkrieg von 1991 verwendete die US-Marineinfanterie Experten zufolge rund 500 MK-77-Bomben gegen irakische Ziele.
Die MK-77-Bomben werden von manchen Soldaten weiter als "Napalm" bezeichnet. Sie haben eine ähnliche Wirkung, aber eine andere chemische Zusammensetzung als Napalm. Der Einsatz amerikanischer Napalm-Bomben im Vietnamkrieg hatte international heftige Kritik hervorgerufen.
Beamte des Verteidigungsministeriums hatten den Einsatz von Napalmbomben stets dementiert und erklärt, die amerikanischen Bestände seien vor zwei Jahren vernichtet worden.
Stand: 08.08.2003 08:47 Uhr
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID2116000…
Mittlerweile wurden aus Rumsy`s "90% Präzisionsbomben" am Tag nach den Krieg runde 60%, und täglich werden es weniger. Next lie.......
syr
Monitor
Die Streitkräfte der USA haben einem Bericht des ARD-Fernsehmagazin "Monitor" zufolge im Irak-Krieg Brandbomben eingesetzt. Vertreter des Pentagon bestätigen darin, dass im Irak Bomben eingesetzt worden seien, die ähnlich wie Napalm-Bomben wirken. Laut "Monitor" erklärte Marinekorps-Oberst Joseph Boehm: "Wir haben 30 Kanister in einem 30-tägigen Krieg verwendet." Auch Marinecorps-Sprecher Oberst Michael Daily habe gegenüber "Monitor" schriftlich den Einsatz der Mark 77-Bomben bestätigt, darunter den gegen den irakischen Beobachtungs- und Artillerieposten Safwan an der kuwaitischen Grenze, bei dem Medienberichten zufolge viele Menschen zu Tode kamen.
Pentagon: Einsatz war legal und notwendig
Das US-Verteidigungsministerium rechtfertigte den Einsatz der international geächteten Munition als notwendig und legal gerechtfertigt. Der Einsatz der Bomben sei ein geeignetes Mittel, um mit einem "schwierigen Feind" umzugehen und zugleich "das eigene Leben zu bewahren". Es gebe zudem keine internationale Konvention, die den Einsatz dieser Munition verbiete. "Mir ist keine Methode bekannt, den Feind auf humane Art und Weise zu töten", betonte ein Pentagon-Vertreter in Washington.
Andere Zusammensetzung - Gleiche Wirkung
Die MK-77-Bombe ist eine Weiterentwicklung der von den USA im Vietnamkrieg eingesetzten Napalm-Bombe M-74. Die mit einem Gel-Gemisch aus Benzol, Benzin und Styropor gefüllten 250-Kilo-Bomben trudeln nach dem Abwurf ungelenkt auf den Boden und setzen beim Aufprall das brennende Gel über eine große Fläche frei. Bereits im Golfkrieg von 1991 verwendete die US-Marineinfanterie Experten zufolge rund 500 MK-77-Bomben gegen irakische Ziele.
Die MK-77-Bomben werden von manchen Soldaten weiter als "Napalm" bezeichnet. Sie haben eine ähnliche Wirkung, aber eine andere chemische Zusammensetzung als Napalm. Der Einsatz amerikanischer Napalm-Bomben im Vietnamkrieg hatte international heftige Kritik hervorgerufen.
Beamte des Verteidigungsministeriums hatten den Einsatz von Napalmbomben stets dementiert und erklärt, die amerikanischen Bestände seien vor zwei Jahren vernichtet worden.
Stand: 08.08.2003 08:47 Uhr
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID2116000…
Mittlerweile wurden aus Rumsy`s "90% Präzisionsbomben" am Tag nach den Krieg runde 60%, und täglich werden es weniger. Next lie.......
syr
!
Dieser Beitrag wurde vom System automatisch gesperrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an feedback@wallstreet-online.de
Die Exekutive hat mich wieder freigelassen 
Also, ihr Wahnsinnige

Also, ihr Wahnsinnige

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/945/15930/
Supermacht USA
Handelspolitik als Waffe
Der Streit der USA mit dem RWE wegen Libyen ist kein Einzelfall.
Von Andreas Oldag
Zimperlich waren die Amerikaner noch nie, wenn es darum ging, ihre Supermacht-Interessen durchzusetzen. So ist es denn auch kein Zufall, dass Washington jetzt Druck auf den deutschen RWE-Konzern ausgeübt hat. Es geht um einen Vertrag der RWE Dea zur Erschließung von Öl- und Gasvorkommen mit Libyen. Für die US-Regierung ist das nordafrikanische Land ein Schurkenstaat, das den internationalen Terrorismus unterstützt.
Nach einem 1996 unter dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton verabschiedeten Gesetz, dem so genannten „Iran Libya Sanctions Act“, drohen die USA auch ausländischen Unternehmen Sanktionen, wenn sie mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr in diesen Ländern investieren.
Sicherheitspolitische Interessen
Washington will damit eine internationale Isolierung der Länder erreichen und sie vom Zufluss westlichen Kapitals abschnüren. Handels- und Wirtschaftspolitik ist aus Sicht der Amerikaner auch eine politische Waffe, die den sicherheitspolitischen Interessen der USA dienen soll.
Dies ist kein neues Element in der US-Außen- und Verteidigungspolitik. Ende der 90er Jahre schlugen die Wellen zwischen Washington und Brüssel hoch, als die USA versuchten, europäische Firmen wegen Investitionen auf Kuba unter Druck zu setzen.
Die Europäer haben sich bisher geweigert, den Weisungen aus Washington zu folgen. Aus gutem Grund: Denn die Regeln der Welthandelsorganisation WTO verbieten eine Boykottpolitik nach dem Tabularasa-Prinzip. Anders liegt die Sache, wenn die UNO einen Beschluss über Wirtschaftssanktionen faßt, wie gegen das Regime des abgesetzten Diktators Saddam Hussein.
Dicke Geschäfte mit Saudi-Arabien
Nur: Die USA sind keineswegs so puristisch, wie sie vorgeben. Mit Saudi Arabien machen amerikanische Öl-Konzerne dicke Geschäfte und werden dabei von Lobbyisten jeder politischen Coleur in Washington unterstützt, obwohl der begründete Verdacht besteht, dass der Wüstenstaat fundamentalistische Moslems protegiert. Ohnehin sieht man in Washington über Schlupflöcher des Sanktionsgesetzes gegen Libyen und Iran hinweg.
So ist nach Presseberichten eine deutsche Tochter des texanischen Ölausrüsters Halliburton mit Servicegeschäften in Libyen aktiv.
Dies legt die Vermutung nahe, dass die US-Gesetze nach Gusto Washingtons eingesetzt werden, um sich unliebsame Konkurrenz im wirtschaftlich lukrativen Nahen Osten vom Leibe zu halten. Da passt es ins Bild, dass EU-Firmen beim Wiederaufbau des Iraks bisher kaum zum Zuge gekommen sind.
Beim RWE-Konzern ist man indes bemüht, den Streit mit den Amerikanern herunterzuspielen. Der Vertrag mit Libyen habe für Seismik und Explorationsbohrungen in einem Fünfjahreszeitraum ein Volumen von 56 Millionen Dollar, also pro Jahr deutlich weniger als 20 Millionen Dollar, heißt es.
Unangenehme Folgen
Andererseits könnte ein Zerwürfnis mit den USA unangenehme Folgen haben: RWE betreibt über seine Tochter Thames Water das US-Unternehmen American Water Works, den größten privatwirtschaftlichen Wasserversorger der USA.
Was politischer Druck aus Washington bewirken kann, zeigt ein anderes Beispiel: Kürzlich hatte der Stahl- und Investitionsgüterkonzern ThyssenKrupp eigene Aktien von 406 Millionen Euro von Iran zurückgekauft, um einen drohenden Ausschuss von öffentlichen Aufträgen in den USA zu verhindern. Durch die Transaktiom sank der Anteil des iranischen Staats an ThyssenKrupp unter eine kritische Schwelle von fünf Prozent.
----------
Hier bitte den nun nachfolgenden Artikel lesen !
Supermacht USA
Handelspolitik als Waffe
Der Streit der USA mit dem RWE wegen Libyen ist kein Einzelfall.
Von Andreas Oldag
Zimperlich waren die Amerikaner noch nie, wenn es darum ging, ihre Supermacht-Interessen durchzusetzen. So ist es denn auch kein Zufall, dass Washington jetzt Druck auf den deutschen RWE-Konzern ausgeübt hat. Es geht um einen Vertrag der RWE Dea zur Erschließung von Öl- und Gasvorkommen mit Libyen. Für die US-Regierung ist das nordafrikanische Land ein Schurkenstaat, das den internationalen Terrorismus unterstützt.
Nach einem 1996 unter dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton verabschiedeten Gesetz, dem so genannten „Iran Libya Sanctions Act“, drohen die USA auch ausländischen Unternehmen Sanktionen, wenn sie mehr als 20 Millionen Dollar pro Jahr in diesen Ländern investieren.
Sicherheitspolitische Interessen
Washington will damit eine internationale Isolierung der Länder erreichen und sie vom Zufluss westlichen Kapitals abschnüren. Handels- und Wirtschaftspolitik ist aus Sicht der Amerikaner auch eine politische Waffe, die den sicherheitspolitischen Interessen der USA dienen soll.
Dies ist kein neues Element in der US-Außen- und Verteidigungspolitik. Ende der 90er Jahre schlugen die Wellen zwischen Washington und Brüssel hoch, als die USA versuchten, europäische Firmen wegen Investitionen auf Kuba unter Druck zu setzen.
Die Europäer haben sich bisher geweigert, den Weisungen aus Washington zu folgen. Aus gutem Grund: Denn die Regeln der Welthandelsorganisation WTO verbieten eine Boykottpolitik nach dem Tabularasa-Prinzip. Anders liegt die Sache, wenn die UNO einen Beschluss über Wirtschaftssanktionen faßt, wie gegen das Regime des abgesetzten Diktators Saddam Hussein.
Dicke Geschäfte mit Saudi-Arabien
Nur: Die USA sind keineswegs so puristisch, wie sie vorgeben. Mit Saudi Arabien machen amerikanische Öl-Konzerne dicke Geschäfte und werden dabei von Lobbyisten jeder politischen Coleur in Washington unterstützt, obwohl der begründete Verdacht besteht, dass der Wüstenstaat fundamentalistische Moslems protegiert. Ohnehin sieht man in Washington über Schlupflöcher des Sanktionsgesetzes gegen Libyen und Iran hinweg.
So ist nach Presseberichten eine deutsche Tochter des texanischen Ölausrüsters Halliburton mit Servicegeschäften in Libyen aktiv.
Dies legt die Vermutung nahe, dass die US-Gesetze nach Gusto Washingtons eingesetzt werden, um sich unliebsame Konkurrenz im wirtschaftlich lukrativen Nahen Osten vom Leibe zu halten. Da passt es ins Bild, dass EU-Firmen beim Wiederaufbau des Iraks bisher kaum zum Zuge gekommen sind.
Beim RWE-Konzern ist man indes bemüht, den Streit mit den Amerikanern herunterzuspielen. Der Vertrag mit Libyen habe für Seismik und Explorationsbohrungen in einem Fünfjahreszeitraum ein Volumen von 56 Millionen Dollar, also pro Jahr deutlich weniger als 20 Millionen Dollar, heißt es.
Unangenehme Folgen
Andererseits könnte ein Zerwürfnis mit den USA unangenehme Folgen haben: RWE betreibt über seine Tochter Thames Water das US-Unternehmen American Water Works, den größten privatwirtschaftlichen Wasserversorger der USA.
Was politischer Druck aus Washington bewirken kann, zeigt ein anderes Beispiel: Kürzlich hatte der Stahl- und Investitionsgüterkonzern ThyssenKrupp eigene Aktien von 406 Millionen Euro von Iran zurückgekauft, um einen drohenden Ausschuss von öffentlichen Aufträgen in den USA zu verhindern. Durch die Transaktiom sank der Anteil des iranischen Staats an ThyssenKrupp unter eine kritische Schwelle von fünf Prozent.
----------
Hier bitte den nun nachfolgenden Artikel lesen !
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0%2C1518%2C260426%2C00.html
PRÄSIDENTENORDER
US-Ölfirmen für unfehlbar erklärt
Amerikanische Ölfirmen können im Irak offenbar tun und lassen, was sie wollen. Auch bei Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung soll sie ein Papier vor Strafe schützen, das US-Präsident Bush schon vor zwei Monaten unterschrieben hat.
Los Angeles - Verwunderlich, dass die "Executive Order 13303" seit Ende Mai ohne bemerkt zu werden im Federal Register stehen konnte, dem Amtsblatt der Regierung. Sie schreibt fest, dass Urteile, Pfändungen oder Gerichtsprozesse für null und nichtig erklärt werden müssen, sollten sie den irakischen Entwicklungsfonds oder jegliche Geschäfte mit irakischem Öl betreffen.
Die von Präsident Bush unterzeichnete Weisung stößt nun bei amerikanischen Rechtswissenschaftlern auf helles Entsetzen. "Das erinnert mich an die breite Formulierung der Befugnisse von Militärtribunalen", sagte beispielsweise Jamin Raskin, Verfassungsrechtler an der American University, der "Los Angeles Times". Er stößt sich vor allem an der Passage, "alle Gerichtsprozesse sind null und nichtig". Seiner Meinung nach könnte dies "jede zivil- oder strafrechtliche Haftbarkeit" amerikanischer Ölfirmen im Irak unmöglich machen.
Tom Devine, juristischer Direktor der Nicht-Regierungsorganisation Government Accountabilty Project, sieht sogar die Gefahr, dass alle möglichen US-Firmen bald auf Straffreiheit pochen können. "Nehmen Sie zum Beispiel eine Werbeagentur, die im Rahmen einer Kampagne für irakisches Öl irreführende Werbung macht. Sie kann die Verbraucher anlügen wie sie will, ohne von der Federal Trade Commission belangt zu werden", zitiert ihn die "Los Angeles Times". Ähnlich kritisch sieht Betsy Apple von Earth Rights International das Präsidenten-Dekret. Ihrer Meinung nach können US-Firmen Irak-Öl nun mit völlig veralteten Tankern außer Landes schaffen und genießen dennoch den umfassenden Rechtsschutz des Präsidenten.
Die Regierung hält solche Interpretationen der "Executive Order 13303" für falsch. Taylor Griffin, Sprecher des US-Finanzministeriums sagte der Zeitung, dass mit dem Dekret nur die Einahmen aus der Förderung irakischen Öls geschützt werden sollen, und diese flössen in den irakischen Entwicklungsfonds. "Die Order schützt nicht das Geld der Unternehmen, es schützt das Geld der Iraker", so Griffin. Er stellte außerdem weitere "Regeln" in Aussicht, die den Firmen im Irak in Kürze auferlegt werden sollen.

PRÄSIDENTENORDER
US-Ölfirmen für unfehlbar erklärt
Amerikanische Ölfirmen können im Irak offenbar tun und lassen, was sie wollen. Auch bei Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung soll sie ein Papier vor Strafe schützen, das US-Präsident Bush schon vor zwei Monaten unterschrieben hat.
Los Angeles - Verwunderlich, dass die "Executive Order 13303" seit Ende Mai ohne bemerkt zu werden im Federal Register stehen konnte, dem Amtsblatt der Regierung. Sie schreibt fest, dass Urteile, Pfändungen oder Gerichtsprozesse für null und nichtig erklärt werden müssen, sollten sie den irakischen Entwicklungsfonds oder jegliche Geschäfte mit irakischem Öl betreffen.
Die von Präsident Bush unterzeichnete Weisung stößt nun bei amerikanischen Rechtswissenschaftlern auf helles Entsetzen. "Das erinnert mich an die breite Formulierung der Befugnisse von Militärtribunalen", sagte beispielsweise Jamin Raskin, Verfassungsrechtler an der American University, der "Los Angeles Times". Er stößt sich vor allem an der Passage, "alle Gerichtsprozesse sind null und nichtig". Seiner Meinung nach könnte dies "jede zivil- oder strafrechtliche Haftbarkeit" amerikanischer Ölfirmen im Irak unmöglich machen.
Tom Devine, juristischer Direktor der Nicht-Regierungsorganisation Government Accountabilty Project, sieht sogar die Gefahr, dass alle möglichen US-Firmen bald auf Straffreiheit pochen können. "Nehmen Sie zum Beispiel eine Werbeagentur, die im Rahmen einer Kampagne für irakisches Öl irreführende Werbung macht. Sie kann die Verbraucher anlügen wie sie will, ohne von der Federal Trade Commission belangt zu werden", zitiert ihn die "Los Angeles Times". Ähnlich kritisch sieht Betsy Apple von Earth Rights International das Präsidenten-Dekret. Ihrer Meinung nach können US-Firmen Irak-Öl nun mit völlig veralteten Tankern außer Landes schaffen und genießen dennoch den umfassenden Rechtsschutz des Präsidenten.
Die Regierung hält solche Interpretationen der "Executive Order 13303" für falsch. Taylor Griffin, Sprecher des US-Finanzministeriums sagte der Zeitung, dass mit dem Dekret nur die Einahmen aus der Förderung irakischen Öls geschützt werden sollen, und diese flössen in den irakischen Entwicklungsfonds. "Die Order schützt nicht das Geld der Unternehmen, es schützt das Geld der Iraker", so Griffin. Er stellte außerdem weitere "Regeln" in Aussicht, die den Firmen im Irak in Kürze auferlegt werden sollen.

Hohe Investitionen in Computer und E-Business treiben Produktivität und Wohlstand
OECD: New Economy lebt – IT bleibt Wachstumsmotor
Von Olaf Storbeck
Die Informations- und Telekommunikationstechnologie (IT) ist eindeutig ein wichtiger Motor für das Wachstum von Wohlstand und Produktivität. Experten sehen darin das Potenzial, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen umzuwälzen.
DÜSSELDORF. Auch Nobelpreisträger können irren: „Wir sehen das Computer-Zeitalter überall, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken“, behaupte der amerikanische Star-Ökonom Robert Solow Ende der achtziger Jahre. Zahlreiche Studien haben in den vergangenen 15 Jahren allerdings gezeigt, dass Solow damit falsch liegt. Jüngster Belegt ist eine soeben erschienene Studie der Organisation für Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris.
Die Autoren sehen die Informations- und Telekommunikationstechnologie (IT) eindeutig als wichtigen Motor für das Wachstum von Wohlstand und Produktivität. „Trotz des Abschwungs der Gesamtwirtschaft und von Teilen des IT-Sektors hat sich IT in den vergangenen zehn Jahren zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, die das Potenzial hat, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen umzuwälzen“, lautet das Fazit.
In einigen Ländern haben Computer und E-Business-Technologie laut OECD das Produktivitäts- und Wirtschaftswachstum erhöht.
Besonders deutlich ist dies in den USA: Dort hat sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität in den neunziger Jahren spürbar beschleunigt. „Dieser Trend ist trotz des Konjunkturabschwungs weiter in Takt“, betont Robert McGuckin, Produktivitätsexperte des US-Wirtschaftsforschungsinstituts Conference Board.
Produktivität pro Arbeitsstunde rasant gewachsen
Im vergangenen Jahr[/b] ist die Produktivität pro Arbeitsstunde sogar mit einem Rekordtempo gewachsen. Im Unternehmenssektor außerhalb der Landwirtschaft lag das Plus im Jahresdurchschnitt bei 5,4 % – so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr, berichtete am Donnerstag das US-Arbeitsministerium. Im zweiten Quartal 2003 lag der Anstieg auf das Gesamtjahr hochgerechnet sogar bei 5,7 %. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 4,1 % gerechnet.
Ökonomen wie Ian Morris von der Großbank HSBC sprechen von einem „Produktivitätswunder.“ Einen Teil des imposanten Anstiegs erklären Volkswirte mit kurzfristigen Faktoren: Durch die harten Kostensenkungsprogramme und Kündigungen hätten die US-Firmen ihre Effizienz gesteigert. Noch ein weiterer Faktor beflügelt das Produktivitätswachstum jenseits des Atlantiks: Computer und E-Business-Technologien sind deutlich stärker verbreitet, zeigt die OECD-Studie.
In keinem anderen Industrieland ist der Anteil von IT-Investitionen am Bruttoinlandsprodukt so hoch wie in den USA – in den vergangenen 20 Jahren hat er sich auf gut 4 % verdoppelt.
In Deutschland hingegen ist er im gleichen Zeitraum nur von 2 auf 2,5 % gestiegen. Seit Mitte der neunziger Jahre haben die Investitionen in Hard- und Software beim durchschnittlichen US-Wirtschaftswachstum von 3,6 % pro Jahr rund 0,8 Prozentpunkte beigetragen. In Deutschland war der Wachstumsbeitrag mit knapp 0,4 Punkten noch nicht einmal halb so groß.
In den USA nutzen Unternehmen neue Technologien häufiger
Neben den deutlich höheren IT-Investitionen führen die OECD-Ökonomen zwei weitere Argumente an für das gute Abschneiden der USA an:
Zum einen gibt es dort deutlich mehr Unternehmen, die IT-Produkte herstellen. Bei den High-Tech-Herstellern steigt die Produktivität dank des rasanten technischen Fortschritt besonders stark – dies schlägt auf die Gesamtwirtschaft durch.
Zum anderen nutzen laut OECD Unternehmen in den USA die neue Technologie deutlich intensiver als in Deutschland und anderen Staaten – vor allem im Dienstleistungssektor.
Dies verschaffe nicht nur den einzelnen Unternehmen Wettbewerbsvorteile und Effizienzgewinne, sondern steigere auch in der Gesamtwirtschaft Produktivität und Wachstum.
Möglicherweise lähmt die deutsche Regulierungswut die Verbreitung von IT in der Wirtschaft. Denn die OECD-Ökonomen stellten fest: In Ländern, in denen sich der Staat nur wenig in den Güter- und Arbeitsmarkt einmischt, waren die IT-Investitionen höher als in Staaten mit hoher Regulierungsdichte.
Quelle: Handelsblatt,
http://www.handelsblatt.com/hbiwwwangebot/fn/relhbi/sfn/buil…
OECD: New Economy lebt – IT bleibt Wachstumsmotor
Von Olaf Storbeck
Die Informations- und Telekommunikationstechnologie (IT) ist eindeutig ein wichtiger Motor für das Wachstum von Wohlstand und Produktivität. Experten sehen darin das Potenzial, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen umzuwälzen.
DÜSSELDORF. Auch Nobelpreisträger können irren: „Wir sehen das Computer-Zeitalter überall, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken“, behaupte der amerikanische Star-Ökonom Robert Solow Ende der achtziger Jahre. Zahlreiche Studien haben in den vergangenen 15 Jahren allerdings gezeigt, dass Solow damit falsch liegt. Jüngster Belegt ist eine soeben erschienene Studie der Organisation für Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris.
Die Autoren sehen die Informations- und Telekommunikationstechnologie (IT) eindeutig als wichtigen Motor für das Wachstum von Wohlstand und Produktivität. „Trotz des Abschwungs der Gesamtwirtschaft und von Teilen des IT-Sektors hat sich IT in den vergangenen zehn Jahren zu einer Schlüsseltechnologie entwickelt, die das Potenzial hat, die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen umzuwälzen“, lautet das Fazit.
In einigen Ländern haben Computer und E-Business-Technologie laut OECD das Produktivitäts- und Wirtschaftswachstum erhöht.
Besonders deutlich ist dies in den USA: Dort hat sich das Wachstum der Arbeitsproduktivität in den neunziger Jahren spürbar beschleunigt. „Dieser Trend ist trotz des Konjunkturabschwungs weiter in Takt“, betont Robert McGuckin, Produktivitätsexperte des US-Wirtschaftsforschungsinstituts Conference Board.
Produktivität pro Arbeitsstunde rasant gewachsen
Im vergangenen Jahr[/b] ist die Produktivität pro Arbeitsstunde sogar mit einem Rekordtempo gewachsen. Im Unternehmenssektor außerhalb der Landwirtschaft lag das Plus im Jahresdurchschnitt bei 5,4 % – so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr, berichtete am Donnerstag das US-Arbeitsministerium. Im zweiten Quartal 2003 lag der Anstieg auf das Gesamtjahr hochgerechnet sogar bei 5,7 %. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 4,1 % gerechnet.
Ökonomen wie Ian Morris von der Großbank HSBC sprechen von einem „Produktivitätswunder.“ Einen Teil des imposanten Anstiegs erklären Volkswirte mit kurzfristigen Faktoren: Durch die harten Kostensenkungsprogramme und Kündigungen hätten die US-Firmen ihre Effizienz gesteigert. Noch ein weiterer Faktor beflügelt das Produktivitätswachstum jenseits des Atlantiks: Computer und E-Business-Technologien sind deutlich stärker verbreitet, zeigt die OECD-Studie.
In keinem anderen Industrieland ist der Anteil von IT-Investitionen am Bruttoinlandsprodukt so hoch wie in den USA – in den vergangenen 20 Jahren hat er sich auf gut 4 % verdoppelt.
In Deutschland hingegen ist er im gleichen Zeitraum nur von 2 auf 2,5 % gestiegen. Seit Mitte der neunziger Jahre haben die Investitionen in Hard- und Software beim durchschnittlichen US-Wirtschaftswachstum von 3,6 % pro Jahr rund 0,8 Prozentpunkte beigetragen. In Deutschland war der Wachstumsbeitrag mit knapp 0,4 Punkten noch nicht einmal halb so groß.
In den USA nutzen Unternehmen neue Technologien häufiger
Neben den deutlich höheren IT-Investitionen führen die OECD-Ökonomen zwei weitere Argumente an für das gute Abschneiden der USA an:
Zum einen gibt es dort deutlich mehr Unternehmen, die IT-Produkte herstellen. Bei den High-Tech-Herstellern steigt die Produktivität dank des rasanten technischen Fortschritt besonders stark – dies schlägt auf die Gesamtwirtschaft durch.
Zum anderen nutzen laut OECD Unternehmen in den USA die neue Technologie deutlich intensiver als in Deutschland und anderen Staaten – vor allem im Dienstleistungssektor.
Dies verschaffe nicht nur den einzelnen Unternehmen Wettbewerbsvorteile und Effizienzgewinne, sondern steigere auch in der Gesamtwirtschaft Produktivität und Wachstum.
Möglicherweise lähmt die deutsche Regulierungswut die Verbreitung von IT in der Wirtschaft. Denn die OECD-Ökonomen stellten fest: In Ländern, in denen sich der Staat nur wenig in den Güter- und Arbeitsmarkt einmischt, waren die IT-Investitionen höher als in Staaten mit hoher Regulierungsdichte.
Quelle: Handelsblatt,
http://www.handelsblatt.com/hbiwwwangebot/fn/relhbi/sfn/buil…
Hallo DolbyDigital5.1,
sei vorsichtig mit Deinen Worten, Du bist nur auf
Bewährung draussen - äh, wieder drinnen!
Übrigens hatte ich extra wegen Dir den Threat #762189
angefangen, weil ich von Dir eigentlich nur das Reinstellen
guter Beiträge kenne.
Würde mich freuen wenn Du es dabei bewenden läßt und
Dich nicht gleich wieder emotional in Board-mail-Diskussionen
mit Usern steigerst und dabei Deine gute Erziehung vergißt.
Jedenfalls:
Willkommen zu Hause!
mfg
thefarmer
sei vorsichtig mit Deinen Worten, Du bist nur auf
Bewährung draussen - äh, wieder drinnen!
Übrigens hatte ich extra wegen Dir den Threat #762189
angefangen, weil ich von Dir eigentlich nur das Reinstellen
guter Beiträge kenne.
Würde mich freuen wenn Du es dabei bewenden läßt und
Dich nicht gleich wieder emotional in Board-mail-Diskussionen
mit Usern steigerst und dabei Deine gute Erziehung vergißt.
Jedenfalls:
Willkommen zu Hause!
mfg
thefarmer
#479 von thefarmer
hab dir drüben geantwortet.
manchmal kochen emotionen halt über.
und dann ist man einfach weg vom fenster

hab dir drüben geantwortet.
manchmal kochen emotionen halt über.
und dann ist man einfach weg vom fenster


#478 von nasdaq10.000
Was ist daran wahnsinnig
produktivität steigt wie´d sau, genauso ist der rüstungsanteil massgeblich daran beteiligt.
und der ist so hoch wie seit dem (glaube ich) vietnamkrieg nicht mehr.
dennoch danke für deinen beitrag
Was ist daran wahnsinnig

produktivität steigt wie´d sau, genauso ist der rüstungsanteil massgeblich daran beteiligt.
und der ist so hoch wie seit dem (glaube ich) vietnamkrieg nicht mehr.
dennoch danke für deinen beitrag

hat nichts mit amerika zu tun, aber an dem artikel kann man sehen wie glaubwürdig US-Zahlen im grunde sind. speziell das verstauchervertrauen aus mischigan, oder wie man das schreibt. manche sagen es wurden 500 amerikaner telefonisch befragt. andere nennen 5dausend leutchen. letztendlich alles für´n poppes. die markierung im text reicht aus:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,260328,00.html
ZUVERLÄSSIGKEIT
Schlechte Noten für deutsche Autos
Müssen die deutschen Automarken um ihren guten Ruf fürchten? In einer aktuellen Leser-Befragung schnitten Volkswagen, BMW, Audi und Mercedes in punkto Zuverlässigkeit so schlecht ab wie nie zuvor.
Erhielt schlechte Noten: Der VW Polo
London - Nach einem Bericht der britischen BBC hat eine Umfrage des Produktmagazins "Which?" ergeben, dass es um die Zuverlässigkeit deutscher Autos schlecht steht. An der Befragung nahmen 80 000 Leser teil. 138 verschiedene Modelle wurden miteinander verglichen. Laut BBC wurden die Zuverlässigkeit der beiden Volkswagen-Modelle Golf und Polo als dürftig eingestuft. Die schlechtesten Noten in dieser Kategorie habe der Sportwagen Audi TT erhalten. Auch BMW und Mercedes erreichten nur Durchschnittswerte.
"Einst waren deutsche Autos bekannt für hohe Qualität", zitiert die BBC einen Mitarbeiter des Magazins. Doch nun hinkten die Deutschen hinterher. Gewinner der Leser-Befragung waren die asiatischen Autos. Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Nissan und Toyota waren in der Zuverlässigkeits-Kategorie Top. Aufgeholt habe auch Ford. Sonst nur durchschnittlich, sei die US-Marke dieses Mal überwiegend als "gut" eingestuft worden.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,260328,00.html
ZUVERLÄSSIGKEIT
Schlechte Noten für deutsche Autos
Müssen die deutschen Automarken um ihren guten Ruf fürchten? In einer aktuellen Leser-Befragung schnitten Volkswagen, BMW, Audi und Mercedes in punkto Zuverlässigkeit so schlecht ab wie nie zuvor.
Erhielt schlechte Noten: Der VW Polo
London - Nach einem Bericht der britischen BBC hat eine Umfrage des Produktmagazins "Which?" ergeben, dass es um die Zuverlässigkeit deutscher Autos schlecht steht. An der Befragung nahmen 80 000 Leser teil. 138 verschiedene Modelle wurden miteinander verglichen. Laut BBC wurden die Zuverlässigkeit der beiden Volkswagen-Modelle Golf und Polo als dürftig eingestuft. Die schlechtesten Noten in dieser Kategorie habe der Sportwagen Audi TT erhalten. Auch BMW und Mercedes erreichten nur Durchschnittswerte.
"Einst waren deutsche Autos bekannt für hohe Qualität", zitiert die BBC einen Mitarbeiter des Magazins. Doch nun hinkten die Deutschen hinterher. Gewinner der Leser-Befragung waren die asiatischen Autos. Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Nissan und Toyota waren in der Zuverlässigkeits-Kategorie Top. Aufgeholt habe auch Ford. Sonst nur durchschnittlich, sei die US-Marke dieses Mal überwiegend als "gut" eingestuft worden.
FORSCHUNG ALS WAFFE
Manipulieren, fälschen, unterdrücken
Die US-Regierung verbiegt die Wahrheit offenbar nicht nur, um Kriege zu rechtfertigen. Ein Parlamentsausschuss untersuchte jetzt, wie Präsident George W. Bush und die Seinen mit der Wissenschaft umgehen - und kam zu skandalträchtigen Ergebnissen.
REUTERS
Bush: Wissenschaftslügen im Dienst der Politik
Der Bericht der Parlamentarier liest sich wie ein Panoptikum von Manipulation, Unterdrückung missliebiger Forschungsergebnisse und offener Fälschung. "Die politische Einmischung der Regierung führte zu irreführenden Aussagen des Präsidenten, ungenauen Auskünften an den Kongress, veränderten Webseiten, unterdrückten Institutsberichten und dem Knebeln von Wissenschaftlern", heißt es in dem 40-seitigen Papier des Regierungsreform-Komitees des Repräsentantenhauses unter Leitung des Demokraten Henry Waxman. Die Manipulationen fänden in vielen Bereichen statt, hätten aber eines gemeinsam: "Die Nutznießer der Verzerrungen sind wichtige Helfer des Präsidenten, unter anderem Konservative und mächtige Industriegruppen."
Dass die Interventionen neben wirtschaftlichen auf ideologischen Interessen dienen, verdeutlichen etwa die bizarren Vorgänge rund um die Sexualmoral. In den Augen des US-Präsidenten und seiner Getreuen gibt es offenbar nur eine akzeptable Verhütungsmethode: keinen Sex zu haben. Um das auch wissenschaftlich zu untermauern, frisierte die Regierung dem Bericht zufolge Statistiken über die Ergebnisse ihrer "Abstinence Only"-Kampagne.
Informationen zur Verhütung unterdrückt
Jugendliche, die dennoch etwas über die Funktionsweise eines Kondoms erfahren wollten, wurden zumindest auf offiziellen Webseiten nicht fündig. Die Bush-Regierung tilgte die Informationen über das Anlegen von Parisern kurzerhand von der Webseite des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), immerhin eine Regierungsorganisation.
AP
Abstinenz-Kampagne: "Jungfrau ist kein schmutziges Wort"
Wer es dennoch nicht lassen kann und beim Sex auch noch unerwünscht schwanger wird, sollte nach dem Willen Washingtons eine Abtreibung besser nicht in Betracht ziehen. Angst wirkt da Wunder, müssen sich Bushs Helfer gedacht haben - und manipulierten die Internetseite einer weiteren Regierungsorganisation, diesmal des Nationalen Krebsinstituts. Dort war dann zu lesen, dass eine Abtreibung Brustkrebs auslösen kann - eine absurde Behauptung, die dem Konsens unter Forschern widerspricht und von der "New York Times" als "ungeheuerliche Verzerrung der Beweislage" gegeißelt wurde.
Auch der Internet-Auftritt des Bildungsministeriums blieb dem Parlamentsbericht zufolge nicht von Bushs Desinformations-Kampagne verschont. In einem Rundbrief wurden die Mitarbeiter des Ministeriums aufgefordert, von der Webseite umgehend alle Materialien zu entfernen, die "nicht mit der Philosophie der Regierung übereinstimmen". Nationale Bildungsorganisationen beschwerten sich ebenso unverzüglich wie erfolglos über Zensur.
Fantastische Vorhersagen zur Raketenabwehr
Im März 2003 behauptete Verteidigungs-Staatssekretär Edward Aldridge vor dem zuständigen Senatsausschuss, bis Ende 2004 stehe ein Raketenabwehr-System bereit, das mit neunzigprozentiger Treffsicherheit aus Korea anfliegende Raketen abschießen könne. Die optimistischsten unabhängigen Wissenschaftler sahen dagegen ein solches Abwehrsystem mindestens zehn Jahre in der Zukunft, viele halten es bis heute für technisch nicht machbar.
AP
Nationale Raketenabwehr: Wilde Übertreibungen der Regierung
Die amerikanische Ölwirtschaft, in der Bush-Regierung ohnehin bestens repräsentiert, sollte ebenfalls von der Wissenschafts-Fälschung profitieren. So erklärte Innenministerin Gale Norton den Senatoren und Repräsentanten, dass Ölbohrungen in der Arktis die dortigen Karibu-Bestände nicht gefährdeten - obwohl die Wissenschaftler in ihrer eigenen Behörde zuvor das Gegenteil festgestellt hatten.
Selektive Besetzung wissenschaftlicher Gremien
In der Landwirtschaft hält die Regierung Bush dem Bericht zufolge die Interessen der Industrie ebenfalls für wichtiger als den Umweltschutz. Das Landwirtschaftsministerium erließ demnach strenge Regeln, um öffentlich beschäftigte Forscher an der Veröffentlichung von Studien zu hindern, die der Industrie schaden könnten. In einem konkreten Fall wurde einem Mikrobiologen die Bekanntgabe von Forschungsergebnissen untersagt, die auf die Gefahren durch Antibiotika-resistente Baketrien im Mittelwesten der USA hinwiesen.
IM INTERNET
· Parlamentsbericht "Politik und Wissenschaft in der Regierung Bush"
SPIEGEL ONLINE ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Die Bush-Regierung bestückte dem Bericht zufolge wissenschaftliche Komitees mit politisch genehmen, wissenschaftlich aber eher ahnungslosen Leuten. In das Gremium zur Aids-Bekämpfung etwa wurde Jerry Thacker berufen - ein Marketingfachmann, der Homosexualität als "Spielart des Todes" und Aids als "Schwulenplage" bezeichnet hatte.
"Rechtskonservative Unterwanderung"
Das Komitee für Regierungsreform im US-Repräsentantenhaus gehört nicht zu den ersten Kritikern von Bushs Umgang mit der Wissenschaft. In der Forschergemeinde regt sich schon länger Unmut über das Wirken Washingtons - nachzulesen in renommierten Magazinen wie "Science", "Nature" oder im "New England Journal of Medicine".
IN SPIEGEL ONLINE
· US-Universitäten: Forschung an vorderster Front (11.08.2003)
Das Medizin-Fachblatt "The Lancet" etwa prangerte die selektive Besetzung einflussreicher Wissenschafts-Gremien an und warnte vor deren "rechtskonservativen Unterwanderung". "Science" brachte die Praxis der Bush-Regierung mit chirurgischer Präzision auf den Punkt: Politik werde mittlerweile in Bereiche der Wissenschaft injiziert, die "früher einmal immun waren gegen diese Art der Manipulation".
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,260859,00.h…
Manipulieren, fälschen, unterdrücken
Die US-Regierung verbiegt die Wahrheit offenbar nicht nur, um Kriege zu rechtfertigen. Ein Parlamentsausschuss untersuchte jetzt, wie Präsident George W. Bush und die Seinen mit der Wissenschaft umgehen - und kam zu skandalträchtigen Ergebnissen.
REUTERS
Bush: Wissenschaftslügen im Dienst der Politik
Der Bericht der Parlamentarier liest sich wie ein Panoptikum von Manipulation, Unterdrückung missliebiger Forschungsergebnisse und offener Fälschung. "Die politische Einmischung der Regierung führte zu irreführenden Aussagen des Präsidenten, ungenauen Auskünften an den Kongress, veränderten Webseiten, unterdrückten Institutsberichten und dem Knebeln von Wissenschaftlern", heißt es in dem 40-seitigen Papier des Regierungsreform-Komitees des Repräsentantenhauses unter Leitung des Demokraten Henry Waxman. Die Manipulationen fänden in vielen Bereichen statt, hätten aber eines gemeinsam: "Die Nutznießer der Verzerrungen sind wichtige Helfer des Präsidenten, unter anderem Konservative und mächtige Industriegruppen."
Dass die Interventionen neben wirtschaftlichen auf ideologischen Interessen dienen, verdeutlichen etwa die bizarren Vorgänge rund um die Sexualmoral. In den Augen des US-Präsidenten und seiner Getreuen gibt es offenbar nur eine akzeptable Verhütungsmethode: keinen Sex zu haben. Um das auch wissenschaftlich zu untermauern, frisierte die Regierung dem Bericht zufolge Statistiken über die Ergebnisse ihrer "Abstinence Only"-Kampagne.
Informationen zur Verhütung unterdrückt
Jugendliche, die dennoch etwas über die Funktionsweise eines Kondoms erfahren wollten, wurden zumindest auf offiziellen Webseiten nicht fündig. Die Bush-Regierung tilgte die Informationen über das Anlegen von Parisern kurzerhand von der Webseite des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), immerhin eine Regierungsorganisation.
AP
Abstinenz-Kampagne: "Jungfrau ist kein schmutziges Wort"
Wer es dennoch nicht lassen kann und beim Sex auch noch unerwünscht schwanger wird, sollte nach dem Willen Washingtons eine Abtreibung besser nicht in Betracht ziehen. Angst wirkt da Wunder, müssen sich Bushs Helfer gedacht haben - und manipulierten die Internetseite einer weiteren Regierungsorganisation, diesmal des Nationalen Krebsinstituts. Dort war dann zu lesen, dass eine Abtreibung Brustkrebs auslösen kann - eine absurde Behauptung, die dem Konsens unter Forschern widerspricht und von der "New York Times" als "ungeheuerliche Verzerrung der Beweislage" gegeißelt wurde.
Auch der Internet-Auftritt des Bildungsministeriums blieb dem Parlamentsbericht zufolge nicht von Bushs Desinformations-Kampagne verschont. In einem Rundbrief wurden die Mitarbeiter des Ministeriums aufgefordert, von der Webseite umgehend alle Materialien zu entfernen, die "nicht mit der Philosophie der Regierung übereinstimmen". Nationale Bildungsorganisationen beschwerten sich ebenso unverzüglich wie erfolglos über Zensur.
Fantastische Vorhersagen zur Raketenabwehr
Im März 2003 behauptete Verteidigungs-Staatssekretär Edward Aldridge vor dem zuständigen Senatsausschuss, bis Ende 2004 stehe ein Raketenabwehr-System bereit, das mit neunzigprozentiger Treffsicherheit aus Korea anfliegende Raketen abschießen könne. Die optimistischsten unabhängigen Wissenschaftler sahen dagegen ein solches Abwehrsystem mindestens zehn Jahre in der Zukunft, viele halten es bis heute für technisch nicht machbar.
AP
Nationale Raketenabwehr: Wilde Übertreibungen der Regierung
Die amerikanische Ölwirtschaft, in der Bush-Regierung ohnehin bestens repräsentiert, sollte ebenfalls von der Wissenschafts-Fälschung profitieren. So erklärte Innenministerin Gale Norton den Senatoren und Repräsentanten, dass Ölbohrungen in der Arktis die dortigen Karibu-Bestände nicht gefährdeten - obwohl die Wissenschaftler in ihrer eigenen Behörde zuvor das Gegenteil festgestellt hatten.
Selektive Besetzung wissenschaftlicher Gremien
In der Landwirtschaft hält die Regierung Bush dem Bericht zufolge die Interessen der Industrie ebenfalls für wichtiger als den Umweltschutz. Das Landwirtschaftsministerium erließ demnach strenge Regeln, um öffentlich beschäftigte Forscher an der Veröffentlichung von Studien zu hindern, die der Industrie schaden könnten. In einem konkreten Fall wurde einem Mikrobiologen die Bekanntgabe von Forschungsergebnissen untersagt, die auf die Gefahren durch Antibiotika-resistente Baketrien im Mittelwesten der USA hinwiesen.
IM INTERNET
· Parlamentsbericht "Politik und Wissenschaft in der Regierung Bush"
SPIEGEL ONLINE ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Die Bush-Regierung bestückte dem Bericht zufolge wissenschaftliche Komitees mit politisch genehmen, wissenschaftlich aber eher ahnungslosen Leuten. In das Gremium zur Aids-Bekämpfung etwa wurde Jerry Thacker berufen - ein Marketingfachmann, der Homosexualität als "Spielart des Todes" und Aids als "Schwulenplage" bezeichnet hatte.
"Rechtskonservative Unterwanderung"
Das Komitee für Regierungsreform im US-Repräsentantenhaus gehört nicht zu den ersten Kritikern von Bushs Umgang mit der Wissenschaft. In der Forschergemeinde regt sich schon länger Unmut über das Wirken Washingtons - nachzulesen in renommierten Magazinen wie "Science", "Nature" oder im "New England Journal of Medicine".
IN SPIEGEL ONLINE
· US-Universitäten: Forschung an vorderster Front (11.08.2003)
Das Medizin-Fachblatt "The Lancet" etwa prangerte die selektive Besetzung einflussreicher Wissenschafts-Gremien an und warnte vor deren "rechtskonservativen Unterwanderung". "Science" brachte die Praxis der Bush-Regierung mit chirurgischer Präzision auf den Punkt: Politik werde mittlerweile in Bereiche der Wissenschaft injiziert, die "früher einmal immun waren gegen diese Art der Manipulation".
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,260859,00.h…
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,260923,00.html } über den totalen Versager!!! 


"Er hat uns alle reingelegt": Notenbankchef Greenspan
Zins-Zuckungen
"Greenspan hat seine Glaubwürdigkeit verspielt"
Von Matthias Streitz, New York
Die Zinsen in den USA sind zuletzt hin- und hergeschlingert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Schuld trägt auch Notenbanker Alan Greenspan: Er hat die Märkte mit einer Hü-Hott-Politik völlig verwirrt. Heute könnte sich zeigen, ob er aus dem Schlamassel herausfindet.
Washington/New York - Paul McCulley zögert nicht lange und schimpft gleich los. Die US-Notenbank Federal Reserve, klagt er dem Börsen-Kanal CNBC, biete kein sehr erbauliches Schauspiel mehr. Ihr Chef Alan Greenspan verhalte sich wie ein Geheimniskrämer. Wann erhöht er die Zinsen wieder? Wie definiert er "stabile Preise"? Greenspan lasse den Finanzmarkt über solch wichtige Fragen einfach im Dunklen. Dass der 77-jährige Fed-Chef rasch in Rente geht, ist wohl McCulleys heimlicher Wunsch. Seine jüngste Studie jedenfalls heißt "Gesucht: Notenbanker mit Weitblick".
Wenn einer wie Paul McCulley öffentlich zürnt, lauschen Zins-Interessierte überall in de USA. Immerhin ist der agile Mann mit dem breiten Schnauzer Geschäftsführer bei Pimco - und Pimco genießt unter Anleihe-Experten fast mythischen Status. Die Westküsten-Firma verwaltet den größten Investmentfonds des Landes, den Total Return Fund - und der investiert mitnichten in Aktien, sondern in Staatsanleihen aus aller Welt, Firmenschulden und anderes Festverzinsliches.
"Die Fed gibt ein gutes Ziel ab"
McCulley ist nur ein Neuzugang im Lager der Notenbank-Skeptiker, das zuletzt größer und größer wurde. Kurz vor der Sitzung der Fed-Oberen am Dienstag erreicht die Greenspan-Kritik eine einst unvorstellbare Lautstärke. "Glaubwürdigkeit der Fed in Frage gestellt" heißen die harmloseren Schlagzeilen der Finanzpresse. Andere kommen drastischer daher: "Das Ende der Maestro-Ökonomie" oder "Wie die Fed die Kontrolle verlor". "Die Fed gibt ein ziemlich gutes Ziel ab", räumt selbst Steven Richardson, Greenspan-Verteidiger und Research-Chef der Bond Market Association, am Telefon ein.
Der einst kultisch verehrte Notenbanker, glauben viele, trägt die Hauptschuld an der jüngsten Irrfahrt der Anleihekurse. Die ist zwar kein Thema, das normalen US-Bürgern gleich Angstschweiß auf die Stirn treibt. Vorsichtige Naturen aber schlagen Alarm. "Eine vorzeitige Steigerung der Zinsen ist das letzte, was wir jetzt brauchen", pointiert es der Volkswirt Melvyn Krauss von der Hoover Institution im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. "Unsere Wirtschaft wird deswegen langsamer wachsen."
"Beinahe-Panik auf den Märkten"
Ein Blick auf die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen (Treasuries) zeigt, weshalb Krauss sich sorgt: Normalerweise sieht der Ertragschart wie ein friedliches Mittelgebirge aus: Kleinere Täler, keine besonders hohen Gipfel. In Frühjahr aber war Schluss mit der Beschaulichkeit - seither ähnelt die Kurve einer Rocky-Mountains-Silhouette.
Von Mai bis Mitte Juni ging es im steilen Winkel abwärts - von knapp über vier Prozent rutschte die Rendite auf 3,07 ab. Dann eine scharfe Wende - in wenigen Wochen schnellt der Ertrag auf 4,6 Prozent hoch, der größte Sprung seit zwei Jahrzehnten. Weil Anleihekurse fallen, wenn Renditen steigen, verloren Rentenfonds wie die von Pimco teils kräftig an Wert. Auch der nüchterne "Economist" diagnostizierte "Beinahe-Panik auf den Bond-Märkten".
Wer den Schauplatz des "Verbrechens" unter die Lupe nimmt, findet überall Greenspans Fingerabdrücke. Kurz vor dem Zinsrutsch im Mai warnte der Fed-Chef mehrfach vor der Gefahr der Deflation, unter anderem bei einer Rede in Berlin. Fed-Mitglieder begannen auf einmal, von "unkonventionellen" Methoden der Geldpolitik zu philosophieren. Wenn selbst Zinssenkungen nicht mehr reichten, könnte man ja lang laufende Treasuries zurückkaufen und so Liquidität in den Markt pumpen. Die Renditen rutschten vorauseilend in die Tiefe.
Schock Nummer eins ereilte die Bond-Händler am 25. Juni: Die Fed senkte die Zinsen - aber nicht um 0,5 Punkte, wie viele nun hofften, sondern um 0,25. War die Deflationsgefahr denn schon gebannt? Auch von "unkonventionellen" Mitteln war plötzlich keine Rede mehr. Schock Nummer zwei traf noch härter: Im US-Parlament spricht Greenspan Mitte Juli wieder von Aufschwung statt fallenden Preisen. Die Anleiheblase platzt, der "lange, seltsame Trip" (McCulley) der Treasury-Preise geht in die zweite Etappe.
"Überreaktionen, Missverständnisse"
Alan-Allierte und Greenspan-Gegner streiten nun, ob der Fed-Chef absichtlich Irreführendes sagte - oder ob Händler das Orakel bloß falsch interpretierten. "Greenspan hat uns alle reingelegt und seine Glaubwürdigkeit verspielt", wettert Hoover-Volkswirt Krauss. Der Fed-Chef habe den Deflationsgeist bloß beschworen um die Märkte zu manipulieren: "Ich bin entgeistert." Gemäßigter zeigt sich Gerald Cohen, Volkswirt bei Merrill Lynch: "Die Märkte selbst sind zu weit nach vorne geprescht", sagt er am Telefon. "Das waren Überreaktionen auf vielleicht etwas missverständliche Mitteilungen - eine Mischung aus beidem."
Zuletzt genoss Greenspan eine kleine Atempause. Die Renditen sind wieder ein wenig gebröckelt, am Montag warfen zehnjährige Treasuries 4,4 Prozent ab. Im historischen Vergleich ist das sowieso fast lächerlich niedrig. Trotzdem stehen die Zinsgewaltigen unter Druck, wenn sie am Dienstag debattieren. Dass sie die Leitzinsen ändern, erwartet zwar keiner. Aber wie Merrill-Mann Cohen werden alle das Statement, das die Fed hinterher abgibt, drei oder viermal lesen. Taucht das Wort "Aufschwung" zu oft auf, könnten die Renditen wieder auf Gipfelfahrt gehen.
"Der Stoff, aus dem Depressionen sind"
Das nährt die Angst vor dem Zinsschock - und die trifft viele Branchen, Arm und Reich. Wer mit dem guten Namen zahlte, statt in bar, sieht vielleicht bald alt aus, Investmentbankern droht das einträgliche Geschäft mit Bond-Emissionen wegzusacken -und die Regierung in Washington zahlt mehr für ihre neuen Schulden. Am lautesten rumort es in der Immobilienbranche. Bis in den Juni hatten viele US-Bürger ihre Hypotheken refinanziert, weil die Zinsen fielen - so blieb pro Monat mehr für den Konsum. Nun steht der Refi-Boom vor dem Ende, eine Säule der Konjunktur bricht weg.
Am Schwärzesten malt John Talbott, Autor des Buches: "Der kommende Kollaps des Häusermarktes". Schlimmstenfalls, schreibt er, fallen die aufgeblasenen Immobilienpreise nach der Zinswende um 30 Prozent. Mancher Häuslekäufer werde mehr Schulden haben, als sein Haus dann wert sei - eine üble Lage für alle, die Umziehen müssen oder krank werden. "Das ist wie 1929", tönte der Unheilsprophet laut CNN Money: "Der Stoff, aus dem Depressionen sind".
"Hoffen, dass es der Wirtschaft schlecht geht"
"Nonsens", schimpft da Alan Reynolds, leitender Wissenschaftler am konservativen Cato Institute und 1981 Greenspans Kollege: "Wenn die langfristigen Zinsen steigen, ist das ist ein gutes Zeichen, kein schlechtes". Auch der Immobilienmarkt werde wachsen, weil im Aufschwung Jobs entstehen und Einkommen steigen, sagt Reynolds SPIEGEL ONLINE. Die Zinsangst werde nur von interessierten Parteien geschürt: Von Politikern und Medien, die "nach negativen Geschichten suchen und hoffen, dass es der Wirtschaft schlecht geht". Immerhin wird 2004 gewählt - da wolle mancher Bush schaden.
So wird Greenspan, der Unantastbare, in den Wahlkampf hineingezogen. Auch deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste Salven der Kritik auf ihn abschießt. Den Demokraten jedenfalls stinkt, dass der Fed-Chef in der Clinton-Ära ständig und überall vor Staatsdefiziten warnte. Seit der Präsident Bush heißt, gebe sich der Defizit-Falke aber ganz zahm - trotz Neuverschuldung auf Rekordniveau. "Der Maestro ist nur ein Lohnarbeiter", klagte ein enttäuschter "Slate"-Kolumnist über den Mann, der sein Amt Ronald Reagan verdankt.
Auch im Kongress, in dem Greenspan zweimal pro Jahr Satzungetüme zur Konjunktur vorbetet, war der Ton zuletzt so rau wie nie. Als der Notenbanker im Juli zukunftsfroh vom Aufschwung sprach, wetterte ein demokratischer Hinterbänkler, Greenspan habe den "Kontakt zur Wirklichkeit" verloren. Statt mit reichen Republikaner-Kumpels Golfen zu gehen, solle er mal in Queens vorbeischauen - und ihn da suchen, den Aufschwung. "Greenspan ist ein feiner Kerl, ich mag ihn persönlich sehr gern", sagt sein Kritiker Krauss angesichts solcher Szenen. "Aber die Prügel, die er einsteckt, hat er verdient."



"Er hat uns alle reingelegt": Notenbankchef Greenspan
Zins-Zuckungen
"Greenspan hat seine Glaubwürdigkeit verspielt"
Von Matthias Streitz, New York
Die Zinsen in den USA sind zuletzt hin- und hergeschlingert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Schuld trägt auch Notenbanker Alan Greenspan: Er hat die Märkte mit einer Hü-Hott-Politik völlig verwirrt. Heute könnte sich zeigen, ob er aus dem Schlamassel herausfindet.
Washington/New York - Paul McCulley zögert nicht lange und schimpft gleich los. Die US-Notenbank Federal Reserve, klagt er dem Börsen-Kanal CNBC, biete kein sehr erbauliches Schauspiel mehr. Ihr Chef Alan Greenspan verhalte sich wie ein Geheimniskrämer. Wann erhöht er die Zinsen wieder? Wie definiert er "stabile Preise"? Greenspan lasse den Finanzmarkt über solch wichtige Fragen einfach im Dunklen. Dass der 77-jährige Fed-Chef rasch in Rente geht, ist wohl McCulleys heimlicher Wunsch. Seine jüngste Studie jedenfalls heißt "Gesucht: Notenbanker mit Weitblick".
Wenn einer wie Paul McCulley öffentlich zürnt, lauschen Zins-Interessierte überall in de USA. Immerhin ist der agile Mann mit dem breiten Schnauzer Geschäftsführer bei Pimco - und Pimco genießt unter Anleihe-Experten fast mythischen Status. Die Westküsten-Firma verwaltet den größten Investmentfonds des Landes, den Total Return Fund - und der investiert mitnichten in Aktien, sondern in Staatsanleihen aus aller Welt, Firmenschulden und anderes Festverzinsliches.
"Die Fed gibt ein gutes Ziel ab"
McCulley ist nur ein Neuzugang im Lager der Notenbank-Skeptiker, das zuletzt größer und größer wurde. Kurz vor der Sitzung der Fed-Oberen am Dienstag erreicht die Greenspan-Kritik eine einst unvorstellbare Lautstärke. "Glaubwürdigkeit der Fed in Frage gestellt" heißen die harmloseren Schlagzeilen der Finanzpresse. Andere kommen drastischer daher: "Das Ende der Maestro-Ökonomie" oder "Wie die Fed die Kontrolle verlor". "Die Fed gibt ein ziemlich gutes Ziel ab", räumt selbst Steven Richardson, Greenspan-Verteidiger und Research-Chef der Bond Market Association, am Telefon ein.
Der einst kultisch verehrte Notenbanker, glauben viele, trägt die Hauptschuld an der jüngsten Irrfahrt der Anleihekurse. Die ist zwar kein Thema, das normalen US-Bürgern gleich Angstschweiß auf die Stirn treibt. Vorsichtige Naturen aber schlagen Alarm. "Eine vorzeitige Steigerung der Zinsen ist das letzte, was wir jetzt brauchen", pointiert es der Volkswirt Melvyn Krauss von der Hoover Institution im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. "Unsere Wirtschaft wird deswegen langsamer wachsen."
"Beinahe-Panik auf den Märkten"
Ein Blick auf die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen (Treasuries) zeigt, weshalb Krauss sich sorgt: Normalerweise sieht der Ertragschart wie ein friedliches Mittelgebirge aus: Kleinere Täler, keine besonders hohen Gipfel. In Frühjahr aber war Schluss mit der Beschaulichkeit - seither ähnelt die Kurve einer Rocky-Mountains-Silhouette.
Von Mai bis Mitte Juni ging es im steilen Winkel abwärts - von knapp über vier Prozent rutschte die Rendite auf 3,07 ab. Dann eine scharfe Wende - in wenigen Wochen schnellt der Ertrag auf 4,6 Prozent hoch, der größte Sprung seit zwei Jahrzehnten. Weil Anleihekurse fallen, wenn Renditen steigen, verloren Rentenfonds wie die von Pimco teils kräftig an Wert. Auch der nüchterne "Economist" diagnostizierte "Beinahe-Panik auf den Bond-Märkten".
Wer den Schauplatz des "Verbrechens" unter die Lupe nimmt, findet überall Greenspans Fingerabdrücke. Kurz vor dem Zinsrutsch im Mai warnte der Fed-Chef mehrfach vor der Gefahr der Deflation, unter anderem bei einer Rede in Berlin. Fed-Mitglieder begannen auf einmal, von "unkonventionellen" Methoden der Geldpolitik zu philosophieren. Wenn selbst Zinssenkungen nicht mehr reichten, könnte man ja lang laufende Treasuries zurückkaufen und so Liquidität in den Markt pumpen. Die Renditen rutschten vorauseilend in die Tiefe.
Schock Nummer eins ereilte die Bond-Händler am 25. Juni: Die Fed senkte die Zinsen - aber nicht um 0,5 Punkte, wie viele nun hofften, sondern um 0,25. War die Deflationsgefahr denn schon gebannt? Auch von "unkonventionellen" Mitteln war plötzlich keine Rede mehr. Schock Nummer zwei traf noch härter: Im US-Parlament spricht Greenspan Mitte Juli wieder von Aufschwung statt fallenden Preisen. Die Anleiheblase platzt, der "lange, seltsame Trip" (McCulley) der Treasury-Preise geht in die zweite Etappe.
"Überreaktionen, Missverständnisse"
Alan-Allierte und Greenspan-Gegner streiten nun, ob der Fed-Chef absichtlich Irreführendes sagte - oder ob Händler das Orakel bloß falsch interpretierten. "Greenspan hat uns alle reingelegt und seine Glaubwürdigkeit verspielt", wettert Hoover-Volkswirt Krauss. Der Fed-Chef habe den Deflationsgeist bloß beschworen um die Märkte zu manipulieren: "Ich bin entgeistert." Gemäßigter zeigt sich Gerald Cohen, Volkswirt bei Merrill Lynch: "Die Märkte selbst sind zu weit nach vorne geprescht", sagt er am Telefon. "Das waren Überreaktionen auf vielleicht etwas missverständliche Mitteilungen - eine Mischung aus beidem."
Zuletzt genoss Greenspan eine kleine Atempause. Die Renditen sind wieder ein wenig gebröckelt, am Montag warfen zehnjährige Treasuries 4,4 Prozent ab. Im historischen Vergleich ist das sowieso fast lächerlich niedrig. Trotzdem stehen die Zinsgewaltigen unter Druck, wenn sie am Dienstag debattieren. Dass sie die Leitzinsen ändern, erwartet zwar keiner. Aber wie Merrill-Mann Cohen werden alle das Statement, das die Fed hinterher abgibt, drei oder viermal lesen. Taucht das Wort "Aufschwung" zu oft auf, könnten die Renditen wieder auf Gipfelfahrt gehen.
"Der Stoff, aus dem Depressionen sind"
Das nährt die Angst vor dem Zinsschock - und die trifft viele Branchen, Arm und Reich. Wer mit dem guten Namen zahlte, statt in bar, sieht vielleicht bald alt aus, Investmentbankern droht das einträgliche Geschäft mit Bond-Emissionen wegzusacken -und die Regierung in Washington zahlt mehr für ihre neuen Schulden. Am lautesten rumort es in der Immobilienbranche. Bis in den Juni hatten viele US-Bürger ihre Hypotheken refinanziert, weil die Zinsen fielen - so blieb pro Monat mehr für den Konsum. Nun steht der Refi-Boom vor dem Ende, eine Säule der Konjunktur bricht weg.
Am Schwärzesten malt John Talbott, Autor des Buches: "Der kommende Kollaps des Häusermarktes". Schlimmstenfalls, schreibt er, fallen die aufgeblasenen Immobilienpreise nach der Zinswende um 30 Prozent. Mancher Häuslekäufer werde mehr Schulden haben, als sein Haus dann wert sei - eine üble Lage für alle, die Umziehen müssen oder krank werden. "Das ist wie 1929", tönte der Unheilsprophet laut CNN Money: "Der Stoff, aus dem Depressionen sind".
"Hoffen, dass es der Wirtschaft schlecht geht"
"Nonsens", schimpft da Alan Reynolds, leitender Wissenschaftler am konservativen Cato Institute und 1981 Greenspans Kollege: "Wenn die langfristigen Zinsen steigen, ist das ist ein gutes Zeichen, kein schlechtes". Auch der Immobilienmarkt werde wachsen, weil im Aufschwung Jobs entstehen und Einkommen steigen, sagt Reynolds SPIEGEL ONLINE. Die Zinsangst werde nur von interessierten Parteien geschürt: Von Politikern und Medien, die "nach negativen Geschichten suchen und hoffen, dass es der Wirtschaft schlecht geht". Immerhin wird 2004 gewählt - da wolle mancher Bush schaden.
So wird Greenspan, der Unantastbare, in den Wahlkampf hineingezogen. Auch deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste Salven der Kritik auf ihn abschießt. Den Demokraten jedenfalls stinkt, dass der Fed-Chef in der Clinton-Ära ständig und überall vor Staatsdefiziten warnte. Seit der Präsident Bush heißt, gebe sich der Defizit-Falke aber ganz zahm - trotz Neuverschuldung auf Rekordniveau. "Der Maestro ist nur ein Lohnarbeiter", klagte ein enttäuschter "Slate"-Kolumnist über den Mann, der sein Amt Ronald Reagan verdankt.
Auch im Kongress, in dem Greenspan zweimal pro Jahr Satzungetüme zur Konjunktur vorbetet, war der Ton zuletzt so rau wie nie. Als der Notenbanker im Juli zukunftsfroh vom Aufschwung sprach, wetterte ein demokratischer Hinterbänkler, Greenspan habe den "Kontakt zur Wirklichkeit" verloren. Statt mit reichen Republikaner-Kumpels Golfen zu gehen, solle er mal in Queens vorbeischauen - und ihn da suchen, den Aufschwung. "Greenspan ist ein feiner Kerl, ich mag ihn persönlich sehr gern", sagt sein Kritiker Krauss angesichts solcher Szenen. "Aber die Prügel, die er einsteckt, hat er verdient."
Wer jetzt noch zu Greenspan steht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Jedem seine Meinung, aber jetzt wisst Ihr, warum ich den Tuppes nicht mag! Eine unverantwortlich Harakiri-Politik, die die Welt noch nie sah, redet von Deflation, verursacht mit seiner expansiven Geldmengenpolitik Inflation. Löst keine Probleme, sondern verschiebt, verschweigt, verdrängt sie, und schafft gar völlig neue Probleme.
Dieser Mensch ist eine völlige Katastrophe und zum Vorzeige-Clown von Bush junior geworden! Traurig und besorgniserregend!
Greenspan, Du wirst uns noch alle ins Unglück stürzen!
Dieser Mensch ist eine völlige Katastrophe und zum Vorzeige-Clown von Bush junior geworden! Traurig und besorgniserregend!

Greenspan, Du wirst uns noch alle ins Unglück stürzen!

Und nichts als die Wahrheit
Ein Gutachten klagt an: Die amerikanische Regierung manipuliert, infiltriert und verfälscht die Wissenschaften
Und sie bewegt sich doch! Henry A. Waxman hat etwas von Galilei. Auch er steht politisch auf verlorenem Posten, aber wie das historische Vorbild beruft er sich auf einen mächtigen Verbündeten: die wissenschaftliche Wahrheit. Wahrheit und Macht können auf eine lange und nur selten glückliche Beziehung zurückblicken – aber sie geben ihre Partnerschaft nicht auf. Waxman, der für einen Wahlkreis in Kalifornien in die demokratische Minderheitsfraktion des amerikanischen Repräsentantenhauses gewählt wurde, gibt jedenfalls nicht auf.
Waxman hat sich im Kampf gegen unwahre Werbung der Tabakindustrie einen Namen gemacht. Er war es, der nach den Beweisen für die angebliche Massenvernichtungswaffen des Iraks verlangte und die Lüge mit der angeblichen Uranlieferung nach Bagdad aufgedeckt hat. Das sind eindrucksvolle Erfolge.
Bei der „Special Investigation Division“ des Repräsentantenhauses hat Waxman ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die „Behandlung der Wissenschaft und der Wissenschaftler durch die Bush-Regierung untersuchen“ sollte. Die Beschwerden namhafter Vertreter der Wissenschaften über eine schädliche Einflussnahme der Regierung hatten sich in letzter Zeit gehäuft, beispielsweise von Albert H. Teich, dem Direktor der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (SZ vom 5. Mai 2003). Das Gutachten wurde jetzt auf der Internetseite des Repräsentantenhauses veröffentlicht (www.house.gov/reform/min/politicsandscience/).
Das Ergebnis ist unmissverständlich: Die Regierung der Vereinigten Staaten soll demnach in einem historisch einmaligen Ausmaß wissenschaftliche Erkenntnisse unterdrückt, zurechtgebogen oder verfälscht haben, um die ideologischen Vorgaben oder wirtschaftlichen Interessen ihrer Klientel zu schützen.
Drei Methoden seien hierbei zur Anwendung gekommen. Erstens seien Beratungskomitees, die ausschließlich den wissenschaftlichen Fakten verpflichtet sein sollten, mit unqualifizierten Interessenvertretern besetzt worden. Zweitens habe die Bush-Regierung in offiziellen Informationen an den Kongress und an die Bevölkerung wissenschaftliche Tatsachen unterdrückt, verändert oder mit falschen Behauptungen verwässert, um die eigene Meinung zu begründen. Und drittens habe sich die Regierung auch einer direkten Einflussnahme in die Forschung schuldig gemacht, indem sie die Gelder der staatlichen Forschungsförderung nach ideologischen Kriterien verteilt und Druck ausgeübt habe, wissenschaftliche Ergebnisse nur im Sinne der Regierung zu produzieren. Kurz: Auf der einen Seite steht die wissenschaftliche Wahrheit. Auf der anderen stehen offenbar die Interessen der Regierung. Wer, zumindest kurzfristig, der Stärkere ist, wissen wir – siehe Galilei.
Verwunderlich ist nur, wie sich die Verhältnisse mittelfristig geändert haben. Wir erinnern uns, Mitte der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts: Eine Schar von rebellischen Wissenschaftlern und Philosophen, vornehmlich aus dem linken Spektrum, trat an, die Autorität und den Machtmissbrauch der Wissenschaft infrage zu stellen. Gibt es denn überhaupt objektive Wahrheit? Ist nicht jede Erkenntnis auch von Interessen bedingt, das Wissen ein Abbild der Herrschaftsverhältnisse? „Wider den Methodenzwang!“ war der Schlachtruf von Paul Feyerabend, der viele Anhänger hatte: Gegen die Vormacht der wissenschaftlichen Experten propagierte er eine Demokratisierung des Wissens. Alles geht! Niemand besitze einen privilegierten Zugang zur Wahrheit. Neben den Experimentalwissenschaftlern mit ihren Doppelblindversuchen sollte auch das gemeine Volk seinen Anteil an der Wahrheit bekommen – auch Außenseiter, die Anhänger der Astrologie, Parapsychologie oder Esoterik.
Das öffentliche Vertrauen in wissenschaftliche Autorität hatte in den vergangenen dreißig Jahren schweren Schaden genommen. Wer allzu vorlaut mit der Autorität der Wissenschaften argumentiert, kann sich bis heute des Spotts der moralischen Mehrheit sicher sein. Wissenschaftler? Sind das die Leute, die uns vor kurzem noch gesagt haben, Rauchen helfe gegen Akne, Atomkraft sei sicher und Asbestbeton rette Menschenleben? Und wo sind die Tabletten gegen Schnupfen und Krebs, die uns seit gut hundert Jahren für die allernächste Zukunft versprochen wurden?
Jetzt aber wendet sich das Blatt. Die Einsicht schleicht sich ein, mit Churchill gesprochen, dass eventuell das falsche Schwein geschlachtet wurde. Der soziale Konstruktivismus mag sich fürsorglich und liebevoll den Interessen der unterdrückten Minderheiten angenommen haben, aber wenn es hart auf hart kommt, ist eine arrogante Wissenschaft mit ihren autoritären Urteilen über das empirische „wahr“ oder „falsch“ ein mächtiger Verbündeter. Wie im Gutachten für den Abgeordneten Waxman, das zwischen den Zeilen ein romantisches Bild von der Wissenschaft wie aus der guten alten Zeit malt – als die Wahrheit noch wahr und ein Interesse bloß ein Interesse war.
21 Belege listet das Gutachten für die Behauptung auf, wonach die Bush-Regierung wissenschaftliche Tatsachen verbiege. Die Themen decken das gesamte Spektrum eines links-ökologischen Parteiprogramms ab:
Einem Forscher, James Zahn, der den Einfluss der Schweinemast auf die Antibiotika-Resistenz von Krankheitskeimen untersucht hatte, sei durch politischen Druck auf die Herausgeber die Veröffentlichung seiner Ergebnisse verwehrt worden. In einem Komitee, das zulässige Grenzwerte für die Bleibelastung der Umwelt festsetzen sollte, habe man anerkannte wissenschaftliche Experten durch Industrievertreter ausgetauscht. Aufgrund ihrer ideologischen Voreingenommenheit habe die Bush-Administration die Lehrer angewiesen, im Unterricht ausschließlich die sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe als probates Mittel gegen Sexualkrankheiten und ungewollte Schwangerschaften zu behandeln – als habe man noch nie etwas von Kondomen gehört.
Wissenschaft ist eben eine äußerst vielseitige Waffe. Das Waxman-Gutachten hätte man allerdings in den meisten Fällen auch durch die Frage „cui bono?“ ersetzen können. Ob Waxman mit der Strategie Erfolg haben wird, die Politik der Bush-Regierung mit Hilfe der wissenschaftlichen Wahrheit anzugreifen, das bleibt abzuwarten.
ULRICH KÜHNE
http://www.sueddeutsche.de/sz/feuilleton/red-artikel1118
Und nichts als die Wahrheit II
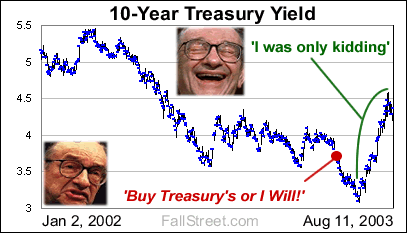
...............


syr
Ein Gutachten klagt an: Die amerikanische Regierung manipuliert, infiltriert und verfälscht die Wissenschaften
Und sie bewegt sich doch! Henry A. Waxman hat etwas von Galilei. Auch er steht politisch auf verlorenem Posten, aber wie das historische Vorbild beruft er sich auf einen mächtigen Verbündeten: die wissenschaftliche Wahrheit. Wahrheit und Macht können auf eine lange und nur selten glückliche Beziehung zurückblicken – aber sie geben ihre Partnerschaft nicht auf. Waxman, der für einen Wahlkreis in Kalifornien in die demokratische Minderheitsfraktion des amerikanischen Repräsentantenhauses gewählt wurde, gibt jedenfalls nicht auf.
Waxman hat sich im Kampf gegen unwahre Werbung der Tabakindustrie einen Namen gemacht. Er war es, der nach den Beweisen für die angebliche Massenvernichtungswaffen des Iraks verlangte und die Lüge mit der angeblichen Uranlieferung nach Bagdad aufgedeckt hat. Das sind eindrucksvolle Erfolge.
Bei der „Special Investigation Division“ des Repräsentantenhauses hat Waxman ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die „Behandlung der Wissenschaft und der Wissenschaftler durch die Bush-Regierung untersuchen“ sollte. Die Beschwerden namhafter Vertreter der Wissenschaften über eine schädliche Einflussnahme der Regierung hatten sich in letzter Zeit gehäuft, beispielsweise von Albert H. Teich, dem Direktor der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (SZ vom 5. Mai 2003). Das Gutachten wurde jetzt auf der Internetseite des Repräsentantenhauses veröffentlicht (www.house.gov/reform/min/politicsandscience/).
Das Ergebnis ist unmissverständlich: Die Regierung der Vereinigten Staaten soll demnach in einem historisch einmaligen Ausmaß wissenschaftliche Erkenntnisse unterdrückt, zurechtgebogen oder verfälscht haben, um die ideologischen Vorgaben oder wirtschaftlichen Interessen ihrer Klientel zu schützen.
Drei Methoden seien hierbei zur Anwendung gekommen. Erstens seien Beratungskomitees, die ausschließlich den wissenschaftlichen Fakten verpflichtet sein sollten, mit unqualifizierten Interessenvertretern besetzt worden. Zweitens habe die Bush-Regierung in offiziellen Informationen an den Kongress und an die Bevölkerung wissenschaftliche Tatsachen unterdrückt, verändert oder mit falschen Behauptungen verwässert, um die eigene Meinung zu begründen. Und drittens habe sich die Regierung auch einer direkten Einflussnahme in die Forschung schuldig gemacht, indem sie die Gelder der staatlichen Forschungsförderung nach ideologischen Kriterien verteilt und Druck ausgeübt habe, wissenschaftliche Ergebnisse nur im Sinne der Regierung zu produzieren. Kurz: Auf der einen Seite steht die wissenschaftliche Wahrheit. Auf der anderen stehen offenbar die Interessen der Regierung. Wer, zumindest kurzfristig, der Stärkere ist, wissen wir – siehe Galilei.
Verwunderlich ist nur, wie sich die Verhältnisse mittelfristig geändert haben. Wir erinnern uns, Mitte der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts: Eine Schar von rebellischen Wissenschaftlern und Philosophen, vornehmlich aus dem linken Spektrum, trat an, die Autorität und den Machtmissbrauch der Wissenschaft infrage zu stellen. Gibt es denn überhaupt objektive Wahrheit? Ist nicht jede Erkenntnis auch von Interessen bedingt, das Wissen ein Abbild der Herrschaftsverhältnisse? „Wider den Methodenzwang!“ war der Schlachtruf von Paul Feyerabend, der viele Anhänger hatte: Gegen die Vormacht der wissenschaftlichen Experten propagierte er eine Demokratisierung des Wissens. Alles geht! Niemand besitze einen privilegierten Zugang zur Wahrheit. Neben den Experimentalwissenschaftlern mit ihren Doppelblindversuchen sollte auch das gemeine Volk seinen Anteil an der Wahrheit bekommen – auch Außenseiter, die Anhänger der Astrologie, Parapsychologie oder Esoterik.
Das öffentliche Vertrauen in wissenschaftliche Autorität hatte in den vergangenen dreißig Jahren schweren Schaden genommen. Wer allzu vorlaut mit der Autorität der Wissenschaften argumentiert, kann sich bis heute des Spotts der moralischen Mehrheit sicher sein. Wissenschaftler? Sind das die Leute, die uns vor kurzem noch gesagt haben, Rauchen helfe gegen Akne, Atomkraft sei sicher und Asbestbeton rette Menschenleben? Und wo sind die Tabletten gegen Schnupfen und Krebs, die uns seit gut hundert Jahren für die allernächste Zukunft versprochen wurden?
Jetzt aber wendet sich das Blatt. Die Einsicht schleicht sich ein, mit Churchill gesprochen, dass eventuell das falsche Schwein geschlachtet wurde. Der soziale Konstruktivismus mag sich fürsorglich und liebevoll den Interessen der unterdrückten Minderheiten angenommen haben, aber wenn es hart auf hart kommt, ist eine arrogante Wissenschaft mit ihren autoritären Urteilen über das empirische „wahr“ oder „falsch“ ein mächtiger Verbündeter. Wie im Gutachten für den Abgeordneten Waxman, das zwischen den Zeilen ein romantisches Bild von der Wissenschaft wie aus der guten alten Zeit malt – als die Wahrheit noch wahr und ein Interesse bloß ein Interesse war.
21 Belege listet das Gutachten für die Behauptung auf, wonach die Bush-Regierung wissenschaftliche Tatsachen verbiege. Die Themen decken das gesamte Spektrum eines links-ökologischen Parteiprogramms ab:
Einem Forscher, James Zahn, der den Einfluss der Schweinemast auf die Antibiotika-Resistenz von Krankheitskeimen untersucht hatte, sei durch politischen Druck auf die Herausgeber die Veröffentlichung seiner Ergebnisse verwehrt worden. In einem Komitee, das zulässige Grenzwerte für die Bleibelastung der Umwelt festsetzen sollte, habe man anerkannte wissenschaftliche Experten durch Industrievertreter ausgetauscht. Aufgrund ihrer ideologischen Voreingenommenheit habe die Bush-Administration die Lehrer angewiesen, im Unterricht ausschließlich die sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe als probates Mittel gegen Sexualkrankheiten und ungewollte Schwangerschaften zu behandeln – als habe man noch nie etwas von Kondomen gehört.
Wissenschaft ist eben eine äußerst vielseitige Waffe. Das Waxman-Gutachten hätte man allerdings in den meisten Fällen auch durch die Frage „cui bono?“ ersetzen können. Ob Waxman mit der Strategie Erfolg haben wird, die Politik der Bush-Regierung mit Hilfe der wissenschaftlichen Wahrheit anzugreifen, das bleibt abzuwarten.
ULRICH KÜHNE
http://www.sueddeutsche.de/sz/feuilleton/red-artikel1118
Und nichts als die Wahrheit II
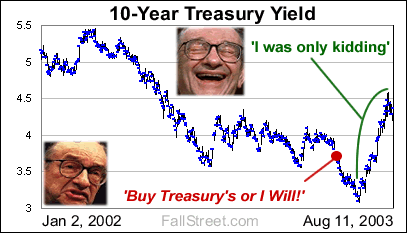
...............



syr

Diese Subblase ist der der Megawahnsinn und sie knallt langsam
---------------
13.08. 13:43
US: Hypothekenkreditnachfrage fällt weiter
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie die Mortgage Bankers Association berichtet, fiel die Nachfrage nach Hypothekenkrediten in der Woche zum 8. August um 16.1%. Der Market Composite Index, der die Anzahl der Anträge auf Hypothekenkredite anzeigt, lag saisonal bereinigt bei 824.6 nach 983.2 Punkten in der Vorwoche. Der Refinanzierungsindex fiel um 20% auf 3238.4 von 4047.5. Als Grund für die anhaltende Schwäche sehen die Experten die deutlich gestiegenen Zinssätze.
---------------
13.08. 13:43
US: Hypothekenkreditnachfrage fällt weiter
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)
Wie die Mortgage Bankers Association berichtet, fiel die Nachfrage nach Hypothekenkrediten in der Woche zum 8. August um 16.1%. Der Market Composite Index, der die Anzahl der Anträge auf Hypothekenkredite anzeigt, lag saisonal bereinigt bei 824.6 nach 983.2 Punkten in der Vorwoche. Der Refinanzierungsindex fiel um 20% auf 3238.4 von 4047.5. Als Grund für die anhaltende Schwäche sehen die Experten die deutlich gestiegenen Zinssätze.
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie eine neue Diskussion.
Meistdiskutiert
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 72 | ||
| 60 | ||
| 52 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 29 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 12 |
| Wertpapier | Beiträge | |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 |





























